Kriminalliteratur: Geburt und Geschichte eines Genres
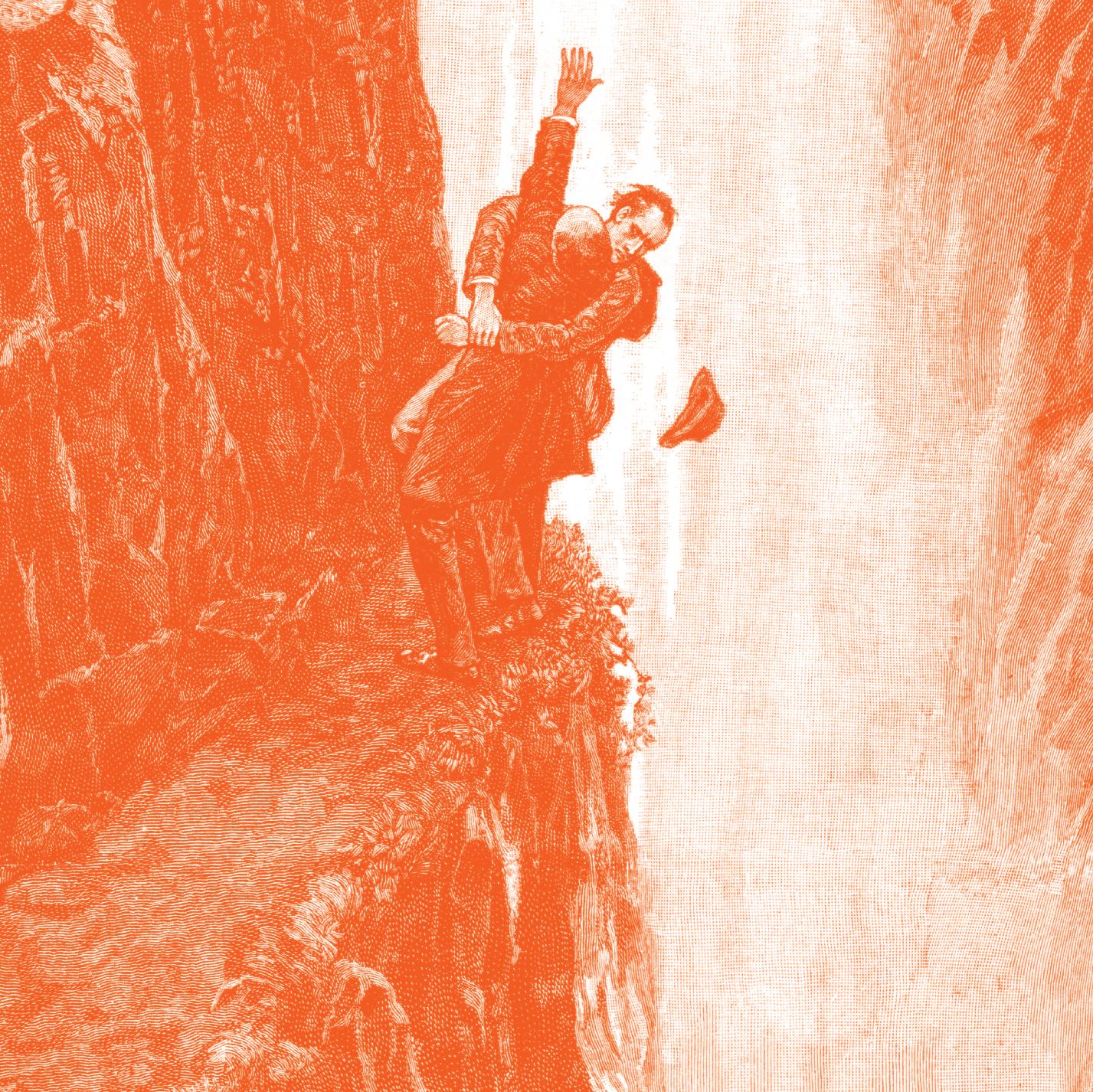
Band 2
Vom Golden Age bis True Crime
Manuel Bauer
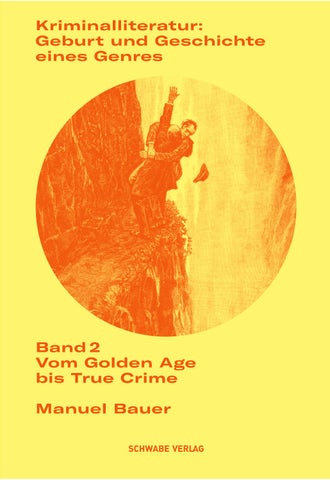
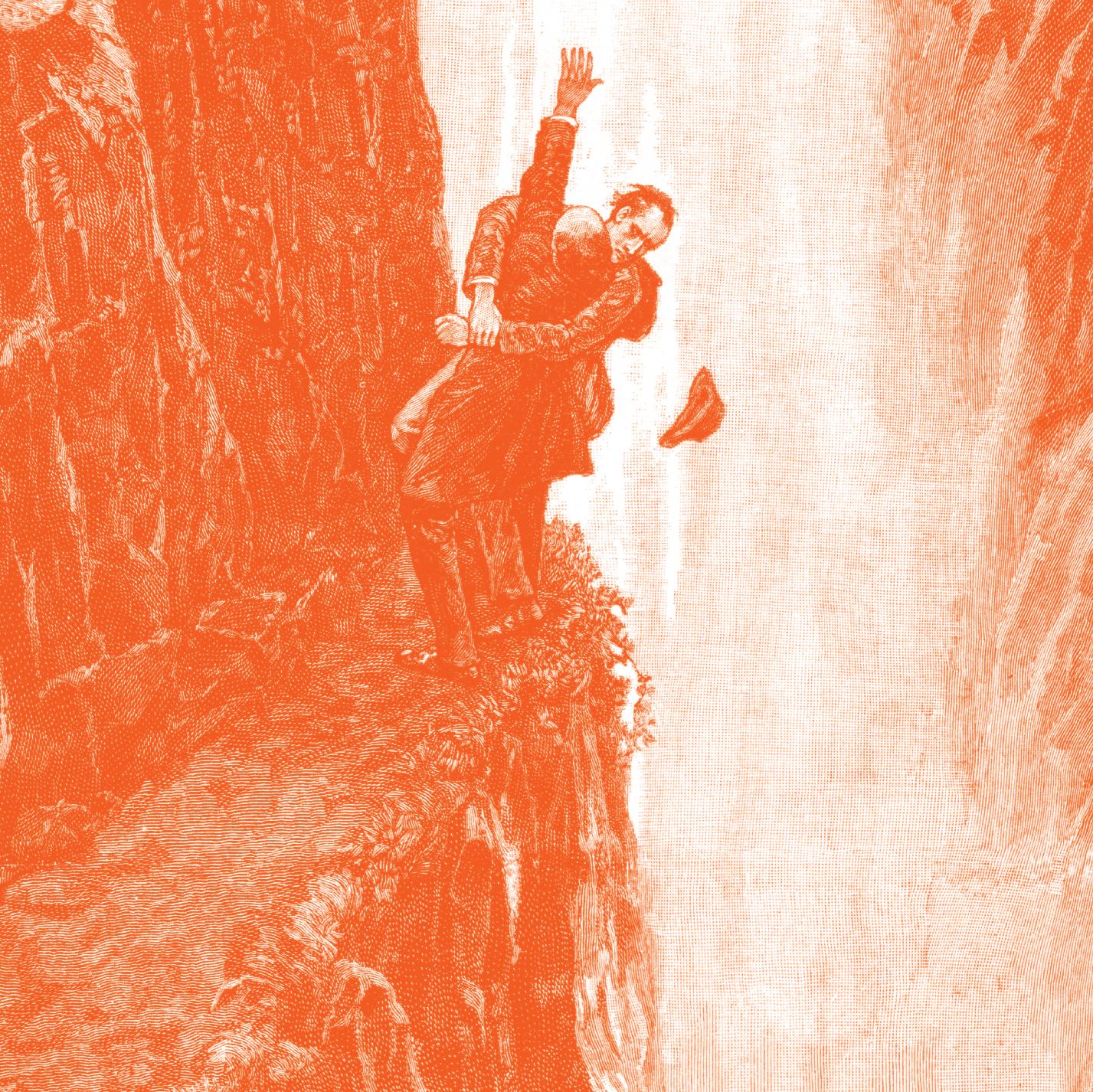
Band 2
Vom Golden Age bis True Crime
Manuel Bauer
Schwabe Verlag
BibliografischeInformation der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothekverzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Schwabe Verlag Berlin GmbH
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teiledarf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach §44b UrhG vor. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Abbildung Umschlag:Sidney Paget, The death of Sherlock Holmes, 1893
Korrektorat:Julia Müller, Leipzig
Cover:Jörg Schwertfeger, Zürich
Layout:icona basel gmbh, Basel
Satz:3w+p, Rimpar
Druck:Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Printed in Germany
Herstellerinformation:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7574-0122-1
ISBN eBook (PDF)978-3-7574-0165-8
DOI 10.31267/978-3-7574-0165-8
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabeverlag.de www.schwabeverlag.de
«Umehrlich zu sein […], ich habe nie viel von Kriminalromanen gehalten und bedaure, daß auch Sie sich damit abgeben.
Zeitverschwendung.»
Friedrich Dürrenmatt:Das Versprechen
«Zur Verteidigung des Kriminalromans möchte ich sagen, daß er keiner Verteidigung bedarf;obwohl man ihn heute mit einer gewissen Geringschätzung liest, bewahrt er doch eine Form von Ordnung in einer Epoche der Unordnung. Das ist ein guter Grund für uns, ihn zu schätzen, und das macht ihn verdienstvoll.»
Jorge Luis Borges:Die Kriminalgeschichte
Kapitel 3
Leere vor dem Abenteuer:Agententum als Wunscherfüllung
Die Leere nach dem Abenteuer:Die ‹antiheroische Tradition› des Spionageromans (Ambler, Greene, le Carré)
Die Ethik der Spionage und die Beherrschbarkeit des
Kein Held. Nur Verzweiflung.
Kapitel 5
Hermeneutik und der Kommissar als «Schicksalsflicker» (Simenon).
Wiederentdeckung des Menschen und die Aufwertung des Kriminalromans (Glauser).
als Ausdruck des Unbehagens in der Kultur (Freud,
Lange Zeit ist die Kriminalliteratur vordringlichanthropologisch und juristisch ausgerichtet und an Aufschlüssen über die Seele des Verbrechers interessiert. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts etabliert sich die genuin literarische Kunstfigur des Detektivs. Durch die ungeheure Popularität des Detektivs, kulminierend in Arthur Conan Doyles Sherlock-Holmes-Erzählungen, rücken die früheren Leitaspekte der Kriminalliteratur in den Hintergrund. Prozesse der Rätsellösung werden wichtiger als Rechtskenntnisse oder literarische Erfahrungsseelenkunde. Stand zuvor der Verbrecher im Zentrum der analytischenNeugier, kommt nun der Figur des Ermittlers die meiste Aufmerksamkeit zu. Nicht mehr Devianz, sondern Detektion ist der bestimmende Gegenstand der Kriminalliteratur. Im Detektiv verdichten sich Tendenzen des Positivismusund des Szientismus, aber auch des Ästhetizismus: Es geht dem Meisterdetektiv nicht um Erkenntnisse über den Menschen,«er betreibt ja die Kunst um der Kunst willen»(Doyle:Buch der Fälle, 291).1 Dieser ebenso logisch wie kreativ denkende und poetisch verfahrende Rationalitätskünstler ist Ausdruck einer Dialektik der «Entzauberung der Welt»(Weber: Protestantische Ethik, 146)infolge umfassender Technisierung und wissenschaftlicher Erklärbarkeit.
Vondieser Entwicklung erzählt der erste Band dieser historisch-systematischen Darstellung der Kriminalliteratur. Vonder antiken Tragödie über Shakespeares Dramen und die gleichermaßen psychologisch wie juristisch motivierten Kriminal- und Rechtsfallgeschichten des 18. Jahrhunderts wird ein Bogen zur Erfindung des Detektivsgespannt. Auch im zweiten Band
1 Im Folgenden werden literarische, theoretische und philosophische Texte mit Nachname und Kurztitel nachgewiesen, Forschungsbeiträge mit Nachname und Jahreszahl. Dass die Grenze zwischen Forschungsbeitrag und Theorietext in manchen Fällen fließend ist, ist unvermeidlich.
wird das Theoriepotenzial kriminalliterarischer Texte entfaltet, indem unterschiedlicheAusprägungen dieses umfassenden, nicht auf Ermittlungstätigkeiten zu begrenzenden Genres vorgestellt werden.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird der Detektiv als romantische Figur gesehen, wie aus Gilbert Keith Chestertons Verteidigung von Kriminalromanen (1901) hervorgeht. Der Detektiv wandere durch die Großstadt, «einsam und frei, fast wie ein Märchenprinz aus Elfenland»(Chesterton:Verteidigung, 35). In der Detektiverzählung finde die Wiederverzauberung der urbanen Welt statt:
Die Lichter der Stadt beginnen wie unzählige Koboldsaugen zu glühen, weil sie die Hüter irgendeines noch so primitiven Geheimnisses sind, das der Dichter weiß und der Leser nicht. Jede Straßenwindung ist wie ein Finger, der darauf hindeutet;die phantastischen Linien der Schornsteine am Horizont scheinen wild und spöttisch den Sinn des Geheimnisses zu signalisieren. (Ebd.)
Es sei aber nicht der einzige Vorzug der Detektivliteratur, dass sie die «romantischen Möglichkeiten der modernen Stadt»aufzeigt (ebd., 36). Sie trage auch zum Erhalt der Zivilisationbei. Es sei eine uralte menschlicheNeigung, «gegen etwas so Allgemeines und Automatisches wie die Zivilisationzurebellieren, Lossage und Aufruhr zu predigen»(ebd.). Dagegen bringe der Detektivroman zum Vorschein, dass «wir im gerüsteten Lager leben und Krieg führen mit einer chaotischen Welt, und daß die Verbrecher, die Kinder des Chaos, nichts anderes sind als die Verräter in unseren eigenen Mauern» (ebd., 37). Chesterton betont die ideologische Funktion des Detektivromans, die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu affirmieren. In Chestertons Sichtweise aber erscheint das Detektivgenre nicht konservativ, da die Zivili-
sation das Aufbegehren gegen die ursprüngliche Wildheit ist. Hüter der zivilisatorischen Wertordnung sei der Detektiv, «während die Einbrecher und Wegelagerer bloß friedliche, alte, komischeKonservativesind, glücklich mit den uralten Anstandsbegriffen der Affen und Wölfe»(ebd.). Anders als in großen Teilen der älteren Kriminalliteratur sind Verbrecher nicht mehr Gegenstände anthropologischer Neugier, sondern nur noch soziale Störfaktoren, wogegen der Detektiv als «Träger der sozialen Gerechtigkeit die eigentlich originelle und poetische Figur»sei (ebd.). Die Figur des Detektivs fungiert im frühen 20. Jahrhundert, ohne ihre Inszenierung als bohemehafter gesellschaftlicher Außenseiter und Einzelgänger aufzugeben, als Bewahrer und Verteidiger bestehender Strukturen.
Ausdifferenziert und zu einem literarhistorischen Höhepunkt geführt wird der Typus des genial-exzentrischen Rätsellösers im (retrospektiv so bezeichneten) Golden Age des Detektivromans. Damit ist üblicherweise die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gemeint, als erstmals eine als satisfaktionsfähig erachtete Syntheseder straffen Form der Detektiverzählung, die bei Poe und Doyle ihre kanonische Ausprägung erhielt (vgl. Bd. 1, Kap. 4und 6), mit der umfangreicheren Form des Detektivromans gelingt. Der Detektivroman ist nun, wie Siegfried Kracauer 1925 feststellt, «längst kein trübes Mischproduktmehr, in dem die Abwässer aus Abenteuerromanen, Ritterbüchern, Heldensagen,Märchen zusammenfließen, sondern eine bestimmte Stilgattung, die eine eigene Welt mit eigenen ästhetischen Mitteln entschieden darstellt»(Kracauer:Detektiv-Roman, 107). Als eigenständige Gattung mit formalen und inhaltlichen Regeln und einem spezifischen Erwartungshorizont hat der Detektivroman sich als populärste Spielart der Kriminalliteratur etabliert. Die epische Breite und das gesellschaftliche Panorama der Detektivromane des 19. Jahrhunderts bei Autoren wie Wilkie Collins oder Emile Gaboriau (vgl. Bd. 1, Kap. 5) werden zugunsten einer deutlich strafferen und auf die Tätigkeitdes privaten Ermittlers fokussierten Narration reduziert.
Ohne den Einfluss der Holmes-Geschichten wäre der Detektivroman des ‹Goldenen Zeitalters› kaum denkbar. Dorothy L. Sayers schreibt 1928, Sherlock Holmes habe «die höchste Ehre erhalten, die die Literatur zu vergeben hat – das säkulare Äquivalentzur Heiligsprechung:[…]Erist der Ausgangspunkt einer ganzen Tradition […], die viele Jahre lang die Detektivliteratur beherrschte.»(Sayers:Einleitung, 149)Dieser Einfluss sei so nachhaltig
gewesen, «daß in der Folgezeitbemerkenswerte Exzentriker ihre Exzentrizität vor allem dadurch unter Beweis stellten, daß sie ihr Vorbild mieden» (ebd.). Traditionsbildung ist ein Wechselspiel von Reproduktion eines Musters und dessen Variation. Noch die Abweichungbestätigt die Macht des Einflusses.
Zur Etablierung des Detektivgenres habe Poe den Anstoß gegeben, doch erst der Erfolg der Holmes-Geschichten sei der Stein gewesen, der eine «Lawine der Kriminalliteratur»ausgelöst habe, in deren Zuge die Detektivliteratur zu einem nicht mehr zu bändigenden Massenphänomen geworden sei:
Buch auf Buch, Illustrierte auf Illustrierte, fluten aus der Presse, voll mit Morden, Diebstählen, Brandstiftungen, Betrügereien, Verschwörungen, Problemen, Rätseln, Geheimnissen, Schaudern, Verrückten, Gaunern, Giftmördern, Fälschern, Würgern, Polizisten, Spionen, Geheimagenten, Detektiven, so daß man den Eindruck hat, die halbe Welt sei damit beschäftigt, sich Rätsel für die andre Hälfte auszudenken. (Ebd., 170)
Neben der schieren Menge derartiger Produktionen benennt Sayers den maßgeblichen Grund für deren Popularität:Die zum Massenphänomen gewordene Kriminalliteraturzeichnet sich weniger durch formalästhetische Aspekte als durch den Charakter des Rätsels aus. Der ‹pointierte Rätselroman› (vgl. Schulz-Buschhaus 1975, 86 ff.) des Golden Age beginnt mit einem Geheimnis, verstrickt die Aktivität der Lesenden in die Auflösungsbemühungen und endet damit, dass der geniale Detektiv alle ausgebreiteten Hinweise zu einer überzeugenden Rätsellösungvereinigt. Sayers’ Eindruck,die halbe Welt denke sich Rätsel für die andere Hälfte aus, benennt eine nur scheinbare Banalität:Die Rätsel der Detektivromanesind ganz und gar erfunden. Sie sind zum einen Produkte literarischer Fiktion, zum anderen drücken sie sogar innerhalb der erzählten Welt den «Ehrgeiz»der Täter aus, «einen Mordfall zu erfinden, den niemand lösen kann»(Christie:Und dann gabs keines mehr, 221). Die Verbrechen der Golden Age-Romane sind von Realitäten abgelöste Konstrukte, «isolierte Begebenheit[en], deren Bedeutungsich in ihrer anerkannten Illegalität erschöpft»(Kracauer:Detektiv-Roman, 163)und die weitestgehend einer kritischen und zeitdiagnostischen Funktion entbehren.
Die Ordnungsstörung verweist nicht auf etwaige Probleme der Ordnung. Sie dient einzig dem intellektuellen Spiel, das sie in Gang setzt. Die Straftaten wie auch die Begleitumstände der Aufklärung folgen dem An-
spruch, «höchst ungewöhnlich und dramatisch»(van Dine:Mordfall Greene, 8) zu sein. Ein raffiniertes Arrangement zieht eine originelle und überraschende Auflösung nach ist. Die logische Reihenfolge aber ist eine andere. Nicht der Mord macht den Detektiv notwendig,sondern umgekehrt:Erst der Umstand eines unnatürlichen Todesfalles bietet dem Detektiv die Bühne, um seine Rolle mit aller Bravour und Grandezzaausfüllen zu können. Um den Rätsellöser glänzen zu lassen, muss ihm eine maximal mysteriöse Tat kredenzt werden. Die unverhohlene Künstlichkeit der Rätsel findet ihre Entsprechung in einer Künstlichkeit der erzählten Welt. Hinzu kommt das selbstreferenzielle Wissen der Gattung um ihre eigene Artifizialität;nicht umsonst treten immer wieder Figuren auf, die sich im Verfassen von Kriminalromanen üben und mit den innerfiktional ‹realen› Detektiven konkurrieren.
Es wird ein beständiges Spiel mit Mutmaßungen und Irreführungen angestrengt, aber gerade diese Dominanz der künstlichen Kriminalität limitiert die Entfaltung der literarischen Möglichkeiten.Auch ohne sich pauschalen und klischeehaften Schmähungen des Detektivromans als minderwertiger literarischer Form anzuschließen, muss eingestanden werden, dass die Fokussierung des Rätsels und die Fetischisierung kriminalistischer Artistik eine Tendenz zum Eskapismus aufweist. Die Literatur gibt ihr analytisches Potenzial preis, wenn sie alles ausblendet, was sich nicht reizerhöhend um ein artifizielles Mysterium gruppieren lässt. Just durch diese Fokussierung indes erreicht die Kriminalliteratur im ‹Goldenen Zeitalter› eine neue Perfektion in der Gestaltung der «Geheimnis- oder Rätselspannung, die sich auf bereits geschehene, aber dem Leser in ihren wichtigsten Umständen noch nicht bekannte Ereignisse bezieht»(Suerbaum 1998, 89). Diese Spannung richtet sich, anders als beim synthetischen Erzählen, immer auf ein «vorerst zurückgestelltes vergangenes Geschehen, das analytisch eingeholtwird»(Weber: Theorie, 96 f.). Vongeringem Gewicht ist hingegen die auf den Fort- und Ausgang einer Ereigniskette gerichtete Zukunftsspannung (vgl. Suerbaum 1998, 89). Schon eine oberflächliche Vertrautheit mit den Gepflogenheiten des Genres lässt die Lesenden davon ausgehen, der Detektiv werde seine intellektuelle Überlegenheit schließlich ausspielen und das Rätsel lösen. Nicht ob, sondern wie das Geheimnis gelöst wird und wie es beschaffen war, verbürgt die Spannung.
DieseApotheose der Rätselspannungzementiert dieAbkehr von derjuridisch-anthropologischenAusrichtung, dieder Kriminalliteratur im 18. Jahrhundert ihrFundamentgab. Abhängig von Erkenntnisinteressen sowie ästhetischen undideologischen Wertmaßstäben lässtsich diese Entwicklung sowohl als Aufstiegs- als auch als Verfallsgeschichte erzählen. DieeinePerspektive besagt, dass diegesamte Kriminalliteratur vordem ‹GoldenenZeitalter› formal unausgereifte Ansätze undVorstufenbot,die in derausgeklügeltenForm des DetektivromansihreVollendung finden. DieandereSichtweiseverstehtdie Kriminalliteraturvor ihrerVerengung zumDetektivgenre als einFeld der Selbsterkenntnis desMenschen,ein von HumanitätgeprägtesMedium psychologischer undjuristischerWissensvermittlung,das beieinzelnen Vertretern mit allen Ambivalenzenund ästhetischenFinessen ausgestattet war, dievon großer Literaturzuerwarten sind, nunaber zu einer zwar ausgefeilten, aber letztlich doch trivialenErfüllungsmaschine affirmativer oder eskapistischer Sehnsüchte verkommt. Beide Positionen sind von spezifischenVorannahmen, standortgebundenenÜberzeugungen und individuellen Vorlieben beeinflusst. Sinnvoller alseindeutige Parteinahmen ist eine Entfaltung der theoretischen Implikationender Genreregeln, diediesen Einschätzungen zugrunde liegen.
Der intellektuellen Physiognomie, die Poe und Doyle ihren Analytikern verliehen haben, konnte der klassische Detektiv-Roman nicht mehr viel hinzufügen. Der Detektiv als ‹Denkmaschine›,wie er am Beispiel von Jacques Futrelles Prof. van Dusen bezeichnet wurde, ist allem voran die «Personifikation der ratio»(Kracauer:Detektiv-Roman, 170). Die ideologische und philosophische Verwurzelung der Figur ist unzweifelhaft:«Empirie und Logik, die Mittel des wissenschaftlichen Denkens, sind auch die, mit denen der Detektiv operiert.» (Alewyn:Anfänge,191) Die von den Vorläufern übernommenen Anlagen werden weiter ausbuchstabiert, ohne in Abrede zu stellen, dass es sich um die Variation eines wiedererkennbaren Typus handelt. Forcierte Originalität im Detail und impliziter Verweis auf Archetypikstellen keinen Widerspruch dar, Tradition und Innovation gehen miteinander einher. In Agatha Christies erstem Roman Das fehlende Glied in der Kette (1920)bekundet der Erzähler, er habe «einmal in Belgien einen Mann kennen gelernt, einen
sehr berühmten Detektiv […]. Er behauptete immer, gute Detektivarbeit bestünde einzig und allein in einer methodischen Vorgehensweise. […]Erwar ein drolliger kleiner Mann, ein richtiger Dandy, aber unglaublich klug.» (Christie:Glied, 14 f.) Kompakter lässt sich das Profil des literarischen Detektivs kaum zusammenfassen. Die Artifizialitätdes Typus, der als Kombination eines relativ konstanten Bündels an Merkmalen erscheint, soll gar nicht verborgen werden:«Sein Kopf hatte genau die Form eines Eies, und er neigte ihn stets ein wenig zur Seite. Sein Schnurrbartwar mit militärischer Strenge steif gezwirbelt. Seine Erscheinungwar von geradezu unglaublicher Korrektheit, wahrscheinlich hätte ihm ein Staubkorn mehr Unbehagen verursacht als eine Schusswunde.» (Ebd., 26 f.) Der Detektiv gleicht auch innerhalb der Fiktion einem lebensfernen und weltentrückten Kunstwerk. Er ist überaus penibel und bringt «jeglicher Ordnungein leidenschaftliches Interesse entgegen»(Christie:Golfplatz,15).Die Einrichtung der Welt soll der Akkuratesse seines eigenen Denkens entsprechen.«Seine Gottheiten hießen ‹Ordnung› und ‹Methode›»(ebd.), sodass die Lösung von Kriminalfällen ein nahezu beliebiger Ausdruck des Bestrebens ist, alles geordnetund methodisch reguliert zu wissen. In einer zunehmend unüberschaubaren und zuweilen anarchisch anmutenden Welt, in der alte Imperien zerfallen, ist der Detektiv eine restaurative Sehnsuchtsfigur. Seine Aufmerksamkeit für Details, gepaart mit seinem Dandytum, erzeugt eine geradezu zwanghafteAufmerksamkeit für die eigene Inszenierung. Die Fixierung auf die korrekteOrdnung der Dinge ist bis in die Gegenwart ein zuweilen ins Neurotischeund Pathologische strapaziertes Merkmal von Ermittlerfiguren.
Die schrullig-skurrilen Züge sind für den Plot entbehrlich (vgl. Alewyn: Anatomie, 60), aber keineswegs für die Popularität des Figurentypus. Die habituellen Marotten des Detektivs, sein erlesener Kunstgeschmack, seine modischen Vorlieben oder sein Ordnungsfetisch sind integrale Bestandteileder Charakteristik dieser Kunstfigur, auch und gerade weil sie für die Narration abkömmlich sind. Wird dagegen vorgebracht, der Detektiv sei «reine Funktion»(ebd.), bei der es keinerlei individueller Persönlichkeitsmerkmale bedürfe, dann wird ein richtiger Gedanke nicht zu Ende gedacht. Zwar ist der Detektiv ein Typus, dessen Marotten austauschbar sind und dessen Funktion wichtiger ist als charakterliche Individualität im emphatischen Sinne, aber diese ‹reine Funktion› wird zu einer Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Um von dieser Verabsolutierung der reinen Funktion, die in ihrer technizistischen
Kälte kein attraktiver literarischer Gegenstand wäre, so erzählen zu können, dass die Lesenden der Personifikation der bloßen Vernunft Interesse und gar Sympathie entgegenbringen (und sie als Helden seriellen Erzählenswiedererkennen), bedarf es, und sei es in durchschaubarster Weise ornamental, einiger Eigenschaften, durch die der Detektiv zwar nicht ‹menschlicher›,wohl aber individueller wird. Dass die Spleens der ‹reinen Funktion› ihrerseits ebenso rein funktional sind, bleibt davon unberührt. Bei allen Wandlungen, die Ermittlerfiguren im Laufe der Zeit erfahren haben:Der Detektiv, dessen je konkrete Marotten «das schlechthin Unpersönliche» (Kracauer:DetektivRoman, 142)kaum camouflieren können, ist die beständigste und konstanteste Figur der Kriminalliteratur. Es genügt mittlerweile das Auftauchen eines Detektivs, um einen Text zur Kriminalliteraturzuzählen – es bedarf gar keines Verbrechens mehr, so dominant werden der Detektiv und die mit ihm verbundenenTätigkeitenals Repräsentationender Kriminalliteratur im Ganzen gesehen.
Der typische Dandy-Detektiv des ‹Goldenen Zeitalters› ist unverheiratet, was seine Antibürgerlichkeit und seine grundsätzliche Bindungslosigkeit signalisiert, vor allem aber seine Entsexualisierung zugunsten eines rein geistigen Wesens (weswegen keine gravierenden Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Detektivfiguren festzustellen sind). Ist er nicht ohnehin von Adel, verfügt er über einen aristokratischen Habitus. Er ist wohlsituiert, «hochgelehrtinallen Fragen der Ästhetik und der Psychologie»(van Dine: Mordfall Canary, 12)und mit einem ausgeprägten Interesse für (zuweilen obskure)Kunst und Kultur. Sein Hang zur Kunst ist keine Nebensächlichkeit, er präfiguriert das Verhältnis zur Verbrechensbekämpfung,daerKriminalfälle zum Vergnügen, zur «Zerstreuung»(Sayers:Badewanne, 162)und wie ein Kunstliebhaber löst. Für S. S. van Dines Detektiv Philo Vance ist die «Liebe zur Kunst […]der beherrschendeZug»(van Dine:Mordfall Benson, 12)seiner Persönlichkeit, alles andere, auch das Detektivische, ist diesem Zug nachgeordnet und davon geprägt. Der (fingiert autodiegetische) Erzähler schildert den ebenso scharfsinnigen wie schöngeistigen Vance als «einen kühlen, zynischen und sarkastischen»Mann, durch den er «eine gänzlich neue Art der intellektuellen Zerstreuung»(ebd., 5) kennengelernt habe. Dass es sich bei dieser ‹Zerstreuung› um das Lösen verwickelter Mordfälle handelt, muss van Dine nicht eigens erläutern. Anders als professionelle Verbrechensbekämpfer wie Polizisten oder Staatsanwälte steht der Detektiv «für
den sorglosen, exotischen, vagabundierenden Geist des intellektuellen Abenteuers»(ebd., 22).
Aufgrund seiner «hochentwickeltenBeobachtungs-und Kombinationsgabe»(Sayers:Ärger,19) istder Detektivimstande,jedwedesMysteriumaufzudecken.«Mir aber entgehtkeinnoch so kleines Geheimnis»(Christie:Alibi, 186),prahlterund stellt es einums andere MalunterBeweis. Derrationalistische Wunschtraum einerlückenlosen Aufklärung undEntzauberung derWelt, dieallzu leicht in vollumfängliche Überwachung umzukippen droht,findetim rationalomnipotenten Detektivseine selbstbewusste Personifikation. Das «für Polizei undRichter nahezu unlösbare Problem»(Leroux:Zimmer,7)ist für ihn gerade gut genug. «Von einemVerbrechen verlange ichPhantasie»(Sayers: Badewanne, 59), begründet derKünstler-Detektiv(dessen eigene Phantasie einewesentliche Voraussetzung seiner kriminalistischen Fähigkeiten ist),weshalb er sich für schnöde Einbrüche nicht interessiert. Die Erstaunen hervorrufende Aufklärung – von banalen Ermittlungserfolgen wird gar nicht erst erzählt – gelingt demDetektiv mit «einemanalytisch deutendenVerfahren,das […] niezuvor für dieErmittlung in Kriminalfällen Anwendung gefunden hatte» unddas den «herkömmlichen Methoden der Polizeiund der Bezirksstaatsanwaltschaft»(van Dine:Mordfall Benson,7)überlegen ist. Innerhalbder Romanwelt muss diesesVerfahrenals einmalig undinnovativ erscheinen, auch wenn es bereitsvon unzähligen Detektiveninvergleichbarer Weise undmit identischem Überlegenheitsanspruch zurAnwendung gebracht wurde. Das Neue ist dasunverzichtbare Vertraute.
Da er sich auf die Überlegenheit seines Geistes und seiner Methode verlassen kann, muss dieser Detektiv den Lehnsessel nicht mit Notwendigkeit verlassen. Analysis ist dem klassischen Detektivroman erheblich wichtiger als Action (zur Begrifflichkeit vgl. Schulz-Buschhaus 1975, 3sowie Bd. 1, Kap. 1). «Die Unbedingtheit der ratio verlangt diese Reinigung von dem Anteil der bedingten Kräfte, sie drängt, wo sie ästhetisch sich verkörpert, ins Körper- und Gestaltlose»(Kracauer:Detektiv-Roman, 181), wie auch das zentrale Verbrechen meist körperlos ist. Bei keinem anderen Heldentypus der Populärkultur ist die Physis so radikal zurückgedrängt wie beim Meisterdetektiv, der oft sogar die Ermittlungen vor Ort Helferfiguren oder der Polizei überlässt. Die körperliche Schrulligkeit und das zuweilen fortgeschrittene Alter unterstreichen, wie gleichgültig der körperlicheEinsatz der Detektivfigur ist. Die Körperlosigkeit des Detektivs reicht so weit, dass das Grundge-