IM GEISTE DES DIONYSOS
Kunst und Praxis des griechischen Theaters im 5. Jahrhundert v. Chr.

Raimund Merker
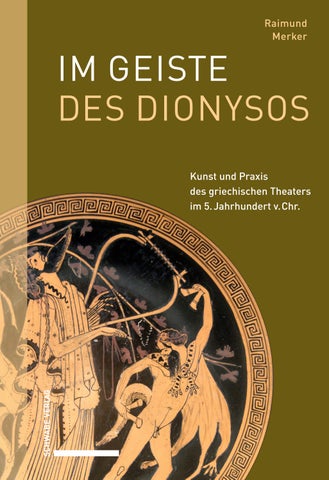
Kunst und Praxis des griechischen Theaters im 5. Jahrhundert v. Chr.

Raimund Merker
Kunst und Praxis des griechischen Theaters im 5. Jahrhundert v. Chr.
Schwabe Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Schwabe Verlag Berlin GmbH
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Abbildung Umschlag: Dionysos mit zwei Satyrn. Trinkschale des Brygos-Malers (datiert in das Jahr um 480 v. Chr.); Cabinet des Médailles – Paris
Korrektorat: Jan Urbich, Leipzig
Cover: icona basel gmbh, Layout: icona basel gmbh, Basel
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Druck: Prime Rate Kft., Budapest
Printed in the EU
Herstellerinformation: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7574-0163-4
ISBN eBook (PDF) 978-3-7574-0164-1
DOI 10.31267/978-3-7574-0164-1
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabeverlag.de www.schwabeverlag.de
Meinem akademischen Lehrer
Herbert Bannert
zum 75. Geburtstag
I.1. Nah ist und schwer zu fassen der Gott
I.4. Exkurs: Zur Erläuterung
II .1. Die Südostseite der Athener Akropolis
.1.1. Das Heiligtum des Dionysos Eleuthereus
des Perikles
II .2. Archäologische Beispiele weiterer wohlgebildeter Theater
II .2.3. Ikarion
II .3. Bühnentechnik und Bühneneffekte
II .3.1. Ekkyklema
II .3.1.1. Exempla und szenische Interpretation
II .3.1.1.1. Aischyl. Ag. 1372–1379
II .3.1.1.2. Aischyl. Choeph. 973–979
II .3.1.1.3. Aischyl. Eu. 64–84
II .3.1.1.4. Soph. Ai. 344–353
II .3.1.1.5. Soph. Ant. 1293
II .3.1.1.6. Soph. El. 1466–1469 . .
II .3.1.1.7. Eur. Herc. 1028–1038 . . .
II .3.1.1.8. Eur. Hipp. 170–171 / 806–816 .
II .3.1.1.9. Eur. El. 1172–1176 .
II .3.1.1.10. Eur. Hec. 1049–1055 . .
II .3.2. Mechané
II .3.2.1. Exempla und szenische Interpretation
II .3.2.1.1. Aischyl. Prom. 128–135
II .3.2.1.2. Soph. Phil. 1409–1417
II .3.2.1.3. Eur. Med. 1317–1322 .
II .3.2.1.4. Eur. Andr. 1226–1230 .
II .3.2.1.5. Eur. Ion 1549–1550 / 1569–1570
II .3.2.1.6. Eur. El. 1233–1237 .
II .3.2.1.7. Eur. Herc. 815–821 .
II .3.2.1.8. Eur. Hel. 1639–1641
II .3.2.1.9. Eur. Or. 1621–1628 .
II .3.2.1.10. Eur. Hipp. 1268–1282
II .3.2.1.11. Eur. Bacch. 1329–1335
II .3.2.1.12. Eur. Suppl. 1180–1184
II .3.2.1.13. Eur. Iph. T. 1431–1437
II .3.3. Feuer und Rauch
II .3.3.1. Exempla und szenische Interpretation
II .3.3.1.1. Aischyl. Ag. 22–24
II .3.3.1.2. Aischyl. Prom. 1080–1093
II .3.3.1.3. Eur. Hik. 1069–1071
II .3.3.1.4. Eur. Tro. 1–12 / 298–324
II .3.3.1.5. Eur. Hel. 865–870
II .3.3.1.6. Eur. Or. 1573–1575
II .3.3.1.7. Eur. Bacch. 6–9
II .3.4. Wagen und Tiere .
II .3.4.1. Exempla und szenische Interpretation
II .3.4.1.1. Aischyl. Ag. 905–907 192
II .3.4.1.2. Aischyl. Pers. 150–158 194
II .3.4.1.3. Aischyl. Suppl. 180–183 (mit Bezug auf Vers 234 f.) 196
II .3.4.1.4. Eur. Tro. 568–576 198
II .3.4.1.5. Eur. El. 965–966 / 998–999 200
II .3.4.1.6. Eur. Iph. A. 610–620 202
II .3.5. Akustik und Geräusche 204
II .3.5.1. Exempla und szenische Interpretation 206
II .3.5.1.1. Aischyl. Prom. 1080–1093 206
II .3.5.1.2. Aischyl. Sept. 100–105 208
II .3.5.1.3. Soph. Oid. K. 1453–1456 / 1460–1479 209
II .3.5.1.4. Eur. Herc. 901–909 212
II .3.5.1.5. Eur. Ion 106–108 214
II .3.5.1.6. Eur. Bacch. 582–603 215
II .3.6. Bühnenversatzstücke und Requisiten 217
II .4. Exkurs: Zur Erläuterung
II .4.1. Die Thymele als Spielort im Drama des 5. Jh. v. Chr. . .
III . Ästhetik, Spiel und Inszenierung .
III .1. Die Schauspieler
III .2. Exkurs: Zur Erläuterung
III .2.1. Timing in der antiken Tragödie. Zum Phänomen der szenischen Synchronisation im griechischen Drama
III .3. Nonverbale Kommunikation
III .3.1. Lauschen und Spähen
III .3.1.1. Exempla und szenische Interpretation
III .3.1.1.1. Aischyl. Prom. 114–127
III .3.1.1.2. Aischyl. Ag. 1343–1347
III .3.1.1.3. Soph. Ai. 1–13, 20–22, 31–35
III .3.1.1.4. Soph. El. 1322–1325 / 1404–1421
III .3.1.1.5. Eur. Hipp. 565–590
III .3.1.1.6. Eur. Hec. 1091–1097
III .3.1.1.7. Eur. Phoen. 261–279
III .3.2. Drohgebärde
III .3.2.1. Exempla und szenische Interpretation
III .3.2.1.1. Aischyl. Ag. 1641–1653
III .3.2.1.2. Soph. Phil. 1254–1258
III .3.2.1.3. Eur. Iph. A. 303–314
III .3.2.1.4. Eur. Ion 520–525
III .3.2.1.5. Eur. Or. 1506 –1529
III .4. Der Chor
III .5. Die Statisterie und Komparserie
III .6. Mise en Scène
III .6.1. Inszenierung
III .6.2. Musik (mit einem Exkurs zur musikalischen Debatte im Athen des 5. Jh. v. Chr.)
III .6.3. Choreographie und Tanz
III .7. Exkurs: Zur Erläuterung
III .7.1. Das Vers-/Wegverhältnis als Maßeinheit für Inszenierung und Spiel im antiken Drama
III .8. Die Ausstattung
III .8.1. Die Maske
III .8.1.1. Die Maske der Tragödie
III .8.1.2. Die Maske der Komödie
III .8.1.3. Die Maske des Satyrspiels
III .8.2. Das Kostüm
III .8.3. Das Bühnenbild
III .9. Exkurs: Zur Erläuterung
III .9.1. Zur verbalen Gestaltung des fiktiven Schauplatzes .
III .10. Die Backstage-Crew
III .11. Das Publikum
Teil II Dichtung
IV . Dichter, Plot und Dramaturgie
IV .1. Die dramatische Literatur der Griechen
IV .1.1. Tragödie und Malerei
IV .2. Die Dichter und ihre Dramen
IV .2.1. Aischylos: Soldat und Tragiker .
IV .2.1.1. Perser (Πέρσαι)
IV .2.1.2. Sieben gegen Theben (Ἑπτὰ ἐπὶ
IV .2.1.3. Hiketiden (Ἱκέτιδες)
IV .2.1.4. Agamemnon (Ἀγαμέμνων).
IV .2.1.5. Choephoren (Χοηφóρoι)
IV .2.1.6. Eumeniden (Εὐμενίδες) .
IV .2.1.7. Prometheus (Προμηθεύς)
IV .2.2. Sophokles: Staatsmann und Theatervollbringer
IV .2.2.1. Aias (Αἴας)
IV .2.2.2. Antigone (Ἀντιγόνη) 498
IV .2.2.3. Die Trachinierinnen (Τραχίνιαι)
IV .2.2.4. König Ödipus (Οἰδίπους Τύραννος)
IV .2.2.5. Elektra (Ἠλέκτρα)
IV .2.2.6. Philoktetes (Φιλοκτήτης) 506
IV .2.2.7. Ödipus auf Kolonos (Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ) 508
IV .2.3. Euripides: Geistesmensch und Relativierer 510
IV .2.3.1. Alkestis (Ἄλκηστις) 520
IV .2.3.2. Medea (Μήδεια) 522
IV .2.3.3. Herakliden (Ἡρακλεῖδαι) 524
IV .2.3.4. Hippolytos (Ἱππόλυτος) 526
IV .2.3.5. Hekabe (Ἑκάβη) 528
IV .2.3.6. Andromache (Ἀνδρομάχη) 530
IV .2.3.7. Die bittflehenden Mütter (Ἱκέτιδες)
IV .2.3.8. Elektra (Ἠλέκτρα)
IV .2.3.9. Herakles (Ἡρακλῆς)
IV .2.3.10. Troerinnen (Τρῳάδες)
IV .2.3.11. Ion (Ἴων) .
IV .2.3.12. Iphigenie auf Tauris (Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις)
IV .2.3.13. Helena (Ἑλένη)
IV .2.3.14. Phönizierinnen (Φοίνισσαι)
IV .2.3.15. Orestes (Ὀρέστης)
IV .2.3.16. Iphigenie in Aulis (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι)
IV .2.3.17. Bakchen (Βάκχαι) . . .
IV .2.3.18. Rhesos (Ῥῆσος) .
IV .2.3.19. Kyklops (Κύκλωψ) .
IV .3. Wiederkehrende szenische Schemata 564
IV .3.1. A-parte-Sprechen 565
IV .3.1.1. Exempla und szenische Interpretation
IV .3.1.1.1. Soph. Phil. 572–581 . .
IV .3.1.1.2. Eur. Hec. 736–753 .
IV .3.1.1.3. Eur. Or. 670–673 . .
IV .3.1.1.4. Eur. Bacch. 959–960 . .
IV .3.1.1.5. Eur. Iph. A. 654–655 / 1139–1140 .
IV .3.1.1.6. Eur. Hel. 132–133 / 138–139 .
IV .3.1.1.7. Eur. Med. 63–66 / 277–281 / 899–900 .
IV .3.1.1.8. Eur. Hipp. 1060–1063 .
IV .3.1.1.9. Eur. Iph. T. 773–778 / 780–783 .
IV .3.1.1.10. Eur. Ion 425–428
IV .3.2. Die gesprochene Aktion .
IV .3.2.1. Exempla und szenische Interpretation
IV .3.2.1.1. Aischyl. Pers. 150–154
IV .3.2.1.2. Aischyl. Ag. 1–5 / 30–33
IV .3.2.1.3. Aischyl. Choeph. 10–21
IV .3.2.1.4. Aischyl. Eu. 34–37
IV .3.2.1.5. Soph. Ai. 1–13
IV .3.2.1.6. Soph. Phil. 819–826
IV .3.2.1.7. Soph. Oid. K. 844–846
IV .3.2.1.8. Eur. Bacch. 582–603
IV .3.2.1.10. Eur. Iph. A. 1098–1099
IV .3.3. Das szenische Schweigen
IV .3.3.1. Exempla und szenische Interpretation
IV .3.3.1.1. Aischyl. Ag. 20–25
IV .3.3.1.2. Aischyl. Ag. 1035–1071
IV .3.3.1.3. Soph. Trach. 307–313 und 320–328
IV .3.3.1.4. Oid. T. 1071–1075 .
IV .3.3.1.5. Soph. Ant. 1240–1245
IV .3.3.1.6. Eur. Or. 1590–1592
IV .3.3.1.7. Eur. Hipp. 565–570 .
IV .3.4. Sterben, Tod, Gewalt . .
IV .3.4.1. Exempla und szenische Interpretation
IV .3.4.1.1. Eur. Alk. 226–243 / 392 .
IV .3.4.1.2. Eur. Med. I, Vers 4–11
IV .3.4.1.3. Aischyl. Semele – fr. 221 (Radt)
569
572
573
577
589
591
591
592
594
596
597
598
599
600
603
603
605
606
Teil III Darstellung
V. Antikes Theater auf der Bühne seiner Zeit
V.1. Exkurs: Zur Erläuterung
V.1.1. Der Prometheus Desmotes auf der Bühne seiner Zeit
VI . Der Nationalsozialismus und die griechische Tragödie
VI .1. Exkurs: Zur Erläuterung
VI .1.1. Bühnenkonzeptionen im dritten Reich. NS -Theater im griechischen Gewand
Anhang
Stammbaum der olympischen Götter
Stammbaum der Götter nach Hesiod
Übersicht über die wichtigsten Feste in Athen
Diese, im erweiterten Sinne ‹phänomenologische› Publikation, welche eine systematische Gliederung mit einem thematischen Zugriff verbindet, richtet sich an Schüler, Studenten, Theaterinteressierte wie auch an Fachkollegen und ist jene Sorte Buch, welches wir in jüngeren Jahren, in den Anfängen unserer Beschäftigung mit den Dramen und der Aufführungspraxis der Griechen, gerne selber zur Verfügung gehabt hätten.
Das ganze Forschungsfeld zum antiken Theater hat in den letzten Jahrzehnten eine mitunter tiefgreifende Veränderung erfahren. Das ist einerseits neuen, kritischen Herangehensweisen an die dramatischen Texte geschuldet, die die Verse viel weniger buchstäblich verstehen, andererseits den Bemühungen, diesen neuen literarischen Blick mit Fragen zur dramatischen Praxis und Organisation zu verbinden.1 So gelegen war die Aussicht auf Scheitern unseres Unterfangens durchaus minimiert, da wir auf umfangreiches Material zurückgreifen konnten, das Literatur- und Theaterwissenschaftler vor uns erarbeitet haben.
Dennoch, jeder, der sich um ein tieferes Verständnis zur Kunst und Eigengesetzlichkeit des antiken Theaters und seiner Dramen bemüht, sei es z. B. unter archäologischen Gesichtspunkten bei der Interpretation der bildlichen Darstellungen oder zur Baugeschichte und Architektur des Spielortes, im Rahmen altphilologischer Aufgabenstellungen zu den Tragikern und ihren Stücken in Form von Kommentaren oder Übersetzungen oder bei theaterwissenschaftlichen Erkundungen wie performative Fragen zum Inszenierungs- und Spielstil der Tragödien und Komödien im 5. Jh. v. Chr., weiß aus eigener Erfahrung, dass die vorhandene Fach- und Forschungsliteratur – spätestens seit der Jahrtausendwende, aber auch schon davor – für eine einzelne Person nicht mehr zu überblicken ist.2 Schier endlos scheint die Summe an Druckerzeugnissen zu kulturschöpferischen Fragen der griechisch-römischen Antike und ihrem Theater in Zeitschriften und Reihen zu sein, wie auch die mitunter beunruhigende Anzahl an Monografien und Sammelbänden, die in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen über die Fachwelt und alle Interessierten gleichsam hereinbrechen.3 Entsprechend braucht kein Altphilologe, Archäologe oder Althistoriker auch nur im Ansatz zu hoffen, eine so umfangreiche Literatur wie jene zum antiken Theater und zu den Dramen
1 So z. B. Raeburn (2017); Douglas Olsen/Taplin/Totaro (2023).
2 Die Aufzählung der angeführten Problemstellungen bildet nur im Ansatz die Fülle an Fragen in den genannten Disziplinen ab, welche sich, quer durch die Geistes- und Kulturwissenschaften, rund um das antike Theater und die Bühnenkunst der Griechen (und Römer) stellen.
3 Waren es in der Vergangenheit Forscher und Autoren des europäischen Festlands, sind es seit einigen Jahrzehnten insbesondere Altertumswissenschaftler von den finanzstarken Universitäten aus Großbritannien und den USA, die sich mit ihren Publikationen die Meinungshoheit zum antiken Theater und dem Drama der Griechen mit Fleiß und Beharrlichkeit erarbeitet haben.
der Griechen im Ansatz zu überblicken. Tatsächlich haben manche am Gegenstand Interessierte die Menge an Informationen so sehr unterschätzt, dass sie entmutigt aufgegeben und/ oder sich anderen Fragestellungen zugewandt haben.
Natürlich, und so viel sei zur Verteidigung dieses Phänomens festgehalten, ist dieser verlegerische Aspekt kein Alleinstellungsmerkmal des Gegenstands ‹Antikes Theater/Drama›. Leiden doch fast alle Fächer und Disziplinen der Geistes- und Kulturwissenschaften – und darüber hinaus – unter ganz ähnlichen Erscheinungen einer scheinbar nicht zu toppenden Publikationsflut. So berichten u. a. die Bibliothekare der Oxforder Bodleian Library, dass sie täglich tausend neue Veröffentlichungen entgegennehmen und die Sammlung so jedes Jahr um rund hunderttausend Bücher und zweihunderttausend Zeitschriften wächst, was in Regallänge gerechnet ca. drei Kilometern entspricht. Anders formuliert, dass 21. Jahrhundert ist nicht nur das Jahrhundert der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, es ist auch das Jahrhundert der Druckwerke und Publikationen. Alle 30 Sekunden erscheint in der Welt ein neuer Titel, 120 jede Stunde, 2800 am Tag, 86 000 im Monat. Ein durchschnittlicher Leser schafft in seinem ganzen Leben gerade mal das, was die Verlagsbranche an einem einzigen Tag produziert.4 Kurzum, man hat, trotz der nachhaltigen und intensiven Beschäftigung mit einem Thema, niemals genügend Zeit und oftmals noch viel weniger die Muse, all diese verschriftlichten Ergebnisse auch sinnstiftend zu erfassen, geschweige denn gründlich zu studieren.
Gleichwohl hat der Umstand der Publikationsfülle selbstredend auch einen nicht zu unterschätzenden erfreulichen Aspekt, da dieser unmissverständlich allen vorlauten Kritikern anschaulich vor Augen führt, dass die Beschäftigung mit dem Gegenstand ‹Theater› sich einerseits großer Beliebtheit in den Geistes- und Kulturwissenschaften erfreut, andererseits weit davon entfernt ist, so etwas wie akademischer Selbstzweck zu sein. Ganz zu schweigen davon, dass bei der Arbeit mit diesem vielgestaltigen Themenkreis regelmäßig hervorragende und neue Erkenntnisse zu Tage gebracht werden und diese, in Form von käuflichem Papier, einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diesem keinesfalls antiquierten Prinzip der Bekanntmachung widerspricht die neuerdings immer mehr um sich greifende, finanziell günstige Variante der reinen Onlinepublikationen. So praktisch wie diese in einem Arbeitsprozess auch sind, können sie im Forschungs- und Wissenschaftsalltag, insbesondere in den Geistes- und Kulturwissenschaften, dennoch nur eine praktikable Ergänzung, aber keine vollumfängliche Alternative zu einer analogen Abhandlung sein, die man, nach Goethe, damals wie heute, getrost nach Hause tragen kann.5
Aber wie dem auch sei, warum aufs Neue ein Druckwerk über das antike Theater? So sollte doch jeder, der ein solches Buchprojekt in Angriff nimmt, sich zunächst fragen, ob für eine weitere Publikation zum antiken Theater überhaupt Bedarf besteht? Neben einer Handvoll eher belangloser Gründe, zu denen auch, wie sollte es auch anders sein, die hochnotpeinliche Eitelkeit des Autors zählt, waren es vor allem zwei ausschlaggebende Stimuli, die uns schlussendlich dazu veranlasst haben, dieses publizistische Kreuz auf uns zu nehmen und das vorliegende Werk in ungezählten Stunden auf eine Festplatte zu bannen. Zum einen ist da die Faktizität, dass sich der Verfasser seit mehr als einem Vierteljahrhundert – in unterschied-
4 Vallejo (2022), 96–97, 434.
5 Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil, V. 1966–1967: «Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.»
lichen Funktionen und beruflichen Phasen – sowohl praktisch an Stadt- und Staatstheatern wie auch theoretisch an Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit dem Phänomen des antiken Theaters auseinandergesetzt hat, sich also der Faszination ‹Antikes Theater› lange Zeit nicht entziehen konnte – oder vielleicht auch wollte. Mal besser, mal schlechter gespielte dramatische Rollen, dramaturgische Stückbearbeitungen für Schauspiel und Musiktheater,6 zu Papier gebrachte Qualifizierungsarbeiten,7 zahlreiche Fachartikel und Vorträge sowie die Organisation mehrerer Tagungen und Kongresse, wie auch ein vom österreichischen FWF finanziertes mehrjähriges Forschungsprojekt, legen hier auf der Habenseite ein umfangreiches Arbeitszeugnis ab.8 Nach einer Schaffenspause zu und mit diesem Thema wie auch anderen beruflichen Verpflichtungen und Herausforderungen hat sich der Autor dieser Zeilen im Jahreswechsel 2020/21 dazu entschlossen, das viel zu lang Aufgeschobene anzugehen und aus der Vielzahl an Manuskripten, losen Blättern und Notizen sowie nicht umgesetzter Ideen, also im Grunde aus allem was sich im Laufe der Jahre zur Themenstellung in Kopf und Lade angesammelt hatte, so etwas wie eine kumulative Schrift, ein ‹Handbuch› für alle am Gegenstand Interessierte, zu erstellen.
Zum anderen gilt es mit dieser Arbeit eine Lücke zu schließen. Manch Eingeweihter würde sagen, eine offene Schuld begleichen, was sich u. a., aber nicht nur, am Widmungsträger des Buches festmachen lässt. In den vielen Jahren, während derer wir uns – vom Studenten zum Senior Scientist – akademisch mit dem schöpferischen Kreislauf des Theaters und den Dramen der Griechen und Römer beschäftigten, war stets eine Person präsent, die wie keine andere unsere Bemühungen in dieser Richtung förderte und mit nie nachlassendem Engagement zu unterstützen wusste. Wir sprechen hier von Prof. Dr. Herbert Bannert, Professor (im Ruhestand) für Klassische Philologie und langjähriger Vorstand des Instituts für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien.9 Erst durch ihn, in seinen Vorlesungen und Seminaren, lernten wir das Wesen und die Besonderheiten des antiken Theaters/Dramas als Ganzes zu erfassen und einschließender in seiner Bedeutung zu beurteilen. Er weitete nicht nur unser Verständnis für die antike Kulturgeschichte und die dramatische und lyrische Sprache der Griechen, er lehrte uns das, was man allgemein als wissenschaftliches Denken bezeichnet. Zwei kleine, oftmals viel zu salopp daher gesprochene Begriffe für einen umfassenden, im Inneren eines Studierenden wirkenden stillen Prozess, der zum Ziel hat, den eigenen, bis dato nur rudimentär ausgebildeten Geist zu weiten und die oftmals stumpfen Sinne zu schärfen, ohne, und das ist vielleicht der beherzigenswerteste Teil solch einer Transformation, die natürliche Bodenhaftung und den klaren Blick für das
6 Insbesondere an Stadt- und Staatstheatern in Österreich (u. a. Wien, Graz, Salzburg) und Deutschland (u. a. Tübingen, München, Bremen, Darmstadt).
7 Zu nennen wären hier vor allen Dingen unsere Magisterarbeit Antike Theaterszenen und ihre modernen Pendants», welche 2005 an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Fachbereich Klassische Archäologie) vorgelegt wurde, wie auch unsere interdisziplinäre Doktorarbeit an der Universität Wien (Betreuer: G. Dobesch und H. Bannert) aus den Fachbereichen Alte Geschichte und Klassische Philologie aus dem Jahre 2009, welche 2011 unter dem Titel Hinter der Maske des Feldherrn in der Reihe Paradeigmata (hg. von B. Zimmermann, K.-H. Stierle und B. Seidensticker) publiziert wurde.
8 Das Forschungsprojekt trug die interne Nummer P-24106-G21, hatte den Titel Real – Abstract – Imaginary. Greek Theatre in Performance und war zwischen 2012 und 2016 am Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien angesiedelt.
9 Zur Person von Herbert Bannerts siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Bannert [26.02.2025].
Wesentliche zu verlieren. Unser nicht gerade dürrer Erfahrungsschatz an Bildungseinrichtungen im In- und Ausland zeigt, dass nur den allerwenigsten (Hochschul-)Lehrern diese besondere Begabung zu eigen ist, und Prof. Dr. Bannert gehört, ganz ohne Frage, zur Elite dieses kleinen und noblen Kreises.
Die hier in diesem Buch versammelten und in drei Teile zusammengefassten Beobachtungen zum dramatischen Kunstwerk der Griechen stammen zumeist aus der für uns so fruchtbaren und lehrreichen Zusammenarbeit mit Herbert Bannert, welche für uns vor der Jahrtausendwende als Student der Altertumswissenschaften begann und im Grunde genommen bis in die Gegenwart reicht. Eine Zeit der lebendigen Kreativität und Aktivität, die beharrlich von Empathie, Schaffensdrang und Forschungseifer geprägt war, und wo sich auch der Humor stets seine Bahnen brechen durfte. Insbesondere Befunde aus unserer gemeinsamen FWF -Projektarbeitszeit, welche – auf der hierfür erstellten Projekthomepage – ausschließlich online der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden,10 haben an dieser Stelle, entsprechend überarbeitet, Eingang gefunden. Aber auch der ein- oder andere in Form gebrachte Vortrag wie auch von uns bereits publizierte Artikel fanden, mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber, an dieser Stelle aufs Neue editorischen Eingang. Es finden sich in diesem Buch also mehr oder minder sämtliche Resultate und Thesen substantiiert zusammengefügt, welche der Autor im Laufe seiner Beschäftigung mit dem antiken Theater/ Drama erarbeitete und großteils bis heute nur online verfügbar waren: «waren» deshalb, da die Projektwebseiten nur mehr schwer zugänglich sind und seit Jahren nicht mehr administrativ betreut werden.
Um die Fülle an Einzeluntersuchungen in ein für den Leser nachvollziehbares inhaltliches Gerüst zu setzen, wurde nicht darauf verzichtet, Bekanntes aus der Faktenlage zum antiken Theater, den Tragikern und ihren Tragödien mit in die Gesamtdarstellung hineinzunehmen, damit auch der oder die in die Thematik weniger eingelesene Person einen geschlossenen Rundumblick über das griechische Theater im 5. Jh. v. Chr. erhält. Daher könnte man diese Arbeit auch als eine aktuelle Einführung in das antike Bühnenwesen der Griechen verstehen, wobei performative Fragestellungen fast immer im Vordergrund stehen.11 Dass es im Zuge der inhaltlichen Verbindung von Bekanntem und Unbekanntem, zu Wiederholungen respektive Überschneidungen kommen musste, ließ sich nicht vermeiden, und wir bitten an dieser Stelle die Leserschaft um Nachsicht – wendet sich das Buch doch in weiten Teilen an einen Personenkreis, der wenig über das Thema weiß, wobei sicherlich auch Fachleute Interessantes darin entdecken werden.
Gemäß all dem bildet die vorliegende Monografie für den Verfasser auch einen (vorläufigen) Abschluss mit dem Gegenstand. Wie formulierte doch einst der große englische Historiker und Essayist Thomas Carlyle: «In Büchern liegt die Seele einer gewesenen Zeit.»12 Diesem schönen Zitat wollen wir mit diesem Buch Rechnung tragen. Dass diese Schrift, wie
10 Siehe dazu https://greek.theatre.univie.ac.at/home/ [26.02.2025]; auch <https://phil-kult.univie.ac.at/ en/ research/projects/aesthetic-communication/real-abstract-imaginary-greek-theatre-in-performance> [26.02.2025].
11 Die Anzahl an Einführungen zum Theater der Griechen ist groß. Zu nennen wären hier z. B. Seidensticker (2010); Wilson (2007); Moraw/Nölle (2002); Csapo/Slater (1995); Brauneck (1993), Blume (1991); Melchinger (1974); Pickard-Cambridge (1946 und 21968) oder Kindermann (1957).
12 Carlyle (1901), 225.
es die Höflichkeit und Professionalität geboten hätte, nicht schon vor einigen Jahren das literarische Licht der Welt erblickt hat, geht allein auf die mannigfaltigen beruflichen wie privaten Verpflichtungen des Autors, welche inmitten Arbeiten in luftiger Höhe und in der Tiefe, zwischen Einsätzen im In- und Ausland, akademischen Verbindlichkeiten an Universität und Schule wie auch im Felde wechselten, und infolgedessen auf seine etwas unstete und unberechenbare Existenz zurück.
Im Rahmen der gestellten Aufgabe bleibt zu hoffen, dass unsere Übung wohlwollende Zustimmung bei allen am Gegenstand Interessierten, wie auch bei Prof. Dr. Herbert Bannert findet, dem diese Schrift mit Dank und Respekt gewidmet ist. Mögen es andere ihm gleichtun.
Dass ich dies verrichte, Nehmt mich zum Chorus an für die Geschichte, Der als Prolog euch bittet um Geduld, Hört denn und richtet unser Stück mit Huld!1
Mögen Sie, Verehrungswürdige, jetzt entscheiden, ob mein Versuch nicht ganz zu verwerfen sei, –mit Zittern zieh’ ich mich zurück und das Stück wird seinen Anfang nehmen.2
1 W. Shakespeare: König Heinrich der Fünfte, übers. von A. W. v. Schlegel (aus: Shakespeare: Werke in acht Bänden, Bd. 4, 353, Prolog V. 31–34. Das Originalzitat lautet: «For the which supply, Admit me Chorus to this history; Who proloque-like your humble patience pray, Gently to hear, kindly to judge, our play.» Mehr dazu bei Craig (1993), 509.
2 Aus dem Prolog zu Der gestiefelte Kater (L. Tieck).
Das Theater der Griechen – Betrachtungen im
Die hohe Festlichkeit und alles überragende Monumentalität des griechischen Theaters, seit der Einführung der Großen Dionysien in Athen im letzten Drittel des 6. Jh. v. Chr., kann auch mit viel Vorstellungskraft von unsereins nur unzureichend erfasst werden, da es in unserer heutigen Zeit nichts Vergleichbares gibt, was diesem Ereignis – eine perfekte Mischung aus Kunst, Religion und politischem Selbstverständnis – nur annähernd nahekommt. Selbst gegenwärtige, vom Staat hoch subventionierte Veranstaltungen ähnlichen Couleurs lassen nicht einmal im Ansatz erahnen, was sich in den Tagen zwischen dem 8. und 14. Elaphebolion (Ἐλαφηβολιών – im gregorianisch-julianischen Kalender entspricht ihm ungefähr der Monat März/April)1 Jahr für Jahr bei den Feierlichkeiten in Athen in klassischer und hellenistischer Zeit, im besten Sinne des Wortes, abgespielt hat: Von Sonnenaufgang bis -untergang religiöse und politische Prozessionen, dramatisch-musikalische Aufführungen, monetäre und symbolische Ehrungen an verdiente Bürger, Gleichgestellte und geladene Gäste, wie auch die öffentliche Zurschaustellung des staatlichen Vermögens vor der Mehrzahl der männlichen Bürgerschaft. All dies im Namen des Gottes Dionysos und die aktive Beteiligung vieler hundert athenischer Knaben und Männer machen deutlich, dass wir es hier weit mehr als nur mit Theater (obwohl das Theaterspiel den gewichtigsten Teil der Festlichkeiten ausmachte) zu tun haben, sondern mit einer machtvollen Demonstration, die Freunden wie Feinden der Athener unmissverständlich von Augen führen sollte, wer die kulturelle, politische und wirtschaftlich führende Autorität in der Region – und darüber hinaus – ist. Noch deutlicher wird dieser Tatbestand, wenn man sich vor Augen führt, dass in den Jahren des Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.), also der Auseinandersetzung um die Vormachtstellung in der Ägäis und Festlandgriechenland zwischen dem Attischen Seebund (Athen) und dem Peloponnesischen Bundes (Sparta),2 welcher final tragisch mit der Kapitulation Athens endete und den selbstbewussten Stadtstaat an den Rand des Kollaps brachte, die athenische Führungselite keinesfalls dazu bereit war, auf die personell aufwendigen und kostspieligen Feierlichkeiten zu verzichten, also selbst im Angesicht der Niederlage (wenn auch gegen Ende des Konflikts in reduzierter Form), an seinen Theaterwettbewerben festhielt.3 Diese für Athen – schon in
1 Im attischen Kalender war Elaphebolion der neunte Monat des Jahres. Der Name wird auf ein in diesem Monat verrichtetes Opferfest für Artemis zurückgeführt. Siehe dazu IG IX, 1, 90.
2 Zur Geschichte des Peloponnesischen Krieg siehe die Gesamtdarstellungen von Schulz (2005), Bleckmann (1998 und 2007) oder Will (2019). Das aussagekräftigste Bild zum Peloponnesischen Krieg vermittelt nach wie vor die Lektüre des Thukydides. In Übersetzung zu empfehlen jene von Vretska/Rinner (2004).
3 Siehe dazu die Argumente bei Pickard-Cambridge (21968), 66 und 83 und die Ausführungen bei Kindermann (1957), 28. Vgl. dazu auch die Verse bei Aristoph. Ach. 40 und Av. 785 f. und 1499. Gegen einen reduzierten Spielplan argumentiert Luppe (1972), 53–75.
der Auseinandersetzung mit den Persern – typische Sturheit und Konsequenz, welche man mit «Lieber Krieg als Abkehr von einem geheiligten Recht» beschreiben könnte, ging sogar so weit, dass es Theatermachern wie Sophokles oder Euripides gelang, in dieser für Athen wirtschaftlich und politisch äußerst schwierigen Phase mit Tragödien wie Medea, Elektra, Philoktet oder einer Iphigenie in Aulis eine Hochblüte, einen Kulturaufstieg und eine neue dramatische und literarische Qualität an Dramen ihrem Publikum zu präsentieren;4 man durfte also schon vor 2500 Jahren die spannende Erfahrung machen, dass Krisen sich durchaus positiv auf die Schöpfungskraft auswirken können.5
Um die Kraft des antiken Bühnenwesens, die Außenwirkung des griechischen Theaterspiels in all seinen technischen und künstlerischen Facetten heute möglichst authentisch erfassen zu können, ist es in methodischer Hinsicht notwendig, den komplexen und mit vielen Unsicherheiten gepflasterten Weg der Rekonstruktion, als Mittel zur Wiedergewinnung des historisch Vergangenen, zu beschreiten.6 Bestehende Rekonstruktionsversuche zum antiken Theaterwesen und deren Spiel beruhen fast ausnahmslos auf den wissenschaftlichen Disziplinen von Archäologie und Philologie sowie ihrem mitunter engem Verständnis zu Begrifflichkeiten wie Theater oder Theatralität, welche zwangsläufig für eine umfassende und ganzheitliche rekonstruktive Betrachtungsweise kaum ausreichen. Zwar versucht die Archäologie, insbesondere aber die Philologie, sich immer wieder szenischen Fragen zu nähern, und sie weisen in der Betrachtung des Gegenstands somit über ihren eigenen Forschungsbereich hinaus, doch bleiben die gefundenen Erkenntnisse, aufgrund ihrer fachlich bedingten Untersuchungsmethodik und der fast schon natürlichen Ermangelung an theaterpraktischer Erfahrung, allzu oft in grauer Theorie stecken. Zu dieser einseitig literarischen Betrachtung bei der Erforschung des antiken Theaters hat nicht zuletzt beigetragen, dass die uns überlieferten Dramentexte die lückenlosesten und sichersten Quellen sind, welche in der Regel dem Fach der Klassischen Philologie zugeordnet werden. Dennoch ist das gesicherte Material über die Bühne und das Theater des 5. Jh. v. Chr. ärgerlich gering. Es setzt sich aus heterogenen Bereichen zusammen, aus wenigen Befunden, Nachrichten und aus der Evidenz der Stücke. Jeder dürre Versuch, plausible Schlüsse daraus zu ziehen, ist zwangsläufig auf Konjekturen angewiesen. Daher ist es beim Rekonstruieren – und hierbei ist es völlig egal um welche Form der Rekonstruktion es sich handelt – unabdingbar, sich nicht nur an allen erhaltenen Quellen und Hinterlassenschaften (und seien dies auch nur Indizien) zu orientieren, sondern auch die Herangehensweise der am Gegenstand involvierten Nachbardisziplinen aus Theaterwissenschaft und den darstellenden Künsten mit einzubeziehen. Nur wenn man sämtliche Arbeitsgebiete aus Praxis und Theorie, alles zwischen gesicherten Fakten und wagen Annahmen, kausal mit in die Fragestellung der Nachbildung hineinnimmt, lässt sich – gerade in Bezug auf das verflochtene Wesen des Theaters – so etwas wie eine sinnvolle und sinnliche Erzählung einer Ereignisabfolge erzielen. Trotzdem darf dabei nicht vergessen werden, unabhängig
4 So kritisierte z. B. Plut. Mor. 263D–351B (De gloria Ath. 6) den unnötigen und weitschweifigen Prunk bei den Dionysien, und dass die Athener für ihre dramatischen Aufführungen mehr Geld ausgeben als für den ganzen Peloponnesischen Krieg.
5 Siehe dazu Kindermann (1957), 25; Allen (1999–2000), 145–156; Mastronarde (2010); Hanink (2014), 319–346.
6 Der Vorgang der Rekonstruktion beschreibt sowohl den physischen Vorgang als auch das Endergebnis einer Wiederherstellung.