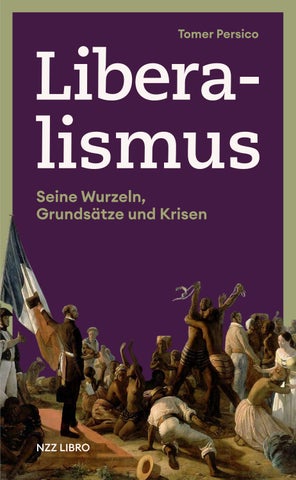Tomer Persico
Liberalismus
Seine Wurzeln,
Grundsätze und Krisen

Tomer Persico
Liberalismus
Seine Wurzeln, Grundsätze und Krisen
Publiziert mit freundlicher Unterstützung der FriedrichNaumann-Stiftung für die Freiheit
Der Verlag NZZ Libro wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2025 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Coverabbildung: Proklamation der Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien, 27. April 1848 von François-Auguste Biard
Covergestaltung:icona basel gmbh, Basel
Korrektorat:Thomas Lüttenberg, München
Satz:3w+p, Rimpar
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza Printed in Germany
Herstellerinformation:Schwabe Verlagsgruppe AG, NZZ Libro, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch
Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Print 978-3-03980-035-3
ISBN E-Book 978-3-03980-036-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG
Gegner der liberalen Ordnung: Populismus und Identitätspolitik ..
Liberalismus in der Krise und der Aufstieg des Populismus .... ...
Die Krise des Liberalismus und der Sozialstaat ..
Israel und die Krise des Liberalismus
Nachwort:Der Weg nach vorn
Im Juli 2014, vier Jahre nach seiner Wiederwahl zum ungarischen Ministerpräsidenten, präsentierte Viktor Orban seine Staatsvision in einer Grundsatzrede. «Liberale Werte», erklärte er, seien unerwünscht. Sie korrumpieren die Moral, führen zu sexueller Promiskuität und schaffen eine Oligarchie der Milliardäre sowie eine Haltung der Gleichgültigkeit gegenüber den Nöten der «weissen Arbeiterklasse». Unter seiner Führung, so Orban, werde Ungarn dem Liberalismus den Rücken kehren und sich in ein «nicht-liberales Land»verwandeln, das sich nicht nur um die Rechte des Einzelnen, sondern auch um die Bedürfnisse der Gemeinschaft und der Nation kümmert. Er betonte mit Nachdruck die Notwendigkeit, sich von den liberalen Grundsätzen zur Organisation der Gesellschaft sowie von der liberalen Weltsicht zu lösen.
Was meint Orban, wenn er von «liberalen Grundsätzen» und einer «liberalen Weltsicht»spricht?Und weshalb will er ihnen den Rücken kehren?Mittlerweile ist es ihm in der Tat gelungen, nicht nur «liberalen Grundsätzen», sondern auch der ungarischen Demokratie vollumfänglich den Rücken zu kehren. Die in Orbans Worten zum Ausdruck gebrachte Kritik ist demnach durchaus ernst zu nehmen.
Mit diesem kurzen, prägnanten Buch möchte ich versuchen, diese Fragen umfassend zu beantworten. Neben der Klärung des Begriffs «Liberalismus», werde ich auf dessen Wurzeln eingehen und der Frage nachspüren, weshalb die liberale
Ordnung in einer Krise steckt. Auf dieser kurzen Lesereise werde ich meinen Leserinnen und Lesern Instrumente an die Hand geben, die sie dazu befähigen, reflektiert über liberale Ordnungen nachzudenken und sich für deren Erhalt oder Verbesserung einzusetzen. Liberale Ordnungen sind zu einer politischen Selbstverständlichkeit geworden und doch –oder vielleicht gerade deshalb –ist ihr Weiterbestehen in den kommenden einhundert Jahren mehr denn je bedroht.
Das gilt übrigens nicht nur für Ungarn. Der Liberalismus wird im Namen der Religion, des Nationalismus, benachteiligter Gruppen und sogar im Namen des Volkes angegriffen. Manchmal steckt in solchen Argumentationsweisen ein Körnchen Wahrheit, allerdings sind die angebotenen Alternativen nicht besser. Unter der Zerstörung der liberalen Ordnung werden wir alle leiden, allen voran Minderheiten und marginalisierte Bevölkerungsgruppen.
Diese Entwicklung wird von einem interessanten Phänomen begleitet. Diejenigen, die die liberale Ordnung und ihre Grundsätze bekämpfen, haben diese längst verinnerlicht. Viele heutige Konservative sind eigentlich liberal. Sie halten das Banner der freien Marktwirtschaft und individueller Freiheiten hoch und unterscheiden sich somit deutlich von den Konservativen des 19. Jahrhunderts, die Monarchisten oder Anhänger von Theokratien waren, und erst recht von den Anhängern des Faschismus des 20. Jahrhunderts. Die Behauptung, dass nicht alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, ist heute tabu. Wer die Diskriminierung von Frauen oder religiösen Zwang für legitim hält, wird bei allen, die nicht am extremen politischen oder religiösen Rand stehen, auf Abscheu stossen. Es gibt mehrere gewichtige Gründe dafür, dass der Liberalismus heute ein weit verbreiteter und ganz selbstverständlicher Teil der Realität ist. Er hat die Herzen der Menschen nicht erobert, weil er zutreffender, interessanter oder verständ-
licher ist als andere Weltanschauungen. Wir leben heute in einem liberalen Zeitalter, weil sich unser über Jahrtausende gewachsenes Selbstverständnis politisch in einen liberalen öffentlichen Raum übersetzt hat. Die Art und Weise, wie wir uns Menschen sehen, hat die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen nachhaltig geprägt. Die Auffassung des Menschen als ein autonomes Wesen hat die liberale Ordnung zu einer nahezu unausweichlichen Wahl gemacht.
Für das moderne Subjekt, das aus der sich in Europa und Nordamerika entwickelnden hellenistisch-jüdisch-christlichen Tradition hervorgegangen ist, stellt Freiheit ein wichtiges Ideal dar. Freiheit bedeutet Autonomie. Wir verstehen uns selbst als gleichwertig mit anderen Menschen und halten es für unser natürliches Recht, über uns selbst und unser Eigentum frei zu verfügen. Daraus ergibt sich die Forderung, auf persönlicher Ebene sowohl frei von staatlicher Einmischung, als auch frei von der Beeinflussung durch andere zu sein. Wenn nun viele Menschen mit einem solchen Selbstverständnis zusammenkommen, bilden sie gemeinsam eine liberale öffentliche Sphäre. Zumindest versuchen sie es, muss man angesichts der Krise liberaler Ordnungen wohl einräumen.
Menschen sind jedoch keine eindimensionalen Wesen und der Liberalismus befriedigt nicht alle menschlichen Bedürfnisse. Man könnte sogar argumentieren, dass sich seine Schwächen gerade jetzt zeigen, weil die liberale Ordnung einen so triumphalen Sieg errungen hat. Paradoxerweise liegt die Schwachstelle des Liberalismus also ausgerechnet in seinem Siegeszug zur im Westen vorherrschenden Ideologie. Eine Rettung des Liberalismus setzt die Kenntnis dieser Schwächen voraus. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns der Stärken des Liberalismus bewusst sind, uns jedoch auch seine Schwächen eingestehen.
Ich beginne meine Erkundung mit der Erklärung des Begriffs Liberalismus. Wo ist der Liberalismus entstanden?Wie konnte er einen so weitreichenden Einfluss erlangen?Woliegen seine Schwächen, die Populismus und Fundamentalismus wachsen lassen?Gegen Ende des Buches werde ich den Blick nach innen richten und die Situation in Israel analysieren, um dann im Nachwort mögliche Wege in die Zukunft zu skizzieren.
Es ist unsere Sicht auf den Menschen, also die Antwort auf die Frage, was der Mensch ist, die die Reihenfolge der Themen bestimmt. Ausgangspunkt ist der Mensch als intelligentes, erzählendes Wesen, das nach Autonomie und Entscheidungsfreiheit strebt und gleichzeitig nach seiner Identität sowie einem Narrativ sucht, das ihn einbezieht, um sich auf der historischen Zeitachse und im moralischen Raum zu verorten. Ich werde darlegen, dass die Freiheit, die der Liberalismus dem Individuum bei der Gestaltung seiner Identität einräumt, mittlerweile einen kritischen Punkt der Erosion erreicht hat –einen Zusammenbruch, der antiliberalen Phänomenen zunehmend Auftrieb verleiht. Darüber hinaus werde ich mögliche Wege aufzeigen, wie sich diese Krise abmildern lässt und welche Schritte zu ihrer Überwindung unternommen werden können.
Ich möchte mich von ganzem Herzen beim Shalom Hartman Institut bedanken, meiner intellektuellen Heimat, die mich in meiner gesamten Arbeit unterstützt und inspiriert.
Ausserdem danke ich dem Rubinstein Center for Constitutional Challenges an der Reichman University, das die hebräische Originalausgabe dieses Buches ermöglicht hat, und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die die Veröffentlichung des vorliegenden Bandes durch eine grosszügige finanzielle Förderung ermöglicht hat.
Liberalismus –eine Definition
Es wird viel über Liberalismus geredet, ohne dass immer klar ist, was damit gemeint ist. Was genau ist also Liberalismus?
Liberalismus ist eine politische Einstellung, die davon ausgeht, dass es bestimmte Lebensbereiche gibt, die die Freiheit des Einzelnen ermöglichen und besonderen Schutz verdienen (Rechte). Der Liberalismus geht davon aus, dass alle Menschen grundsätzlich gleich sind und gleiche Rechte besitzen. Dementsprechend hängt die Regierung von der Zustimmung der Regierten ab und ihre Macht ist so begrenzt, dass sie deren Rechte nicht unterdrücken kann.
Anders ausgedrückt, regelt der Liberalismus die Beziehungen zwischen Einzelpersonen, Gesellschaft und Regierung, basierend auf Grundwerten wie Individualismus, Freiheit und Gleichheit. Der Liberalismus bietet einen politischen und gesellschaftlichen Rahmen, in dem jeder Mensch, jedes Individuum, gewisse Freiheiten geniesst. Menschen können sich anhand eigener Entscheidungen verwirklichen. Die Legitimität einer Regierung hängt von der Wahrung dieser Freiheiten und Grundprinzipien ab oder, anders ausgedrückt, vom Schutz der Bürgerrechte.
Aber was sind Rechte?Eine Person mit einem bestimmten Recht ist nicht einfach eine Person, die etwas tun darf. Rechte haben die Macht, die Realität zu gestalten. Die Kraft des Gebotes. Sie haben die Macht, von Anderen oder der Re-
gierung ein bestimmtes Verhalten zu verlangen oder sie aufzufordern, eine bestimmte Handlung zu unterlassen.
So ermöglicht das Recht auf Eigentum dem Einzelnen nicht nur, Besitz zu haben, sondern verbietet anderen Individuen und der Regierung, ihm diesen Besitz ohne gerechtfertigten Grund zu nehmen. Rechte legen also im Voraus fest, was der Einzelne tun darf und zu unterlassen hat. Gleichzeitig verlangen sie von allen anderen und jeder staatlichen Einrichtung, dem Einzelnen die Ausübung seiner Rechte auch zu ermöglichen und alles zu vermeiden, was ihn daran hindern könnte, von diesen Rechten Gebrauch zu machen.
Allerdings sind Rechte keineswegs der Trumpf, der alle anderen Beweggründe aussticht. Kein Recht ist absolut. So erlaubt mir etwa mein Recht auf Religionsfreiheit nicht, Menschen zu steinigen, die den Sabbat nicht heiligen. Und Ihr Recht auf Bewegungsfreiheit bedeutet nicht, dass Sie Museen auch ausserhalb der Öffnungszeiten betreten dürfen. Allerdings haben Rechte einen besonderen Status. Sie betreffen Bereiche unseres Lebens, die ganz wesentlich mit unserer Selbstwahrnehmung zusammenhängen:die Selbstbestimmung über unseren Körper und unseren Besitz, unsere Autonomie, unsere Würde und unsere Identität. Sie sind so etwas wie ein Warnschild, das anderen und der Regierung zeigt, welche Bereiche zu respektieren sind. Es gibt also eine Verknüpfung zwischen der Würde des Menschen und seiner Freiheit.
Die liberale Ordnung basiert auf einigen Grundannahmen:
1. Der Mensch ist ein Individuum, ein intelligentes und autonomes Subjekt.
2. Alle Menschen sind grundsätzlich gleich.
3. Die normative Forderung, die Autonomie jedes Menschen zu respektieren, bildet den Kern seiner Freiheit.
4. Diese Autonomie ist in diverse Rechte unterteilt (das Recht auf Eigentum, das Recht auf Meinungs- und Gewissensfreiheit etc.).
5. Zwischen dem öffentlichen Bereich mit seinen Institutionen und dem privaten Bereich wird klar getrennt.
6. Es gilt Rechtsstaatlichkeit, also die Vorherrschaft des Gesetzes und die Gleichheit vor dem Gesetz.
7. Es gibt einen politischen Rahmen, in dem diese Rechte durch Regierungsinstitutionen verwirklicht werden und in dem die Legitimität der Regierung von der Wahrung dieser Rechte abhängig ist.
Eine liberale Regierung unterliegt grundsätzlich dem Gesetz. Das Gesetz, das den Schutz der Rechte seiner Bürger gewährleisten muss, wird von Volksvertretern erlassen, die als Bevollmächtigte der Bürger fungieren. Zum Rechtsstaatsprinzip gehört, dass die Rechtsordnung vom Willen der Regierenden unabhängig ist. Die Führung des Staates erfolgt auf Grundlage von Gesetzen und richtet sich nicht nach dem Willen einzelner Personen. Sie basiert auf einem System und nicht auf Willkür.
Da die Konzentration von Macht in den Händen einer Gewalt eine potenzielle Gefahr für die politischen Freiheiten der Bürger und die Rechte des Einzelnen darstellt, wurde das Prinzip der Gewaltenteilung eingeführt. Die Dezentralisierung administrativer Aufgaben spiegelt sich in der berühmten Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative in liberalen Regierungssystemen wider. Das Justizsystem ist dabei für die Aufrechterhaltung der Verfassungsmässigkeit der Regierung verantwortlich und gewährleistet dadurch die Rechte von Einzelpersonen und Minderheiten.
Diese Prinzipien kommen in liberalen Gesellschaften auf der ganzen Welt zum Tragen. Sie bilden die Grundlage des klassischen Liberalismus. Doch es gibt nicht den einen Libera13
lismus. Seine Elemente können in unterschiedlichen Formen auftreten und mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Bestimmte Formen des Liberalismus verstehen Rechte nicht als universelle, zeitlose Eigenschaften des Menschen, sondern als Privilegien, die aus der lokalen Geschichte oder einer spezifischen politischen Tradition hervorgehen –eine Auffassung, die gemeinhin als konservativ gilt. Andere Formen versuchen, den starken Fokus auf das Individuum auszugleichen, indem sie das tiefe Bedürfnis nach gemeinschaftlichen Institutionen und kollektiver Identität betonen (kommunaler Liberalismus) oder die Förderung von Toleranz gegenüber anderen kollektiven Identitäten unterstreichen (multikultureller Liberalismus). All diese Ausprägungen haben eines gemeinsam:Sie schmälern den universellen Status von Menschenrechten und betonen bestimmte (kulturelle, gesellschaftliche, politische)Dimensionen. Diese unterschiedlichen Ausprägungen (eshandelt sich bei den hier genannten keineswegs um alle Formen des Liberalismus)versuchen, den Prinzipien des klassischen Liberalismus entgegenzuwirken und seine Schwächen auszugleichen –Schwächen, auf die ich noch eingehen werde.
Liberalismus in der Praxis
Wie manifestieren sich liberale Prinzipien in der Praxis?Die Verwirklichung dieser Prinzipien in einem funktionierenden politischen System lässt sich aus dem zweiten Absatz der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten –der ersten liberalen Demokratie –von 1776 erschliessen:
«Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich:dass alle Menschen gleich geschaffen sind;dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmässige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten; dass, wenn irgendeine Regierungsform sich für diese Zwecke als schädlich erweist, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solchen Grundsätzen aufgebaut wird […]»
Diese Abfolge historischer Sätze beginnt mit dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, nennt dann einige unantastbare Rechte, die alle Menschen besitzen, und anschliessend den Grund, weshalb Menschen Regierungen (d.h.Staaten)gründen:nämlich, um genau diese Rechte zu garantieren. Diese neuen Regierungen leiten die Rechtmässigkeit ihrer Befugnisse von der Zustimmung derer ab, die sie gewählt haben, also der Bürger.
Das bedeutet, dass Menschenrechte Vorrang vor Regeln und Vorschriften haben –auch vor solchen, die die Regierung erlässt. Regierungen sind ein Mechanismus zum Schutz von Rechten. Sie legen keine Rechte fest. Es gibt keine liberale Regierung, so die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die ohne Zustimmung der Bevölkerung existiert. Somit verliert jede Regierung, die ohne Zustimmung der Bevölkerung regiert, ihre Legitimität. Regierungen erhalten ihre Befugnis von der Bevölkerung und nicht, wie in der Antike üblich, von Gott. Auch die nächsten Sätze folgen derselben Logik. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika gibt Bürgern das Recht, Regierungen abzuschaffen, wenn sie den Schutz von Menschenrechten vernachlässigen oder wenn sie, Gott behüte, selbst morden. Sie gewährt Bürgern das Recht, eine neue Regierung zu bilden, die für den Schutz ihrer Rechte eintritt.
Das Aufkommen des Liberalismus im 17. und 18. Jahrhundert hat zu einer Transformation des Konzepts weltlicher Regierungen geführt. Nicht der König herrscht durch Gottes Gnade oder göttliche Bestimmung, sondern ein gewählter Vertreter der Bevölkerung regiert auf der Basis einer Mehrheitsentscheidung –und damit auf Basis der Autorität des Volkes.
Ohne diese Revolution des Regierungskonzepts wäre ein liberales Regierungskonzept nicht denkbar. Bisherige Konzepte sahen einen von Gott gesalbten Monarchen vor, dessen Macht durch nichts eingeschränkt war.
Die gleichen liberalen Prinzipien sind in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 zu finden, die wenige Jahre nach der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in Frankreich von der französischen Nationalversammlung verkündet wurde. Im Folgenden zitiere ich ihre beiden ersten Absätze: