Thomas Borer
René Lüchinger
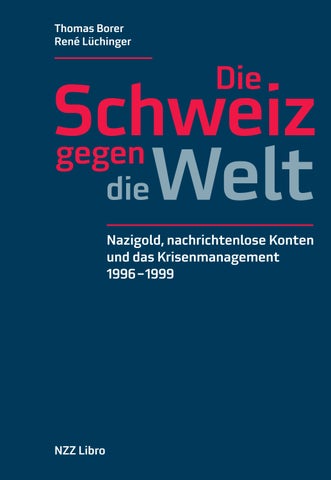
Thomas Borer
René Lüchinger
Nazigold, nachrichtenlose Konten und das Krisenmanagement 1996 – 1999
Thomas Borer, René Lüchinger
Nazigold, nachrichtenlose Konten und das Krisenmanagement 1996–1999
Der Verlag NZZ Libro wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2025 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche
Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Covergestaltung:icona basel gmbH, Basel
Abbildung Cover:Keystone, Foto:Alessandro della Valle
Korrektorat:Anna Ertel, Göttingen
Layout:icona basel gmbH, Basel
Satz:3w+p GmbH, Rimpar
Druck:Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Printed in Germany
Herstellerinformation:Schwabe Verlagsgruppe AG, NZZ Libro, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Print 978-3-03980-025-4
ISBN E-Book 978-3-03980-026-1
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Vorwort
1943–1996
Ein Gewitter braut sich zusammen
23. Oktober 1996
Der Anruf und ein Job fur30Monate
Winter 1996
«Hardball», «Softball»und ein Treffen mit Paul Volcker
Fruhjahr 1997
Die grosse Eskalation und ein Nachtwächter namens Meili
7. Mai 1997
Pauschale Anwurfe aus den USA und Backlash in der Schweiz .. .
Dezember 1997
Die Wende an der Goldkonferenz in London 189
Erstes Halbjahr 1998
Ein bundesrätlicher Fettnapf und amerikanische Doppelzüngigkeit
Winter 1998/99
Die Globallösung und ein Gipfeltreffen in Davos
von Thomas Borer
Vorder Jahrtausendwende steht die Schweizvor ihrer grössten aussenpolitischen Krise seit dem Ende des ZweitenWeltkriegs. Und es ist ebendieses Verhalten der Eidgenossenschaft vor, währendund nachdem ZweitenWeltkrieg, das Gegenstand der Auseinandersetzung wird.Vor allem die jüdischen Stimmenaus einer vergangenenZeit, die wir Schweizer für abgeschlossen hielten, stellenFragen und Forderungen, die nach einer Ergänzung, ja einer Änderung unseres Geschichtsbildes rufen. Die Forderungen der jüdischen Opfer, von denen wir annahmen, dass sie in den Jahren nach dem Krieg bereitserfülltworden seien, richten sich zunächstandie Banken unseres Landes.Esgeht um nachrichtenlose Vermögen, die von Verfolgten des Dritten Reiches als Auslandsgelder in der Schweiz deponiert worden waren und nicht mehr abgeholt wurden, weil die Depositäre Krieg und Konzentrationslager nichtüberlebthatten. Die Diskussiondreht sich um die Fragen, wie viele derartige Gelder noch bei den Banken liegen, was ihr Schicksalwar und, falls nochvorhanden,inskünftig sein soll –und warum diese Fragen nicht alle schon längst abschliessend geklärt sind.Ineinerzweiten Bewegung rücken dann andere Vermögenswerte in den Blick Versicherungspolicen, Schmuck, Diamanten,Gemälde. Die Fantasien werden aberamstärksten vom Gold beflügelt. Zum einen geht es dabei um das Gold, das die Deutsche Reichsbank gegen Schweizer Franken oder Warenlieferungen an unsere Nationalbank verkaufthatte. Dabeihandelt es sich zu einem grossen Teilum Gold, das die Nationalsozialisten den Zentralbanken der eroberten Länder abgenommenhatten, also sogenanntes Raubgold.Moralisch viel heikler ist jedoch das «Totengold», das von den Nationalsozialisten im Rahmen ihres schrecklichen Genozids erbeutet worden war;Zahnplomben und Eheringe, die in den Vernichtungslagern systematisch gesammelt wurden. In einem drittenSchritt kommt «Naziraubgut»hinzu, das heisstdie Vermögenswerte, die von Funktionären des DrittenReiches während des Krieges in die Schweiztransferiert worden waren, sei es als geheimerKriegsschatzfür eine
mögliche Wiederaufrüstung Deutschlands, sei es zur persönlichen Bereicherung. In weiteren Schüben erfolgteine Reaktivierung zusätzlicherThemen, etwa der gesamte Aussenhandel der Schweiz jener Jahre, unser Finanzplatz, unsere Neutralitätspolitik und vor allem auch unsereFlüchtlingspolitik.
Letztlich steht unsere ganze Geschichtevor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg international zur Debatte.
Der scheinbar anachronistische Ruf nach Gerechtigkeit stört das Bild, das etliche Schweizer sich von unserem Land im Zweiten Weltkrieg geschaffen hatten. Er stellt unser Geschichtsverständnis infrage und erweckt in uns den Eindruck, auf der Anklagebank zu sitzen. Er ruft heftige Abwehrreflexe hervor, umso mehr als dieser Ruf nach Gerechtigkeit mitunter in aggressivster Form, gleichsam als undifferenzierter Angriff auf unser ganzes Land und Volk erfolgt und dabei oft Anschuldigungen mit aus dem Zusammenhang gerissenen Halbwahrheiten scheinbar «bewiesen»werden. Die Debatte um historische Sachverhalte ist keine akademische Diskussion. Vielmehr werden ausgehend von tatsächlichen oder behaupteten Fakten Forderungen nach konkreten Handlungen erhoben, und gegenüber Privaten, Unternehmen und dem Staat wird Macht ausgeübt, um vor allem finanzielle Kompensationen in Milliardenhöhe zu erhalten.
Wir müssen feststellen, dass die Schweiz überhaupt nicht auf diese Auseinandersetzung vorbereitet ist. Dies mag wenig verwunderlich sein für ein Land, das seit vielen Generationen von den grossen geschichtlichen Strömungen nicht oder nur am Rande und verspätet erfasst wurde. Es stellt sich aber heraus, dass wir hier keinen weiteren Fall einer eidgenössischen Verspätung haben, sondern dass die Schweiz erst am Beginn einer wichtigen Entwicklung steht. Auf jeden Fall lässt sich in der Vergangenheit kein Zeitpunkt finden, zu dem die Geschichte der Schweiz derart im Mittelpunkt der Innen- und Aussenpolitik stand, wie dies seit 1996 der Fall ist. Zur Bewältigung der Krisewird –leider verspätet –vom Bundesrat die Task Force «Schweiz –Zweiter Weltkrieg»geschaffen, zu deren Leiter ich ernannt werde.OhneInfrastruktur und Vorbereitungmüsseneinige wenige Diplomaten in eine Auseinandersetzung eingreifen, die durch viele Besonderheiten geprägt ist. Normalerweise sind aktuelle und zukünftige Herausforderungen Gegenstand der Aussenpolitik;hier sind es historische Fakten und Wahrnehmungen. Üblicherweise ist Aktualität der entscheidende Faktor für Medien;hier sind es längst vergangene Sachverhalte. Zu-
dem erfährtdie Schweiz zum ersten Mal umfassend, wie internationale Medien als «Transmissionsriemen»zur Druckausübung ausgenutzt werden können. Ferner sind unsere Ansprechpartner nicht nur Regierungen, vor allemjene der USA und Israels, sondern auchNGOs, einzelne Parlamentarier und Lokalpolitiker sowieRechtsanwälte. Diese Akteure folgen keinen diplomatischen Regeln, sondern sind stattdessen oft aggressiv, polemisch und unberechenbar. Sie bedienen sich unkonventioneller Methoden, wie Sanktionsdrohungen oder Sammelklagen. Schliesslich besteht ein grosser verwaltungsinterner und innenpolitischer Koordinationsbedarf.Der Bundesrat kann seine Strategie nicht eigenständig bestimmen. Er ist gezwungen, sich mit Parlament,Nationalbank, privaten Banken, Versicherungen und Wirtschaft sowie Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, insbesondere der jüdischen Gemeinschaft, eng auszutauschen. Kurzum, wir haben es mit einer neuen Formeiner Gesamtkrise zu tun.
Bekanntlich hat die Eidgenossenschaft grösste Mühe, komplexe Krisen vorherzusehen und zu bewältigen. Im vorliegenden Fall treten diese Schwächen frappant und augenscheinlich zutage. Daher ist diese Darlegung interessant für alle, die sich für Aussenpolitik oder Krisenmanagement interessieren. Wie fast jede Krise wäre die hier beschriebene Auseinandersetzung durch einige, wenig kostspielige Massnahmen, die rechtzeitig hätten ergriffen werden müssen, zu verhindern gewesen. Stattdessen verlässt sich die Regierung zu lange darauf, dass die weltgewandten und selbstsicheren Bankiers ihr Problem adäquat lösen werden. Nachdem der Bundesrat die Führung übernommen hat, begehen er und andere Akteure unnötige, aber umso schwerere Fehler. Dadurch wird die Krise verlängert und hinterlässt insbesondere in unserem bilateralen Verhältnis zu den USA und Israel tiefe Spuren. Innenpolitisch verunmöglicht sie die Jahrhundertidee einer Solidaritätsstiftung und befördert den Aufstieg der SVP weiter. Es ist die Geschichte einer schweren Druckausübung auf die Schweiz. Dass diese auch über jüdische Organisationen erfolgt, ist eher zweitrangig. Im Vordergrund steht der Umstand, dass der gewaltige Druck aus den USA kommt. Wie man damit erfolgreich umgehen soll, haben wir leider nicht gelernt. Zwar ist nach der Krise bekanntlich vor der Krise;man sollte aus schmerzlichen Erfahrungen Lehren ziehen. Aber in diesem Fall tun dies Bundesrat und Banken in unzureichendem Masse –zum Schaden der Schweiz. Daher sind wir dazu verurteilt, in späteren Krisen Ähnliches zu
erleben. Dieses Buch soll eine Anleitung sein, wie Derartiges abläuft, und Hinweise geben, wie man damit in Zukunft umgehen sollte.
Das vorliegende Thema wurde schon von Autoren aus dem In- und Auslandbehandelt. Im Gegensatz zu anderenAutoren, die über diese Auseinandersetzung geschrieben haben, hatte ich das Privileg, 30 Monatelang mitten im Geschehen gestanden zu haben. Da uns in der Task Force von Anfang an die Bedeutung unserer Tätigkeitklar war, haben wir nicht nur Wichtiges dokumentiert, sondern über praktisch jedes Gespräch, jeden Telefonanruf, jede zufällige oder geplante Begegnung, jeden Gedankenaustausch, jeden Meinungsunterschied, viele Umstände, die normalerweise keine Spuren in den Archiven hinterlassen, eineschriftliche Notizverfasst. Dazu motiviert wurden wir insbesondere durch den Umstand, dass wir schon gleich nach Beginn meinerTätigkeit im Oktober 1996 feststellen mussten, dass einigeGesprächspartner mitunter dazu neigten, vertrauliche Gespräche bei Bedarf öffentlich verzerrt oder gar falsch wiederzugeben. Daherhatte ich bei fast allen Gesprächen immer einen«Zeugen»dabei. So ist die Tätigkeitder Task Force wohlbesserdokumentiert als das meiste staatliche Handeln. Ich muss mich nicht wie andereAutoren auf allgemein zugängliche Quellen oder subjektive Interviews stützen. Vielmehrkann ich das Denken und Handelnder damaligen Akteure mit unzähligen Gesprächsnotizen, Berichten, Telexen, Konzepten, Gedankenspielen untermauern, die meist von einem Kollegen oder mir erstellt wurdenund die anderen Autoren noch nicht zugänglich sind. Auf andere Quellen, die bereits öffentlich sind, wie insbesondereMedienberichte, Debatten in Parlamenten, Veröffentlichungen von Historikerkommissionen,gehe ich nur ein, um meine Darlegungen zu ergänzen oder zu illustrieren.
Die Mehrheit der Aufzeichnungen der Task Force liegt im Bundesarchiv und wartet auf ihre Bearbeitung und Veröffentlichung. Aus Rücksicht auf die Schutzfrist von 30 Jahren, die für Bundesakten gilt, veröffentliche ich meine Einschätzung erst kurz vor deren Ablauf. Dies hat zudem den Vorteil, dass ich objektiver und mit mehr Distanz auf jene so zentralen Jahre zurückblicken kann. Natürlich war und bin ich bis heute in dieser Sache parteiisch Unsere Aufgabe bestand darin, die Interessen der Eidgenossenschaft zu wahren, nichts weniger, nichts mehr. Zwar bemühe ich mich um Objektivität und stütze mich auf schriftliche Festlegungen aus jener Zeit, aber meine Einschätzung wird wohl subjektiv gefärbt bleiben.
Unbestritten ist aber, dass die Erfahrungen aus der Auseinandersetzung um nachrichtenloseVermögen und Nazigold aus den 1990er Jahren im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts wieder erhöhte Aktualität erhalten haben –seit Putinund Trump die Agenda der globalen Politik beherrschen, heisstes, eine bislang geltende regelbasierte Ordnung sei nun ausser Kraft gesetzt. Es mag zeitgeschichtliche Phasen gegeben haben, in denen Völkerrechtund «Soft Law» in grösseren Teilen der Welt Gültigkeit besessen haben. Grossmächte jedoch, auch die demokratischen USA, setzen immerwieder kompromisslos das Recht des Stärkeren durch –auch nach der Zeitenwende im Jahr 1989. Davon zeugt nichtzuletzt die Auseinandersetzung, um die es in diesem Buch geht. Damals wurde der Kleinstaat Schweiz von der ClintonAdministration, den angelsächsischenMedien und ausländischen jüdischen Organisation gezielt und koordiniert unter grossen Druck gesetzt, mit dem ausschliesslichen Ziel, aus einem Vergleich so viel wie möglich herauszuholen.Die international isolierte Schweizhat das Milliarden Franken gekostet. Sich diese Vergangenheit in der Gegenwart geopolitischer Umwälzungen präsentzuhalten und Lehren aus ihr zu ziehen, lohnt in jedem Fall.
Dieses Buch ist das Konzentrat einer umfassenden, lückenlosen, von mir verfassten Dokumentation über die Task Force «Schweiz –Zweiter Weltkrieg»,1 die für die vorliegende, nun im Verlag NZZ Libro erscheinende Publikation als Grundlage gedient hat. Ich habe dafür den Journalisten und Historiker René Lüchinger engagiert. Seine Aufgabe bestand darin, aus der rund 2800-seitigen juristisch-wissenschaftlichen Version eine stark gekürzte und journalistisch geprägte Fassung herzustellen.
Dieses Buch ist meinen drei Kindern Roman, Ruby und Jake gewidmet. Mit steigendem Interesse verfolgten sie meine Nacht- und Wochenendarbeit, begannen sich für alte Dokumente und vor allem Videos zu interessieren, in denen ein junger Mann, der ihr Vater werden sollte, vor dem USKongress und anderen Foren aussagte. Sie begriffen, dass es wichtig ist, im Leben Spuren zu hinterlassen und sich für die Interessen des Vaterlandes einzusetzen.
Vorallem aber ist dieses Buch den Mitgliedern der damaligen Task Force «Schweiz –Zweiter Weltkrieg»gewidmet. Wie wohl seit dieser Zeit nie mehr verfügte die Eidgenossenschaft mit ihr über eine brillante, intelligente, hingebungsvolle, verschworene Gemeinschaft von Staatsdienern, die
vereint für die Schweiz in schwieriger Zeit kämpften. Es ist mir bis heute ein grosses Privileg, dass ich ihr Primus inter Pares sein und zusammen mit ihnen und anderen die Interessen und vor allem die Ehre der Schweiz verteidigen durfte.
Thalwil, im Juli 2025
«You Swiss you had the chance to provide the proof that the money deposited with you actually belonged to you. You did not provide the proof, therefore you will have to suffer the consequences.»1 Es ist der 20. Oktober 1943, als dieses Schreiben an die Adresse der Schweizerischen Nationalbank (SNB)imUnited States Department of the Treasury in Washington aufgesetzt wird:eine offene Drohung an die Währungshüter und die Landesregierung in Bern –ohne Neutralitätsnachweis sollen Privat- und Firmenvermögen auf dem Schweizer Bankenplatz zukünftig eingefroren, die Eigentümer auf eine schwarze Liste gesetzt werden. «Suffer the consequences», schwarze Listen, Drohungen, Vermögen auf Schweizer Banken einzufrieren:Schon seit Monaten mehren sich die Anzeichen, dass die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, nun gegen die Neutralen, insbesondere die Schweiz und deren Finanzplatz, ins Feld ziehen wollen.
Vergessenscheint, dassdie USA noch vor zwei Jahren sich selbst neutral verhalten hatten und erst nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbour im Dezember1941 eher widerwillig in den ZweitenWeltkrieg eingetreten sind. Nun gibt es für die Amerikaner nur noch Freund oder Feind. Eine neutrale Haltung ist Komplizenschaft mit dem Gegner. In diesem Sinne trommeln auchdie US-Medien. Sie sehendie Schweiz als willfährigenUnterstützer der braunen Todfeinde in Europa, als Hort der Deutschfreundlichkeit. US-Präsident Franklin Roosevelt lässt ausrichten, mit Konzessionen an Nazideutschland –Bankgeschäfte, Transitrechte, Kriegsmateriallieferungen –setzedie Schweiz den «Anschluss an die siegreichen MächteaufsSpiel». Neutral sein, lautet die Botschaft aus Washington, geht im Kriegsjahr 1943 nichtmehr.
Krieg bedeutet immer auch Wirtschaftskrieg. Bereits am 5. Januar 1943 hatten die Kriegsgegner der Achsenmächte ein einschlägiges Dokument
unterzeichnet. In einer «Alliierten Erklärung über die in den vom Feinde besetzten oder unter seiner Kontrolle stehenden Gebieten begangenen Enteignungshandlungen»warnen sie insbesondere auf neutralem Terrain wohnhafte Personen davor, Eigentum im Feindesland zu erwerben, und die Alliierten behalten sich das Recht vor, jede Transaktion dieser Art im Nachhinein für nichtig zu erklären. Dies gilt nicht nur für klar widerrechtlich erworbene Besitztümer aus Plünderungen oder Raubzügen, sondern auch bei Handwechseln, die –soweit ersichtlich –legal und freiwillig vollzogen worden sein können.2 Briten und Amerikaner hatten Ende 1944 zudem mit der «Operation Safehaven»3 ein Programm aufgelegt, um in neutralen Ländern deutsche Vermögenswerte aufzuspüren und zu identifizieren, in der Absicht, diese nach Ende des Krieges zu beschlagnahmen. Besonders im Visier:der Schweizer Finanzplatz. Nach angelsächsischer Beurteilung dient dieser als willige Drehscheibe zur Verschiebung deutscher Vermögen.
Für den Schweizer Finanzplatz ist das Kapital der Neutralität aufgebraucht. Diese hatte drei Jahrzehnte zuvor, im Jahr 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, den Aufstieg in eine internationale Liga erst ermöglicht. «Aufgrund der sich rasch verschlechternden Wirtschafts- und Valutalage in den kriegführenden Ländern bot sich der von militärischen Operationen verschonte neutrale Staat als Hort furFluchtkapital und als europäische Finanzdrehscheibe an und vermochte eine substantielle Neutralitätsdividende zu realisieren»,4 urteilt die Unabhängige Expertenkommission Schweiz –Zweiter Weltkrieg (UEK)später über diesen Paradigmenwechsel auf dem Schweizer Finanzplatz. Banken und Versicherungen, Vermögensverwalter und Finanzgesellschaften verzeichnen einen noch nie dagewesenen Zufluss an Geldern aus dem Ausland, entsprechend steigt der wertschöpfende Anteil der Finanzbranche am Bruttoinlandprodukt (BIP)der Schweiz und sie geniesst auch «hohe innenpolitische Akzeptanz».5
Die Stellung des SchweizerFinanzplatzes als sicherer Hafen für ausländische Gelder aus politisch instabilen Nachbarstaatender Schweizist während der Weltwirtschaftskriseder 1930er Jahre erstmalsplötzlich bedroht. Im Innern schlittert das Land 1931 in die bislang schlimmsteBankenkrise: Vonden damals acht Grossbanken im Land geht eine pleite,eine weitere wird mit millionenschwerer Staatshilfegerade noch gerettet, vierweitere müssen saniert werden. Der Qualitätsnimbus der SchweizerBanken droht verloren zu gehen. Auch ausländischeRegierungen erhöhen nun die Schlagzahl. Ihnen ist in wirt-

Neutral sein, geht nicht mehr:US-Präsident Franklin Roosevelt 1944
schaftlich schwierigen Zeiten zunehmend einDorn im Auge,dass Schweizer Banken Fluchtgelder ihrer Steuerpflichtigen horten. Die deutsche Regierung unter Reichskanzler HeinrichBrüning heuert Spione an, um Steuersündern auf die Schliche zu kommen, und französische Fahnder erwischen Schweizer Bankiers in Pariser Appartements bei der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. In dieser brenzligenSituation erlässt die Eidgenossenschaftein «Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen», das am 1. März 1935 in Kraft tritt –es beinhaltet auchdas sogenannte Bankkundengeheimnis,das Offenlegung oder Weitergabe von vertraulichen Bankdaten durch Angestellte oder Organe der Bank«mit Gefängnis oder mit Busse bestraft».6
«Esging bei der Einführung des Bankkundengeheimnisses noch keineswegs um den Schutz der Vermögen von jüdischen Klienten vor dem Zugriff der Nationalsozialisten, wie das später von Bankiers vereinzelt und zu Unrecht ins Feld geführt wurde.» Thomas Borer
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als sich die militärische Niederlage der Achsenmächte abzeichnet, stellen Schweizer Behörden insbesondere bei den Amerikanern eine veränderte Tonlage fest. Mit einiger Verwunderung registrieren sie, dass politische Forderungen an das Land keineswegs mehr über diplomatische Kanäle kommuniziert, sondern als öffentliche Medienkampagnen inszeniert werden, was zu einigen «üblen Entgleisungen»7 führt. Die Schweiz wird «als Versorgungsbasis der nationalsozialistischen Armeen»geschildert, zum «Aasgeier Europas»gestempelt, als «Zufluchtsort für Faschisten und deren Vermögen»gebrandmarkt und Diplomaten des Landes werden als angebliche Gestapo-Mitarbeiter verunglimpft.8 Die Schweiz als Handlanger der Nazis, als Drehscheibe für braunes Fluchtkapital –diese Sicht auf die Eidgenossenschaft findet auch Eingang in zahlreiche Berichte von US-Dienststellen und vertraulichen Notizen in Akten, die zu jener Zeit mit fleissiger Akribie von alliierten Spionen erstellt werden.

Die Schweiz steht 1945 unter Generalverdacht,ist an dieser Zeitenwende aussenpolitisch weitgehend isoliert. Zur Siegermacht Sowjetunion existierenkeinerlei diplomatische Beziehungen –Stalin hatte entsprechende Avancen der Schweizer Diplomatie brüsk mit dem Hinweiszurückgewiesen,das Land sei schlimmer als Franco-Spanien. Und die Westalliierten machen unter Führung der USA Druck auf SchweizerRegierung und Finanzplatz. Auf die orchestrierte Pressekampagne in der amerikanischenHeimatfolgtbald darauf der mahnende Fingerzeigaus Washingtonandie Adresse des schweizerischen BundesFinanzplatz unter Generalverdacht:Paradeplatz 1946
«Einige Dokumente aus diesem Fundus werden fünf Jahrzehnte später, ab 1996, von unseren Kritikern gezielt veröffentlicht. Das beeinflusste natürlich auch den sogenannten Eizenstat-Bericht des USUnterstaatssekretärs Stuart Eizenstat rund um das Raubgold der Nazis, der für die Schweiz negativ ausfiel.» Thomas Borer
präsidenten. In einem Brief an seinenAmtskollegen in Bern, Eduardvon Steiger, zeigt US-Präsident Franklin Roosevelt zwar vielVerständnis für die Nöte der Neutralen inmitten kriegführender Mächte in der ersten Phase des Weltenbrands. Aber er schreibt ebenauch,dasssichdas Kriegsglück nun gewandelt habe und die Alliierten in einer besseren Positionseien, ihre Bedürfnisse zu adressieren. Was das bedeutet, äussert der Präsidentindeutlichen Worten: «I speak strongly as every day the war is prolonged costs the lives of some of my countrymen. Ihopealso that you will lend every assistance to our efforts in the post-war period to track down and seize the property of our foe.»9 Damit liegt die Forderung der Amerikaner klar auf dem Tisch:Die Schweiz soll in die Operation «Safehaven»eingebundenwerdenund Hand bieten zur Beschlagnahmung von Nazivermögeninder Schweiz.
Es bleibt keineswegs bei dem schriftlich formulierten präsidialen Wunsch. Roosevelt schickt seinen engen Mitarbeiter Laughlin Currie als Kopf einer Westalliierten-Delegation in die Schweiz. Die sogenannte Currie-Delegation soll dem Willen des Präsidenten Durchbruch verschaffen und –immerhin –auch die Blockade der Schweiz durch die Alliierten thematisieren und neu verhandeln. Der Bundesrat ernennt seinerseits den Diplomaten und ehemaligen Gesandten im französischen Vichy, Walter Stukki, zum Kopf der eigenen Delegation –dessen Übername «der grosse Stucki»ist keineswegs nur seiner Körpergrösse geschuldet, sondern insbesondere auch seinem Verhandlungsgeschick.
Vom12. Februar bis zum 8. März 1945 wird verhandelt, und als das Resultat vorliegt, herrscht Ernüchterung in der Schweiz:Der Bundesrat beugt sich dem Druck der Westalliierten, sperrt deutsche Guthaben in der Schweiz, baut Transitverkehr und Aussenhandel mit Deutschland ab und verzichtet auf weitere Ankäufe von Gold.
«Die Schweizer Regierung fügte sich damit in die wirtschaftliche Kriegsführung der Alliierten ein und verletzte die Neutralität.»
Thomas Borer