Mut zur Schwäche
Grenzen erkennen, Hilfe
annehmen
Musik im Blut
Warum wir häufiger singen sollten

Dem Winter trotzen Immunsystem und Psyche stärken

Grenzen erkennen, Hilfe
Musik im Blut
Warum wir häufiger singen sollten

Dem Winter trotzen Immunsystem und Psyche stärken

Ein Apéro reiht sich an den nächsten, man tingelt über Weihnachtsmärkte, die Festessen häufen sich. Was kümmert mich das Morgen, sagen sich wohl viele. Doch nach den Festtagen herrscht Katerstimmung: Gefühlt sind etliche Kilo mehr auf den Rippen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gross, dass dieser Eindruck trügt: Durchschnittlich zeigt die Waage nach Weihnachten nur zwischen 0,4 und 0,9 Kilo mehr an. Nur: Laut einer Studie bleibt das über die Festtage angesetzte Gewicht hartnäckig. Die Feiertagskilos addieren sich also über die Jahre. Wie sagt man so schön: Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Die metabolische Gesundheit wird immer wichtiger: Sind Blutzucker, Blutdruck, Cholesterin und Insulinempfindlichkeit im Gleichgewicht, sinkt das Risiko für folgenschwere Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich. Wir unterstützen Sie dabei, die Gesundheit Ihres Stoffwechsels zu stärken, etwa mit unserem neuen Guide für Körperwerte in Balance oder anderen Angeboten – und auch durch Kostenübernahmen für Prävention innerhalb unserer ambulanten Zusatzversicherung Vital. Wussten Sie, dass das neue Therapieangebot Ylah persönliche Therapie mit digitaler Begleitung verbindet? Sanitas ist eine der wenigen exklusiven Partnerinnen. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.



Kundenvorteile
20 % Rabatt auf
Winter ist Hochsaison für Viren. Sanitas Versicherte erhalten 20 Prozent Rabatt auf Impfungen gegen Grippe, Covid, das respiratorische Synzytialvirus (RSV) und Pneumokokken. Denn besonders Atemwegsinfekte sind für Risikogruppen gefährlich. Eine Impfung dämmt die Verbreitung der Viren ein – um sich selbst und andere zu schützen. Die Impfrabatte sind in Amavita, Coop Vitality, Sunstore und Benu Apotheken bis 31. Januar 2026 gültig.
So funktioniert’s: sanitas.com/impfrabatte


Die App Macht Lust auf Winter wandern und Schlitteln!
Langlaufen, Schlitteln, Winterwandern und Schneeschuhlaufen: Mit der kostenlosen App Schweizmobil lässt sich unser Land auf über 1500 Routen auch in der kalten Jahreszeit entdecken. Alles in höchster Kartenqualität mit den Landeskarten von Swisstopo im Massstab 1:10 000.
Die App ist für iOS und Android erhältlich.
Arzt und Therapeutensuche
Ist mein Therapeut für Alternativmedizin von Sanitas anerkannt? Welche Praxen, Gesundheitszentren und Hausärztinnen sind für das Hausarztmodell oder das Kombimodell MultiAccess zugelassen? Mit der Hausarzt sowie der Therapeutensuche finden Sanitas Versicherte unkompliziert passende Fachpersonen in ihrer Nähe.
Ärztinnen und Therapeuten finden: sanitas.com/arztsuche
Neuer Sanitas KI Chatbot
Unser neuer intelligenter KI Chatbot im Sanitas Portal ist ab sofort für Sie da. Schnell, smart und effizient unterstützt er Sie bei der Lösung Ihres Problems. Versicherungsangelegenheiten wie das Anpassen Ihrer Versicherung, eine Adressänderung oder das Anfordern des Steuerbelegs erledigen Sie dank seiner Hilfe mit wenigen Klicks. Selbstverständlich ist auch unsere Kundenberatung weiterhin persönlich für Sie da.
Lassen Sie sich unterstützen: sanitas.com/chatbot
Guide für Körperwerte in Balance
Hohe Blutzucker oder Cholesterinwerte sowie ein erhöhter Blutdruck können schwerwiegende Folgen haben, etwa einen Herzinfarkt oder Schlaganfall (lesen Sie dazu unseren Beitrag ab Seite 18). In unserem Guide für Körperwerte in Balance in der Sanitas Portal App erfassen oder messen Sie ganz einfach Ihre Körperwerte – beispielsweise dank des kostenlosen Blutdruck Checks mittels KI. Ausserdem bieten fundierte Ratgeber Fachwissen zu Blutzucker, Bluthochdruck und Cholesterin mit Tipps zu Ernährung, Bewegung und Therapien.
Prüfen Sie Ihr Risiko in der Sanitas Portal App: sanitas.com/stoffwechselgesundheit
Sanitas Challenge Award Jetzt für 2026 bewerben!
Sanitas fördert seit über 30 Jahren Projekte, die Kinder und junge Erwachsene zu mehr Bewegung motivieren. Die 15 besten Engagements erhalten Fördergelder von bis zu 25 000 Franken. Anmeldestart ist der 1. Januar 2026.
Melden Sie Ihr Projekt an: sanitas.com/engagement
Schon gewusst?
Eine neue Studie der Universität Basel zeigt: Wer sich beim Sport stärker anstrengt, lebt länger – unabhängig von der Trainingsdauer. Die Forschenden werteten Daten von über 7000 Personen aus, die Bewegungsmesser trugen. Ergebnis: Intensive Bewegungseinheiten senken das Sterberisiko deutlich stärker als moderate. Wobei es nicht darum gehe, konstant am Limit zu trainieren. Es helfe schon, die Intensität der alltäglichen Bewegung wie Treppenlaufen zu erhöhen. Wer regelmässig Sport treibe, profitiere zudem von intensiven Intervallen.
Quelle: European Journal of Preventive Cardiology

Die Zahl
62 %
der Menschen in der Schweiz schlafen stressbedingt schlecht.
Umfrage
Wie gefällt Ihnen das Sanitas
Uns interessiert Ihre Meinung: Was gefällt Ihnen am Magazin besonders, was können wir verbessern und was vermissen Sie? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von 10 Orell FüssliGut scheinen à 50 Franken. Teilnahmeschluss ist der 30. Dezember 2025.
Hier teilnehmen: sanitas.com/meinfeedback

In der Podcastfolge «Polyamorie: Die Zukunft der Beziehungen?» spricht Frank Baumann mit Sexualtherapeutin und Psychologin Dr. Ursina Donatsch über offene Beziehungen, Treue, Vorurteile und was es braucht, um in polyamoren Beziehungen zu leben.
Reinhören: sanitas.com/polyamorie Guide für Pflege zu Hause
Studienreihe «Präventions radar Schweiz»
Die komplette Studie: sanitas.com/ praeventionsradar2025
Wie gesund lebt die Schweizer Bevölkerung? Damit setzt sich der aktuelle «Präventionsradar Schweiz» der Stiftung Sanitas auseinander – eine neue, mehrjährige Studienreihe, die der Bevölkerung in Sachen Gesundheitsvorsorge auf den Zahn fühlt. Das diesjährige Ergebnis zeigt: Den Befragten ist ein gesundes Leben wichtiger als ein möglichst langes. Und: Die meisten überschätzen sich bei der Ernährung – so gesund, wie sie denken, essen sie gar nicht.
Brauchen Sie oder ein Familienmitglied pflegerische Unterstützung zu Hause? Ob langfristig oder nur vorübergehend: Mit unserem Guide für Pflege zu Hause finden Betroffene und Angehörige passende Pflegeorganisationen und Fachpersonen – aber auch praktische Tipps rund um Pflege, Kosten und Finanzierung. Der Guide für Pflege zu Hause ist in der Sanitas Portal App verfügbar.
Holen Sie sich den Guide aufs Handy: sanitas.com/pflegezuhause

Schwäche zu zeigen, ist nicht immer einfach –aber es zeugt von echter Stärke. Es verlangt Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen und die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Denn der mutigste Schritt ist manchmal, nicht stark sein zu wollen und seine Grenzen anzuerkennen.

DOSSIER
Wenn der Körper sich selbst angreift — 10
5 Impulse für psychisches Wohlbefinden — 13 «Angst ist nichts Schlechtes» — 14
Jede Minute zählt — 16
Chronisch krank: Die Rolle des Stoffwechsels — 18
Text Nicole Krättli Bilder Sebastian Doerk, Thomas Egli
Autoimmunerkrankungen werden oft spät erkannt, denn viele Symptome sind unspezifisch. Für Betroffene bedeutet das häufig einen langen Leidensweg –auf dem sie aber Strategien entwickeln, mit der Krankheit umzugehen.
«Ich bin froh, dass ich nun schmerzfrei bin»
Als Andreas vor rund zwölf Jahren Schmerzen in Daumen und Zeigefinger spürt, denkt er an eine harmlose Überlastung. Der 43-jährige Berner treibt häufig Sport, arbeitet viel am Computer. Für ihn liegt der Verdacht einer Sehnenscheidenentzündung nahe. «Die Schmerzen wurden schlimmer und schränkten mich zeitweise ein.» Zusätzlich fallen ihm erste Hautveränderungen auf. Die Diagnose zieht sich hin: Blutwerte unauffällig, bildgebende Verfahren zunächst ohne klaren Befund. Doch die Symptome breiten sich aus. Als die zweite Hand zu schmerzen beginnt, vermuten die Ärzte eine chronische Entzündung. Ein Hautarzt erkennt schliesslich die Verbindung zwischen den Gelenkbeschwerden und den zunehmenden Schuppenflechten: Andreas leidet an Schuppenflechtenrheuma. Einer Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem sowohl Haut als auch Gelenke angreift.

Heute nimmt Andreas einmal pro Woche Methotrexat –ein starkes Rheumamedikament. Die Schwellungen sind deutlich zurückgegangen, die Hautprobleme nahezu verschwunden. Doch das Medikament hat Nebenwirkungen: Müdigkeit nach der Einnahme, und auch auf Alkohol sollten Betroffene verzichten. «Ein Glas Wein in Gesellschaft fehlt mir schon ab und an», gibt Andreas lachend zu. Auch die Müdigkeit sei manchmal lästig. Die Erleichterung, die Erkrankung frühzeitig erkannt zu haben, überwiegt aber: «Trotz gewisser Einschränkungen bin ich sehr froh, dass ich nun schmerzfrei bin und durch das Medikament keine bleibenden Schäden haben werde.»

Die häufigsten Autoimmunkrankheiten einfach erklärt: sanitas.com/ immunsystem
«Die
Als Bruno vor elf Jahren plötzlich starke Bauchkrämpfe bekommt, denkt er an eine harmlose Magen-DarmGrippe. Doch der Zustand bessert sich nicht. Die Diagnose Colitis ulcerosa trifft ihn unerwartet. Betroffene müssen oft sehr häufig zur Toilette, und das Gefühl, sich entleeren zu müssen, kann dringend oder sogar unkontrolliert kommen. «Ich war wie gelähmt», erinnert er sich. Es dauert, bis er akzeptieren kann, dass er nun mit einer chronischen Erkrankung lebt, die in Schüben kommt und bislang nicht heilbar ist.
Heute ist der 42-Jährige Präsident der Patientenvereinigung Crohn Colitis Schweiz. Er engagiert sich für den Austausch unter Betroffenen und eine offenere Gesellschaft – gerade weil das Thema für viele ein Tabu ist. Er selbst hat gelernt, mit der Krankheit offen umzugehen. «Meine Freunde wissen Bescheid, mein Team, meine Vorgesetzten, sogar meine Kunden informiere ich vor einem Meeting darüber – denn ich muss unter Umständen sehr schnell zur Toilette. Diese Transparenz erleichtert meinen Alltag.»
Bruno lebt heute ein weitgehend normales Leben. Und trotzdem ist vieles anders als früher. Statt spontan zu verreisen, plant er seine Trips heute sorgfältig im Voraus, bei Konzerten bucht er einen Gangplatz in Toilettennähe. «Ich habe über die Jahre viele Strategien zur
Bewältigung meines Alltags entwickelt», sagt er. Die Angst vor dem nächsten Schub bleibt, trotz langer guter Phasen. «Aber man darf nicht in Angst leben. Sich Hilfe zu holen, war für mich deshalb entscheidend.» Was ihn trägt, ist der Austausch mit anderen. «Ich habe durch die Krankheit Freundschaften geknüpft, die ich sonst nie gefunden hätte.» Und so sieht Bruno trotz allem auch Positives: «Diese Krankheit hat mir viel abverlangt, aber mir auch beigebracht, geduldiger zu sein und mich neu zu organisieren.»

!EXPERTENINTERVIEW
Prof. Dr. med. Gerhard Huber, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, Klinik Hirslanden Zürich
Was passiert bei einer Autoimmunerkrankung?
Das Immunsystem erkennt körpereigene Strukturen plötzlich als fremde. Die Gründe dafür sind leider nicht abschliessend geklärt. Es gibt Hinweise darauf, dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Aber auch Infekte und Chemikalien können solche Reaktionen auslösen.
Welche Krankheiten zählen dazu?
Die Bandbreite ist enorm: Rheuma, Morbus Sjögren, Lupus, Schilddrüsenerkrankungen oder Darmentzündungen. Manche betreffen ein einzelnes Organ, andere den ganzen Körper. Weil die Symptome meist unspezifisch sind, ist eine Diagnose oft schwierig. Erst bei einem hartnäckigen Verlauf wird genauer hingeschaut.
Gibt es Behandlungsmöglichkeiten?
Je nach Schwere reichen lokale Therapien von Kortison bis hin zu Immunsuppressiva. Ziel ist es, damit das überaktive Immunsystem zu bremsen. Doch dadurch wird die Person auch anfälliger für Infektionen und Krebs.
Was bedeutet die Diagnose Autoimmunerkrankung?
Das Spektrum reicht von kaum spürbar bis potenziell lebensbedrohlich. Gerade deshalb ist es wichtig, sich früh an erfahrene Fachpersonen zu wenden. Eine gute medizinische Begleitung kann helfen, den Alltag wieder stabiler und mit weniger Einschränkungen zu gestalten. Gewisse Autoimmunerkrankungen können nach einer bestimmten Zeit auch wieder deutlich nachlassen oder vollständig verschwinden.

«Ich bin wahnsinnig dankbar»
Es beginnt mit heftigem Nesselfieber. Geraldine ist 40 Jahre alt, sportlich und beruflich erfolgreich. Doch plötzlich schwellen ihre Augen an, ihre Haare fallen aus, sie nimmt trotz gesunder Ernährung und regelmässigem Sport innert kürzester Zeit über zehn Kilo zu. «Zuerst vermutete ich, dass hormonelle Veränderungen rund um die Menopause dafür verantwortlich sind», erinnert sie sich. Richtig beunruhigend wird es, als sie massive Gedächtnisprobleme feststellt. «Ich konnte mir nach Gesprächen nichts merken und fürchtete irgendwann eine beginnende Demenz.» Ein Bluttest liefert die Antwort: Hashimoto – eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. «Mein Arzt meinte, er sei überrascht, dass ich überhaupt noch aufstehen könne.» Geraldine beginnt sofort mit einer Hormontherapie. Es dauert allerdings noch fast acht Monate, bis sie sich wieder wie die Alte fühlt. «Ich war so erleichtert, als meine Haare nachwuchsen, die Kilos purzelten und meine Energie wieder den normalen Pegel erreichte.» Heute nimmt Geraldine täglich eine Tablette und lebt beschwerdefrei.
Hashimoto ist aus ihrem Alltag verschwunden, aber nicht aus ihrem Bewusstsein. «Ich war vorher nie krank. Heute weiss ich, wie sehr einen körperliche Veränderungen aus der Bahn werfen können und wie wertvoll Gesundheit ist.» Dass sie wieder leistungsfähig, mental klar und voller Lebensfreude ist, empfindet Geraldine als Geschenk. «Ich bin wahnsinnig dankbar und so glücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben.»
Von Alternativmedizin bis Ernährungsberatung: Die ambulante Zusatzversicherung Vital ist das Plus Ihrer medizinischen Versorgung. sanitas.com/ besser-versichert
Text
Laurina Waltersperger Illustration Joël Roth
Manchmal wächst einem alles über den Kopf. Sich dann etwas Gutes zu tun oder Hilfe zu suchen, kann Überwindung kosten, stärkt aber die Psyche.

Und das idealerweise, bevor die Last zu gross wird. Denn je länger eine Belastung andauert, desto eher kann sie in einer psychischen Erkrankung münden. Familie und Freunde können zwar eine wichtige Stütze sein, doch manchmal ist ein Gespräch mit einer aussenstehenden Person einfacher. Menschen, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, gehen besser mit seelischen Problemen um. Das zeigen Studien.

1 Mit Freunden reden
Auch wenn Offenheit nicht immer einfach ist: Teilen Sie mit anderen, was Ihnen auf dem Herzen liegt! Studien zeigen, dass Reden bei seelischen Belastungen hilft. Ausserdem stärken soziale Beziehungen die Psyche – sich mitzuteilen, wirkt entlastend. Am besten, man spricht ohne Zeitdruck an einem Wohlfühlort mit einer vertrauten Person.
4
Schlafend verarbeiten

Schlafen Sie genug. Denn während des Schlafs wird das Gehirn von Abfallstoffen befreit und es regeneriert sich. Das verbessert das Wohlbefinden und macht resilienter gegen Stress. Zudem hilft Schlaf, Emotionen, Gedanken und Erinnerungen zu verarbeiten. Fehlt er, reduziert das die emotionale Stabilität und die kognitiven Fähigkeiten.
3 Fürs Gemüt bewegen

Hoch vom Sofa! Schon moderate, regelmässige Bewegung – egal ob Sport, Tanzen oder Alltagsaktivitäten wie Spazieren – reduziert Stress, hellt die Stimmung auf, reduziert Angst- und Depressionssymptome. Bei Letzteren wirkt körperliche Aktivität oft ähnlich wie Medikamente. Gleichzeitig fördert sie die Konzentrationsfähigkeit, geistige Belastbarkeit und emotionale Ausgeglichenheit.
5 Neues lernen
Lernen fördert die Bildung neuronaler Verbindungen im Gehirn – mit positivem Effekt auf die Psyche. Besonders anregend ist die Kombination von körperlicher und geistiger Aktivität mit sozialem Austausch: tanzen, zusammen musizieren, singen, reisen. So werden verschiedene Hirnareale gleichzeitig angeregt, das Hirn wird flexibler und bleibt länger jung.


Rund 15 bis 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen. Prof. Dr. med. Katja Cattapan über mögliche Ursachen, Trends und Therapieansätze.
Wann spricht man von Angst und wann von einer Angststörung?
Angst per se ist nichts Schlechtes, da sie eine biologische Reaktion auf Bedrohung ist. Doch wenn Angst übermässig ist, anhaltend und die Funktionsfähigkeit im Alltag beeinträchtigt, spricht man von einer Angststörung. In den sozialen Medien wird häufig über Ängste, auch «Anxiety», geredet. Ist Angst im Trend?
Trendphänomene erkennt man an dramatisierten Darstellungen oder allgemeinen Aussagen. Zudem sprechen junge Menschen auf TikTok oder Instagram immer häufiger von ihren Ängsten – und setzen oft Schüchternheit mit klinischer Angst gleich. Das kann enttabuisierend wirken, birgt aber auch die Gefahr einer Verharmlosung. Diagnose und Therapie gehören in professionelle Hände. Worauf lassen sich Angststörungen zurückführen?
Unser Guide für mentale Gesundheit in der Sanitas Portal App unterstützt Sie bei der Suche nach dem passenden Angebot – von der Selbsthilfe über Coaching bis zur Psychotherapie: sanitas.com/ mentalegesundheit
Wir wissen, dass gravierende belastende Kindheitserfahrungen die Wahrscheinlichkeit und das Ausmass von verschiedenen Angststörungen erhöhen. Dazu gehören emotionale Vernachlässigung, körperliche Misshandlung und sexueller Missbrauch. Auch Ausgrenzungserfahrungen in der Jugend können einen Einfluss haben. Ausserdem ist Angst vererbbar: Haben nahe Angehörige eine Angststörung, ist das eigene Risiko erhöht. Aber auch die eigene Persönlichkeit und unsere Umwelt spielen eine Rolle – wenn etwa überängstliche Eltern vieles verbieten.
Wie äussern sich Angststörungen?
Es gibt unterschiedliche Angststörungen mit verschiedenen Symptommustern. Körperlich treten zum Beispiel Herzrasen, Schwindel, Atemnot, Schwitzen und Magenbeschwerden sowie muskuläre Anspannung auf. Bei psychischen Symptomen ist – neben der Angst – ein starker Grübelzwang charakteristisch, es kann zu Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen oder Schlafstörungen kommen. Zudem kann eine Angststörung zu einem generellen sozialen Rückzug führen.
Prof. Dr. med. Katja Cattapan ist Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie. Als designierte ärztliche Direktorin des Sanatoriums Kilchberg leitet sie die Privat- und Spezialstationen sowie die Ambulatorien und hat die ambulanten und stationären Behandlungsangebote mitentwickelt.
Wie wirkt sich eine Angststörung auf die Gesundheit aus?
Unbehandelte Angststörungen können zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, aber auch zu Magen-DarmBeschwerden, und es besteht ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Suchtkrankheiten und psychosomatische Schmerzstörungen. Überhaupt: Ein Teil der Betroffenen erlebt die Angstsymptome oft so stark, dass ihr Alltag massiv beeinträchtigt ist, sie den Beruf nicht mehr ausüben oder bestimmte Situationen nur in Begleitung bewältigen können.
Kann man eine Angststörung überwinden?
Angststörungen sind gut behandelbar. Dabei gilt: Je früher die Behandlung, desto besser die Prognose. Wir arbeiten vor allem mit der Exposition, indem wir die Betroffenen mit der auslösenden Situation konfrontieren und versuchen, deren Vermeidungsverhalten zu reduzieren. Im besten Fall kann sich die betroffene Person nach einigen Sitzungen und in Begleitung ihrer Therapeutin der Situation aussetzen, die sie aus Angst vor Angstsymptomen immer vermieden hat. Auch Entspannungsübungen, körperliche und sportliche Betätigung sowie Antidepressiva können helfen. Voraussetzung dafür ist die Wissensvermittlung, was bei Ängsten psychisch und körperlich geschieht.
Der Ratschlag, sich seinen Ängsten zu stellen, stimmt also.
Sich seinen Ängsten zu stellen, ist zentraler Bestandteil der Therapie. Es geht darum, gezielt, strukturiert und gestärkt neue Erfahrungen zu machen und die Belastungen und Einschränkungen abzubauen.
Text Julie Freudiger Illustration Pia Bublies
Erste Hilfe zu leisten, rettet Leben. Einfacher gesagt als getan? Nicht doch! Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist, nichts zu tun. Eine Anleitung zum Helfen.


Was tun, wenn Sie eine verletzte Person auffinden?

Schauen: Was ist passiert?
Wie viele Personen sind involviert?

Denken: Gibt es Gefahren für Helfende, Verletzte, Passanten oder Angehörige?
Handeln: Achten Sie auf Ihren eigenen Schutz.
Sichern Sie den Ereignisort ab, alarmieren Sie und holen Sie Hilfe.

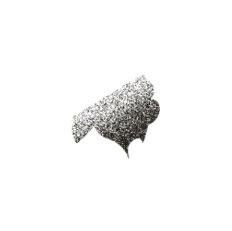

Ist die Person bei Bewusstsein? Antwortet oder reagiert sie also?


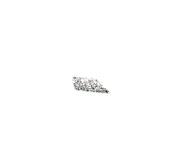

In maximal 10 bis 15 Minuten ist in der Schweiz die Sanität vor Ort.


In 85 % der dringlichen Einsätze kann die Frist von 15 Minuten eingehalten werden.



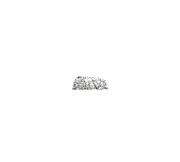
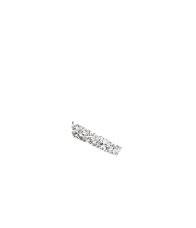




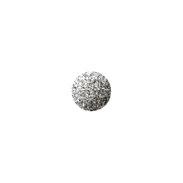



Etwa 10 % pro Minute sinken die Überlebenschancen nach einem Herzstillstand. Darum ist Erste Hilfe so wichtig: Es zählt jede Minute.
Schlaganfall: FAST-Test
So prüfen Sie, ob jemand einen Schlaganfall hatte:
Face (Gesicht): Kann die Person lächeln? Oder hat sie eine einseitige Gesichtslähmung?
A rms (Arme): Kann die Person beide Arme hochheben?
S peech (Sprache): Kann die Person normal und verständlich sprechen?

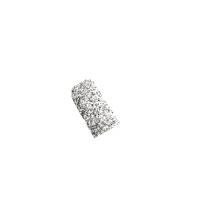
Situationsgerecht helfen und je nach Bedarf den Notruf 144 alarmieren.

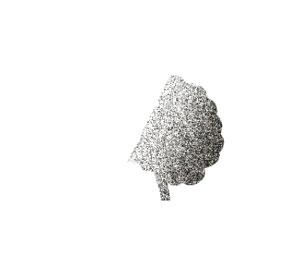

T ime (Zeit): Hat die Person Anzeichen für einen Schlaganfall, müssen Sie sofort den Notruf 144 alarmieren!
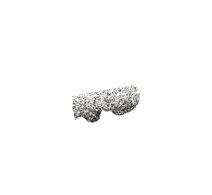
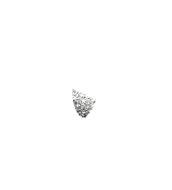
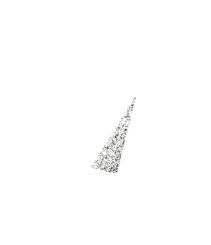




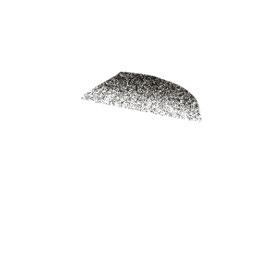
Mögliche Anzeichen für einen Herzinfarkt: Schraubstockartige Schmerzen im Brustbereich, isolierte und unerklärliche Beschwerden in den Armen, im Nacken, im Kiefer, im Rücken oder im Bauchraum. Begleitet durch Atemnot, Übelkeit, ein Enge- oder Schwächegefühl. Insbesondere bei Frauen können sich Symptome auch unspezifisch äussern, etwa als Oberbauch- oder Rückenschmerzen oder als Übelkeit mit Erbrechen.
Wählen Sie im Zweifelsfall daher lieber einmal zu viel als zu wenig den Notruf 144.
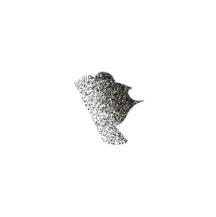




Um Hilfe rufen. Danach prüfen: Ist eine Atmung erkennbar?

Die Person nicht bewegen und warm halten, bis die Sanität eintrifft.
Ausnahme 1: Die Person ist bewusstlos. Legen Sie sie vorsichtig und in einem Stück in die stabile Seitenlage – oder wenn sie nicht atmet, auf den Rücken – und beginnen Sie mit der Herzdruckmassage und der Beatmung.



Ausnahme 2: Die Person muss aus einem Gefahrenbereich gebracht werden. Dazu fassen Sie die Person mit beiden Händen unter den Achseln und ziehen sie weg.

Rund 8000 Personen in der Schweiz erleiden pro Jahr einen Herz-KreislaufStillstand.





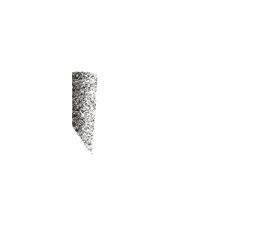







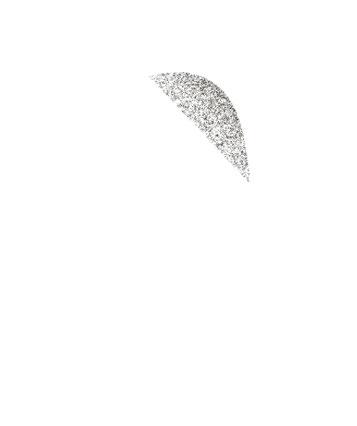
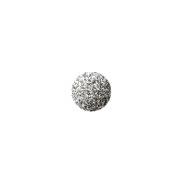
Die bewusstlose Person in die stabile Seitenlage bringen und den Kopf leicht nach hinten überstrecken. 144 alarmieren.

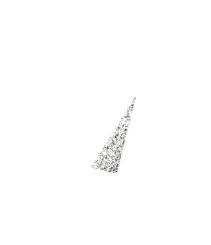
Den Notruf 144 alarmieren und falls vorhanden einen automatischen Defibrillator (AED) holen lassen. Sofort mit der Herzdruckmassage und Beatmung beginnen, bis die Sanität eintrifft.




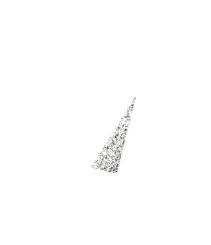

1. Die bewusstlose, nicht atmende Person in Rückenlage bringen und den Oberkörper frei machen – wenn nötig, Kleider zerschneiden.
2. Der Druckpunkt ist in der Mitte des Brustkorbs: beide Hände übereinander legen und sich senkrecht darüber platzieren.
3. Mit gestreckten Armen 30-mal sehr kräftig 5 bis 6 Zentimeter tief auf die Brust drücken. Nach jedem Druck kurz entlasten.
4. Für die Beatmung den Kopf nach hinten strecken, 2 Atemstösse Mund zu Mund oder Mund zu Nase. Der Brustkorb sollte sich anheben.
5. Wenn möglich, einen automatischen Defibrillator (AED) nutzen.
6. Herzdruckmassage (30 Kompressionen) und Beatmung (2 Atemstösse) abwechseln, bis die Sanität eintrifft.
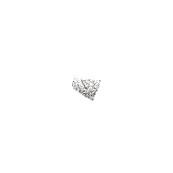

Der berühmte Song «Stayin’ Alive» von den Bee Gees hat einen Rhythmus von 103 beats per minute (BPM) – ideal für die Herzdruckmassage. Denn diese muss mit einer Frequenz von 100 bis 120 Kompressionen pro Minute ausgeführt werden.

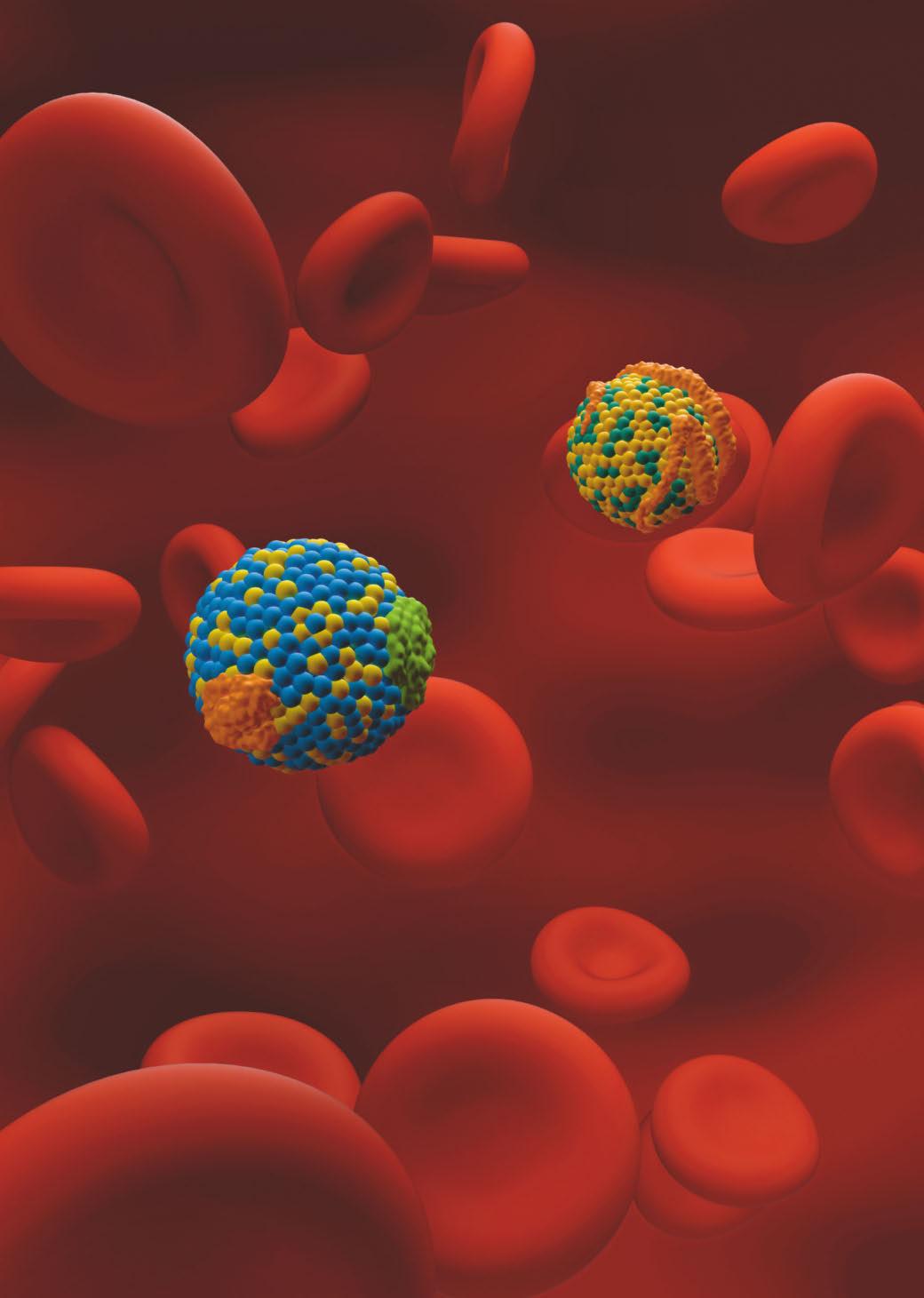
Immer mehr Menschen sind von chronischen Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen –Diagnosen, die vieles verändern. Am Anfang steht der Stoffwechsel. Und die Unkenntnis von Zusammenhängen.
Cholesterin kann sich an den Wänden der Blutgefässe ablagern und sie verengen – was verheerende Folgen haben kann.
Er lässt uns müde oder energiegeladen durch den Tag gehen, beeinflusst Gewicht und Gesundheit: Der Stoffwechsel ist unser Motor. Denn er wandelt aufgenommene Nährstoffe in Energie und Bausteine für die Zellen um, ausserdem ermöglicht er den Aufbau zum Beispiel von Zellwänden, Muskelfasern oder Knochen. Doch wenn der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät, kann hier die Ursache zahlreicher Krankheiten liegen. Was genau bringt den Motor also zum Stottern?
Insulinresistenz und Prädiabetes
Insulin ist ein Teil der Antwort: Sobald der Körper Nahrung erhält und der Blutzucker ansteigt, produziert er mehr Insulin. Der Zucker (Glukose) wird mithilfe dieses lebenswichtigen Hormons als Energiequelle verstoffwechselt. In der Folge sinken der Blutzucker- und damit der Insulinspiegel wieder – zumindest bei Menschen mit einem gesunden Metabolismus.
Chronischer Stress, Schlafmangel, falsche Ernährung, hormonelle Veränderungen, genetische Veranlagungen und Bewegungsmangel können diesen Stoffwechselprozess beeinträchtigen: Die Zellen reagieren nicht mehr ausreichend auf das Hormon und Glukose wird schlechter aus dem Blut aufgenommen – der Blutzucker steigt an. Dieser Zustand wird als Insulinresistenz bezeichnet. Langfristig kann sich daraus ein Prädiabetes und letztendlich ein Typ-2-Diabetes entwickeln, also eine chronische Erkrankung des Zuckerstoffwechsels. Bleibt der Zuckerspiegel dauerhaft hoch, kann dies zudem zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nerven- und Nierenschäden und sogar Erblindung führen.
Ein zunehmendes Problem
«Wir gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel der Erwachsenen in der Schweiz mindestens ein Anzeichen von Insulinresistenz aufweisen», erzählt John Schoonbee. Er ist Global Chief Medical Officer bei Swiss Re und beschäftigt sich seit Jahren mit metabolischer Gesundheit. «Bereits zehn Jahre bevor ein Prädiabetes diagnostiziert wird, kann der Insulinspiegel ansteigen und fungiert somit als Frühwarnsystem.» Prädiabetes nimmt weltweit erheblich zu. Die International Diabetes Federation (IDF) geht von weltweit über 530 Millionen Men-
schen aus, die 2021 von Diabetes betroffen waren – 6,7 Millionen Todesfälle sollen weltweit mit den direkten Folgen dieser Krankheit zusammenhängen. Dabei liesse sich mit relativ einfachen Mitteln schon viel erreichen, sagt Schoonbee: «Studien haben gezeigt, dass etwa 50 Prozent der Menschen mit Typ-2-Diabetes durch eine Kombination aus kohlenhydratarmer Ernährung und angepasstem Lebensstil ihren Blutzucker senken können.»
In der Behandlung von Diabetes sind also zuerst einmal die Betroffenen gefragt: «In der frühen Phase eines Diabetes kann eine Reduktion von fünf Prozent des Körpergewichts den Blutzuckerspiegel bereits deutlich senken und im besten Fall normalisieren», sagt Claudia CaveltiWeder. Sie ist leitende Ärztin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und klinische Ernährung am Unispital Zürich. «Reichen alleinige Veränderungen des Lebensstils nicht aus, setzen wir allenfalls Semaglutide ein», so Weder. Der Wirkstoff ist beispielsweise als Ozempic bekannt. Wird die Insulinempfindlichkeit verbessert, kann das Risiko für Typ-2-Diabetes merklich reduziert werden: «Bei Typ-2-Diabetes ist Insulin immer der letzte Schritt.»
Hohe Cholesterinwerte als Risiko
Auch Cholesterin und andere Blutfette sind relevant für die Stoffwechselgesundheit: Der Körper benötigt sie für die Zellherstellung, Hormonbildung und Fettverdauung. Sind sie aber erhöht, können sie sich an den Wänden der Blutgefässe ablagern und diese verengen – mit Folgen wie einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Eine Ursache
Fokus Insulinresistenz: Dos und Don’ts beim Essen sanitas.com/ insulinresistenz

EXPERTINNENTIPP
Melanie Sprenger, Leiterin Ernährungsberatung und -therapie am Universitätsspital Zürich:
«Für einen gesunden Stoffwechsel empfehle ich das Tellermodell: bestenfalls die Hälfte des Tellers Gemüse oder Salat, ein Viertel Protein (Fleisch, Fisch, Käse, Tofu usw.) und ein Viertel Stärke (Reis, Kartoffeln, Teigwaren, Brot usw.).
Gesunde Menschen können die Anteile auf je einen Drittel aufteilen. Süssigkeiten bewusst geniessen und optimalerweise direkt nach den Mahlzeiten konsumieren. Zucker (z. B. in Süssgetränken oder Fruchtsäften), Salz, Fertigprodukte und Alkohol zurückhaltend konsumieren und Nikotin weglassen.»
Blutzucker
– Regelmässiges Essen mit Mahlzeiten nach dem 3-Komponenten-Modell (siehe oben) hilft, den Blutzuckeranstieg zu bremsen. Dauerhaftes Snacken führt zu schnellen Blutzuckerspitzen und ist zu vermeiden.
– Ein kurzer Spaziergang nach dem Essen senkt den Blutzucker.
Bluthochdruck
– Salzkonsum reduzieren, stattdessen Kräuter und Gewürze verwenden. Fertigprodukte und Snacks bewusst und sparsam planen.
– Ausdauersport hilft bei der Regulation des Blutdrucks.
Blutfettwerte
– Der Fokus liegt auf guter Fettqualität, wie kalt gepresstes Raps-, Oliven- und Leinöl sowie Nüsse und Samen. Bewusster Alkoholkonsum ist wichtig für die Blutfettwerte. Maximal ein Glas pro Tag bei Frauen oder zwei bei Männern.
– Regelmässige Bewegung, bestenfalls 30 Minuten pro Tag oder 150 Minuten pro Woche.
für erhöhte Cholesterinwerte kann eine genetische Veranlagung sein, von der in der Schweiz etwa 1 von 200 Personen betroffen ist. Aber auch ungünstige Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht, andere Krankheiten und Medikamente können den Cholesterinspiegel ansteigen lassen.
Konsequenzen eines hohen Blutdrucks
Nicht zuletzt braucht unser Körper einen gesunden Blutdruck, damit das Blut Nährstoffe, Sauerstoff, Wärme, Abfallstoffe und Hormone optimal transportieren und verteilen kann. Ist der Druck in den Arterien dauerhaft erhöht – beispielsweise durch eine Verengung der Gefässe –, kommt es zu Bluthochdruck. In den schlimmsten Fällen führt dieser zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, zu Nierenschäden oder Sehstörungen.
Metabolisches Syndrom: Die folgenschwere Kombination
Insulinresistenz, Bluthochdruck, Übergewicht, ein gestörter Fettstoffwechsel und erhöhter Blutzucker: Häufen sich drei oder mehr dieser Risikofaktoren, spricht man vom metabolischen Syndrom – «Haupttreiber ist dabei die Insulinresistenz», sagt Schoonbee. «Das Syndrom begünstigt viele chronische Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Krebs und psychische Krankheiten sowie Schlaganfälle.» Bis es von der Entstehung des Syndroms zu tatsächlichen Beschwerden und zum Krankheitsausbruch kommt, können mehrere Jahre vergehen. Daher ist es wichtig, frühzeitig gegenzusteuern. HerzKreislauf-Erkrankungen gehören in der Schweiz nebst Krebs mit Abstand zu den häufigsten Todesursachen. Das Schweizerische Konsumentenforum hat 2023 zudem eine Schätzung aufgestellt, dass die Insulinresistenz sowie die damit zusammenhängenden Erkrankungen das Gesundheitswesen geschätzt rund 31 Milliarden Franken kosten – eine Milliarde allein in direktem Zusammenhang mit Diabetes.
Gesund leben und bleiben
Die gute Nachricht: Man kann aktiv etwas für seine Stoffwechselgesundheit tun. Eine ausgewogene Ernährung, Bewegung, guter Schlaf und Stressreduktion sind entscheidend, um zahlreichen Krankheiten vorzubeugen. Es wäre also eigentlich einfach. Doch oft fällt bereits eine gesunde Ernährung schwer – denn über das Essen werden viele Emotionen reguliert. Fachleute empfehlen daher eine langfristige Verhaltensänderung. Ganz am Anfang steht dabei der Mut, etwas zu verändern.
Kennen Sie Ihre Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinwerte? Im Guide für Körperwerte in Balance in der Sanitas Portal App messen und erfassen Sie Ihre Werte und finden wertvolle Empfehlungen. sanitas.com/ stoffwechsel
sanitas.com/audio-cyber

Dean ist Channel Manager Multimedia bei Sanitas und produziert unsere Videos –von Versicherungswissen bis Home-Workouts.

Aufgezeichnet von Kathia Baltisberger Bild Ali Ravau
Wenn ich auf dem Surfbrett stehe, sehe ich nur die Welle und kann an nichts anderes mehr denken. Ich mag dieses Gefühl, eins mit der Natur und dem Wasser zu sein. Gleichzeitig ist man dem Meer ausgeliefert und muss das Beste aus der Situation machen. Vor Kurzem habe ich mich in Sri Lanka zum Surfinstructor ausbilden lassen, um meine Technik zu verbessern und das Meer noch besser analysieren zu können. Wenn ich auf dem Brett liege und nach hinten auf eine Wasserwand blicke, kann das furchteinflössend sein. Mit dem falschen Timing überspült mich die Welle – man muss wissen, wie man in solchen Situationen reagiert. Als Schweizer ist Surfen sicher nicht das perfekte Hobby. Aber ich weiche auf mobile Wellenbecken in der Stadt oder Flusswellen aus und plane alle meine Ferien rund ums Surfen.
Timing ist alles, auch beim Filmen
Mit dabei ist immer meine Kamera – zum Filmen, aber auch zum Fotografieren. Mein zweites grosses Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe. Bei Sanitas bin ich Channel Manager Multimedia und verantworte Videoinhalte für Youtube, die Sanitas Website, Social Media sowie die interne Kommunikation. Darunter auch unsere Workout-Videos und Videos mit Ärztinnen, die über Krankheiten aufklären. Und wir begleiten Sanitas Versicherte in gesundheitlich schwierigen Situationen. Ihre Schicksale sind oft aufwühlend. Anfangs dachte ich, dass man die Personen mit Samthandschuhen anfassen muss. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit ihnen genauso umgehen kann wie mit allen anderen auch. Meine Aufgabe ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie ihre Geschichten authentisch erzählen können.

EXPERTENTIPP
Dr. med. Marc Jungi, Facharzt für Allgemeine Innere Me dizin FMH, Sanacare Gruppenpraxis Bern: «Muskelkater ist grundsätzlich nicht schlimm, aber ein Zeichen dafür, dass der Muskel überfordert wurde. Treten die Schmerzen plötzlich auf – wie ein Messerstich – und werden sie bei Belastung schlimmer, könnte es sich auch um eine Zerrung handeln. Dabei verhärtet sich der Muskel und ist druckempfindlich. Die Zerrung ist also sofort spürbar, der Muskelkater meldet sich erst im Nachhinein. Auch eine Thrombose kann sich durch ähnliche Symptome wie Muskelkater äussern: Schmerzen und verhärtete Muskeln werden dann begleitet von einer sichtbaren einseitigen Schwellung, allenfalls Hautverfärbung und hervortretenden Adern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich zum Arzt.»
Text Julie Freudiger

Die ersten Schwünge auf der Piste, die ersten Langlaufrunden oder einfach ein ungewohntes und anstrengendes Training: Manchmal ist nach dem Sport vor dem Muskelkater. Besonders Bewegungen, bei denen die Muskeln gegen den Widerstand gedehnt werden, zum Beispiel beim Bergablaufen oder bei einer ruckartigen Abbremsbewegung, führen zu den unangenehmen Schmerzen. Ursache sind kleinste Verletzungen des Muskels. Was hilft? Vor allem Ruhe und Schonung. Und bei starker Muskelschwellung ein kühler Umschlag. Später unterstützt vor allem Wärme die Heilung, etwa ein warmes Bad oder ein Saunabesuch. Auch ätherische Öle wie Rosmarin, Pfefferminze oder Arnika können die Beschwerden lindern, da sie die Durchblutung und somit die Regeneration ankurbeln. Erneutes Training oder eine Massage sind entgegen der landläufigen Meinung keine gute Idee. Hingegen kann sanfte Bewegung wie Radfahren zur Erholung der Muskeln beitragen. Spätestens nach einer Woche sollte der Muskelkater abgeklungen sein.
Text Anna Miller Bild Jonathan Labusch
Singen ist erwiesenermassen gesund, macht glücklich und stärkt den Zusammenhalt. Dafür ist der Zürcher Hardchor der lebende Beweis. Und er trifft den Nerv der Zeit – mit Club Closings statt Kirchenliedern.
Es fing alles im Frühling vor zwei Jahren an. Oliver Saiger, 39 Jahre alt, in Zürich zu Hause und in der Geschäftsleitung eines Gastrobetriebs, wollte singen. Die Idee geisterte schon länger in seinem Kopf herum –«warum, weiss ich auch nicht», sagt er und lacht. Er konnte keine Noten lesen und Chorerfahrung hatte er auch nicht. Doch eine Internet-Recherche später war klar: Das, was er suchte, schien es nicht zu geben. «Die bestehenden Chöre, da war irgendwie nichts für mich dabei», erzählt Oliver Saiger – und gründete mit zwei Freunden kurzerhand einen eigenen Chor.
Das erste Treffen fand in einer Bar statt. Bald kam ein Proberaum hinzu, eine ehemalige Töffgarage beim Zürcher Letten. Seither wuchs der Hardchor rasant: Heute zählt er 130 Mitglieder, 50 weitere stehen auf der Warteliste. Und die Auftritte begeistern – an urbanen Orten wie dem Flussbad Letten, dem alternativen Kulturzentrum Rote Fabrik oder dem Club Zukunft, an dessen Closing der Chor sang.
Das Singen im Kollektiv, im lockeren Gefüge, mit Menschen aus dem gleichen sozialen Umfeld, an für Chören unkonventionellen Orten: Der Zürcher Hardchor scheint damit einen Nerv zu treffen. «Das Bedürfnis, sich durch Singen auszudrücken, ist riesig», sagt Saiger. «Ich war selbst verblüfft vom Andrang.» Überraschend ist vielleicht der Ansturm – die positiven Effekte des Singens aber nicht. Denn wer singt, aktiviert ein ganzes Feuer-
werk im Körper. Während des Singens werden Glückshormone ausgeschüttet: Serotonin stabilisiert die Stimmung, Dopamin aktiviert das Belohnungssystem, Endorphine lindern sogar Schmerzen. Wer singt, fühlt sich lebendiger, zentrierter, ausgeglichener. Hinzu kommt: Der Stresspegel sinkt. Studien zeigen, dass der Cortisolspiegel – das zentrale Stresshormon – bereits nach kurzer Zeit des Singens deutlich reduziert wird. Singen beruhigt also das Nervensystem und wirkt wie ein innerer Neustart.
Kollektives Singen verbindet
Besonders wirksam ist der Effekt in der Gruppe. Denn gemeinsames Singen stärkt nicht nur das seelische Wohlbefinden, sondern auch unser Bindungssystem. Beim Chorgesang schüttet der Körper vermehrt Oxytocin aus – das Hormon, das für Nähe, Vertrauen und soziale Bindung sorgt. Der britische Psychologe Robin Dunbar bezeichnet Gruppensingen sogar als «soziale Superkraft», weil es schneller verbindet als viele andere Aktivitäten. Dass sich dabei sogar Herzschlag und Atmung synchronisieren können, haben Experimente längst belegt.
Stärkt Atmung, Immunsystem und Mut
Das ist aber noch nicht alles: Die kontrollierte Atmung, die fürs Singen notwendig ist, stärkt die Atemmuskulatur, fördert das Lungenvolumen und verbessert die Sauerstoffversorgung. Wer regelmässig singt, aktiviert ausserdem sein Immunsystem. Eine Studie der Universität Frankfurt zeigt, dass sich der Anteil von Immunglobulin A im Speichel – ein wichtiger Abwehrstoff –nach dem Singen deutlich erhöht.
Singen bedeutet aber vor allem auch sich trauen.
«Sich auszudrücken, ohne Bewertung. Gerade für Männer ist das oft eine Hürde», sagt Oliver Saiger. Im Chor falle das leichter. «Man ist Teil eines Ganzen, es klingt schnell gut – das schafft ein Erfolgserlebnis. Und man darf laut sein und sich spüren.»
30 % Rabatt auf Gesangs- und Musikunterricht: Mit Matchspace Music buchen Sanitas Versicherte den Musikunterricht günstiger. sanitas.com/ musikunterricht
Immer mehr Singwillige: Der Zürcher Hardchor macht Chorsingen wieder salonfähig.

Keine Lust auf Singen? Anders entspannen: sanitas.com/ entspannen

Mehr Tipps für das Immunsystem: sanitas.com/ immunsystem
Es klingt fast wie ein Gesetz: Kommen Herbst und Winter, haben Psyche und Immunsystem zu kämpfen – mit Dunkel- und Schlappheit, Infekten und Müdigkeit. Wer die Wechselwirkungen zwischen Körper und Kopf versteht, kommt besser durch die kalte Jahreshälfte.
So schlecht scheint die Idee mit dem Winterschlaf gar nicht zu sein. Viele Tierarten ziehen sich zurück, fahren ihren Kreislauf herunter, sobald es kalt und dunkel wird. Und tatsächlich steigt dann auch bei vielen Menschen der Schlafbedarf, Energie und Antrieb lassen nach. Nur läuft der Alltag eben unverändert weiter: früh aufstehen, Termine einhalten, Feierabend, wenn es schon dunkel ist. Das schlägt vielen auf die Stimmung.
Lange Zeit wurden Psyche und Immunabwehr als zwei voneinander abgeschottete Systeme betrachtet. Inzwischen zeigen viele Studien, dass sie eng miteinander verwoben sind und über Botenstoffe dieselbe Sprache sprechen. Zum Glück lässt sich dieses Zusammenspiel positiv beeinflussen.
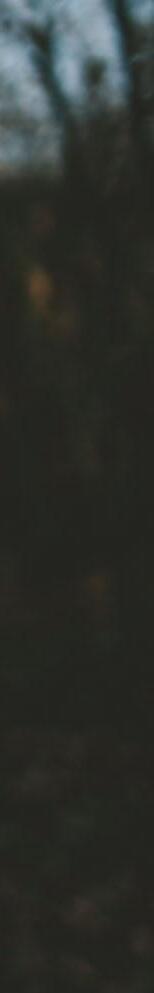
Winterblues hat eine einfach zu erklärende biochemische Ursache: Geht die Intensität des Tageslichts zurück, baut der Körper die Aminosäure Tryptophan vermehrt in das «Schlafhormon» Melatonin um – und weniger in das «Glückshormon» Serotonin wie in der hellen Jahreshälfte. Dadurch sinkt der Serotoninspiegel, Müdigkeit und Stimmungsschwankungen nehmen zu.
Die Extraportion Lux
Löst Lichtmangel Winterblues aus, hilft am besten: Licht! Selbst bei bewölktem Himmel wirkt natürliches deutlich besser als Kunstlicht. Eine halbe Stunde an der frischen Luft kann schon ausreichen, um die Stimmung zu heben. Falls nicht, ist die Wirkung von Tageslichtlampen inzwischen gut belegt. Mindestens 10 000 Lux sollte das weisse, fluoreszierende Licht haben und eine halbe Stunde pro Tag oder länger direkt ins Gesicht scheinen, um Wachheit und Antrieb anzukurbeln.
Gut strukturiert
Eine gute Struktur im Tagesablauf hilft dem Gehirn, in den winterlichen Schlaf-Wach-Rhythmus zu kommen. Zudem verringert alles, was Stress reduziert, Entzündungsherde im Körper und erleichtert dem Immunsystem die Arbeit. Für Wohlfühlmomente können Rituale wie eine Tasse Tee oder eine Wärmflasche auf der Couch sorgen.
Schönes einladen
Sie fühlen sich nicht gut? Im Guide für schnelle
Genesung in der Sanitas Portal App finden Sie medizinische Anlaufstellen, Tipps zur Genesung und Hausmittel. sanitas.com/ genesung
Kalt und dunkel bedeutet oft Rückzug in die eigenen vier Wände. Nur hilft die Couch langfristig nicht gegen Winterblues. Angenehme Gesellschaft und gute Gespräche tun nun gut – wie auch in besseren oder wärmeren Zeiten. Man muss es nur tun: sich verabreden, den Termin einhalten, rausgehen. Gemeinsam zu lachen, bremst Stresshormone aus und sorgt für Serotonin-Nachschub.
Die Heizungsluft ist trocken, die Schleimhäute sind weniger gut durchblutet und Viren überleben in der Kälte leichter: Die Immunabwehr ist im Herbst und Winter besonders gefordert und auf Unterstützung angewiesen.
Gesundes auf dem Teller
Es gibt nicht das eine Wundermittel als Immun-Booster. Wichtig ist ein guter Mix aus Nährstoffen: Vitamin A (etwa in Nüsslisalat, Grünkohl, Sellerie) unterstützt die Arbeit der körpereigenen Immunzellen. Zink und Vitamin C (Broccoli, Zitrusfrüchte, Peperoni) bewirken, dass ein Infekt weniger heftig ausfällt und schneller vorbeigeht. Vitamin E (Leinöl, Haselnüsse, Mandeln) fängt freie Radikale ab. Für Vitamin D benötigt der Körper vor allem Sonnenlicht. Der beste Weg der Vitaminzufuhr ist immer der natürliche. Wer im Winter zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel einnehmen will, sollte dies am besten in Absprache mit einer Arztpraxis tun.
Sport lohnt sich
Für Sport im Freien gibt es viele gute Argumente. Und im Winterhalbjahr noch mehr. Man kommt raus ans Tageslicht, erlebt im besten Fall Glücksmomente. Die Anstrengung an der kalten Luft treibt zudem die Produktion von Immunzellen an, die sich später gegen Bakterien und Viren zur Wehr setzen. Nur zu heftig sollten die Einheiten beim (Lang-)Laufen oder Radfahren nicht ausfallen, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten.
Eiskalt abhärten
Fest steht: Im Winter ins eiskalte Wasser abzutauchen, ist ein gutes Training für die Blutgefässe. Denn um die Körpertemperatur zu halten, ziehen sich diese zusammen. Der Wechsel von Kälte und Wärme stimuliert ausserdem das Immunsystem. Inwieweit Eisbaden tatsächlich vor Infekten schützt, ist aber noch nicht eindeutig belegt.
So erkennen Sie ein Burnout: sanitas.com/ ausgebrannt

Für Thomas Rochat waren insbesondere die Übungen zwischen den Therapiesitzungen hilfreich, um sich besser auf die Therapie einlassen zu können.
Text Julie Freudiger
Keine langen Wartezeiten, schneller Zugang zu Therapeutinnen und Therapeuten, eine fundierte App, um das Gelernte zwischen den Sitzungen zu vertiefen: Das Programm «ylah.therapy» verfolgt den Ansatz der Blended Psychotherapie.
Ich habe die Warnsignale zu lange ignoriert», sagt Thomas Rochat selbstkritisch. «Einerseits wollte ich mir nicht eingestehen, dass mir alles über den Kopf wächst. Andererseits sind die Wartelisten für eine Psychotherapie lang – was bringt es, wenn ich ein halbes Jahr oder länger warten muss, bis ich mit jemandem reden kann?» Immer schlechter kam der Mitvierziger morgens aus dem Bett, war dünnhäutig gegenüber Mitarbeitenden, seine Freunde sah er nur noch selten. «Ich hatte keine Energie mehr, wusste nicht mehr ein noch aus», erzählt Rochat. Er realisierte: Es ist höchste Zeit, Hilfe zu suchen. Und die fand er zu seinem eigenen Erstaunen überraschend schnell.
Persönlich und digital begleitet
Durch Zufall stiess Rochat auf «ylah.therapy» – ein neues Programm für Blended Psychotherapie des Berner Unternehmens Ylah. «Blended» bedeutet, dass die persönliche Therapie mit digitalen Übungen via App kombiniert wird. Die Patientinnen und Patienten erhalten zwischen den Online-Sitzungen auf sie individuell zugeschnittene Aufgaben, Fragebogen und Journale, die sie zeit- und ortsunabhängig bearbeiten und mit denen sie ihre Fortschritte festhalten. Die Einbettung des Gelernten in den Alltag ist dabei der Schlüssel zum Therapieerfolg – aber meistens die grösste Hürde. Denn 50 Prozent dessen, was in der Therapie gesagt wird, ist nach einer Stunde bereits wieder vergessen. Aufgaben zwischen den Gesprächen steigern die Wirksamkeit der Therapie. Das findet auch Rochat: «Die Übungen dazwischen haben mir sehr geholfen. So blieb ich am Ball und habe mehr mitgenommen, als wenn ich nur einmal pro Woche mit meiner Therapeutin geredet hätte.» Ausserdem konnte er direkt nach der Anmeldung in der App starten und so die Wartezeit bis zur ersten Therapiesitzung überbrücken.
Ein vielversprechender Ansatz
Ylah heisst auf Berndeutsch «sich einlassen». Und genau das steht im Zentrum: Die Betroffenen sollen sich auf die Therapie einlassen, um sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen – in der Sitzung wie auch im Alltag. Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis bestätigen, dass ganzheitliche Ansätze im «Blended»-Format die Therapie nachhaltig unterstützen und deren Erfolg fördern können. Und dennoch gibt es bisher nur wenige Angebote, bei denen die digitalen Übungen nahtlos an die persönlichen Gespräche mit der Fachperson anknüpfen. «Für mich war ‹ylah.therapy› ein Glücksfall», sagt Rochat. Er hat mittlerweile Strategien erlernt, dank derer er besser mit Stress umgehen kann. Und auch die Energie ist zurück, um seine Freunde wieder zu treffen.
Sanitas bietet als eine der ersten Partnerinnen schweizweit das Programm «ylah.therapy» an. Weil gute Psychotherapie nicht mit der Sitzung endet, sondern im Alltag weitergehen sollte.
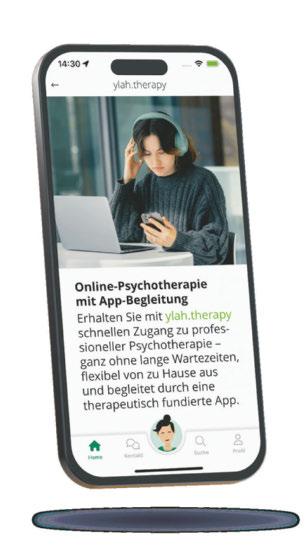
Das Programm «ylah.therapy» steht Sanitas Versicherten auf Deutsch und Französisch zur Verfügung. Voraussetzung ist sowohl eine Grundversicherung als auch eine ambulante oder stationäre Zusatzversicherung bei Sanitas. Die Psychotherapie wird mit einer ärztlichen Verordnung über die Grundversicherung abgerechnet. Die Nutzung der App ist kostenlos. sanitas.com/ylah
Wer in einem Haushalt mit begrenzten finanziellen Mitteln lebt, hat oft Anspruch auf Prämienverbilligung. Was heisst das genau und wo wird diese beantragt?

Mit der Prämienverbilligung unterstützen Bund und Kantone Personen mit geringerem Einkommen, damit die Prämie der obligatorischen Grundversicherung bezahlbar bleibt. Ob und in welcher Höhe jemand Anspruch darauf hat, hängt vom Einkommen, Vermögen, Wohnort und von der familiären Situation ab. Die Prämienverbilligung ist kantonal geregelt: In einigen Kantonen erhalten Anspruchsberechtigte direkt ein Formular von der kantonalen Ausgleichskasse, das sie unterschrieben zurücksenden müssen. In anderen müssen Versicherte den Antrag selbst stellen. Über das Vorgehen informiert man sich am besten bei der zuständigen Stelle im Wohnkanton. Wird der Antrag bewilligt, zahlt der Kanton den Betrag an die Krankenkasse, die ihn direkt von der Prämie abzieht.
Muss man zu viel erhaltene Beiträge zurückzahlen?
Das handhabt jeder Kanton unterschiedlich. In der Regel berechnet der zuständige Kanton die Prämienverbilligung provisorisch, basierend auf den Steuerdaten der Vorjahre. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass das tatsächliche Einkommen höher war, müssen die Versicherten unter Umständen den zu viel erhaltenen Betrag zurückerstatten. Um Überraschungen zu vermeiden, sollten Versicherte deshalb der kantonal zuständigen Stelle das aktuelle Einkommen frühzeitig melden.
Versicherungskauderwelsch?
Unser Lexikon erklärt wichtige Fachbegriffe: sanitas.com/ wissenswert
IMPRESSUM:
Herausgeber Sanitas Management AG, Jägergasse 3, 8021 Zürich, sanitas.com | Kontakt redaktion@sanitas.com | Gesamtverantwortung Claudia Sebald | Redaktion Julie Freudiger (Leitung), Helwi Braunmiller, Kathia Baltisberger, Anne-Sophie Keller, Nicole Krättli, Anna Miller, Irène Maria Schäppi, Stefan Schweiger, Laurina Waltersperger | Übersetzungen Sanitas Übersetzungsdienste | Art Direction Linkgroup AG | Lithografie Detail AG | Druck Stämpfli AG | Bildnachweise Alle nicht gekennzeichneten Bilder sind Eigentum von Sanitas oder von Sanitas lizenziert, Cover: KI-generiert / Sebastian Doerk, S. 8/9 Olena Malik / Moment / Getty Images, S. 18 Nemes Laszlo / Science Photo Library / Getty Images, S. 23 Walter Frehner / unsplash, S. 26 Frederik Franz / True Shot / Westend61, S. 12/20/23 Porträts Illustration grafilu | Gesamtauflage ca. 550 000; 15. Jahrgang; gedruckt auf umweltfreundlichem FSC©-Papier: SGSCHCOC-002716 | Erscheinungsweise 4× jährlich in D, F, I | Das nächste Magazin erscheint im Februar 2026.
Sani und Elina haben Guetsli gebacken – aber Sani hat zu viel Teig genascht und hat nun Bauchweh. Was hilft besser: ein kalter Umschlag auf der Stirn oder ein Fencheltee?

Wettbewerb
Weisst du, was gegen Bauchweh hilft?
Hier nimmst du an der Verlosung teil: sanitas.com/saniundelina
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 6 bunte Thermosflaschen für Kinder von Sigg. Teilnahmeschluss ist der 30. Dezember 2025.
Die Gewinner:innen werden schriftlich informiert. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.
