
GRUSSWORT
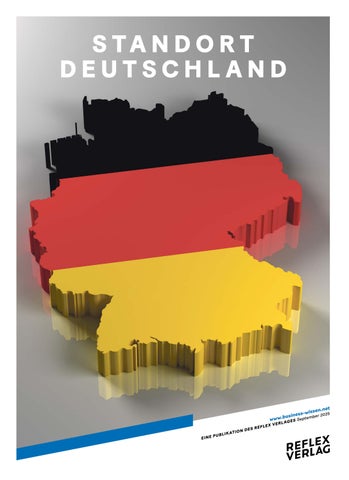

GRUSSWORT
Zugegeben: Die Schlagzeilen klingen oft wenig ermutigend. Marode Brücken, lahmes Netz, hohe Energiepreise – und dazu noch eine Bürokratie, die immer mehr blockiert. Auch die zunehmende Steuer- und Abgabenlast lähmt die Wirtschaft, während die demografische Entwicklung mehr und mehr die Personalsituation vieler Unternehmen verschärft. Auf den ersten Blick ist Deutschland also kein Wirtschaftsstandort mit Glamour-Faktor. Doch in den vielen Herausforderungen können auch Chancen liegen: Deutschland steht an

einem Wendepunkt. Enorme Chancen können sich ergeben, wenn es gelingt, Innovationen schneller auf den Weg zu bringen, die Digitalisierung endlich in den Turbo-Modus zu versetzen und Talente aus aller Welt zu gewinnen. In dieser Beilage blicken wir deshalb genauer hin: Wo drückt wirklich der Schuh? Wo liegen die Stärken, die nicht übersehen werden dürfen? Und welche Perspektiven eröffnen sich für die Zukunft? Antworten finden Sie auf den kommenden Seiten – willkommen bei der Standortdebatte!
Michael Gneuss Chefredakteur
LEITARTIKEL
INFRASTRUKTUR
ENERGIE- UND WASSERSTOFFSTANDORT
REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DIGITALE VERWALTUNG
DIGITALISIERUNG UND KI
FÖRDERUNGEN
FACHKRÄFTEMANGEL
INHALTSVERZEICHNIS
Standort Deutschland kämpft um seine Zukunft — 3
Eine Mammutaufgabe — 5
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit — 7
Das eigene Profil schärfen — 8
Warum Deutschland beim E-Government hinterherhinkt — 9
Die Schlüssel zum Erfolg — 10
Vielfalt hat Licht und Schatten — 12
Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft — 14
JETZT SCANNEN
Lesen Sie spannende Artikel dieser Ausgabe online, und sichern Sie sich ein kostenfreies Digital-Abo www.business-wissen.net www.portal-wissen.net
Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.

Das Papier dieser Reflex-Verlag-Publikation stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
Folge uns auf Instagram, und verpasse keine Ausgabe mehr.

@reflexverlag
LEITARTIKEL | VON MICHAEL GNEUSS
Die Konjunkturschwäche will einfach nicht nachlassen am Wirtschaftsstandort Deutschland. So sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Ende August kletterte die Arbeitslosenzahl erstmals seit einem Jahrzehnt wieder über die Drei-Millionen-Marke. Bereits zuvor hatte Creditreform gemeldet, dass im ersten Halbjahr rund 11.900 Unternehmen Insolvenz angemeldet hätten – eine so hohe Zahl hat es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben.
Zum Jahresanfang zeigten sich am Standort Deutschland noch erste zarte Hoffnungsschimmer: So war die Wirtschaft in den ersten drei Monaten dieses Jahres noch leicht um 0,4 Prozent gegenüber dem Zeitraum Oktober bis Dezember 2024 gewachsen. Nun sieht es so aus, als ob der zaghaften Erholung bereits die Puste ausgegangen ist.
Keine Frage, die Unsicherheit bleibt hoch. Dabei sind die zentralen Probleme schnell benannt: zu viel Bürokratie, Kostensteigerungen –insbesondere bei Energie- und Lohnkosten –, Fachkräftemangel, eine in die Jahre gekommene Infrastruktur und eine allgemein schwache Auftragslage. Darüber hinaus hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf bei der Digitalisierung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Das betrifft die öffentliche Verwaltung ebenso wie die Unternehmen. Last but not least
belasten geopolitische Konflikte wie in der Ukraine oder dem Nahen und Mittleren Osten die Stimmung, und natürlich stellt auch die US-Zollpolitik ein großes Risiko dar.
Viele Probleme hausgemacht
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele der heutigen Probleme hausgemacht sind. Die vielleicht größten Versäumnisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte liegen in der Energiepolitik und der Digitalisierung. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der notwendigen Stromnetzinfrastruktur wurde viel Zeit vergeudet. Die Abhängigkeit von Importen fossiler Energien erwies sich als gravierender Schwachpunkt. Offen zutage trat dies mit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen für die Gasimporte aus Russland nach Deutschland.
Digitalisierung und KI sind entscheidende Standortfaktoren.
Im Bereich der Digitalisierung, speziell bei der digitalen Verwaltung, hinkt Deutschland im europäischen Vergleich immer noch hinterher. Während in anderen Ländern Behördengänge mit wenigen Klicks erledigt werden können, scheitern
„Partnerschaften zur Fachkräftesicherung”
Johannes Ebert ist Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender des Goethe-Instituts. Mit 150 Instituten in 99 Ländern fördert es die Kenntnis der deutschen Sprache, pflegt internationale kulturelle Zusammenarbeit und vermittelt ein zeitgemäßes Deutschlandbild. Seit über 15 Jahren engagiert sich das Goethe-Institut in Projekten zur Fachkräfteeinwanderung.
Herr Ebert, Deutschland braucht Fachkräfte. Was hat das mit dem Goethe-Institut zu tun? Ohne gezielte Zuwanderung aus Drittstaaten lässt sich der Fachkräftemangel nicht beheben. Das Goethe-Institut unterstützt weltweit Menschen, die sich für einen beruflichen Weg in Deutschland entscheiden. Wichtig ist uns, Migration als ganzheitlichen Prozess zu sehen und Fachkräfte bereits im Herkunftsland zu begleiten. Wir bieten Deutschkurse, Prüfungen und kultursensible Vorbereitung, z. B. zu Unterschieden in
Arbeitskulturen. Eine gute Vorbereitung erleichtert den Einstieg in Leben und Arbeit in Deutschland. Insbesondere Sprachkenntnisse fördern gesellschaftliche Teilhabe. Mit Angeboten wie „Fit für den deutschen Arbeitsmarkt“ (FIMA), in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit (BA), gehen wir auf diesen Bedarf ein.
Was leistet „Fit für den deutschen Arbeitsmarkt“ konkret?
FIMA bereitet 2.200 Fachkräfte und Ausbildungsinteressierte in Mexiko, Brasilien und Kolumbien auf den deutschen Arbeitsmarkt vor. Einige Teilnehmende sind bereits erfolgreich in Deutschland beschäftigt. Wir übernehmen Kosten für Deutschkurse, visumsrelevante Prüfungen und kultursensible Trainings. Die BA schließt Vermittlungsabkommen mit Partnerländern, bietet Rekrutierung und Vermittlung an deutsche Arbeitgeber an und unterstützt bei Abschlussanerkennung sowie
SCHON GEWUSST?
In der Rezession Für das vergangene Jahr ermittelten die Experten des Statistischen Bundesamtes für die deutsche Wirtschaft ein Bruttoinlandsprodukt von rund 4,3 Billionen Euro. Damit war das BIP das zweite Mal in Folge geschrumpft – und zwar um 0,5 Prozent; nach minus 0,9 Prozent im Jahr 2023. Für das aktuelle Jahr erwarten die Statistiker führender Institute eine Stagnation, bestenfalls ein minimales Wachstum von etwa 0,1 bis 0,2 Prozent. Erst für 2026 prognostizieren Experten wieder etwas stärkere Zuwächse, nachdem die Wirtschaft insgesamt mehrere schwierige Jahre mit nur schwachem oder negativem Wachstum durchlaufen hat.
hierzulande viele Prozesse an komplizierten Formularen oder bestehenden Kommunikationsbarrieren zwischen Behörden. Dies kostet Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen. Dabei sind Digitalisierung und inzwischen auch KI entscheidende Standortfaktoren. So kann KI dabei helfen, etwa Prozesse in der Produktion zu optimieren, Medikamente zu entwickeln oder Energienetze intelligent zu steuern.
Visabeantragung. Im Fokus stehen Branchen mit hohem Fachkräftebedarf wie Gesundheit, Handwerk und Technik.
Was haben deutsche Unternehmen davon? FIMA ermöglicht Unternehmen Zugang zu motivierten, qualifizierten und gut vorbereiteten Fachkräften und Ausbildungsinteressierten. Die Kosten für Sprachkurse und Prüfungen sind reduziert – das entlastet die Unternehmen. Die Unterstützung für Fachkräfte und Unternehmen ist transparent und fair. Dies sind wichtige Voraussetzungen für ein gutes Ankommen und Bleiben im Betrieb.

Johannes Ebert ist seit 2012 Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender des Goethe-Instituts.
Wie wichtig sind solche Kooperationen für die Fachkräftesicherung? Entscheidend ist, dass Zuwandernde einen gut vorbereiteten und sicheren Weg nach Deutschland gehen: dass sie Deutsch lernen, über ihr zukünftiges Arbeitsund Alltagsleben informiert sind und den Zuwanderungsprozess kennen. Starke Partnerschaften, wie mit der BA, ermöglichen, dass jeder Akteur seine Expertise einbringt. Je mehr strukturierte Angebote es gibt, desto größer der Nutzen für Unternehmen, Fachkräfte und die Gesellschaft. www.goethe.de/fima-arbeitgeber
MEHR INFORMATIONEN
FIMA wird co-finanziert durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU.
Damit dies gelingt, braucht es jedoch mehr Investitionen in Forschung, Rechenkapazitäten und digitale Bildung. Förderungen für solche Zukunftsprojekte sind in Deutschland zwar vorhanden, aber die Zugänge dahin oft kompliziert. Ein Dickicht aus Förderprogrammen von Bund, Ländern und EU überfordert viele, vor allem innovative Start-ups. Eine Vereinfachung und Beschleunigung der Abwicklung wären ein großer Gewinn.
Fachkräfte aus dem Ausland überlebenswichtig Klar ist, dass ohne die richtigen Köpfe vieles im Argen bleiben wird. Das Fachkräftepotenzial aus dem Ausland ist daher überlebenswichtig. Deutschland muss für internationale Talente attraktiver werden. Dazu gehören schnellere und unbürokratischere Anerkennungsverfahren für Berufsabschlüsse, mehr englischsprachige Services in Behörden und eine willkommen heißende Gesellschaft. Der Fachkräftemangel ist eine der größten Bedrohungen für den Wohlstand von morgen. Ist also alles dünn am Standort D? Keineswegs, denn es gibt auch Hoffnungsschimmer und große Chancen. Deutschland hat das Potenzial, zu einem der führenden Energieund Wasserstoffstandorte Europas zu werden. Der ambitionierte Ausbau von Wind- und Solarenergie schreitet voran. Vor allem im Bereich des grünen Wasserstoffs, der mit Ökostrom hergestellt wird, können deutsche Unternehmen als Technologieführer weltweit Maßstäbe setzen. Wasserstoff wird als Schlüsselelement für eine klimaneutrale Industrie gesehen. Hier kann Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen.
Herausforderungen sind erkannt Positiv ist auch, dass die Politik die Herausforderungen erkannt hat und versucht, mit gezielten Maßnahmen darauf zu reagieren.

und KI
In puncto Infrastrukturerneuerung etwa hat die neue Bundesregierung das 500 Milliarden Euro schwere „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ auf den Weg gebracht. Weitere Beispiele für den „Erkenntnisprozess“ sind das Wachstumschancen-Gesetz und das Zukunftsfinanzierungs-Gesetz. Das Wachstumschancen-Gesetz sieht unter anderem die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter vor, um Investitionen zu stimulieren. Das Zukunftsfinanzierungs-Gesetz wiederum soll den Finanzstandort stärken und Start-ups den Zugang zu privatem Kapital erleichtern. Eine wichtige Maßnahme ist auch die schrittweise Absenkung der
Umfrage zu Geschäftsrisiken von Unternehmen der Industrie in Deutschland 2024 Welche Geschäftsrisiken sehen Sie für Ihre Unternehmen innerhalb der nächsten Monate?
Körperschaftsteuer ab 2028. Trotz aller Maßnahmen und Programme muss klar sein, dass Deutschland letztlich einen grundlegenden Mentalitätswandel braucht. Die aktuellen politischen Reformen sind wichtige erste Schritte, aber sie müssen von einer konsequenten Umsetzung begleitet werden. Die Chancen, die der Standort bietet – von der Stärke des Mittelstands bis zu den neuen Förderprogrammen – sind real. Doch die Risiken wie eine weiterhin fragile Konjunktur und die geopolitischen Unsicherheiten sind es ebenso. Die entscheidende Frage ist, ob Deutschland es schafft, seine strukturellen Schwächen zu beheben und sein enormes Potenzial tatsächlich zu entfesseln.
INFRASTRUKTUR | VON JÜRGEN ACKERMANN
2024 stürzt die Carolabrücke in Dresden ein, 2025 muss in Berlin die viel befahrene Westendbrücke nahezu über Nacht gesperrt und abgerissen werden. Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie es um die Infrastruktur in Deutschland bestellt ist. Überall bröckelt die sprichwörtliche Fassade. Deutschlands Infrastruktur befindet sich am Rande des Zusammenbruchs.
Rund 130.000 Brücken gibt es im Land, etwa 5.000 davon sind laut Bundesverkehrsministerium dringend reparaturbedürftig oder müssen neu gebaut werden. Laut einer Studie der Verkehrs-NGO Transport & Environment
Nicht nur auf Straßen und Brücken macht sich der Investitionsstau bemerkbar.
sind etwa 16.000 Brücken bundesweit in einem bedenklichen Zustand. Und: Allein Ersatzneubauten würden rund 100 Milliarden Euro kosten. Auch das Straßennetz ist in einem erbärmlichen Zustand. Der Sanierungsbedarf allein bei Fernstraßen beträgt aktuell fast 25.000 Kilometer. Rund 11.000 Kilometer davon entfallen auf Autobahnen. Nicht besser sieht es auf der Schiene –und auch hier gerade bei Brücken – aus. Nach einer Schätzung der Deutschen Bahn (DB) sind 1.160 Bahnbrücken in einem Zustand, der einen
Neubau erfordert. Bis 2029 will die Bahn insgesamt 2.000 Brücken modernisieren. Die Gründe für den Verfall sind bekannt. Ein seit vielen Jahren verschleppter Investitionsstau ist die zentrale Ursache. So liegen allein die kommunalen Rückstände laut einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) 2025 bei rund 216 Milliarden Euro.
Investitionsstau nicht nur auf der Straße Doch nicht nur auf Straßen und Brücken macht sich der Investitionsstau bemerkbar: Auch bei der digitalen Infrastruktur hinkt Deutschland
Die Carolabrücke in Dresden war 2024 eingestürzt.

„Geld allein baut keine Infrastruktur”
Christian Strunk, Präsident des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO), über die Rolle von Kies, Sand, Schotter und Splitt für die Modernisierung Deutschlands.
Wie bewerten Sie das milliardenschwere Infrastrukturpaket der Bundesregierung? Die Richtung stimmt. Investitionen in Straßen, Brücken, Bahnlinien, Schulen oder Windräder sind Investitionen in die Zukunft der Bundesrepublik. Ohne die Verfügbarkeit von Kies, Sand und Hartgestein scheitern aber die angekündigten Milliardeninvestitionen an der Umsetzung. Klar muss also sein: Geld allein baut keine Infrastruktur.
Mangelt es an mineralischen Rohstoffen in Deutschland? Keineswegs. Geologisch gesehen verfügen wir über ausreichende Vorkommen. Was fehlt, sind vielmehr pragmatische und verlässliche Genehmigungsprozesse. Für

Christian Strunk, Präsident des Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO)
neue Gewinnungsprojekte liegt die Genehmigungsdauer teils bei über zehn Jahren. Das ist inakzeptabel. Viele Anträge liegen in Schubladen, blockiert durch überkomplexe Verfahren oder politisches Zögern auf Landes- und Kommunalebene. So entstehen regionale Engpässe und lange Transportwege quer durch das Land. Insgesamt gibt es also einen Genehmigungsmangel
hinterher. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) beklagen inzwischen mehr als ein Viertel der Unternehmen, dass der schnelle Internetzugang vor Ort nicht ausreichend sei. Gleiches gilt für digitale Behördenleistungen.
Viele Probleme werden durch die föderalen Strukturen in Deutschland noch verstärkt. So arbeiten Städte, Länder und Bund oft isoliert. Unkoordinierte Zuständigkeiten bei Planung und Umsetzung wirken vielfach als Bremsklötze.
Milliarden für die Infrastruktur
Die neue Bundesregierung will nun der Infrastrukturmisere mit einem 500 Milliarden Euro schweren „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ zu Leibe rücken. 100 Milliarden davon sollen für Investitionen der Länder bereitstehen, weitere 100 Milliarden für den Klimaschutz. Die restlichen 300 Milliarden Euro bekommt der Bund für zusätzliche Investitionen etwa in die Verkehrs-, Energie-, Krankenhaus-, Bildungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, in den Zivil- und Bevölkerungsschutz, die Digitalisierung sowie für Forschung und Entwicklung.
Eines ist klar: Es ist höchste Eile geboten, denn eine moderne Infrastruktur ist für ein Industrieland wie die Bundesrepublik unabdingbar. Sie sichert Wirtschaftskraft, Innovationsfähigkeit, Lebensqualität und Klimaziele. Ohne sie droht Deutschland auf Dauer der Verlust seiner Wirtschaftskraft.
und keinen Rohstoffmangel. Das schadet nicht nur der Bauwirtschaft, sondern ist auch ökologisch widersinnig.
Was müsste aus Ihrer Sicht passieren? Wir fordern bezüglich der Genehmigung neuer Flächen sowohl eine Änderung des Planungsrechts als auch eine klare Beschleunigung der Verfahren, ähnlich wie das bei großen Verkehrs- und Energieprojekten inzwischen möglich ist. Rohstoffsicherung ist Teil der Daseinsvorsorge und muss politisch auch so behandelt werden. Und wir brauchen eine klare Priorität im Planungsrecht für heimische Ressourcen als überragendes öffentliches Interesse. Eine auf Dauer tragfähige Infrastrukturpolitik kann nicht auf Rohstofflieferungen aus Übersee gründen.
Wie lässt sich das mit den Klimazielen vereinbaren? Sehr gut, wenn man regional denkt. Kurze
Transportwege, moderne Gewinnungstechnik und umfassende Rekultivierung senken Emissionen und stärken die regionale Akzeptanz. Aber dafür braucht es auch ein gesellschaftliches und politisches Bekenntnis, dass Rohstoffgewinnung Teil der Energiewende und einer Erneuerung der Infrastruktur ist. Rohstoffe sind das Fundament für diesen Wandel in unserem Land.
Wie hoch ist denn eigentlich aktuell der Bedarf an mineralischen Rohstoffen? Jährlich rund 500 Millionen Tonnen. Dafür stehen rund 1.600 mittelständisch geprägte Unternehmen, 2.700 Kiesgruben und Steinbrüche und mehr als 22.000 Beschäftigte bereit. Die Branche liefert, wenn man sie lässt. Dafür brauchen wir einen verlässlichen Rahmen, der Investitionen und Planungssicherheit ermöglicht. Jede Infrastrukturmaßnahme beginnt mit der Baggerschaufel. Das sollten wir politisch ernst nehmen.
ENERGIE- UND WASSERSTOFFSTANDORT | VON KATHARINA LEHMANN
Die Ziele sind ambitioniert: Bis 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein. Aber zu welchem Preis? Schon heute ächzen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen unter hohen Energiekosten. Dennoch steht die Mehrheit der Deutschen hinter der Energiewende. Aktuell wird an der einen oder anderen Stelle aber auch in den Rückwärtsgang geschaltet. Auch die Nationale Wasserstoffstrategie –einst Hoffnungsträger für Innovationen, Wachstumsimpulse und Zukunftsfähigkeit –kommt nicht wie einst gewünscht voran.
Die Energiewende gilt als Jahrhundertaufgabe. Doch der Weg zur klimaneutralen Zukunft ist noch weit – und er wird teuer. Das belegt eine aktuelle Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die den ökonomischen Kern des Problems schonungslos aufzeigt: Die Energiewende könnte zwar Einsparpotenziale von über einer Billion Euro eröffnen, demgegenüber stehen jedoch Kosten in Höhe von 4,8 bis 5,4 Billionen Euro für den Zeitraum 2025 bis 2049. Beim derzeitigen Kurs drohen Überforderung, Standortschwäche und zunehmende Zweifel an der industriellen Zukunft des Landes. DIHK-Präsident
Was gestern der Autobahnanschluss war, ist heute ausreichend verfügbarer Platz mit einer gesicherten Versorgung durch erneuerbare Energien. Beides hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE) zur Genüge: mehr als 300 Hektar sofort verfügbare, voll erschlossene großflächige Gewerbe- und Industriegebiete, niedrige Quadratmeterpreise, eine ausgebaute Infrastruktur zu Straße, Schiene, Luft und Wasser, eine gesicherte Versorgung mit grünem Strom direkt vom Erzeuger, die anstehende G3-Zertifizierung kooperierender Gewerbegebiete und vor allem – kurze und direkte Wege zu Entscheidern auf kommunaler, regionaler und Landesebene.
Mit der zentralen Lage zwischen Skandinavien, dem Baltikum und den Metropolregionen Berlin, Hamburg und Stettin bietet MSE Standortvorteile, die Unternehmen in den wirtschaftsstarken Regionen West- und Süddeutschlands nicht mehr finden. Wir nehmen den etablierten Wirtschaftsregionen aber
Peter Adrian warnte, die Energiewende sei „mit der aktuellen Politik nicht zu stemmen“. Energiekosten in Deutschland gehören zu den höchsten in Europa – ein Befund, den Unternehmen schon
59 Prozent der größeren
Industrieunternehmen prüfen, ihre Produktion im Inland einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern.
lange beklagen. Im DIHK-Energiewende-Barometer gaben 59 Prozent der größeren Industrieunternehmen an, ihre Produktion im Inland einzuschränken oder Verlagerungen ins Ausland zu prüfen. Vor zehn Jahren waren es nur rund 22 Prozent. Energieintensive Branchen wie Chemie, Metall oder Glas ziehen daraus längst drastische Konsequenzen. Für sie gilt: Wenn Strom und Gas zu Hause kaum noch bezahlbar sind, werden Fabriken anderswo gebaut.

Sabine Lauffer, Geschäftsführerin Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbH
nichts weg. Wir bieten dort ansässigen Unternehmen mit Expansionsplänen jedoch Perspektiven, die sie in der Heimatregion nicht haben.
Dass hinsichtlich der Entscheidungskriterien für einen Standort Investoren und Projektentwickler umdenken, belegen unsere Präsentationen auf großen Konferenzen und Messen. Sei es die Expo Real München, die Real Estate Hannover, die Private-Equity-Konferenz der NRW.Bank oder das Treffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall – die Mecklenburgische Seenplatte ist als Ansiedlungs- und Investitionsstandort mit Zukunft bei Investoren und Unternehmen angekommen.
www.wirtschaft-seenplatte.de
Dabei zeigt sich ein Dilemma: Investitionen in klimafreundliche Technologien sind oftmals mit Unsicherheit behaftet, ohne dass sie kurzfristig Wettbewerbsvorteile sicherten. Hohe Vorlaufkosten, unklare Förderbedingungen und schwierige Genehmigungsverfahren lassen viele Entscheider zögern. Im Hintergrund wächst die Sorge, dass die Transformation am Ende weniger auf Innovation, sondern auf Deindustrialisierung hinausläuft.
Die Bevölkerung ist voraus – Politik und Wirtschaft suchen noch den Kurs Trotz aller wirtschaftlichen Sorgen ist die Stimmung in der Bevölkerung erstaunlich robust. Eine repräsentative Umfrage des Instituts Pollytix im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe zeigt: 73 Prozent der Befragten unterstützen die Energiewende. Eine klare Mehrheit befürwortet Investitionen in erneuerbare Energien und lehnt den Bau neuer fossiler Kraftwerke ab. Besonders hoch ist die Zustimmung beim Ausbau von Solarenergie auf Hausdächern – 71 Prozent wünschen sich eine Fortführung der Förderung. Dieses öffentliche Bekenntnis könnte der Politik eigentlich Rückenwind geben. Doch die Realität ist widersprüchlich. Während die Wirtschaft über Kosten und Unsicherheit klagt, fordern Bürgerinnen und Bürger mit Nachdruck umweltfreundliche Lösungen. Die Frage ist daher weniger, ob die Energiewende kommt, als vielmehr, wie sie organisiert wird, ohne Unternehmen zu überlasten und den Standort zu schwächen.
SCHON GEWUSST?
Erneuerbare auf Rekord Windkraft und Photovoltaik, Wasserkraft und Biogas – die erneuerbaren Energien sind inzwischen zu Deutschlands wichtigster Energiequelle geworden. 59,4 Prozent des Stroms, der im vergangenen Jahr hierzulande erzeugt und ins Netz eingespeist wurde, stammte aus regenerativen Quellen. Im Jahr 2024 sei fast in allen Monaten mehr Strom aus erneuerbaren als aus konventionellen Energieträgern wie Kohle und Erdgas ins deutsche Stromnetz geleitet worden, teilte das Statistische Bundesamt mit. Den größten Beitrag leisten Wind- und Solarenergie, daneben spielen Biomasse und Wasserkraft eine Rolle. Demgegenüber verliert vor allem die Kohle an Bedeutung. Ihr Anteil an der inländischen Stromproduktion sank im Jahr 2024 auf einen Tiefststand von 22,5 Prozent. 2023 waren es noch 25,9 Prozent gewesen. Schwankungen in der Stromproduktion der erneuerbaren Energien gibt es je nach Witterung, doch der allgemeine Trend zeigt klar nach oben. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen.

Der Streit um die Gaskraftwerke Eine Antwort wollte der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seinem Konzept wasserstofffähiger Gaskraftwerke geben. Sie sollten als Reservekraftwerke die Versorgung sichern, wenn Sonne und Wind nicht genügend Energie liefern – und perspektivisch auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Damit wären sie ein Bindeglied zwischen heutiger Energiesicherheit und der angestrebten Wasserstoffwirtschaft. Doch unter der neuen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich die Richtung verschoben: Statt auf Wasserstoff-ready- setzt sie auf sogenannte CCS-ready-Kraftwerke, bei denen das CO₂ abgeschieden und gespeichert werden soll. Fachleute halten die Technologie jedoch für teuer und riskant. Hinzu kommt der Zeitfaktor: Der Bau neuer Kraftwerke dauert etwa fünf Jahre, anschließend arbeiten sie mindestens zwei Jahrzehnte. Damit droht Deutschland seine selbst gesteckten Ziele – bis 2035 eine klimaneutrale Stromversorgung zu schaffen – zu verfehlen.
Nationale Wasserstoffstrategie:
Ein großer Plan, keine Fortschritte Dass der Energieträger Wasserstoff eine Schlüsselrolle für die Zukunft einnehmen soll, gilt in Politik und Wirtschaft als Konsens. Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS), 2020 unter Kanzlerin Merkel gestartet und später von der Ampelregierung fortgeschrieben, wollte Berlin nichts weniger als den Grundstein für eine neue Industrie legen: Wasserstoff als Brennstoff für klimaneutrale Stahlproduktion, als Treibstoff für Nutzfahrzeuge, als Speichermedium für überschüssigen Strom aus Wind und Sonne. Milliarden sollten in Elektrolyseure, Leitungen, Importabkommen und Pilotprojekte fließen. Die Hoffnung war, Deutschland zum Technologieführer zu machen. Hinzu kamen Überzeugungen, dass sich daraus für Wasserstoff-Start-ups sowie Maschinen- und Anlagenbauer lukrative Exportchancen ergeben könnten und obendrein neue Arbeitsplätze. Tatsächlich gehört Deutschland bei Elektrolyseuren und Brennstoffzellen bereits
Im Emsland entsteht eine Leuchtturmregion für die Energiewende. In der traditionellen Energieregion sollen bald große Mengen des in Deutschland geplanten grünen Wasserstoffs produziert werden. Und Wasserstoff findet hier in vielen Projekten direkte Anwendung. Die EU zeichnete das Emsland jetzt als „Hydrogen Valley of the Year 2024“ aus. Mehr dazu erzählt uns Dr. Tim Husmann.
Was bedeutet die Auszeichnung „Hydrogen Valley of the Year” für das Emsland?
Es ist eine große Anerkennung für die Innovationskraft und das Engagement im Bereich Wasserstoff.
Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung des Standorts auf europäischer Ebene und zeigt, dass sich Investitionen in Deutschland lohnen.
Was für Investitionen sind das?
Wir rechnen damit, dass Unternehmen in den kommenden Jahren rund zwei Milliarden Euro in die Region investieren werden. Das betrifft den Ausbau der Infrastruktur, Produktionsanlagen und die Integration modernster Technologien. Künstliche Intelligenz ermöglicht es uns dabei, Prozesse zu optimieren. Energie und KI gehen hier Hand in Hand – das ist essenziell für eine nachhaltige, "net-zero" orientierte Zukunft.
international zur Spitzengruppe. Mittlerweile sieht die Realität jedoch ernüchternd aus. Von den bis 2030 geplanten zehn Gigawatt Produktionskapazität für grünen Wasserstoff sind bislang nur 0,16 Gigawatt umgesetzt –das entspricht mageren 1,6 Prozent. Weitere 200 Megawatt sind im Bau. Milliardenprojekte wurden gestoppt oder verzögern sich aufgrund gestiegener Bau- und Finanzierungskosten oder Firmenpleiten. „Die Ziele für den Wasserstoffhochlauf 2030 werden krachend verfehlt“, warnt Dr. Felix Matthes, Interims-Vorsitzender des Nationalen Wasserstoffrats.
Gefahr für den Industriestandort
Das zentrale Risiko: Deutschland droht in einem strategischen Zukunftsfeld den Anschluss zu verlieren. Während Länder wie die USA mit dem Inflation Reduction Act großzügige Subventionen verteilen und China massiv in Elektrolyseure und Exportkapazitäten investiert, ringt Berlin um Förderkriterien, Netzinfrastruktur und Genehmigungsverfahren. Unternehmen, die weltweit produzieren, könnten sich entschließen, neue Wasserstoffwerke gleich in Nordamerika oder Asien zu errichten. Die neue Bundesregierung mit Wirtschafts- und Energieministerin Reiche hat daher angekündigt, „pragmatischer“ zu werden und neben grünem Wasserstoff auch blauen und grauen Wasserstoff einzubeziehen – also Varianten, die aus Erdgas gewonnen werden, zum Teil mit CO₂-Abscheidung. Ökologisch ist das zwar problematisch, ökonomisch aber realistischer als ein alleiniger Fokus auf grünen Wasserstoff. Kritiker befürchten jedoch, dass dieser „Pragmatismus“ den Markthochlauf klimafreundlicher Technologien verzögert und die Glaubwürdigkeit der Energiewende gefährdet. Wenn Deutschland seinen Status als führender Industriestandort behalten will, muss es nun schneller und konsequenter handeln: durch innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, durch eine spürbare Entlastung bei den Energiekosten und durch den entschlossenen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Noch ist es nicht zu spät. Aber der Handlungsspielraum schrumpft.
Welche Akteure sind beteiligt?
Das Spektrum ist breit gefächert: Große Player wie BP und RWE treiben die Entwicklung maßgeblich voran, aber auch mittelständische Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle. Gemeinsam schaffen sie ein starkes Netzwerk für Wasserstoffproduktion, -transport und -nutzung. Das Emsland nimmt mit seiner Innovationskraft und seinem starken Mittelstand eine Schlüsselrolle bei der Energiewende ein. Der Erfolg des Hydrogen Valley Emsland ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
www.hydrogen-valley.eu info@h2-region-emsland.de

REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG |
Hightech-Chips aus Dresden, Autos aus Wolfsburg oder Stuttgart, Technologie aus München, Kohle aus dem Pott – die deutschen Regionen haben sich wirtschaftlich ganz unterschiedlich ausgerichtet. Wichtig ist dabei immer: die eigenen Stärken zu kennen und auszuspielen und das Profil zu schärfen. Und natürlich gilt es, den Strukturwandel nicht aus den Augen zu verlieren und die Wirtschaft der eigenen Region zukunftsfähig aufzustellen.
Das Herz der europäischen Halbleiterproduktion schlägt in Ostdeutschland – so äußerte sich Carsten Schneider, seinerzeit Ostbeauftragter der Bundesregierung, heute Umweltminister, als der taiwanesische Chipkonzern TSMC ankündigte, seinen ersten europäischen Standort in Dresden zu errichten. Doch nicht nur TSMC glaubt an den Standort; auch Infineon und Bosch investieren massiv in ihre Werke in der Region. Dresden gilt als Zentrum der Mikroelektronik. Das liegt auch daran, dass die Stadt seit Jahrzehnten auf gezielte Clusterbildung setzt: Hochschulen, Forschungsinstitute wie das Fraunhofer-Institut und zahlreiche Mittelständler bilden ein dichtes Ökosystem, das Fachkräfte anzieht und Innovationen fördert. Zum anderen unterstützt die sächsische Landespolitik den Hightech-Standort durch gezielte Fördergelder, Infrastrukturprojekte und internationale Vernetzung. Die Kombination aus starker Wissenschaftslandschaft, passgenauer regionaler Wirtschaftsförderung und klarer Profilierung als „Silicon Saxony“ macht Dresden zum Magneten
für Zukunftsinvestitionen. Dresden zeigt, wie wichtig es ist, regionale Wirtschaftsförderung strategisch auszurichten. Regionen können nicht alles gleichzeitig sein – sie müssen auf ihre besonderen Stärken setzen, um ein klares Profil zu entwickeln, das national wie international sichtbar wird. Wirtschaftsförderung bedeutet daher weit mehr als die Vergabe von Subventionen. Sie muss Standorte aufbauen, in denen Unternehmen Fachkräfte, Zulieferer und Forschungspartner finden. Gleichzeitig geht es darum, die Schwächen einer Region zu erkennen und zu beheben – sei es ein Mangel an Infrastruktur, zu wenig Breitband oder fehlender Wohnraum für Fachkräfte. Richtig eingesetzt , schafft Wirtschaftsförderung Wertschöpfung vor Ort, bindet Unternehmen an die Region und eröffnet die Chance, in globalen Zukunftsmärkten mitzuspielen.
Die Zukunft im Blick Doch nicht nur die Gegenwart, auch die Zukunftsfähigkeit muss stets im Blick bleiben. Strukturwandel ist unausweichlich – und wer ihn verschläft, zahlt einen hohen Preis. Das zeigt der Ruhrpott: Jahrzehntelang lebten die Menschen im Pott gut von Kohle und Stahl, doch als diese Industrien schrumpften, fehlte lange Zeit eine klare Strategie für neue Beschäftigungsfelder. Die Folge: M ehr und mehr Arbeitsplätze verschwanden, Fachkräfte wie Unternehmer wanderten ab, diejenigen, die blieben, wurden zunehmend pessimistischer. Ein langwieriger Anpassungsprozess begann.
Hilden zeigt Profil: In wenigen Jahren hat sich die Stadt im Kreis Mettmann zu einem starken Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungszentrum entwickelt. Besonders deutlich ist das Wachstum im Versicherungs- und Bancassurance-Sektor.
Die HDI Deutschland AG, die zum Talanx-Konzern gehört, stärkt ihren Standort in Hilden: Bis Ende 2026 steigt die Mitarbeiterzahl von rund 800 auf etwa 1.400. Ziel ist die enge Verzahnung der Bereiche Leben und Bancassurance im modernisierten Gebäude am Proactiv-Platz 1 – ausgestattet mit hochmodernen Arbeitsplätzen und einem hybriden Arbeitsmodell.
„Mit der Bündelung unserer Ressorts Leben & Bancassurance in Hilden möchten wir die Zusammenarbeit intensivieren, Effizienzpotenziale heben und unseren Kunden einen noch besseren
Service bieten. Hilden ist dafür ideal: technisch bestens angebunden, zentral gelegen und mit einer offenen, wirtschaftsfreundlichen Plattform“, erläutert Holm Diez, Mitglied im Vorstand der HDI Deutschland AG, verantwortlich für das Ressort Leben & Bancassurance.
Auch Bürgermeister Claus Pommer betont die Bedeutung der Investition: „Die Konzentration zentraler Funktionen in Hilden unterstreicht eindrucksvoll, wie attraktiv unsere Stadt als Finanzstandort ist. Wir bieten Unternehmen ein modernes Umfeld, verlässliche Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die Wachstum ermöglichen.“
Mit der HDI, Ökoworld und der Sparkasse HRV beschäftigt Hilden die meisten Menschen im Finanzsektor des Kreises Mettmann. Weitere Aushängeschilder sind
Ein ähnliches Bild zeigt sich derzeit in der Lausitz, wo der Kohleausstieg ganze Regionen zum Umdenken zwingt. Werden Alternativen nicht rechtzeitig aufgebaut, droht ein Vakuum, das die wirtschaftliche Substanz aushöhlt und soziale Spannungen verstärkt.
Doch Strukturwandel kann auch eine Chance sein. Nordrhein-Westfalen etwa hat in Teilen gelernt, sich neu zu erfinden: Heute zählt das Land nicht mehr nur Kohle und Stahl, sondern auch Energiewende, Wasserstoffwirtschaft und innovative Dienstleistungen zu seinen starken Wirtschaftsfeldern. Alte Industrieflächen wurden umgebaut, Start-ups und Forschungseinrichtungen siedelten sich an. Solche Beispiele zeigen: Wenn Politik, Wirtschaft und Wissenschaft frühzeitig zusammenarbeiten, lassen sich selbst aus tiefen Strukturbrüchen neue Wachstumsfelder entwickeln.
Am Ende ist regionale Wirtschaftsförderung ein Drahtseilakt zwischen Gegenwart und Zukunft. Sie muss bestehende Stärken erkennen, schärfen und ausbauen, gleichzeitig aber auch die Transformation im Blick behalten. Für Deutschland als Wirtschaftsstandort bedeutet das: Ohne gezielte Förderung vor Ort und ohne regionale Profile in einer globalisierten Welt bleiben viele Chancen ungenutzt. Dresden mag heute das Herz der europäischen Halbleiterindustrie sein – entscheidend ist, dass auch andere Regionen ihre eigenen Herzensthemen finden.
Finovesta, die von Hilden aus den internationalen elektronischen Finanzhandel steuert, sowie Creditreform, das auf die leistungsstarke Rechenzentrumsinfrastruktur von AtlasEdge setzt.
Ob starke Finanzdienstleister, dynamischer Branchenmix oder
exzellente Infrastruktur – Hilden beeindruckt als Standort, der wächst und lebendig ist: im Zentrum der Metropolregion mit direkter Verbindung zu einem Absatzmarkt von über elf Millionen Menschen! www.wirtschaft.hilden.de

DIGITALE VERWALTUNG | VON PIA WEGENER
Digitale Steuererklärungen, Online-Kindergeldanträge oder Wohnsitzummeldungen:
In der digitalen Verwaltung ist in den vergangenen Jahren schon einiges passiert. Auch die Zufriedenheit mit digitalen Verwaltungsangeboten hat sich etwas erhöht. Doch noch hinkt Deutschland beim E-Government im EU-Vergleich hinterher. Gründe dafür sind bürokratische Hürden, strenge Datenschutzbestimmungen, aber auch ein mangelndes Vertrauen der Bürger in die Verwaltung.
Dass es noch Nachholbedarf in Sachen digitaler Verwaltung gibt, belegen Zahlen des neuen Bitkom-DESI-Indexes für 2025, der den Digitalisierungsfortschritt der 27 EU-Länder vergleicht. Die ernüchternde Bilanz: In der
Einige Angebote, wie der Online-Kindergeldantrag, werden bereits genutzt.
Gesamtbewertung konnte sich Deutschland zwar auf den 14. Platz verbessern. Beim E-Government landet die Bundesrepublik im EU-Ranking aber nur auf Rang 21 von 27 Ländern. Nur Frankreich und Italien schnitten in Westeuropa noch schlechter ab. Die Nutzung digitaler Verwaltungsdienstleistungen liegt demnach mit 64 Prozent mehr als zehn Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt. Den ersten Platz beim E-Government belegt Malta, dahinter folgen Estland und Finnland. Auch im Gesamtranking schnitt Finnland am besten ab, gefolgt von Dänemark
Fotobeschreibung für Deutschland hat im Bereich E-Government einiges aufzuholen.

und den Niederlanden. Beispielhaft für die langsame Digitalisierung der deutschen Verwaltung ist die schleppende Einführung der E-Akte.
Akzeptanz schaffen
Hinzu kommt, dass selbst bestehende digitale Verwaltungsangebote nicht allen Bürgern bekannt sind. Laut dem eGovernment-Monitor, den die Initiative D21 und die Technische Universität München unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) vergangenes Jahr veröffentlicht haben, wählen drei von zehn Deutschen nach wie vor den analogen statt den digitalen Weg. Viele schrecken auch vor der Eingabe ihrer Daten und dem Online-Ausweisverfahren zurück, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Einheitliche und bedienungsfreundliche Anwendungen sowie konkrete Informationen darüber, was mit den eingegebenen Daten passiert, könnten für mehr
Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung sorgen. Einige Angebote, wie etwa der Online-Kindergeldantrag, werden hingegen bereits von einem Großteil genutzt.
Digitalen Fortschritt fördern Um das E-Government schneller voranzubringen und die Verwaltung aus dem Papierzeitalter herauszuholen, fordert der Verband Bitkom die Abschaffung der Schriftformerfordernisse per Generalklausel sowie eine gesetzliche Verankerung des sogenannten Once-Only-Prinzips. Ersteres würde digitale Vorgänge enorm beschleunigen. Darauf zielt auch das Once-OnlyPrinzip ab, das es Bürgern und Unternehmen ermöglichen soll, Standardinformationen, wie etwa Gehaltsnachweise, nur noch einmalig an die Behörden zu übermitteln. Diese könnten dann auf die ihnen ohnehin vorliegenden Dokumente zurückgreifen.
Anzeige











#nextgermany ... oder vom 30.09. bis 02.10. in Berlin










Seien Sie dabei am 22. und 23. Oktober 2025 in Nürnberg! Jetzt kostenloses Ticket sichern mit Code KOM25AKDBW



















































Sie setzen Kurs auf eine zukunftsorientierte, digitale Verwaltung –wir machen sie möglich! Ob sicherer IT-Betrieb, vollständig digitale Verwaltungsprozesse, servicestarke Ämter oder klimaresiliente Städte und Gemeinden: Die AKDB-Gruppe bietet Ihnen Lösungen, nicht nur Software. Für ein funktionierendes Gemeinwesen. Für einen modernen Staat. Für uns alle!
www.akdb.de/kommunale25
DIGITALISIERUNG UND KI | VON HARTMUT SCHUMACHER
Die deutsche Wirtschaft ist bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und Produkte sowie bei der Nutzung künstlicher Intelligenz im internationalen Vergleich nur gutes Mittelmaß. Fortschritte sind zwar erkennbar, aber ihr Tempo ist zu niedrig. Abhilfe schaffen lässt sich mit Investitionen in Technik, Forschung und Fachkräfte.
In der Wirtschaft ist Digitalisierung vor allem deshalb wichtig, weil sie für mehr Effizienz sorgt: Digital vorliegende Daten lassen sich leichter erfassen, transportieren und bearbeiten. Unternehmen, die diesen Vorteil
Deutschland muss seine
Anstrengungen steigern, um bei der Digitalisierung Schritt zu halten.
nicht nutzen, geraten ins Hintertreffen gegenüber ihren Konkurrenten. Dies gilt auch international: Staaten, deren Wirtschaft einen
Osnabrück:
geringen Digitalisierungsgrad aufweist, sind im Nachteil gegenüber Staaten, die in dieser Hinsicht fortschrittlicher sind.
Digitalisierung messbar machen Wie es um die deutsche Wirtschaft diesbezüglich bestellt ist, darüber gibt der Digitalisierungsindex des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Auskunft: Im Jahr 2024 betrug der deutschlandweite Indexwert 114 Punkte. Als Vergleichswert dienen dabei die 100 Punkte, die dieser Index bei seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2020 erreichte. 2021 stieg der Index auf etwa 108 Punkte, blieb in den Jahren 2022 und 2023 fast unverändert und legte dann 2024 wieder um knapp sechs Punkte zu.
In den verschiedenen Branchen gibt es dabei starke Unterschiede: An der Spitze liegen wenig überraschend Informationsund Kommunikationsunternehmen mit 285 Punkten. Auch Unternehmen der Kategorie „Elektrotechnik, Maschinen- und Fahrzeugbau“ kommen mit 160 Punkten auf einen hohen Wert. Unterdurchschnittliche Werte dagegen erreichen das sonstige verarbeitende Gewerbe (78 Punkte) und das Baugewerbe (68 Punkte).
Wo Wirtschaft 4.0 zu Hause ist
Wer heute in Zukunftstechnologien, Digitalisierung oder künstliche Intelligenz investiert, braucht mehr als nur Gewerbefläche – er braucht ein Ökosystem. Osnabrück bietet genau das: eine innovative Infrastruktur, starke Netzwerke und kurze Wege zwischen Forschung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft.
Mit dem Smart Business Park Limberg entsteht in Osnabrück ein Leuchtturmprojekt für die
CIC in Osnabrücks Lok-Viertel: Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Forschung & Gesellschaft
Wirtschaft 4.0. Das neue Gewerbegebiet verbindet digitale Infrastruktur, smarte Energie- und Mobilitätslösungen und eine hervorragende Lage mit einem klaren Fokus auf Unternehmen, die an der Schnittstelle von Technologie, Produktion und datenbasierten Dienstleistungen arbeiten. Der Park steht für gelebte Transformation – inklusive Aufenthaltsqualität für Fachkräfte, urbaner Nähe und ressourcenschonender Entwicklung.


Staaten mit hohem Digitalisierungsgrad sind klar im Vorteil.
Auch die Unternehmensgröße macht einen erheblichen Unterschied. Kleine Unternehmen kommen deutschlandweit auf einen Indexwert von 102 Punkten, mittlere Unternehmen auf 136 Punkte und große Unternehmen auf 203 Punkte.
Internationaler Vergleich
Wer wissen möchte, wie die deutsche Wirtschaft im EU-Vergleich abschneidet, kann einen Blick in den Bitkom-DESI-Index werfen, der den Grad der Digitalisierung bewertet. Mit einem Indexwert von 50,1 Punkten liegt Deutschland leicht unter dem EU-Durchschnitt von 51,2 Punkten. Insgesamt erreicht die Bundesrepublik Platz 14 unter den 27 Mitgliedsstaaten – immerhin eine Verbesserung von zwei Plätzen gegenüber dem Vorjahr. Auf den ersten fünf Plätzen sind Finnland, Dänemark, die Niederlande, Malta und Schweden zu finden. Im Teilbereich
Osnabrück überzeugt mit einer starken mittelständischen Wirtschaftsstruktur, moderner Infrastruktur und echtem Kooperationsgeist. Ansiedlungen werden aktiv begleitet – vom Planungsprozess bis zum operativen Betrieb. Unternehmen profitieren von einem offenen Netzwerk lokaler Dienstleister, einer engagierten Wirtschaftsförderung und renommierten Forschungspartnern wie u.a. die Hochschule Osnabrück und die Universität Osnabrück. Bereits heute ist das Coppenrath Innovation Center im neu entstehenden Osnabrücker Stadtquartier Lokviertel, einem deutschlandweiten Vorbildprojekt in Sachen Stadtentwicklung, ein wichtiger Hotspot der KI-Forschung. Hier ist unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) mit den Schwerpunkten „Kooperative und Autonome Systeme“ sowie „Smart Enterprise Engineering“ angesiedelt – ein Ort, an dem die Schnittstellen zwischen Forschung und Wirtschaft täglich gelebt werden.
Auch in Hinblick auf qualifizierte Fachkräfte hat Osnabrück viel zu
bieten. So arbeiten fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten laut Auswertung von Prognos in Zukunftsbranchen (Quelle: Zukunftsatlas 2025). Für Nachwuchs ist zudem gesorgt: Besonders in Informatik und Ingenieurwissenschaften hat Osnabrück überdurchschnittlich viele Studierende, die häufig in der Region bleiben. Projekte wie das „KI-Reallabor Agrar“ oder das „AgriData-Observatory“ unterstreichen die Dynamik des Standorts – gerade im Bereich Digitalisierung und KI.
Der Blick über den Tellerrand lohnt auch: Die Osnabrücker Wirtschaft ist breit aufgestellt – von Logistik über neue Materialien bis zu Life Sciences – und damit prädestiniert für Synergien und branchenübergreifende Kooperationen. Die Lage im UNESCO Geopark TERRA. vita und ein pulsierendes Kulturleben machen Osnabrück zudem zu einem attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten. Davon profitieren im Einzugsgebiet rund 750.000 Menschen, die hier zu Hause sind. Weitere Informationen: www.wfo.de
digitale Wirtschaft kommt Deutschland auf Platz 8, in der Netzqualität auf Rang 9. Weniger rühmlich sieht es aus bei den digitalen Kompetenzen der Bevölkerung (Platz 15) und der Digitalisierung der Verwaltung (Platz 21).
„Das neue EU-Ranking zeigt, dass Deutschland seine Anstrengungen steigern muss, um bei der Digitalisierung mit den anderen Nationen nicht nur Schritt zu halten, sondern nach vorne zu kommen“, kommentiert Dr. Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalbranchenverbands Bitkom, die Ergebnisse.
Zukunftstreiber KI
Doch die Digitalisierung steigert nicht nur Effizienz und Wachstumschancen, sie macht die Wirtschaft auf fit für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, des Zukunftstreibers der Zeit. Bis dato setzen allerdings nur rund 20 Prozent der deutschen Unternehmen KI ein, hat eine Bitkom-Studie aus dem vergangenen Oktober ergeben. In weiteren 35 Prozent wird ein solcher Einsatz bereits geplant oder zumindest diskutiert. Das sind deutliche Steigerungen: Im Jahr 2020 verwendeten lediglich sechs Prozent der Unternehmen KI-Anwendungen, 22 Prozent dachten über ihren Einsatz nach.
Ganz im Südwesten Niedersachsens liegt an der Ems die Stadt Lingen. 60.000 Einwohner, eine lebendige Wirtschaft, der Campus Lingen der Hochschule Osnabrück, ein vielfältiges kulturelles Angebot und zahlreiche positive Trends machen Lingen nicht nur zur größten Stadt des Emslandes, sondern auch zu einem spannenden Hotspot der Region. Lingen macht sich bereit für die Zukunft.
Dabei blickt die Stadt nicht einfach nach morgen: Die Stadtväter nehmen gezielt das Übermorgen ins Visier. Mit dem IT-Campus Lingen (ICL) schafft die Stadt ein innovatives Quartier, in dem Unternehmen und Start-ups sich perfekt rund um KI entwickeln können; 17 Grundstücke auf 130.000 Quadratmetern, perfekt angebunden. Jüngst wurde Lingen
Diese Entwicklung wird sich wohl fortsetzen. Denn 78 Prozent der deutschen Unternehmen betrachten KI als Chance, nur 12 Prozent als Risiko. Folgerichtig haben 37 Prozent der Unternehmen bereits in KI investiert, und stolze 74 Prozent beabsichtigen, dies in Zukunft zu tun.
100 Milliarden Euro sind nötig, um Deutschland digital souverän zu machen.
Das Statistische Amt der Europäischen Union kommt zu einem sehr ähnlichen Ergebnis bezüglich des Prozentsatzes deutscher Unternehmen, die bereits künstliche Intelligenz nutzen – und stellt dieses zusätzlich in den internationalen Zusammenhang: Deutschland liegt mit 19,8 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt von 13,5 Prozent. An der Spitze stehen Dänemark (27,6 Prozent), Schweden (25,1 Prozent) und Belgien (24,7 Prozent).
dritter Satellit des KI Parks Berlin, der Deutschland und Europa bis 2030 auch international in Sachen KI in Führung bringen will. Analoge Nähe im ICL für erfolgreiche Digitalität, Innovationen und ein starkes Netzwerk.
Lingen als Energiestandort vollzieht erfolgreich die Wende: Mit über 400 Megawatt Elektrolyseurleistung mausert sich die Stadt zum größten deutschen Standort für grünen Wasserstoff. Nicht nur BP und RWE investieren, auch Amprion baut eine moderne Konverterstation, um hier 1,8 Gigawatt Offshore-Windstrom anlanden zu können. Insgesamt lösen diese aktuellen Projekte in Lingen Investitionen von über drei Milliarden Euro in eine nachhaltige Zukunft aus. wirtschaft.lingen.de

Lösungsansätze
Was benötigt die deutsche Wirtschaft, um das Potenzial von Digitalisierung und KI zu nutzen und damit neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder zu erschließen? Diverse Studien, unter anderem der Deutschen Industrie- und Handelskammer und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Erforderlich sind erstens eine Stärkung der Infrastruktur, vor allem bei den Datennetzen und der Rechenleistung. Zweitens eine gezielte Förderung von KI-Innovationen und deren Anwendung in Unternehmen. Drittens Investitionen in die Qualifikationen der Mitarbeitenden. Und viertens regulatorische Rahmenbedingungen, die Innovation ermöglichen, aber nicht leichtfertig mit dem Datenschutz umgehen. Werden diese Bedingungen erfüllt, dann ist Deutschland laut einer Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung „insgesamt gut aufgestellt, um im globalen Wettbewerb im Bereich der KI Schritt zu halten“.
Ein Ziel, das auch der Bundesregierung gefällt. Daher hat sie in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, sowohl die Digitalisierung allgemein als auch die Infrastruktur und künstliche Intelligenz im Besonderen zu fördern. Bezahlt werden soll dies unter anderem aus dem 500 Milliarden Euro umfassenden Infrastruktur-Sondervermögen: Für die Digitalisierung will die Regierung jährlich zunächst mindestens vier Milliarden Euro aus diesem Sondervermögen investieren. In den folgenden Jahren soll die Investitionssumme noch „deutlich“ steigen. Das ist wohl auch nötig. Der Bitkom schätzt, dass insgesamt 100 Milliarden Euro nötig sind, um „Deutschland zu einem digital souveränen Land zu machen“.
Umfrage unter Unternehmen zum Stand der Digitalisierung im weltweiten Vergleich 2025 Wo sehen Sie die deutsche Wirtschaft bei der Digitalisierung im weltweiten Vergleich?
Weltweit führend
In der Spitzengruppe
13 %
Im Mittelfeld
Unter den Nachzüglern 1 % 53 %
22 %
Abgeschlagen 5 % 8 %
Weiß nicht / k. A.

FÖRDERUNGEN | VON THOMAS SCHULZE
Die Bedeutung der Förderung von Unternehmen und Infrastruktur ist enorm. Sie ist der Motor für Innovation, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Deutschen Unternehmen steht ein vielseitiger Förder-Mix zur Verfügung: Von klassischen Bankkrediten bis zu Zuschüssen reicht die Palette an Instrumenten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Eine zentrale Rolle spielen öffentliche Förderbanken wie die bundesweite KfW, die Investitionsbanken der Länder und die Landesbanken. Sie alle bieten – teilweise in Kooperation, teilweise eigenständig – zinsgünstige Darlehen für Existenzgründer, den Mittelstand oder für spezifische Innovationsprojekte und

Infrastrukturmaßnahmen an. Eine weitere wichtige Säule sind Zuschüsse. Diese müssen nicht zurückgezahlt werden und sind oft an bestimmte Kriterien geknüpft, beispielsweise an Investitionen in Forschung und Entwicklung, in Energieeffizienz oder in die Digitalisierung.
Eines der wichtigsten Förderprogramme von Bund und Ländern ist die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Mit Mitteln aus diesem Programm werden strukturschwache Regionen gestärkt, indem gewerbliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastruktur gezielt unterstützt werden.
Service-Stelle für ausländische Investoren Doch Deutschland ist auch auf internationale Investoren angewiesen. Für diese gibt es spezielle Service-Stellen wie Germany Trade & Invest (GTAI), die bei Standortsuche und Behördengängen helfen und über Fördermöglichkeiten informieren.
Ein ganz neues Instrument gerade für die Instandsetzung der maroden Infrastruktur ist das „Sondervermögen Infrastruktur“. Damit sollen Schienen, Straßen, Breitbandausbau oder Energieinfrastruktur auf Vordermann gebracht werden. Unternehmen, die von diesen Mitteln profitieren wollen, müssen sich auf Ausschreibungen bewerben, die von den
Nachfolge im Mittelstand: wie Bürgschaftsbanken den Generationswechsel ermöglichen
Der Generationswechsel im Mittelstand spitzt sich zu – besonders bei kleinen Betrieben. Laut aktuellem DIHK-Report stehen rund 9.600 übergabebereiten Unternehmen nur etwa 4.000 potenzielle Nachfolgelösungen gegenüber. Fast 40 Prozent der Übernahmen scheitern an Finanzierungshürden.
Nach Schätzung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks benötigen in den nächsten fünf Jahren mindestens 125.000 Handwerksbetriebe eine Nachfolgeregelung – sei es innerhalb der Familie, im Betrieb oder durch externe Übergaben.
Bürgschaftsbanken als Schlüsselakteure
Bürgschaftsbanken ersetzen fehlende Sicherheiten und ermöglichen Bankkredite – mit einer Risikoabdeckung von bis zu 80 Prozent und Bürgschaften bis zu 2 Millionen
Euro. Das ist entscheidend für kleine Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, deren Kaufpreis zwar Substanz widerspiegelt, aber selten vollständig abgesichert werden kann.
ERP-Förderkredit als Hebel Zusätzliche Dynamik bringt der „ERP-Förderkredit für Gründung und Nachfolge“ der KfW in Kombination mit Bürgschaftsbanken. Anträge laufen zentral über kapital.ermoeglicher.de. Die Bürgschaft kann die Hausbank vollständig vom Ausfallrisiko entlasten – das senkt die Finanzierungshürden spürbar.
Zahlen belegen den Bedarf Im ersten Halbjahr 2025 genehmigten Bürgschaftsbanken 2.478 Bürgschaften über rund 937 Millionen Euro – ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 57 Prozent dieser Bürgschaften dienten der Finanzierung von Unternehmensnachfolgen. Auch
zuständigen Ministerien oder Infrastrukturbetreibern veröffentlicht werden. Die Mittel fließen also nicht direkt an Unternehmen, sondern indirekt über die Vergabe öffentlicher Aufträge.
Zentrales Portal soll Überblick geben Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Fördervielfalt in Deutschland auch effektiv ist. Hier gehen die Meinungen auseinander. Einerseits gibt es Erfolgsgeschichten wie die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg. Andererseits werden
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Fördervielfalt in Deutschland auch effektiv ist.
oft die hinderliche Bürokratie und die Komplexität der Förderlandschaft kritisiert. Vor diesem Hintergrund wird immer wieder eine Vereinfachung des Systems gefordert. Eine zentrale Anlaufstelle oder ein digitales „Förder-Portal“, das Unternehmen durch den Dschungel lotst, stehen dabei ganz oben auf der Agenda. Überhaupt betrachten viele Unternehmen und Investoren Deutschland trotz aller Förder- und Finanzierungsbemühungen aktuell mit Skepsis. Hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und die Bürokratie sind derzeit eher abschreckende Faktoren.

der ERP-Förderkredit wurde 157mal zugesagt, mit einem Volumen von 45 Millionen Euro. Die Nachfolge prägt die Dynamik.
Empfehlung für Übernahmen Frühzeitig kalkulieren, Bankgespräch und Bürgschaft parallel denken, die Nachfolge-Landingpage der Bürgschaftsbanken
nutzen – inklusive Tools wie Unternehmenswertrechner – und den ERP-Förderkredit als Finanzierungselement einbinden. So wird aus der demografischen Welle keine Finanzierungskrise, sondern eine Chance für kleine Betriebe.
nachfolge.ermoeglicher.de
An unseren Standorten Berlin und Münster suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Dich (so/wie/du/bist)!
job@reflex-media.net




FACHKRÄFTEMANGEL | VON PIA WEGENER
Deutschland leidet weiterhin unter einem Fachkräftemangel: Bis zum Jahr 2030, so die Experten-Prognosen, droht eine Lücke von bis zu fünf Millionen Fachkräften. Erwerbstätige aus dem Ausland könnten diese füllen. Aktuell schneidet Deutschland bei der Attraktivität für ausländische Fachkräfte jedoch nur mittelmäßig ab. Gründe dafür sind bürokratische Hürden, Sprachprobleme, aber auch eine fehlende Willkommenskultur.
In nahezu allen Branchen mangelt es schon jetzt an Arbeitskräften. Zuletzt berichteten Unternehmen zwar von einem leichten Rückgang der offenen Stellen, die Prognosen für die kommenden Jahre sind dennoch düster. Einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge könnten bereits im Jahr 2028 rund 768.000 Stellen nicht mehr mit ausreichend qualifizierten Fachkräften besetzt sein. Im vergangenen Jahr fehlten bundesweit immerhin schon 487.000 Facharbeiter. Besonders groß ist der Mangel bei Erziehern, Sozialarbeitern und Pflegern, aber
Jedes Jahr müssten knapp 288.000 ausländische Arbeitskräfte kommen, um den demografischen Wandel zu kompensieren.
auch bei Verkäufern. Bei Letzteren gehen Experten von mehr als 40.470 fehlenden Fachkräften im Jahr 2028 aus. Bei Erziehern ist mit einem Anstieg auf rund 30.800 Fehlstellen zu rechnen, in der Sozialarbeit von einem Mangel von 21.150 und in der Gesundheits- und Krankenpflege von gut 21.350 Fachkräften, die fehlen werden.
Grund für den Mangel ist der demografische Wandel und das damit einhergehende Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge, der sogenannten Babyboomer, aus dem Berufsleben, die damit eine große Lücke hinterlassen. Laut einer Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) droht bis zum Jahr 2035 der Verlust von mehr als sieben Millionen Arbeitskräften, immerhin ein Siebtel des aktuellen Arbeitsmarkts. Gleichzeitig kommen zu wenige junge, potenzielle Arbeitskräfte nach. So blieben alleine im Jahr 2024 mehr als 70.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, so die Deutsche Industrieund Handelskammer (DIHK).
Negative Auswirkungen auf die Wirtschaft Eine Entwicklung, die sich schon jetzt negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirkt. Laut einer IW-Studie gingen hierzulande im vergangenen Jahr Produktionskapazitäten im
Wert von 49 Milliarden Euro verloren. In der Studie wurde das Produktionspotenzial mithilfe des Global Economic Model von Oxford Economics berechnet. Im Jahr 2027 könnte der Verlust bei 74 Milliarden Euro liegen. Einbußen, die sich Deutschland gerade mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung, den Einsatz von KI und die Klimapolitik nicht erlauben kann. Um diese Einbußen gering zu halten, müsste Deutschland auf Fachkräfte aus dem Ausland zurückgreifen. Konkret wären knapp 288.000 ausländische Arbeitskräfte jährlich notwendig: Das ergeben aktuelle Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung. Doch diese potenziellen Arbeitskräfte zieht es immer seltener in die Bundesrepublik.
Deutschland weniger attraktiv für ausländische Fachkräfte Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland bei der Attraktivität für Fachkräfte eher mittelmäßig ab. In aktuellen OECD-Rankings liegt die Bundesrepublik meist im Mittelfeld oder darunter. Zwar kann Deutschland nach wie vor mit guten Verdienst- und Karrieremöglichkeiten sowie einer hohen Lebensqualität punkten. Getrübt wird dieses Bild jedoch durch eine schleppende Digitalisierung der Verwaltung, hohe bürokratische Hürden, Diskriminierungserfahrungen und eine vielerorts als wenig einladend empfundene Willkommenskultur. Das bestätigt auch eine Umfrage unter Expats aus dem Jahr 2024: Vor allem bei den Punkten Bürokratie und Wohnsituation schneidet Deutschland schlecht ab. Problematisch seien langwierige und komplizierte Verfahren bei der Visavergabe. Auch die Sprachbarriere spielt für Erwerbstätige eine entscheidende Rolle. Für viele ausländische Fachkräfte ist Deutschland deshalb kein leichtes Einstiegsland – und es zieht sie eher in unsere Nachbarländer, allen voran in die Schweiz und nach Dänemark. Diese Staaten werden auch für junge deutsche Fachkräfte immer interessanter.
Langwierige und komplizierte Verfahren bei der Visavergabe gelten als Bremse für den Fachkräftezuzug.
Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass jährlich rund 210.000 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Alter von 20 bis 40 Jahren das Land verlassen, um im europäischen Ausland zu arbeiten. Etwa drei Viertel von ihnen haben einen Hochschulabschluss.
Positive Entwicklung bei Ausbildungen Immerhin bei den Ausbildungszahlen gibt es Positives zu vermelden: Zwischen 2014 und 2024 ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zwar um acht Prozent gesunken. Doch im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der ausländischen Auszubildenden nahezu verdoppelt – ein Plus von 93 Prozent auf rund 70.000. Ihr Anteil wuchs damit von sieben Prozent im Jahr 2014 auf etwa 15 Prozent im vergangenen Jahr. Das zeigen Auswertungen des Statistischen Bundesamts. Besonders häufig entschieden sich 2024 junge Menschen mit vietnamesischer (7.100), syrischer (6.800) und ukrainischer (5.800) Staatsangehörigkeit für eine Ausbildung in Deutschland. Die Zahl der ukrainischen Auszubildenden hat sich im Vergleich zu 2023 sogar nahezu verdreifacht.
Zuwanderung erleichtern, Potenziale nutzen Doch viele Stellen dürften ohne weitere Fachkräftemigration in Zukunft unbesetzt bleiben. Um dem entgegenzuwirken, wurden mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz einige Maßnahmen beschlossen, die die Zuwanderung von Erwerbstätigen vereinfachen sollen. Mit Erfolg: In den ersten Monaten nach Gesetzeseinführung wurden nach vorläufigen Zahlen rund 200.000 Visa zu Erwerbszwecken erteilt. Vielen Experten geht das aber noch nicht weit genug. Um dem Fachkräftemangel auf Dauer entgegenzuwirken, soll auch das inländische Potenzial, das durch mehr Aus- und Weiterbildung und eine stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren erhöht werden kann, von der Bundesregierung gefördert werden.

Manchmal staunt man ja, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können: Während etliche von uns Deutschen die „German Angst“ quält und wir über Bürokratie, Energiekosten oder Steuern klagen, sehen viele Ausländer Deutschland durch eine erstaunlich rosige Brille. Eine aktu elle GTAI-Studie, die 1.800 Manager aus aller Welt befragte, zeigt: Der Wirtschaftsstandort Deutschland gilt international als stabil, innovativ und bestens vernetzt. Qualifizierte Fachkräfte, solide Lieferketten und sogar

unsere oft gescholtene Arbeitsdisziplin rangieren dort ganz oben. Besonders charmant: Auf die Frage, was ihnen beim Stichwort „Deutschland“ zuerst einfällt, nannten Manager tatsächlich „Zuverlässigkeit und Qualität“ – und nicht etwa Sauerkraut oder Fußball. Vielleicht, so könnte man sagen, sollten wir uns künftig häufiger mal die Sicht von außen auf unser Land ins Bewusstsein rufen. Denn während hierzulande gern die Probleme ins Rampenlicht gerückt werden, sieht die Welt vor allem die Chancen.
Michael Gneuss Chefredakteur
IMPRESSUM
Projektmanagement Philipp Stöhr, philipp.stoehr@reflex-media.net Redaktion Jürgen Ackermann, Michael Gneuss, Katharina Lehmann, Thomas Schulze, Hartmut Schumacher, Pia Wegener Layout Anika Göhritz, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / creisinger Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Michael Gneuss, redaktion@reflexmedia.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www.reflex-media.net Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 22. September 2025 im Handelsblatt. Der Reflex Verlag und die Handelsblatt Media Group & Co. KG sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
UNSERE NÄCHSTE AUSGABE
IT-SICHERHEIT

IT-Sicherheit
Unsere Publikation verfolgt ein klares Ziel: das Sicherheitsverständnis von IT-InvestitionsVerantwortichen zu schärfen. Gemeinsam mit CybersecurityAnbietern, Beratern und Dienstleistern können diese mit den richtigen Lösungen, Technologien und Services, wirkmächtige Schutzstrukturen für ihre Organisationen, Wirtschaftsunternehmen und Produktionsbetriebe aufbauen.
Erfahren Sie dazu mehr, ebenfalls heute im Handelsblatt.
Goethe-Institut e.V. 3 Oskar-von-Miller-Ring 18 80333 München www.goethe.de
Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO) 5 Luisenstraße 45 10117 Berlin www.bv-miro.org
Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbH 6 Adolf-Pompe-Straße 12–15 17109 Demmin www.wirtschaft-seenplatte.de
H2-Region Emsland 7 Kaiserstraße 10 b 49809 Lingen (Ems) www.hydrogen-valley.eu
Wirtschaftsförderung
WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH 10 Natruper-Tor-Wall 2 a 49076 Osnabrück www.wfo.de
Aktion Deutschland Hilft e. V. –Bündnis der Hilfsorganisationen 16 Willy-Brandt-Allee 10-12 53113 Bonn www.aktion-deutschland-hilft.de KOMMENTAR
Stadt Hilden 8 Am Rathaus 1 40721 Hilden www.wirtschaft.hilden.de
AKDB 9
Hansastraße 12–16 80686 München www.akdb.de
Stadt Lingen (Ems) 11 Elisabethstraße 14–16 49808 Lingen (Ems) www.lingen.de
Verband deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) 12 Schützenstraße 6 a 10117 Berlin nachfolge.ermoeglicher.de
JETZT SCANNEN Unsere Ausgaben finden Sie auch auf unserem Wissensportal: www.portal-wissen.net


Jetzt spenden!
Die weltweiten Katastrophen nehmen zu. Aktion Deutschland Hilft steht Menschen in ihrer größten Not bei, versorgt sie medizinisch und mit Trinkwasser und Lebensmitteln. In sicheren Unterkünften finden Betroffene Schutz.
Helfen Sie uns Leben zu retten – mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank! Aktion-Deutschland-Hilft.de
Bündnis der Hilfsorganisationen