
Wir sind dabei


Wir sind dabei
Heute ist ein ganz besonderer Tag: Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Februar findet der World Rare Disease Day statt – diesmal unter dem Motto: „Teilt eure Farben“. Seit 2008 treffen sich Menschen rund um den Globus am „Tag der Seltenen Erkrankungen“, um gemeinsam auf Anliegen und Probleme der sogenannten Waisen der Medizin aufmerksam zu machen. Gemeint sind Menschen, die von einer der rund 8.000 seltenen Erkrankungen betroffen sind – und das sind
weltweit über 350 Millionen Kinder und Erwachsene. Jede einzelne betroffene Person steht für eine einzigartige Erkrankung, die Aufmerksamkeit verdient. Aufklärung ist wichtig, damit eine frühzeitige Diagnose und somit im Idealfall Therapie erfolgen können. Das Ziel: die Auswirkungen der Erkrankung auf das Leben Betroffener so gering wie möglich zu halten. Diese Publikation trägt zur Aufklärungsarbeit bei, beleuchtet Fortschritte und bekennt Farbe für mehr Forschung zu seltene Erkrankungen.

Nadine Effert Chefredakteurin
INHALTSVERZEICHNIS
LEITARTIKEL
THERAPIEN
ÜBERSICHT
EOSINOPHILE ÖSOPHAGITIS
CLUSTERKOPFSCHMERZ
PATIENT STORY
MYASTHENIA gravis
PRIMÄR BILIÄRE CHOLANGITIS
Künstliche Intelligenz als Hoffnungsträger — 3
Die Gene im Fokus — 6
Zentren für Seltene Erkrankungen in Deutschland — 8
Schluckbeschwerden? Daran kann es liegen — 10
„Es gibt Hilfe gegen einen der stärksten Schmerzen“ — 11
„NMOSD hat unser Leben komplett verändert“ — 12
„Ziel ist die bestmögliche Krankheitskontrolle“ — 14
Aufklären und Vorurteile beseitigen — 15
IMPRESSUM
Projektmanagement Myriam Krämer, myriam.kraemer@reflex-media.net Redaktion Nadine Effert, Mark Krüger, Tobias Lemser Layout Silke Schneider, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / twinsterphoto Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Nadine Effert, redaktion@reflexmedia.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www.reflex-media.net
Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 29. Februar 2024 im Handelsblatt. Der Reflex Verlag und die Handelsblatt Media Group & Co. KG sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG 3
www.takeda.com/de-de
Biogen GmbH 5 www.biogen.de
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH 6
www.vrtx.com/de-de
MGZ – Medizinisch Genetisches Zentrum 7 www.mgz-muenchen.de
Dr. Falk Pharma GmbH 10 https://de.drfalkpharma.com/de/
Hormosan Pharma GmbH 11 & 14 www.hormosan.com
Horizon Therapeutics GmbH, ein Unternehmen der Amgen GmbH 13 www.horizontherapeutics.de
Ipsen Pharma GmbH 15 www.ipsen.com/germany/
Aktion Deutschland Hilft e. V. 16 www.aktion-deutschland-hilft.de
Der Umgang mit seltenen Erkrankungen ist für Betroffene und medizinisches Fachpersonal gleichermaßen herausfordernd. Die Diagnose ist schwierig, und es mangelt an Therapien. Mit neuen Verfahren der Künstlichen Intelligenz und des Maschinenlernens können Krankheiten automatisch erkannt werden – eine Voraussetzung für frühere Diagnosen und individuelle Therapien bei seltenen Krankheiten.
4 Millionen Menschen leben Schätzungen zufolge mit einer seltenen Erkrankung allein in Deutschland. In der gesamten EU geht man von
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/ gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen; Zugriff: 15.02.2024
Von A wie Aarskog-Scott-Syndrom über O wie Osteochondritis bis Z wie zerebrotendinöse Xanthomatose: Es gibt aktuell bis zu 8.000 Krankheiten, von denen selbst die meisten Ärztinnen und Ärzte noch nichts gehört haben und für die es kaum effektive Therapien gibt. Die Rede ist von seltenen Krankheiten, auch bekannt als Orphan Diseases (engl. orphan „Waise“, disease „Krankheit“), von denen pro Jahr etwa 250 neu entdeckt werden. Eine Erkrankung wird in der EU als „selten“ bezeichnet, wenn höchstens fünf von 10.000 Personen daran leiden. Obwohl die Zahl der Betroffenen mit Blick auf die einzelne Erkrankung gering ist, ist es die Gesamtzahl keineswegs: In Deutschland leiden schätzungsweise ungefähr vier Millionen Kinder und Erwachsene unter einer seltenen Erkrankung, in der EU sind es etwa 30 Millionen und weltweit rund 350 Millionen.
Breites Spektrum an Krankheiten
Von speziellen Krebsarten und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu Krankheiten der Muskeln und Nerven: Seltene Erkrankungen bilden eine sehr heterogene Gruppe von zumeist komplexen Krankheitsbildern. Mit etwa 80 Prozent ist der Großteil der Orphan Diseases genetisch bedingt oder mitbedingt, sodass die ersten Symptome schon kurz nach der Geburt oder in früher Kindheit auftreten. Dies ist beispielsweise der Fall bei der Osteogenesis imperfecta, umgangssprachlich: Glasknochenkrankheit, oder beim Rett-Syndrom, bei dem zwischen dem 6. und 18. Monat erstmals Anzeichen eines Entwicklungsstopps auftreten. Ebenso unterschiedlich wie die
Der Tag der Seltenen Erkrankungen fällt in diesem Jahr auf den seltensten Tag im Kalender – den 29. Februar. Takeda und fünf weitere forschende Pharmaunternehmen sowie ein Spielehersteller organisieren aus diesem Anlass vom 26. Februar bis 3. März die Mitmach-Aktion colourUp4RARE in den sozialen Medien.
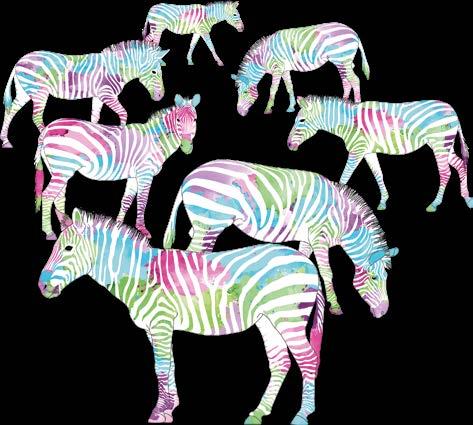
Buntes Zebra: Aufmerksamkeit für die seltenen Krankheiten mit der Aktion #colourUp4RARE
Im Rahmen von colourUp4RARE wird die Öffentlichkeit eingeladen, gemeinsam Zebras – Symbolbild für seltene Erkrankungen – digital auszumalen. Der Aufruf lautet: „Malen für die Seltenen!“ – Farbe bekennen für Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für seltene Erkrankungen zu schaffen und das Bewusstsein für verbesserte Rahmenbedingungen zur Forschung und Entwicklung neuer Diagnoseund Behandlungsmöglichkeiten zu erhöhen.
Zeichen setzen
„Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras“: Der alte Medizinerlehrsatz verdeutlicht: Häufige Erkrankungen sind wahrscheinlicher als seltene, auch wenn die Symptome zu beiden passen würden. Daher ist das Zebra Symboltier für seltene Erkrankungen. Zwar betreffen diese
Quelle: EURORDIS European Organisation for Rare Diseases, https://www.eurordis.org/de/ unsere-prioritaeten/fruehzeitigere-schnellereund-genauere-diagnose/; Zugriff: 15.02.2024
Art der Erkrankungen ist auch ihre Häufigkeit. Von beispielweise der Amyotrophen Lateralsklerose, kurz ALS, einer neurodegenerativen Krankheit, die zunehmend Nerven zerstört und Muskeln lähmt, sind rund 8.000 Menschen in Deutschland betroffen. Hingegen gibt es weltweit nur etwa 250 Kinder, die an Progerie, der sogenannten Greisenkrankheit, leiden.
Späte Diagnose, wenige Therapien Seltene Krankheiten sind ernste, oft chronische und fortschreitende Krankheiten, die häufig lebensbedrohlich sind. Je früher eine seltene Krankheit diagnostiziert wird, umso besser kann sich die betroffene Person auf ihr Schicksal einstellen und umso besser kann ihr in einigen Fällen geholfen werden. Auch wenn ein Großteil der Seltenen nicht heilbar ist, lassen sich zumindest häufig die Symptome bekämpfen. Der Verein ACHSE, die Allianz Chronischer

jeweils nur sehr wenige Menschen, doch in Summe sind es viele: allein in Deutschland rund vier Millionen. Noch immer erhalten sie zu wenig Aufmerksamkeit für ihre sozialen, medizinischen und ökonomischen Herausforderungen. Takeda unterstützt den Tag der seltenen Erkrankungen, um Zeichen zu setzen: für mehr Forschung, eine gesicherte Versorgung und eine bessere Lebensqualität für Betroffene. Seit 1781 engagiert sich Takeda, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Heute konzentriert sich das Unternehmen bei der Forschung
auf Erkrankungen mit den größten unerfüllten medizinischen Bedürfnissen. Denn für Takeda stehen die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt.
www.takeda.com/de-de

Mehr Infos zur Aktion colourUp4RARE unter: takeda.info/ colourUp4RARE
Seltener Erkrankungen, macht jedoch darauf aufmerksam, dass Betroffene „häufig eine jahrelange vergebliche Suche nach der richtigen Diagnose, einen eklatanten Mangel an Expertise für die jeweilige Krankheit sowie unzureichende Therapiemöglichkeiten, fast immer ohne Aussicht auf Heilung, erleben“. Der Leidensdruck bei Betroffenen, aber auch deren Angehörigen, ist daher groß. Etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten werden zunächst fehldiagnostiziert, viele weitere erfahren nie, was ihnen eigentlich fehlt. Ein Grund: Aufgrund ihrer Komplexität, Variabilität, unspezifischen Symptomatiken und des mangelnden Wissens über seltene Erkrankungen ist es für nicht spezialisierte Ärztinnen und Ärzte eine große Herausforderung, eine Diagnose zu stellen.
Im Schnitt warten Betroffene fünf Jahre, vereinzelt aber auch über 20 Jahre, auf Klarheit. Und wenn eine Diagnose erfolgt, stehen nur für wenige Krankheiten Therapien zur Verfügung, da sowohl die Erforschung der Krankheiten als auch die Entwicklung neuartiger Medikamente in diesem Bereich erschwert sind. Hinzu kommt, dass dies für Pharmaunternehmen aufgrund der
Da es mehr als 8.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen gibt, ist die Gesamtzahl der Betroffenen trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen hoch.
Quelle: Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V., https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/seltene-erkrankungen/ orphan-drugs-risiken-fuer-ein-modell; Zugriff: 15.02.2024
kleinen Patientengruppen nicht lukrativ und somit attraktiv ist. Aktuell sind laut Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. in der EU 143 sogenannte Orphan Drugs zugelassen (Stand: Oktober 2023), mit denen 171 Krankheiten behandelt werden können.
Zentren als wichtige Anlaufstelle
Eva Luise Köhler, Schirmherrin der ACHSE, appellierte auf der letzten Nationalen Konferenz zu Seltenen Erkrankungen (NAKSE) im September 2023 insbesondere an die Politik: „Forschung und Vernetzung brauchen strukturelle Förderung. Von der Erforschung seltener Erkrankungen können auch die häufigen Erkrankungen profitieren.“ Das gelte nicht nur für Therapieansätze, sondern auch für die
Mit Künstlicher Intelligenz schneller zur Diagnose seltener Erkrankungen
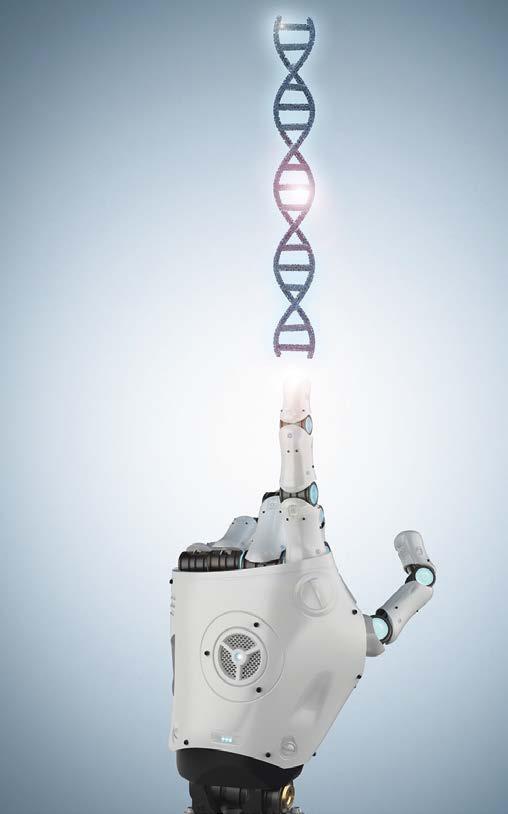
vernetzten Versorgungsstrukturen, die mit den Zentren für Seltene Erkrankungen (ZSE) bereits etabliert sind. Diese müssten endlich auf finanziell sichere Beine gestellt werden. Die bundesweit insgesamt 36 ZSE sind wichtige Anlaufstellen für Menschen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung oder gesicherter Diagnose.
Von KI profitieren
Als ein echter Gamechanger in der Versorgung von Menschen mit seltenen Krankheiten könnte sich Künstliche Intelligenz (KI) entpuppen. Neue Technologien des maschinellen Lernens haben das Potenzial, die Erforschung, Diagnostik und Behandlung seltener Erkrankungen deutlich zu verbessern. Verschiedene Studien haben bereits unterschiedliche Ansätze gezeigt, um mithilfe von Algorithmen der KI schnell Muster und Zusammenhänge zu erkennen.
So konnte unter anderem ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften und des Universitätsklinikums Leipzig zeigen, dass KI automatisch Muster in Bildgebungsdaten von Patientinnen
und Patienten erkennen kann, die spezifisch für seltene Demenz-Erkrankungsformen sind. „Wir konnten im Vergleich zu vorherigen Studien nicht nur Erkrankte von Gesunden unterscheiden, sondern zusätzlich die spezifische Krankheit klar von anderen Demenzkrankheiten abgrenzen“, sagt Matthias Schroeter, Oberarzt an der Klinik für Kognitive Neurologie des Universitätsklinikums Leipzig. „Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Therapie an jeden einzelnen Betroffenen und seine Krankheit anzupassen.“ Forschende der Universität Zürich (UZH) wiederum nutzen KI in der Wirkstoffentwicklung für die seltene, unheilbare Speicherkrankheit Cystinose, die bereits im frühen Kindesalter zu Nierenversagen führt. Mithilfe von Modellsystemen konnten sie die Signalwege identifizieren, welche die Krankheit verursachen, und mögliche Ziele für Therapien priorisieren. Auf der Medikamenten-Plattform PandaOmics wurde nach bereits vorhandenen passenden Medikamenten gesucht.
Die Analyse der Struktur der Medikamente, ihrer Ziele, möglicher Nebenwirkungen und ihrer Wirksamkeit in den betroffenen Geweben brachte ein vielversprechendes Arzneimittel zutage. Alessandro Luciani, einer der Forschungsgruppenleiter, ist zuversichtlich: „Obwohl weitere klinische Untersuchungen erforderlich sind, glauben wir, dass diese Ergebnisse, die durch eine einzigartige Zusammenarbeit erzielt wurden, uns einer realistischen Therapie für Patienten mit Cystinose näherbringen.“
Smartes Arztportal geplant Krankheitsübergreifend und bis Dezember 2024 vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert, tüftelt das Fraunhofer IESE aktuell im Projekt „Smartes Arztportal für Betroffene mit unklarer Erkrankung“ (SATURN) daran, wie mithilfe von KI bei geringen Datenmengen nachvollziehbare und transparente Verdachtsdiagnosen für seltene Erkrankungen gestellt werden können. Mit dem se-atlas, einer Maßnahme des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE), ist ein Register mit den Zentren für Seltene Erkrankungen angebunden, sodass direkt Kontakt mit Spezialistinnen und Spezialisten aufgenommen werden kann. Zum diesjährigen „Tag der Seltenen Erkrankungen“ am 29. Februar stellt SATURN den ersten Prototyp auf saturn-projekt.de vor.
Etwa 2 Prozent der seltenen Erkrankungen können in Deutschland mit einem zugelassenen Arzneimittel behandelt werden.
Quelle: Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V., https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/selteneerkrankungen; Zugriff: 15.02.2024
„Viele betrifft eine seltene Erkrankung“
Die Ice Bucket Challenge ist nun zehn Jahre her. Seitdem gab es keine vergleichbare öffentlichkeitswirksame Kampagne für seltene Erkrankungen mehr. Dr. Andreas Bracher, Leiter des Bereichs Medical Affairs bei Biogen, über ganzheitliches Denken für mehr Fortschritt bei seltenen Erkrankungen.
Herr Bracher, braucht es derartige Mobilisierungen wie die Ice Bucket Challenge öfter? Keine Erkrankung sollte zu selten sein, um ignoriert zu werden. Denn viele betrifft eine seltene Erkrankung. Die Ice Bucket Challenge hatte einen positiven Effekt auf die Bekanntheit von Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS. Eine virale Kampagne gibt Menschen die Möglichkeit, die Betroffenen einer seltenen Krankheit zu unterstützen, hilft, sie zu entstigmatisieren, und steigert die Wahrnehmung. Die Aufmerksamkeit und die Spendeneinnahmen, die durch die Ice Bucket Challenge gesammelt wurden, waren wichtig für die Forschung und die Betroffenen. Langfristig gehört aber mehr dazu, um echten medizinischen Fortschritt zu erzielen. Genau deshalb erforscht Biogen diesen Bereich, um denen eine echte Perspektive zu geben, deren
ZUR PERSON
Dr. Andreas Bracher ist bei Biogen für den Bereich Medical Affairs in Deutschland und Österreich zuständig. Bracher promovierte im PhD Programm „Vascular Biology“ an der

Medizinischen Universität Wien und hatte zuvor das Studium der medizinischen und pharmazeutischen Biotechnologie an der FH IMC Krems abgeschlossen. Nach mehreren Jahren in der biomedizinischen Forschung wechselte er 2012 in die Industrie.
Erkrankung in der Regel selten im Fokus der Öffentlichkeit steht.
Medizinischer Fortschritt bleibt dabei also nach wie vor unerlässlich. Wie trägt die Forschung von Biogen dazu bei? Forschung und klinische Entwicklung sind die wichtigsten Aspekte, um langfristig neue Behandlungsmöglichkeiten zu etablieren, medizinische Standards zu steigern und dadurch die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern. Darum dürfen wir uns nicht mit dem Status quo zufriedengeben. Stattdessen bauen wir darauf auf, um aktiv den Fortschritt im Bereich der seltenen Erkrankungen voranzutreiben. Dadurch konnten wir für Patientinnen und Patienten mit Spinaler Muskelatrophie, kurz SMA, im Jahr 2017 die erste in Deutschland zugelassene Therapie anbieten. Darüber hinaus haben wir eine vielversprechende Pipeline mit innovativen Therapieansätzen, um auch künftig für Betroffene seltener Erkrankungen Therapien zur Verfügung stellen zu können.
Dazu gehört unter anderem auch die Friedreich-Ataxie, welche die Bewegungskoordination stark beeinflusst und circa 1.300 Menschen in Deutschland betrifft. Oder auch ALS, eine fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung, die bestimmte Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark angreift.
Was ist Ihnen bei der Forschung von seltenen Erkrankungen besonders wichtig? Es ist unser Anspruch, bei all unseren Prozessen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Klinische Skalen und Scores erlauben oft nur bedingt, den Benefit für Patientinnen und Patienten zu beschreiben. Eine wichtige Rolle spielt aber auch der subjektive, von der erkrankten Person wahrgenommene Gesundheitszustand während einer Therapie. Dieser sollte strukturiert im Patient-Reported-Outcome-Measurement erfasst werden. Dies ist ein wesentlicher Baustein für eine maßgeschneiderte und qualitätsorientierte Therapie.
Gleichzeitig dürfen wir auch vor Misserfolgen nicht zurückschrecken, denn nur daraus lernen wir. Daher plädiere ich dafür, dass auch weiterhin negative Studiendaten gänzlich publiziert werden, um

den Fortschritt dadurch schneller voranzutreiben.
Welche Möglichkeiten gibt es, Patientinnen und Patienten mit einer seltenen Erkrankung über medikamentöse Therapien hinweg zu unterstützen? Der Austausch zwischen Betroffenen ist besonders wichtig. Darum hat Biogen verschiedene Formate etabliert, um diese Begegnungen zu ermöglichen. Mit der Carisma App, die von Ärztinnen und Ärzten entwickelt wurde, stellen wir einen digitalen Begleiter zur Verfügung, und mit SMAlltalk haben wir eine interaktive Plattform von SMA-Betroffenen für Betroffene ins Leben gerufen. Hier veranstalten wir Online-Events mit wechselnden Themen wie Reisen oder Mobilität.
Darüber hinaus engagieren wir uns bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e. V. und arbeiten für klinische Studien eng mit der Initiative SMA zusammen. Im Allgemeinen ist Partnerschaft ein zentraler Aspekt für uns. Keiner kann alles allein lösen. Deshalb entwickeln wir in Deutschland viele Angebote
gemeinsam mit Betroffenen, Ärztinnen und Ärzten, Patientenorganisationen und Partnern aus der Branche. Denn wir möchten die Bedürfnisse und Geschichten hinter der Erkrankung kennen und verstehen. Dieses ganzheitliche Denken bringt Fortschritt in die Versorgung und neue Perspektiven in das Leben der Betroffenen.
Für Menschen mit seltenen Erkrankungen ist der schnelle Zugang zu spezialisierter Versorgung und Diagnostik essenziell. Wie kann der Zugang gefördert werden? Zentren für Seltene Erkrankungen sind für Patientinnen und Patienten eine sehr wichtige Anlaufstelle. Deshalb ist es entscheidend, dass sich diese Zentren national und auf Europaebene abstimmen, um Erfahrungen und Daten zu teilen. Nur so erhalten wir eine valide und ausreichende Datengrundlage für bestimmte Erkrankungen. Diese Vernetzung ermöglicht zudem langfristig eine erfolgreiche und wohnortnahe Versorgung.
www.biogen.de
Biogen ist ein weltweit führendes Biotechnologie-Unternehmen, gegründet 1978 in Genf, unter anderem von den späteren Nobelpreisträgern Walter Gilbert und Phillip Sharp. Jährlich investiert Biogen rund 2,5 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien, denn Forschung treibt Fortschritt. So konnte Biogen beispielsweise dank Studiendaten und seiner Expertise daran mitwirken, dass SMA seit 2021 Teil des sogenannten Neugeborenen-Screenings in Deutschland ist.
THERAPIEN | VON MARK KRÜGER
Menschen mit seltenen Erkrankungen benötigen dringend Therapien. Großes Potenzial schlummert in Gentherapien, da rund 80 Prozent der Seltenen auf Veränderungen im Erbgut basieren. Noch steht nur für eine Handvoll diese Behandlungsform zur Verfügung. Neues aus der Forschung, wie etwa im Fall von Epilepsie, und eine mit dem Nobelpreis ausgezeichnete neue Technologie sind große Hoffnungsträger.
Funktionale Gene in das Erbgut einbringen, die fehlerhaften Gene reparieren, die Expression spezieller Gene oder auch die Proteinproduktion regulieren: Erfolgreiche gentherapeutische Ansätze haben das Potenzial, die Ursache einer
erstmals 2017 zugelassen. Wird der Gendefekt im Rahmen des Neugeborenen-Screenings entdeckt und die SMA-Gentherapie früh verabreicht, kann eine Verringerung des Muskelschwunds bei betroffenen Kindern, die sonst schwer krank sind und früh sterben, erreicht werden. An einer Gentherapie zur Heilung der SMA wird aktuell geforscht.
Neue gentherapeutische Ansätze
Seit der weltweit ersten Gentherapie im September 1990 haben Forschende eine Vielzahl neuer gentherapeutischer Verfahren entwickelt – nicht zuletzt die Gen-Schere CRISPR-Cas, mit der sich Gene sehr passgenau korrigieren lassen und für deren Entdeckung es 2020 den
Zur frühzeitigen Diagnostik gibt es ein Neugeborenen-Screening, mit dem bereits 16 Zielerkrankungen erkannt werden können, von denen die meisten selten sind.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Neugeborenenscreening e. V., https://screening-dgns.de/krankheiten.php; Zugriff: 15.02.2024
genetisch verursachten, seltenen Krankheit zu bekämpfen. Heißt, das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten oder diese sogar zu heilen. Beispiel: Spinale Muskelatrophie (SMA). Die seltene Muskelerkrankung ist die häufigste genetisch bedingte Todesursache bei Säuglingen.
Eine entsprechende Gentherapie, bei der mithilfe sogenannter viraler Vektoren therapeutische Gene als „Medikament“ direkt in die Zelle transportiert werden, wurde in Deutschland
Chemie-Nobelpreis gab. Im Dezember 2023 hat die europäische Arzneimittel-Agentur EMA erstmals den Einsatz dieser Gen-Schere als Therapie empfohlen – und zwar zur Behandlung der selten vorkommenden Sichelzellkrankheit und Beta-Thalassämie. Fakt ist: Derzeit gibt es nur für eine Handvoll der Seltenen zugelassene Gentherapien. Forschung ist teuer und die Aussicht auf Gewinn für Pharmakonzerne aufgrund der niedrigen Anzahl an Patientinnen und Patienten gering. Die überregionale Verteilung Betroffener
Eine Sichelzellkrankheit begleitet Betroffene ein Leben lang, denn die Bluterkrankung ist genetisch bedingt und somit angeboren. Mit heftigen Folgen für die Erkrankten: Sie werden oft von plötzlichen und schweren Schmerzattacken heimgesucht. Neue Therapiemöglichkeiten werden dringend benötigt.
Rote Blutkörperchen sind lebenswichtig, denn sie transportieren Sauerstoff zu den Organen. Bei gesunden Menschen sind dies runde, flache Scheiben. Bei der Sichelzellkrankheit nehmen sie die Form von Sicheln an. Diese Sichelzellen können Blutgefäße verstopfen, was
zu heftigen Schmerzen und Organschäden führt. Die Schmerzen können jederzeit auftreten und erfordern eine sofortige Behandlung im Krankenhaus.
Verkürzte Lebenserwartung
Die Erkrankung sabotiert das gesamte Leben der Betroffenen – ein normaler Alltag oder eine geregelte Arbeit sind oft nicht möglich. Die Sichelzellkrankheit bedeutet lebenslange Einnahme von Medikamenten und häufige Krankenhausaufenthalte. Und damit nicht genug: Die Bluterkrankung verkürzt das Leben um Jahrzehnte. Im Durchschnitt werden die Erkrankten nur etwa 45 Jahre alt.
erschwert zudem die Durchführung aussagekräftiger Studien. Zumindest stehen derzeit über 50 weitere gentherapeutische Ansätze in der Entwicklung, so auch im Fall der Epilepsie, von der es mehr als 30 verschiedene, darunter einige seltene Formen – wie das Doose- oder Dravet-Syndrom – gibt.
Therapieresistente Epilepsien lindern Zwar steht für Epilepsie, bei der es zu einer Überaktivierung des Gehirns und krampfartigen Anfällen kommt, eine breite Palette an Wirkstoffen zur Verfügung, doch nicht alle Betroffenen erreichen damit eine Anfallsfreiheit. Dies gilt zum Beispiel für Menschen, deren Epilepsie durch fokale kortikale Dysplasien (FCD), das sind lokalisierte Fehlbildungen in der Hirnrinde, ausgelöst werden. Hier hilft lediglich ein chirurgischer Eingriff, bei dem das fehlgebildete Gewebe entfernt wird – mit einem hohen Risiko, dabei benachbartes gesundes Gewebe zu beschädigen. An einer risikoärmeren Alternative tüfteln derzeit Forschende am Queen Square Institute of Neurology in London. Dort wurden heranwachsenden Mäusen mit per Gen provozierter Epilepsie sogenannte Adeno-assoziierte Viren (AAV) injiziert, die das therapeutische Gen für einen Kaliumkanal in den Hirnzellen installieren, um damit eine Übererregbarkeit zu verhindern. Die Behandlung führte laut Studie, die im Februar 2024 im Fachmagazin „Brain“ veröffentlicht worden ist, zu einem Rückgang der epileptischen Anfälle um 87 Prozent. Etwa 60 Prozent der Tiere wurden anfallsfrei. Kognitive Störungen als Folge blieben aus. Eine klinische Studie am Menschen ist in den nächsten fünf Jahren geplant.
Da die meisten seltenen Erkrankungen genetisch bedingt sind, können sie mit der geeigneten genetischen Analyse diagnostiziert werden. Sie kann dabei helfen, die Ursache der Erkrankung zu finden. Zudem kann die Wiederholungswahrscheinlichkeit innerhalb der Familie oder für das erneute Auftreten in nachfolgenden Generationen berechnet werden.
Bedarf an neuen Therapien Abgesehen von den starken Beeinträchtigungen, welche die Sichelzellkrankheit für die Betroffenen und deren Familien mit sich bringt, belastet sie auch das Gesundheitssystem stark. Bislang gibt es nur eine Chance auf kurative Therapie: die Stammzelltransplantation. Die kommt aber nur für einen kleinen Teil der Erkrankten infrage. Somit ist medizinische Forschung gefragt: Es werden neue Therapiemöglichkeiten benötigt, um Menschen mit Sichelzellkrankheit in Zukunft besser helfen zu können. www.vrtx.com/de-de

Viele Menschen mit Sichelzellkrankheit leiden unter starken Schmerzen aufgrund ihrer Erkrankung.
Weitere Infos finden Sie auf realtalk-sichelzellkrankheit.de
„Plattform FindMe2care ermöglicht Kontakt zu Betroffenen”
Um die etwa 3,2 Millionen Menschen in Deutschland mit einer seltenen Erkrankung, der eine genetische Ursache zugrunde liegt, zu unterstützen, wurde die Plattform FindMe2care entwickelt. Dr. med. Christian Gebhard, Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Humangenetik und in der Initiative verantwortlich für die Koordination der technischen Entwicklung der Plattform, erklärt, was dahintersteckt.

Herr Dr. Gebhard, was ist FindMe2care? FindMe2care ist eine Kontaktplattform für Menschen mit seltenen genetischen Erkrankungen. Patientinnen und Patienten mit einer genetisch gesicherten Diagnose stehen oft vor drängenden Fragen, wie etwa: Wer kennt sich mit dieser seltenen Erkrankung aus? Kann ich an Forschungsprojekten teilnehmen? Gibt es andere Betroffene?
Sind diese Patientinnen und Patienten nicht bereits am richtigen Spezialzentrum angebunden, oder gibt es zum Zeitpunkt der Diagnose nicht bereits passende Studien, finden sie hierauf nur schwer Antworten.
Auf der anderen Seite haben die Ansprechpartner und Versorger für diese Patientengruppe, wie Universitäten, forschende Pharmaunternehmen oder auch Patientenorganisationen, Schwierigkeiten, Kontakt zu ihnen noch unbekannten Betroffenen aufzunehmen. Um diesen Kontakt herzustellen, haben wir FindMe2care entwickelt. Aus unserer täglichen
Erfahrung in Sprechstunde und Labortätigkeit haben wir wiederholt festgestellt, dass es hier eine Lücke gibt, die bislang von keinem Anbieter geschlossen wurde.
Wie sieht diese Kontaktherstellung zwischen Kontaktsuchenden – wie zum Beispiel wissenschaftlichen Einrichtungen – und den Patientinnen und Patienten aus? Wir stellen Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt – Stichwort: „Patient Empowerment“. Für sie haben wir den Ablauf so einfach wie möglich gestaltet und gewährleisten dabei ein Maximum an Datenschutz und Transparenz. Erkrankte, bei denen eine genetische Diagnose in einem teilnehmenden humangenetischen Labor gestellt wird, erhalten auf ihrem Laborbefund einen QR-Code. Mit diesem QR-Code können sich die Betroffenen bei FindMe2care selbstständig registrieren – sie entscheiden somit selbst, ob sie bei FindMe2care mitmachen möchten. Außerdem können sie auf der Plattform auswählen, zu welchem Zweck sie kontaktiert werden möchten.
Wird eine Anfrage von zum Beispiel einem Studienzentrum an FindMe2care gestellt, wird diese Anfrage durch ein unabhängiges Expertengremium geprüft. Im Anschluss bekommen ausschließlich die passenden Patientinnen und Patienten die Information, dass eine Kontaktanfrage gestellt wurde. Die Angesprochenen können nun selbst entscheiden, ob sie auf diese Anfrage antworten oder ob sie diese ignorieren.
Wichtig ist es uns zu betonen, dass FindMe2care keine Daten an die anfragenden Einrichtungen weitergibt und diese Daten auch nicht selbst, etwa für wissenschaftliche Zwecke, nutzt. Entsprechend der zweckgebundenen Einwilligung der Betroffenen dürfen wir diese Daten ausschließlich zur gezielten Vermittlung der Kontaktanfragen nutzen.
Auf genetische Diagnose zugeschnittene Informationen
• Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten
• Patientenorganisationen
• Patientenregister
• Kontakt von und zu anderen Betroffenen Aufrufe zu Studien und wissenschaftlichen Forschungsprojekten
Betroffene stehen im Mittelpunkt
• Betroffene mit einer gesicherten genetischen Diagnose können sich über einen QR-Code selbstständig bei FindMe2care registrieren
• Alle Daten unterliegen strengster Einhaltung des Datenschutzes.

Welche Chancen bietet somit FindMe2care für die beziehungsweise den einzelnen Betroffenen? Patientinnen und Patienten können über Patientenorganisationen, diagnosespezifische Patientenregister, neue Behandlungsmöglichkeiten oder auch klinische Studien in ganz Deutschland informiert werden. Ab dem Zeitpunkt der Registrierung sind sie auch für zukünftige Forschungsprojekte auffindbar und bleiben somit über die Plattform immer zum aktuellen Stand des medizinischen Fortschritts informiert. Gleichzeitig behalten sie die Hoheit über ihre Daten.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, selbst nach anderen registrierten Betroffenen mit der gleichen Erkrankung zur Vernetzung und gegenseitigen Unterstützung zu suchen. Hierin sehen wir vor allem Vorteile bei sehr seltenen Erkrankungen, für die es noch keine Patientenorganisation gibt.
Medizinische Daten stehen unter besonderem Schutz. Wie stellen Sie diesen Schutz der Daten sicher? Der Schutz sensibler Daten nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein. Deshalb haben wir zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um einen lückenlosen Schutz der Daten sicherzustellen. Selbstverständlich beachten wir die europäischen und nationalen Vorgaben des Datenschutzes. Die Patientinnen und Patienten entscheiden, ob sie sich registrieren wollen, und erst dann werden die medizinischen und persönlichen Daten – durch die Betroffenen selbst – an die Plattform übertragen. Die Daten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland verarbeitet. Das umfassende Datenschutzkonzept kann bei Interesse auf findme2care.de nachgelesen werden.
Wer steht hinter FindMe2care? Findme2care ist eine Initiative von Fachärztinnen und Fachärzten für
Humangenetik in einer laborübergreifenden Zusammenarbeit. Dadurch können sie die Schlüsselstellung, die sie in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit genetischen Erkrankungen haben, noch besser nutzen. Das Projekt lebt von einer großen Zustimmung und Beteiligung möglichst aller Labore in Deutschland. Verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb der Plattform ist die RxOME GmbH. Diese wurde von amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH und dem Medizinisch Genetischen Zentrum (MGZ) eigens zu diesem Zweck gegründet und stellt FindMe2care allen Diagnostiklaboren in Deutschland zur Verfügung.
Die RxOME GmbH hat keine Absicht, Gewinne zu erzielen. Wir möchten mit FindMe2care den Austausch zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen im Bereich Genetik fördern und stärken, was letztlich zu einer verbesserten Patientenversorgung führt. Deshalb ist die Teilnahme an FindMe2care für alle Patientinnen und Patienten kostenlos.
Was machen Patientinnen und Patienten, die schon vor dem Start von FindMe2care eine Diagnose bekommen und somit keinen QRCode haben? Wir arbeiten daran, auch Betroffenen einen Zugang zu FindMe2care zu ermöglichen, deren genetischer Befund noch keinen QRCode enthält. Zum aktuellen Stand dieser Entwicklungen informieren wir regelmäßig auf unserer Website.

Die Zentren für Seltene Erkrankungen (ZSE) sind zentrale, qualifizierte Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten mit bekannter Diagnose einer seltenen Erkrankung. Zum anderen können sich auch Menschen mit unklarer Diagnose zur weiteren Abklärung vorstellen. In den aktuell bundesweit 36 ZSE schließen sich spezialisiertes medizinisches Fachpersonal und Wissenschaftlerteams verschiedener Fachrichtungen zusammen, um Betroffenen zu einer präzisen Diagnose, maßgeschneiderten Therapie sowie umfassenden Betreuung zu verhelfen.
Berliner Centrum für Seltene Erkrankungen (BCSE) Charité –Universitätsmedizin Berlin http://bcse.charite.de
1
Care for Rare Center im Dr. von Haunerschen Kinderspital (CRC Hauner) LMU Klinikum München www.klinikum.uni-muenchen.de/Kinderklinik-und-Kinderpoliklinik- im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital/de/zentren/Care_for_Rare- Center_CRCHauner_/index.html
2
Centrum für seltene Erkrankungen Münster (Kinder) Universitätsklinikum Münster www.ukm.de/zentren/seltene-erkrankungen
3
Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) Ruhr-Universität Bochum, Universität Witten/Herdecke www.centrum-seltene-erkrankungen-ruhr.de
4
Essener Zentrum für Seltene Erkrankungen (EZSE) Universitätsklinikum Essen www.ezse.de
5
Frankfurter Referenzzentrum für Seltene Erkrankungen (FRZSE) Universitätsklinikum Frankfurt www.kgu.de/einrichtungen/zentren/frankfurter-referenzzentrum- fuer-seltene-erkrankungen-frzse
6
Freiburger Zentrum für Seltene Erkrankungen (FZSE) Universitätsklinikum Freiburg www.uniklinik-freiburg.de/fzse.html
7
Martin Zeitz Centrum für Seltene Erkrankungen, Hamburg Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf www.uke.de/kliniken-institute/zentren/martin-zeitz-centrum/ index.html
8
Mitteldeutsches Kompetenznetz Seltene Erkrankungen (MKSE) Kooperationsverbund der Uniklinik Halle und Magdeburg sowie des Städtischen Klinikums Dessau www.mkse.ovgu.de
9
Münchener Zentrum für Seltene Erkrankungen (Erwachsene) LMU-Klinikum, München www.klinikum.uni-muenchen.de/Muenchener-Zentrum-fuer-Seltene- Erkrankungen/de/index.html
10
Universitäres Zentrum für Seltene Erkrankungen Leipzig
11
Universitätsklinikum Leipzig
www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/uzsel
UniversitätsCentrum für Seltene Erkrankungen Dresden (USE)
12
Universitätsklinikum Dresden
www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/universitaetscentren/use
Zentrum für Seltene Erkrankungen Regensburg (ZSER)
30
Universitätsklinikum Regensburg www.ukr.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
Zentrum für Seltene Erkrankungen Tübingen
31
Universitätsklinikum Tübingen www.medizin.uni-tuebingen.de/de/kontakt/zuweiser/zentren/ zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
Zentrum für Seltene Erkrankungen Ulm (ZSE)
32
Universitätsmedizin Ulm www.uniklinik-ulm.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen.html
Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZESE) Würzburg –Referenzzentrum Nordbayern
33
Universitätsklinikum Würzburg www.ukw.de/behandlungszentren/zentrum-fuer-seltene- erkrankungen-zese/startseite
Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen Marburg (ZusE ) Universitätsklinikum Marburg https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_zuk/27241.html
34
Augsburger Zentrum für Seltene Erkrankungen (AZeSE)
Universitätsklinikum Augsburg www.uk-augsburg.de/zentren/azese-seltene-erkrankungen/ueberblick
35
Zentrum für Seltene und Ungeklärte Erkrankungen des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH www.ctk.de/info.php?object=contact&id_object=62&tab=ueber-uns
36
Zentrum für Seltene Erkrankungen (TUM)
13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM)
www.mri.tum.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
Zentrum für Seltene Erkrankungen Aachen (ZSEA) Uniklinik RWTH Aachen
14
www.ukaachen.de/kliniken-institute/zentrum-fuer-seltene- erkrankungen-aachen-zsea/das-zentrum
Zentrum für seltene Erkrankungen Gießen (ZSEGi)
15
Universitätsklinikum Gießen
www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_zse/index.html
Zentrum für Seltene Erkrankungen Hannover Medizinische Hochschule Hannover www.mhh.de/interdisziplinaere-zentren/zentrum-fuer-seltene- erkrankungen
23
Zentrum für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum des Saarlands
16
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Zentrum für Seltene Erkrankungen Heidelberg Universitätsklinikum Heidelberg www.klinikum.uni-heidelberg.de/interdisziplinaere-zentren/ zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
24
www.uniklinikum-saarland.de/de/einrichtungen/kliniken_institute/ zentrum_fuer_seltene_erkrankungen/
Zentrum für Seltene Erkrankungen Bonn (ZSEB)
17
Universitätsklinikum Bonn
www.zseb.ukbonn.de
Zentrum für Seltene Erkrankungen Jena Universitätsklinikum Jena www.uniklinikum-jena.de/zse
25
Zentrum für Seltene Erkrankungen der Uniklinik Rostock
18
Universitätsmedizin Rostock https://selten.med.uni-rostock.de
Zentrum für Seltene Erkrankungen Köln Uniklinik Köln www.uk-koeln.de/kliniken-institute-und-zentren/zentrum-fuer- seltene-erkrankungen
26
Zentrum für Seltene Erkrankungen des Nervensystems (ZSEN) Mainz
19
Universitätsmedizin Mainz www.unimedizin-mainz.de/zsen/startseite/willkommen.html
Zentrum für Seltene Erkrankungen Lübeck (ZSE)
27
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein –Campus Lübeck www.uksh.de/zse-luebeck
Zentrum für Seltene Erkrankungen Kiel (ZSE)
28
Zentrum für Seltene Erkrankungen Universitätsklinikum Düsseldorf www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/ zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
20
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein –Campus Kiel www.uksh.de/zse-kiel
Zentrum für Seltene Erkrankungen Mannheim
29
Universitätsmedizin Mannheim www.umm.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
Zentrum für Seltene Erkrankungen Universitätsklinikum Erlangen www.zseer.uk-erlangen.de
21
Zentrum für Seltene Erkrankungen Göttingen (ZSEG)
Universitätsmedizin Göttingen https://zseg.umg.eu
22
Quellen: RESEARCH FOR RARE, Forschung für Seltene Krankheiten, www.research4rare.de; se-atlas –Versorgungsatlas für Menschen mit Seltenen Erkrankungen, www.se-atlas.de/map/zse; Zugriff: 15.02.2024
EOSINOPHILE ÖSOPHAGITIS | VON TOBIAS LEMSER
Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln nehmen in der Bevölkerung deutlich zu – wovon letztlich auch die Speiseröhre betroffen sein kann. Ein Beispiel dafür ist die Eosinophile Ösophagitis. Wie wirkt sich diese häufigste Form von Speiseröhrenentzündung aus, und was kann man dagegen tun?
Wer kennt sie nicht, diese brennenden Schmerzen hinter dem Brustbein nach einer üppigen Mahlzeit? Das Gute: Oft verschwindet dieses unangenehme Gefühl recht schnell von allein. Doch was, wenn sich die an Reflux erinnernden
Auslöser sind häufig
Eiweiße aus tierischen Milchprodukten.
Beschwerden chronifiziert haben und das Schlucken fester Nahrung die Lebensqualität auf
Dauer deutlich beeinträchtigt? Worauf nicht jede Hausärztin oder Hausarzt unmittelbar kommt:
Hinter den Beschwerden kann sich eine Eosinophile Ösophagitis verbergen, eine Erkrankung der Speiseröhre, die mit einer allergieähnlichen
chronischen Entzündung einhergeht. Es wird vermutet, dass bei dieser erstmals in den frühen 1990er-Jahren beschriebenen Autoimmunerkrankung das Immunsystem fehlgeleitet ist und übermäßig auf einen Reiz reagiert.
Gen- und Umweltfaktoren
Vor allem in Industrieländern wird die Eosinophile Ösophagitis zunehmend festgestellt. Eine von 3.000 Personen ist von dieser seltenen Erkrankung betroffen. Mehrheitlich sind es Männer, die bei der Diagnose oft zwischen 30 und 50 Jahre alt sind und vielfach bereits an Allergien leiden. Jedoch kann die Erkrankung auch bei Kindern auftreten. Nahrungsverweigerung, Erbrechen, Gewichtsverlust oder Bauchschmerzen können Anzeichen sein.
Die genaue Ursache für die chronische Entzündung der Speiseröhre ist noch nicht bekannt. Neben genetischen Faktoren – im Jahr 2010 wurde erstmals eine Veränderung auf dem Chromosom 5q22 beschrieben – spielen ebenso Umwelteinflüsse und verschiedene Nahrungsmittelbestandteile als auslösende Faktoren eine wichtige Rolle. Letztere sind etwa Eiweiße aus tierischen Milchprodukten oder Weizen.

Herausforderung Diagnose: Anhaltende, sich verstärkende Schluckbeschwerden können auf Eosinophile Ösophagitis hindeuten.
Verzicht auf Milchprodukte Für eine gesicherte Diagnose ist eine Magenspiegelung inklusive der Entnahme von Gewebeproben aus der Speiseröhre unerlässlich. Und wie bekommt man die Beschwerden in den Griff? Oft hilft eine sogenannte hypoallergene Diät, also für einige Wochen der komplette Verzicht auf die Hauptallergene Kuhmilch, Weizen, Soja sowie Eier, Nüsse und Fisch. So lassen sich bei rund drei Viertel der Betroffenen die Beschwerden deutlich lindern. Laut einer US-amerikanischen Studie aus dem Frühjahr 2023 reicht es jedoch bereits aus, Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch zu meiden. Zudem können entzündungshemmende Medikamente oder eine Aufweitung der Speiseröhre lindernd wirken.
Ich
Anton, 32 Jahre alt, verheiratet und stolzer Vater eines einjährigen Sohnes, leidet seit seiner frühen Kindheit an der seltenen Krankheit Eosinophile Ösophagitis. Die korrekte Diagnose erhielt er erst nach einem langen Leidensweg.
Die Ärzte haben seine Schluckbeschwerden viele Jahre als Nahrungsmittelallergie gedeutet und ihm geraten, auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten. Über die Jahre wurde so die Liste der Lebensmittel, die nicht mehr auf den Tisch kamen, immer länger.
Starke Schmerzen hinter dem Brustbein
Neben Schluckbeschwerden hatte Anton nach dem Essen oft sehr starke Schmerzen in der Brustregion. Er musste extrem langsam essen und sehr viel trinken, oft eine ganze Flasche Wasser, um überhaupt ein paar Bissen schlucken zu können. Schließlich bereitete ihm selbst das Trinken von Wasser Probleme. Sein Leidensdruck wurde immer größer. Das hat auch die Familie belastet und das Berufsleben eingeschränkt. Antons Arzt diagnostizierte schließlich eine
Gastritis (Entzündung der Magenschleimhaut), und Anton wurde ein Säureblocker verordnet, den er ein Jahr lang einnahm. Besser wurden die Beschwerden dadurch jedoch nicht.
Diagnose: Eosinophile Ösophagitis
Der Leidensdruck nahm schließlich überhand, und Anton suchte einen Magen-Darm-Spezialisten (Gastroenterologen) auf, der eine Magenspiegelung durchführte. Dabei wurde eine ausgeprägte Entzündung in seiner Speiseröhre festgestellt und nach weiteren Untersuchungen die Diagnose „Eosinophile Ösophagitis“, kurz EoE, gestellt.
Medikament lindert Beschwerden
Vor einigen Wochen verordnete Antons Gastroenterologe ihm schließlich ein Medikament, das eigens zur Behandlung der EoE entwickelt wurde. Seitdem haben sich seine Beschwerden sehr rasch gebessert, und heute, wenige Wochen später, sind sie kaum noch ein Problem. Endlich kann der junge Mann wieder alles essen, im Job vollen Einsatz zeigen und sein Familienleben uneingeschränkt genießen.

Anton ist seitdem regelrecht aufgeblüht: „Ich führe nun endlich ein normales Leben.“
Anton weiß, dass er das Medikament vorerst auf unbestimmte Zeit einnehmen muss und dass beim Absetzen eventuell die Beschwerden zurückkommen können. Auf lange Sicht hofft er jedoch, dass die medikamentöse Behandlung die Entzündungen der Speiseröhre bekämpft und dass er irgendwann, auch ohne dauerhaft Medikamente einnehmen zu müssen, ein Leben ohne Beeinträchtigungen durch die
EoE führen kann. Menschen, die ebenfalls an Schluckbeschwerden leiden, rät Anton, an die Möglichkeit einer EoE zu denken, frühzeitig einen Gastroenterologen zu konsultieren und hartnäckig bei der Abklärung der Diagnose zu sein. Betroffene und ihre Angehörigen finden weitere Informationen zu Symptomen, zum Krankheitsbild und zu Behandlungsmöglichkeiten hier:
https://schluckbeschwerden.de
„Es gibt Hilfe gegen einen der stärksten Schmerzen“
CLUSTERKOPFSCHMERZ
Schätzungsweise rund 150.000 Menschen in Deutschland haben einen Clusterkopfschmerz. Was diese seltene Kopfschmerzart auszeichnet und wie Betroffenen geholfen werden kann, weiß Dr. med. Estelle Bianca Neb, Leitende Oberärztin an der Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein/Schmerzzentrum Taunus.

Wie macht sich der Clusterkopfschmerz, der in Episoden auftritt, bemerkbar? Typisch ist ein zumeist einseitig mit höchster Intensität auftauchender Schmerz, häufig hinter dem Auge. Die Dauer der Attacken ist kürzer als etwa bei einer Migräne und liegt bei 15 bis 180 Minuten. Währenddessen kommt es auf der Kopfschmerzseite außerdem zu sogenannten trigeminoautonomen Symptomen wie Augentränen, Augenrötungen, Schwitzen im Gesichtsbereich oder Naselaufen. Betroffene sind während der Attacke innerlich unruhig und verspüren einen Bewegungsdrang.
Warum ist der Clusterkopfschmerz trotz dieser recht eindeutigen Symptomatik unterdiagnostiziert? Ausgenommen von Kopfschmerzfachleuten kennen die wenigsten Ärztinnen und Ärzte, aufgrund der Seltenheit, die Kriterien für einen Clusterkopfschmerz und ordnen die Beschwerden daher falsch zu. Entscheidend ist, die eigenen Schmerzen präzise und nachvollziehbar zu vermitteln. Mein Tipp: die Attacken dokumentieren – idealerweise auch in Form einer Videoaufnahme.
Angenommen, die Diagnose – basierend auf einer ausführlichen Anamnese und neurologischen Untersuchungen – ist gesichert, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Im Fall der Akuttherapie können wir Betroffenen hochdosierten Sauerstoff über eine geschlossene Mund-Nasen-Maske und schnell wirksame Triptane mittels eines Injektionspens, der sie unter die Haut spritzt, und einem Nasenspray anbieten. Länge und Intensität der Attacken lassen sich damit gut reduzieren. Zudem gibt es zur prophylaktischen Behandlung Medikamente, mit denen eine Verkürzung der gesamten Schmerzepisode möglich ist – zum Beispiel aus der Gruppe der Calciumantagonisten, aber auch Cortison in Form einer Kurzzeit-Stoßtherapie.
Gibt es Neues an der Therapiefront? Nicht direkt, dafür wird noch zu wenig gezielt geforscht. Das Gute ist, dass Clusterkopfschmerz-Betroffene häufig vom therapeutischen Fortschritt in der Migräne-Forschung profitieren, wie etwa im Fall der Triptane. Aktuell wird in Studien geprüft, ob monoklonale CGRP-Antikörper auch in der prophylaktischen Therapie von Clusterkopfschmerz infrage kommen. Eine Zulassung wäre wünschenswert, um das Behandlungsspektrum zu erweitern.
FACHLEUTE & SELBSTHILFEGRUPPEN
Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) hält eine Liste mit ärztlich, psychotherapeutisch oder physiotherapeutisch tätigen DMKG-Mitgliedern sowie DMKG-zertifizierten Kopfschmerzzentren bereit. www.dmkg.de/kopfschmerzexperten
Der Bundesverband der Clusterkopfschmerz-Selbsthilfe-Gruppen (CSG) informiert über Clusterkopfschmerz sowie aktuelle Erkenntnisse und Studien und stellt den Kontakt zu anderen Betroffenen her. www.clusterkopf.de
Clusterkopfschmerz „Schmerzen wie glühende Nägel im Auge“







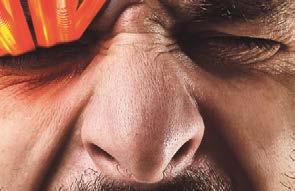

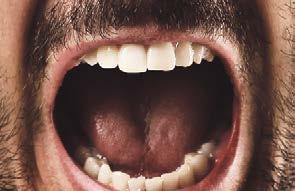












Leiden Sie oder Bekannte unter folgenden Symptomen?
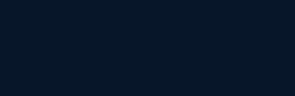
Heftigste einseitige Kopfschmerzen Unruhe und Bewegungsdrang während der Attacke Attacken-Dauer von 15 Minuten bis 3 Stunden mindestens ein Begleitsymptom (einseitig) tränendes Auge laufende Nase hängendes Augenlid
Brauchen Sie Hilfe und Unterstützung?
Unter www.kopfschmerz-kompass.de finden Sie Informationen rund um Kopfschmerzerkrankungen und Experten in Ihrer Nähe.
Bundesweit sind bis zu 2.000 Menschen von NMOSD betroffen, einer seltenen, schwerwiegenden Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 39 Jahren. Matthias Fuchs, selbst Betroffener, berichtet, wie er von der Diagnose erfahren hat und was ihm dabei hilft, mit der Erkrankung umzugehen.

Als Matthias Fuchs im Jahr 2010 mit seiner Frau Christine zur gemeinsamen Reise nach New York City aufbrach, ahnte er noch nicht, wie sich von diesem Urlaub an sein Leben verändern würde. „Ich stand auf dem hell erleuchteten, mit Blitzlichtern durchzogenen Times Square und spürte plötzlich einen starken Schmerz auf meinem linken Auge. Die Sicht wurde völlig verschwommen, als wäre Nebel davor.“
Neurologe sorgte für Klarheit
Zurück in München, suchte der damals 34-jährige Ingenieur schnellstmöglich einen Augenarzt auf, der ihn nach einigen Tests weiter zum Neurologen schickte. Diagnose: Sehnerventzündung, was, wie er damals noch nicht wusste, ein Zeichen für seine Erkrankung sein kann. Dank Steroidinfusionen konnte Matthias Fuchs sein Sehvermögen wiedererlangen. Doch dann der nächste Tiefschlag: „Zwei Jahre später konnte ich beim Wandern meinen linken Fuß nicht mehr richtig hochheben und stolperte über jeden Stein“, erinnert er sich.
Nach umfangreichen Untersuchungen und zahlreichen Tests beim selben Neurologen und am Klinikum Großhadern war schließlich klar: Der Münchner hat NMO (engl. Neuromyelitis optica). Diese Erkrankung gehört zu der Gruppe von Autoimmunerkrankungen, die auch als Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD, engl. Neuromyelitis optica spectrum disorders) bezeichnet werden. Dabei wird durch fehlgeleitete Abwehrzellen des Immunsystems
irrtümlich körpereigenes Gewebe angegriffen. Damit einhergehende Entzündungen betreffen vor allem das Rückenmark und die Sehnerven, jedoch auch in einigen Fällen das Gehirn. Schwere, sich wiederholende Schübe können zur Erblindung, Lähmung oder sehr selten sogar zum Tod führen. Das Komplexe bei NMOSD: Mit jedem Schub verschlimmert sich der Zustand der Betroffenen – mitunter sogar sehr schnell. Typische Beschwerden sind Sehstörungen, genauso wie Taubheit oder Kribbeln in den Extremitäten. Nicht wenige Betroffene haben Schwierigkeiten beim Gehen, so wie Matthias Fuchs, der sich nach der Diagnose immer schlechter bewegen konnte und zeitweise Mühe hatte, ganz allein vom Sofa aufzustehen. „Als ich 2019 kaum noch 500 Meter laufen konnte, entschied ich mich für einen Rollstuhl.“
Unaufhaltsame Reiselust
Gerade wegen der drohenden Immobilität schlägt NMOSD vielen Betroffenen auf die Psyche. Genauso bei Matthias Fuchs: Auch wenn er noch immer damit kämpft, die Erkrankung zu akzeptieren, geht der Autofan weiterhin positiv durchs Leben: „Die Diagnose hat unser Leben komplett verändert. Aber nicht nur im Negativen. Unser Alltag ist überhaupt nicht traurig. Wir sind viel unterwegs gewesen und sind es immer noch. In den letzten Jahren haben wir die USA, Kanada, Hawaii, Afrika, Island und viele Destinationen in Europa bereist.“ Seit 2020 sind Matthias und Christine in Besitz eines Campervans, womit sie so oft wie möglich dem Alltagsstress entfliehen.
Frühzeitige Therapie entscheidend
Bis zur Antikörpertherapie hat es insgesamt sieben Jahre gedauert – was unter anderem daran lag, dass es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine zugelassenen Medikamente für NMOSD gab. Das große Problem: die finanzielle Übernahme durch die Krankenkasse. Matthias Fuchs musste einen langen Weg über mehrere Instanzen gehen, bis die Krankenkasse schließlich einwilligte, die Kosten für eine sogenannte Off-Label-Therapie zu übernehmen. Für den Münchner ein großes Glück – auch weil die Diagnose nach kurzer Zeit


in einem frühen Stadium gestellt wurde, was grundsätzlich bei allen an NMOSD-Erkrankten für eine gute Prognose zentral ist. Doch es braucht neben der frühzeitigen Diagnose auch eine konsequente Behandlung mit dem obersten Ziel, neue Schübe zu verhindern. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie kommen sowohl bei einem akuten Erkrankungsschub als auch im täglichen Leben ebenso der Physio- und Ergotherapie eine besondere Bedeutung zu. Ob NMOSD Matthias Fuchs als Mensch verändert hat, beantwortet der Münchner voller Überzeugung: „Absolut. Die eigene Situation zu überdenken, die Lebensperspektive zu ändern und Hilfe anderer anzunehmen kosteten zwar einiges an Anstrengung, kann aber wunderbare Möglichkeiten schaffen.“
Mit jedem Schub verschlimmert sich der Zustand.
STECKBRIEF NMOSD
Verlauf
Meist schubförmig
Symptome
Meist Sehstörungen und/oder Sensibilitätsstörungen bis hin zur Lähmung in Armen und Beinen
Beeinträchtigungen
Symptome bilden sich zum Teil nach Schub schlecht zurück; Verschlechterung nur durch Schub
Durchschnittliches Erkrankungsalter 39 Jahre
MRT
Größere zusammenhängende Entzündungsherde meist in Sehnerven und Rückenmark
Quelle: https://www.dmsg.de/news/detailansicht/ multiple-sklerose-und-neuromyelitisoptica-spektrum-erkrankung-aehnlichesymptome-aber-unterschiedliche-erkrankungen; Zugriff: 27.11.2023
Neuromyelitis-optica-SpektrumErkrankungen (NMOSD, engl. Neuromyelitis optica spectrumdisorder) sind seltene Erkrankungen, bei denen das körpereigene Immunsystem Sehnerven und Rückenmark angreift. Aufgrund ihres zunächst ähnlichen, schubweisen Verlaufs wird eine NMOSD oft mit einer Multiplen Sklerose (MS) verwechselt. Doch NMOSDSchübe sind oft schwerwiegender und führen häufig zu irreparablen Schäden und Behinderungen.
Rund 1.500 bis 2.000 Menschen in Deutschland sind von NMOSD 1 , genauer gesagt von plötzlichen Entzündungsschüben, die ihre Sehnerven und ihr Rückenmark angreifen, betroffen. Die Inzidenz bei Frauen ist neunmal höher als bei Männern. 2
Zu den frühen Symptomen, mit denen sich Erkrankte erstmals bei einer Ärztin oder einem Arzt vorstellen, können plötzliche Taubheitsgefühle an Gliedmaßen gehören, ein Kribbeln im Körper, brennende Schmerzen im Rücken, Übelkeit, Inkontinenz, Geh- und Sehstörungen bis hin zu völliger Blindheit auf einem Auge oder sogar auf beiden Augen. 3 Anders als bei einer MS sind die häufig wie -


vollständigen Erblindung führen kann. 5, 6 Drei Viertel der Erkrankten leiden an chronischen Schmerzen, für 40 Prozent gehören Depressionen zum Alltag. 7
Neben finanziellen Belastungen durch Behandlungskosten und Einschränkungen im Berufsleben klagen Betroffene zudem häufig über Blasen- und Darmprobleme sowie eine sexuelle Dysfunktion. 3, 8
„Seltene Erkrankungen wie NMOSD erfordern besondere Aufmerksamkeit –wir unterstützen Ärzte und Patienten, wo wir können.”
Dr. med. Bastian Eulenstein, Leiter des Geschäftsbereichs Seltene Erkrankungen bei Amgen Deutschland
derkehrenden Schübe bei einer NMOSD allerdings schwerer und verlaufen attackenartig: Mit jedem neuen Schub können sich Symptome plötzlich verschlechtern oder neue auftreten. Zudem können nach einem durchgemachten Schub schnell weitere auftreten, denn die Schübe treten häufig in sogenannten Clustern auf. 90 Prozent aller Patienten erleben innerhalb von fünf Jahren nach dem ersten Schub weitere Schübe. 4
Lebensqualität stark beeinträchtigt
Fast zwei Drittel der Menschen mit NMOSD verlieren innerhalb von drei Jahren erheblich an Sehkraft, was im weiteren Verlauf zur
All diese Beschwerden beeinträchtigen die Lebensqualität deutlich. Und auch schwerste motorische Störungen mit Lähmungserscheinungen sind keine Seltenheit – in einigen Fällen sind sie so stark, dass die Patienten auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 6 Wird die Erkrankung nicht erkannt oder behandelt, verstirbt jeder dritte Betroffene innerhalb von zehn Jahren. 9
NMOSD oft mit MS verwechselt Lange Zeit wurde NMOSD als Variante der Multiplen Sklerose betrachtet. Erst 2004, mit der Entdeckung der sogenannten Aquaporin-4-Immunglobolin-GAuto-Antikörper (AQP4-IgG), wurde deutlich, dass es sich bei NMOSD
allem um das 40. Lebensjahr herum auf – etwa elf Jahre später als MS. 11, 13 Im zentralen Nervensystem sind zudem andere Zellen betroffen 14 , und während es bei NMOSD relativ häufig zu Entzündungen des Sehnervs und langstreckigen Rückenmarksentzündungen kommt, sind solche Befunde bei der MS ungewöhnlich. 11 Ein weiterer Unterschied ist, dass sich Menschen mit MS häufig wieder von Krankheitsschüben erholen, was bei NMOSD nur selten der Fall ist. 15
Klarheit durch Antikörpertest
um ein eigenständiges Krankheitsbild handelt. 10
Bis zur Einführung des Tests auf AQP4-IgG war die Unterscheidung von NMOSD und MS eine diagnostische Herausforderung, zumal die Symptome vor allem zu Beginn der Erkrankung nur schwach ausgeprägt sein können 11 und die Beteiligung des zentralen Nervensystems auch zu einer MS passen könnte. Und so wird selbst heute noch in 41 Prozent der Fälle eine MS diagnostiziert, obwohl es sich eigentlich um eine NMOSD handelt. 3
Für die betroffenen Patienten hat das die Konsequenz, dass ihre NMOSD nicht behandelt wird und durch die MS-Therapie sogar verschlimmert werden kann. 12 Deshalb ist es entscheidend, dass die Behandelnden die Unterschiede der beiden Erkrankungen kennen. Unterschiede zwischen NMOSD und MS
Ein wichtiger Unterschied zwischen der MS und NMOSD ist das Erkrankungsalter: Eine NMOSD tritt vor
Der entscheidende Faktor bei der Unterscheidung von NMOSD und MS ist in den meisten Fällen ein Labortest: Während bei den NMOSDBetroffenen Autoantikörper gegen das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin-4 im Blutserum gefunden werden, sind diese bei einer MS nicht nachweisbar. 16 Die Autoantikörper werden von speziellen weißen Blutkörperchen produziert, sogenannten Plasmablasen und Plasmazellen. Diese spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung der NMOSD und sind ein wichtiges Ziel bei der gezielten Behandlung. 16 www.horizontherapeutics.de
Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von Horizon Therapeutics, jetzt Teil von Amgen, erstellt.
1 Hemmer B et al., S2k-Leitlinie www.dgn.org/leitlinien (letzter Zugriff: 25.01.2023).
2 Wingerchuk DM et al., Neurol. 2015;85(2):177-89.
3 Beekman J et al., Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2019;6(4):e580.
4 Wingerchuk DM et al., Neurol. 1999;53(5):1107-14.
5 Cabre P et al., J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80:1162-4.
6 Jiao Y et al., Neurol. 2013;81:1197-204.
7 Ayzenberg I et al., Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021;8(3):e985.
8 Eaneff S et al., Mult Scler Relat Disord. 2017;17:116-22.
9 Huda S et al., Clin Med (Lond). 2019;19(2):169-76.
10 Trebst J et al., J Neurol. 2014;261:1-16.
11 Kim SM et al., Ther Adv Neurol Disord. 2017;10(7):265-89.
12 Jarius S et al., Clin Exp Immunol. 2014;176:149-64.
13 Hor JY et al., Front Neurol. 2020;11:501.
14 Kawachi I, Lassmann H, J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017;88:137-45.
15 Jarius S et al., J Neuroinflamm. 2012,9:14.
16 Borisow N et al., Front Neurol. 2018;9(888):1-15.
„Oftmals vergehen Jahre bis zur korrekten Diagnosestellung einer seltenen Erkrankung, da nur wenige Menschen darüber Bescheid wissen“, sagt Dr. med. Bastian Eulenstein, Leiter des Geschäftsbereichs Seltene Erkrankungen bei Amgen Deutschland. „Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, die Situation von Betroffenen und ihren Familien durch Aufklärung und innovative, zugelassene Therapien nachhaltig zu verbessern.“ Nicht zuletzt deshalb arbeitet das Unternehmen im Rahmen seines #RAREis-Programms weltweit mit Patientenorganisationen zusammen und unterstützt so Menschen mit seltenen Autoimmun- und schwerentzündlichen Erkrankungen.

„Ziel ist die bestmögliche Krankheitskontrolle“
MYASTHENIA GRAVIS | IM GESPRÄCH MIT NADINE EFFERT
Die Myasthenia gravis führt zu einer belastungsabhängigen Muskelschwäche. Über Ursachen, klassische Symptome und moderne Behandlungsoptionen berichtet Univ.Prof. Prof. h.c. Dr. med. Dr. h.c. Heinz Wiendl, Direktor der Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie, Universitätsklinikum Münster.
Was steckt hinter der Myasthenia gravis? Es handelt sich dabei um eine erworbene Autoimmunerkrankung, bei der die Reizübertragung vom Nerv auf die quergestreiften Muskeln gestört ist. Ursache ist eine fehlgesteuerte Immunreaktion. Es kommt zur Bildung von Antikörpern, vor allem gegen sogenannte Acetylcholin-Rezeptoren, die an der postsynaptischen Membran der neuromuskulären Endplatte sitzen. Eine Rolle spielt die hinter dem Brustbein sitzende Thymusdrüse als wichtiges Organ bei der Entwicklung des Immunsystems im
Kindesalter. Im Erwachsenenalter bildet sich die Drüse zurück. Bei den meisten Betroffenen ist der Thymus verändert oder in seltenen Fällen von einem Tumor befallen. Frauen erkranken bereits ab dem 20. Lebensjahr (und oft auch schwerer) an Myasthenia gravis – Männer am häufigsten im vierten Lebensjahrzehnt.
Wie macht sich die Erkrankung bemerkbar? Typisch ist, dass die Muskelschwäche nach Belastung auftritt oder sich verstärkt und abends ausgeprägter ist als morgens. Erste Anzeichen können im Bereich der Augen sein: Sehstörungen in Form von Doppelbildern, schwere Augenlider. Weiter können auch die Kau- und Rachenmuskulatur sowie die Muskulatur der Extremitäten betroffen sein. Letztlich kann sogar die Atemmuskulatur beeinträchtigt sein, sodass die betroffene Person intensivmedizinisch behandelt werden muss. Dies nennt man „myasthene Krise“.






Was macht die Krankheit zu einer Herausforderung? Zum einen, dass ihr Verlauf nicht vorhersehbar ist und dass sie sich sehr heterogen manifestiert und verläuft. Zum anderen, dass die Beschwerden individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Folglich wandern Betroffene meist von einem Arzt zum nächsten, sodass oft Jahre vergehen können, bis eine Diagnose – etwa mittels Untersuchung des Bluts auf Antikörper – erfolgt.
Ziel der Therapie sind die bestmögliche Krankheitskontrolle und eine Symptomfreiheit. Wie gelingt das? Während Cortison, Immunsuppressiva und B-Zell-gerichtete Antikörper die Angriffe des Immunsystems dämpfen, wirken sogenannte Cholinesterasehemmer symptomatisch, indem sie den Abbau des Botenstoffs Acetylcholin hemmen, wodurch die Nervenimpulse verstärkt werden. Die Entfernung des Thymus führt häufig zu einem milderen, besser kontrollierbaren Verlauf, da nach der OP weniger Medikamente verabreicht werden müssen. Heutzutage kann eine Myasthenie in vielen Fällen gut behandelt werden und können Betroffene ein weitgehend normales Leben führen. Eine Reihe neuer Medikamente ist seit Kurzem verfügbar – und in der Entwicklung: Sogenannte FcRn-Inhibitoren und Hemmer des Komplementsystems wirken schneller und spezifischer auf die immunologischen Treiber der Erkrankung.
Die Spezialisten für seltene Erkrankungen sind oft die Betroffenen selbst –von ihnen zu lernen ist für uns der erste Schritt zur Lösung



PRIMÄR BILIÄRE CHOLANGITIS | VON TOBIAS LEMSER
Müdigkeit, Juckreiz und Gelenkschmerzen können Symptome für eine seltene Autoimmunerkrankung der Leber sein. Von der primär biliären Cholangitis sind bis zu 90 Prozent Frauen betroffen. Viele Erkrankte leiden vor allem unter Stigmatisierung. Doch was steckt dahinter, und was lässt sich dagegen tun?
Zumeist verläuft sie über viele Jahre schleichend, ohne dass die meisten Patientinnen und Patienten etwas davon bemerken. Erst erhöhte Leberwerte bei einem routinemäßigen Checkup bringen die primär biliäre Cholangitis, kurz PBC, ans Tageslicht – eine chronische Lebererkrankung, bei der die Gallengänge in der Leber angegriffen und durch eine Entzündung zerstört werden. Von 100.000 Menschen sind bis zu 40 Personen daran erkrankt.
Ein Leben lang Medikamente
Das Problem: Oftmals wird im Laufe der Jahre die gesamte Leber geschädigt, sodass diese im Endstadium vollständig vernarbt. Fachleute sprechen dann von der sogenannten Leberzirrhose. Als Auslöser geht man von einer Autoimmunerkrankung aus. Betroffen sind insbesondere Frauen, die das 40. Lebensjahr bereits überschritten haben. Wird die Erkrankung im Frühstadium diagnostiziert, können als Standardtherapie sogenannte Gallen- und Lebertherapeutika,
welche als Tablette lebenslang eingenommen werden, die Krankheit verlangsamen oder gar zum Stillstand bringen. Im späteren Stadium ist die Wirksamkeit dieser Medikamente nicht eindeutig geklärt.
Erkrankte werden stigmatisiert Wie es zu der Erkrankung kommt, ist unbekannt. Fest steht jedoch: PBC wird nicht durch Alkohol verursacht – für Betroffene die wichtigste Botschaft überhaupt. Denn noch immer sind Menschen, die an der Leber erkranken, häufig dem Vorurteil ausgesetzt, selbst daran schuld zu sein – etwa durch übermäßigen Alkohol- oder Drogenkonsum. Werden Krankheiten wie Herzerkrankungen in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung ohne Vorurteile bewertet, haben Lebererkrankte noch immer häufig mit Stigmatisierung zu kämpfen. „Wir haben eine Vernachlässigung des Organs Leber in Deutschland. Und Lebererkrankungen haben ein schlechtes Image“, stellt Prof. Dr. Michael P. Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung, fest. Zudem betont er: „Um dem entgegenzuwirken, engagiert sich die Deutsche Leberstiftung für mehr öffentliches Bewusstsein für dieses lebenswichtige Organ.“ Hinzu kommt, dass Frauen angesichts weit verbreiteter Geschlechterklischees hinsichtlich ihrer Schmerzen und Symptome oftmals nicht
90 Prozent der Fälle von primär biliärer Cholangitis (PBC), einer seltenen Autoimmunerkrankung der Leber, betrifft Frauen.
Quelle: Deutsche Leberstiftung, https://www.deutsche-leberstiftung.de/presse/ pressemappe/lebererkrankungen/seltene-erkrankungen/pbc/; Zugriff: 15.02.2024

ernst und zudem als hysterisch von Ärztinnen und Ärzten wahrgenommen und somit ihre Krankheiten nicht erkannt werden – was den Alltag sehr herausfordernd macht.
Lösungen zur Entstigmatisierung
Was können Betroffene tun? Auch wenn chronische Krankheiten wie PBC hinsichtlich der belastenden Symptome, Prognosen und Herausforderungen äußerst heterogen sind, lassen sich dennoch allgemeingültige Phasen des Krankheitserlebens und typische emotionale, kognitive oder aktionale Bewältigungsstrategien erkennen. Wichtige Unterstützungsangebote sind Selbsthilfeorganisationen sowie Konzepte der Stressbewältigung und der Gesprächspsychotherapie, genauso wie die kognitive Verhaltenstherapie und Strategien für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben – nicht zu vergessen Schulungs- und Coachingprogramme sowie sozialrechtliche Beratungen. Über PBC zu reden und Rechte einzufordern sollte oberstes Ziel sein –auch um das Umfeld zu sensibilisieren. Für wirksame Veränderungen sind ebenso Anti-StigmaKampagnen hilfreich. Diese sollten vor allem eine greifbare Zielsetzung haben und sich konkret an die Gesellschaft richten – mit der Absicht, dass möglichst viele Menschen Leberpatientinnen und -patienten offen und vorurteilsfrei, tolerant und einfühlsam begegnen.




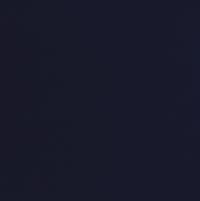



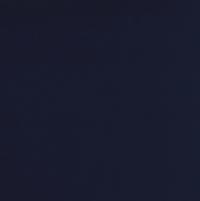





Wir entwickeln innovative Therapien für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Unsere Initiative Räume zum Reden bringt die Anliegen der Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihrer Angehörigen zur Sprache.







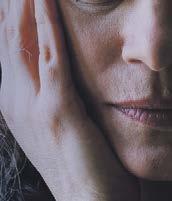







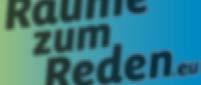


Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe nach schweren Katastrophen und hilft Familien, sich besser zu schützen. Erdbebensicheres Bauen rettet Leben. Getreidespeicher wappnen gegen Hunger. Und Hygieneprojekte bekämpfen Krankheiten und Seuchen. Das verhindert Leid, noch bevor es geschieht. Helfen Sie vorausschauend. Werden Sie Förderer!
Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de