Ressourcen schonen, Zukunft bewegen
GRUSSWORT

GRUSSWORT
In Deutschland denken viele Menschen zunächst ans Auto, wenn von Mobilität die Rede ist. Aus gutem Grund, denn die Fahrzeugindustrie ist eine Schlüssel branche, die viel Beschäftigung schafft und für Wohlstand sorgt. Doch wenn wir den Blick zu sehr auf das klassische Automobil verengen, gerät dieser Wohlstand in Gefahr. Moderne Technologien und neue Herausforderungen – wie etwa der Klimawandel oder die Urbanisierung –werden weltweit dafür sorgen, dass sich

Mobilität in Zukunft verändern wird. Nur mit mutigen Entwürfen für neue Autos und Mobilitätskonzepte werden wir weiterhin Produkte und Lösungen bieten können, die weltweit gefragt sind und die die hiesigen Verkehrsprobleme bewältigen. Hier in Deutschland, unserem Heimatmarkt, müssen wir zeigen, dass wir mobil bleiben – in der Logistik, im Wirtschaftsverkehr und in unserem privaten Bereich. Denn sonst lahmt unsere Wirtschaft – wie auch unser gesellschaftliches Leben.
Michael Gneuss Chefredakteur
LEITARTIKEL
UNTERNEHMENSMOBILITÄT
RADVERKEHR
LOGISTIK
E-MOBILITÄT
INHALTSVERZEICHNIS
Ein weiter Weg — 3
Neue Wege zur Arbeit — 4
Grünes Licht für Drahtesel — 6
Vor gewaltigen Herausforderungen — 7
Luft nach oben — 8
JETZT SCANNEN
Lesen Sie spannende Artikel dieser Ausgabe online, und sichern Sie sich ein kostenfreies Digital-Abo www.technologie-wissen.net www.portal-wissen.net
Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.

Das Papier dieser Reflex-Verlag-Publikation stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
Folge uns auf Instagram, und verpasse keine Ausgabe mehr.

@reflexverlag
LEITARTIKEL | VON MICHAEL GNEUSS
Stau auf der Autobahn, verspätete Züge, überfüllte Busse und die ständige Suche nach einem Parkplatz: Mobilität ist ein Thema, das die Deutschen oft genug Nerven kostet. Doch es geht um weit mehr als nur den persönlichen Komfort. Mobilität ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und obendrein eine große Emittentin von klimaschädlichen Gasen. Kurz: Es ist ein Megathema unserer Zeit.
Der Verkehrssektor trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. Laut Umweltbundesamt war er 2024 in Deutschland für den Ausstoß von rund 143 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten verantwortlich und hat damit das Klimaziel erneut verfehlt. Gleichzeitig ist die Fähigkeit des Menschen, sich frei zu bewegen, ein zentraler Pfeiler einer modernen Gesellschaft und Wirtschaft. Um Mobilität und Klimaschutz zeitgleich voranzubringen, ist ein grundlegender Wandel notwendig. Und dieser ist bereits in vollem Gange.
Akteure müssen eng zusammenarbeiten Klar ist, dass der Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Mobilität nicht von einer einzelnen Branche im Alleingang gestemmt werden kann. Vielmehr ist die Mobilität der Zukunft das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten Akteuren. Automobilhersteller entwickeln nicht mehr nur Autos, sondern ganzheitliche Mobilitätslösungen. Energiekonzerne bauen die Ladeinfrastruktur aus – Anfang 2025 zählte Deutschland bereits rund 131.000 öffentliche Ladepunkte – und sorgen dafür, dass der Strom dafür zunehmend aus regenerativen Quellen stammt. IT-Unternehmen liefern intelligente Systeme, die den Verkehr fließen lassen, während Logistikfirmen mit neuen Konzepten für die letzte Meile den Lieferverkehr in den Städten revolutionieren.
Eine entscheidende Rolle spielt die Politik. Mit gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel dem Klimaschutzgesetz, das klare Reduktionsziele vorgibt, und den CO₂-Flotten-Grenzwerten der EU wird der Druck erhöht, saubere Technologien zu entwickeln. Förderprogramme und das Deutschlandticket, das inzwischen von rund 14 Millionen Menschen genutzt wird, setzen zusätzliche Anreize für einen Umstieg. Die technologischen Fortschritte können sich sehen lassen. Der Bestand an reinen Elektroautos wuchs bis Mitte 2025 auf fast zwei Millionen an. Auch wenn ihr Anteil an den Neuzulassungen nach dem Auslaufen der Förderung im vergangenen Jahr kurzzeitig gesunken war, so war die Zahl der Neuzulassungen reiner Stromer in der ersten Jahreshälfte 2025 wieder angestiegen – der Trend scheint unumkehrbar. Parallel dazu versprechen Wasserstofftechnologien eine saubere Alternative für den Schwerlastverkehr. Last but not least könnte autonomes Fahren in Zukunft den Verkehrsfluss optimieren, Unfälle reduzieren und auch Menschen ohne Führerschein neue Möglichkeiten der Mobilität eröffnen. Aber es geht nicht nur um neue Antriebsarten. Digitale Plattformen ermöglichen es, verschiedene Verkehrsmittel nahtlos miteinander zu

E-Bus: Der öffentliche Personennahverkehr ist eine tragende Säule einer nachhaltigen Mobilität.
kombinieren. Die Zahl der Carsharing-Nutzer ist Anfang 2024 auf über 5,5 Millionen gestiegen, ein Zuwachs von 23 Prozent innerhalb eines Jahres. Sogenannte „Mobility as a Service“-Apps (MaaS-Apps) bündeln all diese Angebote und machen es einfacher denn je, für jede Strecke die passende und umweltfreundlichste Option zu finden.
Unterschiede zwischen Stadt und Land Also alles im grünen Bereich? So einfach ist es leider nicht. Eine der größten Herausforderungen der modernen mobilen Gesellschaft bleibt die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse. Während in Metropolen bereits ein Drittel der Wege zu Fuß zurückgelegt werden, ist auf dem Land für über 60 Prozent aller Wege das Auto unverzichtbar. Im Jahr 2023 pendelten nach Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) rund 20,5 Millionen Deutsche über Gemeindegrenzen hinweg zur Arbeit, die durchschnittliche einfache Strecke betrug dabei 17,2 Kilometer. Um hier eine nachhaltige Veränderung zu bewirken, müssen neue,
Der Bestand an reinen Elektroautos wuchs bis Mitte 2025 auf fast zwei Millionen an.
wirksame Konzepte realisiert werden. Neben dem dringenden Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge können flexible Lösungen wie etwa Rufbusse oder kommunales Carsharing die Lücke zum klassischen ÖPNV schließen. Der Fehler, der in der Vergangenheit oft gemacht wurde, war, Konzepte aus der Stadt eins zu eins auf den ländlichen Raum übertragen zu wollen.
Trotz aller Fortschritte gibt es viele Hürden. Generell muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit der wachsenden Zahl an E-Fahrzeugen Schritt halten. Eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die oftmals langwierigen Genehmigungsverfahren beschleunigt und bürokratische Hindernisse zum Beispiel bei der Errichtung von Ladepunkten abgebaut werden. Dringend verbessert werden muss auch die Koordination zwischen Verkehrsplanung, Stadtentwicklung und Energieversorgung. Die Stromnetze müssen so ausgebaut werden, dass sie überall bereit für hohe Lasten sind. Anders wird sich die nachhaltige Wende hin zur E-Mobilität
nicht bewerkstelligen lassen. Optimiert werden müssen auch die Anreize zur Anschaffung und zum wirtschaftlichen Betrieb von Elektro- oder Wasserstoff-Fahrzeugen. Neben der teuren Ladeinfrastruktur sind Unterhalt, hohe Stromkosten und Wartung zusätzliche Hürden auf dem Weg zu alternativen Antriebsformen. Ein Hemmnis sind vielfach auch die Preise für den öffentlichen Nahverkehr, die für viele nicht attraktiv genug sind, um umzusteigen – trotz Deutschlandticket. Zudem sind die Verbindungen, besonders am Abend, oft unzureichend.
Auch fehlt es an einer durchgängigen und sicheren Infrastruktur für den Fahrradverkehr, obwohl die Fahrradflotte in Deutschland auf rund 78 Millionen Räder angewachsen ist, ein Fünftel davon bereits mit Elektromotor. Ein weiteres Problem ist die oft noch mangelnde digitale Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger. Natürlich gibt es auch Beispiele, die zeigen, wie Bestandteile einer zukunftsgerechten Mobilität aussehen können: So setzen immer mehr Unternehmen auf Mobilitätsbudgets, Jobtickets oder Diensträder. Zudem erregen die verschiedenen Pilotprojekte für autonome Shuttlebusse Aufmerksamkeit. Erst vor wenigen Wochen ist im niedersächsischen Burgdorf Deutschlands erster autonomer Linienbus an den Start gegangen.
Infrastruktur muss dringend saniert werden Ein wirklicher Mobilitätswandel ist aber nicht denkbar ohne eine durchgreifende Modernisierung der maroden Infrastruktur in Deutschland. Rund 5.000 Brücken im Land sind laut Bundesverkehrsministerium dringend reparaturbedürftig oder müssen neu gebaut werden. Auch das Straßennetz ist in einem erbärmlichen Zustand. Der Sanierungsbedarf allein bei Fernstraßen beträgt aktuell fast 25.000 Kilometer. Rund 11.000 Kilometer davon entfallen auf Autobahnen. Nicht besser sieht es auf der Schiene, und auch hier gerade bei Brücken, aus. Nach einer Schätzung der Deutschen Bahn (DB) sind 1.160 Bahnbrücken in einem Zustand, der einen Neubau erfordert.
Die Mobilität der Zukunft kann aber nur auf einem modernen Straßen-, Schienen- und Wegenetz stattfinden. Zudem muss sie flexibel, nachhaltig und für alle zugänglich und bezahlbar sein. Das erfordert nicht nur technologische Innovationen, sondern auch ein Umdenken bei den Bürgerinnen und Bürgern. Nur wenn alle bereit sind, ihre Gewohnheiten zu hinterfragen, lässt sich eine ressourcenschonende und intelligente Mobilität in die Tat umsetzen.
UNTERNEHMENSMOBILITÄT | VON JENS BARTELS
Diesel-Dienstwagen als Nonplusultra – das war einmal. Mobilitätsangebote in Unternehmen sind längst vielfältig und an die Bedürfnisse verschiedener Mitarbeitender angepasst. Angefangen beim E-Auto über das Mobilitätsbudget bis zum Jobticket: Wer nachhaltige und flexible Konzepte liefert, verbessert nicht nur die Klimabilanz der Firma, sondern gewinnt auch im Wettbewerb um die Fachkräfte der Zukunft.
Eine aktuelle Elektromobilitätsstudie von Shell zeigt: Flottenkunden sind ein Motor der E-Mobilität und zugleich anspruchsvolle Nutzer. 80 Prozent der gewerblichen E-Auto-Fahrer wollen laut der Studie auch künftig vollelektrisch unterwegs sein. Ihr Profil unterscheidet sich deutlich von Privatkunden: Rund 36 Prozent der deutschen E-Auto-Fahrer nutzen das Fahrzeug beruflich, zwei Drittel legen dabei mehr als 15.000 Kilometer jährlich zurück, jeder Fünfte sogar über 30.000 Kilometer. Für zwei Drittel gehören Langstrecken mit regelmäßigem Ladebedarf längst zum Alltag. 72 Prozent der Flottenfahrzeuge werden vom Arbeitgeber gestellt, zumeist über Leasing, während nur 15 Prozent privat angeschafft werden, ein deutlich geringerer Anteil als bei Privatkunden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur:

Firmenflotten treiben die Verbreitung von E-Fahrzeugen voran.
Ladegeschwindigkeit (73 Prozent), Kosten (71 Prozent) und Zuverlässigkeit (69 Prozent) stehen im Vordergrund. Doch auch Komfort gewinnt an Gewicht: Shops und Gastronomie an Schnellladestationen werden für Pendler zunehmend zum relevanten Faktor.
Flotten als Treiber Insgesamt geht ein erheblicher Teil der Neuwagen in Deutschland direkt in die gewerbliche
Nutzung: Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren 2024 rund zwei Drittel aller Neuzulassungen gewerblich. Firmen- und Dienstwagenflotten bilden darin ein zentrales Segment und treiben die Verbreitung von E-Autos voran. Hersteller platzieren neue Modelle häufig zuerst in diesem Markt, da hier Stückzahlen und planbare Laufzeiten sichere Kalkulationen erlauben. So beschleunigen Flotten nicht nur die Elektromobilität, sondern schaffen zugleich wichtige Grundlagen
Vetter treibt die Mobilitätswende voran
Die Verkehrswende ist eine der großen Aufgaben der heutigen Zeit. Unternehmen spielen dabei eine wichtige Rolle – sie können nachhaltige Verkehrsmittel fördern und so Verantwortung für Klima und Gesellschaft übernehmen. Der Pharmadienstleister Vetter zeigt, wie das gelingt: Mit umfassenden Mobilitätsangeboten für seine über 7.300 Mitarbeitenden wird der Arbeitsweg klimafreundlich gestaltet – ein Ansatz, der auch politische Aufmerksamkeit weckt.
Das Familienunternehmen, das 2025 sein 75-jähriges Jubiläum feiert, ist tief in der Region Bodensee-Oberschwaben verwurzelt. Vetter produziert im Auftrag kleiner und großer Pharma- und Biotech-Unternehmen Medikamente, die für mehr Lebensqualität sorgen.
Beim kürzlichen Besuch des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann wurde deutlich, wie breit Vetter sein Mobilitätskonzept aufgestellt hat. Dazu zählen die vollständige Kostenübernahme des Deutschlandtickets als Jobticket, ein etabliertes

Durchdachte Radinfrastruktur: moderne Stellplätze mit inkludierten Reparaturstationen
JobRad-Leasing mit inzwischen weit über 3.000 geleasten Fahrrädern, eine moderne Radinfrastruktur mit überdachten Stellplätzen, Reparaturstationen und Duschen sowie Leihfahrrädern an mehreren Standorten. Wer elektrisch Auto fährt, profitiert von rund 70 Ladepunkten mit Ökostrom an verschiedenen Standorten. Allein 2024 investierte das Unternehmen 1,8 Millionen Euro in nachhaltige Mobilitätsangebote – eine Summe, die zeigt: Hier geht es anstatt punktueller Maßnahmen um einen systematischen und möglichst ganzheitlichen Ansatz. Das zeigt auch Vetters Engagement als Gründungsmitglied des Bündnisses „Verkehrswende in
der Arbeitswelt“ für einen klimaneutralen Arbeitsweg bis 2040. „Als Familienunternehmen denken wir langfristig und haben den Anspruch, ökonomisch, sozial und ökologisch verantwortungsbewusst zu agieren“, so Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie.
Klimaziele wissenschaftlich fundiert
Beim Klimaschutz verfolgt Vetter ambitionierte Ziele: Bis 2040 in Deutschland und bis 2050 weltweit soll der Net-Zero-Status bei klima relevanten Emissionen erreicht werden. Bereits heute stammen 54 Prozent des
Energieverbrauchs des Unternehmens aus erneuerbaren Quellen.
Dafür ist Vetter auch Teil der Science Based Targets initiative (SBTi). Die international anerkannte Organisation unterstützt Unternehmen dabei, wissenschaftlich fundierte Klimaziele zu entwickeln. Die kürzlich erfolgte offizielle Validierung durch die SBTi bestätigt, dass Vetters Klimastrategie den aktuellen wissenschaftlichen Standards entspricht.
Mehr als ein Unternehmensziel Vetter zeigt, wie nachhaltige Mobilität nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch tragbar und sozial wirksam gestaltet werden kann. Ziel ist es, das unternehmerische Handeln konsequent zu verbessern – verantwortungsbewusst, zukunftsorientiert und im Einklang mit der langfristigen Unternehmensentwicklung.
für den Ausbau von Ladeinfrastruktur.
Doch der Boom birgt Risiken: Nach zwei bis drei Jahren wird eine große Zahl gebrauchter E-Autos zurück in den Markt gebracht. Hinzu kommen Unsicherheiten über Batteriezustand, Softwarestand und Ladefähigkeit.
Tipps für Fuhrparkmanager
Damit ein Umstieg auf grünere Flotten gelingt, ist vorausschauendes Management unverzichtbar. Zentral ist eine Total-Cost-of-OwnershipAnalyse, die neben Anschaffung und Leasing auch Energiepreise, Wartung, Ladeinfrastruktur und Restwerte berücksichtigt. Laut DAT liegt der durchschnittliche Restwert dreijähriger E-Autos aktuell bei nur gut 50 Prozent des Neupreises. Dies ist ein Risiko, das einkalkuliert werden muss. Allerdings ist diese Zahl mit Vorsicht zu betrachten: Der tatsächliche Restwert hängt auch stark von Modell, Marke, Laufleistung oder Ausstattung ab. Abhilfe schaffen
Batteriezustandsprüfungen, die Reichweite und Alterung dokumentieren. Ebenso wichtig ist der strategische Ausbau firmeneigener Ladepunkte mit Lastmanagement, kombiniert mit klaren
Mobilität gehört zu den Benefits, die über die Arbeitgeberwahl entscheiden.
Verträgen zu Softwarepflege oder Batteriegarantien. Wer darüber hinaus die Rotationszyklen klug plant und Fahrer gezielt schult, steigert die Akzeptanz und senkt die Kosten. So wird die Transformation planbar, und die Flotte bleibt auch im Wandel ein starker Wettbewerbsfaktor.
Umfrage: alternative Antriebsarten im Fuhrpark deutscher Unternehmen
Quelle: Arval, 2025
Mit Mobilitätskonzept punkten Mobilität endet aber nicht bei der Flotte: Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernst nehmen, integrieren Mobilitätskonzepte ganzheitlich in ihre Strategie. Eine neue Deloitte-Studie zeigt, dass klassische Dienstwagenprogramme zunehmend durch flexible Mobilitätsbudgets und multimodale Angebote ersetzt werden. Firmen bieten Mitarbeitenden statt eines eigenen Dienstwagens Zugang zu ÖPNV, Carsharing, E-Bikes oder On-Demand-Mobilität – je nach Bedarf. Wachsende Bedeutung haben dabei auch ELastenräder, Jobtickets für Bahn und Bus sowie Mikromobilitätsangebote wie E-Scooter oder Ridepooling. Die Herausforderung liegt in der Verknüpfung: Ein integriertes Mobility-Management muss alle Verkehrsströme von Dienstreisen bis zur Lieferlogistik im Blick behalten und sie an CO₂- und Kostenzielen ausrichten. Experten betonen, dass nur Unternehmen, die Mobilität als strategischen Bestandteil ihres Geschäftsmodells begreifen, langfristig wettbewerbsfähig bleiben.
Mitarbeitende binden
Nachhaltige Mobilitätsangebote sind heutzutage also längst mehr als nur ein ökologisches Plus: Sie entscheiden darüber hinaus auch zunehmend über die Attraktivität von Arbeitgebern. Laut der Unternehmensberatung Roland Berger zählen Mobilitätsleistungen inzwischen zu den Top-5-Benefits neben Gesundheits- und Bike-Leasing-Programmen. In Zeiten des Fachkräftemangels erwarten Mitarbeitende flexible und nachhaltige Mobilitätskonzepte. Unternehmen, die solche Optionen bieten, senden ein klares Signal: Sie übernehmen Verantwortung für Umwelt und Lebensqualität, fördern Work-Life-Balance und stärken so Bindung und Loyalität. Mobilität wird damit zu einem strategischen Faktor im Wettbewerb um Talente und nicht nur zu einer Frage der Fortbewegung.
Zukunftsthema betriebliche Mobilität
Ob Pendelverkehr, Geschäftsreisen oder Fuhrpark – Unternehmen sind einer der größten Treiber von Mobilität in Deutschland. Damit tragen sie enorme Verantwortung für Kosten, Klima und Gesundheit. Wie gelingt es Unternehmen, ihre Mobilität nachhaltiger, effizienter und attraktiver für Mitarbeitende zu gestalten?
Gerade jetzt eröffnen sich ungeahnte Chancen: Nachhaltige Mobilitätskonzepte können Arbeitgebermarken stärken, Ausgaben senken und gesetzliche Anforderungen erfüllen. Die Verkehrswende wird oft als einfacher Kurswechsel dargestellt. Tatsächlich handelt es sich um den tiefgreifenden Umbau lieb gewonnener Routinen. Für Unternehmen heißt das: Sie
müssen Mobilität strategisch in ihr Handeln integrieren – nicht nur als ökologisches Thema, sondern als ökonomischen und sozialen Faktor.

„Nachhaltige Mobilität funktioniert, wenn die Menschen überzeugt sind“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverbands
Betriebliche Mobilität e. V.
Betriebliches Mobilitätsmanagement – das Universalwerkzeug
Das Betriebliche Mobilitätsmanagement (BMM) ist dafür das richtige Instrument. Es adressiert nicht nur einzelne Verkehrsträger, sondern den Ursprung: die Unternehmen selbst als Mobilitätsgeneratoren. Die bekannten drei Vs geben Orientierung: Vermeiden, Verlagern und Verbessern.
Ein strategisches Mobilitätsmanagement verbindet Unternehmensziele wie Kostensenkung, Attraktivität als Arbeitgeber oder ESG-Reporting mit gesellschaftlichen Zielen wie Klimaschutz und Gesundheit.
www.mobilitaetsverband.de
MEHR INFORMATIONEN
Antworten, wie das funktionieren könnte , liefert die Nationale Konferenz für betriebliche Mobilität (NaKoBeMo®) am 25. und 26. November 2025 in Heidelberg. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die die betriebliche Mobilität strategisch weiterentwickeln wollen. Informationen unter www.nakobemo.de

Von Experten und erfahrenen Praktikern profitieren
RADVERKEHR | VON PIA WEGENER
In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge rund 78 Millionen Fahrräder. Etwa 80 Prozent aller Haushalte besitzen mindestens ein Zweirad, 55 Prozent von ihnen halten das Fahrrad gar für ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Solche Zahlen zeigen, dass sich Deutschland zunehmend zur Fahrradnation entwickelt. Damit noch mehr Menschen auf das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel umsteigen, müssen aber auch die Weichen für den Ausbau entsprechender Infrastrukturen gestellt werden.
Grün, nachhaltig und auf die Menschen, die in ihnen leben, ausgerichtet: So sehen die Visionen für die Städte der Zukunft aus. Eine zentrale Rolle in diesen Vorstellungen nehmen Fahrräder ein, gelten sie doch als effizientestes und vor allem umweltfreundliches Fortbewegungsmittel im urbanen Raum. Tatsächlich wächst die Beliebtheit von Fahrrädern seit Jahren. Allein in Berlin ist der Anteil der Radfahrenden von der Jahrtausendwende bis heute um mehr als 53 Prozent angestiegen. Fest installierte Fahrradzählstellen haben rund 28 Millionen Radfahrende im Jahr 2023 in der Hauptstadt registriert.
Treibhausgase reduzieren Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden hinkt
Deutschland aber dennoch hinterher, was die Radfahrquote angeht. Dabei steckt im Fahrrad enorm viel Potenzial im Kampf gegen den Klimawandel. „Radfahren ist emissionsfrei und spart Platz. Der Radverkehr trägt damit zum Erreichen der nationalen Umwelt- und Klimaschutzziele sowie der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
In Berlin ist die Zahl der Radfahrenden vom Jahr 2000 bis heute um mehr als 53 Prozent gestiegen.
Nationen bei“, heißt es dazu im Nationalen Radverkehrsplan 3.0 der Bundesregierung. In vielen Städten, so die Schätzungen von Experten, könnten mit einem Umstieg vom Auto aufs Fahrrad rund 14 Prozent der Treibhausgase und Luftschadstoffe reduziert werden.
Ausbau von Radschnellwegen vorantreiben Im Idealfall ließen sich so laut Rechnungen des ADFC in jedem Jahr 19 Millionen Tonnen CO₂ einsparen. Dabei spielen auch die immer beliebter
Steigende Anforderungen an den Klimaschutz, neue Antriebstechnologien und digitale Vernetzung verändern, wie wir uns bewegen. Das gilt im Alltag ebenso wie im beruflichen und wirtschaftlichen Umfeld. Angesichts des Mobilitätswandels stehen damit auch Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Mobilitätsstrategien neu zu denken und nachhaltige, flexible Lösungen zu integrieren.
Alternative Antriebe und vernetzte Konzepte gewinnen an Bedeutung, während das Auto auch
beim Thema betriebliche Mobilität langsam, aber sicher seine dominante Stellung verliert. E-Bikes als Diensträder werden angesichts der aktuellen Entwicklungen als Alternative oder zumindest Ergänzung zum Dienstwagen immer beliebter.
Individualverkehr im Wandel Staus, Parkplatzsuche, steigende Kosten und die wachsende Bedeutung des Klimaschutzes haben den Blick auf Alternativen zum motorisierten Individualverkehr geschärft. Besonders das E-Bike entwickelt sich dabei zur Schlüsseltechnologie, die den Umstieg vom

Fahrradfahren

werdenden E-Fahrräder eine wichtige Rolle –legen Radfahrende mit dem elektrischen Antrieb meist längere Strecken zurück. Bei neueren Modellen werden die Emissionen, die bei der AkkuHerstellung entstehen, zudem bereits nach ungefähr 165 Kilometern ausgeglichen. Trotz einiger Bemühungen mangelt es aber in vielen Städten an der passenden Radinfrastruktur. Vor allem in Großstädten wird deshalb in den Ausbau von Radschnellwegen, geschützten Radwegen sowie in die Schaffung von Schnittstellen mit Bus und Bahn investiert.
Auto attraktiver denn je macht. Mit elektrischer Unterstützung lassen sich auch längere Strecken mühelos zurücklegen, ohne auf Flexibilität und Schnelligkeit zu verzichten. Da überrascht es nicht, dass mittlerweile jedes dritte neu verkaufte Rad ein E-Bike ist. Und: Ein wesentlicher Anteil wird dabei von Unternehmen als Dienstrad für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geleast.
Bikeleasing als Chance für Unternehmen
Die Möglichkeit, Dienstrad-Leasing als Benefit für Mitarbeitende anzubieten, vereint für Unternehmen gleich mehrere Aspekte, mit denen sie sich als attraktive Arbeitgeber positionieren können: nachhaltige Unternehmensführung, Gesundheitsförderung und Wertschätzung mit echtem Mehrwert für Mitarbeitende.
Diese profitieren beim DienstradLeasing von einem steuerlich geförderten Modell, das ihnen den Zugang zu moderner Mobilität erleichtert. Unternehmen wiederum stärken ihre Position im
Wettbewerb um Fachkräfte, fördern die Gesundheit im Team und leisten zugleich einen Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Gerade in Zeiten, in denen nachhaltiges Handeln zunehmend zum Entscheidungskriterium für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für Kundinnen und Kunden wird, ist das Dienstrad ein starkes Signal.
Dienstrad-Leasing als zentraler Baustein moderner Unternehmensmobilität Am Ende zeigt sich: E-Bikes werden das Auto nicht komplett ablösen und Diensträder das Konzept Dienstwagen nicht vollständig ersetzen, aber die Zukunft der betrieblichen Mobilität ist vielfältig –und das Dienstrad ist ein zentraler Baustein auf dem Weg dorthin. Wer heute in diese Form der Mobilität investiert und dabei auf einen leistungsfähigen Partner setzt, profitiert nicht nur kurzfristig durch motivierte Mitarbeitende, sondern gestaltet aktiv den nachhaltigen Wandel von morgen.
www.bikeleasing.de
LOGISTIK | VON CHRISTIAN HARTWICH
Logistik ist nicht alles, aber ohne Logistik ist alles nichts. Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist tatsächlich Realität. In einer modernen Volkswirtschaft wie der deutschen sind die Steuerung der Waren- und Informationsflüsse, der Transport der Güter und ihre Lagerung entscheidende Wirtschaftsfunktionen. Rund 331 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete die Logistikbranche 2024 in Deutschland, das waren vier Milliarden Euro mehr als 2023.
Dabei ist die Bedeutung dieses nach der Automobilwirtschaft und dem Handel größten Wirtschaftsbereichs nicht zu unterschätzen. Als Bindeglied zwischen Rohstoffgewinnung, Produktion, Handel und Endverbraucher besitzt die Logistik eine Schlüsselfunktion. Gerade für eine Exportnation wie Deutschland sind effiziente und verlässliche Lieferketten ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Eine funktionierende Logistik ist aber auch ein Garant für Versorgungssicherheit. Sie stellt sicher, dass Lebensmittel, Medikamente und Güter des täglichen Bedarfs auch in Krisenzeiten verfügbar bleiben. Gerade die vergangene Covid-19-Pandemie und die gegenwärtigen geopolitischen Konflikte zeigen dies in beeindruckender Weise.
Drei Säulen der „grünen Logistik“ Allerdings steht die Logistikbranche derzeit vor immensen Herausforderungen. Diese betreffen nicht nur die stetig steigenden Kosten entlang der Lieferketten. Vielmehr geht es in bedeutendem Maß um die Nachhaltigkeit, bei der die Branche erheblichen Nachholbedarf hat. So ist der Verkehrssektor einer der Hauptverursacher von CO₂-Emissionen. Hier kommt die grüne Logistik ins Spiel, die auf drei zentra-
Die Logistikbranche steht derzeit vor immensen
Herausforderungen.
len Säulen ruht. Im Zentrum steht die Elektrifizierung: Besonders auf der sogenannten letzten Meile, also bei der Paketzustellung in Städten, kommen zunehmend E-Transporter auf die Straßen. Bei schweren E-Lkws für die Langstrecke ist der Weg jedoch beschwerlicher. Die Anschaffungskosten sind hoch. Zudem fehlt eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Dennoch steigt die Zahl der Zulassungen stetig. Wo Elektrifizierung keine Lösung ist, kommt Wasserstoff ins Spiel: Für den Schwerlastverkehr über weite Distanzen gilt grüner Wasserstoff als große Hoffnung. Wasserstoff-Lkws können schnell betankt werden und ermöglichen große Reichweiten. Aber auch hier ist der Aufbau einer Produktionsund Tankinfrastruktur eine Milliardenaufgabe für das kommende Jahrzehnt. Bleibt also nur noch die Verlagerung auf die Schiene: Jede Tonne Fracht, die per Bahn statt per Lkw transportiert wird, spart massiv CO₂ ein. Das Ziel der neuen Bundesregierung, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf 25 Prozent zu erhöhen, ist

Digitalisierung kann für eine effizientere Logistik sorgen.
ambitioniert. Aktuell liegt er bei knapp unter 20 Prozent. Um hier voranzukommen, sind massive Investitionen in das Schienennetz und die Modernisierung von Terminals nötig.
Digitalisierung treibt den Umbau der Logistik Eine entscheidende Bedeutung bei der Modernisierung kommt der Digitalisierung zu. So ist zum Beispiel die „Digitale Automatische Kupplung“ (DAK) eine Basisinnovation für den wirtschaftlichen, automatisierten Schienengüterverkehr. Sie sorgt nicht nur dafür, dass sich Züge wesentlich schneller zusammenstellen
Anzeige
und Kapazitäten vergrößern lassen. Vielmehr ist sie auch für die Arbeitssicherheit ein Quantensprung, denn tatsächlich werden Güterwaggons in Deutschland bislang noch einzeln und per Hand gekuppelt. Um all dies möglichst rasch voranzutreiben, sind hohe Investitionen notwendig. Bund und Länder stellen hier bereits eine Vielzahl an Förderprogrammen, vor allem für Fahrzeuge, Lade- und Tankinfrastruktur sowie Gleisanschlüsse, zur Verfügung. Woran es aber immer noch mangelt, sind Koordination, Geschwindigkeit und langfristige gesetzliche Verbindlichkeit.


Der ideale Standort in Frankfurt/Main für Ihr Team







START-UPS@ Büroflächen bis 500 m² Co-Working-Flächen



Erfolgreich arbeiten. Erfolgreich vernetzen. Erfolgreich sein.







Standortgarantie
Tel: +49 69 240070-444 standort@frankfurt-holm.de www.frankfurt-holm.de
House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH Bessie-Coleman-Straße 7, 60549 Frankfurt am Main

Jetzt Büro sichern und durchstarten!


MESSE MÜNCHEN
Die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität
n Charging the Future of Mobility: Märkte, Geschäftsmodelle und Wachstumsperspektiven
n Innovationen erleben: Ladeinfrastruktur, bidirektionales Laden, Megawatt Charging & Smart Charging
n Integration im Fokus: Elektromobilität im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien und vernetzten Energiesystemen
n Branchentreffpunkt: 100.000+ Energieexperten und rund 2.800 Aussteller auf vier parallelen Fachmessen


E-MOBILITÄT
| VON JENS BARTELS
Der Markt wächst, die Infrastruktur zieht nach, die Technologie reift, doch für den endgültigen Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland braucht es mehr Tempo, klare Industriepolitik und konsequente Investitionen. Bei Erfolg der Transformation winken sauberere Städte, eine unabhängigere Energieversorgung und neue wirtschaftliche Stärke.
Die Nachfrage nach Elektroautos nimmt 2025 kräftig Fahrt auf. Im August meldete das KraftfahrtBundesamt 39.367 neue reine Batterie-Pkw (BEV). Das entspricht einem Anteil von 19 Prozent und einem Zuwachs von fast 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch im gesamten ersten Halbjahr 2025 zeigt sich eine positive Dynamik: Laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres über 297.000 Stromer neu zugelassen, 38 Prozent mehr im Vergleich zu 2024. Ausschlaggebend ist vor allem das größere Angebot in günstigeren Einstiegssegmenten, das neue Käufergruppen anspricht und die Nachfrage breiter streut. Ein positiver Nebeneffekt: Der durchschnittliche CO₂Ausstoß sank um knapp elf Prozent auf 105 Gramm je Kilometer – ein klarer Fortschritt für Klimaziele und grüne Mobilität.
Knackpunkt Ladeinfrastruktur

braucht es verlässliche Schnellladehubs, intelligente Netzintegration und eine einheitliche Nutzererfahrung. Laut einer Fraunhofer-Studie ist dafür vor allem Ladeinfrastruktur am Wohnort entscheidend. Doch gerade bei den rund 3,5 Millionen Mehrfamilienhäusern sowie den zwei Millionen Nichtwohngebäuden wie Büros, Supermärkten oder Parkhäusern besteht Nachholbedarf. Nur wenn dort Lademöglichkeiten geschaffen und die Stromnetze für hohe Lasten ertüchtigt werden, kann der Markthochlauf gelingen.
Bis 2030 sollen in Deutschland 15 Millionen E-Fahrzeuge auf der Straße sein, so das Ziel der vormaligen Bundesregierung. Doch der Durchbruch der E-Mobilität als Schlüsseltechnologie für die Verkehrswende hängt nicht allein von der Zahl der Autos ab. Es ist auch
Bis 2030 sollen in Deutschland 15 Millionen E-Fahrzeuge auf der Straße sein.
das Zusammenspiel aus Batterietechnik und Ladeinfrastruktur. Batterien gelten als Herzstück der Verkehrswende: Neue Architekturen mit 800 Volt, Fortschritte bei Lithium-Eisenphosphat und erste Pilotprojekte für Festkörperzellen versprechen kürzere Ladezeiten, größere Reichweiten und weniger Abhängigkeit von teuren Rohstoffen wie Kobalt.
Nun der Blick auf die Ladeinfrastruktur als weitere zentrale Säule für die Anziehungskraft der Elektromobilität. Zwar wächst die Zahl der Ladepunkte, doch für den echten Durchbruch
Strom teurer als Benzin
Es bleiben weitere Stolpersteine. So belasten hohe Strompreise an Schnellladesäulen die Attraktivität der E-Mobilität: Je nach Anbieter kostet die Kilowattstunde zwischen 49 und 60 Cent, deutlich mehr als heimisches Laden oder auch die derzeitigen Kosten für Benzin. Gleichzeitig steht die Automobilindustrie vor einer Herkulesaufgabe: Produktionslinien müssen neu ausgerichtet, Kapazitäten aufgebaut und Lieferketten auf nachhaltige Rohstoffe umgestellt werden. Erst wenn Infrastruktur, Kosten und Industrie im Gleichschritt vorankommen, kann der Durchbruch gelingen.
Neue Mobilität ist Versprechen
Die Folgen eines Wandels werden weit über das Auto hinaus sichtbar sein: Städte profitieren von saubererer Luft, weniger Lärm und sinkenden CO₂-Emissionen. Stromnetze können dank Vehicle-to-Grid-Technologien E-Autos als mobile Speicher nutzen, um Schwankungen bei erneuerbaren Energien abzufedern und Versorgungssicherheit zu erhöhen. Volkswirtschaftlich sinkt die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten. Dies ist ein entscheidender Vorteil in geopolitisch unruhigen Zeiten, der zugleich Chancen für neue Märkte und Arbeitsplätze schafft.

Jetzt spenden!
Kompetent. Zuverlässig.
Gemeinsame Nothilfe, die von Herzen kommt. Dank Ihrer Solidarität!
Aktion-Deutschland-Hilft.de
Bündnis der Hilfsorganisationen


Es ist früh am Morgen im australischen Darwin, direkt vor dem Rathaus reihen sich 35 schlanke Flitzer aus aller Welt entlang der Startlinie auf. Die Fahrer bereiten sich auf die Bridgestone World Solar Challenge, eine Marathonfahrt quer durchs Outback bis ins südliche Adelaide, vor. Bei diesem Rennen spielt die Schnelligkeit bei den Tankstopps keine Rolle, es entscheidet die schlaueste Sonnenstrategie. Mit maximal drei Kilowattstunden AkkuLeistung müssen die fahrbaren Solargeneratoren die über 3.000 Kilometer lange Strecke bewältigen
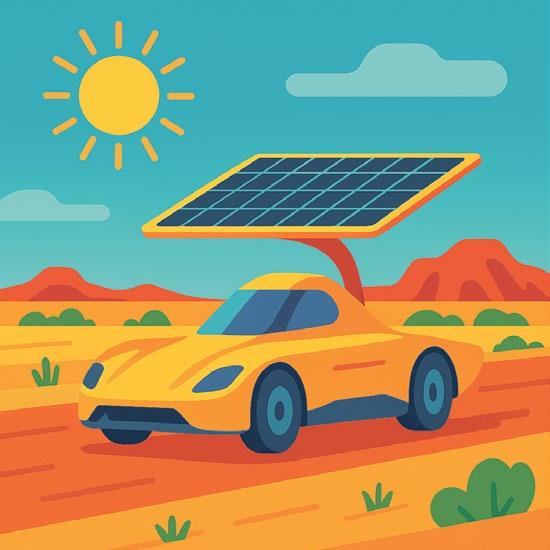
und dabei die australische Sonne so effizient wie möglich nutzen. Manche Rennautos sehen dabei aus wie elegante Katamarane, andere wie verkappte Düsenjets – gewonnen haben am Ende immer jene, die Aerodynamik, Teamgeist und Sonnenstrahlen zur perfekten Melange verdichtet haben. Während früher die großen Formel-1-Rennen als Innovationstreiber galten, zeigen heute wagemutige Forschende und Studierende mit ihren kreativen Solar-Konstruktionen in Australien, wie die Mobilität der Zukunft genutzt werden kann.
Michael Gneuss Chefredakteur
IMPRESSUM
Projektmanagement Laura Colantuono, laura.colantuono@reflex-media.net
Redaktion Jens Bartels, Michael Gneuss, Christian Hartwich, Pia Wegener Layout Silke Schneider, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / jemastock Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Michael Gneuss, redaktion@reflex-media.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www.reflexmedia.net
Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 20. Oktober 2025 im Handelsblatt. Der Reflex Verlag und die Handelsblatt Media Group & Co. KG sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
JETZT SCANNEN
Unsere Ausgaben finden Sie auch auf unserem Reflex-Portal: www.reflex-portal.de Wir sind
Vetter Pharma International GmbH 4 Eywiesenstraße 5 88212 Ravensburg www.vetter-pharma.com
Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. 5
Am Oberen Luisenpark 22 68165 Mannheim www.mobilitaetsverband.de
BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG 6 Ernst-Reuter-Straße 2 37170 Uslar www.bikeleasing.de
House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH 7 Bessie-Coleman-Straße 7 60549 Frankfurt am Main https://frankfurt-holm.de
Solar Promotion GmbH 8 Kiehnlestraße 16 75172 Pforzheim www.powertodrive.de
Aktion Deutschland Hilft e. V. 9 Willy-Brandt-Allee 10–12 53113 Bonn www.Aktion-Deutschland-Hilft.de