SELTENE KRANKHEITE N

EINE PUBLIKATION DES REFLEX VERLAGES Februar 2025
GRUSSWORT


EINE PUBLIKATION DES REFLEX VERLAGES Februar 2025
GRUSSWORT
Heute ist der 28. Februar. Ein besonderer Tag für Menschen mit seltenen Erkrankungen, denn er macht jedes Jahr aufs Neue auf ihre Anliegen aufmerk sam. So wünschen sich Betroffene – und das sind immerhin schätzungsweise etwa vier Millionen allein in Deutschland – neben mehr Forschung, mehr Therapien und Behandlungsmöglichkeiten sowie der Chance auf ein besseres, längeres Leben auch

gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe. Das Gute: Durch Anreize für eine Erforschung dieser Krankheiten, von denen rund 8.000 bekannt sind, die Einrichtung spezialisierter Zentren und engagierte Patientenorganisationen verbessert sich die Situation nach und nach. Wie konkret, das verraten wir Ihnen auf den folgenden Seiten dieses Ratgebers im Zeichen der „Seltenen“.
Nadine Effert Chefredakteurin
LEITARTIKEL
FORSCHUNG
HEREDITÄRES ANGIOÖDEM
EOSINOPHILE ÖSOPHAGITIS
RHEUMATISCHE ERKRANKUNGEN
TENOSYNOVIALER RIESENZELLTUMOR
PAROXYSMALE NÄCHTLICHE HÄMOGLOBINURIE
INHALTSVERZEICHNIS
Auf der Suche nach der richtigen Diagnose — 3
Anstieg an Innovationen — 6
Attacken richtig deuten und gegensteuern — 10
Speiseröhre mit Hindernissen — 11
Mehr als Gelenkschmerzen — 12
„Eine frühe Therapie schützt vor der Zerstörung von Gelenken“ — 13 Extrem erhöhte Thrombosegefahr — 14
JETZT SCANNEN
Lesen Sie spannende Artikel dieser Ausgabe online, und sichern Sie sich ein kostenfreies Digital-Abo www.seltene-krankheiten-info.de www.reflex-portal.de
Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.

Das Papier dieser Reflex-Verlag-Publikation stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
Folge uns auf Instagram, und verpasse keine Ausgabe mehr.

@reflexverlag
LEITARTIKEL | VON NADINE EFFERT
Weltweit leiden 300 Millionen Menschen an einer seltenen Krankheit. So gesehen sind die „Seltenen“ insgesamt betrachtet gar nicht so rar. Was Betroffene eint, ist die Tatsache, dass sehr viel Zeit bis zur Diagnose vergeht. Forschende weltweit arbeiten mit innovativen Ideen daran, den langen Weg zu verkürzen.
4 Millionen
Menschen leben Schätzungen zufolge mit einer seltenen Erkrankung allein in Deutschland. In der gesamten EU geht man von 30 Millionen Betroffenen aus.
Quelle: www.namse.de/zum-aktionsbuendnis/ueber-selteneerkrankungen; letzter Zugriff: 13.02.2025
Von A wie Akrozephalosyndaktylie über K wie Klippel-Feil-Syndrom bis Z wie Zerebrotendinöse Xanthomatose: Es gibt Leiden, von denen selbst viele Ärztinnen und Ärzte noch nichts gehört haben. Kein Wunder, dass die meisten der etwa 8.000 bekannten seltenen Krankheiten durch das alltägliche Diagnoseraster fallen, indem Symptome falsch gedeutet oder nicht ernst genommen werden. Manche der schätzungsweise circa vier Millionen betroffenen Menschen in Deutschland machen eine wahre Odyssee durch das Gesundheitssystem durch, bevor sie die richtige Diagnose erhalten – manche erfahren nie, was hinter ihren Beschwerden steckt.
Wichtig: frühe Diagnosestellung
Bis eine Person mit einer seltenen Erkrankung diagnostiziert wird, dauert es im Durchschnitt fünf Jahre. Dieser lange Weg geht häufig mit Fehldiagnosen einher sowie einer häufig ungenügenden medikamentösen Versorgung. Ein früher Zeitpunkt der Diagnosestellung ist von essenzieller Bedeutung, denn viele dieser Krankheiten sind lebensbedrohlich oder führen zu Invalidität. Zu den seltenen Erkrankungen, die mit zum Teil schwerwiegenden körperlichen und geistigen Einschränkungen einhergehen, zählen zum Beispiel bestimmte Infektionskrankheiten, Autoimmunkrankheiten oder Krebsformen. Das Gros der Seltenen ist genetisch bedingt, daher machen sich viele schon bei der Geburt oder
SCHON GEWUSST?
In Europa gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen das spezifische Krankheitsbild aufweisen. Rund 30.000 Krankheiten sind weltweit bekannt, davon zählen etwa 8.000 zu den seltenen Erkrankungen.
im frühen Kindesalter bemerkbar. Die Genforschung ist somit aber auch der Schlüssel zu ihrem Verständnis und Ausgangspunkt für neue Therapieansätze.
Genetische Daten
Laut einer aktuellen Studie, die im Januar 2025 in „Nature Medicine“ erschienen ist und an der die Universitäten Radboud (Niederlande), Tübingen (Deutschland) und Barcelona (Spanien) beteiligt waren, handelt es sich in über 70 Prozent aller Fälle um genetische Defekte. Das Problem: Sie sind in der Regel von Ärztinnen und Ärzten schwer zu identifizieren. Das soll sich mithilfe des von den Forschenden vor einigen Jahren gegründeten Netzwerks Solve-RD zur Erforschung klärungsbedürftiger seltener Erkrankungen auf Basis der nun durchgeführten Analyse genetischer Daten ändern. Ziel: schnellere und häufigere Diagnosen. Untersucht wurden die
„Mit KI schneller, präziser und zugänglicher Gewissheit bekommen“
Keine Diagnose trotz ÄrzteOdyssee? Saventic Health stellt eine kostenfreie KI-gestützte Online-Plattform zur Verfügung, mit deren Hilfe Menschen mit seltenen Erkrankungen zu einer schnelleren Diagnose kommen sollen. Maciek Klein, Global Chief Business Officer, erklärt, was genau hinter SaventicCare steckt.
Wie funktioniert SaventicCare? Unsere Patienten-Plattform ist einfach in der Anwendung, erfordert keine technischen Vorkenntnisse und ist kostenfrei. Es müssen lediglich ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt und idealerweise medizinische Daten hochgeladen werden. Die enge Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen wie der HAE-Vereinigung ermöglicht es uns, SaventicCare passgenau auf die Bedürfnisse der Betroffenen auszurichten. Sensible Daten werden selbstverständlich streng geschützt und transparent

verarbeitet. Anschließend werden im nächsten Schritt die Informationen von unseren KI-Algorithmen analysiert und von unserem Team aus Fachärztinnen und -ärzten verifiziert.
Wie lange dauert es, bis ich eine Rückmeldung erhalte? Innerhalb von circa 30 Tagen erhalten Sie eine fundierte Auswertung der Analyse mit ersten Hinweisen auf ein mögliches Risiko und möglichen nächsten Schritten, wie der Empfehlung, sich an eine geeignete Facharztpraxis oder an ein Referenzzentrum zu wenden, um sich
weitergehenden Untersuchungen zu unterziehen.
Wie viele „Seltene“ können die KI-Algorithmen aktuell identifizieren? Derzeit können wir rund 50 seltene Erkrankungen identifizieren, darunter das Hereditäre Angioödem, Lysosomale Speicherkrankheiten, zum Beispiel Morbus Fabry, Gaucher und Mukopolysaccharidosen, außerdem Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis, primäre Immundefizienz, kutanes T-Zell-Lymphom und Amyloidosis. Seit dem Start von SaventicCare in Deutschland vor zwei Jahren konnten wir schon über 500 Menschen Rückmeldung geben.
Wo sehen Sie weiteres Potenzial? Unser Ziel ist es, SaventicCare kontinuierlich auszubauen, um noch mehr Menschen in Deutschland und weltweit zu einer schnelleren Diagnose, adäquater Therapie und mehr Lebensqualität zu verhelfen. Langfristig wollen wir weitere Erkrankungen abdecken. KI ist nicht
nur in der Lage, Symptome und Risiken frühzeitig zu erkennen, sondern Fehl- und Spätdiagnosen zu reduzieren und Fachkräfte zu entlasten. Unsere zweite Plattform SaventicMed wird in immer mehr Kliniken implementiert. Hierzulande kooperieren wir aktuell mit drei Institutionen, darunter das Universitätsklinikum Leipzig. Dort ist die KI im Einsatz, um bei Patientinnen und Patienten Hinweise auf seltene Herzerkrankungen zu finden. www.saventiccare.de
MEHR INFORMATIONEN
Leiden Sie unter anhaltenden, unklaren Symptomen oder vermuten eine seltene Erkrankung? Scannen Sie den QR-Code, füllen Sie das Formular aus, und lassen Sie kostenfrei Ihr Risiko für seltene Erkrankungen überprüfen!

Daten von insgesamt 6.447 Menschen mit seltenen Erkrankungen und 3.197 engen Angehörigen ohne Symptome. Bei immerhin 506 Patienten und Angehörigen gelangte das Wissenschaftlerteam zu einer klaren Diagnose. Bei 15 Prozent der Betroffenen ergaben sich daraufhin neue Ansätze für Therapien, schreiben die Forschenden. Geplant ist, über 19.000 Datensätze regelmäßig erneuten interdisziplinären Analysen zu unterziehen.
Neue genetische Erkrankungen
In der Nutzung einer gemeinsamen Daten-Infrastruktur steckt viel Potenzial – genauso wie dem Hoffnungsträger KI. So ist es dank Künstlicher Intelligenz zum Beispiel einem internationalen Forschungskonsortium, an dem 15 deutsche Unikliniken und die Stellenbosch University in Kapstadt (Südafrika) teilgenommen haben, gelungen, bei 499 Patientinnen und Patienten die genetische Ursache der Erkrankung zu identifizieren. „Besonders stolz sind wir auf die Entdeckung von 34 neuen molekularen
Da es mehr als 8.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen gibt, ist die Gesamtzahl der Betroffenen trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen hoch.
Quelle: www.namse.de/zum-aktionsbuendnis/ueber-selteneerkrankungen; letzter Zugriff: 13.02.2025

Erkrankungen, die ein schönes Beispiel für die wissensgenerierende Krankenversorgung an Unikliniken sind“, sagt Erstautorin Dr. Theresa Brunet vom Institut für Humangenetik des Klinikums rechts der Isar der TUM.
Diagnose per Gesichtsanalyse Zusätzlich testeten die Forschenden das KISystem „GestaltMatcher“ erstmals in der Breite. Die innovative Gesichtsanalyse nutzt das menschliche Gesicht beziehunsgweise dessen charakteristische Züge als Anhaltspunkt für die Diagnose seltener, sogar bislang unbekannter Erkrankungen – und das mit hoher Treffsicherheit und somit klinischem Nutzen. Dies gelingt, da die den Erkrankungen zugrunde liegenden Erbgutveränderungen sich meist auch zum Beispiel durch anders geformte Augenbrauen oder Wangen äußern. „GestaltMatcher ist wie eine Expertenmeinung, die wir jeder ärztlich tätigen Person in Sekundenschnelle zur Verfügung stellen können“, erklärt Korrespondenzautor Prof. Dr. Peter Krawitz, Direktor des Instituts für Genomische Statistik und Bioinformatik (IGSB) am Universitätsklinikum Bonn (UKB). „Ein unterstützender Einsatz der Software durch
Kinderärztinnen und -ärzte könnte bereits bei Auffälligkeiten während der Kindervorsorgeuntersuchungen U7 mit 21 bis 24 Monaten oder U7a mit 34 bis 36 Monaten sinnvoll sein.“
Mehr Therapien nötig
Die Diagnose ist das eine, eine adäquate Therapie das andere: Gerade einmal für knapp drei Prozent aller bekannten Seltenen steht in der EU laut Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) aktuell eine spezifisch zugelassene Behandlung zur Verfügung – aber immerhin, und es kommen jedes Jahr neue Medikamente hinzu. So profitieren in der Summe eben doch sehr viele Menschen von den Forschungsbemühungen der Pharmaunternehmen in einem Bereich, der aufgrund der sehr geringen Anzahl an Patientinnen und Patienten wirtschaftlich gesehen nicht gerade lukrativ ist. Das Gute: Das Wissen über seltene Krankheiten auf molekularer und genetischer Ebene wächst und treibt die Entwicklung neuer Therapien voran – gepusht von der im Jahr 2000 erlassenen EU-Verordnung, welche die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Refinanzierung für die Unternehmen verbessert.
Wir blinzeln etwa 14.500-mal täglich, meist, ohne es zu bemerken. Stellen Sie sich vor, jeder Lidschlag reibt schmerzhaft über Ihre Hornhaut – bis Sie eines Tages gar nichts mehr sehen. Genau das passiert Millionen Menschen weltweit. Die Ursache: Trachom.
Falls Sie noch nie davon gehört haben: Sie sind nicht allein. Obwohl die bakterielle Bindehautentzündung global die häufigste infektiöse Ursache für Erblindung ist, ist sie weitgehend unbekannt. Betroffen sind vor allem arme Menschen in heißen Klimazonen, Kinder stecken sich besonders leicht an. Begünstigt wird Trachom durch Wassermangel und schlechte
hygienische Verhältnisse, neben Fliegen erfolgt die Übertragung meist durch Schmierinfektion. Ohne Behandlung vernarbt das Augenlid, die Wimpern drehen sich nach innen und zerkratzen die Hornhaut. Betroffene verlieren nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch ihre Zukunft – wer nichts sieht, kann oft nicht arbeiten, lernen oder für die Familie sorgen.
Effektiver Einsatz gegen Trachom Dabei könnte Trachom verhindert und behandelt werden – die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, die Krankheit zu eliminieren. LIGHT FOR THE WORLD bekämpft Trachom seit vielen Jahren in Subsahara-Afrika. Wir verteilen flächendeckend Medikamente, führen

2023 haben wir sechs Millionen Antibiotikagaben gegen Trachom verteilt, hier in Äthiopien.
Lid-Operationen durch, klären auf und setzen uns für eine verbesserte Hygiene und sanitäre Bedingungen ein. Kein Mensch soll erblinden, wenn es vermeidbar ist!

www.light-for-the-world.de
Mehr, als Sie sich vorstellen können: Selten sind viele
Der Februar steht seit vielen Jahren ganz im Zeichen der seltenen Erkrankungen. Für die 300 Millionen betroffenen Menschen weltweit ist vor allem der letzte Tag des Monats, der „Rare Disease Day“, ein Höhepunkt. Den Scheinwerfer auf die Anliegen der Betroffenen und ihren Angehörigen wirft auch die ACHSE: Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen, dem Dachverband von und für Menschen mit seltenen Erkrankungen – und das nicht nur im Februar.
Die geballte Awareness hat dafür gesorgt, dass Bedarfe gehört und letztlich Verbesserungen erreicht wurden. In Deutschland gibt es eine vernetzte Struktur mit 36 „Zentren für Seltene Erkrankungen“ und einen Nationalen Aktionsplan, an dessen Maßnahmen weitergearbeitet wird. Entwickelte „Orphan Drugs“ sind hierzulande zugänglich, und innovative wissenschaftliche Projekte treiben den Erkenntnisgewinn und Forschungsfortschritt voran. Dennoch darf sich bei Weitem nicht auf diesen Errungenschaften ausgeruht werden. Die Konkurrenz um Geldtöpfe wächst. Strukturen und Vernetzung schwächeln. Und immer wieder wird zudem der Eindruck erweckt, selten käme nicht oft vor und verursache aber hohe Kosten.
Finger in die Wunde legen Vier Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen werden in Deutschland geschätzt – zusammen mit ihren Angehörigen sind mehr als 15 Millionen Menschen betroffen. Selten sind viele! Jede Zahl ein Mensch! Jede Zahl ein Schicksal! Ein großer Teil der Betroffenen kämpft täglich mit den Herausforderungen, die unser Gesundheitssystem ihnen stellt. Diagnose, Therapie, Kostenübernahme – es gibt so viele Baustellen. Pflegende Angehörige übernehmen eine enorme Last. Sie koordinieren Termine, leisten medizinische Aufgaben und kämpfen mit bürokratischen Hürden. Unterstützungsangebote fehlen häufig. Eine bessere Entlastung und Anerkennung dieser wichtigen Arbeit sind dringend erforderlich. Ein „MyCaseManager“, ein sogenannter Kümmerer im System, kann Bürokratie mindern. Von Schulgesundheitsfachkräften, die bundesweit eingesetzt werden sollten, profitieren nicht nur chronisch kranke Kinder und

Der
Großteil der Betroffenen wird von Angehörigen gepflegt und betreut, oftmals rund um die Uhr.
Jugendliche sowie ihre Familien. Diese würden zudem einen wichtigen Beitrag zu Teilhabe und Inklusion leisten – eine Entlastung auf vielen Ebenen.
Versorgungslücken schließen Bestehende Versorgungsstrukturen müssen gesichert, neue Ansätze gezielt gefördert werden. Künstliche Intelligenz, Patientenregister und Genommedizin bieten vielversprechende Möglichkeiten. Gesetzliche Maßnahmen zur Stärkung neuer Versorgungsmodelle sollten konsequent umgesetzt werden. Zudem muss sichergestellt werden, dass bewährte Strukturen nicht durch finanzielle Engpässe gefährdet werden. Eine unzureichende Finanzierung kann dazu führen, dass lebenswichtige Angebote für Betroffene nicht mehr bereitgestellt werden können. Die Politik ist gefordert, gezielt in die Verbesserung der Versorgung zu investieren. Zudem müssen die Schulung und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten verstärkt gefördert werden, damit sie seltene Erkrankungen besser erkennen und behandeln können.
Bessere Vernetzung für Betroffene Eine gute Versorgung braucht eine starke Vernetzung. Betroffene benötigen eine wohnortnahe Versorgung, die mit spezialisierten Zentren koordiniert ist. Die ACHSE fordert eine klare Definition und Veröffentlichung der Patientenpfade: Haus- und Fachärzte müssen wissen, wie der Weg in spezialisierte
Zentren und zurück aussieht. Auch ambulante spezialisierte Zentren sollten gefördert und in bestehende Strukturen integriert werden. Eine bessere Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren reduziert Unsicherheiten und verbessert die Behandlung. Internationale Kooperationen, insbesondere im Rahmen der European Reference Networks (ERNs), könnten ebenfalls dazu beitragen, den Zugang zu spezialisiertem Fachwissen zu erleichtern. Es braucht einen besseren Informationsfluss, um Fehlversorgungen zu vermeiden und Patientinnen und Patienten gezielt zur richtigen Behandlung zu bringen. Zudem sollten verstärkt interdisziplinäre Fallkonferenzen genutzt werden, um die Expertise verschiedener medizinischer Fachrichtungen gezielt zusammenzuführen.
Digitalisierung als Chance
Die Digitalisierung verändert die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen. Digitale Patientenakten und Diagnosehilfen ermöglichen gezieltere Behandlungen. Tools wie Human Phenotype Ontology oder Face2Gene unterstützen Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnostik. Notaufnahmen profitieren von digitalen Systemen, um schnellere und präzisere Diagnosen zu stellen. Die Nutzung großer Datenmengen kann helfen, bessere Behandlungsansätze zu entwickeln. Wichtig ist eine stärkere Vernetzung der Versorgungsstrukturen, um Fachwissen effizient zu teilen und den Zugang für Betroffene zu verbessern. Auch
telemedizinische Angebote können eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere für Betroffene in ländlichen Regionen, wo der Zugang zu spezialisierten Ärztinnen und Ärzten oft eingeschränkt ist. Zusätzlich müssen Datenschutz und sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Gesundheitsbereichen gewährleistet sein, um eine effiziente Nutzung digitaler Lösungen zu ermöglichen. Die Einführung einheitlicher digitaler Systeme könnte den Austausch von Patientendaten erleichtern und so die Behandlungsqualität verbessern. Um den Zugang zu digitalen Gesundheitsangeboten zu erleichtern, sollten gezielte Schulungsmaßnahmen für Patientinnen und Patienten sowie medizinisches Personal angeboten werden.
Die Herausforderungen für Menschen mit seltenen Erkrankungen sind groß, doch durch gezielte Maßnahmen und gemeinsames Engagement kann viel erreicht werden. Die hier genannten sind nur einige Felder, die besser aufgestellt werden müssen. Politik, Forschung, Medizin und Gesellschaft sind gefragt, um eine bessere Zukunft für Betroffene zu gestalten. Es braucht ein langfristiges Umdenken, damit alle Menschen – unabhängig von der Seltenheit ihrer Erkrankung – die Versorgung erhalten, die sie benötigen. Die Selbsthilfe der „Seltenen“ ist dabei nicht nur treibende Kraft. Sie verfügt über Expertise und einen Wissensschatz, der noch viel mehr Anerkennung finden muss.

























FORSCHUNG | VON NADINE EFFERT







Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar finden lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familien ein zweites Zuhause auf Zeit. Die gleichnamige Stiftung hat das Ziel, die Arbeit im Kinder und Jugendhospiz Balthasar in Olpe dauerhaft zu sichern, denn das Haus ist zu rund 50 % spendenfinanziert.
Im „Balthasar“ können die Eltern die Pflege vertrauensvoll in die Hände der qualifizierten Mitarbeitenden legen, um selbst einmal zur Ruhe zu kommen. Das speziell ausgebildete psychosoziale Team leistet der Familie wertvolle Hilfe. Durch die familiäre Atmosphäre im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar fällt es allen Gästen leichter, über ihre Gefühle – ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen – zu reden. Viele Gespräche und auch der Austausch untereinander helfen, die Trauer zu bewältigen. Auch nach dem Versterben des Kindes ist das Hospiz für die Familien da – für jede so lange, wie sie es braucht.
Helfen Sie mit! Tragen Sie mit dazu bei, dass Deutschlands erstes Kinderhospiz dauerhaft ein Ort zum Leben und Lachen, Sterben und Trauern sein kann.
Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar Pax Bank Köln
IBAN DE23 3706 0193 0000 0190 11
BIC GENODED1PAX
Verwendungszweck: Selten sind Viele + Ihre Anschrift www.balthasarstiftung.de · kontakt@balthasarstiftung.de Maria-Theresia-Straße 42a · 57462 Olpe
Endlich wissen, was hinter den Beschwerden steckt: Für Menschen mit einer seltenen Erkrankung ist die Diagnose eine große Erleichterung – insbesondere dann, wenn zudem eine gezielte Behandlung zur Verfügung steht. Bei immer mehr forschenden Pharmaunternehmen steht die Entwicklung von Medikamenten gegen die „Orphan Diseases“ verstärkt im Fokus. Neuester Hoffnungsträger ist zum Beispiel eine Genschere.

Mit einer CRISPR-Genschere können bestimmte Gene ausgeschaltet werden.
Nach Angaben des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) sind in der Europäischen Union (EU) derzeit 230 sogenannter Orphan Drugs für mehr als 170 „Seltene“ zugelassen. Das heißt: Es gibt aktuell für nur knapp drei Prozent aller bekannten seltenen Erkrankungen eine spezifisch zugelassene Behandlung. Die Erforschung und Entwicklung von innovativen Therapien ist für die zukünftige Versorgung der „Waisen der Medizin“ daher weiterhin von überragender Bedeutung, denn viele seltene Erkrankungen gehen mit starken Einbußen in der Lebensqualität und verkürzter Lebensdauer einher.
Markteinführungen
Die Bilanz aus dem Jahr 2024 kann sich sehen lassen: 27 Medikamente haben eine Zulassung erhalten – darunter 18, bei denen die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Orphan-DrugStatus anerkannt hat. „Das zeigt das anhaltende Engagement der Branche dafür, dass auch Patientinnen und Patienten nicht unversorgt bleiben, deren Krankheit nicht häufig vorkommt“, resümiert vfa-Präsident Han Steutel. Gleich drei der neuen Medikamente dienen der Behandlung von Menschen mit paroxysmaler
Innovative Gentherapien sind die großen Hoffnungsträger.
nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), einer Krankheit, bei der das Immunsystem unter anderem rote Blutkörperchen angreift, und zwei Medikamente bei Myasthenia gravis, die zu Muskelschwäche führt, weil Attacken des Immunsystems die Übertragung von Nervensignalen auf die Muskeln beeinträchtigen.
Gentherapien: Chance auf Heilung Die gute Nachricht: Derzeit (Stand: Dezember 2024) werden rund 2.700 Arzneimitteltherapien entwickelt, die ebenfalls den OrphanDrug-Status, aber noch keine Zulassung von der EMA erhalten haben. Im Fokus: Gentherapien, mit denen die Ursache einer Erkrankung in Angriff genommen werden kann und somit eine Chance auf Heilung oder zumindest Linderung besteht. „Gen- und Zelltherapien gehören zu den fortschrittlichsten medizinischen Innovationen. Sie bieten in zahlreichen Anwendungsbereichen neue Behandlungsmöglichkeiten für schwere Krankheiten, die bislang kaum oder gar nicht therapierbar waren“, bestätigt Steutel. Die EMA rechnet ab diesem Jahr mit 10 bis 20 neuen Gentherapien pro Jahr. Gut so, denn rund 80 Prozent der
Orphan Diseases sind Krankheiten, die auf erblichen Gendefekten beruhen. Zu den sogenannten monogenen Erbkrankheiten zählen beispielsweise die Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose und die Spinale Muskelatrophie. Im Fall der neuromuskulären Erkrankung ermöglichen Gentherapien, sofern frühzeitig angewendet, betroffenen Kindern heutzutage ein weitgehend normales Leben. Dank enormen Verbesserungen bei den Therapien ist die Lebenserwartung von Neugeborenen mit Mukoviszidose enorm gestiegen: „Im aktuellen Berichtsband werten wir Daten bis Ende 2023 aus und sehen erstmals mittelfristige Auswirkungen der hocheffektiven Modulatortherapie“, erläutert Prof. Dr.
SCHON GEWUSST?
Damit ein Medikament von der EMA den Orphan-Drug-Status erhält, muss es sich um eine Krankheit handeln, an der nicht mehr als fünf von 10.000 EU-Einwohnenden leiden. Außerdem muss es den bisherigen Medikamenten signifikant überlegen sein, oder es muss an einer zufriedenstellenden Behandlungsoption fehlen. Der Status, durch den Pharmaunternehmen einige Vorteile, etwa Schutz vor NachahmerPräparaten, genießen und somit positive Anreize zur Beantragung bieten, läuft regulär nach zehn Jahren ab.
Lutz Nährlich, medizinischer Leiter des Deutschen Mukoviszidose-Registers. „Besonders eindrücklich ist die Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung: Sie liegt heute bei 67 Jahren und ist gegenüber dem Vorjahr um sieben Jahre gestiegen.“ Vor 70 Jahren überlebten Säuglinge nur wenige Monate. Neben den hocheffektiven sogenannten CFTR-Modulatoren machen in Zukunft auch bei dieser seltenen Krankheit genetische, aber auch neue symptomatische Therapien noch mehr Betroffenen Hoffnung.
67 Jahre beträgt die heutige Lebenserwartung bei Neugeborenen mit Mukoviszidose. Im Jahr 1938 lag sie bei sechs Monaten.
Quelle: Deutsches Mukoviszidose-Register, Patientenberichtsband 2023
Fehler im Erbgut beseitigen Ebenso Hoffnung machen neue Technologien auf diesem Gebiet wie sogenannte Gentaxis, die therapeutische Gene als „Medikament“ in den Menschen bringen, und zwar genau zu den richtigen Zellen, oder die Genschere CRISPRCas, mit deren Hilfe defekte Gene gezielt angegangen werden können. Erstmals wurde im Februar 2023 in der EU grünes Licht für die Zulassung einer Gentherapie auf Basis von CRISPR-Cas gegeben – gegen die Sichelzellkrankheit und gegen Beta-Thalassämie. Beide seltenen Bluterkrankungen werden durch Mutationen im Hämoglobin-Gen verursacht und sind schmerzhafte, lebenslange Erkrankungen, die in manchen Fällen tödlich verlaufen können. Bisher konnten nur die Symptome dieser Krankheiten bekämpft werden. Die aufwendige Transplantation von Knochenmark galt als einzige dauerhafte Behandlungsoption. Fachleute sind überzeugt, dass schon in absehbarer Zeit immer mehr erblich bedingte Krankheiten mit der Genschere zielgenau bekämpft und manche sogar geheilt werden können. Derzeit befinden sich zahlreiche Projekte in unterschiedlichen Phasen der klinischen und vorklinischen Erprobung.
„Forschung kann Leben verändern“
Viele schwere seltene Erkrankungen sind genetisch bedingt – sie basieren auf Veränderungen des Erbguts, der DNA. Bislang konnte man bei diesen Erkrankungen meist nur die Symptome behandeln. Gentherapien verfolgen einen neuartigen Ansatz. Andreas Kopp, Geschäftsführer Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, stellt vor, welches Potenzial dieser für Betroffene bieten könnte.
Herr Kopp, was sind Gentherapien, und was ist das Besondere daran? Als Gentherapie wird der Einsatz von genetischem Material – DNA oder RNA – zur Behandlung eines genetischen Defektes direkt in den Körperzellen bezeichnet. Ziel ist hier, die Ursache der Erkrankung am Ursprungsort zu beseitigen, statt einzelne Symptome lebenslang zu behandeln.
Welche gentherapeutischen Ansätze verfolgen Sie bei Vertex? Wir forschen an verschiedenen Verfahren. Als besonders Erfolg

versprechend hat sich die Geneditierung mit CRISPR/Cas9 gezeigt. Dieses Verfahren, das eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten birgt und auf der Entdeckung eines natürlichen Abwehrmechanismus von Bakterien beruht, wurde im Jahr 2020 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Mittels CRISPR/Cas9 kann man die DNA präzise trennen, um die Krankheit gezielt anzugehen.
Und wie können Patientinnen und Patienten von Gentherapien profitieren? Die Entwicklung von Gentherapien hat beeindruckende
Fortschritte gemacht und neue Hoffnung für Betroffene gebracht. Bei verschiedenen Erkrankungen werden Gentherapien heute bereits angewandt, etwa bei Blutkrebs, Spinaler Muskelatrophie oder anderen schweren Bluterkrankungen.
Was ist Ihnen bei der Forschung besonders wichtig? Bei Vertex haben wir uns dem Ziel verschrieben, nach innovativen Therapien bei schweren Erkrankungen mit einem hohen medizinischen Bedarf zu suchen. Durch unsere Forschung wollen wir Menschen mit schweren, lebensbedrohlichen und häufig sehr seltenen Erkrankungen neue Perspektiven schenken. Dafür investieren wir einen erheblichen Teil unseres Umsatzes in die eigene Forschung und Entwicklung – in diesem Bereich arbeiten bei uns drei von fünf Mitarbeitenden. Dieser Fokus auf die Forschung ermöglicht uns, das notwendige tiefgreifende Verständnis von Krankheiten und ihren Ursachen zu erlangen. Denn nur wer die Biologie einer
MEHR INFORMATIONEN
TIME zeichnete im letzten Jahr die CRISPR/Cas9-basierte GeneditierungsTechnologie von Vertex als „zukunftsweisende Gentherapie“ und eine der 200 wichtigsten Errungenschaften des Jahres 2024 aus.
Erkrankung bis ins Detail versteht, kann eine passende und zielgerichtete Therapie dafür entwickeln. Wir sehen es als unsere Aufgabe als innovatives Pharmaunternehmen an, Menschen mit schweren Erkrankungen die bestmöglichen Therapien zur Verfügung zu stellen. Auch – oder gerade –wenn das bedeutet, völlig neue Wege zu beschreiten.
Die Zentren für seltene Erkrankungen (ZSE) sind zentrale, qualifizierte Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten mit bekannter Diagnose einer seltenen Erkrankung. Zum anderen können sich auch Menschen mit unklarer Diagnose zur weiteren Abklärung vorstellen. In den aktuell bundesweit 36 ZSE schließen sich spezialisiertes medizinisches Fachpersonal und Wissenschaftlerteams verschiedener Fachrichtungen zusammen, um Betroffenen zu einer präzisen Diagnose, maßgeschneiderten Therapie sowie umfassenden Betreuung zu verhelfen.
Berliner Centrum für Seltene Erkrankungen (BCSE)
Charité –Universitätsmedizin Berlin http://bcse.charite.de
1
2 Care-for-Rare Foundation im Dr. von Haunerschen Kinderspital (CRC Hauner)
LMU Klinikum München www.klinikum.uni-muenchen.de/Kinderklinik-und-Kinderpoliklinik- im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital/de/zentren/Care_for_Rare- Center_CRCHauner_/index.html
3 Centrum für seltene Erkrankungen Münster (Kinder)
Universitätsklinikum Münster www.ukm.de/zentren/seltene-erkrankungen
4 Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER)
Ruhr-Universität Bochum www.centrum-seltene-erkrankungen-ruhr.de
5 Essener Zentrum für Seltene Erkrankungen (EZSE)
Universitätsklinikum Essen www.ezse.de
6 Frankfurter Referenzzentrum für Seltene Erkrankungen (FRZSE)
Universitätsklinikum Frankfurt www.kgu.de/einrichtungen/zentren/frankfurter-referenzzentrum-fuer- seltene-erkrankungen-frzse
7 Freiburger Zentrum für Seltene Erkrankungen (FZSE)
Universitätsklinikum Freiburg www.uniklinik-freiburg.de/fzse.html
8 Martin Zeitz Centrum für Seltene Erkrankungen, Hamburg Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf www.uke.de/kliniken-institute/zentren/martin-zeitz-centrum/ index.html
9 Mitteldeutsches Kompetenznetz Seltene Erkrankungen (MKSE) Kooperationsverbund der Uniklinik Halle und Magdeburg sowie des Städtischen Klinikums Dessau www.mkse.ovgu.de
10 Münchener Zentrum für Seltene Erkrankungen (Erwachsene) LMU Klinikum München https://www.lmu-klinikum.de/seltene-erkrankung
Universitäres Zentrum für Seltene Erkrankungen Leipzig
11
Universitätsklinikum Leipzig www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/uzsel
UniversitätsCentrum für Seltene Erkrankungen Dresden (USE)
12
31 Zentrum für Seltene Erkrankungen Tübingen
Universitätsklinikum Tübingen
www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/ zentren/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen-zse
32 Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZSE) Ulm
Universitätsmedizin Ulm
www.uniklinik-ulm.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen.html
33 Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZESE) Würzburg –
Referenzzentrum Nordbayern
Universitätsklinikum Würzburg
www.ukw.de/behandlungszentren/zentrum-fuer-seltene- erkrankungen-zese/startseite/
34 Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen
Marburg (ZusE )
Universitätsklinikum Marburg
www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_zuk/27241.html
35 Augsburger Zentrum für Seltene Erkrankungen (AZeSE)
Universitätsklinikum Augsburg
www.uk-augsburg.de/zentren/azese-seltene-erkrankungen/ueberblick
36 Zentrum für Seltene und Ungeklärte Erkrankungen des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus
Medizinische Universität Lausitz
https://mul-ct.de/index/kontakte.php?object=contact&id_ object=62&tab=ueber-uns
23 Zentrum für Seltene Erkrankungen Hannover Medizinische Hochschule Hannover www.mhh.de/interdisziplinaere-zentren/zentrum-fuer-seltene- erkrankungen
24 Zentrum für Seltene Erkrankungen Heidelberg
Universitätsklinikum Heidelberg www.klinikum.uni-heidelberg.de/interdisziplinaere-zentren/zentrum- fuer-seltene-erkrankungen
Universitätsklinikum Dresden www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/universitaetscentren/use
13 Zentrum für Seltene Erkrankungen (TUM)
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (ZSE TUM) www.mri.tum.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
14 Zentrum für Seltene Erkrankungen Aachen (ZSEA)
Uniklinik RWTH Aachen
www.ukaachen.de/kliniken-institute/zentrum-fuer-seltene- erkrankungen-aachen-zsea/das-zentrum
15 Zentrum für seltene Erkrankungen Gießen (ZSEGi)
Universitätsklinikum Gießen www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_zse/index.html
16 Zentrum für Seltene Erkrankungen am
Universitätsklinikum des Saarlandes
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
www.uks.eu/kliniken-einrichtungen/spezialisierte-einrichtungen/ zentrum-fuer-seltene-erkrankungen-am-uks
17 Zentrum für Seltene Erkrankungen Bonn (ZSEB)
Universitätsklinikum Bonn
www.zseb.ukbonn.de
25 Zentrum für Seltene Erkrankungen Jena Universitätsklinikum Jena www.uniklinikum-jena.de/zse
18 Zentrum für Seltene Erkrankungen der Uniklinik Rostock
Universitätsmedizin Rostock https://selten.med.uni-rostock.de
26 Centrum für Seltene Erkrankungen Köln (CESEK) Uniklinik Köln
www.uk-koeln.de/kliniken-institute-und-zentren/centrum-fuer- seltene-erkrankungen/
19 Zentrum für Seltene Erkrankungen des Nervensystems (ZSEN) Mainz
Universitätsmedizin Mainz www.unimedizin-mainz.de/zsen/startseite/willkommen.html
27 Zentrum für Seltene Erkrankungen Lübeck Universitätsklinikum Schleswig-Holstein –Campus Lübeck www.uksh.de/zse-luebeck
28 Zentrum für Seltene Erkrankungen Kiel Universitätsklinikum Schleswig-Holstein –Campus Kiel www.uksh.de/zse-kiel
20 Zentrum für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Düsseldorf (ZSED) www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/ zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
29 Zentrum für Seltene Erkrankungen Mannheim Universitätsmedizin Mannheim www.umm.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
21 Zentrum für Seltene Erkrankungen Erlangen Uniklinikum Erlangen www.zseer.uk-erlangen.de
30 Zentrum für Seltene Erkrankungen Regensburg (ZSER) Universitätsklinikum Regensburg www.ukr.de/zentrum-fuer-seltene-erkrankungen
22 Zentrum für Seltene Erkrankungen Göttingen (ZSEG)
Universitätsmedizin Göttingen https://zseg.umg.eu
Quellen: RESEARCH FOR RARE, Forschung für Seltene Krankheiten, www.research4rare.de; se-atlas –Versorgungsatlas für Menschen mit Seltenen Erkrankungen, www.se-atlas.de/map/zse; Zugriff: 11.02.2025
HEREDITÄRES ANGIOÖDEM | VON TOBIAS LEMSER
Starke Schwellungen der Haut und Schleimhäute sind die Hauptsymptome des Hereditären Angioödems, kurz HAE. Bei circa einem von 50.000 Menschen wurde diese vererbbare Erkrankung hierzulande diagnostiziert – oft jedoch erst nach langer Leidenszeit. Dank moderner Medikamente ist die Krankheit heute gut behandelbar.
Wer von einer Wespe gestochen wurde, braucht in der Regel nicht lange zu warten, bis das Areal um die Einstichstelle anschwillt – eine natürliche Reaktion des Körpers. Denn die im Wespengift enthaltenen Substanzen führen zu einer Entzündung und sorgen dafür, dass sich die Blutgefäße erweitern und Flüssigkeit ins umliegende Gewebe eindringt. Doch was, wenn eine Schwellung eintritt, jedoch kein offensichtlicher Grund dafür erkennbar ist? Ursache hierfür könnte das Hereditäre Angioödem (HAE) sein – eine seltene Krankheit, bei der die Ödeme episodisch auftreten und bis zu drei Tage anhalten.
Haut und Magen
Das Gute: Auch wenn die einzelnen Schwellungen häufig nach einer gewissen Zeit wiederkehren, bilden sie sich immer von selbst zurück. Doch nicht nur Hautpartien – zumeist an Händen, Füßen, Lippen oder im ganzen Gesicht – können betroffen sein. Typisch sind auch schmerzhafte, krampfartige Bauchschmerzen, genauso wie Erbrechen, Durchfall oder HerzKreislauf-Symptome. Gar lebensbedrohlich können die Auswirkungen von HAE sein, wenn sich die Schwellungen am Kehlkopf oder an der Zunge bemerkbar machen. Es drohen Atemnot und letztlich Erstickungsgefahr. Ursache für die Schwellungen ist ein Gendefekt auf dem elften Chromosom. Dort befindet sich ein mutiertes Gen, das für die Herstellung des Proteins C1-Inhibitor zuständig ist. Wird dieses Protein in zu
niedriger Menge produziert, werden die Blutgefäße durchlässiger für die Blutflüssigkeit. Tritt diese aus den Gefäßen aus und lagert sich ins Gewebe ein, kann es zu besagten Schwellungen kommen.
Oftmals langer Leidensweg Zumeist beginnt die Erkrankung im ersten oder zweiten Lebensjahrzehnt. Das Problem hier: Bis es zur richtigen Diagnose kommt, vergehen oft einige Jahre oder sogar Jahrzehnte – vor allem dann, wenn die erblich bedingte Erkrankung in der Familie noch nicht bekannt ist. Da HAE angesichts der vergleichsweise wenigen Fälle nur selten in Arztpraxen Thema ist, kommen Ärztinnen und Ärzte dort mit Betroffenen kaum in Kontakt und haben daher kaum Erfahrung mit der Erkrankung. So erhalten viele von ihnen die Diagnose erst, nachdem sie eine Odyssee an Arztbesuchen hinter sich und Therapien durchlaufen haben, die keine Besserung gebracht
Typisch sind auch schmerzhafte, krampfartige Bauchschmerzen.
haben. Dank sehr guter biochemischer Möglichkeiten lässt sich HAE Typ 1 – die mit 85 Prozent der Fälle mit Abstand häufigste HAE-Variante –heute deutlich leichter diagnostizieren. Gerade weil manche Betroffene mehrere Episoden pro Woche erleiden, ist es wichtig, bestimmte Trigger zu kennen. Vor allem verstärkter Druck auf die Haut, psychische Belastungen, aber auch Infektions- und Erkältungskrankheiten sowie bestimmte Medikamente können zu Attacken führen.

Bei Betroffenen treten wiederholt unvorhersehbare Schwellungen im Gesicht auf.
Verbesserte Therapien
Zwei Behandlungsstrategien stehen besonders im Fokus: zum einen eine Bedarfsbehandlung der akuten Symptome, welche Schwellungsattacken abmildert und zudem verkürzt. Hier gab es zuletzt beachtliche Fortschritte. Zum anderen wird mithilfe der Langzeitprophylaxe die Anzahl der akuten Attacken erheblich vermindert. Insbesondere durch die dauerhafte Einnahme von Medikamenten lässt sich eine Vielzahl an Schwellungsattacken vermeiden, sodass ein Teil der an HAE erkrankten Menschen inzwischen symptomfrei ist – was sich deutlich auf die Lebensqualität auswirkt. Damit dies jedoch gelingt, braucht es aufgeklärte Patientinnen und Patienten und vor allem Ärzte, welche das Hereditäre Angioödem frühzeitig erkennen, um den Betroffenen einen passenden Therapieplan unterbreiten zu können.
„Ich kann trotz HAE das Leben genießen“
Die plötzlichen Schwellungsattacken begannen bei Franziska von Werder, heute 29 Jahre alt, bereits in der Jugend. Die von einem Hereditären Angioödem (HAE) Betroffene erzählt, wie es ihr heute geht.
Mit welchen Symptomen hat sich die Erkrankung erstmals bei Ihnen gezeigt? Meine erste Attacke hatte ich mit 14 Jahren. Ich bekam Schwellungen im Gesicht, meine Lippe war fünfmal so dick, und ich wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Da meine Mutter ebenfalls betroffen ist, war schnell klar, dass ich auch HAE habe.

habe ich mich aber nie wirklich eingeschränkt gefühlt. Durch meine familiäre Vorbelastung bin ich früh von Fachleuten betreut worden, die sich gut mit HAE auskannten. Aber als ich in eine andere Stadt gezogen bin, habe ich auch anderes erlebt. Da musste ich den Ärztinnen und Ärzten erklären, was HAE ist und auch, dass manche Therapievorschläge nicht helfen, beispielsweise Kortison.
Gibt es Situationen, in denen Sie sich eingeschränkt fühlen? Nein, durch meine Prophylaxe-Therapie fühle ich mich unfassbar frei und kann ein ganz normales Leben führen. Ich mache alles, was Nichtbetroffene auch können: Ich arbeite, mache Sport, gehe feiern, fahre in den Urlaub und plane meine Zukunft. Das Wichtigste ist, dass Betroffene schnell eine Diagnose erhalten.
Wie äußern sich Attacken? Bei mir sind es meistens Attacken an den Extremitäten, an den Händen und Füßen. Manchmal sind auch die Unterarme und Ellenbogen betroffen. In den letzten Jahren kamen Magenattacken hinzu. Dabei schwillt der Magen an, was starke Magenkrämpfe und Erbrechen zur Folge hat.
Welche Herausforderungen gibt es mit HAE? Die theoretisch lebensbedrohlichen Attacken machen das Leben weniger planbar. Persönlich
Wie werden Sie therapiert? Anfangs bekam ich zur Akuttherapie bei Attacken eine Spritze intravenös. Später bin ich auf ein subkutanes Mittel gewechselt. Heute nehme ich ein orales Medikament. Dadurch haben sich Häufigkeit und Intensität der Attacken deutlich verringert, und mein Leben ist wieder planbarer.

EOSINOPHILE ÖSOPHAGITIS | VON TOBIAS LEMSER
Ist die Speiseröhre chronisch entzündet, leiden Betroffene unter teils erheblichen Schluckbeschwerden. Häufigste Form dieser Entzündung ist die Eosinophile Ösophagitis. Doch wie kommt es dazu, und was kann man tun, um diese bislang unheilbare Erkrankung in den Griff zu bekommen?
Ob ganz bewusst beim Verzehr einer leckeren Mahlzeit oder unbewusst etwa beim Nachdenken oder im Schlaf: Bis zu 1.500-mal schlucken wir pro Tag und „verschlucken“ dabei rund 1,5 Liter Speichel. Das Schlucken ist einer der wichtigsten und zugleich komplexesten Vor-
gänge in unserem Körper. Schwer vorzustellen, dass jeder Essvorgang Schluckbeschwerden oder sogar das Steckenbleiben von Nahrung in der Speiseröhre. verursachen kann – so jedoch bei der Eosinophilen Ösophagitis, einer Erkrankung der Speiseröhre, die mit einer allergieähnlichen, chronischen Entzündung einhergeht.
Betroffene verspüren ein teils schmerzhaftes Kloßgefühl und Würgereiz.
Allergene als Auslöser
Die Eosinophile Ösophagitis gilt als relativ neue Erkrankung, die erstmals im Jahr 1993 als eigenständiges Krankheitsbild beschrieben wurde. Bei einer von 3.000 Personen wird die Diagnose gestellt – zumeist sind es Männer, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind und vielfach bereits an Allergien leiden. Doch auch bei Kindern kann diese seltene Erkrankung auftreten. Wichtige Hinweise dafür können Nahrungsverweigerung, Erbrechen, Gewichtsverlust oder Bauchschmerzen sein. Noch nicht eindeutig erforscht sind die Hintergründe, wie es zu dieser seltenen Erkrankung kommt. Fachleute gehen von genetischen Komponenten, aber auch von Umwelteinflüssen und verschiedenen in der Nahrung enthaltenen Allergenen als auslösende Faktoren aus. Gerade Letztere stehen im Verdacht, eine Entzündung in der Speiseröhre hervorzurufen. Nicht selten leiden Betroffene auch an Heuschnupfen, Asthma, Hautausschlägen und/oder bestimmten Nahrungsmittelallergien.
Weitung der Speiseröhre Sicher diagnostiziert wird die Erkrankung durch Besprechung der Symptome sowie durch eine Endoskopie der Speiseröhre mit gleichzeitiger
Es bleibt kaum noch etwas im Hals stecken
Sonja (56) litt immer wieder unter Schluckbeschwerden. Ein Besuch in der Notaufnahme brachte die Diagnose Eosinophile Ösophagitis (EoE) und mit ihr eine Behandlung, die ihr Leben verändern sollte.
Sonja war elf Jahre alt, als ihr zum ersten Mal beim Essen etwas in der Speiseröhre steckenblieb und sich nur mit großer Mühe herauswürgen ließ. Dem Mädchen war das extrem peinlich. Selbst als Erwachsene verheimlichte die heute 56-Jährige ihre Probleme, bis vor einem Jahr eine Blaubeere in ihrer Speiseröhre stockte, die sich weder durch Trinken von Wasser noch Würgen von der Stelle bewegen wollte.
Speiseröhre bereits stark vernarbt
In der Notaufnahme kann ein auf Magen-Darm-Krankheiten spezialisierter Internist per Speiseröhrenspiegelung mit einem Endoskop die Blaubeere zerkleinern und in den Magen spülen. Doch hierfür musste der Arzt auf ein kleineres Instrument wechseln, denn durch Sonjas über Jahrzehnte entzündete

Bei einer Eosinophilen Ösophagitis kommt es zu einer übermäßigen Ansammlung von weißen Blutkörperchen in der Speiseröhrenschleimhaut.
Gewebeentnahme. Befindet sich in der biopsierten Schleimhaut eine erhöhte Anzahl spezieller weißer Blutkörperchen, den eosinophilen Granulozyten, gilt dies als entscheidender Befund. Doch was hilft bei derartigen Schluckbeschwerden? Als Basistherapie stehen vor allem Medikamente sowie der komplette Verzicht auf die Hauptallergene Kuhmilch, Weizen, Soja sowie Eier und Fisch im Fokus. So wird das Risiko möglicher Vernarbungen und Verengungen der Speiseröhre minimiert. Kommt es dennoch zu verengten Stellen, können diese vorsichtig geweitet werden. In bestimmten Fällen muss diese sogenannte Dilatation später wiederholt werden.

Speiseröhre sind Narben entstanden. Diese ziehen sich zusammen, das Gewebe verhärtet sich, die unwillkürlichen Bewegungen der Speiseröhre beim Schluckakt (Peristaltik) funktionieren nicht mehr gut, und der Hohlraum, durch den jeder einzelne Bissen zum Magen gelangt, wird immer schmaler. „Der Arzt schlug mir vor, die Engstelle mit einem Ballon zu weiten, doch dafür war das Gewebe bereits zu stark vernarbt.“
Eine Biopsie ergab die Diagnose Eosinophile Ösophagitis, eine Speiseröhrenentzündung, vor allem getriggert durch bestimmte
Lebensmittel. „Ich wünschte, ich hätte mich früher zu einer Untersuchung entschlossen“, meint Sonja, nachdem die Behandlung ihr Leben zum Positiven verändert hat – nicht zuletzt, weil die chronische Krankheit unbehandelt schwerwiegende Folgen haben kann.
Die Suche nach Informationen zu EoE führte sie auch zur Internetseite schluckbeschwerden.de. „Da wusste ich: Ich bin nicht allein mit meinem Problem!“
Therapie: spürbare Verbesserung
Sonja erhielt eine Behandlung mit einer antientzündlich wirkenden
medikamentösen Therapie. Außerdem begann sie, alle potenziell triggernden Nahrungsmittel wegzulassen – vor allem Weizen –, denn die EoE kann durch bestimmte Nahrungsmittelallergene ausgelöst werden. Die Behandlung zeigte nach wenigen Wochen erste Wirkung. Danach wurde es Woche für Woche besser mit dem Schlucken.
Der Gastroenterologe konnte mit dem normal großen Endoskop die gesamte Speiseröhre inspizieren und eine deutliche Verbesserung feststellen. Die Biopsien haben aber unter alleiniger Diät eine fortschreitende Entzündungsaktivität ergeben. Und verengt ist die Speiseröhre noch immer etwas – nicht immer lassen sich die Vernarbungen vollständig therapieren. Daher erhält die Patientin nun eine medikamentöse Dauertherapie. Und wenn doch mal etwas steckenbleibt? Dann braucht Sonja heute nur noch ein Glas Wasser. „Das ist eine wirklich große Verbesserung meiner Lebensqualität.“
https://schluckbeschwerden.de
RHEUMATISCHE ERKRANKUNGEN | VON TOBIAS LEMSER
Von milden bis hin zu lebensbedrohlichen Formen: Rheumaerkrankungen haben viele Gesichter. Rund 200 verschiedene seltene Krankheiten sind bislang bekannt. Umso wichtiger ist es, typische Symptome zu kennen. Nur so lässt sich frühzeitig therapeutisch gegensteuern und die Lebensqualität verbessern.
Fieber, Gewichtsabnahme, Nachtschweiß, ohne dass eine Infektion oder ein Tumor dahintersteckt: alles Symptome, die für rheumatische Erkrankungen sprechen können. Ein Großteil wird unter Fachleuten als selten eingestuft –etwa dann, wenn die Erkrankung lediglich einmal unter 100.000 oder sogar einer Million Menschen auftritt.

Häufige Hautveränderungen bei einer Vaskulitis sind punktförmige Rötungen.
Attacke auf eigene Zellen Neben der bekanntesten Form, der rheumatoiden Arthritis, zählen zu den selteneren rheumatischen Erkrankungen die sogenannten Kollagenosen. Nahm man früher an, dass bei dieser Krankheit vorrangig eine Veränderung im Bindegewebe vorliegt, ist man sich inzwischen einig, dass systemische Autoimmunerkrankungen dahinterstecken und die Blutgefäße attackieren können. Nicht nur verschiedene innere Organe können chronisch erkranken, in manchen Fäl-
Oft kommt es bei Vaskulitiden zu Schmerzen an Gelenken oder Muskeln.
len sind ebenso Haut und Gelenke gleichzeitig oder nacheinander betroffen. Eine weitere große Untergruppe sind die Vaskulitiden: Sie sind ein Oberbegriff für unterschiedliche Formen von Entzündungen von Blutgefäßen.
Oft kommt es bei Vaskulitiden zu Schmerzen an Gelenken oder Muskeln. Hin und wieder gehen mit einer Vaskulitis Gelenkschwellungen einher. Ursache für die Gefäßentzündungen ist eine fehlerhafte Immunreaktion. In diesem Fall sieht das Immunsystem körpereigene
„Rheumatologen sind Medizin-Detektive“
Dr. med. Gabriele Zeidler, Chefärztin des Rheumazentrums des Landes Brandenburg, Klinik für Internistische Rheumatologie, Osteologie und spezielle Schmerztherapie im JohanniterKrankenhaus Treuenbrietzen, berichtet, wie seltene rheumatische Erkrankungen besser erkannt werden können und welche Therapien den Betroffenen helfen.
Frau Dr. Zeidler, an einer der bundesweit drei größten Rheumakliniken nehmen Sie sich viel Zeit für die Diagnose. Was macht diese oft so schwierig? Das liegt einfach an der Seltenheit vieler rheumatischer Erkrankungen. Manche kommen mit einer Häufigkeit von eins zu einer Million vor. Deshalb müssen wir mitunter äußerst detektivisch vorgehen. Dadurch, dass wir jährlich rund 3.500 Patientinnen und Patienten teil- und stationär behandeln, haben wir jedoch glücklicherweise einen großen Fundus an Erfahrungswerten. Das Problem: Außerhalb der Rheumatologie werden seltene

rheumatische Erkrankungen aufgrund ihres seltenen Vorkommens oft erst spät oder nicht erkannt.
Was könnte den Weg verkürzen? Bei Auftreten von Gelenkschwellungen oder auch erhöhten Entzündungswerten ohne gleichzeitig vorliegende Infektzeichen sollte an rheumatische Erkrankungen gedacht werden. Oft ist es allerdings schwer, in einer rheumatologischen Facharztpraxis zeitnah einen Termin zu erhalten. Als Rheumazentrum des Landes Brandenburg haben wir deshalb eine Notfallambulanz eingerichtet, in der sich von
SCHON GEWUSST?
Die Deutsche Rheuma-Liga (www. rheuma-liga.de) ist eine wichtige Anlaufstelle bei seltenen rheumatologischen Erkrankungen. Sie bietet niedrigschwellige Angebote zu Erkrankungen, Therapien sowie zu Ansprechpersonen und den Austausch in Selbsthilfegruppen.
Substanzen irrtümlich als fremd an und bekämpft sie mit der Folge, dass sich die Blutgefäße entzünden.
Augenlicht in Gefahr
Dass rheumatische Erkrankungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind, wird mit Blick auf so manche seltene Form deutlich. Hellhörig sollten Betroffene sowie Ärztinnen und Ärzte dann werden, wenn ein Schläfenkopfschmerz mit gleichzeitig erhöhten Entzündungswerten sowie Sehstörungen auftritt – Anzeichen, die für die sogenannte Riesenzellarteriitis sprechen können, eine Entzündung der Augenarterie, bei der innerhalb eines Tages die Erblindung droht. Gerade bei diesen Symptomen gilt es, nicht zu warten und schnell einen spezialisierten Rheumatologen aufzusuchen. Aber auch sonst ist bei Rheuma eine gezielte medizinische Versorgung – es gibt immer wirkungsvollere Therapien – immens wichtig: Denn wie Studien aufzeigen, ist die Lebenserwartung gerade bei Männern mit schlecht eingestellter rheumatoider Arthritis um acht Jahre verkürzt.
Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr akut Erkrankte unter dem Verdacht auf eine rheumatische Erkrankung vorstellen können. Ergänzend bieten wir die ASV Rheumatologie (ambulante spezialfachärztliche Versorgung) an.
Wie gehen Sie bei einem Verdacht vor? Am Beginn stehen eine ausführliche Anamnese sowie eine Untersuchung von Kopf bis Fuß. Ebenso dazu gehören Ultraschalluntersuchungen, weitere bildgebende Diagnostik, je nach Bedarf auch eine Kapillarmikroskopie sowie Labordiagnostik. Ist die Diagnose gestellt, ist der zweite Schritt, eine passende Therapie zu finden.
Wie sieht diese in der Regel aus? Cortison ist das bekannteste Medikament, das zugleich am schnellsten die Entzündung hemmt. Das Ziel ist jedoch, dieses nur anfangs zu verabreichen und idealerweise angesichts möglicher Nebenwirkungen vollständig oder zumindest weitgehend
auszuschleichen. Dazu setzen wir synthetische Basistherapeutika, Biologika und zielgerichtete Small Molecules ein. Nicht selten gibt es jedoch keine zugelassene Therapie, was aufwendige Anträge auf Kostenübernahme bei der jeweiligen Krankenkasse erfordert.
Für die Betroffenen viel verlorene Zeit. Das ist richtig. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Kostenträger mehr Vertrauen in uns als Behandelnde haben und auch weniger kritisch gegenüber der teil- und stationären Therapie seltener Erkrankungen eingestellt wären. Das Wichtigste ist jedoch, dass Betroffene rechtzeitig zu uns kommen. Denn ist Rheuma gut eingestellt, besteht für viele Patienten eine weitestgehend normale Lebensqualität und -erwartung. Ein guter Partner kann dabei für Betroffene die Deutsche RheumaLiga sein.
www.johanniter.de/ johanniter-kliniken/johanniterkrankenhaus-treuenbrietzen
„Eine
TENOSYNOVIALER RIESENZELLTUMOR | IM GESPRÄCH MIT NADINE EFFERT
Nicht lebensbedrohlich, aber mitunter stark lebenseinschränkend: PD Dr. med. Per-Ulf Tunn (links), Chefarzt Tumororthopädie, und Prof. Dr. med. Peter Reichardt (rechts), Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin, am Helios Klinikum Berlin-Buch berichten als Leiter des Sarkomzentrums über den seltenen tenosynovialen Riesenzelltumor und wie er behandelt wird.


Dr. Tunn, was versteht man unter einem tenosynovialen Riesenzelltumor?
Dabei handelt es sich um einen seltenen Tumor, der in einem Gelenk, an der Gelenkkapsel, an Sehnenscheiden oder im Bereich der Schleimbeutel zu finden ist. Er kann alle Gelenke betreffen, am häufigsten ist es das Knie, gefolgt vom Sprunggelenk. Wir gehen schätzungsweise von jährlich etwa zwei bis zwölf Fällen pro eine Million Einwohner in Deutschland aus. Betroffen sind vor allem Menschen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, Frauen etwas häufiger als Männer.
Auch wenn es sich nicht um einen bösartigen Tumor handelt, ist die Lebensqualität der Betroffenen oftmals sehr stark eingeschränkt. Prof. Reichardt: In der Tat. Dazu führen typische Beschwerden wie Schwellungen, Funktionseinschränkungen und starke Schmerzen, die sich mit der Zeit verschlimmern.
Ist die Diagnose mittels MRT und Röntgenbild gestellt, wie wird der Riesenzelltumor behandelt?
Dr. Tunn: Das Herzstück der Behandlung ist die chirurgische Entfernung des Tumors. Beim Knie entweder bei kleineren Manifestationen mittels arthroskopischer Kniegelenkspiegelung oder bei größeren Tumoren durch die Entfernung des tenosynovialen Riesenzelltumors über eine Eröffnung des Gelenks, Synovektomie genannt. Ziel ist es, durch die OP die Diagnose zu sichern, Schmerzen zu lindern und die Funktionalität des Gelenks zu verbessern, um auch Folgeschäden am umliegenden Gelenkgewebe und Knochenerosionen – und letztlich einen Gelenkersatz –zu vermeiden. Daher ist es wichtig, den Tumor rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Wie ist die Prognose nach der OP?
Dr. Tunn: Sie hängt davon ab, um welchen Typ Riesenzelltumor es sich handelt: lokalisiert oder diffus. Während die Rezidivrate der lokalisierten Form sehr gering ist, liegt das Risiko eines erneuten Auftretens bei der diffusen Form bei circa 50 Prozent. Dies gilt es entsprechend im Rahmen einer engmaschigen Nachkontrolle zu berücksichtigen.
Prof. Reichardt, bei diffusen oder nicht operablen Fällen kommt auch eine medikamentöse Therapie infrage.
Richtig. Es handelt sich um sogenannte Tyrosinkinasehemmer. Sie bauen unmittelbar auf der inzwischen sehr genau erforschten molekularen Ursache der Erkrankung auf. Nachgewiesen wurde nämlich eine Mutation des CSF1-Gens auf dem Chromosom 1 mit dem COL6A3-Gen auf dem Chromosom 2, wodurch es zu einer Überexpression des CSF1 und somit Anziehung von makrophagenähnlichen Entzündungszellen im betroffenen Bereich kommt. Die zielgerichteten Inhibitoren blockieren den CSF1-Rezeptor, der zum Tumorwachstum beiträgt. Bislang entwickelte Medikamente überzeugten aufgrund zu schwacher Wirkung auf den CSF1-Rezeptor oder starker Nebenwirkungen auf die Leber nicht.
Wünschenswert wäre ein potenter Inhibitor mit weniger Nebenwirkungen.
Prof. Reichardt: Genau, und einen solchen Kandidaten haben wir hier, am Sarkomzentrum Berlin-Buch, im Rahmen einer internationalen Studie untersucht. Die neue Substanz erfüllt die Erwartungen hinsichtlich der Tumorrückbildungsrate, sie liegt bei 40 Prozent gegenüber null Prozent in der Placebo-Gruppe und der Verbesserung der klinischen Symptome – und dies ohne die negativen Auswirkungen auf die Leber. Wir gehen aufgrund dieser Ergebnisse davon aus, dass dieses Medikament im Laufe dieses Jahres Patienten zur Verfügung steht. Das heißt: In Zukunft folgt eine interdisziplinäre Absprache zwischen Tumorchirurgen und Onkologen, welches Verfahren individuell das Beste für die betroffene Person ist – und das ist ein Fortschritt für Menschen, die von einem seltenen tenosynovialen Riesenzelltumor betroffen sind.
FAZIT
Der tenosynoviale Riesenzelltumor (TGCT) kann die Lebensqualität der Betroffenen auf verschiedene Weise beeinträchtigen.1
Der TGCT ist ein seltener gutartiger, lokal aggressiver Tumor, der in einem Gelenk, einem Schleimbeutel oder einer Sehne auftritt und zu einer Funktionsbeeinträchtigung und Schädigung des benachbarten Gewebes führt. Durch das Wachstum des Tumors bedingte Beschwerden 2, 3, 4 entwickeln sich oft langsam über Monate hinweg.
Dazu gehören häufig anhaltende Schmerzen im betroffenen Gelenk oder in der Sehnenscheide, die sich bei Bewegung verstärken können, sowie Einschränkungen in der Beweglichkeit und Steifheit im Gelenk. Alltägliche Aktivitäten wie Gehen, Greifen oder Treppensteigen können erschwert sein. Der Tumor kann zudem Schäden am betroffenen Gelenk und den umliegenden Geweben und Strukturen verursachen. Dies kann –je nach Schwere der Symptome und Art der Tätigkeit – in manchen Fällen zu einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit führen. 5
iStock / gorodenkoff

Informationen sowie Tipps und Hilfen im Umgang mit der Erkrankung finden Betroffene und ihre Angehörigen unter anderem bei der Deutsche Sarkom-Stiftung unter: www.sarkome.de
Der TGCT kann trotz seiner Gutartigkeit erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen haben. Eine frühzeitige Diagnose mittels MRT und anschließende adäquate Behandlung sind wichtig, um Lebensqualität zu erhalten und langfristige Folgen, wie zum Beispiel eine sekundäre Arthrose, zu vermeiden.
1 Stacchiotti S et al. Cancer Treat Rev 2023; 112:102491.
2 Gouin F, Noailles T. Orthop Traumatol Surg Res. 2017;103(1S):S91 – 97.
3 Gelhorn HL, et al. Clin Ther. 2016;38(4):778 – 93.
4 Brahmi M et al. Curr Treat Options Oncol. 2016;17(2):10.
5 https://journals.lww.com/joem/fulltext/ 2021/04000/the_economic_burden_of_ tenosynovial_giant_cell.17.aspx.

www.deciphera.com
PAROXYSMALE NÄCHTLICHE HÄMOGLOBINURIE | VON NADINE EFFERT
Wenn rote Blutkörperchen zerstört werden: Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist eine ultraseltene, potenziell lebensbedrohliche Erkrankung des Blutes. Anzeichen können eine unvermittelte Rotfärbung des Urins und Fatigue sein. Das Gute: Es gibt zielgerichtete Therapien.
Starke Bauchkrämpfe, dunkler Urin, ausgeprägte
Fatigue: Diese unspezifischen Beschwerden lassen nicht direkt an eine Blutkrankheit denken –vor allem nicht an die sehr seltene paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, deren geschätzte Prävalenz bei 16 Fällen pro einer Million Einwohnenden liegt. Jährlich erhalten weltweit nur etwa 1,3 von einer Million Menschen die Diagnose PNH. Aufgrund der sehr unspezifischen Symptome ist davon auszugehen, dass PNH „unterdiagnostiziert“ wird.
Mutation in Blutstammzellen
Ursache der PNH ist eine erworbene genetische Veränderung im Erbgut der sogenannten Blutstammzellen, die dazu führt, dass – einfach ausgedrückt – rote Blutkörperchen aufgrund fehlender „Schutzschilder“ vom Komplementsystem, einem wichtigen Bestandteil der körpereigenen Immunabwehr, fälschlicherweise angegriffen und abgebaut werden. Dieser Prozess setzt den
eisenhaltigen Blutfarbstoff Hämoglobin frei, der über die Nieren in den Urin gelangt und für die Dunkelfärbung verantwortlich ist. Neben Blutarmut kann die Freisetzung des Hämoglobins schwerwiegende Folgen haben: insbesondere Thrombosen, die primär in den Venen der inneren Organe wie Lunge, Nieren oder Leber auftreten und Hauptursache für Todesfälle infolge unbehandelter PNH sind, sowie Schädigungen an den Organen.
Neue Leitlinie
Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie/DGHO) berichtete im Oktober letzten Jahres, dass die PNH einer der „Brennpunkte“ bei medikamentösen Innovatio-
Fast alle Betroffenen leiden unter einer Fatigue.
nen in der Hämatologie sei. Seit 2007 gibt es zielgerichtete Medikamente, die an verschiedenen Komponenten des Komplementsystems ansetzen und das gefährliche Thromboserisiko senken und dank derer Betroffene heute in der

Bei einer Thrombose kommt es zu einem vollständigen oder teilweisen Verschluss eines Blutgefäßes durch einen Blutpfropf.
Regel eine normale Lebenserwartung haben. Erst im letzten Jahr wurden neue Substanzen zugelassen. Die im Herbst 2024 aktualisierte Leitlinie zur Behandlung der PNH beschreibt zudem die Fatigue erstmals als wesentliche Symptomatik. Etwa 90 Prozent der Betroffenen berichten von dieser ausgeprägten chronischen Erschöpfung, welche eine Reihe von meist kontinuierlich vorhandenen körperlichen und kognitiven Anzeichen umfasst – darunter verminderte Leistungsfähigkeit, Antriebslosigkeit, körperliche Schwäche und Schlafprobleme –und die Lebenqualität stark mindert.
„Die Behandlung der PNH bedarf gebündelter Expertise“
Die Stiftung lichterzellen ist Anlaufstelle für Menschen mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) und Aplastischer Anämie (AA). Geschäftsführerin Pascale Burmester berichtet über die Bedeutung spezialisierter Behandlungszentren und Neues aus der Forschung.
Welche Herausforderungen bringt die Diagnose PNH mit sich? Auch wenn es seit 2007 Medikamente gibt, welche die PNH spezifisch adressieren, ist die Versorgung nicht optimal, da diese ultraseltene Bluterkrankung noch nicht gut erforscht ist. Zudem berichten Betroffene über Unverständnis im Umfeld und darüber, dass zum Beispiel die sehr häufig auftretende Fatigue als Faulheit abgetan wird. Selbst Aufklärung zu leisten und sich Gehör bei Ärztinnen und Ärzten zu verschaffen ist sehr energieraubend. Daher gehört es auch zu unserer Mission, für mehr Bewusstsein für PNH sorgen.
Auf Ihrer Website findet sich eine Liste mit auf PNH spezialisierten hämatologischen Fachärztinnen

und -ärzten. Warum sollten sich Betroffene in deren Hände geben?
Weil sie nur dort dezidierte Antworten auf alle ihre Fragen sowie die bestmögliche Versorgung erhalten. Ob für eine Zweitmeinung, auf die gesetzlich Versicherte ein Recht haben, oder bei einer wichtigen Therapieentscheidung – es lohnt sich, eines der Behandlungszentren für AA/PNH aufzusuchen, auch weil die international vernetzten Fachleute stets auf dem aktuellsten Stand der Forschung und Behandlungsmöglichkeiten sind. Die alltägliche Betreuung und Medikamentengabe können im Anschluss hingegen in einer hämatologischen Praxis erfolgen.
Der Stiftungsrat hat bestimmte Mindestkriterien für Experten
festgelegt. Richtig, so muss die Person über begutachtete Publikationen zum Thema AA/PNH innerhalb der letzten fünf Jahre verfügen oder sich in den letzten fünf Jahren aktiv an interventionellen klinischen Studien beteiligt haben oder sich aktiv in das AA/BMF-Register oder das Register der International PNH Interest Group, kurz IPIG, einbringen und/oder sich in der Arbeitsgemeinschaft Klassische Hämatologie der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie, kurz DGHO, sichtbar engagieren.
lichterzellen engagiert sich auch im Bereich Forschung. Inwiefern? Letztes Jahr zum Beispiel hat die Stiftung eine Pilotstudie zum Thema Thromboseneigung bei PNH gefördert. Das AA/BMF-R egister bezuschussen wir jährlich mit einem fünfstelligen Betrag. Für 2025 haben wir ein Versorgungsforschungsprojekt in Kooperation mit der RWTH Aachen und der DGHO geplant. Unabhängig von unserem Engagement laufen aktuell auf globaler Ebene einige Studien zu weiteren Wirkstoffen, manche davon recht vielversprechend. Meine
HILFE FÜR BETROFFENE
• Patienten-Helpline: Telefon 0211/57 77 22 76, mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr
• Notfallausweis und Patientenpass
• Basis-Kit als erste Orientierung für neu diagnostizierte Patienten
Reisekostenzuschuss
• Vernetzungsprojekt: „Find your Buddy“ und lichterzellenForum zum Austausch für Betroffene
• 6. lichterzellen-Wochenende 20.–22. Juni 2025 in Hamburg
persönliche Hoffnung ist die Therapie mit der Genschere CRISPR/Cas, mit der PNH in ferner Zukunft vielleicht sogar geheilt werden kann.
Stiftung zur Hilfe bei PNH/AA
www.lichterzellen.de
KOMMENTAR
Das Bewusstsein für die Schicksale der „Waisen der Medizin“ wächst – etwa dank engagierter Patientenorganisationen und der Aktionen rund um den „Rare Disease Day“. Auch die Politik hat Handlungsbedarf erkannt, zuletzt mit einem 20-Punkte-Plan für eine bessere Versorgung der Menschen mit seltenen Erkrankungen, der im Dezember 2024 an den Gesundheitsausschuss überwiesen wurde. Pharmaunternehmen sehen neue Chancen durch die Eroberung von Nischenmärkten. Selbst die Wissenschaft hat sich vom
Stigma einer scheinbar bedeutungslosen „Orchideen“Forschung befreit. Doch noch immer dauert es in der Regel zu lange, bis korrekte Diagnosen gestellt werden, zu selten sind wirksame Therapiemöglichkeiten – trotz der großen Fortschritte in der Entwicklung von Orphan Drugs. Patientinnen und Patienten benötigten eine umfassende und spezialisierte Versorgung. Das heißt: Auch weiterhin sind gemeinsames Handeln und eine verbesserte Koordination aller Akteure des Gesundheitswesens gefordert!
Nadine Effert Chefredakteurin
IMPRESSUM
Projektmanagement Myriam Krämer, myriam.kraemer@reflex-media.net Redaktion Nadine Effert , Tobias Lemser Layout Silke Schneider, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / Lucky Kristianata Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Nadine Effert , redaktion@reflex-media.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www.reflex-media.net Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 28. Februar 2025 im Handelsblatt. Der Reflex Verlag und die Handelsblatt Media Group & Co. KG sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
UNSERE NÄCHSTE AUSGABE


Saventic Health GmbH 3 Deutscher Platz 5 c 04103 Leipzig www.saventiccare.de
Light for the World – Licht für die Welt e. V. 4 Ridlerstraße 31 a 80339 München www.light-for-the-world.de
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e. V. 5 c/o DRK Kliniken Berlin | Mitte Drontheimer Straße 39 13359 Berlin www.achse-online.de
Kinder- und Jugendhospizstiftung
Balthasar 6 Maria-Theresia-Straße 42 a 57462 Olpe www.kinderhospiz.de
Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH 7 Sonnenstraße 19 80331 München www.vrtx.com/de-de/
BioCryst Pharma Deutschland GmbH 10 Unicorn Workspaces Rosenheimer Straße 116 81669 München https://biocryst.de
Dr. Falk Pharma GmbH 11 Leinenweberstraße 5 79108 Freiburg https://de.drfalkpharma.com/de/ Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen 12 Johanniterstraße 1 14929 Treuenbrietzen www.johanniter.de/johanniterkliniken/johanniter-krankenhaustreuenbrietzen
Deciphera Pharmaceuticals (Germany) GmbH 13 Maximilianstraße 35 a 80539 München www.deciphera.com


LEBEN MIT KREBS



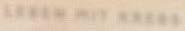

Leben mit Krebs Jährlich erhalten eine halbe Million Menschen in unserem Land die erschütternde Diagnose Krebs. Doch inmitten der Herausforderung gibt es Hoffnung. Fortschritte in der Früherkennung, Forschung und Behandlung eröffnen neue Wege. Der Reflex Verlag klärt über aktuelle Entwicklungen auf und zeigt, wie sich Lebensqualität erhalten lässt.
Lesen Sie dazu heute mehr im Handelsblatt.
JETZT SCANNEN Unsere Ausgaben finden Sie auch auf unserem Reflex-Portal: www.reflex-portal.de
Stiftung lichterzellen 14 Oppenheimstraße 11 50668 Köln www.lichterzellen.de
Stiftung AtemWeg 16 Max-Lebsche-Platz 31 81377 München www.stiftung-atemweg.de
Für eine Welt ohne Lungenkrankheiten!



„Luft ist der Sto , den wir am dringendsten zum Leben brauchen. Und unsere Lunge ist das Organ, das uns diese Luft schenkt. Das vergessen wir leider viel zu oft. Umso dringender brauchen wir Aufklärung über chronische Lungenkrankheiten und ihre Behandlung.“
Stiftungsbotschafter Roland Kaiser
AtemWeg
Stiftung für Lungengesundheit
Spendenkonto: Münchner Bank
IBAN DE37 7019 0000 0000 6500 64
BIC GENODEF1M01
www.stiftung-atemweg.de info@atemweg-stiftung.de 089 - 31 87 21 96
