
Lesen Sie heute auch

GRUSSWORT


Lesen Sie heute auch

GRUSSWORT
Lange Zeit war Deutschland weltweit für seine Innovationskraft bekannt – in der Automobilindustrie und im Maschinenbau galt „Made in Germany“ als Prädikat. Zuletzt allerdings hat die wirtschaftliche Strahlkraft der deutschen Volkswirtschaft ganz schön gelitten. Heraus forderungen wie Fachkräftemangel und Bürokratie, Energiekrise, Lieferkettenprobleme und internationale Konkurrenz machten und machen den deutschen Unternehmen zu schaffen – und für sie braucht es neue Antworten. Doch es gibt Hoffnung: Gezielte Förderprogramme für Innovationen und neue Technologien, mutige Start-ups und nicht zuletzt das von Union und SPD

geplante Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Wirtschaft bergen das Potenzial, der deutschen Wirtschaft neuen Anschub zu verleihen und den Erfindergeist im Land der Dichter und Denker neu zu erwecken. In dieser Beilage beleuchten wir, wie neue Technologien die Wettbewerbsfähigkeit stärken und welche Rolle Kooperationen dabei spielen. „Innovationsland Deutschland“ zeigt, wie Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gemeinsam den Standort sichern können. Mit Mut, Engagement, Entschlossenheit und Kreativität können auf allen Ebenen wichtige Impulse gesetzt werden, um Deutschland nach vorn zu bringen.
Michael Gneuss Chefredakteur
LEITARTIKEL
TECHNOLOGIE
MITTELSTAND
INHALTSVERZEICHNIS
Erfindergeist neu entdecken — 3
KI trifft Maschine — 5 Wo gute Ideen entstehen — 6
JETZT SCANNEN
Lesen Sie spannende Artikel dieser Ausgabe online, und sichern Sie sich ein kostenfreies Digital-Abo www.unternehmensfuehrung-info.de www.reflex-portal.de
Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.

Das Papier dieser Reflex-Verlag-Publikation stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
Folge uns auf Instagram, und verpasse keine Ausgabe mehr.

@reflexverlag
LEITARTIKEL
| VON MICHAEL GNEUSS UND KATHARINA LEHMANN
Deutschland gilt als Land der Erfinder – doch in letzter Zeit behindern Wirtschaftsflaute, Fachkräftemangel, politische Unwägbarkeiten und Bürokratie den Entdeckergeist von Forschenden und Unternehmern. Nun gilt es, zügig zurück in die Innovationsspur zu finden – und neue Ideen auch in marktfähige Produkte und Technologien zu verwandeln. Denn nur so sichern die Innovationen von heute die Wirtschaftskraft von morgen.
Es ist ein Paradox: Deutsche Forscher und Unternehmer erfinden die Zukunft, das Geschäft aber machen andere. Beispiel Chatbots: Während Forscher der Uni Kaiserslautern bereits 2008 Chatbot-Prototypen entwickelten,
Unsere Wettbewerbsfähigkeit hängt im Kern von unserer Innovationsfähigkeit ab.
streichen heute US-Konzerne die Gewinne ein. Und das ist kein Einzelfall. Vielmehr wiederholt sich dieses Muster immer wieder – ob bei Kleinbildkameras, mRNA-Technologie oder Softwareanwendungen: Deutsche Wissenschaftler liefern oft die Grundlagen, während US-Unternehmen mit mehr Risikokapital, besserem Zugang zu Märkten und aggressiverem Marketing die großen Gewinne einfahren.
Klar ist: Erfindergeist und Innovationskraft gehören zur DNA der deutschen Wirtschaft. Allerdings hat die Innovationskraft zuletzt aus vielfältigen Gründen nachgelassen, und dies besorgt Unternehmer wie Wirtschaftsforscher gleichermaßen. „Unsere Wettbewerbsfähigkeit hängt im Kern von unserer Innovationsfähigkeit ab“, sagt Siegfried Russwurm, bis 2025

Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). „Die Unternehmen investieren in Innovation, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“ Dazu gehören für Russwurm niedrigere Energiepreise, effiziente Verwaltungsverfahren und wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern. Ebenso wichtig sind für ihn mutige Schwerpunktsetzungen bei der staatlichen Finanzierung von Forschung und Entwicklung, bessere Start-upBedingungen und eine kluge Annäherung von ziviler und militärischer Forschung. Doch bei all dem hapert es hierzulande gegenwärtig.
Vize-Europameister bei Patenten Dabei hat Deutschland nach wie vor gute Voraussetzungen, Innovationstreiber zu sein: Gemäß der QS World University Rankings hat kein Land so viele Hochschulen unter den 1.300
„So bekommen Sie mehr qualifizierte Bewerbungen”
Der Fachkräftemangel setzt vielen Branchen immer stärker zu. PhDr. Oliver Scharfenberg, wissenschaftlicher Beirat des DIQP e. V., teilt fünf praxisnahe Erfolgsfaktoren, mit denen Unternehmen sich auch künftig über eine stabile Zahl qualifizierter Bewerbungen freuen können.
1. Sie sollten als Arbeitgeber als Erstes definieren, wer Ihre potenziellen Bewerberinnen und Bewerber sind. Wenn Sie wissen, wie genau Ihre Zielgruppe aussieht, ist auch klar, wo Sie diese erreichen

können. Sei es zum Beispiel auf Facebook, TikTok, YouTube oder zum Beispiel auf LinkedIn.
weltweit angesehensten Universitäten der Welt wie Deutschland. Auch die Wirtschaft ist noch immer innovativ: Erfinderinnen und Erfinder aus Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr als 25.000 Patente in Europa angemeldet – das sind etwas mehr als im Vorjahr. Nach den Daten des Europäischen Patentamts haben nur die USA noch mehr Patente angemeldet. Selbst Japan und China lassen sich in Europa weniger Erfindungen schützen als die Deutschen. Und das, obwohl viele Mittelständler aus dem Bundesgebiet ihre Innovationen gar nicht erst anmelden, um den Wettbewerbern keine Hinweise zu geben.
Der aktuelle Innovationsindikator des BDI und der Unternehmensberatung Roland Berger dokumentiert indes einen langsamen
2. Bauen Sie eine authentische Arbeitgebermarke auf. Zeigen Sie potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, wer Sie sind. Lassen Sie Ihr Team in authentischer Weise von Ihnen als Arbeitgeber berichten. Geben Sie einen glaubwürdigen Einblick in den Arbeitsplatz und das Team.
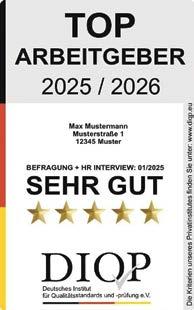
3. Befragen Sie die Beschäftigten regelmäßig nach deren Zufriedenheit. Kommunizieren Sie die Ergebnisse, und lernen Sie aus dem
Feedback. Gehen Sie auf die Wünsche der Beschäftigten so weit wie möglich ein.
4. Verschaffen Sie sich mehr Sichtbarkeit und Unterscheidbarkeit von anderen Arbeitgebern.
5. Zeigen Sie die Zufriedenheit der Beschäftigten mit einer Auszeichnung wie „Top Arbeitgeber“ oder „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ des DIQP. www.diqp.eu
Abstieg. Deutschland belegt in diesem Ranking nur Platz 12 von 35 Staaten und büßt damit gegenüber dem Vorjahresbericht zwei Plätze ein. Zwar sei die deutsche Wirtschaft stark in Forschung und Entwicklung, aber es gebe Schwächen bei der Umsetzung, so das Fazit der Studie.
Die Studie benennt aber auch einige deutsche Stärken. Besonders bei Technologien für die Kreislaufwirtschaft (Platz 1), innovativer Produktionstechnologie (Platz 2) sowie Energietechnologien (Platz 3) schneiden wir gut ab. Dagegen sind Platz 10 in der digitalen Vernetzung und Platz 17 bei Biotechnologie lediglich Mittelmaß. Insgesamt erreicht die Bundesrepublik in der Kategorie Schlüsseltechnologien erneut Platz 7. In Sachen nachhaltiges Wirtschaften nahm Deutschland hinter Dänemark und Finnland erneut Platz 3 ein. Nach einer deutlichen Steigerung in diesem Metier zwischen 2010 und 2020 zeigt sich aber auch hier eine Stagnation.
Stärken in der Wissensgenerierung Unter dem Strich vermittelt der Innovationsindikator durchaus Hoffnung: insbesondere weil Deutschland im Teilprozess Wissensgenerierung die höchste Punktzahl erreicht. Hier wirken die Bemühungen der Innovationspolitik, Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) zu erhöhen: 2017 wurde das Ziel von 3,0 Prozent des BIP erreicht, für 2025 gelten 3,5 Prozent als Ziel.
Der beharrlich im Raum stehende Vorwurf, Deutschland sei schlecht im Transfer von Wissen in Innovationen, findet sich aber auch in der Analyse von BDI und Roland Berger wieder. Grundsätzlich gibt es dafür mehrere Ursachen, die aber eng miteinander verknüpft sind. Ein zentrales und zunehmendes Problem ist heute der Fachkräftemangel: Viele Unternehmen und vor allem Start-ups finden nicht ausreichend

In Deutschland herrscht Mangel an hoch qualifizierten Fachkräften.
qualifizierte Mitarbeiter – insbesondere in den Bereichen Technologie und Digitalisierung. Hinzu kommt, dass die Wagniskapitalinvestitionen in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin relativ niedrig sind. Gründern fällt es oft schwer, risikofreudige Investoren zu finden, die bereit sind, junge Unternehmen mit innovativen, aber noch unsicheren Geschäftsmodellen zu unterstützen. Auch die staatliche Förderung von betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten fällt im internationalen Vergleich eher gering aus. Zwar existieren Förderprogramme, doch diese sind häufig komplex und bürokratisch, was den Zugang erschwert und die Innovationsdynamik hemmt.
Hoffnungen auf das Sondervermögen
Ein zentrales Element für den Innovationsschub kann das geplante 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen sein, das gezielt in Infrastruktur,
Innovationsfähigkeit: Ranking und Indexwerte der Volkswirtschaften
Rang Volkswirtschaft
1 Schweiz
2 Singapur
3 Dänemark
4 Schweden
5 Irland
6 Finnland
7 Belgien
SCHON GEWUSST?
Digitaler Wandel, Energiewende, KI –Innovationen in Zukunftstechnologien brauchen Experten. Aber gerade an diesen mangelt es immer mehr, beklagen Unternehmen. So gaben in einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unter 15.000 Firmen insgesamt 84 Prozent an, derzeit vom Fachkräftemangel betroffen zu sein. Zwei von drei Betrieben bezweifeln gar, dass sie in Zukunft überhaupt ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen können. „Die Fachkräftesicherung hat in den Betrieben eine große Bedeutung“, so IABForscher Dr. Christian Hohendanner. Weiterbildungsangebote und Personalentwicklung, aber auch attraktive Arbeitsbedingungen halten etwa die Hälfte der Betriebe für geeignete Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.
Digitalisierung, Forschung und Bildung investiert werden soll. Diese Mittel müssen klug eingesetzt werden: vorrangig in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Modernisierung von Forschungseinrichtungen und die Förderung von Zukunftstechnologien. Wie eine Allensbach-Umfrage für den BDI zeigt, halten 70 Prozent der Führungskräfte die Sanierung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur für „sehr wichtig“, um die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft langfristig zu sichern.
Um das Innovationsland Deutschland wieder auf Kurs zu bringen, wird es aber nicht reichen, Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren. Entscheidend ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen, Innovationsprozesse entbürokratisiert werden und eine Kultur entsteht, die Risikobereitschaft, Kreativität und unternehmerischen Mut als zentrale Werte begreift. Nur dann kann Deutschland seine Innovationskraft nicht nur erhalten, sondern auch in wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Fortschritt ummünzen.
TECHNOLOGIE | VON JENS BARTELS
Generative KI-Anwendungen sind im wirtschaftlichen Alltag der Bundesrepublik angekommen. Und die bergen große Potenziale für den Standort: Unternehmen können durch den gezielten Einsatz dieser innovativen Lösungen die Produktivität steigern, Kosten reduzieren und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
In deutschen Chefetagen mangelt es an ausreichender Kompetenz im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (KI). So nutzen laut einer Studie von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut derzeit lediglich 26 Prozent der befragten Unternehmen solche Anwendungen
Deutschland ist im europäischen Vergleich stark, aber nicht führend.
explizit auf Vorstandsebene – ein Indiz dafür, dass immer noch zu oft zu wenig strategisch gehandelt wird. Zudem gehen zwei Drittel der Führungskräfte selbstkritisch davon aus, dass Entscheider ohne fundiertes KI-Verständnis mittelfristig aus den Führungsetagen verdrängt werden. Gleichzeitig erwarten 52 Prozent, dass
künftig vor allem Geschäftsmodelle dominieren, die vollständig auf generativer KI basieren.
Mehr Investitionen nötig Klar muss also sein: KI-Anwendungen verändern die Arbeitswelt der Zukunft und bieten für die Wirtschaft ganz unterschiedliche Chancen. Schon heute sorgen zum Beispiel die Erstellung digitaler Zwillinge von Bestandsanlagen mithilfe generativer KIgestützter Assistenten in der Pharmaproduktion oder die Gestaltung kritischer Geschäftsprozesse mit generativer KI für Effizienzsteigerungen, geringere Kosten und erhöhten Kundennutzen. Dabei ist Deutschland bei diesem Thema zumindest im europäischen Vergleich ein zentraler Player. Allerdings sind die Investitionen in künstliche Intelligenz, gemessen an der Bevölkerungsgröße in Deutschland, laut einer Analyse des Beratungsunternehmens Prognos deutlich geringer als in anderen europäischen Staaten, wie etwa in der Schweiz, in Finnland, Norwegen oder Irland.
Bürokratische Hürden abbauen

Dennoch gibt es in Deutschland viele etablierte Unternehmen aus dem Mittelstand und der Industrie oder Forschungseinrichtungen
Die Welt der Lieferkettenlösungen hat sich nach der Pandemie grundlegend verändert. Der E-Commerce boomt, das Zusammenspiel von Mensch und Software rückt im Lagerbetrieb ins Zentrum, Kunden erwarten Lieferungen über Nacht. Lieferketten müssen heute widerstandsfähiger sein denn je. Die KION Group erläutert, wie mithilfe von Physical AI komplexe Lager- und Lieferkettenprozesse virtuell abgebildet werden können, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Ziel ist es, durch digitale Zwillinge und simulationsbasierte Szenarien die effizienteste und sicherste Konfiguration eines Warenlagers zu ermitteln.
In einer Welt, in der sich Handelsströme, Lieferketten und Logistikzentren ständig verändern, sind Unternehmen gefordert, flexibel und vorausschauend zu agieren. Der Einsatz von Physical AI eröffnet neue Möglichkeiten: Mit ihrer Hilfe lassen sich reale Handlungsoptionen in Warenlagern nicht nur
wie die Fraunhofer-Institute, die der internationalen KI-Community wichtige Impulse geben. Diese Akteure arbeiten bereits in vielen Bereichen zu KI und haben das Potenzial, die Breite der deutschen Wirtschaft etwa beim Thema Robotik zum internationalen Vorreiter zu machen. Allerdings müssen dafür in Zukunft bürokratische Hürden abgebaut, der Fachkräftemangel adressiert und die digitale Infrastruktur weiter verbessert werden, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen.

simulieren, sondern auch gezielt optimieren – für mehr Resilienz, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Effizientere Projektplanung Besonders relevant wird das vor dem Hintergrund bisheriger Prozesse: Klassische Automatisierungslösungen brauchen oft vier bis fünf Jahre – von der ersten Planung bis zur finalen Inbetriebnahme. Durch den Einsatz digitaler Zwillinge verkürzt sich dieser Prozess drastisch. Kunden können unzählige Szenarien digital durchspielen, ideale Layouts für neue Warenlager definieren und
fundierte Entscheidungen treffen – bevor eine einzige Schraube verbaut ist.
Sicherheit durch Vernetzung Ein weiterer entscheidender Vorteil von Physical AI ist die erhöhte Sicherheit. Durch die präzise Sensorik im Lager wird eine lückenlose Kontrolle des gesamten Systems ermöglicht. Potenzielle Gefahren können so frühzeitig erkannt und automatisch Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Diese intelligente Vernetzung sorgt nicht nur für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Robotern, Maschinen und
Menschen, sondern schützt auch die Mitarbeitenden und Anlagen.
Mit Physical AI schaffen Unternehmen smarte, agile und resiliente Lagerlösungen, die sich den Bedingungen des Markts dynamisch anpassen. Kunden können so nicht nur auf die wachsende Komplexität in der Branche reagieren, sondern die Zukunft mitgestalten.
MEHR INFORMATIONEN
Physical AI: neue Möglichkeiten durch digitale Zwillinge Physical AI bietet Unternehmen die Möglichkeit, reale Handlungsoptionen in ihrer Lieferkette zu simulieren und in Echtzeit zu optimieren. Digitale Zwillinge fungieren dabei als Steuerzentrale und Vorlage für ihre physischen Gegenstücke. In Kombination mit der Fähigkeit, eine unbegrenzte Anzahl an Szenarien durchzuspielen, lassen sich Layouts neuer Lagerumgebungen effizient planen und bestehende Strukturen dynamisch verbessern – bei gleichzeitig sinkendem Kapital- und Betriebsaufwand.
MITTELSTAND | VON JENS BARTELS
Innovationen verbessern den Einsatz von Ressourcen und führen zu besseren Produkten und Dienstleistungen. Sie zählen daher zu den wichtigen Stellschrauben, um sich am Markt zu positionieren und im Wettbewerb bestehen zu können. In Deutschland sind große Mittelständler in diesem Feld deutlich umtriebiger als kleine Unternehmen.
Die Innovationstätigkeit im deutschen Mittelstand entwickelt sich immer stärker auseinander. 76 Prozent der großen Mittelständler mit 50 oder mehr Beschäftigten haben in den vergangenen drei Jahren eine Produktinnovation hervorgebracht. Damit stieg der Anteil der Innovatoren im Vergleich zu dem Zeitraum von 2020 bis 2022 um fünf Prozentpunkte und erreichte wieder genau das Niveau zu Beginn der Coronakrise. Bei kleinen Unternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten dagegen waren es zwischen 2021 und 2023 nur 35 Prozent. Der Anteil sank im Vergleich zu 2020 bis 2022 um einen Prozentpunkt, im Vergleich zu 2018 und 2020 sogar um vier Prozentpunkte. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Sonderauswertung im Rahmen des KfW-Mittelstandspanels.
Zunehmende Konzentration
Die aktuelle Entwicklung stellt die Fortsetzung eines Trends dar, der seit Mitte des vorletzten Jahrzehnts zu beobachten ist: Vor allem kleine Unternehmen sowie solche ohne eigene Forschung und Entwicklung bringen immer seltener Innovationen hervor. Konstant hohe Innovationsausgaben bei einer geringeren

Anzahl an innovativen Unternehmen bedeuten gleichzeitig aber auch eine zunehmende Konzentration auf wenige Unternehmen: Bereits
Unternehmen ohne eigene Forschung und Entwicklung bringen immer seltener Innovationen hervor.
heute erbringen die zwei Prozent der größten mittelständischen Unternehmen 56 Prozent der Innovationsausgaben im Mittelstand. Viele der großen Mittelständler sind übrigens
„Innovatives Risikomanagement für den Mittelstand“
Wie kann sich der Mittelstand heute verlässlich absichern –spartenübergreifend, zukunftsorientiert und mit minimalem Verwaltungsaufwand? Stephan Geis, Managing Director Germany bei HDI Global SE, erklärt die besonderen Anforderungen mittelständischer Unternehmen an ihren Versicherungspartner – und warum ein ganzheitlicher Blick entscheidend ist.

Herr Geis, warum benötigen mittelständische Unternehmen einen besonderen Versicherungsschutz? Mittelständische Unternehmen sind oft spezialisiert, flexibel aufgestellt und international tätig. Sie sind zudem häufig familiengeführt mit teils jahrhundertealter Tradition. Das macht ihre Risikoprofile besonders komplex, vielseitig und interessant. Einzelne Bereiche isoliert zu betrachten, greift deshalb zu kurz: Erst das intelligente Zusammenspiel aller Sparten schafft einen wirkungsvollen Schutz. Dies gilt insbesondere für Betriebsunterbrechungen – denn die daraus resultierenden finanziellen Folgen sind oft gravierender und schmerzhafter als bei börsennotierten Konzernen.
Wie gelingt es, solche Risiken im Blick zu behalten und abzusichern? Unser Fokus liegt auf systematischer Risikoanalyse. Bei HDI Global prüfen unsere
Zahlreiche Innovationen kommen aus dem Mittelstand.
Familienbetriebe mit einer hohen Bedeutung für ihre jeweilige Heimatregion.
Erfolgsgarant Hidden Champion Zum großen Mittelstand zählen auch die Hidden Champions, die global tätig sind und in ihrer jeweiligen Branche zu den Weltmarktführern zählen, obwohl sie keine Konzerne sind. Ein wesentlicher Grund für die besondere Marktstellung der Hidden Champions sind ihre häufig verfolgten Internationalisierungsstrategien, Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung sowie ihr Fokus auf die Entwicklung innovativer Produkte und Prozesse. Um ihre Marktführerschaft auch künftig zu behaupten, werden sie darauf angewiesen sein, Anwendungen der KI in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren.
Underwriting-Experten und Risikoingenieure die Risikosituation auf Wunsch direkt vor Ort, bewerten Gefahren realistisch und schaffen eine verlässliche Grundlage für den notwendigen Versicherungsschutz. Auf Basis dieser Wertermittlung vermeiden wir Unterversicherung und entwickeln spartenübergreifende Konzepte, die zu den tatsächlichen Gegebenheiten im Unternehmen passen. Dies ist besonders wichtig, da im Mittelstand oft nur ein eingeschränktes Risiko-Management vorhanden ist.
Welche Rolle spielen neue Bausteine wie ESG-Mehrkostenblöcke? Nachhaltigkeit und soziale Leistungsindikatoren bewegen viele mittelständische Unternehmen. Im Schadenfall soll nicht nur ersetzt, sondern nachhaltig, resilient und zukunftsorientierter wiederaufgebaut werden. Deshalb bieten wir ergänzende Leistungen wie klimaangepassten
Wiederaufbau, Biodiversitätsmaßnahmen oder ESG-Beratung. Bei HARIS focus etwa, unserer Sach-/Ertragsausfall-Lösung für den Mittelstand, haben wir gezielt ESG-Mehrkostenblöcke integriert, um diese Investitionen zu fördern.
Welche Innovationen sehen Sie bei Versicherungslösungen für den Mittelstand? Die Notwendigkeit maßgeschneiderter Lösungen für den Mittelstand hat klar zugenommen. Ob Sach-, Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Transport- oder Technische Versicherungen: In allen Kernsparten bieten wir innovative und passgenaue Konzepte an. Unser globales Expertennetzwerk in über 175 Ländern ermöglicht zudem konsistenten, lokal angepassten Versicherungsschutz aus einer Hand – ohne Schnittstellenprobleme oder Deckungslücken. http://www.hdi.global/mittelstand
Deutschland war einst bekannt als das Land der Ingenieure, Erfinder und Pioniere. Das Qualitätssiegel „Made in Germany“ stand weltweit für Innovation und Zuverlässigkeit. Doch in den letzten Jahren hat sich das Bild gewandelt. Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten bremsen die Wettbewerbsfähigkeit.
Was also ist der Grund für den Rückstand? Deutschland hat sich lange auf seinen Erfolgen ausgeruht – nun rächt sich dieser Stillstand. Der bürokratische Aufwand ist hoch, die Digitalisierung kommt nur schleppend voran, und Genehmigungsverfahren dauern oft viel zu lange. Auch die Konkurrenz schläft nicht: Länder wie China und die USA investieren massiv in Forschung und Entwicklung, während Deutschland in Bürokratie und Regularien erstarrt.
Unternehmensberatung, zeigt in ihrem aktuellen Benchmark-Bericht, dass Länder wie Australien und Kanada hier deutlich effizienter aufgestellt sind. Die Prozesse sind einfacher, die Beantragung weniger bürokratisch und die Förderquoten höher.
Deutschland hat mit der Erhöhung der Forschungszulage auf 35 Prozent (für KMU) ein Zeichen gesetzt, doch es braucht mehr. Vor allem IP-Box-Regelungen, die in Ländern wie Italien, Belgien und Portugal enorme steuerliche Vorteile für geistiges Eigentum bieten, fehlen hierzulande komplett. Hier besteht akuter Handlungsbedarf.
Ayming als Fördermittelspezialist
Der Prozess bei Ayming sieht folgendermaßen aus: Am Anfang wird das Vorhaben der Kunden ganz genau analysiert. Ist die Beantragung von
„Wir befinden uns im größten Transformationsprozess der Nachkriegsgeschichte. Unternehmen sollten alle Möglichkeiten nutzen, Förderpotenziale auszuschöpfen.“
Patrick Lerner
Die gute Nachricht ist: Die strukturellen Voraussetzungen sind in Deutschland nach wie vor stark – es fehlt jedoch an Effizienz. Eine Chance sind die über 1.500 verschiedenen Programme, die Unternehmen zur Verfügung stehen. Der Zugang hierzu ist jedoch komplex. Es braucht klare Strategien, um Fördermittel gezielt einzusetzen und Bürokratie abzubauen.
Förderprogramme als Innovations-Booster Fördermittel sind ein oft unterschätztes Instrument, das Unternehmen nicht nur entlasten, sondern auch Innovationen vorantreiben kann. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten können sie den entscheidenden Unterschied machen. Relativ neu in Deutschland ist die Forschungszulage, mit der KMU beispielsweise bis zu 3,5 Millionen Euro jährliche Förderung erhalten können. Das ist schon relevant. Ayming, eine internationale
Fördermitteln sinnvoll, begleitet Ayming durch den gesamten Prozess von A bis Z. Konkret bedeutet das: Formulierung des Förderantrags und ganzheitliche Unterstützung auch bei nachgelagerten Schritten wie dem notwendigen Schriftverkehr mit dem Finanzamt. Grundsätzlich arbeitet Ayming erfolgsabhängig, eine Rechnungsstellung erfolgt nur bei positivem Bewilligungsbescheid. Das minimiert das finanzielle Risiko für das auftraggebende Unternehmen enorm.
Aymings Mitarbeitende sind ausgebildete Expert:innen in spezifischen Branchen, so zum Beispiel Ingenieur:innen, Biolog:innen, Chemiker:innen oder Informatiker:innen mit mehrjähriger Erfahrung in den jeweiligen Förderthemen. Durch umfangreiche Kenntnisse der Geschäftsmodelle und Branchenthemen begegnen sie ihren technischen Ansprechpartner:innen auf Augenhöhe.

Innovation als Schlüssel für „Made in Germany“ Um das Qualitätssiegel „Made in Germany“ auch in Zukunft als Garant für Spitzenleistungen zu etablieren, müssen Unternehmen strategischer planen. Förderprogramme müssen genutzt, digitale Innovationen vorangetrieben und neue Technologien entwickelt werden. Es reicht nicht mehr, nur auf traditionelle Stärken zu setzen – es braucht einen Innovationsschub.
Fazit: Vom Verwalter zum Gestalter Deutschland hat alle Voraussetzungen, um den Wandel zur modernen Innovations-Nation zu schaffen. Doch dafür müssen Bürokratie abgebaut, Förderprogramme vereinfacht und neue Technologien stärker gefördert werden. Die hervorragenden Chancen vieler Unternehmen auf staatliche Förderung sollten wahrgenommen werden. Mit dem richtigen Partner gelingt das auch ohne großen Aufwand und Bürokratie. Es ist Zeit für Optimismus und eine „Hands-on Mentality”. Nur so kann „Made in Germany” auch in Zukunft ein Gütesiegel für Qualität und Innovation sein.
ÜBER AYMING
Ayming ist ein internationaler Spezialist für Fördermittel und Innovationsförderung. Mit der Erfahrung von über 35 Jahren hat die Unternehmensberatung gezielte Expertise im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsförderung. Über 1.600 Mitarbeitende in 14 Ländern weltweit unterstützen Unternehmen dabei, ihr volles Förderpotenzial auszuschöpfen.

Mehr Informationen zur Forschungszulage finden Sie auf unserer Website.

www.ayming.de
Zu den Innovationsmotoren eines Landes gehören Start-ups. Sie bringen frische Ideen, Tempo und Mut ins System und zeigen, dass Wirtschaftswachstum nicht nur aus Tradition, sondern vor allem aus Neugier und der Lust am Neuen entsteht. In Deutschland flossen im vergangenen Jahr laut dem Start-up-Barometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY mehr als sieben Milliarden Euro in junge Unternehmen – 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das ist zweifelsohne eine gute Nachricht. Zur Wahrheit gehört
aber auch: 2022 sammelten deutsche Start-ups bereits 9,8 Milliarden Euro Wagniskapital ein, im Rekordjahr 2021 waren es gar 17,3 Milliarden. Und auch das sind im internationalen Vergleich noch überschaubare Summen. Für dieses Jahr wird erwartet, dass Venture-Capital-Gesellschaften weltweit 260 Milliarden Dollar investieren. Davon entfallen allein mehr als 140 Milliarden auf die USA. Es wäre wünschenswert, wenn auch Gründer im Innovationsland Deutschland mehr Unterstützung bekämen.
Michael Gneuss Chefredakteur
IMPRESSUM
Projektmanagement Laura Colantuono, laura.colantuono@reflex-media.net
Redaktion Jens Bartels, Michael Gneuss, Katharina Lehmann Layout Silke Schneider, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / bestofgreenscreen Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Michael Gneuss, redaktion@ reflex-media.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@ reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www.reflex-media.net Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 21. Mai 2025 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Reflex Verlag und die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
JETZT SCANNEN
Unsere Ausgaben finden Sie auch auf unserem Reflex-Portal: www.reflex-portal.de
SQC-QualityCert GmbH 3
Bessemerstraße 82 12103 Berlin www.sqc-cert.de
KION GROUP AG 5
Thea-Rasche-Straße 8 60549 Frankfurt am Main www.kiongroup.com/de
HDI Global SE 6
HDI-Platz 1 30659 Hannover www.hdi.global
Ayming Deutschland GmbH 7
Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf www.ayming.de