DEUTSCHLANDS INFRASTRUKTUR
Wohin mit 500.000.000.000 Euro?














GRUSSWORT

Wohin mit 500.000.000.000 Euro?














GRUSSWORT
Nach Jahren, in denen die Haushaltsdisziplin an erster Stelle stand und der Infrastruktur des Landes dringende Investitionen vorenthalten wurden, ist mit dem 500 Milliarden schweren Sondervermögen ein Gesinnungswandel eingekehrt. Die Wirtschaft sehnt sich seit Langem nach solchen Impulsen. Die Hoffnung kehrt zurück, dass wir wieder – zumindest zu leichtem – Wirtschaftswachstum zurückfinden. Allerdings sind vielfach und wohl auch zu Recht mahnende Worte

zu vernehmen. Zuallererst: Wer so viel Geld, das im Haushalt eigentlich gar nicht da ist, in die Hand nimmt, muss dafür Sorge tragen, dass es auch so wie beabsichtigt ausgegeben wird. Sinnvolle Projekte für die Modernisierung oder den Ausbau der Verkehrs-, Bau-, Energie- oder DigitalInfrastruktur gibt es zuhauf. In dieser Publikation wollen wir Ihnen veranschaulichen, womit unsere Wettbewerbsfähigkeit, aber auch unsere Lebensqualität, verbessert werden kann.
Michael Gneuss Chefredakteur
LEITARTIKEL
WOHNUNGSBAU
BAUINFRASTRUKTUR
DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN
DIGITALE INFRASTRUKTUR
INHALTSVERZEICHNIS
Die 500-Milliarden-Frage — 3
Neue Häuser braucht das Land — 6
Baustelle Deutschland — 7
Mit Daten heilen — 9
Bessere Netze, bessere Chancen — 10
JETZT SCANNEN
Lesen Sie spannende Artikel dieser Ausgabe online, und sichern Sie sich ein kostenfreies Digital-Abo
www.bauindustrie-info.de www.energieratgeber-info.de www.reflex-portal.de
Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.

Das Papier dieser Reflex-Verlag-Publikation stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
Folge uns auf Instagram, und verpasse keine Ausgabe mehr.

@reflexverlag
LEITARTIKEL
| VON MICHAEL GNEUSS
Das Infrastrukturpaket der Bundesregierung soll Deutschland modernisieren. Doch ob das viele Geld für Straßen, Schienen, Netze und Wohnungsbau reichen und klug eingesetzt wird, ist noch nicht ausgemacht. Klar ist: Ohne bessere Planung und klare Prioritäten wird sich der Investitionsstau nicht auflösen.
Viel Geld weckt viele Ansprüche. Die Deutsche Bahn hat vorgerechnet, dass sie bis 2034 rund 290 Milliarden Euro für die Erneuerung ihrer Infrastruktur benötigt. Das Bundesverkehrsministerium kalkuliert mit 140 Milliarden Euro allein für den Erhalt der Bundesstraßen. Zusammengenommen wäre damit schon ein Großteil des 500-Milliarden-Infrastrukturpakets verplant – und das nur für Schiene und Straße.
Großer Handlungsbedarf Angesichts der Berechnungen, die aktuell kursieren, schmilzt die zunächst so üppig anmutende Summe von einer halben Billion Euro ein ordentliches Stück dahin. Eine aktuelle Analyse der Beratungsgesellschaft „Strategy&“ beziffert die Infrastrukturlücke von 2025 bis 2035 auf 982,1 Milliarden Euro. Der gesamte Investitionsbedarf wird auf über 1,9 Billionen Euro geschätzt, während bislang nur 942 Milliarden Euro finanziert sind. Besonders groß ist der Rückstand bei den Kommunen: Ihnen fehlen 540 Milliarden Euro, mehr als die Hälfte der Lücke. Der Bund steht mit 344 Milliarden Euro im Minus, die Länder mit knapp 100 Milliarden Euro. Die Studienautoren untersuchten Schiene, Straße, Wasserwege, digitale Infrastruktur, Energienetze, Gebäude- und

Nun gilt es, die Mittel aus dem Sondervermögen sinnvoll und effizient einzusetzen.
Wohnungsbau sowie die militärische Infrastruktur. Ihr Fazit: Ohne dauerhaft höhere Investitionen bleibt der Rückstand bestehen.
Fehler vermeiden
Aber selbst das größte Sondervermögen hilft nur, wenn das Geld effizient verwendet wird. Hier mahnt die Vergangenheit: Ob BER, Elbphilharmonie oder Stuttgart 21 – Deutschland hat genug Beispiele für Großprojekte, die aus dem Ruder liefen. Planungsfehler, überlange Genehmigungsverfahren und Kostenexplosionen prägten das Bild. Ohne vereinfachte Verfahren, klare Zuständigkeiten und verbindliche Fristen droht auch das neue Milliardenpaket ins Stocken zu geraten. Hilfreich könnte die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor sein – in Form von gut organisierten Public-Private-Partnerships. Umstritten ist auch, dass die Länder
„Geld allein baut keine Infrastruktur”
Christian Strunk, Präsident des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO), über die Rolle von Kies, Sand, Schotter und Splitt für die Modernisierung Deutschlands.
Wie bewerten Sie das milliardenschwere Infrastrukturpaket der Bundesregierung? Die Richtung stimmt. Investitionen in Straßen, Brücken, Bahnlinien, Schulen oder Windräder sind Investitionen in die Zukunft der Bundesrepublik. Ohne die Verfügbarkeit von Kies, Sand und Hartgestein scheitern aber die angekündigten Milliardeninvestitionen an der Umsetzung. Klar muss also sein: Geld allein baut keine Infrastruktur.
Mangelt es an mineralischen Rohstoffen in Deutschland? Keineswegs. Geologisch gesehen, verfügen wir über ausreichende Vorkommen. Was fehlt, sind vielmehr pragmatische und verlässliche Genehmigungsprozesse. Für

Christian
Strunk,
Präsident des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO)
neue Gewinnungsprojekte liegt die Genehmigungsdauer teils bei über zehn Jahren. Das ist inakzeptabel. Viele Anträge liegen in Schubladen, blockiert durch überkomplexe Verfahren oder politisches Zögern auf Landes- und Kommunalebene. So entstehen regionale Engpässe und lange Transportwege quer durch das Land. Insgesamt gibt es also einen Genehmigungsmangel
weitgehend freie Hand bei der Verwendung ihrer 100 Milliarden Euro aus dem Paket erhalten sollen. Einem Gesetzentwurf zufolge dürfen die Länder die Mittel aus dem Bundespaket zwar
Ohne dauerhaft höhere Investitionen bleibt der Investitionsrückstand bestehen.
nicht in laufende Projekte umleiten. Doch neue Investitionen könnten sie künftig gezielt mit den Milliarden aus Berlin finanzieren. Generell ist das Risiko groß, dass die Gelder in Prestigeprojekte oder den Konsum fließen statt
und keinen Rohstoffmangel. Das schadet nicht nur der Bauwirtschaft, sondern ist auch ökologisch widersinnig.
Was müsste aus Ihrer Sicht passieren? Wir fordern bezüglich der Genehmigung neuer Flächen sowohl eine Änderung des Planungsrechts als auch eine klare Beschleunigung der Verfahren, ähnlich wie das bei großen Verkehrs- und Energieprojekten inzwischen möglich ist. Rohstoffsicherung ist Teil der Daseinsvorsorge und muss politisch auch so behandelt werden. Und wir brauchen eine klare Priorität im Planungsrecht für heimische Ressourcen als überragendes öffentliches Interesse. Eine auf Dauer tragfähige Infrastrukturpolitik kann nicht auf Rohstofflieferungen aus Übersee gründen.
Wie lässt sich das mit den Klimazielen vereinbaren? Sehr gut, wenn man regional denkt. Kurze
Transportwege, moderne Gewinnungstechnik und umfassende Rekultivierung senken Emissionen und stärken die regionale Akzeptanz. Aber dafür braucht es auch ein gesellschaftliches und politisches Bekenntnis, dass Rohstoffgewinnung Teil der Energiewende und einer Erneuerung der Infrastruktur ist. Rohstoffe sind das Fundament für diesen Wandel in unserem Land.
Wie hoch ist denn eigentlich aktuell der Bedarf an mineralischen Rohstoffen? Jährlich rund 500 Millionen Tonnen. Dafür stehen rund 1.600 mittelständisch geprägte Unternehmen, 2.700 Kiesgruben und Steinbrüche und mehr als 22.000 Beschäftigte bereit. Die Branche liefert, wenn man sie lässt. Dafür brauchen wir einen verlässlichen Rahmen, der Investitionen und Planungssicherheit ermöglicht. Jede Infrastrukturmaßnahme beginnt mit der Baggerschaufel. Das sollten wir politisch ernst nehmen.
in dringend nötige Infrastruktur. Möglich macht das auch die lange Laufzeit: Erst bis Ende 2029 muss ein Drittel der Gelder verbindlich in konkrete Maßnahmen gebunden sein, so der Gesetzesentwurf. Nordrhein-Westfalen darf übrigens über 21 Milliarden Euro verfügen, Bremen über 930 Millionen – mehr als doppelt so viel, wie der Stadtstaat sonst jährlich investiert. Eine der Fragen, die im Raum stehen: Wird das Sondervermögen zur Modernisierung oder zum Entlasten der Haushalte genutzt?
Neubau vorantreiben
Der Wohnungsbau ist ein besonders drängendes Feld für mehr Investitionen. Laut der Studie „Bauplan D 2030“ fehlen bundesweit mehr als 550.000 Wohnungen. 9,6 Millionen Menschen leben in überbelegten Wohnungen – 1,1 Millionen mehr als vor fünf Jahren. In Großstädten teilt inzwischen jeder Sechste sein Zuhause mit zu vielen Menschen. Allerdings steckt die Bauindustrie in einer Innovationskrise, und ohne
leistungsfähige Bauunternehmen kann ein schneller und effizienter Neubau nicht funktionieren. Laut PwC verliert der Sektor den digitalen Anschluss. So geht die Schere zwischen den theoretischen Möglichkeiten der Digitalisierung und den eigenen Fähigkeiten seit Jahren weiter auf. Deutlich zeigt sich hierbei das Auseinanderdriften von Potenzialen und Fähigkeiten bei IoT-Lösungen auf der Baustelle: 62 Prozent der befragten Unternehmen attestieren dieser Technologie große Chancen, jedoch nur zehn Prozent bringen starke Fähigkeiten in diesem Bereich mit. Auch bei Technologien zur Visualisierung und Simulation sowie bei KI-basierten Technologien klafft eine große Lücke zwischen Potenzial und Fähigkeiten. Ohne Modernisierung aber wird der Bau das Versprechen des Infrastrukturpakets kaum erfüllen können.
Chancen durch Digitalisierung
Auch die Energie- und Gesundheitsinfrastruktur warten auf Impulse. Der Aufbau der
Wie gut oder schlecht schätzen Sie in Deutschland die Qualität der Infrastruktur ein? Anteil der „gut/relativ gut“-Antworten in Prozent
„Wohnraum ist Infrastruktur – nicht Luxus”
Bernd Hertweck, Vorsitzender des Verbands der Privaten Bausparkassen, über notwendige politische Reformen für mehr Schwung im Eigentumserwerb und Wohnungsbau.
Wie schätzen Sie aktuell die Lage des Wohnungsbaus in Deutschland ein? Die Lage ist dramatisch. 2024 wurden nur noch rund 250.000 Wohnungen fertiggestellt – rund 100.000 zu wenig. Besonders alarmierend: Seit 2021 ist die Zahl der Baugenehmigungen im Eigentumssegment um 45 Prozent eingebrochen. Die Gründe: massiv gestiegene Baukosten, fehlende Planbarkeit und die für viele Menschen eingeschränkte Finanzierungsfähigkeit. Wohnen ist längst zur neuen sozialen Frage geworden.
Wie könnte in dieser Situation Geld aus dem Infrastrukturpaket weiterhelfen? Wohnraum ist gesellschaftliche Infrastruktur:

Bernd Hertweck, Vorsitzender des Verbands der Privaten Bausparkassen
ebenso relevant wie Straßen, Schienen oder digitale Netze. Deshalb ist es nur konsequent, Teile des milliardenschweren Infrastrukturpakets gezielt in die Schaffung von Wohnraum, die Wohneigentumsförderung und in die energetische Ertüchtigung des Wohnungsbestands fließen zu lassen. Der Sanierungsbedarf allein liegt laut Studien bei bis zu 66 Milliarden Euro jährlich.
SCHON GEWUSST?
Zukunft sichern: Mit dem eigenen Vermächtnis Gutes tun Staatliche Milliarden modernisieren Straßen, Schulen und Netze. Doch auch private Verantwortung zählt –zum Beispiel durch eine Nachlassspende. Jedes Testament kann Zukunft stiften: für Kinder, die Schutz, Bildung und Perspektiven brauchen. So wird aus individuellem Vermögen ein gesellschaftlicher Beitrag – sinnvoll, nachhaltig, menschlich.
Wasserstoffwirtschaft hinkt: Von zehn Gigawatt Elektrolyseleistung bis 2030 sind laut der dritten Ausgabe des Fortschrittsmonitors Energiewende erst 1,6 gesichert. Ohne schnellere Genehmigungen und klarere Rahmenbedingungen droht die Dekarbonisierung zu scheitern. Zudem fehlt es in der Gesundheitsversorgung an moderner Ausstattung und digitaler Vernetzung. Der Ausbau von Kliniken und Notfallstrukturen ist vielerorts überfällig. Nicht zuletzt gilt es, die digitale Verwaltung zukunftsfähig zu machen. Laut ifo-Institut entgehen Deutschland durch überbordende Bürokratie bis zu 146 Milliarden Euro pro Jahr. Allein der Anschluss an das Niveau Dänemarks bei der Digitalisierung würde die Wirtschaftsleistung um 96 Milliarden Euro jährlich erhöhen.
Das Ziel ist klar: Deutschland muss die Milliarden jetzt in echten Fortschritt verwandeln. Doch das gelingt nur mit Tempo, Transparenz und Mut zur Reform. Das Infrastrukturpaket ist eine historische Chance und ein Stresstest für den Modernisierungswillen des Landes. Es wird sich zeigen, ob Deutschland beim Bauen und Sanieren wirklich gelernt hat.
Welche politischen Reformen sind denn besonders dringend? Grundsätzlich geht es darum, dass Bauen wieder schneller und günstiger wird. Wir brauchen weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und verlässliche Regeln. Der Gebäudetyp E ist ein guter Ansatz, wenn er rechtssicher umgesetzt wird. Wie Verfahren schneller werden können, zeigen die digitalen Genehmigungsprozesse und Fristvorgaben in Bayern. Zu den zentralen Faktoren für mehr Investitionen in den Wohnungsbau gehören natürlich auch die Planbarkeit von Zinsen sowie die Förderung der Eigentumsbildung. Und: Eigentumsbildung muss für Normalverdiener wieder erreichbar werden.
Was schlagen Sie vor, damit Eigentumsbildung gerade für Normalverdiener wieder erreichbar wird? Wir brauchen eine echte Entlastung beim Erwerb von Eigentum,
etwa durch die Abschaffung der Grunderwerbsteuer für Ersterwerber bis 500.000 Euro. Auch bewährte Programme zur Eigenkapitalbildung wie Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage oder die Eigenheimrente (WohnRiester) spielen eine wichtige Rolle und müssen an die Inflation angepasst werden. Eigentum darf nicht als Luxus gelten, denn es ist eine tragende Säule der privaten Altersvorsorge.
Welche Rolle spielen dabei die privaten Bausparkassen? Bausparen bietet eine bewährte Möglichkeit, um zweckgerichtet Eigenkapital aufzubauen und sich gegen Zinsrisiken abzusichern. Viele Haushalte nutzen Bausparverträge auch zur maßgeschneiderten Finanzierung energetischer Modernisierungen. Die privaten Bausparkassen stehen nach wie vor als verlässlicher Partner bei Ausbau und Erhalt der Wohninfrastruktur bereit.
„Endlich
Matthias Benz, CEO der Zeppelin Group, spricht über Impulse aus dem Infrastrukturpaket und warum es jetzt einen Kulturwandel braucht.
Herr Benz, wie haben Sie auf die Ankündigung der Bundesregierung reagiert, ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität aufzulegen? Meine erste Reaktion war: Endlich! Diese Investitionen sind längst überfällig, denn Deutschland liegt seit Jahren deutlich unter dem EUDurchschnitt. Wir investieren nur etwa 2,2 bis 2,5 Prozent des BIP in unsere Infrastruktur, während der Schnitt in der EU bei circa 3,5 Prozent liegt. Das ergibt jährlich eine Investitionslücke von rund 45 Milliarden Euro. Ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro bis 2030 ist daher ein notwendiger Schritt, um überhaupt erst einmal den Rückstand aufzuholen. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Höhe der Summe, sondern dass die Mittel jetzt zügig im wahrsten Sinne auf die Straße und in die Leitung kommen.
In welchen Geschäftsfeldern erwarten Sie durch die staatlichen Investitionen die stärksten Wachstumsimpulse? Als einer der größten Baudienstleister in Deutschland sehe ich für Zeppelin vor allem drei Geschäftsfelder mit großen Chancen. Erstens die Bauinfrastruktur: Rund 30 Prozent der Autobahnen in unserem Land gelten als sanierungsbedürftig. Zweitens die Energieinfrastruktur, allein 44.000 Kilometer neue Stromtrassen sind in Deutschland geplant, um E-Mobilität und

Datenzentren mit Strom zu versorgen. Der dritte Bereich betrifft die Digitalisierung. Beim 5G-Ausbau hinkt die Bundesrepublik immer noch hinterher. Auch hier sind wir sehr gut aufgestellt und erwarten mit unseren Komplettlösungen bei Maschinen, Engineering und Services starke Wachstumsimpulse.
Bremsen denn langwierige Planungsverfahren und Genehmigungsprozesse wirklich die Wirtschaft aus? Aber ja. Deutschland liegt laut Weltbank bei der Dauer von Genehmigungsprozessen für Großprojekte weltweit nur auf Platz 24, deutlich hinter Nachbarländern wie Dänemark oder den Niederlanden. Ein Beispiel: Für einen Autobahnabschnitt in Süddeutschland dauerte das Genehmigungsverfahren inklusive Einspruchsprüfung sechs Jahre, der eigentliche Bau war in nur 16 Monaten erledigt. Das ist ein Missverhältnis, das wir uns nicht länger leisten können. Wir brauchen verbindliche Planungsfristen, digitale Verfahren und eine ehrliche Debatte über das Verbandsklagerecht. Damit die Mittel
aus dem Infrastrukturpaket tatsächlich wirken, muss der Gesetzgeber jetzt dringend für mehr Verbindlichkeit und Effizienz sorgen.
Wie läuft es beispielsweise in Dänemark? In Dänemark ist etwa die Umweltprüfung auf zwölf Monate begrenzt. Wird in dieser Zeit nichts gefunden, darf gebaut werden. Das Problem ist selten das Bauen selbst, sondern die langwierigen Genehmigungsverfahren. Mit Gesamtvergaben und modularen Baukonzepten ließe sich vieles beschleunigen. Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Das Durchschnittsalter der Planungsingenieure liegt bei Mitte 50, und es wurde über Jahre versäumt, in Nachwuchs bei Behörden zu investieren. Wenn aber Fachkräfte fehlen, die Planungen erstellen oder Ausschreibungen vorbereiten, hilft auch das größte Investitionspaket nichts. Hier muss dringend gehandelt, aber das Rad nicht neu erfunden werden. Länder wie Dänemark zeigen mit ihren gut funktionierenden Lösungen doch längst, wie es schneller und effizienter geht.
Reichen die Kapazitäten an Fachkräften in der gesamten Branche eigentlich für einen möglichen Bauboom aus? Trotz aller gegenteiligen Berichte arbeitet die Bauwirtschaft schon heute an der Kapazitätsgrenze. Laut ifo-Institut liegt die Auslastung im Bauhauptgewerbe bei über 90 Prozent. In den nächsten Jahren wird sich der Engpass weiter zuspitzen. Wir reagieren darauf mit gezielten Investitionen in Aus- und Weiterbildung. Intern bieten wir jährlich mehr als

8.000 Trainings an, von der Grundlagenqualifikation bis zur Maschinenschulung. Denn klar ist: Ohne qualifizierte Menschen werden kein Fundament und kein einziger Kilometer Autobahn gebaut.
Ein zentrales Thema im Infrastrukturausbau ist die Klimaneutralität. Wie adressiert Zeppelin die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Es wird immer Einsatzbereiche geben, in denen Diesel unverzichtbar bleibt – etwa bei schweren Baumaschinen, wo hohe Energiedichte gefragt ist. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht Stillstand: Bereits der Austausch alter gegen moderne Maschinen reduziert die Emissionen um bis zu 25 Prozent. Darüber hinaus setzen wir zunehmend auf alternative Antriebe. Unsere Mietmaschinenflotte ist heute bereits zu 20 Prozent elektrifiziert. Die elektrifizierte Baustelle kommt also Schritt für Schritt.
Und das Thema Wasserstoff?
Auch beim Thema Wasserstoff sind wir aktiv dabei. Erst kürzlich haben wir in Hamburg gemeinsam mit Bürgermeister Tschentscher eine mobile Brennstoffzelle vorgestellt – ideal für Baustellen, Events oder Festivals. Die Technik ist einsatzbereit, es fehlt nur noch an wirtschaftlich tragfähigen Wasserstoffpreisen. Aber auch das wird sich ändern. Unser Ziel ist klar: Mit Maschinen, Service und Technologie leisten wir einen messbaren Beitrag zur CO₂-Reduktion im Bausektor.
Bitte verraten Sie schließlich noch Ihre wichtigste Botschaft an Politik und Gesellschaft, damit der geplante Infrastrukturpakt zum Erfolg wird. Wir müssen uns von einer Kultur des Zögerns hin zu einer Kultur des Handelns entwickeln, also einfach machen und nicht jammern. In den USA zeigt der „Infrastructure Investment and Jobs Act“, wie es gehen kann: 1,2 Billionen Dollar und über 32.000 gestartete Projekte in nur 18 Monaten. Was wir brauchen, ist ein echter Kulturwandel: entscheiden, priorisieren und realisieren anstatt abwägen und diskutieren. Meine zentrale Botschaft lautet: Lasst uns endlich eine Umsetzungsnation werden!
www.zeppelin.com
WOHNUNGSBAU | VON JENS BARTELS
Hohe Baukosten, langwierige Genehmigungsverfahren und mehr Klimaschutz: Der Wohnungsmarkt in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Damit mehr Wohnraum in einem schnelleren Tempo entsteht, müssen Bürokratie abgebaut, Investitionen erleichtert und Förderprogramme effizienter gestaltet werden.
Der Wohnungsbau bleibt das Sorgenkind der deutschen Bauwirtschaft. So wurden im Jahr 2024 laut der aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts lediglich 251.900 neue Wohnungen fertiggestellt. Dies ist ein Rückgang um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erneut deutlich weniger als die jährlich benötigten 400.000 Wohnungen, die erforderlich wären, um dem wachsenden Wohnraumbedarf gerecht zu werden. Besonders starke Rückgänge gab es 2024 bei den meist von Privatpersonen errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern: Mit 54.500 Einfamilienhäusern wurden 22,1 Prozent weniger fertiggestellt als im Vorjahr. Die Zahl neuer Wohnungen in Zweifamilienhäusern fiel um 26,2 Prozent auf 17.600. Auch die sinkende Zahl der Baugenehmigungen stimmt bedenklich. Sie ging im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 17,1 Prozent auf 215.300 zurück und war damit deutlich niedriger als die Zahl der fertiggestellten Wohnungen.
Verlässlichen Rahmen schaffen
Bei diesen Zahlen stellt sich schnell die Frage, was die neue Bundesregierung für den Hausund Wohnungsbau tun kann. Klar muss in diesem Zusammenhang zunächst einmal sein: Bauherren, Investoren und Familien brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, denen sie vertrauen können. Dazu zählen planbare Zinsen, stabile Förderprogramme und ein fairer Zugang zu Grundstücken. Unterstützung könnte hierbei das Infrastrukturpaket der Bundesregierung liefern. Mehr Dynamik schaffen aber

auch schnellere Genehmigungsverfahren, der Abbau von Bürokratie in der Verwaltung oder einfachere Baustandards wie der Gebäudetyp E. Dieser Typ ermöglicht einfaches und experimen-
Wohnungsbau ist in Deutschland teurer als in anderen Ländern.
telles Bauen, ohne die Gebäudesicherheit zu gefährden. Dabei geht es darum, auf Standards zu verzichten, die nicht zwingend nötig sind, und gleichzeitig innovative Lösungen zu fördern sowie Kosten zu senken.
Auftragsmangel im Wohnungsbau in Deutschland von März 2024 bis März 2025
Kostentreiber Staat
Gerade aufgrund der hohen Baukosten schrecken viele Haushalte vor Bauvorhaben zurück oder können sich das Bauen schlichtweg nicht mehr leisten. Für Neubauwohnungen müssen in Deutschland 5.150 Euro pro Quadratmeter ausgegeben werden. Damit sind sie teurer als in vielen anderen europäischen Ländern. Ein zentraler Kostentreiber ist hierbei der Staat. Fast ein Drittel dieser Kosten, etwa 1.500 Euro pro Quadratmeter, werden direkt durch Steuern und öffentliche Abgaben verursacht, zeigt eine aktuelle Analyse von CBRE, für die neben Deutschland auch die Wohnbaukosten in Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Polen und Schweden untersucht wurden.
BAUINFRASTRUKTUR | VON JENS BARTELS
Sanierungsstau abbauen, moderne Verkehrswege schaffen und klimafreundlich bauen: Das Infrastrukturpaket der Bundesregierung bietet der Bauwirtschaft enorme Chancen. Zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg zählen die zügige Freigabe der Mittel, eine Priorisierung der Projekte und die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.
Die deutsche Wirtschaft kommt nur sehr langsam auf Touren. Trotz Aussicht auf das milliardenschwere Programm für die Infrastruktur hebt etwa die Bauindustrie ihre Prognose aus dem Januar nur minimal an. So erwartet der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) in diesem Jahr für das Bau-
Die Bauwirtschaft ist ein zentraler Wirtschafts- und Innovationsmotor.
hauptgewerbe weiterhin einen Umsatzrückgang von minus ein Prozent. Grund hierfür ist etwa die vorläufige Haushaltsführung des Bundes, wodurch gerade im Bundesfernstraßenbereich seit neun Monaten keine neuen Projekte an den Markt kommen. Auch im Wohnungsbau kommt es erst sehr langsam zu einer Wiederbelebung. Diese Prognose decke sich mit den Ergebnissen einer brancheninternen Konjunkturumfrage des HDB: 31 Prozent der teilnehmenden Unternehmen erwarten, dass der eigene Umsatz 2025 im Vergleich zu 2024 zurückgehen wird. Dennoch gehen 60 Prozent trotz der schwachen Umsatz- und Ertragserwartungen davon
SCHON GEWUSST?
Nach einem schwungvollen Jahresstart wird die deutsche Wirtschaft dank des Investitionspakets ab Ende des Jahres wohl Fahrt aufnehmen. So dürfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,3 Prozent, im Jahr 2026 um 1,7 Prozent zulegen, prognostiziert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und revidiert damit seine frühere Konjunkturprognose um 0,2 beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte nach oben. Auftrieb verleihen ein anziehender privater Konsum, die in diesem Jahr beschlossenen umfangreichen finanzpolitischen Maßnahmen sowie starke Exporte, auch wenn die Unsicherheiten durch die US-Handelspolitik und die weiterhin bestehenden strukturellen Probleme nach wie vor dämpfen.
aus, dass die Zahl der Beschäftigten im Unternehmen gleichbleiben werde.
Wirtschaft wird angekurbelt
Klar muss sein: Die Bauwirtschaft ist nicht nur Erfüllungsgehilfe, sondern ein zentraler Wirtschafts- und Innovationsmotor. Jeder Euro, der in den Bau investiert wird, zieht nach Angaben der Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) einen starken wirtschaftlichen Folgeeffekt nach sich, etwa im Handwerk, in der Industrie oder im Dienstleistungssektor. Insgesamt hätte eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen um 500 Milliarden Euro laut Berechnungen des DIW zur Folge, dass die Wirtschaftsleistung in den kommenden zehn Jahren um durchschnittlich mehr als zwei Prozent pro Jahr höher läge als ohne die Erhöhung. Nach einer Anlaufphase wären die größten Anstiege der Wirtschaftsleistung für die Jahre 2028 und 2029 zu erwarten. Dazu kommt: Investitionen in den Bau sind Investitionen in die Klimastabilität, Standortattraktivität und soziale Balance.
Verlässlichen Rahmen schaffen
Doch ein solcher Kraftakt braucht nicht nur frisches Kapital, sondern vor allem auch eine funktionierende Bauwirtschaft. Damit das Geld auch wirklich in der Infrastruktur des Landes ankommt, muss es vor allem planbar und schnell verfügbar sein. Dafür braucht die Branche aber verlässliche Investitionszusagen, beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie eine klare politische Priorisierung. Mit Blick auf den Wohnungsbau würden etwa durch die Einführung des Paragrafen 246e im Baugesetzbuch und die damit ermöglichte Abweichung von Bebauungsplänen neue Wohnungsbauprojekte nicht nur einfacher, sondern auch schneller genehmigt werden.
Insgesamt könnte ein Großteil der Mittel in den öffentlichen Hoch- und Tiefbau, in den Verkehrswegebau, die energetische Gebäudesanierung, die Trink- und Abwassernetze, den Schienenverkehr sowie in den digitalen Netzausbau fließen. Um dabei Engpässe zu vermeiden, ist es notwendig,
Anzeige









Jetzt QR-Code scannen und kostenlosen Ratgeber anfordern.
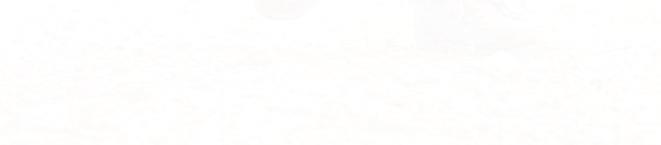



projektübergreifende Planungskapazitäten auszubauen, Fachkräfte zu sichern und Lieferketten zu stabilisieren.
Neubau forcieren
Zu den dringend benötigten Großprojekten zählen etwa neue Schulen, Kitas und Hochschulen, insbesondere in wachsenden Regionen. Auch öffentliche Wohnbauinitiativen müssen forciert werden, um die Wohnungsnot zu lindern. Der Neubau von Krankenhäusern und Reha-Zentren ist ebenso überfällig wie der Ausbau von Justizvollzugsanstalten, Polizeigebäuden und Katastrophenschutzinfrastruktur. Nicht zuletzt gehören auch große Energieprojekte auf die Prioritätenliste wie der Bau neuer Umspannwerke, Wasserstoff-Hubs oder Energieparks, beispielsweise entlang der Industrieachsen zwischen Rheinland, Ruhrgebiet und Sachsen.
Sanierung stärken Mindestens ebenso wichtig wie Neubauten ist die Instandsetzung der bestehenden Infrastruktur. Rund 30 Prozent der Autobahnen gelten laut des Bundesverkehrsministeriums als sanierungsbedürftig. Kaputte Brücken wie die Talbrücke Rahmede an der A45 oder auf der stark frequentierten Stadtautobahn A100 in Berlin zeigen, wie empfindlich unser Verkehrsnetz auf Ausfälle reagiert. Dazu passt eine im April 2025 veröffentlichte Auswertung des Bundesrechnungshofs. Demnach liegt die die bundeseigene Autobahn GmbH bei der Modernisierung der Brücken in Deutschland deutlich hinter dem Zeitplan: Von den geplanten 280 Modernisierungen sind im Jahr 2024 lediglich 69 umgesetzt worden. Auch Tunnelsanierungen wie

zum Beispiel am Elbtunnel oder im Süden der A8 sind längst überfällig und könnten durch das Infrastrukturpaket neuen Schwung erhalten.
Stetige Pflege im Auge haben Zu den großen Sanierungsfällen in Deutschland zählt auch das Netz unter unseren Füßen. Kommunale Wasser- und Abwassernetze, viele in den 1950er- bis 1970er-Jahren gebaut, müssen ebenfalls erneuert werden, sonst drohen Kostenexplosionen durch Folgeschäden. Gleichzeitig wird der Ausbau digitaler Netze
Mit den Infrastrukturmilliarden wird die Bauwirtschaft zum Treiber eines neuen Wirtschaftsaufschwungs.
blockiert, wenn die Tiefbaukapazitäten anderweitig überlastet sind. Fest steht also: Gelingt es, die hohen Summen in den nächsten Jahren nicht in Ankündigungen, sondern in Ausschreibungen und Ausführungen zu überführen, kann das Infrastrukturpaket zum echten Konjunkturmotor für die Bauwirtschaft, die Gesellschaft und den Standort werden. Wenn die Wirtschaft sieht, dass Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgebaut wird, werden Investitionen in zahlreichen Branchen die Folge sein.
„Infrastruktur ist Zukunft – wenn man sie richtig denkt”
Oliver Nohse, Geschäftsführer der EUROVIA Bau GmbH und Präsident des Deutschen Asphaltverbands e. V., über klimafreundliche Bauweisen und Planungsstau.

Warum müssen wir in Deutschlands Infrastruktur investieren? Deutschland hat jahrelang zu wenig in seine Infrastruktur investiert und liegt im europäischen Vergleich weit hinten. Ein leistungsfähiges Straßennetz ist jedoch
unverzichtbar für eine wettbewerbsfähige, resiliente Wirtschaft. Es gilt nun, den Sanierungsstau abzubauen und Einschränkungen, besonders auf hoch belasteten Fernstraßen, zu verhindern. Doch auch kommunale Infrastrukturen brauchen Aufmerksamkeit. Innovative Bauverfahren und umweltschonendere Materialien bieten konkrete Chancen, infrastrukturelle und klimapolitische Ziele zu vereinen.
Welche Innovationen machen Asphalt klimafreundlich und effizient? Ein zentraler Hebel ist die Kreislaufwirtschaft. Asphalt lässt sich effizient und qualitativ hochwertig wiederverwenden. Moderne Werke erreichen eine Recyclingquote von über 80 Prozent. Temperaturabgesenkter Asphalt, dessen Einsatz ab 2026 zur Regelbauweise wird, senkt Emissionen bereits im Herstellungsprozess. Zudem eröffnen Konzepte wie die „Power Road“ multifunktionale Perspektiven:
Straßen könnten künftig Sonnenenergie gewinnen und Elektrofahrzeuge laden.
Welche Rolle spielt der Straßenbau für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Ein modernes Straßennetz ist unerlässlich für unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Der Güterfernverkehr bleibt auf die Straße angewiesen – das Schienennetz allein bietet nicht genug Kapazität. Daher ist es dringend nötig, die Straßeninfrastruktur zukunftsfest zu gestalten. Nur so kann Deutschland wirtschaftlich mithalten und eine neue Dynamik entwickeln.
Was muss sich bei Planung, Genehmigung und Vergabe ändern? Der Infrastrukturausbau scheitert nicht am Willen, sondern an langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Deutschland muss hier effizienter und digitaler werden. Es braucht verlässliche
Rahmenbedingungen und langfristige Planungssicherheit, um Investitionen zu fördern. Digitale Tools wie Building Information Modeling (BIM) können Bauprozesse beschleunigen. Vergabeverfahren sollten so gestaltet sein, dass Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz gezielt gefördert werden.
Was fordern Sie konkret von der Politik? Der Koalitionsvertrag setzt einen begrüßenswerten Fokus auf Infrastruktur, und das Sondervermögen bietet eine historische Chance – doch es ist über zwölf Jahre gestreckt und steht unter Finanzierungsvorbehalt. Daher braucht es eine klare Priorisierung der Mittelverwendung. Angesichts ihrer systemrelevanten Bedeutung als logistische Lebensader sollte der Straßeninfrastruktur eine vorrangige Rolle zukommen. Die Bauwirtschaft ist bereit – jetzt braucht es Mut, Geschwindigkeit und klares politisches Commitment.
DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN | VON JENS BARTELS
Künstliche Intelligenz, Big Data und vernetzte Systeme können Diagnosen verbessern, Therapien personalisieren und die Versorgung effizienter machen. Doch in Deutschland bleibt viel Potenzial ungenutzt, weil es an einer ausreichenden Anzahl an Daten fehlt. Für die Gesundheitswirtschaft ist das ein Wettbewerbsnachteil.
Egal, ob E-Rezept, Video-Sprechstunde oder elektronische Patientenakte: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens gewinnt endlich an Tempo. Eine weit überwiegende Mehrheit der Menschen begrüßt diese Entwicklung. Stolze 89 Prozent halten die Digitalisierung im Gesundheitswesen grundsätzlich für richtig, und 71 Prozent wünschen sich dabei sogar mehr Bewegung. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom aus dem vergangenen Jahr. Demzufolge erleben 83 Prozent überdies, dass ihre Ärztinnen und Ärzte dem Thema Digitalisierung insgesamt aufgeschlossen gegenüberstehen. Gleichwohl gilt aber auch: Fast jeder Zweite (48 Prozent) fühlt sich von der Digitalisierung im Gesundheitswesen überfordert.
Chancen nutzen
Nichtsdestotrotz eröffnet die Digitalisierung dem Gesundheitswesen in vielen Bereichen enorme Chancen, etwa durch die intelligente Nutzung von Gesundheitsdaten. Künstliche Intelligenz und Big Data ermöglichen eine deutlich
präzisere Diagnostik, indem sie Krankheitsmuster schneller erkennen und analysieren. Auch in der personalisierten Medizin schaffen Datenanalysen die Grundlage für individuell zugeschnittene Therapien, die besser auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt sind. Zudem fördern vernetzte Systeme den reibungslosen Informationsaustausch zwischen Ärztinnen und Ärzten, Fachabteilungen und Einrichtungen. Dies ist ein echter Gewinn für die Versorgungsqualität. Dennoch bleiben viele
machen die Versorgung effizienter.
dieser Potenziale in Deutschland bislang ungenutzt, weil der Zugang zu Patientendaten oft eingeschränkt ist. Dabei sind diese Daten nicht nur medizinisch wertvoll, sondern auch entscheidend für Innovation, Produktentwicklung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Gesundheitswirtschaft.
Tempo erhöhen

Die Deutschen wünschen sich mehr Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens wird mehr Tempo gefordert, etwa beim Durchlauf klinischer Studien. Fest steht: Die Digitalisierung verändert diesen Bereich grundlegend. Dezentrale Studienmodelle gewinnen dadurch an Relevanz. Sie ermöglichen eine schnellere Rekrutierung, effizientere Datenerhebung und eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Patienten. Unterstützt durch Telemedizin, mobile Technologien und spezialisierte Logistiklösungen, bieten dezentrale klinische Studien einen zukunftsweisenden Ansatz, um diese flexibler und patientennäher zu gestalten.
„Labordiagnostik ist unverzichtbar”
Dr. Michael Müller, Vorsitzender des Verbands der Akkreditierten Labore in der Medizin, spricht über die hochwertige Patientenversorgung und drohende Kürzungen durch Reformvorhaben.
Warum ist die Labordiagnostik heute wichtiger denn je? Egal, ob bei Prävention, Erkennung von seltenen Krankheiten oder zur Therapiebegleitung: Die medizinisch-ärztlich verantwortete Labordiagnostik ist für eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und wohnortnahe Patientenversorgung einfach unverzichtbar. Sie liefert präzise Antworten genau dann, wenn sie gebraucht werden. Kurzum: Die Labordiagnostik ist eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems.
Ist diese hochwertige Versorgung gefährdet? Leider müssen wir feststellen, dass die Laborreform 2025 sowie die geplante Überarbeitung

Dr. Michael Müller
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) die seit vielen Jahren gravierendsten Einschnitte für die fachärztlichen Labore in Deutschland darstellen. Sollten diese Reformen ohne grundlegende Anpassungen umgesetzt werden, drohen erhebliche Auswirkungen auf die Patientenversorgung. Die finanziellen Rahmenbedingungen für medizinische Labordiagnostik würden sich
deutlich verschlechtern und das bei stark steigenden Kosten von 20 bis 30 Prozent in den letzten fünf Jahren. Diese Kostensteigerungen können die Labore nicht wie ein „normales“ Unternehmen durch Preiserhöhungen weitergeben. Besonders betroffen wären auch die über 40 Labore in Deutschland, die unter die KRITIS-Verordnung fallen und somit eine zentrale Rolle in der kritischen Infrastruktur einnehmen. Insgesamt gefährden die geplanten Änderungen die Existenz vieler medizinischer Labore vor allem in ländlichen Regionen.
Was schlagen Sie vor? Wir brauchen verlässliche politische Rahmenbedingungen, die sich am medizinischen Bedarf der Patientinnen und Patienten orientieren und zugleich die flächendeckende fachärztliche Laborstruktur erhalten. Entscheidend ist unter anderem dabei, dass finanzielle Entscheidungen – sowohl bei der
Honorierung ärztlicher Leistungen als auch der Kostenerstattung – auf transparenten und betriebswirtschaftlich fundierten Grundlagen getroffen werden. Klar muss sein: Nur eine sachgerechte und angemessene Vergütung ermöglicht es uns, dem wachsenden Kostendruck wirksam zu begegnen.
Mit welchen Herausforderungen sind die akkreditierten Labore außerdem konfrontiert? Hierzu zählt vor allem, den Fachkräftebedarf in unseren beiden wichtigsten Berufsgruppen sicherzustellen, also zum einen medizinische Technologien und Technologen für Laboratoriumsanalytik und zum anderen die Fachärztinnen und Fachärzte im Labor. Es besteht auch erheblicher Nachhol- und Verbesserungsbedarf in der Digitalisierung des Gesundheitswesens über die verbesserte Interoperabilität oder standardisierte Datenstrukturen.
DIGITALE INFRASTRUKTUR | VON HARTMUT SCHUMACHER
Schnelle Netze und eine moderne Verwaltung sind keine netten Extras, sondern Schlüsselfaktoren für die Wirtschaft. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hierbei jedoch deutlich hinterher. Für eine Aufholjagd sind Investitionen und Innovationen dringend erforderlich.
Der neue Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat gleich in seiner ersten Rede im Bundestag klargestellt: Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und 5G-Mobilfunk sowie moderner Rechenzentren sind die Grundlage für eine innovative Wirtschaft und Gesellschaft. Der Ausbau dieser digitalen Infrastruktur in Deutschland schreitet zwar voran, bleibt im internationalen Vergleich jedoch hinter vielen Staaten zurück: Im „Digital Quality of Life Index 2024“ des Cybersecurity-Unternehmens Surfshark kommt Deutschland in der Kategorie digitale Infrastruktur lediglich auf Platz 11 (von 121 Staaten). Auf den ersten Plätzen landen die USA, die Niederlande und Dänemark.
Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken, sind also Investitionen in die digitale Infrastruktur dringend nötig. Die Bereitschaft der Politik dazu ist vorhanden: Das im März beschlossene Infrastruktur-Sondervermögen stellt über einen Zeitraum von zwölf Jahren 500 Milliarden Euro zur Verfügung. Die genaue Verteilung dieser Summe steht zwar noch nicht fest, neben dem Verkehrsnetz sowie dem Klimaschutz und der Gesundheitsversorgung soll jedoch auch die digitale Infrastruktur von dem Sondervermögen profitieren. Doch das Geld allein wird keine Investitionswende bringen. Auch die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. So sollen zum Beispiel durch eine Novellierung des Telekommunikationsgesetzes die Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen beschleunigt werden.
Breitband für alle Nach Ansicht der Industrie- und Handelskammern zählen leistungsstarke Breitbandanschlüsse, die eine schnelle Datenübertragung per Internet ermöglichen, zu den „entscheidenden harten Standortfaktoren für Unternehmen“. Doch die in Deutschland immer noch vorherrschenden Internet-Anschlüsse über Kupferkabel (DSL) erlauben im Download gerade einmal Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde. Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, in denen Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen oder andere große Datenübertragungen regelmäßig zum Einsatz kommen, brauchen mehr – zum Beispiel Glasfaseranschlüsse, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde ermöglichen. Besonders ländliche Regionen und die östlichen Bundesländer sind schlechter mit solchen schnellen Zugängen ausgestattet als städtische Regionen und die westlichen Bundesländer.
Das Ziel der Gigabitstrategie des Bundes lautet, bis Ende 2030 Glasfaseranschlüsse flächendeckend bereitzustellen. Zur Wahrheit gehört

aber auch: Mitte 2024 hatten laut dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 43,2 Prozent der deutschen Haushalte prinzipiell Zugang zu Glasfaser, aber lediglich 5,9 Prozent nutzten tatsächlich einen Glasfaseranschluss. Der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge liegt Deutschland bei den aktiven Glasfaseranschlüssen weit unter dem OECD-Durchschnitt.
Mobilfunk mit Bremsen
Auch der Ausbaustand im Mobilfunk ist verbesserungswürdig. Der Mobilfunkstandard 2G steht in Deutschland nahezu flächendeckend zur Verfügung. Die leistungsfähigeren Standards 4G und 5G versorgen laut der Bundesnetzagentur bereits 97,6 Prozent beziehungsweise 94,2 Prozent der Fläche Deutschlands (Stand: April 2024). Dennoch erreicht das deutsche Mobilfunknetz im „Global Network Excellence Index (2025)“ des Analyseunternehmens Opensignal
Leistungsstarke Breitbandanschlüsse sind entscheidende Standortfaktoren für Unternehmen.
nur Platz 31 (von 132 Staaten). Auf den ersten drei Plätzen befinden sich Dänemark, Südkorea und Finnland. Deutschland kommt bei der Verfügbarkeit zwar auf einen recht guten 15. Platz. Die relativ niedrigen Download-Geschwindigkeiten ziehen das Gesamtergebnis jedoch herunter. Weitere Investitionen in das deutsche Mobilfunknetz sind vor allem deshalb nötig, weil für Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, smarte Fabriken und Augmented Reality höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und geringere Verzögerungen erforderlich sind, als dies derzeit möglich ist.
Moderne Verwaltung
Die Digitalisierung der Verwaltung ist hierzulande weniger weit fortgeschritten als in den
Glasfaser und 5G sowie moderne Rechenzentren bilden die Grundlage für eine innovative Wirtschaft und Gesellschaft.
meisten anderen EU-Staaten: In den entsprechenden Kategorien des Berichts „State of the Digital Decade (2024)“ der Europäischen Kommission erreicht Deutschland nur Plätze im hinteren Drittel.
Das seit 2020 geltende Onlinezugangsgesetz verpflichtet zwar alle Behörden, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Nach Zählungen der Arbeitgeber-Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft waren allerdings im Februar 2025 lediglich 196 der 575 betroffenen staatlichen Leistungen tatsächlich bundesweit digital verfügbar.
Digitalminister Wildberger will dafür sorgen, dass die Verwaltung den Bürgern besseren Service anbieten kann. Erreichen möchte er dies unter anderem mithilfe des „Deutschland-Stack“, eines modularen Baukastens aus IT-Basiskomponenten (wie Cloud-Diensten und Identitätsmanagement-Lösungen), die eine einheitliche digitale Infrastruktur für die öffentlichen Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen sollen.
Digitale Unabhängigkeit
Bei Cloud-Diensten, Büro-Software und künstlicher Intelligenz dominieren derzeit US-amerikanische Anbieter. Beispielsweise kontrollieren die drei Tech-Giganten Amazon, Microsoft und Google 72 Prozent des europäischen CloudMarktes (laut der Unternehmensberatung BDO). Europäische Anbieter kommen nur auf einen Marktanteil von 13 Prozent.
Diese technologische Abhängigkeit bringt Risiken mit sich für den Datenschutz und für die politische Handlungsfreiheit. Es gibt diverse deutsche und europäische Projekte, die Alternativen zu den US-amerikanischen Diensten entwickeln wollen. Allerdings benötigen sie Unterstützung, um den finanziell übermächtigen US-Konkurrenten etwas entgegensetzen zu können. Der Digitalbranchenverband Bitkom fordert daher, 50 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen für digitale Schlüsseltechnologien und Infrastrukturen zu verwenden, „die einerseits Deutschlands Position auf den Weltmärkten verbessern und andererseits die technologische Unabhängigkeit stärken“.
KOMMENTAR
Künstliche Intelligenz ist derzeit die vermutlich wichtigste Technologie. Von ihrem Einsatz hängt maßgeblich auch die Zukunft des Standorts Deutschland ab. Das muss auf den ersten Blick aber nicht erschrecken, denn deutschen Unternehmen wird in dieser Hinsicht eine durchaus solide technologische Basis attestiert. Jedoch auch hier kommen wir schnell wieder zum Thema Infrastruktur. Denn um die Technologie zur Anwendung zu bringen, werden immense Rechenleistungen benötigt – und da schwächelt die Bundesrepublik. Das Beratungsunternehmen Deloitte
moniert, dass Deutschlands Anteil an der weltweiten Rechenleistung seit 2015 um rund ein Drittel geschrumpft ist. Der Studie zufolge muss die Kapazität für KI-Anwendungen bis 2030 verdreifacht werden, und zwar von 1,6 auf 4,8 Gigawatt. Um im globalen Wettbewerb mithalten zu können, seien Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Euro nötig. Allerdings: Bau und Betrieb von Rechenzentren sind hierzulande besonders teuer. In München kostet der Bau einer Serverfarm 17 Prozent mehr als in Madrid, und die Stromkosten sind doppelt so hoch wie in den USA.
Michael Gneuss Chefredakteur
Wir sind dabei
IMPRESSUM
Projektmanagement Philipp Stöhr, philipp.stoehr@reflex-media.net Redaktion Jens Bartels, Michael Gneuss, Hartmut Schumacher Layout Silke Schneider, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / j. seepukdee Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Michael Gneuss, redaktion@reflex-media.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@ reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www. reflex-media.net
Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 1. Juli 2025 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Reflex Verlag und die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.
UNSERE NÄCHSTE AUSGABE

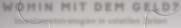

Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO) 3 Luisenstraße 45 10117 Berlin www.bv-miro.org
Verband der Privaten Bausparkassen e. V. 4 Klingelhöferstraße 4 10785 Berlin www.bausparkassen.de
Zeppelin GmbH 5
Graf-Zeppelin-Platz 1 85748 Garching bei München www.zeppelin.com
SOS-Kinderdorf e. V. 7
Renatastraße 77 80639 München www.sos-kinderdorf.dex
Deutscher Asphaltverband (DAV) e. V. 8 Ennemoserstraße 10 53119 Bonn www.asphalt.de
Akkreditierte Labore in der Medizin – ALM e. V. 9 Leipziger Platz 16 (Design Offices) 10115 Berlin www.alm-ev.de

Wohin mit dem Geld?

Im aktuellen volatilen Finanzmarktumfeld stellt sich die Frage, wie Investoren erfolgreich agieren und angemessene Renditen erzielen. Die Publikation „Wohin mit dem Geld? – Investmentstrategien in volatilen Zeiten“ wird Investoren Entscheidungshilfen an die Hand geben, welche die Vor- und Nachteile eines Investments aufzeigen und deren Chancen- und Risikoprofile für ein Portfolio analysieren.
Erfahren Sie mehr am 9. Juli 2025 im Handelsblatt.
JETZT SCANNEN Unsere Ausgaben finden Sie auch auf unserem Reflex-Portal: www.reflex-portal.de
An unseren Standorten Berlin und Münster suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Dich (so/wie/du/bist)!
job@reflex-media.net



