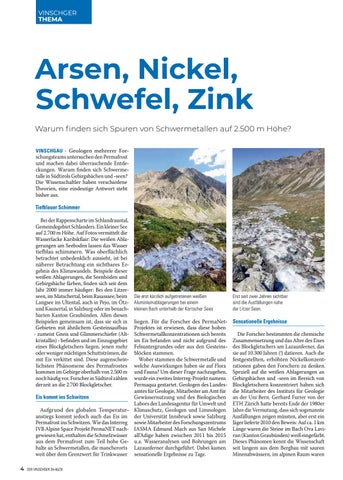VINSCHGER THEMA
Arsen, Nickel, Schwefel, Zink Warum finden sich Spuren von Schwermetallen auf 2.500 m Höhe? VINSCHGAU - Geologen mehrerer Forschungsteams untersuchen den Permafrost und machen dabei überraschende Entdeckungen. Warum finden sich Schwermetalle in Südtirols Gebirgsbächen und -seen? Die Wissenschaftler haben verschiedene Theorien, eine eindeutige Antwort steht bisher aus.
Tiefblauer Schimmer Bei der Rappenscharte im Schlandrauntal, Gemeindegebiet Schlanders. Ein kleiner See auf 2.700 m Höhe. Auf Fotos vermittelt die Wasserlacke Karibikflair: Die weißen Ablagerungen am Seeboden lassen das Wasser tiefblau schimmern. Was oberflächlich betrachtet unbedenklich aussieht, ist bei näherer Betrachtung ein sichtbares Ergebnis des Klimawandels. Beispiele dieser weißen Ablagerungen, die Seenböden und Gebirgsbäche färben, finden sich seit dem Jahr 2000 immer häufiger: Bei den Litzerseen, im Matschertal, beim Rasasssee, beim Langsee im Ultental, auch in Pejo, im Ötzund Kaunertal, in Salzburg oder im benachbarten Kanton Graubünden. Allen diesen Beispielen gemeinsam ist, dass sie sich in Gebieten mit ähnlichem Gesteinsaufbau - zumeist Gneis und Glimmerschiefer (Altkristallin) - befinden und im Einzugsgebiet eines Blockgletschers liegen, jenen mehr oder weniger mächtigen Schuttströmen, die mit Eis verkittet sind. Diese augenscheinlichsten Phänomene des Permafrostes kommen im Gebirge oberhalb von 2.500 m noch häufig vor. Forscher in Südtirol zählen derzeit an die 2.700 Blockgletscher.
Die erst kürzlich aufgetretenen weißen Aluminiumablagerungen bei einem kleinen Bach unterhalb der Kortscher Sees
liegen. Für die Forscher des PermaNetProjektes ist erwiesen, dass diese hohen Schwermetallkonzentrationen sich bereits im Eis befanden und nicht aufgrund des Felsuntergrundes oder aus den Gesteinsblöcken stammen. Woher stammen die Schwermetalle und welche Auswirkungen haben sie auf Flora und Fauna? Um dieser Frage nachzugehen, wurde ein zweites Interreg-Projekt namens Permaqua gestartet. Geologen des Landesamtes für Geologie, Mitarbeiter am Amt für Gewässernutzung und des Biologischen Eis kommt ins Schwitzen Labors der Landesagentur für Umwelt und Aufgrund des globalen Temperatur- Klimaschutz, Geologen und Limnologen anstiegs kommt jedoch auch das Eis im der Universität Innsbruck sowie Salzburg Permafrost ins Schwitzen. Wie das Interreg sowie Mitarbeiter des Forschungszentrums IVB Alpine Space Projekt PermaNET nach- IASMA Edmund Mach aus San Michele gewiesen hat, enthalten die Schmelzwässer all’Adige haben zwischen 2011 bis 2015 aus dem Permafrost zum Teil hohe Ge- u.a. Wasseranalysen und Bohrungen am halte an Schwermetallen, die mancherorts Lazaunferner durchgeführt. Dabei kamen weit über dem Grenzwert für Trinkwasser sensationelle Ergebnisse zu Tage.
4
DER VINSCHGER 39-40/20
Erst seit zwei Jahren sichtbar sind die Ausfällungen nahe der Litzer Seen.
Sensationelle Ergebnisse Die Forscher bestimmten die chemische Zusammensetzung und das Alter des Eises des Blockgletschers am Lazaunferner, das sie auf 10.300 Jahren (!) datieren. Auch die festgestellten, erhöhten Nickelkonzentrationen gaben den Forschern zu denken. Speziell auf die weißen Ablagerungen an Gebirgsbächen und -seen im Bereich von Blockgletschern konzentriert haben sich die Mitarbeiter des Instituts für Geologie an der Uni Bern. Gerhard Furrer von der ETH Zürich hatte bereits Ende der 1980er Jahre die Vermutung, dass sich sogenannte Ausfällungen zeigen müssten, aber erst ein Jäger lieferte 2010 den Beweis: Auf ca. 1 km Länge waren die Steine im Bach Ova Lavirun (Kanton Graubünden) weiß eingefärbt. Dieses Phänomen kennt die Wissenschaft seit langem aus dem Bergbau mit sauren Minenabwässern, im alpinen Raum waren