

LEGAL SUCCESS
RECHT IM FOKUS – ORIENTIERUNG FÜR UNTERNEHMEN
10/2025
Sag mir, wo die Daten sind
Das DSG betrifft immer mehr Branchen und Mitarbeitende
Due Diligence
Wenn die IT-Strukturen über Top oder Flop entscheiden
Investitionsprüfgesetz Big Trouble in Lex China
«Strategisch gesehen sollte der Einsatz von KI integraler Bestandteil der Unternehmensprozessarchitektur sein.»
Adrian Tüscher im Interview



Unternehmensgründungen
Zwischen Rechtsform und ersten rechtlichen Hindernissen: Wie können KMU und Start-ups Risiken eindämmen?
SEITE 4
Datenschutz
Drei aktuelle Urteile zeigen, wie Daten für Bürger, Behörden und Unternehmen zur dauernden Herausforderung werden
SEITE 6
Interview Adrian Tüscher über die Möglichkeiten von KI und die Zukunft junger Juristinnen und Juristen
SEITEN 8/9

Due Diligence
Wie IT-Strukturen Unternehmensübernahmen beeinflussen können. Was ist nötig, um die IT-Systeme eines Targets richtig zu bewerten?
SEITE 10
Innovationsprüfgesetz
Big Trouble in Lex China: Wird das angekündigte Investitionsprüfgesetz zum Investitionsschreck oder Sicherheitsgaranten für systemrelevante Wirtschaftsbereiche?
SEITEN 12
Schlusswort
SEITE 13

Jenseits der Maschine
Die juristische Arbeit steht nicht bloss vor einem Tool-Upgrade, sondern vor einem Paradigmenwechsel. Die Transformation durch generative Künstliche Intelligenz (KI) greift so tief in die Arbeitsweise ein, dass sie die gesamte Wertschöpfungskette neu ordnet. Zugleich legt KI aber auch den Wesenskern der juristischen Tätigkeit frei und eröffnet damit die Chance, deren Wert neu zu definieren. Einen konkreten Lebenssachverhalt unter abstrakte Rechtsnormen zu subsumieren und zu prüfen, ob ein bestimmter Fall die Voraussetzungen einer Norm erfüllt und welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben, das können heute Maschinen genauso gut wie Juristinnen und Juristen. Dass Maschinen heute schon so weit gekommen sind, kratzt bisweilen am Selbstverständnis vieler Kolleginnen und Kollegen. Zudem hinterfragt KI unsere traditionelle Arbeitsweise, die Zeitaufwand als Indikator für Qualität begreift und in der Effizienzsteigerung eine Bedrohung der Rentabilität erkennt.
Der Transformationsprozess geht also über technologische Aspekte hinaus und betrifft auch Identität, Kultur und Anreizsysteme. Juristinnen und Juristen stehen heute vor der Herausforderung, etablierte Prozesse zu überarbeiten, Technologie umfassend zu integrieren und den eigenen Wertbeitrag neu zu bestimmen. Dabei reicht es nicht, KI wie eine bessere Suchmaschine zu nutzen. Sie muss zum selbstverständlichen, integrierten Bestandteil des juristischen Arbeitens werden. Wer diesen Paradigmenwechsel vollzieht und KI versiert beherrscht, bietet der Mandantschaft einen Mehrwert, der weit über Effizienzsteigerung hinausgeht.
Kompetenzprofil der Zukunft Im Zeitalter von KI verschiebt sich das Kompetenzprofil grundlegend. Das

Ioannis
lic. iur., LegalTech Experte und Head of Innovation, Coop Rechtsschutz AG
«Der Transformationsprozess geht über technologische Aspekte hinaus und betrifft auch Identität, Kultur
und Anreizsysteme.»
zeitaufwendige Suchen von Informationen entfällt. Im Fokus steht das Bewerten der gelieferten Informationen: Sind sie tatsächlich relevant, stimmen die Outputs der KI und was bedeuten sie für den konkreten Fall? Dazu müssen Juristen verstehen, wie KI funktioniert, wo sie noch systematisch versagt und wie man sie richtig nutzt. Das Stichwort hierzu lautet AI Fluency und umfasst die Fähigkeit, mit KI-Systemen auf eine Weise zu arbeiten, die effektiv, effizient,
ethisch und sicher ist. AI Fluency ist jedoch nicht nur technisches Know-how, sondern umfasst darüber hinaus die menschliche Kompetenz, KI als Werkzeug und Partner intelligent einzusetzen.
Während KI nun viel Fleiss- und Abklärungsarbeit übernimmt, sind menschliche Kernfähigkeiten wie Verhandlungsgeschick, Empathie, Überzeugungskraft und die Kompetenz, zwischenmenschliche Dynamiken zu lesen, weiterhin sehr gefragt; Fähigkeiten, die weder jedem gegeben sind noch einen Teil der juristischen Ausbildung darstellen. Sie müssen deshalb ebenfalls trainiert, optimiert und verinnerlicht werden.
Ins Handeln kommen Wer jetzt ins Handeln kommen will, benötigt einen realistischen Anlauf. Der erste Schritt ist eine nüchterne Analyse: Welche Prozesse eignen sich, welche Daten sind verfügbar und wo liegen die grössten Risiken? Hieraus werden Anwendungsfälle mit hohem Nutzen und grosser Machbarkeit priorisiert. Ein Zielbild hilft zudem, nicht beim ersten gescheiterten Proof-of-Concept gleich das Handtuch zu werfen. Danach folgt der eigentliche Umbau der Prozesse.
Da wir uns bereits im Zeitalter der AI-Agents befinden, empfiehlt sich ein Gremium aus Legal, IT und Risk, das sich um das Thema AI-Governance kümmert und die Spielregeln definiert. Denn wenn Softwareprogramme in der Lage sind, autonom mit ihrer Umgebung zu interagieren, Daten zu sammeln und diese zu nutzen, um selbstständig Aufgaben auszuführen, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist, bürdet man sich ohne AI-Governance bloss unnötige Risiken auf.
Technologie verändert damit erstmals grundlegend den Kern der Jurisprudenz und bricht mit etablierten Konzepten: KI ermöglicht es, aufgrund der Automatisierung von Prozessen von
stundenbasierten Vergütungsmodellen auf ergebnisorientierte Modelle zu setzen. Skalierung erfolgt nicht mehr durch den Einsatz von weiteren Associates, sondern exponentiell durch Technologie und optimierte Arbeitsabläufe. Die Reduktion von Routinearbeit erhöht die Kapazität für hochwertige Arbeit und verbessert die Wirtschaftlichkeit von Kanzleien und insbesondere von Rechtsdiensten. Technologie ermöglicht zudem einen Zuwachs an Geschwindigkeit, was dem Kundenerlebnis bei Rechtsfällen besonders zuträglich ist.
Identität und Wesenskern der juristischen Tätigkeit Trotz aller Technologie steht im Zentrum der ganzen Entwicklung nach wie vor der Mensch. Und je leistungsfähiger die technischen Systeme werden, desto deutlicher tritt der Wert dessen hervor, was algorithmisch nicht abbildbar ist. Die Fähigkeit, Sachverhalte in ihrem situativen Zusammenhang zu erfassen, ethische Dimensionen zu erkennen, in Verhandlungen strategisch zu agieren, die Kunst des Abwägens und zwischen widersprüchlichen Anforderungen tragfähige Lösungen zu finden – diese Kompetenzen bilden das unverrückbare Fundament juristischer Arbeit. KI schafft den Raum, sich genau diesen essenziellen Aufgaben zu widmen –jenen, die für die Mandantschaft echten Mehrwert schaffen und für Juristinnen und Juristen persönliche Erfüllung bedeuten, weil sie sich nicht durch eine Maschine ersetzen lassen. Hier eröffnet sich die transformative Chance, den Wesenskern der juristischen Tätigkeit neu zu definieren – nicht als Konkurrenz zur Maschine, sondern als symbiotische Partnerschaft, in der Technologie die Bühne bereitet für das, was zutiefst menschlich ist. Jenseits der Algorithmen entsteht so eine Jurisprudenz, die präziser, menschlicher und zukunftsfähiger ist denn je.

OPINOMIC AG Dammstrasse 19, 6300 Zug, Schweiz / Herausgeber David Kohler / Redaktion (verantwortlich) Rüdiger Schmidt-Sodingen / Art Department Einhorn Solutions GmbH, Sylvio Murer (Art Direction) / Distribution Handelszeitung / Druck DZZ Druckzentrum Zürich AG / Anzeigen OPINOMIC AG / Titel Sandra Vonesch Sie erreichen uns unter info@opinomic.ch und opinomic.ch

In Kooperation mit IMPRESSUM

Martinis
Moderne Kanzlei
«Wir entwickeln unser Angebot anhand der neuen Herausforderungen unserer KMU-Kunden»
An 12 Standorten berät der schweizweite Kanzleiverbund SwissLegal national und international tätige Unternehmen, KMU, Private Clients und Family Offices bei Fragen des Wirtschafts-, Steuer-, Arbeits- und Erbrechts.
Rechtsanwältin und Notarin Christine Boldi, SwissLegal Basel, und ihr Kollege
Mauro Lardi, Verwaltungsratspräsident der SwissLegal-Gruppe, erörtern, wie modernes Recruiting und die Arbeit mit KI funktionieren - und den Kanzleialltag verändern.
Frau Boldi, Herr Lardi, mit welchen Entscheidungen konnten Sie an Ihren Standorten besondere Erfolge erzielen?
Christine Boldi: Bei unserer Klientschaft und auch im Team ist die Begegnung auf Augenhöhe entscheidend. Wenn Sie empathisch auf die Persönlichkeiten und deren Fragestellungen reagieren, steigern Sie automatisch den Erfolg. Dazu sind unsere Leistungen transparent und bezahlbar, wir verlangen keine astronomischen Honorare. Das Ergebnis bei uns in Basel: Die Klientinnen und Klienten kommen immer wieder zurück. Auch die Nähe zum Team ist ein Erfolgsgarant. Wir sind ein verlässlicher Partner – und eine gute Kommunikation gegenüber Team und Klientschaft ist alles.
Mauro Lardi: Seit ich vor 20 Jahren in der Kanzlei in Chur begonnen habe, hat sich die Klientenstruktur stark von Einzelmandaten zu wiederkehrenden Kunden gewandelt. Wir haben einen Kundenstamm aus dem KMU-Bereich aufgebaut, der regelmässig mit seinen Anliegen zu uns kommt. Der aktuell grösste Erfolg am Standort Chur ist sicherlich, dass wir in den letzten drei Jahren unsere Altersstruktur und die Zusammensetzung unseres Teams komplett verändern konnten. Wir konnten die Altersstruktur umdrehen und haben nun eine Mehrheit von jüngeren Anwältinnen und Anwälten sowie juristischen Mitarbeitern unter 40 Jahren in der Kanzlei.
Wie kommen Sie an neue Talente? Welche Möglichkeiten der Ansprache haben sich als besonders erfolgreich herausgestellt?
CB: Auch bei uns dreht sich die Alterspyramide seit kurzem um – was in der Tat befruchtend ist. Wir suchen Talente vor allem über die Kanäle, die junge Leute nutzen, also zum Beispiel über LinkedIn und Instagram. Dabei bekam ich neulich eine Initiativbewerbung von einer jungen Anwältin, der «auf Anhieb» unser neues Kanzleivideo gefiel. Das zeigt, dass die Art und Weise, wie wir Talente ansprechen, funktioniert.
ML: Wir stehen bei der Ansprache von Talenten sicher auch vor Herausforderungen, denn der Anwaltsmarkt ist regional sehr unterschiedlich. Die Metropolen wirken immer noch wie ein Magnet, während es kleinere Orte schwieriger haben. Hier in Chur haben wir immer zwei Praktikumsstellen parallel – und nehmen uns bewusst Zeit, um die jungen Talente zu unterstützen.
Das spricht sich herum. Dazu können wir Partner mit unterschiedlichen Schwerpunkten bieten. Das heisst: Der Nachwuchs kann in vielen verschiedenen Rechtsgebieten arbeiten und lernen und sich so auf die Anwaltsprüfung vorbereiten.
Welche Schritte gehen Sie für die «Kanzlei von morgen»?
ML: Wir setzen viele Neuerungen Schritt für Schritt um. Das betrifft sowohl technische als auch organisatorische Aspekte. Dossiers werden digital verarbeitet, sind auf der Cloud hinterlegt und wir arbeiten mit juristischen Datenbanken. Die Arbeitsplätze werden flexibler innerhalb der Kanzlei, Mitarbeitende können von auswärts arbeiten und es gibt neue Arbeitszeitmodelle. Der Vorteil unserer Gruppe ist, dass wir von den unterschiedlichen Erfahrungen der einzelnen Standorte profitieren. Wir können die Erfahrungen sammeln und austauschen. Dieser Austausch ist ein wertvoller Vorteil.
CB: Unser zusätzlicher Pfeiler in Basel ist die 30-jährige Anwältin und Partnerin Sama Bolog, die auf Digitalisierung und Datenschutz spezialisiert ist. Sie hat auch intern das Mandat, uns weiter zu digitalisieren und unsere Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Von den Erfahrungen, die wir in Basel machen, profitiert die ganze SwissLegal-Gruppe. Der Vorteil des Netzwerkes besteht darin, von gegenseitigen Erfahrungen mit Tools zu profitieren, ohne alle selber erwerben und testen zu müssen, was letztlich sowohl zeit- wie auch kostenmässig effizienter ist.
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag in den vergangenen Jahren verändert? Wie beeinflussen die Einsatzmöglichkeiten von KI und der allgemein zunehmenden technischen Innovationen Ihren Arbeitsalltag?
CB: Im Gegensatz zu früher haben wir es heute mit einer Klientschaft zu tun, die deutlich aufgeklärter ist, was ich sehr befruchtend finde. Es ist ein bisschen wie bei der Ärzteschaft, wo vermehrt Patientinnen und Patienten in die Praxis kommen, die vorher schon bei Dr. Google waren. Viele Klientinnen und Klienten haben sich bereits im Vorfeld

Steckbrief
SwissLegal: Schweizweit verankert, weltweit vernetzt. SwissLegal berät national und international tätige Firmen, KMU, Unternehmerinnen, Investoren und Private Clients in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, Bau- und Immobilienrecht, Nachfolge- und Erbrecht sowie M&A-Transaktionen. Das Kanzleinetzwerk verfügt über weitere Spezialisierungen an den jeweiligen Standorten und erbringt auch notarielle Dienstleistungen.
Je nach Mandat können kanzleiübergreifende Teams oder Kooperationen mit internationalen Preferred Partners zusammengestellt werden.
Mehr Informationen unter swisslegal.ch
informiert und das verändert auch die Art und Weise, wie man als Anwalt in einen Fall einsteigt.
ML: Kürzlich kam ein Mann in unsere Kanzlei, der seitenweise KI-Auswertungen bei sich hatte – und dementsprechend eine ganz klare Vorstellung, wie man sein gesellschaftsrechtliches Problem nun angehen und lösen sollte. Gegenüber früher, wo das Vorwissen eingeschränkt war, kommen Klientinnen und Klienten nun mit einem Gerüst in der Tasche. Wir stellen uns darauf ein, indem wir die Problemerfassung mit den Klienten entsprechend anpassen und dann sicherstellen, dass eine zielführende, praxisorientierte Lösung entwickelt werden kann. Insgesamt wird die Arbeitsweise dynamischer, aber auch anspruchsvoller, da wir Klienten oft auch davon überzeugen müssen,
«Der Vorteil des Netzwerkes besteht darin, von gegenseitigen Erfahrungen mit Tools zu profitieren, ohne alle selber erwerben und testen zu müssen.»

Christine Boldi Rechtsanwältin und Notarin

Mauro Lardi Rechtsanwalt und Notar
dass ihre KI-Auswertungen ihrem konkreten Rechtsproblem nicht gerecht werden und zu keinem guten Ergebnis führen würden.
In welchen Arbeitsbereichen liefert KI heute einen messbaren Nutzen? Gibt es einen standortübergreifenden Leitfaden bezüglich des Einsatzes von KI?
CB: Man muss zunächst sagen, dass die Entwicklung extrem schnell verläuft. Wir haben zweimal im Jahr einen Weiterbildungstag, wo sich alle Anwältinnen und Anwälte treffen, und da ist seit einiger Zeit KI ein ständiges Traktandum. Wir schauen dabei auch, was geregelt werden muss und wie wir Daten gezielt schneller verarbeiten und trotzdem noch besser schützen können.
ML: Die Veränderungen durch KI sind erheblich und wir wollen und müssen sie mitgehen. Wir unterstehen dem Berufsgeheimnis und verwenden Tools, die Daten verarbeiten. Im Falle von KI können Daten verarbeitet, gespeichert und zu Lernzwecken weiterverwendet werden. Daher braucht es einen Leitfaden für alle Mitarbeitenden, damit die uns anvertrauten Informationen stets geschützt bleiben.
Sehen Sie Rechtsgebiete, die in Zukunft wichtiger werden und die Sie an den jeweiligen Standorten gezielt aufbauen?
CB: Die Digitalisierung beeinflusst
unsere Arbeit stark und muss in Zukunft abgedeckt sein. Entsprechend rechne ich mit viel Entwicklungsarbeit. Die Klientinnen und Klienten werden zwar mit noch mehr Vorwissen zu uns kommen, aber am Ende des Tages müssen wir als Anwaltschaft die Einordnung übernehmen. Die konkrete Einschätzung juristischer Fragestellungen wird das Handwerksgerüst von uns Anwältinnen und Anwälten bleiben.
ML: Man könnte allgemein sagen: Wir entwickeln unser Dienstleistungsangebot anhand der neuen Herausforderungen unserer KMU-Kunden. Dazu gehören zurzeit z.B. das Datenschutzgesetz und das IT-Recht. Entsprechend müssen wir uns stets in neue Themen einarbeiten und können uns mit den anderen Standorten austauschen. Massgeschneidert auf neue Entwicklungen reagieren zu können, ist die Stärke unseres Verbundes.
Wie wichtig ist der schweizweite Verbund «SwissLegal» für Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten? Wie wichtig ist der Verbund beim Gewinnen junger Talente? Welche Chancen oder Synergien ergeben sich?
ML: Als eine Marke aufzutreten, stärkt die Aussenwirkung. Gleichzeitig profitieren wir von sämtlichen Standorten und deren individuellen Erfahrungen. Das hat einen sehr grossen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden – und macht uns auch als Arbeitgebende attraktiv. Unsere Mitarbeitenden sehen, dass wir auch international unterwegs sind. Das können viele kleinere und mittlere Kanzleien nicht bieten. CB: Es ist für die Gewinnung junger Talente sehr interessant, mit Kanzleien in der ganzen Schweiz vertreten und tätig zu sein. Auch die Klientschaft profitiert von unserer breiten Erfahrung, denn wir können zu jeder Fragestellung weitere Kolleginnen und Kollegen anderer Standorte hinzuziehen, in sämtlichen vier Landessprachen. Die Rechtsfragen werden komplexer und die Kenntnis der kantonalen Gegebenheiten und unterschiedlichen Rechtsprechungen ist somit wichtig. Dieses weitgefächerte Wissen gehört zum SwissLegal-Qualitätsgütesiegel oder neudeutsch gesprochen zur USP («Unique Selling Proposition»).

Gut in Form
Rechtssicherheit bei Unternehmensgründungen ist wichtig. Doch welche Rechtsform eignet sich für welches Unternehmen? Und mit welchen Anforderungen oder rechtlichen Herausforderungen müssen junge Unternehmen rechnen?
VON RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
Wer ein Unternehmen gründet, will meistens etwas Neues anbieten. Franz Barjak, Professor für Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), stellte in einem Beitrag für Discover 2024, das Jahresmagazin von Innosuisse, fest, wie schwer sich vor allem KMU mit Innovationen tun. Der Hauptgrund für die schwindende Innovationskraft sei «die wachsende Komplexität der Innovationstätigkeit». Die strukturellen Veränderungen greifen nicht nur in kreative Prozesse, sondern vor allem auch in organisatorische. Neben dem konkreten Kundennutzen müssten sich Unternehmen oder Start-ups mit den technischen und regulatorischen Herausforderungen auseinandersetzen. Während Tech-Berater oder IT-Profis zur Standardausrüstung eines Unternehmens gehören, wird es bei regulatorischen Anforderungen, die sich auf nachhaltige Lebens- und Recyclingzyklen und das Wettbewerbsumfeld ausdehnen,
schon schwieriger. Über Gesetze oder spezielle Marktanforderungen aufzuklären, ist das eine – dabei aber auch schon Umweltanforderungen und Risiko- und Haftungsfragen mitzudenken, das andere.
Nicht jede Rechtsform passt zu jedem Unternehmen
Neue Unternehmen müssen sich zunächst für eine Rechtsform entscheiden. Schon hier kann es schwierig werden. Das KMU-Portal des SECO weist auf die verschiedenen Rechtsformen für neugegründete oder umstrukturierte Unternehmen hin, die in direkter Verbindung mit künftigen Haftungsfragen stehen. «Wer alle Risiken allein tragen will und kann sowie bereit ist, mit seinem Privatvermögen für allfällige Forderungen zu haften, kann sich einfach als Einzelfirma im Handelsregister eintragen lassen. Unternehmende, die mit Kolleginnen oder Kollegen starten, sind dagegen mit der Gründung einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft besser beraten.» Wer das Unternehmerrisiko geringer halten wolle, sollte sich für die Gründung einer Kapitalgesellschaft entscheiden, etwa eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder eine Aktiengesellschaft (AG). «Je höher das Unternehmerrisiko
oder der finanzielle Einsatz», desto mehr spreche für eine GmbH. Die Wahl der Rechtsform sei «eine der strategisch wichtigsten Entscheidungen bei einer Neugründung», betonen die Zürcher Rechtsanwälte Eric Neuenschwander und Sebastian Hepp. Wo die GmbH auf den ersten Blick kapitalmässig als günstigere Variante erscheine, da lediglich ein Stammkapital von mindestens CHF 20‘000 erforderlich ist, könnten «Expansionsstrategien mit externen Investoren, Business Angels oder Venture-Capital-Gesellschaften» doch für die Gründung einer Aktiengesellschaft sprechen. «Professionelle Investoren verlangen fast immer die Rechtsform der Aktiengesellschaft, da diese international bekannt ist und bestimmte Vorteile bietet. So werden insbesondere die Aktionäre im Gegensatz zu den Gesellschaftern einer GmbH nicht im Handelsregister namentlich veröffentlicht. Durch die Wahl der Aktiengesellschaft bereits bei der Gründung lassen sich die Kosten und der Aufwand einer späteren Umwandlung vermeiden.»
Der erste Ärger kommt bestimmt Besonders junge Unternehmen mit wenig Erfahrung können sich oftmals nicht vorstellen, dass direkt in den ersten Geschäftsmonaten rechtliche Schwierigkeiten auftreten. Doch genau das kann der Fall sein. Interne Streitigkeiten, Schadenersatzklagen von beauftragten Dienstleitern, mit deren Leistung man nicht zufrieden ist, Abmahnungen von Mitbewerbern, rechtliche Schwierigkeiten im Personalbereich – die Liste potenzieller Kollateralschäden, die den Arbeitsfluss lähmen und leider auch der Reputation schaden, ist lang. Mit steigender Geschäftstätigkeit steigen die Risiken.
Rechtsanwälte pochen deshalb auf
frühzeitige Abklärungen und Verträge, die Streitbeilegungsmechanismen verankern und Klauseln anpassen – und dabei auch eine neutrale Drittpartei für den Streitfall benennen. Besonders wichtig sei dies «auch für den Fall, dass sich ein Gründer auskaufen lassen möchte und seine Beteiligung übertragen will». Wer hier kein schlüssiges Verfahren der Unternehmensbewertung sowie zur Preisfestsetzung festgelegt hat, muss sich plötzlich wortwörtlich mit unterschiedlichen Preisvorstellungen auseinandersetzen.
Prävention durch Corporate Governance, Versicherungen und Rechtsberatung Dass Start-ups auch dadurch ausgebremst werden, dass einer der Gründer parallel noch andere Geschäfte verfolgt oder sein Firmenwissen einer weiteren Partei zur Verfügung stellt, ist keine Seltenheit. Plötzlich stoppt der Raketenstart und es geht zurück Richtung Erde. Wer dann nicht weiss, ob und wie Verantwortlichkeiten und Erfindungen oder geistiges Eigentum geschützt sind – oder wie dies in einem Vertrag verbindlich festgelegt wurde – kann sich kaum wehren oder die Unternehmung retten. Ein weiterer «Knackpunkt» sind unklare Arbeitsverträge, die bei schnell wachsenden Unternehmen schlecht formuliert werden, Sozialversicherungsbeiträge vergessen, schwammige
Kündigungsklauseln enthalten oder Freelancer falsch einstufen. Vergütungsregeln, die sich auf Aktienoptionen oder Bonus-Zahlungen beziehen, können ebenfalls problematisch sein, wenn es zu einer Kündigung kommt – und nicht klar ist, wie Aktien oder Boni konkret angerechnet werden sollen. So gibt es bereits einige Klagen ehemaliger Mitarbeitender, die Boni-Zahlungen oder Aktienwerte einfordern, weil diese bei der Kündigung bewusst übersehen oder einfach gleich Null gesetzt wurden. Neben Compliance-Management-Systemen, die Verhaltensregeln formulieren, raten Rechtsberatungen deshalb auch dazu, solche Bonus-Zahlungen transparent und jederzeit überprüfbar zu machen. Neben einer obligatorischen Betriebshaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung bleibt eine sorgfältige Buchführung das beste «Tool», um rechtlichen Problemen vorzubeugen. Angesicht der zunehmenden Regulierungen sollten KMU und Start-ups allerdings auch Gesetze und Vorschriften laufend «scannen», um ihre Corporate Governance ab- und anzugleichen. Nicht ist besser, als wenn man in einem immer lauter brummenden Geschäft mit zunehmenden Verkäufen, Anfragen, Rechnungen, Bewertungen, Kündigungen und Neueinstellungen jederzeit vermelden kann: «Es isch alles greglet.»
Die Wahl der Rechtsform sei «eine der strategisch wichtigsten Entscheidungen bei einer Neugründung».
Datenschutzrecht
«Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Tools dem Schweizer Recht entsprechen»
Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasend schnell und «saugt» immer mehr Daten. Was bedeutet das hinsichtlich des revidierten Datenschutzgesetzes für Unternehmen und Betroffene?”
Für die Zürcher Blum & Grob Rechtsanwälte AG erörtern David Schwaninger, Elisabeth Niederstetter und Simon Fritsch die Lage.
Frau Niederstetter, Herr Schwaninger, Herr Fritsch, wie wirkt sich das revidierte Datenschutzgesetz (DSG) auf die Nutzung von KI-Anwendungen aus?
David Schwaninger: Dass Personendaten geschützt werden müssen, ist im Grunde nicht neu. Was die Arbeit mit KI-Tools oder -Diensten allerdings erschwert, ist die Tatsache, dass in KI eingegebene Daten an Drittanbieter gehen. Hierüber muss nach Schweizer Recht die betreffende Person informiert werden. Auch wenn Drittanbieter Personendaten für Trainings verwenden, müssen die betreffenden Personen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Bei kostenlosen KI-Anbietern ist es jedoch schwierig, sicherzustellen, dass sie nach Schweizer Recht arbeiten. Aus Datenschutzsicht am einfachsten wäre es deshalb, erst gar keine Personendaten in KI-Systeme einzugeben. Simon Fritsch: Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) hat darauf hingewiesen, dass das Schweizer Datenschutzgesetz auf KI-gestützte Datenbearbeitungen direkt anwendbar ist. Auch wenn das eigentlich klar ist, hat der EDÖB damit ein klares Zeichen an Hersteller, Anbieter und Verwender gesendet, dass sie die Rechte der betroffenen Personen, mit deren Daten KI-Anwendungen gefüttert werden, sicherstellen müssen. Ein klares Signal an jedes Unternehmen, das KI nutzt.
Sie sehen den Input, also die erste Stufe der KI-Nutzung, als zentrale Herausforderung. Warum?
DS: Der Input ist entscheidend, denn hier werden die Daten eingegeben, mit denen die Systeme dann arbeiten. Das heisst: Personendaten können automatisch weitergeleitet oder zu Trainingszwecken verwendet werden. Und schon haben Sie nach Schweizer Recht als Unternehmen ein Problem.
SF: Auch der Output kann Probleme verursachen. So haben Personen beispielsweise einen klaren Anspruch darauf, dass falsche Daten korrigiert werden müssen. Wenn ich also Daten aus dem Output verwende, sollte ich dessen Richtigkeit immer überprüfen.
Elisabeth Niederstetter: Die Nutzung von KI-Chatbots, wie ChatGPT, kann ebenfalls eine Herausforderung darstellen. Gerade erst tauchten – aufgrund

Die Schweizer Wirtschaftskanzlei Blum & Grob berät Privatkunden und Unternehmen bei allen Fragestellungen des Wirtschaftsrechts. David Schwaninger ist seit 2008 bei der Zürcher Kanzlei, Simon Fritsch seit Sommer 2023 und Elisabeth Niederstetter seit Sommer 2024. Alle drei sind Experten für Immaterialgüterrecht & IT-Recht, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht. Schwaninger ist ausserdem auf Verwaltungs-, Bau- und Immobilienrecht fokussiert.
Mehr Informationen unter blumgrob.ch
einer mittlerweile von ChatGPT eingestellten Funktion - Chatverläufe eines italienischen Anwalts, der KI-Unterstützung bei einem heiklen Mandat suchte, bei Google auf. Abgesehen davon, dass auch die konkreten Sachverhalte und von ChatGPT vorgeschlagene Beratungsansätze in der Öffentlichkeit landeten, zeigt dieses Beispiel, dass Eingaben in ChatGPT fälschlicherweise als privat angesehen werden. Auch Fragen an ChatGPT sind aktive Eingaben, die bearbeitet werden. Entsprechend müssen Mitarbeitende in Unternehmen dazu sensibilisiert werden. Auf Userseite muss klar sein, dass, wenn Personendaten eingegeben werden, die angeforderten Ergebnisse wieder Personendaten ausgeben können und womöglich von anderen Personen eingesehen werden können.
Was können Unternehmen konkret tun, um entsprechend des Datenschutzgesetzes mit KI zu operieren?
DS: Es gibt drei Punkte zur konkreten Vorgehensweise. Erstens sollten Sie als Unternehmen grundsätzlich keine Personendaten in eine KI eingeben, ohne sichergestellt zu haben, dass der Datenschutz gewährleistet wird. Entsprechende Angebote gibt es. Zweitens müssen Sie sicherstellen, dass bei der Auftragsdatenbearbeitung, also beim Auslagern der Bearbeitung von Personendaten an einen externen Dienstleister, ebenfalls das Datenschutzgesetz eingehalten wird. „Drittens: Sollten die Personendaten ins Ausland gehen, muss ein nach Schweizer Recht angemessener Datenschutz gewährleistet sein. In der EU ist das beispielsweise der Fall. Ansonsten gibt es dazu auch Standardvereinbarungen. Am besten ist es natürlich, wenn die Daten in der Schweiz bleiben.



EN: Die Unternehmen müssen sich auch vergegenwärtigen, dass Rückschlüsse auf Personen nicht nur über den Namen möglich sind. Personendaten sind alle Daten, durch die eine Person bestimmbar wird. Oftmals wird vergessen, dass auch weitere Attribute oder Adressen Hinweise auf ganz bestimmte Personen geben können. Anonymisierungen müssen so erfolgen, dass sie wirklich keinerlei Rückschlüsse auf konkrete Personen zulassen. SF: Man sollte als Unternehmen sicherstellen können, dass beim jeweiligen Anbieter technische und vertragliche Grenzen gesetzt sind. Natürlich wären lokale Systeme besser. Aber um diese zu installieren und aktiv zu betreiben, müssen Sie einigen Aufwand betreiben und entsprechende Kosten einplanen. Da das viele Unternehmen nicht wollen, greifen sie auf die grossen Anbieter zurück. Das schützt aber nicht davor, dass man sich mit den vertraglichen Bedingungen und technischen Abläufen dieser Anbieter auseinandersetzen sollte. Was muss sich beim Arbeitsalltag in Unternehmen ändern?
SF: Studien zufolge nutzt mindestens fast jeder zweite, der an einem PC arbeitet, mittlerweile KI. Die Dunkelziffer ist sicher höher. Denn: KI ist an fast allen Arbeitsplätzen und für jedermann verfügbar. Um zu verhindern, dass die Anwendungen oder Tools unwissend
mit Daten gefüttert werden, sollten Unternehmen alle Mitarbeitenden im Umgang mit KI schulen. Das richtige Verhalten im Umgang mit dem Datenschutz ist also sicher auch eine Bildungsfrage der Mitarbeitenden. Es braucht interne Weisungen und Schulungen. Dabei ist es wichtig, möglichst breit zu schulen und alle Mitarbeitenden ins Boot zu holen. Dabei sollte, wie von Frau Niederstetter schon hervorgehoben, deutlich gemacht werden, was alles Personendaten im rechtlichen Sinne sind. Ein weiteres Ziel sollte sein, dass alle Mitarbeitenden verstehen, wie Daten nach draussen dringen – und eigentlich jeder ein Interesse daran haben sollte, geschäftsinterne wie Personendaten zu schützen.
EN: Der Arbeitgeber sollte als Lead fungieren. Die Chefetage muss vorleben, wie KI-Tools verantwortungsbewusst genutzt werden. Da sich KI immer weiterentwickelt, müssen wir auch davon ausgehen, dass immer mehr Mitarbeitende KI-Tools nutzen – auch privat. Hier müssen Unternehmen die Mitarbeitenden sensibilisieren, dass Unterschiede zwischen geschäftlicher Nutzung und Nutzung zum persönlichen Gebrauch bestehen. Auch über mögliche Haftungsrisiken und Strafen müssen alle Mitarbeitenden Bescheid wissen. Datenschutz sollte Teil der Unternehmens-Compliance sein. Das lässt sich auch als Chance begreifen.
Bei kostenlosen KI-Anbietern ist es jedoch schwierig, sicherzustellen, dass sie nach Schweizer Recht arbeiten.
Wie müssen sich Unternehmen auf die Auskunftspflicht vorbereiten?
SF: Man sollte die Auskunftspflicht auf jeden Fall ernst nehmen. Eine Auskunft sollte aus Angst nicht voreilig erteilt werden, sondern es sollte erst einmal geprüft werden, was die Pflicht alles genau umfasst. Das DSG sieht nämlich vor, dass eine falsche oder unvollständige Auskunft hohe Bussen nach sich ziehen kann. Man sollte sich im Zweifelsfalle also rechtlich beraten lassen.
Raten Sie dazu, dass Unternehmen vermehrt Datenschutzbeauftragte oder Datenschutz-Teams installieren? EN: Jedes Unternehmen sollte wissen: Welche Personendaten bearbeiten wir genau – und mit welchen Anbietern oder Tools? Wenn man keinen eigenen Datenschutzberater hat, sollte man sich extern beraten lassen – auch um ein gewisses System oder eine bestimmte Vorgehensweise mit der Eingabe von Daten zu etablieren. SF: Sie brauchen als Unternehmen jemanden, der geschult ist und Ihre Prozesse kennt. Das können auch wir als Anwälte sein. Viele Unternehmen, speziell KMU, denken, dass sie die Datenbearbeitungen nicht sonderlich beachten müssen. Aber viele Unternehmen leben mittlerweile von Daten und automatisierter Kommunikation. Wenn Sie da sehr aktiv sind, beispielsweise bei einer intensiven Kundenansprache, sollten Sie unbedingt einen Datenschutzberatenden in der Nähe haben, egal ob intern oder extern. Dabei sollte einem bewusst sein, dass jede Prozessänderung im Unternehmen auch Einfluss auf allfällige Datenbearbeitungen haben kann. Der Datenschutz ist kein einmaliger Aufwand, sondern eine dauerhafte Verantwortung.
Steckbrief
Elisabeth Niederstetter Rechtsanwältin
David Schwaninger Partner, Rechtsanwalt
Simon Fritsch Rechtsanwalt

Vor allem dürfen Daten natürlicher Personen «nur für einen bestimmten, erkennbaren Zweck erhoben und bearbeitet werden und müssen danach vernichtet oder anonymisiert werden». Was bedeutet das für Datenbanken, automatisierte Dienste und nachgelagerte Beratungsunternehmen?
URTEIL 1
ZAMIS-Datenberichtigung zum Geburtsjahr (Schweiz) Das Bundesgericht in Lausanne hatte sich Mitte Mai (BGer 1C_200/2025) mit der Frage zu befassen, ob das im Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS) eingetragene Datum eines afghanischen Asylsuchenden berichtigt werden muss, nachdem das Bundesverwaltungsgericht dies bereits abgelehnt hatte und über das Staatssekretariat für Migration ein Nichteintretensentscheid ergangen war. Konkret lagen zwei unterschiedliche Jahresdaten zur Geburt des Asylsuchenden vor. Einmal das, das das Staatssekretariat für Migration aufgrund eines forensischen Altersgutachtens eingetragen hatte und das bei seiner Einreise in Bulgarien und Österreich ähnlich vermerkt worden war. Daneben gab es ein zweites Datum, das direkt vom Asylsuchenden und Beschwerdeführer stammte und ihn ein Jahr jünger machte. Das Bundesgericht stellte fest, dass «die Bundesbehörde, die Personendaten bearbeitet», die Richtigkeit der bearbeiteten Daten zu beweisen habe, «wenn sie von einer betroffenen Person bestritten wird». «Der betroffenen Person, die ein Gesuch um Berichtigung von Personendaten stellt, obliegt dagegen der Beweis der Richtigkeit der verlangten Änderung. Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten bewiesen werden, so muss das Bundesorgan bei den Daten einen entsprechenden Vermerk anbringen (Art. 41 Abs. 4 DSG). Spricht mehr für die Richtigkeit der von einer betroffenen Person verlangten
Der Kampf mit den Daten
Datenschutzverstösse können teuer werden – und beschäftigen diverse Gerichte und Behörden. Drei aktuelle Urteile zeigen, wie Datenschutz branchen- und länderübergreifend immer mehr den Arbeitsalltag bestimmt.
Änderung, sind die Personendaten zu berichtigen und ebenfalls mit einem derartigen Vermerk zu versehen.» Als richtiges Datum, so das Bundesgericht, sei jedoch das Datum mit der «überwiegenden Wahrscheinlichkeit» anzusehen, in diesem Fall also das mittels einer Untersuchung festgestellte Geburtsjahr, das dann im ZEMIS eingetragen wurde.
Nicole Beranek Zanon und Corinna Stubenvoll von der Kanzlei Härting sehen in den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts «einen bedeutenden Schritt zur Konkretisierung der neuen datenschutzrechtlichen Vorgaben in der Schweiz. Sie schärfen die Anforderungen an die Beweisführung, machen die Rolle medizinischer Gutachten deutlich und stellen klar, dass auch ungeklärte Daten unter bestimmten Bedingungen genutzt werden dürfen – unter Wahrung der Transparenzpflicht.»
URTEIL 2
Bussgelder gegen Finanzunternehmen wegen unzureichender Auskunft (Deutschland)
Wegen Verstössen gegen die Rechte betroffener Kundinnen und Kunden bei automatisierten Kreditkartenentscheidungen muss ein «Unternehmen aus der Finanzwirtschaft» 492.000 Euro zahlen. «Trotz guter Bonität», so der urteilende Hamburgische Beauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) Ende September, «waren die Kreditkartenanträge mehrerer Kundinnen und Kunden mittels automatisierter Entscheidungen abgelehnt worden – dabei handelt es sich um Entscheidungen, die auf der Grundlage von Algorithmen und ohne menschliches Eingreifen maschinell getroffen werden.» Als die Betroffenen eine Begründung für die Ablehnung sehen wollten, «erfüllte das Unternehmen seine gesetzlich vorgegebenen Informations- und Auskunftspflichten nicht ausreichend». Zur Veröffentlichung des Urteils unterstrich der Datenschutzbeauftragte die «besonderen Risiken für die Rechte und Freiheiten» der von automatisierten Entscheidungen betroffenen Personen. So gehe es auch darum, «die involvierte Logik» automatisierter Entscheidungen darzulegen und transparent zu machen. Wörtlich gab Thomas Fuchs, der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu bedenken: «Wenn Unternehmen auf Auskunftsund Informationsansprüche systematisch nicht oder nur unzureichend reagieren, ist eine spürbare Sanktion geboten. Dies gilt insbesondere bei Strukturen, die für die Betroffenen undurchsichtig sind, wie Adresshandel oder komplexe Entscheidungsalgorithmen – und immer mehr auch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Entscheidet eine Software über Menschen,
muss die verarbeitende Stelle die tragenden Gründe verständlich erklären können.»
Simeon Boltjes von der Datenschutzkanzlei Herting Oberbeck: «Automatisierte Entscheidungsverfahren unterliegen strengen Anforderungen der DSGVO, insbesondere im Hinblick auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Unternehmen sind verpflichtet, betroffenen Personen aussagekräftige Informationen über die Entscheidungslogik bereitzustellen. Eine unzureichende Erfüllung dieser Pflichten kann zu erheblichen Sanktionen führen, selbst bei grundsätzlich rechtmässiger Datenverarbeitung.»
URTEIL 3
Weitergabe personenbezogener Daten nach Pseudonymisierung (Spanien) Im September stellte der Europäische Gerichtshof (62023CJ0413) fest, dass pseudonymisierte Daten weiterhin als personenbezogene Daten gelten, wenn sie an Dritte weitergegeben werden. Hintergrund des Urteils ist eine Untersuchung zur Abwicklung der Banco Popular Español durch das Single Resolution Board der EU. Die Frage war, ob ehemalige Aktionäre der Bank einen Anspruch auf Entschädigung haben. Die Stellungnahmen der Betroffenen wurden in pseudonymisierter Form vom SRB an ein grosses Beratungsunternehmen weitergegeben. Mehrere Betroffene mahnten anschliessend an, dass sie einer Weitergabe ihrer Daten nicht zugestimmt hätten. Nachdem der EU-Datenschutzbeauftragte
einen Verstoss gehen die DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) festgestellt hatte, legte das SRB Einspruch ein. Der EuGH folgte diesem Einspruch zunächst, um ihn nun doch wieder aufzuheben. Massgeblich sei die Sicht des ursprünglich Verantwortlichen und Datensammelnden, also des SRB, der Daten eben doch bestimmten Personen zuordnen könne und Betroffene über eine von Anfang an geplante Weitergabe informieren müsse. Im Urteil heisst es: «Einer Pseudonymisierung unterzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, sollten als Informationen über eine identifizierbare natürliche Person betrachtet werden. Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern.»
«Der EuGH hat die Verantwortung eindeutig beim Datenverarbeiter verortet», schreibt dazu Unternehmensberater Philipp Herold. «Unternehmen sind auch bei pseudonymisierten Daten dazu verpflichtet, die Anforderungen der DSGVO einzuhalten. Wer hier sauber dokumentiert, transparent informiert und technische Massnahmen mit organisatorischen Pflichten kombiniert, reduziert rechtliche Risiken und stärkt gleichzeitig das Vertrauen von Kunden, Partnern und Mitarbeitern.»
«Unternehmen sind auch bei pseudonymisierten Daten dazu verpflichtet, die Anforderungen der DSGVO einzuhalten.»
Finanzmarkt- und Gesellschaftsrecht
« Rechtssicherheit ist ein Standortvorteil»
Eric Neuenschwander und Sebastian Hepp, beide Partner bei der Kanzlei Zürcher Rechtsanwälte AG, über die aktuellen juristischen Fragestellungen im Finanzmarkt- und Gesellschaftsrecht.
Herr Hepp, Sie sind seit Herbst 2025 Partner der Kanzlei und auf Finanzmarktrecht spezialisiert. Was für Unternehmen beraten Sie?
Einerseits berate ich Unternehmen im traditionellen Finanzmarkt, wie z.B. Vermögensverwalter, Finanzdienstleister oder Finanzintermediäre bei der Einholung von Bewilligungen, der erfolgreichen Umsetzung neuer Geschäftsmodelle sowie beim Aufbau der internen Compliance-Struktur. Andererseits unterstütze ich Start-ups und etablierte Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle im Blockchain- und FinTech-Bereich. Im Vordergrund steht dabei stets die Frage, ob diese Geschäftsmodelle überhaupt der Finanzmarktregulierung unterstehen und falls ja, welche Bewilligungen dafür erforderlich sind. Besonders spannend ist für mich der Austausch und die Zusammenarbeit mit Klienten, die kreative Ideen und Visionen für die Modernisierung des Finanzmarktes einbringen.
Wo liegen die Herausforderungen oder auch Probleme im Blockchain- und FinTech-Bereich?
Gerade für Anwälte stellt das erforderliche technische Know-how eine besondere Herausforderung dar. Reine Expertise im Finanzmarktrecht genügt nicht, um Klienten im Blockchain- und FinTech-Bereich kompetent beraten zu können. Erforderlich ist vielmehr ein vertieftes Verständnis der zugrunde liegenden technischen Abläufe. So muss ein Anwalt z.B. die Funktionsweise von Smart Contracts in einer DLT-basierten Applikation im DeFi-Bereich im Detail verstehen, um das Geschäftsmodell regulatorisch korrekt einzuordnen.
Stichwort: Crypto Valley. Die Schweiz war am Anfang bei Krypto-Währungen ganz vorne mit dabei – und will nun wieder an diese Zeit anschliessen. Was bedeutet das für den Finanzplatz und für internationale Gründer und Investoren?
Die Schweiz hat schon früh eine Vorreiterrolle bei der Regulierung von DLTbasierten Geschäftsmodellen übernommen. Besonders hervorzuheben sind die ICO-Wegleitung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) aus dem Jahr 2018 mit der weltweilt ersten Einführung verschiedener Token-Kategorien sowie das Inkrafttreten des DLT-Gesetzes im Jahr 2021, das unter anderem die Registerwertrechte in das Schweizer Rechtssystem eingeführt hat. Ein solch verlässlicher Rechtsrahmen war international einmalig und hat dazu geführt, dass zahlreiche internationale Gründer ihre Start-ups in der Schweiz ansiedelten und sich das Crypto Valley zu einem weltweit führenden Blockchain-Hub entwickeln konnte.
Allerdings holen andere Jurisdiktionen wie z.B. die EU mit der MiCA oder auch die USA mit zunehmend kryptofreundlichen Regulierungsansätzen in Bezug auf die Standortattraktivität für Krypto-Unternehmen immer stärker auf. Die Schweiz darf sich daher nicht auf ihren bisherigen Erfolgen ausruhen. Umso wichtiger sind Initiativen wie jene der drei Krypto-Branchenverbände Swiss Blockchain Federation, Crypto Valley Association und Bitcoin Association, die erst kürzlich ein starkes Positionspapier zur Stärkung der
Die Schweiz zieht weltweit Gründer aus dem Blockchainund FinTech-Bereich an – und wird vor allem von Gründern mit innovativen Geschäftsmodellen im Finanzbereich aufgrund ihrer Rechtssicherheit sehr geschätzt.


Innovationskraft des Schweizer Finanzplatzes veröffentlicht haben. Gleichwohl verfügt die Schweiz weiterhin über erhebliche Standortvorteile gegenüber anderen Jurisdiktionen wie etwa der EU. Während die Einholung einer MiCA-Lizenz in der EU mit beträchtlichem Aufwand und sehr hohen Kosten verbunden ist, können in der Schweiz Geschäftsideen im Blockchain- oder FinTech-Bereich allenfalls ganz ohne Bewilligung oder mit einem einfachen Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetzgebung umgesetzt werden, womit die regulatorischen Hürden und Kosten deutlich geringer sind. Da viele KryptoStart-ups in der Regel mit einem MVP beginnen, bietet die Schweiz nach wie vor ideale Rahmenbedingungen, um die Marktfähigkeit des Produktes zuerst in der Schweiz zu testen und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen Markt einzutreten.
Herr Neuenschwander, welche Fragen beim Gesellschaftsrecht beschäftigen derzeit Ihre Mandantinnen und Mandanten?
Wir erleben in unserer Beratungspraxis derzeit, dass die Schweiz nach wie vor ein sehr attraktiver Standort für die Gründung von Gesellschaften ist – gerade auch für Unternehmen im Bereich Blockchain, Crypto und Finanzmarktlösungen. Allerdings bestehen im Gesellschaftsrecht nach wie vor hohe Hürden, die junge Gesellschaften fordern. Besonders herausfordernd sind die Fragen rund um die Finanzierung und die Bewertung von Aktien bei Start-ups,
wo sich rechtliche und wirtschaftliche Überlegungen eng verzahnen. Hinzu kommt, dass in diesen Branchen neben dem Gesellschaftsrecht auch das Arbeitsrecht und das Steuerrecht eine zentrale Rolle spielen – sei es bei der Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen oder bei der steuerlichen Behandlung von Tokens und anderen innovativen Finanzinstrumenten. Diese Schnittstellen machen die Beratung komplex, aber auch spannend.
Verändern die globalen Krisen samt plötzlichen Regulierungen oder Strafzöllen auch die Übernahmen und Transaktionen? Wie ändert sich dabei der längerfristige rechtliche Fokus? Transaktionen sind heute wesentlich stärker von geopolitischen und regulatorischen Risiken geprägt als noch vor wenigen Jahren. Sanktionen, Exportkontrollen oder auch Fragen des Marktund Standortzugangs gehören inzwischen zu den zentralen Punkten einer Due Diligence. Gerade auch neue Regulierungen – insbesondere im Blockchain-Bereich, aber auch Datenschutz – verändern den Übernahmemarkt
Zürcher Rechtsanwälte
Steckbrief
Als Full-Service Kanzlei bietet die Kanzlei Zürcher Rechtsanwälte AG Privatpersonen und Unternehmen umfassende
Rechtsberatung in einer Vielzahl von Rechtsgebieten, wie z.B. Arbeitsrecht, Vertragsrecht, öffentliches Recht, Prozessrecht und Immobilienrecht. Damit kann sichergestellt werden, dass individuelle, praxisnahe und lösungsorientierte Strategien für Unternehmen jeder Grösse zu finden.
Eric Neuenschwander
Eric Neuenschwander ist seit 2023 Partner der Zürcher Rechtsanwälte AG und dort auf gesellschaftsrechtliche und
spürbar. In der Vertragsgestaltung sehen wir deshalb einen Trend hin zu flexiblen Anpassungsmechanismen: Käufer verlangen Klauseln, die auf unvorhersehbare Regulierungen oder Handelsbarrieren reagieren können (Stichwort MAC-Klauseln), während Verkäufer weiterhin auf Planungssicherheit setzen. Langfristig verändert sich damit der Fokus: Investoren suchen nicht mehr nur nach steuerlichen Vorteilen oder Kostenstrukturen, sondern vor allem nach Standorten mit Rechtssicherheit, stabiler Regulierung und planbarer Politik. Die Schweiz bietet hier einen klaren Standortvorteil. Sie verbindet Neutralität und verlässliche Rahmenbedingungen mit Offenheit für Innovation, unter anderem natürlich im Bereich FinTech. Diese Mischung macht den Standort in einem zunehmend volatilen Umfeld besonders attraktiv.
Sie unterstützen Gründerinnen und Gründer in allen Phasen und waren selbst Deputy General Counsel in einem Blockchain Start-Up. Wo treten derzeit die grössten Unsicherheiten oder Probleme auf?
«Die Schweiz bietet einen klaren Standortvorteil. Sie verbindet Neutralität und verlässliche Rahme-bedingungen mit Offenheit für Innovation.»
transaktionsbezogene Kompetenz, etwa im Bereich M&A, bei Start-ups und in der Prozessführung, spezialisiert. Er ist zudem bekannt für seine ganzheitliche juristische Beratung.
Sebastian Hepp Sebastian Hepp ist seit 1. Oktober 2025 Partner bei der Zürcher Rechtsanwälte AG. Er ist spezialisiert auf Blockchainund Finanzmarktrecht und berät insbesondere Start-ups, etablierte Finanzinstitute und Technologieunternehmen im Blockchain-/FinTech-Bereich.
Mehr Informationen unter zurich-law.ch
Die grössten Unsicherheiten für Gründerinnen und Gründer liegen derzeit beim Zugang zu Finanzierung und in der Regulierung digitaler Geschäftsmodelle. Kapital ist zwar vorhanden, Investoren prüfen aber deutlich strenger: Längere Prozesse, komplexere Beteiligungsverträge und der Trend zu Downrounds erhöhen den Beratungsbedarf bei entsprechenden Verträgen. Hinzu kommen regulatorische Herausforderungen – insbesondere für FinTechs und Krypto-Unternehmen. Themen wie Geldwäschereiregeln, Tokenisierung, aber auch neue europäische Vorgaben wie MiCA oder der AI Act wirken bis in die Schweiz hinein. Wer international tätig ist, muss Compliance-Fragen sehr früh auf der Agenda haben. Neben Finanzierung und Regulierung sehen Gründerinnen und Gründer derzeit vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz neue Unsicherheiten. AI eröffnet enorme Chancen für digitale Geschäftsmodelle, wirft aber komplexe rechtliche Fragen auf. Gerade junge Unternehmen müssen deshalb früh eine klare IP und Datenschutz-Strategie entwickeln. Investoren achten heute sehr genau darauf, ob Rechte an Algorithmen, Daten oder Modellen sauber zugeordnet und vertraglich gesichert sind. Wir erleben immer wieder, dass die juristische Begleitung nicht nur in der Gründungsphase besonders wichtig ist, sondern auch dann, wenn ein Start-up wächst, Governance-Strukturen professionalisiert und die erste Gründergeneration abgelöst wird. In dieser Phase entscheidet sich oft, ob ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich bleibt.
Sebastian Hepp Partner, Rechtsanwalt, MLaw
Eric Neuenschwander Partner, Rechtsanwalt, MLaw, LL. M. (Columbia)
Steckbrief

KPMG
KPMG gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in der Schweiz mit gut etablierten lokalen Standorten und einem starken globalen Netzwerk. KPMG Law, der Rechtsberatungsarm von KPMG mit weltweit über 3‘600 RechtsexpertInnen, unterstützt Kunden aus unterschiedlichen Branchen mit Rechtsdienstleistungen, die neue Möglichkeiten eröffnen und zu wirtschaftlicheren Ergebnissen führen.
Adrian Tüscher
Als Leiter von KPMG Law Schweiz ist
Adrian Tüscher in ständigem Austausch mit Rechtsabteilungen von Unternehmen verschiedenster Grössen und Industrien in der Schweiz. In seiner Rolle als Mitglied des Steering Committees von KPMG Global Legal Services erhält er zudem Einblick in weltweite Trends in der Rechtsindustrie. Tüscher tritt regelmässig als Referent an diversen Seminaren und Veranstaltungen auf und hat in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften publiziert. Zudem ist er Co-Autor eines Buches über rechtliche Aspekte bei internationalen Mitarbeitereinsätzen und CAS-Dozent für Arbeits- und Aufenthaltsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

«Messbare Erfolge von KI hängen stark davon ab, dass Prozesse, Rollen und Datenflüsse vorher geklärt sind.»
Adrian Tüscher ist Leiter KPMG Law Schweiz. Zusammen mit seinem Team von Anwältinnen und Anwälten berät er nationale und internationale Kunden in sämtlichen Belangen des Wirtschaftsrechts und der Optimierung von Legal Operations.
VON RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
Im Interview erläutert Tüscher, wie Künstliche Intelligenz die Rechtsberatung bereits verändert – und noch verändern wird.
Herr Tüscher, wie sehr beschäftigt das Thema KI bereits die Rechtsabteilungen?
KI ist in den Rechtsabteilungen bereits ein bedeutender Faktor. Wir beobachten einen spürbaren Produktivitätsgewinn, insbesondere dort, wo KI in klar abgegrenzten Anwendungsfeldern eingesetzt wird. Wichtig ist allerdings, dass der Einsatz von KI den Prozessen folgt und nicht umgekehrt. Viele Enttäuschungen entstehen, wenn Tools ohne vorheriges Prozessmapping eingeführt werden und niemand so genau weiss, wann und wie sie eigentlich eingesetzt werden sollen. Dies führt nicht nur zu Integrationsproblemen, sondern nimmt gerade bei hoher Adaptionsrate den erhofften Effizienzgewinn. Am Ende bleibt oft Frustration zurück – und eine Bestätigung jener Skepsis, die viele Juristinnen und Juristen gegenüber Technologie leider immer noch haben.
Wo sehen Sie besondere Chancen, aber auch Hürden für den Einsatz von KI?
Besondere Chancen sehe ich vor allem darin, hochvolumige, eher einfache Routineaufgaben zu unterstützen oder sogar zu automatisieren. Die grössten Hürden liegen meines Erachtens vor allem in der fehlenden Integration und der Notwendigkeit, Prozesse vor der Einführung von KI klar zu definieren. Messbare Erfolge von KI hängen stark davon ab, dass Prozesse, Rollen und Datenflüsse vorher geklärt sind.
Was verändert sich in Unternehmen hinsichtlich der Prozesse, Arbeitsweisen oder strategischen Entscheidungen?
KI ist eine Technologie, die Unternehmen und ihren Rechtsabteilungen unter anderem hilft, effizienter zu arbeiten. KI eignet sich insbesondere für Erstrecherchen, die Erstellung, den Abgleich oder die Zusammenfassung verschiedener Dokumente wie Verträge, Vertragsvorlagen, interne Richtlinien und Playbooks sowie für die Bearbeitung von Kunden-Onboarding-Prozessen.
KI ist aber in den derzeit verfügbaren Versionen eben gerade keine Prozessmanagementtechnologie, auch wenn das Verketten von KI-Personas und KI-Agenten Prozesse teilweise bereits
ziemlich umfassend abbilden können. Strategisch gesehen sollte der Einsatz von KI meines Erachtens daher als integraler Bestandteil der Unternehmensprozessarchitektur und nicht als Treiber für Letztere betrachtet werden.
Welche Anwendungsfälle von KI haben sich bereits bewährt?
Neben den bereits erwähnten hochvolumigen Arbeiten geringer Komplexität bewähren sich in der Praxis von Rechtsabteilungen derzeit vor allem die Unterstützung von Matter Tracking, Ausgaben-Management und Legal Horizon Scanning sowie dazugehöriges Impact Assessment. Diese Anwendungsfälle zeigen, wie KI die Effizienz und Transparenz in Rechtsabteilungen bereits substanziell steigern kann.
Der Einsatz von KI betrifft das ganze Unternehmen. Was bedeutet das für die Rechtsberatung und die Anleitung jedes einzelnen Mitarbeitenden, der rechtssicher handeln können sollte?
Für die Rechtsberatung bedeutet dies, dass ein fundiertes Verständnis und klare Leitlinien für den rechtssicheren Umgang mit KI notwendig sind. Der präzise Umgang mit Sprache gehört zu den Kernkompetenzen von Juristinnen und Juristen, weshalb sie in der Lage sein sollten, KI effizient zu nutzen. Ein gezieltes Training und die Möglichkeit, mit KI zu experimentieren, sind aber entscheidend, um Berührungsängste abzubauen und die Produktivität zu steigern. In der Praxis beobachten wir oft, dass die Rechtsabteilung nicht nur im rechtssicheren, sondern gerade auch im effizienten Umgang mit KI oftmals eine Vorreiterrolle im Unternehmen übernimmt – eine Rolle, die sie meiner Meinung nach auch einnehmen sollte.
Wie kann ein solches Upskilling der Mitarbeitenden durchgehend gelingen? An wen können sich Mitarbeitende im Zweifelsfall wenden, wenn sie Fragen haben?
Upskilling gelingt durch gezieltes Training, praktisches Experimentieren mit KI und den Austausch über Anwendungsfälle. Gerade Letzteres beschleunigt die Lernkurve deutlich. Wie bereits erwähnt, macht der Einsatz von KI einen Prozess jedoch nicht automatisch effizienter. Daher halte ich es für ebenso wichtig, das Upskilling auf das Verständnis und die Steuerung von Prozessen zu richten. Hier sehe ich den grössten Trainingsbedarf bei Juristinnen und Juristen – deutlich höher als beim direkten Umgang mit KI.
Noch einmal zur Strategie, die mit KI verfolgt werden sollte. Was müssen Unternehmen bedenken, wenn sie KI selbst entwickeln oder entwickeln lassen, oder «Fertiglösungen» von externen Anbietern einkaufen?
Neue KI-basierte Legal-Tech-Lösungen schiessen derzeit wie Pilze aus dem Boden und bieten oft beeindruckende Funktionen. Häufig erfüllen sie jedoch nicht die spezifischen Anforderungen von Unternehmen und Rechtsabteilungen zur Unterstützung bestehender Prozesse. Viele Lösungen sind zudem oft mit unnötigen Funktionen überladen, was Juristinnen und Juristen abschrecken oder gar überfordern kann. Massgeschneiderte Technologien bieten in der Praxis daher klare Vorteile. Entscheidend für eine nachhaltige und erfolgreiche Umsetzung bleibt jedoch in jedem Fall eine klare Definition von Prozessen, Governance und Schnittstellen.
Lässt sich pauschal sagen, ob das Rechtsrisiko bei Eigenentwicklung oder Kauf grösser ist?
Nein, das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das grösste Risiko bei Eigenentwicklungen besteht darin, dass nach der Einführung oft vergessen wird, Technologie, Personal und Prozesse angesichts des rasanten technologischen Fortschritts kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Eine zentrale Herausforderung für Rechtsabteilungen ist in diesem Zusammenhang zudem, Mitarbeitende ohne klassischen juristischen Hintergrund oder Tätigkeitsbereich zu binden und zu entwickeln, da es hier oft noch an Karrierewegen fehlt. Eine spannende Alternative bieten sogenannte Legal Managed Services (LMS) – ein Trend, der gerade aus den USA nach Europa und in die Schweiz kommt. Mit LMS
können diese oft unterschätzten, über die Erstimplementierung hinausgehenden Herausforderungen komplett an einen Anbieter ausgelagert werden. Deshalb bauen wir von KPMG Law unser LMS-Angebot derzeit stark aus. Wie sollte KI in den nächsten Jahren eingesetzt werden? Was werden die nächsten Entwicklungen sein? Nach unserer Beobachtung geht der Trend klar zu unternehmensweiten Lösungen. KI wird zunehmend als zentraler Bestandteil der Unternehmensarchitektur mit klar definierten Schnittstellen zu Bereichen wie Legal integriert. Im Fokus stehen somit horizontale Plattformen, die Prozess- und Datenkonsistenz sowie Governance abteilungsübergreifend erleichtern und harmonisieren. Vertikale Speziallösungen wie Legal Tech bleiben wichtig, aber als punktuelle Module innerhalb einer solchen Architektur. In der Praxis werden wir daher wohl vermehrt Lösungen sehen, die KI mit Low-Code kombinieren.
Braucht die KI einen eigenen KIRechtsdienst oder einen KI-Check, wenn sie sich immer weiter in die Unternehmen und deren Daten –und damit auch in Unternehmensgeheimnisse oder andere sensible Informationen – hineinarbeitet? Einen eigenen KI-Rechtsdienst braucht es wohl kaum. Soweit es um die Einhaltung rechtlicher Vorgaben und das Management von rechtlichen Risiken rund um den Einsatz von KI im Unternehmen geht, reicht meines Erachtens ein vertikaler Ansatz innerhalb der bestehenden Rechtsabteilung absolut aus. Dies auch im Einklang mit dem Ansatz des Schweizer Gesetzgebers, der derzeit auch keine Notwendigkeit für eine horizontale KI-Regulierung sieht.
«KI ist eine Technologie, die Unternehmen und ihren Rechtsabteilungen unter anderem hilft, effizienter zu arbeiten. KI eignet sich insbesondere für Erstrecherchen, den Abgleich oder die Zusammenfassung.»
Gute Tech Law Skills, ein ausgeprägtes Grundverständnis für die Funktionalitäten und praktischen Anwendungsfälle werden aber innerhalb der Rechtsabteilung sicherlich an Bedeutung gewinnen, sowohl für eine sorgfältige Technologie-Einführung als auch zur Gewährleistung fortlaufender Compliance mit den wachsenden nationalen und internationalen KI-Regulierungen. Je nach Entwicklung der Letzteren könnte ein regelmässiger KI-Compliance-Check künftig durchaus einen festen Platz auf der Compliance Roadmap einnehmen.
Denken Sie, dass KI Einstiegspositionen in der Rechtsbranche verschwinden lässt? Wie werden dann zukünftige Juristinnen und Juristen die notwendige Ausbildung erhalten, um Resultate von KI kritisch prüfen zu können? Die rasante Entwicklung von KI verändert die traditionellen Einstiegspositionen in der Rechtsbranche wohl tatsächlich grundlegend. Ich glaube jedoch nicht, dass diese Rollen vollständig verschwinden werden – vielmehr wandeln sie sich. Die Aufgaben werden anspruchsvoller und erfordern zunehmend technologische und analytische Kompetenzen. Für die Ausbildung der nächsten Generation von Juristinnen und Juristen bedeutet das, dass klassische Tätigkeiten wie Dokumentenprüfung oder Recherche zwar teilweise automatisiert werden, der Fokus aber stärker auf der kritischen Bewertung von KI-Ergebnissen, strategischem Denken und Mandantenberatung liegen muss. Um sicherzustellen, dass junge Juristinnen und Juristen zu echten SpezialistInnen heranwachsen, setzen wir bei KPMG Law auf technologiegestützte Simulationen, interdisziplinäre Projektarbeit und enge Mentorenprogramme. So lernt der Nachwuchs nicht nur, KITools effektiv einzusetzen, sondern auch deren Resultate kritisch zu hinterfragen und rechtlich einzuordnen. Ergänzend dazu sind Universitäten und Fachhochschulen gefordert, neue Ausbildungsformate wie strukturierte Praktika, digitale Lernplattformen und praxisnahe Fallstudien zu etablieren. Durch eine gezielte Kombination aus technischer, juristischer und ethischer Ausbildung stellen wir sicher, dass der juristische Nachwuchs nicht nur mit, sondern auch über KI hinausdenken kann – und so die Qualität der Rechtsberatung weiterhin auf höchstem Niveau bleibt.
VON RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
Wer die digitale Transformation ernst nehme, so die Autoren des 2020 im IDW-Verlag Düsseldorf erschienenen Buches, müsse einsehen, dass das Transaktionsgeschäft der Zukunft «vielmehr auf ein zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell als auf historische Finanz- und Marktzahlen zu fokussieren ist». In diesem Zusammenhang müsse man «Red Flags» oder «Deal Breaker» verstärkt anhand von eingesetzten Technologien und Systemen identifizieren. «Die Durchführung einer IT Due Diligence wird vor Abschluss eines Unternehmenskaufs somit unverzichtbar.»
Selbst bei kleineren Zusammenschlüssen sei eine Übersicht über die mit- oder eingekaufte IT-Infrastruktur von grossem Vorteil, so Tritschler und Mucka. Wer vorhandene IT-Systeme in andere integrieren oder ERP-Systeme umstellen müsse, solle sich der entsprechenden Ressourcen, Kosten und Zeitaufwände bewusst sein. Wie aber soll das ohne ein tiefgreifendes Wissen und eine darauf fussende Einschätzung, wann das IT-System wie schnell wieder oder weiterarbeiten kann, gehen?
«Bad Deal» vs. «Missed Opportunity»
«In einem Projekt aus der Praxis», so das Buch, «wurden bis zum Signing keinerlei Überlegungen zu den betriebenen Systemen und zur IT-Integration angestellt. Erst beim Closing wurde klar, welch immensen Aufwand eine Systemmigration mit sich bringen wird.» Allerdings geht es eben auch andersherum. So werden mitunter Übernahmen gestoppt, ohne die Chancen der IT-Systeme auf der Verkaufsseite richtig zu bewerten. Gestoppte Deals, die Synergien oder sogar klare Vorteile einer «Target»-IT nicht richtig erkennen, werden zur «Missed Opportunity». Es ist deshalb wichtig, vorhandene IT-Strukturen richtig einzuschätzen. Einerseits müssen Compliance-Risiken, Sicherheitsrisiken oder die Wartung der Systeme bewertet werden. Andererseits müssen Synergien möglichst klar und schnell erkannt werden, um Kosten zu sparen, die gesamte IT-Verwaltung schlanker zu machen und Geschäftsmodelle wie auch das Funktionieren des Arbeitsalltags für alle Mitarbeitenden zu vereinfachen. Man sollte nicht vergessen: IT ist heute für jeden Arbeitsplatz und jeden Handgriff oder jeden Verkauf zuständig. Je besser diese Systeme unterstützen, Daten sichern oder vorbereiten, desto wertvoller sind sie.
Informationen anfordern und bewerten
Eine IT Due Diligence kann ganz simpel mit den Informationen, die auf der Website des Zielunternehmens präsentiert werden, beginnen. Eine gute Homepage zeigt Datenschutzhinweise, klärt über die rechtlichen Grundlagen für Geschäfte und die entsprechende Datenverarbeitung auf, besteht aus Kontakt- und Shop-Möglichkeiten, bietet Newsletter und Chatbots an und arbeitet mit Verschlüsselungstechniken. Im nächsten Schritt sollten die Bewertenden dann gezielte Informationen zur IT-Strategie und der IT-Organisation
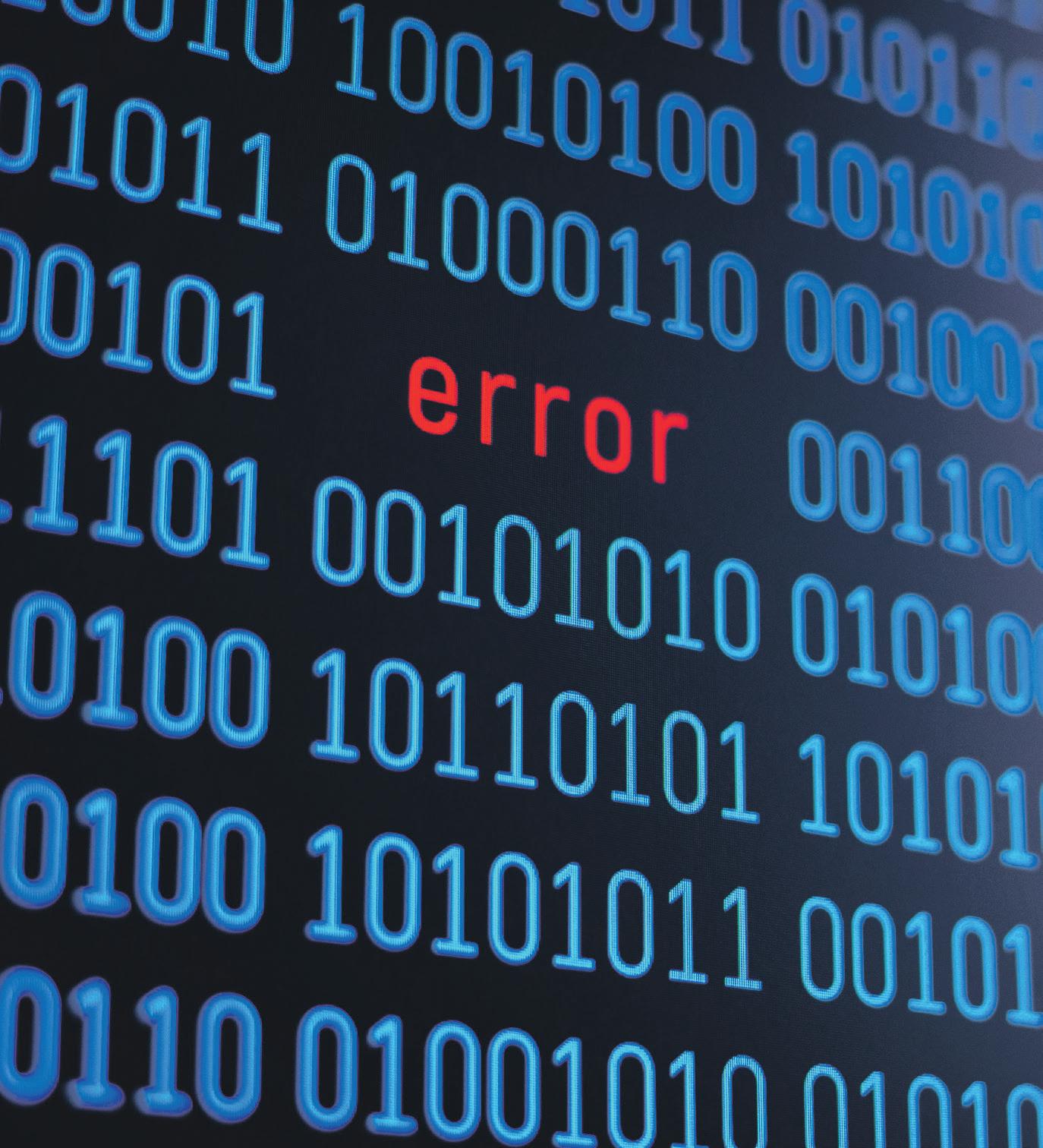
Fehler im System?
Wenn die IT «Kratzer» hat: In ihrem Buch «IT Due Diligence – Risiken und Synergien richtig bewerten und darstellen» sehen sich Jonas Tritschler und Nertila Mucka die IT-Strukturen von «Target»-Unternehmen an – und werben für mehr Lust an der Analyse.
des Unternehmens anfragen. Wer ist verantwortlich? Wie lautet das Mission-Vision-Value-Statement? Wie und wo funktionieren Netzwerke und Server? Welche Service-Level-Agreements gibt es und welche Zertifizierungen?
In Follow-up-Gesprächen können die divergierenden oder fehlenden Antworten dann mit der zuvor erstellten Anforderungsliste abgeglichen werden.
Achtung Risiko?
Die Autoren raten dazu, sich auf die Gespräche mit den verschiedenen ITAbteilungen gut vorzubereiten und nachher entsprechende Gesprächsprotokolle anzufertigen. Nur so könne sichergestellt werden, dass sich alle Erkenntnisse verwerten lassen und die «Phase der Identifizierung und Bewertung der erhobenen Risiken und
Synergien» beginnen könne. Während sich Risiken vor allem aus schlecht gewarteter oder überalterter Hardware ergeben, ist die «Bestimmung der Synergien sehr einzelfallabhängig und kann nur im Kontext mit dem Vorhaben des Unternehmenskaufs vollständig durchgeführt werden».
Das bedeute auch, dass diejenigen, die die Due Diligence durchführen, allgemein verstehen müssen, «was nach Abschluss einer Transaktion mit dem Kaufgegenstand geplant ist». Nur so «können Risiken und Synergien vollständig und sachgerecht beurteilt werden». Mit den IT-Strukturen rücken auch die allgemeineren Unternehmensstrukturen ins Blickfeld der Due Diligence. Denn wer nach «IT Values» fragt, muss bei Familienunternehmen in vierter Generation, so das
«IT ist heute für jeden Arbeitsplatz und jeden Handgriff oder jeden Verkauf zuständig. Je besser diese Systeme unterstützen, Daten sichern oder vorbereiten, desto wertvoller sind sie.»
Klischee, vielleicht länger suchen als bei Start-ups, die das Wort Mission in jedem zweiten Konzeptpapier viermal aufführen.
Zunehmend im Fokus: IT Policies Neben den IT-Teams, die ebenfalls auf Risiken, etwa Lücken im Wissenstransfer oder zu hohe Fluktuation, und Synergien, wie etwa mögliches Insourcing von IT-Dienstleistungen oder Personalkosteneinsparung, geprüft werden sollten, nennen Tritschler und Mucka auch die IT Policies samt Procedures und der daraus folgenden Arbeitsprozesse als zentrale Herausforderung einer Durchführung der IT Due Diligence. Diese Richtlinien und Arbeitsanweisungen werden in den nächsten Jahren zweifellos weiter in den Fokus rücken, wenn IT-Dienstleistungen auch von klassischen Produktionsunternehmen angeboten oder sich rechtliche Vorgaben auf immer mehr Datenbereiche ausbreiten.
Unternehmen, die für oder durch ihre IT keine Informationssicherheitsrichtlinien oder Risikomanagementrichtlinien haben, werden Schwierigkeiten bekommen, wenn sie mit IT-Ausfällen oder Datensicherungen kämpfen müssen. Auch klare Backup-Richtlinien oder Berechtigungskonzepte, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spezielle Zugriffsrechte und damit Verantwortlichkeiten zuweisen, werden im Zuge des Datenschutzgesetzes, das auch KI-Tools unter die Lupe nimmt, an Bedeutung gewinnen. Von Richtlinien zum Datenaustausch oder Verschlüsselungstechniken ganz zu schweigen.
Allgemeine und spezielle Compliance Wer sich über Netzwerke, Server- und Storage-Systeme, Betriebssysteme und die im Einsatz befindlichen Endgeräte eine Übersicht verschafft, das geben die beiden Autoren in ihrem Buch klar zu verstehen, bewertet im Grunde mehr als die IT-Infrastruktur und deren Möglichkeiten oder Wettbewerbsfähigkeit. Klarheit über die IT zu haben, kann Unternehmen resilienter und wieder selbstbestimmter machen. Wer die «allgemeine IT Compliance» im Griff hat, die Informationssicherheit, Verfügbarkeit, Datenaufbewahrung und Datenschutz ordnet, kann bald auf die «spezielle IT Compliance» schwenken, die branchenspezifisch bei Partnern oder Dienstleistern neue Standards oder Zertifizierungen durchsetzt. Dies alles tabellarisch listen und bewerten zu können, dürfte in der Tat mehr über die Zukunftstauglichkeit eines Unternehmens sagen als so manche Bilanz von gestern. So könnte es im nächsten Schritt moderner Due Diligence darum gehen, IT-Strukturen mit den regulatorischen Anforderungen und der kompletten Compliance eines Unternehmens kurzzuschliessen. Wenn immer mehr rechtliche Anforderungen über automatisierte Dienste und Überprüfungen umgesetzt oder angepasst werden, und andererseits fast sämtliche Vorgehensweisen eines Unternehmens in Daten münden, von der Personalstruktur über Betriebsabläufe bis zu Verhaltensrichtlinien, Back-ups und Erfindungen, wird die IT das Herz jedes Unternehmens sein.
«KI kann Risikosignale ans Licht bringen, die früher im Datenrauschen untergegangen wären»
M&A-Transaktionen leben von umfangreichen, komplexen DueDiligence-Prozessen, die Zielunternehmen möglichst vollständig «scannen» sollen.
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, Präsident von AGON PARTNERS Group, erklärt, wie KI-gestützte Risikoanalysen jetzt und in Zukunft den beruflichen Alltag beeinflussen werden – und der Mensch als prüfende Instanz doch unverzichtbar bleibt.
Herr Prof. Krauskopf, worin liegt aus Ihrer Sicht der grösste Vorteil beim Einsatz von KI in der Due Diligence? Der grösste Vorteil liegt in der enormen Geschwindigkeit, mit der KI Informationen durchforsten kann. KISysteme durchsuchen in Sekundenbruchteilen riesige Datenmengen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder im Fall einer DD im geschützten Raum auf unseren Schweizer Servern – was früher Wochen manueller Recherche erforderte. Dadurch lassen sich DDPrüfungen beschleunigen und breiter aufstellen. Zudem werden Routineanalysen kostengünstiger: Durch Automatisierung sparen wir Aufwand ein und erreichen Kostenersparnisse von bis zu 90 Prozent.
Was kann KI schneller erkennen als der Mensch, und wo stösst sie an Grenzen?
KI entdeckt in riesigen Datenbergen Muster und Anomalien, die ein Mensch übersehen würde – etwa ungewöhnliche Transaktionsmuster oder Abweichungen in Verträgen. Im M&A-Kontext kann eine KI tausende Dokumente (Verträge, Bilanzen, E-Mails usw.) viel schneller analysieren und auffällige Punkte markieren als ein rein manuelles Team. Doch es gibt auch Grenzen: KI versteht den Inhalt nicht wirklich. Sie kennt nur, was man ihr beigebracht hat, und kann nicht zuverlässig beurteilen, ob eine gefundene Information plausibel ist. Mit anderen Worten: Eine KI liefert Hypothesen – aber ob diese zutreffen, muss der Mensch entscheiden. Gerade beim Fact-Checking, also dem Überprüfen von Quellen auf Vertrauenswürdigkeit, stösst die KI an ihre Grenzen. Menschliche Expertise bleibt unverzichtbar, um KI-Ergebnisse einzuordnen.
Welche regulatorischen Herausforderungen bringt der verstärkte KI-Einsatz in der Due Diligence mit sich? Die regulatorischen Vorgaben entwickeln sich laufend weiter. An erster Stelle steht der Datenschutz: KI-Einsätze dürfen weder gegen das revidierte Schweizer DSG noch gegen die


Patrick Krauskopf Verwaltungsratspräsident
DSGVO verstossen. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten in der DD braucht also eine klare Rechtsgrundlage und Zweckbindung. Ausserdem stellt sich die Frage der Haftung: Wer haftet, wenn die KI falsche Schlüsse zieht oder Risiken übersieht? Es fehlen noch klare gesetzliche Regeln. Zudem setzen EU-Regeln wie NIS2 und DORA neue Massstäbe bei Cybersicherheit und Resilienz – auch KI-Analysen müssen diese erfüllen, etwa bei ITSicherheit und Nachvollziehbarkeit. Schliesslich besteht das Risiko von KIFehlleistungen, u.a. bekannt unter dem Stichwort Halluzinationen. Auch dafür müssen Unternehmen und Aufsichtsbehörden Vorkehrungen treffen. Kurzum: KI bietet grosse Chancen, muss aber – das ist für mich als VRP von auch börsennotierten Unternehmen wichtig - mit solider Governance einhergehen, damit alle rechtlichen Vorgaben erfüllt bleiben.
Kann KI bestimmte Risiken aufdecken, die früher womöglich übersehen wurden?
Richtig eingesetzt kann KI heute Risikosignale ans Licht bringen, die früher im Datenrauschen untergegangen wären.
Eine KI kann etwa verdächtige Zahlungsflüsse oder negative Schlagzeilen
Steckbrief
AGON PARTNERS Group
Die AGON Group bricht mit alten Mustern. Als First Mover vereinen wir KI-Innovation in Legal, Compliance und Public Affairs/Litigation PR. Wir verbinden juristische Exzellenz (AGON Legal, AGON Compliance) nahtlos mit modernster Technologie (AGON Innovation, AGON Solution – Legal Tech & KI). AGON Public Affairs ergänzt diesen Ansatz durch strategische Kommunikation und Litigation PR.
über ein Zielunternehmen erkennen, lange bevor ein menschliches Team darauf stossen würde. Unsere Plattform «Global Risk Tracker» (GRT), welche vor allem im Finanzsektor zur Anwendung kommt, geht genau diesen Weg: Sie durchleuchtet fortlaufend weltweite Register-, Medien-, Finanz- und Sanktionsdaten und meldet frühzeitig mögliche Compliance- oder Reputationsrisiken bei Lieferanten oder Geschäftspartnern. So erhalten wir ein Frühwarnsystem über Entwicklungen, die manuell nicht in Echtzeit erfassbar sind. Natürlich müssen auch hier Menschen die letztliche Bedeutung der Befunde bewerten – aber KI verschafft uns und unserer Klientschaft einen Wissensvorsprung.
Kann KI rechtliche Verstösse aufdecken, die bewusst vertuscht wurden? Ergeben sich daraus neue rechtliche Fragen? KI kann versteckte Auffälligkeiten aufspüren – zum Beispiel auffällige Kommunikationsmuster in E-Mails oder Chats, die auf illegale Tätigkeiten hindeuten. Aber wer einen Verstoss bewusst vertuscht, den kann wohl auch die beste KI nicht entlarven, wenn es keine Spuren gibt. Hier kommt weiterhin der Faktor Mensch ins Spiel – wir
«Eine KI liefert Hypothesen –aber ob diese zutreffen, muss der Mensch entscheiden.»
Unser vernetztes System entwickelt Lösungen, die Sicherheit und digitale Integrität vereinen – für die Herausforderungen von morgen. Unsere Verwaltungsräte, in denen namentlich eine Schweizer Parlamentarierin, ein (ehemaliger) kantonaler Baudirektor sowie ein Vertreter der Versicherungsbranche sitzen, gehen keine Kompromisse ein.
Mehr Informationen unter agon-partners.com
ergänzen KI-Analysen durch Whistleblowing-Kanäle. Unsere «Safe2Whistle» ermöglicht Mitarbeitenden, anonym oder vertraulich Hinweise auf Missstände zu geben, die der KI verborgen bleiben. Hinsichtlich Zulässigkeit stellt sich die Frage: Darf man interne Kommunikationsdaten überhaupt per KI auswerten, ohne die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeitenden zu verletzen? Bezüglich der Haftung muss klar sein: Wer haftet, wenn die KI Fehlalarme auslöst oder Warnsignale übersieht? Daher erarbeiten wir Richtlinien, um KI-gestützte Untersuchungen rechtssicher einzubetten – etwa durch lückenlose Protokollierung der KI-Auswertungen.
Erleben wir dank KI bei der Risiko- und Chancenbewertung einen qualitativen oder einen quantitativen Durchbruch? Derzeit vor allem einen quantitativen. KI kann viel mehr Informationen in viel kürzerer Zeit auswerten als ein Mensch. Wo früher Mitarbeitende vielleicht dutzende Dokumente analysieren konnten, berücksichtigt eine KI heute tausende Quellen und Datensätze in der Analyse. Ein wirklich qualitativer Sprung ist dagegen noch begrenzt. KI-Modelle zeigen zwar Korrelationen und markieren potenzielle Risiken, aber sie erklären nicht von sich aus die Ursachen oder Hintergründe. Die Analysequalität hängt weiterhin stark von der Qualität der Eingabedaten und der Fragestellungen ab. Mit den richtigen Daten und gezielten Fragen kann KI tiefergehende Einsichten liefern
– doch ohne menschliche Interpretation fehlen ihr nach wie vor Urteilskraft und Erfahrung.
Wie wichtig ist Datenschutz bei KI-gestützter Due Diligence, und worauf müssen Auftraggeber besonders achten?
Datenschutz hat oberste Priorität – in DD-Prozessen arbeiten wir mit äusserst sensiblen personenbezogenen oder geschäftlichen Informationen, die auch beim KI-Einsatz jederzeit geschützt bleiben müssen. Für Auftraggebende heisst das konkret: Rechtsgrundlage und Zweck der Datenanalysen müssen klar definiert sein. Es sollten nur notwendige Daten verarbeitet und möglichst anonymisiert werden. Wichtig ist auch, wo die Daten verarbeitet werden. Aus Gründen der digitalen Souveränität empfehlen wir KI-Plattformen mit Hosting in der Schweiz – dies trifft auf alle Produkte und Dienstleistungen der AGON Partners Group zu. So bleibt wird das Risiko eines Datenabflusses ins Ausland minimiert.
Welche Rolle spielt der Mensch bei der Analyse und der abschliessenden Entscheidungsfindung?
Der Mensch bleibt die entscheidende Instanz: Wir bauen Kontrollmechanismen ein, damit jede KI-Auswertung von erfahrenen Fachleuten geprüft wird. Sämtliche KI-Schritte werden –u.a. unter dem Schutz des Schweizer Anwaltsgeheimnisses - dokumentiert, sodass jeder Befund nachvollzogen werden kann. Unsere Experten aus dem Bereich Legal und Compliance testen die KI-Modelle regelmässig mit bekannten Beispielen, um Fehler oder Bias zu erkennen. Im gesamten Prozess nimmt der Mensch mehrere Rollen ein: als Kontrolleur, der KI-Ergebnisse kritisch hinterfragt, und als Kontextgeber, der zusätzliches Hintergrundwissen einbringt. KI leistet wertvolle Vorarbeit – aber das letzte Wort hat immer der Mensch.

Big Trouble in «Lex China»
Müssen ausländische Investitionen besser kontrolliert werden? Während die Befürworter eines Investitionsprüfgesetzes den Ausverkauf zentraler Branchen fürchten, warnen die Kritiker vor zurückgehenden Investitionen und massiven Nachteilen für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
VON RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
In die zunehmende Regulierungswut platzte das Vorhaben eines Gesetzes zur Beschränkung ausländischer Investitionen letztes Jahr wie ein zusätzliches Gewitter. Denn längst geht es beim drohenden «Ausverkauf» zentraler Branchen nicht mehr so sehr um glasklare Fakten, sondern um Meinungen, Ängste und die berühmte Vorsorge, die der Staat im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft zu treffen habe.
Der Schreck der Übernahme des Schweizer Agrochemieriesen Syngenta durch die China National Chemical Corporation sitzt der Schweizer Öffentlichkeit allerdings noch in den Knochen. Mit einiger Verzögerung wurde der 2017 vollzogene Deal nun doch noch zum Politikum – und das Parlament forderte für «kritische Branchen» eine Investitionskontrolle nach dem Modell der OECD-Staaten.
«Geschärftes Bewusstsein» notwendig?
Auf der Wirtschaftspolitik-Plattform Die Volkswirtschaft unterstrich Joachim Pohl, Leiter der Einheit Regulierung internationaler Investitionen der OECD-Investitionsabteilung in Paris, im März die Bedeutung der Investitionskontrollen als Folge des wirtschaftlichen Aufstiegs der Volksrepublik China und ihrer staatlich gesteuerten strategischen Unternehmenserwerbe im Ausland. «Wirtschaftliche Verwerfungen während der Covid-19-Pandemie, das dadurch geschärfte Bewusstsein für Abhängigkeiten und Lieferketten
sowie Russlands Invasion der Ukraine und die seither beobachtete hybride Kriegsführung haben dazu beigetragen, dass immer mehr Länder Investitionskontrollen einführen und Kontrollen verstärken.»
Die Schweiz, so Pohl, nehme «unter den wohlhabenden und technologieintensiven OECD-Staaten eine Sonderstellung ein». Zusammen mit Norwegen gehöre sie «zu den letzten Staaten ohne Investitionskontrolle». Pohl beschreibt, dass viele OECD-Staaten auf «transparente und zügige Verfahren» setzten, nur wenige Übernahmen würden «beschränkt oder verboten, und Reformen sorgen für laufende Verbesserungen». Angesichts der Ausbreitung von Investitionsprüfungen, so suggeriert es der OECD-Regulierungschef, bleibe der Schweiz gar nichts anderes übrig, als ebenfalls eine «Lex China» zu installieren.
Kontroll-Muss oder -Monster
«Die Lex China liesse den Staat und seine Macht weiter wuchern, er würde zum Bürokratiemonster», so Marcel Speiser in der Handelszeitung vom 18.9.2024. «Über Schweizer Firmen würde quasi der fürsorgerische Freiheitsentzug verhängt, wenn sie sich mit Ausländern einlassen. Eine grauenhafte Vorstellung.» Das Investitionsprüfgesetz sei aus mehreren Gründen «unnötig, ja gar schädlich für unser Land», notierte Patrick Dümmler in der Schweizer Gewerbezeitung am 7.2.2025. Eine Ablehnung des Gesetzes durch das Parlament wäre folglich «ein Beleg dafür, dass es die Volksvertreter ernst meinen und überzogene Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit zurückweisen.»
Was die angeblich reibungslosen Verfahren angeht, äusserten Tim Meyer und Mani Reinert von der Wirtschaftskanzlei Bär & Karrer in Legal Success 11/24 bereits klare Zweifel: «FDI-Verfahren führen zu teilweise erheblichen Verzögerungen, und dies auch in Fällen, in denen die betreffenden Transaktionen offensichtlich unproblematisch sind.» «Die mit einer FDI-Gesetzgebung einhergehenden bürokratischen und willkürbehafteten Leerläufe» schwächten folglich die Standortattraktivität. «Staatlich gelenkter Kapitalismus vs. freie Marktwirtschaft»
FDP-Ständerat Thierry Burkart zweifelte Mitte März, in der achten Sitzung des Ständerats, eine Gefahr durch ausländische Investitionen an: «Die Hauptgefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind nicht legale Firmenübernahmen aus dem Ausland, sondern illegale Aktivitäten wie Cyberkriminalität und Wirtschaftsspionage.»
Sozialdemokrat Carlo Sommaruga hielt dem entgegen, es sei essenziell, «dass die Schweiz im Interesse der eigenen Sicherheit, der eigenen wirtschaftlichen Souveränität und des Schutzes von Innovationen über ein rechtliches Instrument zur Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen» verfüge. Mitte-Ständerat Beat Rieder fragte daraufhin: «Wieso hat Norwegen kein Investitionskontrollgesetz?» Antwort: Norwegen habe «einen Staatsfonds von 1500 Milliarden Kronen, der in allen wichtigen Gesellschaften von Norwegen mit dem Fuss drin ist». Wenn in Norwegen «jemand vom Ausland eine wirklich kritische Infrastruktur kaufen will, muss er an diesem Staatsfonds vorbei». Auch auf das «Phänomen des staatlich gelenkten Kapitalismus, der staatlich gelenkte Investitionen in europäische Länder infiltriert» ging Rieder ein. «Dieses Phänomen der Neuzeit habe sich verstärkt», und nach wie vor habe «die freie, liberale Marktwirtschaft bis anhin noch keine Antwort darauf gefunden». «Ohne die Einführung von Investitionskontrollen, insbesondere bei staatlich dominierten oder staatlich unterstützten Unternehmen, schaltet ein staatlich gelenkter Kapitalismus die freie Marktwirtschaft aus.»
«Auswirkung auf Investitionen der nächsten Jahre» Konkret peilt das Gesetz neben Branchen, die sich mit militärischer
«Ohne die Einführung von Investitionskontrollen, insbesondere bei staatlich dominierten oder staatlich unterstützten Unternehmen, schaltet ein staatlich gelenkter Kapitalismus die freie Marktwirtschaft aus.»
Ausrüstung und militärischen Gütern beschäftigen, Energie- und Wasserversorger, Unternehmen der Gesundheits- und Pharmaindustrie sowie Telekommunikationsunternehmen und Verkehrsbetriebe an. Auch grössere Lebensmittelhändler mit einem Umsatz über 100 Millionen CHF könnten ins Visier der Investitionskontrollen geraten. Der Zürcher Anwalt Dr. Alexander Lindemann rechnet mit einer Umsetzung des Gesetzes «voraussichtlich bis 2028 oder später», «je nach den Beratungen im Parlament, dem Feedback der Industrie und den regulatorischen Vorbereitungen des SECO». «Im Zuge der weiteren Diskussionen über das Gesetz» werde «die endgültige Fassung des Gesetzes die Landschaft der ausländischen Investitionen in der Schweiz für die kommenden Jahre bestimmen». In der Wirtschaftskommission des Ständerats gab es im September ein erneutes Ping-Pong-Spiel zum Für und Wider neuer Gesetze und Regulierungen von «Foreign Direct Investments». Während Thierry Burkart die Notwendigkeit eines Kontrollgesetzes nochmals bestritt, da bislang keine Fälle bekannt seien, «in denen Übernahmen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet hätten – das, was dieses Gesetz prüfen müsste», und SVP-Ständerat Hannes Germann von einem Eigentor und «verfehltem Heimatschutz» sprach, gab sich Beat Rieder abermals erstaunt: «Ich weiss nicht, ob es Ihnen gleichgültig ist, wenn eine chinesische Staatsbank die UBS oder die Raiffeisenbanken übernehmen würde? Ich finde das relevant.»
Da der Ständerat eine vom Nationalrat geplante Ausweitung des Gesetzes auf noch mehr Kontrollen bereits rückgängig gemacht hatte, wurde die Vorlage mit 27 zu 11 Stimmen klar angenommen. Diese abgespeckte Vorlage muss nun erneut in den Nationalrat. Da erste Kritiker eines FDI-Screenings bereits eine Volksabstimmung ins Spiel bringen, könnte die «Lex China» noch zum ganz grossen Politikum werden –und Investitionen, die bis dato hinter verschlossenen Türen vollzogen wurden, in die breite Öffentlichkeit rücken.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, LEGAL SUCCESS hat sich seit seinem Erscheinen und auch in dieser Ausgabe Legal Tech und insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) auf die Fahne geschrieben. Hierin liegen ohne Zweifel begründete Chancen auf Rationalitätsgewinne für die juristische Unternehmensberatung. Was soll sich nun hier ein längst zum alten Eisen zählender pensionierter Bundesrichter und Bundesgerichtspräsident zu Worte melden, der Zeit seines Lebens immer pünktlich, ohne irgendein Unternehmerrisiko zu tragen, zum 25. des Monats sein Gehalt auf dem Konto hatte, der als Sekuritätsmensch stolz darauf ist, unter seinen vier Kindern Selbständigerwerbende zu wissen und der mit den technischen Entwicklungen bis zum Schluss seiner Aktivzeit nur am Rande (elektronisches Gerichtsdossier im Rahmen von Justitia 4.0) konfrontiert war? Vielleicht das: die unverzichtbaren, ewig gültigen basics in Erinnerung zu rufen, die erfüllt bleiben müssen, solange es in unserem Lande eine freiheitliche Wirtschaftsordnung geben soll: Rule of Law, Checks and Balances, Law and Order – und das Verständnis des Rechts als eines kulturellen Gutes.
1. Rule of Law Rule of Law bedeutet Herrschaft des Rechts, wo Menschen zusammenleben. Recht geht allen anderen möglichen Massstäben vor, begrenzt folglich individuelle und kollektive Machtausübung. Die Herrschaft des Rechts ist der Willkür eines jeden Einzelnen vorzuziehen (Aristoteles). Im Mittelalter liessen die Engländer ihren König zwar regieren, sich aber von diesem nicht willkürlich verhaften (habeas-corpus-Akte). 1656 forderte James Harrington die Herrschaft des Rechts. Seit Glorious Revolution (1688/89), Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika (1776), französischer Revolution (1789), Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft als Bundesstaat (1848), Völkerbund (1920-1946), UNO (seit 1945) sowie vielen anderen Institutionen, internationalen Verträgen und Erklärungen auf europäischer und globaler Ebene ist Rule of Law, unterbrochen durch die Katastrophen zweier Weltkriege (1914-1918; 19391945) und des Hitlerismus’ in Deutschland (1933-1945), das vorrangige Leitmotiv für die politische Ausgestaltung (zwischen-)staatlicher Verhältnisse und Beziehungen, dies aber nur in der westlichen Hemisphäre. Russland hat daran keinen Anteil, weil es nie eine bürgerlich-liberale Revolution erlebt hat, sondern vom zaristischen Absolutismus mit Leibeigenschaft direkt in den Kommunismus bolschewistischer Prägung hinübergeglitten ist. Nach dem Ende der UdSSR (1991) hat sich nicht Rule of Law, sondern die Macht eines oligarchischen Regimes um den ehemaligen KGB-Funktionär, chronischen Rechtsbrecher und Kriegsverbrecher Putin herum durchgesetzt. Das russische Verfassungsgericht tanzt nach seiner Pfeife.
2. Checks and Balances
So sind wir bei Montesquieu (16891755) angelangt, der die geniale Idee hatte, Rule of Law auf drei Instanzen
Das Recht –Grundvoraussetzung freiheitlicher Wirtschaftsordnung

zu verteilen, Gesetzgeber, Regierung/ Verwaltung und Gerichte, die Gewaltenteilung und damit verbundene Gewaltentrennung: Nicht einer allein soll kompetent sein zu sagen, was Recht ist, sondern mehrere durch die Verfassung vorgesehene Organe in ihrem teils konkurrierenden, teils kontrollierenden Zusammenwirken. Damit geht einher die Unabhängigkeit der Gerichte im Bereich ihrer verfassungsmässig umschriebenen Zuständigkeit, Recht zu sprechen, der Rule of Law zum Durchbruch zu verhelfen. Dieses Modell, sehr früh in den USA und - nach ihrem Vorbild - in der Schweiz realisiert, hat sich in vielen - zum Teil sehr unterschiedlichen - Varianten in fast allen westlichen Staaten des kontinentaleuropäischen und angelsächsischen Rechts etabliert. Demgegenüber geht etwa in China die gerichtliche Unabhängigkeit der Staatsräson nach, welche allein die - ausdrücklich über der Verfassung stehende - Kommunistische Partei definiert.
3. Law and Order 1919 formulierte Max Huber, wohl der grösste und wirkungsvollste Völkerrechtler, den die Schweiz je hatte: «Der kleine Staat hat seine grösste Stärke in seinem guten Recht.» In der
«Unsere Gerichte sind, entgegen allen Unkenrufen, trotz politischer Wahl (und Wiederwahl nach vier oder sechs Jahren) unabhängig.»
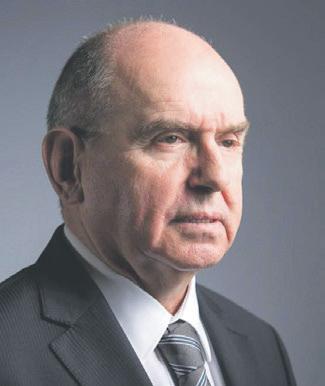
Prof. Dr. Ulrich Meyer
Bundesrichter 1987-2020
Bundesgerichtspräsident 2017-2020
1968er-Bewegung dagegen wurde Law and Order zum Schimpfwort. Es bezeichnete jenen Politiker, welcher für die Aufrechterhaltung der existierenden staatlichen Ordnung eintrat und nicht an die sozialistischen Heilsversprechungen von Volkspension und betrieblicher Mitbestimmung glauben wollte. Heute kann sich die Schweiz glücklich schätzen, immer noch und allen Anfechtungen zum Trotz ein Land von Recht und Ordnung zu sein. «Dass im Land für immer die Liebe zu den Gesetzen, die Freiheit und der Frieden regiere!», lautet der Refrain des Hymne vaudois. In der Tat, das Recht und seine Durchsetzung mithilfe des staatlichen Gewaltmonopols, sie allein garantieren Rechtsbeständigkeit, Rechtssicherheit und damit Freiheit. Unsere Gerichte sind, entgegen allen Unkenrufen, trotz politischer Wahl (und Wiederwahl nach vier oder sechs Jahren) unabhängig; sie urteilen ohne Ansehen der Person und sind insbesondere nicht korrupt. Unser funktionierendes Rechtssystem, ergänzt um die in der Schweiz traditionell starke (auch international tätige) Schiedsgerichtsbarkeit sowie die in den letzten Jahren aufgekommenen Formen der Mediation, ist im Standortwettbewerb um Unternehmungen ein grosser Vorteil. Nicht dass hierzulande
alles zum Besten bestellt wäre, bei weitem nicht. So verunmöglichen vom Streitwert abhängige exorbitante Gerichtskosten, dass KMU und Mittelstand überhaupt noch Prozesse führen können. Ausbildung, Spezialisierung und Auswahl der Richterpersonen sind klarerweise zu optimieren. Und es gibt auch im schweizerischen Justizwesen leider viel zu viele Akteure und Akteurinnen, welche der Fraktion der Säbelzahn-Schleim-Fische zuzurechnen sind: die Abwesenheit von Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Kraft, Stärke und Mut auch in heiklen, belastenden Situationen – kurz, dem Mangel von all dem, was man Charakter und Persönlichkeit zu nennen pflegt.
4. Recht ist ein Kulturgut … Damit ist der matchentscheidende Punkt angesprochen: Es kommt im Grunde genommen letztlich allein auf die rechtskulturelle Haltung der im Justizwesen tätigen Personen an, ob Richter oder Anwältinnen, mit ihrem je individuellen Rechtsbewusstsein. Recht hat nichts mit Natur zu tun, ist gar keine Kategorie davon. Daher kann es kein Naturrecht geben; denn nichts ist ungerechter als die Natur. Die Naturrechtslehre des 17./18. Jahrhunderts kann vernünftigerweise lediglich als Antwort auf die absolutistischen Herrschaftsverhältnisse im historischen Kontext verstanden werden. Wovon die Aufrechterhaltung freiheitlicher Verhältnisse abhängt, ist vielmehr die Antwort auf die Frage, ob es der Schweiz weiterhin gelingt, ihre seit 1848 bestehende Rechtskultur zu bewahren. Es geht um die Erhaltung des Rechtsbewusstseins auf allen Ebenen, individuell-persönlich, aber auch institutionell. Nach der Bundesverfassung ist die Ausübung
jeder staatlichen Tätigkeit an das Recht gebunden. Das gilt selbstverständlich auch für die Bundesversammlung, welche, unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen, die höchste Gewalt im Lande darstellt. Leider entfernt sich das Parlament davon ausgerechnet in jenen Bereichen, wo es nicht politische sondern rechtliche Entscheide zu fällen hätte, zum Beispiel bei der Prüfung der verfassungsrechtlichen Gültigkeit von Volksinitiativen.
5. … und bleibt das auch bei Einsatz von Legal Tech und KI Automatisierte Urteilsdatenbanken, EDV-Dossiers, computerbasierte Kommunikation etc. werden die Grundprinzipien freiheitlicher Rechtsanwendung nicht verdrängen. Das gilt selbst für KI, gegen deren Einsatz auf juristischem Gebiet Bedenken bestehen, nach meinem Dafürhalten zu Unrecht. Zum einen muss KI gefüttert, die Aufträge mit einschlägigen Merkmalen konfiguriert und eingegrenzt werden. Zum andern hat die rechtsanwendende Person die Ergebnisse, welche KI ihr liefert, zu bewerten; sie muss dazu Stellung nehmen, sie muss vor allem sagen, ob sie das ihr als bestes erscheinende KI-gestützte Resultat will. Die hauptsächliche Herausforderung liegt also nicht in der KI-Technik selber angelegt, sondern im Umgang der rechtsanwendenden Person mit ihr. Da die Sprache das Medium des Rechts ist und weil sodann Entscheidung und Begründung diskursiv miteinander verknüpft sind, können sich Juristen und Juristinnen nicht auf KI-Verwendung als solche beschränken. Vielmehr haben sie zwingend die Erfahrung und das Handwerk guter Rechtsanwendung - best practicemitzubringen.
Wohnen in seiner klarsten Form: Mit Casa White entsteht ein Neubauprojekt der Extraklasse.
XANIA real estate Zurich setzt mit Casa White ein klares Statement für modernes Wohnen mit höchstem Anspruch an Architektur, Design und Lebensqualität in Zumikon. Das Zürcher Immobilienunternehmen verbindet in seinem jüngsten Projekt zeitlose Eleganz mit nachhaltiger Bauweise. Klare Linien und geometrische Formen werden mit einer edlen Materialauswahl gekonnt kombiniert.
Das Zürcher Unternehmen entwickelt und realisiert Wohn(t)räume rund um den Zürichsee. Statt auf reine Quadratmeter oder kurzfristige Trends setzt XANIA real estate Zurich auf Werte, die Bestand haben – klare Architektur, hochwertige Materialien, durchdachte Raumkonzepte und lebenswerte Standorte. Mit Neubauprojekten wie The Terraces in Küsnacht, Heritage Hill in Horgen oder Casa White in Zumikon setzt das Unternehmen neue Massstäbe im Premiumsegment – stets mit dem Ziel, individuellen Wohnraum auf höchstem Niveau zu schaffen.
Helle Leichtigkeit durch und durch Das neueste Projekt Casa White liegt im begehrten Zumikon, einer der exklusivsten Wohnlagen im Kanton Zürich. Hier verschmelzen moderne Architektur, durchdachtes Raumkonzept und natürliche Umgebung zu einem harmonischen Ganzen. Bereits der Name ist Programm: Weiss – als Symbol für Klarheit, Leichtigkeit und zeitlose Eleganz – prägt mit hellen Akzenten die gesamte architektonische Linie. Die klar gegliederte, weiss mineralisch verputzte Fassade, entworfen vom Zürcher Architekturbüro Daluz Gonzalez, verleiht dem Baukörper eine moderne Leichtigkeit und Ruhe. Reduzierte Linien und grosszügige Glasfronten lassen Licht und Raum fliessen, während natürliche Materialien wie Holz und Stein Wärme und Beständigkeit vermitteln. Es entstehen Räume, die sich leicht anfühlen und trotzdem Geborgenheit bieten.
Mit Weitblick ins Grüne
Die Einbettung von Casa White in die natürliche Umgebung folgt einem klaren Konzept: Die Hanglage von Zumikon bildete den Ausgangspunkt des Entwurfs. Inspiriert von der umgebenden Landschaft entwickelten die Architekten zwei elegante Mehrfamilienhäuser, welche eine harmonische Verbindung von Baukörper und Natur schaffen und sich damit respektvoll in die Umgebung einfügen, ohne sich aufzudrängen. Das Ergebnis ist ein ästhetisches Gesamtbild, das klares Design und naturnahe Bauweise miteinander verbindet – modern, aber nicht kühl; luxuriös, aber nie laut. Casa White steht für jene Form von Eleganz, die durch Zurückhaltung wirkt.
Private Terrassen als Rückzugsort und flexible Raumgestaltung
Ein Alleinstellungsmerkmal von Casa White sind die privaten Terrassen, die jede Wohnung zu einem Rückzugsort machen. Es gibt keinen gemeinsamen Aussenbereich – jede Einheit verfügt
über ihre eigene, grosszügige Terrasse, die fliessend in den Wohnraum übergeht. Innen und Aussen verschmelzen, Natur und Architektur treten in Dialog. Diese Konzeption schafft Räume für Erholung und Inspiration – ideale Orte für ein Frühstück in der Morgensonne, einen Sommerabend mit Freunden oder einfach stilles Innehalten.
Die 4.5- bis 6.5-Zimmer-Eigentumswohnungen richten sich an ein qualitätsbewusstes Publikum – an Paare, Familien oder Menschen, die ihren nächsten Lebensabschnitt bewusst gestalten möchten. Die durchdachten Grundrisse bieten Raum für individuelle Lebensentwürfe: Platz für Gäste, Pflegepersonal oder ein Homeoffice auf höchstem Niveau. Besonders hervorzuheben sind die grosszügigen Duplexwohnungen mit separaten Eingängen und zusätzlichen Bädern – ideal für Mehrgenerationenhaushalte oder eine gehobene Gästeunterbringung. Casa White kombiniert damit architektonische Raffinesse mit praktischer Lebensqualität –eine Wohnform, die Flexibilität und Zukunftsdenken verbindet. Dieses Projekt beweist, dass architektonische Eleganz und praktische Lebensqualität perfekt harmonieren können.
Bevorzugte und attraktive Lage Ein weiteres Highlight ist der Standort. Zumikon zählt zu den begehrtesten Wohnlagen. Der Ort bietet, was in der Region zur Rarität geworden ist: Ruhe, Natur und Stadtnähe in perfekter Balance. In wenigen Minuten ist die Zürcher Innenstadt erreichbar, gleichzeitig profitieren Bewohnerinnen und Bewohner von einer hervorragenden Infrastruktur direkt im Ort – mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeitangeboten in unmittelbarer Nähe. Hinzu kommt ein attraktiver Steuerfuss, der Zumikon auch aus wirtschaftlicher Sicht zu einer erstklassigen Adresse macht. Casa White kombiniert damit Lebensqualität und Werterhalt – zwei Faktoren, die auf dem heutigen Immobilienmarkt selten so harmonisch zusammentreffen. Auch
kulturell ist das Projekt in der Region verwurzelt. Die Gestaltung der Aussenräume und die Materialwahl greifen traditionelle Schweizer Bauweisen auf, interpretieren sie aber modern.
Qualität und Langlebigkeit Neben der architektonischen und handwerklichen Qualität spielt Nachhaltigkeit bei XANIA eine zentrale Rolle. Casa White wurde nach den neuesten Energiestandards konzipiert. Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und intelligente Gebäudetechnik sorgen für effiziente Energienutzung und ein gesundes Wohnklima. Ebenso tragen optimierte, effizient geplante Grundrisse zur nachhaltigen Bauweise bei – sie ermöglichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Raum und Ressourcen, ohne dabei auf ein grosszügiges Wohnerlebnis zu verzichten. Diese Grundlage prägt die gesamte Unternehmensphilosophie: Langlebigkeit statt Schnelllebigkeit, Qualität statt Quantität.
XANIA real estate Zurich versteht Wohnen als ein sehr individuelles Erlebnis. Deshalb begleitet das Unternehmen seine Käuferinnen und Käufer persönlich – von der ersten Beratung bis zur Schlüsselübergabe. Im Showroom im Herzen von Zürich können Materialien, Farben und Ausstattungsdetails ausgewählt und aufeinander abgestimmt werden. So entsteht eine Wohnung, die nicht nur architektonisch überzeugt, sondern auch die Persönlichkeit ihrer zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner widerspiegelt.
Möchten Sie auf Ihr neues Zuhause anstossen?
Etwas ganz Besonderes erwartet die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer von Casa White nach dem Einzug: Als Willkommensgeschenk erhalten sie ein Jahresabonnement bei Baur au Lac Vins. Viermal im Jahr wird ein ausgewählter Wein direkt nach Hause geliefert – eine Geste, die den XANIAAnspruch an Qualität und Genuss auf charmante Weise unterstreicht.
«Der Ort bietet, was in der Region zur Rarität geworden ist: Ruhe, Natur und Stadtnähe in perfekter Balance. In wenigen Minuten ist die Zürcher Innenstadt erreichbar.»





www.schulthessdigital.info

Alle persönlichen Fachpublikationen unter «Meine Bibliothek» verfügbar
Intelligente Suche für eine effiziente juristische Recherche
Komfortabler Wechsel zwischen Web- und Print-Ansicht
