

LEGAL SUCCESS
RECHT IM FOKUS - ORIENTIERUNG FÜR UNTERNEHMEN
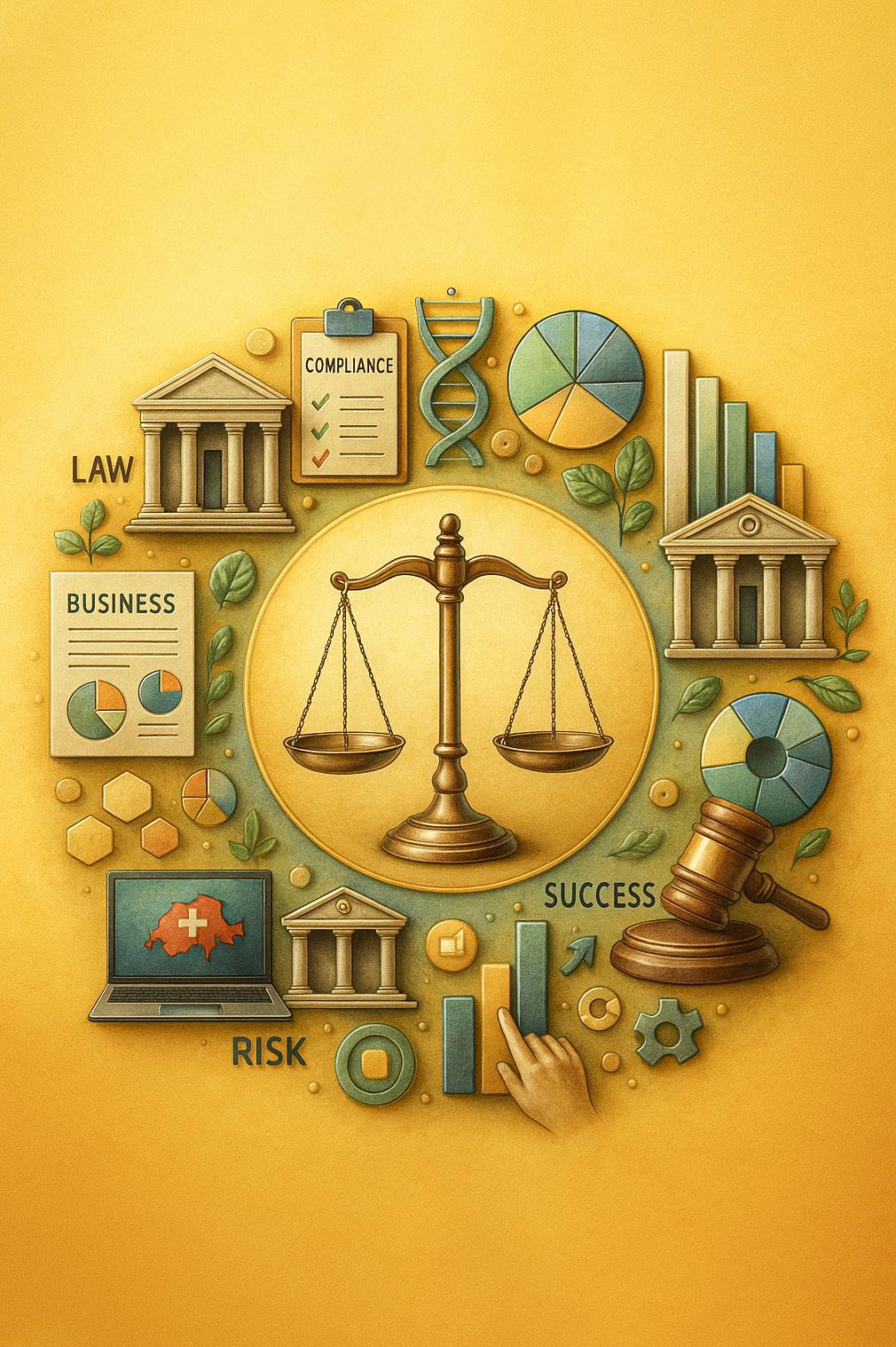
«Warum
Mathias Gaertner im Interview
06/2025
US-Sanktionen
Rechtliche Mittel gegen die Willkür
Mindeststeuer
Globaler Standard oder Bürokratenmonster?
Kartellrechtsrevision
Endlich Satz und SIEC für KMU?

Mindeststeuer
Zahl- vs. Verteilkampf SEITE 4
US-Sanktionen Schadensbegrenzung vs. Diversifizierung

M&A
Die Kunst der Durchdringung
Kartellrecht

Interview Mathias Gaertner über zunehmende
Regulierungen und die Bedeutung der Legal Teams SEITEN 12/13
Schlusswort SEITE 22
Proaktive Compliance als Schlüssel zum Wettbewerbsvorteil
In einer zunehmend komplexen und dynamischen Geschäftswelt ist es für Unternehmen unerlässlich, gesetzliche Entwicklungen aktiv zu beobachten. Die kontinuierlichen Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen stellen nicht nur an spruchsvolle Herausforderungen an die Compliance, sondern bieten auch wert volle Möglichkeiten zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen und zur früh zeitigen Identifikation sinnvoller neuer Investitionen. Unternehmen, die regu latorische Veränderungen rechtzeitig erkennen und verstehen, können nicht nur Risiken besser managen, sondern auch neue Marktpotenziale schneller erschliessen. Die richtige rechtliche Be ratung spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Die aktuelle Ausgabe von Legal Success widmet sich zentralen recht lichen Themen, die für die Schweizer Wirtschaft von Bedeutung sind. Dazu gehören die Auswirkungen der neuen Aussen- und Wirtschaftspolitik der USA, die Revision des Kartellrechts oder die globale Mindeststeuer sowie deren Einfluss auf Schweizer Unternehmen; zudem werden auch internationa le M&A-Strategien beleuchtet. Diese Themen sind nicht nur rechtlicher Na tur, sondern haben auch weitreichen de wirtschaftliche Implikationen, die Unternehmen in ihrer strategischen Planung berücksichtigen müssen.
Ein Beispiel sind die jüngsten Wei chenstellungen der USA in der Aus sen- und Wirtschaftspolitik, die nicht nur direkt betroffene Unternehmen, sondern auch deren Geschäftspartner und gesamte Branchen vor neue Herausforderungen stellen. Unternehmen müssen sich intensiv mit den neuen (und immer wieder ändernden) Regeln

Blum Managing Partner EY Law Schweiz
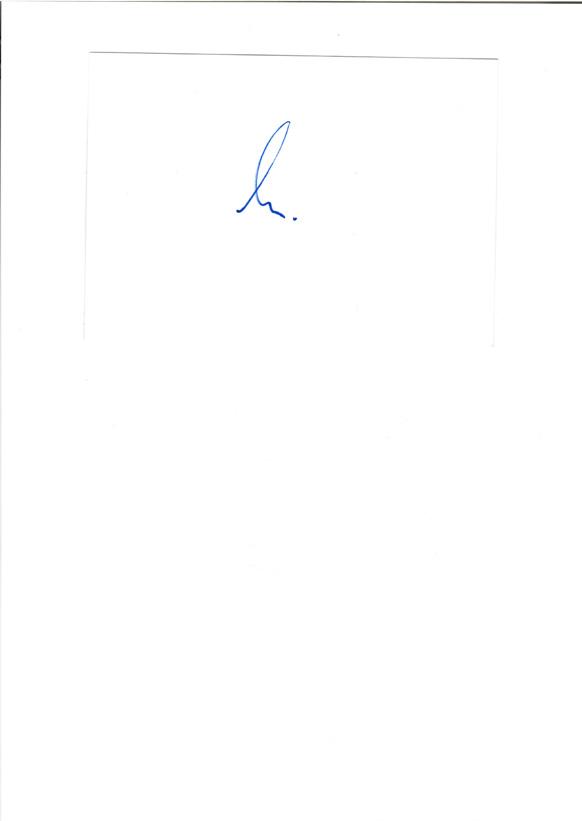
auseinandersetzen, um Lieferketten (neu) zu optimieren, Haftungsrisiken zu minimieren und gleichzeitig ihre Geschäftsbeziehungen zu schützen. Umgekehrt können aber auch Investitionen in neuen Märkten auf einmal attraktiv werden. Eine proaktive Informationsbeschaffung und rechtliche Beratung sind hier entscheidend, um rechtzeitig geeignete Massnahmen zu ergreifen. Die laufende Revision des Kartellrechts stellt eine weitere Herausforderung
dar, die Unternehmen nicht ignorieren dürfen. Mit einigen der neuen Regelungen, etwa der Stärkung von Möglichkeiten für Schadenersatzklagen (insbesondere auch für Konsumenten), aber auch der Einführung des international etablierten «SIEC-Tests» («Significant Impediment to Effective Competition») in der Fusionskontrolle, der bereits unterhalb der aktuell massgeblichen Marktbeherrschungsschwelle greifen kann, ergeben sich einerseits neue Risiken und Hürden. Andererseits bringt das revidierte Recht aber auch Modernisierungen und Erleichterungen mit sich; so ermöglicht zum Beispiel der SIEC-Test umgekehrt auch die bessere Berücksichtigung von Effizienzvorteilen, und es wird klargestellt, dass Arbeitsgemeinschaften grundsätzlich nicht als Wettbewerbsabreden gelten. Weitere, ebenfalls wichtige Neuerungen sind noch Gegenstand der laufenden parlamentarischen Beratungen. Unternehmen, die diese neuen Vorgaben frühzeitig verstehen und umsetzen, können sich nicht nur rechtlich absichern, sondern auch ihre Marktposition stärken. Ein fundiertes Verständnis der kartellrechtlichen Rahmenbedingungen ermöglicht es Unternehmen, strategische Entscheidungen zu treffen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern und gleichzeitig die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften gewährleisten. Ein weiteres zentrales Thema ist die Einführung einer globalen Mindeststeuer. Diese Regelung wird, zusammen mit anderen jüngst erfolgten Bestrebungen der Staaten, Gewinne näher bei der tatsächlichen Wertschöpfung zu besteuern, nicht nur die Steuerplanung von Unternehmen beeinflussen, sondern auch deren internationale
M&A-Strategien, da die klassische Gewinnallokation nach steuerlichen Aspekten voraussichtlich an Bedeutung verlieren wird und stattdessen andere Kriterien wie die Verlagerung von Wertschöpfung in Niedrigsteuerländer oder die Ausschöpfung alternativer staatlicher Investitionsanreize in den Vordergrund rücken. Unternehmen müssen sich aber auch ganz generell darauf einstellen, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen volatiler werden und entsprechende Anpassungen in ihrer Konzernstruktur und -strategie regelmässig erforderlich sind. Hier ist aktuelles rechtliches Know-how unerlässlich, um langfristige Stabilität und Effizienz zu gewährleisten.
Die Fähigkeit, sich flexibel an dynamische Rahmenbedingungen anzupassen, ist ein zentraler Wettbewerbsvorteil in der heutigen Geschäftswelt. Eine fortlaufende und strukturierte Informationsbeschaffung ist dabei von entscheidender Bedeutung. Unternehmen sollten nicht nur auf aktuelle Entwicklungen reagieren, sondern auch proaktiv Trends und Veränderungen im regulatorischen Umfeld verfolgen und antizipieren. Dies ermöglicht es ihnen, frühzeitig Strategien zu entwickeln, die nicht nur der Sicherstellung der Compliance dienen, sondern auch zur Schaffung von neuen Marktchancen beitragen.
Insgesamt wird deutlich, dass eine kontinuierliche Beobachtung und Analyse des relevanten rechtlichen Umfelds für Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Sie sichern nicht nur die Einhaltung von Vorschriften und reduzieren Haftungsrisiken, sondern eröffnen auch neue Chancen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und sind deshalb ein strategischer Erfolgsfaktor.
OPINOMIC AG Dammstrasse 19, 6300 Zug, Schweiz / Herausgeber David Kohler / Redaktion (verantwortlich) Rüdiger Schmidt-Sodingen / Art Department Einhorn Solutions GmbH, Sylvio Murer (Art Direction) / Distribution Handelszeitung / Druck DZZ Druckzentrum Zürich AG / Anzeigen OPINOMIC AG / Titel JAKOBUNDBERTSCHI.CH





In Kooperation mit IMPRESSUM
Sie erreichen uns unter info@opinomic.ch und opinomic.ch



Oliver
« Zunehmende Komplexität in (grenzüberschreitenden) M&A Transaktionen»
Nationale wie internationale Regulierungen verändern den M&A-Markt.
Salome Wieser, Rechtsanwältin und Legal Partner bei MME, zeigt gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Samuel Bussmann, Tax & Legal Partner bei MME, die wichtigsten Veränderungen auf.
Frau Wieser, welche aktuellen rechtlichen Herausforderungen beobachten Sie derzeit auf dem Schweizer M&AMarkt?
In den letzten fünf Jahren wurden international aber auch in der Schweiz eine Vielzahl an Vorschriften eingeführt, die zusätzliche Compliance-Anforderungen festlegen und Unternehmen umfassende Dokumentationssowie Berichterstattungspflichten in verschiedenen Bereichen auferlegen. Diese Entwicklungen führen dazu, dass Käufer, Verkäufer und deren Berater in der Transaktionspraxis neue und umfassende(re) Risiken, Pflichten und Bewertungsfragen berücksichtigen müssen, was naturgemäss eine teils deutlich erhöhte Komplexität mit sich bringt. Zu nennen sind beispielsweise die Regulierungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), Datenschutz und Datensicherheit sowie Künstliche Intelligenz oder Gleichstellung (Lohngleichheitsanalysen). Angesichts der ausgeprägten internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen kommt internationalen Regelwerken auch für die Schweiz eine zunehmend wesentliche Bedeutung zu. Die regulatorische Dichte nimmt weltweit stetig zu, während sich Gesetze in immer kürzeren Zyklen ändern. Exemplarisch lassen sich etwa die Sanktionsbestimmungen, die derzeit erkennbare Abkehr von ESG-Initiativen in den USA sowie die aktuellen Bestrebungen in der EU, die Anforderungen an die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette wieder zu lockern, nennen. Die Schweiz passt ihre Gesetzgebung fortlaufend an die internationalen Entwicklungen an, was konsequenterweise auch hier zu erhöhten Komplexitäten führt. Aktuelle Beispiele sind etwa die geplante Einführung einer Investitionskontrolle für Direktinvestitionen durch ausländische Unternehmen oder Privatpersonen, die anstehende Revision des Kartellgesetzes sowie der Gesetzesentwurf zur Einführung eines Transparenzregisters für wirtschaftlich berechtigte Personen an Unternehmen.
Herr Dr. Bussmann, welche Rolle spielen dabei die steuerlichen Rahmenbedingungen?
Steuern können den Investitionsentscheid massgeblich prägen. Sie können die Bewertung von Zielunternehmen senken und müssen auch bei der Strukturierung der Transaktion berücksichtigt werden. Zölle beeinflussen dagegen die operativen Kosten und die Lieferketten, was sich negativ auf erwartete Synergien und Cashflows auswirkt. Beide Faktoren führen dazu, dass Käufer einen stärkeren Fokus auf steuerliche und handelsbezogene Risiken in der Due Diligence legen müssen. Drei wichtige Aspekte sind sicherlich die Schweizer Verrechnungssteuer, die mit 35 Prozent im internationalen

Verhältnis sehr hoch ist, die indirekte Teilliquidation, die dazu führt, dass ein an sich privater steuerfreier Kapitalgewinn teilweise in einen steuerbaren Vermögensertrag umqualifiziert wird, und dann auch die geplante Mindeststeuer, die auf grosse Konzerne anwendbar sein wird (z.B. wenn durch Wind Fusion die Umsatzgrenze von 750 Millionen Euro erreicht wird).
Die geopolitischen Spannungen sind aktuell aufgrund verschiedener paralleler Faktoren herausfordernd. Spiegelt sich dies in M&A Transaktionen wider, Frau Wieser? Wir nehmen Bedenken über die zukünftigen Entwicklungschancen von bestehenden Geschäftsmodellen wahr. Hinzu kommt die Volatilität im Finanzierungsumfeld, längere Transaktionsphasen und höhere Transaktionskosten. Wir beobachten, dass Käufer deshalb ein verstärktes Bedürfnis haben, den Kaufpreis für ein Unternehmen zumindest in Teilen von dessen zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklung abhängig zu machen, üblicherweise durch sogenannte Earn-Out Regelungen. Vertraglich wird dies so umgesetzt, dass ein Teil des Kaufpreises, der Basiskaufpreis,
bei der Übernahme des Unternehmens durch den Käufer bezahlt wird. Der zweite, erfolgsabhängige Teil des Kaufpreises wird dann in einer oder mehreren Tranchen nach der Übernahme bezahlt. Ob und in welchem Umfang die erfolgsabhängige Kaufpreistranche bezahlt wird, hängt damit von der Erreichung der definierten Erfolgsfaktoren ab, welche sich üblicherweise auf ein Geschäftsjahr beziehen. Nebst den klassischen Erfolgsfaktoren wie EBITDA oder EBIT wird auch wieder vermehrt auf weitere finanzielle Indikatoren abgestellt, wie beispielsweise die Performance von bestehenden wesentlichen Kunden oder die Gewinnung von neuen Kunden. Die Definition des erfolgsabhängigen Kaufpreises wird komplexer, indem mehrere Erfolgsfaktoren kombiniert werden (beispielsweise EBITDA mit Kundenperformance), er in mehrere Tranchen unterteilt wird und damit mehrere Geschäftsjahre nach der Übernahme für den Kaufpreis relevant sei können. Die Tranchen werden zudem ebenfalls abgestuft, indem für einen Erfolgsfaktor mehrere Schwellenwerte der Zielerreichung definiert werden. Ferner hat sich das Verhältnis zwischen Basiskaufpreis und erfolgsabhängigem
Kaufpreis dahingehend verändert, dass erfolgsabhängige Kaufpreistranchen einen grösseren Anteil am Gesamtkaufpreis ausmachen. Die Behandlung dieser Konstellationen, ihrer Besonderheiten und Feinheiten ist komplex und oftmals Kernpunkt der Verhandlungen zwischen den Beteiligten.
Herr Dr. Bussmann, hat dies steuerliche Auswirkungen? Je nach Ausgestaltung der Kaufpreistilgung ist abzuklären, ob dann wirklich ein steuerfreier privater Kapitalgewinn oder allenfalls steuerbares Einkommen vorliegt.
Frau Wieser, welche Auswirkungen haben die regulatorischen Entwicklungen auf den Due-Diligence-Prozess bei M&A-Transaktionen?
Sie machen die Due Diligence umfangreicher und komplexer. Auf Käuferseite findet sicherlich eine zunehmend vertiefte Due Diligence statt. Hierbei können auch die EU-Regularien eine Rolle spielen, da diese für zahlreiche Schweizer Unternehmen gelten. MME verfügt deshalb über Berater mit Ausbildung in der EU, die eine fundierte Kenntnisse der für die Schweiz relevanten
Die Schweiz passt ihre Gesetzgebung
MME Als moderne Wirtschaftskanzlei für Recht, Steuern und Compliance unterstützen und vertreten wir Unternehmen und Privatpersonen in allen wirtschaftlichen und zukunftsweisenden Angelegenheiten. Wir betreuen unsere Klienten persönlich und setzen uns für sie ein: unkompliziert und beharrlich -

Salome Wieser ist auf nationale und internationale Unternehmenstransaktionen spezialisiert und berät in- und ausländische Klienten bei M&A und Private Equity Transaktionen sowie Umstrukturierungen in verschiedenen Branchen.

Dr. Samuel Bussmann hat langjährige internationale Erfahrung in der Steuerberatung von mittelständischen und grossen Unternehmen und deren Stakeholdern. Er begleitet seine Kunden bei der Implementierung neuer Geschäftsmodelle, M&A Transaktionen, Umstrukturierungen, internationalen Expansion und Ansiedlung.
Mehr Informationen unter www.mme.ch Steckbrief
EU-Regularien haben. Verkäuferseitig bedeutet dies, sich frühzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und gezielt zu adressieren. Deshalb führen Verkäufer bestenfalls schon vor Einleitung eines Transaktionsprozesses eigene Due-Diligence-Prüfungen durch (sog. Vendor Due Diligence) und setzen im Optimalfall die daraus gewonnenen Erkenntnisse umgehend um. Und welchen Effekt haben diese regulatorischen Entwicklungen auf die Integration nach Vollzug, Frau Wieser? Der rechtlichen Integrationsvorbereitung kommt sicherlich zunehmend mehr Bedeutung zu. Durch den Zukauf eines Unternehmens kann eine Gruppe etwa Schwellenwerte erreichen, welche zu Dokumentations- sowie Berichterstattungspflichten führen. Die Eingliederung eines in der Schweiz tätigen Unternehmens in einen EU-Konzern kann zur Folge haben, dass EU-Regulierungen Anwendung finden. Regulatorische Anforderungen müssen daher frühzeitig identifiziert und bei der Zielgesellschaft gut dokumentier implementiert werden.
Herr Dr. Bussmann, welche Herausforderungen stellen sich aus steuerlicher Sicht bei der Integration? Da gibt es ganz verschiedene Themenbereiche, die zu beachten sind. Was man sicher sagen kann, ist, dass das Transfer Pricing seitens der Steuerbehörden vermehrt geprüft wird. Deshalb sind bei der Integration gruppeninterne Transaktionen genau zu analysieren.
Es klingt plausibel: Unternehmen sollen dort Steuern zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften - und damit auch das Gemeinwesen finanzieren. Doch Streitigkeiten sind vorprogrammiert.

Was
bringt, was nimmt die Mindeststeuer?
Welche Auswirkungen hat die OECD-Mindestbesteuerung auf Schweizer Unternehmen und Kantone? Welchen Handlungsbedarf haben Konzerne mit internationaler Steuerplanung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Was bedeutet die globale Mindeststeuer?
«Die bisherige Besteuerung von grossen, international tätigen Unternehmensgruppen», so das Eidgenössische Finanzdepartment in seinem Dossier vom 4. September letzten Jahres, «ist nach Ansicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) nicht mehr zeitgemäss». Angesichts zunehmend digitaler und globaler Geschäftsmodelle fordern deshalb 140 Staaten, darunter die Schweiz, von international tätigen Unternehmensgruppen mit einem Umsatz ab 750 Millionen Euro eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf deren Gewinn. Wer in einem Land, in dem er tätig ist, die 15 Prozent nicht erreicht, soll die Differenz an ein anderes Land abführen.
Was soll die Mindeststeuer bewirken?
Die Mindeststeuer, die hierzulande als Ergänzungssteuer erhoben wird, damit die restlichen Prozente nicht aus der Schweiz abfliessen, soll möglichst schnell stabile Rahmenbedingungen schaffen «sowie Steuereinnahmen und Arbeitsplätze in der Schweiz sichern». Der Ertrag der Ergänzungssteuer, so das EFD, «soll zu 75 Prozent den Kantonen und zu 25 Prozent dem Bund zukommen. Über den Nationalen Finanzausgleich erfolgt danach eine Umverteilung zwischen allen Kantonen. So erhalten auch finanzschwache Kantone einen Anteil der Einnahmen.» Für 2026 schätzt das EFD die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer auf 1 bis 2,5 Milliarden Franken. Sowohl «die kurz- als auch langfristigen finanziellen Auswirkungen» seien allerdings ungewiss. Die Unsicherheiten begründet das EFD mit einer «eingeschränkten Datengrundlage» – offensichtlich ist längst nicht bei allen grossen Unternehmen geklärt, wer wo wie hoch besteuert wird.
Wie setzt die Schweiz die Regelungen um?
Nach der Volksabstimmung am 18. Juni 2023, bei der 78,5 Prozent der teilnehmenden Stimmberechtigten für eine Umsetzung der Mindestbesteuerung votierten, erfolgt die Umsetzung zunächst über eine von den Kantonen veranlagte nationale Ergänzungssteuer (QDMTT). Als Zusatz dient die internationale Ergänzungssteuer (IIR), die temporär «alle ausländischen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe bei der obersten Muttergesellschaft (oder einer Zwischenholding)» mindestbesteuert, «wenn die Geschäftseinheiten in anderen Staaten keiner Mindestbesteuerung unterworfen sind».
Welche Unternehmen sind betroffen, welche nicht?
Von der Mindeststeuer betroffen sind «ausschliesslich grosse, international tätige Unternehmensgruppen mit einem jährlichen weltweiten Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro». «In der Schweiz», so das EDF, «zählen wenige Hundert inländische sowie wenige Tausend ausländische Unternehmensgruppen dazu. Grob 99 Prozent der Unternehmen in der Schweiz sind von der Reform daher nicht direkt betroffen und werden wie bisher besteuert». Die entsprechend höheren Summen der betroffenen Konzerne machen allerdings auch die zu erwartenden Probleme deutlich. In Kantonen mit einer tieferen Besteuerung als 15 Prozent wirken nun verstärkt nicht-kantonale Kräfte auf die Unternehmen ein. Die jahrelang als sicher geltende Profitkraft droht zur Fliehkraft zu werden.
Welche Steuerstrategien können Firmen ergreifen?
Betroffene Firmen müssen ihre nationalen Einheiten überprüfen und werden Vergleiche mit den anderen Ländern, in denen sie aktiv sind, anstellen. Erste Beraterfirmen bieten bereits Steuermodellierungen gemäss
dem OECD-Regelwerk an, planen länderübergreifende Reportings und passen die entsprechenden Compliance-Pflichten an. Inwieweit sich daraus Produktionsverlagerungen in andere Länder ergeben, von Erweiterungen oder Verkleinerungen bestehender Dependancen bis zu Neueröffnungen in Ländern ohne Mindestbesteuerung, kommt sicher entscheidend auf die Branche und auch auf die globalen, politischen Entwicklungen an. Die LegalBereiche werden in jedem Fall die weiteren rechtlichen Vorgaben der OECD überprüfen und gegebenenfalls auch Abwägungen treffen, wie sich im Einklang mit den Unternehmenszielen und Steuerlasten M&A-Transaktionen zur weiteren Vergrösserung eines Unternehmens noch lohnen. Sicherlich wird es auch Unternehmen geben, die sich bewusst kleinrechnen oder -schrumpfen wollen, um die Umsatzmarke von 750 Millionen Euro zu unterschreiten.
Was sind die Risiken und Chancen für den Wirtschaftsstandort Schweiz?
Zunächst einmal sei es gut, mit den anderen 140 Staaten und der OECD auf einer Wellenlänge zu liegen, meinten einige Beobachter nach der Einführung der Mindeststeuer in der Schweiz. Dennoch bleibt die Sorge, dass neue Compliance-Anforderungen mit zusätzlichen Berichtspflichten aus der Mindeststeuer ein maximales Bürokratenmonster erschaffen und den Standort Schweiz unattraktiver machen. «Die Schweiz läuft Gefahr, durch die Einführung dieser
internationalen Ergänzungssteuer an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren», so Peter Hongler, Professor für Steuerrecht an der Universität St. Gallen am 16.8.2024 in der NZZ. «Die globale Mindeststeuer ist in ihrem Ausmass zudem sowohl für die Behörden als auch für die Unternehmen nicht verdaubar. Die Begleitdokumentationen zu den Mustervorschriften haben mittlerweile mehrere hundert Seiten erreicht, und bis auf ganz wenige Spezialisten hat niemand den umfassenden Durchblick.» Eine bürgernahe Steuerpolitik sehe anders aus. Ebenfalls in der NZZ vermerkte Matthias Benz am 3.9.: «Solange die halbe Weltwirtschaft nicht mitmacht, ist die Mindeststeuer kein globaler Standard, sondern ein prekäres Gebilde mit unklarer Zukunft.»
Zahl- vs. Verteilkampf In seinem Dossier vom September betont das EFD, dass «eventuelle Anpassungen» seitens der Unternehmen aber auch Kantone die Einnahmen der Ergänzungssteuer noch erheblich verändern könnten. Die «Anpassungsreaktionen der Unternehmen können sich auf die Einnahmen aus nahezu allen Steuern und auf die Einnahmen aus Sozialversicherungsbeiträgen negativ auswirken». Darum solle ein Teil der Steuereinnahmen «zur Finanzierung von Massnahmen eingesetzt werden, die dem Standort Schweiz zugutekommen». Ob diese Kompensationsmassnahmen hauptsächlich von den Kantonen oder vom Bund ergriffen werden sollen, ist unklar. So könnten
Unternehmen trotzdem ihre Investitionen in der Schweiz zurückfahren oder bestimmte Abteilungen oder Geschäftsfelder in ein anderes Land verlegen, wo die Mindeststeuer noch nicht erhoben wird. Auch könnten Unternehmen sich noch mehr dazu verleiten lassen, gezielt nach staatlichen Förderungen für Investitionen zu fragen, oder, je nach Gewinnplanung, öfters ihre Konzernstrukturen umzustellen. Fest steht: Die Steuerplanung wird je nach Branche und Umsatz des Unternehmens an Bedeutung zunehmen. Andererseits dürfte mit der Ergänzungssteuer der Steuerwettbewerb der Kantone leiden, was ebenfalls zu einem erhöhten Aktionismus führen könnte. So könnten etliche Kantone klassische Steuern für juristische Personen, etwa die Gewinnsteuer, nach oben anpassen, weil sie mit dem Verteilschlüssel der Ergänzungssteuer nicht zufrieden sind. Wenn ein Unternehmen in dem Kanton, in dem es ansässig ist, sehr wenig Steuern zahlt, profitieren plötzlich andere Kantone und der Bund von der Differenzbesteuerung. Hier werden angesichts der Investitionen, die ein Kanton in Zukunft stemmen muss oder möchte, sicherlich Anpassungen erfolgen, um die Gelder grosser, vor Ort tätiger Unternehmungen bei sich zu behalten. Ob Unternehmen innerhalb der Schweiz umziehen werden, um sich lieber von hohen klassischen Steuern eines Kantons als von einem schwierigen SteuerMix in einem Kanton mit bis dato tiefen Steuern gängeln zu lassen, wird auch von der Lust an der Berichtslast abhängen.
«Die Schweiz läuft Gefahr, durch die Einführung dieser internationalen Ergänzungssteuer an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.»
Peter Hongler Professor für Steuerrecht an der Universität St. Gallen
«Internationale Entwicklungen im Steuerrecht sind aktuell einer der zentralsten Punkte der Unternehmenspolitik »
Fabian Sutter, Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte, ist Partner im Zürcher Büro der Anwaltskanzlei Loyens & Loeff. Im Interview nimmt er Stellung zu den neuesten Unwägbarkeiten im schweizerischen und internationalen Steuerrecht
Herr Sutter, wie sehr beeinflusst das Steuerrecht allgemein die Unternehmenspolitik?
Steuern waren schon immer und bleiben ein Kostenfaktor. Einer von vielen – aber dennoch ein relevanter. Steuern sind wichtig für Investitionsentscheidungen. Selbstverständlich müssen auch andere Faktoren stimmen (politische Stabilität bzw. Berechenbarkeit, Sicherheit, verfügbarer Talentpool).
Wenn es nicht (nur) um den Zugang zum lokalen Absatzmarkt geht, dürfte Steuerrecht eine wesentliche Entscheidungsgrundlage sein. Dies geht wiederum auch aus jüngeren Studien der OECD hervor. Steuerrecht setzt somit aber auch Anreize oder kann eine Art Abschreckungswirkung entfalten. Insbesondere die jüngere Tendenz, wonach anstelle von generellen Steueranreizen oder tiefen Steuersätze lieber von spezifischen Subventionen gesprochen wird, setzt dies voraus, dass sich ein Land bewusst ist, was die konkret erwünschte Tätigkeit sein soll. Und das kann sich je nach politischer Lage rasch ändern.
Wo liegen derzeit die Herausforderungen im schweizerischen Steuerrecht?
Die Schweiz hat ein komplexes, aber sehr vielfältiges Steuerrecht. Wir erheben neben den generellen Einkommens- und Gewinnsteuern noch Stempelabgaben, Konsumsteuern, verschiedene Lenkungsabgaben, nun noch eine Radio- und TV-Gebühr (richtig wäre: Steuer) sowie jüngst noch die OECDMindeststeuer. Zwar trifft dies auch auf viele andere Länder zu, der Föderalismus führt jedoch zu einer grossen Vielfalt, was äusserst positiv ist, weil sich so der Ideen-Wettbewerb entfalten kann und die unterschiedliche Wirtschaftssituation der Kantone so auch mit verschiedenen Strategien erfolgreich sein kann. Herausfordernd sind daher zentralistische Massnahmen wie die OECDMindeststeuer. Die meisten Schweizer Kantone verfolgen seit Inkrafttreten der letzten Unternehmenssteuerreform im Jahr 2020 eine Strategie mit relativ tiefen Steuerbelastungen, aber ohne selektive Massnahmen. Forschungs- und Entwicklungsanreize wie Patentboxen sind zwar international akzeptiert aber m.E. landesweit wenig von Bedeutung. Die Mindeststeuer hat die Schweiz dank einer sehr erfolgreichen Volksabstimmung rechtzeitig umgesetzt. Herausfordernd ist aber wohl weniger die Idee einer globalen Mindeststeuer an sich, sondern deren Umsetzung. Es ist ein zentralistischer Ansatz, nach dem Prinzip «one-size-fitsall». Die Vorgabe der Steuerberechnung und Erhebung durch die Musterwerke der OECD nehmen vor allem kleineren Staaten die Möglichkeit, ihre Stärke über die Steuerpolitik auszuspielen. Natürlich ist es das Ziel des Projektes, den Steuerwettbewerb zu reduzieren
bzw. auszuschalten, was definitiv nicht im Interesse aller Mitgliedstaaten der OECD ist. Aber wir leben in einer Zeit der Realpolitik.
Nochmal zur OECD-Mindeststeuer.
Um was geht es dort genau?
Per Anfang 2024 haben zahlreiche, vor allem westliche Staaten die Vorschläge der OECD zur Mindeststeuer ganz oder teilweise umgesetzt. Darin enthalten sind nicht nur Massnahmen, in welchen die Länder ihr eigenes Steuersubstrat zu mindestens 15 % besteuern, sondern auch das anderer Staaten, in welchen sich Gruppengesellschaften eines Konzerns befinden. Das ist notwendig, um alle Länder faktisch zu zwingend, die Regeln anzuwenden.
Ist das denn etwas Schlechtes?
Das ist eine politische Frage und keine rechtliche. Rechtlich ist immerhin klar, dass vor allem die westlichen Länder im Rahmen der OECD eine internationale Steuerpolitik der Abgrenzung der nationalen Besteuerungsbefugnisse über Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) verfolgt haben. Die Besteuerung erfolgt da, wo die Wertschöpfung generiert wird. Unter der Mindeststeuer haben wir im Extremfall mit der sog. Undertaxed Profits Rules (UTPR) eine formelhafte Zuteilung von Einkünften auf verschiedene Länder unabhängig von der Wertschöpfung. Es erscheint fraglich, inwiefern sich dies mit den geltenden DBA verträgt. Das war mitunter ein Grund, weshalb die Schweiz die fragliche Regelung bisher nicht eingeführt hat.
Ist es nicht eher eine Frage der Zeit, bis sich die Staaten an die Umsetzung gewöhnt haben? Sicherlich auch ja. Aber es ist schwierig, eine Umsetzung zu erreichen, wenn die OECD jährlich drei bis vier neue Leitlinien erlässt, welche angeblich offene Fragen klären. Die jüngste Version vom Januar 2025 führt teilweise derartig weitgehende, neue Konzepte ein, dass man wohl von einer Änderung der Spielregeln im Spiel sprechen muss. Das stellt uns verfassungsrechtlich vor spannende Fragen – hat aber auch effektive reale Kosten. Der administrative Aufwand für Unternehmen ist hoch. Dem Vernehmen nach gibt es Konzerne, welche Kosten im zweistelligen Millionenbereich für die Compliance unter der Mindeststeuer haben, nur um herauszufinden, dass sie keine oder fast keine Mindeststeuer bezahlen werden. Schon nur aus verfassungsrechtlicher Sicht, halte ich derartige Verhältnisse für nicht sachlich begründbar.
Man liest auch gegenwärtig viel über die US-Zölle sowie andere Steuerstreitigkeiten der USA. Die USA haben sich per Januar 2025 offiziell aus dem Mindeststeuerprojekt verabschiedet. Es wird zwar verhandelt,

Steckbrief
Loyens & Loeff
Loyens & Loeff ist eine führende sowie eine der grössten kontinentaleuropäischen Anwaltskanzlei mit Standorten in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und der Schweiz. Mit weiteren Büros in London, Paris und New York ist die Kanzlei auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Effizienz und integrierte Expertise ausgelegt. Ein besonderer Fokus von Loyens & Loeff liegt den Bereichen der Beratung von Unternehmen, Private Equity & Fonds, Real Estate, Life Sciences & Healthcare sowie Energie & Infrastruktur.
Mehr Informationen unter loyensloeff.com

aber der Wunschkatalog der USA ist lang: Die aktuelle Regierung verlangt mitunter eine völlige Ausklammerung von US-Gruppengesellschaften aus dem System sowie, dass ihre GILTI-Hinzurechnung (ein der Mindeststeuer ähnliches Konzept) als äquivalent angesehen wird – wodurch der administrative
Aufwand für US-Gruppen stark reduziert würde. GILTI berechnet die Mindeststeuer jedoch auf globaler Ebene – die OECD-Mindeststeuer auf nationaler. Ich kann die Einwände der TrumpAdministration ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen. Vor allem die westeuropäischen Staaten sind überrascht über die Androhung von Zöllen, aber drohen selbst seit Jahren mit der Erhebung extraterritorialer Steuern oder mit möglicherweise DBA-widrigen Massnahmen in anderen Bereichen. Etwas Selbstkritik aus europäischer Sicht wäre durchaus angebracht.
Eskaliert der internationale Steuer- und Zollstreit?
In den USA wird an einem Vergeltungspaket gearbeitet, welches sich an Staaten richtet, welche die extraterritorialen Steuern unter der Mindeststeuer anwenden oder eine Digitalsteuer erheben (welche sich offenkundig vor allem gegen US-Konzerne richtet). Die Schweiz hat gut daran getan, derartige Massnahmen nicht umzusetzen, was man aktuell auch als Standortvorteil bezeichnen könnte. Mittel- bis langfristig
Herausfordernd ist aber wohl weniger die Idee einer globalen Mindeststeuer an sich, sondern deren Umsetzung.
sehe ich keine Eskalation. Der Vorschlag der USA, ihre GILTI-Hinzurechnung als äquivalent zu behandeln, scheint mir eine sehr elegante und für die OECD gesichtswahrende Lösung zu sein, den Umfang der Mindeststeuer zu reduzieren, ohne das Ziel ganz zu verfehlen. Dies würde darüber hinaus die Möglichkeit bieten, dass auch unter der OECD-Mindeststeuer auf eine globale anstatt nationale Berechnung gewechselt werden könnte. Dies sollte die Bedenken vieler Länder entschärfen. Es war von Anfang an klar, dass weder die USA noch China das Projekt je umsetzen werden. Entsprechend ist es sinnvoll, sich hier um eine einfache Lösung zu bemühen.
Wie sehen sie die Position der Schweiz? Wichtig ist: Die USA sind das Land mit den höchsten Direktinvestition in die Schweiz. Die Investitionen sind gemäss letzter Statistik der SNB höher als diejenigen der EU-Mitgliedstaaten zusammengerechnet. Das wird in der öffentlichen Diskussion gerne vergessen. Es erstaunt daher nicht, dass die Schweiz als eines der ersten Länder eine Verhandlungslösung im Zollstreit sucht. Der Bundesrat hat gut daran getan, weder die UTPR noch eine Digitalsteuer einzuführen. Trotz Einführung der Mindeststeuer haben wir aktuell mehr Anfragen für Ansiedlungsprojekte in der Schweiz. Dies schafft Arbeitsplätze und generiert neue Steuereinnahmen für Bund und Kantone. Als Berater wäre mein Wunsch einzig, dass wir restriktive Praxen überdenken, wenn noch die OECD-Mindeststeuer hinzukommt.
Fabian Sutter Partner, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte

Anpassungsmassnahmen von Unternehmen
«Tue Gutes und rede nicht
mehr darüber»
Die US-Regierung möchte ihre Gesellschaftspolitik bis in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Unternehmen bringen.
Wer sich als Unternehmen präsentiert, das aktiv Diversität fördert, Frauenquoten einführt und den Klimawandel bekämpft, so machte es eine Art «blauer Brief» an mehrere internationale Unternehmen Anfang April klar, handelt nicht im Sinne der derzeitigen US-Regierung und muss eventuell mit Auftragseinbussen rechnen. Von weiteren Massnahmen gegen Bürgerinnen und Bürger, die aus den angeschriebenen Ländern kommen, ganz zu schweigen.
Hat dieser Eingriff in die jeweilige Unternehmensphilosophie Folgen? Müssen Unternehmen ihr Bekenntnis zur Diversität ad acta legen? In einer Zeit, in der nonstop Dinge kommuniziert werden, die gar nichts mit den jeweiligen Produkten oder Dienstleistungen zu tun haben, sondern mit verantwortungsbewusstem Handeln, könnte es sein, dass Unternehmen wieder «nur» über ihre konkreten Ergebnisse sprechen – und das Handeln für die Gesellschaft und für Minderheiten den Regierungen überlassen. Natürlich: Ein gutes Produkt muss nicht zwangsläufig aus einem divers denkenden Unternehmen kommen.
Allerdings haben die Verbraucher auch ein Wörtchen mitzureden. Aus einer Gesellschaft, die Vielfalt und Umweltschutz möchte und zunehmend verinnerlicht, lässt sich keine stumme Konsumentenherde mehr machen, die nur auf den Preis schielt und so tut, als wäre man im letzten Jahrhundert.
Die geforderte Transparenz der Digitalisierung lässt sich im Personalbereich und bei der konkreten Erarbeitung von Produkten nicht einfach abstellen. So gesehen könnte es vor allem zu einem Rückbau der öffentlichen Kommunikation kommen – was auch die sozialen Medien und deren Betreiber empfindlich treffen wird. Denn wenn Statusmeldungen sich weg von Unternehmensphilosophien oder verantwortungsvollem Handeln zurück zu reinen Produktaussagen entwickeln, wird das für die emotional funktionierenden, polarisierenden sozialen Medien nicht mehr reichen. Es stellt sich dann die Frage, ob Unternehmen abseits klassischer Werbung überhaupt noch andere Dinge über die eigene Arbeit, über das Personal und ihre Teams kommunizieren sollten. Inwiefern das Nicht-Kommunizieren einer Firmenphilosophie diese auch umkrempelt, steht auf einem anderen Blatt. Bei Liebenden reichen ja auch Blicke anstatt Worte.

Bevorzugte Behandlung?
Der Preis der Neutralität
Dass US-Präsident Donald Trump die neutrale Schweiz nicht anders behandelt als andere Länder, sorgte in den letzten Wochen kaum für Verwunderung.
In seiner lesenswerten Geschichte «Die Schweiz und ihre Neutralität» (Hier und Jetzt, Zürich 2023) analysiert Marco Jorio, wie die Neutralität als «Nichtteilnahme an einem Krieg» zu den Eidgenossen kam – und sich über die Jahre und Jahrhunderte hielt, immer wieder in Frage gestellt wurde und im Neutralitätsrecht gipfelte. Die «grösste Herausforderung für die Neutralität und die Aussenpolitik der Schweiz» sei die europäische Einigung gewesen, «die in den 1950er-Jahren Fahrt aufnahm und der die Schweiz aus Furcht vor Souveränitätsverlust misstrauisch gegenüberstand».
Wenn angesichts des UkraineKrieges neue Neutralitätskonzepte diskutiert werden, die einen Schulterschluss mit dem Westen suchen, um Sanktionen mitzutragen und gleichzeitig weiter als zuverlässiger Werteund Handelspartner zu gelten, erklärt Jorio dies damit, dass die Schweiz mittlerweile «von friedlichen Nachbarn umgeben» sei, «womit die Unabhängigkeits- beziehungsweise Schutzfunktion der Neutralität hinfällig wurde». Wer, beispielsweise im Hinblick auf die wirtschaftlichen Interessen, weiter auf grösstmögliche Neutralität poche, müsse wissen, dass «gegen eine Reihe von neuen militärischen Gefahren, wie etwa Massenvernichtungswaffen, Raketen, Marschflugkörper, Cyberangriffen oder Terrorismus» Neutralität ohnehin nicht schütze. Die Unabhängigkeitsfunktion drohe sich
sogar ins Gegenteil zu kehren, «weil für eine isolationistische Schweiz die Gefahr besteht, bei einer militärischen Bedrohung allein gelassen zu werden». Bereits die Übernahme der EUSanktionen im Ukrainekrieg sei «ein beredtes Zeugnis dafür, dass die Schweiz in Kriegs- und Krisenzeiten nur noch beschränkt Handlungsfreiheit besitzt, sofern sie politische und wirtschaftliche Schäden vermeiden will». Der «autonome Nachvollzug» entpuppe sich «als Euphemismus, die Rückkehr zur integralen Neutralität als Luftschloss». Jorio plädiert folglich für eine auf den ursprünglichen «militärischen Kern reduzierte Neutralität», mit der die Schweiz «mehr zu einer regelbasierten Friedensordnung beitragen» könne «als mit ihrer gegenwärtigen verwirrlichen Neutralitätspraxis».

Zwischen Schadensbegrenzung und Diversifizierung
Auch die Schweiz arbeitet an einer Zollvereinbarung mit den USA. Und so werden, nachdem sich Bundespräsidentin Karin KellerSutter und Bundesrat Guy Parmelin mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer auf ein «agreement in principle» verständigt haben, die Staatssekretärinnen Helene Budliger Artieda und Daniela Stoffel in die USA fliegen, um dort, wo gefühlt im Minutentakt ausländische Staatsgäste landen, eine für beide Seiten annehmbare Zoll- und damit auch Wirtschaftsvereinbarung zu treffen.
Die Wechselwirkungen zwischen den US-Sanktionen und der Schweizer Wirtschaft sind komplex. Dass die USA beispielsweise für hiesige Uhrenhersteller der wichtigste Markt sind, ist sicher richtig. Längst stehen die Zeiger jedoch auch in vielen anderen Branchen auf Veränderung und mahnen «höchste Zeit» für eine Diversifizierung an. Angesichts der zunehmenden Willkür und Unsicherheiten «muss die Schweiz ihre Märkte diversifizieren und ihre Handelsallianzen stärken, um ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern», empfiehlt John Plassard, Senior Investment Specialist der Mirabaud Group. Zugleich warnt Plassard
vor weiteren Kreisen der Krise – und konkret dem Stichtag 9. Juli, ab dem die USA 50 Prozent auf sämtliche Einfuhren aus der EU erheben wollen. «Dieser Tag könnte einen bleibenden Bruch in den Handelsbeziehungen von zwei der grössten Wirtschaftsmächte der Welt bedeuten.» Schrumpfende Bruttoinlandsprodukte, weniger Investments und gestörte Lieferketten würden folgen, so Plassard auf LinkedIn. Trumps täglicher «MAGA»-Rundumschlag mit seinen kurzfristigen On-Off-Anpassungen will unter Ausklammerung der eigenen Techgiganten alle ausländischen Exportmeister bestrafen – und befördert eine Willkür, mit der die Märkte nur schlecht umgehen können. Dr. Andreas Beck, Gründer und CEO der Index Capital GmbH, gab auf seinem YouTube-Kanal «Wissenschaftlich Investieren» zu bedenken: «Unternehmen haben immer zwei Risiken: Sie müssen heute erraten, was der Kunde will. Sie haben immer Investitionsvorlauf. Sie müssen heute ins Risiko gehen, sich überlegen, welche Maschinen schaffen wir an, etc. Und dann haben sie als zweites Thema: Was will mein Investor? Wie muss ich in der Preispolitik vorgehen, damit ich am Kapitalmarkt auch die nötige Liquidität bekomme, um meine
Investitionsvorhaben umzusetzen?»
Während ausländische Politiker für die Planungssicherheit der Wirtschaft Schadensbegrenzung betreiben, wagen sich die Amerikaner selbst mittlerweile an eine Art Ursachenforschung für Trumps Trial-and-Error-Politik. Im Wall Street Journal griff Holman W. Jenkins Jr. unter dem Titel «Trump gegen das Vakuum» sämtliche Kontrollinstitutionen des Staates an. Sie hätten Trump zurück ins Weisse Haus getrieben. Alle Institutionen, «von der Presse und den Universitäten bis hin zum FBI, der Anwaltschaft und der Demokratischen Partei» hätten sich so diskreditiert, «dass sie jetzt hilflos umherirren». So geniesse US-Präsident Trump, «obwohl er eine lahme Ente ist, nun aussergewöhnlichen Handlungsspielraum, da ihm eine glaubwürdige Opposition fehlt». «Glücklicherweise», so Jenkins, funktioniere der «grundlegende Newtonismus der amerikanischen Politik noch immer». Die grosse zentrierende Kraft des amerikanischen Lebens werde «ihren rechtmässigen Platz» wieder einnehmen. «Es ist damit zu rechnen, dass dies in Rekordzeit geschehen wird, wenn die Auswirkungen von Trumps Handelstheorien an den amerikanischen Küchentischen spürbar werden.»
©iStockphoto.com/assalve
Grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten

«Schweizer und andere ausländische Unternehmen könnten einen
Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Tarife haben»
Als Partner von 5Gambit Disputes vertritt Tomislav Joksimovic Unternehmen und Privatpersonen in grenzüberschreitenden US-amerikanischen Vollstreckungsverfahren.
Der US-Rechtsanwalt, globale Prozessanwalt und Krisenmanager erläutert im Interview die aktuellen Herausforderungen für ausländische Unternehmen.
Herr Joksimovic, Sie sitzen gerade in den USA. Wie erleben Sie die Unsicherheiten ausländischer Unternehmen angesichts der verhängten Strafzölle?
Die Tarife der Trump-Regierung sorgen zunächst einmal für grosse Verunsicherung auf der geschäftlichen, operativen und logistischen Ebene für viele Schweizer und europäische Unternehmen. Allerdings kann die konsequente Umsetzung und Anwendung der Tarife für europäische Unternehmen auch zu verschiedenen rechtlichen Herausforderungen führen.
Wie sehr erfordern die Massnahmen der derzeitigen US-Regierung rechtliche Anpassungen für Schweizer Unternehmen?
Die Massnahmen erfordern nicht unbedingt direkte rechtliche Anpassungen, allerdings sollten Schweizer Unternehmen sicherstellen, dass alle Exporte in die USA richtig deklariert und klassifiziert werden. Die US-Behörden haben ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Zollbetrug deutlich verstärkt und ihren Ansatz deutlich verschärft, was auch bei einfachen Fehlern und Versäumnissen bei den Ausfuhrbestimmungen zu Untersuchungen führen kann. In der Tat gab es jüngst schon strafrechtliche Verfolgungen von ausländischen Unternehmen und Personen, primär in China, die durch verschiedene Methoden, wie z.B. die künstliche Reduzierung von Preisen, die falsche Klassifizierung von Gütern oder die Ausfuhr über Drittstatten, auf die die USA niedrigere Zölle anwenden, die US-Tarife umgangen haben.
Des Weiteren können die US-Tarife auch zu rechtlichen Streitfällen mit Vertragspartnern führen, um zu bestimmen, wie diese in diesem Ausmass
Die US-Behörden haben ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Zollbetrug deutlich verstärkt und ihren Ansatz deutlich verschärft.
oft nicht antizipierten Kosten zwischen den Parteien verteilt werden sollten.
Sie vertreten zahlreiche Unternehmen und auch Einzelpersonen aus anderen Ländern, die von der US-Regierung angeklagt wurden. Wie wichtig sind Erfahrungen aus verschiedenen Ländern, um in diesen Rechtsstreitigkeiten vermitteln zu können?
Sehr wichtig, da das Verständnis von anderen und häufig auch abweichenden Rechtssystemen und Rechtskulturen auf Seiten der US-Behörden in einigen Fällen auch zu einer gewissen Nachsicht führen kann.
Helfen diese Erfahrungen auch, damit Unternehmen nach einer Zollvereinbarung sicher planen können?
Zum Teil schon, allerdings ist die die Planung um die Tarifvereinbarung herum schon primär eine operative, logistische und wirtschaftliche Frage.
Können rechtliche Klärungen dazu beitragen, dass momentane Lieferstopps nach einer Zollabsenkung schneller wieder aufgehoben werden? In einigen Fällen vielleicht, aber grundsätzlich nein.
Inwieweit müssen Unternehmen ihre Compliance intern und extern anpassen?
Unternehmen, die in die USA exportieren, müssen in der Compliance sehr wachsam sein, dass die bestehen
Vorschriften und Anforderungen zur Einfuhr in die USA eingehalten werden, um zu vermeiden, dass das Unternehmen in Verdacht kommt, die Tarife bewusst umgehen zu wollen.
Wo werden in den kommenden Monaten die Herausforderungen liegen, um weiterhin sicher, und eben auch rechtssicher, in die USA exportieren zu können?
Abgesehen von den bereits beschriebenen Herausforderungen könnte es eventuell zu einem Szenario kommen, dass Schweizer und andere ausländische Unternehmen einen Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Tarife haben, wenn ein US- Gericht in der letzten Instanz befindet, dass die von der Trump-Regierung verhängten Zölle ungültig sind, da sie sich ausserhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen.
Das US-Sanktionsrecht galt schon immer als zentrales Recht, um aussenpolitische Veränderungen herbeizuführen oder Gefahren von den USA abzuwenden. Rechnen Sie damit, dass nach den Zöllen weitere Massnahmen folgen, die sich gezielt gegen Organisationen, Unternehmen oder einzelne Personen richten?
Ja, die Anwendung von neuen Sanktionen, gerade auch in Kombination mit hohen Tarifen, wird weiterhin eines der primären Instrumente zur Umsetzung von aussenpolitischen Zielen der US-Regierung bleiben.
Steckbrief
5Gambit Disputes 5Gambit Disputes ist eine in der Schweiz gegründete Boutique-Anwaltskanzlei mit dem Schwerpunkt auf internationaler Streitbeilegung. 5Gambit Disputes verbindet die langjährige Erfahrung aus Elite-Anwaltskanzleien mit einem mutigen, hartnäckigen und konfliktfreien Ansatz in Streit- und Regulierungsfragen, Handelsstreitigkeiten und grenzüberschreitender Prozessführung.
Mehr Informationen unter 5gambit.com

Tomislav Joksimovic Partner
VON RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
Das Bewältigen kultureller, regulatorischer und wirtschaftlicher Unterschiede, das von internationalen Unternehmenszusammenschlüssen mehr denn je gefordert wird, verlagert sich zunehmend auf den rechtlichen Bereich. Denn wenn Compliance-Bestimmungen je nach Regierung hoch- oder runterfahren, Steuern und Zinsen kurzfristig variieren und sich das Konsumentenverhalten vor Ort nach der politischen Einflussnahme, sprich der öffentlichen Meinung, richtet, müssen Rechtsabteilungen entschlossen handeln. Und Lösungen finden. Neben Handlungsempfehlungen für die Geschäftsführung und alle Mitarbeitenden müssen Rechtsabteilungen auch ruhige, verlässliche Voraussagen treffen, die den weiteren Weg weisen. Mehr denn je gilt: Kein Unternehmen kann ein «Closed Shop» sein, wenn es um die Bedürfnisse der Stakeholder und die Auswirkungen und das Ansehen der täglichen Arbeit geht. Das Erschliessen oder Halten internationaler Märkte kann auch kurzfristige Produktionsverlagerungen oder Fusionen bedeuten. Denn wenn sich der «regelbasierte Welthandel» dank vermehrter Zölle auflöst oder zumindest grundlegend ändert, stellt das die Frage nach mehr Produktionsstätten oder neuen Kooperationen in dem Land, das die Zölle erhebt.
Anzahl der Fusionen leicht rückläufig
Die Beratungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte meldete im Februar in ihrer Studie «M&A Activity of Swiss SMEs» zunächst einen Rückgang der Fusionen und Übernahmen mit Schweizer Beteiligung um knapp neun Prozent. Während ausländische Unternehmen 2024 wieder fünf Prozent mehr Schweizer KMU kauften als im von minus 35 Prozent gebeutelten Vorjahr, gingen Schweizer KMU um knapp ein Prozent weniger auf Einkaufstour im Ausland, nach einem moderaten Ein-Prozent-Plus im Jahr 2023. Der bis dato zunehmend stärkere «Outbound»-Markt schwächelte im Vorjahr, während die Rückgänge der «Inbound»-Transaktionen gestoppt und wieder deutlich ins Plus gefahren wurden.
Die Hauptsorgen der Schweizer CFOs, so die Umfrage, seien «geopolitische Risiken, die Auswirkungen des US-Präsidentenwechsels und, in geringerem Masse, die schwache Nachfrage und der Arbeitskräftemangel». 2025 werde ein turbulentes Jahr – besonders auch für die Unternehmen, die Fusionen und Übernahmen durchführen wollten. Das Rekordtempo, in dem beispielsweise die USA Zölle ankündigen, dann umsetzen oder doch wieder aussetzen, lässt viele Unternehmen ratlos zurück. Lohnt es sich, zusätzliche Verpflichtungen einzugehen oder gar Produktionsstandorte aufzubauen, wenn bestimmte Zölle in ein paar Jahren wieder zurückgenommen oder neu verhandelt werden?
Volatile Geopolitik
Dass Produktionsstätten vor Ort selber von Zöllen betroffen sein können,
Die Kunst der Durchdringung
Als Kind des liberalisierten Handels galten Cross-Border M&A lange Zeit als perfekte Unternehmensstrategie, um internationale Märkte schneller zu erobern und Einkünfte und Produkte zu diversifizieren. Was wird aus dieser Strategie angesichts zunehmender Regulierungen?
wenn sie nicht wirklich sämtliche benötigten Komponenten im Land der Produktion bekommen, macht die Planung keineswegs leichter. Auch ist nicht klar, wie sich die Kaufkraft in Ländern wie den USA entwickelt, wenn zum Schutze der eigenen Produktion zwar Strafzölle gegen ausländische Produkte verhängt werden, aber dadurch inländische Produkte doch teurer werden und die Nachfrage sinkt. Unternehmen brauchen mehr also denn je Exit-Strategien, die auch rechtliche Fragen hinsichtlich kurzfristiger Kurskorrekturen oder Zurück-Verlagerungen klären.
Eine Weitung des Blicks ist nötig, um die nächsten Jahre absichern zu können – und die Nervosität und Unsicherheiten, die von den täglichen medialen Absichtserklärungen munter in die Arbeitsmoral und Alltagsstimmung schwappen, einzudämmen. Fusionen, an denen immer mehr Staaten mitverdienen oder mitsteuern wollen, sind längst zum Studienobjekt geworden, das mit jeder weiteren Untersuchung nach mehr Expertise und Rechtsberatern ruft.
Die Studentin Ana Bilokapić hob in ihrer LLM-Dissertation «Legal challenges facing cross-border mergers
and acquisitions in the global economy within the energy sector» (Universität Cumbria, 2024) den grossen Einfluss politischer Widerstände und der öffentlichen Meinung hervor. Politische Parteien könnten sich «gegen Transaktionen aussprechen, die potenzielle Risiken für die nationale Sicherheit oder grosse Investitionen im Ausland mit sich bringen». Auch Bürger leisteten zunehmend Widerstand, «wenn sie mit den Bedingungen der Transaktion nicht einverstanden sind oder sie als negative Auswirkungen auf ihre lokale Wirtschaft und die eigenen Arbeitsplätze wahrnehmen».
Wie sich solche Einflüsse juristisch verhindern oder zumindest begleiten lassen, beispielsweise durch transparente, faire Absprachen oder einen rechtlich einwandfreien Interessensausgleich, könnte in Zukunft im Bereich der Corporate Governance und Transparenz verhandelt werden. Besonders Sektoren, die sensible Infrastrukturen berühren oder in den Augen der Allgemeinheit umkrempeln, werden sich emotional geführten Debatten mit Kennzahlen, internationalen Vergleichsfällen und rechtlich verbindlichen Zusagen stellen müssen. Diese könnten dann Teil
der Richtlinien zur Rechenschaftspflicht werden, um die Legitimität des eigenen Handelns und Wirtschaftens gegenüber Stakeholdern zu stärken. Bilokapić weist in dem Zusammenhang auch auf das Implementieren «effektiver Kommunikationskanäle» hin, um «eine Kultur der Rechenschaftspflicht zu gewährleisten». Dass eine solche Kultur rechtliche Expertise und entsprechende Ansprechpartner braucht, ist keine Frage. Vor allem braucht sie Rechtsabteilungen oder Kanzleien, die offen und für alle vernehmlich kommunizieren, statt mögliche Wege nur der Geschäftsführung ins Ohr zu flüstern.
Recht gegen Willkür Im Journal of Legal Studies & Research untersuchte Pranay Singha im Herbst 2023 die «zentrale Rolle regulatorischer Genehmigungen und Compliance bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen» («Regulatory and Legal Challenges in Cross-Border M&A»). Auch er nannte Faktoren, die weit über Steueraspekte oder regulatorische Genehmigungen hinausgehen. So stehe gerade bei technologiegetriebenen Branchen der Schutz des geistigen Eigentums im Mittelpunkt, was angesichts noch zahlreicher ungeklärter KI-Einsätze, die ohne sehr individuelle Prompts oder eine menschliche Bearbeitung der Ergebnisse gar kein Urheberrecht kennen, durchaus eine neue, dauernde Herausforderung bedeutet. Inwiefern kann der Einsatz von KI bei der Erstellung von Produkten, die weiter als spezifisches, von Menschen geschaffenes und damit urheberrechtlich oder markenrechtlich geschütztes Werk gelten sollen, überprüft und über die Ländergrenzen hinaus abgesichert werden? Tatsächlich könnte und sollte es von Vorteil sein, wenn Rechtsabteilungen zunehmend dezentral arbeiten, um eine rechtliche Bewertung einzelner Arbeitsschritte vorzunehmen und vor Ort, idealerweise in fast jedem entscheidenden Schritt, die menschliche Arbeit, die KI-Ergebnisse individuell verändert, zu dokumentieren und zu belegen. Die Kunst von Unternehmen wird in Zukunft darin bestehen, Arbeitsplätze so zu durchdringen, dass ein freiheitliches Arbeiten möglich und garantiert ist, dass aber gleichzeitig Erfindungen, Produkterweiterungen und sensible Daten schlüssig zurückverfolgt, geschützt und klar einer Unternehmensstruktur zugeordnet werden können. Auch ist davon auszugehen, dass vermehrte Lizensierungen von verwendeter Software oder speziellen Tools einwandfrei dokumentiert werden müssen, um Kosten durch eventuelle Lizenzverstösse abzuwenden und Schadenersatz, der eindeutig von der Lizenzfirma übernommen werden muss, durchzusetzen. Auch bei kostspieligen Rückrufen in einzelnen Ländern muss kurzfristig geklärt werden können, ob von Zulieferern gekaufte Produkte oder Dienstleistungen den Schaden verursacht haben und entsprechend in Regress genommen werden können. Es mutet widersprüchlich an: Je mehr einzelne Länder zusperren oder individuelle Regeln erlassen, desto offener müssen Unternehmen agieren, um Lösungen zu finden und das Geheimnis ihres Erfolgs genauso zu zelebrieren wie zu schützen. Die Rettung aus der nervösen Willkür wird das längerfristige Recht sein.
Die Kunst von Unternehmen wird in Zukunft darin bestehen, Arbeitsplätze so zu durchdringen, dass ein freiheitliches Arbeiten möglich und garantiert ist.
International Business Restructuring
Technologie als
Schlüssel: Wie gezielte

Lösungen internationale Restrukturierungen effizienter machen und Risiken minimieren
Internationale Fusionen und Restrukturierungen erfordern eine umfassende rechtliche Vorbereitung und Begleitung - idealerweise unterstützt durch Technologie.
Dominique Gottret, Leiter Corporate & Business Law sowie Legal Deal Advisory bei KPMG Schweiz, erläutert, worauf Unternehmen im Bereich International Business Reorganizations (IBR) achten müssen.
Herr Gottret, wie sehr befeuert der allgemeine Transformationsdruck das Transaktionsgeschehen und die Restrukturierung von Unternehmen?
Die Digitalisierung, der Trend zur Dekarbonisierung sowie geopolitische Spannungen verändern die Wettbewerbsbedingungen erheblich und erhöhen den Druck auf Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Viele Unternehmen reagieren darauf mit Fusionen, Übernahmen und Restrukturierungen. Besonders in technologieintensiven, geopolitisch sensiblen und ESGgetriebenen Branchen beobachten wir tiefgreifende und rasante Veränderungen, die zu einer verstärkten Dynamik auf den M&A- und Restrukturierungsmärkten führen.
Angesichts zunehmender Regulierungsdichte und politischer Unsicherheiten fragen sich viele, wie sie die rechtlichen Herausforderungen besser bewältigen können. Wie können sich Unternehmen auf plötzlich verhängte Zölle, kurzfristige Steuererhöhungen oder länderspezifische Gesetzesänderungen vorbereiten?
Um agil auf Veränderungen reagieren zu können, gilt es, Lieferketten zu diversifizieren und alternative Bezugsquellen ausserhalb potenzieller Konfliktzonen aufzubauen. Steuer- und zolloptimierte Strukturen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle, etwa durch die Nutzung von Freihandelszonen und bilateralen Abkommen oder
internationale Holding- und Intellectual Property-Strategien. Ebenso essenziell ist ein effektives Monitoring- und Frühwarnsystem, welches durch LegalTech-Tools und lokale Expertinnen und Experten regulatorische Entwicklungen frühzeitig erfasst.
Sie haben seit Jahren Erfahrung in komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen und Umstrukturierungen. In welchen Bereichen ist die rechtliche Beratung derzeit besonders anspruchsvoll?
Neue länderspezifische Vorschriften, Investitionskontrollen und wirtschaftliche Sanktionen verlängern Genehmigungsverfahren und erschweren rechtssichere Transaktionen. Zudem gewinnen Datenschutz- und Nachhaltigkeitsthemen weiter an Bedeutung. All diese Aspekte müssen in die Strukturierung und Umsetzung einer Transaktion einfliessen und setzen eine umfassende, länderübergreifende Rechtskompetenz und eine sorgfältige Compliance-Due-Diligence voraus.
Inwieweit spielen technologische Aspekte mittlerweile eine entscheidende Rolle bei Restrukturierungen und den entsprechenden rechtlichen Fragen?
Technologie gewinnt bei Restrukturierungen in zweierlei Hinsicht an Bedeutung. Einerseits erhöht sie die Komplexität bei einzelnen Transaktionen, da die reibungslose Integration bzw. Abspaltung von IT-Systemen ein zunehmend erfolgskritischer Faktor ist. Andererseits unterstützt Technologie die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten, zum Beispiel durch eine schnellere und präzisere Analyse von Unternehmensdaten.
Wie nutzen Sie bei KPMG Schweiz digitale Tools bei der Rechtsberatung? Bei KPMG Law greifen wir dafür zum Beispiel auf die eigens entwickelte IBR Delivery Platform zurück, welche die rechtlichen Anforderungen von mehr als 80 Jurisdiktionen «kennt». Diese erlaubt eine automatisierte Planung und effiziente Umsetzung komplexer internationaler Reorganisationsprojekte. Unsere Klienten erhalten einen zentralen Überblick über die Unternehmensstruktur und können Umstrukturierungen automatisiert und flexibel gestalten. Unsere Plattform überwacht zudem Friständerungen sowie deren Auswirkungen und ermöglicht eine transparente Echtzeit-Berichterstattung an alle Stakeholder. Das Beispiel
«Unsere Plattform überwacht Friständerungen sowie deren Auswirkungen und ermöglicht eine transparente Echtzeit-Berichterstattung
Steckbrief
KPMG Schweiz
KPMG gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in der Schweiz mit gut etablierten lokalen Standorten und einem starken globalen Netzwerk. KPMG Law, der Rechtsberatungsarm von KPMG, bietet interdisziplinäre Rechtsberatung an. Es unterstützt Unternehmen bei komplexen rechtlichen Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsrecht, M&A, Compliance, Steuerrecht und internationale Restrukturierungen. Das KPMG Global Legal Network umfasst über 3‘750 Anwältinnen und Anwälte in mehr als 80 Jurisdiktionen.
Dominique Gottret Dominique Gottret ist Partner und Leiter Corporate & Business Law und Legal Deal Advisory bei KPMG Schweiz. Als Rechtsanwalt berät er multinationale Kunden sowie KMU im Bereich Gesellschafts- und Unternehmensrecht und M&A-Transaktionen inkl. Umstrukturierungen und Nachfolgeregelungen. Zudem unterstützt er Unternehmen, Start-ups und Investoren bei Wachstumsfinanzierungen und Beteiligungsplänen.
Mehr Informationen unter kpmg.ch/law
Dominique Gottret Partner und Leiter Corporate & Business Law und Legal Deal Advisory

zeigt, dass der gezielte Einsatz technologischer Lösungen helfen kann, Restrukturierungsprozesse effizienter zu gestalten und Risiken zu minimieren.
Wie gehen Sie vor, um Restrukturierungen, etwa bei geänderten Compliance-Anforderungen, erfolgreich zu machen?
Eine erfolgreiche Restrukturierung erfordert eine sorgfältige rechtliche Analyse, strategische Planung und effiziente Umsetzung. Mit Hilfe unseres globalen KPMG Law Netzwerks erfassen wir zunächst die Unternehmensstruktur, relevante Geschäftseinheiten und lokale Vorschriften. Diese Bestandsaufnahme fliesst in eine strukturierte Projektplanung auf unserer IBR Delivery Platform ein, die eine transparente und effiziente Umsetzung unterstützt, indem sie innert Minuten einen umfassenden Plan erstellt.
Wie entscheidend sind weltweite Netzwerke, um Risiken frühzeitig zu erkennen?
Ein weltweites Netzwerk aus Expertinnen und Experten ist wichtig, um Gesetzesänderungen frühzeitig erkennen und gezielt analysieren zu können. Dadurch erhalten Unternehmen massgeschneiderte Lösungen, die exakt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Besonders vorteilhaft ist dabei der «Single Point of Contact»-Ansatz, den wir bei KPMG vertreten: Unsere Kundinnen und Kunden haben eine zentrale Ansprechperson, die alle relevanten Themen koordiniert. Dieser Ansatz spart Zeit, vereinfacht die Zusammenarbeit und ermöglicht dennoch Zugriff auf globales Fachwissen.
Wo liegen die besonderen rechtlichen Herausforderungen für KMU? KMU müssen oft die gleichen regulatorischen Anforderungen erfüllen wie Grossunternehmen, verfügen jedoch über limitierte Ressourcen. Besonders herausfordernd sind grenzüberschreitende Transaktionen und komplexe Umstrukturierungen, da unterschiedliche Steuervorschriften und Governance-Standards beachtet werden müssen. Ohne sorgfältige Planung drohen langfristige Haftungsrisiken oder kostspielige Fehlentscheidungen. Daher ist eine realistische Einschätzung des Aufwands und die gezielte Einbindung professioneller Unterstützung entscheidend. Ein multidisziplinärer Ansatz, der neben rechtlichen Aspekten auch finanzielle Fragen sowie Steuer- und IT-Aspekte aufnimmt, ist dabei unerlässlich.
Werden sich die Fragen zu M&A in den nächsten fünf Jahren in bestimmten thematischen Bereichen besonders stark verändern? Ja, wir erwarten signifikante Veränderungen in mehreren Bereichen. ESGKriterien werden eine noch grössere Rolle spielen und die Due Diligence, Transaktionsverträge und Unternehmensstrukturen beeinflussen. Auch technologische Entwicklungen, insbesondere digitale Plattformen und KI-gestützte Prozesse, werden M&A-Strategien durch beschleunigte Analysen und verbesserte Entscheidungsgrundlagen prägen. Und geopolitische Faktoren wie Handelsbarrieren, steuerliche Rahmenbedingungen und regulatorische Unsicherheiten dürften die Komplexität von M&A-Transaktionen weiter erhöhen.
« Belastbare Preisinformationen für Transaktionen im KMU-Bereich sind eine Mangelware»
Während Transaktionspreise, die börsennotierte Unternehmungen erzielen, bei grösseren Deals zumindest im Anhang des Geschäftsberichts halbwegs transparent offengelegt werden müssen, bleiben Transaktionspreise bei KMU-Transaktionen entweder geheim oder sind allenfalls aus den Handelsregisterdaten oder vom Hörensagen erschliessbar.
Alexander Cassani, Leiter Corporate Finance bei Raiffeisen Schweiz, über mögliche Lösungen und die neuesten Entwicklungen des M&A-Marktes in der Schweiz.
Herr Cassani, warum ist es so schwierig, für KMU in der Schweiz die effektiven Transaktionspreise zu ermitteln?
Zunächst gibt es in der Schweiz, anders als z.B. in der EU, keine Publikationspflicht der Abschlüsse privater Unternehmen und es ist traditionell selten, dass KMUs freiwillig Finanzinformationen kommunizieren. Daher kann bei Transaktionen zwischen privaten Unternehmungen in der Schweiz meist keinerlei Relation zwischen Preis und Ertrag des übernommenen Unternehmens gebildet werden, da weder Zähler noch Nenner bekannt sind. Selbst dort, wo Preisinformationen verfügbar sind, ist oft unklar, ob sich diese auf den Unternehmens- oder den Eigenkapitalwert beziehen, wie diese berechnet wurden und wie es um die effektive, d.h. «normalisierte» betriebliche Profitabilität des übernommenen Unternehmens bestellt ist, da die Jahresabschlüsse aufgrund von stillen Reserven, Leasing und weiterer Faktoren verzerrt sein können. Damit sind belastbare Preisinformationen für Transaktionen im KMU-Bereich in der Schweiz eine absolute Mangelware.
Welche Rolle spielen die Transaction und Trading Multiples?
In unserer Erfahrung sind Bewertungsmultiplikatoren in der Praxis die meist genutzte Bewertungsmethode im KMU-Umfeld. Die Relation von Unternehmenswert zu EBITDA oder EBIT eignet sich aufgrund ihrer einfachen Anwendbarkeit und relativen Objektivität besser als eine theoretisch zwar vollkommene, aber oft subjektive DCF-Bewertung. Problematisch sind aber vorschnelle Analogieschlüsse aus Transaction Multiples, die bei grösseren M&A Deals erzielt wurden oder wenn Trading Multiples aus Aktienkursen börsennotierter Unternehmen verwendet werden. Es wird gerne übersehen, dass sich Grossunternehmungen z.B. in Bezug auf Endmärkte oder den Zugang zu Ressourcen und Technologien deutlich von schweizerischen KMUs unterscheiden bzw. aufgrund breiterer Aufstellung in geringerem Masse individuellen Produkteund Dienstleistungszyklen ausgesetzt sein können, was wesentlich höhere Bewertungen rechtfertigen kann. Man muss sich immer die Frage stellen, ob es zulässig ist, Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Manchmal schon, aber nicht immer. Oder anders formuliert: Ascom ist eben nicht Apple.
Überschätzen KMU oftmals ihren Wert? Wenn ja, woran liegt das?
Aus den bereits angeführten und auch weiteren Gründen gibt es statistisch eine robuste Relation: Je kleiner die Firma, desto tiefer der erzielbare Bewertungsmultiple. Diese alte Weisheit wird oft negiert. Die Fehleinschätzung, die aufgrund öffentlich zugänglicher Transaction und Trading Multiples gemacht wird, ist nicht leicht zu korrigieren, weil öffentlich zugängliche und aussagekräftige Bewertungsmultiplikatoren für KMUs in der Schweiz fehlen. Gewisse Datenbankanbieter publizieren zwar regelmässig Multiples, bei denen der Anwender aber nicht weiss, wie die Transaktionsdaten erhoben und mittels welcher Modelle diese individualisiert werden (z.B. im Hinblick auf Branchen).
Wie kann die Diskussion über die Bewertung versachlicht werden?
Einfach gesagt, durch die Verwendung von Transaktionsmultiplikatoren aus den bereinigten, in der Schweiz effektiv bezahlten Transaktionspreisen, idealerweise hergeleitet aus Transaktionen mit vergleichbaren Firmen ähnlicher Grössenordnung.
Sie bauen seit drei Jahren eine eigene Transaktionsdatenbank auf. Was kann die?
Es gab mehrere Gründe für den Aufbau einer internen Transaktionsdatenbank. Ausgangspunkt war das Bedürfnis, für unsere Beratungstätigkeit und für die Kreditentscheide der Bank bei Nachfolgefinanzierungen über aussagekräftige KMU-Multiplikatoren zu verfügen. Weiter stellten wir fest, dass unsere Firmenkundenberater mit vertretbarem Aufwand die Bewertungsmultiples kompetent rechnen und einordnen konnten. Natürlich sind diese Informationen streng vertraulich. Auf strikt anonymisierter Basis und mit einer statistisch hinreichenden Anzahl erfasster Transaktionen lassen sich über die Zeit immer robustere Indikationen der durchschnittlichen effektiven

Raiffeisen unterstützt Unternehmen jeder Grösse in Finanzierungsfragen, insbesondere KMU-Unternehmen. Die 218 Raiffeisenbanken verfügen über lokalen Zugang und Kompetenzen und werden ergänzt durch die sechs Firmenkundenzentren von Raiffeisen Schweiz. Das Corporate Finance Team unterstützt Unternehmen und ihre Eigentümer bei M&ATransaktionen, berät bei der Prüfung strategischer Optionen aus CorporateFinance-Sicht und bietet unabhängige Unternehmensbewertungen an.
Alexander Cassani leitet seit Oktober 2015 das Corporate Finance Team von Raiffeisen Schweiz. Er ist zudem Mitglied des Supervisory Boards der Advior International und seit 2011 Verwaltungsrat eines mittelgrossen, export-orientierten Schweizer Industrieunternehmens in der Bahnbranche.
Mehr Informationen unter raiffeisen.ch

Marktpreise herausschälen, insbesondere, wenn wir auch die Transaktionshintergründe berücksichtigen, ob z.B. eine Transaktion unter Dritten oder innerhalb des Familienkreises stattfand. Für unsere Datenbank verwenden wir nur Preise, die im Markt verhandelt wurden. Die Datenbank liefert heute für Transaktionen mit Unternehmenswerten von CHF 10 Mio. bis CHF 75 Mio. aussagekräftige EBITDA und EBITMultiplikatoren für die Schweiz. Die Multiplikatoren lassen sich auch ins Verhältnis setzen zur durchschnittlichen EBITDA bzw. EBIT-Marge der erworbenen Unternehmen. Wir können innerhalb der Wertbandbreite weiter segmentieren, d.h. z.B. nur diejenigen Transaktionen mit Unternehmenswert unter CHF 25 Mio. berücksichtigen. Auch haben wir damit begonnen, die Veränderung der Bewertungsmultiples im Zeitablauf zu untersuchen.
Welche ersten Erkenntnisse lassen sich aus den gesammelten Daten ziehen? Wir stellen fest, dass Transaktionen bei schweizerischen KMUs im Durchschnitt substanziell tiefere Preise erzielen als im börsennotierten Umfeld. Das ist nicht überraschend, die Höhe der Differenz aber bemerkenswert. Wir sehen auch einen Zusammenhang zwischen der Grösse des KMUs und Bewertungsmultiple – auch das ist nicht überraschend, wir haben aber nicht erwartet, dass dies in unseren Daten so rasch zu sehen ist. In zeitlicher
Aus den bereits angeführten und auch weiteren Gründen gibt es statistisch eine robuste Relation: Je kleiner
Hinsicht konnten wir weiter feststellen, dass die durchschnittlichen Bewertungsmultiples seit 2023 unter Druck geraten und im Jahr 2024 in der Grössenordnung von 10 bis 20 % gesunken sind.
Was soll die Datenbank demnächst noch abbilden oder erfassen? Wir beabsichtigen, noch dieses Jahr eine erste Aufteilung der Unternehmen in unterschiedliche Branchen umzusetzen, um branchenspezifische Multiplikatoren berechnen zu können. Mit zunehmender Datendichte können wir die Aussagekraft und Anwendbarkeit laufend verbessern.
Wie werden sich Übernahmen und Transaktionen in den nächsten Monaten entwickeln? Mit was rechnen Sie? Wir erwarten 2025 einen nochmaligen Rückgang bei den Private Equity-finanzierten Nachfolgetransaktionen, u.a. aufgrund der höheren wirtschaftlichen Unsicherheit, welche auch die Kapitalbeschaffung erschwert. Es ist noch offen, ob stattdessen strategische Investoren in die Bresche springen. Im Vergleich zu den Vorjahren werden 2025 vermutlich weniger Transaktionen in die Datenbank einfliessen. Der Druck, Nachfolgelösungen zu finden, ist aber weiterhin da? Es liegt in der Natur des Nachfolgethemas, dass irgendwann eine Lösung gefunden werden muss, und dass die Lösungsvarianten nicht besser werden, je länger man wartet. Gleichzeitig werden viele Transaktionen aufgrund des härteren Umfelds aufgeschoben oder abgebrochen. Momentan ist der Nachfolgezyklus in unserer Einschätzung nahe am Tiefpunkt; wenn die allgemeine Marktunsicherheit schwindet, wird es eine rasche Belebung geben und sich der Rückstau abbauen.
Alexander Cassani Co-Head Corporate Finance
Steckbrief
Transaktionsmanagement

Transaktionen erfolgreich steuern
Von der Planung bis zur Due Diligence: Die Wirtschaftskanzlei Advestra erklärt, wie man Transaktionen sicher und effizient zum Ziel führt.
Dieser Text soll eine kurze Übersicht zu nicht-juristischen Stolpersteinen geben, die regelmässig auf Transaktionen anzutreffen sind.
Kulturelle Unterschiede
Bei Transaktionen, und insbesondere in Verhandlungen, spielt sich vieles auf persönlicher Ebene ab. Ein zentraler Faktor, um eine produktive Atmosphäre zu schaffen, stellt dabei das Betrachten kultureller Unterschiede dar.
Damit können Missverständnisse und Konflikte bereits vor einer allfälligen Entstehung vermieden und ein effektives sowie harmonisches (Verhandlungs-)Umfeld geschaffen werden.
Zum Beispiel legen einige Kulturkreise grossen Wert auf Hierarchien, d.h. es ist wichtig zu beachten, wer bei Verhandlungen teilnimmt und welche Personen angesprochen werden sollen. Teilweise ist es auch zentral, zunächst persönliche Beziehungen aufzubauen, sei es bei einem Nachtessen oder anderen (halb-)privaten Anlässen.
(Interne) Vorbereitung Wie bei den meisten grösseren Projekten ist die richtige Vorbereitung einer Transaktion entscheidend für den späteren Erfolg. Dabei sind sowohl interne wie auch externe Faktoren zu beachten.
Intern bedeutet dies, dass die notwendigen Mitarbeitenden frühzeitig einbezogen sowie Ressourcen und die benötigten Informationen verfügbar gemacht werden. Dabei ist es empfehlenswert, die Verantwortlichkeiten und die interne Kommunikation klar festzulegen, um Reibungsverluste zu vermeiden.
Richtiges Team
Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Vorbereitung ist die Zusammenstellung des richtigen Teams. Dieses besteht häufig nicht nur aus den bereits erwähnten internen Teammitgliedern, sondern es sollten frühzeitig die benötigten externen Berater beigezogen werden.
Dazu gehören insbesondere Spezialisten im Bereich Finanzen, Steuern, Recht, sowie im Bezug auf die betroffene Industrie. Das externe Team sollte immer die benötigten Kompetenzen abdecken, dabei aber gleichzeitig so klein wie möglich gehalten werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass die jeweiligen internen und externen Experten direkten Kontakt miteinander haben und die relevanten Informationen an das gesamte Transaktionsteam weitergegeben werden.
«Key Terms» frühzeitig festlegen
(Term Sheet)
In der Anbahnung jeder Transaktion lohnt es sich, frühzeitig eine Einigung über die wichtigsten Parameter des Deals zu erzielen. Dies dient einerseits einer internen Klarstellung der eigenen Verhandlungsposition. Andererseits geht es auch darum, in einem frühen Stadium herauszufinden, ob die eigenen Vorstellungen darüber, wie die Transaktion aussehen sollte, mit denjenigen der Gegenpartei übereinstimmen. Nichts ist frustrierender, als wenn sich ein sog. «Roadblocker» erst nach monatelangen Verhandlungen herauskristallisiert, obwohl er viel früher erkennbar gewesen wäre.
Hierzu kann es sinnvoll sein, ein
Term Sheet oder eine Absichtserklärung abzuschliessen, worin die wichtigsten Elemente der Transaktion für
beide Parteien festgehalten werden. Obwohl diese Dokumente häufig als rechtlich nicht bindend ausgestaltet sind, kommt ihnen in der Praxis grosse Bedeutung zu. Dabei ist entscheidend, die richtige Flughöhe zu finden, denn ein zu detailliertes Term Sheet kann die Verhandlungen in einem Anfangsstadium auch unnötig aufhalten.
Zusammenspiel mit Beratern in Verhandlungen
In Verhandlungen kann es durchaus mal zur Sache gehen. Nicht selten ist das Frustpotential hoch, wenn die Gegenseite gefühlt mit immer neuen Punkten kommt oder trotz sachlichen Argumenten nicht einlenken will. In solch kritischen Situationen ist die Rollenverteilung innerhalb des Verhandlungsteams von entscheidender Bedeutung. Einerseits kann es zielführend sein, für gewisse Themen bewusst Eskalationsstufen einzubauen. Dadurch wird die Beziehung auf strategischer Entscheidungsebene nicht überstrapaziert, trotz zäher Verhandlungen. Andererseits lohnt es sich oft auch, gewisse Verhandlungsrunden ausschliesslich durch Berater durchführen zu lassen, wodurch sich der Katalog von offenen Punkten häufig signifikant reduzieren lässt. Auch dadurch kann die Beziehung
zwischen Prinzipalen geschont werden, was insbesondere im Hinblick auf eine allfällige Zusammenarbeit nach Abschluss der Transaktion (z.B. aufgrund einer Re-Investition einer Verkäuferin) entscheidend ist.
Fokus auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit auch während einer M&A-Transaktion Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist meistens ein einmaliger Vorgang, bei dem der Eigentümer in aller Regel keine Vorerfahrungen hat und die Stabsübergabe oftmals auch emotional geprägt ist. Dieser Cocktail birgt ein nicht zu unterschätzendes Potential, entscheidende Fehler zu begehen – sowohl in Bezug auf das Tagesgeschäft wie auch im Rahmen des Verkaufsprozesses. Daher ist es ratsam, frühzeitig einen erfahrenen M&A-Berater beizuziehen. Dieser hilft, emotionale Höhen und Tiefen auszugleichen und in der Verkaufsstrukturierung entscheidende Impulse zu setzen. Gleichzeitig entlastet er die Geschäftsleitung, sodass diese sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann, um reibungslose Abläufe, Produktivität und Effizienz des Unternehmens zu sichern. Auch bezüglich der Kommunikation kann einiges schieflaufen. Dabei sollte man sich zurück auf die Grundweisheiten besinnen: Klare Kommunikation und transparente Entscheidungsprozesse helfen, Mitarbeiter motiviert zu halten und Vertrauen aufzubauen.
Richtige Incentivierung der Verkäufer und Integration in die Käufer-Gruppe Der Integrationserfolg eines gekauften Unternehmens hängt nicht zuletzt von der richtigen Incentivierung der Verkäufer ab. Finanzielle Anreize wie Boni oder Aktienoptionen sowie klare
In der Anbahnung jeder Transaktion lohnt es sich, frühzeitig eine Einigung über die wichtigsten Parameter des Deals zu erzielen.
Advestra zählt zu den führenden Wirtschaftskanzleien in der Schweiz. Mit unserer Expertise beraten wir Klienten in den Bereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Kapitalmarktrecht, Finanzierungen, Finanzmarktregulierung und Steuern.
Unser engagiertes Team steht für massgeschneiderte, erstklassige Beratung bei sämtlichen Unternehmenstransaktionen. Besonders in komplexen Fällen sind wir ein verlässlicher Partner für börsenkotierte Gesellschaften, Finanzinstitute, Private-Equity-Häuser und Investoren sowie Unternehmer und Start-ups. Zudem begleiten wir unsere Klienten bei gesellschafts- sowie handelsrechtlichen Fragestellungen und unterstützen sie im Bereich Corporate Governance und ESG.
Advestra vereint erfahrene Anwälte mit exzellenter juristischer Expertise und umfassender Transaktionserfahrung. Wir meistern auch komplexeste Herausforderungen und nutzen unser internationales Netzwerk, um regelmässig mit führenden globalen Kanzleien grenzüberschreitende Mandate über die Ziellinie zu bringen.
Mehr Informationen unter advestra.ch
Kommunikation motivieren Verkäufer, aktiv an der Integration mitzuwirken. Im Private-Equity-Bereich ist es üblich, dass sich das bestehende Management im Rahmen der Transaktion an der Zielgesellschaft rückbeteiligt. Dies sichert einerseits die betriebliche Kontinuität und andererseits das operative Knowhow. Zudem wird durch eine solche Management-Beteiligung ein Gleichlauf der Interessen zwischen Käuferin und Management angestrebt, was die gemeinsame Wertsteigerung der Zielgesellschaft fördert. Bei der Strukturierung eines Buyouts wird das Management oft indirekt über eine mehrheitlich vom Käufer gehaltene Management-Gesellschaft beteiligt. Die Governance wird i.d.R. durch einen Aktionärbindungsvertrag zwischen dem Management und dem Käufer geregelt. In der Schweiz erfolgt eine (Rück-)Beteiligung idealerweise in Abstimmung mit den Steuerberatern, um steuerfreie Kapitalgewinne bei einem Exit zu ermöglichen.
Transparenz in der Due Diligence Transparenz fördert Vertrauen und kann verhindern, dass die Stimmung auf einer Transaktion unruhig wird. Es ist daher aus Verkäufersicht entscheidend, wichtige Themen wie finanzielle Risiken und rechtliche Herausforderungen dem Käufer gegenüber frühzeitig offen zu legen, soweit dieser Offenlegung keine rechtlichen Einschränkungen oder andere Gründe entgegenstehen.
Eine transparente Due Diligence hilft Käufern, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Schwerpunkte in einer Transaktion richtig zu setzen, auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Integration nach Abschluss der Transaktion. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern erleichtert den Offenlegungsprozess aus Verkäufersicht und die Verarbeitung und Einordnung der offengelegten Informationen aus Käufersicht. Die Due Diligence kann für Verkäufer nervenaufreibend sein. Dabei sollte jedoch die Perspektive des Käufers, der das Zielunternehmen nur begrenzt kennt und deshalb in den für ihn relevanten Bereichen vertiefte Informationen und Unterlagen anfordert, nicht vergessen werden.

«Der Inhouse-Jurist muss ein echter Business Partner sein und unternehmerische Risiken mittragen»
Angesichts immer neuer Regulierungen und eines immer dynamischeren geopolitischen Umfelds müssen nicht nur Grossunternehmen agiler werden.

Mathias Gaertner, General Counsel, Company Secretary und Mitglied der Konzernleitung bei ABB, beschreibt, wie Rechtsabteilungen den Unternehmenserfolg mehr denn je mitgestalten.
Herr Gaertner, wie sehr unterscheiden sich die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen von denen vor 10 oder 15 Jahren? Die Dichte der rechtlichen Regelungen hat global stark zugenommen. Einerseits sind neue Rechtsbereiche entstanden, insbesondere im Umwelt- und Klimarecht − Stichwort ESG-Berichterstattung −, beim Datenschutz oder im internationalen Steuerrecht. Andererseits ist die Welt multipolar geworden. Das geopolitische Umfeld ändert sich rasch, zahlreiche Sanktionen reflektieren die weltpolitische Lage. Insgesamt ist es komplexer und anspruchsvoller geworden.
Das heisst, die Rechtsabteilungen in den Firmen sind wichtiger geworden?
Ja. Die Rolle des Legal Teams im Unternehmen hat an Bedeutung gewonnen. Das geht einher mit deutlich grösserer Verantwortung − der Inhouse-Jurist muss ein echter Business Partner sein und trägt dementsprechend unternehmerische Risiken mit. Mir und meinem Team macht das grossen Spass, es ist aber auch eine Herausforderung.
Steckbrief
2024 wurde Mathias Gaertner von ABB zum General Counsel, Company Secretary und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Gaertner ist Experte im Management internationaler M&A-Transaktionen, Litigationsowie IP- und Compliance-Themen. Vor seiner Tätigkeit bei ABB arbeitete er zehn Jahre für den US Industrie- und Technologiekonzern Honeywell und war danach Head Legal & Compliance und Mitglied der Konzernleitung des globalen Baustoffunternehmens Holcim. Als promovierter Rechtsanwalt war Gaertner zudem für die Anwaltskanzleien Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates sowie Baker & McKenzie tätig.
Mehr Informationen unter abb.com
Wie meistern Sie diese Herausforderung?
Um ein echter Business Partner zu sein, müssen wir das Geschäft sehr gut verstehen, unsere Technologien, die Lieferkette, Kundenstruktur, unsere Wachstumsmärkte und langfristigen Strategien. Das erfordert einen engen Austausch mit unseren internen Mandanten in den Geschäftsbereichen und Divisionen, und dies weltweit. Das wiederum ist nur möglich mit guter Kommunikation und starken, proaktiven lokalen Juristinnen und Juristen. Wichtig ist mir, dies in einem möglichst schlanken, agilen Set-up zu tun. Dadurch sind wir in der Lage, uns immer wieder rasch auf sich ändernde Umstände − sei es im regulatorischen Umfeld oder in unserem Geschäft − erfolgreich einzustellen.
ABB hat buchstäblich mit Antrieben aller Art zu tun. Wie sehr können kurzfristig geänderte Rahmenbedingungen, etwa bei Zöllen oder neuen Vorschriften bei Compliance und ESG-Regeln, den Antrieb eines Unternehmens bremsen? Regulierung, Zölle und Handelsbeschränkungen haben einen langfristigen Effekt auf das Investitionsverhalten von Unternehmen. Die zunehmende Regulierungsdichte, wie wir sie zum Beispiel in der Europäischen Union beobachten können, kann da durchaus bremsend wirken. Aus meiner Erfahrung ziehen sich aber Unternehmen nicht aus attraktiven Märkten zurück, nur weil die Regulierung komplexer wird. Da gibt es andere Gründe, die einen viel stärkeren und längerfristigen Effekt haben, zum Beispiel die Energiepreise. Hier kommt ABB ins Spiel − Energieeffizienz, Energiesicherheit, der Trend zur Elektrifizierung und Automatisierung, das sind globale Megatrends. ABB hat hier
Mathias Gaertner
das notwendige Know-how und innovative Technologien, um unseren Kunden und allen unseren Stakeholdern Mehrwert zu bieten.
Wie schaffen Sie bei Ihren Kunden Mehrwert?
Der Unternehmenszweck von ABB ist, als Technologieführerin in den Bereichen Elektrifizierung und Automation eine nachhaltige und ressourceneffiziente Zukunft zu ermöglichen. Zum einen sollen die Partner von ABB konstant hohe Leistungen erbringen können, zum anderen unterstützt ABB sie dabei, ihre Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit fortlaufend zu steigern, damit sie ihre Ziele übertreffen können. «We help industries outrun − leaner and cleaner».
Zölle sind zurück in der politischen Realität, was halten Sie davon?
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass der freie Warenverkehr nicht nur gut für ABB ist, sondern auch für unsere Kunden und Partner. Zölle sollen Unternehmen in der Regel incentivieren, lokale Wertschöpfung zu fördern. ABB ist da mit ihrer seit Jahren etablierten «Local-for-Local»-Strategie gut gefahren. Wir entwickeln und produzieren in den grossen Märkten weitgehend vor Ort und sind deshalb ein wirklich globales Unternehmen.
Gerät die Transformation der Industrie durch immer neue Regulierungen ins Stocken?
Das denke ich nicht. Die zunehmende Regulierung kann aber die Transformation verteuern und damit verlangsamen. Unternehmen müssen sich dementsprechend positionieren und künftige Trends berücksichtigen. Wir arbeiten intern deshalb eng mit unseren Government-Relations-Experten zusammen, um diese Trends gut einzuordnen und auch der Position des eigenen Unternehmens eine Stimme zu geben.
Wie sehr beeinflussen nationale Alleingänge die globale Wirtschaft und deren neues Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich Nachhaltigkeit oder auch sozialer Verantwortung? Als global tätiges Unternehmen sind wir es gewohnt, dass wir sowohl lokale wie auch internationale Regeln einhalten müssen, was wir selbstverständlich auch sicherstellen.
Auf der einen Seite sollen Nachhaltigkeitsberichte erstellt und Lieferkettengesetze eingehalten werden. Auf der anderen Seite protegieren einige Länder immer vehementer die «heimische Wirtschaft». Welche Folgen hat das?
Diese beiden Trends führen zu einer stärkeren Lokalisierung der Lieferketten und wirken damit de-globalisierend. Letztlich geht es den einzelnen Staaten um ausgeglichene Handelsbilanzen und Wohlstand im eigenen Land. ABB kann damit als Unternehmen umgehen, und wir haben unsere Forschung und Entwicklung, die Produktion und unsere Lieferketten entsprechend darauf ausgerichtet. Am Ende investieren wir dort, wo wir Wachstum sehen. Auch hier spielt das Legal Team bei der Planung und Umsetzung eine grosse Rolle.
Müssen sich global agierende Unternehmen davon verabschieden, wirklich in allen Ländern erfolgreich sein zu können, weil der Preis dafür, sprich die rechtlichen Hürden, mitunter zu hoch ist? Globale Unternehmen sehe ich hier eher im Vorteil, wir haben eine natürliche
Risikodiversifizierung und die Erfahrung, rechtliche Hürden schnell zu verstehen und damit umzugehen. Wichtig ist es dabei, in allen Ländern auch als Legal Team stark verankert zu sein. Ich dezentralisiere deshalb unser Team, entsprechend unserem erfolgreichen dezentralen Business-Modell, dem ABB-Way. Dies führt zu einem besseren lokalen Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und ist auch für meine Mitarbeitenden interessant, weil die lokalen Jobs attraktiver werden und mit mehr Verantwortung verbunden sind. Schnelligkeit und Proaktivität der Juristin bzw. des Juristen wird zum bestimmenden Faktor.
Lassen sich kurzfristige Änderungen in bestimmten Ländern überhaupt vorhersehen? Wie kann ein Unternehmen trotzdem vorausschauend planen?
Es gibt globale Trends bei der Regulierung, Sie haben diese völlig richtig angesprochen − Compliance, ESG, Sanktionen, Zölle. Einzelne Länder preschen hier manchmal vor, das wirkt dann überraschend, bewegt sich aber in der Regel innerhalb des globalen Trends.
Innovationen brauchen ein «Out of the Box»-Denken. Wie lässt sich das in Zeiten von KI und zunehmender Datenverarbeitung rechtlich absichern?
Das ist ein unglaublich spannendes Thema, sowohl für uns als Unternehmen in der Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen, als auch für meine Mitarbeitenden. Wir haben hierfür eine Expertengruppe gebildet, die übergreifend die Bereiche Digital und Intellectual Property umfasst, in allen Geschäftsbereichen aktiv ist und die Entwicklung und auch den Eigentumsschutz von KI-Lösungen unterstützt. Das sind meines Erachtens derzeit die spannendsten Jobs bei uns. KI ist aber auch ein grossartiges Tool, um als Team besser und schneller zu werden. Hier investieren wir derzeit. KI wird die Agilität und Kreativität unseres Legal Teams sehr positiv beeinflussen, da bin ich mir sicher.
Welchen Vorteil haben Unternehmen, die eine lange Tradition und gleichzeitig eine breite Palette von Produkten vorweisen können?
Das gibt vor allem Stabilität und eine natürliche Risikoverteilung. Letztlich gilt aber sowohl in der unternehmerischen als auch in der rechtlichen Arbeit immer − schnell und flexibel sein und dabei eine möglichst diverse, globale Perspektive haben. Die Zukunft ist, was zählt.
Welchen Vorteil sehen Sie für Unternehmen, die in der Schweiz ansässig sind?
Ich kann mir keinen besseren Standort als die Schweiz für ein globales Unternehmen vorstellen. Wir haben hier optimale Bedingungen − ein hervorragendes Bildungssystem und damit hoch qualifizierte Mitarbeitende, eine insgesamt vernünftige Wirtschaftspolitik, Pragmatik und ein gutes Mass an Weltoffenheit.
Kann man eine Prognose wagen, wie sich die Regulierungsvorgaben bezüglich übergeordneter Klimaziele, aber auch bezüglich lokaler Protektionismen in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln oder auch zurückentwickeln werden?
Ich erwarte nicht, dass sich der Trend zu mehr Regulierung ändert oder umkehrt. Unser Legal Team hat sich darauf eingestellt und kann damit erfolgreich umgehen.

«Bei Massenentlassungen lohnt sich der Diskurs mit den Mitarbeitenden»
Wenn sich Restrukturierungen oder Massenentlassungen nicht vermeiden lassen, nehmen die rechtlichen Herausforderungen zu.
Fanny Sutter, Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Streichenberg, erläutert die Folgen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden.
Frau Sutter, Unternehmen, die aufgrund existenzieller Krisen Massenentlassungen vornehmen, müssen einige gesetzliche Vorgaben beachten. Welche sind zentral?
Es muss darauf geachtet werden, dass die Informationsflüsse korrekt ablaufen: erstens die Information und Konsultation der Mitarbeitenden oder der Arbeitnehmervertretung und zweitens die Information des kantonalen Arbeitsamtes. Wichtig ist auch, dass das Konsultationsverfahren formal korrekt durchgeführt wird, da die Kündigungen sonst als missbräuchlich eingestuft werden können. Konsultation heisst nicht blosse Information, sondern mit den Mitarbeitenden in den Austausch zu treten und ihnen die Möglichkeit zu gewähren, Vorschläge zu unterbreiten, wie eine Massenentlassung abgewendet oder deren Folgen abgeschwächt werden könnten.
Einerseits drängt die Zeit, um eine Insolvenz abzuwenden. Andererseits müssen die Mitarbeitenden konsultiert und das kantonale Arbeitsamt informiert werden. Wo liegt da die rechtliche Herausforderung? Wie Sie sagen - es müssen viele Dinge parallel beachtet und eingehalten werden, darin liegt die grosse Herausforderung. Gleichzeitig ist es ein sehr sensibles und für die Arbeitnehmerschaft hoch emotionales Thema. Eine sorgfältige und durchdachte vorgängige Planung des gesamten Prozesses sowie eine transparente und professionelle Kommunikation – intern sowie auch extern - sind meines Erachtens der Schlüssel.
Gibt es einen klassischen Fehler, den Unternehmen bei der Planung und Durchführung von Entlassungen machen?
Wichtig ist, dass der definitive Entscheid der Massenentlassung erst nach dem
Konsultationsprozess gefällt werden darf und man das auch bei der internen und externen Kommunikation beachten muss. Man riskiert sonst, dass der Konsultationsprozess zum toten Buchstaben verkommt und die nachfolgenden Kündigungen missbräuchlich werden. Hier passiert immer wieder der Fehler, dass ungeschickt und unüberlegt kommuniziert wird. Der Konsultationsprozess und damit einhergehend der Austausch mit den Mitarbeitenden sollten zudem ernst genommen werden. Es lohnt sich, mit den Mitarbeitenden in den Diskurs zu treten, da sie eine andere Sicht der Dinge und andere Interessen haben, die das Unternehmen schlussendlich auch weiterbringen können.
Wann genau muss ein Sozialplan verhandelt werden?
Unternehmen haben eine gesetzliche Pflicht zur Verhandlung eines Sozialplans, wenn sie üblicherweise mindestens 250 Mitarbeitende beschäftigen und beabsichtigen, innert 30 Tagen mindestens 30 Mitarbeitenden zu kündigen aus Gründen, die nicht persönlicher Natur sind. Teilweise ergeben sich Verhandlungspflichten auch aus Gesamtarbeitsverträgen. Je nach Situation drängt sich in der Praxis aber auch die Verhandlung eines Sozialplans ausserhalb dieses gesetzlichen Grenzwerts auf, beispielsweise wenn das Unternehmen nicht ganz so gross ist, aber dennoch einige Kündigungen aussprechen muss. Sinnvoll kann ein Sozialplan auch sein, wenn keine klassische Massenentlassung vorliegt, sondern eine Umstrukturierung im Sinne eines Betriebsübergangs.
Was muss im Rahmen eines Betriebsübergangs beachtet werden?
Der Verkauf eines Betriebs oder Betriebsteils kann auch eine Restrukturierungsmassnahme sein, indem Betriebsmittel und Inventar an eine neue Eigentümerin verkauft werden in Form eines sog. Asset Deals. Die Arbeitnehmerschaft ist oftmals zentral für die Aufrechterhaltung des Betriebs und geht grundsätzlich automatisch über auf die neue Eigentümerin des Betriebs. Hier ist der übertragende Arbeitgeber insbesondere an gewisse Informationspflichten gegenüber der Arbeitnehmerschaft gebunden. Ich beobachte in der Praxis, dass den Käuferinnen eines Betriebs oftmals nicht bewusst ist, dass sie einem Übernahmezwang unterliegen und die Mitarbeitenden – mit sämtlichen Rechten und Verpflichtungen – übernehmen müssen. Hier muss man aus Käufersicht daran denken, die nötigen Zusicherungen im Kaufvertrag einzubauen und gegebenenfalls eine Schadloshaltungsklausel auszuhandeln.
Was ist die sogenannte «missbräuchliche Kündigung»?
Eine Kündigung kann aus den verschiedensten Gründen missbräuchlich sein. Liegt eine missbräuchliche Kündigung vor, so kann von den betroffenen Mitarbeitenden eine Entschädigung von bis zu sechs Monatslöhnen geltend gemacht werden. Beispielsweise kann eine Kündigung missbräuchlich sein, wenn sie diskriminierender Natur ist, weil sie ohne sachlichen Grund aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung einer Person ausgesprochen wird. Ferner kann eine Kündigung auch missbräuchlich sein, wenn sie nur deswegen ausgesprochen wird, um arbeitsrechtliche Ansprüche zu vereiteln, beispielsweise kurz vor der Auszahlung des Bonus. Oder
Steckbrief
Streichenberg unterstützt seit 1997 Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz und international in rechtlichen Angelegenheiten. Insbesondere auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts verfügt die Kanzlei über ausgewiesene Erfahrung. Aufgrund der Spezialisierung ihrer Anwältinnen und Anwälte auf verschiedene Branchen profitieren die Kundinnen und Kunden nicht nur von erstklassigem Fachwissen, sondern erzielen durch die fundierten Branchenkenntnisse auch entscheidende Vorteile. «Als eingespieltes Team setzen wir uns für Ihre Anliegen ein – unkompliziert, vertrauensvoll und zielgerichtet.»
Mehr Informationen unter streichenberg.ch

eben, wenn bei einer Massenentlassung das Konsultationsverfahren nicht oder nicht korrekt durchgeführt wurde. Diesfalls können von den Mitarbeitenden aber nur zwei Monatslöhne als Entschädigung geltend gemacht werden.
Sie raten generell zu einer «transparenten und professionellen Kommunikation» mit den Mitarbeitenden. Wie kann die aussehen und was kann sie bewirken?
«Der Konsultationsprozess und damit einhergehend der Austausch mit den Mitarbeitenden sollten ernst genommen werden.»
Gesetzlich wird für die Eröffnung von Massenentlassungen oder Betriebsübergängen aus formeller Sicht lediglich ein schriftliches Informationsschreiben verlangt. Ich empfehle meinen Klientinnen und Klienten aber regelmässig, Townhall Meetings oder, je nach Situation, 1:1-Meetings mit den Mitarbeitenden abzuhalten. Das führt erfahrungsgemäss zu erhöhter Akzeptanz unter den Mitarbeitenden. Hilfreich kann auch sein, eine Anlaufstelle einzurichten, die für die Dauer des Konsultationsprozesses Rede und Antwort steht und den Mitarbeitenden ein offenes Ohr gewährt. Dafür eignet sich HR-Personal, jemand aus der Rechtsabteilung oder sonst jemand, der sich mit der Thematik auskennt und das nötige Feingefühl mitbringt. Kann man das nicht bewerkstelligen, so kann auch ein FAQ-Dokument mit den gängigsten Fragen und Antworten zuhanden der Mitarbeitenden hilfreich sein.
Sie beraten Unternehmen auch im Bereich Whistleblowing und Datenschutz. Wo haben Unternehmen derzeit besonders viel Beratungsbedarf? In der letzten Zeit haben sich in der Schweiz und im Ausland die Fälle rund um interne Untersuchungen bei unternehmensinternen Missständen gehäuft. Hier geht es einerseits darum, solche Vorfälle umfassend und mit der nötigen Diskretion aufzuklären und geeignete Massnahmen zu beschliessen und durchzusetzen. Andererseits brauchen Unternehmen auch präventive Unterstützung in der Erstellung von Prozessen, wie mit solchen Risiken umgegangen werden kann, damit sie nicht zur Eskalation führen.
Tangiert die Forderung nach mehr Transparenz in Unternehmen auch die Entlassungsproblematik?
Absolut. Mitarbeitende heutzutage stellen hohe Anforderungen an die unternehmensinterne Transparenz und begreifen sich teilweise als mitentscheidende Instanz. Es muss dabei von Fall zu Fall ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden, welche Themen aus Unternehmenssicht preisgegeben werden dürfen und sollen und welche Entscheidungen nur von einem bestimmten Personenkreis gefällt werden müssen.
Fanny Sutter Rechtsanwältin und Partnerin
«Verkäufer oder Ersteller von Neubauten können sich nicht mehr aus der Haftung stehlen»
Zum 1. Januar nächsten Jahres treten mehrere Neuerungen im Bau- und Immobilienrecht in Kraft, die unter anderem die Rügefristen sowie die Nachbesserung von Mängeln betreffen.
Die wichtigsten Änderungen erläutern Dr. Sibylle Schnyder, Leiterin der Praxisgruppe Immobilienrecht und Fachanwältin SAV Bau- und Immobilienrecht, und Dr. Thomas Zweifel, beide Partner bei CMS in Zürich.
Frau Dr. Schnyder, was ist der Hintergrund der ab 2026 geltenden neuen Bestimmungen?
Es geht bei dieser Revision darum, die Käufer und Bauherren von Immobilien hinsichtlich Baumängeln besser zu schützen. In der Schweiz ist es bei Liegenschaftskäufen üblich, dass die Verkäufer ihre Gewährleistung so weit als möglich wegbedingen. Dies kann aber insbesondere beim Kauf von neu erstellten Bauwerken problematisch sein. Bei Neubauten im Stockwerkeigentum ist es zum Beispiel häufig so, dass Verkäufer keine Gewähr bezüglich Baumängeln leisten wollen und stattdessen die Käufer an die beim Bau involvierten Handwerker verweisen. Neu wird der Schutz von Immobilienkäufern und Bauherren verstärkt: Ab dem 1. Januar 2026 können sich Verkäufer bzw. Ersteller von Neubauten nicht mehr aus der Haftung stehlen und sie müssen bei Mängeln auf form- und fristgerechte Rüge von Käufern hin zwingend eine Nachbesserung vornehmen.
Wie muss ein Käufer oder Bauherr konkret vorgehen, um das Nachbesserungsrecht geltend zu machen?
Das Nachbesserungsrecht besteht zum einen beim Kauf von Bauwerken, die bei Vertragsabschluss noch zu erstellen sind oder in den letzten zwei Jahren erstellt wurden – sprich bei Neubauten. Zum andern haben auch Bauherren, welche ein Bauwerk im Rahmen eines Werkvertrags erstellen lassen, ein Nachbesserungsrecht. Wird ein Mangel am Bauwerk ersichtlich, muss zunächst eine Mangelrüge erfolgen. Dies geschieht am besten schriftlich, per Einschreiben, mit einer kurzen Umschreibung des Sachverhaltes. Sodann sollte dem Verkäufer bzw. Bauunternehmer einer Frist zur Behebung des Mangels angesetzt werden.
Was ist zu tun, wenn der Verkäufer oder Bauunternehmer untätig bleibt?
Wenn der Verkäufer bzw. Bauunternehmer den Mangel nicht behebt, kann der Käufer bzw. Bauherr am Nachbesserungsanspruch festhalten und diesen gerichtlich einklagen. Denkbar ist auch, dass der Mangel mittels Ersatzvornahme durch Dritte auf Kosten des Unternehmers bzw. Verkäufers beseitigt wird. Alternativ kann der Käufer bzw. Bauherr eine Kauf- oder Werkpreisreduktion geltend machen und allenfalls Schadenersatz fordern. Oftmals haben die Parteien bereits heute spezielle Gewährleistungsbestimmungen vereinbart, z.B. durch Verweis auf die SIA-Norm 118. Diese sieht vor, dass der Bauherr
bei unbenutztem Fristablauf den Mangel auf Kosten des Unternehmers durch einen Dritten beheben lassen kann (Ersatzvornahme).
Herr Dr. Zweifel, was ändert sich bei der Rügefrist?
Nach aktuellem Recht muss der Käufer einer Liegenschaft diese nach dem Kauf im üblichen Rahmen prüfen und allfällige dabei entdeckte Mängel «sofort» rügen. Verdeckte Mängel, die erst später entdeckt werden, müssen ebenfalls «sofort» gemeldet werden. Auch das Werkvertragsrecht kennt eine ähnliche Regelung. Wenn ein Käufer oder Bauherr diese «sofortige» Rügeobliegenheit verletzt, verwirkt er sämtliche Gewährleistungsansprüche für den betreffenden Mangel. Dies ist eine sehr einschneidende Rechtsfolge. In der Praxis sind sich Käufer oftmals nicht bewusst, wie wichtig eine schnelle Rüge ist. Wir sehen in unserer Anwaltspraxis auch immer wieder, dass es bei Firmen nicht möglich ist, einen Mangel kurzfristig zu rügen, weil die Kommunikationskette vom Hauswart über die Bewirtschaftung bis zum Asset Management zwangsläufig einige Zeit in Anspruch nimmt. Die auf den 1. Januar 2026 in Kraft tretende Revision sieht nun vor, dass Immobilienkäufer bzw. Bauherren 60 Tage Zeit haben, um einen Mangel zu rügen. Diese Frist darf vertraglich nicht verkürzt werden; eine vertragliche Verlängerung ist hingegen zulässig.
Die neue Rügefrist gilt auch für den Kauf älterer Immobilien? Ja, diese geänderte Bestimmung gilt für sämtliche Immobilien und beschränkt sich nicht auf Neubauten.
Frau Dr. Schnyder, in welchem Verhältnis stehen die revidierten Gesetzesbestimmungen zur SIA-Norm 118? Sie sprechen die Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten an, welche der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) als SIA-Norm 118 herausgegeben hat. Es handelt sich dabei nicht um gesetzliche Regelungen, sondern um Vertragsbedingungen, welche die Parteien einvernehmlich als Vertragsbestandteil vereinbaren können. Dies ist bei Bauprojekten in der Schweiz regelmässig der Fall. Die SIA-Norm 118 sieht bereits heute ein Nachbesserungsrecht des Bauherrn vor. Ebenso können Baumängel während den ersten zwei Jahren nach der Abnahme jederzeit gerügt werden; es gilt also zunächst sogar eine zweijährige Rügefrist für


Dr. Sibylle Schnyder Rechtsanwältin
Baumängel. Erst nach Ablauf der ersten zwei Jahre müssen Mängel gemäss der SIA-Norm 118 «sofort» nach ihrer Entdeckung gerügt werden. Die Bestimmungen der SIA-Norm 118 sind aber, wie gesagt, nicht zwingend, sondern werden von den Parteien eines Werkvertrages freiwillig vereinbart.
Herr Dr. Zweifel, was ist bei der fünfjährigen Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln zu beachten? Die Rechte des Käufers bzw. Bauherrn bei Mängeln der Liegenschaft verjähren fünf Jahre nach der Eigentumsübertragung bzw. der Bauabnahme. Die Verjährungsfrist bedeutet, dass Ansprüche des Käufers bzw. Bauherrn zeitlich befristet sind. Nach Ablauf der Verjährungsfrist können die Gewährleistungsansprüche nicht mehr durchgesetzt werden, selbst dann nicht, wenn ein Mangel rechtzeitig gerügt worden ist. Es gibt aber Möglichkeiten, eine
Steckbrief
CMS Schweiz CMS von Erlach Partners AG ist eine führende Anwaltskanzlei in der Schweiz mit mehr als 120 Anwältinnen und Anwälten sowie Steuerexpertinnen und Steuerexperten und insgesamt über 200 Mitarbeitenden. Die Kanzlei berät Schweizer und internationale Unternehmen, darunter multinationale Konzerne, Finanzinstitute, Start-ups, Behörden, öffentliche Anstalten, Privatinvestoren und Privatpersonen in allen Branchen und Rechtsgebieten.
Mehr Informationen unter cms.law
laufende Verjährungsfrist zu unterbrechen: sei es durch eine Betreibung, eine Klage oder eine einvernehmliche Vereinbarung. Die per 1. Januar 2026 geänderten Gesetzesbestimmungen sehen nun vor, dass die fünfjährige Verjährungsfrist im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Erstellung von Immobilien vertraglich nicht verkürzt werden darf.
Welche Klarstellung erfolgt beim Bauhandwerkerpfandrecht? Handwerker bzw. Unternehmer, welche für ihre Arbeitsleistung oder Materiallieferung nicht bezahlt werden, können zur Sicherung ihres Werklohnes auf dem Grundstück, auf dem sie tätig waren, ein Pfandrecht eintragen lassen. Der Grundeigentümer kann das Pfandrecht verhindern oder löschen lassen, wenn er für die Forderung samt Zinsen eine «hinreichende Sicherheit» leistet. Bisher verlangte das Bundesgericht, dass Verzugszinsen zeitlich

unbeschränkt abgesichert werden mussten, was in der Praxis zu Problemen geführt hat. Gemäss der neuen Regelung im Zivilgesetzbuch ist nun klargestellt, dass die Sicherstellung eines Verzugszinses für zehn Jahre ausreichend ist.
Frau Dr. Schnyder, sollen die neuen Gesetzesbestimmungen bereits heute bei der Ausgestaltung von Kauf- und Werkverträgen beachtet werden? Was empfehlen Sie diesbezüglich? Die neuen Bestimmungen gelten nur für Verträge, die ab dem 1. Januar 2026 abgeschlossen werden. Wenn jemand heute einen Kaufvertrag über eine Stockwerkeigentumseinheit ab Plan unterzeichnet, in welchem die Gewährleistung des Verkäufers wegbedungen wird, bleibt das Vereinbarte gültig, auch wenn der Bau erst im Jahre 2026 vollendet wird. Es ist natürlich heute schon möglich, im Kauf- oder Werkvertrag die käuferfreundlicheren Bestimmungen des neuen Rechts freiwillig zu vereinbaren. Entwickler von Stockwerkeigentum, mit dessen Bau bereits dieses Jahr begonnen wird, deren Einheiten aber erst 2026 oder später verkauft werden, sollten unbedingt darauf achten, dass die Gewährleistungsbestimmungen in den Werk- und Kaufverträgen aufeinander abgestimmt sind.
Dr. Thomas Zweifel Rechtsanwalt
Verbessern SIEC-Test, besser geschützte KMU und ein gestärktes Kartellzivilrecht den Wettbewerb? Eine Erfolgsprognose.
Als die drei wichtigsten Komponenten der Kartellrechtsrevision dürfen der SIEC-Test, KMU als wichtigste Nutzniesser und ein gestärktes Kartellzivilrecht bezeichnet werden. Diese Komponenten lohnen eine kurze Betrachtung, um die Wirkung der Kartellrechtsrevision einschätzen zu können – auch im Hinblick auf den angeblichen Mehraufwand und die Möglichkeiten, die KI-Systeme demnächst bieten könnten, um Kartellrechtsverstösse anzuzeigen.
Zum SIEC-Test, der unilaterale und koordinierte Effekte eines geplanten Zusammenschlusses anhand von Markt- und Wettbewerbsstrukturen bewertet, stellten Dr. Christian Jaag, Dr. Samuel Rutz und Noëmi Jacober von der Zürcher Wirtschaftsberatung Swiss Economics in ihrer 80-seitigen Analyse «Einführung des SIEC-Tests – Auswirkungen auf die Schweizer Fusionskontrolle» bereits 2017 fest: «Die vom Bundesrat vorgeschlagene Einführung des SIEC-Tests wird von beinahe allen befragten Experten als sinnvoll erachtet.» Dabei stehe «nicht nur das Motiv im Vordergrund, dass unter dem SIEC-Test die Interventionsschwellen tiefer sind». Genauso wichtig erscheine es Experten, «dass unter dem SIECStandard eine sachgerechtere Prüfung von Fusionen stattfinden kann, was zu konsistenteren und besser nachvollziehbaren Entscheiden führen würde. Gerade die heute fehlende Effizienzverteidigung wird von vielen Experten als störend empfunden».
Das Autoren-Trio schliesst auch «negative Auswirkungen einer Einführung des SIEC-Tests auf die KMU» fast gänzlich aus. «Im Gegenteil.» Gerade KMU könnten vom SIEC-Test profitieren, «da sich mit diesem Prüfstandard wettbewerblich bedenklichen Konzentrationstendenzen auf Zuliefer- und Absatzmärkten von KMU besser entgegen-
differenzierte Betrachtung wünschenswert. Ihre Sorge: «Der Einzelfall wird nicht mehr betrachtet - der Behörde genügt eine Fiktion der Schädlichkeit.»
Dies könne zu «erheblichen Nachteilen für die Wirtschaft» führen, «da die Rechtssicherheit untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt» werde.
Durchaus interessant bleibt hier die Verwechslungsgefahr von Wettbewerbsfähigkeit und -schädigung, die bei zu einseitiger Betrachtung offenbar Unternehmen und deren Geschäfte entsprechend beschädigen und, so darf man folgern, künstlich kleinhalten kann oder schrumpfen lässt. «Schädliche Auswirkungen», so das Positionspapier, müssten «nicht theoretisch, sondern tatsächlich» vorliegen. Nur eine Einzelfallbetrachtung mit «mehr Praxis und Tiefenschärfe», die nun als «qualitative Betrachtung» in die Revision eingebracht wurde, führe zur Erhöhung der Rechtssicherheit.
Vielleicht ist demzufolge die vorgesehene Stärkung des Kartellzivilrechts die eigentliche «Wild Card» unter den Änderungen. Jedoch seien kartellrechtliche Schadenersatzklagen in der Schweiz «nahezu inexistent», so Dr. Nada Ina Pauer und Prof. Dr. Andreas Heinemann in ihrem 2023 in «Wirtschaft und Wettbewerb» publizierten Artikel «Kartellrechtliche Schadenersatzklagen in der Schweiz». Pauer und Heinemann fordern einen besseren «Zugang zum Beweismaterial zugunsten der Geschädigten» sowie das Einfügen einer «Vermutung über die Höhe des entstandenen Schadens». Die «sachgemässe Entwicklung des gesetzlichen Rahmens» sei allerdings «nur der erste Schritt». «Erfahrungsgemäss braucht es viel Zeit, bis sich gesetzliche Änderungen in der Praxis widerspiegeln. Mit der Stärkung des Kartellzivilrechts verbindet die Gesetzesvorlage die Hoffnung, dass sich die Wettbewerbsbehörde noch besser ders im öffentlichen Interesse liegen.» Bevor aber spürbare Hilfe durch einen «private attorney general» komme, Ob Unternehmen zwischen Krisen, Konkurrenten und Kaufgelüsten nun einfach abwarten sollten, ist fraglich.
Florett oder Keule
Das Kartellrecht soll unter der zuständigen Wettbewerbskommission (WEKO) den Wettbewerb schützen. Schärft die aktuelle Kartellrechtsrevision so das Bewusstsein für wettbewerbswidriges Verhalten oder fördert sie den Generalverdacht?
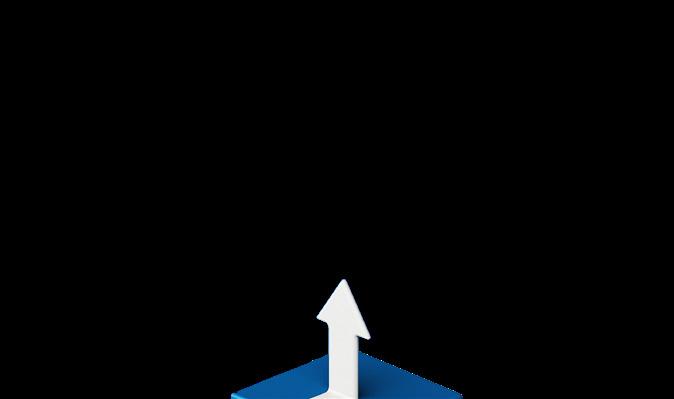
VON RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
Wheiten in den Rechtsabteilungen früher oder später den Griff zum

ieder einmal könnte das Problem beim Tempo liegen. Denn natürlich soll ein modernes Kartellrecht schneller Verstösse aufdecken und ahnden. Andererseits aber, so mahnt es unter anderem der Verband economiesuisse seit längerem an, muss es jeden Fall individuell beurteilen, was per se nur mit einer gründlichen und entsprechend zeitintensiven Prüfung gelingen kann.
Als der Bundesrat am 24. Mai 2023 die nun in Kraft tretende Teilrevision des Kartellgesetzes verabschiedete, lobte das Staatssekretariat für Wirtschaft die «verbesserte Wirkung des Kartellgesetzes» bei gleichzeitiger Umsetzung dreier parlamentarischer Vorstösse. Durch den Wechsel «vom bisherigen qualifizierten Marktbeherrschungstest zum Significant Impediment to Effective Competition-Test (SIEC-Test)» werde «der kartellrechtliche Prüfstandard bei Unternehmenszusammenschlüssen der internationalen Praxis angepasst». Neben «dieser Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle» werde «das Kartellzivilrecht gestärkt und das Widerspruchsverfahren verbessert».
Mit der Umsetzung der Forderungen der Motion 16.4094 Fournier, «Verbesserung der Situation der KMU in Wettbewerbsverfahren», der Motion
18.4282 Français, «Die Kartellgesetzrevision muss sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigen, um die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsabrede zu beurteilen», und der Motion 21.4189 Wicki namens «Untersuchungsgrundsatz wahren. Keine Beweislastumkehr im Kartellgesetz» erfolge eine bestmögliche Revision, durfte man implizieren.
Ungelöste strukturelle Probleme Allerdings sprechen Marc Thommen und Andrés Payer in ihrer Monografie «Kartellverfahren als Strafverfahren.
Zur institutionellen Ausgestaltung des Verfahrens über Direktsanktionen vor den Schweizer Wettbewerbsbehörden im Lichte der Bundesverfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention» (EIZ Publishing, 2024) auch die weiter bestehenden, strukturellen Probleme hiesiger Kartellrechtsverfahren an. Zusammenfassend habe sich gezeigt, «dass die Bedingungen, unter denen von einer unmittelbaren bzw. erstinstanzlichen Beurteilung durch ein Gericht abgesehen werden kann, im Kartellrecht nicht erfüllt sind». Kartellstrafen seien «weder Bagatellsanktionen, noch kommen sie massenhaft vor». Weiter stellen Thommen und Payer fest: «Gerade weil den Sanktionen langjährige und sehr aufwendige Untersuchungen vorangehen, sind die Wettbewerbsbehörden bei ihrer Ausfällung nicht mehr unvoreingenommen und ergebnisoffen. Vielmehr sind sie
mit der an sie gestellten Anforderung einer unabhängigen Entscheidung überfordert.» Es brauche daher eine gerichtliche Erstinstanz.
Auch bezüglich der obligatorischen Unschuldsvermutung, die nun Teil der Revision werden soll, stehe es nicht zum Besten. Die Unschuldsvermutung scheine «in verschiedener Weise unter Druck zu stehen bzw. nicht gewahrt zu werden. Bereits die Praxis der amtlichen Veröffentlichung der Namen von Unternehmen, die Adressaten einer Untersuchung sind, steht mit ihr in einem Spannungsverhältnis». So müssten von der WEKO mit einer Verfügung belegte Unternehmen ihre Unschuld beweisen, was faktisch eine «Richtigkeitsvermutung zugunsten der WEKO» und damit auch eine «Schuldvermutung zulasten der Unternehmen» bedeute. Die Autoren schlagen am Ende ein Modell vor, «in dem ein erstinstanzliches Sachgericht die Direktsanktionen verhängt und die einvernehmlichen Regelungen genehmigt», womit «die Direktsanktionen institutionell und verfahrensrechtlich mit den Vorgaben der Konvention, der Bundesverfassung und den Maximen des Strafprozesses im Einklang» stünden. «Die beste Lösung besteht darin, das Sekretariat als Untersuchungsbehörde, die WEKO als Anklagebehörde, ein neues Bundeswettbewerbsgericht als erstinstanzliche Entscheidbehörde und das Bundesverwaltungsgericht als Berufungsinstanz vorzusehen.»
«Das Potenzial der
Unternehmen

steigt, sich gut und glaubhaft verteidigen zu können»
Wie sehr wird die Revision des Kartellrechts die Risikoanalyse, Verwaltungs- und Zivilverfahren beeinflussen?
Für AGON PARTNERS LEGAL antworten Verwaltungsratspräsident Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf und CEO Dr. Markus Wyssling.
Herr Prof. Krauskopf, Herr Dr. Wyssling, welche Folgen hat die Kartellrechtsrevision für Unternehmen?
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf: Die Auswirkungen der Kartellgesetzrevision verfolgen wir nicht nur für unsere eigene AGON Partners Group, sondern auch weil Markus bei vielen Verbänden und Unternehmen die kartellrechtliche Compliance sicherstellt und ich selbst mehrfacher Verwaltungsratspräsident auch von börsennotierten Unternehmen bin.
Dr. Markus Wyssling: In der Tat, unsere Kunden wollen nicht von den Neuerungen überrascht werden. Deswegen versuchen wir, absehbare Änderungen des Kartellgesetzes rechtzeitig in die Prozesslandschaft der Unternehmen einzupflegen.
Bei der Fusionskontrolle löst der SIEC-Test den alten Marktbeherrschungstest ab. Ist der SIEC-Test tatsächlich besser?
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf: Die Anlehnung mit dem SIEC-Test im neuen Art. 10 Kartellgesetz an das europäische Recht ist zu begrüssen. Im internationalen Vergleich weist die Fusionskontrolle im geltenden Kartellgesetz Wirkungsdefizite aus. Dies zeigt sich daran, dass vertiefte Prüfungen von Zusammenschlüssen eher selten erfolgen. Mit dem neuen Recht wird es zwar nicht mehr Meldungen geben. Aber die WEKO wird nun auch Fusionen aufgreifen können, die unter der sog. Marktbeherrschungsgrenze «fliegen». Die Anwendung des SIEC-Tests wird in diesen Fällen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung die «Timeline» eines Zusammenschlusses beeinflussen, d.h. in der Regel um vier Monate verlängern. Auch wird
der Aufwand, um der WEKO die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, zunehmen.
Dr. Markus Wyssling: Dem kann ich nur beipflichten. Der SIEC-Test erfordert eine bessere Dokumentation. Die Effizienzvorteile einer angestrebten Fusion müssen robuster sein. Für Unternehmen entstehen zusätzliche ökonomische Analysemöglichkeiten. Dies ist positiv für die Unternehmen, bedingt organisatorisch aber – möchte man keinen selbst verschuldeten Verzug vor der WEKO riskieren – frühzeitige Vorbereitungsarbeiten.
Wie ändert sich der Risiko-Appetit, wenn Unternehmen vorgeworfen wird, ihre marktbeherrschende Stellung ausnützen?
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf: Aus der Sicht einer Unternehmensführung sind die Ergänzungen in Art. 7 KG differenziert zu beurteilen: Wird mein Unternehmen eines Marktmachtmissbrauchs bezichtigt, so verfüge ich gegenüber der WEKO über neue «Verteidigungsmöglichkeiten». Ist mein Unternehmen indes Opfer eines Marktmachtmissbrauchs, sind die Erfolgsaussichten einer Anzeige bei der WEKO spiegelbildlich geringer. Mit anderen Worten: In der Risikoanalyse eines Unternehmens dürfte das kartellrechtliche Risiko «Marktmachtmissbrauch» an Bedeutung eher abnehmen.
Die WEKO wird weiter Einzelfallprüfungen machen. Wie müssen diese rechtlich begleitet werden?
Dr. Markus Wyssling: Für das

Patrick Krauskopf Verwaltungsratspräsident
marktbeherrschende Unternehmen eröffnen sich neue, weitreichende Verteidigungsmöglichkeiten. Ein Verhalten kann künftig erst dann verboten werden, wenn die «Erfahrung» zeigt, dass ein volkswirtschaftlicher Schaden besteht und nicht nur droht. Zudem muss konkret nachgewiesen werden, dass das unternehmerische Verhalten den Wettbewerb beeinträchtigt hat. Unternehmen werden daher mit empirischen Daten gegenüber der WEKO darlegen können, dass ein Verbot ihres Verhaltens nicht gerechtfertigt ist. Aus operativer Sicht wird der Koordinationsbedarf zwischen Juristen und Ökonomen steigen. Welche Entwicklungen sehen Sie bei den Wettbewerbsabreden?
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf: Der vorliegende Vorschlag in Art. 5 ist für ein Unternehmen, dem unerlaubte Kartellabsprachen vorgeworfen werden, keine
AGON PARTNERS LEGAL
AGON PARTNERS LEGAL AG berät und vertritt in Zivil-, Verwaltungs- und Strafverfahren im Bereich des Wirtschaftsrechts, insbesondere in wettbewerbsrechtlichen Verfahren.
Bei kartellrechtlichen Zivil- und Verwaltungsverfahren ist das Team u.a. spezialisiert auf praxisnahe Auslegungen, die Risikoanalyse und Beseitigung kartellrechtlicher Altlasten, Schiedsverfahren, kartellrechtliche Verwaltungs(straf)verfahren, WEKO-Meldu ngen von Fusionen und kartellrechtliche Zivilverfahren.
Mehr Informationen unter agon-partners.com Steckbrief
schlechte Nachricht. Der Beweisaufwand für die WEKO wird in jedem Fall zunehmen, je nachdem wie Gerichte Begriffe wie «Erfahrungswerte» oder «konkrete Umstände» auslegen werden.
Aus der Sicht eines ehemaligen WEKOVizedirektors, der 2003 WEKO-intern federführend an der letzten erfolgreichen KG-Revision beteiligt war, erachte ich die beabsichtigten Änderungen für die Schweizer Volkswirtschaft nicht als Gewinn.
Man hört immer wieder, dass das Kartellzivilverfahren derzeit nicht wirksam ist. Was können sich Verbraucher erhoffen, was müssen Unternehmen fürchten?
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf: Eine Stärkung des Zivilverfahrens ist überfällig. Gerade für viele KMU sind das im internationalen Kontext mit marktmächtigen Zulieferern gute News. Der Eindruck, es

CEO
gäbe bei uns kein Kartellzivilverfahren, trügt allerdings. Die meisten Verfahren vor Handels- und anderen Zivilgerichten laufen unter dem Radar der Öffentlichkeit. In über 90 Prozent der Fälle vergleichen sich die Partien. Dabei wird fast immer Vertraulichkeit vereinbart. Hier spielen Richter eine gute und entscheidende Rolle, wenn sie unverbindliche Urteils-Prognosen abgeben. Gestützt auf solche Orientierungshilfen einigen sich oft die Unternehmen. Die Revision des Kartellrechts wird das sog. Private Enforcement (Klagen vor Gericht) stärken und somit das Public Enforcement einer streckenweise unterdotierten WEKO entlasten. Wird es dabei zu einer Zunahme der öffentlich publizierten Fälle kommen? Ich gehe nicht davon aus. Dr. Markus Wyssling: Auch betroffene Konsumenten können künftig direkt gegen Unternehmen klagen, die gegen das Kartellrecht verstossen haben. Neu beginnt die Verjährungsfrist für solche Schadenersatzforderungen erst, wenn ein endgültiges Gerichtsurteil oder eine endgültige behördliche Entscheidung vorliegt. Das erhöht das Risiko für Unternehmen, nachträglich verklagt zu werden. Für Firmen bedeutet das: Wer gegen das Kartellgesetz verstösst, muss künftig verstärkt mit Klagen und finanziellen Forderungen rechnen.
Markus Wyssling
Aus- und Weiterbildung
« Das Studium hat mir vieles möglich gemacht»
Rasante gesellschaftliche Entwicklungen und eine immer komplexere Regulierung verändern gerade den Bedarf nach rechtlichem Knowhow, die Berufsbilder und die Möglichkeiten der Arbeitnehmenden.
Als Teil der Kalaidos Fachhochschule bietet die Kalaidos Law School (KLS) deshalb ein vollwertiges berufs- und familienbegleitendes Rechtsstudium sowie Weiterbildungen an. Prof. Dr. Daniel Dedeyan, Rechtsanwalt, LL.M. (Yale), Dean und Professor der KLS sowie Partner in der Kanzlei Loyens & Loeff Switzerland LLC, und Lukas Meier, Master of Arts in Law der Kalaidos Fachhochschule sowie Chef Ordentliche Verfahren beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, ab 1. Juli 2025 Leiter des Stadtrichteramts Winterthur, schildern die Ausbildung.
«Unser berufs- und familienbegleitendes Studium kommt den Bedürfnissen der sich schnell verändernden Arbeitswelt und Gesellschaft entgegen.»

Herr Prof. Dedeyan, an wen richten sich die Angebote der Kalaidos Law School?
Unsere Studiengänge sprechen Persönlichkeiten mit grossen Zielen an, die im Beruf und im Leben stehen und die sich mit einem vollwertigen Rechtsstudium weiterentwickeln wollen. Mit unseren Vertiefungsrichtungen, die wir neu ab diesem Herbst anbieten, können sie sich zugleich für eine bestimmte Branche qualifizieren: unter anderem als Unternehmens-, Verwaltungs-, Tech- sowie Finanzmarkt-Juristinnen und -Juristen. Unsere Studierenden sind Mitarbeitende und Führungskräfte aus Unternehmen, regulierten Sektoren oder der Verwaltung mit Freude am Recht, die sich mit dem Studium neue Chancen eröffnen. Unsere besondere Studienstruktur ermöglicht es ihnen, ihre berufliche Karriere und persönlichen Ziele parallel mit 80 bis 100 % weiterzuverfolgen. Dementsprechend ist unseren Absolventinnen und Absolventen bisher mit dem Bachelorund erneut mit dem Masterabschluss, den wir in dieser Form als einzige Fachhochschule anbieten, durchwegs ein Karrieresprung gelungen. Unser berufs- und familienbegleitendes Studium kommt damit den Bedürfnissen der

sich schnell verändernden Arbeitswelt und Gesellschaft entgegen.
Wie haben sich die Arbeitswelt und die Berufsbilder denn in den letzten Jahren verändert?
Die rasant zunehmende Komplexität und Regulierung in allen Lebensbereichen schafft eine wachsende Nachfrage nach rechtlichem Knowhow, und zwar kombiniert mit aktuellem Branchenwissen, etwa aus dem Tech-Bereich oder der Corporate Finance. Dies wirkt sich auch auf die Rechtsberufe und die Biografien aus, die vielfältiger werden. Blosses Wissen, auch unterstützt durch KI, reicht nicht mehr, vielmehr sind ein innerer Kompass und Verhandlungsgeschick gefragt. Waren die Rechtsberufe bisher vorwiegend Uni-Abgängerinnen und Abgängern vorbehalten, so hat sich dies gewandelt. Unsere Absolventinnen und Absolventen arbeiten sowohl an Schnittstellen des Business zum Recht als auch in klassischen Rechtsberufen in Unternehmen, der Verwaltung oder NGOs. Ihre Berufserfahrung, verbunden mit der berufsbegleitend erworbenen akademischen Qualifikation, wird nachgefragt und von den Arbeitgebern honoriert.
Wie sieht das berufsbegleitende Studium an der Kalaidos Law School aus? Unser modularer Studienaufbau erlaubt die Vertiefung in ein Rechtsgebiet im Selbststudium mit Unterricht während rund zwei Monaten. Der Unterricht kann sowohl vor Ort als auch per Livestream verfolgt werden. Er dient v.a. der interaktiven Besprechung von Fällen und ist mehr Seminar als Vorlesung. Hier lernen die Studierenden das Recht aus erster Hand von Dozierenden, die nicht nur akademisch besonders qualifiziert, sondern auch in der Praxis verankert sind, etwa als Richterinnen, Staatsanwälte, Behördenvertreterinnen oder Anwälte. Ein
Kalaidos Law School
Die Kalaidos Law School bietet als Teil der Kalaidos Fachhochschule ein berufs- und familienbegleitendes Bachelor- und Masterstudium in Recht und einen Bachelor in Business Law an — neu alle Programme mit praxisrelevanten Vertiefungsmöglichkeiten — sowie Weiterbildungen. Sie legt grossen Wert auf eine solide, praxisorientierte Rechtsausbildung und vernetzt als Lern- und Forschungsplattform Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft.
Mehr Informationen unter kalaidos-fh.ch
Herzstück ist unser methodisch-didaktisches Konzept. Dieses ist auf das berufsbegleitende Studium ausgerichtet und zeichnet sich durch eine besonders strukturierte Vermittlung der Lerninhalte aus.
Konkret geht es Ihnen auch um einen breiten Wissensaustausch. Beim 3. Nachhaltigkeits-Symposium im letzten November haben Sie dazu mit 17 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung diskutiert. Kann man sagen, dass rechtliche Fragen immer mehr auch die Zivilgesellschaft berühren und gemeinsame Lösungen verlangen?
Absolut. Wir verstehen uns in der Lehre, Forschung und Dienstleistung als eine Plattform, die Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenbringt und Lernprozesse fördert. Denn die heutigen Herausforderungen vom Klimawandel bis zur digitalen Transformation verlangen nach einem interdisziplinären Ansatz im Austausch mit der Praxis. Das Recht wird hierbei zunehmend zum Bezugspunkt der gesellschaftlichen Diskurse, und die Erwartungen an es steigen, je mehr gesellschaftliche Gewissheiten
«Berufserfahrung, verbunden mit der berufsbegleitend erworbenen akademischen Qualifikation, wird nachgefragt und von den Arbeitgebern honoriert.»
schwinden. Dies ist eine Chance: Das Recht wird zum runden Tisch, an dem gegensätzliche Interessen verhandelt und gestaltet werden. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.
«In meiner Masterarbeit konnte ich das Wissen direkt aus meiner täglichen Arbeit einbringen und neue Erkenntnisse für die Praxis gewinnen.»

Lukas Meier Chef Ordentliche Verfahren beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, ab 1. Juli Leiter Stadtrichteramt Winterthur
Herr Meier, was motivierte Sie zum Rechtsstudium?
In meiner beruflichen Tätigkeit stellten sich immer wieder rechtliche Fragen. Dabei merkte ich, wie mich dieser Bereich interessiert und ich mehr dazu lernen möchte. Ausserdem wollte ich auch mehr Perspektiven erhalten für eine allfällige spätere berufliche Veränderung.
Wie liessen sich Studium, Karriere, Familie und Freizeit unter einen Hut bringen?
Mit dem Beginn des Studiums wurde ich viel strukturierter und organisierter. Mir half eine gute Zeitplanung, wo eben auch die Freizeit ihren Platz hatte. Zudem wurde ich von meinem Arbeitgeber so unterstützt, dass ich meine Arbeitszeit flexibel planen konnte. Weil der Unterricht immer am Abend oder am Wochenende stattfand, konnte ich dies gut in mein Arbeitsleben integrieren. Nicht zuletzt haben auch meine Familie und der Kollegenkreis verständnisvoll reagiert, als ich am einen oder anderen Treffen nicht teilnehmen konnte. Das didaktische Konzept des Studiums ist so aufgebaut, dass man die Lernphasen flexibel planen kann. Halt eben so, dass es gut mit dem Berufsund Privatleben vereinbar ist.
Wie nahe ist das Studium an der Praxis?
Das Studium ist sehr praxisnah aufgebaut. Einerseits sieht man dies an den Dozierenden, welche in der Praxis tätig sind. Andererseits auch am Aufbau der Unterrichtseinheiten, wo die Inhalte vorwiegend anhand von praktischen Fällen vermittelt werden. Natürlich ist auch die theoretische Basis für das Verständnis wichtig. Diese hatte ich mir jeweils zwischen den Vorlesungen im Selbststudium angeeignet, angeleitet durch ein «Drehbuch», welches die Dozierenden erstellt hatten.
Nützte Ihnen Ihre Berufs- und Lebenserfahrung im Rechtsstudium? Gab es erlernte Fähigkeiten, die Sie bereits in die Praxis umsetzen konnten? Auf jeden Fall halfen mir die bereits im Beruf erlangten Kenntnisse, um die erlernten spannenden Inhalte besser einzuordnen. Zudem konnte ich die Sache aufgrund der Lebenserfahrung sicher etwas gelassener angehen. Da ich beruflich in der Strafverfolgung tätig bin, konnte ich auch schon während des Studiums vieles in die Praxis umsetzen. Nicht nur das Wissen aus dem Strafrecht, sondern auch aus anderen Bereichen wie dem Zivilrecht und dem öffentlichen Recht. Schliesslich konnte ich in meiner Masterarbeit zu Strafverfahren durch Verwaltungsbehörden Erkenntnisse direkt aus meiner Praxis verarbeiten und für meine Praxis gewinnen.
Ihre Arbeit hat den Preis der Kalaidos FH für die beste Masterarbeit gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Wie hat das Studium Ihre Karriere beeinflusst? Eingestiegen ins Studium bin ich als Sachbearbeiter. Inzwischen leite ich einen Bereich und bin neben rechtlichen auch für strategische Fragen zuständig. Das Studium hat mir also vieles möglich gemacht.
Gab es für Sie während des Studiums persönliche Highlights und Aha-Momente?
Ja, ganz viele! Als Highlight würde ich jeden erreichten Meilenstein bezeichnen, also zum Beispiel ein erfolgreich abgeschlossenes Modul aber natürlich auch den Bachelor- und der Masterabschluss. Aha-Momente gab es auch immer wieder, insbesondere dann, wenn ich wieder einen Rechtsbereich mit dem anderen verknüpfen konnte und merkte, dass alles irgendwie «zusammenpasst».
Steckbrief
Prof. Dr. iur. LL.M. (Yale) Daniel Dedeyan Dean und Professor der Kalaidos Law School, Partner bei Loyens & Loeff
«Wie Führungskräfte gut schlafen und Nutzen schaffen»
Unternehmen sind täglichen Einflüssen ausgesetzt. Die rechtlichen Risiken werden regelmässig nicht erkannt oder falsch eingeschätzt.
Führungskräfte, die frühzeitig eingreifen, können nicht nur Schaden von sich und dem Unternehmen fernhalten, sondern sogar aktiv einen Mehrwert schaffen. Prof. Dr. Bruno Mascello von der Universität St.Gallen erklärt im Interview, wie das geht.
Herr Prof. Mascello, was hat Recht mit Hassliebe zu tun?
Leider besteht das Stereotyp des Juristen als Geschäftsverhinderer. Unternehmen ist bewusst, dass rechtliche Vorgaben ein unverzichtbarer Bestandteil des Geschäftsalltags sind. Statt das Recht also nur negativ als Beschränkung zu verstehen, lohnt es sich, den Blick auf die Gestaltungsräume zu richten, die es bietet.
Können Sie konkrete Beispiele für die Relevanz von Recht im Geschäftsalltag geben?
Unternehmen sind zurzeit mit dem neuen Zollregime der USA stark gefordert. Das erfolgt primär aus finanzieller Sicht, und man fokussiert zeitbedingt auf schnelle Lösungen. Genauso wichtig wäre es jedoch, die Verträge mit den eigenen Lieferanten und Kunden zu prüfen, weil man sich letzten Endes darauf beziehen wird. Der aktuelle Zollund Handelsstreit stellt jedoch nur das jüngste Beispiel von vielen dar. Schaut man sich die letzten fünf Jahre an, erkennt man schnell, dass sich Unternehmen wiederholt mit Krisen konfrontiert sahen. Sie wurden herausgefordert mit dem Ukrainekrieg, dem Russlandembargo, der blockierten Schifffahrt am Roten Meer und natürlich der CoronaPandemie. In all diesen Fällen hat man schnell erfahren, was die eigenen Verträge wert sind, oder eben auch nicht.
Wie können Verträge in solchen Situationen helfen? Verträge entfalten eine doppelte Schutzwirkung: Sie dienen präventiv dem Risikomanagement, indem potenzielle Konflikte erkannt und im Vertrag geregelt werden. Die genannten Beispiele zeigen bestens, dass sich Unternehmen mit ihren Verträgen nicht nur auf Jahrhundertereignisse vorbereiten müssen. Wer noch nicht gemerkt hat, dass wir hier mittlerweile vom Tagesgeschäft sprechen, wird künftig weiter übermässig leiden. Und reaktiv dienen Verträge später, wenn ein Ereignis eingetreten ist, um die Krise zu managen. Also im Falle von Konflikten und schlimmstenfalls im Gerichtsfall. Man hat also die Wahl, wann und wo man lieber Zeit und Geld investieren will.
Manager sind bekanntlich keine Juristen. Wie soll das gehen?
Manager müssen keine Volljuristen sein – dennoch ist es entscheidend, dass sie trotz fehlender juristischer Ausbildung ein sicheres Gespür für Rechtsfragen entwickeln. Hierfür reicht es, drei Dinge zu verbessern: Erstens sind sie genügend sensibilisiert, um zu verstehen, wann es ratsam ist, Fragen auch rechtlich abzuklären. Zweitens können

sie einfache rechtliche Fragen selbst kompetent beantworten. Und drittens können sie Anwälte richtig instruieren und steuern. So erhält man nicht nur einen fundierten und nützlichen Rechtsrat, sondern behält auch die Kosten im Griff.
Reicht es nicht, juristische Expert:innen in der eigenen Rechtsabteilung zu haben?
Eine Rechtsabteilung kann nicht in jeder Besprechung oder bei jeder Verhandlung mit dabei sein, jeden Vertrag prüfen oder jede E-Mail gegenlesen. Man sollte sich von der Illusion verabschieden, dass die Rechtsabteilung alle Rechtsrisiken managt. Die Verantwortung für Rechtsrisiken liegt weiterhin primär bei den einzelnen Führungskräften und Mitarbeitenden. Rechtliche Fragen schlagen zuerst an der Front und im Business auf und müssen dort richtig adressiert und kanalisiert werden. Nur ein kleiner Teil der Fälle endet schliesslich bei den Juristen, und auch das oft zu spät, wenn die Weichen bereits falsch gestellt wurden.
Welchen konkreten Nutzen bringen Manager, die sich mit rechtlichen Fragen auskennen?
Hier sind zwei Sichtweisen zu unterscheiden. Schaut man das Ganze positiv an, dann weist in rechtlichen Fragen kundig zu sein einen grossen finanziellen und auch einen Wettbewerbsvorteil aus. Neue Gesetze und Regularien werden von CEOs regelmässig als einige der grössten Risiken genannt. Sie verstehen das Recht aber nicht als Beschränkung, sondern erkennen darin Opportunitäten, um den Unternehmenswert zu steigern. Rechtskenntnisse zu haben, wirkt sich damit unmittelbar positiv auf die optimale Positionierung aus.
Und die Schattenseite?
Rechtsunkenntnis bietet keinen Schutz vor negativen Konsequenzen. Mit Rechtsverletzungen sind oft sehr schmerzhafte rechtliche und finanzielle Konsequenzen verbunden. Rechtlich unkundige Manager können für Unternehmen also ein Risiko darstellen und zu einer erheblichen finanziellen Gefahr in Form von hohen Kosten und Strafen führen. Und im schlimmsten Fall einen teuren Reputationsschaden nach sich
Steckbrief
Prof. Dr. Bruno Mascello ist Titularprofessor für Wirtschaftsrecht und Legal Management an der Universität St.Gallen (HSG) und Direktor der Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG) der Universität St.Gallen. Er lehrt, forscht und publiziert regelmässig zu verschiedenen Themen an der Schnittstelle von Recht und Betriebswirtschaft und im Legal Management.
Der Geschäftsbereich Law & Management der Universität St. Gallen bietet verschiedene Lehrgänge für Nichtjurist:innen an und ist bei Kunden beliebt für massgeschneiderte Angebote. Die Lehrgänge sind modular aufgebaut und können flexibel und individuell zusammengestellt werden, vom Wochenmodul, über ein Zertifikat bis zum Executive Master Management & Law.
Mehr Informationen unter lam.unisg.ch

Prof. Dr. Bruno Mascello Titularprofessor für Wirtschaftsrecht und Legal Management
ziehen. Es ist deshalb unerlässlich, dass Führungskräfte auch im Rechtsumfeld sicher navigieren können. Oft sind sich wenig sensibilisierte Führungskräfte gar nicht bewusst, welche Wissenslücken sie haben. Vielmehr glauben sie oft, dass sie richtige Entscheidungen fällen. Und im schlechtesten Fall riskieren sie auch noch eine persönliche Haftung.
Wie sind Unternehmen rechtlich exponiert?
Unternehmen sind heute in rechtlicher Hinsicht gleich mehrfach exponiert. Die Rechtslandschaft ist komplexer geworden und es kommen laufend neue Themen dazu. Unabhängig von der jeweiligen Branche sieht sich jedes Unternehmen mit gewissen Kernthemen konfrontiert. Das Unternehmen muss zunächst die für seinen Betrieb geschäftsrelevanten Gesetze und Regularien kennen und die Neuerungen laufend aktuell halten. Anschliessend muss es dafür sorgen, dass die geltenden Vorschriften im Unternehmen auch von allen Mitarbeitenden eingehalten werden. Damit reduziert sich automatisch auch das Risiko von Complianceverstössen.
Welche Rechtsgebiete erachten Sie auch noch als wichtig? Neben der bereits genannten Compliance ist zunächst der von vielen Unternehmen nicht geliebte Datenschutz zu nennen. Dann ist das Thema Cybersicherheit zu ergänzen. Auch dieses ist unbeliebt, gehört für Unternehmen aber leider zum Alltag. Ferner sind die Regeln einer guten Unternehmensführung einzuhalten, weshalb das Thema
«Manager müssen keine Volljuristen sein – dennoch ist es entscheidend, dass sie trotz fehlender juristischer Ausbildung ein sicheres Gespür für Rechtsfragen entwickeln.»
Governance wichtig bleiben wird. Und schliesslich werden auch die Themen Nachhaltigkeit und ESG relevant bleiben, auch wenn gerade andere Tendenzen spürbar sind. Alle diese Rechtsthemen haben eines gemeinsam: Die Regeln werden sich zwar immer wieder ändern, das Rechtsrisiko wird jedoch stets bestehen bleiben. Manager sollten deshalb ein Grundverständnis davon besitzen.
Welches juristische Grundwissen sollten Führungskräfte ohne Jurastudium im Gepäck haben? Hier geht es um Basiswissen wie beispielsweise das Kernwissen über Verträge und die Verhandlungskompetenz bei der Festlegung der Risiken. Und die Sensibilisierung für Kündigungen im Arbeitsverhältnis, die schnell missbräuchlich und teuer werden können, ist wichtig. Auch Abreden mit Wettbewerbern sind beliebte rechtliche Fallen. Ausserdem kann es auch nicht schaden, sensibilisiert zu sein für Fragen zur Diskriminierung, zu immateriellen Werten wie Marken und Patenten sowie zu Themen wie Korruption oder Insiderhandel.
Aus Ihrer Sicht: Welcher Soft Skill ist hier besonders gefragt?
Natürlich der Evergreen: Verhandeln. Da Vertragsverhandlungen heute zum Alltag gehören, hat man oft das Gefühl, dass man sie auch ohne weitere Vorkenntnisse erfolgreich führen kann. Manchmal frage ich mich jedoch, wie es dazu kam, gewisse Klauseln so zu verhandeln und zu formulieren und diese Verträge letztlich auch zu unterzeichnen.
Wie beurteilen Sie abschliessend den Einsatz von KI im Rechtsalltag? Erlauben Sie mir, mit einem Irrglauben aufzuräumen: Mit KI werden die Verträge nicht besser. Bloss weil sich etwas gut anhört, heisst das nicht, dass es gut ist oder ein Richter es auch gut findet. Es ist verständlich, dass die Versuchung gross ist, sich von KI schnell einen Vertrag formulieren zu lassen. Aber nur, wer über ausreichende Rechtskenntnisse verfügt, kann die KI-Ergebnisse auch überprüfen und richtig einschätzen. KI in den Händen juristisch spezialisierter Experten kann aus meiner Sicht nützlich sein.
«ComplianceProgramme digital bündeln: Synergien und Effizienz statt Insellösungen»
EQS ist Europas führende Plattform für effektive Compliance-Programme. Sascha Meier, Country Manager Schweiz, erläutert, wie eine umfassende Automatisierung im Compliance-Bereich Unternehmen mehr Rechtssicherheit und Erfolg verschafft.
Herr Meier, das Thema Compliance wird angesichts drohender Bussgelder und Reputationsschäden immer wichtiger, aber auch komplexer. Was können Unternehmen denn tun, um ihre Arbeit kurz- und mittelfristig zu schützen und den Überblick zu behalten?
Grundsätzlich ist das Thema Compliance nicht nur wichtig aufgrund drohender Bussgelder und Reparationsschäden, sondern auch, um vertrauensvolle Unternehmen zu schaffen. Vertrauen ist die Basis von allem, was sich auch in unserem Leitmotto spiegelt, «Creating trusted companies», also vertrauensvolle Unternehmen zu schaffen. Wir leben in einer Welt, wo es einen ziemlich grossen Mangel an Vertrauen in Unternehmen gibt. Deswegen ist Compliance aus meiner Sicht ein Instrument, um Vertrauen sicherzustellen und auch langfristig oder mittelfristig das Wachstum von Unternehmen sichern zu können. Damit Unternehmen generell einen guten Überblick haben, ist natürlich wichtig, die richtigen internen Experten sowie externen Berater an der Seite zu haben und vor allem im Bereich Compliance auf eine ganzheitliche integrierte Software-Plattform zu setzen. In Vertriebsteams kennt man Salesforce, im Bereich Office nutzt man Microsoft365. Im Bereich Compliance gibt es noch nicht so viele Plattformen, aber es wird in diese Richtung gehen. Das Ziel ist, Insellösungen zu verhindern und vor allem Effizienzsteigerungen sicherzustellen.
Wie unterstützt EQS Unternehmen dabei, ihre Compliance-Prozesse durch digitale Lösungen zu automatisieren? Gestartet haben wir im Bereich Whistleblowing. Ursprünglich haben wir Unternehmen dabei unterstützt, digitale Hinweisgebersysteme zu etablieren und umzusetzen. Seit 2017 sind wir in diesem Bereich stark gewachsen und können weltweit über zehntausend Kunden zählen, die unserem Hinweisgebersystem vertrauen. Wir haben aber gleich zu Beginn festgestellt, dass Unternehmen weitaus mehr Herausforderungen haben als nur das Thema Whistleblowing bzw. Hinweisgebersysteme. Compliance-Management-Systeme in den Unternehmen sind zum Teil noch sehr analog und ineffizient aufgestellt, was zu hohen Risikos führen kann mit immer mehr Gesetzen und Regularien, die man im Überblick behalten muss. Deshalb haben wir eine Plattform entwickelt – das EQS Compliance
Steckbrief
EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt berichten. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern welt weit rund 550 Mitarbeitende. Der Standort Schweiz mit rund 20 Mit arbeitenden befindet im Herzen der Stadt Zürich.
Zur Person Sascha Meier verantwortet den Schweizer und österreichischen Standort des Technologieanbieters

EQS Group. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Digitalisierung von Compliance-Prozessen und unterstützt in seiner Funktion Organisationen täglich bei der Einführung und Optimierung von Compliance-Management-Systemen. Zudem verfügt er über einen CAS-Abschluss in Compliance-Management. In seinen vorherigen Positionen war er für die EQS Group in München sowie Dubai tätig.
Mehr Informationen unter eqs.com

Sascha Meier Country Manager Switzerland
«Grosse Herausforderungen werden vor allem Unternehmen haben, die heute noch sehr analog bzw. manuell arbeiten und nicht wirklich auf die Digitalisierung setzen.»
COCKPIT – welches alle Elemente eines Compliance-Programms digital bündelt. Seit 2024 können wir zudem auch für das Thema Datenschutz-Compliance und Nachhaltigkeit Lösungen anbieten. Durch nahtlos integrierte Plattformen können wir Synergien erzeugen und z.B. das Thema Reporting und Analyse deutlich verbessern.
Wie arbeiten cloudbasierte Plattformen, wie das EQS COCKPIT, um Rechts- und Compliance-Abteilungen
zu unterstützen? Muss eine Software installiert werden? Gibt es Updates, die man dann immer einspielen muss? Alle unsere Plattformen sind cloudbasiert, also «Software as a Service». Das heisst, die Plattform wird auf Hochsicherheitsservern der EQS Group gehostet. Zugriff auf die Plattform hat man über einen Webbrowser bzw. eine Webseite. Es muss nichts installiert werden und der Benutzer verwendet ohne Aufwand immer die aktuellste Version. Und ganz wichtig: Die Plattform ersetzt
keine Compliance-Fachleute, sondern unterstützt dabei, Prozesse zu vereinfachen und zu digitalisieren, damit sich die Compliance- und Rechtsabteilungen auf die wichtigen Themen fokussieren können. Die Plattform kann auch an Schnittstellen innerhalb des Unternehmens angebunden, wie zum Beispiel Mitarbeiterdatenbanken. So kann ein Unternehmen das gesamte Thema Policy Management digitalisieren und automatisiert neue Richtlinien an Mitarbeitende versenden.
Sie stellen auch sicher, dass Ihre Compliance-Software den höchsten Standards für Datenschutz und ITSicherheit entspricht?
Als RegTech-Unternehmen für Softwareprodukte in den Bereichen Compliance und Investor Relations hat ITSicherheit bei der EQS Group höchste Priorität. Daher erfüllt selbstverständlich auch unsere Compliance-Plattform höchste Anforderungen an IT-Sicherheit und an den Datenschutz. Unsere nach ISO 27001-zertifizierte Plattform nutzt hochmoderne Verschlüsselungstechnologien auf Militärniveau und strikte Datenschutzkontrollen, um z.B. eingehenden Meldungen von Hinweisgebern zu schützen. Es werden weder IP-Adressen noch Standort- oder Geräteinformationen gespeichert. Ob Hinweise auf Korruption oder Probleme am Arbeitsplatz – Hinweisgeber können sich vertrauensvoll und ohne Angst vor Repressalien äussern. Zudem ist auch unser Standort in Zürich ISO 27001 zertifiziert und setzt auf ein detailliertes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS).
Welche Entwicklungen und Herausforderungen sehen Sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren für den Compliance-Bereich?
Ich denke, grosse Herausforderungen werden vor allem Unternehmen haben, die heute noch sehr analog bzw. manuell arbeiten und nicht wirklich auf die Digitalisierung setzen oder sich nicht auf die Unterstützung von technischen Lösungen einlassen. Auch betreffend dem Thema Künstlicher Intelligenz sollte jeder offen sein. KI wird Compliance-Fachleute nicht ersetzen. Jedoch bin ich der Meinung, dass Künstliche Intelligenz die Compliance-Fachleute
ersetzen wird, die nicht auf KI setzen bzw. offen sind für das Thema. Die EQS Group ist ein grosser Fan von Künstlicher Intelligenz und deren Integration in unsere Lösungen. Der Einsatz der KI-Funktionen ist natürlich freiwillig und muss nicht genutzt werden. Um ein konkretes Beispiel für die Vorteile zu nennen: Wir werden KI im Bereich Whistleblowing nutzen, um den Fallbearbeitern die Möglichkeit zu geben, durch KI den Kontext zu suchen. Sprich, wenn ich eine Meldung bekomme, kann ich auf «Kontext» klicken und dann screent das System alle vergangenen Fälle und bietet dem Bearbeiter Informationen, ob vergleichbare Fälle irgendwo in diesem Unternehmen schon mal passiert sind und zeigt auch an, ob und wenn ein Unternehmen dort beinhaltet ist oder es zum Beispiel Meldungen in den Medien dazu gibt. Wir unterstützen also Fallbearbeitende in ihrer Arbeit mit zusätzlichen Informationen. Das ist nur ein Beispiel, wie wir KI nutzen, um Compliance-Prozesse zu optimieren.
Müssen Mitarbeitende in Unternehmen dann noch besser in den ComplianceBereich und die entsprechenden Richtlinien eingebunden werden? Ja, das ist einer meiner Lieblingspunkte, den ich mit Unternehmen bespreche. Aus meiner Sicht wird Compliance nur erfolgreich sein, wenn Compliance auch entsprechend innerhalb des Unternehmens involviert, etabliert und akzeptiert ist. Das ist, wenn wir mit vielen unserer Kunden sprechen, eine der meistgenannten Herausforderungen, die nicht einfach zu lösen ist und die proaktive Unterstützung des Managements braucht. Gegenüber den Mitarbeitenden muss es das Ziel sein, alles rund um Compliance so simpel und einfach wie möglich zur Verfügung zu stellen. Wir haben unsere Plattform nicht nur für die Compliance-Fachleute gebaut, sondern auch für die Mitarbeitenden. Die Plattform für Mitarbeitende nennt sich bei uns Integrity Hub. Das ist die zentrale Anlaufstelle, wo Mitarbeitende z.B. sämtliche Richtlinien finden, Interessenskonflikte melden können oder Infos zu Geschäftspartnern hinterlegen – alles gebündelt an einem Ort und verknüpft mit dem Compliance COCKPIT.
Regulatorische Agilität

« Agil Unterwegs –Wie Rechts und Compliance Abteilungen neue Wege durch ungewisse Zeiten beschreiten»
Die Rolle vom General Counsel und Compliance Manager verändert sich grundlegend: Wo früher juristische oder regulatorische Beratung genügte, sind heute strategische Weitsicht, technologische Affinität und operative Flexibilität gefragt.
Die Rolle vom General Counsel und Compliance Manager verändert sich grundlegend: Wo früher juristische oder regulatorische Beratung genügte, sind heute strategische Weitsicht, technologische Affinität und operative Flexibilität gefragt. Regulatorische Anforderungen steigen in nahezu allen Rechtsgebieten: von ESG bis KI, von Datenschutz bis Lieferkettenrecht. Gleichzeitig belasten geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Volatilität die Planbarkeit unternehmerischer Entscheidungen. Alternative Rechtsdienstleister wie Interim Legal bieten in diesem Spannungsfeld eine skalierbare, sofort einsetzbare Lösung: Sie helfen Rechts- und Compliance-Abteilungen, temporäre Kapazitäten zu schaffen, Expertise punktgenau einzubinden und in volatilen Zeiten handlungsfähig zu bleiben.
Konstanter Wandel ist die Herausforderung von heute Rechtsabteilungen befinden sich im konstanten Wandel. Laut einer Studie vom Association of Corporate Counsel, einer internationalen Vereinigung von
Inhouse-Juristen, ist die Ungewissheit über Regulatorische Entwicklungen für Europäische General Counsel ihre grösste Herausforderung. Neue EU-Verordnungen, ESGStandards, KI-Regulierungen und Cybersicherheitsvorgaben kommen mit hoher Geschwindigkeit auf Unternehmen zu. General Counsel und Compliance Manager sind gefordert, unter hohem Zeitdruck komplexe Sachverhalte zu beurteilen und regulatorische Risiken zu steuern und zu bewältigen.
Diese steigende Komplexität trifft auf ein wirtschaftliches Umfeld, das von Unsicherheit geprägt ist: Erschwerter internationaler Handel, ungewisse ökonomische Zustände und geopolitische Instabilität. Die Folge: Personalbudgets werden eingefroren, Projekte auf Eis gelegt. Jedoch steigt gleichzeitig die Notwendigkeit, Rechtsrisiken schnell und präzise zu beurteilen.
Interim Legal: Agilität bei internen Compliance- und Rechtsteams
In dieser Lage bietet Interim Legal eine effektive Antwort. Sie ermöglichen es Rechts- und Compliance-Abteilungen,
ihre Teams gezielt zu verstärken – ohne langfristige Personalverpflichtungen und bei voller Kostenkontrolle. Durch ihr Netzwerk von Rechts- und Compliance-Spezialisten bringt Interim Legal sofort einsetzbares Knowhow in Schlüsselthemen wie regulatorische Anforderungen, Datenschutz, Vertragsrecht, Corporate Governance oder Compliance. Gerade bei regulatorischen Projekten, Kapazitätsengpässen, internen Untersuchungen oder transnationalen Transaktionen bietet Interim Legal operative Entlastung und inhaltliche Tiefe.
Auch die Transformation der Rechtsabteilung, etwa durch die Einführung von Legal Operations oder
KI-Initiativen, lässt sich durch Interim-Spezialisten beschleunigen, ohne bestehende Strukturen zu überfordern. Interim Legal funktioniert hier wie ein externer Verstärker: Es bringt in Zeiten des Wandels Know-how ins Unternehmen und agiert als Partner für einen General Counsel oder Compliance Manager.
Recht als agiler Business Partner Moderne Rechtsabteilungen sind heute mehr als Kostenstellen, sie sind ein wichtiger Teil der unternehmerischen Wertschöpfungskette. Das gelingt nur, wenn sie flexibel auf Veränderungen reagieren können. Interim Legal ist hierbei nicht nur eine temporäre
Interim Legal ist ein alternativer Rechtsdienstleister in der Schweiz, der Rechtsabteilungen dabei unterstützt, ihre Arbeitsmodelle zu modernisieren und dabei den menschlichen Aspekt in den Vordergrund zu stellen.
Gegründet in Zürich im Jahr 2020, arbeitet Interim Legal mit internen Rechtsabteilungen in Bereichen wie Bankenwesen, Technologie und Life Sciences zusammen. Die Kunden reichen von Unternehmen mit einem Umsatz von unter 25 Millionen CHF bis hin zu multinationalen Konzernen mit über 50 Milliarden CHF sowie gemeinnützigen Organisationen.
Seit der Gründung hat Interim Legal mehr als 180 Projekte für interne Rechts- und Compliance-Teams erfolgreich umgesetzt, wobei über 50 % dieser Projekte grenzüberschreitende oder komplexe rechtliche Fragestellungen beinhalteten. Der Talentpool umfasst mehr als 1.500 erfahrene Rechts- und Compliance-Spezialisten mit Expertise in Unternehmen sowie in Anwaltskanzleien.
Mehr Informationen interimlegal.ch

Ressource, sondern Teil einer strategischen Personal- und Risikosteuerung. In Phasen regulatorischen Umbruchs kann externe Verstärkung auch helfen, neues Know-how im Unternehmen zu implementieren und eine erfolgreiche Umsetzung der regulatorischen Anforderungen herbeizuführen.
Eine bewährte Methode in unsicheren Zeiten Interim Legal wirkt stabilisierend gerade in unsicheren ökonomischen Zeiten, bei fehlendem Personal oder wenn kurzfristig Spezialwissen gebraucht wird. Ob durch Secondments, Projektmandate oder Beratung in hybriden Strukturen: Unternehmen erhalten punktgenaue Unterstützung bei maximaler Flexibilität. Besonders in der Schweiz, wo regulatorische Anforderungen aus dem internationalen und nationalen Schweizer Umfeld gleichzeitigen Einfluss auf die Unternehmensstrategie und die Entscheidungen haben, hat diese Flexibilität einen absichernden Effekt und stärkt die unternehmerische Resilienz.
Fazit: Zukunft sichern durch Flexibilität Angemessenes Risk Management in Compliance und Recht steht unter einem konstanten Wandel. Wer als General Counsel oder Compliance Manager als strategischer Partner führen möchte, muss nicht nur tiefe juristische oder regulatorische Kenntnisse besitzen, sondern auch mit begrenzten Ressourcen strategisch agieren. Alternative Rechtsdienstleister wie Interim Legal bieten hier ein entscheidendes Werkzeug: Sie schaffen Freiräume, senken Risiken und ermöglichen es, auch unter Druck zukunftsorientiert zu handeln.
Sebastian Fanai-Danesh Co-Founder & Managing Director
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Wer vor 10 Jahren an einer Anwaltstagung über Legal Tech sprach, erntete noch höfliche Skepsis. Heute zirkuliert in nahezu jeder Schweizer Kanzlei ein Memo, das die Einführung von KI-gestützten DokumentenmanagementSystemen plant. Was einst visionär klang, ist heute bereits Alltag geworden. Viele Juristinnen und Juristen haben in den vergangenen drei Jahren mit Tools wie ChatGPT erste Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz gesammelt. Das hat dazu geführt, dass Legal Tech nicht länger als Spielwiese für IT-Verantwortliche wahrgenommen wird, sondern als strategisches Thema für Kanzleien und Rechtsabteilungen. Dank der breiten Bekanntheit von KI-Tools ist der Einsatz von Technologie im Rechtsbereich kein Top-Down-Thema mehr, sondern zunehmend eine Bottom-upBewegung. Wer privat schon einen KIChatbot nutzt, tut sich auch beruflich leichter mit technologischen Lösungen – wie Anisja Porschke vom deutschen AI Legal Club treffend bemerkt hat.
Eine junge, aber wachsende Legal Tech-Landschaft in der Schweiz Trotz des kleinen Marktes haben sich in der Schweiz bereits einige Legal TechUnternehmen etabliert. Ein Beispiel ist das ETH-Spin-off DeepJudge, dessen KI-basierte Such- und Wissensplattform es erlaubt, interne Kanzlei- und Abteilungsdokumente effizient zu durchsuchen. Die Wirtschaftskanzlei Homburger berichtet, damit «Millionen interner Dokumente intuitiv mit natürlicher Sprache durchsuchbar» gemacht zu haben – durchaus ein Beleg für die Praxisreife solcher Technologien.
Exemplarisch lässt sich auch das Legal Tech-Unternehmen Legartis aufführen. Es bietet eine Lösung zur automatisierten juristischen Prüfung von Dokumenten. Ob NDAs, Auftragsverarbeitungsverträge oder Software-Lizenzen – Legartis analysiert und bewertet solche Dokumente unter Anwendung von sogenannten Playbooks in wenigen Minuten. Zielgruppen sind nicht nur Rechtsabteilungen, sondern auch Vertriebs- und Einkaufsteams. Parallel dazu professionalisieren Kanzleien und Unternehmen ihre Strukturen, stellen Legal Tech Spezialisten und Legal Engineers ein und entwickeln eigene Legal Tech-Roadmaps, um das Thema strategisch voranzutreiben.
Vom Hype zum handfesten Mehrwert
Die These, dass Legal Tech ein Buzzword sei, ist 2025 sicherlich überholt. Laut dem Chief Legal Officer Strategy Survey von Deloitte gehen 93 % der CLOs davon aus, dass generative KI in den nächsten zwölf Monaten Mehrwert für ihre Organisation schaffen kann. 85 % erwarten eine Zunahme des Einsatzes von Technologie-Tools. Beispiele aus der Praxis belegen zudem die betriebswirtschaftliche Relevanz: So berichtet Arvato Supply Chain Solutions, dass sich durch den Einsatz von Legartis die Prüfzeit für Data Processing Agreements von 45 bis 60 Minuten auf rund zehn Minuten reduziert hat. Gleichzeitig sank die Fehlerquote bei

Legal Tech –Von der Randnotiz zum Rückgrat
Querverweisen auf unter ein Prozent. Solche Zahlen sind natürlich immer mit etwas Vorsicht zu geniessen, zeigen aber auf, wohin die Reise geht. Mandantenerwartungen sind ebenfalls ein Treiber für Legal Tech: Viele Kundinnen und Kunden erwarten, dass ihre Kanzlei moderne Technologien nutzt – nicht zuletzt, um effizient und kostentransparent zu arbeiten. Digitale Reife ist zu einem entscheidenden Auswahlkriterium geworden: Wer keine automatisierte Due-Diligence-Lösung vorweisen kann, wird frühzeitig aussortiert.
Justitia 4.0: Digitalisierung der Schweizer Justiz
Auch die Schweizer Justiz steht an einem Wendepunkt. Mit dem Projekt Justitia 4.0 wird mit «justitia.swiss» eine zentrale, sichere Plattform aufgebaut, über die künftig alle Verfahrensschritte in Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichtsverfahren elektronisch abgewickelt werden sollen. Die Plattform ermöglicht elektronische Eingaben, Akteneinsicht und Kommunikation zwischen Gerichten, Staatsanwaltschaften,
«Als Trusted AI Counsel können Sie technologische, rechtliche und ethische Aspekte von KI-Einsatz zusammenführen und Ihre Position im Markt neu definieren.»

Justizvollzugsbehörden, Anwältinnen und Anwälten sowie weiteren Verfahrensbeteiligten. Das Projekt verfolgt klare Zielsetzungen: Die Kommunikation soll vereinheitlicht, Papieraufwand reduziert und die Verfahrensdauer verkürzt werden.
Zur effizienten Verwaltung der elektronischen Akten wird zudem eine eJustizakte-Applikation entwickelt, die die Bearbeitung und Übermittlung der digitalen Akteninhalte erleichtert. Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) wird der elektronische Rechtsverkehr für Justizbehörden und die Anwaltschaft schliesslich verpflichtend. Ein wichtiger Schritt für die digitale Transformation der Justiz.
Mehr als Effizienz: KI-Agenten, neue Rollen und servicezentrierte Architekturen
Die gegenwärtige Entwicklung erschöpft sich jedoch nicht in Prozessoptimierung und Effizienzgewinn. Sie ebnet auch den Weg für strukturelle Veränderungen im Rechtsmarkt. Es entsteht ein neuer Kompetenzbereich für Kanzleien: Als Trusted AI Counsel können Sie technologische, rechtliche
und ethische Aspekte von KI-Einsatz zusammenführen und Ihre Position im Markt neu definieren. Die vermehrte Nutzung von KI-Agenten, die über den klassischen Rahmen von Auskunftsoder Textgenerierung hinausgehen und eigenständig Entscheidungen treffen können, erhöht den Bedarf nach einem Trusted AI Counsel nur noch mehr. Langfristig wird sich der Rechtsmarkt entlang neuer Wertschöpfungsketten organisieren. Rechtsberatung wird vermehrt in cloudbasierte Plattformen migrieren. Vergütungsmodelle orientieren sich zunehmend am tatsächlichen Mehrwert – nicht an der eingesetzten Zeit. Gleichzeitig eröffnen KI-gestützte Systeme den Zugang zu Basisberatungen für breitere Bevölkerungsschichten. Die Fähigkeit, Daten strukturiert zu nutzen und intelligente Systeme kontinuierlich zu verbessern, wird dabei zum strategischen Vorteil. Kanzleien ohne digitale Agenda riskieren, den Anschluss zu verlieren – nicht aus Mangel an juristischer Kompetenz, sondern aufgrund fehlender technologischer Skalierbarkeit.
Ein Blick nach vorn: Rechtsdienstleistungen im Jahr 2035 Stellen wir uns vor, es ist das Jahr 2035. Ein mittelständisches Unternehmen in Lausanne benötigt innerhalb weniger Stunden eine rechtssichere Vertriebsvereinbarung für Singapur. Der CEO lädt auf der Website eines Rechtsdienstleisters die relevanten Unterlagen hoch, definiert die wesentlichen Parameter – und erhält einen passenden Vertrag, der auch noch steuerrechtlich und regulatorisch geprüft ist. Im Hintergrund
orchestrieren spezialisierte KI-Agenten die Erstellung, klären die optimale steuerliche Strukturierung, ermitteln die regulatorischen Anforderungen und bewerten die rechtlichen, finanziellen oder operationellen Risiken. Juristinnen und Juristen begleiten diese Prozesse nicht mehr primär durch manuelle Prüfung, sondern durch ModellAudits, Trainingsdatenauswahl und Systemmonitoring. Der Rechtsmarkt ist also nicht verschwunden – er hat sich transformiert. Klassische Kanzleien sind zu hybriden Plattformdienstleistern geworden. Damit diese Entwicklung gelingt, müssen Juristinnen und Juristen ihr Know-how im Hinblick auf Technologien deutlich erhöhen. Darüber hinaus braucht es aber auch klare Leitplanken: Datenschutz, Fairness und Erklärbarkeit. Der Rechtsstaat wird dabei nicht zum Innovationshindernis, sondern zum verlässlichen Rahmen, in dem technologischer Fortschritt verantwortungsvoll gestaltet werden kann. Entscheidend für den Erfolg juristischer KI-Systeme sind künftig drei Faktoren: die Qualität der Datenstrategie – wie strukturiert, aktuell und vertrauenswürdig juristische Informationen verarbeitet und gepflegt werden; die Fähigkeit zur Systemintegration – also wie gut KI-Agenten mit bestehenden Tools, Datenbanken und Prozessen interagieren können; und die kontinuierliche modellbasierte Qualitätskontrolle – insbesondere bei Aufgaben, die rechtliche Tragweite entfalten. Wer das verinnerlicht, gestaltet nicht nur juristische Dienstleistungen neu, sondern den Rechtsmarkt der Zukunft aktiv mit.
Ioannis Martinis Head of Innovation & Legal Tech, Coop Rechtsschutz AG
© André Volk
«Das KI-Tool, das die juristische Arbeit nachhaltig verändern könnte»
KI kommt in die Kanzleien und Rechtsabteilungen.
Bestes Beispiel: die erfolgreiche KI-Plattform Ominilex eines jungen, ehemaligen ETH-Teams.
Ismael Seck, Co-Founder und COO, erläutert die Hintergründe des Schweizer KI-Tools, das seit 2024 bereits in über 100‘000 Rechtsfällen angewendet wurde.
Herr Seck, was war Ihre Motivation, als Sie vor zwei Jahren, zusammen mit Marco Henri, Ari Jordan und Etienne Salimbeni, Omnilex gegründet haben? In jedem Startup-Gründerhandbuch hiess es klar: «Entwickelt niemals für Anwälte, sie kaufen keine Software.» Genau das wollten wir testen. Wir sind vier Tech-Gründer aus ETH- und EPFL-Kreisen, keine Juristen, und glaubten trotzdem, dass moderne KI die grössten Reibungsverluste der Branche beseitigen kann. Als wir erste Prototypen zeigten, war die Resonanz überwältigend. Kanzleien und Rechtsdienste suchten händeringend nach einem Werkzeug, das Rechtsquellen sauber erschliesst und Antworten in Fachanwaltsqualität liefert. So entstand Omnilex.
Das heisst: Sie wollten vor allem die qualifizierte Recherche beschleunigen?
Unsere erste Version verkürzte zunächst nur die Suche. Heute beantwortet Omnilex komplexe Rechtsfragen auf Fachanwaltsniveau, zieht Kanzleiinternes Wissen heran, verfügt über eine kuratierte Prompt-Bibliothek und ordnet grosse Mandate mit einem Case-Logik-Layer. Das Ergebnis fühlt sich gemäss unseren Kunden an wie ein sofort verfügbares Spezialistinnen-Team für jedes Rechtsgebiet.
Warum ist Omnilex mehr als ein weiteres KI-Tool?
LLMs liefern auf jede Rechtsfrage eine Antwort, aber ohne Kontrolle auch Fehlinformationen. Bereits 2023 im bekannten «Avianca-Case» wurde deutlich, wie gravierend KI-Halluzinationen sein können, als ein Anwalt mehrere erfundene Gerichtsentscheidungen in einem Schriftsatz einreichte, die ihm von ChatGPT geliefert worden waren. Gemeinsam in einem Forschungsprojekt mit der ETH Zürich und dem Bundesgericht zeigten wir kürzlich, dass gängige Modelle bei kleinen Jurisdiktionen wie der Schweiz versagen. Omnilex setzt deshalb auf ein domänenspezifisches Multiagenten-System mit bis zu 40 spezialisierten Schritten. Jede Einheit prüft streng nach dem Regelwerk der Sachverhaltsanalyse, Subsumtion, Normenhierarchie, Abwägung und weiterem. Antworten erscheinen erst, wenn sie auf Basis von Gesetzestexten, Gerichtsentscheiden oder Fachliteratur belastbar sind. Das Resultat sind Antworten auf Rechtsfragen, denen unsere Kunden so vertrauen oder die sie gar direkt an Klienten senden können.

Aus welchen Quellen speist sich Omnilex?
Omnilex deckt genau das Spektrum ab, das ein Anwalt nutzen würde, hätte er unbegrenzt Zeit. Dazu gehören: sämtliche Gesetzestexte auf Bundes- und Kantonsebene, alle Gerichtsentscheide auf Bundes- und Kantonsebene, vertrauenswürdige Webseiten, ein Teil der juristischen Fachliteratur sowie kanzleiinterne Daten – darunter frühere ähnliche Fälle, wertvolle Vorlagen, spezifisches Know-how und mehr.
Statt auf simple Stichwortsuche oder generative Sprachmodelle zu setzen, arbeitet Omnilex mit dem bereits erwähnten Multiagenten-System, das juristische Arbeitsprozesse nachbildet. Wir sind überzeugt, dass wertvolles Legal Tech nicht im «Kellerlabor» von Ingenieur:innen entsteht, sondern Seite an Seite mit der Fachexpertise. Darum haben wir von Anfang an eng mit Kanzleien und Rechtsdiensten zusammengearbeitet und Omnilex so gebaut, dass es schlicht das tut, was ein Anwalt in einer gründlichen Recherche selbst leisten würde: Ein KI-Agent zieht die Fakten heraus, ein anderer ordnet die einschlägigen Normen, weitere prüfen Präjudizien, wägen Risiken und verknüpfen alles sauber – und bis zu 40 Schritten, die bei einer Recherche gemacht werden. Dabei hat jede Instanz immer auf die nötigen Rechtsquellen Zugriff und jede Aussage stützt sich auf eine valide Rechtsquelle.
Wie verändert sich durch Ihr Tool die juristische Arbeitsweise?
Wir erleben jeden Tag, wie sich die
Omnilex
Steckbrief
Omnilex ist eine spezialisierte KI-Plattform für Kanzleien und Rechtsabteilungen. Sie unterstützt Jurist:innen bei komplexen Rechtsabklärungen und liefert präzise Antworten – fundiert, nachvollziehbar und auf Basis vertrauenswürdiger Quellen wie Gesetzestexten, Bundesgerichtsentscheiden und internen Daten der Organisation.
Mehr Informationen unter omnilex.ai

Arbeit in den Kanzleien verschiebt: Wo früher eine Associate drei Stunden lang Entscheidungen recherchierte, stellt sie heute in fünf Minuten einige Anfragen an Omnilex. Die übrige Zeit nutzt das Team, um Strategien zu entwerfen, Szenarien mit Mandanten durchzuspielen oder neue Geschäftsmodelle anzudenken. Partner müssen weniger delegieren und Nachwuchsjurist:innen melden, sie steigen dank der strukturierten Omnilex-Feedbacks doppelt so schnell in die Materie ein. Gleichzeitig spüren wir, dass Mandanten immer weniger bereit sind, für reine Recherche zu zahlen – sie verhandeln härter, weil sie wissen, dass andere Kanzleien dieselbe Aufgabe inzwischen wesentlich effizienter erledigen. Viele dieser Recherche-Stunden waren ohnehin nicht abrechenbar; jetzt entfallen sie komplett, ohne dass Qualität verloren geht. Kanzleien gewinnen so
Wettbewerbsfähigkeit, und wir werden als zuverlässiger Partner für diesen Effizienzsprung wahrgenommen – das zeigt sich daran, dass mehrere Kundenorganisationen uns in ihre Innovationsbeiräte geholt haben.
Omnilex wird vollständig in der Schweiz gehostet. Sie können auch sensible Klientendaten verarbeiten?
Ja, wir können sensible Klientendaten sicher verarbeiten. Omnilex läuft ausschliesslich in Schweizer MicrosoftAzure-Rechenzentren – in unseren Augen nachweislich der Gold-Standard für Cloud-Hosting hierzulande. Die Daten verlassen das Land nicht, und wir trainieren unsere Modelle selbstverständlich nie auf Kundendaten. Für die Übertragung setzen wir auf die besten Verschlüsselungen und technischen Standards. Mehrere Grossorganisationen haben unsere Plattform bereits gründlich geprüft und uns jedes Mal ohne Beanstandung freigegeben – ein klares Zeichen, dass unser Sicherheitskonzept auch höchsten Anforderungen standhält.
Omnilex wird bereits von zahlreichen Kanzleien und Rechtsdiensten genutzt. Was haben Sie noch vor?
Ja, wir nutzen die heutige Verbreitung vor allem als Sprungbrett für den nächsten Entwicklungsschritt. Die Antwortqualität bleibt unser Dauerprojekt. Dabei verstehen wir Omnilex produkttechnisch als Boot, die zugrunde liegenden KI-Modelle sind sein Spiegel – je besser die Modelle über die Zeit werden, desto stärker wird Omnilex als Produkt. Parallel bereiten wir die Expansion in europäische Rechtssysteme vor und arbeiten dafür mit Kanzleien zusammen, die den Wandel aktiv vorantreiben – ihr Praxis-Feedback zeigt uns täglich, wo wir den grössten Mehrwert schaffen. Wachstumskapital steht dafür reichlich bereit; tatsächlich übersteigt das Investoreninteresse aktuell unseren Bedarf, sodass unsere Aufgabe darin besteht, die strategisch passendsten Partner auszuwählen. Dieser finanzielle Rückhalt ermöglicht uns, die nächsten Schritte zügig umzusetzen, ohne den Fokus zu verlieren. Unser Ansatz bleibt der des schnellen Zweitplatzierten: Wir lernen aus Erfolgen und Fehlern der Pionier-Modelle, investieren nicht in Modelltraining, sondern liefern die agilste, kundennächste Anwendungsschicht. So bleibt Omnilex auch künftig einen Schritt voraus.
Fotocredit
Ismael Seck Co-Founder und COO

Gemeinsam für nachhaltige Investitionen. Jetzt aktiv werden: greenpeace.ch/dreampeace
