BIOLOGIE FÜR ALLE
3. KLASSE





Drechsler, Grössing, Hellerschmidt, bearbeitet von Reich







Drechsler, Grössing, Hellerschmidt, bearbeitet von Reich

Margit Drexler, Helga Grössing, Brigitta Hellerschmidt, bearbeitet von Alexander Reich

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!
Dieses Buch ist laut Bescheid des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 7. Februar 2025 (GZ: 2024-0.332.548) gemäß § 14 Abs. 2 und 5 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unterrichtsgebrauch für die 3. Klasse an Mittelschulen und für die 3. Klasse an allgemein bildenden höheren Schulen – Unterstufe im Unterrichtsgegenstand Biologie und Umweltbildung (Lehrplan 2023) geeignet erklärt.

Deine Übungs-App: Auf eSquirrel findest du zu jedem Kapitel viele Übungen.
Umschlagbilder: istockphotoscom: Евгений Харитонов, LFPuntel, Orla, Sakorn Sukkasemsakorn, sankalpmaya
Schulbuchnummer: 221.182 © Olympe Verlag GmbH, Oberwaltersdorf, 2025
Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigungen jeder Art gesetzlich verboten 10. Auflage (2025)
Lektorat: Marion Ramell, BA Umschlaggestaltung, Satz, Layout: Raoul Krischanitz, Wien, transmitterdesign.com Grafik: Raoul Krischanitz, transmitterdesign.com Druck, Bindung: Druckerei Berger, Horn Bildrechte: © Bildrecht/Wien, 2025 ISBN: 978-3-903328-99-0
1. Entstehung der Erde

2. Aufbau der Erde
UNTERSUCHUNG: Plattentektonik
UNTERSUCHUNG: Vorgänge an Plattengrenzen
Quellen bewerten
3. Fossilien
4. Einteilung der Erdgeschichte
5. Erdurzeit – Das Präkambrium
6. Erdaltertum – Das Paläozoikum
7. Erdmittelalter – Das Mesozoikum
8. Erdneuzeit – Das Känozoikum
9. Entwicklung der Wirbeltiere
10. Entwicklung des Menschen
11. Kladistik – Verwandtschaft darstellen


Gesteinsarten und Kreislauf der Gesteine
ÖKOSYSTEM BODEN
1. Boden – Grundlage des Lebens 61
2. Lebewesen des Bodens 65
3. Böden und ihre Vielfalt 71
4. Gefahren für den Boden 73
WIE EIN BIOLOGE
ATMUNG
1. Atmen – Warum? 79
2. Atmung der Insekten 80
3. Lungen – Evolution von Effizienz 83 4. Kiemen 90 WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE


1. Multitalent Blut 97
2. Der Blutkreislauf 104
WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 111 KOMPETENZ-CHECK 112
1. Blutkreislauf als Teil des Ganzen 113
2. Erkrankungen des Kreislaufs 116
PROJEKT: Lebensstilcheck 118
WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 123 KOMPETENZ-CHECK 124
1. Das Meer – weltweiter Lebensraum 125

2. Grundlage des Nahrungsnetzes im Meer 129
3. Offenes Meer – Anpassungen ans Wasser 131
UNTERSUCHUNG: Auftrieb in Wasser 135
4. Offenes Meer – Lebensweisen 141
5. Meeressäuger und Tieftaucher 149
6. Schelfmeere 153
7. Tropische Korallenriffe 162
8. Polarmeere und Tiefsee 166
PROJEKT: Steckbrief Eisbär 167
9. Der Mensch und das Meer 171
WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 174 KOMPETENZ-CHECK 175


1. Der Wasserkreislauf 176
2. Wasserläufe – Bach und Fluss 177
3. Tümpel, Weiher und See 183
4. Einfluss des Menschen auf Gewässer 186
WIE EINE BIOLOGIN, WIE EIN BIOLOGE 189 KOMPETENZ-CHECK 190
ANHANG Register 191
Damit du dein neues Buch besser kennenlernst, haben wir 8 Aufgaben für dich zusammengestellt. Nach ihrer Lösung wirst du dich bestens in deinem Buch zurechtfinden.
1. INHALTSVERZEICHNIS: Schlage das Inhaltsverzeichnis in deinem Buch auf! Welches Großkapitel und welches Unterkapitel interessieren dich am meisten? Schreibe sie auf!
Großkapitel:
Unterkapitel:


2. FLIEßTEXT: Auf den Textseiten erfährst du alles, was du zu den verschiedenen Themen wissen solltest. Gehe auf S. 131 und beschrifte mit Hilfe der Abb. 3 die Teile des Herings!
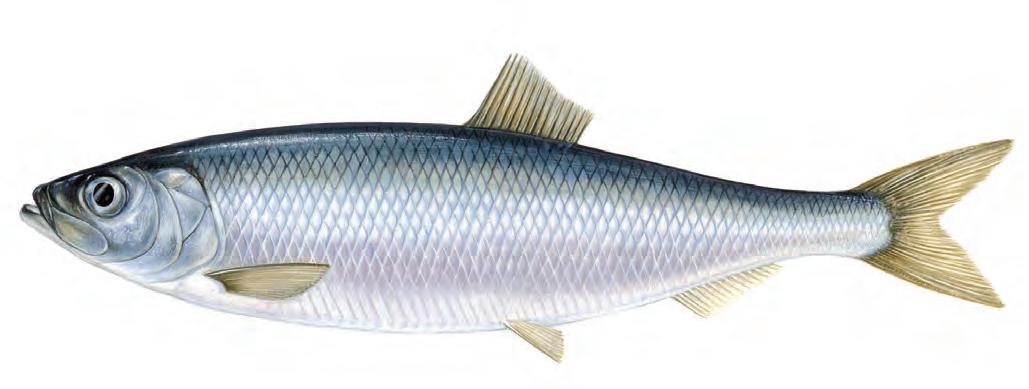
3. SEITENSPALTE: Dort findest du...
...ERKLÄRUNGEN für die im Fließtext orange markierten Wörter. Suche die Erklärung für „Ballonreifen“ im 3. Großkapitel und schreibe sie auf!
... AUFGABEN, die mit Symbolen für die unterschiedlichen Anforderungsbereiche gekennzeichnet sind.
Verwende was du an Wissen erlernt hast, um zu verstehen, zu erklären und Fragen zu beantworten.
Beobachte, untersuche, probiere aus, um dein Wissen zu vertiefen und zu erweitern.

Erinnere dich an die Bodenbildung! Weshalb sind Bakterien Pioniere, wenn es darum geht, Boden aufzubauen?
das ist zu tun
Begründe, weshalb lang anhaltende Trockenzeiten, …
Wie hängt das, was du gelernt hast mit deinem Leben, deinen Vorstellungen und Handlungen zusammen?
Lerne deine Gedanken auszudrücken und zu begründen.
Orientiere dich an den Farben und suche in den Seitenspalten für jeden Bereich nach einer Aufgabe! Notiere das Verb, das angibt was in der jeweiligen Aufgabe zu tun ist, in der zum Aufgabenbereich gehörenden Spalte!
Fachwissen erlernen und kommunizieren
Erkenntnisse gewinnen über Gelerntes nachdenken und Probleme lösen


4. INFORMATION: In den Seitenspalten findest du immer wieder Postits, die mit ihren zusätzlichen Informationen dein Wissen erweitern. Gib den Titel der Zusatzinformation auf S. 97 an!
5. FOTOS und ILLUSTRATIONEN: Im Buch gibt es auch viele Fotos und Illustrationen. Sie sind nummeriert (Abb. 1, Abb. 2...) und sehr oft beziehen sich Aufgaben in der Seitenspalte auf sie! Gehe auf S. 37 und schreibe die Bildlegende von Abbildung 4 hier auf!
6. AUFGABEN: Fast jedes Unterkapitel endet mit der oder den Seite(n) „Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“ . Hier kannst du dein Wissen und Können testen und die neu erworbenen Kompetenzen (gekennzeichnet durch die drei Farben) anwenden. Gehe auf S. 89 und schreibe auf, um welches Thema es bei Aufgabe 2 geht!
7. AUSPROBIEREN: Hier wirst du selbst aktiv! Du findest Anleitungen dazu sowohl in der Seitenspalte als auch als ganze Seiten mit Versuchen! Schreibe den Titel des Versuchs auf S. 135 auf!

8. PERSONEN- UND SACHREGISTER: Es hilft dir schnell, wichtige Inhalte mit alphabetisch geordneten Stichwörtern im Buch zu finden! Schreibe mit Hilfe des Registers auf, wo folgendes Wort im Buch zu finden ist!
Gabbro:








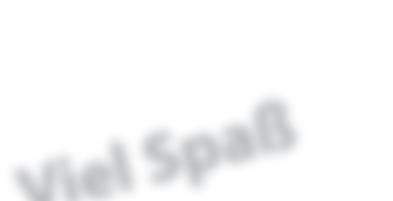







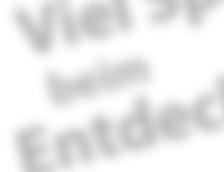
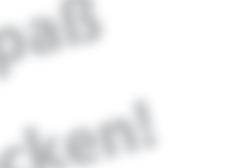



Die Wissenschaft vermutet, dass das Universum vor etwa 14 Milliarden Jahren in einer Art gigantischen Explosion entstanden ist, die Urknall genannt wird. Schwer vorstellbar dabei ist, dass beim Urknall auch Raum und Zeit mit entstanden. Mit dem Urknall entstand auch sämtliche Materie, die wir heute kennen.
Nach einer turbulenten ersten Phase bestand die Materie zu 75,5 % aus Wasserstoff – dem einfachsten Element – und zu 24,5 % aus Helium in Form von Gas. In manchen Regionen verdichtete sich das Gas zu riesigen Gaswolken.


Abb. 1: Eine Spiralgalaxie. Galaxien gibt es in unterschiedlichen Formen.
Universum, das: Weltall Materie, die: in der klassischen Physik alles, was Raum einnimmt und Masse hat. Wasserstoff, der: leichtestes Element und Gas Element, das: chemischer Grundstoff Helium, das: zweitleichtestes Element, ein Edelgas Kernreaktion, die: physikalischer Prozess, bei dem ein Atomkern durch Zusammenstoß mit Teilchen seinen Zustand oder seine Zusammensetzung ändert
Was ist die Schwerkraft? Als Gravitation oder Schwerkraft bezeichnet man die Eigenschaft von Massen, sich gegenseitig anzuziehen. Da die Erde sehr viel Masse hat, zieht sie andere Körper – wie zum Beispiel deinen eigenen – besonders stark an. Deshalb spürst du ein Gewicht, das dich in Richtung Erdmittelpunkt zieht.

In den Gaswolken war die Materie nicht gleichmäßig verteilt. Regionen mit mehr Materie zogen durch die Schwerkraft Gas aus der Umgebung an. Das Gas wurde an diesen Stellen immer dichter und heißer, bis Kernreaktionen starten konnten. Etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden so die ersten Sterne. Die Gaswolken enthielten genügend Materie, um Milliarden von Sternen zu formen, es entstanden die Galaxien. Unsere Milchstraße ist eine davon. In klaren Nächten kannst du die Milchstraße als helles Band am Nachthimmel erkennen. In den ersten, sehr massereichen und kurzlebigeren Sternen entstanden durch Kernreaktionen, genannt Kernfusion, schwerere Elemente. Diese Sterne explodierten schließlich und schleuderten den verbliebenen Wasserstoff und die im Inneren gebildeten Elemente ins Weltall. Es bildeten sich Gaswolken, die eine Vielzahl chemischer Elemente, Staub und auch organische Verbindungen enthielten. In diesen Gaswolken konnten neue, meist leichtere und langlebigere Sterne entstehen.


Abb. 2: Die Milchstraße von Australien aus gesehen. So schön erscheint sie nur, wenn es in der Umgebung sehr dunkel ist.
Einer dieser Sterne war unsere Sonne. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren zog sich eine Gaswolke durch die Gravitation zusammen. Sie begann zu rotieren und flachte zu einer Scheibe ab. Im Zentrum dieser Scheibe konzentrierte und verdichtete sich Gas. Temperatur und Druck stiegen, bis dort unsere Sonne entstand. In den umliegenden Bereichen der Scheibe bildeten sich die Planeten.
Abb. 3: Rotierende Scheibe aus Gas und Staub. Im Zentrum bildete sich die Sonne, Bereiche mit mehr Staub zogen sich zusammen und formten die Planeten.
Gib „Galaxie“ in eine Suchmaschine ein! Finde zwei Suchergebnisse, die folgende Fragen beantworten: Welche Formen von Galaxien gibt es? Von welcher Form ist die Milchstraße?
Geh in einer klaren Nacht nach draußen und schau, ob du die Milchstraße erkennen kannst! Die meisten Lichtpunkte, die du siehst, sind Sterne unserer Galaxie – nur sehr wenige sind andere Galaxien mit Milliarden von Sternen. Schätze, wie viele Sterne du insgesamt sehen kannst!
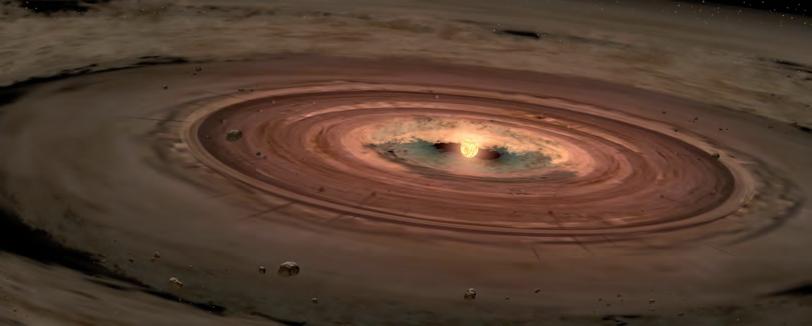
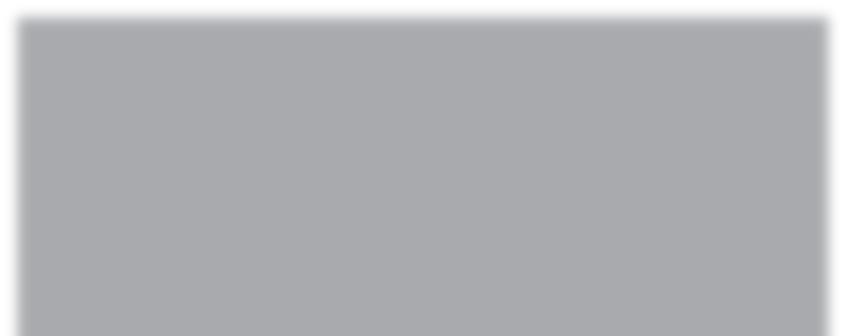
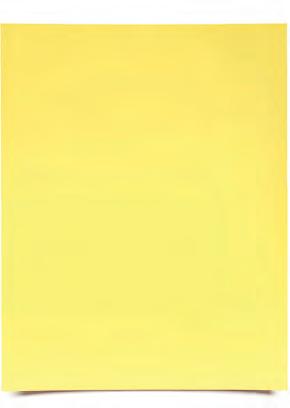

Wieso strahlt die Sonne? In der Sonne verschmelzen Wasserstoffkerne durch Kernfusion zu Helium. Dabei wird große Mengen Energie freigesetzt. Diese Energie gibt die Sonne in Form von Strahlung ab – ein Teil davon erreicht die Erde. Das Sonnenlicht ermöglicht die Fotosynthese und steht damit am Anfang der Nahrungskette. Ohne diese Energiequelle wäre Leben auf der Erde nicht möglich.
Galaxie, die: Ansammlung vieler Sternen, Staub- und Gaswolken Planetensystemen, und dunkler Materie.
rotieren: sich um sich selbst drehen †
Recherchiere im Internet die tatsächlichen Größen der Planeten und der Sonne! Zeichne eine maßstabsgetreue Abbildung der Planeten! Versuche auch die Sonne maßstäblich darzustellen! Was fällt dir im Vergleich zur Abb. 4 auf?
Wiederhole dies mit den Abständen der Planeten zur Sonne!
Wiederhole was du in der 2. Klasse zu Modellen gelernt hast! Betrachte deine Ergebnisse der vorherigen Aufgabe. Erörtere damit Vor- und Nachteile der Darstellung in Abb. 4!


Was sind Asteroiden?
Asteroiden nennt man Objekte von einigen Metern bis 1000 km Größe, die sich um die Sonne bewegen. Während der Entstehung der Planeten schwirrten viele davon im Sonnensystem umher. Sie kollidierten mit den Protoplaneten, erhöhten deren Masse und gestalteten die Oberfläche um. Spätere Einschläge auf Planten mit erstarrter Kruste hinterließen große Krater, die man heute noch sehen kann.

Protoplanet, der: Vorläufer eines Planeten, bzw. das Entwicklungsstadium eines Planeten, bei dem sich die Masse erst langsam verdichtet.
Lava, die: an die Erdoberfläche getretenes Magma.
Magma, das: flüssiges, geschmolzenes Gestein im Erdinneren.
In unmittelbarer Umgebung der Sonne blies die von der Sonne ausgehende Strahlung die leichten Gasbestandteile davon, sodass nur Staub aus schweren Elementen übrig blieb. Durch die Schwerkraft und die Rotation verdichtete sich der Staub an bestimmten Stellen. Dort entstanden größere Klumpen, die weitere Materie anzogen. Aus ihnen entstanden vor etwa 4,6 Milliarden Jahren die inneren Planeten MERKUR, VENUS, ERDE und MARS. Sie bestehen nur aus fester Materie. Weiter entfernt von der Sonne blieb das Gas erhalten. Dort entstanden die großen Gasplaneten JUPITER, SATURN, URANUS und NEPTUN
Die Planeten behielten die Drehbewegung der ursprünglichen Scheibe bei, sodass sie heute in festen Umlaufbahnen um die Sonne kreisen. Zwischen Mars und Jupiter befindet sich der Asteroidengürtel. Dieser besteht aus Millionen von kleineren Gesteinsbrocken, die ebenfalls um die Sonne kreisen.


Zu Beginn waren die sich neu formenden Planeten noch vergleichsweise klein. Es entstanden Protoplaneten. Auch die Erde war so ein Protoplanet. Durch ihre Schwerkraft zogen die Protoplaneten andere massereiche Objekte an und durch Zusammenstöße mit anderen Materieklumpen wurden sie immer schwerer
Während ihrer Bildung war die Erde ein riesiger glühender Ball aus flüssigem Gestein. Nach und nach kühlte die Erdoberfläche immer mehr ab und feste, große Platten aus Gestein bildeten sich. Im Laufe der Zeit verschmolzen sie miteinander zu immer größeren Platten.




Abb. 5: Die Erde als Protoplanet (links) und in ihrer heutigen Form (rechts).
Durch die noch instabile Erdoberfläche konnte geschmolzenes Gestein aus dem Erdinneren hervortreten. Die damals zahlreichen Vulkane brachen immer wieder aus und überzogen die Erdoberfläche mit flüssiger Lava und schwefelhaltigem Wasserdampf. Durch das Aneinanderstoßen der Platten falteten sich die ersten Gebirge auf. Nach und nach kühlte die Erdoberfläche ab. Durch die Abkühlung kondensierte der Wasserdampf und die ersten Meere bildeten sich.
Abb. 6: Die Oberfläche der jungen Erde war von zahlreichen Vulkanen übersäht und veränderte ständig ihre Form. Asteroideneinschläge trugen ihres dazu bei.


Die Erde kann man sich als riesige, an den Polen abgeflachte, Kugel vorstellen, die aus mehreren Schichten besteht. Im Zentrum liegen der feste innere und der flüssige äußere Kern. Beide sind aus Metallen aufgebaut, vor allem Eisen und Nickel. Am äußeren Kern schließt eine dicke Schicht aus heißem, festem bis plastischem Gesteinsmaterial an, der Erdmantel.
Auf den Erdmantel folgt die kühle Erdkruste. Während diese unter den Ozeanen aus der dünnen und schwereren ozeanischen Kruste besteht, wird sie unter den Kontinenten aus der dickeren und leichteren kontinentalen Kruste gebildet.
Erdkern
Er besteht aus dem festen inneren Kern mit einem Durchmesser von ca. 2 400 km und dem flüssigen äußeren Kern mit einer Dicke von etwa 2 200 km. Der innere Kern besteht zu etwa 80 % aus vermutlich festem Eisen und zu 20 % aus Nickel. Er hat eine Temperatur von etwa 7 000 ºC. Der äußere Kern besteht zu etwa 88 % aus flüssigem Eisen und zu 12 % aus Schwefel. Hier liegt die Temperatur bei etwa 4 000 ºC.

Erdmantel

plastisch: weich, verformbar



Er hat eine Dicke von 2 900 km und macht so 2/3 der Erdmasse aus. Unter dem sehr hohen Druck ist sein Hauptbestandteil –der Peridotit – trotz der hohen Temperaturen von 1 000 bis 3 500 ºC fest bzw. plastisch. Peridotit ist ein Gestein, das vor allem aus Magnesium und Eisen besteht. Der Anteil an Silizium und Aluminium im Erdmantel ist gering. Heiße Strömungen wälzen die zähe Gesteinsmasse langsam um. Dies führt zu Vulkanismus und Erdbeben.
Ozeanische Kruste
Die ozeanische Kruste ist nur etwa 8 km dick. Sie wird laufend neu gebildet. Kein Teil des Ozeanbodens ist älter als 200 Millionen Jahre. Neben dem Basalt ähnelndem Gabbro ist sie aus Sediment gestein aufgebaut. Die ozeanische Kruste besteht vor allem aus Sauerstoff und Silizium, gefolgt von Magnesium.
Abb. 2: Ausgeschnittenes Segment der Erde.

Abb. 3: Peridotit ist ein Gemisch aus verschiedenen Mineralien.
Basalt, der: Gestein, das durch Abkühlung von dünnflüssigem Magma entstand
Gabbro, der: ein kompaktes, grobkörniges, aus Magma entstandenes Gestein
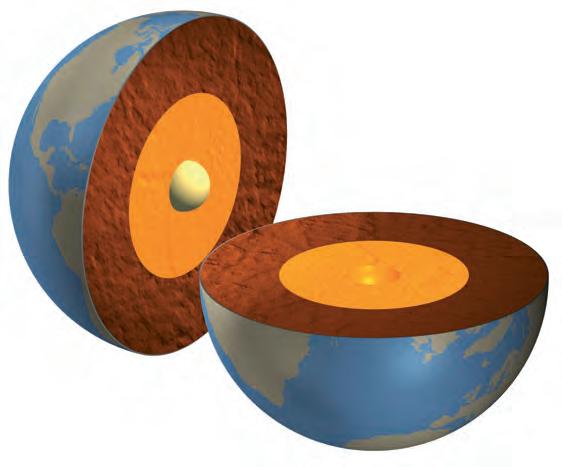



Kontinentale Kruste
Sie ist wesentlich dicker als die ozeanische Kruste und ist unter Gebirgen bis zu 70 km dick. Sie besteht aus leichten Gesteinen wie Granit mit geringerer Dichte. Die ozeanische Kruste besteht vor allem aus Sauerstoff und Silizium, gefolgt von Aluminium.

Ozeane und Atmosphäre
Die äußeren, nicht festen Schichten der Erde bestehen aus der Wasserhülle und der Lufthülle. Etwa 20 % des Gasgemisches der Lufthülle ist der durch Fotosynthese erzeugte Sauerstoff.


Abb. 1: Schichtenaufbau der Erde. Beachte wie dünn die Kruste im Vergleich zu den anderen Schichten ist. Auch die Atmosphäre macht mit etwa 80 km Dicke nur eine dünne Schicht aus.
Sediment, das: Ablagerung, Schicht
Granit, der: aus Magma in der Tiefe entstandenes Gestein mit deutlich sichtbaren Kristallen, von granum, lateinisch: „Korn“
Berechne den Erddurchmesser aus den in Abb.1 gegebenen Angaben!
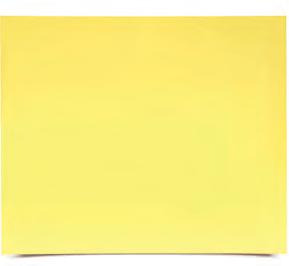

Was ist die Biosphäre? Als Biosphäre wird die Gesamtheit aller mit Lebewesen besiedelten Räume der Erde bezeichnet. Sie umfasst die oberste Schicht der Erdkruste einschließlich des Wassers sowie die unterste Schicht der Atmosphäre.

Abb. 4: Strömungen im Erdmantel. Beachte die Kreisform, von kühler sinkend zu heißer steigend, zu kühler.
Gib einige Sägespäne in einen Topf mit Wasser und erhitze das Wasser! Vergleiche, was du beobachtest, mit den Strömungen im Erdmantel! Beschreibe, welche Gemeinsamkeiten es gibt, und fertige eine Skizze zu deinen Gedanken an!
Studiere deinen Atlas! Welche Kontinentalplatten gibt es, und wo stoßen sie aufeinander? Lässt sich eine Verbindung zu Gebirgen herstellen?
Die Landmassen auf der Erde, die Kontinente , scheinen massiv und unbeweglich. Dennoch bewegen sie sich ständig, wenn auch nur extrem langsam. Diese Bewegung der einzelnen Platten nennt man Plattentektonik. Die Platten bestehen aus ozeanischer oder kontinentaler Kruste und der starren obersten Schicht des Erdmantels.
Die Bewegung der Erdplatten, auch Kontinentalplatten genannt, wird durch gewaltige Strömungen im Erdmantel und das Gewicht der Platten selbst verursacht. An manchen Stellen steigt heißeres, zähflüssiges Gestein auf, bewegt sich unterhalb der Erdkruste zur Seite, kühlt dabei ab und sinkt schließlich wieder ab. Dabei werden die Platten verschoben. Man nennt solche durch Temperaturunterschiede bewirkten Strömungen Konvektionsströme. Sie werden dir auch im Kapitel über das Meer wieder begegnen.
Mechanismen der Plattentektonik
Je nachdem, wie sich Kontinentalplatten und Erdmantel bewegen, können an der Oberfläche unterschiedliche Verformungen der Erdkruste als Folge beobachtet werden. Treffen zwei Kontinente aufeinander, schiebt sich eine Platte unter die andere sodass eine gehoben und die andere abgesenkt wird. An der Grenze der Kontinente werden Gebirge, wie etwa die Alpen, aufgefaltet. Bewegen sich Platten auseinander, entsteht neue Erdkruste, oder Senken. Füllen sich die Senken mit Wasser, entstehen Meere. Abbildung 5 verschafft dir einen Überblick über die Vorgänge.
Abb. 5: Darstellung der Plattentektonik


1. Aufsteigende heiße Gesteinsmassen schieben die Platten der ozeanischen Kruste auseinander. Das austretende Gestein erstarrt unter Wasser und bildet neuen Meeresboden.
2. Trifft eine ozeanische Platte auf einen Kontinent, wird sie unter die leichtere kontinentale Platte geschoben und in der Tiefe aufgeschmolzen. Der Kontinent wird am Rand aufgefaltet. Dabei entstehen Gebirge, die mit Vulkanen durchsetzt sind. Am Meeresboden vor der Küste bilden sich Tiefseegräben.
Beschreibt in Teams die Folgen von Erdbeben! Erinnert ihr euch an ein größeres Beben aus den Nachrichten? Diskutiert, was unternommen wird, um die Folgen von Erdbeben abzumildern!
3. Trifft eine Platte der ozeanischen Kruste auf eine andere, wird eine der beiden unter die andere geschoben. Dabei entstehen vulkanische Inselketten. Auch in diesem Fall bilden sich Tiefseegräben.
4. Wenn heiße Gesteinsmassen unter einem Kontinent aufsteigen, kann der Kontinent auseinanderbrechen und ein neuer Ozean entsteht.
5. Mitunter treten heiße Stellen unter einer Platte auf. An solchen „Hot Spots“ steigt das heiße Gestein an die Oberfläche und bildet Vulkaninseln.
Bei der Bewegung der Platten können sich diese verhaken. Da sie jedoch weiter geschoben werden, steigt der Druck, bis sie sich ruckartig voneinander lösen. Das Entstehungszentrum in den tieferen Schichten ist der Erdbebenherd. An der Erdoberfläche liegt das Epizentrum des Bebens. Von dort breiten sich die Erschütterungen in Wellen aus. Etwa 90 % der Beben entstehen so. Sie können aber auch durch einstürzende Hohlräume, Vulkanausbrüche oder Explosionen hervorgerufen werden.
Übertragungsfehler! Bei der E-Mail-Übertragung dieses geologischen Berichtes über „Schwarze Raucher“ ist leider etwas schief gegangen. Versuche, diesen Text trotzdem zu lesen! Wenn du das geschafft hast, beantworte anschließend die Fragen zum Bericht!
Wo treten Schwarze Raucher auf? entlang Rücken
Woraus beziehen die Produzenten ihre Energie? aus ______________________________
Welches Organ besitzen die hier lebenden Tiere nicht? _______________________________
Wie lange sind Schwarze Raucher aktiv? etwa Jahre
Treppe der Geschichte! Ordne die Ereignisse auf dieser Treppe den Zeitangaben richtig zu! Male dazu die zusammengehörigen Paare immer in einer Farbe an!
Es gibt die ersten Einzeller auf der Erde.


Urknall – das Universum entsteht. Kleinere Gaswolken verdichten sich zu Sternen.

Es gibt die ersten Vielzeller auf der Erde.


vor 1 Milliarde Jahren
vor 3,5 Milliarden Jahren

vor 4,5 Milliarden Jahren
vor 5 Milliarden Jahren

vor 10 Milliarden Jahren

vor 13 Milliarden Jahren


vor 16 Milliarden Jahren
Die riesige Wolke beginnt zu rotieren und flach t zu einer Scheibe ab.

Aus größeren Klumpen bilden sich Merkur, Venus, Erde und Mars.

Aus riesigen Gaswolken entstehen Galaxien.

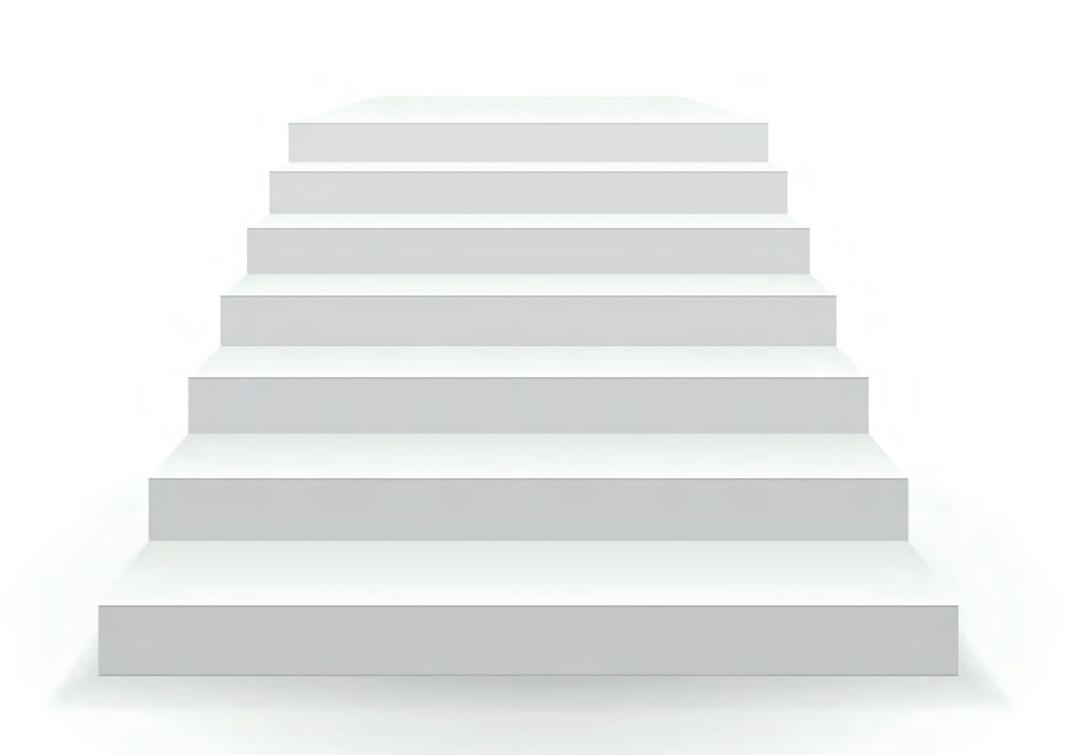

Bildet Teams. Findet zur Versuchsbeschreibung passende experimentelle Fragestellungen. Formuliert eure Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führt dann den Versuch durch.
Ihr braucht: Eine Platte aus Styropor oder anderem schwimmenden Materials % einen großen Topf oder eine Bratpfanne % ein Kochfeld oder einen Herd
FRAGE:
VERMUTUNG:
DURCHFÜHRUNG
Schneidet die Platte in Stücke beliebiger Form! Diese sollen die Kontinentalplatten darstellen. Wählt die Größe so, dass sie im Topf Platz haben, sich gemeinsam zu bewegen!
Füllt den Topf mit Wasser und stellt ihn so auf den Herd, dass etwa die Hälfte auf der Kochplatte steht!
Platziert eure Kontinentalplatten im Topf auf der Seite, die über der Kochplatte steht! Fügt sie an den passenden Rändern zusammen, sodass ein „Urkontinent“ entsteht!
Schaltet den Herd an und beobachtet was passiert!


Wiederholt den Versuch, indem ihr die Plattenstücke nach einer Zeit wieder auf der Seite des Topfes über der Kochplatte zusammenführt. Vorsicht: Greift nicht in das heiße Wasser, benutzt einen Kochlöffel oder ähnliches oder lasst das Wasser erst auskühlen!
AUSWERTUNG: Was sind eure Beobachtungen? Skizziert die Bewegung der „Kontinente“ indem ihr ihre Anfangsposition und mehrere Positionen im Laufe der Zeit aufzeichnet! Kennzeichnet die Bewegungsrichtungen in jeder Zeichnung mit Pfeilen! Tipp: Fotos und Videos helfen euch dabei die Vorgänge festzuhalten.
Welche Schlussfolgerungen könnt ihr aus euren Beobachtungen ziehen? Erklärt eure Beobachtungen! Euer Wissen zur Plattentektonik kann euch dabei helfen. Fasst eure Ergebnisse schriftlich zusammen!


Wiederholt den Versuch in einem flacheren Gefäß, in dem ihr mit einem Löffel oder ähnlichem am Boden des Gefäßes Bewegungen ausführt, ohne die Platten zu berühren! Probiert verschiedene Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten aus! Erklärt auch hier eure Beobachtungen!
Haltet alles in einem Protokoll fest und diskutiert eure Ergebnisse! Vergleicht eure Resultate und Schlussfolgerungen mit denen eines anderen Teams!
Bildet Teams. Findet zur Versuchsbeschreibung passende experimentelle Fragestellungen. Formuliert eure Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führt dann die Versuche durch.

Ihr braucht: Gesteinsmehl (z.B. aus dem Baumarkt) % ein Blatt A4 Papier % einen etwa handtellergroßen Holzblock
FRAGE:
VERMUTUNG:
DURCHFÜHRUNG A
Schneidet das Papier entlang einer beliebigen Linie ungefähr in der Mitte entzwei! Und legt die Stücke an der Schnittlinie leicht überlappend auf! Tipp: Legt eine leicht zu reinigende Unterlage darunter!
Streut eine 2 – 3 cm dicke Schicht Gesteinsmehl auf das Papier! Klopft sie mit dem Holzblock glatt und fest!
Zieht die Papierstücke langsam in unterschiedliche Richtungen und beobachtet die Oberfläche der Schicht!
DURCHFÜHRUNG B
Formt einen flachen Haufen aus Gesteinsmehl und klopft ihn mit dem Holzblock glatt und fest!
Schiebt den Holzblock langsam von einer Seite gegen den Haufen und beobachtet die Oberfläche! Verändert langsam die Bewegungsrichtung beim Schieben!

Ihr braucht: Zwei Holzplatten % Gesteinsmehl (z.B. aus dem Baumarkt) % Sandpapier % Alleskleber
FRAGE:
VERMUTUNG:
DURCHFÜHRUNG
Beklebt jeweils eine Schmalseite der Holzplatten mit einem Streifen Sandpapier!
Legt die Platten mit den beklebten Seiten aneinander! Bestreut sie mit einer dünnen Schicht Gesteinsmehl!
Bewegt die Platten aneinander entlang und beobachtet die Gesteinsmehlschicht! Drückt die Platten dabei unterschiedlich stark aneinander!
Stellt „Gebäude“, beispielsweise aus gestapelten Papierkügelchen oder Spielwürfeln entlang des Spaltes auf und wiederholt den Versuch!
AUSWERTUNG: Was sind eure Beobachtungen? Skizziert die sich ergebenden Strukturen und beschreibt ihre Entstehung! Fotos und Videos helfen euch bei der Dokumentation. Welche Schlussfolgerungen könnt ihr aus euren Beobachtungen ziehen? Euer Wissen zur Plattentektonik kann euch dabei helfen.
Haltet alles in einem Protokoll fest und diskutiert eure Ergebnisse! Vergleicht eure
Resultate und Schlussfolgerungen mit Bildern von Gebirgen, Canyons, Bruchlinien und Verwerfungen, die ihr unter diesen Suchbegriffen online ausfindig macht!

Du hast bereits in der ersten Klasse und sicher auch im Fach Digitale Grundbildung schon einiges über Recherche im Internet gelernt. Doch wie findest du heraus, wie sehr du Informationen, die du online
WER stellt die Information zur Verfügung?



erhältst, vertrauen kannst? Hierzu ist es wichtig dich über deine Quellen zu informieren und mehrere Quellen heranzuziehen. Ein guter Leitfaden hierfür sind folgende drei Fragen:
Wer steht hinter den Websites und Channels, auf denen du Informationen gefunden hast?
Dafür gibt es auf Websites ein Impressum (meist ganz unten zu finden) und auf Channels Profilinformationen. Handelt es sich um eine Privatperson, eine Firma, eine Universität oder eine andere öffentliche Einrichtung, eine politische Partei, eine Organisation? Informiere dich durch eine online Suche genauer, falls du dir mit den gefundenen Informationen noch kein gutes Bild zu den Verantwortlichen machen kannst!
Wer hat den konkreten Inhalt erstellt, aus dem du deine Informationen hast?
Wie kompetent und vertrauenswürdig ist diese Person bezüglich der Informationen, die sie teilt? Ist sie Expertin oder Experte auf dem Gebiet? In welcher Rolle befasst sie sich mit dem Thema? Gib den Namen in eine Suchmaschine ein um mehr über die Person und ihren Hintergrund zu erfahren! Verschaffe dir ein Bild über Kompetenzen, Einstellungen und Interessen der Verantwortlichen für die Informationen. Versuche abzuschätzen wie sich das auf die Darstellung, Qualität und Richtigkeit der Informationen auswirkt!
WIE wird die Information präsentiert?
Wie werden die Informationen dargestellt und welche Wirkung erzeugt diese Darstellung?
Quellen, die informieren wollen, benutzen in der Regel eine sachliche Darstellung um den Fokus auf den Sachinhalten zu belassen. Reißerische Darstellungen sollen Gefühle erzeugen. Sie werden oft dazu verwendet eine Grundstimmung zu schaffen, unter deren Einfluss die Informationen, meist verzerrt, aufgenommen werden sollen. Achte genau darauf, auf welcher Ebene eine Quelle versucht zu wirken!
Woher stammt die Information ursprünglich?
Woher hat deine Quelle die Informationen und wie gewissenhaft geht sie damit um? Um das herauszufinden achte auf Quellenangaben mit denen Informationen immer versehen sein sollten. Sind die angegebenen Quellen vertrauenswürdig? Stehen dort die gleichen Informationen? Je näher du an der originalen Quelle der Information arbeitest, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Information unverfälscht ist. Deine Gedanken zu „Wer?“ und „Warum?“ können dir bei der Einschätzung, wie verlässlich deine Quellen Informationen wiedergeben, helfen.
Bei der Verbreitung von Falschinformationen führen die Quellenangaben oft im Kreis oder Teilinhalte werden aus dem Zusammenhang gerissen. Arbeite immer möglichst nahe an originalen Quellen (Primärquellen).
Sind die dargestellten Informationen vollständig und schlüssig?
Durch das Weglassen von Details oder nur scheinbar richtige Schlüsse kann der Inhalt von Informationen stark verändert werden. Frage dich immer, ob die Inhalte auch wirklich ausreichen um das vermittelte Bild zu stützen. WARUM teilt die Quelle die Information?
Welche Motivationen und Ziele stecken hinter deiner Quelle?
Zu welchem Zweck teilt deine Quelle die Informationen? Möchte sie Wissen vermitteln, unterhalten, beeinflussen, für etwas werben? Stehen finanzielle Interessen mit der Präsentation und den Inhalten in Verbindung? Das lässt sich nicht immer so leicht erkennen. Deswegen sollte Werbung klar gekennzeichnet und etwaige Geldgeber nachvollziehbar sein. Die Frage „Wer?“ hilft dir dabei.
Vermitteln die Inhalte bestimmte Einstellungen, Wertvorstellungen oder Weltanschauungen?
Seriöse wissenschaftliche und journalistische Quellen arbeiten mit strengen Methoden, um persönliche Einstellungen und Werte von den Inhalten möglichst fern zu halten. Inhalte, die Wertvorstellungen und moralische Urteile transportieren, sollen meist beeinflussen, während die Sachinformationen nur als Anlass dienen. Achte gut darauf, ob du dich von Inhalten sachlich informiert, oder bezüglich deiner Meinung und deines Urteils beeinflusst fühlst. Schwer zu erkennen ist das vor allem, wenn die präsentierten Wertvorstellungen deinen eigenen entsprechen.
Einzelliges Leben gibt es auf der Erde seit etwa 3,5 Milliarden Jahren. Erst ab diesem Zeitpunkt waren die Bedingungen für das Entstehen von Leben gegeben. Spuren des frühen Lebens haben sich bis heute in Gesteinen erhalten. Diese versteinerten Überreste nennt man Fossilien. Sie sind Reste von Lebewesen, die vor dem Ende der letzten Eiszeit gelebt haben und somit älter als etwa 11 000 Jahre sind.

Der verwesende Kadaver des Procolophon, einer Dinosaurierart, liegt auf der Erdoberfläche.

Abb. 1: Ammoniten sind häufig zu findende Fossilien

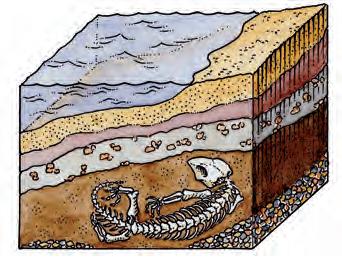
Viele Millionen Jahre bleibt das Skelett unter Sauerstoffabschluss in der Tiefe von fest gewordenem Schlamm oder Sand bedeckt und gelangt immer tiefer in den Boden.
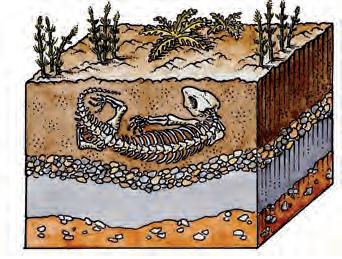
Der Kadaver wird mit Schlamm oder Sand bedeckt. Das passiert so schnell, dass das Skelett nicht zerstört wird


Wiederhole, was du bisher über die frühe Erde gelernt hast! Weshalb waren nicht sofort passende Bedingungen für Leben vorhanden?
Überlege, wo es in deinem Wohnbezirk oder in deiner näheren Umgebung eine Fossilienfundstelle gibt! Statte ihr einen Besuch ab und sieh nach, ob du etwas findest!
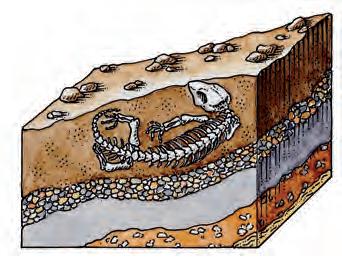
Unter Druck wird der Sand zu Stein. Chemische Prozesse wandeln die Knochensubstanz um und lassen aus dem Skelett des Procolophon ein Fossil entstehen. Durch geologische Prozesse kann das Fossil an die Oberfläche gelangen.

Abb. 2: Phasen der Entwicklung von Fossilien. Unter den richtigen Bedingungen bleibt das Skelett und kann viele Millionen Jahre später noch gut erhalten gefunden werden.
Fossilien und Evolution
Fossilien geben Auskunft darüber, wie sich Lebewesen im Lauf der Erdgeschichte weiterentwickelt und ihr Aussehen dabei verändert haben. Diesen Vorgang nennt man Evolution. Den Verlauf der Evolution können Paläontologinnen und Paläontologen mit Hilfe von Fossilien rekonstruieren. Aber es gibt auch einige Entwicklungen, deren Verlauf man noch nicht genau kennt wie die der Vögel, von denen es kaum Fossilien gibt.
Für die Bestimmung des Alters von Gesteinsschichten sind Leitfossilien sehr wichtig. Leitfossilien sind Überreste von Lebewesen, die ausschließlich während einer bestimmten, möglichst kurzen, Zeit weit verbreitet gelebt haben und häufig gefunden werden.
Ammoniten, die: gab es bereits vor 400 Mio. Jahren. Sie starben vor etwa 65 Mio. Jahren aus und lebten im Wasser. Sie sind mit den heutigen Tintenfischen und Perlbooten verwandt.
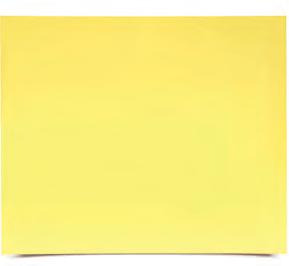

Was ist die Paläontologie? Sie ist die Wissenschaft, die sich mit den Lebewesen vergangener Erdperioden beschäftigt. Die Paläontologin oder der Paläontologe untersucht Reste von Organismen und Hinweise aller Art auf früheres Leben, also Fossilien.
Kadaver, der: Tierleiche oder auch Aas
Was erfährst du über die früheren Umweltbedingungen an einem Ort, wenn du das Fossil eines Laubblatts, einer Koralle, einer Muschel oder eines Haifischzahns findest?
rekonstruieren: etwas wieder herstellen oder aufstellen, was es nicht mehr gibt
Erkläre, weshalb es schwierig ist, Fossilien von Mikroorganismen zu finden!

Abb. 3: Paläontologinnen und Paläontologen bei der Ausgrabung eines Dinosaurierskeletts.
Trilobit, der: lebte bereits vor 600 Mio. Jahren und starb vor 245 Mio. Jahren aus. Er gehörte zu den Gliederfüßern und lebte im Wasser. Die Tiere wurden bis zu 50 cm lang.
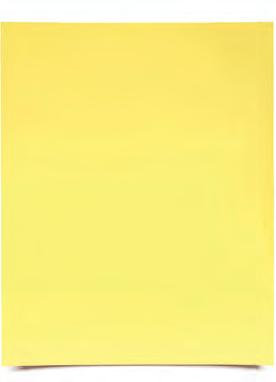

Gibt es lebende Fossilien?
Schon lange kannte man 400 Mio. Jahre alte Fossilien des Quastenflossers. Man hielt diesen Fisch für ausgestorben. Doch 1938 fand man einen lebenden Quastenflosser, der denselben Körperbau hatte, wie die fossilen Funde. Ein anderes lebendes Fossil ist der Nautilus. Er ist fast genauso gebaut wie die Ammoniten, die vor 65 Mio. Jahren gelebt haben.




Sieh dir folgendes Zahnfossil an: Kannst du etwas über die Lebensweise des Tiers, von dem er stammt, vermuten? Begründe deine Hypothese!
Von Lebewesen können Körperreste oder Spuren als Fossilien verschiedener Art erhalten bleiben. Überreste und Spuren müssen rasch von Sand oder Schlamm bedeckt und somit von der Luft abgeschlossen werden, damit sie versteinern. Das passierte häufig in und an Gewässern. Abgelagerte Materialschichten nennt man Sedimente.
SPURENFOSSILIEN: Sie sind Hinweise auf Tätigkeiten von Lebewesen, die erhalten geblieben sind. Dazu zählen Fußabdrücke sowie Grab-, Brut- oder Fraßspuren.
KÖRPERFOSSILIEN: Sie gehen direkt auf Körper oder Körperteile zurück. Sehr selten ist der Körper des Lebewesens selbst erhalten geblieben, wie etwa bei einem gefrorenen Mammut oder in Bernstein (fossilisiertes Harz) konservierten Lebewesen. Solche Fälle sind als Körperfossilien besonders interessant, da verschiedene Gewebe der Lebewesen untersucht werden können. Mittels DNA – Proben lässt sich etwas über Verwandtschaften zwischen Arten und die Evolution herausfinden



Abb. 4: Verschiedene Arten an Fossilien. Fußabdruck (links), Abdruck des Urvogel Archaeopteryx (Mitte), Steinkern eines Trilobiten (rechts).
ABDRÜCKE: Häufig sind nur Abdrücke der Körper von Tieren und Pflanzen im weichen Sediment vorhanden, wie bei einer Gussform. Das Tier selbst muss nicht mehr „da“ sein.
STEINKERN: Mitunter löst sich das Lebewesen selbst auf und hinterlässt einen Hohlraum, der von einer Schale umgeben ist. Nachdem der Hohlraum sich mit Sedimenten aufgefüllt hat, löst sich die Schale auf. Dann verfestigt sich das Sediment und bildet einen Steinkern. Dieser ist ein Innenabdruck des Lebewesens.
VERSTEINERUNG: Wird die Schale oder organisches Material von Lebewesen wie Knochen oder Holz langsam durch mineralische Umwandlung ersetzt, spricht man von Versteinerung. So wurde in verkieseltem Eichenholz das Holzgewebe durch Kieselsäure ersetzt. Die Jahresringe sind noch deutlich erkennbar.


Abb. 5: Verkieseltes Eichenholz (links), achte auf die Jahresringe! Körperfossil eines Mammutjungtieres (rechts), Haut und andere Gewebe sind erhalten, was Körperfossile für die Forschung besonders interessant macht.
Löse dieses Fossilien-Rätsel! 1 2 3
Was für ein Durcheinander! Ordne diese Schritte bei der Entstehung von Fossilien, indem du der Reihe nach nummerierst!



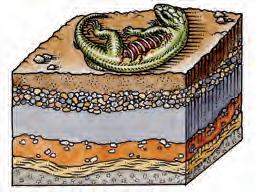
Beschreibe nun den Verlauf mit eigenen Worten!
waagrecht:

3. Fossil, bei dem der Körper eines Lebewesens erhalten geblieben ist
4. Überreste von Lebewesen, die während einer bestimmten Zeit in weiten Gebieten stark vertreten waren
6. Wissenschaft, die sich mit den Lebewesen vergangener Erdperioden beschäftigt
7. Tierleiche oder Aas

senkrecht:

1. Vorgang, bei dem das organische Material, die Schale oder das Holz langsam durch mineralische Umwandlung ersetzt wird
2. Spuren von früheren Lebewesen
5. ein lebendes Fossil







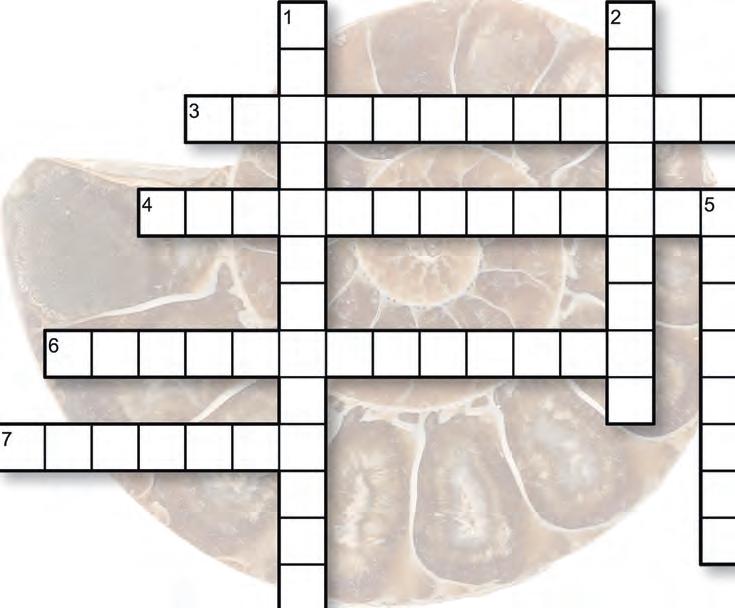
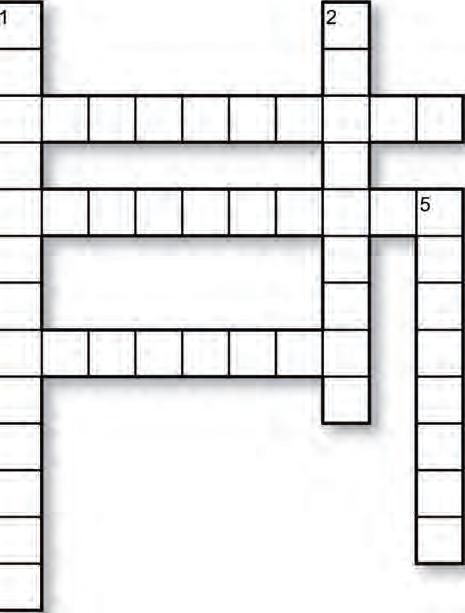
Quellenvergleich! Wende die Prinzipien an, die du auf Seite 14 kennengelernt hast, um sie zu üben! Gib den Begriff „Fossil“ in verschiedenen Suchmaschinen ein und betrachte jeweils die ersten fünf Ergebnisse! Liefern sie Informationen zu biologischen Fossilien? Führen sie zu denselben Websites? Notiere deine Beobachtungen!
Suche nun jeweils mit der Suchphrase „Fossil Biologie“, „Fossil Geologie“ und „Fossilien“! Vergleiche wieder die jeweils ersten fünf Ergebnisse und notiere auf welche Websites sie führen! Gibt es Übereinstimmungen?

Wähle nun drei gefundene Quellen zum Thema Fossilien aus, die jeweils Informationen zu folgenden drei Fragen beinhalten:
1) Was ist ein Fossil?
2) Wie entstehen Fossilien?
3) Welche Arten von Fossilien gibt es?
Versuche, für alle drei Quellen die auf Seite 14 präsentierten Fragen „WER?“, „WIE?“ und „WARUM?“ möglichst gut zu beantworten! Folge der Anleitung und den Tipps auf Seite 14! Notiere deine Ergebnisse!
Vergleiche die zu den drei Fragen über Fossilien passenden Informationen der drei Quellen miteinander! Sind sie gleich, oder unterscheiden sie sich? Sind sie vielleicht sogar fast wortgleich und wirken wie kopiert? Worin bestehen eventuelle Unterschiede? Notiere deine Beobachtungen!
Fasse nun die Informationen aus deinen Quellen zusammen, um die drei Fragen zu Fossilien in einem kurzen Text zu beantworten! Solltest du unterschiedliche Antworten gefunden haben, halte dies ebenfalls fest!
Beurteile und notiere abschließend, wie vertrauenswürdig du die jeweiligen Quellen findest und welche Quelle dir am besten geeignet erschien, um die Fragen zu beantworten! Erkläre auch, welche Eigenschaften diese Quelle für dich besonders überzeugend gemacht haben!
5
Hier spiegelt es! Versuche zuerst, den Text zu lesen! Erst wenn du das geschafft hast, kannst du auch die Fragen dazu beantworten.
Wer ist eng mit dem Quastenflosser verwandt?
Welche Atmungsorgane haben sie?

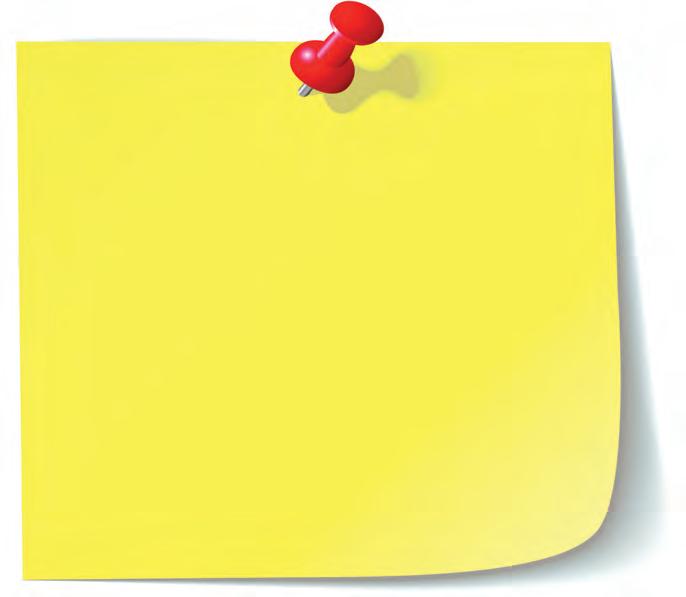
Wann lebten diese Tiere?
vor Jahren
Wann wurde ein lebendes Exemplar gefunden?
Abb. 6: Südamerikanischer Lungenfisch
Die Erde entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Seitdem hat sie sich immer wieder verändert. Die Entwicklung der Erde und des Lebens darauf erfolgte nicht gleichmäßig. Mehrmals gab es Ereignisse mit schwerwiegenden Folgen. Die Lebensbedingungen änderten sich in kurzer Zeit. Da sich evolutionäre Anpassungen nicht so rasch entwickeln konnten, starben zahlreiche Tier- und Pflanzengruppen aus. Aufgrund dieser Ereignisse entstanden unterschiedliche Gesteinsschichten.
Die Geologie teilt die Entwicklung der Erde daher in mehrere Abschnitte ein. Diese richten sich meist nach den Ereignissen auf der Erde, die an den Gesteinsschichten abgelesen werden können. Es werden vier Äonen, jeweils in mehrere Ären und Perioden unterteilt, unterschieden.
Wie alles begann
Zunächst war die Erde eine an den Polen abgeflachte Kugel heißen, geschmolzenen

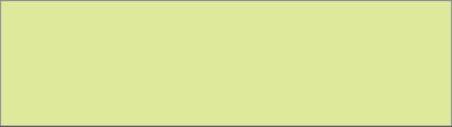
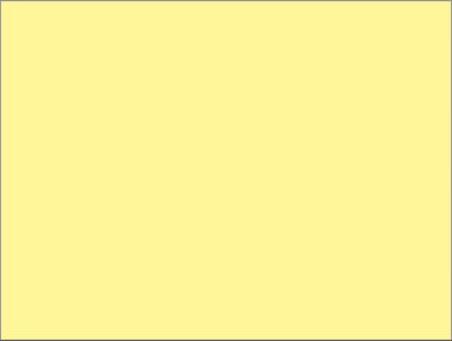
Gesteins. Bei diesen Temperaturen und auch wegen der ständigen starken Veränderung der Erdkruste war kein Leben möglich. Erst als die Erde so weit abgekühlt war, dass sich eine feste Erdkruste und die Urmeere bilden konnten waren die Bedingungen für Leben gegeben. In den Meeren waren viele unterschiedliche chemische Stoffe wie Stickstoff-, Schwefel- und Phosphorverbindungen gelöst. Diese konnten über lange Zeiträume miteinander reagieren, bis wohl der Zufall eine ganz besondere Art von Verbindungen hat entstehen lassen.
Abb. 2: Die Erdzeitspirale zeigt die verschiedenen Abschnitte der Erdgeschichte. Dargestellt sind auch typische Vertreter der jeweils vorherrschenden Arten an Lebewesen. Kennst du schon einige davon? Viele haben heute noch Nachfahren, die wichtige Merkmale von ihren Urahnen geerbt haben.
Abb. 1: Die Zeitalter der Erdgeschichte. Sie sind eng mit dem Wechsel der Lebensbedingungen und vorherrschenden Lebewesen verbunden.
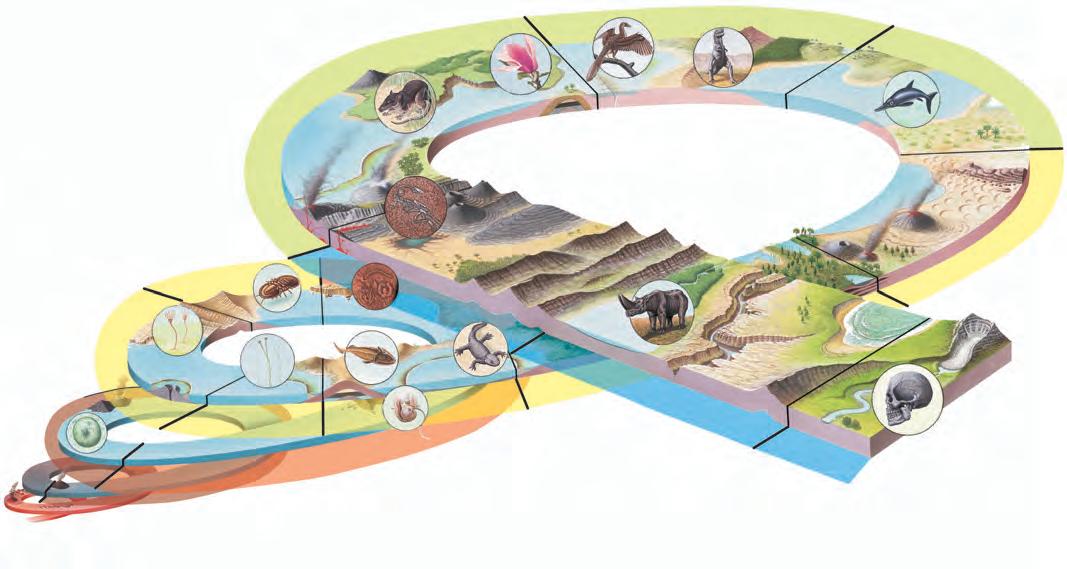

Woher kam der Sauerstoff? Zunächst gab es keinen freien Sauerstoff auf der Erde. Im Meer jedoch entstanden Lebensformen, die durch Fotosynthese Sauerstoff erzeugten. Vorerst blieb dieser Sauerstoff im Meer. Erst als das Meerwasser keinen weiteren Sauerstoff mehr aufnehmen konnte, reicherte sich der Sauerstoff in der Atmosphäre an. Dort reagierte er zunächst sehr heftig mit anderen Gasen der Atmosphäre und mit Stoffen an der Erdoberfläche. Vor ca. 750 Mio. Jahren war der Sauerstoffgehalt so hoch, dass sich durch die Sonneneinstrahlung aus dem Sauerstoff in der oberen Atmosphäre eine schützende Ozonschicht bilden konnte. Sie filtert einen Großteil der ultravioletten (UV-) Strahlung, die Zellen und Erbgut schädigen kann. Erst dadurch konnte auch das Land besiedelt werden.

organische Verbindung, die: Verbindungen mit einem Gerüst aus Kohlenstoffatomen; sind Bestandteil aller Zellen.
In welchem Zusammenhang hast du sonst schon von UV-Strahlung gehört? Erkläre mit Bezug auf den nebenstehenden Absatz, worauf du im Sommer achtgeben musst und weshalb!
Wie entstand das Leben auf der Erde?
Die ersten 3 Äonen werden häufig zusammengefasst als „Erdurzeit“ oder „Präkambrium“ bezeichnet. Aus dieser sehr weit zurückliegenden Zeit sind kaum Gesteine erhalten geblieben, da sie durch geologische Prozesse umgeformt worden sind. Die drei Äonen des Präkambrium sind das Hadaikum, in dem es noch kein Leben auf der Erde gab, das Archaikum, in dem die ersten Lebensformen als Einzeller entstanden und das Proterozoikum, die Zeit, in der erste mehrzellige Lebensformen auftraten.
Abb. 1: Erde in der Erdurzeit. Vermutlich hat die Erde gegen Ende der Erdurzeit so wie rechts abgebildet ausgesehen. Die Landmassen, aus denen sich später die heutigen Kontinente gebildet haben, hingen zusammen und formten einen einzigen Kontinent, der Rodinia genannt wird. Erst über viele Millionen Jahre wanderten die Kontinentalplatten durch die Plattentektonik zu ihren heutigen Positionen.
Äon Ära Beginn vor Mio. Jahren
Erdneuzeit/Känozoikum
Erdmittelalter/Mesozoikum
Erdaltertum/Paläozoikum

Zu Beginn der Erdurzeit enthielt die Erdatmosphäre noch keinen Sauerstoff. Daher hatte die Erde auch noch keine schützende Ozonschicht. Energiereiche UV-Strahlung konnte so ungehindert die Meere erreichen. Vermutlich bewirkte die UV-Strahlung gemeinsam mit der Energie, die durch zahllose Blitze erzeugt wurde, dass in den Urmeeren aus den gelösten Stickstoff-, Schwefel- und Phosphorverbindungen organische Verbindungen gebildet wurden.
Leben auf der Erde entsteht
Fossilien geben keine Auskunft darüber, wie Leben auf der Erde entstanden ist, da die ersten Lebensformen nicht erhalten sind. Stanley Miller, ein amerikanischer Biologe und Chemiker, versuchte aber 1953, der Entstehung des Lebens mit einem Experiment auf die Spur zu kommen:

Man geht davon aus, dass sich über lange Zeiträume immer kompliziertere chemische Verbindungen gebildet haben. Irgendwann waren diese in der Lage, sich selbst zu kopieren. Dies war der Urprung des Lebens. Neue Erkenntnisse legen auch die Möglichkeit der Entstehung des Lebens an heißen Quellen in der Tiefsee nahe. Vor 3,5 Milliarden Jahren gab es erste einzellige Lebensformen auf der Erde. Aber erst vor rund einer Milliarde Jahre entstanden Mehrzeller.
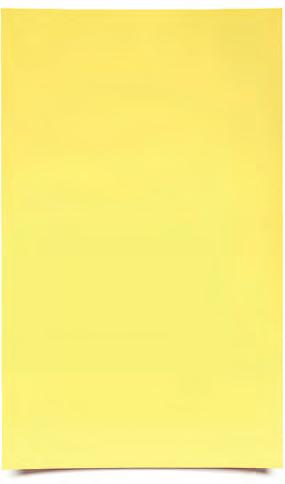

In einer Versuchsapparatur bildete Stanley Miller die Uratmosphäre der Erde nach. Er verwendete dazu ein Gasgemisch bestehend aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff, Wasserdampf und Kohlenstoffmonoxid. Unter dem Einfluss elektrischer Entladungen (elektrische Funken), die Blitze simulierten, entstanden aus dem Gasgemisch der Uratmosphäre Aminosäuren. Aminosäuren sind Bausteine von Eiweißmolekülen, den Werkzeugen des Lebens.
Es ist nicht genau bekannt, seit wann es Leben auf der Erde gibt. Man hat allerdings Spuren von Bakterien gefunden, die etwa 3,5 Milliarden Jahre alt sind. Im Proterozoikum entstanden bereits mehrzellige Lebewesen. Gegen Ende der Erdurzeit bildeten sich dann die entfernten Vorfahren der meisten heute noch existierenden Tiergruppen. Allerdings kennt man auch Fossilien von Gruppen von Lebewesen, die sich schwer oder gar nicht in die heute bekannten Baupläne von Lebewesen einordnen lassen. Diese Tiergruppen sind im Laufe der Zeit ausgestorben.

Abb. 2: Fossile Bakterien, gefunden auf einem fossilisierten Haifischzahn.
Das Erdalterum, auch Paläozoikum genannt, wird in sechs Perioden eingeteilt.
1. Periode – das Kambrium
Im Kambrium entwickelte sich eine große Vielfalt an Lebewesen. Am Meeresboden siedelten sich viele Tiere an, die noch keine feste Körperstütze hatten wie Schwämme oder Vorformen der Weichtiere. Im Kambrium lebten auch viele Lebewesen mit harten Körperteilen (z. B. Schalen), von denen viele als Fossilien erhalten geblieben sind. Ein wichtiges Leitfossil dieser Zeit ist der Trilobit, den du im Kapitel über Fossilien kennengelernt hast.
Äon Ära Periode
Beginn vor Mio. Jahren
Erdneuzeit/Känozoikum
Erdmittelalter/Mesozoikum
Es war zudem die Zeit, in der die ersten Riffe entstanden, die hauptsächlich von Schwämmen gebildet wurden. Während des gesamten Kambrium kam es immer wieder zu Massenaussterben
2. Periode – das Ordovizium
Im Ordovizium gab es eine große Vielfalt an Lebewesen, besonders an Weichtieren. Zu dieser Zeit lebten unter anderem die Vorfahren des Nautilus. Außerdem traten die ersten Schnecken, Seeigel und Seesterne auf sowie die ersten Wirbeltiere wie kieferlose Fische.
Korallen bildeten mit den Schwämmen zusammen große Riffgemeinschaften. Ihre Überreste finden sich heute in kalkhaltigen Gesteinsschichten. Sowohl zu Beginn als auch am Ende des Ordovizium gab es Massenaussterben die Raum für neue Arten schufen.
3. Periode – das Silur
Im Silur besiedelten die ersten Pflanzen das Land. Diese waren viel einfacher gebaut als heutige Pflanzen. Sie sind die Vorfahren der heutigen Farne und Bärlappgewächse. Von den Ufern der Meere und Flüsse ausgehend, bildeten sie niedrige Wälder, die sich zu riesigen Sumpfwäldern entwickelten. Diese erzeugten Nahrung und Sauerstoff für die Tiere, die das Festland zu erobern begannen. Die ersten Landtiere waren Tausendfüßer, Skorpione, Milben und Spinnen.

Abb. 1: Lebewesen im Kambrium (1. Trilobit, 2. Weichtiere, 3. Nesseltiere)
Riff, das: hier, von Lebewesen gestaltete Struktur im Meer
In den Meeren lebten unter anderem die ersten gepanzerten Kieferfische und später auch Knochenfische sowie die zu den Gliederfüßern zählenden Schwertschwänze.

Abb. 2: Erde im Erdaltertum: Ein Großteil der Landmassen im Ordovizium war zum Riesenkontinent Gondwana zusammengeschlossen. Westlich davon gab es noch einige kleinere Kontinente.
Massenaussterben, das: Ein großer Teil der Tier- und Pflanzenarten stirbt in kurzer Zeit aus.


Abb. 3: Gepanzerter Kieferfisch
Abb. 4: Der Nautilus ist seinen Vorfahren noch sehr ähnlich.
Denk daran, was du über Lebensräume gelernt hast! Begründe, weshalb ein Massenaussterben auch immer einigen Tierarten Chancen bietet!

1 Eusthenopteron –Lungenfisch
2 Panderichthys – Verwandter des Quastenflossers
3 Tiktaalik – weist bereits Merkmale von Amphibien auf
4 Acanthostega – gehört bereits zu den Landwirbeltieren
5 Ichthyostega
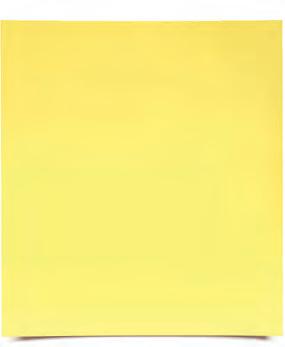

Was ist ein Brückentier?
Durch seinen Körperbau zeigt ein Brückentier eine enge stammesgeschichtliche Verwandtschaft zu zwei heute getrennten Gruppen von Lebewesen. Es stellt also einen Verzweigungsstelle in der Evolution dar. So gilt der Ichthyostega als Brückentier zwischen Fischen und Amphibien.
Wiederhole den Unterschied zwischen Sporenpflanzen und Samenpflanzen aus dem letzten Jahr!
Die Menge an Pflanzen auf der Erde nahm im Karbon deutlich zu. Erkläre, weshalb das deiner Meinung nach zu den veränderten atmosphärischen Bedingungen geführt hat!
Sieh dir den Körperbau von Dimetrodon an! Was meinst du, wie gut ist dieser an das Leben und die Fortbewegung an Land angepasst? Fallen dir heutige Tiere mit ähnlichem Körperbau ein? Wie leben sie?


Aus dem Devon kennt man den Quastenflosser. Man vermutet, dass sich aus nahen Verwandten des Quastenflossers die ersten Landwirbeltiere, die Urlurche, entwickelt haben. Ein Vertreter der Urlurche war der Ichthyostega, ein Amphibium, das zeitweise auch an Land leben konnte.
In den Meeren des Devon lebten auch Vorfahren der heutigen Tintenfische, die Ammoniten. Sie sind Leitfossilien dieser Zeit.
Abb. 5: Ichthyostega: Entwicklung vom Wasserlebewesen zum Amphibium.
Im Devon setzten sich an Land Sporenpflanzen, ähnlich den heutigen Farnen, Schachtelhalmen und Riesenbärlappgewächsen durch. Sumpflandschaften bildeten sich und die ersten Samenpflanzen entstanden. In weiterer Folge wurde es auch Insekten und Landwirbeltieren möglich, das Festland zu besiedeln. Gegen Ende des Devon starben aufgrund einer Klimaabkühlung ca. 40% der Arten in den Meeren aus.
Das Karbon wird auch das Steinkohlezeitalter genannt. Aus den Pflanzen der riesigen Sumpfwälder des Karbon bildeten sich die großen Steinkohlelager, die auch heute noch abgebaut werden.

Das Klima im Karbon war sehr warm und feucht. Wälder und Sumpflandschaften breiteten sich weiter aus. In den ausgedehnten Sumpfgebieten entwickelten sich die Amphibien weiter. Im Laufe des Karbons nahm der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre deutlich ab, während der Sauerstoffgehalt stieg. Das führte zu einer zunehmenden Abkühlung des Klimas. Gegen Ende dieser Periode entstanden die ersten Reptilien. Das feuchte Klima begünstigte außerdem die Entwicklung von Riesenlibellen mit einer Flügelspannweite von bis zu 1 m, sowie Spinnen, Landskorpionen und Tausendfüßern.





Weshalb kommen Reptilien mit trockenem Klima besser klar als Amphibien?
6. Periode – das
Die im Karbon begonnene Abkühlung hielt bis weit in die Perm hinein an. Das Klima wurde wieder trockener und die ersten nacktsamigen Pflanzen entstanden. Sie waren die Vorfahren unserer Nadelbäume. Auch Ginkobäume stammen aus dieser Zeit.
Reptilien beherrschten nun das Festland. Sie legten Eier, die durch eine Schale vor dem Austrocknen geschützt waren. Daher konnten die Reptilien weiter ins Landesinnere vordringen. Einer der ersten Saurier entwickelte sich, das Dimetrodon.


Übertrage die Entstehung der Lebewesen auf diese Uhr! Zeichne dazu die jeweiligen Erdzeitalter der Anleitung entsprechend ein und benenne sie auf der Uhr!
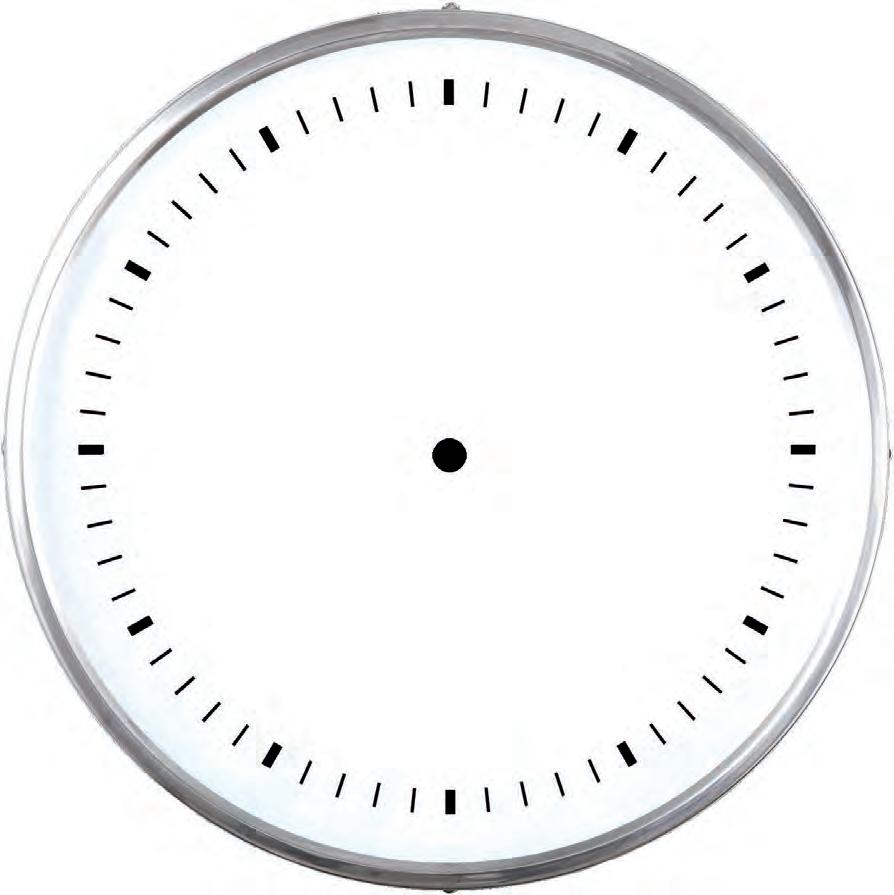
Anleitung:
Die 12 Stunden des Zifferblattes stellen 4,6 Milliarden Jahre der Erdgeschichte dar. Du sollst nun die Fläche des Zifferblattes so in Segmente („Tortenstücke“) einteilen, dass ihre Größe der Dauer der einzelnen Abschnitte der Erdgeschichte entspricht.
1. Schritt: Das Zifferblatt hat einen Umfang von 46 cm, sodass 1 mm also 10 Millionen Jahre entspricht. Beginne bei 12 Uhr und miss am äußeren Rand eine Länge von 40 cm ab! Tipp: Du kannst die Länge auch auf einem Stück Schnur abmessen und es dann um das Zifferblatt herum legen.
2. Schritt: Ziehe von dort eine gerade Linie zum Mittelpunkt! Dieses Segment stellt die Erdurzeit dar.
3. Schritt: Trage anschließend die anderen Erdzeitalter ein und bemale jeden Abschnitt der Erdgeschichte mit einer anderen Farbe!
4. Schritt: Zum Schluss trage noch die Entstehung folgender Lebewesen ein:
Bakterien © mehrzellige Lebewesen © Trilobiten und Vorfahren des Nautilus © Quastenflosser und Ichthyostega © Mensch

Richtig oder falsch? Ringle den richtigen Buchstaben ein, dann erhältst du als Lösungswort die Bezeichnung eines Kontinents im Erdaltertum!
richtig falsch
Zu Beginn der Erdurzeit hatte die Erde eine schützende Ozonschicht. C G
Fossilien geben Auskunft darüber, wie Leben auf der Erde entstanden ist. A O
Man fand Spuren von Bakterien, die aus dem Archaikum stammen. N M
Gegen Ende der Erdurzeit entstanden bereits mehrzellige Lebewesen. D P
Fundorte erdurzeitlicher Formationen findet man häufig auf der Erde. E W
Die erste Formation des Erdaltertums nennt man Devon. R A
Die Vorfahren des Nautilus lebten bereits im Ordovizium. N S
Das Ichthyostega gilt als Brückentier zwischen Fischen und Säugetieren. U A
LÖSUNGSWORT:
Steinkohle! Im Norden Frankreichs, an der Grenze zu Belgien liegt das nordfranzösische Kohlerevier (siehe Karte). Dort wurde, im Zuge der industriellen Revolution, seit dem späten 19. Jahrhundert Steinkohle abgebaut.
Stelle aufgrund der gegebenen Informationen eine Hypothese darüber auf, wie die Landschaft dieser Region vor etwa 250 bis 350 Millionen Jahren ausgesehen hat und welche klimatischen Bedingungen geherrscht haben!

Beschreibe deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn deine Hypothese und worauf diese beruht! Höre auch umgekehrt genau zu! Seid ihr einer Meinung? Besprecht euch und einigt euch auf eine gemeinsame Hypothese und weshalb ihr denkt, dass diese stimmt! Erarbeitet nun gemeinsam einen Plan, wie ihr eure Hypothese mit Hilfe von Ausgrabungen überprüfen könntet!
Gut aufgepasst? Tanja und Mehmet unterhalten sie sich über den Bio Stoff. Lies dir ihre Aussagen genau durch und beurteile, wo sie recht haben und wo nicht! Stelle falsche
Aussagen richtig und begründe deine Korrektur!
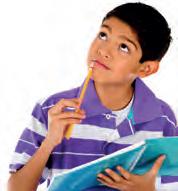
Mehmet sagt „Ich habe im Internet ein Video gesehen. Dort wurde gezeigt, dass organische Verbindungen sehr kompliziert aufgebaut sind und keine große Hitze aushalten. Auf der Erde war es zu Beginn furchtbar heiß, also konnten solche Verbindungen ganz sicher nicht entstehen. Da war dann natürlich die Frage wo kommt das Leben her? Die haben aber eine schlüssige Lösung dafür gefunden. Jemand hat diese Verbindungen, oder das Leben selbst, auf die Erde gebracht. Das ist doch ein sehr schlüssiger Beweis für Außerirdische!“

Tanja blickt ihn mit gerunzelter Stirn an. „Na ich weiß nicht so recht…“ erwidert sie. „Ich hab dafür eine coole Doku gesehen. Da ging es um Leitfossilien, also Lebewesen, die quasi Pioniere ihrer Zeit waren. Die hatten auch gleich Beispiele, wie Trilobiten im Kambrium und Ichti … hmmm irgendwie so im Devon.“
„Boh diese Namen sind echt mühsam!“ seufzt Mehmet. „Bei den Versteinerungen hab ich mir gemerkt, dass im Karbon Steinkohle entstanden ist, wie Carbon im Englischen. Clever gell? Und kühler ist es zu der Zeit auch geworden. Und da die Wärme von der Sonne kommt ist das ein guter Hinweis darauf, dass sich die Sonnenaktivität im Laufe der Zeit ändert.“
Das Erdmittelalter bzw. Mesozoikum teilt man in 3 Perioden ein: Trias, Jura und Kreide

1. Periode – die Trias
Abb.1: Erde zu Beginn des Erdmittelalters. Die Landmassen bildeten einen einzigen großen Kontinent, den Pangäa. Vergleiche mit den Karten zuvor und versuche die Bewegung der Kontinentalplatten nachzuverfolgen!
Äon Ära Periode Beginn vor Mio. Jahren
Erdneuzeit/Känozoikum
Phanerozoikum
Erdmittelalter/ Mesozoikum
Erdaltertum/Paläozoikum
Erdurzeit/Präkambrium
Der Übergang von Perm zu Trias war vom wahrscheinlich größten Massenaussterben der Erdgeschichte geprägt. Durch eine Erwärmung des Klimas starben etwa 96% der Meeresbewohner und 75% der Landbewohner aus. Im trockenen, subtropischen Klima der Trias wuchsen Ginkgogewächse, Farne und Nadelbäume sehr hoch. In der Tierwelt waren außer den Schlangen bereits alle Gruppen der Reptilien vertreten. Es gab Schildkröten, Krokodile und erste Saurier. Aus einer Gruppe der Reptilien entstanden säugetierähnliche Reptilien, aus denen sich im Laufe der Zeit die Säugetiere entwickelten. Im Gegensatz zu den wechselwarmen Reptilien können Säugetiere ihre Körpertemperatur regulieren. Daher wurden sie in ihrer Aktivität durch unterschiedliches Wetter oder den Wechsel der Tageszeiten nicht beeinträchtigt und konnten länger nach Nahrung suchen.
2. Periode – der Jura
Während dem Jura brach Pangäa langsam auseinander. Ozeane überfluteten große Teile der Kontinente. Daher konnten sich die Landtiere nicht mehr ungehindert ausbreiten. Die Entwicklung verlief auf den einzelnen Kontinenten unterschiedlich. Neue Tiergruppen und in der Folge auch neue Arten entstanden. Das Klima war weiterhin warm. Es gab große Wälder aus Nadelbäumen wie dem Mammutbaum. Zudem wuchsen Palmfarne und Ginkgogewächse. Die Saurier konnten sich in allen Lebensräumen ausbreiten. Man fand Fossilien von im Meer lebenden Fischsauriern und an Land lebenden Dinosauriern wie etwa Allosaurus und Diplodocus. Flugsaurier eroberten die Lüfte. Saurier konnten gigantische Größen erreichen, es gab aber auch Arten, die nicht größer als Hühner wurden. Aus dem Jura stammt auch der Urvogel Archaeopteryx, der als Brückentier zwischen Reptilien und Vögeln gilt.
Abb. 3: Darstellung des typischen Landschaftsbildes im Erdmittelalter. 1. Palmfarn, 2. Nadelbäume, 3. Urvogel, 4. Saurier, 5. Krokodil, 6. Flugsaurier.


Die Klimaveränderungen, die zum großen Massenaussterben im PermTrias-Übergang führten, brachten eine Steigerung der globalen Durchschnittstemperatur um etwa 5 °C innerhalb mehrerer tausend Jahre mit sich. Weshalb ist deiner Meinung nach die Wissenschaftsgemeinde alarmiert, wenn heute Temperaturveränderungen von 3 °C und mehr innerhalb von etwa 100 Jahren erwartet werden?


Säugetiere im Erdmittelalter
Die ersten Säugetiere, also unsere direkten Vorfahren, waren klein und spitzmausähnlich. Sie ernährten sich von Insekten. Eines der ersten Säugetiere war das Megazostrodon. Die Tiere wurden etwa zehn Zentimeter groß und es wird vermutet, dass sie über einen guten Geruchssinn und ein gutes Gehör verfügten.









Abb.2: Megazostrodon war eine der frühesten Säugetierarten.
Brückentier, das: Tier, das Merkmale zweier Tiergruppen in sich vereinigt.
Suche online nach Bildern des Archaeopteryx (als Fossil und künstlerische Darstellung)! Kannst du Merkmale ausmachen, die seine Rolle als Brückentier verdeutlichen?
Vergleiche die Weltkarte zur Kreidezeit mit der heutigen! Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede!

Wie kam es zum Aussterben der Dinosaurier?
Bis heute sind die Gründe für das Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit nicht restlos geklärt. Es gibt aber mehrere mögliche Erklärungen:
D Ein Asteroid kollidierte mit der Erde. Durch die aufgewirbelte Staubwolke änderten sich plötzlich die Lebensbedingungen.
D Die Säugetiere entwickelten sich rasch weiter und fraßen die Eier der Dinosaurier.
D Das Klima veränderte sich und evolutionäre Veränderungen konnten die Dinosaurier nicht rasch genug an die steigenden Temperaturen anpassen.
D Der Vulkanismus nahm zu. Die Aschewolken veränderten die Umweltbedingungen.


5: Die Erde zur Kreidezeit. Das Auseinanderdriften der Kontinente setzt sich in der Kreidezeit fort.
Beschreibe genauer, weshalb eine höhere Chance zur erfolgreichen Bestäubung zur raschen Verbreitung von Blütenpflanzen geführt hat! Formuliere aufgrund deiner Gedanken, wie Evolution und Fortpflanzung zusammenhängen!
Suche im Internet nach Chicxulub-Krater, um den momentan heißesten Kandidaten für die Ursache des Massensterbens am Ende der Kreidezeit kennen zu lernen! Beurteile drei gefundene Quellen nach dem Schema auf Seite 14 und entscheide, welche du für die vertrauenswürdigste hältst!
Das Klima der Kreide war relativ warm und gleichbleibend. Das schaffte für viele Arten den Zeitraum sich weiterzuentwickeln. Bis zur Kreide hatten die Pflanzen nur einfache Fortpflanzungsmechanismen. Meist erfolgte die Bestäubung durch den Wind. Nun entwickelten sich neue, wirkungsvollere Methoden der Fortpflanzung: Blütenpflanzen gingen zur Bestäubung Symbiosen mit Insekten ein. Diese Beziehung erhöhte die Chance einer erfolgreichen Bestäubung und Blütenpflanzen verbreiteten sich rasch über die Erdoberfläche. Die Ausbreitung der Blütenpflanzen förderte die Entwicklung der Insekten. Diese bildeten die Nahrungsgrundlage für Vögel und kleine Säugetiere, sodass sich auch diese rasch ausbreiten konnten.
In den Meeren entstanden neue Formen von Weichtieren und in den küstennahen Flachmeeren neue Arten fleischfressender Krebstiere wie Garnelen, Krabben und Hummer. Mosasaurier durchstreiften auf der Jagd nach Fischen die Weltmeere.
In der Kreide entwickelten sich die Reptilien weiter. Neue Dinosaurierarten entstanden. Hadrosaurier mit entenähnlichen Schnäbeln waren die verbreitetsten Weidetiere, die in Herden lebten. Andere Arten der Kreide waren Stegosaurier, Pachycephalosaurier und Ankylosaurier. Gegen Ende der Kreidezeit lebte der Raubsaurier Tyrannosaurus rex.
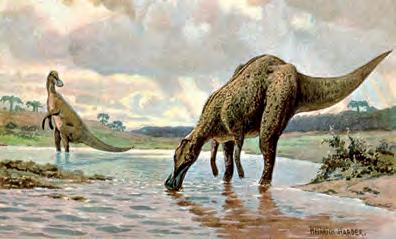


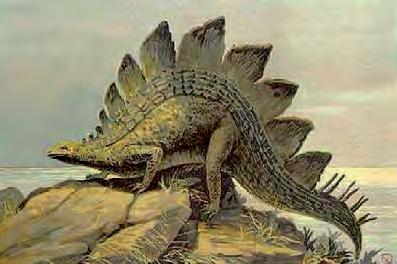
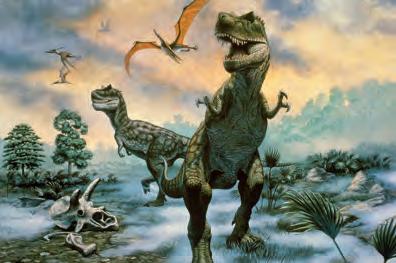
Abb. 7: Einige Dinosaurier der Kreidezeit, Tyrannosaurus rex ist wohl einer der bekanntesten. Tyrannosaurus rex
Am Ende der Kreidezeit verschwand plötzlich ein Großteil aller Lebewesen. Auch die Dinosaurier starben aus.

Welcher Saurier ist das? Lies dir zuerst diese Informationstexte genau durch! Dann ordne die Namen der verschiedenen Saurier aus den Abbildungen den Texten zu!
NAME:
Er war bis zu 9 m lang und erreichte ein Gewicht von 6 bis 12 Tonnen. Dieser Saurier hatte einen sehr großen und wuchtigen Schädel. Seine mächtigen Hörner, die Stoßwaffen waren, setzte er zur Verteidigung gegenüber Fressfeinden und bei Revierkämpfen ein. Seine Nackenschilde schützten ihn vor Bissen.

NAME:
Er bewegte sich auf den Hinterbeinen fort. Sein schwerer, steifer Schwanz bildete das Gegengewicht zum vorderen Teil des Körpers. Dieser Saurier konnte hohe Geschwindigkeiten erreichen und ernährte sich vorwiegend von Pflanzen in Bodennähe, aber auch von Insekten, Kleintieren oder Eiern.
NAME:
Dieser Saurier war ein Pflanzenfresser mit einem breiten, stämmigen Rumpf. Seine Hinterbeine waren länger als seine Vorderbeine, sodass der Kopf in einer bodennahen Position war. Um seine Feinde abzuschrecken, besaß dieser Saurier einen mit Stacheln besetzten Panzer und einem am Ende verdickten, knochigen Schwanz.

NAME:
Dieser Saurier war ohne Zweifel einer der bedrohlichsten Fleischfresser aller Zeiten. Im Vergleich zu seiner Länge von mehr als 15 m und seiner Höhe von über 6 m waren seine vorderen Gliedmaßen klein und so kurz, dass er nicht einmal sein Maul damit erreichte. Da er wegen seines riesigen Körpers nicht weit laufen konnte, lauerte er seiner Beute auf und sprang sie an.

NAME:
Dabei handelt es sich um einen vierbeinigen, pflanzenfressenden Saurier, der eine Doppelreihe von knöchernen Platten oder Stacheln entlang des Rückens und der Oberseite des Schwanzes hatte. Diese dienten der Verteidigung, denn durch das Hin- und Herschwingen des Schwanzes konnte er Fressfeinde verwunden.





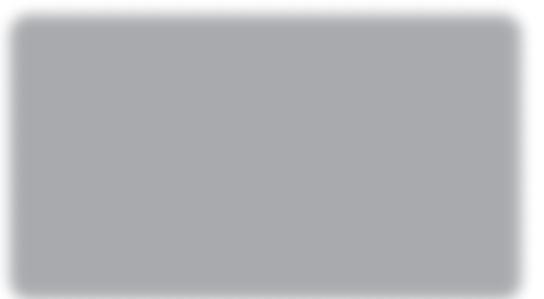
Triceratops













Welche Saurier haben sich hier versteckt – Finde die 3 Gruppen der Saurier sowie die 5 Dinosaurierarten, die du schon kennengelernt hast!
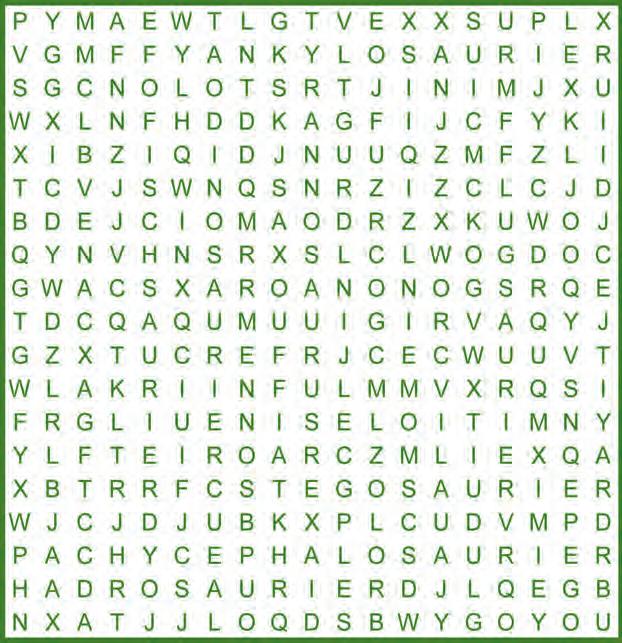




Sauriergruppen:

Dinosaurierarten:
Die Größten! In der Kreide entwickelten sich die Titanosaurier. Diese Pflanzenfresser waren die größten, je lebenden Lebewesen. Suche dir ein Bild eines Titanosauriers! Vergleiche dieses Bild und die vier in Abbildung 4 auf Seite 25 abgebildeten Dinosaurier miteinander!
Notiere Gemeinsamkeiten und Unterschiede! Versuche aus den Körpermerkmalen auf die Lebensweise zu schließen!
Tipp: Überprüfen kannst du deine Hypothesen indem du zu den einzelnen Sauriern recherchierst!
4
Wie genau? Lies dir die Infobox zum Aussterben der Dinosaurier auf Seite 25 durch! Schreibe zu jedem der vier Erklärungen einen kurzen Absatz! Führe darin deine Vorstellung davon, wie die beschriebenen Ursachen letztlich zu einem Aussterben der Dinosaurier geführt haben, genauer aus!
Stelle dir dazu Fragen wie:
Was verändert sich, wenn viel Staub in der Atmosphäre ist?
Was bedeutet es für ein Lebewesen, wenn seine Eier gefressen werden?
Weshalb sind Temperaturänderungen für Lebewesen allgemein und für Reptilien im Speziellen eine Herausforderung?
Wenn du dir nicht sicher bist, versuche durch gezielte Stichwortsuche im Internet mehr Informationen zu sammeln.
Setzt euch in kleinen Teams zusammen und tauscht eure Gedanken und Schlussfolgerungen aus! Diskutiert und findet für jeden Punkt in der Infobox eine genauere Erklärung, der alle Teammitglieder zustimmen können! Übertrage diese Erklärungen in dein Bioheft! 2


Die Erdneuzeit oder Känozoikum wird in 3 Perioden unterteilt: Paläogen, Neogen und Quartär . In dieser Zeit zerfiel der riesige Südkontinent Gondwanaland weiter.
Nachdem die Dinosaurier am Ende der Kreidezeit ausgestorben waren, konnten sich im Paläogen die Säugetiere rasch weiter entwickeln und die freigewordenen Lebensräume besiedeln. Es entwickelten sich drei Gruppen von Säugetieren: Kloakentiere, Beuteltiere und Plazentatiere.
Kloakentiere
Sie traten erstmals in der mittleren Kreide auf und sind die ursprünglichste Gruppe der Säugetiere. Obwohl sie Säuger sind, legen sie wie Reptilien Eier. Zwei Arten der stacheligen Ameisenigel und eine Art der Schnabeltiere, haben bis heute überlebt. Sie kommen in Australien und Neuguinea vor.

Beuteltiere
Die Beuteltiere sind weiter entwickelt als Kloakentiere. Sie bringen bereits lebende Junge zur Welt. Die größeren Arten halten ihre Jungen in Hauttaschen, bis sie alleine lebensfähig sind. Beuteltiere kommen heute noch in Amerika und Australien vor.

Abb. 2: Känguru
Äon Ära Periode Beginn vor Mio. Jahren
Phanerozoikum
Erdneuzeit/ Känozoikum
Erdmittelalter/Mesozoikum
Erdaltertum/Paläozoikum
Erdurzeit/Präkambrium
Plazentatiere
Die Jungen der Plazentatiere entwickeln sich im Körper des Weibchens und werden von der Plazenta ernährt. Aufgrund des Heranwachsens im Körper des Muttertiers haben die Jungen eine größere Chance zu überleben. Plazentatiere waren besonders erfolgreich und besiedeln heute fast alle Lebensräume.
Plazenta, die: Gewebe in der Gebärmutter, das den Fötus versorgt.
Wo gibt es Beuteltiere? Eurasische Route: Da Beuteltiere sowohl in Amerika als auch in Australien vorkommen, nahm man ursprünglich an, dass die Vorfahren der heutigen Beuteltiere sich von Nordamerika ausgehend über Nordeuropa und Asien nach Australien ausgebreitet hätten.
Abb. 3: Gnu

Im ersten Drittels des Paläogens erwärmte sich das Klima stark, was zum Aussterben vieler der neu entwickelten Säugetierarten führte. Danach kühlte das Klima ab und der erste durchgehende Eisschild der Antarktis bildete sich aus. Im Verlauf des Paläogen entfernten sich die Kontinente weiter voneinander. Pflanzenfressende Säugetiere brachten eine reiche Formenvielfalt hervor wie Nagetiere, Fledertiere, Primaten, frühe Elefanten, Antilopen, Giraffen und Vorfahren unserer Pferde. Rüsseltiere waren die größten Landsäugetiere gegen Ende des Paläogens. Auch Raubtiere wie Wölfe, Bären oder die Säbelzahnkatzen tauchten in dieser Zeit auf. In den Meeren vermehrten sich fleischfressende Haiarten. Einige Säugetiere des Festlandes kehrten ins Meer zurück. So etwa jene Säugetiere, die sich später zu den Walen entwickelten.


Abb. 4: Zeuglodon – ein prähistorischer Wal.
Zahlreiche neue Tiergruppen entstanden: Ameisen, Bienen, Pinguine und Giftschlangen traten erstmals auf. Flussufer und Meeresküsten wurden Lebensraum für neue Vogelfamilien wie Enten, Reiher, Pelikane oder Möwen.


aber erkannte, wie sich die Kontinente im Verlauf von Jahrmillionen verschoben hatten, ging man davon aus, dass sich die Beuteltiere von Norden aus nach Südamerika ausgebreitet hatten. Bevor sich die Kontinente abspalteten, wanderten sie über die Antarktis nach Australien ein





Finde heraus, welche Rüsseltiere es heute auf der Erde gibt! Zählen Vertreter davon zu den größten heute lebenden Landsäugetieren?
Suche Bilder von Säbelzahnkatzen! Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennst du zu heutigen Katzen?

Das Hyracotherium lebte vor ca. 50 Mio. Jahren: Es war etwa 20 cm hoch, hatte an den Vorderbeinen noch 4 und an den Hinterbeinen 3 Zehen.

Der Mesohippus lebte vor ca. 40 Mio. Jahren: Es war bereits 60 cm hoch und hatte nur noch 3 Zehen.

Der Hypohippus lebte vor ca. 15 Mio. Jahren: Es war bereits so groß wie ein Pony, hatte noch 3 Zehen und ging nur noch auf den Zehenspitzen.

Das heutige Pferd, das nur noch eine Zehe hat, gibt es seit etwa 2,5 Mio. Jahren.
Formuliere eine mögliche Erklärung, warum der Meeresspiegel in den Eiszeiten deutlich niedriger war als heute! Kannst du daraus eine mögliche Folge der heutigen Klimaerwärmung ableiten?
Der momentane Klimawandel spielt sich in Zeitdauern von Jahrzehnten ab. Vergleiche das mit den Zeiträumen der Klimaveränderungen im Quartär! Weshalb ist der Unterschied in den Zeiträumen für Lebewesen ein sehr großes Problem? Wohin weichen die Lebewesen heutzutage aus? Sind Gebirge nach wie vor ein Hindernis? Tauscht eure Gedanken in der Klasse aus!
Aufgrund der Bewegungen der Kontinente kam es zur Kollision Afrikas mit Europa und Asien. Dadurch wurden die Alpen aufgefaltet. Zu Beginn des Neogens war die Auffaltung der Alpen abgeschlossen. Als Indien und Asien zusammenstießen, war das der Beginn der Entstehung des Himalajas. Australien und Südamerika blieben isoliert vom Rest der Welt mit ihrer jeweils eigenen, einzigartigen Tierund Pflanzenwelt. Etwa ab der zweiten Hälfte des Neogen hatten die Kontinente in etwa die heutige Lage.
Abb. 5: Lage der Kontinente gegen Ende des Neogen.

Im Neogen und im Quartär folgten mehrere Eiszeiten aufeinander. Weite Teile der Nordhalbkugel lagen unter dicken Gletschern begraben. Der Meeresspiegel war 120 bis 130 m tiefer als heute. Gebiete, die heute vom Meer bedeckt sind, waren während der Eiszeiten trockenes Land. Zwischen Amerika und Asien gab es eine Landbrücke. Über sie konnten sich Tier- und Pflanzenarten ausbreiten. Möglicherweise erfolgte auch die Besiedlung Amerikas durch den frühen Menschen über diese Landbrücke.
Zwischen den Eiszeiten gab es immer wieder Perioden warmen Klimas. Die Wechsel zwischen kaltem und warmem Klima dauerten jeweils viele tausende Jahre. Bei größeren Tieren wie Wollnashörnern, Rentieren und Mammuts entwickelten sich Anpassungen an die Kälte. Andere wanderten in den wärmeren Süden ab. In Europa wurde das Abwandern nach Süden durch den Gebirgszug der Alpen sowie das Mittelmeer behindert. Tierarten, deren Anpassung nicht rasch genug geschah, starben aus.



Manche Lebewesen wie Zwerg-Weide, Schneehase oder das Murmeltier zogen sich nach der letzten Eiszeit ins Hochgebirge zurück, wo sie bis heute überleben konnten.



Erst im letzten Viertel des Neogen, vor 7 bis 8 Mio. Jahren, begann die Stammesgeschichte des Menschen mit der Trennung der Schimpansen- von der Menschenlinie. Der heutige Mensch (Homo sapiens) entwickelte sich vermutlich über mehrere Zwischenformen.
Die Spuren der Bewegungen der großen Gletscher der Eiszeiten sind noch heute an der Erdoberfläche zu erkennen. Durch ihr ungeheures Gewicht schliffen sie mit dem Geröll an ihren Rändern die Oberfläche ab. Viele Täler der Alpen wurden durch Gletscherbewegungen geformt.
Um welche Gruppe von Säugetieren handelt es sich hier? Zu jedem Tier gibt es eine kurze Beschreibung, anhand der du eine Zuordnung treffen kannst. Trage ein D KL = Kloaktentiere, BE = Beuteltiere, PL = Plazentatiere!




Koalas ernähren sich von Eukalyptusblättern. Ihr Name stammt aus der Sprache der Aborigines und bedeutet „ohne Wasser“. Bei der Geburt krabbelt das Junge selbständig aus der Kloake in den Beutel.




Das Schnabeltier ist ein eierlegendes Säugetier aus Australien. Es ist nachtaktiv und kann ausgezeichnet schwimmen. Unter Wasser schließt es seine Augen und Ohrenöffnungen. Der Schwanz dient als Steuer.




Der Kurzschnabeligel bewohnt weite Teile Australiens. Trotz seiner Stacheln ist er nicht mit dem Igel verwandt. Das Weibchen bebrütet das Ei in einem eigens angelegten Beutel am Bauch.





Der Ameisenbär ist nicht mit den Bären verwandt. Sein Lebensraum erstreckt sich über Mittel- und Südamerika. Seine Nahrung besteht aus Ameisen und Termiten. Das Jungtier reitet auf dem Rücken der Mutter.




Das Nordopossum lebt in Nordamerika. Es ist so groß wie eine Hauskatze. Die Weibchen haben einen gut entwickelten Beutel mit meist 13 Zitzen darin, die kreisförmig angeordnet sind.




Der Pfeifhase gibt hohe Töne als Warn- und Erkennungssignal von sich. Pfeifhasen leben in Nordamerika und Asien. Die nackten und hilflosen Neugeborenen wachsen schnell und werden nach 3 bis 4 Wochen entwöhnt.




Der Beutelteufel (Tasmanischer Teufel) ist der größte noch lebende Raubbeutler. Wenn er sich aufregt, kreischt er laut, seine Ohren färben sich rot und er verströmt einen unangenehmen Geruch.




Der Nacktnasenwombat, der in Australien ziemlich weit verbreitet ist, gräbt einen Bau, der viele Tunnel hat. Nach der Geburt verbringen die Jungen die ersten 6 bis 7 Lebensmonate im nach hinten geöffneten Beutel.
Temperaturkurve! Betrachte untenstehende Grafik! Sie stellt die globale Durchschnittstemperatur im Laufe der Erdgeschichte dar. Markiere die Perioden, die du kennen gelernt hast, entlang der Zeitachse mit senkrechten Linien! Markiere dann die klimatischen Ereignisse, die im Text des Buches beschrieben sind und insbesondere auch die Massenaussterben! Notiere dir für jede Periode das Temperaturminimum und das Temperaturmaximum!

12: Globale Durchschnittstemperatur
Religiöses Erbe!
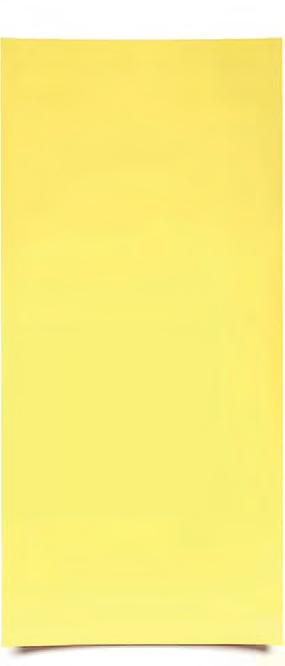

Der Schöpfungsglaube verhinderte lange Zeit, dass Gedanken von einer veränderlichen Natur verfolgt wurden. Die moderne Wissenschaft konnte Beweise dafür liefern, dass Schöpfungsgeschichten die Welt nicht richtig erklären können. Trotzdem gibt es heute noch viele Menschen, die wissenschaftliche Erklärungsmodelle ablehnen und überzeugt sind, dass die Erde und ihre Lebewesen durch einen Schöpfungsakt unveränderlich erschaffen wurden. Man nennt diese Vorstellung Kreationismus (von kreieren = erschaffen). Manche religiösen Gruppierungen, insbesondere in den USA, versuchen den Kreationismus in Schulen als der Evolution gleichgestellte oder als einzig richtige Lehre einzuführen.
Erinnere dich an die erste Klasse und benenne die einzelnen Knochen der Vordergliedmaßen, die du in Abb. 1 in unterschiedlichen Farben erkennen kannst!
homolog: von einer gemeinsamen Urform ableitbar
analog: ähnlich
Recherchiere online ein weiteres Rudiment (rudimentäres Merkmal) des Menschen! Beschreiben seine Herkunft bzw. frühere Funktion! Begründe, warum du dich für die genutzte Quelle entschieden hast!
Stelle Vermutungen an, bei welchen Tieren sich analoge Organe entwickelt haben! Suche Bilder der Organe und beschreibe Ähnlichkeiten und Unterschiede! Vergleicht und besprecht eure Funde in Teams! Tipp: Die Art der Fortbewegung ist ein guter Ausgangspunkt.
Weshalb weisen deiner Meinung nach Tiere, die in gleichen Lebensräumen leben, oft analoge Merkmale auf? Besprich dich mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn!
Die Wissenschaft war lange Zeit von religiösen Vorstellungen geprägt. So nahm man an, dass sämtliche Pflanzen- und Tierarten so erschaffen worden waren, wie wir sie heute kennen und dass sie sich im Laufe der Zeit nicht verändert hatten. Erst im 18. Jh. erkannten Wissenschafter, dass verschiedenartige Lebewesen wie Katze, Fledermaus, Wal, Pferd oder Mensch viele gemeinsame Merkmale besitzen. So haben sie z. B. einen ähnlichen Knochenbau der Gliedmaßen, einen ähnlichen Aufbau des Nervensystems oder ein ähnliches Kreislaufsystem.
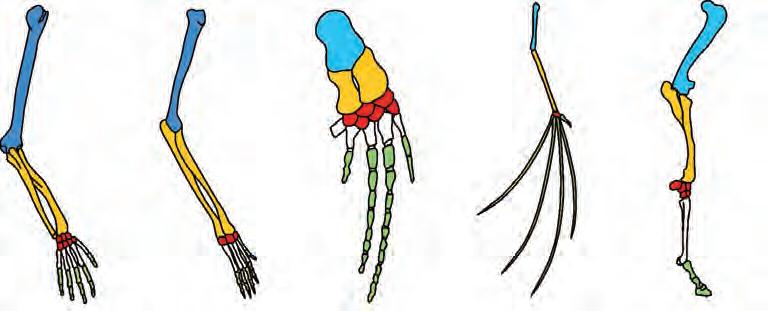
Abb. 1: Homologe Vordergliedmaßen verschiedener Wirbeltiere. Gleich gefärbte Knochenabschnitte entsprechen einander in den verschiedenen Tieren.
Homologe Organe: Die Gliedmaßen verschiedener Wirbeltiere haben zwar verschiedene Aufgaben, aber einen ähnlichen Bauplan. In der Biologie spricht man in diesem Fall von homologen Organen. Sie deuten auf eine gemeinsame Abstammung hin, die auf eine Verwandtschaft der betreffenden Lebewesen schließen lässt.
Rudimentäre Organe: Oft sind diese Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick nicht erkennbar. So hat z. B. eine Riesenschlange keine Beine. Auf einem Röntgenbild oder an einem Skelettpräparat einer Schlange kannst du jedoch Reste von Hinterbeinen sehen. Solche verkümmerten Körperteile, die keine Funktion mehr haben, nennt man rudimentäre Organe. Das Steißbein des Menschen ist ebenfalls ein Rudiment. Es ist der Rest eines früheren Schwanzes.

Abb. 2: Riesenschlangen haben keine Beine.

Abb. 3: Beinüberreste am Skelett.
Analoge Organe: Andererseits haben die Beine eines Käfers und eines Hundes die gleiche Aufgabe, ihre Baupläne aber sind verschieden: Der Hund hat ein Knochenskelett und der Käfer ein Außenskelett aus Chitin. Sie sind also nicht homolog. In diesem Fall sprechen Biologen und Biologinnen von analogen Organen. Sie geben keinen Hinweis auf eine Stammesverwandtschaft, sondern haben sich unabhängig voneinander im Laufe der Evolution entwickelt.


Abb. 4: Schmetterling und Stechmücke sind nicht verwandt. Ihre Rüssel sind analoge Organe zur Nahrungsaufnahme.
Abb. 5: Analoge Vordergliedmaßen bei Hund und Käfer.


Einen weiteren Hinweis auf die gemeinsame Stammesgeschichte von Wirbeltieren liefert der Vergleich der Embryonalentwicklung. Beim Betrachten der Abbildung in der Seitenspalte kannst du sehen, dass zu Beginn der Embryonalentwicklung alle Wirbeltiere ähnlich aussehen. Je weiter ihre Entwicklung aber fortschreitet, desto stärker unterscheiden sich die Embryonen und zeigen die Merkmale des fertigen Tieres.
Homologe und rudimentäre Organe sowie die Ähnlichkeit der Embryonalentwicklung gelten als Beweise für die Evolution. Evolutionstheorien liefern Erklärungsmöglichkeiten für die Entstehung und Weiterentwicklung verschiedener Arten. Sie sind die Grundlage der Abstammungslehre. Mit diesem Wissen und Wissen von Fossilienfunden von Brückentieren wurde ein Stammbaum der Lebewesen erstellt. Auch der Mensch findet in diesem Stammbaum seinen Platz.
Stammbaum der Wirbeltiere
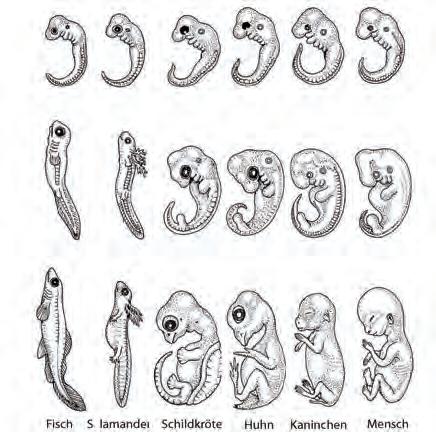
Knorpelfische Quastenflosser Froschlurche Krokodile Eidechsen Säugetiere
Knochenfische Schwanzlurche Schildkröten Schlangen Vögel Menschen Urvogel Saurier
Ursäugetier
Urlurch Quastenflosser Panzerfisch
Urkriechtier
Erdmittelalter Erdneuzeit Erdaltertum
Erdurzeit

Vorstellungen über die Entstehung und Entwicklung der Lebewesen veränderten sich im Laufe der Geschichte. Erst im 18. Jhdt. entstanden erste Theorien, die nicht Gott als Schöpfer annahmen und von der Veränderung der Arten im Laufe der Zeit ausgingen.
Evolutionstheorie
Der Zoologe Jean Baptiste de Lamarck (1744 – 1829) verglich Fossilien mit lebenden Tieren. Er behauptete, dass es für jede heutige Pflanzen- und Tierklasse eine eigene „Urzeugung“ gegeben hat. Seinen Vorstellungen nach nützen Lebewesen jene Organe aktiv, die ihnen beim Überleben helfen, wodurch sich diese im Laufe ihres Lebens stärker ausprägen. Organe, die sie nicht nutzen, verkümmern hingegen. Auf diese Weise im Leben erworbene, veränderte Merkmale werden an Nachkommen weitergegeben. Leben diese unter gleichen Bedingungen, verändern sich die selben Organe weiter. Somit seien die heutigen Arten das Ergebnis einer langen Entwicklung. Lamarck stützte seine Theorie also auf zwei Annahmen:
1. Annahme: Organismen sind fähig, sich im Verlauf ihres Lebens aktiv ihrer Umwelt anzupassen.
Beachte, dass Evolution so ein von den Lebewesen durch ihre Lebensführung aktiv herbeigeführter Vorgang wäre. Spätere Forschungen haben Lamarcks erste Annahmen bestätigt, die zweite hat sich aber als falsch erwiesen. Evolution ist nicht zielgerichtet.
Abb. 6: Embryonalentwicklung bei Wirbeltieren.
Theorie, die: in den Naturwissenschaften eine durch Experimente getestete und bestätigte, wissenschaftliche Erklärung für Vorgänge in der Natur
Urzeugung, die: Entstehung von Lebewesen oder lebenden Zellen aus anorganischen oder organischen Substanzen ohne das Vorhandensein von Eltern. Recherchiere im Internet, welche Erklärungsmodelle zur Entstehung der Welt und des Lebens von verschiedenen Religionen entwickelt wurden! Was können diese Modelle erklären – und was nicht? Warum erschienen sie den Menschen lange Zeit überzeugend? Tauscht euch im Team darüber aus!
Stelle dir den Vorfahren des Straußes als einen Vogel ohne die heutigen typischen Merkmale vor! Nimm an, dieser Vogel kann besser überleben, wenn er gut laufen kann! Formuliere auf Basis von Lamarcks Theorie eine Hypothese zur Entwicklung des heutigen Straußes!
Stelle dir den Vorfahren des Maulwurfs als ein gut sehendes Wesen vor!
2. Annahme: Wenn Organismen während ihres Lebens Eigenschaften oder Merkmale erworben haben, können sie diese an ihre Nachkommen vererben. Fisch Salamander Schildkröte Huhn Kaninchen Mensch
Durch das Jagen unter der Erde hatte er einen Vorteil gegenüber anderen Nahrungskonkurrenten. Nimm an, dass es unter der Erde meist dunkel ist. Formuliere auf Basis von Lamarcks Theorie eine Hypothese zur Entwicklung der heutigen Maulwürfe!
Was ist sexuelle Selektion? Um Merkmale weitergeben zu können, müssen Individuen sich fortpflanzen. Bei sexueller Fortpflanzung müssen sie dafür Partner/innen finden. Die Partnerwahl erfolgt häufig nach Auswahlkriterien. Paarungskämpfe bevorzugen kräftige Individuen und Waffen wie Geweihe oder Stoßzähne. Die Auswahl nach Farbenpracht, besonders ausgeprägten Organen oder Paarungsritualen wie Gesang und Paarungstanz sorgt dafür, dass diese sich durchsetzen. Auch Merkmale, die die Anzahl und Fitness der Nachkommen einer Paarung beeinflussen, verschaffen evolutionäre Vorteile.

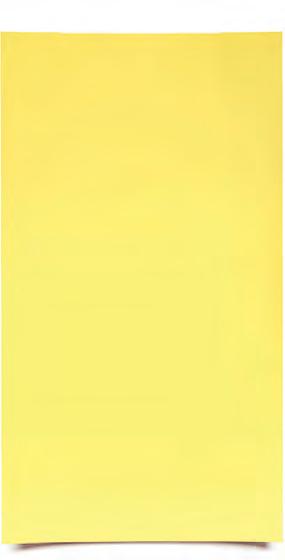



Abb. 9: Feuersalamander gleicher Art a), b) sind unterschiedlich gezeichnet –zufällige Variation. Beim verwandten Alpensalamander c) hat sich eine bestimmte Variation durchgesetzt –Selektion (siehe 2. Klasse weshalb).
Individuum, das: einzelnes Lebewesen
Denke an dein Lieblingstier! Wo und wie lebt es? Welche evolutionären Anpassungen an seine Lebensbedingungen kannst du bei ihm ausmachen?
Stelle dir vor, die Lebensbedingungen deines Lieblingstiers ändern sich stark. Was müsste sich an seinem Körper verändern, damit es gut überleben kann? Tauscht eure Ideen in Kleingruppen aus!
Ein Umbruch in den Vorstellungen zur Evolution wurde vom Biologen Charles Robert Darwin (1809 – 1882) eingeleitet. Seine Theorie baut auf drei Prinzipien auf, die in Beziehung zueinander stehen.
1. Variation: Lebewesen der selben Art unterscheiden sich von Geburt an ein wenig in ihren körperlichen Merkmalen. Diese Unterschiede entstehen zufällig
2. Selektion: Lebewesen sind nach Darwins Theorie einem ständigen Konkurrenzkampf ausgesetzt. Er erkannte, dass manche Individuen Merkmale haben, die ihnen Vorteile bieten. Sie können z. B. Nahrungsquellen besser nutzen oder sich besser vor Feinden schützen. Somit können sie in ihrer Umwelt leichter überleben und sich erfolgreicher fortpflanzen. Sie zeugen also eher Nachkommen als andere Individuen.
3. Fortpflanzung: Durch Fortpflanzung geben Lebewesen die zufällig entstandenen Variationen an ihrer Nachkommen weiter. Der Teil einer Population mit vorteilhaften Merkmalen überlebt eher und pflanzt sich eher fort. So werden vorteilhafte Merkmale zunehmend verbreitet, während nachteilige mit der Zeit verschwinden.
Evolution entsteht also passiv durch Wechselwirkung von zufällig entstandenen Veränderungen von Merkmalen mit den Umwelt- und Lebensbedingungen von Lebewesen.


Abb. 8: Darwin fand auf den Galapagos Inseln eng verwandte Finken Arten mit sehr unterschiedlich geformten Schnäbeln. Bestimmte Formen sind für bestimmte Nahrungsquellen besonders geeignet. Vögel, deren Schnäbel sich durch zufällige Änderungen so formten, waren begünstigt. Links: Großschnabel-Grundfink, rechts: Grüner Warbler-Fink.
Darwins Theorie wird immer wieder falsch als Überleben des Stärksten wiedergegeben. Tatsächlich geht es darum, wer am besten angepasst ist. Das können auch kleine, „schwache“ Lebewesen sein, wie das Überleben der Säugetiere am Ende der Kreide und der große Erfolg der Insekten zeigt. Oft geht es auch um Verhaltensmerkmale. Ein wesentliches evolutionäres Erfolgsmerkmal ist beispielsweise Zusammenarbeit.
Die heutige Evolutionstheorie erweitert Darwins Erkenntnisse um jene der Genetik, Ökologie und dem aus Fossilien gewonnenen Wissen über Verwandtschaftsverhältnisse. Die Genetik erklärt die zufälligen Veränderungen durch plötzliche Veränderungen des Erbguts, genannt Mutationen. Durch sexuelle Fortpflanzung werden die Erbmerkmale der beiden Eltern in den Nachkommen gemischt. Dadurch entstehen neue Kombinationen an Merkmalen. Sexuelle Fortpflanzung erhöht also die Vielfalt und damit die Wahrscheinlichkeit, dass vorteilhafte Merkmale entstehen.
Die Ökologie beschreibt Lebewesen in ihren Lebensräumen. Durch zufällige Ereignisse wie Umweltkatastrophen, Krankheiten, aber auch menschliche Eingriffe wie Verschmutzung können Teile von Populationen und damit ihre Merkmale für die Gesamtpopulation verloren gehen.
Werden Teile von Populationen einer Art, beispielsweise durch Flüsse oder Gebirge, voneinander abgetrennt, können in den Teilen jeweils unterschiedliche Merkmale entstehen, die sich nicht mehr vermischen. Besetzen Teile von Populationen unterschiedliche ökologische Nischen kann sich ihre Lebensführung und ihr Verhalten ändern. Passen Paarungszeiten und Paarungsverhalten nicht mehr zusammen, können sie sich nicht mehr vermischen. All das kann dazu führen, dass neue Arten entstehen.
Von kurz zu lang ohne Übergang! Wie fast alle Säugetiere hat die Giraffe sieben Halswirbel, auch wenn diese viel länger sind als bei Tieren von ähnlicher Größe wie dem Elefanten. Hier siehst du zwei Theorien über die Ursache der Halslänge abgebildet und beschrieben. Entscheide, welche Theorie von Jean Baptiste de Lamarck stammt und welche von Charles Robert Darwin aufgestellt wurde!
Die Vorfahren hatten kurze gleich lange Hälse.





Als das Gras knapp wurde, verlängerte sich durch Strecken der Hals, damit die Giraffen an die Blätter der Bäume herankommen konnten.


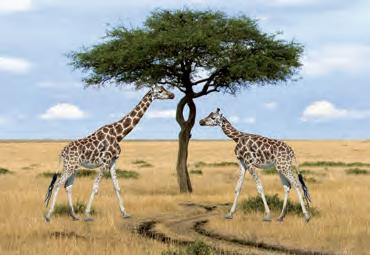


Die Vorfahren hatten von Geburt an verschieden lange Hälse.










D Die erworbene Eigenschaft wird an die Nachkommen vererbt.


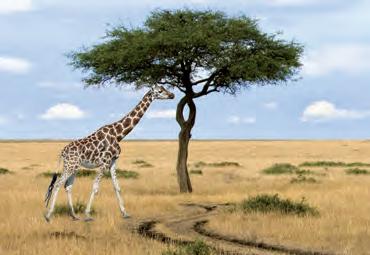




Die natürliche Auslese löschte die Giraffen mit kurzen Hälsen aus, sodass diese sich nicht fortpflanzen konnten. Nur Giraffen mit langem Hals überlebten und gaben diese Eigenschaft an ihre Nachkommen weiter.




Die Natur wählt Individuen mit günstigen Eigenschaften aus.
Theorie stammt von Theorie stammt von
Gute Quellen? Scannt in Zweierteams die QR-Codes und seht euch die Websites an!
Lest jeweils mindestens die ersten beiden Sektionen des Haupttextes! Achtet auf Tatsachenbehauptungen! Werden diese näher erläutert? Findet ihr Informationen darüber, woher diese stammen? Lassen sich Quellen erkennen, auf die sich der Text bezieht? Vergleicht wie einfach es jeweils ist, auf der Seite an weiterführende Informationen zu gelangen! Stehen die jeweiligen Aussagen in Übereinstimmung zu anderen Quellen? Wendet die Methoden auf Seite 14 an, um die beiden Websites zu beurteilen!


Selektion? Menschen haben sehr unterschiedliche Eigenschaften, Stärken, Schwächen und manchmal auch Einschränkungen. Bildet Gruppen und überlegt gemeinsam, wie unsere Gesellschaft damit umgeht! Fragt euch, ob hier ein Überleben der am besten Angepassten vorherrscht, bzw. vorherrschen sollte!
Blättere zum Kapitel Erdzeitalter – Erdurzeit und sieh nach, wie spät der Mensch im Verhältnis zur Entwicklung der Lebewesen in Erscheinung trat!
Gen, das: Erbinformation gespeichert in der DNA.
Unwillkommene Erkenntnis!
Charles Darwin behauptete 1871 als Erster, dass es eine Verwandtschaft des Menschen mit den Affen gibt. Seine Aussage, sie teilen sich gemeinsame Vorfahren, war damals sehr umstritten und wurde ins Lächerliche gezogen.



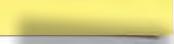
Abb. 3: DarwinKarikatur erschienen 1871 im Magazin „The Hornet“.
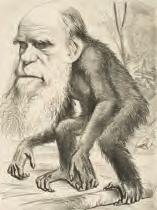

Karikatur, die: Komisch übertriebene Darstellung von Personen, Dingen und gesellschaftlichen Zuständen.
Erkläre, warum es falsch ist zu sagen, dass der Mensch vom Affen abstammt!
Kannst du dir vorstellen, weshalb die Idee einer Verwandtschaft von Mensch und Affe für die Zeitgenossen Darwins so schwer zu akzeptieren war? Wie sieht es heute aus? Diskutiert in Gruppen!


Interessant zu wissen: Unsere Vorfahren, die in der Graslandschaft geblieben waren, mussten sich auf die Hinterbeine stellen, um im hohen Gras Ausschau halten zu können. Dadurch wurden die Hände frei und die Augen verlagerten sich nach vorne. Diese Entwicklung war ein wichtiger Schritt hin zum modernen Menschen.
Fossilienfunde geben Auskunft über die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Aufgrund dieser Funde weiß man heute, dass der Mensch zu den Primaten gehört. Die Primaten sind eine Ordnung in der Klasse der Säugetiere, zu der neben dem Menschen alle heute lebende Affen und Halbaffen gehören. Dies bedeutet, dass die heutigen Affen und der Mensch gemeinsame Vorfahren haben. Moderne biochemische Untersuchungsmethoden wie der Vergleich der DNA von Mensch und anderen Primaten belegen unsere Verwandtschaft mit den heutigen Affen. So stimmt unser Genmaterial zu 99 % mit dem der Schimpansen überein.
Abb. 1: Fossiler Schädel eines Australopithecus.
Die Entwicklung des Menschen und der Affen kannst du dir dabei wie einen verzweigten Ast vorstellen. Der Mensch wäre gemeinsam mit den heute lebenden Affenarten an den äußersten Zweigen zu finden. Innerhalb der Ordnung der Primaten gehört der Mensch zur Familie der Hominiden oder Menschenaffen. Da immer wieder neue Funde hinzukommen, müssen Details der Entwicklungsgeschichte neu überdacht werden, ein reiches Betätigungsfeld für Biologinnen und Biologen.
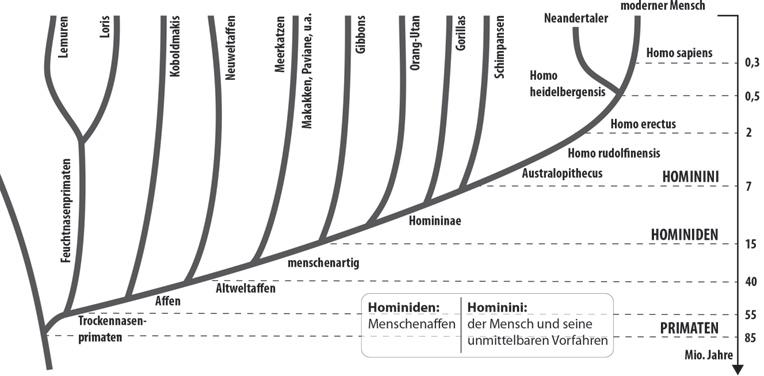
Abb. 2: Nach heutigem Wissen vermutete Entwicklungsstufen des Menschen.
Die gemeinsamen Vorfahren der heutigen Affen und des Menschen lebten vermutlich in Waldgebieten in Ostafrika. Neuere Fossilienfunde legen die Vermutung nahe, dass diese vor etwa sechs bis sieben Millionen Jahren von Europa nach Afrika gewandert sein könnten. Da die Bedingungen für die Erhaltung von Fossilien in dieser Umgebung sehr ungünstig sind, weiß man wenig über sie. Ihre Arme und Beine waren etwa gleich lang, ihre Schädel schimpansenähnlich und ihre Augenwülste gering ausgebildet.
Als es in Afrika zu Klimaveränderungen kam, bildeten sich die Wälder zurück. Einige unserer gemeinsamen Vorfahren folgten den zurückweichenden Wäldern. Diese waren die Vorfahren von Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans. Andere besiedelten das entstehende, savannenähnliche Grasland. Durch die neuen Lebensbedingungen kam es zur Selektion von anderen Merkmalen. So entwickelte sich der aufrechte Gang, wie durch fossilisierte Spuren festgestellt werden konnte. Vor 7 bis 8 Millionen Jahren entstanden aus ihnen die Hominini. Sie umfassen die Arten der Gattung Homo einschließlich des heutigen Menschen sowie deren (ausgestorbenen) direkte Vorfahren nach der Abspaltung der Schimpansen.
Affen und Menschen haben sich seitdem unabhängig voneinander weiterentwickelt, bis sie ihr heutiges Aussehen erlangten.
AUSTRALOPITHECUS: In Süd- und Ostafrika wurden in den letzten Jahrzehnten viele Schädel, Knochen und Fußspuren der Hominini gefunden. Diese Funde belegen, dass in Afrika vor etwa 3,2 Mio. Jahren Hominini lebten, die bereits aufrecht gingen. Man gab ihnen den Namen Australopithecus („südlicher Affenmensch“). Australopithecus wurde 1,1 bis 1,5 m groß und hatte ein Gehirnvolumen von etwa 500 cm3
HOMO RUDOLFENSIS: Vor etwa 2,5 Millionen Jahren lebten in Afrika die ersten Vertreter der Gattung Homo, die bereits aus Holz und Knochen brauchbare Werkzeuge herstellten konnten. Unser direkter Vorfahre war der Homo rudolfensis. Er hatte ein Gehirnvolumen von etwa 750 cm3
HOMO ERECTUS: Der „aufrecht gehende Mensch“ lebte vor ca. 2 Mio. Jahren. Er verwendete bereits Faustkeile und konnte vermutlich mit Feuer umgehen. Er setzte sorgfältig bearbeitete Werkzeuge ein, deren Eigenheiten sich je nach Gegend unterschieden. Vermutlich konnte sich Homo erectus mit seinen Artgenossen durch einfache Laute verständigen. Sein Skelett unterscheidet sich kaum mehr von dem des heutigen Menschen. Er war größer als 1,5 m, hatte aber noch eine fliehende Stirn, große Augenwülste und ein fliehendes Kinn. Das Volumen seines Gehirns betrug bis zu 1 200 cm3. Homo erectus breitete sich von Afrika nach Asien und Europa hin aus.
HOMO SAPIENS: Der „vernunftbegabte Mensch“, trat vor ca. 300 000 Jahren erstmals in Afrika auf und breitete sich langsam über die Erde aus. Werkzeuge aus dieser Zeit waren fein bearbeitet. Der Homo sapiens entwickelte bereits eine höhere Kultur. Höhlenmalereien oder das Bestatten der Toten zeugen davon. Er ist der moderne Mensch, auch wir gehören zu dieser Art. Unser Gehirn hat ein Volumen von ca. 1300 cm3.
NEANDERTALER: Ist ein enger Verwandter des Homo sapiens, jedoch kein Vorfahr des modernen Menschen. Beide Arten entwickelten sich aus dem gemeinsamen Vorfahren Homo erectus. Vor etwa 600 000 Jahren spaltete sich der Homo heidelbergensis vom Homo erectus ab. Aus ihm entwickelte sich vor etwa 300 000 Jahren der Neandertaler Dieser siedelte erst in Europa, ab der letzten Eiszeit auch in Asien. Homo sapiens und Neandertaler kamen dabei in Kontakt. Spätestens am Ende der Eiszeit, vor ca. 40 000 Jahren, dürfte er ausgestorben sein. Als Grund dafür sieht man heute die geringe Zahl an Neandertalern und eine größere Anpassungsfähigkeit und Fortpflanzungsrate des Homo sapiens. Dadurch erfolgte eine langsame Verdrängung des Neandertalers.
Homo, der: Gattung der Menschenaffen (Hominiden), zu der der Mensch und seine nächsten ausgestorbenen Vorfahren gehören, unterscheiden sich vom Australopithecus dadurch, dass sie bereits Werkzeug benutzten.
fliehend: zurückweichend
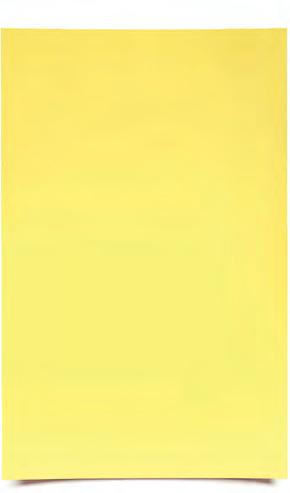

Der sensationelle Fund von „Lucy“! Lange Zeit war man der Ansicht, dass die ersten Hominini vor ca. 2 Mio. Jahren entstanden waren. Dann wurde das 3,2 Mio. Jahre alte Skelett von „Lucy“ in Äthiopien gefunden. Man erkannte, dass es schon wesentlich früher Hominini gegeben hatte. Neuere Funde brachten auch wesentlich ältere Skelettteile von Lucy recht ähnlichen Vorfahren des Menschen zum Vorschein. Es ist jedoch umstritten, ob diese auch zu den Hominini gezählt werden sollten.
Abb. 4: Die Entwicklung der Hominini vom Australopithecus hin zum Menschen.
Aufgrund genetischer Untersuchungen geht man davon aus, dass Neandertaler und Homo Sapiens teilweise gemeinsame Nachfahren gezeugt haben. So trägt der moderne Mensch Gene des Neandertalers in seiner DNA. Das Gehirn des Neandertalers war mit einem Volumen von ca. 1 600 cm3 größer als das des Homo sapiens.
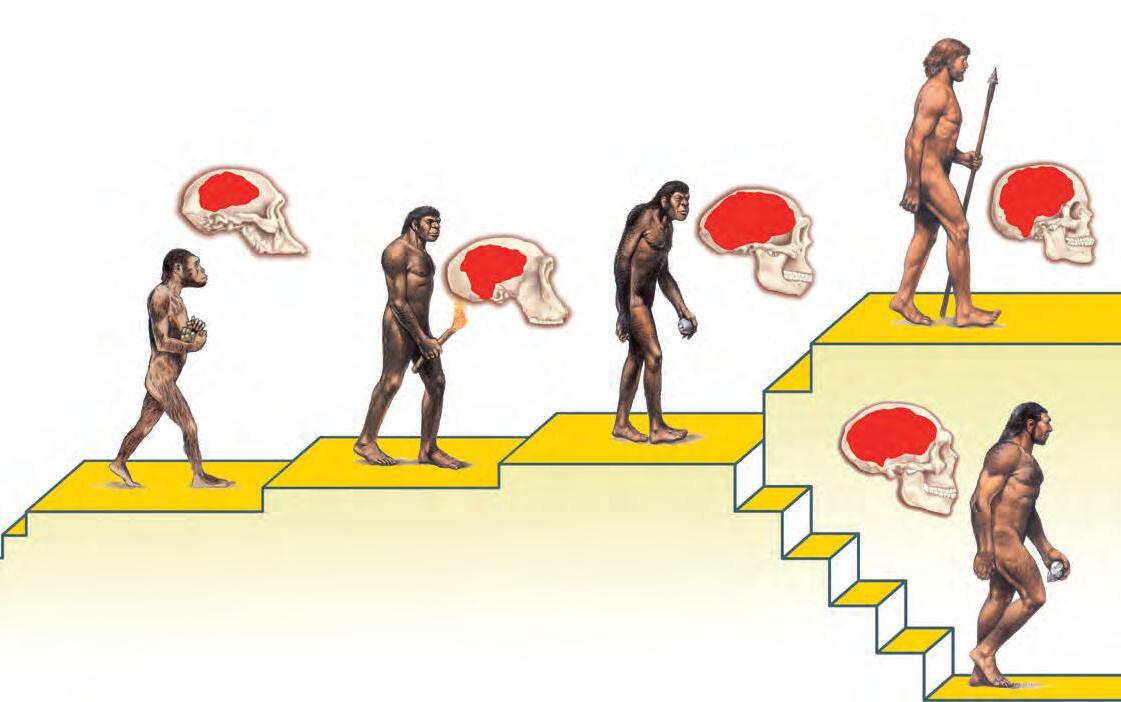
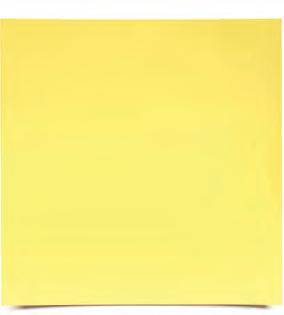
Primaten können greifen! Mit ihren Händen können Primaten Gegenstände greifen. Abgesehen vom Menschen können sie ihren großen Zeh den anderen Zehen gegenüberstellen, also auch mit ihren Füßen greifen. Neben dem Menschen gehören alle heute lebende Affen, Lemuren, und Loris zu den Primaten.

Menschen und Gorillas – Unterschiede zwischen zwei Primaten
Die Art der Fortbewegung ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Menschen und Gorillas. Gorillas sind geschickte Kletterer, die, wenn sie am Boden laufen, ungeschickt wirken. Sie stützen sich meist mit den Armen am Boden ab.



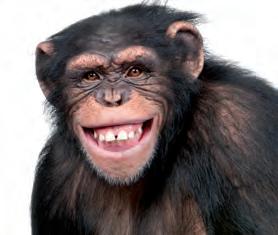
Abb. 8: Verschiedene Primatenarten
Sieh dir die Füße von Mensch und Gorilla genau an! Stelle eine Vermutung auf, weshalb jene des Gorillas nicht so gut zum Gehen geeignet sind!
Der Mensch geht aufrecht. Sein Skelett ist an den aufrechten Gang angepasst. Seine Kniegelenke und die Wirbelsäule können die hohen Belastungen des aufrechten Gangs abfedern. Das Fußgewölbe dämpft die Erschütterungen des Auftretens. Das verbreiterte Becken kann die inneren Organe beim aufrechten Gang besser tragen.
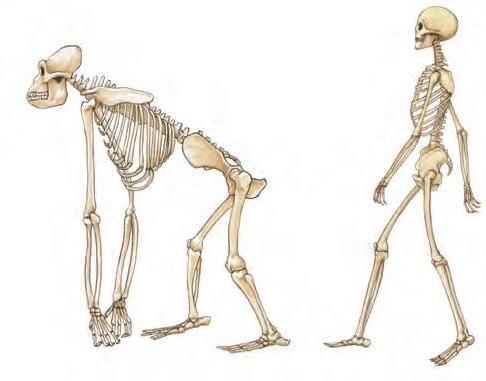
Das Gehirn des Menschen ist etwa 4-mal so groß wie das des Gorillas. Vor allem das Großhirn ist hoch entwickelt. Es ermöglicht, besondere geistige Fähigkeiten wie Denken, Planen und Überlegen oder Lernen besonders gut durchzuführen.
Das Gesicht des Menschen ist eher flach, mit Augenwülsten wesentlich kleiner als die der Gorillas. Gorillas haben große Wülste über den Augen und verlängerte Ober- und Unterkiefer.
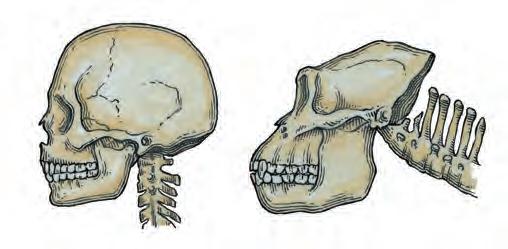
6:
Der Mensch ist sehr geschickt mit seinen Händen. Er hat spezielle Greifhände ausgebildet. Der Daumen ist den anderen Fingern gegenübergestellt. Dadurch können sehr feine Greifbewegungen ausgeführt werden, was die Benutzung von Werkzeug erleichtert. Gorillas haben wesentlich beweglichere Füße. Wie der Daumen des Menschen kann bei ihnen die große Zehe zum Greifen genutzt werden. Sie benötigen diese Fähigkeit zum Klettern.




Abb. 7: Vergleich der Hände und Füße zwischen Mensch und Gorillas. Achte vor allem auf die Unterschiede bei den Füßen.
Der aufrechte Gang, das größere Gehirn und geschickte Greifhände sind die drei Bedingungen für die Menschwerdung. Eine Weiterentwicklung in einem dieser drei Bereiche bewirkt auch einen Fortschritt in den anderen. Durch den aufrechten Gang werden die Hände frei, um sie einzusetzen. Der vielfältige Einsatz der Hände fördert die Entwicklung geistiger Fähigkeiten und lässt den dauerhaften aufrechten Gang lohnender werden. Die Ansichten zur Einzigartigkeit des Menschen und seiner Fähigkeiten haben in den letzten Jahrzehnten einen Wandel erfahren. Forschungen zeigen, dass viele Tiere zu außergewöhnlichen Leistungen, was die Nutzung von Werkzeugen, Lernen, Kommunikation untereinander und soziales Verhalten betrifft, fähig sind.

SÜDOSTASIEN
Abb. 9: Ausbreitung des modernen Menschen über die Erde. Diese konnte aufgrund von Fossilienfunden rekonstruiert werden.
Der moderne Mensch ist heute über die gesamte Erde verbreitet. Menschen sehen aufgrund von Hautfarbe, Körpergröße, Körperbau, Haarfarbe usw. sehr unterschiedlich aus. Da sie in unterschiedlichen Kulturkreisen leben, unterscheiden sie sich auch hinsichtlich Kleidung, Schmuck und Verhalten. Genetisch sind sie einander jedoch sehr ähnlich. Zwei nicht miteinander verwandte Menschen stimmen genetisch zu 99,9 % überein!
BEMERKENSWERT!


Vor etwa 1,2 Mio. Jahren war die Haut aller lebenden Menschen dunkel. Dunkle Haut ist eine Folge des Verlustes der Körperbehaarung und schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung.

Die genetischen Variationen (Abweichungen) innerhalb einer Bevölkerungsgruppe wie den Europäern sind größer als die zwischen verschiedenen Gruppen (Europäer und Afrikaner). Dies bedeutet, zwischen den einzelnen Menschengruppen lassen sich aufgrund von genetischen Unterschieden keine exakten Grenzen feststellen. So gehen 75 % der Farbunterschiede von Haut, Haaren und Augen auf sehr geringe genetische Unterschiede zurück. Der Rest lässt sich auf Umweltfaktoren wie Sonnenlicht, Ernährung usw. zurückführen. Menschen verschiedener Herkunft sind sich aus biologischer Sicht also sehr ähnlich.



Früher wurde versucht, die Menschen in einzelne „Rassen“ einzuteilen. Diese Einteilung wurde oft als Begründung einer Rangordnung zwischen Menschen missbraucht. Diese Rangordnung wurde als Rechtfertigung für Unterdrückung und Ausbeutung zahlreicher Menschen benutzt. Da die biologischen Unterschiede zwischen den Menschen jedoch sehr gering sind und die Grenzen zwischen den Menschen einzelner Gruppen nicht genau festgelegt werden können, ist der Begriff „Rasse“ wissenschaftlich nicht zu halten. Er wird auch von Anthropologinnen und Anthropologen nicht mehr verwendet.
Abb. 10: Menschen unterschiedlicher Herkunft. Kannst du die Region der Erde erahnen, aus der sie stammen?


Wie sieht die Zukunft der menschlichen Entwicklung aus?
Derzeit leben etwas mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ihre Anzahl wird in Zukunft weiter ansteigen. Es wird erwartet, dass bis 2100 etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Danach wird aus heutiger Sicht ein leichter Rückgang der Weltbevölkerung erwartet.
Die natürliche Selektion, die für die Weiterentwicklung von Arten sorgt, wird durch die medizinische Versorgung und durch kulturelle Einflüsse beim Menschen unwirksam. Dies wird zu einer Verlangsamung der Evolution führen. Unklar ist, inwieweit sich der Mensch durch Gentechnologie selbst verändern wird können und so in seine eigenen Evolution eingreift.
genetisch: die Erbanlagen betreffend
Anthropologie, die: beschäftigt sich mit der Lehre vom Menschen
Diskutiert in Teams: Wie lebt der Mensch heute? Welche Hilfsmittel nutzt er, mit welchen Herausforderungen ist er konfrontiert? Welche Veränderungen in der Umwelt oder Gesellschaft fordern Anpassungen vom Menschen –und können solche Veränderungen durch die Evolution bewältigt werden?“
Betrachte dich selber ganz bewusst! Was macht dich aus? Äußerlich, aber auch von deinem Verhalten, deinen Einstellungen und Vorstellungen her! Überlege was davon biologisch bestimmt ist und was nicht!
Merkmale! Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Menschen und Gorillas? Benenne den dargestellten Unterschied und beschreibe, was dieser Unterschied für den Menschen bedeutet!


Unterschied:
Bedeutung:


Unterschied:
Bedeutung:

Unterschied:
Bedeutung:


Vielfalt der Menschheit! Bildet Gruppen aus etwa 5 Schülerinnen und Schülern! Betrachtet noch einmal die Menschen in Abb. 10! Tauscht euch über eure Vorstellungen, Ansichten und Meinungen aus, die ihr mit den Menschen in den Bildern sowie den Völkern, Nationalitäten oder Gruppen, zu denen sie gehören, verbindet! Findet drei weitere Beispiele für Menschen unterschiedlicher Herkunft und sprecht auch darüber! Findet ihr Inspiration in eurer Gruppe?
Notiert anhand eures Gesprächs Antworten auf folgende Fragen:
1. Wie sehen diese Menschen aus? Beachtet körperliche Merkmale, aber auch was sie tragen!
3. Woher stammen eurer Meinung nach etwaige Andersartigkeiten?
2. Was macht ihre Kultur aus? Denkt an Eigenheiten, Gebräuche und Verhaltensweisen die ihr mit den verschiedenen Kulturen verbindet!
4. Welchen Anteil an den Unterschieden haben eurer Meinung nach biologische Faktoren und Evolution? Beachtet die Zeitmaßstäbe in denen Evolution geschieht!
Abschließend präsentiert jede Gruppe kurz ihre Ergebnisse! Nehmt euch alle gemeinsam etwas Zeit, über eure Ergebnisse und Gedanken zu sprechen! Erstellt ein Plakat über ein Miteinander verschiedener Menschen, wie ihr es euch wünscht! 1

5. Wie geht ihr mit Menschen anderer Kulturen als eurer eigenen um und wie wünscht ihr euch, dass Menschen anderer Kulturen mit euch umgehen? Findet Beispiele aus eurem Alltag und stellt euch Begegnungen mit den Menschen, die ihr besprecht vor! Denkt an Hindernisse und Missverständnisse, die vorkommen können! Erarbeitet gemeinsam einen Leitfaden zum Umgang mit Menschen, die fremdartig wirken! Formuliert dazu drei Zielsetzungen, die durch die Anwendung des Leitfadens erreicht werden sollen!
Neue Arten gehen aus alten Arten hervor, indem ein Teil der Population neue Merkmale ausbildet, die sich in ihrer Umwelt bewähren. Die Entwicklung neuer Merkmale ist ein Vorgang über viele Generationen, mit vielen Zwischenstufen kleiner Veränderungen. Deshalb ist es oft nicht einfach zu sagen „jetzt ist das neue Merkmal da“. Erst wenn man Lebewesen, die in größerem zeitlichen Abstand gelebt haben, oder Gruppen, die sich über längere Zeit unabhängig entwickelt haben, vergleicht, lässt sich klar feststellen, hier hat die Evolution etwas neues hervorgebracht.
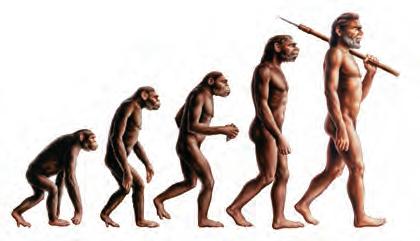
Abb. 1: Häufige Darstellung der Evolution des Menschen. Zwischen den unterschiedenen Arten fanden zahlreiche kleine Zwischenschritte in der Entwicklung statt, die erst nach hunderttausenden von Jahren zu einer „neuen“ Art führten.
Neue Merkmale entwickeln sich also nachvollziehbar aus bereits vorhandenen durch Abwandlung. Alte und neue Art teilen aber weiterhin vorherige gemeinsame Merkmale. Man spricht von Verwandtschaft
Kladogramme
In der Biologie werden Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Arten in sogenannten Kladogrammen dargestellt. Kladogramme zeigen, welche Arten miteinander verwandt sind und durch welche Merkmale sie sich unterscheiden. Verwandte Arten werden in Gruppen zusammengefasst (z.B. Wirbeltiere, Säugetiere). Die Entstehung eines neuen Merkmals wird durch eine Verzweigung im Diagramm angezeigt – eine neue Art oder Gruppe von Arten ist entstanden. Die Lebewesen auf einem Ast der Verzweigung haben das neue Merkmal, die Lebewesen auf dem andern Ast nicht. Ursprünglich vorhandene Merkmale teilen beide Gruppen.
Abb.7 auf Seite 32: Welche Verwandtschaftsverhältnisse und Entwicklungsschritte kannst du ausmachen?
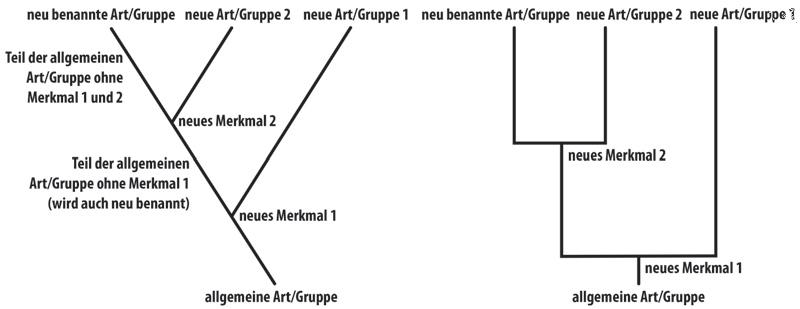
Abb. 2: Grundlegende Darstellungsformen von Kladogrammen. Tritt ein neues Merkmal auf, wird eine Verzweigung gezeichnet. Es wird eine Art/Gruppe unterschieden, die dieses Merkmal hat und eine, die es nicht hat. Entwickelt sich danach ein weiteres neues Merkmal, entsteht eine weitere Verzweigung. Die neue Art/Gruppe 1 hat nur das erste neue Merkmal, die neue Art/Gruppe 2 nur das zweite. Die neuen Arten/Gruppen behalten andere, ursprüngliche Merkmale.
So lassen sich Entwicklungen zurückverfolgen und evolutionäre Verwandtschaften zwischen Arten erkennen.
Es ist oft nicht einfach Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Arten eindeutig festzustellen. Durch stetige Anpassung und Veränderung können verschiedene Nachfahren einer Art auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen, je nachdem auf welche Lebensweise sie sich spezialisiert haben. Umgekehrt können die Nachkommen unterschiedlicher Vorfahren sehr ähnliche Merkmale aufweisen, wenn ihre Lebensräume durch ihre Anforderungen ähnliche Merkmale als Anpassung notwendig machen.
Die Entwicklungsstufen von Arten werden durch Fossilienfunde nachgewiesen. Weshalb ist deiner Meinung nach die Entwicklungsgeschichte der Arten meist nur bruchstückhaft bekannt, während viel durch möglichst schlüssige Vermutungen ergänzt werden muss?
Wieso müssen Populationen einer Art getrennt voneinander leben, damit sich Unterschiede zwischen den Gruppen ausbilden können? Begründe deine Antwort sachlich!
Sieh dir die Abbildungen der Lebewesen in den bisherigen Kapiteln genau an! Suche Merkmale, die sich unterscheiden und als mögliche Verzweigungspunkte in einem Kladogramm dienen könnten! Überlege dir außerdem, welche Funktion diese Merkmale jeweils erfüllt haben könnten! Versuche anschließend, eigene Kladogramme zu skizzieren! Notiere dabei immer die Arten und die jeweiligen Merkmale! Arbeitet zu zweit –das erleichtert die Aufgabe!
Abb. 3: Wie ist deine Vermutung zu diesen Verwandtschaftsverhältnissen? Welche Gemeinsamkeiten sprechen dafür, welche Unterschiede dagegen?




Abb. 3: Jeweils verwandt oder nicht?
Sieh dir Abb. 1 auf Seite 29 an! Beschreibe in einem kurzen Text, weshalb diese sehr unterschiedlichen Gliedmaßen auf einen gemeinsamen Vorfahren schließen lassen!


Das eine Kladogramm?
Wie genau ein Kladogramm aussieht hängt davon ab, welche Merkmale für eine Unterscheidung herangezogen werden. So lassen sich beispielsweise die Säugetiere auch als Nachfahren der Reptilien darstellen. Bei den Schildkröten ist nicht klar, ob das bestimmende Unterscheidungsmerkmal (bestimmte Öffnungen im Schädel) direktes Erbe ist, oder sich erst später hinzuentwickelt hat. Je nach Betrachtungsweise ergeben sich andere Kladogramme. Genanalysen und neue Fossilienfunde bringen ständig neue Erkenntnisse, die oft bisherige Vorstellungen in Frage stellen oder über den Haufen werfen. Die Evolution hat zwar auf eine bestimmte Art stattgefunden, doch diese herauszufinden ist sehr schwierig. Die angenommenen Verwandtschaftsverhältnisse und Einteilungen der Lebewesen werden daher intensiv diskutiert und unterliegen stetigen Anpassungen, während sich unser Verständnis der Evolution Schritt für Schritt verbessert.

Seht euch in der Klasse gemeinsam das Kladogramm der Wirbeltiere auf https://de.wikipedia.org/wiki/ Wirbeltiere an! Bildet Kleingruppen! Jede Gruppe bekommt eine Verzweigung zugewiesen und hat als Hausaufgabe herauszufinden, welche(s) Merkmal(e) zu der Verzweigung geführt haben/hat! Zeichnet dann alle gemeinsam ein Plakat auf dem das Kladogramm mit den jeweiligen Merkmalen dargestellt ist (ähnlich wie in Abb. 5)! Tipp: Die Bezeichnungen im Kladogramm auf Wikipedia sind Links. Über sie kannst du direkt Infos über die verschiedenen Gruppen und ihre Eigenheiten einholen.
Die Kladistik versucht Ordnung und System in die vielen verschiedenen lebenden und ausgestorbenen Arten zu bringen. Dazu teilt sie die Arten in Verwandtschaftsgruppen (Taxa) und versucht nachzuvollziehen, wie die Evolution auf der Erde abgelaufen ist. Die Gruppen beinhalten eine Stammart und alle Arten, die sich aus dieser im Laufe der Zeit entwickelt haben. Alle Merkmale der Nachfahren müssen sich dabei nachvollziehbar aus den Merkmalen der Stammart entwickelt haben. Man nennt das abgeleitete Merkmale. Die grundlegende Struktur der ursprünglichen Merkmale muss also, wenn auch oft versteckt, in den neuen noch nachvollziehbar sein. Ein Beispiel sind homologe Organe. Auch wenn sie sehr unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen, ist ihre Grundstruktur gleichartig. Das lässt darauf schließen, dass sie sich aus einer gemeinsamen Urform entwickelt haben. Die Arten haben also einen gemeinsamen Vorfahren und sind verwandt.
Im Kapitel über das Paläogen hast du bereits Beispiele für die Entwicklung neuer Merkmale, die zu neuen Arten führten, kennengelernt. Abb. 5 stellt diese Entwicklung in einem Kladogramm dar.
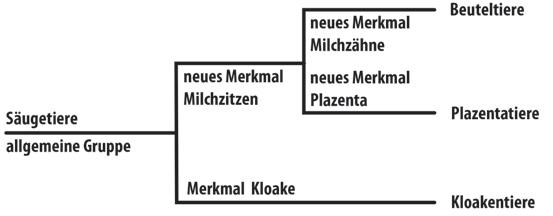
Abb. 4: Stark vereinfachtes Kladogramm der Säugetiere. Die neuen Merkmale sind immer nur in einem Ast der Verzweigung vertreten.
Die Gruppe der Wirbeltiere unterteilt sich durch verschiedene Merkmale in immer kleinere und speziellere Untergruppen. Jede der Untergruppen lässt sich noch weiter unterteilen, bis zu den einzelnen Arten. Kladogramme können sehr umfangreich werden, wenn sie viele Unterteilungsebenen darstellen sollen. Abb. 6. zeigt ein grobes Kladogramm der Wirbeltiere. Einiges darin wird dir bekannt vorkommen. Beachte: Kladogramme können unterschiedlich gezeichnet werden, je nachdem welche Unterscheidungsmerkmale für die Verzweigungen herangezogen werden!
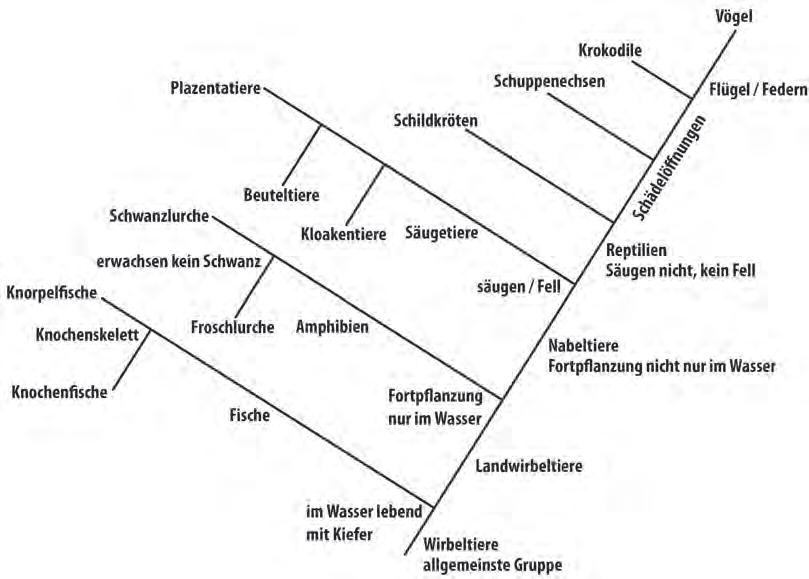
Abb. 5: Kladogramm der Wirbeltiere. Nimm dir Zeit, in Ruhe die Verzweigungen zu studieren.
In der Paläontologie arbeiten Forscherinnen und Forscher der Geologie und Biologie zusammen. Letztere vergleichen Körpereigenschaften und Erbgut fossilisierter Lebewesen, um deren Entwicklung und Verwandtschaftsgrad mithilfe statistischer Methoden zu bestimmen. Aus den Ergebnissen werden Stammbäume und Kladen abgeleitet sowie ein besseres Verständnis der evolutionären Mechanismen und Umweltbedingungen im Laufe der Erdgeschichte ermöglicht.


Eine Untersuchung der in Fossilien erhaltenen Körpermerkmale und Rückstände ermöglicht Rückschlüsse auf die Funktionsweise als auch Lebensvorgänge vergangener Lebewesen. Die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Lebewesen früherer Epochen werden untersucht, um Einblicke in vergangene Ökosysteme zu erhalten. Für die Archäologie ist die richtige Einordnung von tierischen oder pflanzlichen Überresten an Fundstätten ein wichtiger Beitrag zur Datierung von Funden.
Biologinnen und Biologen sind unter anderem in Museen und Ausstellungen tätig, um Sammlungen zu verwalten, die Präsentation zu gestalten und mittels Führungen und Workshops Wissen zu vermitteln. Sie werden hinzugezogen, um ausgestorbene Lebewesen in Filmen, Serien oder Computerspielen realistisch darzustellen.
Organvergleich! Betrachte folgende Bilder genau! Notiere Gemeinsamkeiten und Unterschiede! Was denkst du, handelt es sich um homologe oder analoge Organe? Zu welcher Art von Tier könnten die Organe gehören und welcher Funktion dienen sie? Notiere deine Argumente! Überlege wie du deine Hypothesen prüfen kannst! Diskutiere mit deiner Sitznachbarin, deinem Sitznachbarn und einigt euch auf eine Sichtweise!






Kladogramm zeichnen! Versuche zum folgenden Text ein passendes Kladogramm zu zeichnen!


Manche Arten an Kopffüßern, die Tintenfische, verfügen über einen Tintensack. In Karbon und Kreide lebten Belemniten genannte Tintenfische, die Haken an ihren zehn Fangarmen trugen. Heute lebende Tintenfischarten tragen Saugnäpfe. Viele von ihnen verfügen über zehn Fangarme, so z.B. Sepien und Kalmare. Das Innenskelett der Sepien wird durch den porösen Schulp gebildet. Das Innenskelett der Kalmare aus dem nicht porösen Gladius. Es gibt auch achtarmige Tintenfische. Bei den Cirrentragenden Kraken und Vampirtintenfischähnlichen sind die Fangarme mit Flossen verwachsen. Kraken tragen keine Flossen zwischen ihren Fangarmen.
Fossilien! Besuche ein Museum oder eine Ausstellung, wo Fossilien ausgestellt werden! Zeichne drei Fossilien ab! Betrachte sie genau und beschreibe das fossilisierte Lebewesen! Stelle Vermutungen zu seinem genaueren Aussehen und seiner Lebensweise auf! Es gibt sicher eine Infotafel zu den Fossilien. Fasse die dort gegebenen Informationen zusammen und vergleiche sie mit deinen Beobachtungen und Gedanken!
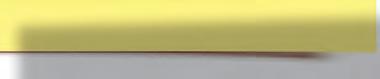



So schätze ich mich nach dem Großkapitel ENTWICKLUNGSGESCHICHTE – ERDE UND LEBEWESEN selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
…die Entstehung des Sonnensystems und der Erde grob nachzeichnen.
…den Aufbau der Erde skizzieren und erklären, was Plattentektonik ist.
…Experimente durchführen, die die Vorgänge der Plattentektonik aufzeigen und Folgewirkungen demonstrieren.
…beschreiben, wie Fossilien entstehen und welche Arten es gibt.
…die Erdzeitalter benennen und ihnen große Neuerungen des Lebens zuordnen.
…erläutern, was Rodinia, Gondwana und Pangäa waren.
…erklären, was ein Leitfossil ist und Beispiele mit zugehöriger Periode nennen.
…zu den Klimaveränderungen im Laufe der Erdgeschichte sowie deren Ursachen und Folgen Stellung nehmen als auch die Zeiträume der Veränderungen mit dem heutigen Klimawandel vergleichen.
…beschreiben, was ein Brückentier ist und Beispiele nennen.
…darüber Auskunft geben, zu welcher Klasse an Lebewesen Saurier gehört haben und welche heute lebenden Tiere ihre Nachfahren sind.
…Theorien zum Aussterben der Dinosaurier anführen und erläutern.



…die drei sich im Paläogen entwickelnden Gruppen von Säugetieren beschreiben.
…erklären, was homologe, analoge und rudimentäre Organe sind sowie Beispiele nennen.
…Darwins Evolutionstheorie erläutern.
…die Entwicklung des Menschen nachzeichnen und wichtige Entwicklungsstufen nennen.
…Kladogramme interpretieren und ihre Bedeutung für die Darstellung von Verwandtschaftsverhältnissen erklären.
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
Luis Feder: Evolution – die nächste Stufe (BoD – Books on Demand 2020).
Harald Lesch, Josef M. Gaßner: Urknall, Weltall und das Leben (Komplett-Media 2017).
Josef H. Reichholf: Evolution: Eine kurze Geschichte von Mensch und Natur (Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG 2016).


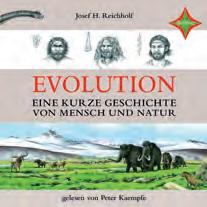


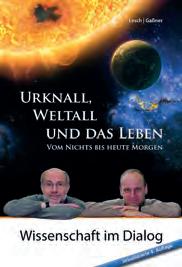
Wenn du Dinge deines täglichen Lebens betrachtest, wird dir auffallen, dass es sich dabei um Materialien sowohl aus der belebten als auch der unbelebten Natur handelt.


Abb. 1: Verschiedene Gegenstände aus deinem Alltagsleben. Sie alle bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Viele davon müssen erst gewonnen und bearbeitet.
Viele der Stoffe, die wir verwenden und benötigen, stammen aus der unbelebten Natur. Sie müssen erst gefunden und gewonnen werden. Die Wissenschaft, die sich mit dem Finden und Gewinnen dieser Rohstoffe beschäftigt, ist die Geologie. Sie erforscht den Aufbau und die Zusammensetzung der Erde und der Gesteinsschichten.
Die Geologie bildet die Grundlage für die Energieversorgung und die Rohstoffversorgung:
2 Gewinnung von Trinkwasser
2 Gewinnung von fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle,
Abb. 1: Welches der beiden Fotos zeigt Gegenstände, die von Lebewesen stammen?
Abb. 2: Aus welchen Materialien bestehen die anderen Gegenstände? Woher stammen diese?
2 Gewinnung von Metallen und Nichtmetallen
2 Gewinnung von Rohstoffen für die Kernenergie
2 Gewinnung von Erdwärme (Geothermie)
2 sichere Nutzung des Untergrundes für bauliche Tätigkeiten
Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die diese Bereiche erforschen, heißen Geologinnen und Geologen. Sie müssen dazu ganz genau über die Gebiete, in denen sie wissenschaftlich tätig sind, Bescheid wissen. Geologinnen und Geologen verwenden oder zeichnen dafür geologische Karten. Diese sind Landkarten, welche die geologischen Verhältnisse eines bestimmten Gebietes darstellen. Das Erstellen solcher Karten wird als geologische Kartierung bezeichnet. Dafür kommen verschiedene technische Untersuchungsmethoden zum Einsatz um den Untergrund zu sondieren. Auch diese Tätigkeit zählt zu den Hauptaufgaben der Geologie. In Österreich sorgt die Geologische Bundesanstalt (GBA) für die geologische Landesaufnahme
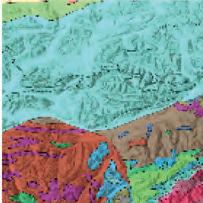



Geo: auf die Erde bezogen; von griechisch Gea: die Erde
fossiler Brennstoff, der: Energie liefernder Stoff, der aus abgestorbenen Pflanzen und Tieren entstanden ist, die vor Millionen von Jahren lebten und nach ihrem Tod in der Erde eingeschlossen wurden.
Schau noch einmal ins Kapitel über Fossilien und erinnere dich, wie es dazu kommt, dass tote Lebewesen in der Erde eingeschlossen werden!
Nichtmetalle, die: sind Stoffe ohne Glanz, die Strom und Wärme schlecht leiten – wie zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenstoff.
Kernenergie, die: Energie, die durch Vorgänge in Atomkernen bestimmter Stoffe entsteht
Erdwärme, die: Wärme, aus dem Erdinneren, die zu einem kleinen Teil auch in den oberen Erdschichten gespeichert ist
Kartierung, die: Erstellen einer Landkarte bzw. Einzeichnen bestimmter wissenschaftlicher Beobachtungen in eine Karte
sondieren: erkunden, untersuchen




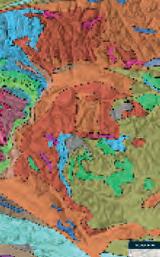
Abb. 2: Geologische Karte des Tauernfensters (schwarz umrandet), eines Teils der Alpen. Die Farben zeigen verschiedene Gesteinsarten an.
Abb. 2: Suche in deinem Atlas das auf der geologischen Karte abgebildete Gebiet! Welche Landschaftsmerkmale findest du dort vor? Kannst du Zusammenhänge mit den Farben erkennen? Tipp: Du kannst dir auch auf Google Maps Geländemerkmale anzeigen lassen!
Informiere dich auf der Homepage der GBA über deren Aufgaben und Forschungstätigkeiten! http://www.geologie.ac.at

Abb. 3: Symbol für eine LKWLadung.
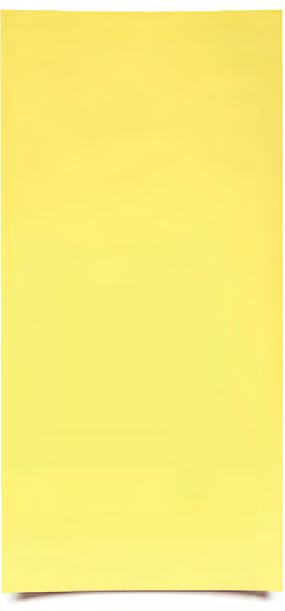

Was sind seltene Erden? Als seltene Erde bezeichnet man eine Gruppe Elemente, die äußerst wichtig für die Elektronik und Hochtechnologie sind. Der Begriff Erde ist historisch bedingt und nicht wörtlich zu nehmen. Die verschiedenen Elemente kommen beispielsweise in Akkumulatoren, Hochleistungsmagneten, Speziallegierungen und -gläsern oder der Medizintechnik zum Einsatz. Der Abbau ist meist aufwendig und mit großen Umweltproblemen verbunden. Da die Förderung häufig in Ländern mit wenig strengen Umweltschutz- und Arbeitsrechtsbedingungen stattfindet, sind die Folgen für Umwelt, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Anwohnerinnen und Anwohner oft gravierend.
Phosphat, das: Salze, die das Element Phosphor enthalten
Überlege, warum in der Tabelle links die Zeile für Holz in grüner Farbe gedruckt wurde!
Was meinst du: Haben sich im Laufe der Geschichte die wichtigsten Rohstoffe verändert? Denke an das, was du bisher im Geschichtsunterricht gelernt hast und was du über vergangene Zeiten weißt! Glaubst du, dass sich die Bedeutung bestimmter Rohstoffe in Zukunft noch einmal verändern wird? Besprich deine Gedanken mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn!
Unser Rohstoffverbrauch
Wie wichtig die Erkenntnisse der Geologie für uns sind, zeigt sich ganz besonders im Zusammenhang mit unserem Bedarf und Verbrauch an Rohstoffen. Durchschnittlich verbraucht jeder Mensch im Laufe von 70 Jahren ungefähr 1 100 Tonnen Rohstoffe, das entspricht fast 55 LKW-Ladungen. Den größten Anteil haben mit 460 Tonnen Sand, Kies und Naturstein für Straßen, Gebäude, Beton und Glas. Dabei ist die Menge an Rohstoffen, die ein Mensch durchschnittlich verbraucht in verschiedenen Regionen der Welt sehr unterschiedlich. Die Menschen in reichen Ländern, wie es auch Österreich ist, verbrauchen ein Vielfaches der Mengen an Rohstoffen, die Menschen in ärmeren Ländern verbrauchen.
Rohstoffe
Sand, Kies, Naturstein 460 t
Stein
Erdöl
Kohle
Eisen



Recherchiere im Internet, welche Umweltfolgen der Abbau von Rohstoffen haben kann! Notiere drei Auswirkungen, die du besonders wichtig findest! Erinnere dich auch daran, was du in der zweiten Klasse schon zu diesem Thema gelernt hast!
Verbrauch in Wichtig für folgende Produkte 70 Lebensjahren
Straßen, Glas, Gebäude, Beton
Mauersteine, Pflastersteine
Benzin, Diesel, Kunststoffe
Heizen (von Kraftwerken zur Stromgewinnung)
Stahl für Autos, Maschinen, Stahlbau
Speisesalz, chemische Industrie
Bauholz, Brennholz, Papierherstellung
Düngemittel, Lebensmittelindustrie
Autobatterien, Autoreifen
Elektronik, Verpackung
Stromleitungen, Drähte







Abb. 4: Einige Rohstoffe sind besonders wichtig, da sie sehr häufig verwendet werden.
Rohstoffe kommen nur sehr selten so in der Natur vor, dass sie direkt genützt werden können. Sie müssen erst gereinigt und aufbereitet, man nennt das raffiniert, werden. Orte, an denen sie gefunden werden und abgebaut werden können, heißen Lagerstätten. Der Abbau von Rohstoffen ist immer mit starken Eingriffen in Lebensräume verbunden.
Welche Rohstoffe nutzt du? Betrachte drei Tage lang Gegenstände deiner Umgebung und notiere jeweils aus welchen Materialien sie bestehen! Triff eine geeignete Einteilung der Materialien und erstelle eine Liste, in der vermerkt ist, wie häufig du jedes Material entdeckt hast!
Versuche herauszufinden, aus welchen Rohstoffen die Materialien hergestellt wurden! Verwende dazu Informationen aus dem Buch wie z.B. die Tabelle auf Seite 46 und eigene Recherche im Internet (z.B. „Was steckt in einem Smartphone“ als Suchanfrage)



2
Mach dir zu folgenden Punkten Gedanken:




Fasse in zwei Tabellen übersichtlich zusammen, wie häufig die jeweiligen Materialien und Rohstoffe in den betrachteten Gegenständen vorgekommen sind. Stelle deine Ergebnisse in einem geeigneten Programm grafisch dar. Tipp: Ihr könnt auch in Kleingruppen arbeiten, so macht es mehr Spaß und ihr könnt euch die Recherche aufteilen.


Wachstum und Wohlstand! Überlege, welche Folgen das weltweite Bevölkerungswachstum und der steigende Wohlstand weltweit für den Rohstoffverbrauch hat! Verknüpfe das mit der Tatsache, dass die Erde nur über eine endliche Menge an Rohstoffen verfügt!

2 Die Erde (und auch das Sonnensystem) verfügt nur über eine endliche Menge an Rohstoffen.
2 Das Ausmaß an Ressourcenverbrauch hängt direkt mit dem Ausstoß von Treibhausgasen, Umweltzerstörung und der Bedrohung von Lebewesen zusammen.
2 Wie reagieren Menschen, wenn es von etwas zu wenig gibt?
Schreib einen kurzen Sachtext mit deinen Überlegungen und möglichen Strategien zum Umgang mit den von dir vermuteten Folgen!
3
Verteilungsgerechtigkeit! Menschen in unterschiedlichen Regionen der Welt verbrauchen sehr unterschiedliche Mengen an Ressourcen. Menschen in wohlhabenden Regionen haben dabei einen um ein Vielfaches höheren Verbrauch als Menschen ärmerer Länder. Im Durchschnitt verbraucht ein Mensch in Europa etwa dreimal so viele Rohstoffe wie ein Mensch in Afrika. Auch das Einkommmen und der persönliche Wohlstand spielen eine große Rolle beim Ressourcenverbrauch. Menschen mit höherem Einkommen verbrauchen viermal so viele Rohstoffe wie jene mit geringem Einkommen.
Mach dir zu folgenden Punkten unter dem Gesichtspunkt von Gerechtigkeit Gedanken:
2 Viele Ressourcen sind endlich.

2 Der Verbrauch erfolgt sehr oft nicht dort, wo die Ressourcen gewonnen werden.
2 Die Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel spüren vor allem Menschen in armen Regionen und Menschen mit geringem Einkommen.
Tauscht in der Klasse eure Gedanken aus und verfasst Handlungsempfehlungen für einen gerechten Umgang mit Rohstoffen! 1


Rohstoffe in Österreich! Lies die Texte über die Rohstoffförderung in Österreich aufmerksam durch!


Obwohl Geologinnen und Geologen vermuten, dass es in Österreich noch 333 Mio. t Braunkohle gibt, wird bei uns seit 2006 keine Kohle mehr abgebaut.
Bei Mittersill in Salzburg wurden 2022 etwa 575 000 t Wolframerz aus dem Gestein gewonnen. Wolfram wird für Glühdrähte verwendet, dient aber auch zur Herstellung von besonders hartem.






In unserem Land werden jährlich etwa 7 Mio. t Kalkstein abgebaut, dieser wird zu Kalk und Zement als Baustoffe weiterverarbeitet.


In Österreich wurden 2022 rund 770 000 t Magnesit abgebaut. Magnesit wird vor allem für die Herstellung von feuerfesten Baustoffen verwendet.
Im Jahr 2022 wurden in Österreich etwa 3 Mio. t eisenhältiges Gestein abgebaut. Die größte Lagerstätte ist der Erzberg in der Steiermark.
In Österreich wird auch Erdöl gefördert. Im Jahr 2022 waren es ca. 520 000 t.



Salz wird bei uns seit vielen tausend Jahren abgebaut. Heute werden jährlich ungefähr 1 Mio. t Salz gewonnen. Neben Speisesalz wird es auch als Rohstoff für die chemische Industrie verwendet.

In unserem Land werden jährlich etwa 8 Milliarden m³ Erdgas verbraucht. Nur etwa 0,6 Milliarden m³ davon werden in Österreich gefördert, der Rest muss aus anderen Ländern eingeführt werden.


Nun finde heraus, welche der Aussagen richtig und welche falsch sind. Wenn du dich immer richtig entschieden hast, erhältst du ein Lösungswort!
Österreich ist eines der wichtigsten Kohleförderländer Europas.
In Österreich wird heute kein Erdöl mehr gefördert.
richtig falsch
M R Magnesit wird zur Herstellung von feuerfesten Baustoffen verwendet.
O N
B H
Das in Österreich geförderte Salz wird ausschließlich als Speisesalz verwendet. E S
Die wichtigste Lagerstätte für Eisen in Österreich liegt in der Steiermark.
2010 wurden bei Mittersill 3 800 t Wolfram abgebaut.
In Österreich wird mehr Erdgas gefördert als verbraucht wird.
Kalk wird für die Herstellung von Baustoffen verwendet.
LÖSUNGSWORT:
T L
O D
U F
F K
Der Gesteinsuntergrund eines bestimmten Ortes ist zwar nicht immer sichtbar, er ist aber stets vorhanden. Direkt sichtbar ist der Gesteinsuntergrund vor allem in Gebirgen, wo die Gesteinsschichten aufgefaltet wurden und nicht von Erde bedeckt sind.


Wenn du dir verschiedene Steine ansiehst, fällt auf, dass sie aus unterschiedlichsten Materialien aufgebaut sind. Das zeigt sich in ihrer Farbe und den Strukturen, die du am Stein erkennen kannst. Diese können sehr unterschiedlich ausgeformt sein und erzählen etwas über die Entstehungsgeschichte des Steins.

Abb. 3: Kiesel aus dem Flussbett eines Wildflusses. Achte auf die unterschiedlichen Färbungen und Strukturen der Steine.

aus,
die nicht immer mit freiem Auge sichtbar sind. Große Kristalle bilden sich aus, wenn Minerale sehr langsam (über Jahrzehnte bis Jahrhunderte) und ohne Störungen erstarren können. Erstarrt das Gestein schnell, haben die Kristalle keine Zeit zu wachsen und bleiben klein.
An fast jedem Ort der Erde kommen ganz charakteristische Gesteine und Mineralien vor. Die Entstehung der Gesteine lässt sich auf drei Vorgänge zurückführen: auf Erstarrung, Ablagerung und Umwandlung
Mineral, das: natürlich vorkommender Festkörper mit einheitlicher chemischer Zusammensetzung, bei dem die einzelnen Atome regelmäßig angeordnet sind.
Erstarrungsgesteine – magmatische Gesteine
Wie du bereits aus dem Kapitel „Aufbau der Erde“ weißt, befinden sich unter den Platten der Erde geschmolzene Gesteinsmassen, das Magma. Gesteine, die durch Abkühlung von flüssigem Magma entstanden sind, nennt man Erstarrungsgesteine oder magmatische Gesteine. Entsteht das Gestein tief im Erdinneren, nennt man es Tiefengestein. An manchen Stellen der Erde kommt das Magma aber direkt an die Oberfläche, z. B. bei Vulkanen. In diesem Fall spricht man von Ergussgestein

Abb. 4: Goldnugget – auch Gold ist ein Mineral.
Kristall, der: Körper, dessen Teilchen (Atome, Moleküle) regelmäßig angeordnet sind.

Abb. 5: Ein groß gewachsener Bergkristall (Quarz).
Abb. 5: Sieh dir den Bergkristall an! Denkst du, er ist in einem schnellen oder langsamen Abkühlungsprozess entstanden?
Versuche dir Situationen zu überlegen, in denen Magma unterschiedlich schnell abkühlt!
Gibt es in deiner Nähe einen Fluss, an dem du Kiesel finden kannst? Begib dich hin und sieh dir verschiedene Steine genau an! Notiere dir unterschiedliche Muster und Strukturen, die du vorfindest! Fertige auch Skizzen und Fotos an!
magmatisch: aus Magma entstanden.
Stricklava, die: erkaltete Lava, die wie nebeneinander liegende Stricke aussieht.
Verwitterung, die: oberflächliche Veränderung von Gestein durch verschiedene chemische und physikalische Vorgänge.

Abb. 11: Durch Frost zerbrochener Stein (physikalische Verwitterung).

Abb. 12: Flechten verändern die Gesteinsoberfläche durch Stoffe, die sie abgeben, chemisch.

Abb. 13: Sandsteinverwitterung

Abb. 14: Geschieht Verwitterung an manchen Stellen stärker als an anderen, können interessante Strukturen entstehen.
Suche in deiner Umgebung Gesteine und achte auf Verwitterungsspuren! Wodurch könnten sie entstanden sein?
Je nachdem, ob das Gestein schnell abgekühlt ist oder die Abkühlung langsam erfolgte, sieht es unterschiedlich aus.


Abb. 6: Durch schnelle Abkühlung entstandene Stricklava




Glimmer

Auch der Ort der Entstehung sowie die Zusammensetzung des Ausgangsmaterials spielen eine große Rolle und lassen unterschiedliche Gesteine entstehen. So kann aus Magma in der Tiefe der kontinentalen Kruste das Tiefengestein Granit entstehen.




Abb. 8: Granit und seine meist drei Bestandteile: Feldspat, Quarz und Glimmer. Die einzelnen Mineralien kristallisieren in, mit dem freien Auge sichtbare, Körner aus. Das gibt dem Granit sein charakteristisches „getupftes“ Aussehen.
Gestein ist an der Erdoberfläche sehr vielen Einflüssen wie Wind, Wasser und Temperaturunterschieden ausgesetzt. Dadurch wird seine Oberfläche verändert. Es zerbricht, zerbröselt, wird abgerundet oder löst sich auf, wir sprechen von Verwitterung. Verwitterung ist der Grund, weshalb Berge an Höhe verlieren und Flussbetten sich mit der Zeit vertiefen können. Falls du schon einmal durch eine Klamm gewandert bist, hast du gesehen, wie Wasser über lange Zeiträume Fels abtragen kann.


Abb. 7: Durch langsamere Abkühlung entstandene Basaltsäulen Abb. 9:


Die durch die verschiedenen Vorgänge verwitterten Gesteine können durch Wasser z.B. in Form von Gewässern oder Gletschereis, aber auch durch Wind weiter transportiert werden. Je weiter der Transportweg, desto kleiner und runder werden die Teilchen, die in der Fachsprache auch „Körner“ genannt werden. Die Bestimmung ihrer Größe, also der Korngröße, ist für die Einteilung der daraus entstehenden Gesteine wichtig.

Bezeichnung Teilchengröße Teilchengröße im Vergleich in mm
Steine ca. 60 – ca. 200 mm größer als ein Hühnerei
Kies grob ca. 20 – ca. 60 mm größer als Haselnüsse mittel ca. 6 – ca. 20 mm Größe zwischen Erbse und Haselnuss fein ca. 2 – ca. 6 mm Größe zwischen Streichholzkopf und Erbse
Sand grob ca. 0,6 – ca. 2 mm Größe zwischen Grieß und Streichholzkopf mittel ca. 0,2 – ca. 0,6 mm Größe ca. wie Grießkörner fein ca. 0,06 – ca. 0,2 mm Größe wie Mehlteilchen
Schluff < 0,06 mm einzelne Teilchen nicht mit freiem Auge
Ton < 0,0002 mm erkennbar
Absatzgesteine
An windgeschützten Stellen oder in ruhigem Wasser können sich die Teilchen ablagern bzw. absetzen. Natürliche Bindemittel wie Ton kleben die Teilchen zusammen, es entstehen daraus Absatzgesteine oder Sedimente.


Abb. 18: Knetarbeit mit frischem Ton.
Erkläre, weshalb Gestein, das durch Wasser oder Wind transportiert wird, kleiner wird! Welche Oberflächenform haben Steine in Bächen und Flüssen meist?
Absatzgestein, das: durch Absetzen und Verfestigung kleiner Teilchen entstandenes Gestein.

Abb. 19: BrezkieSedimentgestein mit eckigen Bestandteilen.
Abb. 15: Schotterbank, entstanden durch natürliche Ablagerung an einem frei fließenden Fluss.


Sandstein entsteht aus verklebten Sandkörnern. Je nach Farbe und Korngröße des Sandes und Art des Bindemittels, kann dabei Gestein unterschiedlicher Farbe und Struktur entstehen. Da Sandstein gut zu bearbeiten ist, wurde Sandstein häufig als Baumaterial und für die Bildhauerei verwendet. Der Stephandsom in Wien wurde, wie viele Kathedralen, zum größten Teil aus Sandstein erbaut.
Kalkgehäuse oder Kalkskelette ehemaliger Lebewesen im Meer verfestigen sich zu Kalkgestein. Auch Kalkstein kommt in vielfältigen Formen vor. Er wird gebrannt und gemahlen zu einer wichtigen Zutat für Beton, ist also für die Bauindustrie von enormer Bedeutung.
Besuche einen Fluss in deiner Umgebung! Sieh dir an wie Steine unterschiedlicher Größe und Erde im Flussbett verteilt sind! Betrachte dazu unterschiedliche Stellen des Flusses und auch wie das Wasser dort fließt! Kannst du Zusammenhänge erkennen? Besprecht eure Erkenntnisse in Teams!

Abb. 20: KonglomeratSedimentgestein mit runden Bestandteilen.
Falls es ein Gebäude aus Sandstein in deiner Umgebung gibt, besuche es! Betrachte den Sandstein genau! Erkennst du Verwitterungsspuren?

Abb. 21: Granate
Metamorphose, die: Umwandlung, Umgestaltung, Verwandlung
Glimmerschiefer, der: metamorphes Gestein, das aus parallelen Schichten besteht.

Abb. 27: Tonfigur nach dem Brennen. Auch beim Brennen wird der Ton verändert.
Gehe zurück zum Kapitel „Aufbau der Erde“! Beantworte mithilfe der dort gegebenen Informationen folgende Fragen:
1. Bei welchen Temperaturen schmelzen Gesteine?
2. Wovon hängt es außerdem ab, ob Gestein bei einer bestimmten Temperatur fest oder flüssig ist?
3. Besteht die ozeanische Kruste in der Nähe der ozeanischen Rücken vor allem aus Erstarrungsgestein, Ablagerungsgestein oder Umwandlungsgestein?
4. Das Gestein welcher der beiden Platten wird beim Aufeinandertreffen einer ozeanischen mit einer kontinentalen Platte aufgeschmolzen?
Umwandlungsgesteine
Durch verschiedenste geologische Vorgänge, vor allem durch plattentektonische Prozesse, werden Gesteine durch hohen Druck und hohe Temperaturen verändert. Bei besonders starken Veränderungen entstehen sogar neue Minerale wie der Granat. Die so entstandenen Gesteine haben eine „Umwandlung“ oder Metamorphose erfahren. Auf diesem Weg können aus Graniten Gneise entstehen, aus Kalk Marmor oder aus tonreichen Sedimenten Glimmerschiefer.



Abtragung, die: in der Geologie –durch Verwitterung locker gewordenes Gesteinsmaterial, das von Wind, Wasser und Schwerkraft in Bewegung versetzt und an andere Orte transportiert wird.
Druckunterschiede und Gesteinsbewegungen lassen sich in metamorphem (umgewandelten) Gestein oft gut nachvollziehen (Abb. 25).
Durch Erstarrung, Gelangen an die Oberfläche, Verwitterung und Ablagerung, Umwandlung und Absenken in die Tiefe (z.B. wenn sich Kontinentalplatten untereinanderschieben) entsteht ein Kreislauf der Gesteine.
Verwitterung und Abtragung

Abb. 25: Metamorpher Schiefer

Zunahme von Druck und Temperatur Abkühlung
Hebung
MAGMATISCHES GE STEIN
Ablagerung (auf dem Festland oder im Meer)
Versenkung, physikalische und chemische Veränderung LOCKERSEDIMENT
SEDIMENTGESTEIN
Temperatur und Druck Temperatur und Druck
METAMORPHES GESTEIN
Abb. 26: Kreislauf der Gesteine
Flüssiges Magma bildet nach seiner Abkühlung Erstarrungsgesteine, die magmatischen Gesteine. Diese verwittern an der Erdoberfläche und werden abgetragen. Die veränderten abgetragenen Teilchen lagern sich ab und verfestigen sich zu Absatzgesteinen, den Sedimentgesteinen. Durch hohen Druck und hohe Temperatur können aus unterschiedlichsten Gesteinen Umwandlungsgesteine, die metamorphen Gesteine entstehen.
2
Welche Gesteine kennst du? Gib die Namen der Gesteine an und ordne sie den Hauptgesteinsarten Errstarrungsgestein, Absatzgestein und Umwandlungsgestein zu!

Name:
Art:



Name:
Art:


Name:
Art:


Name:
Art:

Name:
Art:




Name:
Art:

Geologische Falten! Bilde mit diesem einfachen Modell die Vorgänge in Gesteinsschichten nach! Findet anhand der Versuchsbeschreibungen passende experimentelle Fragestellungen. Formuliert eure Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führt dann die Versuche durch.
Du brauchst: Knetmasse unterschiedlicher Farben % Nudelwalker % Küchenmesser
FRAGE: _______________________________________________________________________________________
VERMUTUNG: _________________________________________________________________________________
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Walke aus den Knetmassen etwa gleich große Platten aus und staple die Platten übereinander!
Nun verforme den Stapel, wie es dir einfällt, verbiegen, verdrehen, an Stellen eindrücken,...!
Dann schneide den Stapel an verschiedenen Stellen vorsichtig von oben nach unten durch und sieh dir die Farbschichtung an!
AUSWERTUNG: Skizziere oder fotografiere die sich ergebenden Strukturen! Verbinde die entstandenen Resultate mit der Art der Verformungen, die du auf den Stapel wirken hast lassen!
Stelle Verbindungen zur Plattentektonik sowie Entstehung und Umwandlung von Gesteinen her! Notiere alles in einem Protokoll! Suche online nach Bildern zu geologischen Falten und vergleiche mit deinem Knetmassenversuch!
Erstelle eine Hypothese zu Abb. 25 auf Seite 52! 1
Finde mögliche Gründe, weshalb für viele Bauwerke unterschiedliche Arten von Gestein verwendet wurden!
Phyllit, der: feinblättriges Gestein; von phyllon, griechisch: Blatt.


Abb. 2: Kalksandstein aus dem Burgenland im Detail.


Abb. 3: Granit eines Kettenständers im Detail.
Suche online Bilder von Phyllit! Finde auch heraus, um welche Art von Gestein es sich handelt! Welche Gesteinsart wird für Dachziegel verwendet?
Finde durch eine Internetsuche heraus, wo im Burgenland Kalksandstein abgebaut wird! Seit wann gibt es den Steinbruch?
Abb. 4: Betrachte das Satellitenbild Österreichs genau! Was kannst du alles darauf entdecken?
Welche Art Gelände befindet sich wo?
Tipp: Gib in deinem Internetbrowser „google.at/maps“ in die Adressleiste ein! Links unten kannst du Satellitenansicht auswählen und alles in größerem Detail betrachten!
Beim Betrachten von Bauwerken aus Stein ist manchmal deutlich zu sehen, dass dafür unterschiedliche Gesteine verwendet wurden. Diese stammen aus unterschiedlichen Gegenden und Ländern.
Auch beim Bau des Wiener Naturhistorischen Museums wurden verschiedene Gesteinsarten verwendet.
Phyllit aus Frankreich
Phyllit aus Großbritannien
Kalksandstein aus dem Burgenland
Figuren aus Marmor unterschiedlicher Herkunft, z. B. aus dem Burgenland
Kalksandstein aus Niederösterreich
Granit aus Oberösterreich


Du siehst, dass die unterschiedlichen Gesteine für unterschiedliche Teile des Gebäudes verwendet wurden. Wenn du das Naturhistorische Museum besuchst, wirst du in seinem Inneren noch weitere Gesteinsarten verbaut finden. Einige der hier verwendeten Gesteine stammen aus Österreich. Da der Gesteinsuntergrund in unserem Land sehr unterschiedlich ist, können aus einzelnen Gebieten unterschiedliche Rohstoffe gewonnen werden.
Ein Satellitenbild oder eine gewöhnliche Landkarte zeigt dir, wie Österreich an der Oberfläche aussieht. Du erkennst Landschaften, Gewässer und Wälder. Auf dem Satellitenbild kannst du jedoch nicht erkennen, welche unterschiedlichen Gesteine unter der Erdoberfläche zu finden sind.
Abb. 4: Satellitenbild von Österreich. Du kannst die Oberflächenbeschaffenheit erkennen, nicht jedoch, was im Untergrund liegt.

Wie du schon gehört hast, wird der geologische Aufbau eines Gebietes oder Landes durch wissenschaftliche geologische Kartierung dargestellt. Unterschiedliche geologische Zonen oder Gesteinszonen und deren Gesteine werden darauf in verschiedenen Farben dargestellt. Um sich auf einer geologischen Karte zurecht zu finden, gibt es wie bei anderen Karten auch Erklärungen in Form von Legenden
Österreich besteht aus drei großen geologischen Einheiten: Der Böhmischen Masse (in der Karte rot markiert), dem Alpenvorland und Beckenlandschaften im Osten des Landes (in der Karte gelb markiert) sowie den Alpen.
Abb. 5: Geologie Österreichs (vereinfachte Übersicht). Jede Farbe entspricht einer Gesteinszone mit charakteristischen Gesteinsarten.
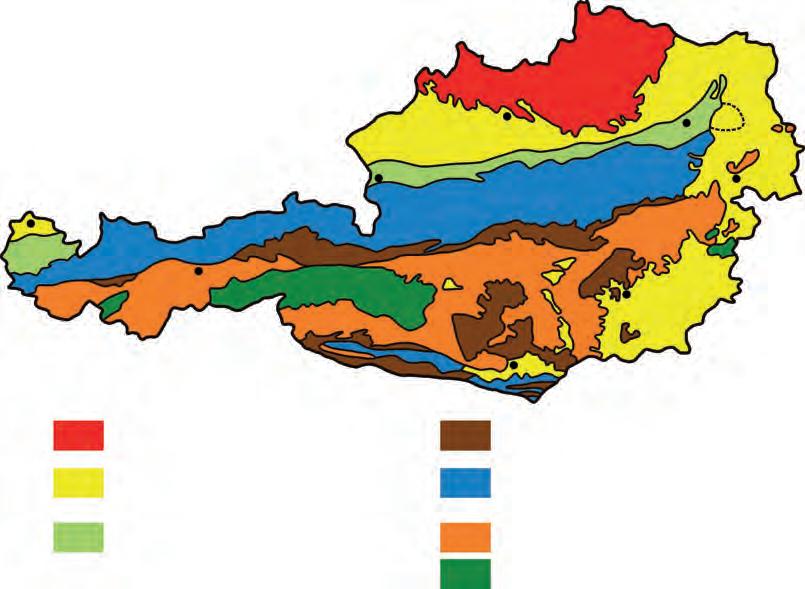
Böhmische Masse
Molassezone
Flysch- oder Sandsteinzone
Zentralalpen mit Tauernfenster
Die Karte zeigt verschiedene geologische Zonen in unterschiedlichen Farben. Diese Zonen bestehen aus charakteristischen Gesteinsarten. Sie sind im jeweils gleichen Zeitabschnitt der Erdentwicklung entstanden. Durch die jeweiligen Gesteinsarten ergibt sich für die entsprechenden Landschaften jeweils ein charakteristisches Aussehen.
Die Böhmische Masse
Die Böhmische Masse ist ein sehr altes Gebirge. Sie ist mehr als 300 Mio. Jahre alt und war einst über 5 000 m hoch. Während der Zeit ihres Bestehens ist die Böhmische Masse durch Abtragung größtenteils abgebaut worden. Heute sind nur mehr die inneren Reste dieses Gebirges zu sehen. Die größtenteils flache Landschaft ist von niedrigen Bergrücken und sanften Tälern geprägt. Hohe Gipfel und schroffe Felswände sind seit langem verwittert. Die Böhmische Masse liegt zum größten Teil in der tschechischen Landschaft Böhmen, von der sie auch ihren Namen hat. Teile dieser Zone befinden sich auch im deutschen Bundesland Bayern. In Österreich gehören Landschaften nördlich der Donau, das Wald- und das Mühlviertel dazu. Granite und Gneise sind die häufigsten Gesteine dieser Landschaft. Sie sind sehr hart und widerstandsfähig, konnten also der Verwitterung am längsten standhalten.
Geologische Zone/ Gesteinszone, die: zusammenhängendes Gebiet, in dem jeweils hauptsächlich ein bestimmtes Gestein vorkommt.
Legende, die: Zeichen- und Farberklärung einer Karte oder eines Plans.
Beckenlandschaft, die: zusammenhängender vertiefter Bereich einer Landschaft.
In welcher der geologischen Zonen bist du zu Hause? Überlege welche Eigenheiten die Landschaft deiner Umgebung zeigt!
Gibt es offen sichtbares, natürliches Gestein in deiner Umgebung? Mache einen Ausflug dorthin und sieh es dir genau an! Mache Fotos und stelle mit deinem schon erlernten Wissen Vermutungen an, um welche Art Gestein es sich handelt und wie es entstanden ist!
Was denkst du? Lassen sich in den unterschiedlichen geologischen Zonen gleiche oder verschiedene Arten von Fossilien finden? Begründe deine Antwort!
In welchem Erdzeitalter ist die Böhmische Masse entstanden? Wie sah es damals auf der Erde aus?
Abb. 6: Gneis in der Wachau. Die harten Gesteinsarten haben überdauert.



Wachau, die: Landschaft in Niederösterreich entlang der Donau.
Molasse, die: Abtragungsmaterial eines Gebirges.
Welche Länder haben
Anteil an den Alpen?
Österreich 28,7%
Italien 27,3%
Frankreich 21,4%
Schweiz 13,2%
Deutschland 5,8%
Slowenien 3,5%
Liechtenstein 0,084%
Monaco 0,001%
Formuliere eine Erklärung, weshalb in der Molassezone Erdöl gefunden werden kann!
†
Suche im Internet nach „Thetys“! Was ist das und was hat es mit den Alpen zu tun? Tipp: Auf der Wikipediaseite dazu findest du ein schönes Video!
Mergel, der: Gestein aus Ton und Kalk.
Hangrutschung, die: abrutschende Erdmassen.
Forme zwei Stücke Ton, drücke sie aneinander und versuche sie gegeneinander zu verschieben! Wiederhole das Ganze, aber befeuchte die Seiten, die du aneinanderdrückst, zunehmend mit Wasser. Was beobachtest du? Formuliere eine Hypothese, weshalb tonhaltige Bodenschichten bei Wasseraufnahme zum Rutschen neigen!
Vor mehr als 50 Millionen Jahren, also im ersten Drittel des Paläogen, befand sich in diesem Gebiet ein Meer, das Molassemeer. In dieses Meer wurde viel Material, das von der Abtragung der Alpen stammte, eingeschwemmt und lagerte sich im Wasser ab. Es entstanden bis zu 5 000 m dicke Schichten aus Schotter, Sanden und Tonen. In solchen Schichten wird heute Erdöl und Erdgas gefunden.

Die Alpen – ein sehr kompliziert gebautes Gebirge


Abb. 11: Hangrutschung in einem Garten in der Flyschzone in Wien, verursacht durch Bauarbeiten am Nachbargrundstück.

Abb. 9: Alpenbogen mit Landesgrenzen. Versuche dir vorzustellen, wie die afrikanische Kontinentalplatte von Süden gegen die europäische stößt und dabei die Alpen auffaltet.
Obwohl Österreich ein kleines Land ist, hat es flächenmäßig den größten Anteil an den Alpen. Die Alpen sind das höchste Gebirge Europas und erstrecken sich bogenförmig von der französischen Mittelmeerküste über die Schweiz und Norditalien bis nach Österreich. Wie du in der geologischen Karte sehen kannst, bestehen die Alpen aus mehreren Zonen: Flyschzone, Grauwackenzone, Kalkalpen und Zentralalpen.
Die Flyschzone bildet einen schmalen Streifen nördlich der Ostalpen. Sie besteht aus Schichten von Sanden, Tonen und Mergeln. Die Sande sind zu hartem Sandstein geworden. Die Mergel und Tone sind weich. Sie nehmen Wasser auf, werden gleitfähig (denke an befeuchteten Ton) und geraten dadurch leicht in Bewegung. Dabei kann es zu größeren Hangrutschungen kommen. Darauf muss bei Bauarbeiten geachtet werden. Daher kommt auch der Begriff Flysch, das Wort hängt mit „fließen“ zusammen. Sandstein wird häufig als Baumaterial verwendet.

Diese Zone ist vor etwa 500 Mio. Jahren entstanden. Sie besteht vor allem aus der sandig-tonigen Grauwacke. Die Gesteine der Grauwackenzone sind meist weich, weshalb rundere Bergformen überwiegen. In der Grauwackenzone kommen Bodenschätze wie Kupfer und Eisen vor, die früher abgebaut wurden. Der Bergbau wurde aber weitgehend eingestellt, da die Vorkommen an Bodenschätzen zum großen Teil aufgebraucht sind und sich der weitere Abbau nicht mehr lohnt. So wird Eisenerz derzeit nur noch am Steirischen Erzberg abgebaut.
Sie bestehen vor allem aus Kalkgesteinen, die in warmen Meeren aus Resten von Pflanzen und Tieren sowie riffaufbauenden Korallen am Meeresgrund entstanden sind. An manchen Orten können solche Lebewesenreste als Fossilien vorgefunden werden. Ein Erbe der ehemaligen Meere sind Salzlagerstätten, die seit mehr als 3 000 Jahren genützt werden und dem Salzkammergut seinen Namen gaben. In Kalk gibt es häufig Höhlen und unterirdische Wasserläufe. Die Kalkalpen sind daher ein wichtiger Trinkwasserspeicher in Österreich. So wird die Bundeshauptstadt Wien mit Wasser aus dieser Zone versorgt.
Die Zentralalpen bilden den größten Teil der österreichischen Gebirge. Der Hauptgesteinsanteil sind Paragneise. Im Tauernfenster sind ursprünglich tiefer gelegene Schichten im Lauf der Erdgeschichte nach oben gehoben worden und bilden nun die oberste Gesteinsschicht. Man spricht von einem geologischen Fenster. In den Zentralalpen liegen die höchsten Gipfel der östlichen Alpen und auch der Großteil der Gletscher. Der mit 3798m höchste Berg Österreichs, der Großglockner, liegt im Tauernfenster. Sein Gipfel liegt direkt an der Grenze zwischen Kärnten und Tirol.



Abb. 12: Steirischer Erzberg. Beachte das Aussehen der Gesteinsschicht im offenen Berg.
Grauwacke, die: Bezeichnung aus dem Bergbau für graue bis graugrüne sandige und tonige Ablagerungen.



Abb. 13: Mieminger Gebirge, nördliche Kalkalpen Tirol. Achte auch hier auf das Gestein und vergleiche es mit dem Erzberg.


Abb. 15: Zentralalpen –Tauernfenster (im Hintergrund der Großglockner)

Zentralalpen
Tauernfenster
Kalkalpen
Abb. 16: Vereinfachter Überblick der Lage des Tauernfensters. Sie dir die verschiedenen Gesteinszonen an und vergleiche mit Abb. 5.
Erz, das: metallhaltiges Gestein, aus dem Metall in reiner Form gewonnen werden kann.

Salz aus Österreich! In Österreich wird schon seit mehreren Tausend Jahren Salz abgebaut. Der Salzbergbau war schon früh wirtschaftliche Grundlage und Quelle des Reichtums für Orte wie Hall in Tirol, Hallein und Hallstatt. Das Wort Hall stammt aus dem Keltischen und bedeutet Salz. In früheren Zeiten wurden per Hand Stollen in den Berg getrieben, um an das Salz zu gelangen. Heute wird noch in Hallstatt, Altaussee und Bad Ischl Salz abgebaut. Dabei kommen moderne Methoden zum Einsatz, so dass pro Tag 3500 Tonnen Salz gewonnen werden können. Du hast wahrscheinlich schon oft Salz aus diesen Bergwerken zu dir genommen. Du hast also Salz aus einem Urmeer gegessen.

Suche auf einer Österreichkarte die Orte Hall in Tirol, Hallein, Hallstatt, Bad Ischl und Altaussee! Vergleiche ihre Lage mit der Karte in Abb. 5! Was fällt dir auf?
Paragneis, der: Gneis, der durch Umwandlung aus Sedimenten entstanden ist.
Geologisches Fenster, das: Stellen, an denen durch Abtragungsvorgänge, Hebung und Erosion Teile des geologischen Untergrunds sichtbar werden.
Erosion, die: Abtragen von Boden durch Wind und Wasser.
Die Geologie Österreichs! Wähle aus dem Kästchen die passenden Überschriften für die Kurzbeschreibung der geologischen Einheiten Österreichs aus und trage sie ein!

In diesem Bereich der Alpen findet man häufig Bodenschätze, die jedoch heute kaum noch abgebaut werden, da sich der Abbau in diesen Lagerstätten nicht mehr lohnt. Der Name leitet sich von der Bezeichnung der Bergleute für graue bis graugrüne sandige und tonige Ablagerungen her.

Die häufigsten Gesteine dieser Zone sind Paragneise. Innerhalb dieser Zone befindet sich ein geologisches Fenster, in dem tiefer gelegene Schichten nach oben geschoben worden sind. Hier findet man die höchsten Berge Österreichs.

Dieser Teil Österreichs ist mehr als 300 Mio. Jahre alt. Der Großteil dieses alten Gebirges wurde bereits abgetragen, sodass nur noch die inneren Reste vorhanden sind. Die vorherrschenden Gesteine sind Granite und Gneise.


Diese Landschaft war früher von einem Meer bedeckt, das bis zu 5 000 m dicke Ablagerungen an Schotter, Sanden und Tonen zurückgelassen hat. Heute findet man dort Erdöl und Erdgas.

Das Gestein in dieser Zone ist vor vielen Mio. Jahren in warmen Meeren aus den Überresten von Pflanzen und Tieren entstanden. Hier gibt es häufig Höhlen und unterirdische Wasserläufe. Dieses Gebiet ist ein wichtiger Trinkwasserspeicher.

Diese Zone besteht vorwiegend aus Schichten von Sanden, Tonen und Mergeln. Aus den Sanden ist harter Sandstein entstanden, die Tone und Mergel sind jedoch sehr weich und können leicht abrutschen.

Studiere das Diagramm! Beantworte dann die Fragen!
a) Wie viele Länder haben Anteil an den Alpen?
Länder
b) Welches Land hat den größten Anteil?
c) Welches Land hat den kleinsten Anteil?
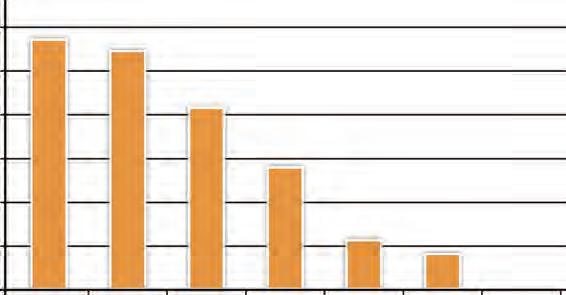
d) In welchen beiden Ländern liegt mehr als die Hälfte der Fläche, die von den Alpen eingenommen wird?
an den Alpen



Die Geologie ist eine sehr vielfältige Wissenschaft, deren Aufgabenbereiche weit über das, für unsere Lebensführung unabdingbare, Auffinden und Nutzbarmachen von Rohstoffen hinausgeht. Die Erforschung der Zusammenhänge, die zur Formung und Veränderung der Erdkruste im Großen und im Kleinen führen, bildet die Grundlage für unser Verständnis des Aufbaus und der geologischen Entwicklung der Erde. Viele Details sind hierbei noch unverstanden und bieten, wie auch die Mineralogie, ein reiches Betätigungsfeld für künftige Forscherinnen und Forscher.
Dieses Wissen ist für die Vorhersage von Erdbeben und Vulkanausbrüchen unabdingbar und seine Anwendung hilft Menschen zu schützen. Ebenso sind Kenntnisse über den Untergrund und seine Eigenschaften notwendig, um Bauvorhaben sicher zu gestalten und Bauten gefährdende Veränderungen des Bodens langfristig zu vermeiden.
Das Gebiet der Astrogeologie befasst sich mit dem Aufbau fremder Himmelskörper. Sie wird im Zuge der ambitionierten Ziele privater Raumfahrt, Rohstoffe außerhalb der Erde zu gewinnen, sehr an Bedeutung gewinnen.
Canyon! Ein Canyon ist eine spezielle Form von Schlucht in Gebieten mit horizontal lagernden Gesteinsschichten. Bilde mit einem Modell die Bildung und Verwitterung eines Canyons nach!
Du brauchst: größeres, durchsichtiges Gefäß mit flachem Boden % genügend Sand, um das Gefäß fast zu füllen % mindestens vier Lebensmittelfarben % Schüsseln und eine kleine Gießkanne oder Plastikbeutel
Teile den Sand in so viele Schüsseln oder Plastikbeutel auf wie du Lebensmittelfarben hast! Gib jeweils einige Tropfen einer der Farben dazu und mische so lange, bis der Sand gleichmäßig gefärbt wird!
Schütte den Sand eine Farbe nach der anderen in die Schüssel, so dass 2–3 cm dicke Farbschichten entstehen!
Fülle nun die Gießkanne oder einen neuen Beutel, bei dem du eine untere Ecke abschneidest mit Wasser und schütte dieses langsam an einer Stelle am Rand über den Sand! Halte das Gefäß leicht schräg, so dass sich ein „Fluss“ ausbilden kann! Gieße solange Wasser über die selbe Stelle bis sich der Fluss einen Weg gegraben hat
Beobachte genau, was passiert und betrachte das Endergebnis. Wie sehen die Wände des Canyons aus?
Fülle die Kanne oder den Beutel wieder mit Wasser und lasse es an einzelnen Stellen oben nahe des Canyon Randes „regnen“! Beobachte, wie sich das Wasser seinen Weg zum Fuße des Canyons bahnt. Findet Erosion statt?
Tropfstein! Tropfsteine entstehen, wenn Wasser beim Versickern Minerale löst und diese beim Verdunsten an Oberflächen, wie beispielsweise Höhlendecken, wieder abgibt. Über längere Zeiträume lagert sich immer mehr Material ab und es wachsen längliche Gebilde – die Tropfsteine. Lasse deinen eigenen Tropfstein wachsen!
Du brauchst: 2 Trinkgläser % 2 Sicherheitsnadeln % ca. 20 cm Wollfaden % Untertasse % Soda
Befülle beide Gläser gleich mit erhitztem Wasser und mische solange Soda dazu, bis sich nichts mehr löst! Rühre dazu immer wieder um!
Befestige die Sicherheitsnadeln an den Enden des Fadens und hänge die je ein Ende in ein Glas!
Stelle die Untertasse unter den hängenden Faden! Richte es so ein, dass der Faden zwischen den Gläsern durchhängt und am tiefsten Punkt einige cm Abstand zur Tasse bleiben!
Warte einige Tage und beobachte, was geschieht!


So schätze ich mich nach dem Großkapitel GEOLOGIE selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
…beschreiben, womit sich die Geologie beschäftigt und weshalb sie für unser tägliches Leben von großer Bedeutung ist.
…über den Verbrauch von Rohstoffen reflektieren und meine Gedanken dazu sachlich in eine Diskussion einbringen.
…Rohstoffe, die in Österreich abgebaut werden, aufzählen.
…beschreiben, was man unter einem Gestein versteht.
…erläutern, durch welche Einflüsse Verwitterung entsteht und Verwitterungsspuren an Gesteinen erkennen.
…erklären, was Erstarrungsgesteine sind und wie sie entstehen.
…erklären, was Sedimentgesteine sind und wie sie entstehen.
…erklären, was Umwandlungsgesteine sind und wie sie entstehen.
…mithilfe eines einfachen Modells die Verformung von Gesteinsschichten experimentell darstellen.
…die drei geologischen Einheiten Österreichs benennen und auf einer Karte anzeigen.
…Eigenheiten der drei geologischen Einheiten Österreichs aufzählen.
…verschiedene Gesteinszonen der Alpen und die jeweils dominierende Gesteinsart benennen
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
Karolin Küntzel: WAS IST WAS Die Erde. Unser einzigartiger Planet (Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG 2024).
Michael Maisch, Werner Fink: Fossilien präparieren: Schritt für Schritt (Quelle & Meyer 2017).



Ronald L. Bonewitz: Steine & Mineralien: Über 500 faszinierende Gesteine, Minerale, Edelsteine und Fossilien (Dorling Kindersley Verlag 2023).



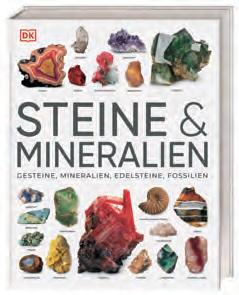
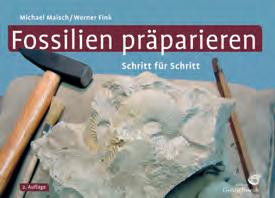

Was
Der Boden verbindet unbelebtes, anorganisches Material, das aus zerkleinertem Gestein besteht, und organisches Material: die Lebewesen. Er ist die oberste Verwitterungsschicht der Erde. In ihm befinden sich Wasser, Luft und Lebewesen.

Abb. 1: Entwicklung vom blanken Fels zum Humusboden.
1. Gestein ist an der Erdoberfläche den Einflüssen von Frost, Hitze, Eis, Wasser und Wind ausgesetzt. Es entstehen Risse und Spalten
2. Diese können von kleinen Lebewesen (Algen, Flechten, Pilze, Moose, Bakterien, kleine Samenpflanzen) besiedelt werden. In den Hohlräumen sammeln sich Staub und Reste von Lebewesen, die vom Wind herangeweht wurden.
anorganisch: nicht von Lebewesen stammend

3. Pflanzenwurzeln dringen immer tiefer ein und sprengen das Gestein. Die Bodenschicht wird langsam dicker. Vom Wind herantransportierte Samen von Gräsern und Kräutern können Wurzeln schlagen. Das Gestein wird durch von den Pflanzenwurzeln ausgeschiedene Stoffe weiter verändert.
4. Es können sich Bäume und Sträucher ansiedeln. Das Gestein zerfällt immer mehr. Abgestorbene Teile von Lebewesen und deren Ausscheidungsprodukte werden von Bodenlebewesen zersetzt und bilden eine Humusschicht. Durch die Wurzelgänge und von kleinen Tieren geschaffenen Hohlräume kann Luft und Wasser im Boden gespeichert werden.
5. Die Wurzeln der Bäume lockern das Gestein in tieferen Bereichen. Die Humusschicht wird dicker und bildet den Nährboden für neue Pflanzen.
Die Bildung des Bodens ist ein sehr langsamer Vorgang und kann mehrere tausend Jahre dauern. Die Dauer hängt wesentlich von der Art des Gesteins, den Witterungsbedingungen und der Neigung des Untergrunds ab. Jahrhunderte von Bodenbildung können durch Starkwetterereignisse wie intensiven Regen rasch zunichte gemacht werden. Die meisten Böden in Österreich sind etwa 6 000 Jahre alt. Aufgrund der geologischen Vielfalt des Untergrunds in Österreich sind auch die Böden in verschiedenen Regionen unterschiedlich zusammengesetzt.


Abb. 2: Boden und sichtbares Gestein an einem Hang im Wald.
Wie nennt man den unter 1. beschriebenen Vorgang?
Lies dir das Kapitel zu Gebirgen in deinem Buch der 2. Klasse durch! Welchen Abschnitt der Bodenbildung findet man im Hochgebirge vor? Weshalb ist eine vollständige Bodenbildung dort kaum möglich? Formuliere eine schlüssige Argumentationskette!
Humus, der: durch die Aktivität der Bodenorganismen entstehende zersetzte Reste abgestorbener Lebewesen im Boden.

Abb. 4: Humus mit Asseln.
Finde und fotografiere in deinem Umfeld Pflanzen, die aus Spalten und Ritzen wachsen! Tipp: Halte nach Mauern, altem Asphalt und Fugen zwischen Bodenplatten Ausschau!
Wiederhole, was du in der 2. Klasse über Nahrungsnetze und Nährstoffkreisläufe in Lebensräumen gelernt hast!


Abb. 5: Fensterfraß (links) und Lochfraß (rechts)
Skelettfraß, der: Vom Blatt sind nur mehr die festeren Bestandteile übrig geblieben. Dabei handelt es sich um die Leitungsbahnen, die ähnlich aussehen wie ein Skelett, daher der Name.


Tausendfüßer, der: Gliederfüßer mit segmentiertem Körper, zwei Beinpaare an jedem Segment.
Segment, das: ringförmiger Abschnitt
Suche in deinem Umfeld Orte natürlichen Bodens mit altem Laub und anderen Pflanzenresten! Betrachte Blätter und Pflanzenreste mit einer Lupe! Stelle ihren Zerfallsgrad fest! Welche Art von Fraß kannst du erkennen? Kannst du auch Destruenten ausmachen? Vergleiche verschiedene Orte! Welche Bedingungen herrschen jeweils? Notiere alles und besprecht eure Funde in kleinen Teams!
Die Zersetzung von organischen Materialien geschieht durch eine Vielzahl an Lebewesen, wie Pilzen, Bakterien und anderen Klein- und Kleinstlebewesen. Man nennt diese Lebewesen Destruenten. Die Blätter, die beim Laubfall auf den Boden gelangen, die Streu, und andere Reste von Lebewesen werden Schritt für Schritt zerkleinert. Sie werden von Bodenlebewesen gefressen und die unverdaulichen Reste ausgeschieden. Aus ihnen wird schließlich Humus, ein wichtiger Bestandteil des Bodens. Viele Bestandteile des Humus werden wieder von Pflanzenwurzeln aufgenommen und ermöglichen Wachstum und das Ausbilden neuer Blätter. So entsteht ein Kreislauf der Nährstoffe. Der Abbau der Blätter erfolgt in mehreren Schritten.

Fensterfraß:
Regen weicht die Blatthaut auf. Springschwänze und Milben fressen die Blattunterseite an und öffnen die Blatthaut.

Lochfraß:
Springschwänze und Milben fressen Löcher. Fliegenlarven befallen das Blatt vom Rand her.
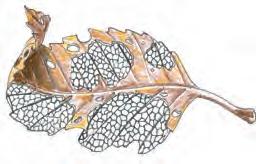
Skelettfraß:
Asseln, Tausendfüßer, Ohrwürmer und Schnecken vergrößern die Löcher und zerkleinern das Blatt weiter
Ausscheidungen, abgestorbene Lebewesen oder Teile von Lebewesen gelangen auf den Boden und sind Nahrung für einige Destruenten. Andere Destruenten, die Mineralisierer, wandeln organische Reste in Mineralstoffe, für Pflanzen wichtige Nährsalze, um. Diese können von den Pflanzenwurzeln aufgenommen und zur Bildung neues Pflanzengewebes genutzt werden. Pflanzen werden von Primärkonsumenten gefressen, verlieren Teile oder sterben ab. Der Kreislauf schließt sich. Die Tätigkeit der Destruenten ermöglicht Wiederverwertung oder Recycling durch im Boden.
Grüne Pflanzen betreiben Fotosynthese D ERZEUGER / Produzenten

Lebewesen, die sich von anderen ernähren D VERBRAUCHER / Konsumenten
organischer Abfall (Reste von Lebewesen, Ausscheidungen) gelangt auf den Boden


Pflanzenwurzeln nehmen die Zersetzungsprodukte von Bakterien und Pilzen (Mineralstoffe) aus dem Boden auf.









Kleine tierische Lebewesen, Bakterien und Pilze zersetzen das organische Material D ZERSETZER / Destruenten
Abb. 8: Der Nährstoffkreislauf des Bodens.
Die die organische Materie zersetzenden Primärkonsumenten stellen nicht nur Nährstoffe für Pflanzen bereit. Sie sind auch Nahrung für andere Tiere und damit bedeutender Teil von Nahrungsnetzen. Böden sind also selbst Lebensraum, bilden aber mit ihren Bewohnern auch einen wichtigen Teil der meisten Lebensräume der Erde.
Bedeutung des Bodens für die Pflanzen
Pflanzen verschiedener heimischer Lebensräume wurzeln meist im Boden. Die Verwurzelung im Boden gibt den Pflanzen Halt. So vermeiden sie, dass sie aufgrund ihres Eigengewichtes beziehungsweise unter der Einwirkung von Wind oder anderen Kräften umfallen.
Über die Wurzeln nehmen Pflanzen Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden auf. Ohne Wasser und Mineralstoffe können Pflanzen nicht überleben. Der Boden ist also eine wichtige Grundlage für das Überleben und Wachstum von Pflanzen.
Abb. 9: Eichensproß, vergrößert Wurzelhärchen






Wiederhole, was du in der 2. Klasse über Pflanzenorgane gelernt hast!
Neben den in der Fotosynthese umgesetzten Stoffen brauchen Pflanzen um zu überleben vor allem die Elemente Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Kalzium und Schwefel. Diese kommen in unterschiedlichen chemischen Verbindungen im Boden vor. Verschiedene Böden beinhalten aufgrund ihrer Zusammensetzung verschiedene Mengen dieser Nährstoffe.
Böden können verschieden sauer sein. Lebewesen im Boden und die Zersetzung organischer Substanzen setzen im Boden CO2 frei, das mit Wasser zu Kohlensäure reagiert. Manche biologischen Prozesse setzen Säuren direkt frei. Saurer Regen und übermäßige Düngung mit Stickstoffverbindungen (Nitraten) erhöhen den Säuregehalt von Böden zusätzlich. Einige Stoffe im Boden können Säuren neutralisieren, sie dienen als Puffer. Wie sauer ein Boden ist, bestimmt, welche Pflanzen darin gut gedeihen. Heidelbeeren, Brombeeren und Erdäpfel bevorzugen eher saure Böden. Die meisten Gemüsesorten wie Tomaten, Karotten und Paprika gedeihen in leicht sauren Böden gut. Salate oder Erdbeeren vertragen keine sauren Böden.


Abb. 10:
a) Lehmböden sind kompakt. b) Sandböden sind locker.
Je nach Zusammensetzung und der Korngröße des verwitterten Gesteins, aus dem Böden bestehen (vergleiche Tabelle S.51), zeigen sie unterschiedliche Eienschaften. Ton- und lehmhaltige Böden bestehen aus sehr kleinen Körnern und sind kompakt. Dadurch halten sie Feuchtigkeit sehr gut. Überschüßiges Wasser kann aber schlecht abfließen und die Böden sind wenig luftdurchlässig. Sandige Böden weisen gröbere Körnung auf. Sie sind vergleichsweise locker und durchlässig für Wasser und Luft. Wie gut die Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden können, hängt von der Bodenfeuchte ab. Staunässe birgt allerdings die Gefahr, dass Wurzeln faulen. Wurzeln brauchen Luft, um zu atmen. Lockerer Boden macht es Wurzeln leichter, sich auszubreiten.
Du siehst, dass in Böden sehr unterschiedliche Bedingungen vorherrschen können. Durch Selektion weisen bestimmte Pflanzen Anpassung an bestimmte Böden vor. Ohne Eingriff des Menschen findet man auf den verschiedenen Bodentarten Pflanzengemeinschaften wie Wälder oder Wiesen, die sich für diese Böden am besten eignen. In Gärten und der Landwirtschaft wird meist aktiv in die Böden eingegriffen um geeignete Bedingungen für die gepflanzten Pflanzen zu schaffen und aufrecht zu erhalten.
Möglichst viel düngen?
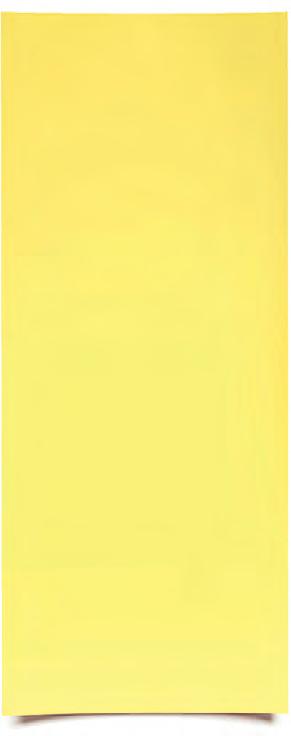

Pflanzenwachstum entzieht dem Boden Nährstoffe. Durch intensive Landwirtschaft werden den Böden Nährstoffe in hohem Maße entzogen. Diese Nährstoffe müssen den Böden wieder zugeführt werden, damit diese nicht auslaugen. Dabei kommen natürlich entstandene Düngemittel wie Jauche oder Kompost und künstlich hergestellte Dünger zum Einsatz. Oft wird allerdings zu viel gedüngt und die Pflanzen können nicht alle Nährstoffe aufnehmen. Durch Regenwasser werden diese dann tiefer in den Boden, ins Grundwasser oder in nahegelegene Gewässer gespült. Insbesondere die in der Massentierhaltung anfallenden Ausscheidungen der Tiere werden häufig übermäßig auf Feldern ausgebracht und belasten den Boden und das Grundwasser.

Wissenstest! Löse folgende Aufgaben zum Themenbereich „Bodenbildung durch Abbau von organischem Material“!
A) Ergänze den Satz!
Die Zerkleinerung der organischen Reste durch Bodenlebewesen ist wichtig, weil
B) Entscheide selbst, ob die Aussage richtig oder falsch ist! Streiche durch, was falsch ist und schreibe eine Begründung!
In natürlichen Lebensräumen sind von den Pflanzen aufgenommene Nährstoffe für die Lebensräume verloren. richtig / falsch, weil
Wenn sich ein Blatt lange genug in der Laubstreu befindet, bleibt oft nur das Blattskelett übrig.
richtig / falsch, weil
Wenn Pflanzen genügend Licht und Wasser haben, ist für alles gesorgt, was sie zum Überleben brauchen.
richtig / falsch, weil
Natürlich oder nicht? Finde in deiner Umgebung Beispiele dafür, wie in Böden eingegriffen wird, um Pflanzenwachstum zu fördern!
Mögliche Orte sind Felder, Gärten, Parks oder auch die Erde in Pflanzentöpfen. Überlege, was du diesbezüglich schon alles beobachtet oder selbst getan hast. Falls möglich, sprich mit Leuten, die für die Pflanzen an diesen Orten zuständig sind.
1) Notiere grob, um welche Art Erde/Boden (z.B. Gartenerde, Ackerboden, Orchideenerde, ...) und Planze(n) es sich handelt.
2) Notiere die Tätigkeiten als auch, soweit feststellbar, ihre Regelmäßigkeit! Stelle zu jeder Tätigkeit eine Hypothese auf, wie diese den Boden verändert!
3) Trage alles in ein Protokoll ein und gib eine Einschätzung ab, wie sehr die jeweiligen Böden in einen natürlichen Kreislauf eingebunden sind!

Gärtnerfreuden! Nimm zu folgenden Beschreibungen Stellung! Beziehe ein, was du über Böden gelernt hast! Fomuliere deiner Meinung nach vorteilhafte Verhaltensweisen!
Jeden Herbst recht Frau Grünbauer das abgefallene Laub und alte Pflanzenreste ihn ihrem Garten penibel zusammen und entsorgt alles im Müll. So ein Garten muss ja in Ordnung gehalten werden, meint sie. Im Frühling lässt sie dann den Gärtner kommen, damit dieser den Boden aufbereitet und düngt. Das kostet zwar viel aber sonst wächst ja nichts meint Frau Grünbauer.

Herr Röhrich mag keine Insekten. Und Würmer schon gar nicht. Eigentlich mag er gar nichts, das kriecht oder krabbelt. Deswegen schaut er, dass sich in seinem Garten möglichst keine Ameisen, Käfer, Würmer, Schnecken oder sonstiges Getier breit machen kann. Das kostet ihn viel Zeit. Zeit, die ihm fehlt, um sich um seine Rosenstöcke zu kümmern. Und die bräuchte er dringend, denn irgendwie werden die nicht so schön, wie bei seinem Nachbarn. Und das, obwohl dieser sehr schlampig mit seinem Garten umgeht.
Der Lebensraum Boden ist Heimat vieler unterschiedlichster Organismen.

Abb. 1: Die obere Bodenschicht beherbergt viel Leben.
Die obersten 30 cm eines Quadratmeters Boden enthalten eine Vielzahl an Lebewesen. Im Durchschnitt sind das – neben vielen anderen:
150 000 Milben
100 000 Springschwänze
200 Regenwürmer
150 Tausendfüßer
50 Asseln
50 Spinnen
100 g Bakterien
100 g Pilze
10 g Einzeller
1 g Algen
In einem Würfel mit 1 cm Kantenlänge befinden sich mehr als 5 Milliarden Lebewesen. Versuche dir das vorzustellen, wenn du das nächste Mal etwas Erde in der Hand hältst. Man nimmt an, dass ein Viertel aller Arten des Planeten Erde in Böden leben.
Humusbildner – typische Destruenten des Bodens
Ein großer Teil der Humusbildner gehört zum Stamm der Gliederfüßer. Einige davon, die auch in Österreich zahlreich vertreten sind, wirst du nun kennen lernen.

Sprunggabel
Springschwänze sind eine Unterklasse der Sechsfüßer. Sie sind Allesfresser. Ihr Name stammt von einer einklappbaren Sprunggabel an ihrem Hinterende.

Hornmilben finden sich besonders häufig im Boden und zählen wie alle Milben zu den Spinnentieren. Sie leben von Falllaub und Bakterien und sind wichtige Humusbildner.

Waldmistkäfer gehören als Käfer zur Klasse der Insekten. Sie ernähren sich von Kot und anderen organischen Materialien. Ihre Eier legen sie in unterirdische Kammern.

Schnurfüßer sind Teil der Doppelfüßer aus dem Unterstamm der Tausendfüßer. Sie ernähren sich von Laubstreu und Totholz, das sie in, für ihre Größe, großen Mengen zu sich nehmen.

Kellerasseln sind wie alle Asseln Krebstiere, die an Land leben. Sie fressen abgestorbene Pflanzenreste und sind wichtige Zerkleinerer und Zersetzer.

Ohrwürmer sind Insekten mit Zangen an ihrem Hinterleib. Diese erinnern an ein Nadelöhr, daher haben die Tiere ihren deutschen Namen. Sie ernähren sich bevorzugt von Pflanzenresten.

Abb. 2: In Waldböden lebt eine Vielzahl verschiedener Schalenamöben.

Abb. 3: Wimperntierchen im Boden ernähren sich vor allem von Bakterien.

Abb. 4: Bodenspinnen jagen andere Tiere.

Abb. 5: Erdläufer werden bis 6 cm lang und ernähren sich von kleinen Bodentieren. Sie sind Gliederfüßer aus der Gruppe der Hundertfüßer.
Hundertfüßer, der: Gliederfüßer mit segmentiertem Körper. Er besitzt je ein Beinpaar pro Segment. Tausendfüßer und Hundertfüßer sind miteinander verwandte „Vielfüßer“
Nadelöhr, das: Öffnung einer Nähnadel
Welche Arten an Gliederfüßern hast du in der zweiten Klasse kennengelernt? Zu welcher großen Gruppe an Tieren gehören sie?
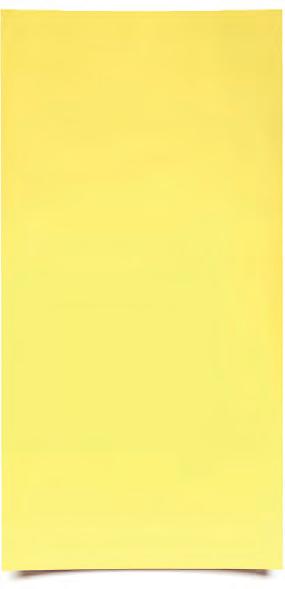
Wie beobachte ich Bodentiere?

Die kleinen Bewohner der Streuschicht mögen kein Licht. Mit einer Bodentierfalle kannst du sie in einem Behälter sammeln und betrachten. Dazu legst du ein Sieb in einen Trichter, der in einem Glas steckt (siehe Abb. 6). In das Sieb füllst du Erde, die du auf Bodenbewohner untersuchen möchtest. Bescheinst du die Erde von oben mit hellem Licht, flüchten die Bodenbewohner nach unten und plumpsen durch den Trichter in das Glas. Von dort kannst du sie in eine flache Schale legen und beobachten. Zur Betrachtung verwendest du am besten eine Lupe, die meisten Bodentiere sind sehr klein.

Begründe, weshalb Tiere wie der Steinläufer und der Pseudoskorpion wichtig für das biologische Gleichgewicht im Boden sind! Tipp: Denke daran, was du im letzten Jahr über Ökosysteme gelernt hast!
Weshalb ist es problematisch, wenn eine größere Zahl an Bodenbewohnern durch Schadoder Giftstoffe getötet oder vertrieben wird? Stelle dir Situationen vor, in denen dies geschieht! Versucht in Teams Möglichkeiten zu finden, solche Situationen zu vermeiden!
Finde heraus, wie im Boden lebende Wirbeltiere zu gesunden Böden beitragen!

Saftkugler zählen zur Klasse der Doppelfüßer. Sie ernähren sich von toter pflanzlicher Substanz.

Rosenkäferlarven sind als Käfer Insekten. Sie ernähren sich von toten Pflanzenteilen und leben z.B. in Komposthaufen. Du kennst sie vielleicht als Engerling.

Bandfüßer zählen zur Klasse der Doppelfüßer. Sie ernähren sich von sich zersetzendem organischen Material.

Fliegenlarven sind ebenfalls Insekten. Da sie als erwachsene Tiere zwei Flügel haben, zählen sie zu den Zweiflüglern. Sie ernähren sich von Bodenstreu und anderen organischen Materialien.
Beutegreifer fressen andere Bodentiere und beeinflussen deren Anzahl.

Steinläufer werden ca. 3 cm lang und zählen zu den Hundertfüßern, einer Klasse der Tausendfüßer. Sie jagen Insekten, Spinnen, Asseln, Tausendfüßer und Regenwürmer, die sie mit ihren Giftklauen erlegen.

Der Pseudoskorpion ist kein Skorpion. Er hat keinen Giftstachel. Pseudoskorpione zählen zu den Spinnentieren. Sie fangen ihre Beute mit ihren Giftzangen. Bei uns gibt es etwa 40 Arten von Pseudoskorpionen.
Von großer Bedeutung für den Boden sind die Ringelwürmer. Sie sind wesentlich an der Umwälzung und Auflockerung der Böden beteiligt. Der bekannteste Vertreter aus dem Stamm der Ringelwürmer ist der Regenwurm. Ihn hast du in der zweiten Klasse schon ausführlicher kennengelernt. Neben den kleinen wirbellosen Tieren, gibt es auch Wirbeltiere, die im Boden leben. Entweder dauerhaft, wie beispielsweise Maulwürfe, oder zum Schlafen und der Aufzucht von Jungen, wie beispielsweise Feldmäuse. Auch sie tragen zu gesunden Böden und einem stabilen Nahrungsnetz bei.
Du hast in der zweiten Klasse schon einiges über die verschiedenen Arten von Mikroorganismen gehört. In Böden sind sie sehr zahlreich vertreten und übernehmen dort wichtige Aufgaben, vorwiegend als Destruenten.
Mikroorganismen im Boden
Mikroorganismen sind die mit Abstand häufigsten Lebewesen auf der Erde und so auch im Boden. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil jedes Lebensraumes und ganz wesentlich daran beteiligt, das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Algen verbindest du wahrscheinlich mit Wasser. Aber auch im Boden lebt eine Vielzahl an Algen. Als Fotosynthese betreibende Lebewesen sind sie Primärproduzenten, ernähren sich also von anorganischen Stoffen und tragen als Nahrung vieler Bodenbewohner zur Basis der Nahrungsnetze bei. Im Boden lebende Algen sind vor allem Grünalgen, Kieselalgen und Gelbgrüne Algen. Auch Fotosynthese betreibende Bakterien, die Cyanobakterien (früher Blaualgen genannt) leben zahlreich im Boden. Sie binden Stickstoff aus der Luft, der ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen ist. Da mit zunehmender Tiefe im Boden das Licht rasch weniger wird, wird angenommen, dass einige Arten sich auch über die Aufnahme von organischen Stoffen ernähren können.


Abb. 7: Grünalgen im Boden sind meist fadenförmig oder rundlich.

Abb. 8: Mehrzellige Cyanobakterien bilden Fäden oder Flächen.
Fasse kurz zusammen, was du in der 2. Klasse gelernt hast! Was hält Ökosysteme im Gleichgewicht und was kann das Gleichgewicht stören?
Begründe, weshalb Bodenalgen nur in den obersten Bodenschichten bis etwa 10 cm leben!
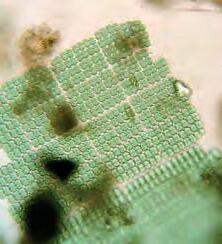
Pilze durchziehen mit ihren Myzelfäden den Boden und zersetzen organisches Material. Die dabei frei werdende Nährstoffe stehen Pflanzen und Algen zur Verfügung. Pilze sind also wesentlich um den Nährstoffkreislauf zu schließen. Rund 90% der Pflanzen leben in Symbiose mit Pilzen. Die Pilze umschließen mit ihrem Myzel die feinen Wurzelhärchen der Pflanzen und dringen teilweise in sie ein. Die Pflanze kann so über das Pilzmyzel auf Nährstoffe, vor allem Phosphor und Stickstoff, zugreifen. Die Oberfläche zur Nährstoffaufnahme vergrößert sich dabei um etwa das Hundertfache. Auch die Aufnahme von Wasser wird so für die Pflanzen erleichtert. Die Pilze erhalten wiederum Zucker und Stärke, die sie nicht selbst herstellen können. Die Beziehungen zwischen Pilzen und Pflanzen sind allerdings nicht immer von gegenseitigem Nutzen. Manche Pilze greifen ihre Partnerpflanzen auch an, wenn diese durch Umwelteinflüsse geschwächt sind und benutzen sie als Nahrung. Aus der Symbiose wird Parasitismus.



Abb. 9: Myzel eines weißen Champignons im Boden. Achte darauf, wie sich die Hyphen um das organische Material (braun) schlingen, um es zu verdauen.
Die Fäden des Myzels (Hyphen) sind von einer Schleimschicht umgeben. Bakterien brauchen zur Fortbewegung eine Flüssigkeitsschicht, in der sie sich bewegen können. Erde mit trockenen Bereichen und Lufteinschlüssen ist für sie ein unüberwindliches Hindernis. Das Myzelnetzwerk der Pilze bietet den Bakterien mit seiner Schleimschicht eine hervorragende Möglichkeit der Fortbewegung. Es ist vergleichbar mit einem Straßennetz für Bakterien, über das sie sich schnell und ungehindert durch den Boden bewegen können.

Abb. 10: Myzel an den feinen Wurzelenden einer Pflanze.
Denke daran, woraus Pflanzen Zucker herstellen! Verbinde dieses Wissen damit, dass Pflanzen im Zuge ihrer Symbiose Zucker an Pilze abgeben! Erläutere in einem kurzen Text, wieso Pilze eine Bedeutung für den Klimawandel haben!
Anpassung im Gedränge! Auf dem Pilzmyzel herrscht oft reger Bakterienverkehr und damit ein ziemliches Gedränge. Während ihrer Fortbewegung auf dem Myzel kommen die Bakterien in engen Kontakt miteinander. Dabei können sie Genmaterial austauschen. Das neue Genmaterial ermöglicht es Bakterien, sich rascher weiterzuentwickeln und an neue Umweltbedingungen anzupassen. Das Pilzmyzel wirkt also beschleunigend auf die Evolution der Bodenbakterien.

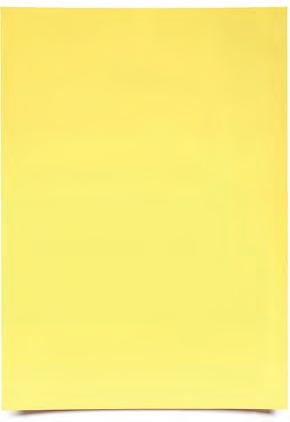
Scanne den QR-Code und sieh dir Bakterien auf einer Myzelautobahn an! Die Bewegung wird in Echtzeit, also unbeschleunigt gezeigt. Stelle eine Vermutung an, was sich da innerhalb der Hyphe im Video bewegt!

Versuche in der Natur deiner Umgebung altes Totholz zu finden! Umgestürzte Bäume oder Baumstümpfe eignen sich gut. Versuche am und im Holz Pilze ausfindig zu machen! Verwende eine Lupe und brich gegebenenfalls etwas Holz auf! Tipp: Wo Fruchtkörper sind, ist Myzel nicht weit.
Erinnere dich an die Bodenbildung! Weshalb sind Bakterien Pioniere, wenn es darum geht, Boden aufzubauen?
Weshalb stellen lang anhaltende Trockenzeiten, wie sie durch den Klimawandel vermehrt vorkommen, für Pflanzen ein doppeltes Problem dar? Denke dabei an Nährstoffe!
Enzym, das: Ein Stoff, der chemische Reaktionen im Körper erleichtern und beschleunigen kann. Sie sind wichtig, um viele Reaktionen überhaupt zu ermöglichen. Man nennt solche Stoffe allgemein auch Katalysator. Du wirst in Chemie mehr darüber lernen.
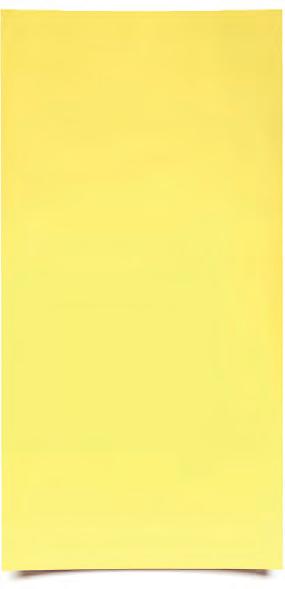
Wunden waschen!

Hast du dich schon einmal gefragt, warum Wunden, die man sich im Freien zufügt, oft rot werden und manchmal eitern? Der Grund dafür sind Bakterien, die im und am Boden leben. Gelangen sie in die Wunde entsteht eine Infektion auf die der Körper mit einer Entzündung reagiert. Das Gewebe um die Wunde wird rot. Manche der Bakterien können auch ernsthaft krank machen. So leben die Erreger des Wundstarrkrampfes (Tetanus) und des Gasbrandes im Boden. Beide Krankheiten haben in Zeiten vor Antibiotika und Impfungen vielen Menschen das Leben gekostet. Wunden sollten daher immer rasch gereinigt und am besten auch desinfiziert werden.

Abb. 15: Größere Wunden solltest du desinfizieren, kleinere zumindest auswaschen.
Warum sollten Landwirte deiner Meinung nach auf die Gesundheit der Bodenbakterien und Mikroorganismen achten?
Recherchiere, welche Eingriffe des Menschen Bakterien und Mikroorganismen allgemein im Boden schädigen! Besprecht eure Funde in der Klasse!
Bakterien
Neben den Pilzen sind es vor allem Bakterien, die den Abbau der organischen Substanzen im Boden bewerkstelligen und damit lebensnotwendige Nährstoffe für die Pflanzen bereitstellen. Bakterien sind die einzigen Lebewesen, die Stickstoff aus der Luft in eine für Pflanzen geeignete Form umwandeln können. Etwa 40% der Lebewesen im Boden sind Bakterien, wobei die genaue Zahl von der Art des Bodens abhängt. Bakterien leben vorwiegend in der dünnen Wasserschicht, die Bodenteilchen umgibt und an Wurzeloberflächen. Trocknen Böden stark aus, wirkt sich das negativ auf die darin vorhandenen Bakterien aus.
Bakterien können viele verschiedene chemische Stoffe, genannt Enzyme, herstellen, mit deren Hilfe sie alle in der Natur vorkommenden organischen Verbindungen zersetzen können. Sie sind die vielseitigsten Destruenten und können selbst Schadstoffe und Pestizide im Boden abbauen. Bakterien unterstützen Pflanzen darüber hinaus bei der Abwehr von Krankheitserregern.

Abb. 11: 3D Modell von Pseudomonas. Die Bakterien haben Geißeln zur Fortbewegung.

Abb. 12: Acidobakterien stellen oft den Hauptanteil der Bakterien im Boden.
In den von Bakterien zersetzten organischen Verbindungen ist Kohlenstoff gespeichert. Dieser stammt ursprünglich aus Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft (denke an die Nahrungspyramide). Ein Teil des Kohlenstoffs wird von den Bakterien über ihren Stoffwechsel zum Wachstum genutzt, also in ihnen gespeichert. Ein Teil wird zu stabilen Verbindungen die im Boden verbleiben. Der Rest wird als CO2 oder Methan freigesetzt und entweicht aus dem Boden in die Atmosphäre. In gesunden Böden wird von den Bakterien mehr Kohlenstoff in Wachstum gesteckt, als durch die Abgabe von CO2 und Methan freigesetzt. Gesunde Böden sind also Treibhausgasspeicher. Das Verhältnis von gespeichertem zu freigesetztem Kohlenstoff verändert sich, wenn sich Böden erwärmen oder für Bakterien ungünstige Umweltbedingungen entstehen. Je schlechter die Bedingungen für die Bakterien, desto weniger Treibhausgase können im Boden gespeichert werden.
Auch Viren spielen im Boden eine Rolle. Sie leben in Bakterien und anderen Mikroorganismen und beeinflussen deren Stoffwechsel. Forschungen haben gezeigt, dass Viren als „Anhalter“ auf Bakterien entlang des Myzelnetzwerks transportiert werden. Sie nutzen dabei Bakterien, die gegen das Virus immun sind. Gelangen die Viren an einen Ort mit Bakterien, die sie befallen können, haben die Transportbakterien einen Vorteil, da sie nicht vom Virus angegriffen werden. Die Ausbreitung von Bakterien im Boden wird also wesentlich von Viren beeinflusst.

Abb. 13: Bakterien auf einer Wurzel. Die größeren hellen Strukturen sind Pilzhyphen.
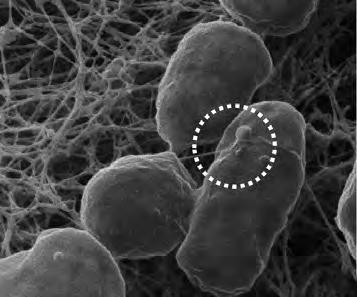
Abb. 14: Manche Viren wandern an Bakterien geheftet durch das Myzelnetzwerk.
Um wen geht es? Beim Stöbern findet Mehmet die alten Biologie-Kärtchen aus der 3. Klasse, die seiner großen Schwester gehört haben. An sich eine gute Sache denkt er, doch leider hat sie nicht notiert, zu welchem Lebewesen welcher Lernzettel gehört. Nun ist Mehmet etwas ratlos. Hilf ihm, die Beschreibung den richtigen Bodenlebewesen zuzuordnen! Ergänze jeweils eine kurze Info, so dass Mehmet wirklich gut auf den Test vorbereitet ist!
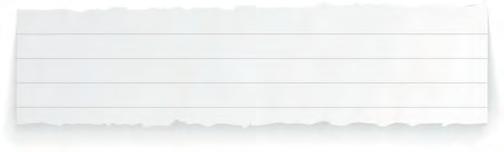
So richtig wohl fühlen sich die meisten von ihnen nur, wenn etwas Wasser vorhanden ist. Sie finden es zwischen Bodenteilchen.
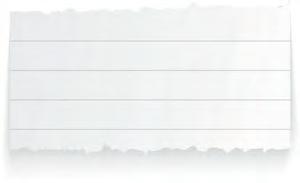
Diese Spinnentiere sind räuberisch unterwegs und fressen andere Bodenbewohner.

Man kennt sie eher aus dem Wasser, wo sie auch zu beträchtlicher Größe heranwachsen können. Doch auch im Boden spielen sie eine wichtige Rolle.
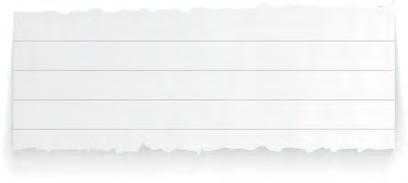
Sie bilden ein weit ausgedehntes Netzwerk, das im Boden vielfältige Verbindungen und Abhängigkeiten herstellt.

Auch wenn sie noch nicht so gut erforscht sind, spielen sie eine wichtige Rolle. Oft sind sie per Anhalter unterwegs.
Das ist
Kurzinfo
Das ist
Kurzinfo Das ist
Kurzinfo Das ist
Kurzinfo Das ist
Kurzinfo
Wie hängt das alles zusammen? Verknüpfe die Textbausteine und formuliere daraus einen Text, der die Zusammenhänge erklärt!
Fühlen sich Mikroorganismen wohl, vermehren sie sich. In der erzeugten Biomasse binden sie Stoffe ihrer Nahrung
Lebewesen nehmen im Laufe ihres Lebens CO2 auf und binden es in ihrem Körper
Die Überreste toter Lebewesen ernähren Mikroorganismen
Nur in gesunden Böden können Mikroorganismen gedeihen und sich wohlfühlen.
Der Klimawandel verschlechtert durch Extremwetter die Lebensbedingungen von Mikroorganismen im Boden
Mikroorganismen unter Stress geben mehr CO2 ab als sie aufnehmen
Der Mensch schädigt und zertört durch intensive Landwirtschaft, Verschmutzung und übermäßige Wasserentnahme Böden
Ein wesentlicher Grund für den Klimawandel ist, dass mehr CO2 freigesetzt als gespeichert wird
Der natürliche Kreislauf des Bodens! Erinnere dich daran, was du gelernt hast und vervollständige den Text mit den richtigen Begriffen! Tipp: Die Wörter auf der Holztafel helfen dir dabei!
Im natürlichen Kreislauf erzeugen die Nährstoffe durch die Fotosynthese. Diese werden von den __________________________ als Nahrung genützt. Die Reste von Lebewesen und ihre _______________________________ gelangen auf den Boden und werden von einigen ________________________ zerkleinert, gefressen und verdaut. Was übrig bleibt, zerlegen andere Destruenten, die zu stoffen, welche von Pflanzenwurzeln aufgenommen werden und zum Aufbau der Pflanzen nötig sind. Der Vorgang, der das Wachstum der Pflanzen ermöglicht, ist die _____________________
Wer lebt im Boden bei dir?
Abbauer Pflanzen Mineralisierer

Du brauchst: ein großes Glas, z.B. ein Einmachglas % ein Sieb % einen Trichter % eine Lampe % eine flache Schüssel
Baue eine Bodentierfalle (siehe S. 66) und sammle dir Erdproben aus deiner Umgebung! Benutze die Falle um aus den einzelnen Proben Tiere in deinem Glas zu fangen! Gib die Tiere in die flache Schüssel und sieh sie dir genau mit einer Lupe an! Notiere folgende Dinge:
Woher stammt deine jeweilige Erdprobe?
Wie viele Tiere sind in deiner Falle gelandet?
Eine kurze Beschreibung der Tiere und eine Vermutung, um welche Art Lebewesen es sich handelt Zeichne deine Funde und mache Fotos!
Führe das mit all deinen Proben durch! Versuche 3 der beobachteten Tiere genauer zu bestimmen! Tipp: Recherchiere dazu mithilfe deiner Fotos im Internet!
Meine bestimmten Tiere:


Abb. 16: Hundertfüßer
Bildet Kleingruppen! Besprecht welche Lebewesen ihr gefunden habt und welche besonders häufig vorkamen! Leben in unseren Böden! Recherchiere ein weiteres Lebewesen, das im Boden lebt, das noch nicht im Buch vorgekommen ist (es kann auch eines der in Aufgabe 3 beobachteten sein)! Sammle ein wenig Info darüber und schreibe einen Steckbrief (erinnere dich was du über Steckbriefe in der 2. Klasse gelernt hast)!
Tragt eure Steckbriefe in der Klasse zusammen, jeder präsentiert seinen Fund! Besprecht welche Aufgaben und Rollen die einzelnen Lebewesen im Ökosystem Boden übernehmen! Erstellt gemeinsam ein Plakat „Leben in unseren Böden“ auf dem ihr alle Bodenlebewesen, die ihr schon kennt, darstellt und kurz beschreibt!


Abb. 17: Maulwürfe graben Tunnel in den Boden. Die Haufen stören Gärtnerinnen und Gärtner.
Mit dem Lebensraum Boden beschäftigt sich eine eigene Wissenschaft, die Bodenkunde oder Pedologie. Eine ihrer Aufgaben ist die genaue Beschreibung von Böden. Dabei werden vor allem zwei Arten der Einteilung verwendet.
Bodenart
Die Bodenart beschreibt die Eigenschaft eines Bodens bezüglich der Größe seiner mineralischen Teilchen, also der Korngröße. Sand, Schluff und Ton hast du bereits kennengelernt. Lehm ist ein Gemisch von Sand, Schluff und Ton in etwa gleichen Anteilen. Die Korngröße und damit die Bodenart hat Einfluss darauf, wie durchlässig der Boden für Wasser ist, wie gut er Wasser und Nährstoffe speichern kann und wie sehr er durchsickerndes Wasser filtert.
Bei Betrachtung eines Bodenprofils (senkrechter Schnitt durch den Boden) fällt auf, dass viele Böden aus mehreren Schichten bestehen. Besonders gut sieht man, wenn der Boden bis zum Gesteinsuntergrund aufgegraben ist. Die meisten Böden bestehen aus vier parallel zur Erdoberfläche verlaufenden Schichten, die man Horizonte nennt:

0-Horizont/Bodenauflage
A-Horizont/Oberboden
Bodenhorizonte
B-Horizont/Unterboden
O-Horizont (Bodenauflage): Hier findet man die Ausscheidungen und abgestorbenen Reste von Lebewesen. Je nach Lebensraum ist er verschieden dick.
A-Horizont (Oberboden): Dies ist die humusreiche Schicht des Bodens. Hier leben die meisten Bodenlebewesen. Die Mineralstoffe in diesem Horizont werden durch den Regen ausgewaschen und gelangen in den darunter liegenden Horizont.

Oberboden (A-Horizont)
Unterboden (B-Horizont)
Untergrund (C-Horizont)
Abb. 1: Schichten des Bodens und Horizonte.
Befindet sich in der Umgebung deiner Schule eine Stelle, an der die Bodenschichten sichtbar sind? Zeichne oder fotografiere die Schichten und versuche, sie zu beschreiben!
Tipp: Baugruben bieten oft gute Einblicke in den Boden!
Muttergestein, das: Gesteinsuntergrund, aus dem der Boden jeweils entstanden ist
C-Horizont/ Gesteinsuntergrund
B-Horizont (Unterboden): Er besteht vorwiegend aus verwittertem Gestein und enthält nur wenig Humus. Im Raum zwischen den Körnern bleibt im Oberboden ausgewaschenes Wasser haften und wird gespeichert. Der Unterboden ist daher mineralstoffreich und reich an Wasser. Die Wurzeln der Pflanzen können hier darauf zugreifen.
C-Horizont (Untergrund): Er ist das Muttergestein des Bodens.
Abb. 2: Bodenprofil und Bodenhorizonte.
Der Boden entsteht aus dem verwitternden Gestein seines Untergrundes und den durch Bodenbewohner veränderten Resten von Lebewesen. Je nach Muttergestein, Verwitterung und im Boden wurzelnden Pflanzen gibt es verschiedene Böden. Der Untergrund beeinflusst das Tempo der Verwitterung. Auch die Vielfalt der Lebewesen im Boden beeinflusst die Bodenbildung. Je größer die Zahl unterschiedlicher Bodenorganismen, desto mehr Mineralstoffe werden den Pflanzenwurzeln von Bakterien und Pilzen im Boden zur Verfügung. Sie können das Gestein weiter lockern und verändern.
Je nach Bodenprofil unterscheidet man verschiedene Bodentypen. In Österreich ist der häufigste Bodentyp die Braunerde. Sie entsteht durch fortschreitende Bodenbildung auf unterschiedlichem Gesteinsuntergrund. Es bildet sich eine mit Humus vermischte Unterbodenschicht aus. Die Farbe stammt von Eisenverbindungen, die durch die Verwitterung freigesetzt werden. In Österreich findet man sie vor allem im Alpenvorland, wo sie als Ackerboden genutzt wird.
Bodentyp, der: Bodentypen fassen Böden mit ähnlicher Abfolge ihrer Horizonte zusammen.

Oberboden
Unterboden
Abb. 3: Braunerde, sie besteht aus humusreichem Oberboden (A), verbrauntem (mit Eisenverbindungen angereichertem) Unterboden (B) und dem Gesteinsuntergrund (C). A/B/C

Abb. 4: Bodenprofil eines Ackerbodens auf Schwarzerde.
Schwarzerde, die: Bodentyp mit einer sehr dunkel gefärbten dicken Schicht Oberboden.

Abb. 5: Pflug im Einsatz.
In welchem Lebensraum erzeugte ebenfalls der langsame Abbau von Biomasse für eine immer dicker werdende oberste Bodenschicht?
Erinnere dich an die Lebensräume der zweiten Klasse! Wie waren ihre Bodenbedingungen? Wie das Pflanzenwachstum? Verknüpfe dieses Wissen damit, was du nun über Böden gelernt hast! Verfasse für einen Lebensraum einen kurzen Sachtext zu seinem Boden, dessen Eigenheiten und die Folgen dieser Eigenheiten auf die Tierund Pflanzenwelt des Lebensraums!

Abb. 9: Bei der Errichtung von Städten wird viel Boden zerstört.
Besonders fruchtbare Ackerböden sind die Schwarzerdeböden. In Österreich bringen sie die größten Erträge für die Landwirtschaft. Sie befinden sich in Gebieten mit Steppenklima, wie dem Weinviertel oder dem nördlichen Burgenland. Während der trockenen Sommer und kalten Winter, sind die Mikroorganismen im Boden wenig aktiv und bauen abgestorbene Pflanzenreste nur langsam ab. Im feuchten Frühjahr wächst die Vegetation üppig. Es wird mehr organische Masse aufgebaut als abgebaut. So bildet sich mit der Zeit eine dicke Humusschicht. Grabende Tiere wie Regenwürmer und Feldhamster überdauern die kalten Winter tief im Boden. Sie müssen tief graben und durchmischen den Boden bis in größere Tiefen. Schwarzerdeböden haben keinen Unterboden und werden deshalb auch als AC-Böden bezeichnet.
Böden liefern den Großteil unserer Nahrung: Die meisten unserer Nahrungsmittel werden durch Landwirtschaft erzeugt. Die Grundlage dafür bilden die Böden, auf denen sich die Felder befinden. Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen wird der Boden oft mit Pflügen gelockert und umgewendet. So können Nutzpflanzen besser wachsen. Dabei wird die oberste Bodenschicht durchmischt und der Humus in ihr gleichmäßig verteilt. Pflügen stört die im Boden lebenden Organismen, wodurch sie die Bodenstruktur schlechter erhalten können. Das tiefe Aufbrechen des Bodens verstärkt dessen Erosion. Am Bodenprofil von Ackerböden ist deutlich die Pfluggrenze zu sehen. Diese zeigt, bis zu welcher Tiefe gepflügt wird.
Böden speichern Trinkwasser: Niederschlagswasser versickert im Boden und sammelt sich als Grundwasser an wasserundurchlässigen Schichten. Stellen, an denen Grundwasser ans Tageslicht kommt, werden als Quellen bezeichnet und werden bei entsprechender Qualität zur Trinkwassergewinnung verwendet. Dort, wo sich keine Quellen befinden, wird Grundwasser über Grundwasserbrunnen aus der Tiefe gepumpt.
Abb. 6: Grundwasser und Bodenhorizonte.
Böden sind die Grundlage von Lebensraumvielfalt: Welche Pflanzen und andere Lebewesen in einem Ökosystem gedeihen können, hängt neben dem Klima und dem Vorhandensein von Wasser auch sehr stark vom jeweiligen Boden ab.
Abb. 7: Salzhaltiger Boden im Nationalpark Neusiedlersee. Das Pflanzenwachstum ist karg.





Abb. 8: Moos-Steinbrech wurzelt in einer Spalte im Hochgebirge der Alpen.

Böden werden auch von Menschen genutzt: Siedlungen, Straßen und Eisenbahnen verbrauchen Bodenflächen und verringern somit den Platz, der für Pflanzen und Tiere verbleibt. Daher muss bei jedem neuen Bauvorhaben genau überlegt werden, ob es notwendig ist und wie man es so umsetzen kann, dass möglichst wenig Boden zerstört wird.
Jeder und jede von uns verbraucht Boden in Form von Wegen, Straßen und Gebäuden. Durch das Verbauen werden Böden mit Beton, Asphalt usw. versiegelt. So ist ein Drittel der Fläche der Bundeshauptstadt Wien Baufläche, 14% der Fläche sind mit Straßen und anderen Asphaltflächen versiegelt.


Abb. 1: Autobahnen und Siedlungen benötigen viel Platz. Der Boden wird versiegelt und kann seine Rolle als Lebensraum nicht mehr erfüllen. Für das Ökosystem ist er verloren.
Außer der Versiegelung spielt die Erosion, besonders in Gebieten mit Ackerbau, eine negative Rolle. Vor allem bei trockenem Wetter kann es zu Bodenverlust durch Staubund Sandstürme kommen. Wenn große und schwere landwirtschaftliche Geräte eingesetzt werden, besteht die Gefahr der Bodenverdichtung.

Abb. 2: Winderosion von Ackerboden. Trockene Erde wird aufgewirbelt und vom Wind vertragen.
verbauen: Errichten von Gebäuden bzw. Straßen auf Erdboden.
versiegeln: Hier – der Boden wird luft- und wasserdicht abgedeckt.
Bodenverdichtung, die: durch maschinelle oder andere Belastung bedingtes Zusammenpressen des Bodens.

Abb. 4: Schwere Maschinen wie Traktoren verdichten den Boden
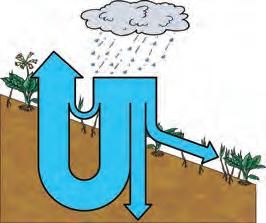
Unversiegelter Boden: Wasser gelangt in den Boden. 1. Ein großer Teil verdunstet wieder.
Abb. 3: Verdichteter Boden wird für Wasser und Luft undurchlässig.
Bodenfläche wird auch durch die Gewinnung von Sand, Schotter und Kies verbraucht. Schipisten beeinträchtigen die Bodenbildung und verändern die Landschaft stark. Durch Verbauen und Erosion geht Boden verloren. Versiegelung und Bodenverdichtung gefährden den Boden als Lebensraum für Bodenlebewesen und verändern den Abfluss von Wasser.
Böden sind je nach Bodenart und Bewuchs natürliche Wasserspeicher. Wasser wird vor Ort gespeichert und steht den Lebewesen zur Verfügung. Die Böden geben das Wasser durch Verdunstung langsam an die Umgebung ab. Da Verdunstung Energie benötigt, wird die Umgebung gekühlt. Luftfeuchtigkeits- und Temperaturschwankungen werden ausgeglichen, das Mikroklima ändert sich weniger.
Versiegelte Böden können kaum Wasser aufnehmen. Das Wasser rinnt zu schnell in die Kanäle und Flüsse und wird abtransportiert. Vor Ort wird kaum Wasser gespeichert und in Trockenphasen fehlt es den Lebewesen. Nur wenig Wasser kann verdunsten, die klimaregulierende Wirkung bleibt aus. Die Böden können sich stark aufheizen. Bei sehr starken Niederschlägen kann der Boden kaum Wasser aufnehmen. Es kommt daher häufiger zu Überschwemmungen
2. Ein Teil gelangt ins Grundwasser.
3. Der Wasserabfluss ist gering.

Versiegelter Boden: Wasser gelangt kaum in den Boden.
1. Viel weniger Wasser wird verdunstet.
2. Auch ins Grundwasser gelangt nur ein kleiner Teil.
3. Das meiste Wasser fließt ungenützt und bedrohlich schnell ab.
Abb. 5: Wasseraufnahme des Bodens.
Einzugsgebiet, das: Bereich eines Flusses, aus dem er durch Niederschläge und Zuflüsse mit Wasser versorgt (gespeist) wird.
Beobachte in deiner Umgebung Flächen und Wasserläufe! Wie viel davon ist versiegelt? Wie natürlich sind die Wasserläufe belassen? Gibt es Flächen, wo Wasser gut versickern kann?

Abb. 8: Verkehrszeichen: gilt für LKW-Fahrer, die wassergefährdende Stoffe geladen haben; zeigt an, dass sie hier besonders vorsichtig fahren müssen.
Abb. 8: Überlege, um welche Stoffe es sich dabei handeln könnte! Wo hast du schon einmal so ein Zeichen gesehen? Welche Folgen könnte unvorsichtiges Fahrverhalten haben? Diskutiert in Teams!

Abb. 9: WasserschutzzoneHinweisschild
Welche weiteren Schutzmaßnahmen für den Boden fallen euch ein? Erarbeitet in Gruppen Ideen, wie ihr zum Bodenschutz beitragen könnt!
Ballonreifen, der: sehr breite und große weiche Reifen mit geringem Luftdruck, die den Boden weniger belasten.
Recherchiere online, ob in deinem Heimatort Maßnahmen zum Schutz der Böden umgesetzt werden! Sprich mit Menschen aus deinem Umfeld darüber, ob sie sich Gedanken zum Thema Boden und Bodenschutz machen – und wenn ja, welche.
Versiegelte Flächen und geschädigte Böden können nur wenig Wasser aufnehmen. In Kombination mit den durch den Klimawandel immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen, steigt dadurch die Überschwemmungsgefahr seit Jahren.
WASSERMENGE

Abb. 6: Vergleich des Hochwasserabflusses unter natürlichen Bedingungen, sowie in einem versiegelten Einzugsgebiet
in einem technisch ausgebauten Bach mit weitgehend versiegeltem Einzugsgebiet
HOCHWASSERABFLUSS
unter natürlichen Bedingungen


Heute ist man sich der Bedeutung der Böden bewusst. Daher gibt es in den meisten europäischen und vielen anderen Ländern auch strenge Gesetze zum Bodenschutz Dieser Schutz ist insbesondere im Zusammenhang mit dem Schutz des Wassers nötig, da verunreinigte Böden auch zu einer Verunreinigung des Wassers führen.
2 Vermeidung von Bodenversiegelung: Möglichst sparsamer Bodenverbrauch beim Bauen.
2 Vermeidung von Bodenvergiftung: Dies gelingt durch Vermeidung von Müll und richtige Müllentsorgung. Dazu gehören auch die richtige Entsorgung von Batterien, Hundekot, Zigarettenstummeln und anderen „kleinen“ Abfällen.
2 Vermeidung von Bodenverdichtung: Einsatz geeigneter Geräte in der Landwirtschaft (z. B. mit Ballonreifen), die mehrere Arbeitsschritte bei einer Befahrung ermöglichen. Ebenso sollten Felder nicht befahren werden, wenn der Ackerboden sehr nass ist.
2 Sparsame Verwendung von Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und in Gärten.
2 Schonung der benachbarten Pflanzendecke bei größeren Eingriffen in den Boden (Bau von Straßen, Pisten usw.).
Merke: Böden können kaum gereinigt werden!
Was bedeuten diese Fachausdrücke? Vervollständige die folgenden Sätze!
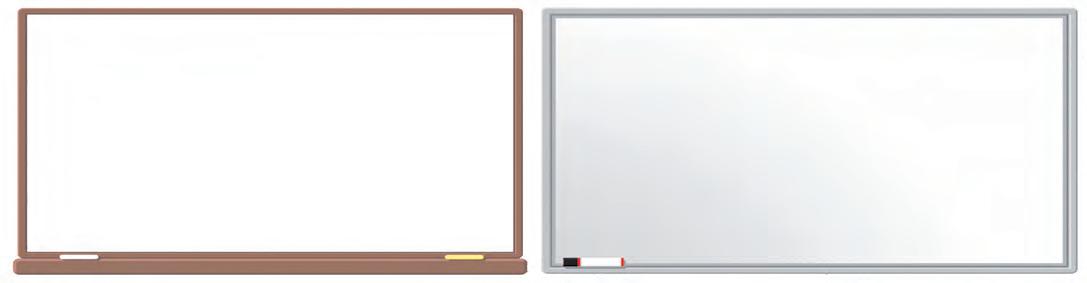
Horizont bedeutet hier Pedologie ist
Unter Muttergestein versteht man Das Bodenprofil ist
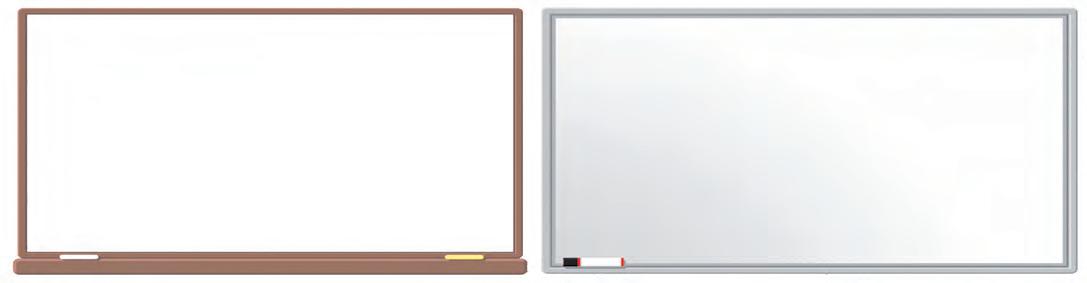
Boden in Österreich! Besuche https://bodenkarte.at! Zoome in die Karte hinein und suche auf der Karte einen Ort, den du kennst und einen beliebigen anderen Ort in Österreich! Wenn du auf einen der roten Bereiche klickst, öffnet sich ein Fenster mit Informationen zum Boden an der Stelle. Das meiste sollte dir schon bekannt vorkommen. Mache dir klar, was die einzelnen Informationen bedeuten! Übertrage alles, worüber du schon gelernt hast in dein Buch! Skizziere auch das Bodenprofil! Vergleiche mit der Karte auf Seite 52!
Bodenprofil

Lage:
Bodentyp:
Wasserverhältnisse:
Horizonte:
Bodenart je Horizont:
Humusverhältnisse:
Erosionsgefahr:
Natürliche Nutzung
Aufgrund der Beschaffenheit:

Bodenprofil
Lage:
Bodentyp:
Wasserverhältnisse:
Horizonte:
Bodenart je Horizont:
Humusverhältnisse:
Erosionsgefahr:
Natürliche Nutzung Aufgrund der Beschaffenheit:
Stelle für einen der beiden Orte eine Hypothese zur Bodenentstehung auf!
Boden-Werkstatt! Führe einfache Bodenversuche durch! Notiere hier die Ergebnisse deiner Bodenprobe!


A: Entnimm in verschiedenen Lebensräumen deiner Umgebung (z. B. Wald, Wiese, Acker) jeweils eine Handvoll Boden!
B: Stelle den Geruch einer Bodenprobe fest!
Mein Boden riecht nach (Pilzen, Laub, Schmutz, Garten, Wald…)
C: Beschreibe die Bestandteile!
Ich finde in meiner Bodenprobe
D: Versuche, eine kleine Menge Bodenmaterial zu kneten!
Ich spüre
E: Unterstreiche das Wort, das am ehesten passt!
Die Farbe meines Bodens ist hellbraun/dunkelbraun/schwarz/grau/rötlich/gelblich.
F: Vergleiche deine Ergebnisse mit dem, was du in Aufgabe zwei über den Boden in deiner Umgebung herausgefunden hast! Du kannst auch auf der Karte nachsehen, ob du die Stellen, an denen du deine Proben gesammelt hast, findest!
Sedimentationsprobe! Führe Sedimentationsproben durch!
Du brauchst: ein Schraubglas % Erdproben (jeweils etwa eine Hand voll) % etwas Wasser
Nimm das Schraubglas und fülle eine deiner Erdproben ein! Fülle dann das Glas mit Wasser! Verschließe es und schüttle es kräftig durch! Lasse die Mischung stehen, bis sich die Erde gesetzt hat und du Schichten erkennst! Betrachte danach dein Glas genau und zeichne dein Ergebnis in das große Schraubglas ein!





Die Beschäftigung mit Böden verbindet Fachleute der Biologie, Geologie und Pedologie (Bodenkunde). Aus Forschung resultierendes Verständnis für die Bodenentstehung hilft nachzuvollziehen, wie sich Böden entwickeln werden. Das ist für viele ökologische aber auch gesellschaftliche Fragen von Bedeutung.


Der ökologische Kreislauf der Böden ist die Lebensgrundlage allen Lebens an Land der Erde. Ein detailliertes Verständnis der vielschichtigen Zusammenhänge ist wissenschaftlich faszinierend aber auch die Basis für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit unseren Böden. Daraus ergeben sich vielfältige Betätigungsfelder:
Das Studium der Bodenbewohner und ihres Zusammenlebens sowie der Bedingungen unter denen sie gedeihen können. Insbesondere die Mikroorganismen und ihr Wirken sind noch weitgehend unverstanden. Die technische Erfassung und Bewertung von Bodentypen und Bodenqualität. Das Erlangen, Anwenden und Kommunizieren von nötigem Know-How für eine langfristig funktionierende Landwirtschaft. Das Erlangen und Anwenden von Wissen über Böden für den Schutz vor Dürren, Überschwemmungen und Erdrutschen. Und nicht zuletzt Tätigkeiten, die Wissen und Techniken hervorbringen, um Böden zu schützen und in einen gesunden Zustand wiederherzustellen und diese anwenden.
Mikroorganismen im Boden! Du hast in der zweiten Klasse gelernt, wie du mit Mikroorganismen arbeitest und diese vermehrst. Wiederhole dieses Wissen und wende es nun wieder an! Finde anhand der Versuchsbeschreibung eine passende experimentelle Fragestellung. Formuliere deine Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führt dann den Versuch durch.
Du brauchst: Erdprobe % mehrere ausgekochte Schraubgläser % sterile Petrischalen mit Nährboden
FRAGE:
VERMUTUNG:
DURCHFÜHRUNG A
Sammle in deiner Umgebung eine Erdprobe! Zwei bis drei Handvoll sollten reichen. Achte darauf, dass du alle Tiere aus der Erdprobe entfernst! Teile die Probe auf die ausgekochten (siehe 2. Klasse, S. 153 Aufgabe 4) Schraubgläser auf! Schaffe in den Schraubgläsern mindestens eine Woche lang unterschiedliche Bedingungen!
Glas 1: Halte die Erde in diesem Glas mit einer Sprühflasche leicht feucht! Sie soll weder nass sein, noch austrocknen. Koche die Sprühflasche aus, bevor du sie benutzt!
Glas 2: Trockne die Erde, indem du das Glas leicht geöffnet in die Sonne oder an einen warmen Ort stellst. Halte die Erde so trocken wie möglich.
Glas 3: Fülle Wasser in das Glas, bis sich durchgehend Staunässe bildet, du also das Wasser am Glas stehen siehst.
Glas 4: Löse soviel Salz in warmem Wasser, bis sich kein weiteres Salz löst! Durchfeuchte die Erde ordentlich damit! Halte sie gegebenenfalls mit weiterem Salzwasser, das du abgekocht hast, feucht. Überlege dir weitere Bedingungen, z.B. Temperatur, Spülmittel oder Seife, Schmieröl, .... sei kreativ!
AUSWERTUNG: Ziehe dir Gummihandschuhe an und desinfiziere sie! Danach zerreibe etwas Erde aus jedem Glas zwischen den Fingern und verteile sie in je einer Petrischale! Beschrifte die Petrischalen zur richtigen Zuordnung! Wasche und desinfiziere nach jeder Probe deine Hände neu! Beobachte die Petrischalen einige Tage und halte das Geschehen mit einem Foto täglich fest!
Dokumentiere alles in einem Protokoll! Bringe deine Ergebnisse damit in Verbindung, was du über Böden und Mikroorganismen darin gelernt hast! Schreibe einen kurzen Text dazu!


So schätze ich mich nach dem Großkapitel ÖKOSYSTEM BODEN selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
…den Begriff Boden aus biologischer und geologischer Sicht grundlegend erläutern.
…die Bodenbildung und deren einzelne Phasen anschaulich erklären.
…die Zeiträume zur Bodenbildung einschätzen und sie im Vergleich zu jenen von Bodenschädigung durch menschliche und natürliche Einflüsse betrachten.
…beschreiben, was Destruenten sind und welche Rolle sie für Böden spielen.
…den Nährstoffkreislauf des Bodens darstellen und erläutern.
…die Bedeutung des Bodens für die Pflanzen sachlich darstellen.
…einige Klein- und Kleinsttiere aufzählen, die im Boden leben
…die Anzahl an Lebewesen in einem Stück Boden grob abschätzen.
…die Rolle von Algen im Boden beschreiben.
…die Rolle von Pilzen im Boden beschreiben.
…die Rollen von Bakterien und Viren im Boden beschreiben.
…den Unterschied zwischen Bodenart und Bodentyp erklären.
…die Bodenhorizonte und deren Eigenschaften benennen
…erläutern, was Braun- und Schwarzerde ist.
…die Funktionen von Böden anschaulich wiedergeben.
…Gefahren für Böden und deren Folgen erörtern.
…Böden meiner Umgebung und deren Bewohner durch geeignete Mittel untersuchen und die Ergebnisse dokumentieren sowie präsentieren.



Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
Wolfram Dunger: Tiere im Boden (Militzke Verlag GmbH 2008).
Klemens Kalverkamp: Die Erde geht uns alle an: Warum gesunde Böden das Klima retten, deinen Körper heilen und die Welt gerechter machen (Wiley-VCH 2025).
Peter Laufmann: Der Boden: Das Universum unter unseren Füßen (C.Bertelsmann Verlag 2020).

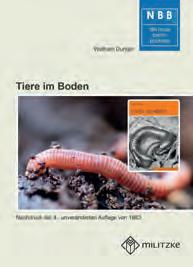
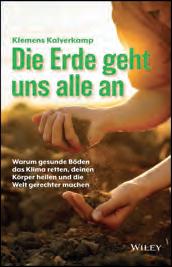


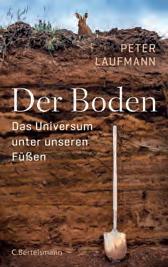
Du kennst das, wenn du dich körperlich anstrengst, kommst du außer Atem. Wenn du die Luft anhältst, wird das nach kurzer Zeit unangenehm. Du hast gelernt, dass der im Laufe der Erdgeschichte von den Pflanzen produzierte Sauerstoff die Entwicklung tierischen Lebens ermöglicht hat. Offenbar ist Sauerstoff ziemlich wichtig. Aber warum?
Alle Tiere, viele Bakterien und die meisten Pilze benötigen Sauerstoff, um Energie zu erzeugen. Nun denkst du vielleicht, ich habe schon gelernt, woher die Energie kommt, nämlich vom Essen und der Verdauung. Das ist jedoch erst der erste Schritt. Kohlenhydrate, Fett und überschüssige Eiweiße aus der Nahrung wandelt der Körper in einem chemischen Prozess mithilfe von Sauerstoff in Energie um. Aus Zucker und Sauerstoff O2 wird Kohlenstoffdioxid CO2, Wasser H2O und Energie. Das Kohlendioxid und Wasser müssen als Restprodukte wieder ausgeschieden werden. Das geschieht beim Kohlenstoffdioxid über die Atmung und beim Wasser über den Urin. Da die Atemgase Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Körper nicht über längere Zeit gespeichert werden können, müssen sie beständig über die Atmung aufgenommen und abgegeben werden. Darum können Tiere längere Zeit ohne Nahrung und Wasser auskommen, nicht jedoch ohne Sauerstoff.


Abb. 1: Luftanhalten geht nicht lange.
Vergleiche den Stoffwechsel der Tiere mit der Fotosynthese der Pflanzen! Welche Stoffe werden dort umgesetzt? Denkst du, es ist Zufall, dass sich beides im Laufe der Evolution nebeneinander entwickelt hat? Begründe deine Antwort!
Konzentration, die: In der Chemie die Menge eines Stoffes, gemessen in Anzahl der Teilchen, Masse oder Volumen, in einem Bezugsvolumen.
Abb. 3: 1) Tropfe aus einer Tintenpatrone etwas Tinte in ein Glas Wasser! Beobachte, was passiert! Finde eine Erklärung für deine Beobachtung!



Abb. 3: 2) Zünde in einer Ecke eines Raumes ein Räucherstäbchen an und stelle es sicher auf eine Ablage! Gehe rasch zum andere Ende des Raumes und schnüffle. Kannst du das Räucherstäbchen riechen? Wie ist es, wenn du ein wenig wartest? Was ist geschehen?

Das einfachste Verfahren zum Stofftransport in Lebewesen ist Diffusion Kleinste Teilchen (denke ans Teilchenmodell der Physik), stehen nie still. Sie bewegen sich in zufällige Richtungen Sind an einem Ort viele Teilchen vorhanden, können sich von dort mehr Teilchen wegbewegen als von einem Ort mit weniger Teilchen. Über die Zeit sorgt das für eine gleichmäßige Verteilung der Teilchen über beide Orte. Die meisten Gewebe in Lebewesen sind für Gase wie Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid bis zu einem gewissen Grad durchlässig. Befindet sich auf einer Seite des Gewebes viel Sauerstoff und auf der anderen Seite wenig Sauerstoff, so kann sich Sauerstoff mittels Diffusion durch das Gewebe hindurch bewegen. Gleiches gilt für Kohlenstoffdioxid. Dieses Grundprinzip steckt hinter jeglicher Form von Atmung. Daraus lassen sich zwei wichtige Dinge ableiten. Um möglichst viel Sauerstoff aus der Umgebung aufnehmen und Kohlenstoffdioxid abgeben zu können, sollte:































Abb. 3: Ausbreitung eines Stoffes durch Diffusion.




1) Die Oberfläche, durch die die Gase durchtreten können möglichst groß sein.
2) Die Gewebeschicht, durch die die Gase hindurchtreten möglichst dünn sein.



Abb. 4: Diffusion durch eine Gewebeschicht.
Abb. 4: Wiederhole den Aufbau der Zelle aus der zweiten Klasse! Was machen die Mitochondrien? Hat das etwas mit Sauerstoff und Kohlendioxid zu tun? Was könnte der ovale Punkt in der Tracheolenzelle andeuten?
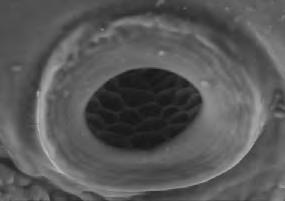
Abb. 2: Stigmen von Kopfläusen sind einfache Öffnungen.
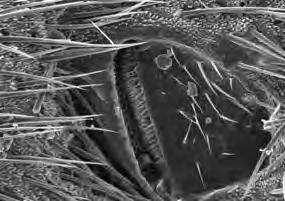
Abb. 3: Die Stigmen der Grillen verfügen über Klappen. Beachte auch den Größenunterschied zur Kopflaus.
Was könnte deiner Meinung nach der Grund sein, dass die Stigmen der Grillen zehnmal größer sind, als die der Kopflaus?
Tipp: Vergleiche die Tiere!
Bildet Zweierteams! Formuliert Hypothesen, weshalb an der Flügelmuskulatur der Insekten besonders viele Tracheolen liegen! Wägt Argumente ab und einigt euch auf eine gemeinsame Hypothese samt Begründung, weshalb sie eurer Meinung nach zutrifft! Nutzt ein KI Programm, um eure Hypothese zu überprüfen!
Betrachte Abb. 7 auf Seite 62, Abb. 9 auf Seite 63 und Abb. 9 auf Seite 67! Vergleiche sie mit dem Tracheensystem!
Was fällt dir auf? Formuliere eine wissenschaftliche Fragestellung und Hypothese dazu!
Die einfachste Möglichkeit, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlenstoffdioxid abzugeben (Gasaustausch), ist über das Gewebe der Körperoberfläche. Die Gase diffundieren hindurch zu den darunter liegenden Zellen. Das funktioniert jedoch nur für kurze Distanzen, also sehr kleine Lebewesen. Oder für Lebewesen im Wasser, deren gesamter Körper vom Wasser, mit den Atemgasen darin, durchströmt wird (z.B. Schwämme). Sonst müssen die Gase im Körper transportiert werden um zu allen Zellen zu gelangen. Im Laufe der Evolution haben sich allerlei Lösungen entwickelt, um den Gasaustausch im ganzen Körper zu ermöglichen. Eine bei Tieren verbreitete Lösung sind Atemorgane
Tracheen sind das Atemorgan der Insekten. Sie sind ein System aus Kanälen, die den gesamten Körper durchziehen. Tracheen sind ringförmig versteift und mit Chitin ausgekleidet, was ihnen Stabilität verleiht. Durch sie kann sich Luft überall im Körper ausbreiten und Gasaustausch mittels Diffusion mit den Zellen stattfinden.
Tracheen enden in Öffnungen, den Stigmen
Tracheen
Körpergewebe, z.B. Muskeln
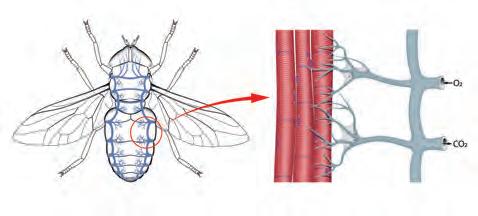
Abb. 1: Tracheensystem einer Fliege. Die Öffnungen am Körper nennt man auch Stigma.
An der Körperoberfläche befinden sich Öffnungen, durch die Luft in das Tracheensystem gelangt. Dies geschieht im einfachsten Fall passiv, also ohne Saug-, oder Pumpwirkung. Bei einigen Insekten (z.B. Silberfischchen und Läusen), finden sich reine Öffnungen. Bei anderen sind diese mit Verschlussmechanismen ausgestattet, um die Belüftung der Tracheen kontrollieren zu können.
Stigma mit Verschlusskappe
Chitinringe zur Stabilisierung

Abb. 4: Detailansicht eines typischen Tracheensystems.
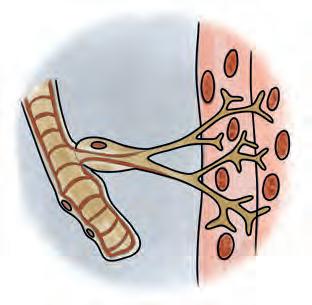
Mitrochondrium
Das Tracheensystem verzweigt sich mit kleiner werdendem Durchmesser. Die gesamte Querschnittsfläche der Tracheen bleibt dabei bei jeder Verzweigung in etwa gleich. Von den dünnen Endverzweigungen des Tracheensytems zweigen feine Kanäle von weniger als 1μm Durchmesser ab, die Tracheolen. Sie bringen die Luft direkt zu den Zellen. In ihnen findet der Gasaustausch statt. Da die Tracheolen so dünn und stark verzweigt sind, ist ihre gesamte Oberfläche sehr groß. Das war eine der Bedingungen für einen möglichst intensiven Gasaustausch durch Diffusion. Da die Tracheolen direkt zu den Zellen und manchmal auch in sie hinein ragen, ist der Weg, den Gase überwinden müssen sehr kurz. Das war die zweite Bedingung.
Tracheolen
Tracheolenzelle
Viele Insekten erhöhen den Gasaustausch, indem sie den Luftstrom in den Tracheen aktiv verstärken. Dafür haben sie verformbare Tracheensäcke (siehe Abb.4), die an das Tracheensystem angeschlossen sind. Sie funktionieren ähnlich wie ein Blasebalg Durch Zusammendrücken der Tracheensäcke wird Luft aus ihnen heraus gedrückt und beschleunigt die Strömung der Luft in den Tracheen. Werden sie wieder auseinandergezogen, wird Luft in sie hineingesaugt und beschleunigt die Strömung in den Tracheen in die andere Richtung. Die Verformung der Tracheensäcke wird durch die Flugmuskulatur, oder Pumpbewegungen des Hinterleibes bewerkstelligt.
Erinnere dich: Welche Lebewesen regulieren ihre Atmung ebenfalls über Spalten in ihrer Oberfläche? Handelt es sich dabei um eine Verwandtschaft – oder um eine parallele Entwicklung?
Scanne den QR-Code! Sieh einer Riesenlaubheuschrecke beim Atmen zu!

Manche Insekten leben teilweise, oder auch ganz im Wasser. Um ihr auf Luftatmung spezialisiertes Tracheensystem trotzdem nutzen zu können, haben sie Tricks entwickelt. Im einfachsten Fallen nehmen sich Insekten einen Luftvorrat mit. Der Gelbrandkäfer nutzt sein Tracheensystem, um den Raum unter seinen Deckflügeln an der Wasseroberfläche mit Luft zu füllen. Taucht er ab, kann er von diesem Luftvorrat zehren und Luftatmung betreiben.

5: Raupe des Oleanderschwärmers. Seitlich siehst du die Stigmen als dunkle Flecken.
Luftblase

Abb. 6: Gelbrandkäfer nehmen von der Oberfläche einen Luftvorrat zwischen Flügeln und Unterleib mit.
Bei vielen Insekten ist die mitgeführte Luftblase mehr als ein bloßer Vorrat. Diese Tiere bilden einen Luftpolster an ihrer Körperoberfläche. Ermöglicht wird das beispielsweise durch feine Härchen. Verbrauchen die Tiere Sauerstoff aus ihrem Luftvorrat und füllen ihn mit CO2, entsteht ein Ungleichgewicht mit dem Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Gehalt im umgebenden Wasser. Diffusion erzeugt einen Ausgleich. So bleibt der Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Luftblase des Insekts über längere Zeit geeignet zum Atmen.
Manche Insekten haben diese Methode perfektioniert. Sie verfügen über permanente Luftpolster. Diese werden durch ihre speziell geformte Körperoberfläche mit feinen Härchen, Schuppen oder Kammern auch bei höherem Wasserdruck stabil gehalten. Der Luftpolster verleiht den Insekten ein silbrig glänzendes Aussehen. Mit ihm können Insekten auch durchgehend unter Wasser leben.
Der Nachteil des Tracheensystems ist die Notwendigkeit eines zusätzlichen Transportsystems, das Nährstoffe zu den Zellen bringt. Tracheensysteme eigenen sich nur für kleinere Organismen, da sonst der Lufttransport nicht mehr rasch genug statt findet. Entsprechend sind die größten heute lebenden Insekten in etwa 15cm groß. Größere Tiere brauchen eine andere Methode der Atmung.

Abb. 7: Große Silberwasserkäfer tragen einen Luftpolster auf der Bauchseite.

Abb. 8: Grundwanzen haben stabile Luftpölster mit denen sie dauerhaft unter Wasser leben können.

Scanne den QR-Code, um Käfer und ihre mobilen Luftvorräte zu sehen. Der Text ist leider auf Englisch, aber das ist vielleicht auch eine gute Übung.

Gespannte Oberflächen?


Die Moleküle einer Flüssigkeit ziehen sich an, nur so bleibt die Flüssigkeit zusammen. Im Inneren der Flüssigkeit sind die Anziehungskräfte in alle Richtungen gleich groß. An der Oberfläche haben Moleküle nur zur Seite und ins Innere der Flüssigkeit hin Nachbarmoleküle, die sie anziehen. Nach Außen hin nicht. Es wirkt eine nach innen gerichtete, die Flüssigkeit zusammenziehende Kraft. Die Oberfläche wird möglichst verkleinert und stabil gehalten. Durch das Zusammenziehen erhöht sich der Druck in der Flüssigkeit bis ein Gleichgewicht entsteht. Dieses Phänomen nennt man Oberflächenspannung.

Abb. 9: Oberflächenspannung. Bei kleiner Belastung verhalten sich Wasseroberflächen wie ein Gummituch. Wasserläufer nutzen das aus.
Volumen und Oberfläche! Stell dir vereinfacht ein Tracheensystem vor, das aus immer kleiner werdenden Quadern aufgebaut ist. Jeder Quader hat eine quadratische Grundfläche. Der größte Quader besitzt die Seitenlänge a und die Höhe h. Bei jeder Verkleinerung werden sowohl die Seitenlänge als auch die Höhe halbiert. (Die Verbindungsstücke kannst du dabei außer Acht lassen.) Berechne für drei Verkleinerungsstufen jeweils das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen! (Schaue notfalls in dein Mathebuch)
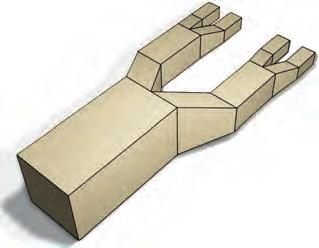
Wie hängen deine Ergebnisse damit zusammen, was du über den Austausch von Atemgasen und Tracheen gelernt hast?


Abb. 11: Oberflächenspannung sorgt für spannende Phänomene. Beispielsweise wenn ein Wassertropfen ins Wasser fällt.
Abb. 10: Einfaches Modell der Verzweigung von Tracheen basierend auf Quadern.
Oberflächenspannung! Mache ein paar einfache Versuche zur Oberflächenspannung!
Du brauchst: eine Schüssel Wasser % kleine leichte Gegenstände wie Centstücke oder Büroklammern % eine Gabel % ungewaschener Apfel oder Birne % ein Glas % Geschirrspülmittel oder Seife .
1) Lege die Gegenstände vorsichtig auf die Wasseroberfläche! Beobachte die Oberfläche genau! Was siehst du? Skizziere deine Beobachtungen!
2) Versuche Gegenstände zu stapeln! Notiere, ob es klappt und wie viele du stapeln konntest! Verfasse Hypothesen, die deine Beobachtungen erklären!
3) Tauche die Gabel flach ins Wasser! Ziehe sie langsam heraus und kippe sie langsam, so dass die Zinken nach unten zeigen! Was beobachtest du? Versuche Tropfen vorsichtig auf das Obst zu verfrachten! Versuche Tropfen zu stapeln! Notiere deine Beobachtungen und versuche eine Erklärung zu finden!
4) Fülle das Glas randvoll an! Füge dann sehr langsam bis tropfenweise noch Wasser hinzu! Wie lange klappt das?
Gib etwas Geschirrspülmittel ins Wasser! Wiederhole deine Versuche! Was hat sich verändert? Für Insekten wie den Wasserläufer oder die Grundwanze ist es gefährlich, wenn durch Abwasser Stoffe wie Waschmittel oder Seifenreste ins Wasser gelangen. Folgere aus deinen Versuchen, wieso!


Abb. 12: Ob und wie große Tropfen sich bilden, hängt von der Oberflächenspannung ab.
Warum ein Apfel? Obst ist oft gewachst, um schöner auszusehen und länger zu halten. Das Wachs ist wasserabweisend, die Grenzschicht des Wassers hat eine hohe Oberflächenspannung.
Künstliche Atmung! Doktor Morbuse möchte ein künstliches Atemorgan erschaffen. Ein passendes, luftdurchlässiges Material hat er schon entwickelt und einige Ideen gesammelt. Nun muss sich entscheiden, welchen Ansatz er weiterverfolgen möchte. Hilf ihm eine Entscheidung zu treffen, indem du ihm durch eine klare Argumentation klar machst, was am besten funktionieren wird!
Idee 1: „Ich baue zwei große hohle Kugeln, die ich mit Luft umströme.
Diese gelangt ins Innere, wo das Atemmodul ist.“
Idee 2: „Ich baue eine Spirale die sich beständig dreht und innen hohl ist.
Das Innere führt über einen Schlauch direkt ins Atemmodul.“
Idee 3: „Ich walze Folien aus, die im Luftstrom leicht flattern. Die kleinen Kanäle darin führen alle zu einem Endstück, das ich an das Atemmodul kopple.“

Lungen sind im Körperinneren gelegene Körperoberflächen (wie ein aus einem Tuch gefalteter Sack), die dem Gasaustausch dienen. Da sie an einer bestimmten Stelle im Körper liegen, muss Sauerstoff von der Lunge in den Rest des Körpers und Kohlenstoffdioxid aus dem Körper zur Lunge transportiert werden. Dies geschieht über ein Kreislaufsystem durch Körperflüssigkeiten. Für einen hohen Gasaustausch muss möglichst viel dieser Körperflüssigkeit durch das Lungengewebe fließen. Es gilt nach wie vor: Die Oberfläche des Lungengewebes sollte möglichst groß sein. Der Weg, den die Gase überwinden müssen, sollte möglichst klein, also die Gewebeschicht zwischen Lungenoberfläche und Transportflüssigkeit möglichst dünn sein.
Die Evolution von Lungen hat sich bei mehreren Tiergruppen unabhängig voneinander vollzogen. Sie entwickelten sich daher aus unterschiedlichen Körpermerkmalen und unterscheiden sich in ihrer heutigen Form und Funktion. Die Lungen der Wirbellosen arbeiten passiv. Die Luft gelangt mittels Diffusion aus der Umgebung zur Lunge. Die Luftbewegung wird jedoch oft von Körperbewegungen unterstützt.
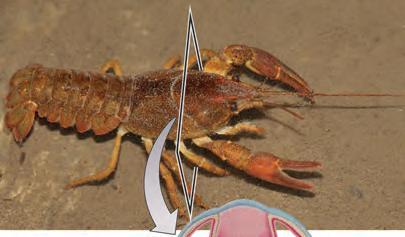
Abb. 1: Das Atemorgan der Lungenkrebse sitzt unter der Schale, wo sich sonst die Kiemen befinden.

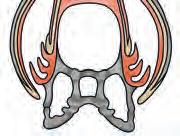
†
Wo liegen beim Menschen die Lungen? Miss die Strecke von deinen Zehenspitzen zu deiner Lunge! Denkst du, das ist kurz genug für Diffusion?
Lungen haben sich bei verschiedenen Tiergruppen unabhängig voneinander entwickelt. Sind sie trotzdem ein Hinweis auf Verwandtschaft? Gib eine Einschätzung ab und begründe sie!

Weshalb Lungen?
Gewebe zum Gasaustausch
Krebstiere mit Lunge verfügen seitlich am Körper über einen Hohlraum unter ihrer Schale. Dieser ist mit gut durchblutetem, dünnem Gewebe zum Gasaustausch ausgekleidet. Lungenschnecken tragen ein mit vielen Blutgefäßen durchzogenes Gewebe in ihrem Gehäuse, oder bei Nacktschnecken unter der Oberseite ihres Körpers. Die Blutgefäße werden direkt vom Herz versorgt.
Lunge mit vielen Blutgefäßen
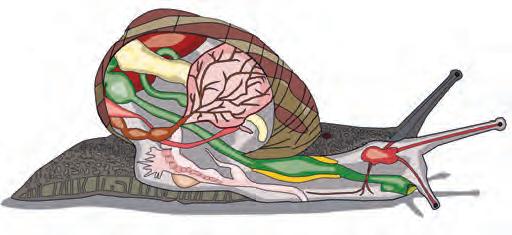
Abb. 2: Körperaufbaue einer Gehäuseschnecke. Die Lunge ist in der Mantelhöhle, einer Ausbuchtung des Rückens, untergebracht.
Viele Spinnentiere verfügen über sogenannte Buch- oder Fächerlungen an der Unterseite ihres Hinterleibes. Sie sind links und rechts der Körpermitte angeordnet. Der Name stammt vom Aufbau des Atemorgans. Das Gewebe zum Gasaustausch ist wie Buchseiten angeordnet. Durch Versteifungen des Gewebes befinden sich zwischen den Blättern Hohlräume in die die Luft von außen gelangen kann.
Zurückgebildete Kiemen Schale
Durch ein Luftloch kann die Umgebungsluft zur Lunge und verbrauchte Luft wieder aus dem Körper gelangen.
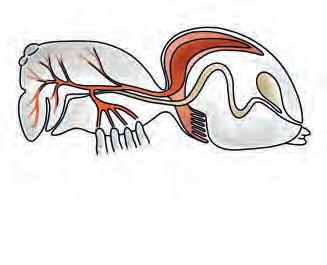
Abb. 3: Buchlunge der Spinne. Luft strömt durch die Spalten.
Buchlunge
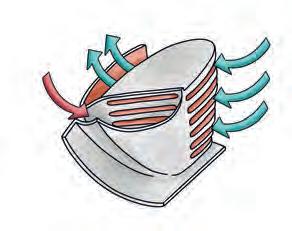

Luft ist weniger dicht als Wasser. Dadurch ist das Atmen an Luft einfacher. Da die Atemorgane nicht vom Wasser getragen werden, müssen sie aber gestützt werden. Dabei hilft das umgebende Gewebe im Körperinneren.
Im Inneren des Körpers ist das Atemorgan besser geschützt.
Für Atemgase durchlässige Gewebe sind dies meist auch für Wasserdampf. Das bedeutet, dass Wasser über sie aus dem Körper entweichen kann. Unter Wasser ist das kein Problem. Die Konzentration an Wasser außen und innen ist etwa gleich. Das Wasser im Körperinneren hat keinen Anlass aus dem Körper auszutreten. Luft ist meist wesentlich trockener als Körpergewebe. Außen liegende Atemorgane würden also für erheblichen Flüssigkeitsverlust sorgen.

Abb. 4: Paarweise angeordnete Buchlungen.

Luftstrom

Atmen über die Haut?


Bei Hautatmung findet der Gasaustausch direkt über die Hautoberfläche mit den Blutgefäßen darunter statt. Das kann auch eine Schleimhaut wie im Mund oder Darm sein. Die meisten Tiere können mit Hautatmung alleine nicht überleben. Eine Ausnahme ist der Regenwurm. Auch beim Menschen findet Hautatmung statt, jedoch werden darüber nur die ersten 0,4 mm der Haut mit Sauerstoff versorgt.
Lies den Text in der Infobox der vorigen Seite! Weshalb spielt Hautatmung bei Amphibien vor allem im Wasser, aber weniger in Luft eine Rolle?

Abb. 6: Braune Bachsalamander atmen über ihre Haut.
Weshalb bevorzugen Braune Bachsalamander feuchte Verstecke, die sie nur bei Regen verlassen? Überlege gut und argumentiere!

Flirtende Frösche!

Die Männchen vieler Froscharten verfügen über ein oder zwei dehnbare Hautsäcke, die Schallblasen, im Hals oder Kehlbereich. Blasen die Frösche diese auf, können sie sie als Resonanzkörper für ihre Paarungsrufe nutzen. Durch die Verstärkung des Schalls sind sie weit zu hören.

Abb. 9: Das ist keine Schluckatmung sondern die Froschart zu flirten.
Amphibien kombinieren mehrere Methoden der Atmung – je nach Art und Lebensweise in unterschiedlichen Verhältnissen.
Bei Kombination von Lungen- und Hautatmung wird oft Sauerstoff vorwiegend über die Lunge aufgenommen und Kohlenstoffdioxid vorwiegend über die Haut abgegeben. Hautund Kiemenatmung spielen vor allem bei vorwiegend im Wasser lebenden Amphibien und während der Überwinterung eine wichtige Rolle. Ein Beispiel für rein hautatmende Amphibien sind die lungenlosen Salamander.

5: Amerikanische Kröte. Sie
Viele Amphibien haben eine einfache Form von Lunge ausgebildet. Diese sind in der Regel sackförmig mit Falten an der Innenseite, um die Oberfläche für den Gasaustausch zu erhöhen (erinnere dich an die beiden wichtigen Prinzipien). Die Lungen werden nach dem Prinzip einer Druckpumpe gefüllt und entleert.
Frösche senken beispielsweise zum Einatmen ihren Mundboden und saugen dadurch Luft durch ihre Nasenlöcher in den Mundraum. Dabei entsteht die typische Bewegung der Kehle bei Fröschen.
Die Verbindung zur Lunge über die Kehle bleibt dabei durch einen ringförmigen Muskel (Glottis) verschlossen. Da die Bewegung aussieht wie Schlucken nennt man diese Art der Atmung auch Schluckatmung




CO

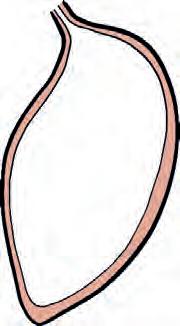
Oberfläche des Gasaustausches
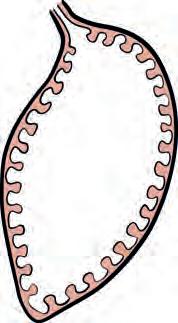
Abb. 7: Amphibienlungen sind einfach aufgebaut. Bei manche Arten haben sich Wölbungen und Falten entwickelt, um die Oberfläche zu vergrößern.
Nach ein bis mehreren Malen der Befüllung des Mundraumes mit Luft, öffnet sich der Zugang zur Lunge und Luft strömt aus der Lunge durch die Nasenlöcher aus dem Tier hinaus. Danach wird die Nase verschlossen und die im Mundraum verbleibende Luft durch ein Heben des Mundbodens in die Lunge gedrückt. Dadurch entsteht in der Lunge ein Überdruck, sodass beim nächsten Atemdurchgang die Luft beim Öffnen der Verbindung zwischen Lunge und Mundraum wieder hinausströmen kann.



Abb. 8: Atmung des Rotaugenlaubfrosches. a) leerer Mundraum. b) Mundraum zum Teil befüllt. c) Mundraum voll befüllt, vor dem Öffnen des Mundes und Einleiten der Luft in die Lunge.
Kaulquappen, also die Larven der Frösche, sind mit Kiemen ausgestattet. Erst beim Heranwachsen entwickeln sich diese zurück und die Lunge entsteht.
Schluckatmung eignet sich nicht besonders gut, um gleichbleibend Luft zu den gasaustauschenden Oberflächen der Lunge zu befördern.Tiere, die dauerhaft an Land leben, haben daher ausgefeiltere Methoden der Luftzufuhr entwickelt.
Reptilien – größere Oberfläche und ausgefeiltere Atmung
Als erste Tiere in der Erdgeschichte haben Reptilien den Übergang vom Wasser zum Landleben vollzogen, sodass die Umstellung ihrer Atmung auf reine Lungenatmung von Vorteil war. Reptilienarten, die auch heute noch viel Zeit im Wasser verbringen, wie beispielsweise Wasserschildkröten, besitzen jedoch nach wie vor die Fähigkeit, über ihre Haut und Schleimhäute zu atmen.
Die Lungen von Eidechsen sind den einfachen Lungen der Amphibien ähnlich. Sie verfügen über einen nicht unterteilten Hohlraum, dessen Oberfläche durch Wölbungen nach innen vergrößert ist. Schildkröten und Krokodile haben in mehrere Kammern unterteilte Lungen, was die Oberfläche, die für den Gasaustausch zur Verfügung steht, deutlich erhöht.


Abb. 10: Die Lungen von Reptilien sind je nach Art unterschiedlich ausgeformt. Von sehr einfach (siehe Abb.7) über a) leicht unterteilt (gekammert) bis hin zu b) stark gekammerten Lungen.
Reptilien, die sich später in der Erdgeschichte entwickelt haben, besitzen im vorderen Bereich ihrer Lungen bereits schwammartige Strukturen, die dicht von Blutgefäßen durchzogen sind. Dadurch entsteht eine Vervielfachung der Oberfläche. Ein Beispiel sind Vipern.
Ein großer evolutionärer Fortschritt war die Luftzufuhr durch Saugwirkung anstelle von Druck, wie bei der Schluckatmung der Amphibien. Voraussetzung dafür war die Entwicklung von beweglich mit der Wirbelsäule verbunden Rippen. Spannt die Rippenmuskulatur, werden die Rippen angehoben und der Brustkorb weitet sich. Da die Lunge fest mit dem umliegenden Gewebe verwachsen ist, dehnt sie sich mit. Es entsteht ein Unterdruck, der bei geöffneter Kehle Luft in die Lunge saugt. Entspannt sich die Rippenmuskulatur, möchten sich Brustkorb und Lunge zusammen ziehen. Es entsteht ein Überdruck in der mit Luft gefüllte Lunge. Öffnet sich die Kehle, wird Luft aus der Lunge hinaus gedrückt und kann den Körper verlassen.
Suche online nach Bildern eines Froschskeletts und dem einer Eidechse! Welches Tier hat Rippen und damit einen Brustkorb? Finde andere Beispiele an Amphibien und Reptilien, die du vergleichen kannst!
Abb. 11: Durch Dehnung des Brustkorbs und der Lunge wird Luft angesaugt.
Nicht alle Reptilien nutzen diese Vorgehensweise. Krokodile verschieben mithilfe ihrer Muskulatur ihre Leber. Diese weitet die Lunge durch Zug, um einzuatmen oder drückt gegen sie, um Luft aus der Lunge zu pressen. Unter Wasser reicht meist schon der Wasserdruck zum Ausatmen. Der starre Panzer der Schildkröten verhindert ein Weiten des Brustraums nach außen. Sie nutzen ein spezielles Muskelpaar, unterstützt durch die Bewegung der Vorderbeine, um die Lunge zu dehnen und zusammenzudrücken.
Atme aktiv so tief ein, wie du kannst! Spüre bewusst, wie sich dein Brustkorb weitet! Atme dann langsam aus und spüre, wie sich der Brustkorb zusammenzieht! Was war mit Aufwand verbunden, Einatmen, oder Ausatmen? Und was ging von selbst? Finde eine Begründung! Atme so tief ein, wie du kannst und halte die Luft an. Spürst du den Druck?
Stell dir einen Würfel vor! Dieser hat eine bestimmte Oberfläche. Nun bohrst du gedanklich ein breites Loch in der Mitte durch! Die Oberfläche im Inneren des Loches kommt zur Oberfläche hinzu. Stell dir nun vor, anstelle des einen Lochs bohrst du zwei etwas dünnere! Nun kommt die Oberfläche von zwei Löchern hinzu. Stell dir vor, du bohrst immer mehr und immer dünnere Löcher! Was passiert mit der gesamten Oberfläche? Argumentiere, weshalb der Ausdruck „Ein Schwamm besteht zum Großteil aus Luft“ zutrifft! Erkläre, weshalb schwammartige Strukturen für Lungen von Vorteil sind!



Abb. 12: Schwämme sind mehr Oberfläche als Volumen.
Ganz schön groß!
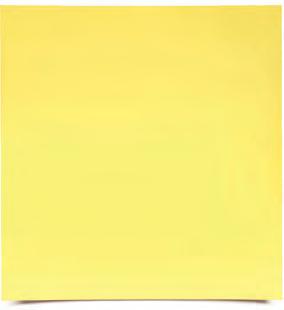

Die gesamte Oberfläche der Lungenbläschen einer menschlichen Lunge ist 70 m² –90 m² groß. Die Lunge selbst hat eine äußere Oberfläche von gerade einmal einem halben Quadratmeter. Die feinporige Struktur sorgt also für eine Vergrößerung der Oberfläche um das 180 fache.
Stellt euch beim nächsten Turnunterricht um eine Fläche von 90 m² (z.B. ein 9 m mal 10 m großes Rechteck, Maßband nicht vergessen) auf! So groß ist die gesamte gasaustauschende Fläche der menschlichen Lunge!
Verknüpfe die Aussage, dass die Luft auf ihrem Weg durch die Bronchien angefeuchtet wird mit der Infobox „Weshalb Lungen“! Formuliere eine erklärende Aussage dazu!
Luftröhre
Säugetiere haben als Nachkommen von Reptilien die Lungenatmung mithilfe von Rippenbewegungen übernommen. Ihre Lungen bestehen aus zwei Lungenflügeln, die links und rechts im Brustraum liegen. Diese werden links in zwei, rechts in drei Lungenlappen unterteilt. Die Oberflächenvergrößerung durch Unterteilung des Innenraums der Lungen (Kammerung) ist bei ihnen besonders stark ausgeprägt.
Säugetierlungen sind mit in Trauben angeordneten Bläschen gefüllt. Diese Lungenbläschen, Alveolen genannt, haben Wände aus sehr dünnem Gewebe, das mit feinen Blutgefäßen (Kapillaren) dicht durchzogen ist. Dieser Aufbau erfüllt die beiden Prinzipien von großer Oberfläche und kleinem Diffusionsweg optimal. Die Oberfläche für den Gasaustausch ist bei Säugetieren fünf- bis zehnmal größer als bei Amphibien und Reptilien gleichen Körpergewichts, obwohl das Volumen von Säugetierlungen wesentlich kleiner ist.
Blase einen Luftballon auf und halte ihn zu! Lasse dann die Luft aus ihm entweichen! Weshalb zieht er sich zusammen? Und weshalb wird das Aufblasen schwerer, je voller er wird? Was hat das mit der Lunge zu tun?
Kehlkopf
Das Lungengewebe der Säugetiere erscheint von außen wie feinporiger Schaumstoff. Ausgehend von der Luftröhre (Trachea) werden die Lungenbläschen über ein stark verzweigtes System an Kanälen (Bronchien mit Bronchiolen als feinen Endverzweigungen) mit Atemluft versorgt. Die Luftröhre und großen Bronchien sind durch hufeisenförmige Knorpelspangen und kleinere Knorpelblättchen versteift. So fallen sie bei Druckänderungen und Bewegungen nicht in sich zusammen und bleiben für die Luft frei durchlässig. Kleinere Bronchien und Bronchiolen verfügen über Muskeln, mit deren Hilfe sie sich verengen und weiten können, um den Luftstrom zu steuern.









gespannter Muskel




Offene Bronchie
Bronchiole
Kapillarsystem
Flimmerhärchen


Lungenbläschen


Verengte Bronchie
Blutgefäße


Kapillare





Abb. 13: Säugetierlunge (Mensch). Die Luftröhre verzweigt sich in zwei Hauptkanäle zu den Lungenflügeln. Dort weiter in die Bronchien und immer feiner bis zu den Bronchiolen. An ihnen sitzen die Lungenbläschen, umspannt von einem dichten Netz an feinen Blutgefäßen.


Kapillarsystem



Sauerstoff Kohlendioxid
Lungenbläschen Wand
CO2 Abgabe
Sauerstoff Aufnahme

Schleimschicht Schleimproduzierende Drüsenzelle
Abb. 14: Innere Oberfläche einer Bronchie.


Luft
Im Inneren der Bronchien liegt eine Schleimschicht mit dicht stehenden feinen Härchen (Flimmerhärchen). Sie filtern Schmutzpartikel aus der Luft. Die Luft wird auf ihrem Weg durch die Bronchien aufgewärmt und angefeuchtet. So erreicht immer gereinigte, körperwarme und feuchte Luft die Lungenbläschen. Von der inneren Oberfläche der Lungenbläschen diffundiert Sauerstoff aus der Atemluft nach innen zu den Blutgefäßen, wo er im Blut aufgenommen wird. Umgekehrt diffundiert Kohlenstoffdioxid aus dem Blut nach außen und wird an die Atemluft abgegeben.
Säugetiere belüften ihre Lungen ausschließlich durch Saugatmung. Die Methode der Dehnung des Brustkorbes kennst du von den Reptilien. Bei den meisten Säugetieren ist die Lunge allerdings nicht mit dem umliegenden Gewebe verwachsen. Sie haftet über einen Flüssigkeitsfilm daran. Nur bei sehr großen Tieren wie Elefanten ist die Lunge mit umgebenden Organen verwachsen. Es wird vermutet, dass die Haftung durch den Flüssigkeitsfilm ab einer bestimmten Größe der Lunge nicht mehr ausreicht. Auch Menschen können mittels ihrer Rippenmuskulatur über eine Dehnung des Brustkorbes atmen. In der ersten Klasse hast du das als Brustatmung kennen gelernt.

Bei Säugetieren hat sich im Laufe der Evolution noch eine weitere Methode zur Dehnung des Brustraumes entwickelt. Sie verfügen über ein Zwerchfell. Das Zwerchfell ist eine flexible Platte aus Sehnen mit Muskeln am Rand, die an Wirbelsäule, Brustbein und Rippen ansetzen. In etwa der Mitte ist es in seiner Lage fixiert. Es liegt unter der Lunge und trennt Brustraum von Bauchraum. Auch das Zwerchfell ist über einen Flüssigkeitsfilm mit der Lunge verbunden.
Film, der: Eine sehr dünne Schicht an der Oberfläche.
Spanne deinen Bauch fest an! Nun versuche tief in deinen Bauch zu atmen! Warum wird die Atmung schwieriger?


In den Bauch atmen? Der Begriff Bauchatmung ist nicht ganz richtig. Die Luft geht nicht in den Bauch hinein. Die Lunge dehnt sich nach unten aus und die Organe darunter müssen Platz machen. Deshalb wölbt sich der Bauch nach vorne und es sieht so aus, als würde man in den Bauch atmen.


Sind die Muskeln des Zwerchfells entspannt, hat es eine nach oben gewölbte Form. Angespannt ziehen die Muskeln die Seiten des Zwerchfells nach unten. Der Brustraum wird vergrößert, die Lunge gedehnt. Es entsteht ein Unterdruck, der Luft einsaugt. Entspannt das Zwerchfell, zieht sich die Lunge wieder zusammen. Die Luft wird aus der Lunge herausgepresst und ausgeatmet. Dies hast du in der ersten Klasse als Bauchatmung kennen gelernt. Wird das Zwerchfell durch intensive Atmung stark angestrengt, kann es zu krampfartigen Schmerzen kommen, dem Seitenstechen.
Scanne den QR-Code und sieh dir an, wie das Zwerchfell beim Atmen arbeitet!














































Brust- und Bauchatmung werden meist gleichzeitig eingesetzt. Der Anteil ist je nach Tierart und Anstrengung verschieden. Bisher hast du die Ausatmung als Vorgang kennen gelernt, der automatisch, also passiv erfolgt. Bei erhöhter Anstrengung kann durch das Spannen der Bauch- und Rippenmuskulatur auch die Ausatmung aktiv unterstützt werden, sodass die Luft schneller aus der Lunge gepresst wird. Beim Kraftoder Kampfsport wird diese als Stoßatmung bezeichnete Methode bewusst eingesetzt.
Die Lunge wird beim Atemvorgang nie vollständig entleert und daher auch nie vollständig mit Frischluft gefüllt. Im oberen Teil der Lunge, der Luftröhre und den Bronchien, findet außerdem kein Gasaustausch statt. Nur ein kleiner Teil der Atemluft wird tatsächlich für den Gasaustausch in den Lungenbläschen verwendet. Das ist zunächst ein großer Nachteil. Doch wird dadurch die Menge an Sauerstoff und CO2 in der Luft in den Lungenbläschen konstant gehalten. Das vermeidet Schwankungen in der Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von CO2

17: Richtige Atmung hilft den Körper bei Anstrengung zu unterstützen. Stoßatmung stabilisiert den Körper und hilft Kraft zu mobilisieren, beispielsweise beim Gewichtheben.

Probiere die Stoßatmung aus! Atme tief ein und dann explosiv durch den Mund aus, indem du aktiv den Bauch einziehst. Was macht deine Bauchmuskulatur? Stelle eine Vermutung an, wieso Stoßatmung Sportlerinnen und Sportlern hilft, den Körper im entscheidenden Moment zu stabilisieren!
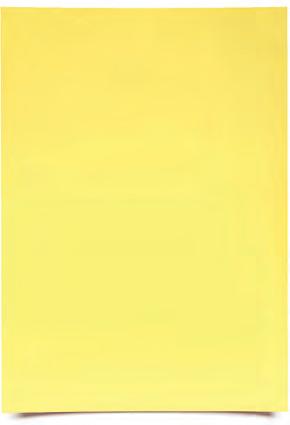
Die Atmung steuern!

Durch intensives Ausatmen lässt sich die Lunge stärker entleeren als bei normaler Atmung. Dadurch sinkt der CO2 Gehalt im Blut und es kann mehr Sauerstoff aufgenommen werden. Taucher nutzen dies, um länger die Luft anhalten zu können. Bei sehr intensiver Atmung über längere Zeit (Hyperventilation) kann allerdings das Gleichgewicht beim Gasaustausch gestört werden. Schwindel bis Ohnmacht sind die Folge.
Parabronchien
Luftsäcke
Blutkapillaren


Luftstrom
Luftpapillaren
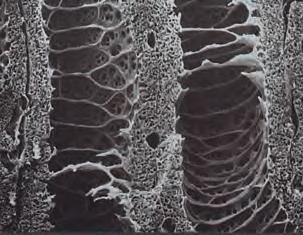
0,5 mm
Abb. 18:
a) Aufbau der Vogellunge.
b) Detailansicht Parabronchie c) Rasterelektronenmikroskop Aufnahme der Parabronchien

höchste Effizienz
Auch Vögel atmen über Lungen. Ihre Lungen sind anders aufgebaut als die der Säugetiere und Reptilien und haben eine noch größere Oberfläche zum Gasaustausch. Evolutionär gesehen, sind die Lungen der Vögel am besten an Luftatmung angepasst. Auch Vogellungen sind als Paar ausgebildet. Sie sind starr mit der rückenseitigen Brustkorbwand verwachsen und können nur wenig gedehnt werden. Statt Lungenbläschen hat sich in ihnen ein System aus dünnen, parallel verlaufenden Röhren, den sogenannten Parabronchien entwickelt. Am Rand der Parabronchien ist ein dichtes Netzwerk aus sehr dünnen Luftkanälen (Luftkapillaren) und Blutgefäßen (Blutkapillaren) ausgebildet. Dadurch entstehen die extrem große Oberfläche zum Gasaustausch und sehr kurze Diffusionswege. Die Parabronchien sind an beiden Enden offen, sodass Atemluft direkt durchströmen kann und nur eine Richtung des Luftstroms notwendig ist. Das hat einen großen Vorteil im Vergleich zu den Luftbläschen, die Sackgassen für den Luftstrom sind und ein hin und her Bewegen der Luft erfordern, wie du sehen wirst.
Die Luftsäcke der Vögel verfügen kaum über Blutgefäße. Argumentiere, weshalb das ein starker Hinweis darauf ist, dass sie nicht dem Gasaustausch dienen! Dies wurde auch experimentell getestet und bestätigt.
Zeichne eine sich verzweigende Bronchie mit Luftbläschen am Ende!
Zeichne den Luftstrom beim Ein- und Ausatmen ein! Mache dir dadurch klar, weshalb die Luft bei Säugetierlungen in zwei Richtungen strömen muss!
Da sich die Lungen selbst wenig dehnen können, braucht es eine andere Methode, um Luft einzusaugen. Auch stellt sich die Frage, wie eine einzige Strömungsrichtung der Luft in der Lunge möglich ist, wenn ein Vogel durch eine Luftröhre ein- und ausatmet. Die Evolution hat dafür eine sehr geschickte Lösung gefunden: Luftsäcke. Luftsäcke finden sich im gesamten Vogelkörper und stellen mit der Lunge ein schleifenförmiges Strömungssystem dar. Sie erstrecken sich in kleine Zwischenräume zwischen Organen und können Hohlräume in Knochen ausfüllen. Die Luftsäcke werden grob in vordere und hintere Luftsäcke eingeteilt.
Bei einem ersten Einatmen dehnt sich der Brustkorb und damit auch die Luftsäcke. Die Dehnung der hinteren Luftsäcke saugt frische Atemluft an. Ein Teil davon gelangt in die Lunge, wo Gasaustausch mit der frischen Luft statt findet, der Rest in die hinteren Luftsäcke. Gleichzeitig wird durch Dehnung der vorderen Luftsäcke verbrauchte Luft aus der Lunge in die vorderen Luftsäcke gesaugt. Beim ersten Ausatmen zieht sich der Brustkorb und damit auch die Luftsäcke zusammen. Die vorderen Luftsäcke pressen dabei die nun in ihnen enthaltene verbrauchte Luft zur Luftröhre, sie wird ausgeatmet. Die hinteren Luftsäcke pressen die frische Luft in ihnen in die Lunge. Bei einem zweiten Atemzug wiederholt sich der Vorgang, so dass die beim ersten Einatmen eingeatmete Luft erst jetzt wieder ausgeatmet wird.
Abb. 19: Ablauf der Atmung bei Vögeln. Die Luft strömt in eine Richtung durch die Lunge. Erst am Ende des zweiten Atemzyklus wird die im ersten eingeatmete Luft wieder ausgeatmet.
Der Vorteil besteht darin, dass sowohl beim Ein- als auch Ausatmen frische Luft durch die Lungen strömt und Gasaustausch stattfinden kann. Lange war nicht klar, wieso die Luft genau auf diese Art strömt, da keine Ventile oder Verengungen im Atemkreislauf vorhanden sind, die die Richtung des Luftstroms steuern. Neuere Forschung hat ergeben, dass allein die schleifenförmige Struktur dazu ausreicht.
Was gehört zusammen? Verbinde die Begriffe mit den Bildern! Formuliere jeweils einen Merksatz!

Rippen

Schluckatmung

Saugatmung








2
Luftsäcke

Lungenbläschen

Zwerchfell

Oberfläche der Lunge! Erstellt ein einfaches Modell, um den Aufbau von Lungen besser zu verstehen! Arbeitet zu zweit oder dritt, dann geht es schneller und macht mehr Spaß!
Ihr braucht: einige Blatt A4 Papier % ein Maßband % Klebstoff oder Klebeband Messt auf einem Tisch eine Fläche von 30 cm mal 42 cm ab und markiert die Ecken! Stellt euch diese Fläche noch einmal 20 cm über der gekennzeichneten vor! Der entstehende Quader soll das Lungenvolumen darstellen. Die Papierblätter sollen die gasaustauschende Oberfläche darstellen.
1) Wie viele Blatt A4 Papier passen in die Fläche? Verdoppelt diese Anzahl, da sie auf der gedachten oberen Fläche noch einmal Platz hätten! Notiert die Oberfläche eurer Lunge als Anzahl der Blatt Papier! (Wenn ihr sehr genau sein möchtet, rechnet die Seitenflächen des Lungenquaders dazu)

2) Faltet die kurze Seite einiger Blätter in etwa 1 cm breiten Streifen abwechselnd nach oben und unten (wie im Bild)! Zieht sie dann leicht auseinander! Wie viele Blatt passen nun in die Fläche? Nehmt diese Anzahl wieder mal zwei! Notiert die Oberfläche eurer Lunge als Anzahl der Blatt Papier! (Wenn ihr möchtest, berücksichtigt die Seitenflächen)

3) Knüllt nun Blätter zu Bällchen und stapelt sie auf eurer Fläche! Denkt daran, maximal 20 cm hoch, das war die Höhe der gedachten Lunge! Notiert die Oberfläche eurer Lunge als Anzahl der Blatt Papier, die nun in eure Lunge passen!
4) Schneidet Blätter der Länge nach in 3 cm breite Streifen. Rollt diese zu Papierröhrchen, die ihr an den Rändern zusammenklebt! Stapelt Röhrchen in eurer Lunge! Ihr müsst die Lunge nicht voll füllen. Stoppt, wenn die Menge an Blatt Papier aus 3) erreicht ist und vergleicht, wie viel Platz noch ist! Schätzt die Oberfläche eurer Lunge durch den Vergleich mit 3) ab!

Verknüpft eure Ergebnisse damit, was ihr über Lungen gelernt habt und fasst alles in einem kurzen Protokoll zusammen!
1 3
Der Evolution auf der Spur! Lies dir folgende Aussagen durch! Verknüpfe sie und formuliere eine Argumentationskette, die begründet, warum Säugetierlungen im Laufe der Evolution größere Oberflächen ausgebildet haben als die der Reptilien und Amphibien!






Der Stoffwechsel dient der Energiegewinnung. Säugetiere sind gleichwarme Tiere, halten also aktiv ihre Körpertemperatur.










Wärme ist eine Form der Energie. Um sie zu erzeugen, muss Energie bereitgestellt werden.








Die Atemgase Sauerstoff und Kohlendioxid werden im Stoffwechsel umgesetzt.








Fülle ein Waschbecken oder eine Wanne mit Wasser! Bewege deine flache Hand mit der Handfläche voran schwungvoll durch das Wasser! Wiederhole das Gleiche an Luft! Was beobachtest du? Stelle eine Verknüpfung zum ersten Absatz her!
Gase im Wasser?


Die in der Luft enthaltenen Gase können ins Wasser eintreten, man nennt das in Lösung gehen, und auch wieder daraus austreten. Tatsächlich findet ständig ein Austausch statt. Im Gleichgewicht geht so viel Gas aus der Luft ins Wasser über wie umgekehrt und an der Gesamtmenge ändert sich jeweils nichts. In Wasser gelöstes Kohlenstoffdioxid kennst du als Kohlensäure vom Mineralwasser oder Softdrinks. Diese wird unter Druck in das Getränk eingebracht und tritt wieder aus, sobald du eine Flasche oder Dose öffnest. Das siehst du als sprudelnde Luftblasen.
Finde eine Begründung dafür, dass Amphibien in der Regel mehrere Arten von Atmung nutzen, während Fische und Säugetiere sich im Laufe der Evolution auf eine Art der Atmung spezialisiert haben!
Abb. 2: Eine Forelle schnappt nach Luft. Das Maul ist geöffnet und der Kiemendeckel angehoben. Normalerweise würde Wasser über die Kiemen strömen, doch an Luft funktioniert die Atmung nicht.

Abb. 3: Kohlensäure ist in Wasser gelöstes Kohlenstoffdioxid. Füllst du Mineralwasser in ein Glas, steigen CO2 Blasen auf.

Abb. 1: Atmung unter Wasser braucht eigens dafür geschaffene Atemorgane. Blick in die Kiementaschen eines Bullenhais.
Atmen im Wasser stellt ganz eigene Herausforderungen an die Atemorgane seiner Bewohner. Im Wasser befindet sich wesentlich weniger Sauerstoff als in Luft. Daher muss eine größere Wassermenge am Atemorgan vorbeiströmen um die selbe Menge Sauerstoff aufzunehmen. Das Sauerstoffangebot im Wasser schwankt deutlich. Weshalb wirst du später erfahren. Kohlenstoffdioxid kann dagegen in größeren Mengen in Wasser übergehen als in Luft. Die Beweglichkeit von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid ist in Wasser viel kleiner als in Luft, was Diffusion erschwert. Wasser ist schwerer als Luft. Es braucht mehr Arbeitsaufwand, um Wasser für die Atmung zu bewegen. Eine Lösung, die im Laufe der Evolution für die Atmung unter Wasser entstanden ist, sind Kiemen
Im Gegensatz zu Lungen, sind Kiemen nach außen gefaltete Körperoberflächen Auch sie sollen eine möglichst große Oberfläche für den Gasaustausch und möglichst kurze Diffusionswege ermöglichen. Ausstülpungen der Körperoberfläche eignen sich besonders gut unter Wasser, da sie durch den Auftrieb im Wasser in Schwebe gehalten werden können. Fein verzweigte Strukturen mit großer Gesamtoberfläche werden vom Wasser selbst in Form gehalten. Es braucht kaum Stützelemente aus dickem Gewebe, das die Diffusion behindert. Allerdings fallen Kiemen an der Luft in sich zusammen und verkleben, sobald sie trocknen. Die Gas austauschende Oberfläche wird stark verringert und die Atmung funktioniert nicht mehr.

Kiemen sind wie Lungen an bestimmten Körperstellen gelagert und brauchen daher ein Kreislaufsystem um die Atemgase zwischen den Kiemen und dem Rest des Körpers zu transportieren. Deshalb ist Kiemengewebe dicht von Blutgefäßen durchzogen
Kiemen haben sich bei unterschiedlichen Tiergruppen eigenständig entwickelt und können sehr unterschiedliche Formen aufweisen. Bei im Wasser lebenden Ringelwürmern bestehen sie aus verzweigten Büscheln, die entlang des Körpers entspringen. Sie werden beständig von Wasser umströmt und können den Gasaustausch vornehmen. Der Axolotl trägt seine Kiemen auf jeweils drei Kiemenästen an den Seiten seines Kopfes.


Die meisten im Wasser lebenden Weichtiere atmen mittels Kammkiemen, die in der sogenannten Mantelhöhle liegen. Die Mantelhöhle ist ein Hautsack, der sich auf der Rückenseite des Tieres befindet. In ihr sind in der Regel die Organe untergebracht. Oft steckt sie in einer schützenden Schale. Kammkiemen bestehen aus Stapeln von Lamellen, die entlang eines fadenförmigen Stranges angeordnet sind. Strang und Lamellen schweben im Wasser. An Luft würden sie zusammensacken und verkleben. Dünne Fortsätze auf den Lamellen erzeugen durch Bewegung einen Wasserstrom über die Oberfläche der Lamellen, der den Gasaustausch verbessert. Viele Muscheln haben stark vergrößerte Kiemen, da sie damit auch Nahrung aus dem Wasser filtern

Kiefermuskel
Raspelzunge
Tentakel

Kopffüßer erzeugen die Wasserströmung über ihre Kiemen durch das Zusammenziehen von Muskeln der hinteren Mantelhöhlenwand. Erfolgt das Zusammenziehen sehr stark, kann bei verschlossener Mantelhöhle ein hoher Druck aufgebaut werden. Der Rückstoß beim Öffnen der Mantelhöhle dient der Fortbewegung. Den genaueren Körperbau anderer Kopffüßer findest du in Abb. 10 in Kapitel 4 im Großkapitel über das Meer.
8: Körperbau der Muscheln. Ihre Kiemen dienen auch der Nahrungsaufnahme.
Sehr kleine Krustentiere können ihren Gasaustausch über die Körperoberfläche durchführen. Größere im Wasser lebende Krustentiere, wie beispielsweise Krabben, Hummer, Garnelen oder Krebse haben dafür Kiemen entwickelt. Diese sind büschelförmig und dicht gepackt, seitlich entlang des Brustraumes unter der Schale positioniert. Dadurch entsteht eine Kiemenhöhle, die mit Wasser durchströmt werden muss. Dafür sorgt ein kleiner blattförmiger Anhang vorne am Brustraum mittels Ruderbewegungen. Das Wasser tritt bauchseitig und von hinten in die Kiemenhöhle und strömt entlang der Kiemen nach oben. Während es die Kiemen umspült, geschieht der Gasaustausch. Danach verlässt das Wasser die Kiemenhöhle am vorderen, bauchseitigen Ende des Brustraums.
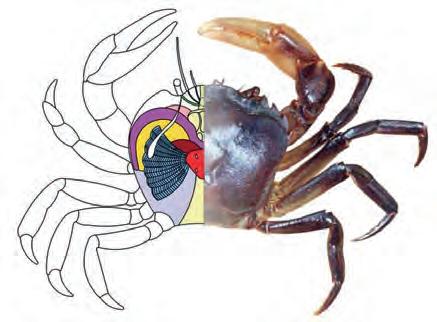


Abb. 6: Körperbau des Perlbootes, ein Kopffüßer. Die Kiemen sitzen in der Mantelhöhle. Wasser und Gas der Schale dienen der Auftriebssteuerung.

Sieh dir die Seite zur Weinbergschnecke in deinem Biologiebuch der 2. Klasse an! Finde die Mantelhöhle auf Abb. 7! Vergleiche auch mit Abb. 2 aus dem Kapitel zu Lungen!
Vergleiche die Lage der Kiemen der auf dieser Seite vorgestellten Tiere! Begründe, warum die Kiemen vieler Tierarten im Inneren ihrer Schale gelegen sind, obwohl das Umströmen mit Wasser dann aufwendiger wird!
Abb. 9: Daphnien sind sehr kleine Krebstiere, die direkt über ihre Körperoberfläche atmen.


Erörtere Unterschiede im Energieverbrauch von Raubfischen, Fischen, die vorwiegend am Grund liegen und Fischen, die weite Strecken zurücklegen Kannst du daraus etwas über die Oberfläche für den Gasaustausch ableiten?
Fische haben hoch entwickelte Kiemen. Viele von ihnen brauchen durch ihre Lebensweise viel Energie und daher einen intensiven Gasaustausch. Die Kiemen der Fische liegen beidseitig in der Mundhöhle. Sie setzen an Kiemenbögen an, die die feste Stützstruktur bilden und größere Blutgefäße beinhalten. Davon gehen zahlreiche Kiemenfilamente ab. Senkrecht auf die Kiemenfilamente stehen dünne Kiemenlamellen eng beieinander und formen eine große Gesamtoberfläche, an der der Gasaustausch stattfindet. Sie sind von einem engmaschigen Netz an feinen Blutgefäßen durchzogen und verfügen über eine sehr dünne äußere Gewebehülle von wenigen bis unter einem Mikrometer.
sauerstoffarmes Blut
Wasserfluss durch ein Kiemenfilament
Bau einer Fischkieme
Kiemenbogen

Kiemenbogen
Wasserfluss

Kiemendeckel (Operculum)

0,5 mm
Abb. 12: Der Aufbau der Kiemen von Fischen. Kleines Bild: Detailaufnahme von Kiemenfilamenten mit senkrechten Lamellen.
Markiere im Sachtext jene Stellen, die mit den beiden Bedingungen für leichten Gasaustausch zusammenhängen!
Was kannst du über die Form und Struktur der Kiemenreuse vermuten, wenn du die Größe der Nahrung eines Fisches kennst?

Abb. 15: Kiementaschen eines Walhais.

Organisation von Kiemenfilamenten
Kiemenfilamente
sauerstoffreiches Blut
Blutgefäße

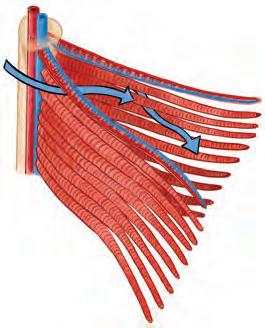
Diffusionsrichtung von O2
Wasserfluss zwischen den Kiemenlamellen
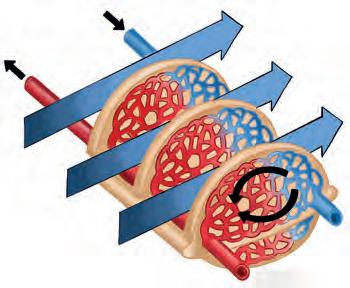

Gegenstromaustausch
Kiemenlamelle
Blutfluss durch die Kapillaren in den Kiemenlamellen
Sauerstoffmenge im Wasser
150 120 90 60 30

140 110 80 50 20
Sauerstoffmenge im Blut
Kiemen sind meist rosa bis tief rot gefärbt, was an der intensiven Durchblutung liegt, die für den Gastransport zwischen Kiemen und dem Rest des Körpers notwendig ist. Für den Gasaustausch muss ständig Wasser über die Kiemen strömen. Das Wasser tritt in der Mundhöhle ein und strömt nach hinten, wo es an den Seiten des Fisches wieder austritt. Von den Kiemenbögen gehen bezahnte Fortsätze in Richtung der Mundhöhle ab. Sie hindern Nahrung daran, durch die Kiemen zu entkommen. Die Fortsätze nennt man Kiemenrechen, das gesamte Organ Kiemenreuse

Abb. 13: Kiemenkamm Kiemenkamm
Kiemenfilamente
Kiementasche
Sauerstoffreiches Wasser
Atemöffnung
Sauerstoffarmes, CO2 reiches Wasser
Im Aufbau der Kiemen von Fischen, deren Skelett aus Knochen besteht (Knochenfischen) und jenen, deren Skelett aus Knorpeln besteht (Knorpelfische), gibt es Unterschiede. Knochenfische tragen meist vier Kiemenbögen in einem nach außen hin durch den Kiemendeckel abgedeckten Bereich, der Kiemenhöhle Der Kiemendeckel besteht aus drei zueinander beweglichen Einzelknochen, wodurch er verformbar ist. Die meisten Knorpelfische verfügen über keinen Kiemendeckel. Bei ihnen sind meist fünf Kiemenbögen durch je eine Scheidewand nach außen hin verlängert. Dadurch bilden sich Kiementaschen in denen jeweils die Kiemenfilamente zweier gegenüberliegender Scheidewände liegen.
Kiemenfilamente

Abb. 14: Kiemen der Knorpelfische. Zweigeteilte Ansicht von jeweils oben (links) und unten (rechts).
Um Sauerstoff aufnehmen und Kohlenstoffdioxid abgeben zu können, müssen Kiemen von Wasser umströmt werden. Dies geschieht immer in die selbe Richtung, da Fische den sogenannten Gegenstromaustausch nutzen (Abb. 12). Wasser und Blut fließen in entgegengesetzte Richtungen, um den Gasaustausch zu erhöhen. Versiegt der Wasserstrom, findet kein Gasaustausch mehr statt und die Fische ersticken.
Knorpelfische können das Strömen des Wassers durch Bewegung der Scheidewände ihrer Kiementaschen unterstützen. Bei manchen Arten reicht dieses aktive Atmen jedoch nicht aus, um einen stetigen Wasserstrom aufrecht zu erhalten. Sie müssen durchgehend schwimmen, um über ihren Mund oder die Atemöffnung Wasser zu den Kiemen strömen zu lassen. Man nennt dies Staudruckatmung

Fische mit Kiemendeckeln haben auch eine weitere Möglichkeit entwickelt, den Wasserstrom aktiv aufrecht zu erhalten. Sie nutzen die Kiemendeckel, um das Wasser pumpen zu können. Dieser Pumpatmung genannte Vorgang, besteht aus zwei Schritten.
Kiemenhöhle
Kiemen
Mundhöhle
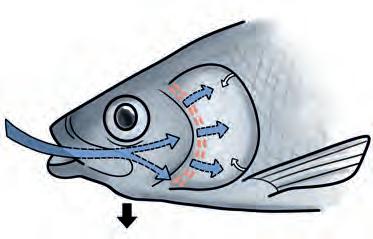
Mundboden
Stell dir vor, du fährst mit dem Rad! Jemand fährt mit etwas größerer Geschwindigkeit neben dir und überholt dich. Später kommt dir die Person mit der gleichen Geschwindigkeit entgegen und fährt an dir vorbei. In welchem der beiden Fälle war eure Geschwindigkeit relativ zueinander größer? Lege dieses Gedankenexperiment auf das Gegenstromprinzip der Kiemen um und formuliere eine kurze Beschreibung!
Erörtere, warum die Schwimmgeschwindigkeit von Fischen für ihren Atemprozess wichtig sein kann – oder ob sie dabei keine Rolle spielt.
Beobachte Fische im Aquarium oder auf Videos! Kannst du den Atemprozess erkennen? Achte auf Details und notiere sie!
Kiemendeckel schließt
Abb. 17: Einatmen mit Kiemendeckeln.

Mundboden
Wasser Kiemendeckel öffnet
Abb. 18: Ausatmen mit Kiemendeckeln.
1) Erst wird der Mundboden bei offenem Maul gesenkt. Dadurch vergrößert sich der Raum in der Mundhöhle. Es entsteht ein Unterdruck und Wasser wird über das Maul eingesaugt. Da der Unterdruck auch in Richtung der Kiemen wirkt, würde so auch verbrauchtes Wasser aus den Kiemen ins Maul strömen. Um das zu verhindern, wölben sich die Kiemendeckel nach außen. Die Ränder der Kiemendeckel werden fest an den Körper angelegt und die Kiemenhöhle verschlossen. Außerdem vergrößern sich die Kiemenhöhlen und Wasser wird aus dem Maul in Richtung Kiemen gesaugt. Das garantiert eine fixe Strömungsrichtung des Wassers.
2) Beim Ausatmen schließt der Fisch das Maul und hebt den Mundboden. Gleichzeitig entspannt der die Kiemendeckel. Durch den sich verkleinernden Mundraum entsteht ein Überdruck, der das Wasser aus der nun durch die entspannten Kiemendeckel offenen Kiemenhöhlen hinauspresst.


Wasser atmen ist Arbeit! Du hast bereits gelernt, dass Wasser schwerer ist als Luft und es mehr Arbeit braucht, um es in Bewegung zu versetzen. Dementsprechend ist es für Fische mit Aufwand verbunden, den Kiemen Wasser durch aktives Atmen zuzuführen. Der Energieaufwand dazu beträgt je nach Fischart und Bedingungen bis zu 40% des Energiebedarfs des ruhenden Fisches (also rein um seine Lebensfunktionen aufrecht zu erhalten). Das ist ziemlich viel und ein guter Grund, passiv durch Staudruck zu atmen, wenn die Schwimmgeschwindigkeit hoch genug ist.
Durch die immer gleichbleibende Strömungsrichtung können sich Partikel in den Kiemen verfangen. Um sie wieder loszuwerden können Fische die Strömungsrichtung kurzzeitig umkehren. Das Wasser trägt dann die Partikel in die Mundhöhle von wo sie ausgespuckt werden können.
Fische, die aktiv atmen, können ab einer gewissen Schwimmgeschwindigkeit auf ihren Pumpprozess verzichten. Sie nützen die durch das Schwimmen erzeugte Strömung (Staudruckatmung) und müssen nicht zusätzlich Energie für das Pumpen aufwenden.
Denke an den Atemprozess bei Fischen mit Kiemendeckeln. Erkläre, wie durch eine Strömungsumkehr die Kiemen gereinigt werden können.
Argumentiere, weshalb es für das Überleben vorteilhaft ist, wenn Fische ihre Kiemen auch ohne aktive Bewegung durchströmen lassen können.
Was ist was? Beschrifte das Bild mit den richtigen Begriffen!

Abb. 19: Kiemen der Knochenfische. Schreibe die Legende.
Knorpelfisch und Knochenfisch! Schnapp dir einen Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied! Erkläre den Unterschied zwischen den Kiemen der Knorpelfische und Knochenfische! Beobachte die Reaktion und bitte um Rückmeldung, um herauszufinden, ob deine Erklärung verständlich war!
Kiemen basteln! Fülle eine Schüssel oder ein Waschbecken mit Wasser. Schneide von einem Taschentuch oder Blatt Klopapier etwa 1 cm breite Streifen herunter! Halte alle Streifen an einem Ende zusammen, tauche sie ins Wasser und bewege sie leicht herum! Was beobachtest du? Ziehe die Streifen aus dem Wasser und bewege sie leicht! Was beobachtest du? Denke daran, was du über Kiemen gelernt hast und unter welchen Umständen sie arbeiten können! Stelle eine Verbindung zu deinen Beobachtungen her! Notiere eine Forschungsfrage, Hypothese und Antwort samt Erklärung, passend zu deinem Versuch!
Forschungsfrage:
Hypothese:
Antwort:
3 4 1 2
Pumpatmung! Fülle Wasser in ein Waschbecken! Führe nun folgende Schritte durch!
1) Tauche beide Hände ins Wasser und lege sie flach aufeinander, so wie in Abbildung 20 gezeigt! Lege die Daumen fest an!
2) Krümme die Hände schnell, so dass Handballen und Fingerspitzen fest beinander bleiben (siehe Abbildung 21)! Was spürst du auf den Handflächen?
3) Presse nun die Handflächen schnell und fest zusammen! Was beobachtest du?
Halte die Hände seitlich ins Wasser! Lege einen kleinen schwimmenden Gegenstand auf die Seite der kleinen Finger nahe an die Hände! Wiederhole den Versuch nahe an der Oberfläche beim Gegenstand! Beobachte, was der Gegenstand macht! Das Ganze braucht vielleicht etwas Übung. Tipp: Du kannst den Effekt verstärken, wenn du die Hände auf der Seite des Gegenstands nur wenig öffnest, so dass eine Trichterform entsteht (Mach einen Abstecher auf Seite 133 und suche die Gemeinsamkeit).
Notiere deine Beobachtungen und verknüpfe sie in einem kurzen Text mit der Pumpatmung der Fische!


Abb. 21: Krümme die Hände.
Für viele Lebewesen ist Atmung lebensnotwendig. Entsprechend sind im Laufe der Evolution Körpermerkmale und -prozesse dahingehend selektiert worden, Atmung für Lebewesen in ihren Lebensräumen effizient zu gestalten. Dies nachzuvollziehen, liefert wertvolle Einblicke in evolutionäre Vorgänge sowie vergangene Umweltbedingungen.


Die Erforschung von Funktionsweise und Aufbau von Atemorganen ist notwendig, um die Folgen von Umwelteinflüssen und Umweltveränderungen auf Lebewesen abschätzen zu können. Das ist wichtig für die Medizin, um beispielsweise die Auswirkung von Krankheiten oder Schadstoffen auf Tier und Mensch vorhersagen und behandeln zu können. Hier arbeitet die Biologie eng mit der Medizin zusammen. Im Bereich der Sportmedizin spielt Atmung zur Leistungssteigerung eine Rolle. Auch für den Umwelt- und Artenschutz sind diese Erkenntnisse sehr wertvoll, um beispielsweise die Folgen der Erwärmung der Meere und deren CO2 Gehalt für Meeresbewohner zu verstehen.
Die besonderen Eigenheiten der im Laufe der Evolution entstandenen Designs sind interessant für die Technik. Viele Millionen Jahre Anpassung und Selektion haben effiziente Lösungen für viele Problemstellungen hervorgebracht. Die Gebiete der Biomimikry und Bionik kopieren die Natur in der Technik – etwa den Atemkreislauf der Vögel, der ohne Ventile und Lenkelemente einen Luftstrom in ausschließlich eine Richtung hervorbringt.
1
Säugetierlunge! Baue ein Lungenmodell, um die Funktion der Lunge besser nachvollziehen zu können!
Du brauchst: Plastikflasche (0,25 l oder 0,5 l) % drei Luftballons % einen Plastikstrohhalm oder zwei Röhrchen von Kugelschreibern % zwei Gummiringe % etwas Knetmasse % Schere oder Stanleymesser
2
Schneide das untere Ende der Plastikflasche weg! Sei dabei vorsichtig oder lasse dir helfen!
Schneide den Strohhalm in der Mitte durch! Stecke jeweils ein Stück in die Öffnung eines Ballons und fixiere das Ganze mit den Gummiringen! Achte darauf, dass die Gummiringe fest sitzen und gut abdichten!
Stecke die beiden Luftballons in die Flasche, sodass die Röhrchen aus der Trinköffnung ragen. Dichte dann den Hals der Flasche mit der Knetmasse luftdicht ab! Achte darauf, dass die Röhrchen nicht verstopft werden!
Schneide vom dritten Ballon den Hals ab! Spanne den Ballon über das untere Ende der Flasche! Achte darauf, dass die Flasche nicht eingedrückt wird! In dem Fall schneide mehr vom Ballon weg, sodass er weiter ist!
Ziehe in der Mitte an dem über die Flasche gespannten Ballon und beobachte was geschieht!
Ordne die Teile deines Modells den Teilen der Säugetierlunge zu! Schreibe einen kurzen Text in dem du beschreibst, wie dein Modell die Atmung der Säugetiere, nicht jedoch jene der Reptilien simuliert!
Atemvolumen! Bildet kleine Teams und bestimmt gemeinsam euer Atemvolumen!
Ihr braucht: große Schüssel mit Wasser % etwa 50 cm langen Schlauch % durchsichtiger Messbecher (mind. 0,5l) Eine(r) von euch taucht den Messbecher unter Wasser, so dass er sich ganz füllt! Dann wird der Messbecher unter Wasser umgedreht, sodass sein Boden über Wasser ragt, der Rand aber noch unter Wasser ist!
Ein anderes Teammitglied holt tief Luft und bläst mit dem Schlauch von unten in den Messbecher. Die Luft verdrängt das Wasser und ihr könnt ablesen, wie viel Luft hineingeblasen wurde!
Ist der Messbecher aber nicht die Lunge leer, heißt es kurz Luftanhalten bis der Messbecher wieder gefüllt und in Position ist. Dann wird weiter geblasen!
Addiert die abgelesenen Werte, um zu wissen, wie viel Luft das Teammitglied ausgeatmet hat! Notiert den Wert!

Macht jeder mehrere Durchgänge! Atmet dazwischen tief und ruhig! Stellt dann die jeweils größten Werte aller Teammitglieder in einem Balkendiagramm dar!

So schätze ich mich nach dem Großkapitel ATMUNG selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
…die Rolle von Sauerstoff für die Energiegewinnung von Lebewesen erläutern.
…beschreiben, was Diffusion ist und ihre Bedeutung für die Atmung darstellen.
… die Atmung von Insekten erklären und die Erklärung durch Skizzen unterstützen.
…beschreiben, was Tracheen und Stigmen sind.
…beschreiben, wie manche Insekten ihr Atmungssystem auch unter Wasser nutzen können.
…argumentieren, weshalb Lungen ein Kreislaufsystem voraussetzen.
…Beispiele für Aufbau und Funktion von Lungen von wirbellosen Tieren geben.
…Arten der Atmung von Amphibien aufzählen und erklären, wie Schluckatmung funktioniert.
…am Beispiel der Reptilien evolutionäre Entwicklungen der Lunge und Atmungsweisen sowie deren Hintergründe aufzeigen.
…Aufbau und Funktionsweise der Säugetierlungen genauer erklären und die Erklärung durch Skizzen unterstützen.
…beschreiben, wie die Atmung der Säugetiere funktioniert und welche Rolle der Brustkorb, das Zwerchfell und die beteiligten Muskeln spielen.
…wichtige Hintergründe und Prinzipien der Atmung durch einfache Versuche demonstrieren.
…die Funktionsweise von Atmung und Lunge der Vögel erläutern.
…die unterschiedlichen Bedingungen von Atmung an Luft und unter Wasser benennen und wie sich diese auf die Entwicklung von Kiemen ausgewirkt hat.
…Aufbau und Funktionsweise von Kiemen verschiedener im Wasser lebender Tiere beschreiben, gegenüberstellen und miteinander vergleichen.
…die Atemmethoden von Fischen und deren Hintergründe erörtern.
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:



Johanna Klement: WAS IST WAS Dein Körper. Was alles in dir steckt (Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG 2024).
Maria Wolke: Ich atme, also bin ich: Wie Atmung unser Denken, Fühlen und Verhalten in Einklang bringt (Meyer & Meyer 2025).
Dietmar Mertens: Visuelles Wissen. Biologie: Der anschauliche Einstieg in alle Themenbereiche (Dorling Kindersley Verlag 2021).



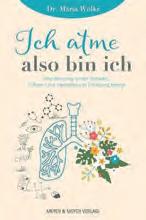




Um die Zellen im Körper mit Nährstoffen und Stoffwechselprodukten zu versorgen, braucht es Transportmechanismen. Tierische Zellen benötigen zur Energiegewinnung Sauerstoff und geben Kohlenstoffdioxid ab. Wird nicht der gesamte Körper direkt über das Atemorgan mit den Atemgasen versorgt, müssen zusätzlich die Atemgase zwischen dem Atemorgan und dem Rest des Körpers transportiert werden. Dies ist bei Lungen und Kiemen der Fall.
















Zur Bewältigung dieser Aufgaben dient ein Kreislaufsystem. In ihm strömt ständig Flüssigkeit durch den Körper. Diese Flüssigkeit kann Substanzen aufnehmen und abgeben und so im Körper bestehende Ungleichgewichte ausgleichen. Flüssigkeit kann Wärme transportieren. So wird Wärme im Körper verteilt und zur Körperoberfläche gebracht, wo sie abgegeben werden kann.

Die Flüssigkeit transportiert Hormone, die Signal- und Regulierungsstoffe des Körpers. Sie beinhaltet Mechanismen Abwehr von Krankheiten. Diese vielschichtig zusammengesetzte und für Lebewesen sehr wichtige Flüssigkeit
Wiederhole, welche Tierarten über Lungen oder Kiemen verfügen und daher auf ein Kreislaufsystem angewiesen sind!
Überlege dir Situationen, in denen es wichtig ist, dass Wärme im Körper transportiert wird! Was würde ohne diesen Mechanismus geschehen?
Blut besteht aus einer wässrigen Lösung von Nährstoffen, Eiweißen (Proteine), Stoffwechselprodukten und anderen Substanzen, dem Blutplasma. Darin sind Blutzellen verteilt. Die Proteine im Blut übernehmen viele Aufgaben. Sie transportieren beispielsweise Fette. Das ist wichtig, da Fette in Wasser unlöslich sind und nicht ohne weiteres im Blut transportiert werden können.
Abb. 2: Blut besteht aus vielen verschiedenen Bestandteilen.

Blutzellen (Hämozyten) erfüllen vielfältige Aufgaben wie den Abbau von Fremdpartikeln oder die Speicherung und den Transport von Nährstoffen. Bei Wirbeltieren können drei Hauptgruppen von Blutzellen unterschieden werden. Rote Blutzellen (Erythrozyten) sind für den Transport der Atemgase zuständig. Weiße Blutzellen (Leukozyten) dienen der Abwehrfunktion des Blutes gegenüber Fremdpartikeln und Krankheitserregern. Blutplättchen (Thrombozyten) sind für die Blutgerinnung und damit Heilung von Wunden wichtig. Diese Blutzellen sind 1,5 μm bis 20 μm groß und entstehen im Knochenmark größerer Knochen aus Stammzellen.
Rote Blutkörperchen Erythrozyten Weiße Blutkörperchen Leukozyten Blutplättchen Thrombozyten

Schnapp dir eine Wärmeflasche, fülle sie mit heißem Wasser und halte sie fünf bis zehn Minuten an eine Stelle deines Körpers! Was kannst du beobachten und weshalb geschieht es? Finde Körperstellen, an denen der Effekt besonders stark ist! Hast du eine Erklärung weshalb? Tipp: besonders gut klappt das, wenn dir etwas kalt ist! wässrige Lösung, die: In der Chemie bezeichnet man mit Lösung mindestens zwei Stoffe, die gleichmäßig durchgemischt sind. Es sind also keine Ansammlungen des einen oder anderen Stoffes vorhanden und mit freiem Auge sieht das Gemisch wie eine einheitliche Substanz aus. Wässrig meint, dass die Lösung in Wasser erfolgt.














Abb. 3: Arbeitsteilung gilt auch im Blut, jede Art von Blutzelle ist auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert. Weiße Blutzellen gibt es in verschiedenen Varianten.
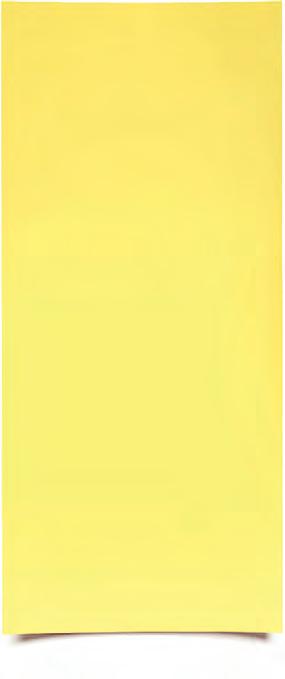
Was sind Stammzellen? Als Stammzellen bezeichnet man Zellen, die sich bei ihrer Teilung in Zellen mit neuen Eigenschaften und Fähigkeiten umwandeln können. Das ist besonders wichtig beim Embryo, wo sich aus einer befruchteten Eizelle ein ganzer Organismus aus vielen verschiedenartigen Zellen mit jeweils ganz speziellen Aufgaben und Eigenschaften entwickeln muss. Stammzellen in erwachsenen Organismen können sich in der Regel nur in bestimmte Zellarten umwandeln. Beispielsweise neuronale Stammzellen im Gehirn zu Nervenzellen. Blutstammzellen befinden sich im Knochenmark, vor allem der Wirbelsäule. Aus ihnen entwickeln sich die unterschiedlichen Blutkörperchen.
Wiederhole, wie der Gasaustausch an Gewebeoberflächen durch Diffusion funktioniert! Was genau zeigt Abbildung 4? Welcher Teil der Lunge (oder eines anderen Atemorgans) ist zu sehen?
Bei Tieren mit Lungen oder Kiemen ist eine der wesentlichen Aufgaben des Blutes der Transport von Sauerstoff vom Atemorgan zu den Geweben und von Kohlenstoffdioxid von den Geweben zum Atemorgan.
An den Gas austauschenden Oberflächen des Atemorganes wird durch Diffusion Sauerstoff vom Blut aufgenommen und Kohlenstoffdioxid vom Blut abgegeben. Nach dem Transport des Blutes durch den Körper geschieht in den anderen Geweben der umgekehrte Prozess. Sauerstoff diffundiert vom Blut in Gewebezellen und Kohlendioxid von den Zellen ins Blut. Innerhalb der Gewebe geschieht der Transport über Gewebsflüssigkeiten, so dass nicht jede einzelne Zelle vom Blut versorgt werden muss.



























Betrachte die Austauschprozesse in Abbildung 4 genau! Wo in den Atemorganen, im Blut und in den Zellen anderer Gewebe muss jeweils mehr oder weniger Sauerstoff (O₂) bzw. Kohlendioxid (CO₂) vorhanden sein, damit die Diffusion in die richtige Richtung verläuft? Begründe deine Antwort! Wodurch entstehen diese Bedingungen?
Finde heraus, welche Tiere eine andere Blutfarbe als Rot haben! Was verursacht die jeweilige Farbe? Recherchiere außerdem, welches Transportprotein bei diesen Tieren für den Gasaustausch verantwortlich ist! Lass dich dabei nicht von schwierigen Fachbegriffen abschrecken. Notiere auch, welche Quellen du verwendet hast – und warum du sie gewählt hast!




CO



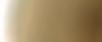





















Abb. 4: Der eingeatmete Sauerstoff gelangt in den Atemorganen durch Diffusion ins Blut. Dieses gelangt über das Kreislaufsystem zu den verschiedenen Geweben innerhalb des Körpers. Dort gibt es den Sauerstoff ab und nimmt Kohlenstoffdioxid auf. Dieses transportiert das Blut zurück zum Atemorgan, wo es ausgeatmet wird. Auf diese Art und Weise wird der gesamte Körper versorgt.
Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid kann direkt in Wasser gelöst sein. Vor allem beim Sauerstoff allerdings in zu geringen Mengen, um für den Transport innerhalb des Körpers ausreichend zu sein. Deshalb werden die Atemgase im Blut durch spezielle Proteine transportiert. Im Laufe der Evolution haben sich, je nach Tierart, unterschiedliche davon durchgesetzt. Alle diese Proteine enthalten Metalle für die Bindung von Sauerstoff und sorgen durch ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit Licht für eine charakteristische Färbung des Blutes. Diese muss nicht rot, wie bei den Wirbeltieren, sein und kann auch wechseln, je nachdem ob gerade Sauerstoff transportiert wird oder nicht. Die Transportproteine für Atemgase können im Blut zu Gruppen zusammengepackt oder in Zellen verpackt vorkommen, nicht jedoch einzeln im Blut schwimmend. Anders würde es zu Problemen kommen. Um die zu verstehen musst du dich aber noch etwas gedulden, bis du in Chemie etwas über Osmose lernst.




Abb.5: Jede dieser Arten hat im Laufe ihrer Evolution unterschiedliche Proteine zum Sauerstofftransport entwickelt. Meist findet die Natur unterschiedliche Lösungen für eine Herausforderung.
Das im Tierreich am weitesten verbreitete und im Blut der Wirbeltiere ausschließlich vorkommende Transportprotein für Atemgase ist Hämoglobin. Bei allen Wirbeltieren (mit Ausnahme der Krokodileisfische) kommt es im Blut verpackt in rote Blutzellen, den Erythrozyten vor. Dies hat den Vorteil, dass die Transportfähigkeit durch Vorgänge in den Zellen gesteuert werden kann.
Abb. 6: Zusammenspiel von roter Blutzelle und Hämoglobin für den Sauerstofftransport.
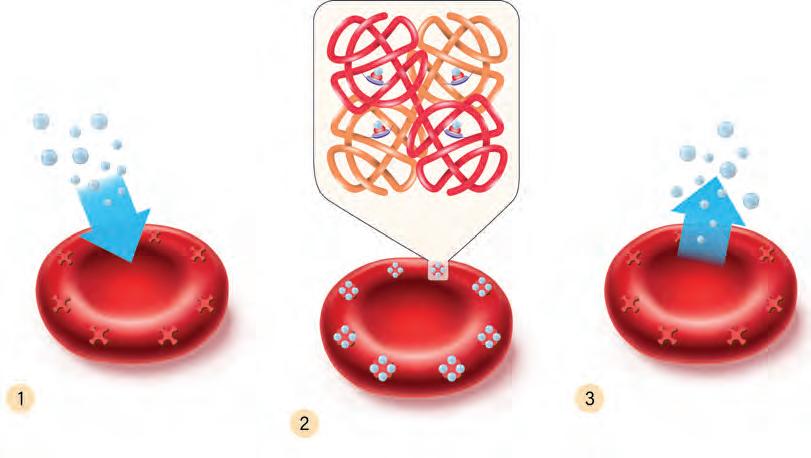
Hämoglobin
Hämoglobin sitzt auf der roten Blutzelle und kann Sauerstoff aus der Umgebung aufnehmen.
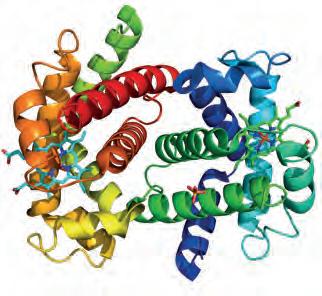
Abb. 7: Computermodell des Hämoglobins. Die Spiralen stellen lange Molekülketten dar, die sechseckigen Teile Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Sieht kompliziert aus? Ist es auch. Deswegen ist die genaue Erforschung von Biomolekülen oft eine schwierige Angelegenheit.
Der Sauerstoff wird gebunden und mit der Blutzelle durch das Blut transportiert.
Sauerstoff gebunden im Hämoglobin
8 μm
Welche Farbe hat Wirbeltierblut? Welches Metall wird in Kombination mit Sauerstoff, also wenn es rostet, rot? Recherchiere online, welches Metall in Hämoglobin vorhanden ist! Beachte: Hämoglobin ist nicht wie Rost, aber die gedankliche Verbindung hilft beim Merken.
An Orten mit wenig Sauerstoff oder viel Kohlenstoffdioxid wird der Sauerstoff vom Hämoglobin abgegeben.
Hämoglobin hat eine besondere Eigenschaft. Ist in seinem Umfeld viel Sauerstoff vorhanden, nimmt es bevorzugt Sauerstoff auf. Ist in seinem Umfeld wenig Sauerstoff, oder viel CO2 vorhanden, gibt es bevorzugt Sauerstoff ab und zwar um so mehr, je geringer der Sauerstoffgehalt der Umgebung ist. Das ist genau die Eigenschaft, die benötigt wird. In den Atemorganen steht viel Sauerstoff zur Verfügung und dieser soll ins Blut aufgenommen werden. In den anderen Geweben ist weniger Sauerstoff und viel CO2 vorhanden. Dort soll Sauerstoff vom Blut nachgeliefert und CO2 abtransportiert werden. Die vorhandene Menge an Sauerstoff und CO2 wirkt für das Hämoglobin also wie ein Schalter, der seine Funktionsweise an die Umgebungsbedingungen anpasst.
Kohlenstoffdioxid muss als Endprodukt des Stoffwechsels ständig ausgeschieden werden. Würde es einfach ins Blut gelangen, würde sich Kohlensäure bilden und das Blut sauer werden. Kohlenstoffdioxid kann vom Hämoglobin aufgenommen und abtransportiert werden. Bei Wirbeltieren ist dieser Vorgang jedoch nur für etwa 20 % des Abtransportes von CO2 verantwortlich. Eine größere Rolle spielen die roten Blutzellen. Sie wandeln das CO2 um, sodass es ohne Probleme zu bereiten im Blutplasma und den Erythrozyten selbst abtransportiert werden kann.
Bei der Sichelzellenanämie sorgt ein genetischer Fehler dafür, dass das Hämoglobin falsch aufgebaut ist. Die Roten Blutzellen nehmen eine Sichelform an. Sie neigen dazu sich in dünnen Blutgefäßen zu verkeilen und sterben früher ab.
Sichelanämie Blutzelle Gesunde Blutzelle

normales Hämoglobin verändertes Hämoglobin
Abb. 8: Sichelzellenanämie entsteht durch eine Veränderung in den Genen.

Sauerstoffkonkurrent!
Kohlenmonoxid (CO) bindet wesentlich leichter an Hämoglobin als Sauerstoff. Darum ist CO giftig. Es blockiert die Transportstellen des Hämoglobins, sodass dieses keinen Sauerstoff mehr transportieren kann. Egal wie viel man einatmet, es gelangt zu wenig Sauerstoff ins Blut, was im schlimmsten Fall zum Tod führt. CO ist ein farbund geruchloses Gas, das beispielsweise bei unvollständigen Verbrennungsprozessen entsteht.

Tabakrauch enthält CO. Erörtere davon ausgehend, weshalb Raucherinnen und Raucher eine geringere Atemleistung zeigen als Nichtraucherinnen und Nichtraucher!


Nicht zu heiß, nicht zu kalt! Die Fähigkeit von Hämoglobin, Sauerstoff aufzunehmen und abzugeben, hängt von der Temperatur ab. Bei zu niedrigen und zu hohen Temperaturen funktioniert der Sauerstoffaustausch nicht mehr richtig. Der Körper bekommt Probleme, die Zellen mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Dies ist beispielsweise für Wasserbewohner ein Problem, wenn sich die Wassertemperaturen ihres Lebensraums verändern.
Antarktische Eisfische leben bei Temperaturen um –1°C. Vermute, weshalb während der Evolution dieser Fische die Verwendung von Hämoglobin abhanden gekommen ist!
Molekül, das: Verbindung aus Nichtmetallatomen.
Biomolekül, das: Molekül, das in biologischen Vorgängen eine wichtige Rolle spielt.
Irgendwie ist jedem klar, dass es nicht so gut ist, viel Blut zu verlieren. Doch weshalb genau ist der Verlust von Blut für den Körper ein Problem? Formuliere einen kurzen Erklärungstext!

Was sind blaue Flecken?

Blaue Flecken entstehen durch Verletzungen der Blutgefäße in den unteren Hautschichten. Wenn du z.B. gegen eine Tischkante läufst, platzen durch die Krafteinwirkung Blutgefäße, ohne dass eine offene Wunde entsteht. Das Blut verteilt sich im Gewebe, bis die Blutung stoppt. Während des Abbaus des Hämoglobins entstehen Reststoffe mit unterschiedlichen Farben. Deshalb ändert sich die Färbung des blauen Flecks mit der Zeit.
Welche Verletzungen sind neben Schürfwunden und blauen Flecken noch recht häufig? Welche Verletzungen bluten stärker, welche weniger? Woran liegt das? Teilt eure Erfahrungen in Kleingruppen und sprecht darüber, wie sich Verletzungen vermeiden lassen!


Blutungen stillen!

Die meisten Wunden bluten nicht besonders stark, so dass die Blutung rasch von selbst aufhört. Ein Pflaster, das leichten Druck auf die Wunde ausübt und sie abschirmt, unterstützt den Körper dabei. Manche Wunden bluten jedoch stark. Dann ist es wichtig, Druck auf die Wunde auszuüben, um die Blutung möglichst zu stoppen. Verwende dabei möglichst sauberes, am besten steriles Material, um eine Infektion der Wunde zu vermeiden. In schweren Fällen ist das Anlegen eines Druckverbands notwendig.
Recherchiere, wie man einen Druckverband anlegt! Um es zu beherrschen, braucht es auch Übung! Am Besten geeignet sind Erste Hilfe Kurse. Vielleicht bietet deine Schule einen an.
Du kennst das, du schneidest dich oder schürfst dich auf und die Wunde beginnt zu bluten. Die Verletzung hat kleinere Blutgefäße aufgerissen, Blut tritt aus. Das kann etwas heftiger sein, doch nach einer Zeit hört die Blutung auf. Wie macht der Körper das? Hätte der Körper keine Möglichkeit, den Blutverlust zu stoppen, wären auch Verletzungen kleinerer Blutgefäße gefährlich, da über die Zeit eine große Menge Blut verloren geht. Für das Stoppen der Blutung spielen die Blutplättchen eine entscheidende Rolle. Im Normalfall sind sie klein und flach. Tritt eine Verletzung auf, werden sie aktiviert und treten in Aktion. Der Vorgang lässt sich in zwei Phasen beschreiben.
Abb. 9: Sehr häufige Verletzungen sind Schürfwunden von Stürzen.
1) „Klebrig und stachelig“: Mit dem Blut treten Blutplättchen aus der Wunde aus. Diese tragen ein spezielles Protein, das sie am Gewebe der Wundränder haften lässt. Während diesem Vorgang verformen sich die Blutplättchen. Sie werden größer, kugelig und bilden stachelförmige Fortsätze, wodurch sie sich miteinander verhaken. Es kommt zur Bildung einer Anhäufung und Verklumpung . Die Blutplättchen setzen einen Signalstoff frei, der weitere Blutplättchen dazu bringt, sich an der verletzten Stelle festzusetzen. Andere Signalstoffe bringen das Blutgefäß dazu, sich zusammenzuziehen, der Blutfluss verringert sich. Insgesamt wird so die Wunde verschlossen. Diese erste Phase dauert in der Regel ein bis vier Minuten. Da während der Bildung des Verschlusses noch Blut austritt, wird diese Zeitspanne auch Blutungszeit genannt.
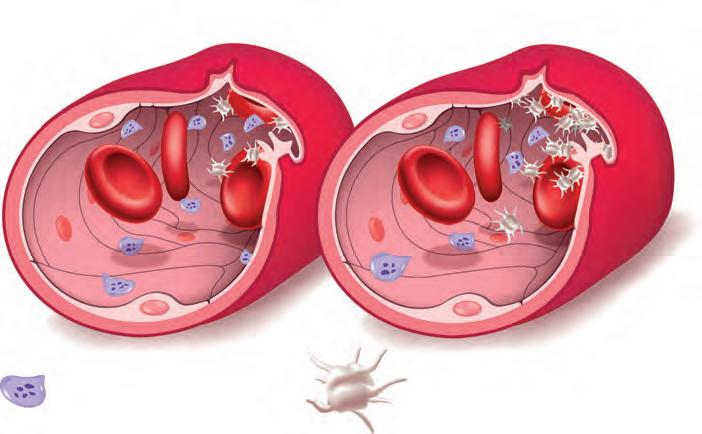
INAKTIVES BLUTPLÄTTCHEN
AKTIVIERTES BLUTPLÄTTCHEN
Abb. 10: Entsteht eine Verletzung am Blutgefäß werden die Blutplättchen aktiviert und bilden einen ersten Verschluss der Wunde. Sie ändern dabei ihre Form zu kugelig mit Stacheln.
Der Wundschorf, der durch die Blutplättchen entsteht, ist weiß. Du kannst ihn bei frischen Wunden oft gut sehen, nachdem die Blutung aufgehört hat.




Abb. 11: Beispiele für weißen Wundschorf an frischen Wunden. Er ist vor allem an Wundrändern zu sehen, wo die Blutplättchen am Gewebe haften können.
Nachdem sich die Wunde durch die Blutplättchen vorläufig geschlossen hat, beginnt die zweite Phase des Wundverschlusses.
2) „Bau ein Netz“: Damit die Wunde auch bei wieder geweitetem Blutgefäß verschlossen bleibt, wird die Blutgerinnung eingeleitet. Dabei gebildete Eiweißfäden fügen sich zu einem Netz zusammen, in dem die Blutplättchen eingebettet sind. In diesem verfangen sich auch rote Blutkörperchen, die es weiter abdichten. Der entstehende Wundverschluss erhält dadurch eine rötliche Farbe. Blutplättchen und Blutkörperchen werden durch die Eiweißfäden verklebt. Die Blutplättchen verschmelzen miteinander und ziehen sich zusammen. Dadurch werden die Wundränder zusammengezogen. Den entstandenen Wundverschluss kennst du als Kruste. Ist die Wunde fest verschlossen kann der Wundheilungsprozess beginnen.
BLUTGERINNUNGSPHASE
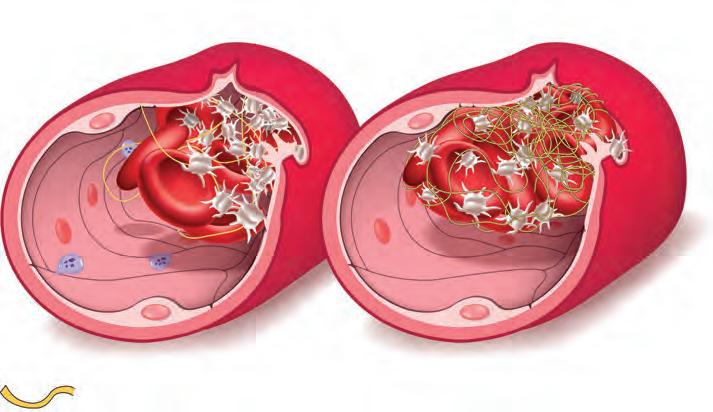
EIWEIßFADEN
Abb. 12: Durch die Bildung von Eiweißfäden werden Blutplättchen und vorbeischwimmende Rote Blutkörperchen zu einem Klumpen verbunden, der die Wunde verschließt. Eine Kruste entsteht.
Die rötlich braune Kruste der Blutgerinnung kennst du gut von Wunden, die am Verheilen sind. Die Kruste bleibt bestehen, bis neues Gewebe nachgewachsen ist. Dann fällt sie von alleine ab.
Auch wenn es nicht wünschenswert ist, die nächste Verletzung kommt bestimmt. Wenn der erste Schock verdaut ist, versuche deinen Körper bei der Bildung des Wundverschlusses zu beobachten! Wenn sich die feste Kruste gebildet hat, zähle die Tage, die es braucht, bis sie von selbst abfällt! Das lenkt vielleicht auch etwas von der Verletzung ab. Und gute Besserung!
Denke daran, was du bisher gelernt hast! Wieso kann ein Blutgerinnsel großen Schaden im Körper anrichten?


Was sind Thrombosen! Der Fachausdruck für Blutgerinnsel ist Thrombose. Die allermeisten Thrombosen verlaufen unbemerkt, da das Blutgerinnsel sehr klein ist. Thrombosen, die Probleme bereiten können, entstehen häufig in den Beinen. Dort machen sie sich durch Schmerzen, Schwellungen, manchmal auch Blutergüsse bemerkbar. Meistens sind ältere Menschen betroffen. Besteht der Verdacht einer Thrombose ist eine ärztliche Untersuchung sehr ratsam.

Blutgerinnung ist ein überlebenswichtiger Vorgang zur Verschließung von Wunden. Findet er in intakten Blutgefäßen statt, kann das aber gefährlich sein. Klumpen geronnenen Bluts (Blutgerinnsel) können Blutgefäße verstopfen. Vor allem bei größeren Gefäßen und im Gehirn kann das lebensbedrohlich sein. Bei gesunden Menschen kommt das sehr selten vor. Je älter ein Mensch wird, desto größer ist das Risiko. Auch Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, manche Medikamente und erbliche Veranlagung erhöhen die Gefahr, dass ungewollte Blutgerinnsel entstehen.
Abb. 13: Kruste einer Schürfwunde am Knie. Die durch Blutgerinnung entstehende Schicht schließt die Wunde stabil, so dass die Heilung einsetzen kann.
Führe ein Gespräch mit einer älteren Person in deinem Umfeld! Erkundige dich dabei vorsichtig, ob sie Erfahrungen mit Krampfadern oder Thrombosen gemacht hat!
Abb. 14: Blutgerinnung kann auch in unverletzten Blutgefäßen auftreten. Dann bildet sich ein Blutgerinnsel, das Probleme bereiten kann.

Erinnere dich, welche Arten von Krankheitserregern gibt es? Falls du es nicht mehr so genau weißt, schlage in deinem Biobuch der zweiten Klasse nach!

Abb. 15: Krankheitserreger kennst du schon einige.


Immunsystem auf Abwegen!
Die Zellen des Immunsystems erfüllen eine lebenswichtige Aufgabe bei der Abwehr von Krankheitserregern. Es kann jedoch auch passieren, dass die Erkennungsmechanismen der Immunzellen durcheinander kommen und sie gesunde Körperzellen als Feinde betrachten. Dann richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Körpereigenes Gewebe wird angegriffen und zerstört, was zu verschiedenen Krankheitsbildern führen kann. Man spricht von Autoimmunerkrankungen.
Recherchiere, welche Autoimmunerkrankungen es gibt! Kennst du jemanden, der betroffen ist?
Lymphgefäßsystem, das: Ein ergänzendes, offenes System zum Flüssigkeitstransport bei Wirbeltieren. Es dient dem Abtransport von Flüssigkeit aus Körpergeweben und ist als Transportweg für die Lymphozyten ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems.
spezifisch: Sich auf etwas ganz bestimmtes beziehend. Beispiele: „Dieses Heft ist spezifisch für die Biologie Mitschrift gedacht“. Die Benutzung von Kleidung ist ein spezifisches Verhaltensmerkmal des Menschen. Lymphozyten dienen spezifisch zur Abwehr von Grippeviren.
Alle Tiere sind in der Lage, körpereigene Bestandteile von Fremdstoffen und Fremdzellen wie Krankheitserregern zu unterscheiden. Diese Fähigkeit muss früh in der Evolution der vielzelligen Lebewesen entstanden sein, da Zellen vielzelliger Organismen nur zusammenarbeiten können, wenn klar ist, wer dazu gehört und wer nicht.
Für die Abwehr von Schadstoffen und Krankheitserregern muss ein Organismus diese erkennen, unschädlich machen sowie zersetzen oder ausscheiden können. Auch ist es wichtig, krankhafte Veränderungen körpereigener Zellen zu erkennen und diese Zellen abzutöten und zu zersetzen. Die für die Abwehraufgaben verantwortlichen Mechanismen nennt man Immunsystem

Abb.16: Wenn krankhaft veränderte Zellen ungehindert wuchern, entsteht Krebs.
Blut enthält wichtige Bestandteile des Immunsystems. Bei allen Tieren sind beispielsweise Zellen vorhanden, die Fremdkörper und Krankheitserreger aber auch abgestorbene und kranke körpereigene Zellen aufnehmen und zersetzen können. Sie werden deshalb Fresszellen genannt.

Abb.17: Ein weißes Blutkörperchen frisst eine Bakterie.
Bei Säugetieren sind die weißen Blutkörperchen für die Abwehrfunktionen verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, in die Körperflüssigkeit eingedrungene Krankheitserreger und Fremdstoffe zu erkennen und zu beseitigen. Weiße Blutkörperchen müssen sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Entsprechend gibt es unterschiedliche Arten, die in drei größere Gruppen eingeteilt werden. Die Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten. Weiße Blutkörperchen können sich eigenständig fortbewegen. Sie können das Blutgefäßsystem verlassen und befinden sich mehrheitlich im Lymphgefäßsystem und zwischen den Zellen im Gewebe. Granulozyten stellen den größten Teil der weißen Blutkörperchen. Sie bekämpfen Mikroorganismen, die sie aufnehmen und verdauen (Fresszellen), mit verschiedenen Substanzen abtöten oder an sich binden. Da sie das mit beliebigen Mikroorganismen tun, sind sie Teil der unspezifischen Immunantwort Monozyten sind erst klein, entwickeln sich aber zu den größten Zellen im Blut. Sie wandern aus dem Blut ins Gewebe und wachsen dort zu Experten-Fresszellen heran, die Bakterien, Zelltrümmer und veränderte Eiweiße aufnehmen und entsorgen können.
Lymphozyten werden nach ihrer Bildung zu Spezialisten. Durch Kontakt mit einem neuen Krankheitserreger kann der Körper Abwehrstrategien entwickeln. Im Laufe der Zeit lernt er so, sich gegen verschiedene Krankheitserreger zu wehren. Lymphozyten können mit diesen Abwehrstrategien ausgestattet werden, um bestimmte Krankheitserreger gezielt zu bekämpfen. Da Lymphozyten auf je einen Krankheitserreger spezialisiert sind, sind sie Teil der sogenannten spezifischen Immunantwort.

Abb.19: Lymphozyten attackieren eine Krebszelle. Oft werden diese nicht erkannt. 40 μm
Abb.18: Monozyten werden im Gewebe zu großen (Makro-) Fresszellen (-phagen). Makrophagen sind die Aufräumtrupps des Körpers.
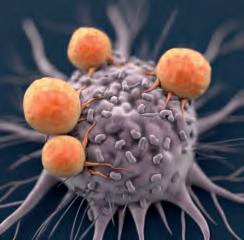
Durcheinander! Tanja hat für ihr Referat Infozettel geschrieben, damit sie nichts vergisst. In der Eile hat sie jedoch nicht notiert, welche Info zu welchem Blutbestandteil gehört. Finde heraus, was beschrieben ist und hilf Tanja die Zettel zu ordnen! Notiere eine kurze Info, die Tanja deiner Meinung nach unbedingt beim Referat ergänzen sollte!



Sie sind die Transporteure des Blutes. Ohne Pause verfrachten sie Sauerstoff in alle Ecken und Enden des Körpers.



Das sind
Kurzinfo





Diese Zellen werden im Laufe ihres Lebens zu den größten der Blutzellen. Unersättlich vertilgen sie Zellabfälle.



Das sind
Kurzinfo





Sie sind die Spezialeinsatztruppe der Körperabwehr. Treffen sie aber auf Krankheitserreger, für die sie nicht trainiert haben, können sie nichts tun.



Das sind
Kurzinfo





Sie sind recht klein und unscheinbar. Werden sie aber aktiv, wachsen ihnen Stacheln und sie rufen Verstärkung.



Das sind
Kurzinfo





Dieses sehr große Molekül ist ein Protein und so etwas wie die Transportbox für den Sauerstoff im Körper.



Das sind
Kurzinfo


Entzündungen! Entzündungen sind Immunreaktionen des Körpers auf das Eindringen von Fremdkörpern und Krankheitserregern oder wenn er Schadstoffe und beschädigte Zellen loswerden möchte. Durch spezielle Botenstoffe weiten sich die Blutgefäße an der betroffenen Stelle. Sie werden für das umliegende Gewebe durchlässiger, sodass Blutstoffe eindringen können. Die typischen Symptome sind Rötung, Schwellung und Erwärmung. Denke daran, was du gelernt hast und erkläre die Entzündungssymptome damit! Was hat bei dir schon einmal eine Entzündung ausgelöst?

Folgen der Sichelzellenanämie! Du hast die Grundzüge der Sichelzellenanämie kennengelernt. Welche Folgen für den Körper kannst du dir vorstellen? Schreibe eine kurze Liste der von dir erwarteten Symptome und Schwierigkeiten mit einer kurzen Begründung weshalb sie entstehen! Welche Art Immunreaktion tritt wohl auf, wenn der Körper die verkeilten Blutkörperchen loswerden möchte?

Abb.20: Entzündung nach einer Impfung. Was möchte der Körper loswerden?


Schreibe für einige sehr verschiedene Tiere, die du kennst, auf, welche Eigenarten sie haben und welche Lebensweisen sie pflegen! Welche Anforderungen stellen diese an sie? Erörtere, welche Anforderungen an das Kreislaufsystem sich daraus ableiten könnten!


Hydraulische Beine!
Spinnentiere besitzen in ihren Beinen keine ausreichende Streckmuskulatur, um ihre Beine zur Fortbewegung zu nutzen. Stattdessen führen eigene Blutgefäße zu den Beinen, in denen die Tiere hohen Druck erzeugen können. Durch den hohen Druck werden die Blutgefäße und damit auch die Gliedmaßen gestreckt. Wird Flüssigkeitsdruck zur Bewegung eingesetzt, nennt man das hydraulisch. Der Vorteil ist, dass ohne die Streckmuskeln mehr Platz für die Beugemuskeln ist, die die Spinne braucht, um Beute fest packen zu können.
Besorge dir einen weichen Schlauch! Schließe den Schlauch an einen Wasserhahn an. Falls es ein kleiner ist, nimm ordentlich Wasser und dann den Schlauch in den Mund!
Drehe den Wasserhahn schnell auf, beziehungsweise stoße das Wasser schnell aus deinem Mund! Was beobachtest du? Was hat das mit der Infobox zu tun?
Tipp: Am besten geht das mit einem Gartenschlauch. Achte darauf, dass du mit dem herumspritzenden Wasser keinen Schaden anrichtest!
Zeichne zwei Skizzen, eine für das offene und eine für das geschlossene Kreislaufsystem! Sie sollen die Unterschiede zwischen den beiden Systemen, so wie du sie dir vorstellst, darstellen. Vergleicht eure Skizzen in Zweierteams und besprecht eure Ideen und Vorstellungen!
Blut muss im Körper bewegt werden, um seine Aufgaben zu erfüllen. Flüssigkeiten bewegen sich nicht von selbst. Es braucht Druckunterschiede, wie wenn du eine Trinkflasche quetscht und das Wasser herausspritzt. Das Prinzip hast du schon bei der Atmung kennen gelernt. Im Blutkreislauf übernimmt das Herz diese Aufgabe, indem es sich zusammenzieht und entspannt. Flüssigkeiten können frei fließen, wie bei Strömungen in einem Teich. Die Flüssigkeit steht dabei in freiem Austausch mit der Umgebung. Möchte man Fließbedingungen, wie den Druck oder den Austausch mit der Umgebung kontrollieren, bieten sich Leitungssysteme an. Beide Varianten haben sich in der Natur entwickelt, offene und geschlossene Kreislaufsysteme.
In offenen Kreislaufsystemen fließt das Blut auch oder ausschließlich außerhalb eigener Blutgefäße. Es durchmischt sich ständig mit der Lymphe genannten Flüssigkeit zwischen den Zellen der Gewebe. Blut und Lymphe sind durch die Durchmischung weitgehend gleich zusammengesetzt. Beide stehen überall im Körper im Stoffaustausch mit den Körperzellen. Deshalb wird das Blut offener Kreislaufsysteme als Hämolymphe bezeichnet. Der Druck ist in offenen Kreislaufsystemen meist nur wenig höher als der Umgebungsdruck im Körper und die Hämolymphe strömt langsam
Insekten
Insekten haben ein röhrenförmiges Herz. Es erstreckt sich entlang des oberen Bereichs ihres Hinterleibes. Es pumpt mit pulsierenden Bewegungen. Über seitliche Öffnungen wird Blut beim Erschlaffen des Herzens eingesaugt. Beim Zusammenziehen des Herzens wird das Blut durch ein großes Blutgefäß, die Aorta, Richtung Brust und Kopf gepresst. Die seitlichen Öffnungen verschließen sich dabei, sodass kein Blut über sie austreten kann. Von Brust und Kopf verteilt sich das Blut frei im Körper und erreicht allmählich wieder den Hinterleib. Dort, wo viel Energie und damit Nährstoffe verbraucht werden
(z.B. bei der Flugmuskulatur), befinden sich Nebenherzen. Sie sorgen für einen erhöhten Zu- und Abfluss von Blut vor Ort.
Abb. 1: Kreislaufsystem eines Insekts. Das Blut wird nur teilweise in Blutgefäßen geführt, bewegt sich ansonsten frei.
Krebstiere
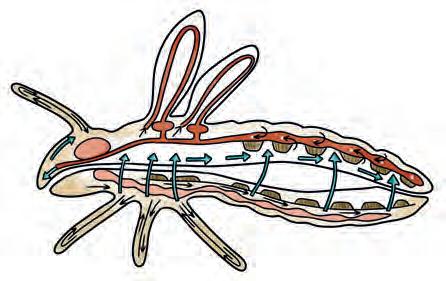
Aorta Nebenherz Herz Öffnungen
vordere Aorta
Bei vielen Krebstieren ist das Blutgefäßsystem stärker ausgeprägt als bei Insekten. Da sie Kiemen- oder Lungenatmer sind, muss das Blut neben Nährstoffen auch Atemgase transportieren. Krebse besitzen ein vergleichsweise kompaktes Herz. Es hat ebenfalls seitliche Öffnungen, durch die sauerstoffreiches Blut aus dem Bereich der Kiemen angesaugt wird. Beim Zusammenziehen pumpt es das Blut durch eine vordere und hintere Aorta zu Kopf und Hinterleib. Seitlich führende Blutgefäße verteilen das Blut weiter im Körper und entlassen es schließlich frei ins Gewebe.
Abb. 2: Kreislaufsystem eines Flusskrebs. Das Blut wird über größere Strecken in Blutgefäßen geführt. Sonst fließt es immer noch frei.
Kiemen mit dichtem Kapillarnetz
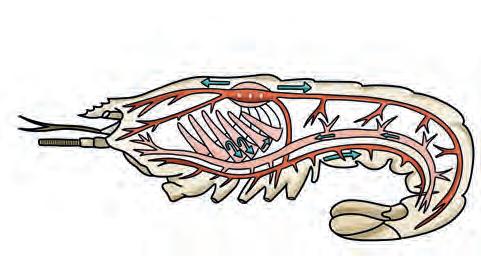
hintere Aorta Herz mit seitlichen Öffnungen
Baucharterie
Geschlossen Kreislaufsysteme
Geschlossene Kreisläufe haben sich in Ringelwürmern, Kopffüßern und allen Wirbeltieren entwickelt. Bei ihnen fließt das Blut ausschließlich in Blutgefäßen. Der Stoffaustausch mit dem Rest des Körpers findet nur über feine Endverzweigungen der Blutgefäße statt, die in die Gewebe ragen. Diese feinen Blutgefäße heißen Kapillaren
Dieser Aufbau erlaubt höhere Strömungsgeschwindigkeiten des Blutes und damit einen erhöhten Transport und Austausch von Nährstoffen und Atemgasen. Über Verengung und Weitung von Blutgefäßen ist eine örtliche Kontrolle der Durchblutung möglich. Blut durch ein ausgedehntes Gefäßsystem zu pumpen braucht eine hohe Pumpleistung. Deshalb mussten sich bei der Evolution geschlossener Blutkreisläufe kräftige Herzen entwickeln, die zu einer hohen Dauerleistung fähig sind.
Das Kreislaufsystem der Ringelwürmer hat eine besondere Form, da sie kein zentrales Herz besitzen. Die Pumparbeit wird auf mehrere Abschnitte des Blutgefäßsystems aufgeteilt. Bei Regenwürmern verläuft ein größeres Blutgefäß entlang der Rückenseite. Darin wird das Blut durch pulsierende Pumpbewegungen nach vorne getrieben. Seitliche Abzweigungen in jedem Segment führen zum Darm, um Nährstoffe aufnehmen zu können. Sie stellen auch Verbindungen zu zwei größeren, entlang der Bauchseite verlaufenden Blutgefäßen her. Im Kopfbereich des Regenwurms verfügen diese Verbindungen über eigene Herzen. Diese pumpen das Blut von dem entlang des Rückens laufenden Blutgefäß zum entlang der Bauchseite laufenden. So entsteht ein Kreisfluss. An der Rückenseite vom Hinterteil zum Kopf und an der Bauchseite zurück.
Frühe Wirbeltiere – das Urherz
† Weshalb findet der Austausch von Atemgasen und Nährstoffen in den Kapillaren und nicht in den größeren Blutgefäßen statt, wo dort doch eine größere Menge Blut durchfließt? Formuliere eine schlüssige Begründung!
Blick in dein Bio2 Buch und erinnere dich an den Aufbau des Regenwurms!

Abb. 3: Kreislaufsystem eines Regenwurms. Achte auf die Flussrichtung des Blutes an Bauch und Rückenseite, sowie die Seiten(Lateral-)herzen.
Wirbeltiere verfügen über ein einzelnes, kräftiges Herz, dessen Muskel die gesamte Pumpleistung übernimmt. Der Herzmuskel hat sich im Laufe der Evolution aus einem Blutgefäß entwickelt. Die röhrenförmigen Herzen der offenen Kreislaufsysteme lassen diese Entwicklung erahnen. Bei der urtümlichen Klasse der Rundmäuler finden sich heute noch Herzen in der Form, wie man sie sich in einer frühen Entwicklungsstufe der Evolution der Wirbeltierherzen vorstellt. Es sind vier Abschnitte zu erkennen, die von zunehmend dickem Muskelgewebe umgeben werden. Jeder von ihnen stellt eine Pumpstufe dar. So lässt sich der Druck stufenweise erhöhen. Das ist wichtig, da einströmendes Blut nur unter geringem Druck steht. Es könnte einen von dickem Muskelgewebe umgebenen Hohlraum beim Einströmen nicht genug dehnen. Die einzelnen Abschnitte sind durch Ventile, den Herzklappen voneinander getrennt, damit das Blut nur in eine Richtung fließt.
Ventilklappen
Zuflussbereiche
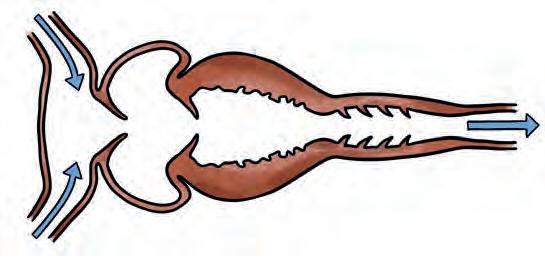
Vorhof (Atrium)
Aorta trichterförmiger Abflussbereich (Conus) Muskulatur
Herzkammer (Ventrikel)
Abb. 4: Gedachte Form des Urherzens, aufgebaut aus vier Abschnitten. Die Muskelwand wird zum Ventrikel hin immer stärker. Achte auf die Ventilklappen (Herzklappen), die einen Rückfluss des Blutes beim Pumpen verhindern.
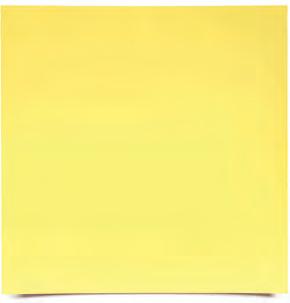

Jeder hatte mal ein Urherz! Die evolutionäre Herkunft des Herzens lässt sich auch in der Entwicklung der Embryos von Wirbeltieren erkennen. Wie alle Organe muss sich das Herz erst ausbilden. Es nimmt, ausgehend von einer röhrenartigen Form zu Beginn, erst im Laufe des Wachstums des Embryos seine endgültige Form an.
Informiere dich online zu Rundmäulern! Wie sehen sie aus? Welches Merkmal fehlt Rundmäulern, das die meisten anderen Wirbeltiere im Laufe ihrer Evolution ausgebildet haben?
Begründe, warum das Blut im Urherz ohne Klappen rückwärts fließen würde! Erkläre deine Antwort anschließend einer Person, die du kennst – so kannst du prüfen, ob deine Erklärung verständlich und schlüssig ist! Tipp: Im Kapitel über die Kiemen wurde dieses Prinzip bereits in einem anderen Zusammenhang erwähnt.
Wieso sind die Blutgefäße in den Kiemen und im Gewebe bis zu Kapillaren verzweigt?
Skizziere das Urherz! Skizziere das Fischherz! Wie könnten Zwischenformen ausgesehen haben? Stelle erst fest, welche Teile wohin gewandert sind! Dann versuche Zwischenformen zu zeichnen! Denk daran, auch die Evolution probiert und probiert, also tüftle ruhig herum! Vergleicht eure Ergebnisse in Teams!
Was bedeutet es für die Energieumsetzung in den Geweben der Fische, wenn der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut deutlich geringer ist, als bei Säugetieren? Brauchen Fische und Säugetiere deiner Meinung nach im Ruhezustand gleich viel Energie? Begründe deine Antworten mit stichhaltigen Argumenten!


Fische
Fische verfügen über eine abgewandelte Form des Urherzens. Vorhof und Kammer liegen nebeneinander. Fische pumpen sämtliches Blut über die Aorta in die feinen Blutgefäße der Kiemen, wo der Gasaustausch stattfindet. Das sauerstoffreiche Blut verteilt sich danach über den Körper bis in die feinen Kapillaren der Gewebe, wo es Sauerstoff ans Gewebe abgibt und CO2 aufnimmt. Von dort fließt es zum Herz zurück. Blutgefäße, die vom Herz weg führen werden Arterien genannt, solche die zum Herz führen Venen.
Aorta
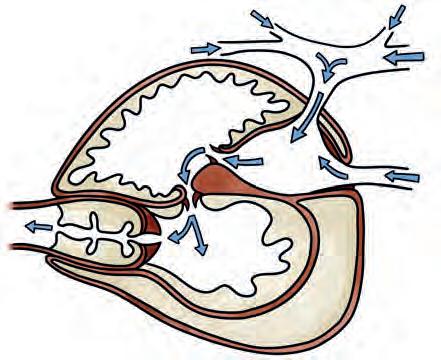
trichterförmiger Abflussbereich
Zufluss über Venen
Vorhof
Rohrleitungen!
Auch in der Technik müssen die Rohre von Leitungen an die vorherrschenden Druckverhältnisse angepasst werden. Rohre von Hochdruckleitungen müssen stabiler gebaut sein als Rohre von Niederdruckleitungen. Die physikalischen Erkenntnisse, die sich aus der Untersuchung des Strömungsverhaltens für technische Anwendungen ergaben, haben auch für die Biologie wichtige Einsichten erbracht. Umgekehrt waren und sind biologische Systeme Inspiration für effiziente technische Lösungen. Die Versuche, sie physikalisch zu erklären, benötigen oft Verfeinerungen und Erweiterungen der physikalischen Modelle für technische Systeme. Wissenschaft lebt von Austausch.
Aus welchen Materialien sind Rohrleitungen in der Technik hergestellt? Welche davon wären für Blutgefäße geeignet und welche nicht? Begründe deine Einschätzung!
Herzkammer
Abb. 5: Das Herz der Fische ist eine zusammengefaltete Version des Urherzens. Die vier hintereinander liegenden Abschnitte sind erhalten.
In dieser Art Kreislaufsystem kann nur niedriger Druck aufrechterhalten werden. Einerseits, da es schwierig ist, das Blut in einer Pumpbewegung sowohl durch die dünnen Blutgefäße der Kiemen als auch danach noch durch die Kapillaren des restlichen Körpers zu pumpen. Andererseits, da die dünnwandigen Gewebe zum Gasaustausch der Kiemen keinem hohen Druck standhalten. Der Druck und damit auch die Fließgeschwindigkeit ist daher eher gering. Entsprechend ist der Sauerstoffgehalt im Blut von Fischen weit unter dem von Säugetieren.

Arterie

Herzklappe
Kammer Vorhof Vene

Kiemenkreislauf
Herz mit zwei Haupthöhlen (zweikammrig)
Kiemenkappilaren
Körperkreislauf
Abb. 6: Schematische Darstellung des Kreislaufs der Fische. Kiemen- und Körperkapillaren liegen im Kreislauf hintereinander.
Körperkappilaren
In anderen Wirbeltieren als den Fischen hat die Evolution eine Anpassung hervorgebracht, die hohen Druck im Kreislaufsystem ermöglicht. Getrennte Kreisläufe. Einer für Atemorgane und einer für den Rest des Körpers. Das Blut wird erst über das Atemorgan geführt. Dann zurück zum Herz, wo ihm erneut Schub verpasst wird und es mit erhöhtem Druck zu den Geweben fließt. So sind höhere Fließgeschwindigkeiten und damit ein erhöhter Gas- und Nährstoffaustausch möglich. Um das Blut entsprechend zu verteilen, ist der Ausgangsbereich der Herzkammer (der trichterförmige Conus des Urherzens – siehe Abb.4) unterteilt. Aorta wird nun das Gefäß genannt, das den Körper mit Blut vom Herzen versorgt. Das vom Herzen zur Lunge führende Gefäß nennt man Lungenstamm, beziehungsweise Lungenarterie(n), wenn es sich weiter verteilt.
Amphibien
Bei Amphibien ist der Vorhof in zwei Bereiche getrennt. In einen strömt Blut von den Lungen. In den anderen vom Rest des Körpers sowie der (auch als Atemorgan genutzten) Haut. Die Kammer ist nicht unterteilt, doch von Sehnen und Muskeln durchzogen.
Zusammen mit einer Falte an der Aorta wird so dafür gesorgt, dass sich sauerstoffreiches und sauerstoffarmes
Blut wenig mischen. Sauerstoffarmes
zu den Lungen
rechter Vorhof
zum Körper
zum Körper zu den Lungen
Lungenvene
linker Vorhof
spiralförmige Falte von Körpervene
Abfluss zu Aorta

Links – rechts, wie jetzt?
Herzkammer
Blut fließt so vorwiegend zu den Atemorganen und sauerstoffreiches in den Rest des Körpers. Die Aorta verzweigt sich. Das Blutgefäß zu den Atemorganen teilt sich weiter, um Lunge und Haut getrennt zu versorgen. Durch die zwei Vorhöfe und die Herzkammer ergibt sich ein Herz mit drei Höhlen (dreikammrig)


Lungen Arterie
Körper Vene linker Vorhof
Lungenkappilaren
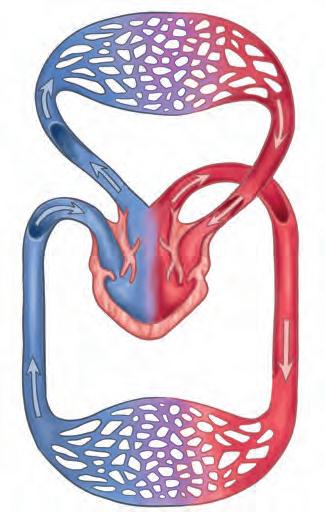
Lungenkreislauf
rechter Vorhof
Körper Arterie Kammer
Körperkreislauf
Abb. 7: Amphibienherzen speisen zwei überwiegend getrennte Kreisläufe. Kannst du die Herzklappen erkennen?


In der Medizin und Biologie beschreibt man die Körperseiten oft aus der Sicht des Lebewesens. Das ist wie, wenn du jemandem gegenüber stehst. Dessen linke Seite befindet sich für dich rechts und umgekehrt. Vielleicht ist dir das schon einmal bei der Zahnärztin aufgefallen. Wenn du ihr sagst, links tut es weh, dann sieht sie automatisch auf der von dir aus links liegenden Seite nach. Entsprechend liegt die für das Lebewesen linke Herzseite rechts auf den Abbildungen und umgekehrt.


Lungen Arterie geteilte Aorta
Lungenkreislauf Lungenkappilaren
Körperkreislauf Lungenvene
Lungenvene
rechter Vorhof Körper Vene
linker Vorhof
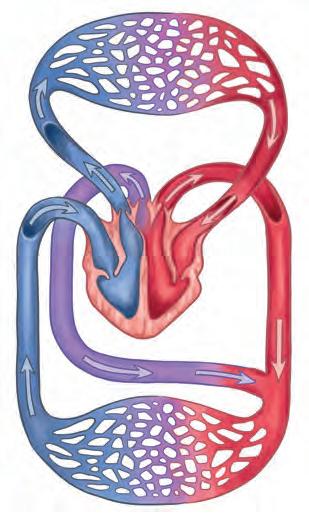
Körper Arterie
Körperkappilaren
Abb. 8: Amphibien verfügen über zwei Kreisläufe, den Lungen- und Körperkreislauf. Die Haut als zweites Atemorgan wird über den Körperkreislauf mit versorgt.
Reptilien
Unter welchen Bedingungen könnte es für Amphibien nützlich sein, auf Hautatmung umzustellen?
Recherchiert online, was Krokodile an ihrem Blutkreislauf verändern, wenn sie unter Wasser sind! Nutzt dabei mindestens zwei verschiedene Quellen und vergleicht eure Ergebnisse (achtet auf die Hinweise auf Seite 14)! Besprecht euch im Team – gemeinsam versteht man komplexe Dinge oft besser als allein!
Körperkappilaren
Abb. 9: Der Kreislauf der Reptilien weist als Besonderheit eine zweigeteilte Aorta auf. Sie sorgt dafür, dass nur sauerstoffreiches Blut zum Gehirn gelangt.
Reptilienherzen sind Amphibienherzen ähnlich, haben allerdings eine Trennwand in ihrer Kammer. Außer bei Krokodilen ist diese noch nicht vollständig, ermöglicht aber eine bessere Trennung von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut und damit des Lungen- und Körperkreislaufes. Die vom Herz ausgehenden Blutgefäße weisen eine Besonderheit auf. Die den Körper versorgende Aorta ist am Ausgang der Kammer unterteilt. Durch einen Teil fließt das sauerstoffreiche Blut zum vorderen Körper und Kopf, durch den anderen Mischblut zum hinteren Teil des Körpers. Die Lungenarterie führt wie bei den Amphibien zu den Lungen.
Blut zum hinteren Körper
Blut vom Körper
Lungenarterien
rechter Vorhof linker Vorhof
geteilte Aorta
Blut zum Kopf
rechter Teil der Kammer
Trennwand
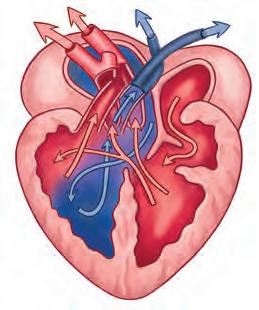
linker Teil der Kammer Blut von der Lunge
Fällt dir ein Grund ein, warum der sauerstoffreiche Teil des Blutes bei den Reptilien zum Kopf geleitet wird, während das Mischblut aus der Durchmischung von sauerstoffreichem und sauerstoffarmen Blut zum hinteren Teil des Körpers gelangt? Schreibe einen kurzen Sachtext, der deine Vermutung beinhaltet und beschreibe, wie dieses Merkmal zu einem evolutionären Vorteil führen könnte, der selektiert wurde!
Abb. 10: Reptilienherz mit Trennwand. Sie hilft, die Ströme sauerstoffarmen und sauerstoffreichen Bluts zu trennen.
Vögel und Säugetiere halten ihre Körpertemperatur ständig aktiv aufrecht. Man nennt sie gleichwarme Tiere. Weshalb ist es für solche Tiere wichtig, ein sehr leistungsfähiges Transportsystem für Nährstoffe und Atemgase zu besitzen?
Beschreibe Situationen, in denen es notwendig ist, bestimmte Teile des Körpers mit einer hohen Blutzufuhr zu versorgen, andere jedoch nicht! Denke daran, welche Aufgaben das Blut übernimmt!
Scanne den QR-Code und beobachte das Herz beim Schlagen! Achte auf die Herzklappen!

Scanne den QR-Code und sieh dir an, wie die elektrische Erregung des Herzes funktioniert! Achte auch auf die Herzklappen! Das zweite Video ist für alle, die es genauer wissen wollen.


Ein herzlicher Groove!


Der Herzschlag ist ein natürlicher Rhythmus- und Zeitgeber für den Menschen. Das regelmäßige Schlagen gibt Zeitabstände vor. Unser Zeitempfinden ist daher mit der Frequenz der Herzschläge verbunden. Das ist ein Grund, weshalb du schneller sprichst, wenn du nervös oder aufgeregt bist, denn dann schlägt dein Herz schneller. Auch Komponisten nutzen das. Balladen sind im Tempo des Ruhepulses von 60 -80 Schlägen pro Minute geschrieben. Songs, die mitreißen sollen, deutlich schneller.
Säugetiere und Vögel
Bei Säugetieren und Vögeln ist die Trennwand der Kammer voll entwickelt. Vorhof und Kammer sind zweigeteilt, sodass sich vier Herzhöhlen ergeben (vierkammrig). Dadurch entstehen zwei komplett getrennte Blutkreisläufe für Lunge und Körper. Im Körperkreislauf wird hoher Druck für einen raschen Bluttransport erzeugt. Im Lungenkreislauf herrscht niedriger Druck. Die einzelnen Bereiche des Körpers werden von parallel laufenden Arterien versorgt, die sich immer weiter bis hin zu den Kapillaren verzweigen. Dadurch entfällt das Problem, Blut durch mehrere hintereinanderliegende Kapillarsysteme pumpen zu müssen. Ein weiterer Vorteil der parallel verlaufenden Versorgung ist, dass die Blutzufuhr getrennt geregelt werden kann.

aufsteigende Aorta
Körpervene
Lungenvenen
rechter Vorhof
Körpervene
Arterien zu Kopf und Armen
Aorta zum Rest des Körpers
Lungen Arterien
Lungenvenen
linker Vorhof
Herzklappen
linke Kammer
rechte Kammer Trennwand
Abb. 11: Säugetierherzen sind vierkammrig, Lungen- und Körperkreislauf werden durch eigene Herzkammern bedient. Die Muskulatur der linken Herzkammerwand ist dicker, da hier mehr Pumpleistung vollbracht werden muss.

Lungenkappilaren

Lungen Arterie
Körper Vene
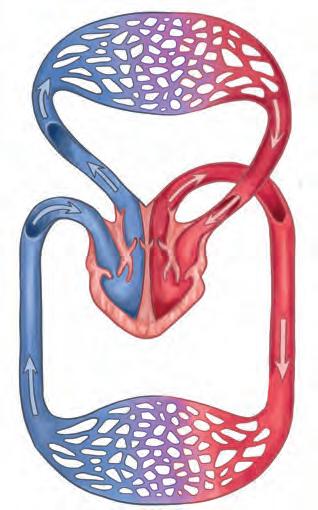
linker Vorhof
linke
Lungenkreislauf
Körperkreislauf Lungenvene
rechter Vorhof
Kammer rechte Kammer
Körper Arterie
Körperkappilaren
Abb. 12: Der Kreislauf der Säugetiere und Vögel ist vollständig in Lungen- und Körperkreislauf getrennt.
Sinusknoten

AV Knoten, er stellt die einzige leitende Verbindung zwischen Vorhöfen und Kammern dar
Nervenfasern zur Weiterleitung des Signals
Bei den Gliederfüßern steuern Gehirn und Zentralnervensystem ihr Röhrenherz. Bei Wirbeltieren, also auch Säugetieren, steuern umgewandelte Muskelzellen, die Schrittmacherzellen, die Pumpbewegung des Herzens. Bei Wirbeltieren hat sich jedoch ein anderes System entwickelt. Hier steuern die Schrittmacherzellen, umgewandelte Muskelzellen, die Pumpbewegung des Herzens. Sie erzeugen elektrische Impulse, die ein rhythmisches Zusammenziehen und Entspannen der Herzmuskulatur auslösen. Zuerst breitet sich ein elektrischer Impuls über die beiden Vorhöfe aus. Diese ziehen sich zusammen, und erzeugen einen Überdruck der das Blut aus den Vorhöfen in die Kammern presst. Gleichzeitig entspannen sich die Kammern und dehnen sich aus. Dadurch entsteht ein Unterdruck, der das Blut aus den Vorhöfen ansaugt. Die Herzklappen an den Zuflüssen der Vorkammern, den Venen und an den Abflüssen der Kammern, den Arterien, verhindern, dass Blut in die falsche Richtung fließt. Zeitlich verzögert, gelangt der elektrische Impuls zu den Kammermuskeln. Die Kammern ziehen sich zusammen und pressen das Blut in die Arterien, von wo es sich im Körper verteilt. Die Verbindungen zu den Vorhöfen wird dabei durch die Segelklappen verschlossen, so dass kein Blut zurück fließen kann. Gleichzeitig entspannen die Vorhöfe wodurch Blut aus den Venen eingesaugt wird um für den nächsten Pumpvorgang zur Verfügung zu stehen.
Abb. 13: Elektrische Erregung des Herzens. Sie startet vom Sinusknoten, dem Taktgeber, und breitet sich über Nervenfasern von den Vorhöfen zu den Kammern aus.
Der Bluttransport im Körper erfolgt durch ein dichtes Netz an Blutgefäßen. Blutgefäße, die vom Herz weg führen, nennt man Arterien. Solche, die Blut zum Herzen führen Venen. Die direkt am Herz ansetzende Arterie wird Aorta genannt. Vom Herz ausgehend verzweigen sich die Arterien immer weiter. Dabei werden sie dünner, bis sie in die Kapillaren mit nur 0,01 mm Durchmesser übergehen. Diese bilden ein dichtes Netz im Gewebe. Das Blut fließt dort nur sehr langsam, damit der Gasund Nährstoffaustausch erfolgen kann. Die Kapillaren vereinigen sich dann wieder zu größeren Blutgefäßen, den Venen, die das Blut zum Herz zurücktransportieren. Direkt am Herz anschließende Venen werden Hohlvenen genannt. Alle Blutgefäße besitzen eine Röhre aus einer einzelligen Gewebeschicht mit elastischer Membran (innere Gefäßwand), durch die das Blut fließt. Größere Blutgefäße haben darüber eine Schicht Muskelgewebe und abschließend festeres Bindegewebe (äußere Gefäßwand). Venen verfügen über Ventile, die Venenklappen. Sie sorgen dafür, dass Blut nur in eine Richtung fließen kann. Kleinere Blutgefäße werden nur von Ringmuskulatur umschlossen. Sie kann das Blutgefäß zusammenzudrücken, um den Blutfluss zu verringern. Kapillaren bestehen nur aus einer dünnen Gewebeschicht. Das ist notwendig, da über sie der Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe stattfindet.
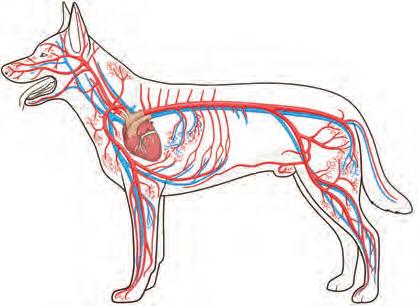
Abb.14: Kreislauf des Hundes. Achte auf die zunehmende Verzweigung in dünnere Gefäße. Kannst du Aorta, und die Gefäßtypen benennen?

Finde in Abb. 11 die Hohlvenen (sie werden dort nicht so genannt).
Weshalb ist das Kapillarnetz in Gewebe, das viel Energie umsetzen muss, dichter als in Gewebe, das wenig Energie umsetzen muss? Nenne Beispiele!
Welche beiden Möglichkeiten, die Durchblutungsmenge im Körper zu regeln, kannst du aus dem bisher Gelernten ableiten?
Venenklappe a) b) c) Bindegewebe
Arterien nahe am Herz müssen hohe Drücke aushalten. Sie sind stabil und muskulös gebaut. Jedoch nicht steif, sondern elastisch. Das erlaubt ihnen, sich bei hohem Druck zu dehnen. Bei nachlassendem Druck ziehen sie sich zusammen. So verzögern sie Druckänderungen. Sie stellen ein Puffersystem dar, das den Druck gleich hält. Venen haben dünnere Wände und sind weniger muskulös. In ihnen herrscht weniger Druck. Der vom Herz aufgebaute Druck nimmt entlang des Blutkreislaufs ab. Er reicht nicht aus, um das Blut wieder zurück zum Herz zu führen. Es muss also noch anders Druck aufgebaut werden. Dafür sorgen die…
Muskelpumpe:
Körpermuskeln erzeugen beim Anspannen Druck in den Venen.
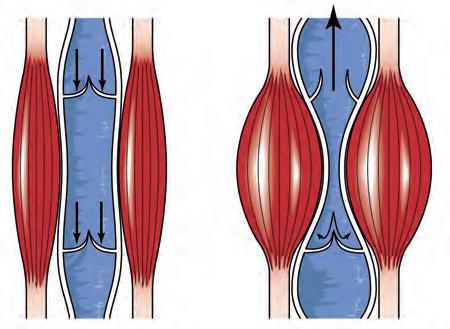
Arterienpumpe:
Druck in den Arterien überträgt sich auf daneben liegende Venen.




Arterie zum Herz vom Herz
Venenklappe

Abb.16: Muskelpumpe (links) und Arterienpumpe (rechts) der Venen. Weiten sich die Muskeln oder Arterien, drücken sie die Venen zusammen und erzeugen so eine Pumpwirkung. Achte auf die Venenklappen: Drückt Blut von unten gegen sie, öffnen sie sich. Drückt es von oben, werden die Venenklappen zusammengepresst und schließen sich.
Muskel elastische Membran einzellige Gewebeschicht
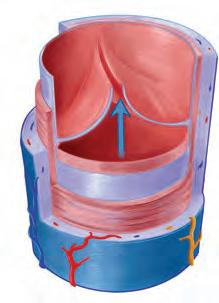
Ringmuskel Geweberöhre

Abb.15: Aufbau der Blutgefäße. a) Arterie, b) Vene, c) kleineres Blutgefäß mit Ringmuskel
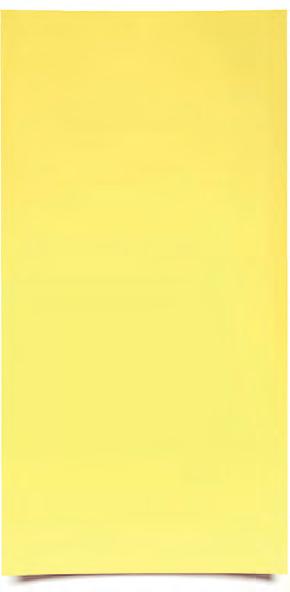

Warum Venenklappen?
Wie im Sachtext beschrieben, wird das Blut in den Venen vor allem durch die Muskeln im Gewebe drumherum bewegt. Es herrscht also kein dauerhafter Druck, der es vorantreibt. Die Schwerkraft zieht das Blut jedoch nach unten. Deshalb muss in den Ruhephasen das Blut am Zurückfließen gehindert werden. Dafür sorgen die Venenklappen. Sie sind deshalb besonders in jenen Venen zahlreich vorhanden, in denen das Blut gegen die Schwerkraft fließen muss, wie in den Beinen. Funktionieren die Venenklappen nicht mehr richtig, ist der Blutfluss gestört und die Vene kann erkranken. So kommt es beispielsweise zu Krampfadern.
Evolution des Herzens! Versuche dir, ausgehend vom Urherz der Wirbeltiere, die Entwicklung der Herzen heutiger Wirbeltiere vorzustellen! Falls du die entsprechende Seitenspaltenaufgabe auf S. 106 gemacht hast, nutze deine Skizzen! Färbe die vier Abschnitte in den dargestellten Herzen entsprechend der Vorlage im Urherz ein, sodass ersichtlich ist, wohin sie jeweils gewandert sind! Notiere auch zu jedem Bild, zu welcher Klasse von Tieren es gehört!
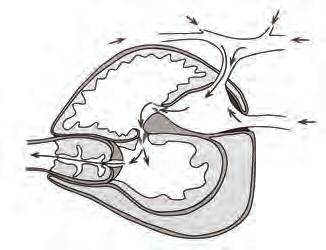


Abb. 17: Nutze diese Farbkennzeichnung der Abschnitte.



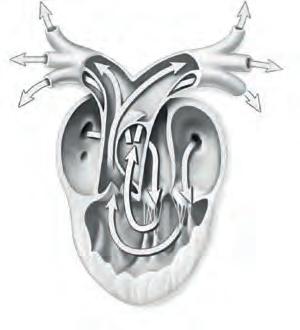
Druckpuffer! Ein Modell sagt oft mehr als tausend Worte.








Du brauchst: zwei Strohhalme % einen Luftballon % eine Nagelschere % Kleber oder Klebeband % Stoppuhr
1) Nimm einen Strohhalm in den Mund! Eine Hand halte bei der Stoppuhr, einen Finger der anderen hinter den Strohhalm! Starte die Stoppuhr und blase gleichzeitig drei Sekunden lang so kräftig du kannst durch den Strohhalm. Stoppe die Uhr sobald du keinen Luftzug mehr spürst! Notiere die Zeit! Wie stark war der Luftstrom zu Beginn?
2) Schneide mit der Schere ein Loch, etwas kleiner als der Strohhalme breit ist, in den Ballon! Stecke das Ende eines Strohhalms von Innen durch und fixiere ihn stabil mit dem Kleber, sodass das Loch rundherum dicht ist (das ist wichtig, teste das)! Stecke den anderen Strohhalm durch die Öffnung des Ballons und klebe sie rundherum ab (notfalls wickle das Ballonende um den Strohhalm, auch hier muss alles stabil und dicht sein) Teste deine Konstruktion, indem du an den beiden Strohhalmen den Luftballon etwas auseinander ziehst!
3) Nimm ein Ende deiner Konstruktion in den Mund! Eine Hand bei der Stoppuhr, ein Finger hinter dem Ausgang deiner Konstruktion! Starte die Stoppuhr und blase gleichzeitig drei Sekunden lang so kräftig du kannst durch den Strohhalm! Stoppe die Uhr, sobald du keinen Luftzug mehr spürst! Notiere die Zeit! Wie stark war der Luftstrom zu Beginn? Es kann sein, dass du ein paar Versuche brauchst, bis alles gut klappt!

4) Verändere, wie stark du bläst! Macht das einen Unterschied? Vergleiche deine Beobachtungen und gemessenen Zeiten! Was waren die Unterschiede? Drücke sie in zwei, drei Sätzen aus! Finde eine Verbindung zum Kapitel über die Blutgefäße und formuliere, was du aus deinem Versuch darüber gelernt hast! Tipp: Führe den Versuch gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund durch, das macht mehr Spaß und es ist leichter, die Zeit zu stoppen!
Stelle dir eine Maus, einen Bären und eine Giraffe vor! Stelle dir ihr Kreislaufsystem vor! Müssen ihre Herzen unterschiedlich viel Druck aufbauen können? Kannst du dir aus der Beantwortung der Frage Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausformung ihrer Blutgefäße vorstellen? Schreibe einen kurzen Text der diese Fragen erörtert!



Die Erforschung des Blutes und Kreislaufsystems beschäftigt Naturwissenschafterinnen und Naturwissenschafter seit Jahrhunderten und ist ein andauernder Prozess. Biologinnen und Biologen arbeiten dabei eng mit Fachleuten der Medizin, Chemie, Physik und Ingenieurwissenschaften zusammen. Die Umsetzung der gefundenen Prinzipien und Wirkmechanismen birgt viel Potential für technische Anwendungen
Transportprozesse im Blut sind wichtig für die Medizin, da sie mit dem Stoffwechsel und Immunreaktionen verbunden sind. Auch der Wirkstofftransport geschieht häufig über das Blut. Um wirksame Medikamente zu entwickeln braucht es Wissen über den Stofftransport. Die Transportmethoden im Blut technisch nachzubilden, ist die Basis maßgeschneiderter Transportmoleküle oder mikroskopischer Maschinen
Wissen über das Kreislaufsystem und die Funktionsweise des Herzens hilft Menschen vor Krankheiten zu schützen und zu heilen. Gleichzeitig dient es der gezielten Leistungssteigerung beim Sport. Die mathematische Modellierung von Gefäßsystemen stellt vorhandene physikalische Modelle vor Herausforderungen. Das befeuert die Entwicklung verbesserter Methoden und bringt neue Erkenntnisse.
1
Venenklappe! Baue ein Modell der Venenklappen und vollziehe ihre Wirkweise nach!
Du brauchst: Joghurtbecher % Nagelschere % Stanleymesser % Alleskleber % Luftballon % kurzes Stück stabilen Schlauchs (1 cm – 2 cm dick) % ein Stück Kork größer als der Schlauchquerschnitt und 5 mm bis 1 cm dick % einen biegsamen Streifen Kunststoff breiter und länger als der Schlauchquerschnitt (z.B. aus einer Obsttasse aus dem Supermarkt ausgeschnitten)
2 Olympe
Schneide aus dem Boden des Joghurtbechers ein Loch von der Größe des Schlauchquerschnitts!
Schneide mit dem Stanleymesser den Kork in der Mitte durch! Schneide aus jedem Stück mittig am Rand ein halbkreisförmiges Stück mit dem Durchmesser des Schlauchs aus! Beide Stücke sollen möglichst genau um den Schlauch passen! Sei vorsichtig beim Schneiden oder lasse dir helfen!
Stecke den Schlauch durch das Loch in den Joghurtbecher! Klebe die Korkstücke innen an den Boden des Bechers und mit den Ausnehmungen anschmiegend an den Schlauch, sodass sie den Schlauch im Becher fixieren! Der Schlauch darf nicht über den Kork hinausragen! Dichte etwaige Lücken mit Kleber ab!
Klebe den Kunststoffstreifen an einer Seite so auf den Kork, dass er die Schlauchöffnung abdeckt! Wähle die Klebestelle weit genug von der Öffnung entfernt, dass sich der Streifen aufbiegen kann!
Fülle den Ballon mit Wasser und stülpe seine Öffnung dann über den Schlauch! Fixiere ihn und dichte ihn, falls notwendig, mit einer Schnur ab!
Halte dein Modell in einer Hand und drücke mit der anderen in Stößen mit etwas Pause dazwischen auf den Luftballon!
Beobachte, was passiert! Beschreibe deine Beobachtungen in einem Protokoll! Lies dir noch einmal die Informationen zu den Venenklappen im Buch durch und führe aus, was dein Modell diesbezüglich demonstriert!
Forscherinnen und Forscher fragen! Bildet kleine Teams! Jedes Team überlegt sich eine Sache, die beiden Teammitgliedern im Zusammenhang mit den Themen dieses Kapitels noch unklar ist! Formuliert eine Frage dazu, deren Antwort in zwei bis drei Sätzen gegeben werden kann! Schreibt die Frage auf ein Stück Papier!
Alle Fragen kommen in einen Sack! Jedes Team zieht eine Frage und hat eine Woche Zeit, die Antwort dazu herauszufinden und vorzubereiten! Bereitet, wo passend, Skizzen vor, die ihr an der Tafel zeichnen könnt oder Bild- und Videomaterial für den Projektor! Jedes Team präsentiert seine Antwort vor der Klasse!


So schätze ich mich nach dem Großkapitel DAS HERZKREISLAUFSYSTEM selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
…die Aufgaben des Bluts im Körper und seine wichtigsten Bestandteile des Bluts aufzählen.
…die drei Hauptgruppen an Blutzellen und deren Aufgaben benennen.
…den Transport der Atemgase im Körper beschreiben.
…erklären, was Hämoglobin ist und welche Rolle es im Körper spielt.
…die zwei Phasen der natürlichen Wundschließung und die Vorgänge dabei beschreiben.
…erläutern, was ein Blutgerinnsel ist.
…die Aufgabe der weißen Blutkörperchen und auf welche Weise sie diese erfüllen wiedergeben.
…den Unterschied zwischen unspezifischer und spezifischer Immunantwort unterscheiden.
…beschreiben, was ein offenes Kreislaufsystem ausmacht, wie es funktioniert und Beispiele für Lebewesen mit offenem Kreislaufsystem nennen.
…beschreiben was ein geschlossenes Kreislaufsystem ausmacht, wie es funktioniert und Beispiele für Lebewesen mit geschlossenem Kreislaufsystem nennen.



…den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise des Wirbeltierherz erläutern und mit einer Skizze darstellen.
…Strukturen gleicher Funktion in den Herzen von Fischen, Amphibien, Reptilien, Säugetieren und Vögeln benennen und sie in bildlichen Darstellungen wiedererkennen.
…Unterschiede im Herz und Kreislaufsystem von Fischen, Amphibien, Reptilien, Säugetieren und Vögeln benennen und auch welche Besonderheiten sie mit sich bringen.
…die Arbeitsweise des Säugetierherzens genauer beschreiben.
…den Aufbau von Blutgefäßen wiedergeben und Unterschiede zwischen Arterien und Venen erörtern.
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
Heike Holtsch, Eva Hierteis: Big Fat Notebook –Alles, was du für Physik, Chemie und Bio brauchst: Das geballte Wissen von der 5. bis zur 9. Klasse (Loewe Verlag 2025).
Sabrina Rachlé: WAS IST WAS Band 50 Der menschliche Körper. Wunderwerk der Natur (Tessloff Verlag 2014).

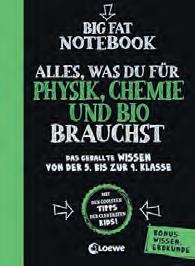


Der Blutkreislauf kann seine Aufgaben erst im Zusammenspiel mit anderen Organen erfüllen. Das menschliche Kreislaufsystem ist typisch für das von Säugetieren. Daher soll der menschliche Körper zum Erkennen der Zusammenhänge als Beispiel dienen.
Angetrieben vom Herz, transportiert das Blut Atemgase, Nährstoffe und Stoffwechselprodukte. Es gibt zwei getrennte Kreisläufe – einen für die Lunge, einen für den Rest des Körpers. Die Blutgefäße verzweigen sich bis zu den feinen Kapillargefäßen, die als enges Netz im Gewebe verteilt sind. Dort findet der Stoffaustausch statt. In der Lunge wird Sauerstoff aufgenommen und Kohlenstoffdioxid abgegeben. Das Blut transportiert die Atemgase durch den Körper. Im Verdauungssystem werden Nährstoffe aus der Nahrung gelöst. Die Nährstoffe werden im Dünndarm an das Blut abgegeben und zur Leber transportiert. Diese beeinflusst den Nährstoffgehalt des Blutes, entfernt Schadstoffe und erfüllt weitere Aufgaben. Das nährstoffreiche Blut fließt durch den Körper.
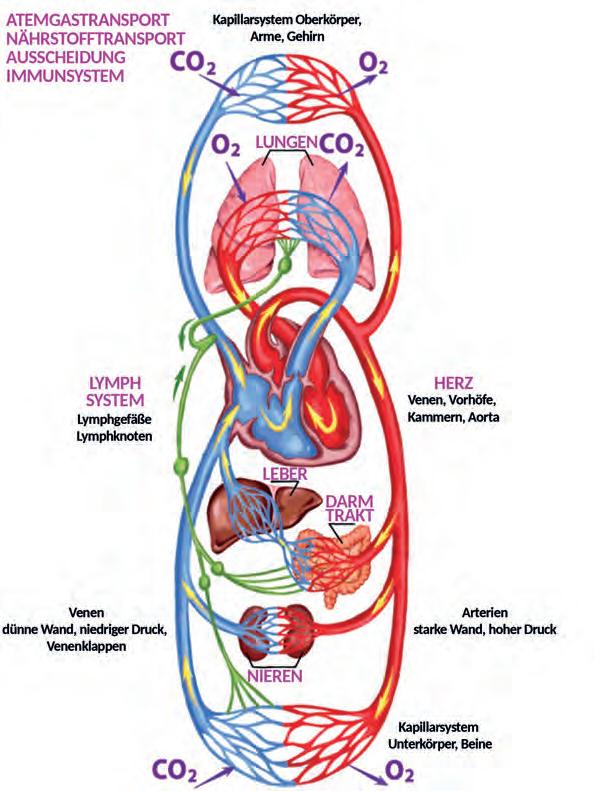

Detaildarstellung des menschlichen Blutkreislaufsystems.
Lies dir das Kapitel über die Verdauung im Buch der ersten Klasse durch!
Was denkst du? Wird am Dünndarm ein dichtes Netz an Kapillaren liegen, oder ist das nicht notwendig? Begründe deine Antwort!
Abb. 1: Der Stoffkreislauf des Menschen – ein Zusammenspiel von Blutkreislauf, Atemkreislauf, Verdauungssystem, Lymphsystem und Ausscheidungssystem.
Im Gewebe findet Stoffwechsel zur Erzeugung von Energie aber auch für andere Prozesse statt. Sauerstoff und Nährstoffe werden umgewandelt, CO2, Wasser und andere Stoffe wieder ans Blut abgegeben. Zusätzlich transportiert das Lymphsystem Flüssigkeit aus dem Gewebe ab. Dabei werden auch unerwünschte Stoffe und Krankheitserreger abtransportiert. Die Nieren filtern und reinigen das Blut, erfüllen aber auch andere Aufgaben. Die Ausscheidungsprodukte des Stoffwechsels werden über die Lungen (CO2) und die Nieren (Wasser und einige andere) ausgeschieden.
Außer Atem!
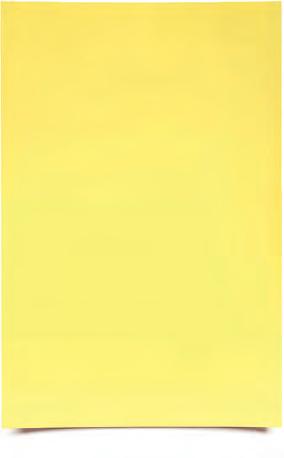

Du hast sicher schon Situationen erlebt, als dein Herz schnell zu schlagen begann oder du außer Atem kamst. Wie schnell das Herz schlägt, hängt davon ab, wie viel Energie der Körper bereitstellen muss. Je größer die Belastung, desto größer der Verbrauch in den Zellen, desto höher die Herzfrequenz. Da für eine hohe Energieproduktion viel Sauerstoff notwendig ist und viel CO2 ausgeschieden werden muss, erhöht sich die Atemfrequenz.
Bildet Teams! Beschreibt Situationen, in denen eure Herz- und Atemfrequenz gestiegen ist! Was hat in diesen Situationen Energie gekostet, sodass der Körper reagiert hat? Wie ist das, wenn man sich erschreckt? Braucht man da viel Energie? Die Herzfrequenz steigt ja ganz gehörig. Welchen Sinn könnte das haben?
Teste wie gut du über den Stoffkreislauf Bescheid weißt! Erkläre jemandem aus deinem Umfeld, was du gelernt has! Stelle dich auf Fragen ein! Auswendig lernen alleine hilft da nicht.


Einfluss nehmen! Atem- und Herzfreuquenz werden von deinem Körper automatisch reguliert. Das geschieht bei tatsächlicher aber auch gefühlter Belastung. Deswegen beschleunigen sich Atem- und Herzschlag auch wenn du Angst hast oder unter Druck stehst. Durch bewusstes tiefes und langsames Atmen kannst du dem entgegen wirken. Dein Körper und auch du selbst werdet ruhiger. Probiere es aus!
Würdest du sagen, die Leber steht in intensivem Austausch mit dem Blut? Lässt sich aus deiner Vermutung etwas über die Form ihrer Blutgefäße ableiten? Formuliere eine Schlussfolgerungskette!
Galle, die: Die Galle, auch Gallenflüssigkeit genannt, ist eine zähe Körperflüssigkeit, die der Verdauung von Fetten dient. Sie zerteilt die nicht in Wasser löslichen Fette in kleine Tröpfchen, sodass diese von anderen Körperstoffen verdaut werden können. Entsprechend hilft sie auch bei der Ausscheidung von schwer wasserlöslichen Stoffen. Gallenflüssigkeit wird in der Leber produziert und in der Gallenblase gespeichert. Tipp für Profis: Wenn dich das mit dem Fett Zerlegen interessiert, suche online nach „Emulgatoren“.
Die Leber – Nebenorgan der Verdauung
Pfortader, die: Auch Portalvene genannt. Venen, die sich noch einmal in ein Kapillarsystem verzweigen.
Sieh dir Abb.1 an!
Nachdem sich die Blutgefäße beim Dünndarm zu Kapillaren verzweigt haben, tun sie dies noch mal bei der Leber. Schaue ins Kapitel zum Blutkreislauf! Weshalb ist das für das Pumpen von Blut nicht optimal?
Der menschliche Körper enthält etwa 40 l Wasser. Etwa 4,5 l davon befinden sich im Blut. Lies den Absatz zum Lymphsystem aufmerksam! Wo könnte sich deiner Meinung nach ein Großteil des restlichen Wassers befinden?
Du hast schon in der ersten Klasse von der Leber gehört. Sie wird in den rechten und den linken Leberlappen unterteilt. Für den Blutkreislauf hat sie in mehrerer Hinsicht Bedeutung. Alle Nährstoffe aus dem Verdauungssystem werden über das Blut zur Leber transportiert. Die Leber kann Zucker, Fette und einige Vitamine speichern. Sie stellt wichtige Stoffwechselprodukte wie Zucker her und reguliert den Stoffwechsel. Die Leber produziert Galle, die der Verdauung von Fetten dient. Die Leber dient der Entgiftung und dem Abbau von Medikamenten. Diese Stoffe werden um- und abgebaut, um danach ausgeschieden zu werden. Die Leber baut alte rote Blutkörperchen ab. Sie stellt wichtige Stoffe für die Blutgerinnung und andere Bluteiweiße her. Du siehst, die Leber bestimmt wesentlich mit, was sich im Blut befindet. Viele Abbauprodukte sind zu groß, um ins Blut zu gelangen. Die Leber steht daher in intensivem Austausch mit dem Lymphsystem, das diese Abbauprodukte in der Lymphflüssigkeit abtransportiert.
Leberpfortader
Kapillarnetz
linker Leberlappen rechter Leberlappen
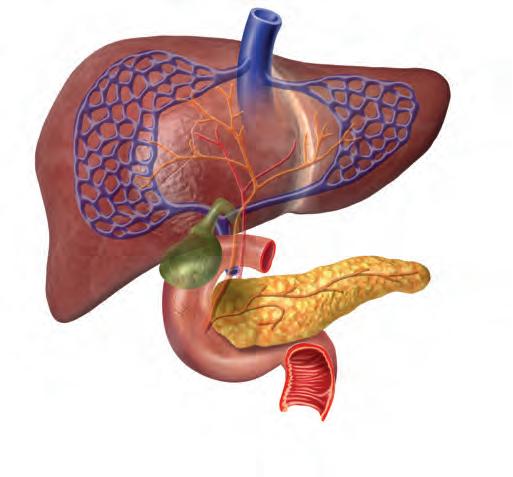
Gallenblase
Leberarterie
Abb. 3: Aufbau der Leber mit Detailansicht der Struktur in einem sogenannten Leberläppchen.
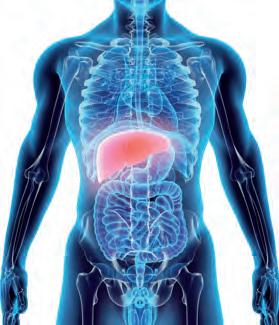
Abb. 2: Lage der Leber im Körper. Was kannst du sonst noch alles erkennen? Arbeite mit deinem Sitznachbarn, deiner Sitznachbarin!
Fließrichtung des Bluts durch das Lebergewebe
Zentralvene
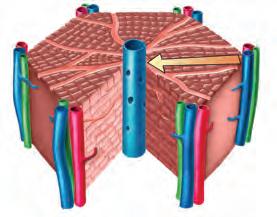
Gallengang
Bauchspeicheldrüse, sie bildet Verdauunssäfte, (Enzyme). Diese zerlegen die Nahrung, sodass diese vom Darm aufgenommen werden kann. Sie ist auch ein wichtiger Hormonproduzent. 1mm
Arterie
Vene
Flüssigkeitstransport und Immunorgan
Durch die dünnen Wände der Blutkapillaren gelangt Sauerstoff und Blutplasma mit darin gelösten Nährstoffen ins Gewebe. Diese sogenannte Gewebsflüssigkeit versorgt die Zellen der Organe. Die Zellen geben Abfallprodukte des Stoffwechsels und CO2 an die Gewebsflüssigkeit ab. Ein Teil der Gewebsflüssigkeit und das CO2 treten wieder in die Blutkapillaren ein. Der Großteil der Abfallprodukte ist zu groß, um ins Blut zu gelangen, kann aber mit Gewebsflüssigkeit in die Lymphkapillaren eintreten.
Diese wässrige, hellgelbe Flüssigkeit wird dann Lymphe genannt. Auch Krankheitserreger und Fremdkörper werden so aus dem Gewebe abgeführt. Das Lymphsystem dient also dem Abtransport von im Gewebe unerwünschten Stoffen. Die Lymphkapillaren münden in die Lymphgefäße, die sich weiter in immer größere Gefäße, wie dem Brustlymphgang, vereinigen. Sie münden schließlich hinter dem Schlüsselbein in die Körpervene. An bestimmten Stellen der Lymphbahn befinden sich Lymphknoten. Diese filtern die Lymphe und reagieren mit der Produktion spezieller weißer Blutkörperchen als wichtiger Teil der Immunantwort auf Krankheitserreger in der Lymphe.
Nieren sind die Reinigungsstationen des Körpers. Sie filtern Stoffe, die kleiner als 4 – 5 nm sind, aus dem Blut. Darunter sind viele für den Körper wertvolle Stoffe. Diese werden wieder in den Blutkreislauf zurückgeführt. Übrig bleibt was ausgeschieden werden soll. Die Nieren produzieren Harn, in dem die auszuscheidenden Stoffe transportiert werden. Er wird durch den Harnleiter zur Blase geleitet. Ist diese voll, verspürst du Harndrang.

Abb. 4: Die Nieren sind in etwa auf gleicher Höhe wie die Leber, aber weiter hinten im Körper angeordnet. Achte auf die Harnleiter.
Das Filtern geschieht über ein feines Netz zusammengeknäulter Kapillaren in den Nierenkörperchen. Der entstandene Primärharn fließt durch stark gewundene Röhrchen. Darin findet die Rückführung der wertvollen Stoffe ins Blut statt. Die Form des Kapillarnetzes und der Röhrchen vergrößert die Oberfläche für den Stoffaustausch.
Die Nieren regulieren den Flüssigkeitshaushalt des Körpers. Trinkst du mehr als der Körper benötigt oder entsteht durch den Stoffwechsel zuviel Wasser, greifen die Nieren ein. Wird mehr Wasser über den Harn ausgeschieden, verringert sich die Wassermenge im Körper. Bleibt mehr Wasser im Körper, gelangt mehr Flüssigkeit in die Blutgefäße. Es erhöht sich der Blutdruck. Die Nieren steuern, wie viele Salze im Körperwasser gelöst sind und wie sauer das Blut ist. Beides hat großen Einfluss auf deinen Körper. Die Nieren stellen ein Hormon her, das die Erzeugung von roten Blutkörperchen fördert.
Nierenrinde
Nierenmark
Harnfluss
Nierenbecken
Was denkst du? Liegt die Grenze für die Größe der Stoffe, die in den Nieren aus dem Blut gefiltert werden, über- oder unterhalb der Größe von Blutkörperchen? Argumentiere, weshalb du dich für deine Antwort entschieden hast!
Nierenkörperchen
Kapillarsystem
Besorge dir ein paar Kaffeefilter. Fülle ein Glas mit Wasser und mische jeweils einzeln verschiedene Stoffe dazu. Zum Beispiel Salz, Zucker, Kaffee, Mehl, Kakao, Tinte, Erde,... sei kreativ. Leere das Wasser durch einen der Filter und beobachte, ob der Stoff durch den Filter dringt. Überprüfen kannst du das über Farbe oder Geschmack des durchdringenden Wassers und dadurch, was im Filter hängen bleibt. Koste nur Wasser, das ausschließlich mit Lebensmitteln in Berührung gekommen ist! Was hat das alles mit den Nieren zu tun?

Was ist Harn?


Kapillarsystem
Nierenvene


Kapillarenknäuel im Nierenkörperchen

Sehr feine Verästelung der Kapillaren
Nierenrinde Nierenmark
Nierenarterie
Nierenkörperchen, der Harn entsteht
Scanne die QR-Codes für spannende Detailansichten mittels Elektronenmikroskop!
Harnröhrchen, wertvolle Stoffe werden in die Blutgefäße zurück geführt

Sammelröhre für Harn
zum Nierenbecken

Wasser wird entzogen, der Harn konzentriert

Kappillarwand mit Öffnungen für Diffusion
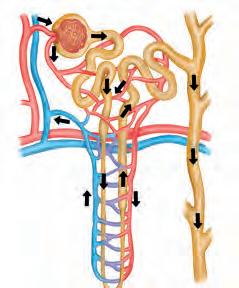
Abb. 5: Aufbau der Nieren. Sie filtern Stoffe aus dem Blut, die ausgeschieden werden sollen. Sieh dir die Detailaufnahmen an. Achte auf Vergrößerung und Größenangaben links unten im Bild.

Harn, auch Urin genannt, kennst du vom täglichen Gang auf die Toilette. Harn hat meistens gelbliche Farbe. Diese stammt von Abbaustoffen, beispielsweise jener von roten Blutkörperchen. Durch Krankheiten und Medikamente kann sich die Farbe verändern. Zusammensetzung und Farbe des Harns können Auskunft über Erkrankungen geben. Deshalb muss bei vielen Gesundheitsuntersuchungen eine Urinprobe abgegeben werden.
Was meinst du? Kannst du die Farbe deines Harns durch die Menge, die du trinkst, beeinflussen? Begründe deine Hypothese! Mache einen Versuch, indem du deutlich mehr Wasser trinkst als sonst!
Vergleiche die Detailansicht der Kapillarwand des dritten QRCodes mit dem der Abbildung zur Diffusion im Kapitel Atmung! Kannst du Gemeinsamkeiten erkennen?
Was denkst du? Welcher Druck wird beim Blutdruckmessen normalerweise erfasst – der im Lungenkreislauf oder der im Körperkreislauf? Und handelt es sich dabei um den Druck in den Arterien oder in den Venen? Erkläre deine Antwort und überlege, warum genau dieser Druck gemessen wird!
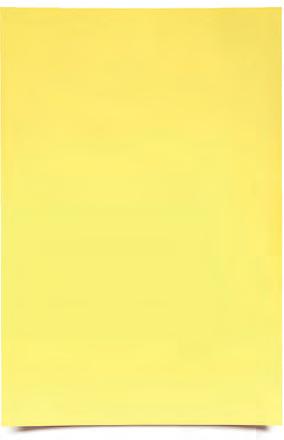

Systole, Diastole... klingt komplizierter als es ist! Durch die Pumpbewegung des Herzens entstehen Phasen, in denen der Blutdruck besonders hoch ist. Nämlich dann, wenn sich die Kammer gerade zusammengezogen hat. Erschlafft die Kammer, um neues Blut aus dem Vorhof einzusaugen, entsteht eine Phase geringsten Drucks. Die Phase höchsten Drucks nennen Mediziner Systole, jene geringsten Drucks Diastole –wie oft, komplizierte Wörter für eigentlich einfache Dinge.
Recherchiere im Internet wie hoch der Blutdruck bei gesunden Menschen sein sollte! Ist der Blutdruck (abgesehen vom Unterschied zwischen Systole und Diastole) immer gleich? Wenn nicht, woran könnte das liegen?
Denke daran, was du über Blutgefäße und Kreislauf gelernt hast! Weshalb wird der Kreislauf gebremst, wenn du dich wenig bewegst?


Regelmäßigkeit bringt‘s! Wenig Bewegung und langes Sitzen hat vielfältige Auswirkungen auf deinen Körper. Dein Kreislauf kommt nicht in Schwung und dein Körper wird mit weniger Sauerstoff versorgt. Oft kommt es zu Gewichtszunahme und schlechter Körperhaltung. Verspannungen erzeugen Unwohlsein und Stress im Körper. All das schadet auch deinem Kreislaufsystem. Etwa 20 Min mittelmäßige Bewegungsanstrengung am Tag hilft dein Kreislaufsystem gesund zu halten!
Ein funktionstüchtiges Kreislaufsystem ist entscheidend für deine Gesundheit ist. Ein gesundes Kreislaufsystem versorgt dich mit genügend Energie, um aktiv zu sein. Ein angeschlagenes oder krankes Kreislaufsystem kann diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. Im Extremfall hat das sehr ernste Folgen für deine Gesundheit.
Zur Überprüfung der Gesundheit des Kreislaufsystems wird häufig der Blutdruck gemessen. Dabei werden zwei Werte notiert. Der systolische Wert beim höchsten Druck und der diastolische Wert beim niedrigsten Druck. Manchmal werden die Bestandteile des Blutes analysiert (Blutbild). Es wird die Zahl der Blutkörperchen und Anteile anderer Stoffe, die mit dem Stoffwechsel zu tun haben, bestimmt. Weichen die Werte von jenen gesunder Menschen ab, sind das Hinweise auf Erkrankungen oder ein erhöhtes Risiko zu erkranken.


Abb. 1: Modernes Blutdruckmessgerät.


Abb. 2: Blutabnahme für ein Blutbild.

Wie alle Muskeln, verlieren das Herz und die Atemmuskulatur an Leistungsfähigkeit, wenn sie nicht trainiert werden. Darum ist es wichtig, Herz und Atemmuskulatur ausreichend zu fordern. Das geht am besten durch Bewegung und Sport. Damit schaffst du die Voraussetzungen für einen gesunden Körper und schützt dich vor Erkrankungen des Kreislaufsystems. Je früher du beginnst, dein Kreislaufsystem zu stärken, desto länger bleibt es leistungsfähig. Erkrankungen des Kreislaufsystems sind die häufigsten Krankheiten bei älteren Menschen. Sie sorgen für Einschränkungen im Leben und können zu einem verfrühten Tod führen.
Abb. 3: Bewegung mit Freunden und Familie macht Spaß und hält dich außerdem noch fit und gesund.
Eine schlechte Haltung beeinflusst deine Atmung. Durch sie entstehen Verspannungen im Brustbereich und oberen Rücken. Der Brustkorb kann sich weniger gut ausdehnen, deine Atmung wird eingeschränkt. Eine krumme Körperhaltung drückt das Zwerchfell zusammen und es kann nicht mehr richtig arbeiten. Die resultierende flache Atmung lässt deine Atemmuskulatur schwächer werden. Sie setzt im Körper Stressreaktionen frei, die Angespanntheit und schlechten Schlaf auslösen. Eine dauerhafte eingeschränkte Funktion des Zwerchfells kann zu Lungenerkrankungen wie Asthma führen. Bei Asthma schlägt der Mechanismus zur Verengung der Bronchien über die Stränge. Sie verschließen sich und die betroffene Person gerät in Atemnot.


Abb. 4: Krummes Sitzen macht auf Dauer krank.
Abb. 5: Bei schlechter Haltung werden Lunge und Zwerchfell zusammengedrückt.

Deine Ernährung hat großen Einfluss auf dein Kreislaufsystem. Das Blut nimmt aus dem Darm auf, was du deinem Körper über die Ernährung zuführst. So greifst du durch die Wahl deines Essens und Trinkens direkt in deinen Stoffkreislauf ein. Leber und Niere müssen verarbeiten, was du ihnen zukommen lässt. Sind bestimmte Stoffe zu zahlreich oder zu wenig vorhanden, kann das die Organe überfordern und langfristig schädigen. Auch Blutgefäße können durch zuviel ungesundes Essen durch Ablagerungen und Entzündungen geschädigt werden. Deshalb ist eine ausgewogene Ernährung mit vielen unterschiedlichen Nahrungsmitteln so wichtig. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was in ihrem Essen alles drinnen steckt und ob sie dadurch ihrem Körper das geben können, was er braucht um gesund zu bleiben.


Abb. 6: Dein Ernährungsstil beeinflusst deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Vielfalt und Abwechslung sind wichtig, dann machen auch ein paar Süßigkeiten und Chips nichts aus.

Um gut zu funktionieren, brauchen die Nieren ausreichend Wasser. Dein Körper besteht zu etwa 60% aus Wasser. Es ist am Großteil der Körperfunktionen beteiligt. Trinkst du zu wenig, wird dein Blut dicker. Dadurch fließt es schlechter und es braucht mehr Druck, um es zu pumpen. Dauerhaft hoher Blutdruck schädigt deine Blutgefäße und lässt das Herz schneller altern. Kopfweh, Müdigkeit und trockene Haut können Folgen von Wassermangel im Körper sein.
Abb. 7: Ausreichend trinken ist wichtig. Nimm immer eine Flasche Wasser mit.
Welche Stoffe braucht der Körper um gesund zu bleiben? Recherchiert zu zweit oder dritt und schreibt eine Liste! Notiere zu jedem Eintrag drei Lebensmittel, in denen der Stoff vorkommt!

Wie viel Wasser ist genug? Mindestens 1,5 l Wasser am Tag solltest du zu dir nehmen. Um deinem Körper seine Arbeit leichter zu machen, sind jedoch 40 ml pro kg Körpergewicht empfehlenswert. Bedenke, beim Schwitzen und in sehr trockener Umgebung verlierst du mehr Wasser. Entsprechend musst du mehr trinken. Beim Verzehr von viel Salz und Zucker braucht der Körper mehr Wasser, um mit dem Überschuss umgehen zu können. Manchmal fühlt sich Durst wie Hunger an, lerne auf deinen Körper zu hören!

Weshalb ist es am besten, Wasser zu trinken? Welche Nachteile haben Limonaden und Säfte? Formuliere einen kurzen Merktext!

Zucker ist der Treibstoff deines Körpers. Fette und überschüssiges Eiweiß werden vom Körper in Zucker umgewandelt und als Energiequelle genutzt. Der Körper braucht nur eine bestimmte Menge an Zucker zur Deckung seines Energiebedarfs. Überschuss kommt erst in den Zuckerspeichern im Gewebe. Sind diese voll, wird der Zucker in Fett umgewandelt und im Fettgewebe gespeichert. Mit der Zeit bauen sich Fettpölster auf, man nimmt zu. Die Umwandlung passiert in der Leber. Muss diese sehr viel Zucker verarbeiten, verfettet sie mit der Zeit und kann krank werden.
Unser Körper liebt Zucker und belohnt uns dafür, ihn zu uns zu nehmen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte war die Regel, dass wir nur schwer an Zucker gelangten. Im Überfluss an Zucker heutzutage macht uns das anfällig. Ist der Körper an süße Lebensmittel gewohnt, verlangt er auch danach. Weniger Süßes schmeckt nicht mehr so gut. Zucker kann ähnlich wie ein Suchtmittel auf Menschen wirken.
Abb. 9: Zucker kann eine ziemlich große Verlockung sein.

Abb. 8: Überschüssigen Zucker speichert der Körper als Fett, meist an Bauch und Hüfte.

Zucker Zucker Zucker! Zucker ist fast überall drinnen. Damit Nahrungsmittel gut schmecken, werden sie meist mit Zucker gesüßt. Oft kommt dann noch Saures dazu, damit man es nicht so merkt. In der Werbung hört man davon nichts. Zucker ist in so gut wie allen Soßen wie Ketchup, Grillsoßen, aber auch Senf, in Fertiggerichten, vielen Knabbereien und auch Wurst drinnen. Sogar die sauren Essiggurken und eingelegten Pfefferoni beinhalten viel Zucker. Obst und Gemüse wird immer süßer gezüchtet, damit es sich besser verkauft und auch im unreifen Zustand schmeckt. Die meisten Menschen nehmen am Tag fünfmal mehr Zucker zu sich als die 25 g, die für eine gesunde Ernährung gut wären.

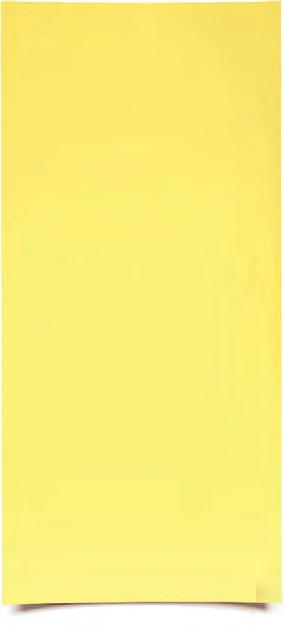

Finde bei dir zu Hause Lebensmittel, die nicht mit Zucker gesüßt wurden! Wie viele sind es im Vergleich zum Rest der Lebensmittel?
Bildet in der Klasse Kleingruppen! Eure Aufgabe in der Gruppe ist es, für jeden von euch einen kleinen Gesundheitscheck zu machen! Nehmt euch dafür eine Woche Zeit, es gibt einiges zu beobachten und herauszufinden!
Jedes Gruppenmitglied erstellt über eine Woche ein Bewegungsprotokoll. Notiert jeden Tag, wie viele Stunden ihr gesessen seid und was ihr dabei gemacht habt! Notiert, wie viel und welche Art von Bewegung ihr gemacht habt! Wann ist euer Kreislauf in Schwung gekommen, so dass ihr außer Atem wart? Das könnte so aussehen:
Montag


Sitzen: Schule 5h, Essen insgesamt 2h, Hausübung machen und lernen 1h, Fernsehen 1,5h, Computerspielen 2h, Brettspiel gespielt 1,5h
Bewegen: Schulwege 20 Min gehen, Straßenbahn nachlaufen außer Atem gekommen, Sportunterricht 1h Ballspielen außer Atem gekommen, Zimmer aufgeräumt 45 Min Dienstag...
AUSWERTUNG: Fasst eure Ergebnisse gemeinsam zusammen! Wie viele Stunden ist jeder in der Woche gesessen, wie viele Stunden Bewegung waren dabei und wie oft war der Kreislauf richtig in Schwung? Wie ist das Verhältnis von Bewegung zu Sitzen? Wobei hat jeder am meisten Zeit sitzend, wobei in Bewegung verbracht? Stellt eure Ergebnisse für jedes Gruppenmitglied übersichtlich dar, beispielsweise in Tabellen, Balkendiagrammen, oder Kreisen unterschiedlicher Größe! Stellt die Ergebnisse gegenüber!
Jedes Gruppenmitglied erstellt über eine Woche ein Ernährungsprotokoll. Notiert dazu jeden Tag, was ihr esst und wie viel ihr trinkt! Unterscheidet Speisen und Getränke folgendermaßen.
Speisen: Obst und Gemüse % Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Bulgur und ähnliches % Fleisch, Wurst, Fisch % Milchprodukte % Süßigkeiten und Knabberzeug Getränke: Wasser % Fruchtsäfte % Limonaden
Ihr könnt beispielsweise eine Strichliste führen. Seht bei den Dingen, die ihr esst und trinkt nach, wo wie viel Zucker drinnen steckt! Auf den Verpackungen ist eine Tabelle zu finden, auf der der Zuckergehalt angegeben ist. Notiert die Menge Zucker, die ihr zu euch genommen habt!

AUSWERTUNG: Fasst eure Ergebnisse gemeinsam zusammen! Wie viel von den einzelnen Lebensmittelarten habt ihr jeweils zu euch genommen? Wie viel Gramm Zucker waren insgesamt dabei? Stellt eure Ergebnisse wieder übersichtlich dar! Stellt auch die empfohlene Menge Zucker von 25g pro Tag, also 175g pro Woche und empfohlene Menge Wasser von 1,5 bis 2 Liter pro Tag dar!
Haltungscheck und Wohlbefinden
Beobachtet euch gegenseitig beim Sitzen, Stehen und Gehen! Achtet auf eure Haltung! Seid ihr gebeugt, krumm, sitzt ihr schief? Wie ist der Gang? Schlurfend oder aktiv? Sind Füße und Knie beim Gehen nach innen oder außen gedreht? Knickt der Fuß nach innen? Notiert eure Beobachtungen und versucht, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten! Fragt euch jeden Tag in der Klasse gegenseitig, wie es euch geht! Notiert wie lange ihr geschlafen habt, ob ihr müde oder munter seid, wie ihr drauf seid und ob ihr Beschwerden habt!
Voneinander Lernen
Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse in der Klasse! Vergleicht eure Ergebnisse und diskutiert sie mit Bezug darauf, was ihr über Stoffwechsel, Kreislauf und Gesundheit gelernt habt! Findet ihr Zusammenhänge zwischen Ernährung, Bewegung, Sitzen, Haltung, Körperbau und allgemeinem Wohlbefinden? Tauscht Gedanken und Tipps zu Bewegung, Ernährung, Körperhaltung und Wohlbefinden aus!


Der übermäßige Konsum zuckerhaltiger Lebensmittel kann den Körper gehörig durcheinander bringen. Isst du ein Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt, schüttet dein Körper größere Mengen Insulin im Blut aus. Durch das Insulin wird der Zucker schnell abgebaut, in die Zellen verfrachtet, oder in die Leber geschickt. Das Insulin bleibt noch eine Zeit in deinem Blut und der Körper baut stetig Zucker ab. Die Menge an Zucker im Blut sinkt weiter. Dein Körper merkt das und sendet ein Signal zu wenig Zucker im Blut, Hunger aktivieren. Obwohl du vor kurzem eine Portion energiereichen Zucker gegessen hast, bekommst du rasch wieder Hunger. In Folge isst du wesentlich mehr, als dein Körper eigentlich bräuchte. Gleichzeitig sorgt dein Körper dafür, dass die Menge an Insulin stark reduziert wird, damit die Menge an Zucker in deinem Blut nicht unter einen kritischen Wert fällt. Isst du wieder etwas Süßes beginnt der Vorgang von vorne.
Sind aufgrund von hohem Zuckerkonsum die Insulinmengen über einen langen Zeitraum hoch, reagieren die Zellen und Organe irgendwann immer weniger auf das Insulin. Der Körper kann zwar noch eine Zeit mehr davon herstellen, aber schließlich ist er überlastet und reduziert die Produktion, oder stellt sie ganz ein. Dann kann dein Körper Zucker von selbst nicht mehr richtig verarbeiten. Diesen Zustand nennt man Diabetes Typ 2, oder auch zuckerkrank.

Abb. 10: Blutzuckerschwankung bei sehr zuckerhaltiger Nahrung (rot) im Vergleich zu weniger zuckerhaltiger Nahrung (blau).

Abb. 11: Diabetiker müssen ihren Blutzuckerspiegel regelmäßig messen. Hier: Einstechen des Fingers.
Das ist eine ernsthafte Sache. Denn wenn der Zucker nicht abgebaut werden kann und in immer größeren Mengen im Blut ist, werden die Körperfunktionen empfindlich gestört. Eine rasch wachsende Zahl an Menschen, auch immer jüngere und selbst Kinder und Jugendliche sind weltweit von Diabetes betroffen. Mediziner gehen davon aus, dass die Ernährungsgewohnheiten der heutigen Zeit und insbesondere hochverarbeitete Lebensmittel dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Insulin kann dem Körper künstlich zugeführt werden. Trotzdem ist das Leben mit Einschränkungen verbunden, vor allem was die Ernährung betrifft. Auch werden Erkrankungen des Kreislaufes durch Diabetes stark begünstigt. In der Regel sind weitere Einflüsse wie ungesunde Ernährung, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Rauchen an der Entwicklung einer Diabetes Typ 2 Erkrankung beteiligt.


Erinnere dich an dein Ernährungsprotokoll! In welchen Lebensmitteln ist überall Zucker drinnen? Checke beim nächsten Mal im Supermarkt zehn Produkte, die keine Süßigkeiten sind auf ihren Zuckergehalt!
Tipp: Oft wird der Zucker unter Namen wie Glucose, Fructose, Saccarose, Dextrose, Traubenfruchtsüße, Süßmolkepulver, Gerstenmalz, … angegeben
Erstelle mit deiner Sitznachbarin, deinem Sitznachbarn eine Liste an Lebensmitteln für eine zuckerarme Ernährung! Vergleicht sie mit euren Essgewohnheiten! Schreibt auf, was ihr für eine bessere Ernährung ändern könnt!

Was ist Diabetes Typ 1? Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung (siehe Infobox im Kapitel Blut). Das Immunsystem greift Insulinproduzierende Zellen in der Bauchspeicheldrüse an und zerstört sie. Dadurch kann der Körper kein eigenes Insulin mehr herstellen. Meist tritt diese Form von Diabetes schon in der Kindheit oder Jugend auf. Erkrankte Menschen sind auf eine dauerhafte Zufuhr von Insulin von außen angewiesen.
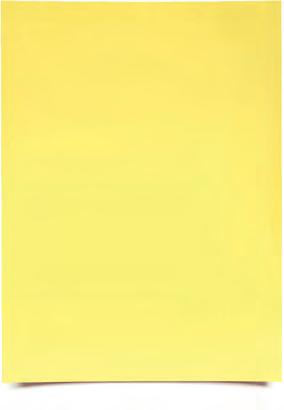
Recherchiere online, wie hoch die Blutzuckerwerte bei gesunden Menschen sein sollten!
Abb. 12: Implantate ermöglichen eine Messung des Blutzuckers ohne Einstich.



Abb. 13: Bei Diabetes muss dem Körper Insulin von außen zugeführt werden. Insulinstifte, funktionieren wie Spritzen (links), Insulinpumpen legen einen dauerhaften Kanal (rechts).

Entwickelt in Gruppen Ideen für die Gesellschaft, um Erkrankungen an Diabetes Typ 2 entgegenzuwirken! Fasst alles übersichtlich zusammen und gestaltet ein Plakat mit Handlungsempfehlungen! Vergleicht das mit euren Lebensgewohnheiten und jenen eures Umfelds! Weshalb schützen diese Handlungsanweisungen nicht vor Diabetes Typ 1? Können sie trotzdem das Krankheitsbild verbessern?
Arteriosklerose, die: Verdickung und Verhärtung der Arterienwände.
Eine Volkskrankheit!
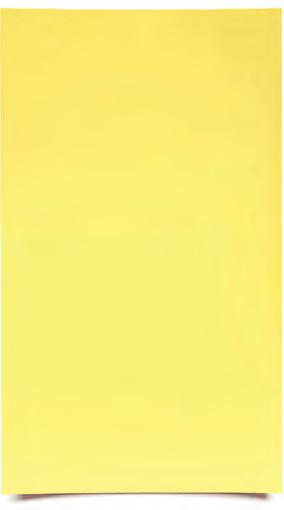

Herzkreislauferkrankungen sind vor allem in der älteren Bevölkerung weit verbreitet. Sie sind die häufigste Todesursache weltweit. Männer sind häufiger und in jüngerem Alter betroffen als Frauen. Die Zahl an Erkrankungen und Todesfällen ist in der westlichen Welt deutlich höher als in anderen Regionen. Betroffen sind nicht nur die Erkrankten selbst. Durch Behandlungsund Pflegekosten, Krankenstände und frühen Ruhestand sind Herzkreislauferkrankungen eine hohe Belastung für die gesamte Gesellschaft.
Warum kommen
Herzkreislauferkrankungen gerade in der westlichen Welt besonders häufig vor? Denkst du, dass sie in diesem Ausmaß ein eher neues Phänomen sind – oder gab es sie schon früher in ähnlicher Verbreitung? Begründe deine Meinung!
Im Kapitel über das Meer wirst du etwas über die Taucherkrankheit lernen. Dort entstehen Gasblasen im Blut. Begründe mit den Informationen dieser Seite, weshalb das lebensbedrohlich sein kann!
Erkläre, warum der Körper bei Sauerstoffmangel infolge einer Lungenembolie den Puls beschleunigt!
Du hast gesehen, das Kreislaufsystem ist ganz schön vielschichtig und mit vielen verschiedenen Vorgängen verknüpft. Entsprechend gibt es auch viele verschiedene Dinge, die nicht nach Plan laufen können. Das kann durch Krankheitserreger, Schadstoffe, Schäden und Veränderungen im Gewebe, das Durcheinandergeraten von Signalen und vor allem auch eine ungesunde Lebensweise geschehen. Man spricht von Herzkreislauferkrankungen oder Erkrankungen eines bestimmten Organs.
Atherosklerose – eine Form der Arteriosklerose
Durch Bewegungsmangel, fettreiche und ungesunde Ernährung, Rauchen und verschiedene Vorerkrankungen kommt es zu einer Schädigung und Entzündung des Gewebes in einer Arterie. Mit der Zeit sammeln sich Fetteinlagerungen in der Arterienwand der geschädigten Stelle, die das Blutgefäß mehr und mehr verstopfen. Man nennt dies Atherosklerose. Es entstehen Durchblutungsstörungen, die im schlimmsten Fall das Absterben von Gewebe wegen Unterversorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff zur Folge hat.

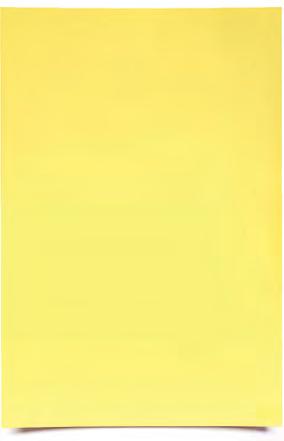

Geschlechterunterschiede! Herzkreislauferkrankungen betreffen die Geschlechter unterschiedlich. Bei Frauen sind Diabetes, Stress und Rauchen größere Risikofaktoren als bei Männern. Auch Hormonunterschiede spielen eine Rolle. Diagnoseverfahren und Medikamente wirken je nach Geschlecht unterschiedlich. Wichtig ist, dass Frauen und Männer verschiedene Symptome zeigen. In der medizinischen Praxis setzt sich dieses Wissen erst langsam durch.
Durch die Verengung kommt es zu einem Druckstau im Blutgefäß der zu einem Riss ) führen kann. Dann tritt Blut in das umliegende Gewebe aus, was zum entstehen, die die Arterie verstopfen. Das Gerinnsel kann durch die Blutgefäße weiterwandern und an anderer Stelle eine Verstopfung hervorrufen, die wiederum das Absterben von Gewebe verursachen kann. . Embolien können auch durch (oder auch . Dadurch ist der Lungenkreislauf gestört. kein mehr stattfinden. Das sich stauende Blut kann nicht zum Herzen die . Je nach Größe des ausgefallenen Bereichs, kann das zu sofortiger Atemnot und Brustschmerzen beim Einatmen führen. Durch den Mangel an Sauerstoff steigt der Puls deutlich an. Durch den Blutstau erhöht sich der Druck im Lungenkreislauf. Das kann zu einer Überlastung des Herzens führen, das im schlimmsten Fall versagt und aufhört zu schlagen. Atherosklerosen und Embolien können auch im Gehirn zu einer Unterversorgung mit Blut und damit Sauerstoff und Zucker zur Energiegewinnung führen. Dabei können Nervenzellen absterben und das Gehirn geschädigt werden. Diese Schädigungen können dauerhaft sein und zum Tod führen. Man spricht von einem Schlaganfall
Abb. 14: Durch Einlagerung von Fett und abgestorbenen Fresszellen entsteht ein immer dickerer Wulst, der Fettstreifen. Bricht dieser auf sind Blutplättchen zur Stelle, es entsteht ein Blutgerinnsel.
Blutgerinnsel in Lungen Arterie

Abb. 15: Blutgerinnsel in Lungenarterie nennt man Lungenembolie. Sie können im schlimmsten Fall zum Tod führen. Fettsreifen
Der Herzmuskel braucht Sauerstoff, um zu arbeiten. Die Blutgefäße, die ihn damit versorgen heißen Herzkranzgefäße. Sind sie beeinträchtigt, kommt es zu einer Unterversorgung des Herzens mit Sauerstoff. Es kann die nötige Pumpleistung nicht mehr vollbringen, was sich besonders bei Belastungen des Körpers bemerkbar macht. Durch den Sauerstoffmangel können die elektrischen Impulse zur Steuerung des Herzschlags durcheinandergeraten. Man nennt dies Herzrhythmusstörungen. Anzeichen dafür sind Schweißausbrüche, Unwohlsein, Schwindel, Angst und Ohnmacht. In schweren Fällen kommt es zu chaotischen elektrischen Impulsen. Die verschiedenen Teile des Herzens arbeiten nicht mehr im Gleichtakt, die Pumpbewegungen werden gestört. Das Herz kann nicht mehr pumpen und der Kreislauf kommt zum Stillstand. Man nennt dies Kammerflimmern.
Im schlimmsten Fall hört das Herz auf zu schlagen. Ein Herzstillstand tritt ein.


Vorhof
ELEKTRO-KARDIO-GRAMM
Normaler Herzrhythmus
Vorhofflimmern
Kammerflimmern
Kammer Abregung


Was ist ein EKG? Mittels Elektrokardiogrammen (EKG) wird die elektrische Gesamtaktivität des Herzmuskels aufgezeichnet. Dafür werden Elektroden im Brustbereich angebracht, die die elektrischen Signale aufnehmen. Auf EKGs bilden sich doppelte Signalspitzen aus (mit einer dritten durch die Abregung). Sie entsprechen den zeitlich versetzten Pumpbewegungen der Vorhöfe und Kammern. Liegen Störungen im Herzrhythmus vor, lässt sich dies mit EKGs aufzeichnen und feststellen.
Abb. 16: EKG Muster. Achte auf die Sichtbarkeit des Zusammenziehens von Vorhof und Kammer und der Abregung des Herzmuskels. Bei Rhythmusstörungen (Flimmern) wird das Signal chaotischer.
Abb. 17: Bei Herzinfarkten muss rasch geholfen werden.
Bei fortgeschrittener Verschließung der Herzkranzgefäße kann die Sauerstoffversorgung zu einem Teil des Herzmuskels komplett unterbrochen werden. Dieser Teil des Herzmuskels stirbt ab und kann nicht mehr arbeiten. Das Herz ist in seiner Pumpfunktion gestört und bleibt stehen. Der Kreislauf wird stark beeinträchtigt oder bricht vollständig zusammen. Man spricht von einem Herzinfarkt. Dieser ist eine lebensbedrohliche Situation und Betroffene müssen schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ein typisches Anzeichen für einen Herzinfarkt sind plötzliche starke und anhaltende Schmerzen in der Brust. Manchmal breiten sich die Schmerzen in andere Regionen des Körpers aus. Plötzliche Atemnot, Bewusstlosigkeit, Schwindel und Beklemmnungsgefühle sind weitere Anzeichen. Achtung: Bei Frauen sind die Anzeichen oft anders! Sie spüren häufig Schmerzen im Rücken und Schulterblatt oder empfinden Übelkeit.
Hast du den Verdacht, dass jemand einen Herzinfarkt hat, oder sonst irgendwie in einem bedrohlichen Zustand ist, rufe die Rettung unter 144! Falls möglich leiste erste Hilfe und versuche Menschen in der Umgebung aufmerksam zu machen! Entschlossenes Handeln kann Leben retten!


Abb. 18: Wiederbelebung mit Defibrillator. Achte auf die Sauerstoffmaske zur Beatmung.
Abb. 19: Herzmassage drückt das Herz zusammen und ersetzt so die Pumpbewegung.
Argumentiere mit deinem Wissen über das Kreislaufsystem, weshalb ein Kreislaufstillstand eine unmittelbar lebensbedrohliche Situation darstellt!
Wiederbelebung!
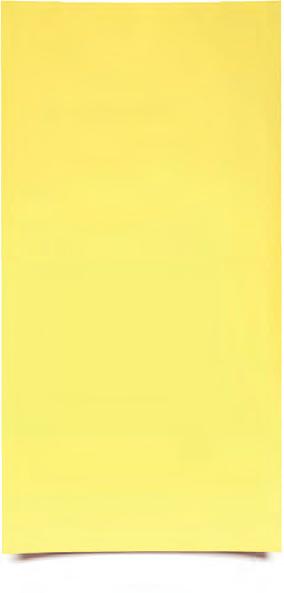

Kommt es zu einem Herzstillstand ist schnelles Handeln angesagt. Da das Herz nicht mehr selbst pumpen kann, muss die Pumpbewegung von außen durchgeführt werden. Dabei drückt man mit den Handballen beider Hände kräftig und rhythmisch auf das Brustbein in Höhe des Herzen. Um dem Körper Sauerstoff zuzuführen, muss man Luft in die Lungen der betroffenen Person blasen. Eine Möglichkeit ein stillstehendes Herz wieder zu starten ist mit einem starken elektrischen Impuls. Dieser unterbricht die chaotischen Signale, die das Herz am Schlagen hindern. Das Gerät dazu nennt man Defibrillator.
Recherchiere, wie Wiederbelebung genau funktioniert! Es gibt ein paar Dinge zu beachten! Am besten lernst du alles in einem Erste Hilfe Kurs! Vielleicht bietet deine Schule einen an.
Erarbeitet in Teams eine Liste mit Anzeichen, um Herzinfarkte zu erkennen. Unterscheidet zwischen den Anzeichen bei Männern und bei Frauen! Wer Bescheid weiß, kann helfen!
Vervollständige den Text! Fülle die Lücken im Text passend auf!
Pulsdiagramm! Schnapp dir eine Freundin oder einen Freund und zeichnet euren Herzschlag auf!

Du brauchst: Papier % Stifte % Plastikbecher oder Stethoskop
Abb. 20: Mit einem Stethoskop lassen sich Herzschlag und Atem gut abhören. Beim Arzt hast du sicher schon eines gesehen.

1) Findet eure Halsschlagader! Sie befindet sich unter deinem rechten Unterkiefer. Beiße leicht zu und fühle, wo sich dein Kaumuskel spannt. Von dort gehe gerade runter zum Hals! Taste, bis du deinen Puls besonders stark spürst! Legt jeweils ein Blatt Papier vor euch und schnappt euch einen Stift! Beginnt eine gerade horizontale Line zu zeichnen! Führt den Stift langsam von links nach rechts! Jedes Mal, wenn du deinen Herzschlag spürst, führe den Stift schnell nach oben und unten und dann langsam weiter! Beobachte das Muster, dass sich ergibt! Wenn du besonders genau nachfühlst, kannst du vielleicht auch den Doppelschlag wahrnehmen und aufzeichnen!
2) Einer von euch legt den Becher mit der Öffnung zum Körper auf eine Stelle an Brust oder Rücken des anderen! Das Ohr kommt auf die geschlossene Seite! Ist der Herzschlag zu hören? Findet eine gute Position! Falls ihr ein Stethoskop habt, geht es viel einfacher. Der runde Teil mit der Membran kommt auf Brust oder den Rücken, die Hörer in die Ohren! Die oder der Hörende zeichnet wieder den Puls auf wie vorher. In der Regel ist der Doppelschlag so besser wahrzunehmen. Versucht ihn aufzuzeichnen!
Vergleicht eure Diagramme in Gruppen! Tauscht euch über eure Ergebnisse aus, darüber wie es geklappt hat und was am besten funktioniert hat!
Um ein gutes Modell des menschlichen _______________________________ zu erhalten, muss man mehr berücksichtigen als den Blutkreislauf. Nährstoffe verlassen im den Verdauungstrakt und werden vom Blut in die transportiert. Diese hat vielfältige Aufgaben, beispielsweise __________________ und Auch die spielen eine wichtig Rolle, da sie das Blut ________________ Dazu filtern sie Stoffe die _________________________ werden sollen aus dem Blut und konzentrieren sie im ________. Dieser wird über die ________________ weitergeleitet und in der __________ gesammelt. Die ____________ regulieren auch den haushalt. Zellen brauchen zur Energiegewinnung neben Nährstoffen auch ____________________. Dieser muss von der __________ wegtransportiert werden. Bei Säugetieren geschieht das in einem vom Körperkreislauf Kreislauf. muss hingegen als Stoffwechselprodukt abtransportiert werden. Braucht der Körper gerade viel , steigen und 2 3
Halte dich gesund! Bildet kleine Gruppen! Wiederholt gemeinsam die Inhalte zum Thema Kreislauf und Gesundheit in diesem Kapitel! Besprecht eure Ernährungs- und Lebensweisen und findet Beispiele aus eurem Alltag, die typisch dafür sind! Schaut, ob ihr Gemeinsamkeiten findet!
Verfasst dann an euer Leben angepasste Handlungsanweisungen, um euer Wohlbefinden, eure Fitness und eure Ernährung zu verbessern und euer Kreislaufsystem zu schützen! Einigt euch auf jeweils drei Punkte! Gestaltet die Liste in einem geeigneten Programm und druckt für jeden von euch ein Exemplar aus!
Hänge die Liste in dein Zimmer und setzte die Ideen und Anregungen auch um!
Die Humanbiologie bildet die Basis für unser Wissen über Gesundheit und Krankheit von Menschen. Sie beschäftigt sich mit dem menschlichen Körper, also auch mit dem Stoffwechsel und Kreislaufsystem. Deren Verständnis ist notwendig um Menschen anzuleiten gesund zu bleiben und Krankheiten zu heilen. Umgekehrt liefern Krankheiten Hinweise auf Funktionsweisen und Hintergründe der Prozesse im Kreislaufsystem. Humanbiologie und Medizin stehen sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung in engem Austausch.


Die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten gegen Erkrankungen des Kreislaufsystems ist wesentlicher Teil der Pharmazie. Dafür braucht es das Wissen von Humanbiologinnen und Humanbiologen, die hier an der Schnittstelle von Biologie, Medizin, Chemie und Pharmakologie arbeiten. Herzkreislauferkrankungen sind volkswirtschaftlich von Bedeutung. Krankenkassen tragen hohe Kosten, um erkrankten Menschen zu helfen und die wegfallende Arbeitsleistung kranker Menschen belastet die Wirtschaft und den Staatshaushalt. Das genaue Verständnis des Kreislaufsystems und des Stoffwechsels ist überall dort wichtig, wo Menschen an ihre körperlichen Grenzen gelangen. Raumfahrerinnen und Raumfahrer, Berufstaucherinnen und Berufstaucher, Jetpilotinnen und Jetpiloten, Sportlerinnen und Sportler sowie Spezialeinheiten arbeiten an der Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit. Um die gesundheitlichen Folgen ihrer Berufe zu vermindern und geeignete Trainingsmethoden zu entwickeln, kommt das Wissen der Humanbiologie zum Einsatz.
Krankheit – Mensch – Gesellschaft! Suche dir eine Erkrankung dieses Kapitels oder auch eine von dir selbst recherchierte des Herzkreislaufsystems aus! Verfasse dazu einen Text, welche Folgen die Krankheit für den betroffenen Menschen und sein Umfeld hat! Finde heraus, was die Hauptursachen der Erkrankung sind und wie sie behandelt wird! Füge Möglichkeiten hinzu, die Erkrankung zu verhindern oder ihren Verlauf und die Symptome abzumildern!



Tipp: Falls du eine betroffene Person in deinem Umfeld hast, sprich mit ihr darüber! Sie kann dir sicher wertvolle Einsichten, vor allem aus einer persönlichen Perspektive geben! Über Ängste, Sorgen, Alltagsschwierigkeiten, Hoffnungen und Enttäuschungen bezüglich einer Erkrankung und ihrer Folgen erfährst du aus Texten kaum etwas. Sie sind aber ganz wesentlich für die betroffenen Menschen!
Tragt eure Texte in der Klasse vor! Besprecht, was ihr herausgefunden habt und welche Ideen zur Vermeidung der Krankheiten ihr habt! Sprecht darüber, wie man erkrankten Menschen und Menschen, die ein hohes Risiko haben zu erkranken, auch abseits der medizinischen Seite helfen kann.
Gestaltet ein Plakat, auf dem ihr zusammenfasst, was euch am wichtigsten erscheint! Betitelt es „Wie bleiben wir gesund“! Hängt es in der Klasse auf!
2
1 Olympe
Pulsmessung! Erinnere dich an Aufgabe 2 auf der vorherigen Seite und wie du deinen Puls spüren kannst! Benutze eine Stoppuhr, beispielsweise in der Uhrfunktion deines Handys, um deinen Puls zu messen! Ertaste dafür deinen Puls und zähle die Anzahl an Schlägen innerhalb einer Minute! Schreibe ein Protokoll!
Führe die Pulsmessung in folgenden Situationen aus:
Nach dem Aufwachen
Nach dem Essen
Wenn du durch Bewegung ordentlich außer Atem bist
Wenn du nervös bist
Atme 15 Sekunden lang tief ein und zähle die Pulsschläge
Atme 15 Sekunden lang tief aus und zähle die Pulsschläge


So schätze ich mich nach dem Großkapitel KREISLAUF – MENSCH – GESUNDHEIT selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
… den Aufbau des Stoffkreislaufs des Menschen skizzieren, seine Bestandteile benennen und Auskunft über deren Aufgaben und Funktionsweise geben.
…Aufgaben der Leber benennen und begründen, weshalb sie für den Stoffkreislauf wichtig ist.
…beschreiben, welche Rolle das lymphatische System im Körper spielt.
…die Funktionsweise der Nieren erläutern und welche Rolle sie für den Stoffkreislauf spielen.
…angeben, welche zwei Werte beim Blutdruckmessen aufgenommen werden.
…den Einfluss von Bewegung und Haltung auf den Stoffkreislauf erörtern.
…die Auswirkungen der Ernährung, insbesondere auch Zucker, auf meinen Körper einschätzen und Tipps für eine gesunde Ernährung geben.
…mir durch Beobachtung und Dokumentation einen Überblick über meinen Lebensstil verschaffen und erkennen, ob ich mich gut um mich kümmere.
…Andere über Diabetes und die damit verbundenen Zusammenhänge aufklären und kenne Verhaltensweisen, die die Entstehung der Krankheit begünstigen.
…grob erläutern, wie Atherosklerose entsteht und weshalb sie für den Körper ein gesundheitliches Risiko darstellt.
…den Vorgang bei Lungenembolie und Schlaganfall grob wiedergeben.
…Die Begriffe Herzrhythmusstörung und Kammerflimmern erklären.
…erklären, wie es zu einem Herzinfarkt kommt.
…typische Anzeichen für einen Herzinfarkt erkennen und weiß, wie ich reagieren sollte, wenn jemand in meiner Gegenwart einen Herzinfarkt hat.
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:



Lara Druhm: Rätselbuch rund um Fähigkeiten des menschlichen Körpers: Von Superkräften des Körpers bis zu erstaunlichen Fakten – Rätselspaß rund um den Menschen (Independently published 2024).
Dietrich Grönemeyer: Das Körper-ABC des kleinen Medicus: Kreislauf, Stoffwechsel, Bewegung, Nerven (Rowohlt Taschenbuch 2007).
Susan Whittemore: The Circulatory System (Your Body, How It Works) (Chelsea House Publishers 2004).
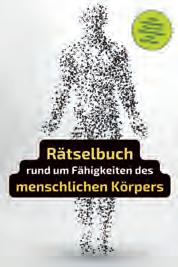


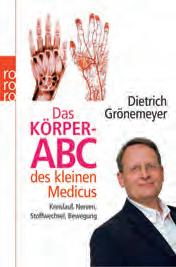




Als Meer, Weltmeer oder Ozean bezeichnet man die verbundenen Gewässer, die die Kontinente, also alle Landmasse umgeben. Das Meer bedeckt etwa 71% der Erdoberfläche und ist der größte Lebensraum der Erde – aber auch der am wenigsten erforschte, da der Zugang zu seinen Tiefen schwierig ist. Es wird in fünf Ozeane eingeteilt.
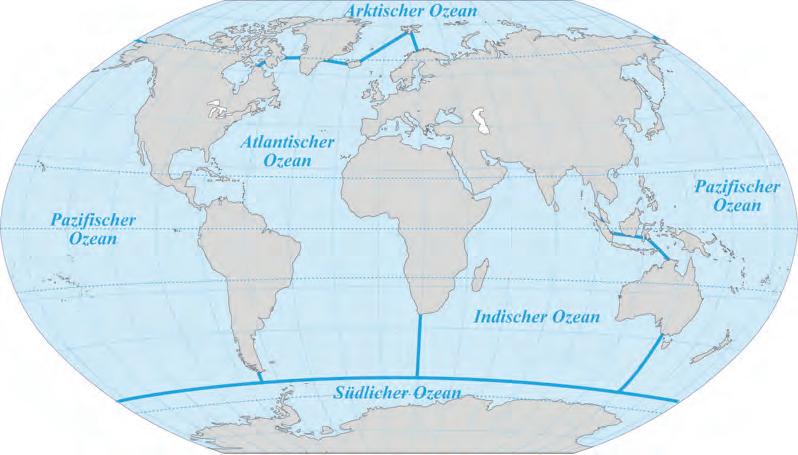
Abb. 1: Benenne auf der Weltkarte die Kontinente!

Der Arktische Ozean im nördlichen Polarkreis angrenzend an Nordasien, Grönland und den Norden Nordamerikas.
Der Atlantische Ozean (Atlantik) zwischen Afrika und Europa auf einer Seite und der Ostküste Nord- und Südamerikas auf der anderen.
Der Pazifische Ozean (Pazifik) zwischen Australien und Ostasien auf der einen und der Westküste Nord- und Südamerikas auf der anderen Seite
Der Indische Ozean zwischen Australien, Südasien und Afrika.
Der Südliche Ozean, der die Antarktis umgibt.
Für Europa ist auch das Mittelmeer von Bedeutung. Als Nebenmeer des Atlantiks trennt es den europäischen vom afrikanischen Kontinent. Das Mittelmeer ist ein Binnenmeer und nur über die Straße von Gibraltar mit dem Atlantik verbunden.
97,5 % des weltweiten Wasservorkommens ist Meerwasser. Meerwasser ist wegen des hohen Salzgehaltes von rund 3,5 % für den Gebrauch als Trink- und Bewässerungswasser nicht direkt geeignet. Nur 2,5 % des globalen Wasservorrates ist Süßwasser.

Warum ist das Meer salzig? Flüsse waschen auf ihrem Weg ins Meer Salze aus dem Gestein, über das sie fließen und transportieren sie ins Meer. Da ständig Wasser aus dem Meer verdunstet und das Salz zurückbleibt, ist das Meer salziger als die Flüsse. Zudem wird aus dem Meeresboden Salz ausgewaschen. Aber weshalb wird dann das Meer nicht immer salziger? Weil Salz in den Meeresboden eingelagert wird. Wasser kann in ihn einsickern und das Salz dort ablagern. Auch werden immer wieder Meeresgebiete durch Landhebungen und Landsenkungen abgetrennt. Das Wasser dort verdunstet und kann über den Regen und Flüsse wieder ins Meer gelangen, während das Salz zurück bleibt. So entstehen die Salzwüsten von denen du letztes Jahr gehört hast.
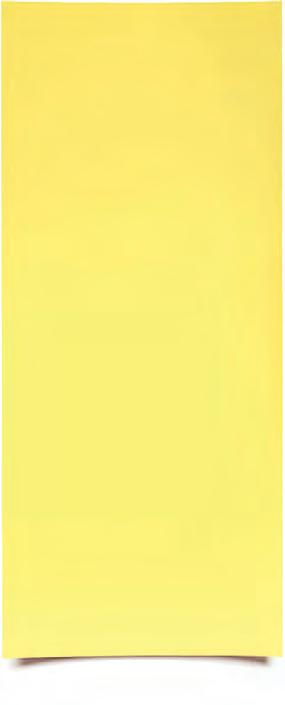
Binnenmeer, das: Teil eines Meeres, der nur durch eine Meerenge mit diesem verbunden ist. Binnengewässer haben im Unterschied dazu keine direkte Verbindung zu einem Ozean.
Abb. 2: Schnapp dir eine Karte und finde heraus, welche Länder an das Mittelmeer angrenzen! Warst du schon in einem dieser Länder? Warst du dort am Meer? Tausche dich mit deiner Sitznachbarin, deinem Sitznachbarn aus und teilt eure Erfahrungen!
Abb. 1 & Abb. 2: Denke an die Lebensräume, die du bisher schon kennen gelernt hast. Kannst du auf den Karten Orte finden, wo einige von ihnen zu finden sind?
Der Marianengraben
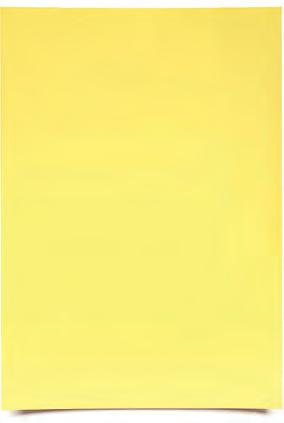

Der Marianengraben ist ein Tiefseegraben im westlichen Pazifischen Ozean. Seine Entstehung ist dem Abtauchen der Pazifischen Platte unter die Philippinische Platte geschuldet. Der Marianengraben ist etwa 2500 km lang und reicht sehr tief hinab. Seine tiefeste Stelle ist das Challenger Tief mit 10.928 Metern Tiefe. Hier befindet sich nach heutigem Wissen auch der tiefste Punkt des Weltmeeres.

Abb. 4: Am Boden des Marianengrabens.
Finde heraus, welche großen Meeresbewohner bis in die Dämmerzone, oder sogar darüber hinaus tauchen!
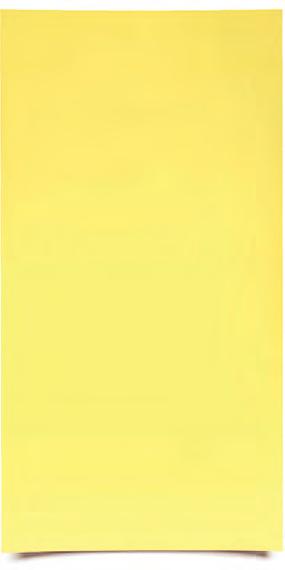
In küstennahen Bereichen finden sich oft flach abfallende Plateaus mit Wassertiefen bis zu 200 m, das sogenannte Schelf. Danach fällt der Meeresboden entlang des Kontinentalhanges steiler ab. In 2000 bis 4000 m Tiefe findet sich meist eine flachere Region, der Kontinentalfuß. Dieser fällt zu den Tiefseeebenen und Tiefseegräben mit Tiefen von bis zu 11.000 m ab. Durch die tektonischen Plattenbewegungen entstehen in den Tiefen der Meere große Gebirgsketten. Man nennt sie Mittelozeanische Rücken.
Kontinentalhang
Vulkanische Insel Tiefseegraben
Druck unter Wasser

Je tiefer du tauchst, desto mehr Wasser befindet sich über dir. Dieses Wasser hat ein Gewicht, mit dem es nach unten drückt. Diese Gewichtskraft spürst du als Druck. Wenn du beispielsweise im Schwimmbad tief tauchst, beginnen die Ohren zu schmerzen. Das ist der Wasserdruck. Wenn du bei geschlossenem Mund und zugehaltener Nase ausatmest, erzeugst du von innen Gegendruck und die Schmerzen lassen nach. An der Erdoberfläche herrscht ein Druck von etwa 1 bar, der Luftdruck. Pro zehn Meter Wassertiefe erhöht sich der Druck um ungefähr ein bar.
Lies die Infobox über den Druck! Welcher Druck herrscht am Boden der tiefsten Stelle des Weltmeeres? Weshalb kann ein Mensch deiner Meinung nach nicht einfach dort hin tauchen?
Kontinent Kontinentalschelf
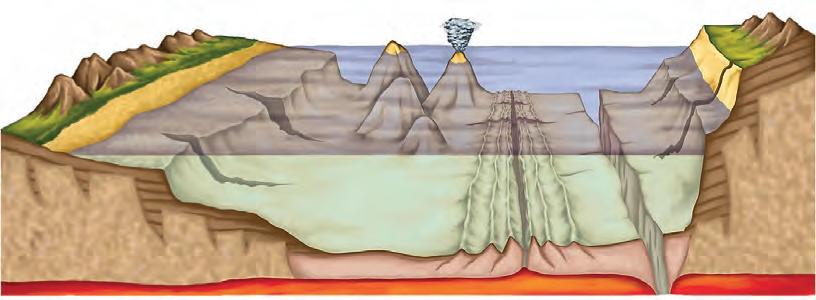
Ozeanischer Rücken
Kontinentalfuß
Unterseeischer Canyon
Tiefseeebene
Abb. 3: Bodenrelief des Meeres. Die Plattentektonik formt den Meeresboden ganz wesentlich.
In zunehmender Tiefe dringt immer weniger Licht vor. Dadurch ändern sich die Lebensbedingungen, weshalb das Meer je nach Wassertiefe in Bereiche eingeteilt wird.
Tiefenzonen des Meeres
In die obersten 200 m dringt genug Licht vor, um Fotosynthese zu betreiben. Daher können in diesem Bereich Pflanzen gedeihen. Dies kann am Meeresboden sein, wenn dieser nahe genug an der Oberfläche liegt. Der überwiegende Teil der Pflanzen im Meer gehört allerdings zum Plankton. Plankton sind, meist sehr kleine, Lebewesen, die im Wasser schwebend leben. Da Pflanzen die Basis von Nahrungsketten bilden, findet sich in diesem Tiefenbereich der höchste Artenreichtum im Meer. Auch für die anderen Tiefenbereiche entsteht in dieser Schicht die Nahrungsgrundlage.
In Küstennähe ist das Wasser lichtdurchflutet. Es gibt viel Leben im Wasser und am Meersboden.
In der Tiefsee herrscht Dunkelheit und hohe Drücke. Nur Spezialisten können sich hier dauerhaft aufhalten.

Die meisten größeren Lebewesen findet man zwischen Oberfläche und Dämmerzone.
Nahe der Oberfläche gibt es viel Licht. Eine Großzahl an Klein- und Kleinstlebewesen gedeiht hier.
Abb. 5: Tiefenschichten des Meeres und ihre Bewohner.
In Tiefen von 200 m bis 1000 m dringt nur wenig Licht vor. Dieser Bereich wird deshalb Dämmerzone genannt. Pflanzenbewuchs kommt in diesen Tiefen nicht vor, lebendes Plankton nur in geringer Menge. Abgestorbenes Plankton sinkt jedoch aus den oberen Schichten nach unten und dient als Nahrungsgrundlage. Auch in wärmeren Meeresregionen liegen die Temperaturen ab 500 m in der Regel unter 5°C. Trotzdem leben in diesen Tiefen zahlreiche Tiere und auch Bewohner der oberflächennahen Schichten tauchen auf Nahrungssuche hinab.
Unter 1000 m spricht man von der Tiefsee. Es dringt kein Sonnenlicht mehr vor. Manche Lebewesen erzeugen jedoch Licht in Form von Biolumineszenz. Dabei entsteht durch chemische Prozesse in ihrem Körper Licht. Auch der Sauerstoffgehalt des Wassers nimmt mit der Tiefe ab. Die Dunkelheit und der große Druck der Tiefsee verlangen von Lebewesen spezielle Anpassungen. Ab 4000 m liegen die Wassertemperaturen nahe dem Gefrierpunkt, was die Lebensbedingungen umso feindseliger macht. Ab 6000 m spricht man von den tiefsten Bereichen im Meer. Der Druck ist enorm. Nur ausgemachte Spezialisten überleben hier.
Das Meer steht nicht still
Das Wasser des Meeres ist in ständiger Bewegung. Temperatur und Salzgehalt beeinflussen, wie schwer Wasser ist. Warmes Wasser steigt auf. Kaltes Wasser sinkt. Dadurch entstehen Strömungen. Ein Netz großer Meeresströmungen, das Ozeanische Förderband, verbindet die vier größten Ozeane. Kaltes, salzreiches Wasser sinkt im Nordatlantik bis 4000 m tief und strömt am amerik anischen Kontinent entlang nach Süden. Dort strömt es im Südlichen Meer Richtung Indischen Ozean und Pazifik. Dabei steigt es an die Oberfläche und wird vermischt. Im Indischen Ozean und Pazifik wird das Wasser an der Oberfläche, vor allem durch Sonneneinstrahlung, erwärmt. Es strömt an der Oberfläche zurück um die Südspitze Afrikas hinauf nach Mittelamerika. Von dort als sogenannter Golfstrom wieder Richtung Nordatlantik.
Wasser ist bei 4 °C am schwersten und sinkt zum Grund eines Gewässers. Stelle eine Vermutung an, warum das eine sehr wichtige Eigenschaft für das Überleben von Wasserlebewesen in kälteren Regionen ist! Tipp: Denke daran, was mit Wasser bei 0 °C geschieht!


Die von den Strömungen transportierte Wärme hat großen Einfluss auf die klimatischen Bedingungen der Erdregionen. Eine Verlängerung des Golfstroms, der Nordatlantik Strom ist bedeutsam für das Klima Europas. Das von ihm transportierte Wasser sorgt in großen Teilen West- und Nordeuropas für milderes Klima als es der geografischen Lage entspricht. Neben diesen großen Meeresströmungen gibt es auch zahlreiche kleinere und zeitlich begrenzt auftretende, die die Wassermassen beständig durchmischen.
Wind treibt das Oberflächenwasser an, wodurch sich Wellen und Strömungen bilden. Bei starken Winden und Sturm können sich meterhohe Wellen auftürmen. Die Wellen laufen weit über das Meer, selbst wenn sie kein Wind mehr antreibt. Auch die Drehung der Erde, Küstenlinien und Unterwasserberge wirken sich auf Meeresströmungen aus.
Sonne und Monde erzeugen mit ihren Anziehungskräften Strömungen. Diese werden noch von der Drehung der Erde und der Form der Kontinente beeinflusst. Da Sonne und Mond ihre Positionen im Bezug auf eine bestimmte Stelle der Erdoberfläche in gleichen Abläufen verändern, entstehen sich zeitlich wiederholende Strömungsmuster. Diese beeinflussen den Wasserstand an den Küsten, die Gezeiten entstehen. Zweimal am Tag entstehen so die Tiden Ebbe (Wassertiefstand) und Flut (Wasserhochstand).
Fülle eine Wanne oder ein Waschbecken mit Wasser! Führe dann mit geöffneter Hand am Grund gleichmäßige Bewegungen hin und her aus! Was beobachtest du? Was geschieht an den Rändern des Beckens? Denke an die Gezeiten!

Die Gezeiten! Sieh dir folgende Infografik genau an um das Zusammenwirken von Sonne und Mond bei den Gezeiten zu verstehen!
Beantworte nun folgende Fragen und schreibe einen kurzen Text über die Gezeiten!
Wie heißt die Kraft, mit der Sonne und Mond auf das Wasser der Erde einwirken?
Wann sind die Unterschiede im Wasserstand besonders groß/klein und warum?
In welchem Zeitabstand folgen Springtide und Nipptide? Tipp: Rechechiere die Mondphasen. Wieso sieht der Mond bei Spring- und Nipptide unterschiedlich aus?
Wieso gibt es zweimal am Tag einen Gezeitenwechsel? Tipp: Denke daran, wie sich der Mond bewegt.
Warmes Wasser in Bewegung! Stelle einen Topf mit Wasser auf den Herd und erhitze das Wasser, bis es leicht köchelt!
Kannst du Wasserbewegungen beobachten?
Halte die Hand mit größerem Abstand über den Topf und senke sie dann langsam, um dich nicht zu verbrühen!
Was spürst du?
Falls du einen gläsernen Topfdeckel hast, schließe damit den Topf! Es klappt auch mit einem Glasteller. Was beobachtest du?
Notiere deine Beobachtungen und Vermutungen zu den Gründen dafür! Formuliere Gedanken, was sie mit dem Meer, Wasserkreislauf und Klima zu tun haben könnten.






Abb. 9: Kochendes Wasser zeigt verstärkt, wie sich Wasser bei Temperaturunterschieden verhält
Was wäre, wenn...? Welche Folgen könnte es haben, wenn die großen Meeresströmungen plötzlich zum Stillstand kämen? Wodurch denkst du, wird das Wasser im nördlichen Polarmeer abgekühlt? Gibt es da einen Zusammenhang mit dem Klimawandel? Schreibe deine Gedanken auf und diskutiert in der Klasse!
Meerwasser ist im Vergleich zu den Böden an Land nährstoffarm. Vor allem in geringer Tiefe, wo es genug Licht für Pflanzenwachstum gibt. Nährstoffe werden von Flüssen, deren Wasser Mineralien aus dem Boden wäscht, ins Meer getragen. Meeresströmungen transportieren sie weiter in den Ozean. In den Tiefen der Meere ist das Wasser nährstoffreicher als an der Oberfläche. Dafür verantwortlich sind sich zersetzende Überreste von Lebewesen, die absinken und vom Meeresgrund stammende Mineralstoffe. Auftriebsströmungen transportieren dieses kalte, nährstoffreiche Wasser aus den Tiefen in die oberflächennahen Bereiche. Meeresströmungen transportieren auch Sauerstoff, der Lebensgrundlage vieler Lebewesen ist. Beachte: Ohne Meeresströmungen wäre Leben im Meer nur sehr eingeschränkt möglich.
Die Nahrungsgrundlage des Meeres wird von kleinsten Lebewesen, dem Plankton gebildet. Wie an Land sind Fotosynthese betreibende Organismen, genannt Primärproduzenten, das Fundament der Nahrungsbeziehungen. Das sind zum einen pflanzliches Plankton, aber auch Fotosynthese betreibende Bakterien wie Cyanobakterien, die früher als Blaualgen zum pflanzlichen Plankton gezählt wurden.




Erinnere dich, was du über Nahrungsnetze in der zweiten Klasse gelernt hast. Welche Lebewesen bildeten die Basis der Nahrungspyramide? Wie nennt man sie?


Wiederhole, was Fotosynthese ist und wie sie funktioniert! Blicke in dein Biobuch der zweiten Klasse, falls du dich nicht mehr erinnerst!
Durch den Klimawandel werden die Meere wärmer und saurer. Kieselalgen und andere Planktonarten, die Fotosynthese betreiben, gedeihen unter diesen Bedingungen schlechter. Erörtere, welche Folgen das für die Lebewesen im Meer haben kann!

μm 25 μm
Pflanzliches Plankton besteht vor allem aus mikroskopischen Algen wie Kiesel-, oder Grünalgen. Das pflanzliche Plankton baut aus Nährstoffen im Wasser und Fotosynthese seine Körpersubstanz auf. Es gedeiht also vor allem in den lichtdurchfluteten und durch Strömungen mit Nährstoffen versorgten Oberflächenbereichen des Meeres. Manche Algenarten verfügen über Geißeln und können aktiv die Oberfläche aufsuchen. Manchmal versorgen Meeresströmungen einzelne Bereiche des Meeres für eine gewisse Zeit mit einer großen Menge Nährstoffe. Dann können sogenannte Algenblüten entstehen. Damit meint man die massive Vermehrung von Algen, so dass große Teppiche entstehen. Je nach Algenart können diese verschieden gefärbt sein.
Welches Plankton gibt es? Plankton wird in verschiedene Arten eingeteilt:
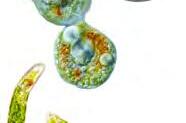

Pflanzliches Plankton erzeugt mehr als die Hälfte des Sauerstoffs der Atmosphäre und bindet bei der Fotosynthese mindestens so viel Kohlendioxid wie alle Wälder der Erde zusammen.
Abb. 2: Augentierchen



Abb. 3: Cyanobakterien. Einige bilden Kolonien aus bis zu mehreren hundert Lebewesen. Diese kannst du frei schwebend als Bausche, oder Fäden im Wasser sehen.
Die Geißeln dienen der Fortbewegung








Abb. 4: Dinoflagellat
Bakterioplankton bakterielles Plankton
Mykoplankton pilzliches Plankton
Phytoplankton pflanzliches Plankton
Zooplankton tierisches Plankton

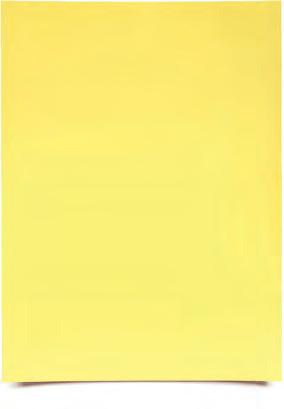
Begründe, warum ein Abnehmen der Fotosynthese betreibenden Planktonbestände auch im Bezug auf den Klimawandel bedenklich ist! Wieso spricht man hier von einem selbstverstärkenden Effekt (positive Rückkopplung)?
Tipp: Denke an die vorherige Seitenspaltenaufgabe!

Eingelagerte Algen


Abb. 6: Acantharia sind
Einzeller mit sternförmigem Zellskelett.

Abb. 8: Ruderfußrebs
Die Schale von Krill enthält Kalk. Kalk löst sich in saurem Umfeld auf. Je wärmer Wasser ist, desto mehr Kohlendioxid speichert es in Form von Kohlensäure. Das Wasser wird saurer. Erörtere, weshalb der Klimwandel für Krill eine Bedrohung darstellt und weshalb sich das auf den gesamten Lebensraum Meer auswirkt!

Abb. 10: Nomura Quallen sind große Plankter.
Als tierisches Plankton bezeichnet man Plankton, das keine Fotosynthese betreibt. Diese Lebewesen ernähren sich von den Primärproduzenten, also pflanzlichem, bakteriellem und pilzlichem Plankton oder von anderem tierischen Plankton. Die zugehörigen Arten sind daher Konsumenten. Tierisches Plankton ist seinerseits Nahrungsgrundlage vieler größerer Tiere.
Räderorgan









Was ist Meerschnee?
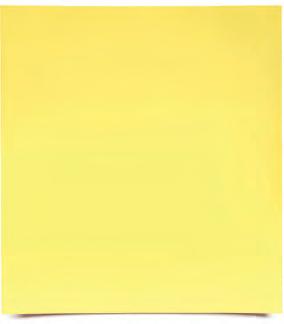

Abgestorbenes Plankton sinkt langsam zum Meeresboden hinab. Geschieht dies in dichteren Wolken, sieht es so aus, als würde es schneien. Vor allem in den dunklen Meeresregionen, wenn es das Licht von Tauchbooten reflektiert und weiß erscheint. Ein anderer Name dafür ist Planktonregen.
verzehrte Algen









Ein großer Teil tierischen Planktons sind Einzeller. Beispielsweise die Acantharia mit ihrem sternförmigen Zellskelett. Es gibt sie in verschiedenen Arten und Formen. Einige ernähren sich von Zooplankton, andere leben in Symbiose mit Algen. Foraminifere sind Einzeller, die meist Gehäuse tragen. Auch sie leben oft symbiontisch mit Algen zusammen. Rädertierchen sind mehrzellige Organismen, die sich von Algen, Bakterien oder auch abgestorbener Biomasse ernähren. Sie verfügen am Kopf über ein wimpernartiges Organ, das ständig in Bewegung ist. Damit bewegen sie sich fort und strudeln sich Nahrung zu.
Kleine Krebstiere wie Ruderfußkrebse und Krill zählen ebenso zum tierischen Plankton. Ruderfußkrebse machen den Großteil des tierischen Planktons im Meer aus. Krill sind garnelenartige Krebstiere. Ihre Größe reicht von etwa ein Millimeter bis mehrere Zentimeter. Krill sind Pflanzenfresser und schweben in riesigen Schwärmen von mehreren zehntausend Tieren durch die oberen Meeresschichten. Ruderfußkrebse und Krill sind enorm wichtig für die Nahrungskette. Auch der Mensch nutzt Krill als Nahrung. Die Larven verschiedenster Tiere, auch größerer zu Beginn ihres Wachstums, werden zum tierischen Plankton gezählt.
Nicht alles Plankton ist klein. Auch Quallen zählen zum Plankton, da sie sich in den Meeresströmungen treibend fortbewegen. Einzelne Quallenarten können sehr groß werden. Die Nomura Qualle hat beispielsweise einen Durchmesser von bis zu 2 m und die Tentakel der gelben Haarqualle können bis zu 37 m lang werden.

Plankton wird von den Meeresströmungen im Meer verteilt. Nach dem Absterben sinkt es in die Tiefe. So bildet es in allen Bereichen des Meeres das Fundament der Nahrungsbeziehungen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Tiere lebt vom Plankton, indem sie es in lebender oder abgestorbener Form aus dem Wasser filtern und zu sich nehmen. Man nennt sie deshalb Filtrierer. Das können sehr kleine, selbst zum Plankton gehörende Tiere wie Krill, aber auch Muscheln, Fische wie Hering und Rochen bis hin zu sehr großen Tieren wie dem Bartenwal sein. Mit ihren Ausscheidungen versorgen diese Tiere das pflanzliche Plankton mit Nährstoffen. Sie selbst sind oft Beute anderer Meeresbewohner, die wiederum Nahrung für ihre Fressfeinde darstellen. Tote Meeresbewohner sinken auf den Grund und bilden die Nahrung einer Vielzahl großer und kleiner Lebewesen von Fischen, über Krebstieren bis hin zu Würmern, Einzellern und Bakterien. Wie du schon gelernt hast, nennt man diese Lebewesen Destruenten.
Als offenes Meer bezeichnet man die Bereiche des Meeres abseits der Küsten. Da sich der Meeresgrund in großer Tiefe befindet, besteht dieser Lebensraum zum allergrößten Teil aus Wasser. Der offene Ozean macht den Hauptteil des Weltmeeres aus. Allerdings wird nur ein verschwindend kleiner Teil der Biomasse des Meeres hier produziert. Das liegt vor allem daran, dass das Wasser der oberen Regionen des offenen Meeres weitgehend nährstoffarm ist und sich nur wenig pflanzliches Plankton bilden kann. Das Nährstoffangebot wird von Strömungen bestimmt. Sonneneinstrahlung und Temperatur sorgen für saisonale Schwankungen der Lebensbedingungen. Dort wo nährstoffreiches Wasser durch Meereswirbel, Strömungen oder tropische Wirbelstürme aus der Tiefe nach oben gefördert wird, gibt es reichlicher Nahrung.
Manchmal kommt es zur explosionsartigen Vermehrung des pflanzlichen Planktons, also Algenblüten. Dann steht kurzzeitig viel Nahrung zur Verfügung. Große Filtrierer wie Bartenwale, Wal- und Riesenhaie oder Teufelsrochen ziehen über tausende Kilometer, um diesem reichen Nahrungsangebot zu folgen. Bestehen solche Auftriebsströmungen dauerhaft, etwa weil Tiefenströmungen an Unterwasserbergen nach oben abgelenkt werden, bilden sich artenreiche Gebiete, ähnlich Oasen in der Wüste.
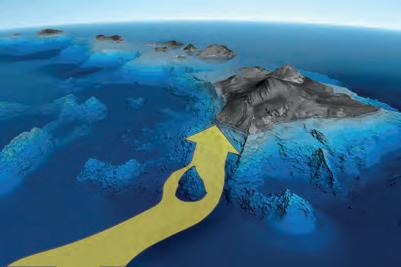
Was sind die Azoren? Die Azoren sind eine Inselgruppe im Atlantik, die steil aus der Tiefe herausragt. Sie bilden eine Barriere für Tiefenströmungen, die nach oben abgelenkt Nährstoffe an die Oberfläche spülen. Das Meer rundherum ist ein Ort voller Leben und als Taucherparadies bekannt.

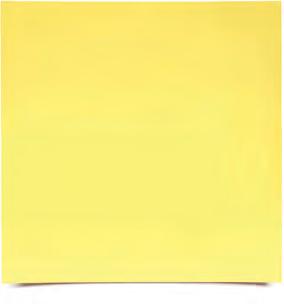
Sieh dir online Bilder und Videos zu Tauchgängen bei den Azoren an! Welche Tiere werden dort gezeigt? Sammelt eure Funde in Gruppen und beschreibt die Artenvielfalt!

Vom Plankton der oberflächennahen Schichten des offenen Meeres ernähren sich verschiedenste Lebewesen. Eine große Zahl davon sind Fische. Als Fisch bezeichnet man im Wasser lebende Wirbeltiere, die mittels Kiemen atmen. Viele dieser Fische leben in Schwärmen weshalb sie als Schwarmfische bezeichnet werden.
Ein typischer Schwarmfisch ist der Atlantische Hering. Er ist einer der häufigsten Fische der Welt und ein bedeutender Speisefisch. Der Atlantische Hering ist vor allem im Nordatlantik verbreitet. Heringe sind 6 cm bis 45 cm lange Knochenfische, das heißt ihr Skelett besteht aus Knochen. Dünne Teile des Skeletts nennt man auch Gräten. Heringe weisen viele für Fische ganz typische Anpassungen des Körpers an das Leben unter Wasser auf, das seine ganz eigenen Herausforderungen an seine Bewohner stellt.
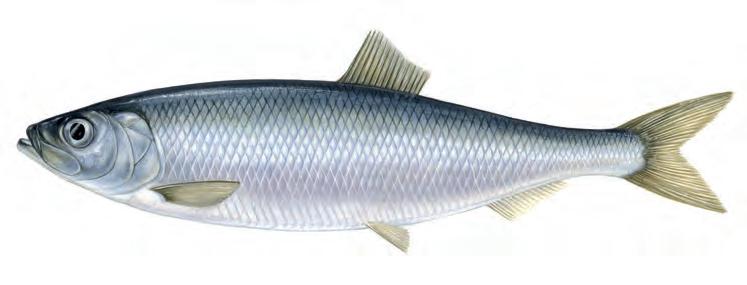
Sieh dir im Supermarkt Verpackungen von Heringsprodukten an! Oft gibt es Herkunftsangaben. Findest du heraus, woher der Hering stammt? Wie leicht machen einem die Hersteller das? Besprecht eure Funde in Teams!
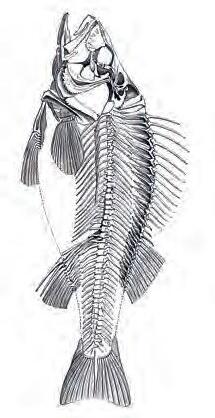
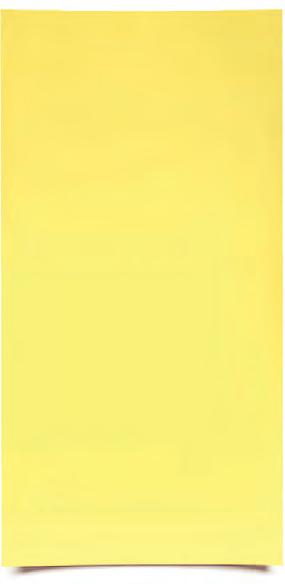

Der Strömungswiderstand! Flüssigkeiten setzen der Bewegung eines Körpers Widerstand, den Strömungswiderstand, entgegen. Zum einen weil die Flüssigkeit weggedrückt werden muss. Zum anderen weil sie am Körper leicht haftet und ihn zurück hält. Man nennt das Reibung. Entstehen bei der Bewegung größere Wirbel in der Flüssigkeit, wird der Strömungswiderstand deutlich erhöht. Kleine Wirbel helfen allerdings, den Strömungswiderstand klein zu halten. Bei Körpern, die spitz zulaufen und über eine glatte Oberfläche mit nur kleinen Strukturen verfügen, verringern sich alle drei Anteile und der Strömungswiderstand wird klein.

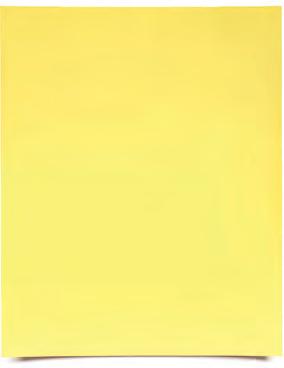
Zähl die Jahre!
Die Schuppen der Knochenfische wachsen im jahreszeitlichen Wechsel mit dem Fisch. Im Sommer schneller, im Winter langsamer. Dabei bilden sie Jahresringe, ähnlich wie bei Bäumen. Anzahl und Anordnung der Schuppen eines einzelnen Fisches bleiben ein Leben lang erhalten. So können Schuppen zur Altersbestimmung herangezogen werden.

Abb. 8: Schleimschicht über den Schuppen.
Fische müssen sich oft sehr schnell bewegen. Was meinst du: Haben solche Fische eher eine dicke oder eine dünne Schleimschicht? Begründe deine Vermutung! †
Richtig gut in Form
Wasser ist deutlich dichter als Luft. Daher braucht es mehr Energieaufwand, um sich hindurchzubewegen. Die Körperform des Herings läuft vorne und hinten spitz zu. Sein Körper hat keine Auswölbungen, oder Einbuchtungen, an denen sich Wasser beim Schwimmen staut. Dadurch gleitet das Wasser ohne viel Widerstand am Körper entlang und Vorwärtsbewegungen werden einfacher. Man nennt diese Art von Körperbau spindel- oder stromlinienförmig. Sie findet sich bei vielen Unterwasserlebewesen.
Abb. 5: Strömung entlang verschiedener Körper angezeigt durch Stromlinien. Dort, wo sie dicht liegen, herrscht großer Druck. Wirbelbereiche stören den Fluss des Wassers. Platte und Kugel weisen einen hohen Strömungswiderstand auf, die Spindelform einen geringen.

Abb. 6: Spindelform des Herings.
Manche Fische verfügen über kugelige oder vorne sehr breite Körperformen. Ihre Lebensweise erfordert jedoch kein schnelles Schwimmen. Der hohe Strömungswiderstand ist daher kein großer Nachteil.
Wie die vieler Fische, enthält die Haut des Herings Schuppen. Die Schuppen sind plattenförmig und dachziegelartig angeordnet. Sie bilden eine biegsame Hülle, die den Fisch schützt aber nicht in seiner Bewegung einschränkt. Menschen haben sich dieses Prinzip für Schuppenpanzer aus Metallplättchen von der Natur abgeschaut.
Die Schuppen der Knochenfische treten vor allem als entwicklungsgeschichtlich ältere Rundschuppen und die daraus hervorgegangenen Kammschuppen auf. Nur noch selten kommen die urtümlichen Schmelzschuppen vor. Die genaue Ausformung der Schuppen ist für jede Fischart speziell. Schuppen können daher zur Artenbestimmung genutzt werden. Die Schuppen vieler Fischarten haben Vorsprünge und Rillen. Es wird vermutet, dass diese kleine Wirbel erzeugen, die den Strömungswiderstand des Fischkörpers verringern.
Über den Schuppen wächst die Oberhaut. In ihr befinden sich Schleimdrüsen, die eine Schleimschicht um den Fisch erzeugen. Diese stellt eine Schutzschicht gegen das Eindringen von Parasiten und Krankheitserregern dar. Gleichzeitig verringert sie die Haftung des Wassers am Fisch und damit den Strömungswiderstand.


Kammschuppen Barsch
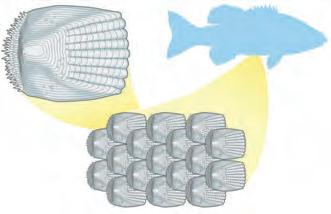
Rundschuppen Lachs

Schmelzschuppen Knochenhecht

Abb. 7: Schuppen der Knochenfische.
Abb. 9: Die Schuppen des Rotauges (links) unterscheiden sich deutlich von jenen des Thunfischs (rechts).
Wie die meisten Fische haben Heringe sieben Flossen (siehe Abb. 3). Flossen sind die Fortbewegungsorgane der Fische. Die Flossen der allermeisten Fische bestehen aus einem Gerüst, den Flossenstrahlen (sie heißen deshalb Strahlenflosser), die mit Hautfalten, der Flossenhaut verbunden sind. Auch die Fortbewegungsorgane mancher anderer Meeresbewohner wie beispielsweise Pinguine, Delfine oder Meeresschildkröten, die in Form und Funktion ähnlich sind, werden oft Flossen genannt.

Flossenstrahlen
Abb. 10: Schwanzflosse des Herings.
Drei der Flossen sind einzeln vorhanden, die Schwanzflosse, die Rückenflosse und die Afterflosse. Vier der Flossen treten in Paaren auf, die Bauchflossen und die Brustflossen. Sie entsprechen den vier Gliedmaßen der landlebenden Wirbeltiere. Flossen finden sich in einer Vielzahl an Formen, abhängig von den Anforderungen die die Lebensweise an die Bewegungsmuster des Tieres stellt.
Wiederhole die Entwicklung der ersten Wirbeltiere an Land aus Kapitel 1!

Was sind Fleischflosser? In vielen Fossilien aus dem Devon finden sich verschiedenste Fische, in deren Brust und Bauchflossen sich relativ dicke Muskeln befanden, weshalb man sie Fleischflosser nennt. Bis heute haben nur drei Linien an Fleischflossern überlebt. Die urtümlichen Quastenflosser, Lungenfische und die Nachkommen jener Lebewesen, bei denen sich Bauch und Brustflossen zu Beinen umgewandelt haben. Die Landwirbeltiere.
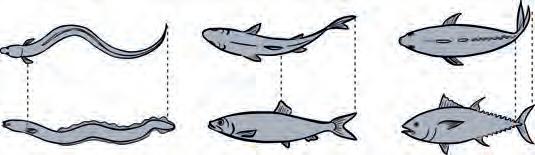
Heringe schwimmen im Schwarm teilweise weite Strecken. Außerdem sind sie ein beliebter Beutefisch für andere Tiere. Entsprechend müssen sie ausdauernd und über kurze Zeit auch sehr flink schwimmen können. Zum Antrieb nutzen sie vor allem ihre Schwanzflosse. Diese führt gemeinsam mit dem hinteren Teil der Wirbelsäule wellenförmige Bewegungen durch. Durch diese wird Wasser beiseite gedrückt und es entsteht eine vorwärtstreibende Kraft.
Abb. 11: Vorwärtsbewegung durch ein wellenförmiges Schlagen der Schwanzflosse (oben). Ein unterschiedlich großer Teil des Körper beteiligt sich je nach Art an der Wellenbewegung (unten).
Wie groß der Anteil des Körpers an den wellenförmigen Bewegungen ist sowie die Form der Schwanzflosse hängen von der Fischart ab. Aale und Muränen verfügen über keine ausgeprägten Flossen und müssen daher ihren gesamten Körper schlängelnd zum Schwimmen benutzen. Thunfische hingegen haben eine sehr ausgeprägte und steife Schwanzflosse, die mit kräftiger Muskulatur bewegt wird. Zum Schwimmen bewegen sie fast nur die Schwanzflosse hin und her. Zwischen diesen Extremen gibt es viele Zwischenabstufungen.
Rücken- und Afterflosse dienen dem Hering zur Stabilisation. Das Wasser, das um sie herum strömt, hält die Flossen und damit den Hering aufrecht. Diese Funktion ist bei vielen anderen Fischen gleich. Es gibt allerdings auch Fische, die sich mithilfe ihrer Rückenund Afterflossen bewegen. Beispiele sind Seenadeln und Kahlhecht. Die Form der Rückenflosse ist je nach Fischart sehr unterschiedlich. Sie kann in mehrere Teile entlang des Rückens geteilt sein oder auch durchgehend entlang der gesamten Körperlänge laufen. Manche Fische, wie Zahnkarpfen, haben die Afterflosse in ein Begattungsorgan umgewandelt.
Bauch- und Brustflossen dienen dem Hering zum Steuern und Bremsen. Zusätzlich haben sie eine stabilisierende Wirkung. In Abbildung 8, 9 und 14 siehst du Beispiele für Brustflossen. Bauch- und Brustflossen sind bei Knochenfischen in der Regel gut beweglich. Für langsames Schwimmen reicht vielen Fischen der Einsatz der Brustflossen. Das kostet weniger Energie, als die Schwanzflosse zu bewegen. Mithilfe der Brustflossen können Fische auch rückwärts schwimmen
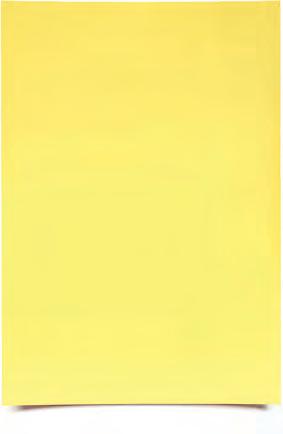
Suche im Internet nach Videos von schwimmenden Fischen! Sieh dir die Bewegungen genau an! Mache Skizzen und notiere um welchen Fisch es sich jeweils handelt! Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennst du? Tipp: Bei den meisten Videoplayern kann man Videos in Zeitlupe ansehen.
Suche nach Informationen zu Lebensraum und Lebensweise der jeweiligen Fische, deren Bewegung du studiert hast! Stelle Zusammenhänge mit der Art der Bewegung her!
Scanne den QR-Code und sie dir an, wie die Schwimmbewegungen der Fische im Wasser Wirbel erzeugen!


Muskulöse Flossen als Vorstufe in der Entwicklung der Beine
Abb. 12: Modell des Mawsonia Fisches, eines Quastenflossers des Mesozoikums .
Lege dich in eine gefüllte Badewanne oder im Schwimmbad ins seichte Wasser! Atme tief ein und halte die Luft an! Was beobachtest du? Atme tief aus! Was beobachtest du? Welches Organ hast du dabei als „Schwimmblase“ benutzt?
Die Zuleitung von Blut erfolgt bei der Schwimmblase durch Arterien. Der Abtransport des Blutes durch Venen. Erinnere dich an das Kapitel zum Kreislauf. Auch die Lunge wird über Arterien mit Blut versorgt und Blut fließt über Venen ab. Was unterscheidet das Blut in der Lungenarterie von dem in der Lungenvene?
Wie denkst du, sieht das bei der Schwimmblase aus?
Tipp: Lies dir Absatz 4 dieser Seite genau durch.
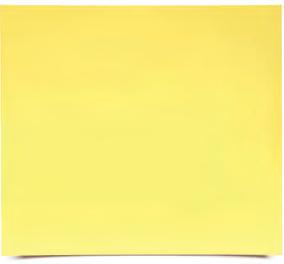

Nicht nur zum Schweben! Bei manchen Fischen dient die Schwimmblase als (zweites) Atemorgan. So können sie ein zeitweises Austrocknen ihres Lebensraumes oder geringen Sauerstoffgehalt des Wassers überleben. Ein Beispiel ist der Knochenhecht.
Du kennst das wohl. Sobald du dich im Wasser nicht bewegst, beginnst du zu sinken. Um nicht unterzugehen, musst du ständige Schwimmbewegungen machen. Mit der Zeit kostet das viel Energie. Damit der Hering energiesparend, ohne extra Schwimmaufwand seine Tiefe halten kann, verfügt er über ein eigenes Organ, die Schwimmblase
Er kann sie mit Gas, in der Regel Sauerstoff, befüllen, oder Gas daraus entnehmen. Ob ein Körper im Wasser schwimmt, schwebt, oder sinkt hängt davon ab, wie schwer er im Vergleich zur von ihm verdrängten Menge Wasser ist. Man spricht dabei von Auftrieb. Im Physikunterricht wirst du sicher mehr dazu erfahren.

Abb. 13: Schwimmblase einer Brachse. Bei Brachsen ist sie zweigeteilt.
Das Körpergewebe der Fische ist größtenteils schwerer als Wasser. Sie würden sinken, sobald sie keine Schwimmbewegungen machen. Füllen sie einen Teil ihres Körpers, die Schwimmblase mit Gas, das leichter als Wasser ist, können sie die Gewichtsverhältnisse ausgleichen. Die Schwimmblase ist meist sackförmig, ähnlich den Lungen der Amphibien, kann aber auch unterteilt sein. Tatsächlich scheinen sich Schwimmblasen im Laufe der Evolution aus Lungen als Spezialisierung für das Leben im Meer entwickelt zu haben. Die meisten Knochenfische verfügen über Schwimmblasen. Ausnahmen sind Fische, die sich vorwiegend am Meeresgrund aufhalten, wie die Flunder.
Kiemen mit Kiemenreuse
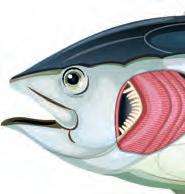


Schwimmblase


Abb. 14: Schnitt durch einen Thunfisch. Du kannst gut die Kiemen mit den Kiemenreusen erkennen. Die Schwimmblase liegt über dem Verdauungssystem. Charakteristisch ist die sichelförmige Schwanzflosse, die spitzen Rücken- und Afterflossen, sowie der vorne eher wuchtige Körper.
Um im Wasser zu schweben, muss in der Schwimmblase die richtige Menge Gas enthalten sein. Zur Kontrolle der Gasmenge haben sich zwei Mechanismen entwickelt. Fische, deren Schwimmblase mit dem Darm verbunden ist, können diese durch Schlucken von Luft befüllen und durch Abgabe von Luft über die Kiemen entleeren. Dies ist vor allem bei Süßwasserfischen der Fall. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Sauerstoff aus dem Blut an die Schwimmblase abgegeben oder umgekehrt Sauerstoff aus der Schwimmblase vom Blut aufgenommen wird. Das lässt die Verwandtschaft der Schwimmblase mit der Lunge erahnen, auch wenn die Prozesse etwas komplizierter ablaufen als bei der reinen Diffusion in der Lunge.
Beim Hering und anderen Fischen verfügt die Schwimmblase über Verbindungen zum Ohr und dient auch als Organ zur Schallwahrnehmung.
Abb. 15: Je nach Befüllung der Schwimmblase steigt, schwebt oder sinkt der Fisch.
Die Schwimmblase kann auch als lautbildendes Organ dienen. Muskeln bringen die Schwimmblase zum Schwingen, was ein klopfendes oder knurrendes Geräusch ergibt. Bei Heringen sind die Lautäußerungen mit der Abgabe von Gas aus dem After verbunden. Man geht davon aus, dass sie der Kommunikation im Schwarm dienen.
Du hast gelernt, wie die Schwimmblase von Fischen funktioniert. Nun wirst du die Wirkungsweise des Auftriebs und wie du ihn beeinflussen kannst, genauer untersuchen.

Finde anhand der Versuchsbeschreibungen passende experimentelle Fragestellungen. Formuliere eine Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führe dann die Versuche durch.
Du brauchst: Eine große Schüssel oder ein Waschbecken, auch die Badewanne funktioniert % kleinere Schüsseln aus unterschiedlichen Materialien, am besten möglichst gleich groß und ähnlich geformt % einen Messbecher
FRAGE:
VERMUTUNG:
VERSUCH: DURCHFÜHRUNG A
Fülle die große Schüssel beziehungsweise das Waschbecken so weit mit Wasser, dass die kleineren Schüsseln ganz untertauchen können!
Nimm eine der kleinen Schüsseln und wiege sie ab! Notiere den gemessenen Wert!
Fülle den Messbecher bis zu einer der oberen Markierungen und notiere, wie viel Wasser du eingefüllt hast!
Setze die kleine Schüssel in die große beziehungsweise das Waschbecken!

Schütte langsam Wasser aus dem Messbecher in die kleine Schüssel und stoppe, sobald sie zu sinken beginnt!
Notiere, wie viel Wasser du aus dem Messbecher ausschütten musstest.
VERSUCH: DURCHFÜHRUNG B, C, ...
Wiederhole den Versuch mit allen kleinen Schüsseln!
Notiere alle Werte!
AUSWERTUNG: Berechne jeweils ab welcher Gesamtmasse die einzelnen Schüsseln gesunken sind. Dazu addierst du zur gewogenen Masse der Schüsseln jeweils die Masse des eingefüllten Wassers. Ein Liter Wasser entspricht recht genau einem Kilogramm. Also addierst du einfach die Menge an eingefülltem Wasser in Litern. Notiere und vergleiche deine Ergebnisse.
1) Notiere deine Beobachtungen! 2) Welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus? Weshalb sanken die Schüsseln ab einer gewissen Wassermenge? Erkläre Unterschiede und Gemeinsamkeiten! Fasse deine Ergebnisse schriftlich zusammen!

Was geschieht, wenn du Schüsseln unterschiedlicher Größe und Form verwendest? Erkläre auch hier deine Beobachtungen!
Halte alles in einem Protokoll fest und vergleicht eure Resultate und Schlussfolgerungen in Teams!


Finde anhand der Versuchsbeschreibungen passende experimentelle Fragestellungen. Formuliere eine Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führe dann die Versuche durch.
Du brauchst: Eine große Schüssel oder ein Waschbecken, auch die Badewanne funktioniert % Einen Luftballon % einen Strohhalm % Füllmaterial, das im Wasser sinkt wie Sand, kleine Murmeln, kleine Schrauben, ... % Stoppuhr
FRAGE:
VERMUTUNG:
VERSUCH: DURCHFÜHRUNG A
Fülle die große Schüssel beziehungsweise das Waschbecken so weit mit Wasser, dass der aufgeblasene Luftballon komplett unter Wasser sein könnte!
Wiege eine bestimmte Menge Füllmaterial ab und stopfe sie in den Luftballon! Notiere den gemessenen Wert!
Stecke den Strohhalm in den Luftballon und halte die Öffnung fest zu! Tipp: Du kannst auch Klebeband verwenden.
Tauche den Luftballon in die Schüssel mit Wasser, sodass der Strohhalm in deiner Hand aus der Wasseroberfläche ragt!


Starte die Stoppuhr und beginne den Luftballon durch den Strohhalm langsam aufzublasen!
Stoppe, sobald der Luftballon beginnt zu steigen. Halte die Stoppuhr an und notiere die vergangene Zeit!
VERSUCH: DURCHFÜHRUNG B, C, ...
Wiederhole den Versuch mit verschiedenen Füllmengen des Füllmaterials! Achte darauf, immer möglichst gleich fest zu blasen und eventuelle Atempausen gleich lange zu halten!
Notiere alle Werte!
AUSWERTUNG: Vergleiche das Gewicht des eingefüllten Füllmaterials jeweils mit der Zeit, die du den Luftballon aufblasen musstest, bis er zu steigen begann! Stelle deine Messwertpaare in einem Diagramm dar!
1) Notiere deine Beobachtungen! 2) Welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus? Kannst du einen Zusammenhang zwischen Füllmenge und Aufblaszeit herstellen? Erkläre Unterschiede und Gemeinsamkeiten! Fasse deine Ergebnisse schriftlich zusammen!

Was geschieht, wenn du die Luft aus dem Luftballon langsam wieder auslässt, nachdem er gestiegen ist? Lässt sich der Luftballon soweit aufblasen, dass er schwebt? Falls ja, beschwere den Luftballon etwas mit deiner Hand! Was musst du tun, um ihn in Schwebe zu halten? Erkläre auch hier deine Beobachtungen!
Halte alles in einem Protokoll fest und vergleicht eure Resultate und Schlussfolgerungen in Teams!


Finde anhand der Versuchsbeschreibungen passende experimentelle Fragestellungen. Formuliere eine Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden. Führe dann die Versuche durch.
Du brauchst: Eine längliche flache Schale wie einen Blumenkastenuntersetzer % Schwimmknetmasse % Küchenwaage % dünne Schnur % Büroklammern % Stecknadeln
FRAGE:
VERMUTUNG:
VERSUCH: DURCHFÜHRUNG A
Wiege gleich große Stücke Knetmasse ab und forme damit verschiedene geometrische Körper!
Schneide zwei Stücke Schnur ab, die etwa 20 cm länger sind als die Schale! An je einem Ende knote eine Schlaufe und hänge die gleiche Anzahl an Büroklammern dran. An den anderen Enden knote je eine Stecknadel fest!
Fülle die Schale mit Wasser und stelle sie auf einen Tisch, sodass ein Ende leicht über die Kante ragt!
Befestige die Schnüre an zwei der geformten Körper, indem du die Nadel hindurchsteckst!

Lege die Körper in die Schale und die Schnüre so, dass die Enden mit den Büroklammern über die Kante der Schale und die Tischkante nach unten baumeln!
Ziehe die beiden Körper an das andere Ende der Schale. Lasse sie gleichzeitig los und beobachte welcher Körper sich schneller bewegt!
VERSUCH: DURCHFÜHRUNG B, C, ...
Wiederhole den Versuch mit verschiedenen Kombinationen an zwei Körpern! Forme auch neue Körper!
Notiere jeweils welcher schneller ist und ordne die Körper am Schluss von schnellstem zu langsamsten!
AUSWERTUNG: Skizziere die Körper in der Reihenfolge ihrer Geschwindigkeiten. Du kannst auch die Zeiten stoppen, die sie brauchen, um an das andere Ende zu gelangen.
1) Notiere deine Beobachtungen! 2) Welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus? Erkläre, weshalb die Körper unterschiedlich schnell sind und welche besonders geeignet für die Bewegung durch Wasser sind! Fasse deine Ergebnisse schriftlich zusammen!
Lass einzelne Körper schwimmen und beobachte das Wasser genau! Wie sieht die Oberflächenbewegung bei unterschiedlichen Körpern aus? Hänge mehr oder weniger Büroklammern an und ziehe aktiv an der Schnur, um die Geschwindigkeit zu verändern!
Was beobachtest du?
Halte alles in einem Protokoll fest und vergleicht eure Resultate und Schlussfolgerungen in Teams!


Schau in dein Biologiebuch der zweiten Klasse und wiederhole, was du dort über das Gehör und den Gleichgewichtssinn gelernt hast! Vergleiche mit dem Seitenlinienorgan!
Weshalb könnte es für Fische praktisch sein, wahrzunehmen, wenn sich andere Lebewesen in ihrer Umgebung bewegen?
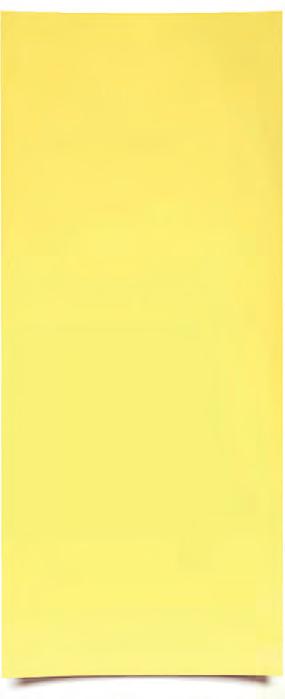
Um seine eigenen und andere Bewegungen im Wasser wahrnehmen zu können, hat der Hering ein reich verzweigtes Netz an Kanälen in der Haut des Kopfes. In ihnen befinden sich feine Haarzellen, die von einer Kuppel aus Gel umschlossen werden. Man nennt dies Neuromasten. Strömendes Wasser verformt die Kuppel und verbiegt damit die Haarzellen. Diese senden einen elektrischen Impuls an das Nervensystem des Fisches. Du hast ein ähnliches Prinzip schon in der zweiten Klasse beim Gehör und Drehsinn des Menschen kennen gelernt. Tatsächlich gehen diese Sinnesorgane auf eine gemeinsame Entwicklungslinie zurück.

Schockierender Fisch!
Der Zitteraal ist trotz seines Aussehens eigentlich kein Aal, sondern ein NeuweltMesserfisch. Er lebt in den Flüssen Südamerikas. Je nach Art in schneller fließenden, sauerstoffreichen oder träger fließenden, sauerstoffarmen Gewässern. Zitteraale bewegen sich mittels ihrer Afterflosse, die entlang fast des gesamten Körpers verläuft. Ihre Kiemen alleine reichen nicht zum Atmen. Sie müssen regelmäßig an der Oberfläche nach Luft schnappen, deren Sauerstoff sie über die Mundschleimhaut aufnehmen. Ihre spannendstes Merkmal ist jedoch, dass sie über ein elektrisches Organ verfügen. Damit orientieren sie sich, können aber auch starke elektrische Stöße von bis zu 860 Volt abgeben. Damit betäuben oder töten sie Beutetiere und verteidigen sich gegen Feinde.
Kannst du in Abb. 18 Seitenlinien erkennen?

Abb. 18: Zitteraale können starke elektrische Stöße abgeben.
Abhängig von der Richtung der Verbiegung werden unterschiedliche Härchen aktiviert und unterschiedliche Signale gesandt. In Kombination damit, wo am Körper in welcher zeitlichen Reihenfolge die Neuromasten aktiviert werden, kann der Fisch dadurch unterschieden, aus welcher Richtung Wasserströmungen kommen.
Bei vielen Fischen verläuft das Kanalsystem zusätzlich entlang einer Linie seitlich am Körper. Man nennt dieses Sinnesorgan deshalb Seitenlinie.
Bewegt sich der Fisch oder ein anderes Lebewesen in seiner Nähe, ändert sich, wie das Wasser in das Seitenliniensystem strömt. Dies kann der Fisch wahrnehmen. Auch Strömungsveränderungen aufgrund feststehender Objekte und generell Strömungen erzeugen eine Sinnenswahrnehmung. Der Fisch bekommt so einen guten Eindruck dafür, wie sein Umfeld beschaffen ist, ob sich darin etwas bewegt und wo.
Auch im Wasser lebende Amphibien verfügen über Seitenlinien. Bei Fischen und Amphibien, die vor allem in stehenden Gewässern leben oder sich nur wenig fortbewegen, liegen die Neuromasten meist direkt an der Hautoberfläche.
Abb. 16: Aufbau des Seitenliniensystems der Fische.
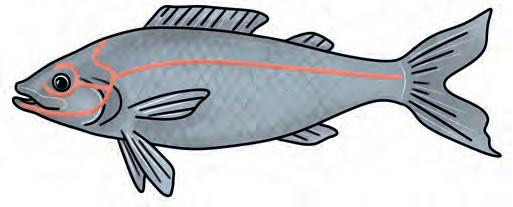
Seitenlinienorgan Gelkuppe
Sinneshärchen strömendes Wasser Sinneszellen

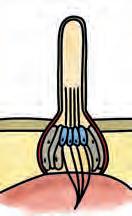
Pore zum Seitenlinienorgan








Bei manchen Fischen, vor allem Haien, Rochen und Aalen sowie im Wasser lebenden Amphibien, haben sich aus Neuromasten zusätzliche Sinneszellen entwickelt. Diese können elektromagnetische Felder wahrnehmen. Da Nervenimpulse elektrisch sind, können so Beutetiere ausgemacht werden. Auch zur Orientierung im Magnetfeld der Erde lassen sich diese Sinneszellen einsetzen. Einige Tiere haben daraus sogar die Fähigkeit entwickelt, selbst starke elektrische Felder zu erzeugen und als Waffe einzusetzen.
Abb. 17: Vergrößerungsstufen des Seitenliniensystems.



Hören und Sehen
Neben der Schwimmblase verfügen Heringe und andere Fische über weitere Organe zur Wahrnehmung von Schall, die gleichzeitig als Gleichgewichtsorgane dienen. Ihre Funktionsweise ist ähnlich der des Innenohrs des Menschen, wie du es schon kennengelernt hast. Gehörsteine aus Kalk oder Stärke von wenigen Millimetern bis Zentimetern Größe sind im Inneren der Organe in Flüssigkeit gelagert.
Die Gehörsteine stehen mit feinen Sinneshärchen in Verbindung. Schallwellen, die durch den Körper des Fisches gehen, bringen diesen zum Schwingen. Da die Gehörsteine schwerer als das umliegende Gewebe sind, reagieren sie langsamer und schwächer auf Schallwellen als das Gewebe um sie herum. Dadurch verändert sich ihre Position zu den Sinneshärchen, die auf die Auslenkungen mit Nervenimpulsen reagieren. Aus diesen Nervenimpulsen erzeugt das Gehirn des Fisches die Schallwahrnehmung. Je nach Richtung der Auslenkung des Gehörsteines werden unterschiedliche Sinneshärchenfelder aktiviert. So kann der Fisch Richtungsinformationen erhalten. Das Ohr der Fische arbeitet eng mit dem Seitenlinienorgan zusammen, um die Umgebung wahrnehmen zu können.
Innenohr Sinneshärchen
Gehörstein
Hörnerv

Hörnerv
Gehörstein Flüssigkeit
Gelmembran
Haarzelle
Abb. 20: Aufbau der Hörund Gleichgewichtsorgane der Knochenfische.
Argumentiere: Weshalb haben sich bei Fischen keine äußeren Ohrmuscheln entwickelt – also keine Strukturen, die wie beim Menschen den Schall aufnehmen und ins Gehör leiten?

Abb. 19: Gehörsteine der Fische können recht groß sein.
Begründe, weshalb Schwarmfische wie der Hering über eine sehr gute Wahrnehmung ihrer unmittelbaren Umgebung verfügen müssen!

Rundherum sehen! Fische haben weit auseinanderliegende Augen seitlich am Kopf. Zusammen mit der Form ihrer Pupillen verfügen Fische so über ein sehr weites Sehfeld von bis zu 300 Grad. So behalten sie einen sehr guten Überblick über ihr Umfeld und nehmen Gefahren oder Beute leichter wahr.

Glaskörper
Netzhaut
Linse Hornhaut
Sehnerv Iris
Heringe orientieren sich auch durch Sehen in ihrem Lebensraum. Ihre Augen sind typisch für die der Knochenfische und dem Auge des Menschen ähnlich. Die optischen Eigenschaften von Wasser ähneln denen des Inneren des Auges. Daher wird das Licht beim Eintreten in das Auge kaum gebrochen. Das ist ein großer Unterschied zum menschlichen Auge, wo die Lichtbrechung vor allem an der Hornhaut geschieht. Die Linse des Fischauges liegt direkt hinter der flach geformten Hornhaut und muss die gesamte Lichtbrechung bewerkstelligen. Die Linsen der Fischaugen sind kugelförmig, nicht verformbar und in ihrer Grundposition auf Nahsicht eingestellt. Um von Nah- auf Fernsicht umzustellen, wird die Linse durch Muskeln im Auge weiter nach hinten gezogen. Dabei kann das Bild nur begrenzt scharf gestellt werden, sodass die meisten Fische kurzsichtig sind. Da die Sichtweite unter Wasser jedoch geringer ist als an Land, ist das kein großer Nachteil.
Linsenmuskel
Abb. 21: Aufbau des Fischauges. Beachte die Ähnlichkeit zu dem des Menschen.
Die Pupille der Knochenfische hat eine feste Größe, die an die üblichen Lichtverhältnisse des Lebensraums angepasst sind. Da die Größe nicht veränderlich ist, kann die Pupille die Menge an Lichteinfall nicht regulieren. Dies wird bis zu einem gewissen Grad durch Mechanismen an der Netzhaut bewerkstelligt. Auf der Netzhaut befinden sich neben Stäbchen und Zäpfchen auch Doppelzäpfchen, die eine sehr detaillierte Farbwahrnehmung erlauben. Fische verfügen über eine vierte Zapfenart, die ultraviolettes Licht wahrnehmen kann, das tiefer in Wasser vordringen kann. Sie verfügen dadurch auch über eine verbesserte Nachtsicht
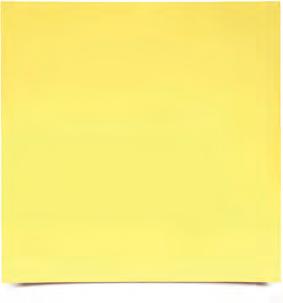
Schlage dein Biologieund Physikbuch der zweiten Klasse auf und wiederhole die Kapitel über das Auge und die Lichtbrechung!
Vergleiche die Mechanismen zum Wechsel zwischen Nah- und Fernsicht bei Fisch und Mensch! Schreibe die Unterschiede auf!
Erstelle eine Hypothese, wie sich die Größe der Pupille und damit auch die Augen von Fischen mit der Wassertiefe, in der sie leben, ändert! Begründe deine Hypothese!
Blinzeln nicht notwendig! Die meisten Fische haben keine Augenlider, manche Fischarten ein sogenanntes Fettlid, eine transparente Schicht über Teilen des Auges. Sie können ihre Augen also nicht schließen. Da sie jedoch im Wasser leben, können die Augen nicht austrocknen, weshalb Lider nicht unbedingt notwendig sind.

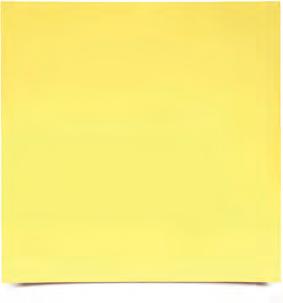
Anpassung an das Leben im Wasser! Erinnere dich daran, was du in dem Kapitel gelernt hast! Welche Anpassungen an das Leben im Wasser kannst du am Kabeljau in Abb. 21 erkennen? Notiere in Stichworten, was du darüber weißt!


Er lebt meist in Bodennähe, aber auch im offenen Meer. Seine Nahrung besteht vor allem aus kleinen Krebs- und Weichtieren, aber auch kleinen Fischen.
Vergleiche und Vermute! Sieh dir folgende Bilder von Fischen an! Denke an die Anpassungen, die du kennen gelernt hast! Welche der Fische sind wohl schnelle Schwimmer und welche eher gemächliche Bummler? Lässt das Vermutungen über ihre Lebensweisen zu? Überlege dir jeweils eine Beschreibung der Flossen!










Gilt das nur für Fische? Du hast gelernt, weshalb Fische, vor allem jene, die schnell schwimmen, über eigens dafür geformte Körper verfügen. Fallen dir andere Tierarten ein, bei denen eine Stromlinienform Vorteile für ihre Lebensweise bringen könnte? Wie sieht es in der Technik aus? Gibt es dort Anwendungsbereiche, wo es wichtig ist, wenig Widerstand gegen Bewegung zu erfahren? Wie sehen die entsprechenden Konstruktionen aus? Bildet Gruppen! Findet Beispiele und sucht nach Bildern dazu! Fertigt Skizzen an und kennzeichnet die Stromlinienform!
Heringe ziehen in großen, dichten Schwärmen durch die oberen Schichten des offenen Meeres. Sie filtern dabei mit ihren Kiemenreusen Plankton aus dem Wasser. Erwachsene Heringe ernähren sich auch von kleinen Fischen. Im Schwarm finden Fische Schutz vor Fressfeinden. Da Fische das Wasser beim Durchschwimmen teilen, benötigen nachfolgende Fische weniger Energie zum Schwimmen. Findet ein Fisch im Schwarm günstigere Bedingungen, wie mehr Nahrungsangebot, profitiert der gesamte Schwarm, indem er ihm folgt. Im Schwarm ist es leichter, Fortpflanzungspartner zu finden, da potenzielle Partner nicht erst aufgespürt werden müssen.

Abb. 1: Ein Schwarm weicht Angreifern aus. Schau genau! Erkennst du vielleicht Flossenund Körperform der Angreifer?

Abb. 2: Sardinen sind typische Schwarmfische. Siehst du den gestreiften Marlin links unten? Ein Fisch im Schwarm ist auch verletzt.
Die Paarung des atlantischen Herings findet in Küstennähe in Tiefen von etwa 50 m statt. Die weiblichen Tiere geben dabei etwa 40.000 um die 1 mm große, Laich genannte, Eier ab. Diese werden von den Männchen im offenen Wasser befruchtet und sinken auf den Grund. Der klebrige Laich bleibt an Steinen, Pflanzen und aneinander haften.

Abb. 4: Larven des Herings in unterschiedlichen Stufen ihrer Entwicklung. Du kannst die zunehmende Ausbildung der Flossen erkennen.

Abb. 3: Laich des Herings an Seegras.
Nach zwei Wochen schlüpfen 8 mm große Larven und steigen dem Licht folgend zur Oberfläche auf. Sie ernähren sich anfangs aus einem Dottersack, danach von kleinem Plankton. Rückenflosse, After- und Bauchflossen sowie die gekerbte Form der Schwanzflosse bilden sich erst während dem Wachstum aus. Ab einer Größe von 4 cm bilden sich Schuppen und die Jungtiere beginnen den erwachsenen Fischen zu ähneln. Im Alter von drei bis sieben Jahren sind Heringe geschlechtsreif und leben danach bis zu 20 Jahre. Diese Fortpflanzungs- und Entwicklungsmuster von Laich, Larve hin zum erwachsenen Tier ist für sehr viele Fischarten typisch. Knochenfische vermehren sich ausschließlich über Eiablage. Es gibt aber auch einige Fischarten, die weiter entwickelten Nachwuchs gebären.

Abb. 5: Fischlarve mit Dottersack am Bauch.

Abb. 6: Junge Heringe zeigen schon alle Merkmale.
Heringe ernähren sich von gleichmäßig im Wasser verteilter Nahrung. Erörtere, warum es für Fische, die sich von einzeln im Wasser vorkommender Beute (wie zum Beispiel einzelnen kleinen Fischen) ernähren, eher ungünstig ist, in einem Schwarm zu leben!
Sieh dir nochmals das Video der Wirbelströmung durch die Schwimmbewegung an! Achte genau auf die Wirbel und die Bewegung der hinteren Fische! Was fällt dir auf?

Formuliere davon ausgehend, passend zum ersten Absatz, eine Forschungsfrage und eine Hypothese!

Was ist Schwarmverhalten? Schwarmverhalten ist ein faszinierendes Phänomen. Der Schwarm bildet eine Einheit aus Einzeltieren, die sich alle gemeinsam koordiniert bewegen, ohne sich groß darüber zu verständigen. Schwarmbewegungen liefern oft ein beeindruckendes Schauspiel, wie du vielleicht schon einmal bei Vögeln beobachtet hast. Auch in der Technik wird versucht, Schwarmverhalten zu nutzen. Dabei werden beispielsweise Roboter zu entsprechendem Verhalten programmiert, um gemeinsam Aufgaben zu lösen. Tipp: Suche Videos zu Schwarmverhalten im Internet, es gibt tolles zu entdecken!
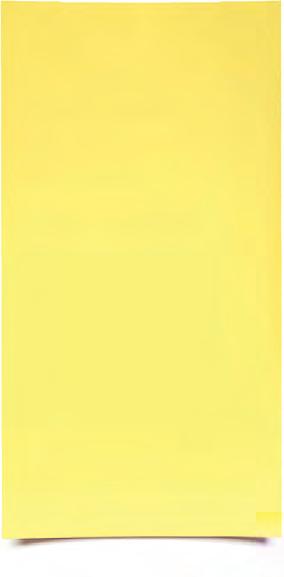
Formuliere ganz einfache Verhaltensregeln, die dafür sorgen könnten, dass ein Schwarm zusammen bleibt.
Wie nennt man die Art der Fortpflanzung, bei der weibliche und männliche Vertreter der Art gemeinsam Nachwuchs zeugen?
Suche online nach Videos von schwimmenden
Thunfischen! Denke daran, was du über Fortbewegung im Wasser gelernt hast! Vergleiche und beschreibe deine Beobachtungen!


Fische die fliegen?
Thunfische jagen auch Fliegende Fische. Um ihren Jägern zu entgehen, durchstoßen Fliegende Fische mit hoher Geschwindigkeit die Wasseroberfläche und segeln mithilfe ihrer flügelförmigen Flossen bis zu 200 m weit und 5 m hoch. Dabei profitieren sie von Auftriebseffekten in Luft, ähnlich wie Segelflugzeuge.

Abb. 9: Fliegender Fisch
Thunfische sind meist oben dunkel und unten hell gefärbt. Argumentiere, weshalb es evolutionär einen Vorteil darstellt! Tipp: Stell dir vor, du schaust vom Meeresgrund nach oben und von der Oberfläche nach unten.

Fechtmeister des Meeres! Schwertfische nutzen ihr Schwert als Waffe bei der Jagd. Sie töten dabei ihre Beute mit Hieben der seitlichen Kante ihres Schwertes. Auch um sich gegen Feinde zu verteidigen, kommt ihr Schwert zum Einsatz. Man geht davon aus, dass es auch die Strömungseigenschaften beim Schwimmen verbessert.
Thunfisch und Schwertfisch – die Nahrungskette hinauf
Heringe sind die Nahrung vieler anderer Fische. Einer davon ist der Thunfisch Thunfische sind schnelle Schwimmer. Sie können in Sprints Spitzengeschwindigkeiten von über 50 km/h erreichen. Entsprechend ist die Stromlinienform seines Körpers stark ausgeprägt. Zur Fortbewegung bewegt sich fast ausschließlich seine sichelförmige Schwanzflosse, die von kräftigen Muskeln angetrieben wird. Schwanzflossen von schnellen Schwimmern sind deutlich höher als breit und haben eine steife Vorderkante, um das Wasser gut verdrängen zu können.

Vergleiche Körper und Flossenform des Thun- und Schwertfisches! Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede erkennst du? Worin könnten Gemeinsamkeiten begründet sein?
Je nach Art werden Thunfische ein bis vier Meter groß und sind in unterschiedlichen Meeren beheimatet. Thunfische halten sich meist in den oberflächennahen Wasserschichten auf, wo die Planktonfresser leben, die sie jagen. Doch tauchen sie je nach Art durchaus 500 m bis 1000 m tief, um Beute zu verfolgen, sind also auch in der Dämmerzone zu finden.
Thunfische wandern meist in Schwärmen aus etwa gleich großen Tieren ihrer Beute hinterher. Sie legen dabei große Distanzen zurück. Sie jagen auch in Schwärmen, wobei sie ihre Geschwindigkeit nutzen, um Beutetiere zu fangen.

sichelförmige Schwanzflosse

geteilte Rückenflosse Stromlinienform
Flössel, sie verringern den Strömungswiderstand glatte Haut mit kleinen Schuppen
spitz zulaufende Brustflosse
Thunfische wandern in bevorzugte Laichgebiete in Küstennähe. Dort geben Thunfischweibchen mehrere Millionen Eier ab. Eier und Larven treiben nahe der Wasseroberfläche. Die Larven ernähren sich von Plankton und wachsen schnell. Vor allem junge Thunfische sind wiederum Beutetiere des Schwertfisches. Dieser nur selten in Küstenregionen anzutreffende, bis zu vier Meter lange Raubfisch, trägt eine auffällige Verlängerung des Oberkiefers, der er seinen Namen verdankt. Schwertfische kommen in allen Ozeanen außerhalb der polaren Regionen vor. Sie wandern weite Strecken. Dabei suchen sie wärmere Gewässer zur Fortpflanzung auf, während sie in kühleren Gewässern ein reicheres Nahrungsangebot vorfinden.
Schwertfische jagen neben Thunfisch auch andere Schwarmfische im oberflächennahen Wasser wie Makrelen, Heringe und Sardellen. Auch Kalmare zählen zu ihrer Beute. Große Schwertfische tauchen zum Beutefang teilweise tief, um Seehechte und Seebrassen in mehreren hundert Metern Tiefe zu erbeuten und sogar in die oberen Tiefseeregionen.
Schwertfische sind wahre Geschwindigkeitsmeister. Für kurze Zeiten können sie bis zu 100km/h erreichen. Dafür sondern sie eine ölige Substanz durch Poren ab. Ihre schuppenlose Haut verfügt darüber hinaus über zähnchenförmige Strukturen. In Kombination reduziert dies den Strömungswiderstand ihres Körpers beträchtlich. Schwertfische haben keine Bauchflossen, weswegen sie nicht abrupt bremsen können. Thunfisch und Schwertfisch sind beides Knochenfische (wiederhole, was das bedeutet).
Abb. 8: Schwertfische sind schnelle Raubfische.


Tintenfische – Düsenantrieb und Saugnäpfe
Tintenfische sind keine Fische, sondern gehören zur Klasse der Kopffüßer aus dem Stamm der Weichtiere. Sie besitzen also keine Knochenstruktur. Die bei Weichtieren übliche Schale hat sich bei Tintenfischen zu einer im Körper liegenden Stützstruktur umgewandelt. Je nach ihrer Größe ernähren sich Tintenfische von Fischen, Krabben, Muscheln oder auch tierischem Plankton. Um ihre Beute zu zerlegen, verfügen
Tintenfische über einen Hornschnabel und eine raue Raspelzunge.
Tintenfische verfügen über zwei Kiemenherzen. Diese Pumpbewegungen ausführenden Blutgefäßabschnitte helfen, die Kiemen mit Blut zu versorgen. Außerdem haben sie im Laufe der Evolution einen Tintensack entwickelt. Aus diesem können sie dunkle Tinte abgeben, die eine kleine Wolke im Wasser bildet. Sie lenkt Fressfeinde ab, die die Wolke attackieren, während der Tintenfisch entkommen kann.
Kalmare sind Tintenfische des offenen Meeres. Sie haben einen keilförmigen Körper, der vom Schulp, einer federförmigen Chitinplatte im Inneren, in Form gehalten wird. Kalmare tragen zehn Fangarme. Acht sind eher kurz und vollständig mit Saugnäpfen besetzt. Sie dienen vor allem dazu, Beute zum Mund zu führen. Zwei, die Tentakel, sind deutlich länger und weisen nur am Ende Saugnäpfe an Verbreiterungen auf. Mit ihnen fangen Kalmare Beute, indem sie sie mit den Saugnäpfen festhalten.
Am hinteren Teil der Kalmare sitzt seitlich ein Paar Flossen. Zum Antrieb nutzen sie jedoch das Rückstoßprinzip. Sie saugen erst Wasser in ihren Körper, um es dann durch eine trichterförmige Öffnung mit hohem Druck wieder auszustoßen (denke an einen aufgeblasenen Luftballon, den du loslässt). Dadurch sind hohe Geschwindigkeiten möglich. Mithilfe ihrer Muskulatur können Tintenfische die Richtung des ausgestoßenen Wasserstrahles kontrollieren. Das macht sie zu sehr wendigen Schwimmern.
Arme
Schwimmrichtung
Welche Weichtiere hast du in der zweiten Klasse schon kennengelernt?

Schnabel des Tintenfischs! Tintenfische verfügen über einen Schnabel, mit dem sie Schalen knacken oder Beute zerlegen. Der Schnabel sieht aus wie der von Papageien. Allerdings deutet das in diesem Fall nicht auf eine Verwandtschaft der Tiere hin. Nützliche Merkmale entwickeln sich im Laufe der Evolution eben auch unabhängig voneinander mehrmals.

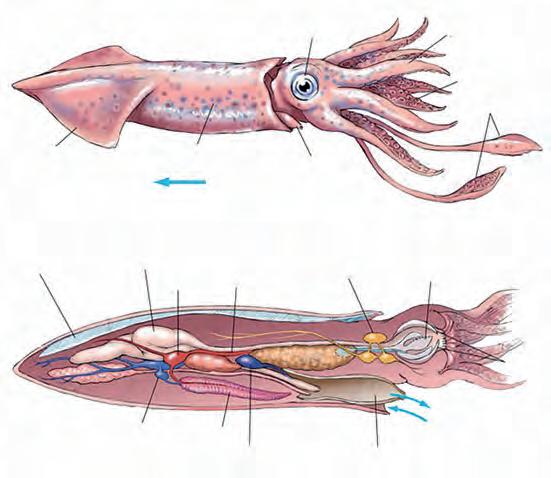
Abb. 10: Körperbau eines typischen Kalmars.



Kommt dir das mit der Raspelzunge bei Weichtieren bekannt vor? Überlege, welches Tier mit Raspelzunge du schon kennengelernt hast!

Abb. 11: Indopazifischer Riffkalmar. Erkennst du, weshalb auch Kalmare an schnelles Schwimmen angepasst sind?


Manche Tintenfischarten sowie andere Meeresbewohner legen weite Strecken über Sprünge aus dem Wasser zurück. Erstelle eine Hypothese, weshalb! Begründe deine Hypothese damit, was du im Kapitel über die Fortbewegung im Wasser gelernt hast!

Abb. 18: Karibische Riffkalmare zeigen ein prächtiges Farbenspiel bei der Paarung.
Finde Gegenstände des täglichen Lebens, die mithilfe des Saugnapfprinzips funktionieren!

Abb. 20: Manche Kalmararten paaren sich in großen Schwärmen und kommen in einen richtigen Paarungsrausch.
© Betty Wills (Atsme), Wikimedia Commons, License CC-BY-SA 4.0
Recherchiere online und finde heraus, ob auch andere Tiere sich mit Samenpaketen fortpflanzen! Der Fachbegriff für diese Pakete ist Spermatophore. Besteht bei manchen Tieren, die du findest, ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Tintenfischen?
Kalmare haben sehr große, gut entwickelte Augen. Die meisten Arten sind nachtaktiv und verbringen den Tag in großen Tiefen, wo sie jagen. Sie sind in einem Umfeld aktiv in dem nur wenig Licht vorhanden ist. Das reicht als Erklärung für derart groß entwickelte Augen nicht aus. Kalmare können mit ihren übergroßen Augen in der Dunkelheit Fressfeinde früher erkennen. Dieser Vorteil war im Laufe der Evolution genug, um so große, mit viel Energieaufwand verbundene Augen zu selektieren. Manche Kalmararten verfügen über Lider und können ihre Augen verschließen.


Kalmare können wie alle Tintenfische die Farbgestaltung ihrer Haut verändern. Dies dient der Tarnung und der Kommunikation untereinander. Bisher ist noch wenig verstanden, wie die Farbbotschaften genau zu deuten sind. In großen Tiefen lebende Kalmararten haben Leuchtorgane entwickelt, mit denen sie Beute anlocken können.
Zur Paarung bilden Kalmare meist Schwärme. Während der Paarung schiebt das Männchen dem Weibchen ein Samenpaket in den Mantel, wo sich die Eier befinden. Die Befruchtung findet also im Unterschied zu den Knochenfischen im Köper des Weibchens statt. Dieses legt die Eier in langen gelartigen Schläuchen in etwa 30 m Tiefe. Es befestigt dabei Büschel von Eischläuchen an Felsen oder anderen Unterwasserstrukturen. Manche Kalmararten ziehen ihre Eischläuche hinter sich her.
Diese sind oft länger als das Tier selbst. Abhängig von der Wassertemperatur reifen die Embryonen in 20 bis 40 Tagen heran. Die Jungtiere schlüpfen danach als Larven, die in Grundzügen den erwachsenen Tieren bereits ähneln.




Abb. 22: Nest eines Kalmars (rechts). Das Bündel an Schläuchen, in denen die Eier liegen, ist gut zu erkennen. Eier mit Embryonen (rechts).




Abb. 21: Kalmar Embryo (links) und Larve (rechts).
Quallen – Nesseltiere auf Wanderschaft
Quallen sind ein Medusa genanntes Entwicklungsstadium im Lebenszyklus vieler Nesseltiere. Der Stamm der Nesseltiere umfasst einfache vielzellige Lebewesen. Sein Name rührt von Nesselzellen her, die sie in ihren Tentakeln tragen. Diese können kleine Schläuche mit Gift verschießen, die die Tiere zum Beutefang und zur Verteidigung nutzen.
Nesseltiere haben meist eine standortsfeste Form, den Polypen. Dieser schnürt mittels ungeschlechtlicher Vermehrung eine Larve (Ephyra) ab, die zu Quallen beiderlei Geschlechts heranreifen. Diese pflanzen sich geschlechtlich fort. Aus einem befruchteten Ei schlüpft wieder eine Larve (Planula) aus der sich ein neuer Polyp bildet.


Abb. 24: Spiegeleiqualle (oben) und Ohrenqualle (unten).


Quallen verfügen über einen Schirm, der verschieden geformt sein kann. Daran hängt ein Magenstiel mit einer Mundöffnung am unteren Ende. In ihm verdaut und der am unteren Ende eine Mundöffnung aufweist. Quallen bestehen vor allem aus zwei dünnen Gewebsschichten, der Außenhaut und der Auskleidung des Magens (Innenhaut). Dazwischen befindet sich eine wässrige Gelschicht. Quallen gibt es in vielen Größen von unter 1 cm bis mehrere Meter. Sie können sich über kurze Strecken durch Pumpbewegungen mittels Rückstoß fortbewegen. Ansonsten treiben sie mit den Meeresströmungen, gehören also zum Plankton.
Viele Quallen verfügen über Tentakel, manche über sogenannte Mundarme. In ihnen lagern die Nesselzellen. Werden Nesselzellen berührt, platzen sie und der ein Gift beinhaltende Nesselfaden wird freigesetzt. Bei manchen Arten wird zeitgleich ein Stachel mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen, um ein Loch in das Opfer zu schlagen, durch das das Gift leichter eindringen kann.
Auch für Menschen ist Quallengift oft spürbar. Meist nur durch leichte Hautreizung, bei einigen Arten aber durch schmerzhafte Verletzungen. Manche Quallen sind für den Menschen gefährlich. Einige Würfelquallen können mit ihrem Gift einen Menschen töten. Manche Quallarten, besonders der Tiefsee, erzeugen Biolumineszenz um Beute anzulocken oder Feinde abzulenken, indem sie einen







Abb. 23: Lebenszyklus der Quallen (Nesseltiere) vom Polyp zur Medusa.
† Bedenke, was du in Kapitel 4 gelernt hast! Weshalb brauchen Quallen kein Atemorgan und keinen Kreislauf? Formuliere eine schlüssige Erklärung!
Bei welchen Lebewesen hast du schon einen Wechsel von geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Vermehrung kennen gelernt?
Weshalb ist es deiner Meinung nach oft sehr schwierig, herauszufinden, welche Qualle zu welcher Art Polypen gehört und umgekehrt? †
Abb. 25: Nesselgift Verletzung

Haie leben in vielfältigen Lebensräumen von hellen Korallenriffen bis zur dunklen Tiefsee. Formuliere eine Annahme darüber, ob und wie sich der Lebensraum darauf auswirkt, wie gut Geruchs- und Sehsinn einer Haiart ausgeprägt sind! Begründe deine Annahme!
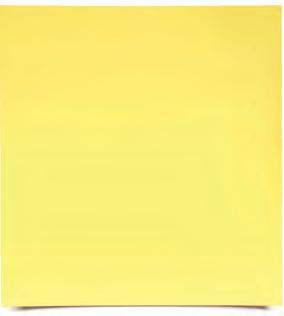
Haie – Zähne ohne Ende! Haifischzähne wachsen durchgehend in Reihen von hinten nach vorne nach. Die benutzten Zähne werden dabei regelmäßig ausgetauscht. Die Form der Zähne hängt von der Nahrung ab und reicht von nadelartig zum Packen über scharf und messerartig zum Schneiden bis hin zu flach zum Knacken von Krustentieren.

Haie und Rochen – Knorpel statt Knochen
Kopffüßer wie die Kalmare sind wie Hering und Thunfisch wichtige Nahrung für viele Haiarten. Die meisten Haie sind Raubtiere. Die verschiedenen Arten bewohnen alle Regionen der Meere. Haie zählen zu den Knorpelfischen. Ihr Skelett besteht aus Knorpel anstatt aus Knochen. Knorpel sind leichter als Knochen, was beim Auftrieb hilft. Knorpelfische verfügen über keine Schwimmblase. Sie nutzen Öl in ihrer Leber, das leichter als Wasser ist. Trotzdem müssen sie ständig in Bewegung bleiben, um nicht zu sinken.
Knorpelfische teilen viele Merkmale, die du bei den Knochenfischen schon kennengelernt hast. Den Unterschied in den Kiemen kennst du auch schon. Unterschiedlich ist auch der Aufbau der Schuppen. Die Schuppen der Knorpelfische haben kleine, nach hinten gerichtete zahnförmige Ausformungen. Die genaue Form hängt von der Fischart ab. Haie sind am ganzen Körper mit Zahnschuppen bedeckt, was ihrer Haut Festigkeit gibt. In größerer Ausformung wird aus ihnen das Haigebiss gebildet. Bei schnell schwimmenden Haien sorgt die Schuppenform mit kleinen Leisten für eine Verringerung des Strömungswiderstands.

Abb. 30: Haikiefer, vergleiche die Zahnreihen mit den Zahnschuppen.
Sieh dir die Färbung der Haie und deren Verlauf auf den Bildern an. Begründe, weshalb sie sich im Laufe der Evolution so entwickelt haben könnte!
Sieh dir die Bilder der Haie genau an! Welche Körpermerkmale erkennst du? Benennne sie! Skizziere hervorstechende Merkmale! Vergleiche mit dem, was du bisher über Fische gelernt hast! Notiere Gemeinsamkeiten und Unterschiede, beispielsweise der Schwanzflossen!
Haie sind nur sehr selten für Menschen gefährlich. Suche im Internet nach Bildern von Haien, vor allem Weißen Haien. Wie werden sie oft dargestellt? Diskutiert eure Gedanken in Teams!
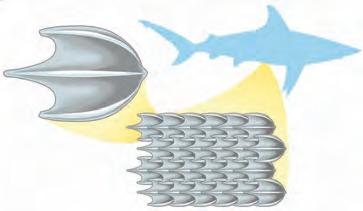
Haie sehen gut, auch im Dunklen, verfügen aber vor allem über Stäbchen. Deshalb sind sie wahrscheinlich farbenblind. Ihr Geruchssinn ist gut ausgebildet. Er erlaubt es ihnen, Beute über große Entfernungen zu wittern. Einige Haiarten legen Eier wie Knochenfische und Kopffüßer. Viele Haiarten sind jedoch lebendgebärend. Die Eier schlüpfen im Mutterleib und die Jungtiere entwickeln sich in der Gebärmutter.
Im offenen Meer leben vor allem große Haiarten – meist als Einzelgänger oder in kleinen Gruppen.
Blauhaie werden etwa drei bis vier Meter groß. Typisch ist die langgezogene Schnauze. Sie leben im offenen Wasser aller Meere. Sie ernähren sich von allem, was sie erbeuten können und sind selbst Nahrung größerer Haie.
Weiße Haie zählen zu den größten Haien. Sie werden etwa vier, manchmal bis zu sieben Meter lang. Sie sind in allen Meeren abseits der Polarregion beheimatet und suchen auch oft Küsten auf. Die Tiere ernähren sich durch aktive Jagd von Fischen, Kopffüßern und Robben, aber auch von Aas. Ihre einzigen Fressfeinde sind Schwertwale. Weiße Haie werden mit bis zu 70 Jahren recht alt.
Fuchshaie haben eine besondere Jagdstrategie entwickelt. Sie nutzen ihre lange Schwanzflosse um auf Schwarmfische einzudreschen. Die dabei betäubten oder getöteten Tiere sind leichte Beute. Auch Seevögel werden mit dieser Technik gejagt. Fuchshaie werden vier bis sechs Meter lang. Alle Haie, die du hier kennen gelernt hast, sind lebendgebärend.


Abb. 32: Weiße Haie stehen weit oben in der Nahrungskette. Sie haben ein unbegründetes Image als „Killer“.



Rochen
Die größten Haie sind keine Raubfische. Sie ernähren sich von Plankton. Der Riesenhai wird bis zu zehn Meter lang und zehn Tonnen schwer. Er schwimmt mit seinem großen, geöffneten Maul nahe der Wasseroberfläche und filtert Plankton mit seinen Kiemenreusen. Die Kiemenreusen werden im Abstand von ein paar Monaten abgeworfen und erneuert.
Walhaie sind mit bis zu 18 m Länge die größten bekannten Fische. Sie leben in warmen Meeresregionen und können über 100 Jahre alt werden.
Auch Walhaie filtern Plankton aus dem Wasser. Sie haben dazu schwammartige Filter vor den Kiemen, die sich wahrscheinlich aus den Kiemenreusen entwickelt haben. Die Tiere schwimmen mit offenem Maul – oder saugen Wasser durch Öffnen und Schließen des Maules aktiv ein.
Rochen sind Knorpelfische wie Haie. Sie sind flach geformt und tragen fünf Kiemenspalten an ihrer Bauchseite. An der Oberseite liegen Öffnungen, die Spritzlöcher, durch die Wasser zum Atmen eindringt. Die Brustflossen haben sich bei den meisten Rochen zu einer breiten, flügelartigen Form entwickelt. Damit führen sie wellenförmige Bewegungen aus, um sich fortzubewegen. Die Augen der Rochen sind an der Oberseite platziert, die Mundöffnung ist meist bauchseitig gelegen.

Die meisten Rochen leben in Bodennähe, nur wenige Arten im offenen Meer. Dazu zählt der Riesenmanta aus der Gattung der Teufelsrochen. Er ist mit einer Spannweite von bis zu sieben Metern der größte Vertreter der Rochen. Die Brustflossen sind dreiecksförmig und am Kopf befinden sich zwei kleinere Flossen wie Hörner, die der Gattung ihren Namen einbrachten. Die Schwimmbewegung der Teufelsrochen ähnelt mehr dem Flügelschlag eines Vogels und unterscheidet sich von der anderer Rochen.
Riesenmantas fressen als Filtrierer tierisches Plankton, das sie mit offenem Maul schwimmend einsammeln. Dazu leiten sie den Wasserstrom mit ihren Kopfflossen ins Maul. Den Großteil ihrer Nahrung machen größere Lebewesen aus, die sie in der Dämmerzone erbeuten. Riesenmantas leben vorwiegend in warmen bis gemäßigten Meeren und wandern weite Strecken. Dabei nutzen sie oft Meeresströmungen und finden sich an Stellen mit nährstoffreichem Auftrieb ein, wo Plankton reichlich gedeiht.
Wie könnte das Pumpen der Walhaie mit dem Mund funktionieren? Denke daran, was du im Kapitel über Kiemen gelernt hast!
Das Maul der Riesenmantas ist nach vorne und nicht wie bei den meisten Rochen nach unten hin ausgerichtet. Argumentiere weshalb diese evolutionäre Entwicklung für Riesenmantas von Vorteil ist!

Abb. 37: Filtrierender Riesenmanta. Achte auf die eingerollten Kopfflossen und den „Flügelschlag“.
Riesenmantas haben einen langen Lebenszyklus von etwa 50 Jahren. Nach der Befruchtung durch Paarung entwickelt sich meist ein einzelnes Ei im Weibchen. Die Jungtiere verbleiben auch nach dem Schlüpfen noch etwa ein Jahr im Muttertier bevor sie im flachen Küstenwasser ausgesetzt werden. Riesenmantas haben ein großes Gehirn und sind recht intelligent. Sie bestehen beispielsweise den Spiegeltest
Weshalb ist die langsame Fortpflanzung mit wenigen Jungtieren der Riesenrochen ein Problem, wenn die Tierbestände unter Druck geraten?
Weshalb ist langsame Fortpflanzung ein Nachteil, wenn sich die Bedingungen in einem Lebensraum ändern? Denke an die Entwicklung der Arten!
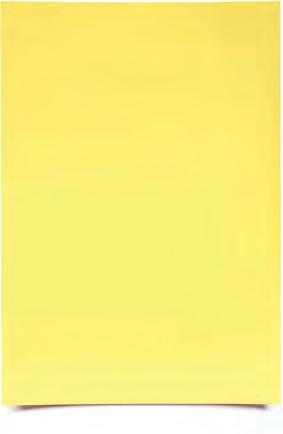

Kosmetikstudio für Fische! Riesenmantas besuchen ab und zu sogenannte Putzerstationen. Dort leben kleinere Lebewesen wie Putzerfische, Grundeln und Putzgarnelen, die sich von Hautschuppen und Parasiten, die große Meeresbewohner befallen haben, ernähren. Die Rochen verharren in einer Position und lassen sich von ihren Helfern reinigen. Tipp: Wenn du im Internet nach „Manta cleaning station“ suchst, findest du tolle Bilder und Videos. Spiegeltest, der: die meisten Lebewesen können sich nicht selbst im Spiegel erkennen. Sie denken, sie stehen einem Artgenossen gegenüber, der sich seltsam verhält. Das kann zu recht komischen Szenen führen. Menschenkinder erkennen sich selbst meist mit zwei oder drei Jahren zum ersten Mal. Sich selbst im Spiegel zu erkennen, wird als Hinweis auf ein Selbstbewusstsein bei Wesen gesehen und gilt als Zeichen von Intelligenz.
Bewohner des offenen Meeres! Welche vier Gruppen von Meeresbewohnern hast du jetzt schon kennen gelernt? Schreibe sie auf und notiere jeweils stichwortartig einige Eigenschaften!
Was gehört zusammen? Ordne die Begriffe den Tieren zu und verbinde die Felder mit den Bildern!
Filtrierer

Saugnäpfe

Nesselzellen

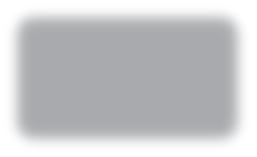








„Schwimmender Rochen“

„whaleshark feeding“
Schnabel

Knochenfisch

Zahnschuppen

Beobachte und Beschreibe! Suche im Internet Videos mit einem der Suchtexte! Tipp: Übersetze deine Suchtexte auch ins Englische, dann bekommst du meist mehr Resultate.

„Tintenfisch schlüpft aus dem Ei“
„Biolumineszenz Quallen“ „Fischschwarm“

Erinnere dich erst daran, was du über das Thema schon gelernt hast, um darauf besonders zu achten! Sieh dir mehrere Videos genau an! Beschränke dich dabei auf Videos und Videoteile, die wirklich das zeigen, wonach du gesucht hast! Schreibe deine Beobachtungen auf und fertige Skizzen an! Vergleiche mit dem, was du bisher gelernt hast! Was erkennst du wieder, was ist neu? Besprecht eure Ergebnisse in Fünferteams!
Da stimmt was nicht! Tanja und Mehmet unterhalten sich über das Meer und seine Bewohner. Lies dir ihre Aussagen genau durch und beurteile, wo sie recht haben und wo sie etwas durcheinandergebracht haben! Stelle falsche Aussagen richtig und begründe deine Korrektur!

Tanja sagt „Heringe schwimmen immer im Schwarm. Dadurch haben sie es im kalten Wasser wärmer, das ist so wie wenn ich mich mit meiner Katze zusammen kuschle.“ Mehmet erwidert „Pfff du hast ja gar nicht aufgepasst, die machen das, damit sie sich schützen. Gemeinsam sind das viel mehr als ein Raubfisch und dann können sie es dem so richtig zeigen!“. „Ich weiß auch, wie Kalmare schwimmen.“ fährt er fort. „Die schlagen mit ihren Armen hin und her und weil sie so viele haben, können die total schnell werden.“ Tanja runzelt die Stirn „Du meinst wie Aale schwimmen, mit so schlängelnden Bewegungen, nur pro Arm?“.
„Ja genau!“ sagt Mehmet „Und weißt du was noch cool ist? Wenn Haie einen Zahn verlieren, macht das gar nichts, da wächst einfach ein neuer aus dem Kieferknochen nach.“. Tanja nickt hört sich praktisch an. Ich frage mich ja, ob das nicht total anstrengend ist, wenn Blauhaimamas ihre vielen Eier ablegen müssen. Im Vergleich zum Hering müssen die Eier ja echt groß sein.“

Du weißt schon, dass sich im Laufe der Evolution Landtiere aus den Tieren des Meeres entwickelt haben. Es kann aber auch das Umgekehrte passieren. Vor allem wenn starke Veränderungen eines Lebensraums seine Bewohner zu Anpassungen zwingen. So auch bei den Walen. Wale sind Säugetiere, die an das Leben im Meer angepasst sind. Sie verfügen über Lungen und müssen zum Atmen an die Wasseroberfläche.
Wale werden in zwei Gruppen geteilt. Die sich als Filtrierer ernährenden Bartenwale und räuberisch lebende Zahnwale. Beide haben langgezogene Körper. Die Vorderbeine haben sich zu Flossen, Flipper genannt, entwickelt. Manche Wale verfügen auch über eine Finne genannte Rückenflosse. Flipper und Finne dienen der Stabilisierung und Steuerung im Wasser. Am Schwanzende hat sich bei Walen eine große Schwanzflosse ausgebildet, die Fluke. Sie steht waagrecht und ermöglicht durch Auf- und Abschlagen die Fortbewegung. Hinterbeine fehlen den Walen vollständig und auch andere vom Körper abstehende Teile haben sich zurückgebildet.




Lies im Buch der ersten Klasse über die Entwicklung der Wale nach! In welcher Ära und Periode der Erdgeschichte war das? Mit welchen heutigen Tieren sind sie verwandt?
Was zeichnet Säugetiere aus? Leite daraus eine Beschreibung der Fortpflanzung und Brutpflege der Wale ab!
Die Nasenlöcher sind an die Kopfoberseite gewandert und bilden das Blasloch, durch das Wale an der Wasseroberfläche atmen. Wale haben eine dicke Fettschicht zur Wärmeisolation und um eine glatte Körperoberfläche zu erreichen. Bei großen Arten kann diese bis zu 50 cm dick sein. Die Knochen des Walskeletts sind weniger dicht aufgebaut als die der Landwirbeltiere, da das Wasser einen Teil der Stützfunktion des Körpers übernimmt. Teilweise sind auch Knochenelemente durch Knorpel ersetzt. Das reduziert das Gewicht der Tiere und verbessert den Auftrieb.
Wale sind intelligent und viele Arten gesellige Tiere. Sie leben in Schulen genannten Gruppen mit fester Rangordnung bzw. bilden Gruppen zur Jagd. Wale tauschen sich durch Berührungen und Töne aus. Walgesänge kann man unter Wasser sehr weit hören und die Tiere koordinieren dadurch ihr Verhalten, beispielsweise bei der Paarung und der Jagd. Wale bringen einzelne Junge zu Welt, die Tragezeit beträgt ein Jahr.
Bartenwale verdanken ihren Namen den Barten – borstigen Hornplatten, die sie anstelle von Zähnen tragen. Damit filtern sie tierisches Plankton aus dem Wasser. Sie nehmen mit offenem Maul große Wassermengen auf und pressen sie mit der Zunge durch die Barten nach außen. Form und Größe der Barten sind von Walart zu Walart verschieden. Neben Plankton fressen manche Bartenwale auch Fische, vor allem Schwarmfische, nach denen sie mit ihrem großen Maul schnappen. Dafür haben einige Wale ausgeklügelte Jagdstrategien in Gruppen entwickelt.

Vergleiche die Flossen der Wale mit denen der Fische! Was ist gleich, was ist anders? Wie sieht es mit der Fortbewegung aus? Sieh dir Abb. 2 auf Seite 75 deines Buches aus der ersten Klasse an!

Abb. 2: Jede Fluke sieht einzigartig aus. Dadurch können Wale wiedererkannt werden.
Erstelle eine Hypothese, weshalb Wale keine Hinterbeinreste und abstehende Körperteile haben! Formuliere eine Begründung für deine Hypothese! Was hat der langgestreckte Körper und die Fettschicht damit zu tun?
Argumentiere, weshalb es praktisch ist, dass sich die Atemöffnung der Wale an der Körperoberseite befindet!
Erörtere, weshalb es für Wale lebensbedrohlich ist, wenn sie an Land geschwemmt werden! Denke dabei daran, dass Lungen sich zum Atmen ausdehnen müssen!

Suche online nach „Blasenfalle“, „Blasenjagd“ oder „Blasennetz“ kombiniert mit „Buckelwal“! Du wirst sehen, wie geschickt und einfallsreich Wale sein können!
Suche online nach den Gesängen von Buckel- und Blauwalen und höre sie dir an!
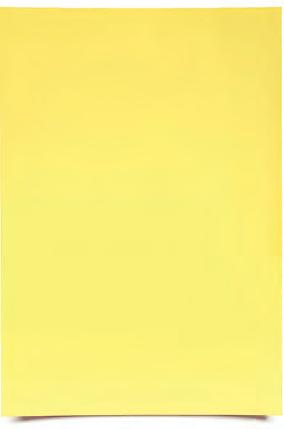

Das Springen der Wale! Wale werden oft bei Sprüngen aus dem Wasser beobachtet. Auch die sehr großen Arten sind dazu in der Lage, tun dies aber seltener. Das Verhalten wird oft als Spielverhalten gedeutet. Neuere Forschung deutet darauf hin, dass Sprünge und die dadurch im Wasser entstehenden Geräusche auch als Form der Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Eine weitere Interpretation ist das Loswerden von Parasiten auf der Haut.

Abb. 8: Buckelwale springen besonders häufig.
Recherchiere Bilder zu anderen Bartenwalarten. Vergleiche sie mit denen von Blau- und Buckelwal! Finde und beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede! Gibt es auffällige Merkmale? Fertige Skizzen an!
Wiederhole, was du in der zweiten Klasse in Physik zur Schallausbreitung gelernt hast! Formuliere eine schlüssige Beschreibung der Echolotortung!
Betrachtet in Zweierteams das Kladogramm aus dem Jahr 2020 zu Walen auf Wikipedia! Übertragt es in euer Heft und findet für jede benannte Verzweigung zwei Merkmale! Notiert diese!
Buckelwale
Buckelwale sind Bartenwale und gehören wegen der Furchen an Kehle und Brust zu den Furchenwalen. Mit etwa 13 m Länge sind sie eher kleine Bartenwale. Ihr Name stammt vom typischen Buckel, den sie beim Abtauchen machen. Buckelwale leben im Sommer in den polaren Meeren und wandern im Winter zur Fortpflanzung in wärmere Gewässer. Da sie sich gerne in Küstennähe und flachem Wasser aufhalten, sind sie leicht zu beobachten. Buckelwale leben meist als Einzelgänger, bilden aber zur Paarung und Jagd Gruppen. Dabei stimmen sie sich eng ab und erlernen neue Jagdstrategien.
Buckelwale sind bekannt für ihre Gesänge, die zu den vielseitigsten im Tierreich zählen. Die Tonfolgen sind mit Themen und Strophen ähnlich aufgebaut wie menschliche Lieder. Der Gesang ist wichtiger Teil der Paarung, spielt jedoch generell zur Kommunikation, beispielsweise bei der Jagd ein Rolle.

Abb. 6: Buckelwale haben Falten entlang Kehle und Bauch. Erkennst du die Putzerfische?

Abb. 7: Blauwale sind die größten Tiere der heutigen Zeit. Beachte den Taucher als Maßstab.
Auch Blauwale zählen zu den Furchenwalen und mit bis zu 33 Metern Länge und 200 Tonnen Körpergewicht zu den größten Tieren, die je gelebt haben. Sie wandern weite Strecken, kommen aber nur selten in Küstennähe. Die Sommermonate verbringen die einzelgängerischen Tiere in polaren Regionen, wo sie am Tag bis zu dreieinhalb Tonnen Krill vertilgen. Bei ihren Tauchgängen zur Nahrungssuche tauchen Blauwale meist bis etwa 100 m, vereinzelt bis 500 m tief. Sie können dabei 15 bis 20 Minuten unter Wasser bleiben, was typische Tauchlängen für viele Bartwale sind.
Zahnwale tragen im Unterschied zu Bartenwalen Zähne, die sie zur Jagd auf andere Meeresbewohner nutzen. Zahnwale sind meist kleiner als Bartenwale, weisen stark stromlinienförmige Körper auf und sind schnelle Schwimmer. Trotz der vergleichsweise kleinen Augen verfügen Zahnwale über ein gutes Sehvermögen
Blasloch
Stimmorgan
Melone
Oberkiefer
Gehör Unterkiefer
Zur Orientierung und um Beute ausfindig zu machen, hat sich in Zahnwalen ein weiteres Organ entwickelt. Sie tragen einen Sack aus fettreichem Gewebe an der Stirnseite ihres Schädels, die Melone. Die Melone bündelt den von den Tieren erzeugten Schall. Zahnwale erzeugen schnelle Serien von Klicklauten, deren Schall sich nach vorne ausbreitet. Von Hindernissen zurückgeworfener Schall wird über den Unterkiefer an das Ohr weitergeleitet und im Gehirn zu Informationen über Art und Position des Hindernisses verarbeitet. So können Zahnwale per Schall Gegenstände sehr genau orten. Man nennt das Echoortung, oder Biosonar.
AUSGESENDETER SCHALL
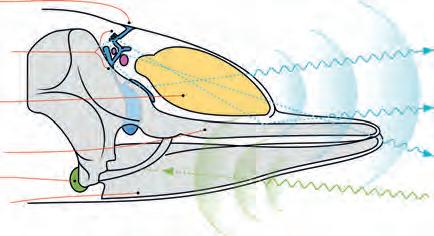
EINGEHENDER SCHALL
Abb. 9: Melone eines Delfines, Querschnitt durch den Schädel. Der Ausgehende Schall dient über die Reflektionen der Ortung.
Delfine – Großer Tümmler
Delfine sind eine Familie der Zahnwale, die viele Arten umfasst. Eine davon ist der Große Tümmler. Große Tümmler werden bis zu vier Meter lang und haben eine für Delfine kurze Schnauze. Typisch ist die sichelförmige Finne. Sie kommen in allen Ozeanen vor. Aufgrund des Nahrungsangebotes halten sich Große Tümmler gerne in Küstennähe auf, wo sie Fische und Kalmare mit ihren spitzen Zähnen packen. Sie schwimmen auch in flache Gewässer und kommen nahe an Strände.

Wie alle Delfine sind Große Tümmler sehr intelligente und soziale Tiere. Sie leben in sogenannten Schulen aus bis zu 15 Tieren zusammen, deren Mitglieder mit der Zeit wechseln. Mittels Pfeiflauten kommunizieren sie untereinander. Dabei ist jedes Tier durch seinen eigenen Pfeiflaut erkennbar und wird damit auch angesprochen, hat also einen Namen. Große Tümmler scheinen sich über ihr Befinden auszutauschen, rufen einander zu Hilfe und trauern um tote Gruppenmitglieder.
Schwertwal – auch ein Delfin

Der Schwertwal, auch Orca genannt, ist mit bis zu neun Metern Länge die größte Delfinart. Typisch ist seine schwarz weiße Färbung. Er ist in gemäßigten und polaren Meeren beheimatet und häufig nahe der Küste zu finden. Die Tiere leben in Gruppen aus bis zu 70 Tieren. Schwertwale spezialisieren sich auf bestimmte Beutetiere und entwickeln dafür Jagdstrategien. Alle nicht zu kleinen Arten von Meeresbewohnern, auch Meeressäuger wie Robben und andere Wale sowie Meeresvögel und Haie werden von ihnen erlegt. Die Tiere arbeiten dabei eng zusammen und nutzen verschiedene Laute, um sich gezielt abzustimmen. Eine Jagdstrategie für Haie ist beispielsweise, diese auf den Rücken zu drehen. Manche Haiarten verfallen dadurch in eine Starre und sind einfache Beute.
In Wasserzoos werden meist Große Tümmler gehalten. Finde Argumente, die für und gegen die Haltung dieser Tiere sprechen! Informiere dich dazu im Internet über die Bedingungen, unter denen sie leben! Erstellt anschließend in Gruppen Regeln für einen fairen und verantwortungsvollen Umgang mit Delfinen!
Recherchiert in der Klasse zum Sozialverhalten von Delfinen. Beispielsweise hier:

Vergleicht es mit dem des Menschen, kommt dir etwas bekannt vor? Gestaltet gemeinsam ein Plakat!
Spieltrieb!
Der Pottwal ist mit über 20 Metern Länge der größte Zahnwahl. Typisches Merkmal ist der große, nahezu rechteckige Kopf mit vergleichsweise schmalem Unterkiefer. Ein großer Teil des Kopfes wird von der Melone gebildet. Männliche Pottwale durchstreifen alle Ozeane bis in die Polregionen. Weibchen und Jungtiere verbleiben in tropischen und subtropischen Gewässern. Pottwale ernähren sich neben Fisch vor allem von Tintenfischen, die sie in großer Tiefe jagen. Sie dringen dabei in Tiefen von 1000 m, vereinzelt bis zu 3000 m vor. Dort treffen sie auf ihre liebste Beute, den Riesenkalmar.


Unterkiefer


Delfine sind neugierig und weisen einen deutlichen Spieltrieb auf. Beispielsweise wurde beobachtet, wie sie unter Wasser Luftringe erzeugen und anschließend zerbeißen. Delfine vollführen oft akrobatische Sprünge, was als Spielverhalten interpretiert wird. Delfine reiten auch auf den Wellen von Schiffen, was aber wohl einer energiesparenden Fortbewegung dient. Gehaltene Delfine sind in der Lage, auch kompliziertere Tricks und Kunststücke zu lernen.
Die Melone des Pottwals ist sehr groß und kann mehrere Tonnen wiegen. Formuliere eine Forschungsfrage und eine passende Hypothese zu dem, was du über die Melone gelernt hast!
wachsartige Substanz

Bildbeschreibungen! Beim Schreiben eines Biobuches ist bei den Bildbeschreibungen etwas schief gegangen. Schaue dir die Bilder und Texte darunter gut an! Wo liegen die Fehler? Versuche richtige Beschreibungen zu finden! Wie könnten passendere Bilder aussehen?


Waleier sind recht groß. Man kann die Embryonen leicht mit freiem Auge erkennen.



Delfine sind scheue Einzelgängen, die sehr schwer zu beobachten sind.


Der Schädel des Buckelwals weist auf seine Ernährung hin.






















Meine Erklärung:













Im Kopf des Pottwals befindet sich ein großer Luftsack (gelb). Deswegen die rechteckige Form. Darin speichert er Luft für seine Tauchgänge, die in über 1000 m Tiefe führen.
Wie kommt denn das? Beluga- oder Weißwale fallen durch ihre helle Hautfärbung auf. Narwale vor allem durch ihren eindrucksvollen Stoßzahn. Beide Wale gehören zu den Gründelwalen und sind Zahnwale.


Sieh dir die Stirnpartie der beiden Wale in den Bildern an! Denke daran, was du gelernt hast! Formuliere eine Erklärung dafür, was dir an den Stirnpartien auffällt!

Sterben Wale, so sinken ihre Körper auf den Meeresgrund, wo sie lange Zeit verbleiben, bis sie zersetzt werden.
Die großen Zusammenhänge! Verknüpfe die Textbausteine und formuliere daraus einen Text, der die Zusammenhänge erklärt!

Durch Jagd, Verschmutzung der Meere und Veränderung der Lebensbedingungen gehen die Walpopulationen zurück.

Tierisches Plankton ernährt sich von pflanzlichem Plankton und nimmt die Stoffe darin in sich auf.

Ein wesentlicher Grund für den Klimawandel ist, dass mehr CO2 freigesetzt als gespeichert wird.

Die großen Bartenwale werden bis zu 100 Jahre alt.

Pflanzliches Plankton betreibt Fotosynthese und bindet CO2

Bartenwale vertilgen jeden Tag große Mengen an Nahrung wandeln sie in Körpermasse um.
Das Schelf ist der flache Meeresbereich vor der Küste, bevor die Kontinentalplatte am Kontinentalhang abfällt. Je nach Form der Kontinentalplatte ist es ein schmaler Streifen oder ausgedehnt. Das Schelf entsteht durch Ablagerungen von Sedimenten im Übergangsbereich zwischen Land und Meer. Daher ist der Boden meist weich schlammig bis sandig, seltener felsig. Durch Meeresströmungen aus den Tiefen und durch Flüsse werden Schelfmeere meist reich mit Nährstoffen versorgt. Es herrschen gute Bedingungen für Algen.
Durch die geringen Wassertiefen dringt Licht bis zum Meeresboden vor. Algen können daher nicht nur in mikroskopischer Form als Plankton frei schwebend, sondern auch am Boden groß wachsend vorkommen. Groß wachsende Algen nennt man auch Seetang. Er kann von wenigen Millimetern, dann sieht man ihn nur als Flaum auf Felsen oder anderen Strukturen wachsen, bis zu 60 m groß werden.

Abb. 1: Auf lockerem Boden kann sich kein Tang halten. Trotzdem gibt es Leben. Kannst du die Hinweise auf Tierbehausungen ausmachen?

Abb. 2: Auf festem Boden und an vor Strömungen geschützten Stellen wächst artenreiche Vegetation.
Welche Pflanzen, die du in der zweiten Klasse kennen gelernt hast, verfügen auch über Wurzelfäden, aber keine echten Wurzeln? Was denkst du, Verwandtschaft oder parallele Evolution?
Seetang bildet feine Wurzelfäden zur Verankerung im Boden, aber keine echten Wurzeln wie Gefäßpflanzen. Große Algen und andere sesshafte Organismen können nur in strömungsarmen Gewässern leben. Starke Strömung würde sie losreißen. Sandiger oder schlammiger Boden ist ungeeignet, da Wasserbewegungen ihn ständig umformen. Seetang benötigt kein verholztes Stützgewebe, da ihn das Wasser aufrecht hält. Manche Tangarten haben gasgefüllte Schwimmkörper, die sie tragen.
Seetang vermehrt sich wie Moose und Farne in zwei Generationen. Der sichtbare Tang bildet ungeschlechtlich Sporen, die mit der Strömung verbreitet werden. Sie setzen sich fest und wachsen zur geschlechtlichen Generation heran. Diese ist mikroskopisch klein und zeugt über Spermium und Eizelle die nächste Tanggeneration.
Große Seetang Arten wie der bis zu 60 m große Riesenseetang bilden Tang- oder Kelpwälder unter Wasser. Diese haben Höhenschichten wie Wälder an Land und sind ähnlich artenreich wie Regenwälder. Die große Menge an Algen (Plankton und Tang) bildet eine reichhaltige Grundlage für das Nahrungsnetz, sodass im Schelfmeer auch eine große Artenvielfalt an Tieren zu finden ist.

Schwimmkörper




Abb. 3: Tang kommt in verschiedensten Formen vor. Im Meer vor allem aus Braun- und Rotalgen. Manche Tangarten sind Delikatessen, wie der Mekabu (ganz links in) Japan.

Zuviel der Blüte!
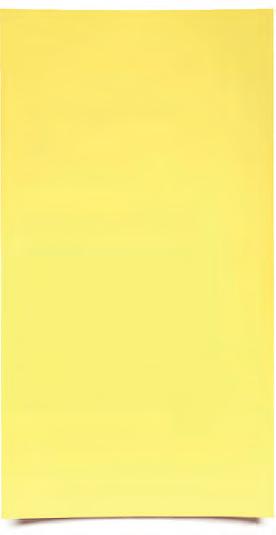

Nehmen Algenblüten überhand, können sie großen Schaden anrichten. Manche Algenarten produzieren Gifte, die vom tierischen Plankton aufgenommen werden und sich durch das Nahrungsnetz ausbreiten. Sie sind auch für Menschen gefährlich. Sterben viele Algen gleichzeitig ab, verbrauchen die Bakterien, die sie zersetzen, sehr viel Sauerstoff. Die Lebewesen in der Umgebung ersticken. Die Erwärmung der Meere sowie Düngemittel aus der Landwirtschaft, die von Flüssen ins Meer gespült werden, fördern Algenblüten zunehmend.
Erörtere, wieso auch noch lange nach einer Algenblüte große Meeresbewohner wie Wale oder Haie daran sterben!

Tangtaxi!
Loser Seetang treibt meist an der Wasseroberfläche. Verstrickt sich der Seetang, entstehen Seetangansammlungen. Auf ihnen können kleine Tiere mehrere tausend Kilometer weit über das Meer treiben und Arten sich verbreiten.

Tipp: Es gibt eine ganze Meeresregion, wo schwimmender Tang eine sehr wichtige Rolle spielt. Suche nach Sargassosee.
Scanne den QR-Code und sieh dir das Video zu Tangtaxis an!

porös: mit kleinen Öffnungen (Poren) versehen, durchlässig.
Detritus, der: hier –abgestorbene organische Materie am Meeresboden.
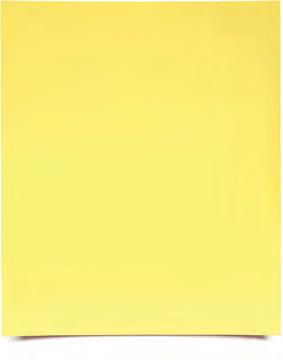

Schwämme im Haushalt! Das Skelett mancher Schwammarten ist sehr flexibel und kann zusammengedrückt werden, ohne zu brechen. Diese Schwämme werden schon seit langer Zeit als Badutensil und zum Putzen genutzt. Heute werden Haushaltsschwämme meist aus Kunststoff hergestellt. Für lange Zeit nutzten Menschen Schwämme auch als Wasserfilter.


9: Bobbitwürmer werden bis zu 3 m lang und fangen auch Fische.

Abb. 10: Schlangensterne (rötlich) sind nahe Verwandte der Seesterne.

11:

Abb. 12: Die Stachelform der Seeigel ist sehr verschieden.
Schwämme sind einfach aufgebaute, meist sesshafte Tiere. Sie bestehen aus einer porösen Außenschicht über einem Skelett und einer Innenschicht mit Geißeln. Diese erzeugen einen Wasserstrom durch ein System aus Kanälen zu einem zentralen Hohlraum. In ihm werden eingespültes Plankton, selten auch Tiere verdaut. Über eine Öffnung an der Oberseite strömt das Wasser aus. Schwämme filtern viele Schweb- und Schmutzstoffe aus dem Wasser. Sie sind bis in die Tiefsee verbreitet.











Abb. 5: Schwämme wachsen in sehr unterschiedlichen Formen, Farben und Größen.
Vielborster tragen zahlreiche Borsten zur Fortbewegung und als Stützelemente. Manche Borstenwürmer leben sesshaft in selbst gebauten Kalk- oder Sedimentröhren Mit Tentakeln filtern sie Plankton aus dem Wasser oder packen Beute. Andere bewegen sich frei im und am Meeresboden und ernähren sich als Jäger oder Destruenten




Stachelhäuter gibt es in vielen Formen. Sie verfügen über ein Kalkskelett mit beweglich verbundenen Stacheln. Sie tragen kleine, hydraulisch bewegte Saugfüßchen. Diese dienen der Fortbewegung und Nahrungszufuhr zum an der Unterseite gelegenen Mund. Die Fortpflanzung erfolgt meist über ins Wasser abgegebene Samen- und Eizellen und zwei Larvenstadien. Die meisten Stachelhäuter können Körperteile nachwachsen lassen. So vermehren sie sich auch ungeschlechtlich.
Seesterne zeigen die typische fünfzählige Symmetrie der Stachelhäuter am deutlichsten. Die Stacheln sind oft zurückgebildet. Seesterne ernähren sich je nach Art räuberisch, von Aas und Detritus oder Algen. Sie werden zwischen 1 cm und 1 m groß. Seeigel sind meist rund. Ihre Stacheln sind ausgeprägt und häufig recht lang. Manche Arten tragen Gift in ihnen. Seeigel ernähren sich meist von Seetang oder Aas und können ganze Algenfelder leer fressen. Sie werden zwischen 3 cm und 10 cm groß.



Seesterne zeigen sehr schön die fünfzählige Symmetrie.
Stamm der Nesseltiere
Du hast mit den Quallen schon Nesseltiere kennengelernt und erfahren, dass sie als Medusa und Polyp vorkommen. Viele Nesseltiere haben keine Medusenform, sondern leben sesshaft als Polypen am Meeresboden. Sie werden Blumentiere genannt. Polypen sind im Wesentlichen sackförmig mit Außen- und Innenhaut und Tentakeln ähnlich den Quallen, bilden aber innen Muskeln aus, um die Tentakel einzuziehen. Sie sind mit einer Fußscheibe am Boden verankert. Manche bilden ein kelchartiges Skelett aus. Die Tentakel tragen Nesselzellen, die dem Beutefang und der Verteidigung dienen. Je nach Größe des Polypen sind tierisches Plankton, Würmer und Krebse oder Fische Beutetiere.


Abb. 15: Seeanemonen sind als Einzeltiere lebende Blumentiere.
Stamm der Weichtiere – Muscheln und Schnecken
Falls du schon am Meer warst, hast du sicher Muscheln oder Muschelschalen gesehen. Die zweiteilige Kalkschale schützt den Weichkörper der Muschel und kann von zwei Schließmuskeln fest verschlossen werden. Muscheln haben einen Fuß zur Fortbewegung. Sie ernähren sich meist von Plankton, das sie mit ihren Kiemen aus dem Wasser filtern. Manche Muscheln leben eingegraben im Meeresboden. Sie bilden einen Schnorchel (Siphon) aus, um Wasser einzusaugen und auszustoßen. Miesmuscheln leben an Stellen starker Strömung, etwa wo die Gezeiten für Wasserbewegung sorgen. Sie verankern sich mit Haftfäden fest am Untergrund. Kammmuscheln erkennt man an ihrer Gehäuseform. Sie besitzen kleine Punktaugen und können durch schnelles Schließen der Schalen einen Wasserstrahl zur Fortbewegung ausstoßen.

Abb. 17: Sandklaffmuschel mit Siphon (Schnorchel).

Abb. 18: Miesmuscheln findest du meist in großen Gruppen. In Gezeitenzonen sind sie bei Ebbe auch außerhalb des Wassers.

Abb. 19: Jakobsmuscheln haben als Kammmuscheln Punktaugen. Ihre Schale trägt die charakteristischen Längsfurchen.
Meeresschnecken treten als Nackt- oder Gehäuseschnecken auf. Sie kommen in einer Vielzahl an Formen und Farben vor. Meeresschnecken leben im und auf dem Meeresboden und einige Arten sind bis in die Tiefsee verbreitet. Sie können beachtliche Größen erreichen und ernähren sich häufig räuberisch. Die Kegelschnecke verfügt über eine Harpune, mit der sie ihre Beute lähmt oder tötet. Das Tritonshorn ist mit bis zu 50 cm eine der größten Schnecken. Die Flamingozunge verspeist Weichkorallen.
Tentakel Muskel
Magenhöhle
Abb. 16: Aufbau eines Blumentiers.

Abb. 21: Kegelschnecken verbringen den Tag im Boden verborgen.

Abb. 22: Dieses Tritonshorn macht sich gerade über einen Dornenkronen Seestern her.

Abb. 23 Eine Flamingozunge knabbert an einer Weichkoralle. Siehst du den Siphon?

Fußscheibe
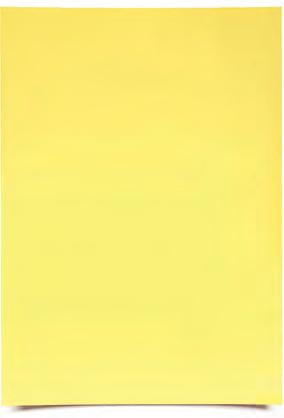
Wertvoll auf dreierlei Art! Austern sind als Delikatessen bekannt und werden gerne verspeist. Sie bilden Perlen, runde Gebilde im Weichkörper aus dem Innenmaterial der Schale, dem Perlmutt. Perlen werden seit jeher für die Schmuckherstellung geschätzt. Austern sind sehr gut darin, Wasser zu filtern und Schadstoffe zu entfernen. Sie werden gezielt zur Reinigung von Gewässern verwendet und sind bei Naturschutzprojekten im Einsatz.




Abb. 20: Pazifische Auster. Geöffnet kannst du gut den Weichkörper und die Öffnung ins Innere sehen (Mitte). Manchmal bilden sich in der Muschel Perlen (unten).

Meeresrauschen!
Oft heißt es, wenn du dir eine Meeresschneckenschale ans Ohr hältst, kannst du das Meer rauschen hören. Tatsächlich hörst du dein eigenes Blut fließen. Das Schneckenhaus wirft den Schall zurück, sodass du ihn hören kannst.


Abb. 28: Riffkalmar
Vergleiche den Körperbau der Kalmare mit dem der Sepien! Fertige eine Skizze an! Was lässt sich daraus über die Fortbewegung im Wasser schließen?

Abb. 29: Zur Flucht nutzen Sepien ihren Trichter und das Rückstoßprinzip.

Das Farbspiel der Kraken! Kraken können die Farbgestaltung ihrer Haut ändern. Sie nutzen dies zur Tarnung, wobei sie mittels Muskeln auch die Oberflächenstruktur ihrer Haut anpassen. Kraken kommunizieren mittels Farben, etwa bei Revierstreitigkeiten oder um Partner zu finden. Der Große Blaugeringelte Kraken lässt ringförmige Muster als Warnung pulsieren. Forschungen zeigen, dass Kraken träumen und sich dabei Farbwechsel ergeben.
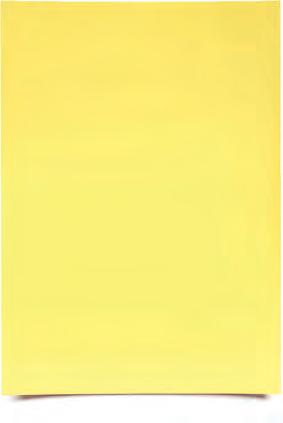
Suche im Internet nach Videos zu den Begriffen Oktopus, Kraken, Farbwechsel, tarnen!
Erstelle eine Hypothese, wie die Kammern des Nautilus seinen Auftrieb regeln könnten!

Im Schelf leben viele, meist kleinere Kalmare wie der Riffkalmar. Nahe Verwandte der Kalmare sind die Echten Tintenfische oder Sepien. Auch sie tragen zehn Arme, acht kürzer und zwei, meist eingerollte Tentakel. Der Körper der Sepien ist rundlicher als der der Kalmare und bis zu 50 cm lang. Die meiste Zeit bewegen sie sich in Bodennähe. Ihre um den Körper verlaufenden Flossen dienen mit wellenartigen Bewegungen als Antrieb. Der Schulp der Sepien ist anders aufgebaut als beim Kalmar. Er besteht aus porösem Kalk mit vielen kleinen gasgefüllten Kammern. Dadurch erhalten die Tiere ihren Auftrieb


Kraken sind achtarmige Tintenfische mit sackartigem Körper. Die meisten Arten sind Oktopusse. Ihr Schulp hat sich im Lauf der Evolution zurückgebildet und sie besitzen kein Innenskelett. Daher sind sie sehr verformbar und können sich durch enge Öffnungen zwängen. Kraken verfügen über hoch entwickelte Linsenaugen und orientieren sich vor allem über den Sehsinn. Die von vielen Nerven durchzogenen Arme und Saugnäpfe können sich unabhängig vom Gehirn bewegen, tasten, schmecken, Farbe wahrnehmen und sind geschickte Werkzeuge. Kraken bewegen sich meist mit Hilfe ihrer Arme am Meeresboden fort, nutzen aber zur Flucht ihr Trichterorgan. Sie werden wenige Zentimeter bis zwei Meter groß. Die meisten Kraken jagen andere Weichtiere, die sie mit ihren Armen aus Spalten und Korallenhöhlen holen. Kraken sind sehr intelligent und lernfähig. Ihre Fähigkeit zur Problemlösung ist hoch entwickelt. Sie können etwa Schraubgläser öffnen und bewältigen LabyrinthAufgaben schneller als die meisten Säugetiere.
Perlboote
Sepien sind Lauerjäger. Sie tarnen sich durch Farbänderungen, womit sie auch kommunizieren. Sie haben einen Tintensack, mit dem sie Feinde ablenken und graben sich bei Gefahr rasch in den Boden. Eine Besonderheit sind die w-förmigen Pupillen. Mit ihnen können Sepien gleichzeitig nach vorne und nach hinten sehen.


Abb. 26: Kraken haben einen sackförmigen Körper (a). Ihre Saugnäpfe (b) sind Sinnesorgane.

Abb. 27: Erkennst du den Kraken? Finde Auge, Trichter und Saugnäpfe!
Perlboote haben wie Pfeilschwanzkrebse ihre ursprüngliche Form behalten, wie Fossilienfunde belegen. Man nimmt an, dass ihre Merkmale denen der Vorfahren aller heutiger Kopffüßer entsprechen. Auffälligstes Merkmal ist die spiralförmige, innen gekammerte Schale. Mit den Kammern regeln die Tiere ihren Auftrieb. Aus der Schale ragt der Kopf mit bis zu 45 Armen und das Trichterorgan, das wie bei den Tintenfischen der Atmung und Fortbewegung dient. Perlboote leben an Riffabhängen bis 500 m Tiefe und ernähren sich vor allem von Krebsen und Aas.

Abb. 31: Nautilus – ein Perlboot. Siehe auch Abb. 6 im Kapitel Kiemen.
Stamm der Gliederfüßer – Krebstiere
Neben den Krebstieren des tierischen Planktons leben noch eine Vielzahl anderer Krebstiere im Meer.
Hummer

Hummer sind Zehnfußkrebse. Sie haben fünf Beinpaare, wovon die ersten drei Scheren tragen. Das erste mit einer großen Knackschere, um Schalen von Beutetieren zu knacken und einer kleineren Greifschere. Die restlichen Scheren sind deutlich kleiner. Ihr Körper steckt in einer harten Schale. Die Antennen am Kopf dienen zum Fühlen und Schmecken. Hummer werden 30 cm bis 60 cm groß. Sie bevorzugen felsigen Meeresboden und jagen Weichtiere, Stachelhäuter und Borstenwürmer. Zur Fortpflanzung werfen die Weibchen den Panzer ab. Das Männchen übergibt ein Samenpaket, das die Eier erst später befruchtet. Das Weibchen trägt die Eier bis zu elf Monate unter dem Panzer. Die geschlüpften Hummerlarven zählen zum Plankton. Hummer häuten sich beim Wachsen und wachsen, wenn auch immer langsamer, ein Leben lang.
Langusten
Langusten bewohnen felsige Küstenregionen wo sie in Nischen und Höhlen im Fels Schutz finden. Sie sehen Hummern ähnlich, haben aber keine Scheren. Sie tragen lange, starke Antennen, mit denen sie sich verteidigen und durch Aneinanderreiben Schall erzeugen. Langusten werden 20 cm bis 50 cm groß und ernähren sich von Beutetieren wie Schnecken, Muscheln und Seesternen oder Aas.
Einsiedlerkrebs


Abb. 34: Rote Einsiedlerkrabbe in Schneckenhaus (links). Suche die für viele Krebstiere typischen Stielaugen! Manchmal wird menschlicher Abfall zu einer Behausung umfunktioniert (rechts).
Krabben

Abb. 32: Amerikanische Hummer (a) sind bunter als die an der Oberseite meist dunklen europäischen (b). Beachte die Scherenpaare.


Begehrte Leckerbissen! Hummer und Langusten sind vor allem in Ländern am Meer beliebte Speisen. Sie zählen zu den sogenannten Meeresfrüchten, womit essbare wirbellose Meerestiere gemeint sind. Durch das Kochen erhalten Hummer und Langusten die charakteristisch rote Farbe, in der sie oft abgebildet werden.


Abb. 33: Gewöhnliche Languste, sie trägt keine Scheren.
Der Hinterleib der Einsiedlerkrebse wird nicht durch eine Schale geschützt. Daher verbergen sie ihren Hinterleib in leeren Schneckenhäusern und ähnlichen verwaisten Tierbehausungen, teilweise auch in Müll. Im Laufe des Lebens müssen sie immer wieder eine neue Behausung suchen, wenn die alte zu klein wird.
Krabbenkörper sind rund bis oval. Das vorderste Beinpaar ist zu Scheren ausgeformt, die bei manchen Arten ungleich groß sind. Die Scheren dienen als Greifwerkzeuge, zum Beutefang, und für Rivalitätskämpfe. Viele Krabben können lange im Trockenen bleiben und leben teilweise an Land. Daher sind sie oft in Ufernähe zu finden. Krabben sind größtenteils Fleischfresser.
Pfeilschwanzkrebse sind lebende Fossilien. Ihre Art lässt sich durch Fossilienfunde bis zu 400 Millionen Jahre zurück verfolgen und war früher weit verbreitet. Sie leben an flachen Sandküsten und ernähren sich von Muscheln und Weichtieren. Der pfeilförmige Schwanz dient der Flucht.

Abb. 35: Diese Gemeine Strandkrabbe macht sich über Venusmuscheln her.
Anemonentaxi!


Anemonen wachsen nicht nur auf dem Boden, sondern siedeln sich auch auf den Schalen von Tieren an. Einsiedlerkrebse werden so oft Taxis für Anemonen. Das kostet zwar beim Bewegen mehr Energie, aber die Nesseln der Anemonen halten auch manchen ungebetenen Gast fern.

Abb. 38: Anemonen auf einem Einsiedlerkrebs.

Krabbenplage!

Krabben werden immer wieder als Neophyten vom Menschen in neue Gebiete eingeschleppt. So etwa die blaue Schwimmkrabbe ins Mittelmeer. Sie hat dort bisher keine natürlichen Feinde, vermehrt sich rasch und bedroht die Aalund Muschelbestände.


Stamm der Wirbeltiere – Fische im Schelfmeer

Abb. 40: Makrele
Erkenne und benenne die Körperteile von Makrele und Dorsch!

Was kommt auf den Tisch? Makrele, Dorsch, Steinbutt, Heilbutt, Scholle, Flunder, verschiedene Rochen und einige andere sind wichtige Speisefische. Da sie nahe der Küste leben, waren sie seit jeher für den Menschen verfügbare Nahrungsquellen. Küstennahe Regionen bauen ihre Wirtschaft traditionell oft auf Fischfang auf. Durch die Überfischung und Verlagerung der Verbreitungsgebiete aufgrund der Meereserwärmung durch den Klimawandel ist die Fischerei aber vielenorts bedroht.
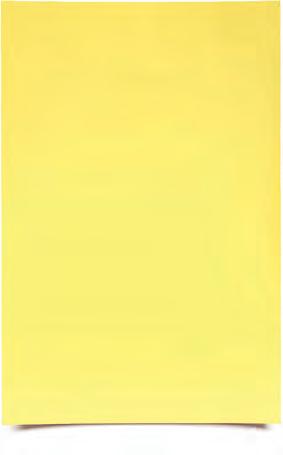
Finde Argumente, weshalb sich die Augen bei Plattfischen auf einer Körperseite befinden und weshalb sich die Oberseite farblich ändern kann!

Abb. 44: Finde die Flunder, Plattfische sind äußerst gut getarnt.

Abb. 45: Nagelrochen sind an Europas Küsten weit verbreitet. Formuliere und beantworte eine Forschungsfrage zum Vergleich des Katzenhais mit Blau- und Weißem Hai! Finde Bilder des Dornhais und binde ihn in deinen Vergleich ein!
Das Schelfmeer dient den sich durch Laichablage fortpflanzenden Arten des offenen Meeres als Kinderstube. Das große Nahrungsangebot und Versteckmöglichkeiten am Meeresboden und im Tang bieten gute Lebensbedingungen für Larven und Jungtiere. Daher bevölkern Knochenfische wie Hering, Thunfisch und Sardine das Schelf, wenn sie laichen. Makrelen leben in der Nähe der Schelfkante zum Kontinentalabhang. Sie ernähren sich von Plankton und den Larven dieser Fische.
Atlantische Dorsche, auch Atlantischer Kabeljau genannte, leben meist in Bodennähe. Vor allem die Jungtiere leben im flachen Wasser, während ausgewachsene Dorsche Tiefen von 200 m, teilweise aber auch mehr bevorzugen. Die Tiere ernähren sich von Krebstieren, Stachelhäutern, Borstenwürmern und Muscheln.

41: Atlantischer Dorsch
Manche Fische haben sich im Lauf der Evolution auf das Leben am Meeresboden spezialisiert. Sie sind seitlich abgeflacht, heißen daher Plattfische. Die Augen wandern während der Entwicklung des Jungtieres an eine Körperseite. Sie leben ab da seitlich am Grund liegend. Die obere Körperseite mit den Augen ist meist dunkler gefärbt und kann sich farblich an den Untergrund anpassen. Plattfische bewegen sich mittels Rücken- und Afterflosse, die am Körper entlang verlaufen. Plattfische werden etwa 50 cm lang und ernähren sich von wirbellosen Tieren, die im und am Meeresboden leben. Einige, wie der Heilbutt werden deutlich größer und erbeuten auch Fische.

Abb. 42: Schwimmende Flunder. Achte auf die Wirbel, hervorgerufen durch den Flossenschlag.
Abb. 43: Steinbutt am Meeresboden. Achte auf die Lage der Augen und Flossenform.

Auch Knorpelfische sind im Schelfmeer verbreitet. Vor allem Rochen haben sich an das Leben am Meeresgrund angepasst. Sie jagen Krebs- und Weichtiere, Stachelhäuter und kleine Fische. Die Rochen im Schelf erreichen Größen von etwa einem Meter. Die Art der Fortpflanzung variiert. Gewöhnliche Stechrochen sind lebendgebärend, während Nagelrochen, die häufigste Rochenart europäischer Meere, Eier ablegen.

Abb. 46: Stechrochen und Steinbutt treffen sich im Schelfmeer. Finde Ähnlichkeiten.

Abb. 47: Kleingefleckte Katzenhaie bewohnen den Meeresboden.
Einige Haie wie Dornhai und Schlingerhai, haben sich auf ein Leben im Schelfmeer und über der Kante des Kontinentalabhangs spezialisiert. Katzenhaie sind in Bodennähe lebende 50 cm bis 80 cm große Haie. Sie weisen einen lang gestreckten Körperbau und oft auffällige Färbungen auf.
Stamm der Wirbeltiere – Meeressäuger und Vögel
Verschiedene Walarten, insbesondere Zahnwale, sind häufig im flachen Wasser des Schelfmeeres anzutreffen. Vor allem dann, wenn sich ihre Beutetiere zum Laichen dorthin begeben oder Schwärme an Jungtieren ins offene Meer ziehen. Ein Beispiel sind Schwertund Buckelwale in den norwegischen Fjorden. Daneben gibt es weitere Meeressäuger, die an den Küsten an Land leben und im Meer jagen.
Robben


Vergleiche den Körperbau der Robben mit dem von Meeresbewohnern, die du bereits als gute Schwimmer kennengelernt hast!

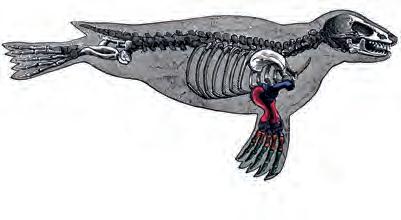
Menschlicher Arm zum Vergleich
Abb. 49: Robbenskelett, nur die unteren Gliedmaßen ragen aus dem Körper (Erkennst du die Homologie zum menschlichen Arm?). Vergleiche mit dem Bild darüber.


Abb. 50: Große Robbenaugen mit Kugellinse und verschlossene Nasenlöcher (links). Die Barthaare sind Tastorgane (rechts).
Robben sind sehr gut an das Leben im Meer angepasst. Ihr Körper ist stromlinienförmig und glatt. Der Schwanz ist nur im Ansatz vorhanden. Ihre Gliedmaßen ragen nur ab Ellenbogen und Knie aus dem Körper. Ihnen fehlen Ohrmuscheln. All das reduziert den Strömungswiderstand des Körpers. Ihr Gebiss ist für Fischfang angepasst. Es hat sich von der für landlebende Beutegreifer typischen Form mit langen Eckzähnen abgewandelt. Vorder- und Hinterbeine haben sich im Laufe der Evolution zu Flossen gewandelt, deren Zehen durch Schwimmhäute verbunden sind. Robben verfügen wie Wale über eine dicke Fettschicht, die ihnen Auftrieb verschafft und sie vor Kälte schützt. Die Nase ist zum Tauchen fest verschließbar.
Robbenaugen sind mit kugeligen Linsen an das Sehen unter Wasser angepasst. Dafür sind die Tiere an Land stark kurzsichtig. Ihre Barthaare sind empfindliche Tastorgane und nehmen Strömungen wahr. Wahrscheinlich spielen sie zum Einschätzen der eigenen Bewegung und Aufspüren von Beutetieren eine wichtige Rolle.
Robben holen zum Tauchen nicht tief Luft und halten sie an, wie man es vermuten würde. Das hängt mit der Taucherkrankheit zusammen. Stattdessen muss der Körper den Sauerstoff zum Tauchen speichern Robben haben dafür besonders viele rote Blutkörperchen und Hämoglobin und ihre Muskeln können Sauerstoff speichern.
Robben leben meist gesellig in Kolonien, besonders zur Aufzucht der Jungtiere. Sie kommunizieren durch Klicklaute und je nach Art durch verschiedene Lautäußerungen. Die Partnerwahl ist oft von heftigen Konkurrenzkämpfen unter den Männchen um Weibchen und Aufzuchtplätze geprägt. Männchen sind oft deutlich größer als Weibchen. Nach acht bis 15 Monaten Tragezeit wird meist ein einzelnes Junges geboren. Jungtiere tragen ein flauschiges Fell. Dieses war lange Zeit von Menschen sehr begehrt, sodass der gesamte Nachwuchs vieler Robbenkolonien getötet wurde.
Die Taucherkrankheit! Je höher der Umgebungsdruck ist, desto mehr Gase werden vom Blut aufgenommen. Je tiefer man also taucht, desto mehr Gas befindet sich im Blut. Taucht man auf, tritt das Gas wieder aus. Geschieht dies zu schnell, bilden sich Bläschen, so wie die Kohlensäure im Mineralwasser, wenn du es schüttelst. Diese Bläschen können den Blutfluss unterbrechen und wie Thrombosen zu schweren Schäden führen. Taucher, die zu schnell auftauchen, können dabei sterben. Robben umgehen dieses Problem, indem sie während des Tauchgangs ihre Lungen komplett leeren. Kein Gas in der Lunge bedeutet kein extra Gas im Blut und damit auch keine Taucherkrankheit.

Abb. 51: Kolonie aus Ohrenrobben (Pelzrobben). Robben sind gesellige Tiere und selten alleine.
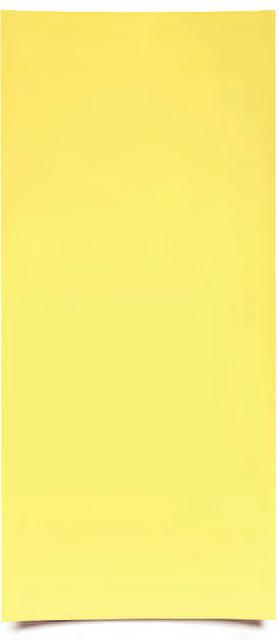
Suche im Internet nach Aufnahmen von Geräuschen von Robben! Schreibe eine Beschreibung zu drei Robbenarten! Versuche eine Einteilung nach Tier- und Lautart zu erstellen!

Kleidsam macht begehrt! Seebären tragen ihr Leben lang Fell. Dieses wurde und wird vom Menschen gerne genutzt. Viele Arten wurden deshalb im 19. Jhdt. durch Jagd beinahe ausgerottet.

Auch heute wird noch Jagd auf Robben gemacht –wegen ihres Fells, aber auch wegen ihres Öls und Fleisches. Was denkst du darüber? Sollte man zwischen der Jagd zur Selbstversorgung durch ansässige Menschen und dem Verkauf in andere Regionen unterscheiden?


Abb. 52: Sattelrobbenjungtier mit Pelz.
Suche weitere Bilder und Videos von Robben, vor allem unter Wasser! Versuche Anpassungen an die Bewegung unter Wasser zu erkennen! Vergleiche mit Fischen und Walen! Besprecht eure Ergebnisse in Kleingruppen!
Wiederhole mithilfe des Bio Buches der 2. Klasse, was Gefäßpflanzen und Bedecktsamer ausmacht!
Überlege, warum Seegraswiesen als Kinderstube für viele Meerestiere besonders gut geeignet sind! Welche Folgen hat ihre Bedrohung durch die Erwärmung der Meere und durch Düngemittel, die ins Meer gelangen, für die Artenvielfalt?

Abb. 54: Der Dugong, eine pazifische Seekuhart. Die neugierigen Tiere werden bis zu 4 m groß.



Abb. 53: Seehunde (links) sind mit etwa 1,40 m eher klein. Sie paaren sich im Wasser. Die Schnauze der etwa 2 m großen Kegelrobben (Mitte) ist eher lang gezogen. Beide Arten sind im Norden Europas verbreitet. Stellerscher Seelöwe (rechts) Seelöwen finden sich an der nördlichen und australischen Pazifikküste, sie werden bis zu 3 Meter groß.
Walrosse (links) leben in den polaren Regionen der Nordhalbkugel. Sie tragen Stoßzähne aus Elfenbein und wurden deshalb früher intensiv gejagt.

Seegras betreibt intensiv Fotosynthese. Welches Gas wird dabei in großen Mengen gebunden? Was bedeutet das für die Rolle von Seegraswiesen für das Weltklima?

Abb. 56: Albatros bei der Landung. Beachte die Schwimmhäute.

See-Elefanten sind Tauchmeister. Sie tauchen bis zu zwei Stunden lang und über 1500 Meter tief. Südliche Seeelefanten sind mit bis zu 6 m die größten Robben. Der Rüssel dient als Schallverstärker. Nördlicher See-Elefant (rechts).

Anders als Algen verfügen Seegräser über Wurzeln und blühen. Sie sind also Gefäßpflanzen und Bedecktsamer. Pollen und Samen werden durch das Wasser verbreitet. Seegräser bilden in küstennahen Gewässern mit flachen Böden oft ausgedehnte Wiesen, die sehr reichhaltige Lebensräume sind. Seekühe nutzen Seegraswiesen als Weiden. Sie sind mit Rüsseltieren verwandt, an dauerhaftes Leben im Wasser angepasst und haben Schwanzflossen ähnlich wie Wale entwickelt.
Abb. 55: Dichte Seegraswiesen sind Lebensraum für viele Meeresbewohner.
Am und auf dem Meere lebt eine Vielzahl Vögel. Viele verbringen den Großteil ihres Lebens auf dem Wasser und kommen nur zum Brüten an Land. Die Mehrzahl der Arten sind Zugvögel. Meist haben sie Schwimmhäute entwickelt und sind gute Schwimmer.
Einige Arten wie der im Norden Europas heimische Sterntaucher, sind gute Taucher und fangen bei ihren Tauchgängen Fische. Albatrosse haben bis zu 3 Meter Spannweite und fliegen weite Strecken. Sie fressen vor allem Tintenfische, folgen aber auch Fischereibooten. Mit Röhrchen im Schnabel scheiden sie Meersalz aus. Pelikane verfüge über einen großen Hautsack unter ihrem Schnabel. Damit schöpfen sie Beute aus dem Wasser. Möwen leben meist direkt an der Küste und erbeuten kleine Weichtiere und Krebse am Boden. Manche Arten leben auch am offenen Meer.



Abb. 59: Dreizehenmöwen leben am Wasser, brüten aber in felsigen Klippen.
Welcher Meeresbewohner ist das? Mehmet war am Wochenende etwas faul und hat seine Bio Hausübung nicht gemacht. Er hat in der Pause schnell von Tanja abgeschrieben, aber vergessen zu notieren, zu welchem Lebewesen die jeweilige Beschreibung gehört. Hilf ihm die Texte zuzuordnen! Recherchiere auch jeweils eine kurze Info über das Lebewesen, die nicht im Buch vorkommt und ergänze sie!

Sie liegen ziemlich dick und imposant am Strand herum und haben zwei große Stoßzähne.






Das ist
Kurzinfo





Sie sind sehr intelligent und können so schnell Farbe wechseln, dass man schwindlig wird.



Das ist
Kurzinfo





Im Gegensatz zu ihren winzigen schwebenden Verwandten können sie ziemlich groß werden und tolle Unterwasserlandschaften entstehen lassen.



Das ist
Kurzinfo





Sie liegen meist einfach am Meeresgrund herum, doch wenn man drauf tritt, tut es ziemlich weh.



Das ist
Kurzinfo





Sie ziehen öfters mal um, wenn es ihnen in ihrer Behausung zu eng wird. Sie können ganz schön fies zwicken.



Das ist
Kurzinfo


Verbreitungsgebiete! Finde heraus, wo in Europa Robben leben! Notiere die Verbreitungsgebiete der verschiedenen Arten! Trage alles in eine Karte ein! Vergleicht eure Karten in Teams! Tipp: Mit den Suchbegriffen „Karte“ und „blank“ findest du gutes Ausgangsmaterial. Die Region musst du als Suchbegriff noch hinzufügen!
Gemeinsamkeiten! Suche Bilder zu Heilbutt, Seezunge, Flunder und Scholle! Betrachte sie genau und lies dir den Text zu Plattfischen noch einmal durch! Schreib einen kurzen Bericht, wie die Plattfischmerkmale bei den von dir betrachteten Fischen jeweils ausgeformt sind! Fertige Skizzen an!


















Aufklärungsarbeit! In vielen Teilen der Welt, auch in Europa, werden Küstengewässer verschmutzt. Nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn werden Abfälle und Abwässer ins Meer verfrachtet, wo sie unter der Wasseroberfläche „verschwinden“. Wie könntest du Bewusstsein für die Lebewesen des Meeres und den Schaden vermitteln, den Verschmutzung in ihrem Lebensraum anrichtet? Beobachte in deiner Umgebung, wie Menschen mit Müll umgehen und wo er landet! Besprecht euch in der Klasse und entwickelt:
3 Tipps, wie Menschen das Meer bewusster wahrnehmen und schätzen lernen.
3 Tipps, wie der Umgang mit Müll verbessert werden könnte.
Sieh dir den Aufbau der Blumentiere auf Seite 155 noch einmal an!
Riff, das: Erhebung des Meeresbodens, die nahe an die Wasseroberfläche ragt.

Abb. 2: a) Einige Polypen wachsen am Fuß zusammen.
Sieh dir dieses tolle Video zu Korallen an!

Welche Farbe hätten Korallen ohne ihre Algen?


Einige Blumentierarten leben in Kolonien aus vielen Tieren zusammen. Man nennt sie Korallen. Korallenkolonien können verschiedenste Farben und Formen ausbilden. Manche bilden ein Kalkskelett aus. Bei einigen Arten ist dieses sehr beständig und bleibt nach dem Tod der Tiere bestehen. Die meisten dieser Korallen nennt man Steinkorallen

b) Neue Polypen kommen hinzu, die Kolonie wächst beständig.


c) Immer mehr Verzweigungen entstehen, es bilden sich Achsen aus.

d) Mit der Zeit entstehen große Strukturen.
Neue Polypen wachsen auf den Skelettresten früherer Tiere. Bilden Korallenkolonien über lange Zeiträume neues Kalkskelett, entstehen große Strukturen aus Kalkstein –die Korallenriffe. Steinkorallen leben häufig in Symbiose mit Fotosynthese betreibenden Lebewesen. Deshalb sind sie auf Licht angewiesen und wachsen nahe der Wasseroberfläche. Daher stammt auch ihre Farbe. Sie gedeihen gut in warmem, lichtdurchflutetem Wasser, wie es in den Tropen anzufinden ist.

Uferkanal




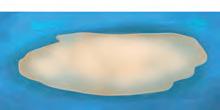
äußerer Riffhang

Abb. 3: Entstehung verschiedener Korallenrifftypen.
Saumriffe erstrecken sich entlang der Küstenlinien von Kontinenten und Inseln. Sie wachsen im seichten Wasser und dehnen sich Richtung Meer aus. Bei alten Riffen sinkt der küstenzugewandte Teil oft durch Erosion ab. Es entsteht ein Ring tieferen Wassers, eine Lagune (auch Uferkanal).
Steigt der Meeresspiegel oder senkt sich der Meeresboden, versuchen Korallen durch Wachstum nahe der Wasseroberfläche zu bleiben. Manchmal wird so der weiter im Meer liegende Bereich eines Korallenriffs abgetrennt. Es entsteht ein Barriereriff Erodiert eine Insel oder steigt der Meeresspiegel an, kann das Innere des Riffs ganz unter Wasser liegen. Ein Atoll entsteht. Sinkt der Meeresspiegels eines Atolls genug, können im Inneren Korallen wachsen. Wiederholen sich die Schwankungen über lange Zeit, entsteht ein Plattformriff. Plattformriffe können überall dort entstehen, wo der Meeresboden nah genug an die Oberfläche ragt. Je nach Zusammenspiel von Erosion, Meeresspiegel und Korallenwachstum, ändern sich Art und Form von Korallenriffen über viele tausende Jahre. Ragen Riffteile aus dem Wasser, entstehen Inseln. Korallenriffe kommen zum Beispiel in der Karibik, den Malediven, im Roten Meer, vor Australien und um Indonesien vor.

Bewohner tropischer Korallenriffe





Tropische Korallenriffe zählen zu den artenreichsten Lebensräumen der Erde. Viele Arten leben dauerhaft dort, andere nur als Larven und Jungtiere, bevor sie ins offene Meer ziehen. Bunte Fischarten sind typisch für Korallenriffe. Feuerfische tragen in den zu Stacheln geformten Flossenstrahlen Gift zur Verteidigung. Sie ernähren sich von kleineren Fischen, Krebstieren und Kopffüßern. Die kantige Form der Kofferfische stammt von ihrem Schutzpanzer aus miteinander verschmolzenen Knochenplatten. Sie fressen Würmer oder knabbern an Schwämmen, Algen und Seegras. Im Sand verborgene Beute wird mit einem konzentrierten Wasserstrahl aus dem Mund freigelegt. Anemonenfische leben in Symbiose mit Anemonen. Deren Nesseln schützen die Fische, die wiederum Fressfeinde der Anemonen abwehren. Anemonenfische ernähren sich von tierischem Plankton oder Algen. Sie wechseln im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht von männlich auf weiblich.
Kugelfische schwimmen mit Hilfe ihrer Brustflossen und sind eher schwerfällig. Fühlen sie sich bedroht, schlucken sie Wasser und pumpen sich zu kugeliger Gestalt auf. Ihre Stacheln stehen dann vom Körper ab und sie sind für viele Fressfeinde zu groß zum Schlucken. Kugelfische tragen in einigen Körperteilen Gift, das tödlich für den Menschen ist. Suche im Internet nach Kugelfisch Nest. Du wirst erstaunt sein.
Auch wenn es nicht so aussieht, Seepferdchen sind Knochenfische. Sie schwimmen aufrecht mit Hilfe ihrer Rückenflosse, allerdings nicht besonders gut. Sie müssen sich an Seegras oder Algen festhalten um nicht fortgeschwemmt zu werden. Seepferdchen sind Lauerjäger, ihre Beute kleine Krebstiere, die vorbeischwimmen. Sie zeigen aufwendiges Paarungsverhalten, die befruchteten Eier werden vom Männchen ausgetragen. Auch Wirbellose nehmen in Korallenriffen ausgefallene Formen und bunte Farben an.



Abb. 10: Die Bezeichnung Seepferdchen scheint sehr passend. Seepferdchen müssen sich an etwas festhalten... ...und sind in ihrer Umgebung sehr gut getarnt.



Für das Austragen des Nachwuchses sorgen die Männchen.

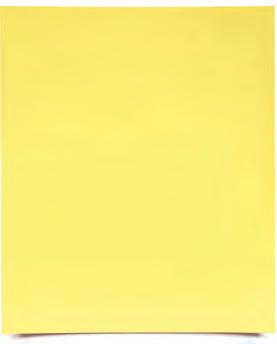

Ein weltweites Netz! Die Korallenriffe der Erde sind miteinander verbunden. Die Larven vieler Fische treiben mit Strömungen durch das Meer. So gelangen sie vom Ort ihres Schlüpfens an Orte, wo sie aufwachsen und als erwachsene Fische leben. So tauschen sich Korallenriffe aus und sind bezüglich ihrer Artenvielfalt voneinander abhängig.
Sind Kofferfische schnelle Schwimmer? Begründe deine Antwort!
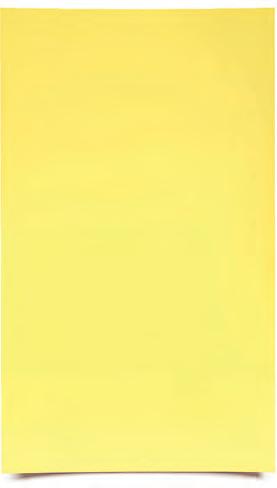

Korallenriff zu Hause? Viele der farbenprächtigen Bewohner der Korallenriffe sind bei Aquariumhalterinnen und Aquariumhaltern sehr beliebt. Die Fische werden allerdings wild gefangen, also ihren Lebensräumen entnommen. Bis zu 80 Prozent der Tiere sterben auf dem Weg zu den Händlern. Sehr beliebte Arten werden intensiv gefangen, so dass viele von ihnen vom Aussterben bedroht sind. Die Zucht der meisten Aquariumfische wäre möglich, ist allerdings oft teurer, als sie einfach aus der Natur zu entnehmen.
Recherchiere, welche Fische bei Aquariumhalterinnen und Aquariumhaltern besonders beliebt sind! Welche davon stammen von Korallenriffen?
Diskutiert in Teams, was getan werden könnte, um die Bestände beliebter Aquariumfische in der Natur zu schonen! Welche Interessen müssen dabei in Einklang gebracht werden?
Sieh dir die Bilder von Seepferdchen an! Finde Gemeinsamkeiten und verfasse ein kurze, allgemeine Beschreibung von Seepferdchen! Ergänze diese durch eine recherchierte Eigenschaft, die du besonders spannend findest!
Was könnte der Grund dafür sein, dass so viele Tiere in Korallenriffen bunt sind? †

Abb. 15: Von Muränen sieht man meist nur den Kopf. Sie leben in Höhlen und Spalten und kommen nur nachts zum Jagen hervor.

Abb. 16: Putzergarnelen säubern die Mäuler von Muränen.
Mit welchem Organ der Haie ist die Wahrnehmung elektrischer Felder verbunden?

Abb. 19: Karettschildkröten werden im Alter fast schwarz gefärbt.
Weshalb war es evolutionär von Vorteil, dass die Panzer der Meeresschildkröten flacher wurden?

Abb. 21: Schildkrötengelege am Strand sind bis zu 50 cm tief.
In tieferen Lagunenbereichen und am äußeren Riffhang im Übergang zum offenen Meer (Riffkante) leben größere Meeresbewohner. Die Riffkante kann flach oder auch sehr steil verlaufen, sodass sehr unterschiedliche Lebensräume entstehen.
Der Napoleon Lippenfisch ist mit 2 m Größe ein beeindruckender Riffbewohner. Er lebt einzelgängerisch und jagt Fische, Schnecken und Krebse. Er ist einer der wenigen Raubfische, die giftige Beute verzehren können.
Zackenbarsche verteidigen vehement ihr Revier Dabei greifen sie auch unvorsichtige Taucher an. Die Fische werden etwa zwei Meter groß und leben bevorzugt in felsigeren Bereichen mit Spalten und Vorsprüngen. Dort jagen sie Langusten, Fische, kleine Schildkröten und Haie. Zur Laichzeit bilden Zackenbarsche größere Gruppen und wandern in ihre Laichgründe.
Einige Haiarten leben in und um Korallenriffe, wo sie reichlich Nahrung finden. Sie werden Riffhaie genannt, werden 1,5 bis 3 m lang und leben meist bodennah. Hammerhaie verfügen über Sinneszellen zur Wahrnehmung elektrischer Felder ihrer Beute. Die bis zu 6 m großen Tiere verdanken ihren Namen der Verbreiterung ihres Kopfes. Man geht davon aus, dass sie die Manövrierfähigkeit verbessert und das Sichtfeld vergrößert.
Meeresschildkröten
Meeresschildkröten besuchen Korallenriffe häufig, wandern aber auch weite Strecken über das offene Meer. Die 70 cm bis 1,5 m großen Tiere nutzen dabei Meeresströmungen, um energiesparend zu schwimmen. Ihre Beine haben sich zu Flossen entwickelt und der Panzer ist flacher als der ihrer landlebenden Verwandten. Meeresschildkröten ernähren sich von Wirbellosen, manche Arten auch von Nesseltieren. Ältere Tiere ergänzen ihre Nahrung durch Algen und Seegräser.

Meeresschildkröten paaren sich im Wasser. Danach machen sich die Weibchen zu ihren Geburtsstränden auf. Dabei legen sie große Distanzen zurück. Alle Weibchen eines Strandes legen die Eier etwa zeitgleich im Sand vergraben ab. So ist eine große Zahl Eier und später Jungtiere gleichzeitig vorhanden. Das ist wichtig, da viele Tiere die Eier ausgraben und fressen. Frisch geschlüpfte Jungtiere müssen über den offenen Strand ins Wasser gelangen. Auf diesem Weg warten Fressfeinde, wie Möwen und Rabentiere. Die Strategie der Schildkröten ist es, die Räuber durch Masse zu sättigen, sodass trotzdem genug Jungtiere ins Meer gelangen. Man nennt das Räubersättigung

Abb. 14: Gefleckte Riesenzackenbarsche sind keine ausdauernden Schwimmer. Sie liegen getarnt auf der Lauer.




Abb. 20: Grüne
Meeresschildkröten orientieren sich mittels Erdmagnetfeld. Sie fressen auch Quallen, werden im Alter aber vegetarisch.
Erkennst du den Rifftyp? Du siehst hier einige Bilder von Korallenriffen. Sieh sie dir gut an und notiere, um welche Art Riff es sich jeweils handelt!






Mein Favorit im Korallenriff! Welches der Lebewesen des Korallenriffs ist dein Favorit? Mache eine Skizze! Schreibe auf, was du darüber gelernt hast! Sieh dir das Bild dazu an und ergänze, was dir darauf noch auffällt! Finde im Internet ein weiteres spannendes Detail, das du in der Klasse präsentierst!


















Korallengarten! Suche im Internet Bilder von Korallen, Seeanemonen und Schwämmen! Zeichne sie und speichere, wenn möglich die Bilder! Finde Gemeinsamkeiten und Teile deine Funde nach von dir erdachten Kriterien ein! Findest du weitere sesshaft am Boden lebende Lebewesen? Besprecht in Teams eure Funde und wie ihr sie eingeteilt habt! Nehmt dann ein großes Blatt Papier und zeichnet gemeinsam einen Korallengarten!


Skizze 3 4
Abb. 26: Hier gibt es viel zu entdecken.
Schildkröten in Not! Recherchiere im Internet, welche Gefahren auf frisch geschlüpfte Meeresschildkröten auf ihrem Weg ins Wasser lauern! Kannst du die Gefahren in natürliche und menschengemachte unterteilen? Schreib eine Liste! Diskutiert in Gruppen, welche Gefahren reduziert werden sollen und können!


Abb. 25: Ist auch das eine Koralle?



Was sind Eisberge?
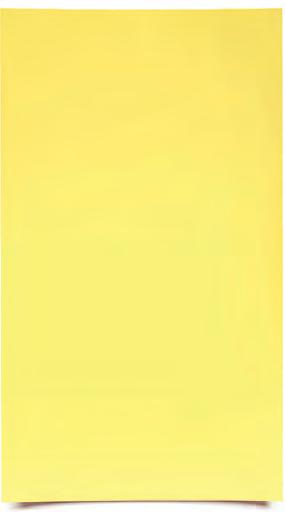

Immer wieder brechen Stücke der Eisschicht des Arktischen Ozeans ab und treiben frei im Wasser. Große Stücke ab 15 m nennt man Eisberge. In den Schelfbereichen ist die Eisdecke meist dünner und flach. Brechen dort Stücke ab, entstehen flache Tafeleisberge. Stücke, die von den hohen Gletscherkanten im Inneren der Arktis abbrechen, sind meist spitz zulaufend. Man nennt sie Gipfeleisberge. Eisberge schwimmen, da Eis etwas leichter als Wasser ist. Um genügend Auftrieb zu erzeugen, steht der größte Teil eines Eisberges unter Wasser.


Abb. 5: Tafeleisberg (oben) und Gipfeleisberg (unten). Der größte Teil des Eises liegt unter Wasser.
†
Friere ein Stück Wasser ein! Sobald es vollständig gefroren ist, lege es in eine Schüssel mit Wasser! Beobachte, wie viel des Eisstücks aus dem Wasser ragt! Schätze das Verhältnis von Eis unter dem Wasser zu Eis über dem Wasser ab! Hängt dieses Verhältnis von der Form des Eisstücks ab?
Beutegreifer, der: Landgebundene Tiere, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren.

Abb. 1: Der größte Teil des Arktischen Ozeans ist eisbedeckt. Kannst du die Wale entdecken?

Abb. 2: Lodde, arktischer Schwarmfisch
Als Arktis bezeichnet man die Region um den Nordpol. Sie umfasst den Arktischen Ozean und die nördlichsten Ausläufer Europas, Asiens und Amerikas. Teile des Arktischen Ozeans sind ganzjährig von Eis bedeckt. Ausdehnung und Dicke des Eises schwanken mit den Jahreszeiten, nehmen aber seit Jahren durch die Erderwärmung immer weiter ab. In polaren Regionen geht die Sonne im Sommer nie ganz unter und im Winter nie ganz auf. Fotosynthese betreibende Lebewesen wie die Arktische Kieselalge, haben also nur ein kurzes Zeitfenster, um zu wachsen und sich zu vermehren. Sie tun dies dafür explosionsartig. Um die lichtlosen Monate zu überstehen, speichern die Algen Nährstoffe. Ruderfußkrebse, Flohkrebse und Krill sind die wichtigsten Primärkonsumenten. Sie leben in riesigen Schwärmen. Am Meeresboden leben Borstenwürmer, Seegurken und Haarsterne von herabsinkenden Algen, Ausscheidungen und Tierkadavern.
Hering, Polardorsch und Lodde sind typische Fische der Arktis. Lodden leben in großen Schwärmen. Sie ernähren sich von Plankton, Schalentieren und Fischen am Rand der Eismassen. Lodden wandern jährlich zu ihren Laichgebieten im flachen Küstenwasser. Laich und Jungtiere sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette der Laichgebiete. Sie ernähren Seevögel, Seehunde und Dorsche. Die Lodde ist ein wichtiger Speisefisch.
Am Eis lebende Robben sind auf stabile Eisflächen angewiesen. Sie bringen darauf ihre Jungen zur Welt und wechseln ihr Fell. Sattelrobben kommen am häufigsten vor. Sie bevorzugen den Schelfbereich, wo sie nach Fischen und Krebsen tauchen. Walrosse hast du schon kennen gelernt. Sie liegen gerne auf Eisschollen mit gutem Zugang zum Wasser und tauchen nach Muscheln. Daneben finden sich auch Bart- und Ringelrobben.

3: Sattelrobbe am Eis.


4: Eisbären kommen nur in der Arktis vor.

An der Spitze der Nahrungskette steht der Eisbär. Etwa 3 m lang, zählt er zu den größten Beutegreifern. Sein Markenzeichen ist sein weißes Fell. Er jagt die Robben der Arktis. Im Wasser ist er den wendigen Schwimmern unterlegen. Auf den Eisfeldern der Wintermonate lauert er an Wasserlöchern. Tauchen Robben zum Luftholen auf, packt er zu. Er verfügt über einen ausgezeichneten Geruchssinn, um Robben aufzuspüren. Da geschlossene Eisdecken durch den Klimawandel immer kürzer vorhanden sind, müssen Eisbären ihre Ernährung umstellen. Sie plündern Nester von Seevögeln, erlegen andere Säugetiere und erlernen den Fischfang.
Erstelle einen ausführlichen Steckbrief des Eisbären
Du hast schon einige Steckbriefe nach dem Schema der ersten Klasse erstellt. Nun sollst du einen ausführlicheren Steckbrief erstellen, der den Eisbär und seine Lebensgewohnheiten beschreibt! Recherchiere dazu gemeinsam mit jemandem aus deiner Klasse! Macht erst Notizen und Skizzen, dann schreibt alles schön auf!
1. Körperliche Merkmale
• Was sind die typischen körperlichen Merkmale des Eisbären?
• Typische Körpergröße und Gewicht bei Männchen und Weibchen
• Körperform, länglich, gedrungen, Proportionen, ...
• Haut und Behaarung
• Beschreibe Beine, Pratzen, Schwanz, Ohren, Schnauze, Gebiss
• Skizzen helfen, alles besser darzustellen und zu verstehen
Tipp: Verwendet Bilder aus dem Internet. Druckt sie aus und klebt sie auf den Steckbrief. Vergesst nicht Beschreibungen und falls möglich Größenangaben hinzuzufügen. Du kannst dich dabei an Bildern hier im Buch orientieren.
2. Eigenschaften

Abb. 6: Ausgewachsener männlicher Eisbär.
Findet besondere Eigenschaften des Eisbären heraus! Wie steht es um seine Sinne, haben einige Körpermerkmale eine ganz besondere Funktion oder einen Aufbau der sich von anderen Bären unterscheidet? Erhält er dadurch besondere Fähigkeiten?
Tipp: Versucht euch auf einige, euch wichtig erscheinende Dinge zu konzentrieren!

Abb. 7: Eisbären stehen, um Ausschau zu halten.
3. Verbreitung und Lebensraum
Recherchiere, wo Eisbären leben! Um welche Regionen der Erde handelt es sich und welche Eigenschaften haben sie! Orientiere dich daran, wie im Buch der zweiten Klasse Lebensräume beschrieben wurden! Welche Anforderungen stellt der Lebensraum an den Eisbär? Hier kannst du Verbindungen zu seinen körperlichen Merkmalen und Eigenschaften herstellen und beschreiben!
4. Lebensweise
Wie lebt der Eisbär? Wann ist er im Tages und im Jahresverlauf aktiv? Wie bewegt er sich, ruht und schläft er auf spezielle Weise? Wo hält er sich in seinem Lebensraum bevorzugt auf und gibt es Wanderbewegungen? Was fressen Eisbären eigentlich und ist das immer gleich? Wie jagen sie? Wie steht es um ihr Sozialverhalten? Leben sie alleine, in Gruppen, kommunizieren die Tiere miteinander? Gibt es Reviere? Wann wo und wie paaren sie sich und ziehen ihre Jungen auf?
Tipp: Konzentriert euch auch hier auf euch wichtig Erscheinendes! Oft gibt es viel mehr zu erfahren, als in einem Steckbrief Platz hätte.
5. Beziehungen
Welchen Einfluss haben Eisbären auf ihre Umwelt und welche Umwelteinflüsse wirken auf sie?
Gefährden sie Teile des Lebensraums? Werden sie durch etwas gefährdet? Wie ist ihre Beziehung zum Menschen?
Vergleicht eure Steckbriefe in der Klasse! Gemeinsam werdet ihr viel mehr herausgefunden haben, als jemals Platz in diesem Buch hätte. Das ist doch toll oder?



Abb. 8: Was hat es mit Eisbärhöhlen auf sich?

Schelfeis und Packeis?


Als Schelfeis bezeichnet man eine dicke durchgehende Eisplatte, die schwimmend in das Meer hineinragt. Packeis hingegen besteht aus einzelnen Eisschollen, die dicht aneinander liegen, aber dazwischen noch Raum für kleinere Wasserflächen lassen. Als Treibeis bezeichnet man einzelne Eisstücke, die frei am Wasser treiben.
Scanne den QR-Code und informiere dich mehr über das Schelfeis!

Begründe, weshalb sich unterschiedliche Pinguinarten, die sich einen Lebensraum teilen, auf unterschiedliche Nahrung spezialisiert haben!


Kalt = Groß?
Da Pinguinarten über verschiedene Klimazonen verteilt sind, lässt sich bei ihnen schön ein Phänomen beobachten, das Bergmannsche Regel genannt wird. Tiere nahe verwandter Arten werden umso größer, in je kälteren Gebieten sie leben. Das liegt daran, dass Wärme im Körper produziert wird, also im Volumen, während Wärme über die Körperoberfläche abgegeben wird. Das Volumen wächst mit der Größe des Tieres stärker als die Fläche (denke an Quadrat und Würfel), die Wärmeproduktion also stärker als der Wärmeverlust.

Abb. 13: Adelie Pinguine brüten zwei Junge aus. Sie werden etwa 70 cm groß.
Antarktis – Südlicher Ozean
Die Antarktis umfasst den Kontinent Antarktika, die Landmasse um den Südpol und den südlichen Ozean. Sie ist größtenteils vom Antarktischen Eisschild bedeckt, der sich bis ins Meer erstreckt. Nahe der Küste reicht das Eis bis zum Meeresboden, weiter weg schwimmt es als Schelfeis, weitläufiger als Packeis. Der Antarktische Eisschild ist direkt vom Klimawandel bedroht und schmilzt mit zunehmender Geschwindigkeit ab.
Abb. 9: Die Form der Schelfeiskante ist bei riesigen Eisbergen gut erhalten.

Pinguine sind an das Leben im Wasser und in der Kälte angepasste Vögel. Vogelkörper sind meist stromlinienförmig. Sie erzeugen beim Fliegen wenig Luftwiderstand. Diese Eigenschaft kommt auch den tauchenden Pinguinen zugute. Ihre Flügel haben sich zu schmalen, kräftigen Flossen entwickelt mit denen sie schnell und wendig schwimmen. Die Oberschenkel sind kurz (erinnere dich weshalb), die Füße groß und mit Schwimmhäuten versehen. Die Knochen der Pinguine beinhalten keine Luftsäcke, sondern sind dicht und schwer. Sie hätten sonst zuviel Auftrieb und könnten schwer abtauchen. Pinguine haben kleine, fast haarartige Federn, die gut isolieren. Zusätzlich sorgt eine dicke Fettschicht für Kälteschutz. Die Augen der Pinguine sind an die Unterwassersicht angepasst, weswegen sie an Land kurzsichtig sind.


Im sauerstoffreichen Wasser des Packeises hat sich ein reichhaltiges Ökosystem entwickelt. Wie in der Arktis bilden große Krebstierschwärme die Nahrungsgrundlage. Typische Bewohner des südlichen Ozeans sind die großen Wale, Ohrenrobben, See-Elefant, Wedellrobbe und Seeleopard. Auch der Riesenkalmar und sein Verwandter der Kolosskalmar sind hier heimisch. Viele Antarktisfische leben bodennah und brauchen keine Schwimmblase. Ihr Blut enthält wie ein Frostschutzmittel wirkende Proteine, aber kein Hämoglobin. Da der Sauerstoffgehalt von kaltem Wasser höher ist, kommen sie ohne es aus. Vögel wie Albatros, Sturmvögel und Möwen bevölkern den Südlichen Ozean und seine Küsten – und eine besondere Gruppe an Vögeln.

Abb. 11: Kaiserpinguin, mit über 1 m Größe die größten Pinguine. Sie zeugen ein einzelnes Junges.
Pinguine ernähren sich von Krebstieren, Tintenfischen und Fischen. Am Eis und Land sind sie vor Fressfeinden recht sicher. Im Meer werden sie aber von verschiedenen Robbenarten, Orcas und Haien gejagt. Die meisten Pinguine brüten in Kolonien, die bis zu hunderttausende Paare umfassen. Die Weibchen legen zwei, bei größeren Pinguinarten ein Ei. Bei der Brutpflege wechseln sich Männchen und Weibchen ab. Außer bei Kaiserpinguinen, wo allein das Männchen brütet, während das Weibchen auf Nahrungssuche ist. Da in Kolonien reger Sozialkontakt herrscht, haben Pinguine ein breites Repertoire an Körper- und Lautausdrücken zur Kommunikation entwickelt. Einige Pinguinarten, wie Felsenpinguin und Galapagos Pinguin leben auch in gemäßigten bis subtropischen Zonen. Sie sind kleiner als die antarktischen Arten.
Abb. 12: Tauchender Eselspinguin. Achte auf die Stromlinienform.
Die Tiefsee
Du hast schon von der Tiefsee, dem Bereich unter 1000 m und den dortigen Bedingungen gehört sowie auch Lebewesen kennengelernt, die dorthin vordringen. Trotz der Bedingungen, ist die Tiefsee ein belebter Ort. Die Forschung beginnt erst langsam, die große Artenvielfalt dieser schwer zugänglichen Welt zu erkennen und zu verstehen.


Meerschnee und größere Tiere, die herabsinken, sind Nahrungsgrundlage der Tiefsee. Doch es gibt auch Primärproduzenten. In der 2. Klasse hast du von an extremen Orten lebenden Bakterien gehört. In der Tiefsee gibt es vulkanische Quellen. Daraus strömen bis zu 400 °C heißes Wasser und für die meisten Lebewesen giftige Schwefelverbindungen. Einige Bakterien und Archaeen fühlen sich dort wohl und ernähren sich von diesen Verbindungen. Sie übernehmen die Rolle des pflanzlichen Planktons in den oberflächennahen Schichten.

Bartwürmer (sie zählen zu den Borstenwürmern) und einige Muscheln stehen in Symbiose mit diesen Mikroorganismen Sie sind Nahrung anderer Tiere. So entsteht über einfache Weichtiere, Stachelhäuter, bis hin zu Fischen und Tintenfischen ein Nahrungsnetz.
Die Anforderungen der Tiefsee haben bei ihren Bewohnern seltsam erscheinende Merkmale hervorgebracht. Da die Sichtweite kurz ist, ist schnelles Schwimmen über weitere Strecken oft nicht notwendig. Die Jagd geschieht auf kurze Distanz, oft durch Anlocken der Beute.
Vipernfische sind langgestreckt und haben spitze Zähne. Die Leuchtorgane an den Augen nutzen sie als Scheinwerfer, um ihre Beute sicher schnappen zu können. Pelikanaale haben ein im Vergleich zu ihrem schlanken Körper riesiges Maul. Damit können sie Beute breiter als ihr Körper packen. Tiefseeangler Weibchen locken ihre Beute mit Leuchtködern auf einer Angel an. Sie werden 6 cm bis über 1 m groß. Die Männchen sind dagegen sehr klein. Zur Verteidigung stoßen sie eine Wolke aus Leuchtpartikeln aus, um Feinde zu verwirren.





Fallende Wale?
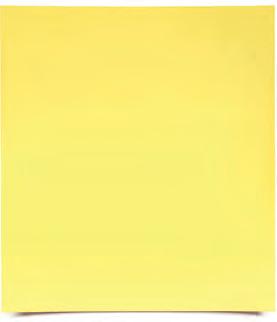

Als Walfall bezeichnet man das Absinken eines Walkadavers in die Tiefsee. Dort dient er als Nahrungsgrundlage für Tiefseebewohner. Um die Stelle des Kadavers entsteht ein Bereich vergleichsweise hoher Populationsdichte und Artenvielfalt. Ein eigenes kleines Ökosystem, das für Jahrzehnte bestand hat.

Archaeen, die: Einzellige Lebewesen, die wie Bakterien keinen Zellkern aufweisen, aber in den chemischen Prozessen in der Zelle eher den Zellen von Tieren und Pflanzen ähneln.
Vergleiche die Körperformen der Tiefseefische mit denen der Tiere aus den Kapiteln davor! Wie zeigt sich, dass sie keine schnellen oder ausdauernden Schwimmer sind?

Abb. 22: Venusfliegenfallen Anemonen sind Vertreter der Nesseltiere in der Tiefsee.

Abb. 23: Dumbo-Oktopus. Er schwimmt mit seinen Flossen in bis zu 7000 m Tiefe und jagt Würmer und Krebstiere am Boden.
Da fehlt doch was! Lies dir den Lückentext gründlich durch und ergänze die fehlenden Wörter!

Die polaren Meere liegen an den ________________ der Erde. Der Arktische Ozean um den__________________, der ___________________________ um den Südpol. Der ____________ ist von Kontinenten umringt, während der Südliche Ozean einen __________________ , nämlich _____________________ umgibt. In beiden Regionen herrschen sehr ____________ Temperaturen, weshalb es ganzjährig eine dicke ________________ gibt. Diese ist jedoch von der _____________________ bedroht und wird jährlich __________. Große ______________________, die sich von pflanzlichem ________________ ernähren, schaffen eine reiche Nahrungsgrundlage für viele Tiere. Der _____________ ist einer der größten Beutegreifer der Welt. Er erlegt vor allem ______________ , denen er an _________________ auflauert. Er kommt nur am ____________ vor. Am Südpol leben _______________. Sie sind hervorragend an die Bewegung im ______________ angepasste Vögel, die ihre Beute _______________ jagen.



Pinguincheck!


Such im Internet nach Pinguinarten! Wähle zwei aus und notiere welche! Sieh dir Bilder und Videos dazu an! Schreibe eine Liste an Gemeinsamkeiten und Unterschieden auf! Kannst du diese Unterschiede mit Lebensraum, oder Lebensweise erklären?
Schreibe 5 Eigenschaften auf, die beide Pinguine teilen!



Abb. 24: Pinguine starten oft gemeinsam auf ihre Tauchgänge.

Was wenn das Eis schmilzt? Im Eis der Antarktis sind 70 Prozent des Süßwassers der Erde gebunden. Gigantische Mengen gefrorenen Wassers türmen sich über dem Land von Antarktika. Überlege, was für Folgen es hat, wenn dieses Eis schmilzt! Versuche folgende Aussagen in deine Gedanken einzubauen!

„Viele der bevölkerungsreichsten Städte der Welt liegen günstig an den Küsten gelegen. Im Laufe der Geschichte haben sich Zugang zu den Ressourcen des Meeres und zu Handelswegen als wertvoll erwiesen.“
„Die Tiere des Meeres haben sich hervorragend an die herrschenden Bedingungen angepasst. Das Salz im Wasser ist kein Problem für sie. Im Gegenteil, durch diese Anpassung können die allermeisten Arten in salzarmen Gewässern nicht überleben.“
Weshalb ist das Schmelzen des Eises der Arktis nur für eine dieser beiden Aussagen von Bedeutung?
Tipp: Lege einen Eiswürfel in ein Glas und fülle es randvoll an! Warte bis der Eiswürfel geschmolzen ist! Ist Wasser übergegangen?
Diskutiert in Teams über eure Einsichten und Gedanken!



Abb. 25: Wenn große Eisbrocken von Gletschern abbrechen, nennt man das Kalben. Im Internet findest du mit diesem Suchbegriff imposante Videos.
Das Meer hat für den Menschen seit jeher eine große Bedeutung. Als Nahrungsquelle, Raum zur Fortbewegung über große Strecken, Quelle von Bodenschätzen, zur Energiegewinnung, Platz zur Erholung und als Quelle für Mythen und Geschichten.
Dabei hat der Einfluss des Menschen auf das Meer ständig zugenommen. Heutzutage ist sein Ausmaß für die allermeisten Meeresbewohner bedrohlich bis stark gefährdend. Damit beeinträchtigt der Mensch auch seine eigene Existenz. Das Meer und seine Bewohner sind wichtig dafür, dass die Erde für den Menschen lebenswert ist.
Fischerei
Fischfabriken!
Heutige Fischereischiffe der großen Unternehmen, vor allem auf Hochsee, sind schwimmende Fabriken. Sie haben wenig mit den traditionellen Vorstellungen von Fischerbooten zu tun. Diese Kolosse fischen bis zu 250.000 Tonnen Fisch pro Tag aus dem Meer. Das entspricht einem Würfel von mehr als 60 m Kantenlänge voller Fisch (Vergleiche das mit der Größe deiner Schule). Der Fisch wird direkt am Meer fertig für den Endverbrauch verarbeitet.


Fischerei ist eine der ältesten Methoden des Menschen zur Nahrungsgewinnung. Mit modernen Mitteln wird jedoch so viel Fisch gefangen, dass sich die Populationen nicht erholen können. Viele Fischbestände werden daher stetig kleiner. Man nennt das Überfischung. Einige Arten wurden an den Rand ihrer Auslöschung gefischt. Auch der Beifang ist problematisch. Neben den Tieren, die gefischt werden sollen, gehen auch anderen Arten ins Netz. Meist verenden sie, oder werden schwer verletzt. Zum Fang von Schwarmfischen werden Schleppnetze verwendet. Diese bis zu 20.000 m² großen Netze werden entweder oberflächennah oder am Meeresboden schleifend eingesetzt. Schleifende Netze richten große Schäden am Meeresboden und an seinen Bewohnern an. Riesige Flächen Lebensraum werden so zerstört.
Leinenfischerei bereitet dem Albatros Probleme Dieser frisst die Köder, verfängt sich in den Leinen und ertrinkt. Schätzungsweise 300.000 Tiere werden so jedes Jahr getötet. Auch Krill wird in großen Mengen gefischt. Er wird für die Nahrungsmittelindustrie, etwa zur Herstellung von Omega3 Öl Kapseln verwendet. Zuchtfischfarmen benötigen Krill als Nahrung für ihre Fische. So wird die Bedrohung durch Fischerei von einer Tierart auf die andere verlagert, anstatt behoben. Nachhaltigkeitssiegel versprechen daher oft mehr als sie letztlich halten.

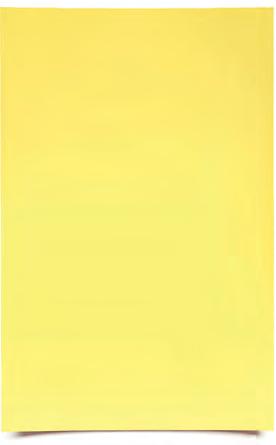
Wiederhole, welche Lebewesen von Krill leben. Schreibe eine Liste der Arten, die durch die Überfischung des Krills betroffen sind!
Scanne den QR-Code und sieh dir das kurze Video zu Bodenschleppnetzen an!

Leinenfischerei, die: Hauptleinen von bis zu 130 km Länge werden mit vielen kürzeren Leinen mit Haken und Ködern versehen.
Gehen die Bestände einer Art zurück, wirkt sich das auf andere Arten aus. Pinguine spüren die Überfischung von Krill in der Antarktis. Durch die starke Befischung der Lodde in der Arktis jagen deren Fressfeinde vermehrt den Dorsch, der dadurch unter Druck kommt. Oft scheint der Mensch zu vergessen, dass in der Natur alles eng verwoben ist und ein Eingriff sich durch das Nahrungsnetz immer im ganzen Ökosystem auswirkt.
Der Mensch entsorgt viele seiner Abfälle im Meer. Je nach Region der Welt ist das Bewusstsein für die dadurch entstehenden Schäden unterschiedlich und daher die Regeln mehr oder weniger streng. In Europa sind die Gesetze zum Schutz des Meeres vor Verschmutzung vergleichsweise streng. Durch Produktionsverlagerungen ins Ausland und den Export von Müll, vor allem Plastik und einige Problemstoffe, wird diese Schutzfunktion aber häufig umgangen.



Nachhaltiger fischen! Vor allem küstennah fischende Fischereibetriebe, viele davon kleine private Unternehmen, spüren den Rückgang der Fischbestände. Sie können nicht einfach in andere Gewässer fahren, wie die Fischfabriken der Hochsee. Sie beteiligen sich deshalb oft an Initiativen, um die Bestände ihrer Fischgründe zu schonen und nachhaltig zu fischen. Sie arbeiten dabei mit Biologinnen und Biologen zusammen.
Seht euch in der Klasse Videos zu den Suchbegriffen Schleppnetzfischerei, Grundschleppnetz und Supertrawler an. Diskutiert das Gesehene in Teams!
Was ist Bioakkumulation?


Von Kleinstlebewesen aufgenommene Stoffe, die im Körper verbleiben, gelangen auch in die Körper ihrer Fressfeinde. Werden diese wiederum gefressen, gelangen die Stoffe in die nächste Stufe der Nahrungskette usw. Tiere müssen deutlich mehr als ihren eigentlichen Massezuwachs fressen. Daher werden die Stoffe immer konzentrierter angereichert, je weiter oben ein Tier in der Nahrungskette steht. Die Lebewesen an der Spitze der Nahrungskette sammeln (akkumulieren) also besonders viel. Das nennt man Bioakkumulation.
Wiederhole die Nahrungspyramide aus der 2. Klasse und erkläre die Energieausbeute in den einzelnen Stufen! Erkläre anschließend, warum sich Giftstoffe entlang der Nahrungskette immer stärker anreichern! Warum ist auch der Mensch von Mikroplastik betroffen?

Abb. 6: Mikroplastik findet sich selbst im Marianen Graben und am Mount Everest. Es ist eines der drängenden Probleme unserer Zeit.
Schau dich in deiner Umgebung um: Welche Dinge bestehen aus Plastik? Überlege, bei welchen Tätigkeiten oder Vorgängen besonders leicht Mikroplastik entsteht!
Welche Lebewesen sind von der Versauerung des Meeres direkt betroffen? Erkläre, wie sich das auf den gesamten Lebensraum auswirkt!
Abwässer und Düngemittel
Für das Meer sind Abwässer aus Städten und Industrieanlagen eine große Belastung. Durch den Wasserkreislauf gelangen Schadstoffe aus dem Landesinneren über die Flüsse in die Ozeane. Der Schutz des Meeres beginnt also nicht erst an den Küsten.
Düngemittel der Landwirtschaft sind vor allem für Küstenbereiche ein Problem. Regen wäscht sie aus dem Boden und sie gelangen ins Meer. Dort düngen sie pflanzliches Plankton, das sich verstärkt vermehrt. Algenblüten können entstehen. Auch ohne Algenblüte verändert sich das Ökosystem. Der Algenwuchs an der Oberfläche beschattet den Meeresboden
Seegräser und Tang bekommen nicht mehr genug Licht. Der geringere Sauerstoffgehalt im Wasser verdrängt Tierarten, das Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht.
Kunststoffe – Mikroplastik

4:
am
Geschätzte 60.000 Tonnen Plastikmüll geraten weltweit täglich in die Wasserkreisläufe. 86 Millionen Tonnen sind geschätzt bereits im Meer. Das Meiste stammt von Verpackungen und Einwegprodukten wie Plastikgeschirr. Vor allem in Afrika und Südostasien sind Einrichtungen zur Müllbeseitigung selten. Ein Großteil des Mülls gelangt in die Natur und ins Meer, wo er von den Strömungen verteilt wird.
Plastikmüll findet sich im Verdauungssystem vieler Meeresbewohner. Er verstopft es oder die Tiere spüren keinen Hunger mehr und verhungern. Tiere können sich in Plastikmüll verfangen und ihr Leben nur noch eingeschränkt oder gar nicht führen. Ein großes Problem ist Mikroplastik. So nennt man Plastikstücke kleiner als 5 mm. Es entsteht durch Verwitterung von Plastik, Abrieb (z.B. bei Reifen) oder wird, wie in Kosmetikartikeln, bewusst eingesetzt. Stücke kleiner als ein Mikrometer werden in Zellen eingelagert und stören biologische Prozesse. Mikroplastik findet sich mittlerweile überall auf der Welt, in den allermeisten Lebewesen und auch im Menschen, da es durch Nahrung und Atmung aufgenommen wird. Die genauen gesundheitlichen Folgen sind noch unbekannt. Bei Tieren wurden schwere gesundheitliche Folgen nachgewiesen. Beim Menschen scheint es Arteriosklerose zu verschlimmern und die Ausbreitung von Krebs zu begünstigen.
Erwärmung der Ozeane

Abb. 5: Plastikmüll ähnelt Quallen, der Nahrung von Meeresschildkröten.
Abb. 7: Beginnende Korallenbleiche

Der Klimawandel erwärmt die Ozeane. Meeresbewohner sind an bestimmte Temperaturen angepasst. Ändern sich diese rasch, müssen sie ausweichen. Damit fehlen sie im Nahrungsnetz des Ökosystems. Bei zu hohen Temperaturen setzen die symbiontischen Algen der Steinkorallen giftige Stoffe frei. Die Korallen stoßen sie ab und verlieren deren Fähigkeit zur Fotosynthese. Da die Farbe der Korallen durch die Algen entsteht, verlieren sie auch diese. Man nennt dies Korallenbleiche. In warmem Wasser laufen chemische Reaktionen, die gespeichertes CO2 zu Kohlensäure umwandeln, rascher ab. Die Ozeane werden saurer. Das ist ein Problem für Lebewesen mit Kalkschalen, da sich Kalk in saurem Wasser auflöst.
Gefährdet oder nicht? Zur Beurteilung, ob eine Tierart gefährdet ist oder nicht wurde ein internationales Bewertungsverfahren entwickelt, bei dem Experten nach klaren Vorgaben vorgehen. Nach diesen Kriterien wird die Rote Liste der gefährdeten Arten vom IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) erstellt. Sie enthält alle momentan als gefährdet eingestuften Arten.
Die möglichen Einstufungen lauten:

Recherchiere drei Arten des Meeres, die gefährdet sind! Schreibe sie und ihren Gefährdungsstatus nach den IUCN Kategorien in eine Liste! Füge eine kurze Beschreibung der Bedrohungen hinzu, die sie gefährden!

Abb. 8: Gefährdungsstatus nach IUCN.
Fasst eure Ergebnisse in der Klasse zusammen! Findet heraus, welche Bedrohungen sich über die Tierarten hinweg als gefährdend herausstellen!
Die Folgen des Mülls! Betrachte folgende Bilder genau!


Abb. 9: Als Geisternetze bezeichnet man Fischernetze, die als Müll im Meer landen. Häufig verstricken sich Tiere darin und sterben.
Notiere deine Gedanken! Nehmt euch in der Klasse Zeit, über eure Beziehung und Gedanken zum Meer zu sprechen! Findet ein paar Sätze, die Übereinstimmendes ausdrücken! Schreibt sie auf ein Plakat mit dem Titel „Unser Meer“! Hängt es in der Klasse auf! 1 2 3


Abb. 10: Eine Schildkröte in Müll verstrickt. Die Bewegung ihrer rechten Flosse ist eingeschränkt, nur die Linke schlägt. Es ist fraglich ob sie sich noch ernähren kann.


Abb. 11: Müll in Maul und Magen von Tieren kommt häufig vor. Meistens sterben sie daran.
Verfasse aufgrund deiner Beobachtungen einen Text, in dem du darstellst, was du siehst und welche verallgemeinernden Schlüsse du daraus ziehen kannst!
Das Meer und du! Was kommt dir in den Sinn, wenn du ans Meer denkst? Überlege welche Eindrücke, Vorstellungen, Erlebnisse oder Wünsche du mit dem Meer verbindest! Welche Berührungspunkte hast du mit dem Meer? Hattest, oder hast du in deinem Leben Einfluss auf das Meer oder seine Bewohner? Direkt oder indirekt, auch im ganz kleinen? Haben das Meer und seine Bewohner Einfluss auf dich?






















Die Meere und die Wechselwirkungen, denen sie unterliegen, sind erst zu einem kleinen Anteil erforscht. Für Meeresbiologinnen und Meeresbiologen gibt es also noch jede Menge zu entdecken. Das Meer und seine Bewohner haben großen Einfluss darauf, wie die Erde als Ökosystem beschaffen ist. Wollen wir die momentan für uns noch recht angenehmen Umweltbedingungen möglichst aufrechterhalten, ist es für uns Menschen daher sehr wichtig, ein umfassendes Verständnis zu erlangen. Dabei besteht ein Wettlauf gegen die Zeit, da der Lebensraum Meer starken und raschen Veränderungen ausgesetzt ist, die sich bereits bei seinen Bewohnern bemerkbar machen.
Die ungeheure Vielfalt an Meereslebewesen von mikroskopisch klein bis zu den größten Tieren der Erde schafft ein sehr breit gefächertes Betätigungsfeld. Dieses ist oft mit Fahrten hinaus auf das Meer und Tauchgängen verbunden, umfasst aber auch Laborarbeit und Datenauswertung. Viele der Meereslebewesen und deren Eigenschaften sind für die Medizin, Ernährungswissenschaft und Technik interessant. So ergeben sich Berufsmöglichkeiten an Schnittpunkten zwischen Fachgebieten. Auch für den Schutz der Meere braucht es Expertinnen und Experten, die die Politik beraten, Strategien erarbeiten, deren Umsetzung begleiten und die Maßnahmen und deren Ziele den Menschen kommunizieren. Fisch- und Garnelenzucht sowie Algenfarmen und andere Aquakultur braucht das Know How von Biologinnen und Biologen, um erfolgreich und nachhaltig durchgeführt zu werden.
Verhalten von Wasser! Finde anhand der Versuchsbeschreibung eine passende experimentelle Fragestellung! Formuliere deine Vermutung darüber, wie die Versuchsergebnisse aussehen werden! Führt dann den Versuch durch!
Du brauchst: durchsichtiges Gefäß von mehr als 5 cm Tiefe und etwa 1 l Volumen % Lebensmittelfarbe % einen dünnen Kochlöffel oder eine dünne Platte, du solltest damit eine flache Rampe in das Gefäß bilden können
FRAGE:
VERMUTUNG:
DURCHFÜHRUNG
Fülle das Gefäß mit kaltem Wasser soweit an, dass noch etwa 1 cm Platz bis zum Rand ist! Erhitze etwa 1/4 l Wasser und mische die Lebensmittelfarbe hinein, bis sich eine kräftige Färbung zeigt! Halte nun den Kochlöffel oder die Platte sehr flach in das Gefäß, sodass sie die Wasseroberfläche nur leicht durchdringt und eine Rampe bildet! Kehre die Temperaturverhätnisse um und wiederhole den Versuch
AUSWERTUNG: Beschreibe deine Beobachtungen schriftlich! Füge Skizzen hinzu! Schreibe einen kurzen Text, der darlegt, wie diese Versuchsreihe mit dem Meer, bzw. Gewässern allgemein zusammenhängt!


Forschungsrecherche! Sucht in Zweierteams im Internet nach Informationen zu den Zeitpunkten und dem Ausmaß des Auftretens von Korallenbleichen! Versucht die gefundenen Informationen zu strukturieren, beispielsweise nach Jahrzehnt, Auftreten lokal oder global, … Sammelt auch ein paar Hintergrundinformationen, die euch wichtig erscheinen!
Findet für den Zeitraum, in dem ihr Ergebnisse gefunden habt, eine grafische Darstellung der globalen Durchschnittstemperatur! Baut diese Information und die Grafik in eure Betrachtungen ein! Fasst eure Ergebnisse übersichtlich zusammen und beschreibt die bisherige Entwicklung und eure Prognose für die Zukunft in einem kurzen Text! Gebt eure Quellen an und beurteilt diese kurz!
So schätze ich mich nach dem Großkapitel DAS MEER ALS LEBENSRAUM selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
…die Ozeane der Erde benennen und auf einer Weltkarte/einem Globus zeigen.
…das Bodenrelief und die Tiefenzonen der Ozeane beschreiben und die entsprechenden Fachbegriffe dazu nennen und erläutern.
…Andere über die großen Meeresströmungen und deren Bedeutung für den Lebensraum Erde informieren.
…beschreiben, was Plankton ist, welche Arten es gibt und welche Rolle es für das Leben im Meer spielt.
…anhand von Körperform und Schuppen der Fische evolutionäre Anpassung an das Leben im Wasser aufzeigen sowie ein Experiment dazu durchführen.
…die Fortbewegung der Fische im Wasser erörtern und die verschiedenen Flossen und deren Rolle dabei benennen.
…Aufbau und Funktionsweise von Schwimmblasen erklären und durch einen Versuch demonstrieren.
…die Organe der Fische zur Orientierung unter Wasser nennen und deren Funktionsweisen erörtern.



…wichtige Merkmale und Lebensweise von einigen Bewohnern des offenen Meeres wiedergeben.
…den Unterschied zwischen Knochen- und Knorpelfischen erklären und jeweils Tiere als Beispiele nennen.
…Säugetiere, die das Meer bewohnen, nennen und deren Merkmale, Eigenschaften und Lebensweisen beschreiben.
…die Bedingungen in der Dämmerzone und Tiefsee beschreiben und einige Lebewesen die dort wohnen, nennen.
…den Lebensraum Schelfmeer und seine vielfältigen Bewohner beschreiben.
…die Entstehung von Korallenriffen erläutern und über Lebensbedingungen und Lebensgemeinschaften in ihnen sprechen.
…Wissen über das arktische und antarktische Meer und seine Bewohner wiedergeben.
…die Beziehung des Menschen zum Meer erörtern und weiß über aktuelle Bedrohungen für das Meer und seine Bewohner, sowie deren Wirkung auf den Menschen und das Leben auf der Erde allgemein Bescheid.
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
Dagmar Röhrlich: Tiefsee: Von Schwarzen Rauchern und blinkenden Fischen (mareverlag 2010).
Oliver Uschmann, Sylvia Witt: Meer geht nicht (Gulliver von Beltz & Gelberg 2020).
Kristina Heldmann: Hallo Plankton!: Wunderwesen im Wasser (Verlagshaus Jacoby & Stuart 2020).

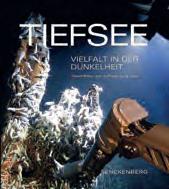



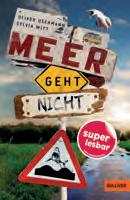



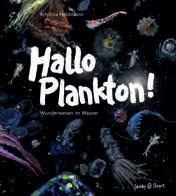

Süßwasser, das: Wasser in dem keine oder nur eine sehr geringe Menge an Salzen gelöst ist. Für Landlebewesen die einzig verwertbare Form von Wasser.
Berechne den Prozentanteil des Oberflächen- Süßwassers am gesamten Wasser der Erde! Messt im nächsten Turnunterricht euren Turnsaal aus und berechnet seine Bodenfläche! Wie groß müsste ein Stück Papier sein, damit seine Fläche so viele Prozent der Turnsaalfläche ausmacht, wie der Prozentanteil an Oberflächensüßwasser! Legt ein Papier dieser Größe in den Turnsaal!
Abb. 1: Wo im Bild nimmt Wasser welchen Aggregatzustand an?
Überlege was geschieht, wenn die Luftströmungen, die verdunstetes Wasser vom Meer zum Land bringen, sich verändern! Denke dir verschiedene Szenarien aus und schreibe sie auf! Diskutiert eure Szenarien in Gruppen!
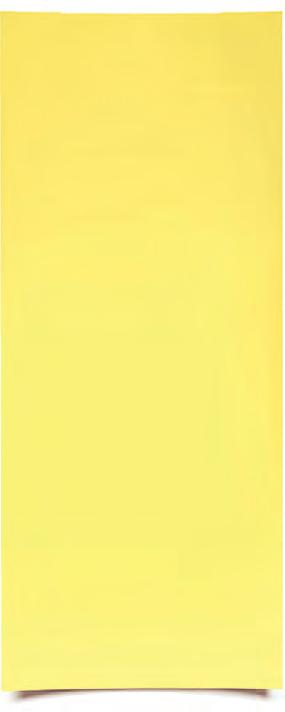
Das Wasser, das du täglich zum Waschen und Trinken verwendest, das zum Gießen der Gärten und für Schwimmbäder genutzt wird und das die Flüsse, Teiche und Seen deiner Umgebung füllt ist Süßwasser. Nur 2,5 Prozent des gesamten Wassers der Erde sind Süßwasser. Die restlichen 97,5 Prozent sind Salzwasser der Meere. Etwa zwei Drittel des Süßwassers sind im Eisschild der Polkappen, in Gletschern und gefrorenen Böden gebunden. Etwas weniger als ein Drittel befindet sich als Grundwasser im Boden. Nur ein winziger Teil des Süßwassers (0,3 %) macht jenes Wasser aus, das in den Oberflächengewässern der Landmassen zu finden ist.
Wie das Wasser an Land kommt, beschreibt der Wasserkreislauf
Was sind Jetstreams?

Jetstreams sind mächtige Luftströmungen von tausenden Kilometern Länge in großen Höhen. Sie können bis über 500 km/h schnell werden und ziehen sich wie Bänder um die Erde. Bei ihren Bewegungen reißen sie tiefer liegende Luftschichten mit sich und sorgen dafür, dass Schönwetter und Schlechtwetterbereiche weiterbewegt werden. Angetrieben werden sie durch den Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator. Durch den Klimawandel erwärmen sich die Pole stärker auf als der Rest der Erde und die Temperaturunterschiede werden geringer. Die Jetstreams verlieren an Stärke. Dadurch werden Schlecht- und Schönwetterbereiche langsamer weiterbewegt. Das führt zu lang anhaltenden Trocken- und Regenphasen, Extremwetterereignisse nehmen zu.

Abb. 1: Der Wasserkreislauf – Wasser geht nicht verloren. Es wechselt zwischen den Gewässern, dem Untergrund, der Biosphäre und der Atmosphäre. Dabei nimmt es alle Aggregatzustände an.
F Wasser verdunstet an den Oberflächen der Gewässer. Dafür wird Energie benötigt. Je stärker die Sonneneinstrahlung, desto stärker die Verdunstung. Da das Meer so groß ist, verdunstet an seiner Oberfläche sehr viel Wasser. Verdunstetes Wasser enthält kein Salz mehr. Auch Pflanzen verdunsten Wasser.
F Das verdunstete Wasser steigt mit der durch die Sonne erwärmten Luft auf. Es wird durch Winde in der Atmosphäre bewegt. Höhere Atmosphärenschichten sind kälter. Dort kondensiert das Wasser und Wolken bilden sich
F Winde transportieren die Wolken zur Küste und ins Landesinnere. An Gebirgen stauen sich die Wolken und steigen in höhere Lagen auf. Dort ist es kühler. Die Luft kann weniger Wasser beinhalten und es bilden sich Tropfen, es regnet. Ist es kalt genug, friert das Wasser und es schneit.
F Das Regenwasser trifft auf den Boden, wo es abfließt oder versickert und ins Grundwasser wandert. Im Untergrund kann sich das Wasser bewegen. Dort, wo Grundwasser an die Oberfläche gelangt, entsteht eine Quelle.
F Wasser aus Quellen fließt in Bächen hin zu tieferen Lagen. Vereinigen sich Bäche, entstehen Flüsse. Diese Transportieren das Wasser bis zum Meer zurück. Auch im Untergrund kann Wasser bis ins Meer gelangen. Der Kreislauf schließt sich.
Entlang von Wasserläufen ändern sich die vorherrschenden Bedingungen deutlich. Sie werden deshalb von der Quelle bis zur Mündung in Ober-, Mittel- und Unterlauf eingeteilt.


Abb. 2: Schnelle Strömungen, Wasserwirbel und geringe Wassertiefe zeichnen Gebirgsbäche aus.
Tritt Grundwasser auf natürliche Weise an die Oberfläche, bildet sich eine Quelle. Bei geneigtem Gelände sammelt sich das austretende Wasser in Erosionsrinnen. Es fließt als Bach oder Fluss ab. Die Temperatur des aus dem Boden kommenden Wassers schwankt wenig und der Sauerstoffgehalt ist gering. In und um das Quellwasser bildet sich eine spezialisierte Tier- und Pflanzenwelt aus. Strudelwürmer, kleine Muscheln und Steinfliegen sind häufig zu finden. Beispiele für Quellen in Österreich sind Pießling-Ursprung und Palfauer Wasserloch.
Nahe der Quelle sind Fließgewässer meist schmal und flach. Kleine Fließgewässer werden als Bach bezeichnet. Oberläufe liegen meist in steilerem, oft felsigem Gelände. Sie haben schnelle Strömungen, die je nach Gegebenheiten stark variieren. Vor allem Gebirgsbäche fließen durch starkes Gefälle und zeigen eine starke Strömung. Diese schwemmt feinere Sedimente fort, weshalb das Bachbett felsig und steinig ist. Mitgeschwemmte Steine und Geröll ändern das Bachbett und den Uferbereich häufig. Das an Steinen und Stufen verwirbelte Wasser trägt viel Sauerstoff in sich.
Scanne den QR-Code und sieh dir das Video zum Pießling-Ursprung an!

Teile die Infos im Video in zwei Gruppen, naturwissenschaftliche und nicht naturwissenschaftliche! Schreibe je Gruppe einen kurzen Text!
Quirle mit einem Schneebesen Wasser in einem Glas kräftig durch! Was geschieht? Erstelle eine Hypothese, weshalb Wasser in Oberläufen so sauerstoffreich ist!

Abb. 3: Eintagsfliegenlarve
Bei starker Strömung leben Fische meist am Boden. Plankton und frei im Wasser lebende Arten fehlen. Sie würden fortgeschwemmt werden. Wasserpflanzen finden im steinigen Untergrund keinen Halt. Einzellige Algen, vor allem Kieselalgen, kommen jedoch als Belag auf Steinen vor. Da Primärproduzenten fehlen, dienen ins Wasser gelangte Blätter und Pflanzenreste der Ufervegetation als Nahrungsgrundlage. An Stellen geringerer Strömung, unter Steinen und nahe am Ufer, leben kleine Tiere wie Eintagsfliegen- und Steinfliegenlarven, Langtasterwasserkäfer und Flohkrebse. Ist das Wasser tief genug, trifft man auf die Bachforelle. Sie ernährt sich von Insekten und kleineren Fischen. Moos wächst auf aus dem Wasser ragenden Steinen. Am Ufer findet sich Vegetation mit einer Vielzahl Insekten.
In Bereichen geringer Strömung lagert sich Sediment ab. Kiesbänke und kleine Inseln entstehen. Sie erzeugen unterschiedlichste Strömungs- und Lebensbedingungen. Die Artenvielfalt erhöht sich. Elritze und Groppe leben hier, ist das Wasser tief genug auch die größere Bachschmerle. Flussmützenschnecken saugen sich an Steine an. So können sie in strömungsreichen Gewässern leben.

Abb. 5: Bachforellen werden bis zu 80 cm lang. Sie sind sehr revierbezogen.

Abb. 7: Stellen geringer Strömung bieten Lebensraum für Wasserbewohner. geringe Strömung

Abb. 4: Langtasterwasserkäfer
Erinnere dich, wie atmen Insekten wie der Langtasterwasserkäfer und die Grundwanze, die in Bächen leben? Beschreibe ihre Methode!

Abb. 6: Elritzen sind kleine Schwarmfische.
Sieh dir Bachforelle und Elritze gut an! Weshalb können sie mit Strömung gut umgehen?

Abb. 8: Flussmützenschnecke auf einem Stein.
Scanne den QR-Code und sieh dir an, wie Flussmäander entstehen!

Folge auf Goolge Maps dem Verlauf der Donau! Finde Gleithänge und Altarme!
Besuche einen Fluss in deiner Umgebung! Versuche Stellen starker und schwacher Strömung auszumachen! Wie sieht das Ufer in dem jeweiligen Bereich aus? Wie klar ist das Wasser? Falls du zum Grund sehen kannst, woraus besteht der Boden? Achte auf die Vegetation am und im Wasser ! Kannst du Tiere erkennen? Notiere alles und verfasse eine Beschreibung des Flusses! Vergleiche mit dem, was du gelernt hast!

Abb. 15: Malermuschel, achte auf den Fuß. Sie leben in langsam fließendem Wasser. Muscheln reagieren sehr empfindlich auf Verschmutzungen. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht.
Abb. 12: Betrachte die Barbe! Welche Anpassungen ans Leben im Wasser erkennst du? Benenne sie und beschreibe ihre jeweilige Funktion!

Abb. 16: Libellenarten wie die Gemeine Keiljungfer sind an Flüssen weit verbreitet.
Kleine Wasserläufe treffen und vereinigen sich auf ihrem Weg. Die Wassermenge wird größer, das Bett, in dem sie fließt breiter und tiefer. Das Gefälle verringert sich und die Fließgeschwindigkeit nimmt ab. Wächst der Wasserlauf genügend an, spricht man von einem Fluss. Flüsse gestalten ihre Uferbereiche durch das Abtragen von Erde und Gestein beständig um. Sie bilden dabei Flusswindungen aus die man Mäander nennt.
Die Lebensbedingungen in Flüssen unterscheiden sich je nach Strömung, Untergrund und Lichtverhältnissen. In strömunsarmen Uferzonen lagern sich Sedimente ab. Der Grund besteht aus Kies oder ist sandig, seltener schlammig. Auf ihm finden
Algen und Wasserpflanzen Halt. Sie bilden mit aus dem Oberlauf angeschwemmtem organischen Material und Plankton die Nahrungsgrundlage. Im Sediment leben Krebstiere, Würmer und Insekten wie Grundwanzen. Kleine Fische finden sich in Ufernähe, wo sie größeren Räubern und der Strömung entgehen.
Plankton, Algen und Pflanzen benötigen Sonnenlicht, um zu gedeihen. Die Lichtmenge im Wasser hängt von der Ufervegetation und Klarheit des Wassers ab. Schmale Wasserläufe sind oft vollständig von Bäumen beschattet. Wasserpflanzen und Plankton gedeihen schlecht und das Wasser ist nährstoffärmer.

Abb. 9: Flussmäander, achte auf die innen liegenden Sedimentablagerungen (hell).


Abb. 10: Algen und Pflanzenbewuchs bei schwächerer Strömung.
Zur Mitte eines Flusses hin wird das Wasser tiefer und die Strömungsgeschwindigkeit höher. Hier fühlen sich größere Fische wohl. Verbreitete Arten sind Äsche und Barbe.

Abb. 11: Äschen leben in Bereichen schnellerer Strömung mit Kiesuntergrund. Meist am Übergang zwischen Oberlauf und Unterlauf. Sie werden 30 cm – 50 cm groß.

Abb. 13: Edelkrebse graben Wohnhöhlen. Sie mögen nährstoffreiches Wasser und reagieren empfindlich auf Verschmutzung. Sie werden vom eingeschleppten Signalkrebs verdrängt.

Abb. 12: Barben mögen Strömung und leben bodennah. Sie ernähren sich von kleinen Wirbellosen im Boden und Fischen. Wie viele Fische ziehen sie zum Laichen flussaufwärts.

Abb. 14: Libellenlarven wie die der Gemeinen Keiljungfer, leben am und im Boden. Sie lauern dort ihrer Beute, vor allem kleinen Krebstieren und Fischen, aber auch anderen Larven auf.
Im Unterlauf fließt das Wasser meist durch flaches Gelände. Die Strömungsgeschwindigkeit ist gering. Vereinigen sich Flüsse, entstehen Ströme. Breite, tiefe Wasserläufe, die viel Wasser transportieren. Wegen der geringen Fließgeschwindigkeit kann Sonneneinstrahlung die oberen Wasserschichten erwärmen. In ihnen gedeiht Plankton gut. Auf seinem bisherigen Weg konnte das Wasser viele Nährstoffe aufsammeln. Der Sauerstoffgehalt ist hingegen gering. Durch die geringe Strömung kann das Wasser Sedimente nicht mehr mitreißen und sie lagern sich am Boden ab. Der Grund von Unterläufen ist meist sandig bis schlammig. Abhängig von der Klarheit des Wassers wachsen Wasserpflanzen in der Regel üppig. Da der Fluss im Laufe der Zeit sein Bett verändert und in unregulierten Bereichen über die Ufer treten kann, entstehen im Umfeld Aulandschaften

17: Mündungsdelta eines Chiemseezuflusses. Achte auf die Sedimentablagerungen. Deltas der großen Ströme sind viele km weit.


Am Meer verbreitern sich Wasserläufe weiter zur Mündung. Verzweigt sich der Fluss durch Sedimentablagerungen, spricht man von einem Delta. Im Mündungsgebiet entstehen oft weitläufige Feuchtgebiete mit einer eigenen Artenvielfalt. Fische kommen artenreich vor. Brachsen bevorzugen schlammigen Grund mit dichtem Pflanzenwuchs. Dort finden sie Deckung und Nahrung. Die bis 80 cm großen Fische ernähren sich von Insektenlarven, Würmern und Schnecken nach denen sie im Schlamm suchen und Wasserpflanzen. Sie leben auch in Seen.
Erkläre mit deinem Wissen über den Grund von Unterläufen, warum das Wasser großer Flüsse und Ströme oft trüb ist!
Zander gehören zur Familie der Barsche, was sich an der geteilten Rückenflosse zeigt. Die etwa 1 m großen Fische jagen kleinere Fische wie Rotfedern und andere Barsche. Männchen graben flache Gruben in Sand und Kies, in die das Weibchen den Laich ablegt. Die Fischlarven leben im freien Wasser und ernähren sich von tierischem Plankton.
Europäische Welse sind die größten Süßwasserfische Europas. Sie wachsen ein Leben lang. Es wurden Exemplare von fast drei Metern Länge gefangen. Erwachsene Tiere bevorzugen warme, langsam fließende bis stehende Gewässer mit Wasserpflanzenbewuchs, in dem sie sich tagsüber aufhalten. Jungtiere sind auch in Bereichen stärkerer Strömung zu finden. Welse sind nacht- und dämmerungsaktive Raubfische. Sie ernähren sich von ziemlich allem, was sie überwältigen können. Ihre Sinne sind gut ausgeprägt.
Flussbarsche haben wie Zander eine geteilte Rückenflosse. Typisch sind die Streifen und rötlichen Brust- und Afterflossen. Sie sind sehr anpassungsfähig, bevorzugen aber tiefe, strömungsarme oder stehende Gewässer mit steinigem Untergrund. In Flüssen leben Flussbarsche meist in Ufernähe. Der größte Fluss Österreichs ist die Donau. Ihre beiden Quellflüsse, Brigach und Breg entspringen in Deutschland im Schwarzwald. Die Donau durchfließt den nördlichen Teil Österreichs. Viele große Flüsse Österreichs wie Inn, Traun, Enns oder Drau münden in der Donau. Sie ist der zweitlängste Fluss Europas, fließt durch mehrere Länder und mündet schließlich im Schwarzen Meer

Suche auf einer Karte mit Satellitenansicht (z.B. Google Maps) nach den Mündungen von Elbe, Nil, Kongo und Amazonas! Sieh dir den Verlauf der Wasserwege und die Umgebung der Mündung gut an! Welche Mündungen sind Deltas und welche nicht? Was fällt dir beim Nil im Vergleich zur umgebenden Landschaft auf?

Abb. 18: Die Große Flussmuschel bewohnt langsam fließende Gewässer und Seen auf Sandgründen. Die Verschmutzung der Flüsse durch Industrieabwässer haben sie stark zurück gedrängt.

Abb. 21: Rotfedern sind etwa 30 cm große Schwarmfische.

Abb. 22: Europäischer Wels
23: Flussbarsch †
Finde den Verlauf der Donau auf einer Karte! Notiere, durch welche Länder sie fließt! Mündet ein Fluss deiner Umgebung in die Donau? †

Abb. 27: Biber nagen Bäume rundherum an, bis sie umfallen. Dadurch gelangen sie an Zweige, Rinde und Blätter.
Recherchiere im Internet, wo es in deinem Bundesland Biber gibt! Welche Informationen werden noch gegeben? Notiere dir, was dir am wichtigsten erscheint! Hast du schon einmal einen Biber gesehen, wenn ja wo? Tauscht euch in Teams aus und vergleicht eure Rechercheergebnisse!
Wodurch gestalten Biber die Landschaft in ihrem Revier maßgeblich mit und weshalb könnte das zu Konflikten mit Menschen führen?
Wie häufig kommen die natürlichen Fressfeinde des Bibers in Europa vor? Welche Folgen kann es langfristig haben, wenn Biber geschützt sind und nicht bejagt werden dürfen?


Gesundheitswächter!
Fischotter jagen vor allem geschwächte und kranke Fische, die sie leichter erbeuten können. So sorgen sie dafür, dass Fischbestände gesund bleiben. Diese Rolle fällt Fressfeinden ganz allgemein zu. Für die bejagten Populationen ergibt sich also auch ein Nutzen. Wechselbeziehungen in der Natur sind vielschichtig.
Stelle eine Vermutung auf, weshalb Fischotter dicht bewachsene Ufer bevorzugen!
Flüsse und ihre Umgebung bieten Lebensraum für Vögel und Säugetiere. Biber gehören zu den Nagetieren und stehen in Europa unter Schutz. Durch ihren speziell geformten Schwanz, der Kelle, als Antrieb und Steuer, ihre Schwimmhäute an den Hinterfüßen und ihr dichtes, wasserabweisendes Fell, sind sie gut an das Leben im Wasser angepasst. Biber leben an allen Arten fließender und stehender Gewässer.

Zähne Kelle


Schwimmhäute
Welche Probleme können eingeschleppte Arten mit sich bringen? Denke daran, was du in der zweiten Klasse dazu gelernt hast!

Abb. 25: Von Bibern errichteter Damm mit Stauwasser. Im Hintergrund die Biberburg.
Abb. 24: Europäischer Biber
Die etwa 1 Meter großen Tiere bilden Familien. Jede Familie beansprucht ein Revier für sich und baut darin eine Biberburg. Biber bauen Dämme, mit denen sie Wasser um ihre Biberburg stauen. So ist diese nur schwimmend erreichbar. Biber sind Pflanzenfresser. Neben Kräutern, Gras und Sträuchern fressen sie Zweige, Rinde und Blätter von Bäumen. Dazu nagen sie den Stamm rundherum ab, bis der Baum fällt. Natürliche Fressfeinde sind Braunbär, Luchs und Wolf.
Belüftung
Wohnkammer Putzkammer

Winterspiegel
Sommerspiegel
Abb. 26: Querschnitt durch eine Biberburg. Die Ausgänge liegen immer unter Wasser.
Fischotter zählen zu den Mardern. Mit ihrem langgezogenen Körper, den Schwimmhäuten und isolierendem Fell, sind sie gute Schwimmer und Taucher. Sie leben an fischreichen, flachen Flüssen und in Überschwemmungsgebieten mit klarem Wasser und stark bewachsenen Ufern sowie in Küstengebieten. Fischotter graben Uferbauten, deren Eingang unter Wasser liegt. Sie jagen kleine und geschwächte Fische sowie Krebse, Wasservögel und andere Tiere. Wolf, Luchs und Seeadler sind Fressfeinde des Fischotters. Die Zerstörung seines Lebensraumes bedrängt ihn in Europa stark. Bisamratten haben sich als eingeschleppte Art (Neozoon) aus Nordamerika in Europa verbreitet. Sie ähneln Bibern, sind aber kleiner mit schmalem Schwanz. Bisamratten sind gute Schwimmer. Statt Schwimmhäuten tragen sie steife Haare, die Schwimmborsten an den Zehen. Sie vergrößern ihre Pfoten paddelartig. Bisamratten bauen Höhlen im Uferbereich oder Bisamburgen aus Schilf. Sie fressen Wasser- und Uferpflanzen, Knollen und Früchte. In vegetationsarmen Monaten weichen sie auf Insekten, Schnecken, selten Frösche und Fische aus.

Pfote


Abb. 28: Eurasische Fischotter sind gute Schwimmer. Achte auf die Schwimmhäute.

Abb. 29: Bisamratten ähneln Bibern. Der schmale Schwanz hilft beim Unterscheiden.

Wasseramseln sind 20 cm große Singvögel. Sie leben an schnell fließenden Bächen und Flüssen mit steinigem bis kiesigem Untergrund. Sie jagen im Wasser lebende Fliegenlarven und Wasserkäfer. Die Vögel picken ihre Beute vom Boden oder der Wasseroberfläche, oft mit dem Kopf im Wasser. Ihre häufigste Methode ist tauchen Unter Wasser drehen sie Steinchen um und ziehen Insektenlarven aus dem Untergrund. Zur Aufzucht der Jungen bauen Wasseramseln Kugelnester in Hohlräume ihrer Umgebung.

Abb. 31: Wasseramsel bei der Jagd im flachen Wasser.

Eisvögel leben an Wasserläufen mittlerer Strömung und stehenden Gewässern klarem Wassers mit Beständen kleiner Fischen. Die 18 cm großen Vögel jagen Fische, Insektenlarven, Kleinkrebse und Kaulquappen. Eisvögel jagen mittels Stoßtauchen Von einem Aussichtspunkt, der Sitzwarte , aus überblickt er das Wasser. Erspäht er Beute, stürzt sich der Vogel kopfüber ins Wasser und schnappt mit seinem Schnabel zu. Zur Balz beschenken Männchen Weibchen mit Fischen, die sie mit einer Verbeugung überreichen. Bruthöhlen werden in die Erde von Steilufern oder Wurzeltellern umgestürzter Bäume gegraben und sechs bis acht Jungen darin großgezogen.
Kormorane leben an Fluss- und Seeufern sowie an Meeresküsten. Die ein Meter großen Vögel leben sowohl standortgebunden, als auch als Zugvögel. In Österreich wurden Kormorane durch Jagd und Lebensraumvernichtung stark dezimiert. Heute überwintern Kormorane im Nordosten Österreichs Brutgebiete bestehen am Neusiedlersee und am Bodensee. Kormorane ernähren sich von Fischen. Sie jagen, was ihr Lebensraum ihnen bietet. Die Vögel tauchen bis zu eine Minute lang und packen ihre Beute mit dem Hakenschnabel hinter den Kiemen. Zur Fortbewegung unter Wasser nutzen sie ihre breiten Füße.



Reiher sind typische Aubewohner. In Österreich besiedeln Grau- und Silberreiher die großen Flusstäler von Donau, March und Mur und alle Gegenden, wo es größere Flüsse, Seen und Teiche gibt. Die ein Meter großen Vögel fischen im flachen Wasser ruhiger Seitenarme, vom Flusslauf abgetrennter Altarme oder den Uferbereichen stehender Gewässern. Sie fangen neben Fischen auch Frösche, Molche, Schlangen und Wasserinsekten. Vereinzelt fressen sie Nagetiere. Die Reiherbestände waren in Österreich und ganz Europa durch Jagd stark zurückgegangen, haben sich aber erholt. Fischer sehen die Vögel als Konkurrenz, weshalb Reiher nach wie vor getötet und Brutkolonien zerstört werden.

Abb. 33: Eisvogelpaar Balz mit Fischgeschenk.
Weshalb könnte der Eisvogel Gewässer bevorzugen, an deren Ufern ausreichend Büsche und andere Gehölze stehen? Tipp: Denke an seine Ernährung!

Abb. 37: Flussuferläufer, sie brüten auf bewachsenen Kiesbänken in Flüssen der Alpen und des Alpenvorlandes.
Finde durch Recherche heraus, wie der Flussuferläufer laut Roter Liste in Österreich eingestuft wird! Tipp: Das Umweltbundesamt gibt Listen dazu aus. Wie sieht es mit den anderen Vögeln auf dieser Seite aus?
Besuche einen Bach oder Fluss in deiner Umgebung! Beobachte die Vögel dort, am besten mit Fernglas! Was tun sie am und im Wasser? Versuche zu erkennen, ob sie sich von Wasserlebewesen ernähren! Mache Fotos und Notizen! Recherchiere online, um zu versuchen die Vögel zu bestimmen!
Was ist das? Tanjas Cousine Camila aus Brasilien macht zum ersten Mal Urlaub in Österreich. Sie ist von der für sie ungewohnten Natur begeistert und ständig am Erkunden. Camila schickt Tanja Fotos von ihren Entdeckungen, weiß aber offenbar nicht so recht, was sie da vor die Kamera bekommen hat. Hilf Tanja dabei, Beschreibungen und Erklärungen zu finden, damit Camila einordnen kann, was sie entdeckt hat!


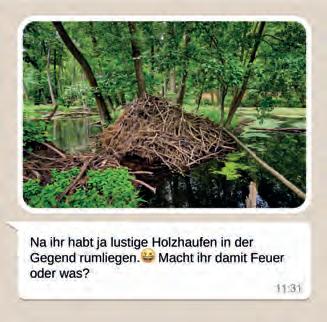


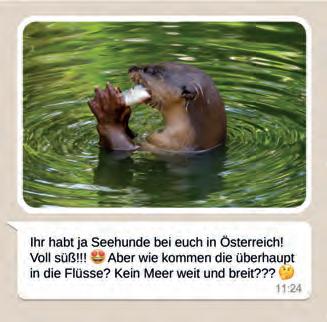

Wer lebt hier? Sieh dir die beiden Bilder gut an! Welche Strömungsverhältnisse kannst du erkennen? Wie sieht wohl der Boden unter Wasser aus? Wie das Ufer? Erstelle eine Liste an Lebewesen, die jeweils in und am Fluss leben könnten! Beschreibe sie auch kurz!




Wie kommts? Bäche und schmale Flüsse sind häufig durch die Vegetation an ihren Ufern komplett beschattet. Formuliere eine Erklärung dafür, dass diese Gewässer, auch bei geringer Strömung, meist wenige Primärproduzenten aufweisen! Welche Folgen hat das für das Nahrungsnetz in diesen Gewässern? Schreib einen kurzen Sachtext! Erstelle eine Liste an Lebewesen, die jeweils in und am Fluss leben könnten!
Gewässer in denen das Wasser nicht fließt, nennt man stehende oder stille Gewässer. Durch Wind und Temperaturunterschiede gerät die obere Wasserschicht jedoch in Bewegung, Strömungen können sich ausbilden. Viele Bewohner der langsam strömenden Unterläufe fühlen sich auch in stehenden Gewässern wohl und umgekehrt.
Tümpel und Weiher
Weiher sind kleine, stehende Gewässer geringer Tiefe. Weiher, die nur zeitweise Wasser führen, nennt man Tümpel. Weiher und Tümpel werden meist vom Grundwasser oder Regen gespeist, seltener durch Zuflüsse aus Wasserläufen. Je nach Nährstoffgehalt des Wassers, gedeihen Algen und anderes Plankton bis zum Grund. Durch die geringe Wassertiefe können Wasserpflanzen überall in Weihern wachsen, nicht aber in Tümpeln, die austrocknen. Für Insekten und Amphibien sind Tümpel ideal.
Viele Insekten, wie Libellen, Schwimm- und Wasserkäfer, Fliegen und Stechmücken legen ihre Eier im ruhigen, warmen Wasser von Tümpeln und Weihern ab. Die geschlüpften Larven leben darin, bis sie sich zum erwachsenen Tier entwickeln. Insektenlarven sind wichtige Nahrung für andere Insekten wie Wasserläufer und Gelbrandkäfer sowie Kaulquappen, Vögel und in größeren Gewässern die dort lebenden Fische.

Abb. 2: Im Wasser von Weihern tummeln sich viele Kleinstlebewesen, auch aus dem Boden.
Amphibien legen ihren Laich in Lacken und Tümpeln ab. Die daraus schlüpfenden Kaulquappen bevölkern kleine Gewässer oft dicht. Trocknet das Gewässer aus, sterben die Kaulquappen. In Österreich sind Teichmolch, Gelbbauchunke, Wechselkröte und Grasfrosch typisch. Ihre Paarungsrufe sind oft deutlich zu vernehmen.

mm

Abb. 5: Stechmückenlarven treten in Tümpeln oft in großer Zahl auf.


Abb. 6: Kaulquappen sind in Tümpeln durch Austrocknung gefährdet.
Die Wasserbedingungen in Weihern sind wegen der geringen Tiefe überall ungefähr gleich (keine Schichtung). Sind sie tief und groß genug, frieren sie nicht bis zum Grund zu und Fische können darin überleben. Wasserlebewesen brauchen Verbindungen zu Fließgewässern, um in Weiher zu gelangen (geschlossener Lebensraum). Oder der Mensch hat sie ausgesetzt. Künstlich angelegte Weiher nennt man Teiche. In sie werden oft Fische als Zierde (Goldfische), zur Fischzucht, oder für den Angelsport ausgesetzt.


Abb. 7: Teichmolche passen sich in der Laichzeit ans Wasser an (sieh den Schwanz an).
Abb. 8: Karpfen sind typische Teichfische. Sie fühlen sich in warmem Flachwasser wohl. Als beliebter Speisefisch werden sie gezüchtet und geangelt.

Abb. 1: Tümpel sind Lebensräume auf Zeit.

Abb. 3: Algen, Rädertierchen und ein Krebstier.

Abb. 4: Gelbbauchunken besiedeln zeitweise bestehende Lacken. Die gelbe Farbe ist eine Warnung vor dem Gift, das sie bei Gefahr über die Haut absondern.
Besuche die Website herpetofauna.at und sieh dir die Amphibien Österreichs an! Beachte die Verbreitungsgebiete und Lebensräume! Welche Amphibien leben in deiner Umgebung? Verfasse zu einem von ihnen einen Steckbrief!

Abb. 9: Rotkehlchen baden sehr gerne. Kleine Tümpel und Uferbereiche sind dafür hervorragend geeignet.

11:
Denke an das Kapitel über Böden: Was bedeutet ein sehr feuchter und sauerstoffarmer Boden für die darin lebenden Mikroorganismen? Welche Folgen hat das für die Verfügbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen?

Abb. 12: Teichrohrsänger
Erarbeitet in Teams Handlungsanweisungen, um Schilfgürtel an Seen zu schützen! Welche Folgen für Tiere und Pflanzen gilt es zu vermeiden?

Abb. 13: Weiße Seerose
In der Tiefalgenzone herrscht dämmriges Licht. Gleichzeitig ist sie noch Teil der Nährschicht. Stelle eine Hypothese auf, weshalb sich Fische hier gerne aufhalten! Denke dabei an Bedürfnisse von und Bedrohungen für die Fische! Besprich deine Hypothese mit deiner Sitznachbarin, deinem Sitznachbarn!
Als See bezeichnet man größere, stehende Gewässer, die tief genug sind, um Schichten unterschiedlicher Lebensbedingungen auszubilden. Diese hängen von der vorhandenen Lichtmenge, der Temperatur und der Menge an Nährstoffen ab. Grundlegend wird zwischen Seegrund (Benthos) und Freiwasser (Pelagial) unterschieden.
Abb. 10: Bereiche unterschiedlicher Lebensbedingungen in einem See.
Der Bereich, in dem Licht bis zum Boden gelangt wird Uferzone genannt. Sie bietet ähnliche Lebensräume wie Tümpel und Weiher oder flache Bereiche gemächlicher Fließgewässer. Entsprechend beheimaten sie oft auch die gleichen Lebewesen. Die Uferzone wird noch weiter unterteilt.
Erlen-Weiden-Zone (Bruchwaldzone): Dieser Bereich ist nie oder nur zeitweise von Wasser bedeckt. Der Boden ist moorig und feucht mit wenig Sauerstoff. Pflanzen haben weite Wurzelnetze, um sich im weichen Boden zu halten. Hier wachsen Erlen, Weiden und Sumpf-Dotterblumen. Reiher, Krähen und Kröten sind typisch.
Schilfzone: Im Flachwasser direkt am Ufer wächst bevorzugt Schilfrohr. Pflanzen haben lange, elastische Halme, um mit wechselnden Wasserständen, Wellen und Wind zurecht zu kommen. Viele Vogelarten wie Rohrsänger, Teichhuhn oder Rohrdommel leben und brüten in der Schilfzone. Sie ist deswegen besonders schützenswert.
Schwimmblattzone: Im etwas tieferen Wasser leben Pflanzen, die am Grund wurzeln, deren Laubblätter aber an der Wasseroberfläche schwimmen. Die Blätter beinhalten dafür Luftkammern. See- und Teichrosen sind Beispiele. Libellen und Wasserläufer sind typisch und unter Wasser tummeln sich Strudelwürmer, Krebse und Insektenlarven.
Tauchblattzone: Hier leben Pflanzen vollständig untergetaucht. Typisch sind Krauses Laichkraut und Hornblatt. Neben vielen Tieren der Schwimmblattzone leben hier auch Fische. Besonders Jungtiere nutzen die an Verstecken reiche Uferzone zum Aufwachsen.
Tiefenalgenzone: Hier dringt nur noch spärlich Licht bis zum Grund vor. Armleuchterund Grünalgen finden geeignete Bedingungen und bilden in sauberen Gewässern oft dichte Rasen. Die Tiefalgenzone ist meist reich an Fischen
In tieferen Seeregionen, die Tiefenzone dringt kein Licht mehr zum Grund vor und es wachsen keine Pflanzen.
Schichten eines Sees
Nährschicht: In den oberen, lichtdurchdrungenen Wasserschichten gedeihen Primärproduzenten. Sie sind Nahrungsgrundlage und Sauerstoffproduzenten für andere Wassertiere. Es wird mehr Biomasse und Sauerstoff produziert als verbraucht. Da Primärproduzenten Nährstoffe verbrauchen, ist die Nährschicht nährstoffarm.
Zehrschicht: In Tiefen, in die kein Licht vordringt, leben keine Primärproduzenten. Dort lebende Tiere brauchen trotzdem Nahrung und Sauerstoff. Es wird weniger Biomasse und Sauerstoff produziert als verbraucht. Ohne größere Wasserbewegungen ist die Tiefe sauerstoffarm. Nährstoffe sinken in Form toten organischen Materials zum Grund. Da keine Primärproduzenten sie verbrauchen, ist die Zehrschicht nährstoffreich.
Kompensationsschicht: Sie liegt am Übergang zwischen Nährschicht und Zehrschicht. Hier wird so viel Biomasse und Sauerstoff verbraucht wie erzeugt.
Temperaturschichtung: Kälteres Wasser ist dichter ist als wärmeres und sinkt nach unten. Da Wasser bei 4°C am dichtesten ist, haben die tiefesten Wasserschichten diese Temperatur. Wasser friert von oben nach unten, sodass tiefere Gewässer im Winter nie vollständig zufrieren und den Lebewesen Rückzugsgebiete flüssigen Wassers bieten.
Jahreszyklus der Seen
Temperaturänderungen und starke Winde sorgen im Frühling und Herbst für Umwälzungen der Wassermassen. Nährstoffe, Sauerstoff und Temperatur werden gleichmäßig verteilt. Nährstoffe gelangen in die Nährschicht und stehen Primärproduzenten wieder zur Verfügung. Im Sommer erwärmen sich die oberen Wasserschichten, während es in der Tiefe kühl bleibt. Im Winter kühlen die oberen Schichten aus, während die Tiefe bei 4 °C bleibt. Es stellt sich jeweils ein Gleichgewicht ohne größere Wasserbewegung ein. Viele Seen sind durch Gletscherschmelzen entstanden und bilden geschlossene Lebensräume. Sie zeigen eine typische Artenvielfalt, die sich nur schwer erneuern kann. Neben dem Karpfen sind Giebel und Schleie typische Seefische Österreichs. Beide bevorzugen Gewässer mit weichem Untergrund und Pflanzenbewuchs. Sie ernähren sich von Würmern, Insektenlarven und anderen Kleintieren sowie von Wasserpflanzen. Die etwa 40 cm groß werdenden Fische laichen zwischen April und Juni an Wasserpflanzen ab. Die Larven und Jungtiere halten sich in Ufernähe auf. Der Hecht ist ein verbreiterter Raubfisch. Er hält sich gerne in Ufernähe auf und lauert in Schilfgürteln oder ähnlichem dichten Bewuchs, der ihm Deckung liefert. Manche Hechte jagen im Freiwasser, wo sie Schwärmen von Renken nachstellen.

Abb. 14: Giebel beim „Grundeln“, dem Suchen nach Nahrung im Seeboden.

Abb. 15: Die Schleie ist von einer dicken, antibakteriellen Schleimschicht bedeckt.
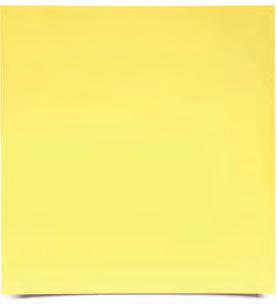

Vogelreichtum! Österreichs Gewässer sind Heimat vieler Wasservögel. Stockente und Höckerschwan lassen sich oft auf Teichen in Parks nieder. Haubentaucher, Reiherente, Blässhuhn Graugans und verschiedene Möwenarten sind in natürlicheren Umgebungen an Seen häufig anzutreffen.

Abb. 18: Haubentaucher bei der Balz. Achte auf den Schnabel, was könnten Haubentaucher fressen?

Abb. 19: Blässhühner sind Pflanzenfresser, die im Schilf versteckt umfangreiche Nester bauen.

Abb. 16: Hecht lauernd zwischen Wasserpflanzen. Weibchen können bis zu 150 cm lang werden.

Österreich ist reich an Seen. Viele Seen, wie der Attersee, Hallstätter See und Traunsee finden sich im Salzkammergut. Sie sind mit über 100 Metern Tiefe recht tief. Wörthersee und Ossiacher See liegen in Kärnten. Sie sind weniger tief und beliebte Badeseen. Der Neusiedlersee im Burgenland ist mit einer Fläche von 320 km² nach dem Bodensee der größte See Österreichs. Seine Tiefe beträgt nur 1,8 Meter. Deshalb verfügt er über keine Wasserschichten und zählt streng genommen gar nicht zu den Seen. Der Neusiedlersee ist Kern eines bedeutenden Naturschutzgebietes. Durch den Klimawandel ist er vom Austrocknen bedroht


Abb. 17: Luftaufnahme des Neusiedlersees. Achte auf den breiten Schilfgürtel. Oben links ausgetrockneter Seeboden.
Denke daran, wie Seen oft entstanden sind! Formuliere eine Begründung, weshalb Österreich so reich an Seen ist! Denkst du, der Neusiedlersee ist auf gleiche Weise entstanden wie die Seen im Salzkammergut? Begründe deine Antwort!
Welcher See liegt am nächsten zu deinem Wohnort? Recherchiere online seine Eigenheiten und welche Tiere und Pflanzen ihn bewohnen! Besuche ihn und mache dir selbst einen Eindruck!
Welchen Lebensraum hast du in der 2. Klasse kennengelernt, der stark zerstört wurde und heute renaturiert wird?

Kleine Eingriffe, großer Unterschied!

Oft werden Tümpel und Mulden aufgeschüttet, Wege befestigt, so dass keine Schlaglöcher und Rinnen entstehen können und Flächen begradigt. Das Ziel ist, dass nach Regen keine lästigen Wasseransammlungen entstehen und die Fläche für den Menschen besser nutzbar ist. Genau diese kleinen Wasseransammlungen sind allerdings für viele Amphibien und Insekten enorm wichtig, da dort ihr Nachwuchs aufwächst. Die Tiere finden also keine geeigneten Bedingungen zur Fortpflanzung vor und werden aus dem Lebensraum verdrängt. Die Gelbbauchunke ist eine davon betroffene Art.
Erörtere, warum die Verdrängung einzelner Amphibien- und Insektenarten aus einem Lebensraum Auswirkungen auf alle darin lebenden Arten haben kann!
Suche in deiner Umgebung nach Orten, wo sich Wasser nach dem Regen sammeln kann! Beurteile wie geschützt die Stellen liegen, wie stark sie Sonneneinstrahlung und Verdunstung ausgesetzt sind und wie gut sie sich als Laichplätze für Amphibien eignen würden!
Recherchiere, wo es in Österreich Wasserkraftwerke gibt und von welchem Typ sie sind! Suche Bildmaterial dazu, so dass du siehst, wie das Bauwerk in die Natur eingreift! Tipp: Auf online Satellitenkarten lässt sich oft viel erkennen!
Gibt es in deiner Nähe ein (Klein)Kraftwerk? Besuche es und sieh dir das Bauwerk und die Umgebung an!
Menschen beeinflussen Gewässer vielfältig. Zum Hochwasserschutz und zur Landgewinnung wurden die meisten Fließgewässer Europas begradigt und die Flussbetten baulich befestigt (reguliert). Dadurch fehlen die Windungen und Strukturen, die unterschiedliche Strömungsverhältnisse und Lebensbedingungen erzeugen. Durch Regulierung wird die Ufervegetation stark reduziert oder komplett zerstört. Ist das Flussbett aus Beton, fehlt ein natürlicher Gewässerboden, den die vielen Bodenbewohner des Wassers brauchen. Viele Arten finden keinen Lebensraum mehr vor, die Artenvielfalt schwindet massiv.


Abb. 1: Flussregulierungen. Der Wienfluss verläuft im Stadtgebiet stark reguliert (a). Oft werden große Felsbrocken zur Stabilisierung von Uferböschungen eingesetzt (b).
Heute werden Wasserläufe oft wieder rückgebaut um einen möglichst natürlichen Zustand herzustellen. Man spricht von Renaturierung. Es gilt einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen eines gesunden Lebensraums und dem Hochwasserschutz zu finden.
Wehre und Kraftwerke
Wehre sind Bauwerke zur Stauung von Wasser. Sie steuern die Durchflussmenge und den Wasserstand von Gewässern. Die dadurch veränderten Lebensbedingungen sind für einige Arten nicht mehr geeignet. Wehre stören die natürliche Verbindung innerhalb von Wasserläufen und bilden Barrieren für Lebewesen Fische auf Laichwanderung können Wehranlagen nur schwer oder gar nicht überwinden. Mitgeschwemmtes Material wird daran gehindert, flussabwärts zu gelangen, was die natürliche Bodenbildung in Wasserläufen stört.

Abb. 2: Talsperren gleichen Schwankungen der Wassermenge aus, die für den Lebensraum Fluss allerdings wichtig sind. Stelle dir vor, Fische möchten hier flussaufwärts wandern.
Wasserkraftwerke wandeln die Bewegungsenergie des Wassers in elektrische Energie um. Sie erzeugen keine Abgase, sind also klimafreundlich, greifen jedoch stark in Gewässer ein. Speicherkraftwerke stauen Flüsse. Ein Stausee entsteht und überschwemmt das Gebiet vor dem Staudamm. Flussabwärts fließt weniger Wasser als zuvor, teilweise trocknet der Wasserlauf unterhalb des Staudamms aus. Auch der Grundwasserspiegel ändert sich. Turbinen von Laufkraftwerken sind für Wasserlebewesen, besonders Aale schwer zu passieren. Die Entnahme von Energie ändert das Fließverhalten des Flusses. Kleinkraftwerke zur regionalen Stromversorgung werden zunehmend populär. Für Ökosysteme stellen sie eine große Herausforderung dar.


Verschmutzung durch den Menschen
Europa hat strenge Gesetze zum Schutz der Gewässer. Trotzdem ist die Verschmutzung von Gewässern eine Gefahr für die Ökosysteme. Abwässer der Industrie und vor allem der Landwirtschaft enthalten Schadstoffe, die sich durch die Wasserläufe verbreiten. Schadstoffe in der Luft lösen sich im Wasser und belasten es zusätzlich. Vor allem Muscheln und Krebse reagieren empfindlich auf Verschmutzungen und sterben in belasteten Gewässern aus. Die Artenvielfalt ist generell bedroht.
Gelangen Düngemittel aus der Landwirtschaft ins Wasser, fördern sie das Wachstum von Algen. Algenblüten können entstehen. Manche Algen setzen Giftstoffe frei und Bakterien, die abgestorbene Algen zersetzen, verbrauchen den Sauerstoff im Gewässer. Die Tiere im Wasser sterben. Geringe Wasserstände und hohe Wassertemperaturen in Folge des Klimawandels begünstigen das Auftreten von Algenblüten.


2022 kam es in der Oder, einem Fluss in Deutschland, zur Goldalgenblüte. Unmengen an Fischen verendeten in kurzer Zeit. Die Ursache war die übermäßige Einleitung von Abwässern aus Landwirtschaft und Industrie. In Kombination mit niedrigen Wasserständen führte dies zur Katastrophe. 2023 wiederholte sich das Sterben.
Andere Regionen der Welt regeln den Schutz von Gewässern weniger streng. Müll und ungefilterte Abwässer aus Industrie und Siedlungen werden oft direkt in Gewässer geleitet. Entsprechend schlecht geht es dem Ökosystem vor Ort.
Halte in Gewässern deiner Umgebung nach Algenbewuchs Ausschau! Vergleiche und achte auf Unterschiede zwischen den Gewässern! Wie tief sind sie? Sind sie beschattet? Aus welchem Material besteht der Untergrund? Gibt es Zufluss und Abfluss? Sind landwirtschaftliche Flächen in der Nähe? Erstelle eine Hypothese zu den Einflussfaktoren für Algenwuchs und wie sie wirken!

Unbedachte Folgen! Manche invasive Arten wandern von selbst ein oder werden vom Menschen unabsichtlich eingeschleppt. Der Mensch hat in Gewässern aber auch bewusst neue Arten eingeführt, die sich rasch vermehren. Sie sollten für die Fischerei und den Angelsport zur Verfügung stehen. Sie verdrängen dabei allerdings eingesessene Arten und gefährden die Vielfalt im Ökosystem. Durch Wasserläufe können sich die invasiven Arten verbreiten und werden so vielerorts zum Problem.

Zur Bewässerung und zum Betrieb von Kraftwerken wird Gewässern Wasser entzogen. Dieses Wasser fehlt im Lebensraum. Im Extremfall trocknen Gewässer aus und der Lebensraum wird zerstört. Vor allem die Landwirtschaft braucht durch die vom Klimawandel geförderte Trockenheit viel Wasser, um ausbleibende Regenfälle zu ersetzen. Auch Siedlungen, große Poolanlagen für den Tourismus, Golfplätze und ähnliches brauchen enorme Mengen Wasser. Meist ist der Mensch nicht bereit, auf etwas zu verzichten und nimmt die Zerstörung von Lebensräumen in Kauf. Dabei wird aber nur hinausgezögert, dass manche Verhaltensweisen auf lange Sicht nicht aufrechterhalten werden können. Die extra Zeit wird auf Kosten anderer Lebewesen erkauft.
Sand ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und für die Bauindustrie von enormer Bedeutung. Der dafür geeignete Sand wird im Meer sowie in Seen und Flüssen abgebaut. Auch Kies für die Bauindustrie wird aus Gewässern entnommen. Uferbereiche und Gewässerböden werden dabei abgetragen und stark geschädigt.

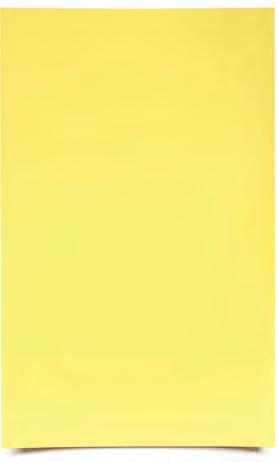

Abb. 9: Regenbogenforellen stammen aus Nordamerika. Sie wurden wegen ihres raschen Wachstums für die Fischerei eingeführt. Heute verdrängen sie die heimische Bachforelle.

Abb. 10: Silberkarpfen wurden zur Bekämpfung übermäßigen Algenwuchs ausgesetzt. Der Effekt war vernachlässigbar, heute stehen sie auf der schwarzen Liste der invasiven Fische in Österreich. Die Ursachen des Algenwuchs zu bekämpfen, hätte sich mehr gelohnt.
Gewässerschutz! Recherchiere online zu Wasserschutzmaßnahmen in Österreich? Suche dir eine Maßnahme aus, die dir besonders gefällt und bringe mehr über sie in Erfahrung!
Welchem genauen Zweck dient sie? Wo wird sie eingesetzt? Welche Mittel sind dazu notwendig? Wer ist daran beteiligt? Gibt es Hindernisse für die Anwendung? Welche Auswirkungen hat sie, abgesehen von der Schutzwirkung?
Verfasse einen kurzen Text dazu! Setzt euch in der Klasse zusammen und präsentiert eure Ergebnisse! Wählt drei Maßnahmen aus, die euch am wichtigsten erscheinen und diskutiert wie man ihren Einsatz fördern könnte!


Gewässerregulierung! Besuche Gewässer in deiner Umgebung und suche nach Regulierungsmaßnahmen! Gibt es Dämme? Baulich veränderte und befestigte Ufer? Wehre?
Versuche zu erkennen, wie die Anlagen wirken! Versuche auch zu erkennen, auf welche Art und Weise die Lebewesen der Gewässer von den Regulierungsmaßnahmen beeinflusst werden könnten! Betrachte und Dokumentiere alles genau! Mache Fotos!
Versuche in einer Recherche herauszufinden, ob Informationen zur Gewässerregulierung in deinem Heimatort zur Verfügung stehen! Die Website der Gemeinde ist manchmal ein guter Startpunkt. Ist deine Heimatgegend von Überschwemmungen bedroht? Versuche, aus den gefundenen Informationen besser zu verstehen, weshalb die Anlagen so errichtet wurden, wie du sie vorgefunden hast! Verfasse einen Bericht, in dem du deine Erkenntnisse darstellst!
3

Abb. 11: Ein Lachs versucht ein Wehr zu überwinden, um in sein Laichgebiet zu gelangen.
Gewässer meiner Umgebung! Deine Mitschülerinnen, Mitschüler und du habt nun schon in einigen Aufgaben Informationen über Gewässer in eurer Umgebung gesammelt und euch Gedanken darüber gemacht.
Tragt diese Informationen zusammen! Diskutiert darüber, was ihr alles in Erfahrung gebracht habt und macht euch ein genaues Bild von den Gewässern! Besprecht deren Bedeutung für euch und euren Heimatort! Spielen manche Lebewesen auch für den Menschen eine besondere Rolle? Welchen Einfluss hast du, habt ihr, haben die Menschen deines Heimatortes auf die Gewässer?
Verfasst ein Plakat „Unsere Gewässer“ und tragt darauf alles ein, was euch wichtig erscheint!
Wenn du in den Sommerferien an einem der Gewässer mit Freundinnen und Freunden freie Zeit genießt, vielleicht auch darin schwimmst und dich erfrischst, wirst du es wahrscheinlich mit anderen Augen sehen und vieles wahrnehmen, auf was du vorher nicht geachtet hast – vielleicht auch eine Verbindung mit dem Gewässer und seinen vielen faszinierenden Bewohnern spüren.








Intakte Lebensräume, Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung als auch attraktive Erholungsgebiete brauchen gesunde Süßgewässer. Biologinnen und Biologen arbeiten daran, die Zusammenhänge in Süßgewässern und deren Entwicklung zu verstehen, was die Voraussetzung für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang ist.


Viele Gewässer sollen renaturiert werden, um die Ökosysteme Europas vielfältiger und gesünder werden zu lassen. Dafür braucht es Fachleute, die wissen, welcher Zustand hergestellt werden soll und wie dieser erreicht werden kann. So bietet neben der Erforschung von Süßgewässern und deren Bewohnern auch der Umweltschutz ein vielseitiges Arbeitsumfeld für Biologinnen und Biologen.
Die Fischerei ist in Europa ein beliebtes Freizeitvergnügen. Fachleute müssen dafür sorgen, dass notwendige Vorschriften erarbeitet, umgesetzt und eingehalten werden. Fischerinnen und Fischer müssen entsprechend ausgebildet und informiert werden. Fischzucht ist als Wirtschaftszweig für einige Regionen von Bedeutung. Es braucht einiges an Fachwissen, um die Tiere gesund zu halten und Standards für ihr Wohlergehen sowie die Qualität der Lebensmittel zu garantieren. In Museen, Naturparks und auf den vielfältig angebotenen Veranstaltungen für Interessierte braucht es Fachleute, die ihr Wissen verständlich und lebhaft vermitteln können. Überall dort kommen Biologinnen und Biologen zum Einsatz.
Leben am und im Fluss! Untersuche einen kleineren, wenig tiefen Fluss in deiner Umgebung! Begib dich zu einem dir interessant erscheinenden Flussabschnitt in deiner Umgebung und folge der Anleitung!
Du brauchst: Skizzenpapier und Stift % Lupe % Fernglas % stabiler Kescher oder feines Netz bzw. Sieb % ein breiteres, flaches Gefäß % Gummistiefel
Verschaffe dir einen Überblick über das Gelände und versuche, Tiere zu entdecken! Bewege dich vorsichtig, um sie nicht aufzuschrecken! Benutze dein Fernglas! Betrachte die Vegetation und ordne sie ein! Notiere alles!
Fertige eine Skizze des Flusses an! Darin enthalten sein sollte: der Uferverlauf und grob die am Ufer wachsende Vegetation, etwaige Sand- oder Kiesbänke, größere Steine, Baumstämme u.ä., Stellen wo Geröll aus dem Wasser ragt, Bereiche schnell und turbulent fließenden Wassers, Bereiche glatt und einheitlich fließenden Wassers, Bereiche geringer Strömung, sonstige Besonderheiten. Wate ein Stück ins Wasser zu einer Stelle intensiverer, turbulenter Strömung. Platziere den Kescher am Grund mit der Öffnung in Strömungsrichtung! Wirble mit der Hand den Boden auf! Hebe eventuell Steine an, wenn der Grund steinig ist! Nimm dir 30 s – 60 s Zeit dafür.
Entleere den Kescher in dein flaches Gefäß! Spüle mit etwas Wasser nach, damit keine Tiere darin hängen bleiben. Fülle etwas Wasser in das Gefäß nach, sodass etwa 1 cm darin steht und verteile den Kescherinhalt etwas!
Beobachte, welche Lebewesen du im Gefäß siehst! Verwende die Lupe, um mehr Details zu erkennen! Mache Nahaufnahmen, falls du ein Handy hast! Notiere und skizziere, was du entdeckst. Versuche, eine grobe Zuordnung wie etwa Insekt, Krebstier, Schnecke, Wurm, .... Tipp: Wenn du Fotos der Tiere in die Google Bildersuche ziehst, besteht die Chance, über ähnliche Bilder herauszufinden, was du fotografiert hast. Auch KI Assistenten können Fotos deuten.
Bringe die gefangenen Lebewesen wieder zurück ins Wasser und wasche den Kescher gut aus!
Wiederhole den Vorgang an einer Stelle glatter und an einer Stelle geringer Strömung (hier musst du wahrscheinlich aktiv etwas Boden in den Kescher schaufeln).
Dokumentiere alles genau und übersichtlich!
Fasse zu Hause alles in einem Protokoll zusammen! Falls du es digital verfasst, füge auch deine Fotos ein! Tipp: Du kannst auch stehende Gewässer auf diese Weise untersuchen.


So schätze ich mich nach dem Großkapitel LEBENSRAUM SÜßWASSER selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
… den natürlichen Wasserkreislauf ausführlicher erklären und mit Skizzen veranschaulichen.
…die Bedingungen in Oberläufen von Flüssen beschreiben und wie sie den Lebensraum gestalten.
…die Bedingungen in Mittelläufen von Flüssen beschreiben und welche Lebewesen sich dort wohlfühlen.
…die Bedingungen in Unterlauf und Mündung von Flüssen beschreiben und welche Lebewesen dort beheimatet sind.
, Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
…einige Säugetierarten, die an Flüssen leben, aufzählen und Informationen zu deren Merkmalen und Lebensweise geben.
…Typische Vögel, die an Süßgewässern leben, beschreiben und benennen.
…den Lebensraum in kleinen stehenden Gewässern beschreiben und weiß, wie solche Gewässer genannt werden.
…Den Lebensraum See und seine Zonen, Schichten und zeitlichen Zyklen beschreiben
…einige Seen in Österreich nennen und kenne einige typische dort heimische Lebewesen.



…Einflüsse des Menschen auf Süßgewässer erörtern und Beispiele aus meiner Umgebung nennen.
…Zur Verschmutzung von Süßgewässern und Entnahme von Wasser und Sedimenten aus ihnen Stellung nehmen.
…Das Problem invasiver Arten in Süßgewässern unter Einbezug meines Wissens aus der zweiten Klasse darüber erörtern.
Wolfgang Engelhardt, Peter Martin, Klaus Rehfeld: Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher?: Pflanzen und Tiere unserer Gewässer (Kosmos 2020).
Kate Bradbury: Leben am Gartenteich: Einen Teich planen, anlegen und Tiere und Pflanzen beobachten (Dorling Kindersley Verlag 2022).
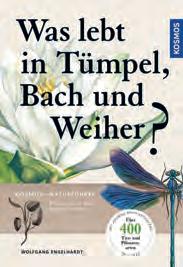



Absatzgestein: 51, 52
Albatros: 160, 168, 171
Algen: 61, 65, 67, 129, 130, 131, 153, 154, 160, 162, 163, 164, 166, 172, 177, 178, 183, 187
Alpen: 10, 30, 45, 55, 56, 57, 181
Ammoniten: 15, 16, 22, 57
Amphibien: 22, 84, 85, 107, 134, 138, 183, 186
Anthropologinnen/ Anthropologen: 39
Aorta: 104, 105, 106, 107, 108
Arktischer Ozean: 166
Atherosklerose: 120
Atlantischer Dorsch: 158
Atlantischer Hering: 131
Atlantischer Ozean: 125
Atmosphäre: 9, 20, 22, 68, 129, 176
Atmung: 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 104, 116, 156, 172
Bach: 176, 177, 178, 181
Bakterien: 20, 61, 62, 65, 67, 68, 79, 102, 129, 130, 153, 169, 187
Bandfüßer: 66
Bartwal: 150
Basalt: 9, 50
Bauchatmung: 87
Biber: 180
Binnenmeer: 125
Bisamratten: 180
Biolumineszenz: 126, 145
Biomolekül: 99
Biosphäre: 9, 176
Blässhühner: 185
Blut: 86, 87, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 134, 143, 155, 159, 168
Blutgefäße: 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 115, 117, 120, 121
Blutgerinnung: 97, 101, 114
Blutkapillare: 88, 114
Blutkreislauf: 104, 105, 108, 109, 113, 114, 115
Blutplasma: 97, 99, 114
Blutzelle: 97, 98, 99
Bodenalgen: 67
Bodenart: 71, 73
Bodentiere: 62, 65, 66
Bodentypen: 71, 77
Bodenverdichtung: 73, 74
Böhmische Masse: 55
Borstenwürmer: 154, 157, 158, 166, 169
Brachse: 134, 179
Bronchien: 86, 87, 88, 116
Bronchiolen: 86
Brustkorb: 85, 87, 88, 116
Darwin, Charles Robert: 34, 36
Delfin: 133, 151, Devon: 19, 21, 22, 133
Destruenten: 62, 65, 66, 68, 130, 154
Diabetes: 119, 120
Diffusion: 79, 80, 81, 83, 86, 90, 92, 98, 115, 134
Ebbe: 127, 155
Eisbär: 166, 167
Eisvögel: 181
Eiweiß: 79, 97, 102, 117
Element: 7, 8, 46, 63, 90
Energie: 7, 20, 73, 79, 92, 93, 104, 106, 109, 113, 116, 133, 134, 141, 156, 176, 186
Enzym: 68, 114
Erdbeben: 9, 10, 13, 59
Erdkern: 9
Erdmantel: 9, 10
Flussuferläufer: 181
Flut: 127
Flyschzone: 56
Fossilien: 15, 16, 20, 21, 22, 25, 33, 34, 36, 39, 43, 45, 55, 57, 133, 156, 157
Fotosynthese: 7, 9, 20, 62, 63, 67, 70, 79, 126, 129, 130, 160, 162, 166, 172
Fresszellen: 102, 120
Gabbro: 9
Galaxie: 7
Galle: 114
Gasaustausch: 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 106, 120
Gelbbauchunken: 183
Geologie: 19, 43, 45, 46,55, 59
Gesteinsarten: 45, 49, 54, 55
Gesteinszonen: 55, 57
Gezeiten: 127, 155
Glimmerschiefer: 52
Gneis: 52, 57, 59
Golfstrom: 127
Graureiher: 181
Granit: 9, 50, 52, 54, 55
Jura: 19, 25
Kalkalpen: 55, 56, 57
Kalksandstein: 54
Kambrium: 19, 20, 21
Kammerflimmern: 121
Känozoikum: 20, 21, 25, 29
Kapillaren: 86, 88, 92, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115
Granulozyten: 102
Grauwackenzone: 55, 56, 57
Grundwasser: 63, 72, 73, 176, 177, 183, 186
Karbon: 19, 21, 22
Karpfen: 183, 184
Katzenhai: 158
Kaulquappen: 84, 181, 183
Kellerasseln: 65
Kernreaktion: 7
Kiemen: 83, 84, 90, 91, 92, 93, 97, 104, 106, 131, 134, 138, 143, 146, 147, 155, 181
Kiemenhöhle: 91, 92, 93
Kiemendeckel: 90, 92, 93, 131
Kiemenreuse: 92, 134, 141, 147
Kladistik: 41, 42
Klimawandel: 47, 67, 68, 74, 129, 158, 166, 168, 172, 176, 187
Knochenfisch: 21, 33, 92, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 144, 146, 158, 163
Kohlendioxid (CO2): 63, 68, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 98, 99, 106, 113, 114, 129, 130, 172
Ernährung: 39, 101, 117, 118, 119, 120, 166, 181
Erosion: 57, 59, 72, 73, 162
Erythrozyten: 97, 99
Evolution: 15, 16, 22, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 67, 79, 80, 83, 87, 88, 90, 95, 98, 102, 105, 106, 134, 143, 144, 149, 156, 158, 159
Filtrierer: 130, 131, 147, 149
Fischotter: 180
Fliegenlarven: 62, 66, 177, 181
Flimmerhärchen: 86
Flossen: 131, 133, 141, 142, 143, 147, 149, 156, 158, 159, 160, 163, 164, 168
Flossenhaut: 133
Flossenstrahlen: 131, 133, 163
Flunder: 134, 158
Fluss: 21, 34, 49, 51, 59, 73, 125, 129, 138, 153, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 189
Hai: 29, 90, 92, 93, 131, 138, 146, 147, 151, 153, 156, 158, 164
Hämolymphe: 104
Haubentaucher: 185
Hecht: 132, 133, 134, 142, 185
Hering: 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 146, 158, 166, 171
Herzinfarkt: 121
Herzrhythmusstörungen: 121
Hominiden: 36, 37
Hominini: 36, 37
Hormone: 97
Hornmilben: 65
Humus: 61, 62, 65, 71, 72, Hundertfüßer: 65, 66
Indischer Ozean: 125, 127
Insekten: 22, 25, 26, 34, 65, 66, 80, 81, 104, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186
Immunantwort: 102, 114
Immunsystem: 102, 119
Kontinente: 9, 10, 12, 20, 25, 26, 29, 30, 125, 127, 162
Kontinentale Kruste: 9
Kontinentalplatte: 10, 12, 20, 25, 52, 56, 153
Korallen: 21, 57, 155, 156, 162, 163, 164, 172
Korallenriff: 146, 162, 163, 164
Kormoran: 181
Kraftwerke: 46, 186, 187
Krebstiere: 26, 65, 83, 91, 104, 130, 157, 158, 163, 168, 178
Kreide: 19, 25, 26, 29, 34, 43
Kreislaufsystem: 32, 83, 90, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 111, 113, 116, 117, 120, 123
Kristall: 49
Krustentiere: 91, 146
Kugelfisch: 163
Lamarck, Jean Baptiste de: 33
Lava: 8, 50
Leber: 85, 113, 114, 117, 119
Leukozyten: 97
Lockersediment: 152
Lodde: 166, 171
Luftblase: 81, 90
Luftkapillare: 88
Luftröhre (Trachea): 86, 87, 88
Lungenatmung: 85, 86
Lungenbläschen: 86, 87, 88
Lungenflügel: 86
Lymphe: 104, 114
Lymphozyten: 102
Lymphsystem: 113, 114
Magma: 8, 9, 49, 50, 52, 126
Makrele: 131, 142, 158
Marmor: 52, 54
Materie: 7, 8, 62, 154
Meer: 8, 10, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 51, 52, 56, 57, 91, 95, 120, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 179, 187
Meeresschildkröten: 133, 164, 172
Meeresströmung: 127, 129, 130, 145, 147, 153, 164
Mesozoikum: 20, 21, 25, 29, 133
Metamorphose: 52
Milben: 21, 62, 65
Milchstraße: 7
Minerale: 49, 52, 59
Mittellauf: 178
Mittelmeer: 30, 56, 125, 157
Molekül: 20, 49, 81, 99
Monozyten: 102
Möwen: 29, 160, 164, 168, 185
Mündung: 177, 179
Muscheln: 91, 130, 143, 155, 157, 158, 166, 169, 177, 178, 187
Muskel: 80, 84, 86, 87, 91, 104, 105, 107, 108, 109, 116, 119, 133, 134, 139, 142, 155, 156, 159
Mutation: 34
Muttergestein: 71
Myzel: 67, 68
Myzelnetzwerk: 67, 68
Nebenmeer: 125
Neogen: 19, 29, 30
Nesseltiere: 21, 145, 155, 164
Neusiedlersee: 72, 181, 185
Nieren: 113, 115, 117
Oberflächenspannung: 81
Oberlauf: 177, 178
Ohrwürmer: 62, 65
Ordovizium: 19, 21
Ozean: 9, 25, 125, 126, 127, 131, 142, 151, 166, 168, 172
Ozeanische Kruste: 9, 52
Paläogen: 19, 29, 42, 56
Paläozoikum: 20, 21, 25, 29
Parabronchien: 88
Pazifische Platte: 126
Pazifischer Ozean: 125, 126
Pelikan: 29, 160
Perm: 19, 20, 22, 25, 29
pflanzliches Plankton: 129, 131, 172
Pfortader: 114
Phyllit: 54
Pilze: 61, 62, 65, 67, 68, 71, 79
Pinguin: 29, 133, 168, 171
Plankton: 126, 129, 130, 131, 141, 142, 143, 145, 147, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 163, 166, 169, 172, 177, 178, 179, 183
Polarmeer: 166
Präkambrium: 20, 21, 25, 29
Primaten: 29, 36, 38
Protein: 97, 98, 100, 168
Protoplanet: 8
Pseudoskorpion: 66
Quartär: 19, 29, 30
Reptilien: 22, 25, 26, 29, 42, 85, 86, 87, 88, 107, Rochen: 130, 138, 146, 147, 158
Rohstoffe: 45, 46, 54, 59
Rohstoffverbrauch: 46
Rosenkäferlarven: 66
Rotauge: 132
Rotkehlchen: 183
Saftkugler: 66
Sauerstoff: 9, 20, 21, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 106, 107, 113, 114, 120, 121, 129, 134, 138, 153, 159, 168, 172, 177, 184, 185, 187
Saugatmung: 87
Säugetiere: 25, 26, 29, 33, 34, 36, 41, 42, 86, 88, 90, 95, 102, 106, 108, 113, 149, 156, 166, 180
Schelfmeere: 153, 159
Schluckatmung: 84, 85
Schnecken: 21, 62, 83, 155, 157, 163, 164, 177, 179, 180
Schnurfüßer: 65
Schrittmacherzellen: 108
Schwämme: 21, 80, 85, 154, 163
Schwarzerdeböden: 72
Schwarmverhalten: 141
Schwerkraft: 7, 8, 55, 110
Schwertfisch: 142
Sediment: 9, 16, 51, 52, 57, 153, 154, 177, 178, 179
Sedimentgestein: 9, 51, 52
Tang: 153, 154, 158, 172
Taucherkrankheit: 120, 159
Teichmolche: 183
Tiefsee: 10, 20, 126, 131, 142, 145, 146, 154, 155, 166, 169
Thrombose: 101, 159
Thrombozyten: 97
Thunfisch: 132, 133, 134, 142, 146, 158
See: 176, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189
Seeelefant: 160
Seehund: 160, 166
Seekuh: 160
Seelöwe: 159, 160
Seepferdchen: 163
Silur: 19, 21
Spinnentiere: 65, 66, 83, 104
Springschwänze: 62, 65
Stachelhäuter: 154, 157, 158, 169
Stammzellen: 97
Stechrochen: 158
Steinbutt: 158
Steinläufer: 66
Sterntaucher: 160
Stoffwechsel: 68, 79, 97, 99, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 123
Stoßatmung: 87
Straße von Gibraltar: 125
Stricklava: 50
Symbiose: 26, 67, 130, 162, 163, 169
Tintenfisch: 15, 22, 43, 143, 144, 151, 156, 160, 168, 169
Tracheensack: 80, 81
Tracheolen: 80
Trias: 19, 25
Tümpel: 183, 184, 186
Universum: 7
Unterlauf: 177, 178, 179, 183
Verdauungssystem: 113, 114, 134, 172
Versiegelung: 73, 74
Vögel: 15, 25, 26, 33, 34, 88, 108, 141, 147, 159, 160, 168, 180, 181, 183
Wasseramsel: 181
Wasserkreislauf: 172, 176
Wasserstoff: 7, 20, 99
Weichtiere: 21, 26, 91, 143, 155, 156, 157, 158, 160, 169
Weiher: 183, 184, 187
Wels: 179
Wirbeltiere: 21, 32, 33, 41, 42, 66, 97, 98, 99, 102, 105, 106, 108, 131, 133, 158, 159
Wundheilung: 97, 100
Zander: 179
Zentralalpen: 55, 56, 57
Zitteraal: 138
Zwerchfell: 87, 116
