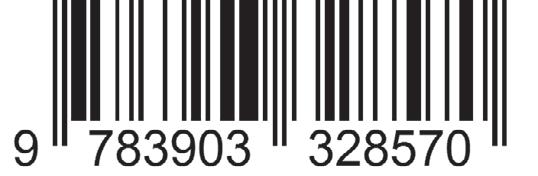Verlag




quirrel


Vorwort
Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Dieses Lehrbuch ist eine Neubearbeitung nach dem neuen kompetenzorientierten Lehrplan.
„Geografie für alle“ ist so aufgebaut, dass Ihre Schülerinnen und Schüler nach den einzelnen Kapiteln mit Hilfe der „Aufgaben für schlaue Köpfe“ ihr zuvor erlerntes Wissen wiederholen und vertiefen können. Damit wird ihre Selbsttätigkeit gestärkt und die Freude an Geografie und wirtschaftlicher Bildung geweckt. Die Arbeitsaufgaben zeichnen sich durch eine leichte Handhabung aus und sind farblich entsprechend der drei Kompetenzbereiche (Reproduktion – Transfer – Reflexion) gekennzeichnet.
Ebenso dienen vielfältige Arbeitsanregungen in der Seitenspalte neben dem Fließtext dem Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Die drei Anforderungsbereiche sind auch hier durch ein Farbleitsystem gekennzeichnet.
Schwierige Begriffe werden im Fließtext orange gekennzeichnet und in der Seitenspalte erklärt.
Im vorliegenden Lehrerheft finden sich folgende Bausteine:
• eine Fülle von 1:1 kopierbaren Arbeitsblättern
Verlag
• Vorgaben für schriftliche Lernstandserhebungen sowie deren Lösungen
• Lösungen für alle „Nun geht‘s los –Aufgaben für schlaue Köpfe“ aus dem Hauptbuch
All dieses Zusatzmaterial ist in der Praxis erprobt und soll Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern!
Und nun: Viel Spaß mit Ihrem neuen Geografiebuch!
Ihr Autorinnenteam

JAHRESPLANUNG
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFTSENTWICKLUNG
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
1. Österreichs Bevölkerung im Wandel
M1: Eine Pround Contra-Diskussion führen
LEHRERBUCHKAPITEL September … den Begriff „demografischer Wandel“ erklären und anhand von Beispielen auf Österreich beziehen. … die Ursachen und Folgen von Bevölkerungsveränderungen (z. B. Zuwanderung, Lebenserwartung) analysieren und beschreiben. … aktuelle statistische Daten zur Bevölkerungsentwicklung interpretieren und in eigenen W orten zusammenfassen. … die Auswirkungen der Bevölkerungsstruktur auf Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeit und das soziale Miteinander beurteilen. … Argumente zu einem gesellschaftlichen Thema sammeln, strukturieren und in Pround ContraPositionen gliedern. … eine eigene begründete Position vertreten und sachlich mit anderen diskutieren.
M2: Rollenspiele gestalten
2. Gesellschaftliche Vielfalt
3. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Wohnen und Arbeit
MONAT
BONUS-SEITE: Migration und Integration
Olympe Verlag
Oktober … unterschiedliche Perspektiven einnehmen und deren Sichtweisen in einem Rollenspiel darstellen. … soziale und kommunikative Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit anderen stärken. … gesellschaftliche Vielfalt in Österreich anhand von Beispielen beschreiben.
… Vorurteile und Diskriminierung erkennen und reflektieren.
… den Wert von Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung begründen.
… eigene Erfahrungen und Meinungen zum Thema Vielfalt sachlich ausdrücken und diskutieren.
… Entwicklungen der Bevölkerungszahl in Österreich mit geeigneten Diagrammen beschreiben.
November
… erklären, wie Bevölkerungswachstum und -rückgang das Wohnen und den Arbeitsmarkt beeinflussen.
… Herausforderungen wie Wohnraummangel oder Fachkräftemangel analysieren.
… eigene Vorschläge für eine zukunftsfähige Gestaltung von Wohnen und Arbeit entwickeln.
… können Ursachen und Formen von Migration erklären.
… den Unterschied zwischen Arbeitsmigration und Flucht benennen und begründen.
… Herausforderungen und Chancen von Integration aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen.
… Maßnahmen zur Förderung von Integration bewerten und eigene Ideen entwickeln.
* (Diese Jahresplanung können Sie für Ihre individuelle Planung als W ord-Dokument auf unserer Homepage downloaden.)
JAHRESPLANUNG
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Eine wichtige Entscheidung –die Berufswahl
BILDUNGSWEGE UND ARBEITSWELTEN
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
Dezember … persönliche Interessen, Fähigkeiten und Werte in Bezug auf die Berufswahl reflektieren. … unterschiedliche Ausbildungswege und Berufsbereiche beschreiben. … Informationsquellen zur Berufsorientierung gezielt nutzen. … begründet eigene berufliche Vorstellungen entwickeln und präsentieren.
2. Eine Lehre absolvieren
3. Eine weiterführende Schule besuchen
4. Selbstständig oder unselbstständig
5. Arbeit ist mehr als eine Beschäftigung, für die man Geld bekommt
6. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit –die Einkommensschere
7. Nicht jeder hat Arbeit
… den Ablauf und die Struktur einer dualen Ausbildung in Österreich erklären. … Rechte und Pflichten von Lehrlingen und Ausbildnerinnen und Ausbildnern benennen.
… Vorteile und Herausforderungen einer Lehre reflektieren.
… Informationsangebote zur Lehrstellensuche zielgerichtet nutzen.
… verschiedene weiterführende Schulformen in Österreich benennen und unterscheiden.
… eigene Interessen und Fähigkeiten mit Bildungswegen in Verbindung bringen.
… Kriterien für die Wahl einer weiterführenden Schule reflektieren.
… Informationsquellen zur Schulwahl zielgerichtet nutzen.
Jänner … zwischen selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit unterscheiden.
… Vorund Nachteile beider Erwerbsformen benennen und vergleichen.
… typische Berufsfelder für selbstständige und unselbstständige Tätigkeiten nennen.
… anhand von Fallbeispielen beurteilen, welche Erwerbsform zu bestimmten Lebensvorstellungen passt.
8. Mit dem Einkommen auskommen
Verlag
… verschiedene Funktionen von Arbeit für das Individuum und die Gesellschaft beschreiben.
… zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit unterscheiden.
… erklären, welchen Einfluss Arbeit auf Selbstwertgefühl, soziale Anerkennung und Lebensgestaltung hat.
… Beispiele für sinnstiftende Tätigkeiten in unterschiedlichen Lebensbereichen nennen.
… erklären, was mit dem Begriff Einkommensschere gemeint ist.
… beschreiben, welche neuen Verkehrswege entstanden sind und warum diese wichtig waren.
… konkrete Beispiele für Lohnunterschiede analysieren und bewerten.
… Maßnahmen und Forderungen zur Einkommensgerechtigkeit diskutieren.
… verschiedene Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit unterscheiden und benennen.
… können die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Individuum und Gesellschaft erklären.
… Statistiken zur Arbeitslosigkeit interpretieren und kritisch hinterfragen.
… Möglichkeiten der Unterstützung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit erläutern.
… den Unterschied zwischen fixen und variablen Ausgaben erklären.
BONUS-SEITE: Arbeiten im Öffentlichen Dienst
… ein einfaches Haushaltsbudget erstellen und Einnahmen sowie Ausgaben gegenüberstellen.
… Maßnahmen nennen, wie man mit dem Einkommen besser auskommen kann.
… den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und finanzieller Verantwortung erläutern.
… erklären, was unter dem öffentlichen Dienst verstanden wird.
… typische Berufe im öffentlichen Dienst nennen und deren Aufgaben beschreiben.
… Vorteile und Besonderheiten einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst erläutern.
… den Beitrag des öffentlichen Dienstes zum Funktionieren der Gesellschaft reflektieren
Februar
„GEOGRAFIE FÜR ALLE3. Klasse“
JAHRESPLANUNG
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Standortfaktoren und ihre Bedeutung für die Entwicklung Österreichsl
WIRTSCHAFTSSTANDORT ÖSTERREICH
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
2. Vielfalt der Wirtschaftsregionen in Österreich
März … wichtige Standortfaktoren nennen und erklären. … anhand von Beispielen die Bedeutung einzelner Standortfaktoren für Betriebe in Österreich beschreiben. … können wirtschaftliche Entwicklungen mit ausgewählten Standortfaktoren in Zusammenhang bringen. … unterschiedliche Regionen Österreichs hinsichtlich ihrer Standortvorteile vergleichen. … verschiedene Wirtschaftsregionen Österreichs benennen und voneinander unterscheiden. … wirtschaftliche Schwerpunkte einzelner Regionen beschreiben. … die Auswirkungen von Wirtschaftsschwerpunkten auf Beschäftigung und Infrastruktur erklären. … mithilfe von Karten und Statistiken regionale wirtschaftliche Unterschiede analysieren.
BONUS-SEITEN: Die Vielfalt der österreichischen Bundesländer
… die neun österreichischen Bundesländer namentlich benennen und deren Lage auf der Karte zeigen. … zentrale geografische Merkmale (z. B. Gebirge, Flüsse, Nachbarländer) der Bundesländer beschreiben.
… kulturelle und sprachliche Besonderheiten einzelner Bundesländer wiedergeben.
M3: Eine Umfrage durchführen
Verlag
M4: Ein Diagramm erstellen 3. Wir alle wirtschaften
… typische wirtschaftliche Schwerpunkte der Bundesländer (z. B. Tourismus, Industrie, Landwirtschaft) nennen.
… regionale Unterschiede bei Bevölkerungszahl und Siedlungsdichte erklären.
… an Beispielen zeigen, wie Naturraum und Wirtschaft miteinander zusammenhängen.
… landschaftliche Besonderheiten und Naturschutzgebiete zuordnen.
… die Bedeutung des föderalen Aufbaus Österreichs anhand der Bundesländer erklären.
… Informationen zu den Bundesländern aus Texten, Karten und Statistiken entnehmen und auswerten.
… eine Präsentation oder ein Plakat zu einem ausgewählten Bundesland gestalten.
… eine zielgerichtete Umfrage zu einem vorgegebenen Thema planen und geeignete Fragen formulieren. … Umfrageergebnisse systematisch erfassen, auswerten und grafisch darstellen.
… aus den Ergebnissen der Umfrage Schlussfolgerungen ziehen und diese präsentieren.
… in der Gruppe kooperativ arbeiten und gemeinsam eine Umfrage durchführen.
April … aus vorliegenden Daten geeignete Diagrammarten auswählen.
… ein Diagramm korrekt und übersichtlich gestalten.
… aus einem selbst erstellten Diagramm zentrale Aussagen ableiten.
… Diagramme zur Veranschaulichung und Präsentation von Ergebnissen nutzen.
… erklären, was wirtschaftliches Handeln im Alltag bedeutet.
… zwischen Bedürfnissen und Gütern unterscheiden.
… einfache wirtschaftliche Entscheidungen anhand von Beispielen begründen.
… den Zusammenhang zwischen Konsum, Produktion und Ressourcen erkennen.
JAHRESPLANUNG
WIRTSCHAFTSSTANDORT ÖSTERREICH
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können … LEHRERBUCHKAPITEL
MONAT
4. Preise und Wettbewerb
5. Die ökosoziale Marktwirtschaft
6. Steuern zahlen –aber warum?
April … erklären, wie sich Preise durch Angebot und Nachfrage bilden. … den Begriff Wettbewerb beschreiben und seine Bedeutung für die Wirtschaft darstellen. … unterschiedliche Marktteilnehmer und ihre Interessen benennen. … die Auswirkungen von Preisvergleichen und Werbung auf das Konsumverhalten analysieren. … erklären, was unter einer ökosozialen Marktwirtschaft verstanden wird. … soziale und ökologische Ziele der Wirtschaftspolitik benennen. … Beispiele für staatliche Eingriffe zur Förderung von Umweltund Sozialstandards nennen. … Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise reflektieren.
7. Österreich –Einnahmen und Ausgaben
8. Österreichische Unternehmen
… den Zweck und die Bedeutung von Steuern für das Gemeinwesen erklären.
… verschiedene Steuerarten (z. B. Einkommens-, Umsatz-, Lohnsteuer) unterscheiden und zuordnen. … nachvollziehen, wie Steuergelder verwendet werden. … diskutieren, warum Steuergerechtigkeit für eine funktionierende Gesellschaft wichtig ist.
Mai … die wichtigsten Einnahmeund Ausgabenquellen des österreichischen Staates benennen und erläutern. … verstehen, wie ein Staatshaushalt aufgebaut ist und wofür öffentliche Mittel verwendet werden. … beurteilen, welche Bedeutung Budgetentscheidungen für das tägliche Leben der Bevölkerung haben. … einfache Statistiken und Diagramme zu Staatseinnahmen und -ausgaben lesen, auswerten und präsentieren.
9. Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs im Überblick: Kennzahlen und ihre Bedeutung
Verlag
… erklären, welche Rolle Unternehmen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Österreich spielen. … zwischen Klein-, Mittelund Großunternehmen unterscheiden und deren Bedeutung einordnen.
… ausgewählte österreichische Unternehmen anhand von Beispielen beschreiben.
… reflektieren, welche Auswirkungen Unternehmen auf Region, Umwelt und Gesellschaft haben.
… wichtige wirtschaftliche Kennzahlen wie BIP, Arbeitslosenquote oder Inflationsrate benennen und erklären.
… wirtschaftliche Kennzahlen richtig interpretieren und deren Aussagekraft einschätzen.
… wirtschaftliche Entwicklungen anhand von Kennzahlen beschreiben und vergleichen.
10. Außenwirtschaftliche Verflechtungen von Österreich
… aktuelle wirtschaftliche Daten Österreichs recherchieren und in einfachen Diagrammen darstellen.
… erklären, was man unter Außenhandel versteht und warum er für Österreich wichtig ist.
… wichtige Handelspartner Österreichs nennen und deren Bedeutung beschreiben.
… Einund Ausfuhrgüter unterscheiden und Beispiele nennen.
… die wirtschaftlichen Chancen und Herausforderungen der globalen V erflechtung für Österreich erläutern.
ZENTREN UND PERIPHERIEN
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Zentren und Peripherien
2. Raumnutzungen und Raumplanungen
BONUS-SEITE: Die Entwicklung des Wahlrechts
JAHRESPLANUNG „GEOGRAFIE FÜR ALLE3. Klasse“ Olympe Verlag
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
Juni … erklären, was man unter Zentren und Peripherien versteht und wie sie sich unterscheiden. … Beispiele für zentrale und periphere Räume in Österreich und weltweit benennen. … Ursachen und Folgen ungleicher Raumund Entwicklungsverhältnisse analysieren. … Maßnahmen zur Förderung peripherer Regionen beschreiben und beurteilen. … verschiedene Formen der Raumnutzung (z. B. Wohnen, Arbeiten, Erholung, Verkehr) erkennen und beschreiben. … Konflikte zwischen unterschiedlichen Raumansprüchen analysieren (z. B. Landwirtschaft vs. Siedlungsbau). … die Ziele und Aufgaben der Raumplanung anhand konkreter Beispiele erläutern. … eigene Ideen zur nachhaltigen und gerechten Raumgestaltung entwickeln und begründen.
… den Begriff Bodenversiegelung erklären und Beispiele aus ihrer Umgebung nennen.
… ökologische und gesellschaftliche Folgen der Bodenversiegelung beschreiben.
… Maßnahmen zur Reduktion und Vermeidung von Bodenversiegelung erläutern.
… unterschiedliche Interessen bei der Nutzung von Bodenflächen erkennen und reflektieren.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Österreichische Gesellschaftsentwicklung
NAME: DATUM:
Bevölkerungs-Silben
Stell dir vor, du lebst zur Zeit von Galileo Galilei! Schreibe einen kurzen Tagebucheintrag aus der Sicht einer Unterstützerin oder eines Unterstützers bzw. einer Kritikerin oder eines Kritikers von Galileo! Versuche, deine Gedanken und Gefühle glaubwürdig darzustellen!



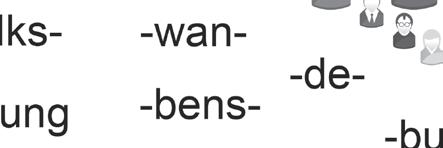
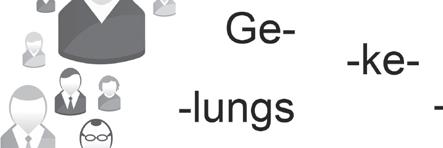
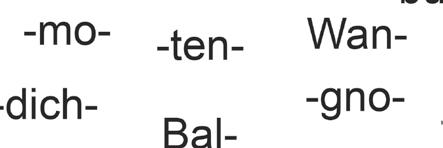
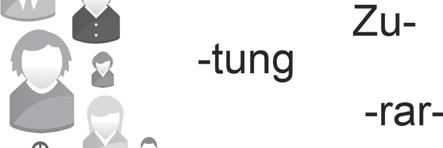
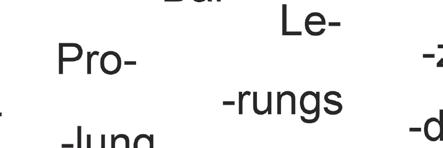

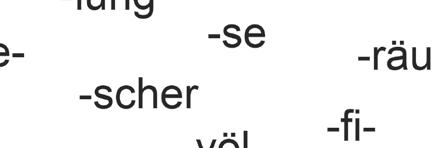











Verlag
Trage die gesuchten Begriffe neben den gestellten Fragen ein! Vergiss nicht, die verwendeten Silben durchzustreichen!
Anschließend schreibe die gesuchten Buchstaben in die rechten Kästchen! Wenn du sie der Reihe nach von oben nach unten liest, erhältst du ein Lösungswort. Frage
Wie nennt man Gebiete, die besonders dicht besiedelt sind?
Wie nennt man die durchschnittliche Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet?
Womit wurde die Bevölkerungszahl in Österreich bis 2001 ermittelt?
Diese gibt an, welches Alter eine Person im Durchschnitt erreicht.
Welcher Begriff beschreibt, dass Menschen in ein Land kommen, um dort zu wohnen oder zu arbeiten?
Wie nennt man eine Voraussage?
Teil der Bevölkerungsprognosen und wird zusammen mit der Wanderungsbilanz verwendet, um die zukünftige Bevölkerungsentwicklung zu berechnen.
Beschreibt eine langfristige Veränderung der Altersstruktur einer Bevölkerung
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Österreichische Gesellschaftsentwicklung
NAME: DATUM:
Wahr oder falsch? – Quizduell zur Bevölkerungsentwicklung
Finde gemeinsam mit deiner Teampartnerin oder deinem Teampartner heraus, welche Aussagen zur Bevölkerungsentwicklung in Österreich richtig oder falsch sind!
Spielvorbereitung: Die Lehrperson verteilt Kärtchen mit Aussagen an jedes Team. Jedes Team besteht aus 2 Schülerinnen oder Schüler
So geht’s:
1. Lest eine Aussage laut vor!
2. Entscheidet gemeinsam im Team: Ist die Aussage richtig oder falsch?
3. Hebt ein Kärtchen hoch oder legt es verdeckt auf den Tisch!
4. Die Lehrperson oder ein anderes Team liest die Lösung vor.
5. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.
Spielende: Nach allen Aussagen zählt jedes Team seine Punkte. Wer die meisten Punkte hat, ist Bevölkerungs-Profi!
Die Bevölkerung in Österreich wächst in allen Regionen gleich stark.


Zuwanderung trägt zum Bevölkerungswachstum in Österreich bei.



Migration meint nur die Einwanderung aus anderen Kontinenten.


Mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt als umgekehrt.

In Österreich leben Menschen aus über 180 Nationen.

Verlag
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich liegt bei über 80 Jahren


Wien ist das Bundesland mit dem stärksten Bevölkerungswachstum.


In Ballungsräumen gibt es häufig Wohnungsmangel.



Ein Grund für Abwanderung aus ländlichen Regionen ist fehlende Infrastruktur.



Das Bevölkerungswachstum in Österreich wird ausschließlich durch Geburten verursacht.



In Österreich gibt es keine anerkannten nationalen Minderheiten.


Geburtenbilanz bedeutet: Geburten minus Todesfälle.

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Österreichische Gesellschaftsentwicklung
NAME: DATUM:
Gitterbastelrätsel – Gesellschaft in Österreich
Fülle die Kästchen mit den Begriffen!
Bevölkerungsstruktur * Prognose * Bevölkerungsdichte * Einpersonenhaushalte * Verwaltungsregister * Geburtenbilanz * Migration * Babyboomer * Erwerbstätigkeit * Wanderungsbilanz * Lebenserwartung * Bevölkerungspyramide * Zuwanderungsland * Toleranz * Perspektive * Integration *
Verlag
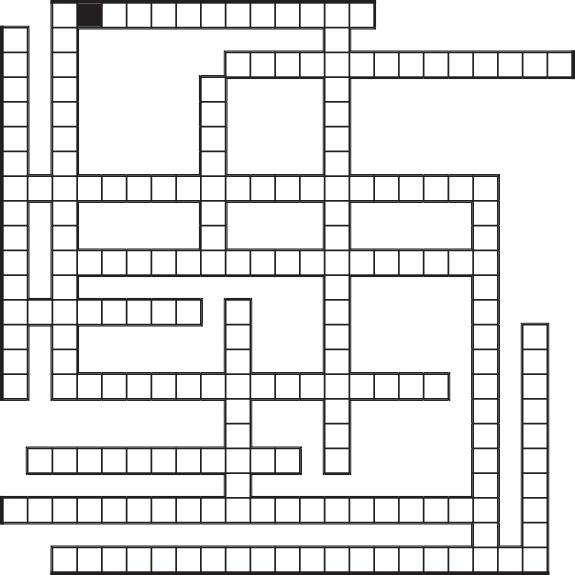
Nun suche dir zwei Begriffe aus und erkläre diese! Begriff Erklärung
Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
Österreichische Gesellschaftsentwicklung
NAME: DATUM:
Aufgaben für schlaue Köpfe
Knifflige Fragen! Bis zu welchem Schwierigkeitsgrad schaffst du es?
Meister-Stufe:

Warum ist es wichtig, dass in einer Gesellschaft alle Menschen gleiche Rechte haben?

Welche gesellschaftlichen Werte findest du besonders wichtig – und warum?
Wie könntest du selbst das Zusammenleben in deiner Schule oder Gemeinde verbessern?
Fortgeschrittenen-Stufe:
Warum leben in manchen Regionen Österreichs mehr ältere Menschen als junge?
Verlag
Was verstehst du unter dem Begriff „Vielfalt“ in der Gesellschaft?

Welche Rolle spielt Bildung in einer modernen Gesellschaft?

Welche Veränderungen gibt es in Österreich durch Zuwanderung?
Anfänger-Stufe:
Welche verschiedenen Familienformen gibt es heute in Österreich?
Nenne zwei Berufe, die es heute gibt, aber früher nicht gab.
Welche Sprachen außer Deutsch hörst du in deinem Alltag?
Warum ziehen manche Menschen vom Land in die Stadt?
Lernstandserhebung
Österreichische Gesellschaftsentwicklung
NAME: DATUM:
1. Kreuze an – was stimmt? 6/
a. Welche Aussage trifft auf die Bevölkerung in Österreich zu?
Alle Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache.
Es leben Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Österreich.
In Österreich leben nur Menschen, die hier geboren wurden.
b. Was ist typisch für den demografischen Wandel in Österreich?
Es gibt immer mehr junge Menschen.
Es gibt mehr ältere Menschen als früher.
Alle Menschen ziehen aufs Land.
c. Welche Aussage beschreibt die heutige Familienstruktur in Österreich am besten?
Alle Familien bestehen aus Vater, Mutter und zwei Kindern.
Es gibt nur verheiratete Eltern mit Kindern.
Es gibt viele unterschiedliche Familienformen.
d. Was gehört zur Digitalisierung in der Gesellschaft?
Schulbücher aus Papier werden durch Online-Lernplattformen ergänzt.
Alle Menschen arbeiten nur noch im Büro.
Niemand braucht mehr Bildung.
Verlag
e. Was ist ein Ziel von Gleichstellung in der Gesellschaft?
Frauen dürfen nicht arbeiten.
Männer verdienen automatisch mehr als Frauen.
Alle Menschen sollen gleiche Chancen haben – unabhängig von Geschlecht.
f. Welche Aussage über Migration in Österreich ist richtig?
Alle Migrantinnen und Migranten sprechen sofort perfekt Deutsch.
Menschen kommen aus verschiedenen Gründen nach Österreich.
Nur Menschen aus der EU dürfen nach Österreich ziehen.
2. Ergänze die fehlenden Begriffe! 5/
In Österreich verändert sich die Gesellschaft ständig. Durch die _____________________ leben Menschen aus vielen Kulturen zusammen. Immer mehr _____________________ prägt das Zusammenleben in Gemeinden. In der Arbeitswelt spielt die ________________ eine große Rolle. Auch die _________________ der Geschlechter ist ein wichtiges Ziel. Weil es immer mehr __________________________ gibt, ist Pflege ein wichtiges Thema geworden.
Digitalisierung * Migration * Vielfalt * Gleichstellung * ältere Menschen
Lernstandserhebung
Österreichische Gesellschaftsentwicklung
NAME: DATUM:
3. Wer passt zu wem? Verbinde die Begriffe mit den passenden Beschreibungen! 5/
Migration alle sollen gleiche Rechte haben
Demografischer Wandel
Familie, Patchwork, Alleinleben, WG, usw. Digitalisierung Menschen ziehen in ein anderes Land
Gleichstellung
Computer, Internet und neue Technologien
Lebensformen immer mehr ältere, weniger junge Menschen
4. Beantworte die folgenden Fragen! 10/
Wie viele Menschen leben ungefähr in Österreich?
Was bedeutet „demografischer Wandel“?
Welche Altersgruppe wächst in Österreich besonders stark?
Was zeigt eine Bevölkerungspyramide?
Was bedeutet „Migration“?
Was bedeutet „Integration“?
Was ist eine Patchworkfamilie?
Verlag
Was versteht man unter einem Ein-Personen-Haushalt?
Seit wann dürfen Frauen in Österreich wählen?
Was bedeutet „soziale Gerechtigkeit“?
5. Zeitstrahl-Aufgabe – Setze die folgenden gesellschaftlichen Entwicklungen in die richtige Reihenfolge (von „früher“ bis „heute“)! 6/
Die meisten Menschen leben in Großfamilien auf dem Land. * In der Schule sitzen Buben und Mädchen gemeinsam im Unterricht. * Viele Menschen arbeiten im Homeoffice. * Fernseher werden schwarz-weiß eingeführt. * Es gibt viele Patchworkfamilien und Alleinerziehende. * Frauen dürfen nicht wählen.
Zeichne einen Zeitstrahl und ordne die Ereignisse ein!
29-32 = Du bist Geografie- und Wirtschaftsmeisterin/-meister
25-28 = Du hast dir viel gemerkt
20-24 = Du weißt schon einiges
16-19 = Du solltest noch viel üben
<16 = Du solltest dir diesen Abschnitt im Buch noch einmal durchlesen
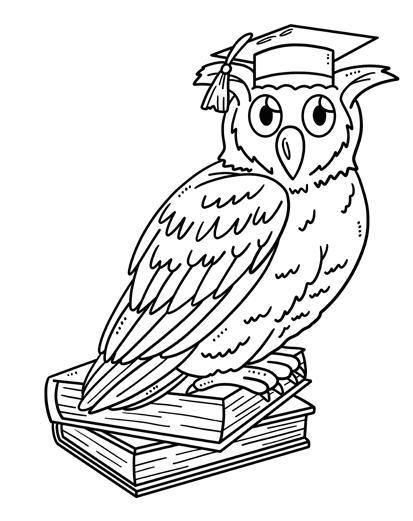
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 7 - 20
K. 1/S. 10/1 Zuwanderung * Volkszählung * Geburtenbilanz * Zone * Lebenserwartung * Statistik Austria * Bevölkerungsdichte * Wanderbilanz * Verwaltungsregister * Minderheiten
K. 1/S. 11/3 a) Eine wichtige Ursache ist die Zuwanderung, also Migration aus dem Ausland nach Österreich. Besonders im Jahr 2022 gab es einen starken Zuwachs durch die Zuwanderung ukrainischer Staatsbürgerinnen und Staatsüber (Rekordwachstum von 1,4 %). 2023 wuchs die Bevölkerung weiterhin, allerdings langsamer (+0,6 %) – dennoch war Migration der Hauptgrund. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten minus Sterbefälle) spielt dabei eine geringere Rolle. * b) Am stärksten gewachsen ist die Bevölkerung in: Wien: +1,2 % – die Stadt hat erstmals über 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Auch Vorarlberg (+0,9 %) und Salzburg (+0,6 %) verzeichnen starke Zuwächse. Am geringsten gewachsen ist die Bevölkerung in: Kärnten: nur +0,1 %. Auch in Niederösterreich (+0,3 %) und dem Burgenland (+0,2 %) ist das Wachstum niedrig. Mögliche Gründe: In Städten wie Wien gibt es mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze, eine bessere Infrastruktur und mehr Zuwanderung. In ländlichen Regionen wie Kärnten wandern viele junge Menschen für Ausbildung oder Arbeit ab. Zuwanderung konzentriert sich stärker auf Ballungsräume. * c) individuelle Lösung
K. 1/S. 12/4 mögliche Lösung: Der Artikel mit dem Titel „Bevölkerung Österreichs auf 9,16 Millionen Menschen gewachsen“ berichtet darüber, wie viele Menschen in Österreich leben und wie sich das verändert hat. Am 1. Jänner 2024 lebten rund 9,16 Millionen Menschen in Österreich. Das sind ungefähr 55.000 mehr als ein Jahr davor. Der größte Grund für dieses Wachstum ist, dass viele Menschen aus anderen Ländern nach Österreich gekommen sind. Im Jahr 2022 war der Anstieg noch viel größer, vor allem weil viele Menschen aus der Ukraine gekommen sind. 2023 war das Wachstum kleiner, aber Österreichs Bevölkerung ist trotzdem weiter gewachsen. Der Artikel zeigt auch, dass das Wachstum in den Bundesländern unterschiedlich ist. In Wien leben jetzt mehr als zwei Millionen Menschen – das ist ein neuer Rekord. Wien ist das Bundesland mit dem größten Zuwachs. Auch in Vorarlberg und Salzburg sind viele neue Menschen dazugekommen. In Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland ist die Bevölkerung nur wenig gewachsen. Besonders spannend ist, dass Salzburg nun mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat als Kärnten. Es gibt auch Unterschiede in den Bezirken. Einige Städte wie Sankt Pölten oder Graz sind stark gewachsen, andere Regionen – zum Beispiel Leoben oder Murau – haben sogar weniger Menschen als im Vorjahr. Das zeigt: In Österreich wachsen vor allem die Städte, viele ländliche Gebiete verlieren Einwohnerinnen und Einwohner. Der Artikel spricht auch darüber, wie viele Menschen in Österreich keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Im ganzen Land sind das jetzt fast 20 %. In Wien ist der Anteil mit über 35 % am höchsten. In Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland ist der Anteil viel niedriger. Zusammengefasst zeigt der Artikel: In Österreich leben immer mehr Menschen, aber nicht überall gleich viele. Vor allem die Städte wachsen, und es leben immer mehr Menschen aus verschiedenen Ländern hier.
K. 1/S. 12/5 Der Artikel berichtet sachlich und genau über die aktuelle Entwicklung der Bevölkerung in Österreich. Dabei werden viele Zahlen genannt, zum Beispiel wie viele Menschen in Österreich leben, wie stark die Bevölkerung gewachsen ist, wo das Wachstum besonders groß oder klein war und wie hoch der Anteil von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft ist. Diese Informationen werden wahrscheinlich so dargestellt, um einen guten Überblick über die Veränderungen in Österreich zu geben – und zwar für das ganze Land und für einzelne Regionen.
Olympe Verlag
Die Autorin oder der Autor möchte den Leserinnen und Lesern vielleicht zeigen, dass sich Österreich ständig verändert. Es leben nicht nur mehr Menschen im Land, sondern auch die Zusammensetzung der Bevölkerung wird vielfältiger. Besonders hervorgehoben wird, dass das Wachstum nicht überall gleich stark ist: Städte wie Wien wachsen schnell, während manche ländliche Gegenden sogar Einwohnerinnen und Einwohner verlieren. Das soll wahrscheinlich zeigen, dass die Entwicklung regional sehr unterschiedlich ist – und dass diese Unterschiede wichtig sind, zum Beispiel für Politik, Bildung oder Infrastruktur Außerdem wird im Artikel betont, dass Migration eine große Rolle spielt. Vielleicht will die Autorin oder der Autor damit deutlich machen, dass Menschen aus anderen Ländern einen wichtigen Teil der österreichischen Gesellschaft bilden. Durch die vielen Zahlen wird gezeigt, dass diese Veränderungen nicht nur Gefühle oder Meinungen sind, sondern mit Daten belegbar. Die Absicht könnte also sein, die Bevölkerung sachlich zu informieren, aber auch zum Nachdenken anzuregen: Was bedeutet das Wachstum für unser Land? Wie gehen wir mit Vielfalt um? Und wie können wir uns auf die Zukunft gut vorbereiten?
K. 1/S. 12/6 individuelle Lösung
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 7 - 20
K. 1/S. 12/7 mögliche Lösung: Die Zahl der Menschen in Österreich steigt weiter. Besonders in Städten wie Wien oder Salzburg leben immer mehr Menschen. Das kann sich auch auf meine eigene Zukunft auswirken – zum Beispiel in der Schule, bei der Arbeit, beim Wohnen oder im Zusammenleben mit anderen.
Wenn mehr Kinder in einer Stadt leben, kann es sein, dass die Klassen in den Schulen größer werden. Vielleicht gibt es in Zukunft nicht genug Platz für alle oder es fehlen Lehrpersonen. Andererseits könnten neue Schulen gebaut werden, und man lernt mehr Kinder aus verschiedenen Ländern kennen – das finde ich spannend, weil man voneinander lernen kann.
Auch bei der Arbeit könnte sich einiges verändern. Wenn mehr Menschen in Österreich leben, bewerben sich auch mehr um Jobs. Das bedeutet, man muss sich besonders anstrengen, um einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Aber es entstehen auch neue Berufe – zum Beispiel im Pflegebereich, weil die Bevölkerung älter wird. Wer gut ausgebildet ist, hat also auch in Zukunft viele Möglichkeiten.
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Wohnraum. Wenn immer mehr Menschen in die Städte ziehen, gibt es dort vielleicht zu wenig Wohnungen. Die Mieten könnten steigen, und nicht alle finden leicht eine passende Wohnung. Deshalb wäre es wichtig, dass Städte genug Wohnraum schaffen, der auch für junge Menschen bezahlbar ist.
Die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst aber auch das tägliche Zusammenleben. Es wird noch mehr Vielfalt geben, weil Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Österreich leben. Das ist eine große Chance, weil man viel voneinander lernen kann. Damit das gut funktioniert, braucht es aber auch Respekt, gegenseitige Hilfe und gute Regeln für das Zusammenleben. Insgesamt denke ich, dass die Bevölkerungsentwicklung viele Veränderungen bringt. Manche davon sind herausfordernd, andere bieten neue Chancen. Es kommt darauf an, wie wir als Gesellschaft damit umgehen – und ob wir bereit sind, gemeinsam Lösungen zu finden.
K. 1/S. 12/8 individuelle Lösung
K. 1/S. 12/9
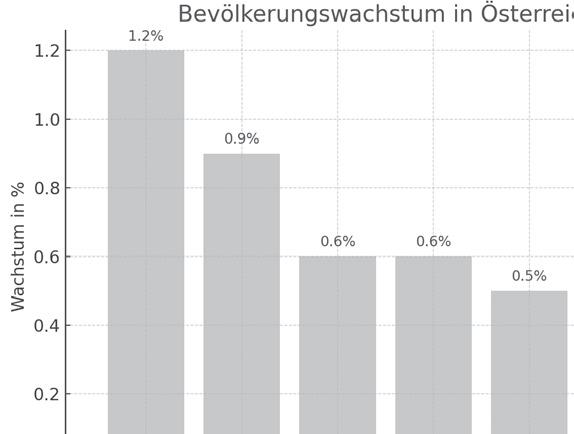
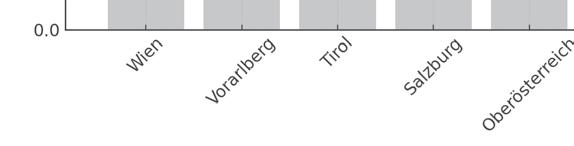
Verlag
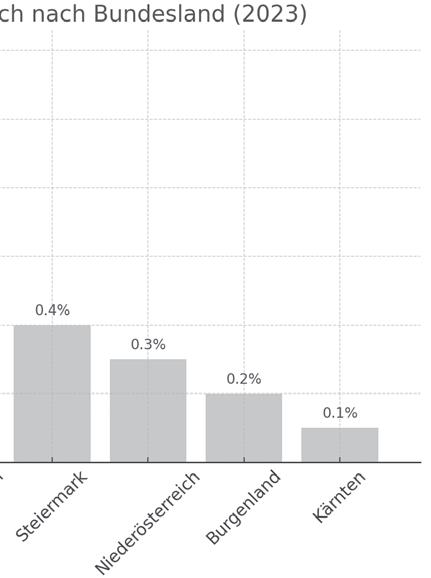
Wien hatte mit +1,2 % das stärkste Bevölkerungswachstum. * Auch Vorarlberg, Tirol und Salzburg lagen über dem Bundesdurchschnitt. * In Kärnten war der Zuwachs mit +0,1 % am geringsten. * Niederösterreich, das bevölkerungsreichste Flächenbundesland, wuchs nur leicht (+0,3 %). Städte und wirtschaftlich starke Regionen wachsen schneller. In Wien zieht es viele Menschen wegen Arbeit, Ausbildung und Infrastruktur hin. * Ländliche Bundesländer oder Regionen mit weniger Arbeitsplätzen und schlechterer Verkehrsanbindung wachsen deutlich langsamer – oder verlieren sogar Einwohnerinnen und Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt deutlich, dass sich Österreich nicht überall gleich entwickelt. Diese Unterschiede wirken sich auf Wohnraum, Schulen, Pflege, Verkehr und politische Entscheidungen aus.
K. 1/S. 12/10 individuelle Lösung
K. 1/S. 12/11 individuelle Lösung
K. 2/S. 16/1 individuelle Lösung
K. 2/S. 16/2 mögliche Lösung: In unserer Schule gibt es viele verschiedene Menschen: Wir sprechen unterschiedliche Sprachen, kommen aus verschiedenen Ländern, glauben an verschiedene Dinge, leben in verschiedenen Familien und haben unterschiedliche Fähigkeiten. Diese Vielfalt ist etwas sehr Wertvolles – sie macht unsere Schule bunt, interessant und lebendig. Damit sich alle wohlfühlen und mitmachen können, ist es wichtig, dass Vielfalt bewusst gefördert wird. Als Klasse haben wir deshalb gemeinsam überlegt, was wir dafür tun können. Zuerst haben wir darüber gesprochen, wo uns Vielfalt im Alltag begegnet. Zum Beispiel, wenn in der Pause verschiedene Sprachen gesprochen werden oder wenn jemand aus einer anderen Kultur etwas über seine Feste erzählt. Auch im Unterricht, etwa bei Gruppenarbeiten oder im Religionsunterricht, fällt uns auf, wie verschieden wir sind – und wie spannend das ist.
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 7 - 20
K. 2/S. 16/2 Dann haben wir Ideen gesammelt, wie man diese Vielfalt noch besser zeigen und leben kann. Eine Idee war, eine „Wand der Vielfalt“ in der Aula zu gestalten. Dort könnten alle Klassen Beiträge aufhängen – zum Beispiel Begrüßungen in verschiedenen Sprachen, Fotos von traditionellen Gerichten oder Steckbriefe über verschiedene Herkunftsländer. Eine andere Idee war, einen „Tag der Kulturen“ zu veranstalten, an dem Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern Tänze, Kleidung oder Musik vorstellen. Auch eine gemeinsame Aktion wie „Wir sagen Hallo in 20 Sprachen“ kam gut an – dafür könnten wir im Schulhaus Schilder mit Begrüßungen aufhängen. Damit aus Ideen echte Projekte werden, haben wir auch geplant, wie wir sie umsetzen könnten. Für die Vielfalt-Wand bräuchten wir eine große freie Fläche, Papier, Farben und etwas Zeit im Unterricht. Die Klassen könnten sich abwechselnd darum kümmern. Beim Tag der Kulturen müssten wir rechtzeitig planen, Einladungen schreiben und vielleicht Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer um Hilfe bitten. Es wäre auch wichtig, dass alle mitmachen dürfen – egal, ob sie hier geboren sind oder aus einem anderen Land kommen.
Uns ist klar geworden: Vielfalt ist nichts Selbstverständliches. Damit sie gut funktioniert, braucht es Respekt, Offenheit und gute Ideen. Wenn wir in der Schule zeigen, dass wir Unterschiede nicht nur akzeptieren, sondern auch feiern, dann wird unsere Schule zu einem Ort, an dem sich alle zu Hause fühlen. Wir freuen uns darauf, bald mit der Umsetzung zu beginnen – und hoffen, dass noch viele Klassen mitmachen!
K. 2/S. 16/3 individuelle Lösung
K. 2/S. 16/4 individuelle Lösung
K. 2/S. 16/5 individuelle Lösung
K. 3/S. 18/1 Demografischer Wandel und seine Auswirkungen
Der demografische Wandel beschreibt die Veränderungen in der Altersstruktur einer Bevölkerung über längere Zeit. In Österreich – wie auch in vielen anderen Ländern – bedeutet das vor allem: Die Menschen werden im Durchschnitt älter, weil die Lebenserwartung steigt und gleichzeitig weniger Kinder geboren werden. Dadurch gibt es immer mehr ältere und immer weniger junge Menschen. In den nächsten Jahren wird dieser Wandel große Auswirkungen haben. Zum Beispiel werden in vielen Berufen – besonders im Gesundheits- und Pflegebereich – mehr Fachkräfte gebraucht, weil es mehr ältere Menschen gibt, die Unterstützung benötigen. Auch die Schulen, der Wohnbau oder der öffentliche Verkehr müssen sich anpassen. Es wird wichtiger, dass ältere Menschen gut versorgt sind, aber auch, dass junge Menschen gut ausgebildet werden, damit sie später die Gesellschaft mitgestalten können. Außerdem wird überlegt, wie das Pensionssystem und die Finanzierung des Staates in Zukunft funktionieren sollen, wenn weniger Menschen arbeiten, aber mehr Menschen in Pension sind.
Der demografische Wandel ist also eine große Herausforderung – aber auch eine Chance, unsere Gesellschaft bewusst und solidarisch weiterzuentwickeln.
K. 3/S. 18/2 individuelle Lösung
K. 3/S. 18/3 individuelle Lösung
K. 3/S. 18/4 individuelle Lösung
K. 3/S. 18/5 individuelle Lösung
K. 3/S. 18/6 individuelle Lösung
Lösungen LehrerInnenheft S. 7 - 12
AB 1 gesuchte Wörter (von oben nach unten): Ballungsräume * Bevölkerungsdichte * Volkszählung * Lebenserwartung * Zuwanderung * Prognose * Geburtenbilanz * demografischer Wandel Lösungswort: Bevölkerungszahl
Olympe Verlag
AB 2 richtig: Mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt als umgekehrt. * Die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich liegt bei über 80 Jahren. * Zuwanderung trägt zum Bevölkerungswachstum in Österreich bei. * In Österreich leben Menschen aus über 180 Nationen. * In Ballungsräumen gibt es häufig Wohnungsmangel. * Wien ist das Bundesland mit dem stärksten Bevölkerungswachstum. * Ein Grund für Abwanderung aus ländlichen Regionen ist fehlende Infrastruktur. * Geburtenbilanz bedeutet: Geburten minus Todesfälle.
Lösungen LehrerInnenheft S. 7 - 12
AB 3
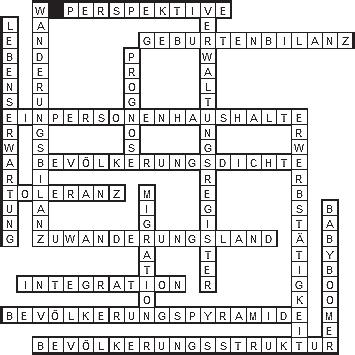
AB 4 mögliche Lösungen:
Verlag
Anfänger-Stufe: Es gibt Kernfamilien (Vater, Mutter, Kind), Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien, Großfamilien und Wohngemeinschaften. * Influencerin/Influencer, App-Entwicklerin/App-Entwickler, Drohnenpilotin/Drohnenpilot, Nachhaltigkeitsmanagerin/ Nachhaltigkeitsmanager, Solartechnikerin/Solartechniker, ,,, * Zum Beispiel Türkisch, Bosnisch/ Kroatisch/Serbisch, Arabisch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Ukrainisch, … * Weil es dort mehr Arbeitsplätze, bessere Ausbildung, mehr Freizeitangebote und öffentliche Verkehrsmittel gibt. Fortgeschrittenen-Stufe: Weil viele junge Menschen in die Städte ziehen, um dort zu lernen oder zu arbeiten. In ländlichen Gegenden bleiben oft ältere Menschen zurück, weil sie dort verwurzelt sind oder nicht mehr umziehen wollen. * Vielfalt bedeutet, dass Menschen in einer Gesellschaft unterschiedlich sind – zum Beispiel in Sprache, Herkunft, Kultur, Religion, Geschlecht, Alter oder Lebensweise. Alle gehören trotzdem dazu und sollen respektiert werden. * Bildung ist wichtig, damit Menschen gute Chancen im Leben haben. Sie hilft dabei, einen Beruf zu finden, sich eine eigene Meinung zu bilden und in einer demokratischen Gesellschaft mitzubestimmen. * Es leben mehr Menschen aus verschiedenen Ländern in Österreich. Dadurch gibt es mehr Sprachen, neue kulturelle Einflüsse, neue Ideen – aber auch Herausforderungen beim Zusammenleben und in der Schule oder im Beruf.
Meister-Stufe: Weil alle Menschen gleich viel wert sind. Wenn alle die gleichen Rechte haben, ist die Gesellschaft gerechter, friedlicher und alle können mitbestimmen – egal, woher sie kommen, welches Geschlecht sie haben oder woran sie glauben. * Ich finde Respekt, Toleranz und Gerechtigkeit besonders wichtig, weil Menschen gut zusammenleben können, wenn sie einander achten, fair behandeln und Unterschiede akzeptieren. * Ich könnte anderen helfen, wenn sie neu sind oder sich ausgeschlossen fühlen. Ich kann zuhören, Streit schlichten und Ideen einbringen, wie wir als Klasse oder Gruppe besser zusammenhalten.
Lernstandserhebung
1. a: Es leben Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Österreich. * b: Es gibt mehr ältere Menschen als früher. * c: Es gibt viele unterschiedliche Familienformen. * d: Schulbücher aus Papier werden durch Online-Lernplattformen ergänzt. * e: Alle Menschen sollen gleiche Chancen haben – unabhängig von Geschlecht. f: Menschen kommen aus verschiedenen Gründen nach Österreich.
2. In Österreich verändert sich die Gesellschaft ständig.
Durch die Migration leben Menschen aus vielen Kulturen zusammen. Immer mehr Vielfalt prägt das Zusammenleben in Gemeinden.
In der Arbeitswelt spielt die Digitalisierung eine große Rolle.
Auch die Gleichstellung der Geschlechter ist ein wichtiges Ziel.
Weil es immer mehr ältere Menschen gibt, ist Pflege ein wichtiges Thema geworden.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft S. 7 - 12
Lernstandserhebung
3. Migration
Menschen ziehen in ein anderes Land Demografischer Wandel immer mehr ältere, weniger junge Menschen Digitalisierung Computer, Internet und neue Technologien
Gleichstellung alle sollen gleiche Rechte haben Lebensformen Familie, Patchwork, Alleinleben, WG usw.
4. ungefähr 9,2 Millionen Menschen. * Die Bevölkerungsstruktur verändert sich – zum Beispiel gibt es mehr ältere Menschen und weniger junge. * die Gruppe der älteren Menschen * Sie zeigt, wie viele Menschen in welchem Alter leben, getrennt nach Männern und Frauen. * Menschen ziehen in ein anderes Land, zum Beispiel um dort zu leben oder zu arbeiten. * Integration bedeutet, dass Menschen gut in die Gesellschaft aufgenommen werden und mitmachen können. * Eine Familie, in der Eltern und Kinder aus früheren Partnerschaften zusammenleben. * Eine Person lebt allein in einer Wohnung oder einem Haus. * seit dem Jahr 1918 * Dass alle Menschen gleiche Chancen haben sollen, egal wie reich oder arm sie sind.
5. Frauen dürfen nicht wählen. * Die meisten Menschen leben in Großfamilien auf dem Land. * Fernseher werden schwarz-weiß eingeführt. * In der Schule sitzen Buben und Mädchen gemeinsam im Unterricht. * Es gibt viele Patchworkfamilien und Alleinerziehende. * Viele Menschen arbeiten im Homeoffice.
Verlag
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Bildungswege und Arbeitsweisen
NAME: DATUM:
Nicht jeder hat Arbeit
Schau dir die aktuelle Grafik zur Arbeitslosenquote in den österreichischen Bundesländern an (Stand: Februar 2024). Beschreibe, was dir auffällt! Notiere deine Beobachtungen in ganzen Sätzen und überlege, welche Rolle Bildung, Wirtschaft und Wohnort bei der Arbeitssuche spielen können!
Verlag































Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Bildungswege und Arbeitsweisen
NAME: DATUM:
Die Arbeitswelt
Im folgenden Suchrätsel haben sich 18 Wörter versteckt, die alle mit der Arbeitswelt zu tun haben. Suche diese und markiere sie!
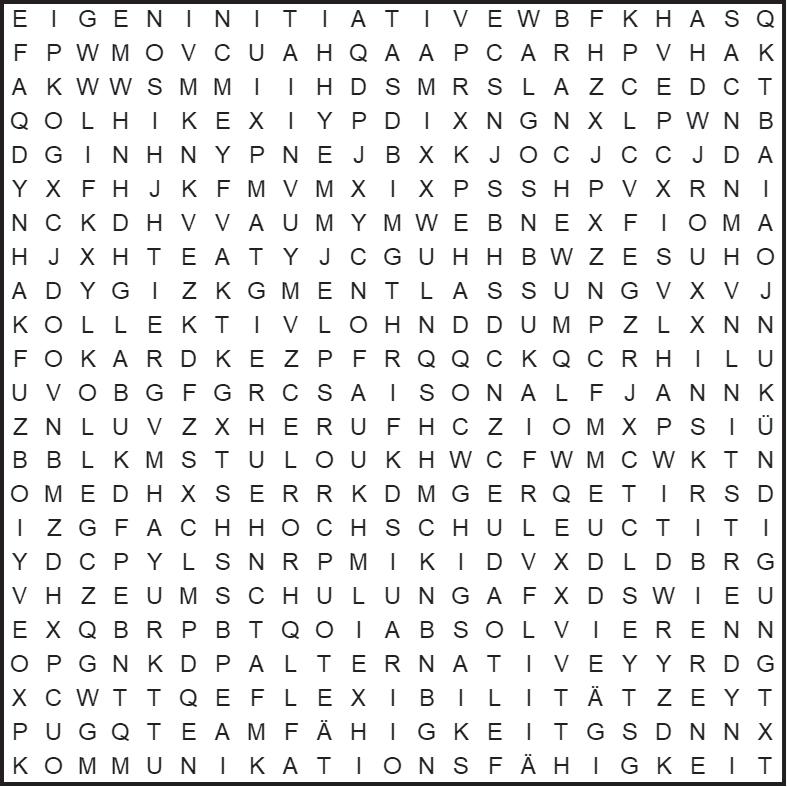
Nun wähle 3 Begriffe aus und erkläre diese!
Begriff Erklärung
Verlag
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Bildungswege und Arbeitsweisen
NAME: DATUM:
Bildung - Bildung - Bildung
Die folgende Tabelle zeigt dir die Bildungsabschlüsse der Bevölkerung. Welche Unterschiede fallen dir auf und worauf führst du diese zurück? Notiere deine Argumente in ganzen Sätzen!
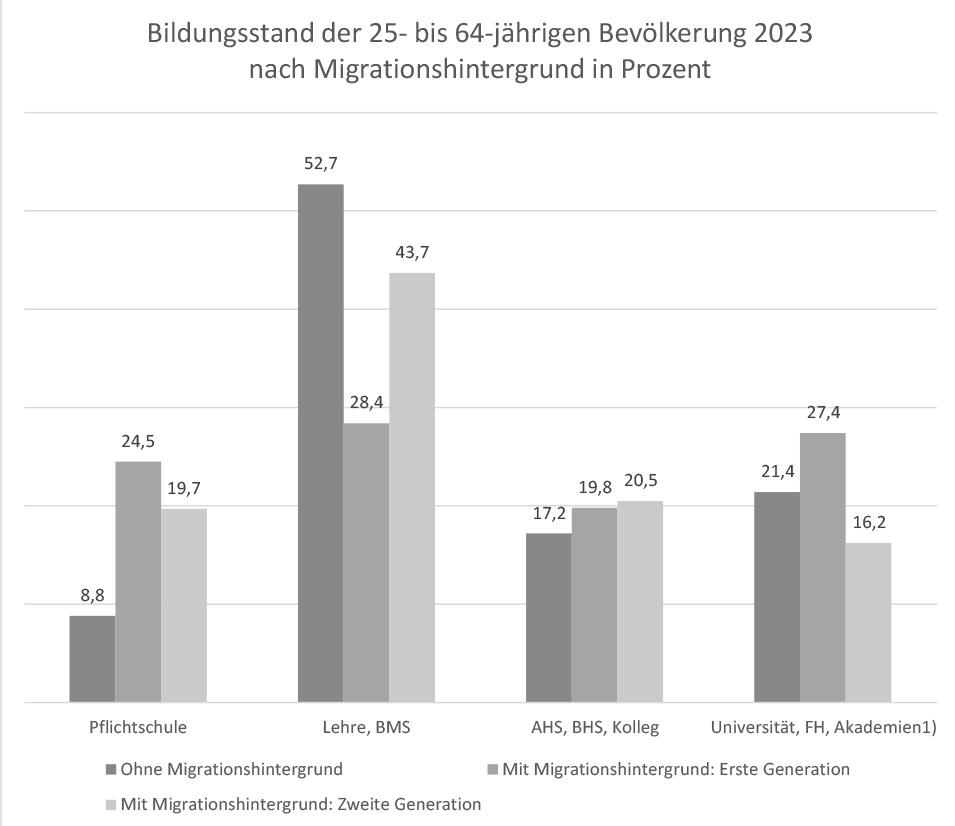
Verlag
Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
Bildungswege und Arbeitsweisen
NAME: DATUM:
Schlagzeilen zum Thema Bildung und Arbeit
Welche Schlagzeile passt nicht zum Text? Kreuze an!
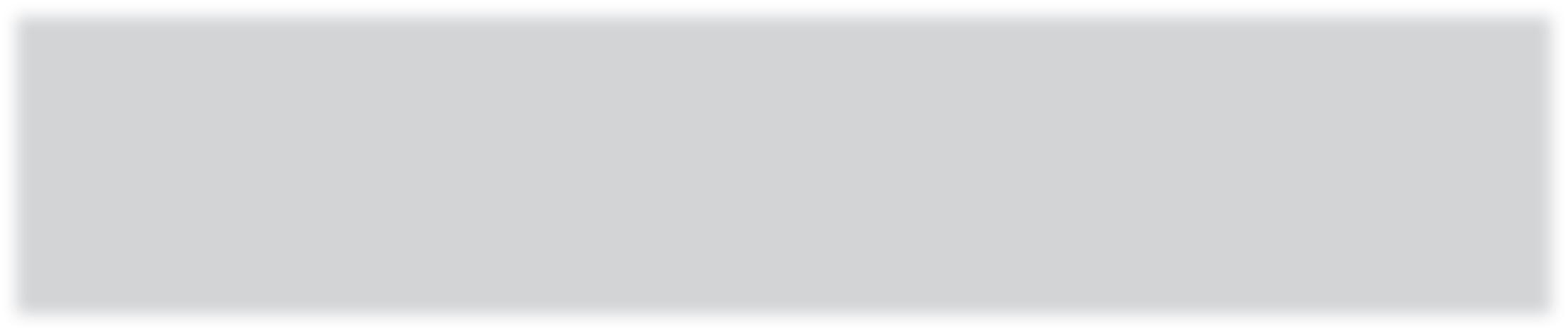
Mai 2025: Im Mai 2025 meldete Statistik Austria, dass etwa 195 000 Menschen nach Österreich zugewandert, aber gleichzeitig 128 300 Österreicher auswanderten. Der Wanderungssaldo lag damit bei +66 600 Personen. Allerdings verließen besonders hochqualifizierte junge Erwachsene im Alter von 20 bis 39 Jahren das Land. Auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gingen netto mit –5 662 Personen abwandernd ins Ausland (Quelle: Wanderungen insgesamt - STATISTIK AUSTRIA - Die Informationsmanager)
A Junge Österreicherinnen und Österreicher verlassen ihr Heimatland
B Fachkräfte ziehen aus Österreich weg
C Rund 195 000 Menschen wandern ein
D Österreich hat mehr Zuzüge als Abgänge
E Niedrigqualifizierte suchen ihr Glück im Ausland
F Mehr Abwanderinnen und Abwanderer als Rückwanderinnen und Rückwanderer
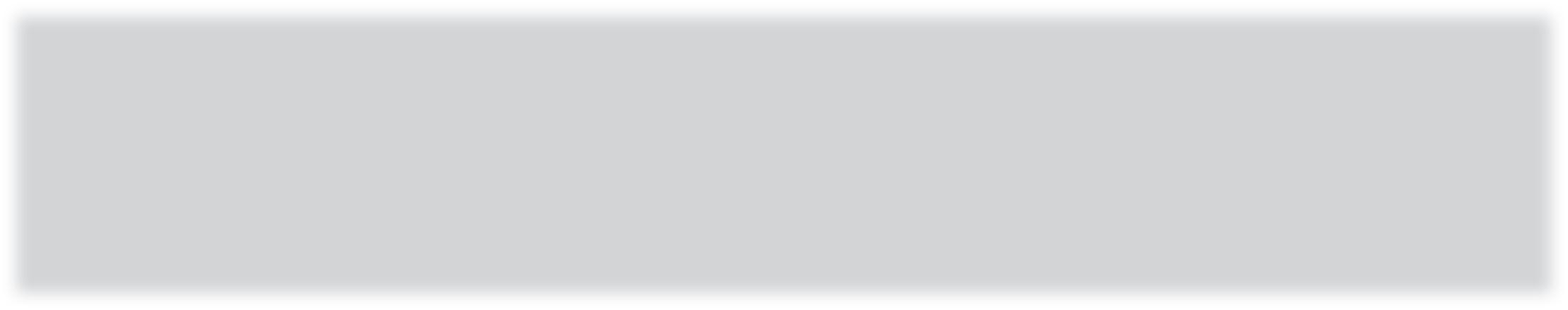
Februar 2024: Im Februar 2024 startete eine Fachkräfte-Initiative: Entwicklung neuer Studienplätze an Fachhochschulen und Ausweitung der Berufsmatura für Lehrlinge. Viele Lehrlinge kombinieren erfolgreich die Lehre mit der Reifeprüfung, ein Modell, das flexible Einstiegsmöglichkeiten bietet und kostenlos bleibt.
Verlag
(Quelle: meinbezirk.atbmwet.gv.at+6bmbwf.gv.at+6burgenland.at+6)
A Option „Lehre mit Matura“ wird ausgebaut
B Rund 12 % der Lehrlinge streben Matura an
C Pilotmodell „Lehre mit Reifeprüfung“ gestartet
D Lehre mit Matura zeigt gute Erfolge
E AHS/BHS sollen duale Ausbildung unterstützen
F Lehrzeit für Maturantinnen und Maturanten wird kürzer
März 2024: Ende März 2024 betrug die Arbeitslosenquote in Österreich 7,3 %, was einem Anstieg von +0,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders betroffen sind Menschen mit nur Pflichtschulabschluss, deren Quote mit 21,3 % deutlich höher liegt als der Durchschnitt von 7 %. habe.
(Quelle: oesterreich.gv.at+7burgenland.at+7bmb.gv.at+7oesterreich.gv.at+5wko.at+5bmwet.gv.at+5salzburg24. at+7orf.at+7bundeskanzleramt.gv.at+7bmbwf.gv.atbmb.gv.atmeinbezirk.at; ams.at+4science.apa.at+4salzburg24. at+4)
A Pflichtschulabsolventinnen und - absolventen besonders oft arbeitslos
B Arbeitslosenquote steigt auf 7,3 %
C Langzeitarbeitslosigkeit nimmt stark zu
D AMS warnt vor Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit
E Höheres Bildungsniveau schützt vor Arbeitslosigkeit
F Arbeitslosigkeit geht deutlich zurück

Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE
Bildungswege und Arbeitsweisen NAME:
Ausbildung abgebrochen – Gefahr für die Zukunft?
Lies den folgenden Text aufmerksam durch! Dann entscheide, welche Grafik den Text richtig abbildet!
Immer wieder verlassen junge Menschen in Österreich die Schule oder Ausbildung, ohne einen Abschluss zu machen. Das kann später zu Problemen führen – zum Beispiel bei der Jobsuche. Wer keine Ausbildung hat, verdient oft weniger, ist häufiger arbeitslos und kann schwerer selbstständig leben.
Laut Statistik Austria lag der Anteil der 18- bis 24-jährigen Jugendlichen in Österreich, die keine Schule oder Ausbildung mehr besuchen und keinen Abschluss haben, im Jahr 2022 bei 8,6 %. Das ist leicht unter dem EU-Durchschnitt von 9,5 %.
Ein genauer Blick zeigt Unterschiede:
• Bei jungen Männern liegt die Abbruchquote bei 7,9 %,
• bei jungen Frauen bei 7,7 %.
Die Abbruchquote hat sich in den letzten Jahren leicht verbessert – sie lag 2011 noch bei 10,6 %. Österreich hat sich das Ziel gesetzt, die Quote dauerhaft unter 9 % zu halten.
Welche der folgenden Grafiken gibt die beschriebenen Werte wieder? Kreuze richtig an!

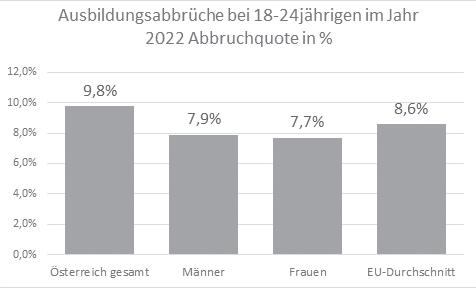
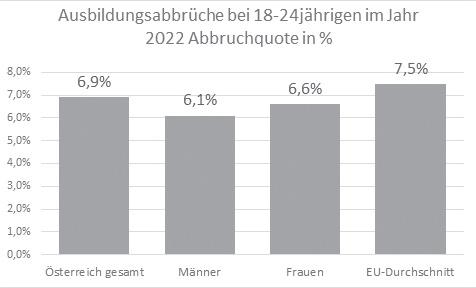
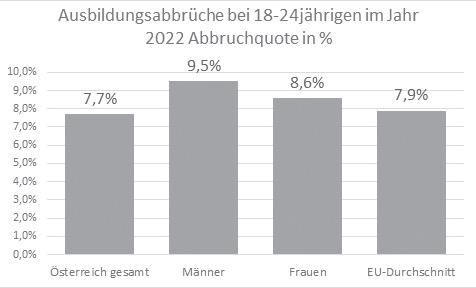
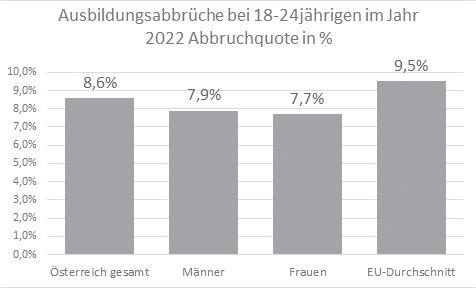
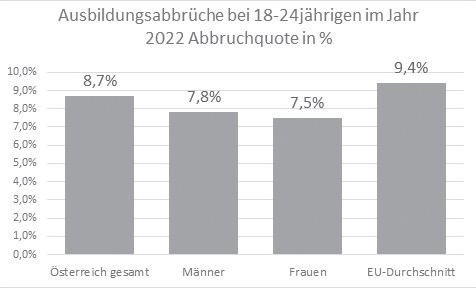
Lernstandserhebung
Bildungswege und Arbeitswelten
NAME: DATUM:
1. Nenne 6 Schlüsselqualifikationen! 6/
Verlag
2. Fülle die Lücken in der Tabelle! 4/
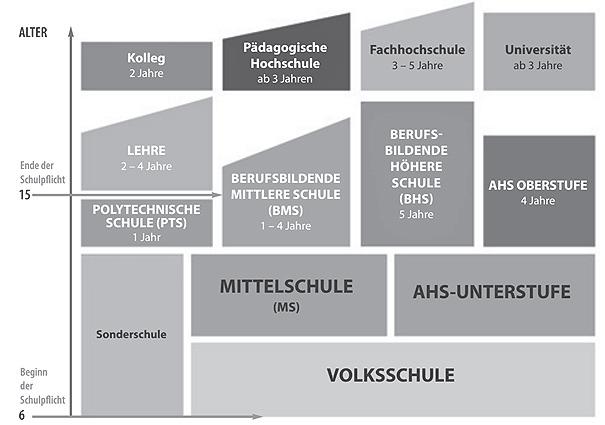
3. Beschreibe mit eigenen Worten das duale System! 4/
Lernstandserhebung
NAME:
4) Fülle die Lücken!
Bildungswege und Arbeitswelten
DATUM:
10/ Begriff Erklärung
Entlassung
Ausbildung, um einen neuen Beruf zu erlernen
Gleichberechtigung, Unabhängigkeit
Branche
finanzielle Unterstützung für Arbeitslose
Kollektivlohn
Notstandshilfe
Gewinn
Gesellschaftsform, in der der Mann eine bevorzugte Stellung hat
von der Jahreszeit abhängig
5) Richtig oder falsch? Kreuze die falschen Sätze an!
In Österreich regelt das Gleichbehandlungsgesetz die Gleichbehandlung von Mann und Frau in der Arbeitswelt.
Frauen verdienen nach wie vor für gleiche oder gleichwertige Arbeit um 10% weniger als Männer.
Notstandshilfe erhält jeder Arbeitslose in Österreich für die Dauer von 6 Monaten.
Schlechte Ausbildung ist einer der Gründe für Arbeitslosigkeit.
Eine Entlassung findet immer einvernehmlich statt.
In Österreich gibt es nur ein geringes Angebot an weiterführenden Schulen.
Olympe Verlag
26-28 = Du bist Geografie- und Wirtschaftsmeisterin/-meister 22-25 = Du hast dir viel gemerkt
18-21 = Du weißt schon einiges
14-17 = Du solltest noch viel üben
<16 = Du solltest dir diesen Abschnitt im Buch noch einmal durchlesen
4/ falsch
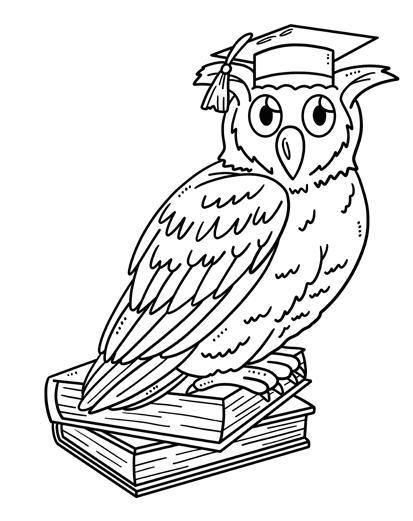
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 21 - 44
K. 1/S. 24/1 individuelle Lösung
K. 1/S. 24/2 individuelle Lösung
K. 1/S. 25/3 mögliche Lösung: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt – Chancen und Risiken
Die Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern unsere Arbeitswelt immer stärker. Viele Arbeiten, die früher von Menschen erledigt wurden, können heute von Computern, Robotern oder intelligenten Programmen übernommen werden. Das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile für die Gesellschaft.
Ein großer Vorteil ist, dass viele Arbeitsabläufe schneller und effizienter werden. Maschinen können rund um die Uhr arbeiten und helfen dabei, Fehler zu vermeiden. In der Medizin zum Beispiel unterstützt KI Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose. Auch in der Industrie und in Büros erleichtert die Digitalisierung viele Aufgaben. Außerdem entstehen durch die neuen Technologien auch ganz neue Berufe – etwa in der Programmierung, in der IT-Sicherheit oder im Bereich der Robotik. Gleichzeitig gibt es aber auch Nachteile. Manche Berufe, besonders einfache Tätigkeiten in Fabriken oder Büros, könnten in Zukunft wegfallen, weil sie von Maschinen übernommen werden. Menschen mit geringer Ausbildung haben es dann oft schwer, einen neuen Job zu finden. Es kann auch passieren, dass manche Menschen sich durch den ständigen technischen Wandel überfordert fühlen – besonders, wenn sie keine digitale Ausbildung haben. Die Unterschiede zwischen gut Ausgebildeten und anderen könnten dadurch größer werden. Insgesamt bringt die Digitalisierung viele neue Möglichkeiten, stellt uns aber auch vor Herausforderungen. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft darauf reagiert – zum Beispiel mit guter Aus- und Weiterbildung für alle. So können wir die Vorteile nutzen und gleichzeitig die Nachteile verringern.
K. 3/S. 29/1 Reisebüroassistentin * Kartograph * Rauchfangkehrerin * Glasbläser * Goldschmied * Zahntechniker * Speditionskauffrau * Kosmetiker * Textilchemikerin
K. 3/S. 29/2 mögliche Lösung: Nach der 8. Schulstufe gibt es in Österreich verschiedene Möglichkeiten, wie man seine schulische oder berufliche Ausbildung fortsetzen kann. Welche Schule man wählt, hängt davon ab, was man später machen möchte – also ob man möglichst bald arbeiten will oder ob man eine längere Ausbildung mit Matura anstrebt.
Eine Möglichkeit ist die Lehre. Dabei beginnt man gleich in einem Betrieb zu arbeiten und geht gleichzeitig in die Berufsschule. Die Lehre dauert meistens drei bis vier Jahre. Am Ende macht man eine Lehrabschlussprüfung. Mit einer Lehre verdient man schon früh Geld und kann in seinem Beruf viel lernen.
Wer lieber noch länger in die Schule gehen möchte, kann eine mittlere Schule wie eine BMS (Berufsbildende mittlere Schule) besuchen. Sie dauert etwa ein bis vier Jahre – je nach Fachrichtung. Am Ende hat man keinen Matura-Abschluss, aber eine gute fachliche Ausbildung, zum Beispiel in Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus oder Technik.
Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch einer höheren Schule mit Matura, also einer AHS (Allgemeinbildende Höhere Schule) oder BHS (Berufsbildende Höhere Schule). Diese Schulen dauern fünf Jahre. Am Ende macht man die Matura, mit der man später auch studieren kann. In der AHS lernt man allgemeinbildende Fächer wie Sprachen, Mathematik oder Geschichte. In der BHS wird zusätzlich ein Berufsfeld wie Technik, Tourismus oder Sozialberufe mitausgebildet. Insgesamt hängt die Entscheidung davon ab, ob man lieber bald ins Berufsleben einsteigen oder sich noch länger schulisch weiterbilden möchte. Wichtig ist, dass man sich gut informiert und etwas wählt, das zu den eigenen Interessen passt.
K. 3/S. 30/3 individuelle Lösung
K. 3/S. 31/4 individuelle Lösung
K. 3/S. 31/5 individuelle Lösung
K. 3/S. 31/6 individuelle Lösung
Olympe Verlag
K. 4/S. 33/1 Von links nach rechts: 1. Zeile: unselbstständig * unselbstständig 2. Zeile: selbstständig * selbstständig 3. Zeile: unselbstständig * unselbstständig
K. 6/S. 36/1 mögliche Lösung: Erwerbsarbeit ist die Arbeit, für die man bezahlt wird. Menschen üben sie aus, um Geld zu verdienen – zum Beispiel als Verkäuferin, Tischler, Lehrerin oder Mechaniker. Diese Arbeit findet meistens außerhalb der eigenen Familie statt, etwa in Betrieben, Büros, Schulen oder Werkstätten.
Reproduktionsarbeit bedeutet dagegen unbezahlte Arbeit im privaten Bereich. Dazu gehören Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, Kinder betreuen oder sich um kranke Angehörige kümmern. Diese Arbeit ist wichtig, damit das tägliche Leben funktioniert, wird aber oft nicht als „richtige“ Arbeit anerkannt, weil man dafür kein Geld bekommt. Der Unterschied liegt also darin, dass Erwerbsarbeit bezahlt wird und Reproduktionsarbeit unbezahlt ist – obwohl beide für die Gesellschaft wichtig sind.
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 21 - 44
K. 6/S. 36/2 individuelle Lösung
K. 6/S. 36/3 individuelle Lösung
K. 6/S. 36/4 Die Grafik zeigt die Entwicklung der Teilzeitquoten von Frauen und Männern in Österreich im Zeitraum von 2014 bis 2023. Es wird deutlich, dass es zwischen den Geschlechtern einen großen Unterschied bei der Teilzeitarbeit gibt.
Interpretation der Grafik
• Die Teilzeitquote der Frauen ist durchgehend sehr hoch – sie liegt in allen Jahren zwischen etwa 47 % und 51 %.
• Die Teilzeitquote der Männer ist deutlich niedriger – sie bewegt sich zwischen etwa 10 % und 14 %.
• Im Vergleich dazu liegt die gesamt-österreichische Teilzeitquote (Frauen und Männer zusammen) zwischen 27 % und 31 %.
• In den letzten Jahren ist die Teilzeitquote insgesamt leicht gestiegen – besonders zwischen 2021 und 2023.
Diese Daten zeigen: Teilzeitarbeit ist vor allem ein Thema bei Frauen. Das könnte daran liegen, dass viele Frauen familiäre Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen.
Auswirkungen der steigenden Teilzeitarbeit
Für die Betroffenen – besonders für Frauen – kann der hohe Anteil an Teilzeitarbeit sowohl Vorteile als auch Nachteile haben:
Vorteile:
• Mehr Zeit für Familie und Haushalt
• Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
• Teilzeit kann eine flexible Lösung sein, etwa bei Studium, Betreuungspflichten oder Wiedereinstieg nach einer Pause
Nachteile:
• Weniger Einkommen → oft finanzielle Abhängigkeit oder geringere Lebensqualität
Verlag
• Geringere Pension im Alter → Altersarmut besonders bei Frauen
• Karrierechancen sinken → Teilzeitkräfte haben oft weniger Aufstiegsmöglichkeiten
• Weniger Einfluss und Mitbestimmung im Betrieb
Zusammenfassung: Die Grafik macht deutlich, dass Teilzeitarbeit in Österreich ein stark geschlechterbezogenes Thema ist. Während viele Frauen Teilzeit arbeiten – oft aus familiären Gründen – bleiben Männer meist in Vollzeit. Um Gleichstellung zu erreichen, bräuchte es mehr Angebote wie leistbare Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle und gleiche Bezahlung, damit beide Geschlechter ähnliche Chancen haben.
K. 7/S. 39/1 Die Grafik zeigt, wie sich die Arbeitslosigkeit in Österreich von 1994 bis 2022 je nach Bildungsniveau entwickelt hat. Dabei wird deutlich, dass Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss viel seltener arbeitslos sind als jene mit einem niedrigen Abschluss. Besonders auffällig ist die durchgehend hohe Arbeitslosenquote bei Personen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben. Im Jahr 2022 waren rund 11,7 % dieser Gruppe ohne Arbeit. Damit liegt ihre Arbeitslosenquote deutlich über dem Durchschnitt und ist mehr als doppelt so hoch wie bei Menschen mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung oder einer weiterführenden Schule.
Am niedrigsten ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Hochschulabschluss. Ihre Werte bleiben über den gesamten Zeitraum hinweg sehr stabil und deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt. Auch Personen mit einem Abschluss an einer BHS oder BMS sowie mit abgeschlossener Lehre schneiden besser ab als jene ohne weiterführende Ausbildung. Die allgemeine Arbeitslosenquote – also über alle Gruppen hinweg – liegt meist im mittleren Bereich und schwankt je nach wirtschaftlicher Lage. Die Grafik zeigt außerdem, dass wirtschaftliche Krisen wie die Finanzkrise 2008 oder die CoronaPandemie 2020/21 in allen Bildungsgruppen Spuren hinterlassen haben. Dennoch bleibt der Unterschied zwischen den einzelnen Ausbildungsniveaus konstant. Menschen mit niedriger Ausbildung sind besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen und haben es schwerer, eine Arbeit zu finden oder in Krisenzeiten ihren Job zu behalten.
Insgesamt wird deutlich, dass Bildung einen wichtigen Schutz gegen Arbeitslosigkeit bietet. Wer über eine abgeschlossene Ausbildung verfügt, hat deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt – besonders dann, wenn es wirtschaftlich schwierig wird. Die Grafik macht daher deutlich, wie wichtig es ist, nach der Pflichtschule eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft S. 18 - 24
AB 1 mögliche Lösung: Die Grafik zeigt die Arbeitslosenquote in den österreichischen Bundesländern im Vergleich zwischen Februar 2023 und Februar 2024. Es fällt sofort auf, dass die Arbeitslosigkeit in Wien mit 11,8 % am höchsten ist. Auch in Kärnten und im Burgenland ist die Quote mit 9,2 % bzw. 8,4 % deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt von 7,6 %. Besonders niedrig ist die Arbeitslosigkeit hingegen in Tirol (4,1 %) und Salzburg (4,2 %), gefolgt von Oberösterreich und Vorarlberg. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern können verschiedene Ursachen haben. In Wien leben viele Menschen auf engem Raum, und es gibt dort besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund oder geringer Ausbildung. Das kann die Arbeitssuche schwieriger machen. Außerdem ist die Konkurrenz in einer Großstadt viel größer. In Regionen wie Tirol oder Salzburg spielt der Tourismus eine große Rolle, und dort werden oft viele Arbeitskräfte – auch saisonal –gebraucht. Das kann die Arbeitslosenzahl senken.
AB 2
AB 3
Auch die Bildung hat einen wichtigen Einfluss. Wer nur einen Pflichtschulabschluss hat, hat es auf dem Arbeitsmarkt schwerer – vor allem in Gegenden mit weniger Angeboten. In städtischen Regionen wie Wien oder Graz sind die Chancen für gut ausgebildete Menschen besser, aber wer keine Ausbildung hat, läuft Gefahr, arbeitslos zu bleiben. In ländlichen Gebieten hingegen sind die Wege zur nächsten Arbeitsstelle oft weit, was die Suche zusätzlich erschwert.
Insgesamt zeigt die Grafik, dass Wohnort, Bildungsniveau und regionale Wirtschaftsstrukturen eine große Rolle spielen, wenn es um die Chancen auf einen Arbeitsplatz geht. Wer in einer wirtschaftlich starken Region lebt und gut ausgebildet ist, hat bessere Chancen, rasch einen Job zu finden.

Verlag
Eigeninitiative: eine Handlung aus eigenem Antrieb setzen * Flexibilität: Anpassungsfähigkeit * Teamfähigkeit: die Begabung, gemeinsam mit anderen arbeiten zu können * Trend: Entwicklungsrichtung * absolvieren: abschließen, bestehen * inskribieren: einschreiben * Kommunikationsfähigkeit: Begabung; die Sprache ziel- und personenorientiert einsetzen zu können * Fachhochschule: universitätsähnliche Einrichtung mit praxisbezogener Ausbildung * Kolleg: eine meist zweijährige praxisbezogene Ausbildung für Maturantinnen/ Maturanten * HAS: Handelsschule * HAK: Handelsakademie * Branche: Berufs- oder Geschäftszweig * Kollektivlohn: ein für eine Berufsgruppe festgesetzter Mindestlohn * Umschulung: Ausbildung, um einen neuen Beruf zu erlernen * Kündigung: Sowohl Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer können das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist beenden. * Entlassung: Arbeitgeberin oder Arbeitgeber beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung * saisonal: von der Jahreszeit abhängig * Alternative: Möglichkeit, Wahl
Die Grafik zeigt deutliche Unterschiede im Bildungsstand der Bevölkerung zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Besonders auffällig ist, dass Menschen ohne Migrationshintergrund am häufigsten eine Lehre oder BMS abgeschlossen haben. Mit 52,7 % liegt dieser Wert deutlich über dem der ersten (28,4 %) und zweiten Generation (43,7 %) von Menschen mit Migrationshintergrund.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft S. 18 - 24
AB 3 Auch beim Pflichtschulabschluss ist ein klarer Unterschied sichtbar: 24,5 % der Personen mit Migrationshintergrund der ersten Generation haben nur diesen Abschluss, bei Menschen ohne Migrationshintergrund sind es hingegen nur 8,8 %. Das zeigt, dass gerade bei der ersten Generation oft ein niedrigerer Bildungsstand vorliegt. Die zweite Generation schneidet in diesem Bereich bereits besser ab, liegt aber noch immer über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Bei den höheren Bildungsabschlüssen (AHS/BHS, Kolleg und Universität) ist das Bild gemischt. Menschen ohne Migrationshintergrund erreichen in etwa gleich häufig wie Menschen mit Migrationshintergrund höhere Schulabschlüsse. Auffällig ist aber, dass Menschen mit Migrationshintergrund der ersten Generation seltener an einer Universität oder Fachhochschule abschließen als Personen ohne Migrationshintergrund (21,4 % vs. 27,4 %). Die zweite Generation liegt hier mit 16,2 % noch weiter zurück.
Diese Unterschiede lassen sich unter anderem dadurch erklären, dass die erste Generation häufig aus Ländern mit anderen Bildungssystemen nach Österreich kam und beim Spracherwerb oder beim Zugang zum österreichischen Bildungssystem benachteiligt war. Viele mussten rasch arbeiten gehen und hatten nicht dieselben Chancen auf weiterführende Schulbildung. Die zweite Generation hat zwar bessere Möglichkeiten, profitiert aber noch nicht vollständig von gleichen Voraussetzungen. Menschen ohne Migrationshintergrund haben oft bessere soziale Netzwerke, kennen das Schulsystem besser und werden gezielter unterstützt. Die Grafik macht also deutlich, dass Bildungschancen in Österreich noch immer stark von der Herkunft beeinflusst sind.
AB 4 von oben nach unten: E * F * F
AB 5 Grafik Nummer 4
Olympe Verlag
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft S. 18 - 25
Lernstandserhebung
1. Einsatzbereitschaft * Eigeninitiative * Selbstständigkeit * Genauigkeit * Pünktlichkeit * Zuverlässigkeit * Ausdauer und Durchhaltevermögen * Kommunikationsfähigkeit * Verantwortungsbewusstsein * Kritikfähigkeit * Durchsetzungsvermögen * Teamfähigkeit * Höflichkeit
2.
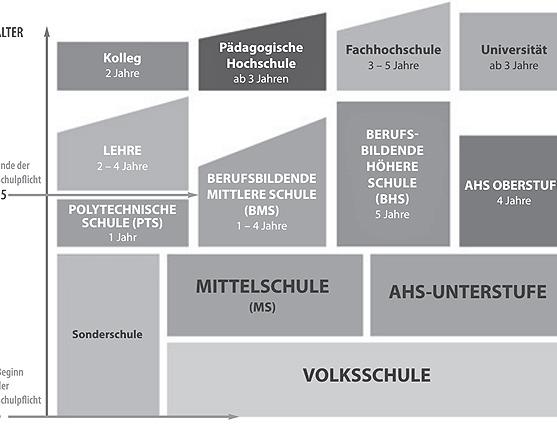
Verlag
3. Das duale System: Die Ausbildung erfolgt sowohl in einem Betrieb aus auch in der Berufsschule. Berufsschulen werden auf zwei unterschiedliche Arten geführt. Entweder besucht man an ein oder zwei Tagen während der Arbeitswoche die Berufsschule oder der Unterricht in der Berufsschule wird geblockt an mindestens acht Wochen im Jahr angeboten. Während dieser Zeit muss man nicht im Lehrbetrieb arbeiten.
4. Entlassung: Arbeitgeberin oder Arbeitgeber beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung * Umschulung: Ausbildung, um einen neuen Beruf zu erlernen * Emanzipation: Gleichberechtigung, Unabhängigkeit * Branche: Berufs- oder Geschäftszweig * Arbeitslosengeld: finanzielle Unterstützung für Arbeitslose * Kollektivlohn: ein für eine Berufsgruppe festgesetzter Mindestlohn * Notstandshilfe: finanzielle Unterstützung nach dem Ende des Arbeitslosengeldes * Patriachat: Gesellschaftsform, in der der Mann eine bevorzugte Stellung hat * Gewinn: Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens * saisonal: von der Jahreszeit abhängig
5. Falsch: Frauen verdienen nach wie vor für gleiche oder gleichwertige Arbeit um 10% weniger als Männer. * Notstandshilfe erhält jede oder jeder Arbeitslose in Österreich für die Dauer von 6 Monaten. * Eine Entlassung findet immer einvernehmlich statt. * In Österreich gibt es nur ein geringes Angebot an weiterführenden Schulen.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Standort-Labyrith
Finde den richtigen Weg durch das Labyrinth! Bei jeder Gabelung musst du eine Frage beantworten. Nur mit der richtigen Antwort kommst du weiter. Verirrst du dich? Dann probier’s noch einmal von vorne!
Wie nennt man einen natürlichen Vorteil für die Besiedlung eines Ortes?
Industriezone (links)
Was zählt zu den harten Standortfaktoren?
Gunstlage (rechts)
Verkehrsanbindung (hinunter) Freizeitangebot (hinauf)
Warum spielt der Boden eine Rolle bei der Standortwahl?
Weil er billig ist (hinauf) Weil er fruchtbar oder bebaubar sein kann (hinunter)
Was ist ein weicher Standortfaktor?
Nähe zum Hafen (rechts)
Lebensqualität (links)
Welche Bedeutung hat der Tourismus in Österreich?
Wichtiger Wirtschaftszweig (hinunter) Kleine Nebenbranche (hinauf)
Was fördert einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort?
Gute Infrastruktur (rechts)
Hohe Abwanderung (links)
Warum siedeln sich Firmen gerne in Städten an
Wegen der vielen Felder (hinauf)
Verlag
Wegen der guten Erreichbarkeit und Arbeitskräfte (hinunter)
Was ist typisch für periphere Räume?
Viele Autobahnen (hinauf)
Abwanderung, schlechtere Infrastruktur (hinunter)
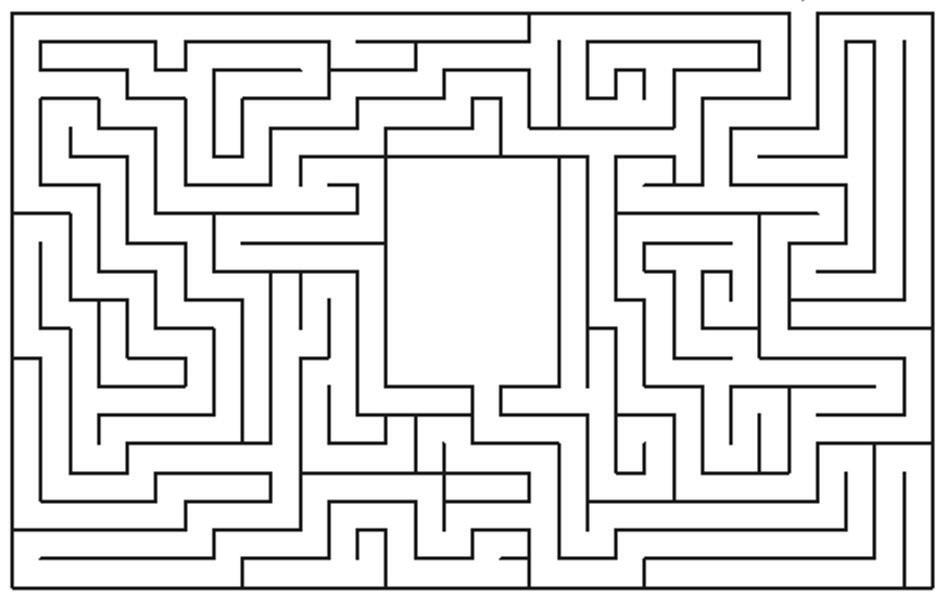

Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
VIELFALT DER WIRTSCHAFTSREGIONEN
IN ÖSTERREICH
1. Lies zuerst diese Informationen über die Vielfalt der Wirtschaftsregionen in Österreich aufmerksam durch!
In Österreich gibt es verschiedene Wirtschaftsregionen, die sich in ihrer Lage, ihren Bodenschätzen, dem Klima, der Bevölkerungsdichte und ihrer wirtschaftlichen Nutzung unterscheiden. Diese Unterschiede führen dazu, dass in manchen Regionen Industrie, in anderen Landwirtschaft, Tourismus oder Dienstleistungen besonders stark vertreten sind.
Hier einige typische Beispiele:
• In Vorarlberg oder Oberösterreich sind viele Industriebetriebe angesiedelt.
• In der Steiermark und im Burgenland spielt die Landwirtschaft eine große Rolle.
• Wien ist das Zentrum für Verwaltung, Wissenschaft, Medien und Finanzwesen.
• Tirol und Salzburg sind stark vom Tourismus geprägt – vor allem durch die Berge und Skigebiete.
• In ländlichen Gebieten gibt es oft weniger Arbeitsplätze, dafür viel Natur und Landwirtschaft.
2. Ordne nun jedem Punkt die passende Wirtschaftsregion zu!
Beispiel: Skihütte in den Alpen → Tourismusregion
Fabrik mit Schornstein
Feld mit Traktor
Bürogebäude mit Laptop
Hotel am See
Marktstand mit Bauernprodukten
Verlag
3. Entscheide, welche Aussagen richtig sind! Wenn du alle Antworten schaffst, erhältst du ein Lösungswort.
richtig falsch
In ganz Österreich ist die Wirtschaft gleich verteilt. B T
In Westösterreich gibt es viele Tourismusregionen. O R
Wien ist ein Zentrum für Dienstleistungen und Verwaltung. U K
Die Landwirtschaft spielt in Ballungsräumen eine besonders große Rolle. E R
In Industriegebieten gibt es oft gute Verkehrsverbindungen. I A
Der Tourismus schafft nur im Sommer Arbeitsplätze. M S
In strukturschwachen Gebieten wandern Menschen oft in Städte ab. M N Wirtschaftsräume unterscheiden sich durch Lage, Klima und Nutzung. U E Regionen mit schwacher Infrastruktur ziehen Unternehmen eher an. L S
Lösungswort:
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Großes Alpenquiz
Streiche bei den folgenden Aussagen die falschen Angaben durch! Tipp: Die Karte und dein Atlas helfen dir dabei.
Verlag




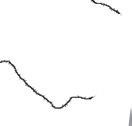

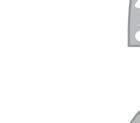
a) Die Kitzbühler Alpen liegen östlich/westlich der Schladminger Tauern.
b) Die Tuxer Alpen liegen in Kärnten/in der Steiermark/in Tirol.
c) Die Gurktaler Alpen liegen in Salzburg/in Kärnten/in Oberösterreich.
d) Die Wildspitze ist Teil der Ötztaler Alpen/der Gurktaler Alpen.
e) Das Kaisergebirge liegt nördlich/südlich der Kitzbühler Alpen.
f) Die Kitzbühler Alpen liegen in Tirol/in Kärnten/in Salzburg.
g) Die Ötztaler Alpen liegen in Tirol/in Vorarlberg/in Salzburg.
h) Die Seckauer Alpen liegen in Salzburg/in der Steiermark/ in Kärnten.
i) Der Bregenzer Wald liegt in Tirol/in Vorarlberg/in Salzburg.
j) Das Sengsengebirge liegt in Salzburg/in Oberösterreich/in der Steiermark.
k) Die Schladminger Tauern liegen westlich/östlich der Seckauer Alpen.
l) Die Seckauer Alpen liegen nördlich/südlich der Gurktaler Alpen.
m) Das Sengsengebirge liegt nördlich/südlich der Gurktaler Apen.
n) Die Gurktaler Alpen liegen nördlich/südlich der Schladminger Tauern.





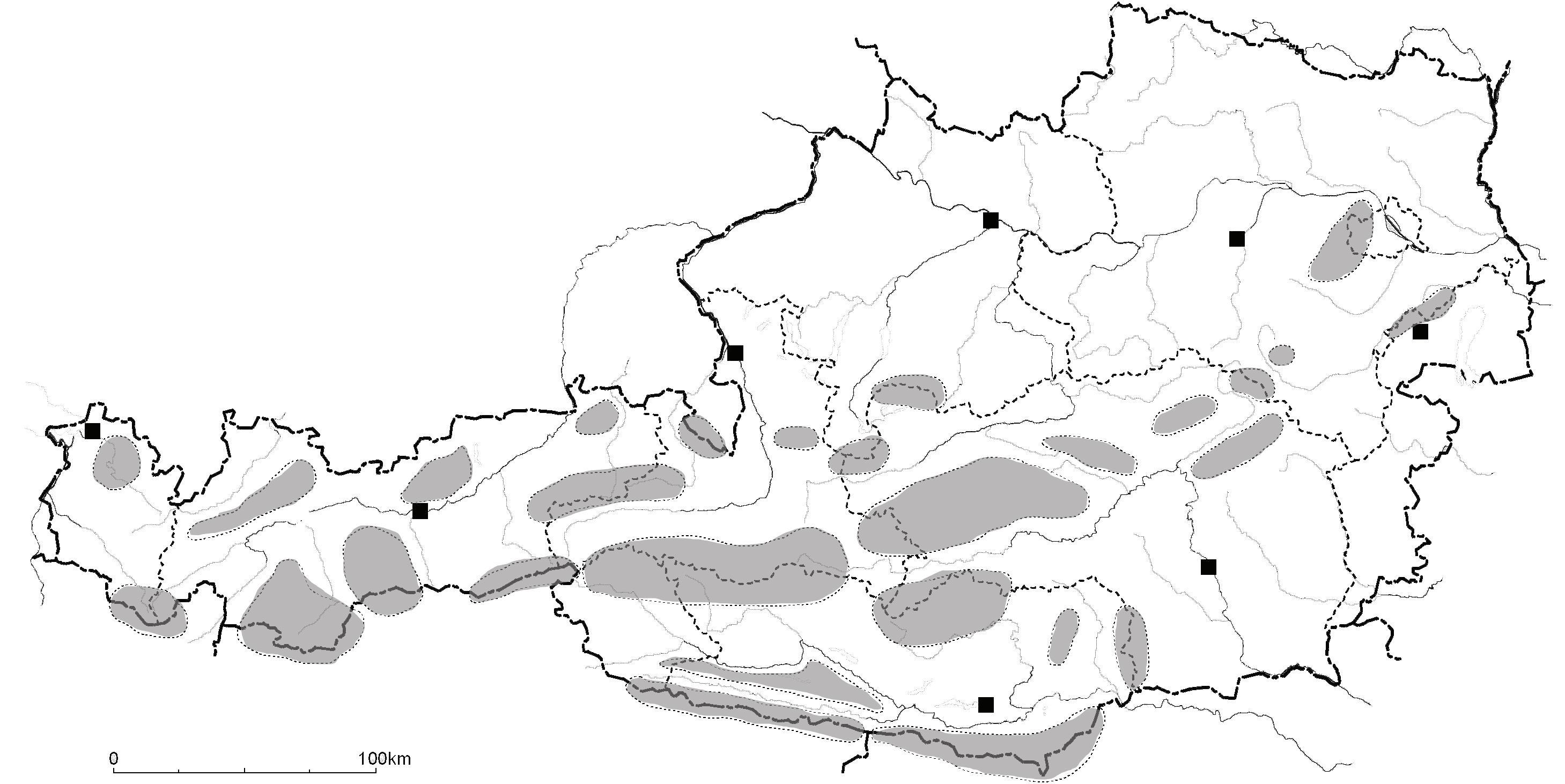






Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
NAME:
Wirtschaftsstandort Österreich
DATUM:
Wahrzeichen Foto-Quiz
Die folgenden Bilder zeigen dir verschiedene berühmte österreichische Gebäude. Entscheide, um welches Wahrzeichen es sich handelt. Anschließend notiere, in welcher Stadt das Wahrzeichen zu finden ist!

T Uhrturm
B Stephansdom
W Goldenes Dachl
Stadt: __________________

R Basilika am Pöstlingberg
T Martinsturm
Ä Uhrturm
Stadt: __________________

E Schloss Mirabell


Olympe Verlag
M Schloss Schönbrunn
L Schloss Esterhazy
Stadt: __________________
Lösungswort:
A Schoss Schönbrunn
O Schloss Esterhazy
N Schloss Mirabell
Stadt: __________________

I Lindwurm
E Rathaus
C Basilka am Pöstlingberg
Stadt: __________________

N Uhrturm
U Martinsturm
W Goldenes Dachl
Stadt: __________________
N Martinsturm
D Schloss Mirabell
U Festung Hohensalzburg
Stadt: __________________

O Schloss Schönbrunn
P Schloss Esterhazy
S Goldenes Dachl
Stadt: __________________

S Rathaus
T Basilika am Pöstlingberg
V Schloss Esterhazy
Stadt: __________________
Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Bundeslandrätsel
In welchem österreichischen Bundesland liegen die folgenden Flüsse, Seen, Gebirge und Städte? Arbeite mit deinem Atlas und ordne richtig zu!

Leopoldsberg
Feldkirch
Grundlsee
Inn
Wulka
Ill

Mittersill
Ötscher
Saualpe
Kufstein
Waidhofen an der Ybbs
Lunzer See
Kapfenberg
Möll
Rechnitz
Wiener Neustadt
Zillertaler Alpen
Hermannskogel
Pörtschach

Bundesland
Verlag
















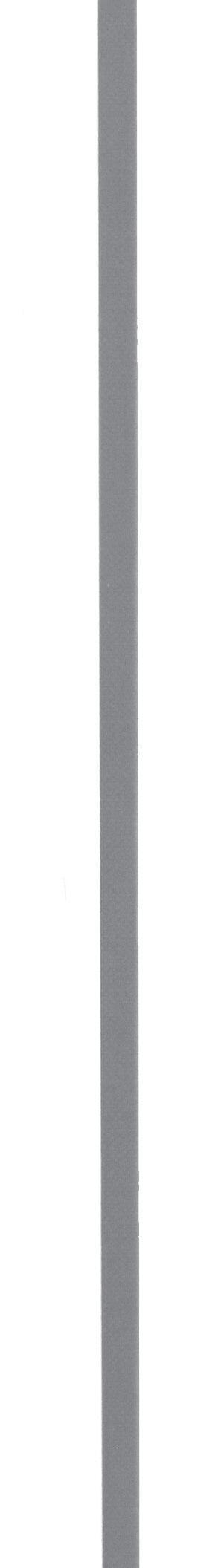

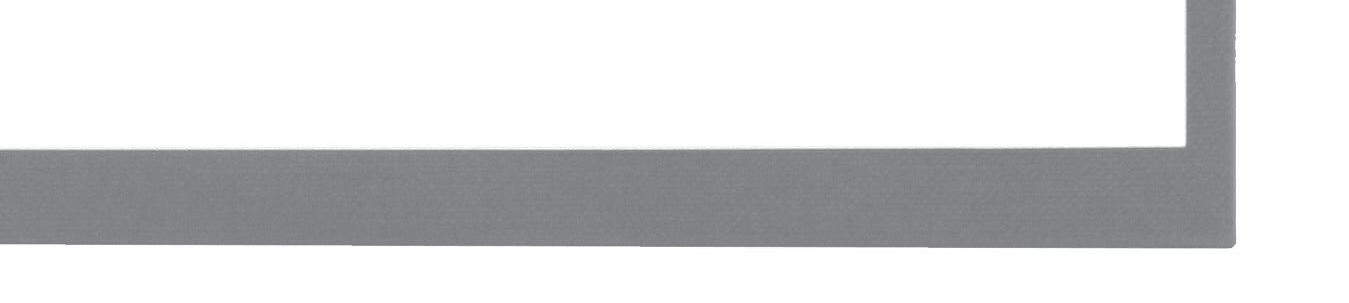
Arbeitsblatt 6 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Bastelbogen - Wappen-SUDOKU
Schneide die Bilder auf der nächsten Seite aus, lege sie dann richtig auf das Sudoku auf, dann erst klebe sie ein! Achtung: In jeder Zeile und jeder Spalte darf jeweils nur ein gleiches Bild sein!







Olympe Verlag
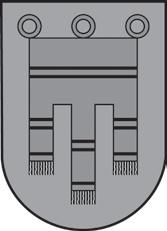



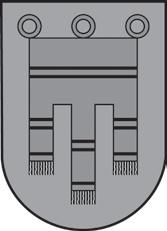
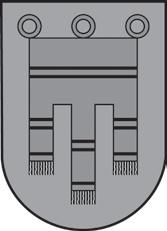


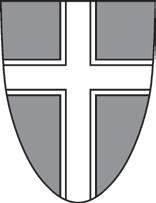
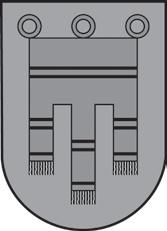


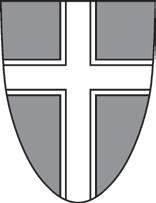







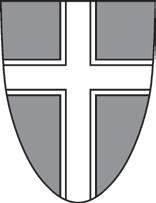





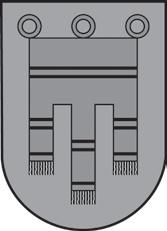
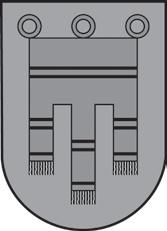



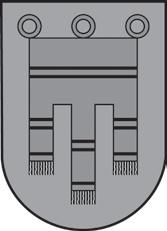
Arbeitsblatt 7 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:















Verlag









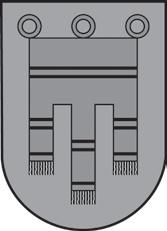
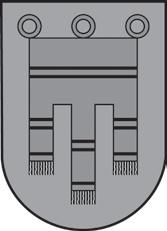




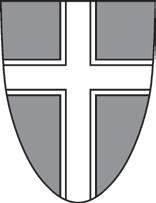
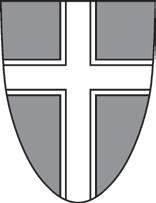
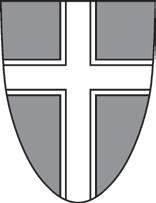
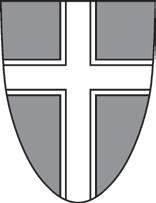
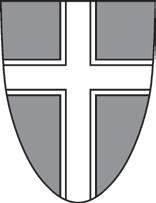
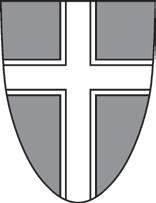




Arbeitsblatt 8 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Löse dieses Rätsel!
Österreich - Kreuzworträtsel

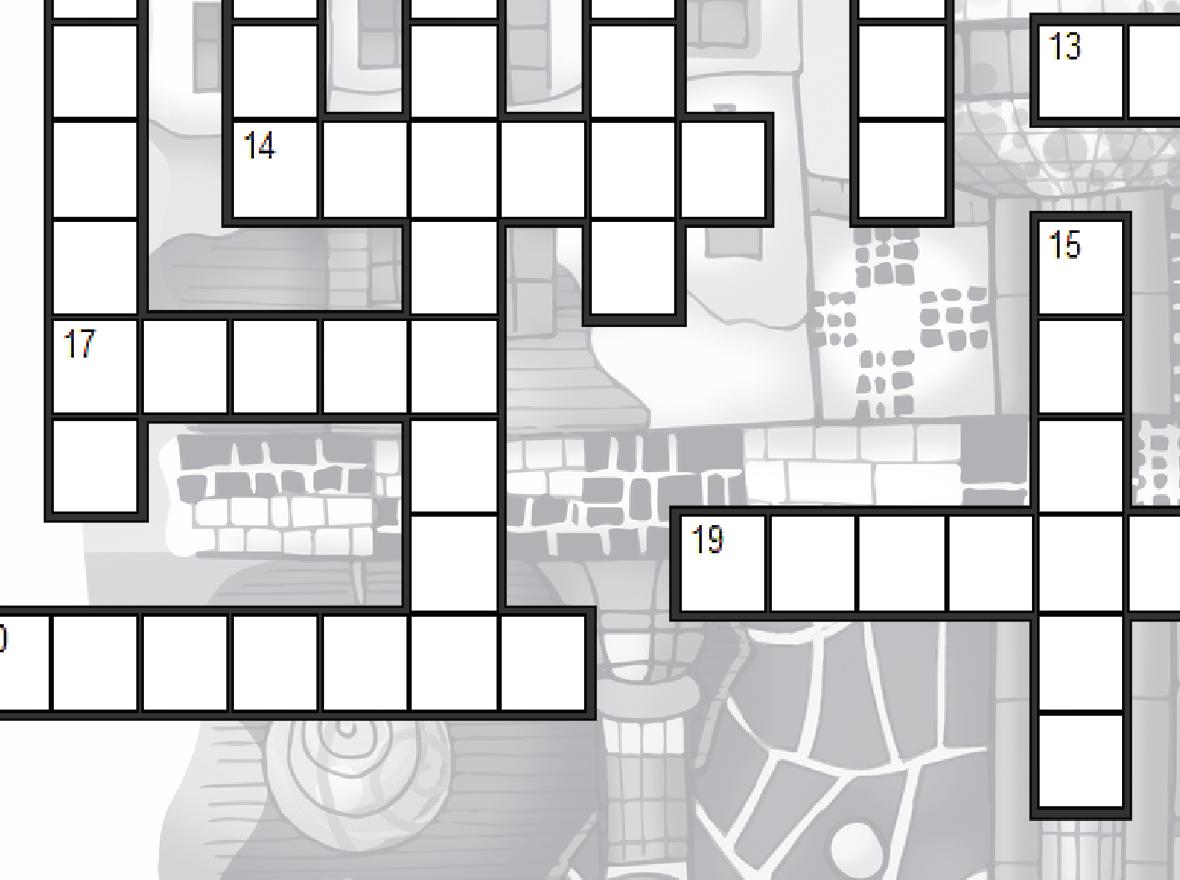

senkrecht:
1. Zersetzung von Gesteinen
2. warme Wasserquelle
4. wichtiges Industriegebiet in der Obersteiermark
5. Naturpark bei Gmünd
6. Ablagerungen
7. Festival in Linz
9. Klagenfurter Wahrzeichen

Olympe Verlag
10. Temperaturumkehrschicht
12. hier mündete der Inn in die Donau
15. Blumeninsel im Bodensee
16. höchster Berg Österreichs
18. Eismassen im Hochgebirge
21. höchster Berg Niederösterreichs
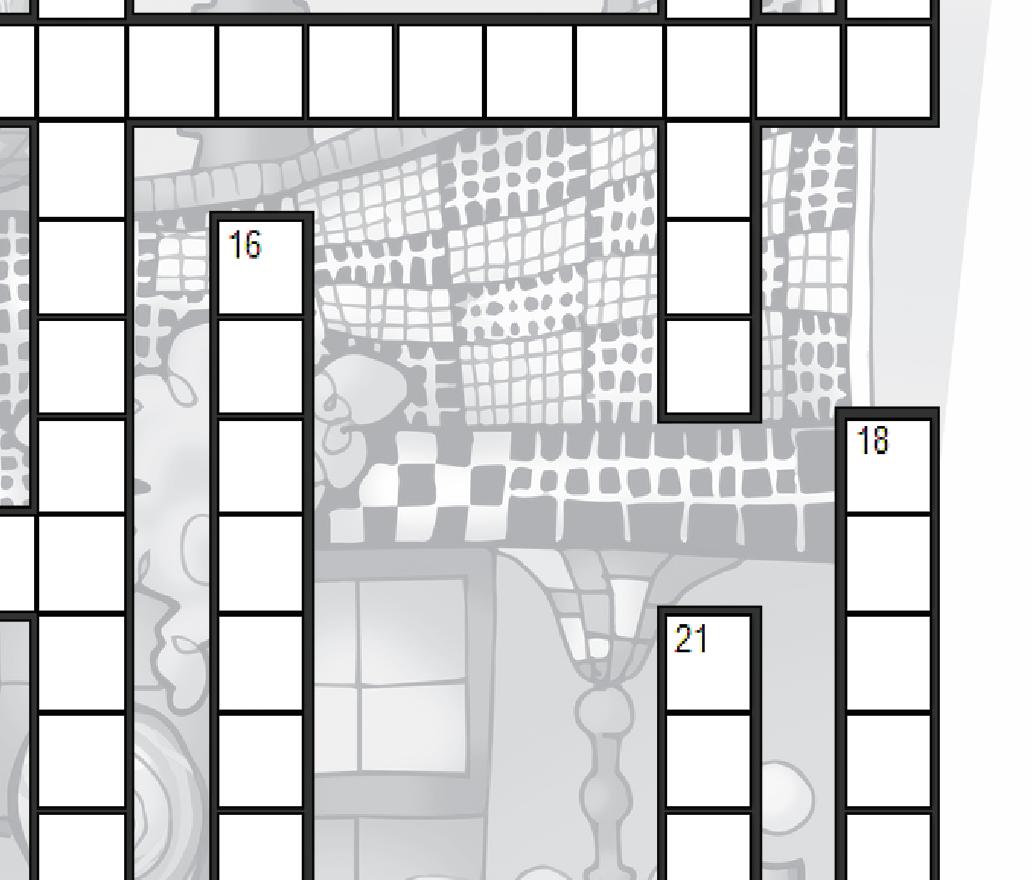
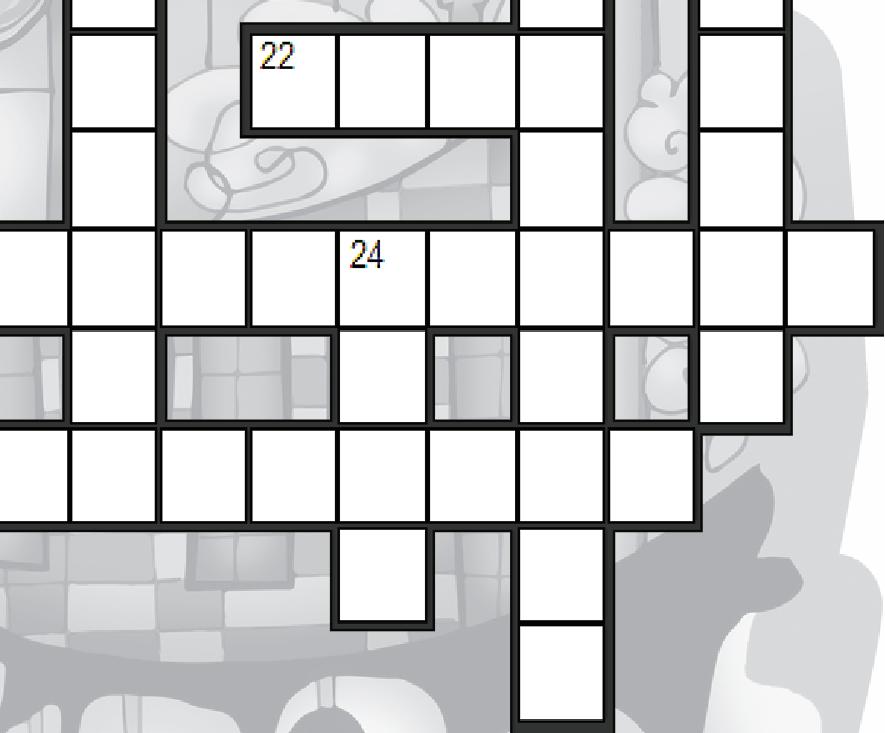

waagrecht:
3. enges, steiles Tal
8. Steppensee in Österreich und Ungarn
11. dieses Gebiet war früher von einem Meer bedeckt
13. Enge zwischen Leopoldsberg und Bisamberg
14. Gletscherschutt
17. größte österreichische Großlandschaft
19. trichterförmige Ausbildung im Kalkgestein
20. U-förmiges, durch einen Gletscher geformtes Tal
22. fester Schnee, der mindestens 1 Jahr alt ist
Arbeitsblatt 9 / KOPIERVORLAGE
NAME:



Wirtschaftsstandort Österreich
DATUM:
Rundreise durch Österreich
Die Studentin Wira hat Besuch aus den USA. Sie möchte ihren Gästen Österreich zeigen und hat sich dafür auch genauestens vorbereitet. Leider sind ihre Notizen über Österreichs Sehenswürdigkeiten durcheinandergekommen. Hilf Wira, diese wieder in Ordnung zu bringen, indem du die Fotos nummerierst!


1. Wira startet ihre Rundreise in Wien. Zunächst zeigt sie ihren Gästen den Stephansdom.



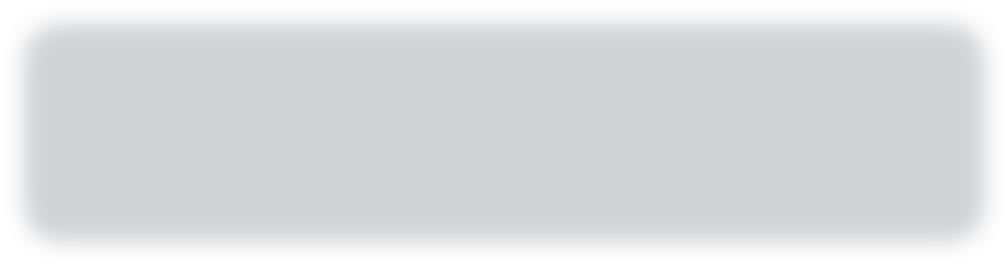
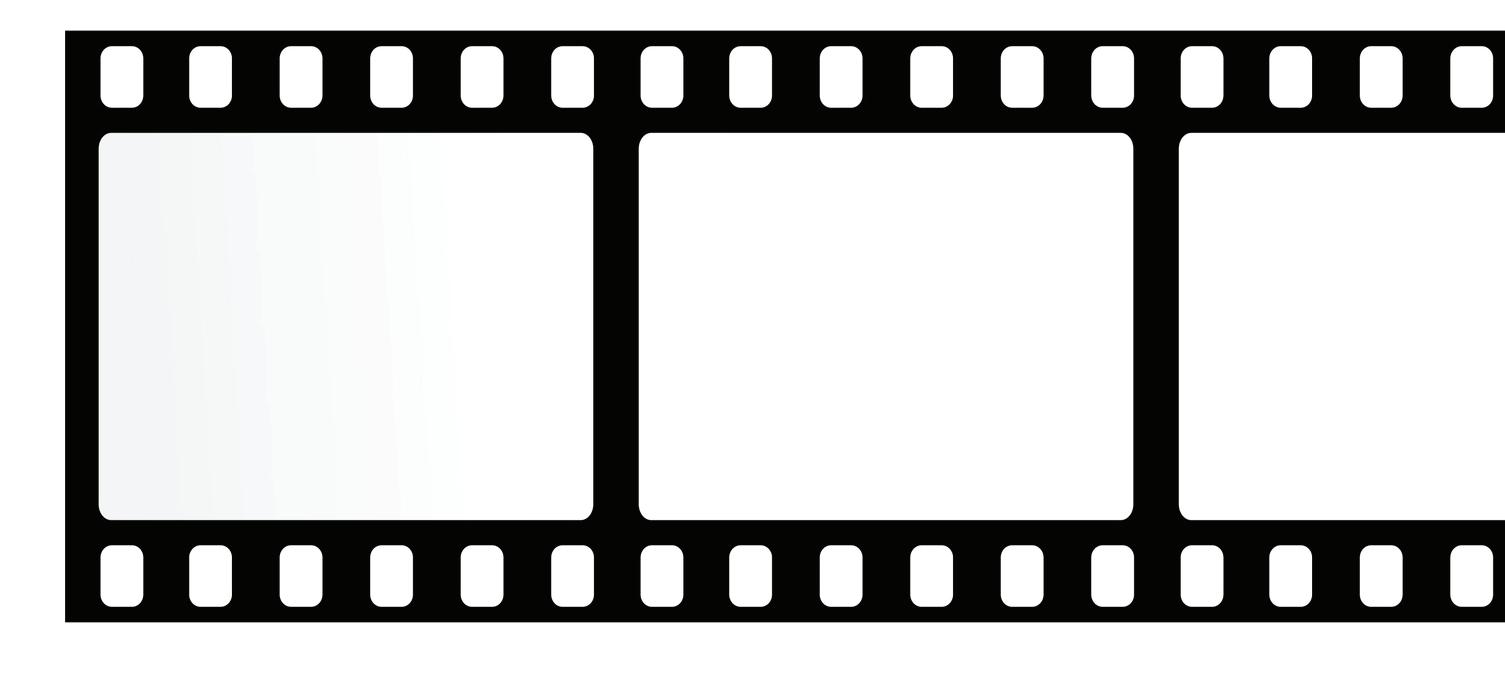
3. In der Wachau besichtigen sie Stift Melk und bewundern die großartige Landschaft. In einem kleinen Gasthof übernachten sie dann, ehe die Reise am nächsten Tag weitergeht.
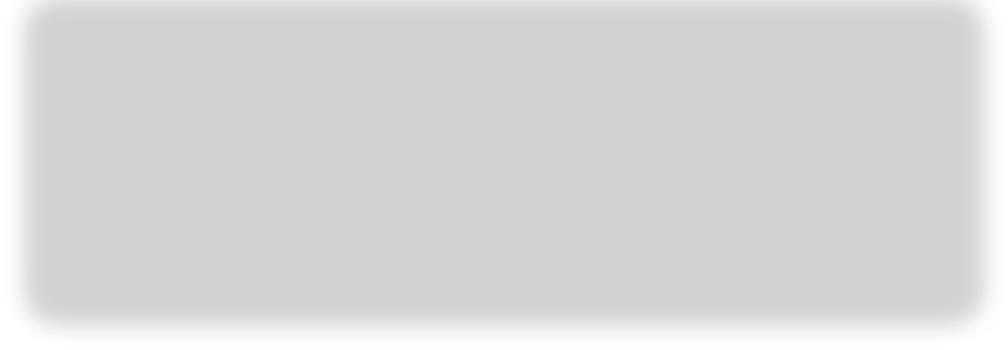
5. Am nächsten Tag besichtigen sie noch die Festung Hohensalzburg, ehe sie weiter reisen nach Vorarlberg.
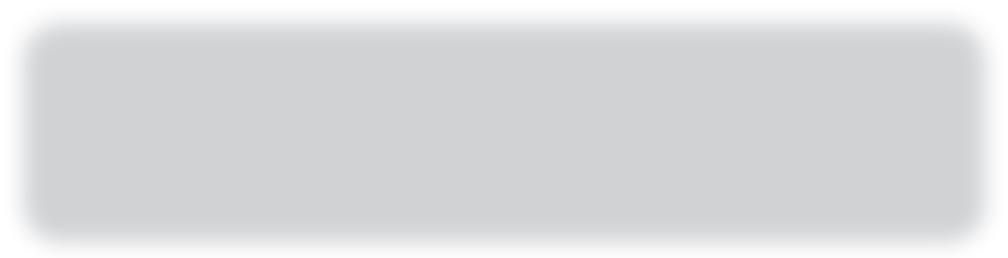

Olympe Verlag
2. Die nächste Sehenswürdigkeit, die Wira ihren Gästen zeigt, ist Schloss Schönbrunn, ehe sie weiter Richtung Westen reisen.


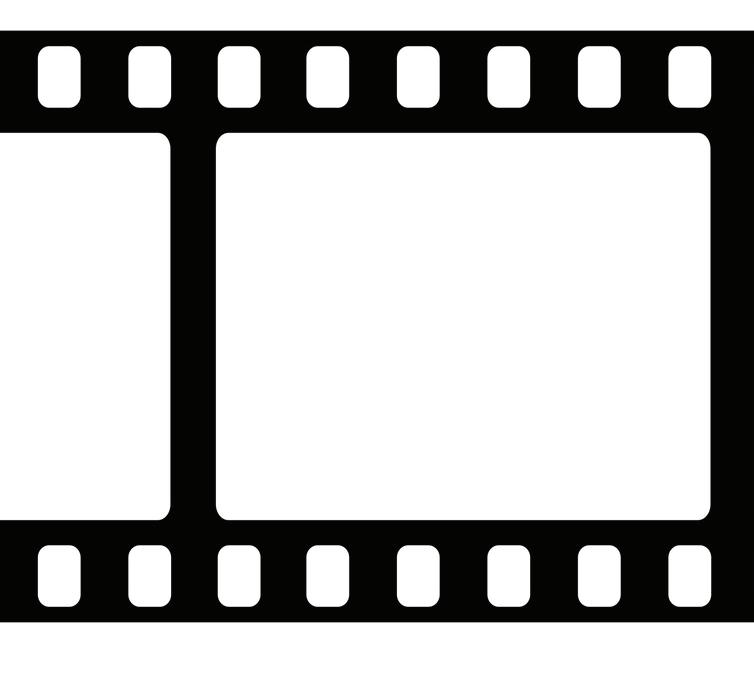
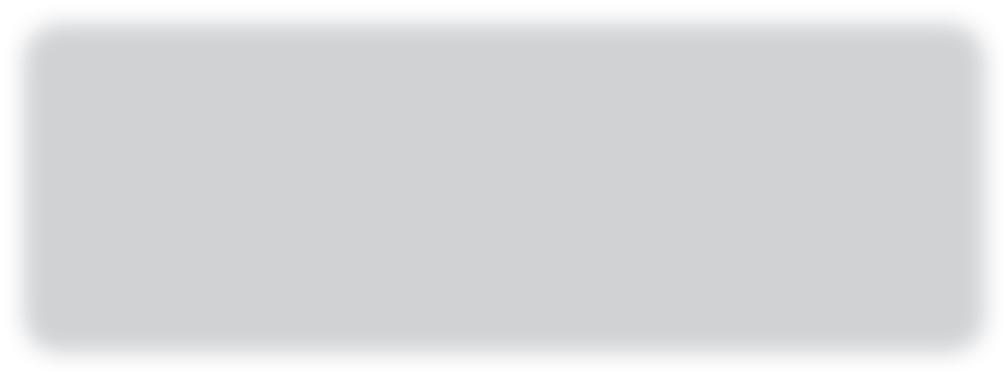
4. Die nächste Station ihrer Reise ist Salzburg. Sie schlendern durch die Gassen der Altstadt, ehe sie sich auf den Weg zu Schloss Mirabell machen, wo sie neben dem Schloss auch die großartige Gartenanlage besichtigen.

6. In Vorarlberg unternehmen sie eine Rundfahrt über den Bodensee und legen einen Halt auf der Blumeninsel Mainau ein.
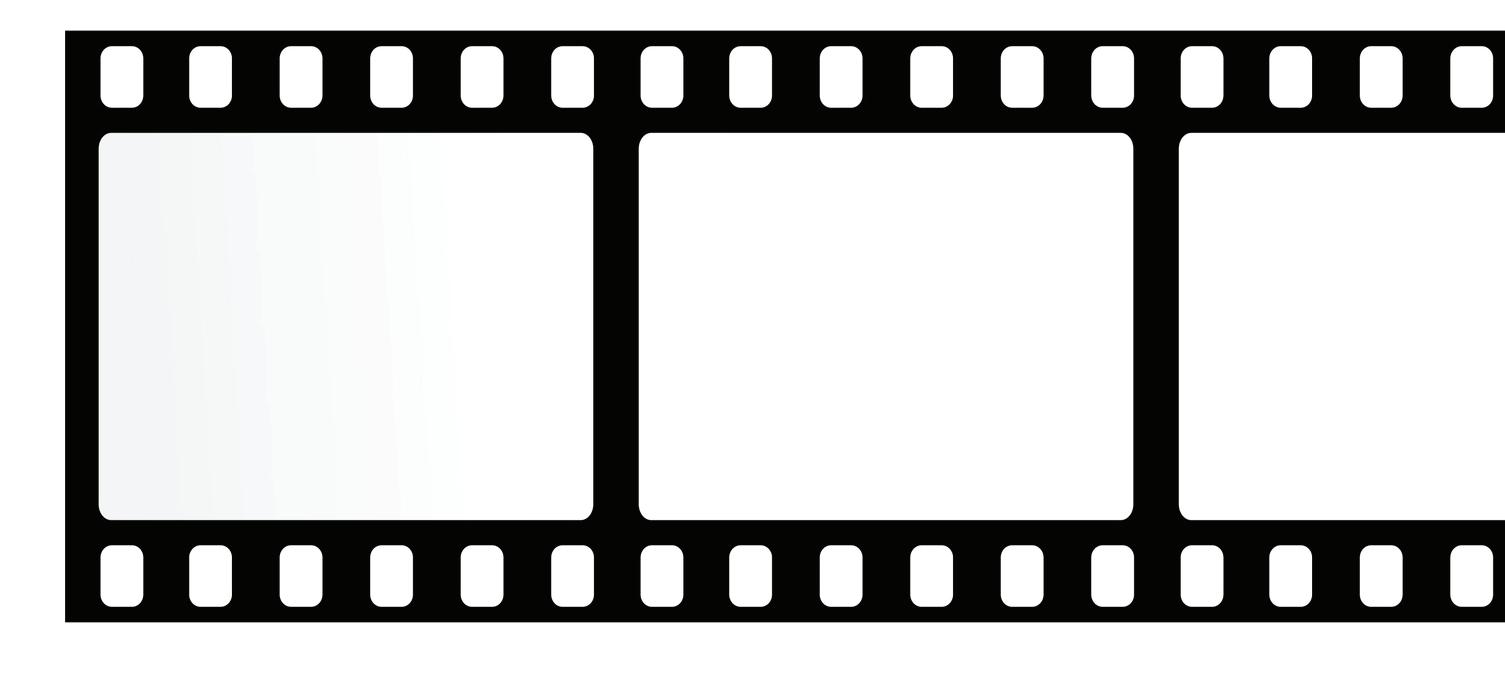



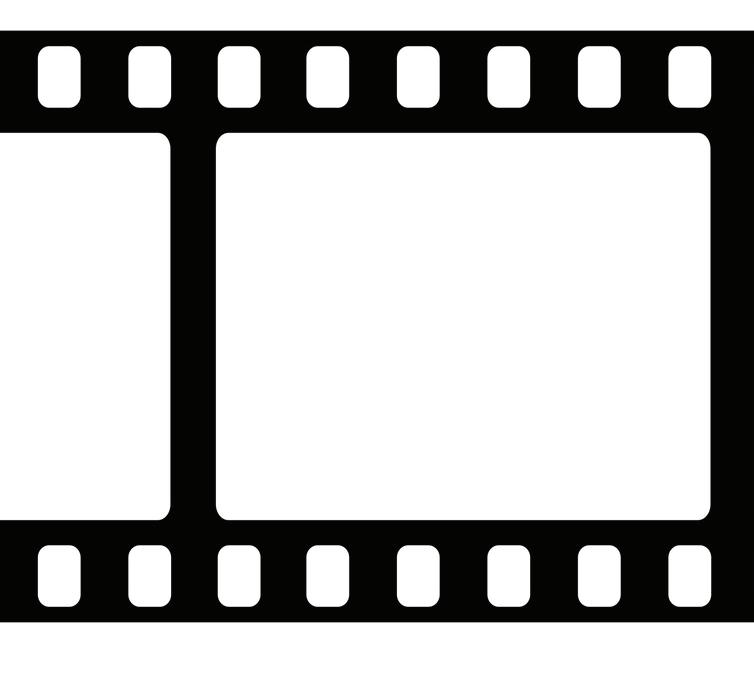
7. Von Vorarlberg reisen sie weiter in die Steiermark und besichtigen die auf einem erloschenen Vulkankegel stehende Riegersburg.
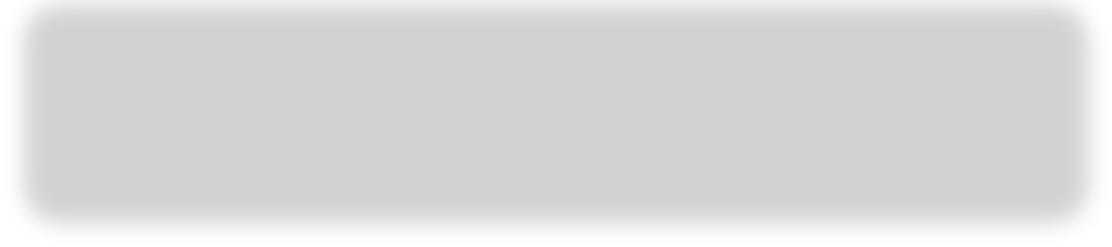
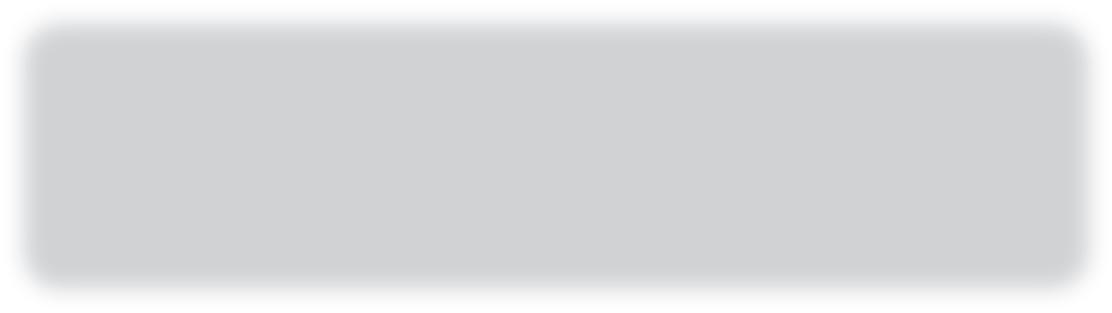
8. Die letzte Station ihrer Reise ist das Burgenland. Sie besichtigen die Landeshauptstadt Eisenstadt, ehe sie sich auf den Weg zum Neusiedler See machen.
Arbeitsblatt 10 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL
Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!
Was bedeutet „wirtschaften“?
Warum muss jeder Mensch wirtschaften?
Was ist ein Wahlbedürfnis?
Was ist ein Gut?
Verlag
Was ist ein Bedürfnis?
Was ist ein Sachgut?
Was ist eine Dienstleistung?
Nenne ein Beispiel für ein Gut.
Was zeigt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) an?
Was bedeutet „produzieren“?
Was ist ein Unternehmen?
Wer bietet Güter am Markt an?
Was ist ein Grundbedürfnis?
Wer fragt Güter am Markt nach?
Was ist ein Markt?
Arbeitsblatt 11 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL
Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!
Ein Wunsch oder ein Verlangen nach etwas.
Weil niemand unendlich viele Mittel zur Verfügung hat.
Ein Apfel, ein Auto, ein Buch.
Ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung.
Verlag
Mit vorhandenen Mitteln sinnvoll umgehen.
Dinge, die man gerne hätte, aber nicht unbedingt braucht.
Es zeigt, wie viel eine Volkswirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet hat.
Eine Tätigkeit, z.B. ein Haarschnitt.
Ein Gegenstand, z.B. ein Tisch.
Unternehmen und Selbstständige.
Eine Organisation, die Güter oder Dienstleistungen anbietet.
Etwas herstellen oder erzeugen.
Ort, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen.
Konsumentinnen und Konsumenten.
Etwas, das man zum Leben braucht, z. B. Nahrung.
Arbeitsblatt 12 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL
Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!
Was ist der Preis?
Was bedeutet Angebot?
Was passiert mit dem Preis, wenn die Nachfrage hoch ist?
Was passiert mit dem Preis, wenn es ein großes Angebot gibt?
Verlag
Was bedeutet Nachfrage?
Was ist ein Wettbewerb?
Was ist ein Kartell?
Warum ist Wettbewerb wichtig?
Warum ändern sich Preise?
Was ist ein Monopol?
Was tut der Staat gegen unlauteren Wettbewerb?
Wie können sich Konsumentinnen und Konsumenten schützen?
Warum ist Information beim Kauf wichtig?
Was bedeutet fairer Handel?
Was ist nachhaltiger Konsum?
Arbeitsblatt 13 / KOPIERVORLAGE
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
Bastelbogen Frage-Antwort-SPIEL
Schneide die Spielkarten aus. Damit sie länger halten, kannst du sie auch folieren. Dann könnt ihr dieses Frage-Antwort-Spiel spielen!
Der Wunsch der Menschen, Güter zu kaufen.
Die Menge an Gütern, die verkauft werden sollen.
Weil sich Angebot und Nachfrage ändern.
Der Preis sinkt.
Verlag
Der Geldbetrag, der für ein Gut gezahlt wird.
Der Preis steigt.
Wenn ein Unternehmen allein ein Gut anbietet.
Er sorgt für bessere Qualität und günstigere Preise.
Konkurrenz zwischen Unternehmen um Kundschaft.
Durch Preisvergleiche und Informationen.
Er erlässt Wettbewerbsregeln und Gesetze.
Eine verbotene Preisabsprache zwischen Unternehmen.
Beim Einkauf auch an Umwelt und Zukunft denken.
Gerechte Bezahlung und Bedingungen für Produzentinnen und Produzenten.
Um gute Entscheidungen zu treffen.
Arbeitsblatt 14 / KOPIERVORLAGE Wirtschaftsstandort Österreich
NAME:
DATUM:
Wer bin ich? – Die Hauptfiguren der ökosozialen Marktwirtschaft
Unten findest du fünf wichtige Akteure in einer ökosozialen Marktwirtschaft: Umwelt, Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen, Staat, Nachhaltigkeit
Jede dieser „Figuren“ spielt eine besondere Rolle. Lies die ausführlichen Beschreibungen genau durch und finde heraus, wer gemeint ist! Trage dann den passenden Begriff in das Lösungsfeld ein. Achtung: Jeder Begriff wird nur einmal verwendet!
1. Ich bin kein Mensch, aber ohne mich geht gar nichts. Ich bestehe aus Luft, Wasser, Tieren, Pflanzen, Böden und vielem mehr. Wenn ich gesund bin, dann können auch Menschen gesund leben. Aber Achtung: Ich kann durch Müll, Abgase, Raubbau oder Chemikalien stark geschädigt werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man auf mich achtet – auch in der Wirtschaft!
Wer bin ich?
2. Ich bin ein ganz zentraler Teil des Wirtschaftskreislaufs. Ich stelle Dinge her, zum Beispiel Kleidung, Möbel, Lebensmittel oder auch Computer. Ich kann auch Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel Haarschnitte, Busfahrten oder Apps. Ich muss mich an Regeln halten, zum Beispiel beim Umweltschutz, bei Steuern und bei fairer Bezahlung. In einer ökosozialen Marktwirtschaft wird von mir erwartet, dass ich verantwortungsvoll wirtschaftlich handle – also auch auf Umwelt und Menschen achte.
Wer bin ich?
Verlag
3. Ich bin eine Person oder eine Menschengruppe – vielleicht sogar du selbst! Ich kaufe Dinge, bezahle für Strom, Internet oder Kinotickets, und treffe dabei Entscheidungen. Meine Einkäufe haben eine große Wirkung, denn ich bestimme mit, welche Produkte Erfolg haben. Wenn ich auf Bio, Fairtrade oder weniger Plastik achte, unterstütze ich nachhaltiges Wirtschaften.
Wer bin ich?
4. Ich mache die Regeln für unser Zusammenleben – auch für die Wirtschaft. Ich sorge dafür, dass niemand betrogen wird, dass Gesetze eingehalten werden und dass es Steuern gibt. Ich kann auch umweltfreundliches Verhalten fördern – zum Beispiel durch eine CO2-Steuer oder durch Förderungen für Solarenergie. In der ökosozialen Marktwirtschaft ist es meine Aufgabe, fairen Wettbewerb, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz zu unterstützen.
Wer bin ich?
5. Ich bin kein Mensch und kein Tier, aber ein wichtiger Gedanke. Ich bedeute: „So leben, dass auch unsere Kinder und Enkel noch gut leben können.“ Ich frage bei jeder Entscheidung: Wie wirkt sich das auf die Zukunft aus? Ich bin das große Ziel der ökosozialen Marktwirtschaft: Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft sollen im Gleichgewicht sein – auch langfristig.
Wer bin ich?
Lernstandserhebung
Wirtschaftsstandort Österreich
NAME: DATUM:
3. Erkläre mit eigenen Worten den Begriff Steuerhinterziehung! 2/
4. Trage die richtige Steuerart zu den folgenden Beispielen ein! 6/
Steuerarten: Lohnsteuer * Umsatzsteuer * Kfz-Steuer * Tabaksteuer * Mineralölsteuer * Hundesteuer
Situation
Marie kauft sich ein T-Shirt im Geschäft.
Felix arbeitet in einer Firma und bekommt jeden Monat Gehalt.
Familie Nowak besitzt ein Auto.
Beim Tanken zahlt man nicht nur für den Treibstoff selbst. Der Vater von Emma raucht regelmäßig Zigaretten.
Anna hat einen Labrador, für den sie jährlich etwas an die Gemeinde zahlen muss.
Verlag
Welche Steuer ist gemeint?
5. Stelle dir selbst eine Frage zum Thema „Menschen wirtschaften“! 3/ Frage:
Antwort:
6. Was sind Standortfaktoren? Nenne mindestens drei Beispiele! 3/
39-44 = Du bist Geografie- und Wirtschaftsmeisterin/-meister
33-38 = Du hast dir viel gemerkt
27-32 = Du weißt schon einiges
22-26 = Du solltest noch viel üben
<22 = Du solltest dir diesen Abschnitt im Buch noch einmal durchlesen
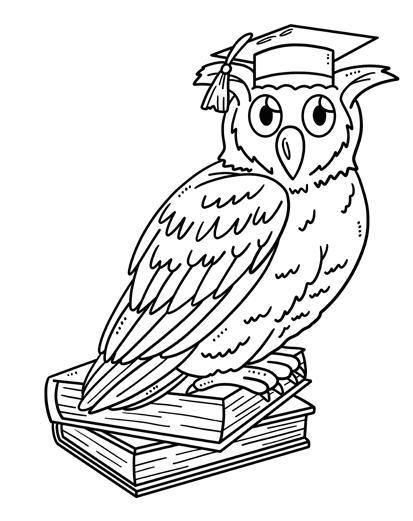
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 1/S. 47/1 mögliche Lösung: Wenn sich eine große Firma in einer Region ansiedelt, entstehen dort neue Arbeitsplätze. Viele Menschen wollen in der Nähe dieser Firma wohnen, um einen kurzen Arbeitsweg zu haben.
Dadurch steigt die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern – aber das Angebot bleibt zunächst gleich oder wächst nur langsam. Wenn viele Menschen das Gleiche wollen (also eine Wohnung oder ein Grundstück), aber nur wenig davon verfügbar ist, werden die Preise dafür teurer
Das bedeutet: Die Mieten steigen, weil Vermieterinnen und Vermieter wissen, dass viele bereit sind, mehr zu zahlen. Auch die Grundstückspreise steigen, weil Bauflächen für Wohnhäuser oder Geschäfte plötzlich sehr gefragt sind.
Kurz gesagt: Mehr Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot führt zu höheren Preisen.
K. 1/S. 47/2 individuelle Lösung
K. 1/S. 47/3 mögliche Lösung: Wie Standortentscheidungen von Unternehmen die Entwicklung Österreichs beeinflussen können
Die Entscheidung eines Unternehmens, sich an einem bestimmten Ort in Österreich niederzulassen, hat großen Einfluss auf die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung dieser Region –und damit auch auf das ganze Land.
Ein großer Vorteil ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wenn ein Unternehmen viele Menschen beschäftigt, steigt die Kaufkraft in der Region. Das kann wiederum dazu führen, dass sich weitere Betriebe ansiedeln – zum Beispiel Supermärkte, Bäckereien oder Dienstleister. Schulen, Kindergärten und Verkehrswege werden oft ausgebaut, wenn die Bevölkerung wächst. So kann ein einzelnes Unternehmen den wirtschaftlichen Aufschwung einer ganzen Region anstoßen. Allerdings gibt es auch mögliche Nachteile. Wenn viele Menschen in die Region ziehen, steigt die Nachfrage nach Wohnraum. Das kann zu höheren Mieten und Grundstückspreisen führen, was besonders für Familien mit wenig Einkommen ein Problem ist. Auch die Umwelt kann unter der Ansiedlung eines großen Betriebs leiden – etwa durch mehr Verkehr, Flächenverbrauch oder Luftverschmutzung.
Für die Entwicklung Österreichs bedeutet das: Standortentscheidungen von Unternehmen sind Chancen und Herausforderungen zugleich. Wichtig ist, dass solche Entscheidungen gut geplant werden – mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen und der Umwelt. Nur so kann eine nachhaltige, gerechte und erfolgreiche Entwicklung gelingen.
K. 2/S. 51/1 a)
Wintersportort
Bundesland
Kitzbühel Tirol
St. Anton am Arlberg Tirol
Ischgl Tirol
Sölden Tirol
Obertauern Salzburg
Schladming Steiermark
Bad Kleinkirchheim
Nassfeld
Kärnten
Kärnten
Lech am Arlberg Vorarlberg
Semmering Niederösterreich
Sommerort/-region
Bundesland
Zell am See Salzburg
Wolfgangsee Salzburg/Oberösterreich
Olympe Verlag
Wörthersee Kärnten
Millstätter See Kärnten
Neusiedler See Burgenland
Salzkammergut Oberösterreich/Steiermark/Salzburg
Großglockner-Region Kärnten/Tirol
Wachau Niederösterreich
Nationalpark Gesäuse Steiermark
Bregenzerwald Vorarlberg
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 2/S. 51/1 b)
Gebiet / Region
Waldviertel (Nordwesten)
Weinviertel (Nordosten)
Innviertel
Hausruckviertel
Industrieviertel (südöstlich von Wien)
Bundesland
Niederösterreich
Niederösterreich
Oberösterreich
Oberösterreich
Niederösterreich
Nordburgenland (außer Neusiedler See) Burgenland
Südburgenland Burgenland
Mühlviertel (nördlich von Linz)
Oberösterreich
Unterkärnten (außerhalb Seenregionen) Kärnten
Oberes Marchfeld
K. 2/S. 52/2
Niederösterreich
c) Bad Gastein * Bad Hofgastein * Bad Ischl * Bad Tatzmannsdorf * Bad Waltersdorf * Bad Gleichenberg * Bad Schallerbach * Bad Radkersburg * Bad Vöslau * Bad Häring
d) Bundesländer mit viel biologischer Landwirtschaft: Salzburg * Oberösterreich * Steiermark * Tirol * Vorarlberg
Bundesländer mit wenig biologischer Landwirtschaft: Burgenland * Niederösterreich * Wien * Kärnten
e) individuelle Lösung
Region
Waldviertel (NÖ)
Marchfeld (NÖ)
Salzkammergut (OÖ/Sbg)
Zillertal (Tirol)
Neusiedler See (Bgld)
Bregenzerwald (Vbg)
Landschaftsform Nutzung (Landwirtschaft, Tourismus etc.)
Hügelland, teils Granitplateau
Ebene, fruchtbare Böden
Seenlandschaft, Alpenvorland
Verlag
Forstwirtschaft, Kartoffelanbau, sanfter Tourismus
Intensivlandwirtschaft (Getreide, Gemüse), kaum Tourismus
Tourismus (Wandern, Seen, Thermen), Milchwirtschaft
Alpen, tief eingeschnittenes Tal
Flache Landschaft, Steppensee
Mittelgebirge, bewaldete Höhenzüge
Lungau (Sbg) Hochplateau, umgeben von Bergen
Murtal (Stmk)
Kärntner Seengebiet
Flusstal mit Industrie und Landwirtschaft
Seen (z. B. Wörthersee), Voralpenlandschaft
Ganzjahrestourismus (Ski, Wandern), Almwirtschaft
Weinbau, Radtourismus, Vogelbeobachtung
Käseproduktion, Bergtourismus, Almwirtschaft
Biolandwirtschaft, Sommer- und Wintertourismus, Abwanderung
Ackerbau, Industrie (z. B. Zeltweg), Tourismus im oberen Tal
Badetourismus, Zweitwohnsitze, milderes Klima
Weinviertel (NÖ) Hügelland, weite Felder Weinbau, Agrarwirtschaft, wenig Tourismus
K. 2/S. 52/3 individuelle Lösung
Verkehrsanbindung & Besonderheiten
Eher dünnes Straßennetz, Bahnverbindungen nach Krems/Zwettl
Gute Straßenanbindung (S1, B8), Nähe zu Wien
Gute Bahnanbindung (z. B. Gmunden, Bad Ischl), Straßen gut ausgebaut
Zillertalbahn, Zufahrten über Bundesstraßen
Bahn nach Neusiedl, Straßen flach und gut ausgebaut
Gut ausgebaute Landstraßen, Busnetz, keine Autobahn
Autobahnanschluss (A10), sonst abgelegen
Schnellstraße (S36), Bahnverbindung entlang der Mur
Bahnlinien (z. B. Klagenfurt–Villach), A2 Autobahn
Nähe zu Wien, gute Schnellstraßenverbindung (B7, S1)
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 2/S. 53/4 mögliche Lösung:
1. Zutrittsmanagement & Besucherlenkung: Einführung eines digitalen Besucherleitsystems (z. B. Ampelsystem online & vor Ort), das anzeigt, ob Hallstatt stark besucht ist. * Maximale Tagesbesucherzahl für Reisegruppen – vorherige Online-Registrierung nötig. * Eintrittsfenster für große Gruppen zu festgelegten Uhrzeiten, um Stoßzeiten zu vermeiden.
2. Tourismus auf sanfte Angebote umlenken: Förderung von Naturerlebnissen außerhalb des Ortskerns (z. B. Wanderrouten, E-Bike-Touren, stille Aussichtspunkte). * Entwicklung thematischer Routen („Salzweg“, „Ruheorte rund um den See“) zur Entzerrung des Besucherflusses. * Ausbau von Digitalführungen und Audioguides, damit Besucherinnen und Besucher auch abseits der Hotspots informiert unterwegs sind.
3. Wohnen & Leben schützen: Begrenzung von Ferienwohnungen und Zweitwohnsitzen im Ortskern (z. B. durch Widmungen, Wohnraumverordnung). * Unterstützung von Einheimischen bei Mietkosten durch touristische Ausgleichsfonds. * Förderung lokaler Betriebe gegenüber globalen Souvenirketten – z. B. mit Siegel „Made in Hallstatt“.
4. Regulierung des Verkehrs: Sperre des Ortskerns für den Privatverkehr von Tagesbesucherinnen und Tagesbesuchern – Parkplätze nur am Ortsrand mit Shuttlebus. * Autofreie Zeiten in Stoßzeiten (z. B. vormittags im Sommer). * Ausbau von umweltfreundlichen Anreisemöglichkeiten (Bahn, Fahrrad, E-Shuttle).
5. Bildung und Bewusstsein: Informationskampagnen für Touristinnen und Touristen (online und vor Ort), z. B. über Rücksichtnahme, Müllvermeidung, Lärmschutz. * Digitaler „Hallstatt-Knigge“ in mehreren Sprachen. * Kooperationsprojekte mit Schulen, um Jugendlichen nachhaltigen Tourismus näherzubringen.
6. Saisonausgleich fördern: Entwicklung von Ganzjahresangeboten, um Besucherinnen und Besucher gleichmäßiger zu verteilen (z. B. Kulturwanderungen im Herbst). * Organisation kleiner lokaler Feste im Frühling/Herbst, die nicht für den Massentourismus gedacht sind. * Kooperation mit Reiseanbietern, um Gruppen außerhalb der Hochsaison nach Hallstatt zu bringen.
7. Digitale Besuchersteuerung: Einführung einer kostenlosen Buchungs-App, in der man Zeitfenster für Museumsbesuche, Parkplätze oder den Skywalk reserviert. * Echtzeit-Anzeige von Auslastungen in Hallstatt mit Push-Benachrichtigungen bei Überfüllung.
K. 2/S. 53/5 individuelle Lösung
Bonus/S. 60/1
Verlag
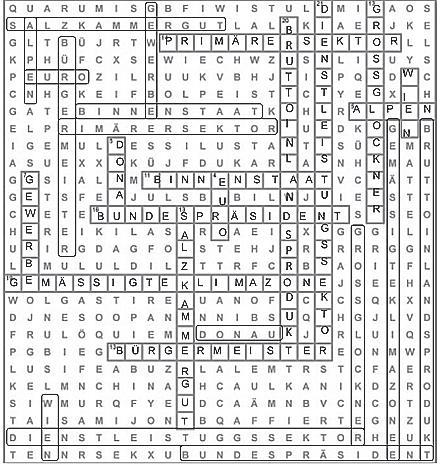
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
Bonus/S. 60/2 Salzkammergut: Seenreiche Alpen- und Voralpenlandschaft im südlichen Oberösterreich und angrenzenden Gebieten von Salzburg und der Steiermark um den Oberlauf der Traun * Bruttoinlandsprodukt: BIP gibt den Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen an, die in einem Jahr innerhalb eines Landes hergestellt wurden und dem Endverbrauch dienen * Alpen: 1 200 km langer Gebirgsbogen vom Golf von Genua bis Wien * Donau: längster Fluss Österreichs * Bundespräsident: Staatsoberhaupt * Bürgermeisterin oder Bürgermeister: verwaltet eine Gemeinde * Dienstleistungssektor: Tertiärer Sektor * Primärer Sektor: Land- und Forstwirtschaft * Wien: Hauptstadt Österreichs * Großglockner: höchster Berg Österreichs * Gemäßigte Klimazone: vorherrschende Klimazone in Österreich * Binnenstaat: Staat ohne Zugang zum Meer
Bonus/S. 61/3 Vorarlberg: wichtigster Fluss: Rhein * Tirol: höchster Berg: Großglockner * Salzburg: 6 politische Bezirke * Oberösterreich: größter See: Attersee * Steiermark: höchster Berg: Hoher Dachstein * Kärnten: wichtigster Fluss: Drau * Burgenland: höchster Berg: Geschriebenstein * Niederösterreich: Landeshauptstadt: St. Pölten * Wien: wichtigster Fluss: Donau
Bonus/S. 62/4 3. Wahrzeichen von Eisenstadt * 6. höchster Berg Österreichs * 7. Nachbarländer der Steiermark * 8. höchster Berg Vorarlbergs * 2. Grazer Wahrzeichen * 1. größter See der Steiermark * 4. größter See Kärntens * 5. andere Bezeichnung für die Steiermark
Bonus/S. 62/5 individuelle Lösung
Bonus/S. 62/6 mögliche Lösung: Die Seen und Flüsse Kärntens spielen eine sehr wichtige Rolle – sowohl für den Tourismus als auch für die Umwelt des Bundeslandes. Aus touristischer Sicht sind die Kärntner Seen – allen voran der Wörthersee, der Millstätter See, der Ossiacher See und der Weissensee – echte Besuchermagnete. Sie ziehen jedes Jahr hunderttausende Gäste an, vor allem in den Sommermonaten. Das warme Wasser, die saubere Qualität und die gute Infrastruktur machen die Kärntner Seen zu idealen Zielen für Badeurlaub, Wassersport und Erholung. Auch Veranstaltungen, wie Beachvolleyball-Turniere oder Musikfestivals am Seeufer, tragen zur touristischen Attraktivität bei. Die Flüsse Kärntens, etwa die Drau oder die Gail, sind wichtig für Aktivitäten wie Rafting, Kanufahren oder Radfahren entlang der Flussradwege. Der Tourismus rund um die Gewässer schafft viele Arbeitsplätze und ist für die regionale Wirtschaft von großer Bedeutung.
Verlag
Gleichzeitig haben die Seen und Flüsse eine enorme ökologische Bedeutung. Sie bieten Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten – zum Beispiel für seltene Fischarten, Wasservögel oder Röhrichtpflanzen. Besonders der Weissensee ist bekannt für seinen sanften Tourismus und seine weitgehend unberührte Natur. Flüsse wie die Drau spielen außerdem eine wichtige Rolle für die Wasserqualität, die Grundwasserneubildung und den Hochwasserschutz. Intakte Gewässerlandschaften helfen dabei, den Klimawandel abzufedern, da sie Wasser speichern und das Mikroklima regulieren können.
Allerdings bringt die touristische Nutzung auch Herausforderungen mit sich. Übermäßige Bebauung, Bootsverkehr oder die Verschmutzung durch Sonnencreme und Abfälle können die empfindlichen Ökosysteme der Seen gefährden. Deshalb ist es wichtig, auf Nachhaltigkeit zu achten: mit strengen Umweltauflagen, ausgewogenen Nutzungskonzepten und bewusstem Verhalten der Gäste. Insgesamt lässt sich sagen: Die Seen und Flüsse Kärntens sind zentrale Natur- und Tourismusressourcen, deren Schutz und nachhaltige Nutzung entscheidend für die Zukunft des Landes sind. Nur wenn Ökologie und Tourismus im Gleichgewicht stehen, kann Kärnten auch langfristig vom „Land der Seen“ profitieren.
Bonus/S. 62/7 individuelle Lösung
K.3/S. 67/1 orange: Die Wirtschaftsleistung steigt an. * blau: Die Kapazitäten der Wirtschaft sind voll ausgelastet. * grün: Die Wirtschaftsleistung geht zurück. * rot: Die Wirtschaftsleistung ist auf einem Tiefstand.
K.3/S. 67/2 individuelle Lösung
K.3/S. 68/3 Die Grafik zeigt die Entwicklung des realen BIP-Wachstums von Quartal 2/2019 (Q2 2019) bis Quartal 3/2023 (Q3 2023). Es handelt sich also um einen Zeitraum von viereinhalb Jahren. * BIP steht für Bruttoinlandsprodukt. Es misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einem Land produziert werden – abzüglich der Vorleistungen. Das BIP zeigt somit die wirtschaftliche Leistung eines Landes. * Ein Wachstum über 5 % wurde in folgenden Quartalen erreicht: Q2 2021: +12,2 %, Q3 2021: +6,4 %, Q4 2021: +9,6 %, Q1 2022: +6,5 % Diese sehr hohen Wachstumsraten sind vor allem auf die starke Erholung nach dem Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch im Jahr 2020 zurückzuführen. * Negatives Wachstum, also wirtschaftlicher Rückgang, trat in folgenden Quartalen auf
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K.3/S. 68/3
• Q1 2020: –0,2 %
• Q2 2020: –3,5 %
• Q3 2020: –13,2 % (stärkster Rückgang – Corona-Krise)
• Q4 2020: –4,3 %
• Q1 2021: –5,6 %
• Q2 2021: –5,5 %
• Q2 2023: –1,6 %
• Q3 2023: –2,0 %
Besonders auffällig sind die massiven Einbrüche im Jahr 2020, verursacht durch die COVID-19Pandemie. * Das BIP pro Einwohnerin oder Einwohner (auch „BIP pro Kopf“) berechnet man, indem man das gesamte Bruttoinlandsprodukt eines Landes durch die Bevölkerungszahl teilt. Diese Kennzahl hilft dabei, die wirtschaftliche Leistung pro Person zu bewerten und mit anderen Ländern zu vergleichen.
K.3/S. 68/4 mögliche Lösung: Eine Depression ist die tiefste Phase im Konjunkturverlauf und bedeutet, dass die wirtschaftliche Leistung stark zurückgegangen ist. Für den Dienstleistungssektor hat das mehrere negative Auswirkungen, die sich sowohl auf die Anbieter als auch auf die Kundinnen und Kunden auswirken.
Zunächst einmal geben viele Menschen in einer Depression weniger Geld aus, weil sie entweder arbeitslos geworden sind oder Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie sparen vor allem bei nicht lebensnotwendigen Dienstleistungen wie Restaurantbesuchen, Hotelübernachtungen, Friseurbesuchen, Freizeitaktivitäten oder Reisen. Dadurch sinkt die Nachfrage in großen Teilen des Dienstleistungsbereichs deutlich.
Für viele Betriebe bedeutet das sinkende Einnahmen. In Folge davon kommt es häufig zu Kosteneinsparungen, Personalabbau oder sogar zu Betriebsschließungen. Besonders betroffen sind kleinere Unternehmen, die oft keine finanziellen Rücklagen haben. Auch Selbstständige, z. B. in der Kultur-, Veranstaltungs- oder Wellnessbranche, geraten in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Zudem kann eine Depression auch den staatlichen Dienstleistungsbereich beeinflussen. Wenn der Staat weniger Steuereinnahmen hat, könnte er öffentliche Dienstleistungen kürzen oder nur eingeschränkt anbieten – etwa im Bereich Bildung, Gesundheit oder Verkehr.
Ein weiterer Aspekt betrifft das Vertrauen. In Krisenzeiten verschieben viele Menschen Ausgaben, die mit Beratung, Investition oder Planung zu tun haben – z. B. Finanzberatung, Architekturleistungen oder Schulungen. Auch hier sind Dienstleister von der allgemeinen Unsicherheit betroffen. Zusammenfassend lässt sich sagen: In einer wirtschaftlichen Depression ist der Dienstleistungssektor besonders anfällig, weil er stark vom Konsumverhalten der Menschen abhängt. Je stärker die Kaufzurückhaltung und Unsicherheit, desto schwerer sind die wirtschaftlichen Folgen für viele Dienstleistungen spürbar.
K. 4/S. 70/1 mögliche Lösung: Produktionskosten sind alle Kosten, die entstehen, wenn ein Produkt hergestellt oder eine Dienstleistung erbracht wird. Dazu gehören zum Beispiel die Kosten für Rohstoffe, Maschinen, Löhne, Energie, Transport und Miete für die Produktionshalle.
Je mehr ein Unternehmen für die Herstellung eines Produkts ausgeben muss, desto höher sind die Produktionskosten. Wenn diese Kosten steigen – zum Beispiel weil Rohstoffe teurer werden oder höhere Löhne gezahlt werden müssen –, versucht das Unternehmen oft, die höheren Ausgaben über den Verkaufspreis auszugleichen. Das bedeutet: Der Preis für das Produkt steigt, damit das Unternehmen trotzdem Gewinn macht.
Umgekehrt kann ein Unternehmen die Preise auch senken, wenn es günstiger produzieren kann –etwa durch moderne Maschinen, günstigere Materialien oder effizientere Arbeitsabläufe. Kurz gesagt: Die Produktionskosten haben direkten Einfluss auf den Preis, weil sie bestimmen, wie viel das Produkt das Unternehmen kostet – und wie viel es am Ende kosten muss, damit sich die Produktion lohnt.
K. 4/S. 70/2 individuelle Lösung
K. 4/S. 70/3 individuelle Lösung
Olympe Verlag
K. 5/S. 73/1 Private Haushalte spielen eine zentrale Rolle in der Wirtschaft, denn ohne sie würde das gesamte Wirtschaftssystem nicht funktionieren. Zum einen sind sie Konsumentinnen und Konsumenten. Das bedeutet, sie kaufen Produkte ein, nutzen Dienstleistungen und geben ihr Geld für Dinge wie Lebensmittel, Kleidung, Wohnen, Freizeit oder Technik aus. Dadurch entsteht Nachfrage – und ohne Nachfrage würden Unternehmen nichts verkaufen und keine Gewinne machen.
Zum anderen sind private Haushalte auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Menschen, die in einem Haushalt leben, gehen arbeiten und stellen Unternehmen ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Sie tragen also direkt zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen bei.
Außerdem zahlen private Haushalte Steuern und Abgaben, mit denen der Staat Schulen, Krankenhäuser, Straßen und andere öffentliche Leistungen finanziert. Sie sparen auch Geld, legen es auf die Bank oder investieren es – und das ist wichtig für den Kapitalmarkt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Private Haushalte sind für die Wirtschaft wichtig, weil sie kaufen, arbeiten, sparen und Steuern zahlen. Ohne ihre Beteiligung gäbe es keinen funktionierenden Wirtschaftskreislauf.
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 5/S. 73/2 individuelle Lösung
K. 5/S. 73/3 individuelle Lösung
K. 5/S. 73/4 individuelle Lösung
K. 5/S. 73/5 mögliche Lösung: Es ist wichtig, sich über die Arbeit des ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) zu informieren, weil der ÖGB eine zentrale Rolle im Arbeitsleben und in der österreichischen Sozialpartnerschaft spielt. Er vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –also der Menschen, die in einem Beruf arbeiten – gegenüber Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, Unternehmen und der Politik. Wer weiß, wofür der ÖGB eintritt, versteht besser, wie Arbeitsbedingungen entstehen, wie Löhne und Arbeitszeiten verhandelt werden und warum gerechte Regeln am Arbeitsplatz notwendig sind. Der ÖGB setzt sich zum Beispiel für faire Bezahlung, sichere Arbeitsplätze, Mitbestimmung und soziale Absicherung ein.
Wenn man eigene Fragen stellt und Antworten darauf bekommt – etwa: „Wie schützt der ÖGB junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?“ oder „Was hat die Gewerkschaft mit dem Kollektivvertrag zu tun?“ – erkennt man, wie konkret die Gewerkschaften das Leben vieler Menschen verbessern. Gleichzeitig wird dadurch klarer, was Sozialpartnerschaft bedeutet: Sie ist das Zusammenarbeiten von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen mit dem Ziel, Lösungen im Interesse beider Seiten zu finden – friedlich, fair und gemeinsam. Die Arbeit des ÖGB zeigt, dass es möglich ist, durch Dialog und Verhandlungen wichtige soziale Fortschritte zu erreichen. Insgesamt fördert das Wissen über den ÖGB das Verständnis dafür, wie soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung und ein stabiler Arbeitsmarkt in Österreich funktionieren – und warum es wichtig ist, sich dafür zu interessieren und vielleicht sogar selbst aktiv zu werden.
K. 5/S. 74/6 individuelle Lösung
K. 5/S. 74/7 individuelle Lösung
K. 5/S. 74/8 mögliche Lösung: Eine enge Zusammenarbeit und das Gespräch zwischen verschiedenen Interessengruppen sind deshalb so wichtig, weil in einer Gesellschaft viele unterschiedliche Meinungen, Bedürfnisse und Ziele aufeinandertreffen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Umweltorganisationen, Politik, Konsumentinnen und Konsumenten – sie alle verfolgen eigene Interessen, die sich manchmal widersprechen. Wenn jede Gruppe nur auf ihren eigenen Vorteil schaut und nicht mit den anderen spricht, entstehen schnell Konflikte, die schwer zu lösen sind. Das kann zu Streit, Stillstand oder sogar Unzufriedenheit in der ganzen Gesellschaft führen. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass sich die Beteiligten an einen Tisch setzen, einander zuhören und versuchen, die Sichtweise der anderen zu verstehen.
Nur wenn alle Seiten ihre Argumente offen darlegen dürfen, entsteht ein fairer Dialog. Durch diesen Austausch kann man gemeinsame Lösungen finden, mit denen möglichst viele leben können. Dabei muss aber oft jede Seite ein Stück nachgeben – man spricht dann von einem Kompromiss. Ein Kompromiss bedeutet nicht, dass alle alles bekommen, was sie wollen, aber er schafft Ausgleich und Frieden. In einer Demokratie ist das besonders wichtig: Zusammenarbeit und Kompromisse sorgen dafür, dass niemand übergangen wird und dass Entscheidungen gerecht, tragfähig und gemeinsam getragen werden. So funktioniert auch die Sozialpartnerschaft in Österreich – durch das Miteinander statt Gegeneinander.
K. 5/S. 74/9 individuelle Lösung
Olympe Verlag
K. 6/S. 77/1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft * Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (z. B. Freiberuflerinnen und Freiberufler wie Ärztinnen und Ärzte, Künstlerinnen und Künstler) * Einkünfte aus Gewerbebetrieb (z. B. Unternehmerinnen und Unternehmer, Handwerksbetriebe) * Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (z. B. Löhne und Gehälter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern) * Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen, Dividenden, Aktiengewinne) * Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (z. B. Mieteinnahmen) * Sonstige Einkünfte (z. B. private Grundstücksverkäufe, bestimmte Pensionen)
K. 6/S. 77/2 Lösungswort: ABGABE
K. 6/S. 78/3 Infrastruktur: ÖBB, Autobahn, Bundesstraßen, Gericht * Sicherheit: Polizei Bundesheer, Cobra * Ausbildung: Volksschule, AHS * Wissenschaft und Kultur: Staatsoper, Burgtheater, Forschungsförderung * Familie und Gesundheit: Arbeitslosenunterstützung, AKH, Gratiskindergarten, Zuschüsse zur Pension, Familienbeihilfe, Schulstartgeld * Wirtschaftsgeschehen: Bauaufträge, Zölle, Straßenbau, Förderung der Landwirtschaft, Subventionen
K. 6/S. 78/4 individuelle Lösung
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 7/S. 81/1 individuelle Lösung
K. 7/S. 81/2 Einnahmen des Staates: Lohnsteuer * Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer * Einkommensteuer * Körperschaftsteuer * Mineralölsteuer * Tabaksteuer * Alkoholsteuer * KfzSteuer * Gebühren und Abgaben
Ausgaben des Staates: Schulen und Bildungseinrichtungen * Krankenhäuser und Gesundheitssystem * Straßenbau und Erhalt von Infrastruktur * Polizei und Feuerwehr * Sozialleistungen * Pensionen für ältere Menschen * Arbeitslosengeld und AMS-Leistungen * Förderungen für Unternehmen und Landwirtschaft * Kultur und Sportförderung * Umweltschutz und Klimaschutzprogramme
K. 7/S. 81/3 Beiträge einer Familie zu den Staatseinnahmen: Lohnsteuer vom Gehalt der Eltern * Mehrwertsteuer bei jedem Einkauf * Mineralölsteuer beim Tanken * Kfz-Steuer für das angemeldete Auto * Haushaltsabgabe für Fernsehen und Radio * Beiträge zur Sozialversicherung * Gebühren für Müllabfuhr, Kanal, Wasser * Gebühren für Reisepass oder Personalausweis
K. 7/S. 81/4 individuelle Lösung
K. 8/S. 84/1 individuelle Lösung
K. 8/S. 84/2 individuelle Lösung
Verlag
K. 8/S. 84/3 mögliche Lösung: Der Zugang zu Geld und qualifizierten Arbeitskräften ist für Unternehmen besonders wichtig, weil sie beides brauchen, um erfolgreich arbeiten zu können. Ohne genügend Geld – also ohne Kapital – können Unternehmen keine Maschinen kaufen, keine Rohstoffe besorgen, keine Produkte entwickeln und keine Löhne zahlen. Geld ist nötig, um Investitionen zu tätigen, neue Ideen umzusetzen oder moderne Technologien einzuführen. Fehlt das Kapital, können Unternehmen nicht wachsen oder sich weiterentwickeln. Genauso wichtig sind qualifizierte Arbeitskräfte. Menschen mit Wissen, Erfahrung und Ausbildung bringen neue Ideen ein, lösen Probleme, sorgen für gute Qualität und machen den Betrieb effizient. Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen entscheidend dazu bei, dass ein Unternehmen im Wettbewerb bestehen kann – nicht nur in Österreich, sondern auch international. Wenn ein Unternehmen zu wenig Geld oder zu wenig qualifiziertes Personal hat, gerät es schnell in Schwierigkeiten. Es kann zum Beispiel schlechtere Produkte herstellen, langsamer liefern oder weniger Kundinnen und Kunden bedienen. Deshalb ist es entscheidend, dass Unternehmen sowohl Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten als auch zu gut ausgebildeten Fachkräften haben – nur so können sie erfolgreich, nachhaltig und konkurrenzfähig bleiben.
K. 8/S. 84/4 mögliche Lösung: Stell dir vor, ich leite ein Unternehmen und möchte es erfolgreich weiterentwickeln. Damit mein Betrieb wachsen kann, brauche ich zwei wichtige Dinge: Geld (Kapital) und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier ist mein Plan, wie ich beides gewinnen und sinnvoll einsetzen würde:
Zuerst überlege ich, wie ich finanzielle Mittel bekommen kann. Ich würde einen klaren Geschäftsplan erstellen, der zeigt, wofür ich das Geld brauche – zum Beispiel für neue Maschinen, den Ausbau meiner Produktlinie oder den Aufbau eines Online-Shops. Mit diesem Plan könnte ich zur Bank gehen und um einen Kredit bitten oder Förderungen vom Staat beantragen. Ich würde mich auch über Investoren informieren, die Interesse daran haben könnten, in mein Unternehmen zu investieren, wenn sie eine gute Zukunft darin sehen.
Parallel dazu plane ich, wie ich qualifizierte Arbeitskräfte finde. Ich würde gezielt Menschen suchen, die gut ausgebildet sind und zu meinem Unternehmen passen – etwa über Jobplattformen, soziale Medien oder durch Kontakte mit Fachschulen und Lehrbetrieben. Besonders wichtig wäre es mir, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bleiben. Ich würde Aus- und Weiterbildungen anbieten, faire Löhne zahlen und auf flexible Arbeitszeiten achten, damit sich Arbeit und Privatleben gut vereinbaren lassen. Um das Wachstum meines Unternehmens zu sichern, würde ich laufend prüfen, wie erfolgreich meine Produkte sind, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt und wie zufrieden Kundinnen und Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Ich würde auch darauf achten, nachhaltig zu wirtschaften – also sparsam mit Ressourcen umzugehen und fair mit allen Beteiligten umzugehen. Mit diesem Plan – kluge Finanzierung, starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, laufende Verbesserung und Nachhaltigkeit – möchte ich sicherstellen, dass mein Unternehmen gesund wächst, wettbewerbsfähig bleibt und auch in Zukunft Erfolg hat.
K. 9/S. 87/1 Die Grafik zeigt die Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen im Jahresdurchschnitt 2022 in Österreich – getrennt nach Frauen (rot) und Männern (blau). Zusätzlich sind die durchschnittlichen Quoten für Frauen und Männer insgesamt als waagrechte Linien eingezeichnet.
Wichtige Beobachtungen:
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 9/S. 87/1
1. Höchste Arbeitslosenquote bei Männern 60 bis 64 Jahre: Die auffälligste Säule betrifft Männer im Alter von 60 bis 64 Jahren – hier liegt die Arbeitslosenquote bei über 13 %, deutlich über dem Durchschnitt.
2. Frauen am stärksten betroffen im Alter von 55 bis 59 Jahren: In dieser Altersgruppe beträgt die Arbeitslosenquote bei Frauen fast 8 % – das ist der höchste Wert für Frauen über alle Altersgruppen hinweg.
3. Niedrige Arbeitslosigkeit bei sehr jungen und sehr alten Menschen: Bei Jugendlichen unter 19 Jahren und bei Menschen über 65 Jahren sind die Quoten sehr niedrig – vermutlich, weil viele in diesen Altersgruppen noch in Ausbildung oder bereits in Pension sind.
4. Relativ stabile Quoten im mittleren Erwerbsalter (25–54 Jahre): In diesen Altersgruppen schwanken die Quoten zwischen ca. 5 % und 6,5 % – relativ konstant.
5. Gesamtwerte: Die rote Linie zeigt die durchschnittliche Arbeitslosenquote aller Frauen (etwas über 6 %), die blaue Linie den Durchschnitt für Männer (etwas höher als bei den Frauen).
Deutung: Die Grafik zeigt, dass das Risiko arbeitslos zu werden nicht gleichmäßig über alle Altersgruppen verteilt ist. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere Männer zwischen 60 und 64 Jahren, sind besonders gefährdet. Auch Frauen ab 55 Jahren sind deutlich über dem Durchschnitt betroffen – möglicherweise wegen altersbedingter Kündigungen oder gesundheitlicher Gründe.
Im mittleren Alter sind die Quoten relativ stabil, da viele Menschen in diesem Lebensabschnitt beruflich gefestigt sind. Junge Erwachsene (20–24 Jahre) haben eine etwas höhere Arbeitslosenquote – möglicherweise, weil viele nach Schule oder Ausbildung noch keine feste Anstellung haben.
Zusammenfassung: Die Grafik macht deutlich, dass die Arbeitslosigkeit stark vom Alter abhängig ist. Besonders für ältere Menschen gibt es Herausforderungen am Arbeitsmarkt, weshalb gezielte Maßnahmen – etwa Weiterbildung oder Altersdiskriminierungsschutz – wichtig sind. Auch der Übergang von der Ausbildung in den Beruf bleibt ein kritischer Punkt.
K. 9/S. 87/2 individuelle Lösung
Verlag
K. 10/S. 89/1 Vorteile: Zugang zu neuen Märkten: Unternehmen können ihre Produkte auch im Ausland verkaufen und mehr Kundinnen und Kunden erreichen. * Warenvielfalt für Konsumentinnen und Konsumenten: Menschen können aus vielen Produkten aus aller Welt wählen (z. B. Bananen im Winter, Mode aus Italien). * Arbeitsplätze durch Exporte: Wenn österreichische Firmen erfolgreich exportieren, schaffen sie oft mehr Jobs im Inland. * Import von Rohstoffen und Technik: Österreich kann wichtige Dinge importieren, die es selbst nicht hat – etwa Erdöl oder Elektronik. * Stärkere wirtschaftliche Beziehungen: Außenwirtschaft fördert den internationalen Austausch und kann Frieden und Zusammenarbeit stärken.
Nachteile: Abhängigkeit vom Ausland: Wenn wichtige Waren nicht mehr geliefert werden (z. B. wegen Krieg oder Krise), kann es zu Engpässen kommen. * Konkurrenz für heimische Betriebe: Günstige Importe können lokale Unternehmen unter Druck setzen oder sogar verdrängen. * Verlagerung von Arbeitsplätzen: Manche Firmen verlegen ihre Produktion ins Ausland, um Kosten zu sparen – das kann Arbeitsplätze im Inland kosten. * Umweltbelastung durch Transport: Der weltweite Handel führt zu langen Transportwegen, mehr CO2-Ausstoß und Umweltproblemen.
* Unfaire Bedingungen in Billiglohnländern: Produkte aus dem Ausland stammen manchmal aus Betrieben mit schlechten Arbeitsbedingungen oder Kinderarbeit.
K. 10/S. 89/2 Reihung der Exportziele Österreichs (2023):
1. EU – 68,4 %
2. USA + Kanada + Mexiko – 9,2 %
3. Asien – 8,1 %
4. Restliches Europa (außer EU & EFTA) – 5,9 %
5. EFTA-Staaten (z. B. Schweiz, Norwegen) – 5,5 %
6. Afrika – 1,1 %
7. Restliches Amerika (z. B. Südamerika) – 1,0 %
8. Australien und Ozeanien – 0,7 %
K. 10/S. 89/3 mögliche Lösung: Der Handel mit anderen Ländern ist für Österreich – wie für viele andere Staaten – besonders wichtig, weil Österreich ein vergleichsweise kleines Land ist und nicht alle Güter und Rohstoffe selbst herstellen oder fördern kann. Durch den internationalen Handel können wir Produkte importieren, die wir selbst nicht (oder nicht ausreichend) haben, und Waren exportieren, die bei uns in hoher Qualität erzeugt werden.
Der Import ist wichtig, weil er den Menschen in Österreich Zugang zu einer größeren Warenvielfalt ermöglicht – zum Beispiel Bananen, Kaffee, Textilien, Erdöl oder technische Geräte, die hier nicht produziert werden. Außerdem kann Österreich durch den Import Rohstoffe und Vorprodukte beziehen, die dann in der heimischen Industrie weiterverarbeitet werden. Ohne Importe könnten viele Unternehmen nicht wettbewerbsfähig produzieren.
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 45 - 90
K. 10/S. 89/3 Der Export wiederum ist für viele österreichische Unternehmen eine zentrale Einnahmequelle. Produkte wie Maschinen, Medikamente, Lebensmittel oder Fahrzeuge werden in viele Länder verkauft. Dadurch entstehen in Österreich Arbeitsplätze, es fließt Geld ins Land und die Unternehmen können wachsen. Je erfolgreicher der Export, desto besser ist meist auch die Lage am Arbeitsmarkt.
Österreich ist sehr stark in den Welthandel eingebunden. Die Grafik zeigt, dass besonders der Handel mit der Europäischen Union entscheidend ist – über zwei Drittel der Exporte gehen in EU-Länder. Das zeigt: Eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern ist für Österreich lebenswichtig, weil sie den Wohlstand sichert, die Wirtschaft ankurbelt und internationale Beziehungen stärkt.
Zusammengefasst ist der Außenhandel wichtig, weil er Versorgungssicherheit, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze schafft – und weil er es ermöglicht, dass sich Länder gegenseitig ergänzen, anstatt alles allein produzieren zu müssen.
Lösungen LehrerInnenheft S. 30 - 44
AB 1
Verlag
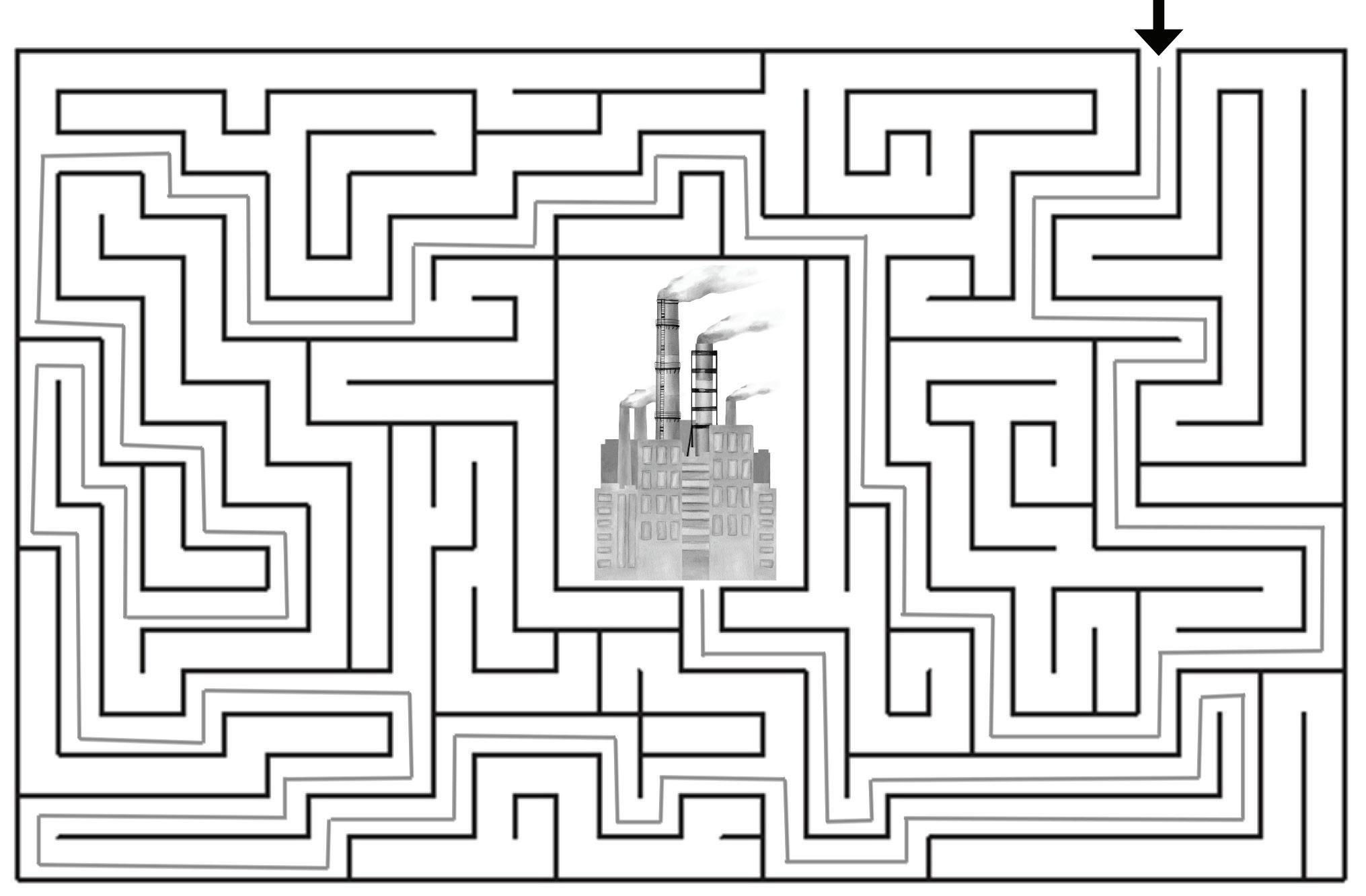
AB 2 2. von oben nach unten: Industrieregion * Landwirtschaftsregion * Dienstleistungsregion * Tourismusregion* Landwirtschaftsregion
3. Lösungswort: TOURISMUS
AB 3 a) westlich * b) Tirol * c) Kärnten * d) Ötztaler Alpen * e) nördlich * f) Tirol * g) Tirol * h) Steiermark * i) Vorarlberg * j) Oberösterreich * k) westlich * l) nördlich * m) nördlich * n) südlich
AB 4 Lösungswort: TOURISMUS
AB 5 Leopoldsberg: Wien * Feldkirch: Vorarlberg * Grundlsee: Steiermark * Inn: Tirol * Wulka: Burgenland * Ill: Vorarlberg * Mittersill: Salzburg * Ötscher: Niederösterreich * Saualpe: Kärnten * Kufstein: Tirol * Waidhofen an der Ybbs: Niederösterreich * Lunzer See: Niederösterreich * Kapfenberg: Steiermark * Möll: Kärnten * Rechnitz: Burgenland * Wiener Neustadt: Niederösterreich * Zillertaler Alpen: Tirol * Hermannskogel: Wien * Pörtschach: Kärnten
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft S. 30 - 44
AB 6
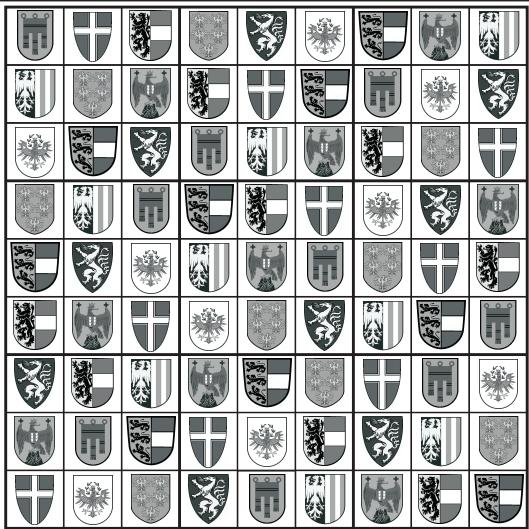
AB 8
Olympe Verlag
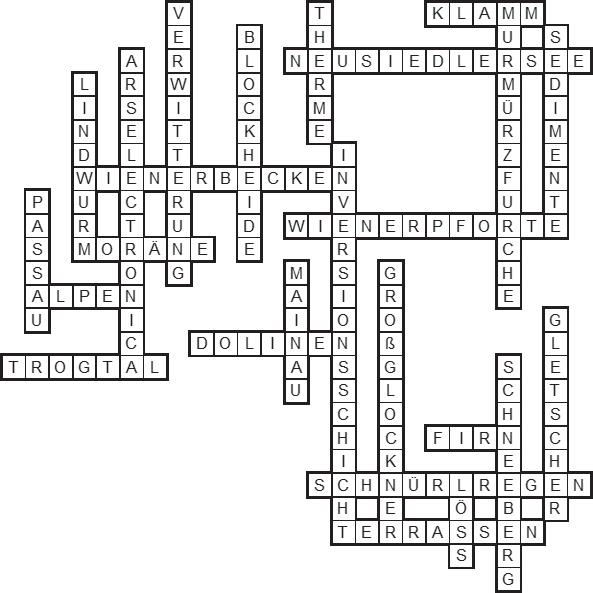
AB 9 von links nach rechts: 5/4/6/1 * 2/7/8/3
AB 14 von oben nach unten: Umwelt * Unternehmen * Konsumentinnen und Konsumenten * Staat * Nachhaltigkeit
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
NAME:
Zentren und Peripherien
DATUM:
Zentren und Peripherien
Lies die Informationen in den Kästchen zuerst aufmerksam durch! In welchem Kästchen findest du die passende Aussage?
Die Anziehungskra städtischer Zentren Zentren wie größere Städte bieten viele Vorteile: Sie verfügen über ein dichtes Netz an Arbeitsplätzen, eine gute medizinische Versorgung, zahlreiche Schulen und Bildungseinrichtungen sowie ein breites Freizeitangebot. Diese Vielfalt macht das Leben dort attraktiv und führt dazu, dass viele Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Dadurch wachsen die Städte weiter und verstärken ihre Rolle als wirtscha liche und gesellscha liche Zentren.

Standortwahl von Unternehmen: Was wirklich zählt Unternehmen wählen ihren Standort sehr überlegt. Besonders wichtig sind dabei harte Standortfaktoren wie eine gute Verkehrsanbindung, verfügbare Fachkrä e, verlässliche Energieversorgung und ein funktionierendes Kommunikationsnetz. Diese Bedingungen nden sie meist in Ballungszentren oder städtischen Regionen, wo sie zudem leichter mit anderen Firmen kooperieren können.



Verlag
Periphere Räume – Leben mit schlechter Infrastruktur


Periphere Regionen, also abgelegene oder ländliche Gegenden, sind häu g schlechter an den ö entlichen Verkehr angebunden. Es gibt nur wenige oder unregelmäßige Bus- und Bahnverbindungen, was für die Bewohnerinnen und Bewohner den Alltag erschwert – zum Beispiel beim Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zur Schule. Diese schlechte Erreichbarkeit kann auch Unternehmen davon abhalten, sich dort anzusiedeln.

Regionale Unterschiede in Wirtscha und Lebensqualität Zentren und periphere Räume unterscheiden sich stark in ihrer wirtscha lichen Entwicklung. Während Zentren viele Funktionen übernehmen – wie Verwaltung, Bildung, Handel und Industrie – sind periphere Räume o strukturschwach. Das bedeutet: Weniger Arbeitsplätze, schlechtere Infrastruktur und geringere Investitionen. Diese Unterschiede beein ussen auch die Lebensqualität der Menschen in den jeweiligen Regionen
Trage nun hier den Buchstaben richtig ein!

Wirtscha liche Folgen der Land ucht In vielen peripheren Regionen gibt es zu wenig attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze. Besonders junge Menschen sehen dort o keine Zukun sperspektiven und ziehen daher in größere Städte. Dieser Prozess wird als Abwanderung bezeichnet. Er führt dazu, dass die ländliche Bevölkerung älter wird und die Region wirtscha lich weiter geschwächt wird.
Wesentlich für Unternehmen sind vor allem harte Standortfaktoren.
Viele Menschen ziehen wegen besserer Infrastruktur in bestimmte Regionen.
Es gibt große Unterschiede der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Zentren und Peripherien.
In ländlichen Gebieten gibt es häufig zu wenig Ausbildungsplätze und zu wenig Arbeitsplätze.
Der öffentliche Verkehr ist in ländlichen Regionen oft schlechter ausgebaut als in Zentren.
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Zentren und Peripherien
NAME: DATUM:
Bodenversiegelung –Warum wir auf unseren Boden achten müssen
1 In Österreich wird jeden Tag eine große Fläche Boden verbaut. Das bedeutet: Auf den Boden wird Asphalt, Beton oder Pflaster gelegt – zum Beispiel für neue
5 Straßen, Häuser, Parkplätze oder Einkaufszentren. Man nennt das Bodenversiegelung, weil der Boden versiegelt, also verschlossen wird.
10 Ein versiegelter Boden kann kein Regenwasser mehr aufnehmen. Stattdessen fließt das Wasser schnell über die Oberfläche in Bäche und Flüsse. Das ist gefährlich, denn bei
15 starkem Regen kann es dann schneller zu Überschwemmungen kommen. Auch das Grundwasser wird durch Bodenversiegelung weniger aufgefüllt, und das ist schlecht für die
20 Trinkwasserversorgung.
30 In Österreich wird im Vergleich zu anderen Ländern in Europa sehr viel Boden versiegelt – oft mehr als notwendig. Besonders im Flachland und rund um Städte entstehen
35 immer neue Gebäude und Straßen. Das nennt man Zersiedelung, wenn Siedlungen immer weiter in die Landschaft wachsen.
40 Doch wir brauchen den Boden auch für viele andere Dinge: für Landwirtschaft, damit wir Lebensmittel anbauen können, für Naturschutz, damit Tiere und Pflanzen leben können, und für Erholung, damit wir in der
45 Natur spazieren, spielen oder Sport machen können.
Verlag
Deshalb sagen viele Expertinnen und Experten: Wir müssen sparsam mit Boden umgehen. Man kann zum Beispiel alte Gebäude
Außerdem können auf versiegeltem Boden keine Pflanzen mehr wachsen, und Tiere verlieren ihren Lebensraum. In Städten sorgt versiegelter Boden oft 50 umbauen, statt neue zu bauen. Auch grüne Dächer, begrünte Innenhöfe oder mehr öffentliche Verkehrsmittel helfen, damit nicht so viel neuer Boden versiegelt werden muss.
25 dafür, dass es im Sommer viel heißer wird, weil Asphalt und Beton die Wärme speichern. Grüne Flächen wie Wiesen, Bäume oder Gärten kühlen dagegen die Luft.
60
Finde nun, so schnell du kannst, die folgenden Informationen!
In welchen Zeilen steht, dass …
… ein versiegelter Boden kein Regenwasser mehr aufnehmen kann?
… Expertinnen und Experten davor warnen, so viel Boden zu verbrauchen?
… wir Boden benötigen, um Lebensmittel anzubauen?
… auch grüne Dächer oder begrünte Innenhöfe dazu beitragen, dass weniger Boden versiegelt wird?
.. Böden durch das Aufbringen von Beton, Asphalt oder Pflaster versiegelt werden?
…, dass die starke Bodenversiegelung auch zu Überschwemmungen führen kann?
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Lernstandserhebung Zentren und Peripherien NAME: DATUM:
1. Nenne 4 Zentralräume in Österreich! 4/ 1. 2. 3. 4.
2. Welches sind die Kennzeichen des Lebens in der Peripherie? Ringle das Richtige ein! 6/ dünn besiedelt viele Menschen auf engem Raum gute Infrastruktur wenig bis gar keine Infrastruktur hohe Wohnqualität genügend Arbeitsplätze Leben und Wirtschaften ist beschwerlich Problem der Abwanderung wenige Arbeitsplätze viele Industrie- und Dienstleistungsbetriebe
3. Warum ziehen immer mehr Menschen in Ballungsräume? Schreibe einen kurzen Text, in dem du die Vor- und Nachteile von urbanem Leben beschreibst! 4/
Verlag
4. Erkläre die folgenden Begriffe! 4/ Zersiedelung: Pendeln: Ballungsraum:
Strukturschwäche:
17-18 = Du bist Geografie- und Wirtschaftsmeisterin/-meister
14-16 = Du hast dir viel gemerkt
11-13 = Du weißt schon einiges
9-10 = Du solltest noch viel üben
< 9 = Du solltest dir diesen Abschnitt im Buch noch einmal durchlesen
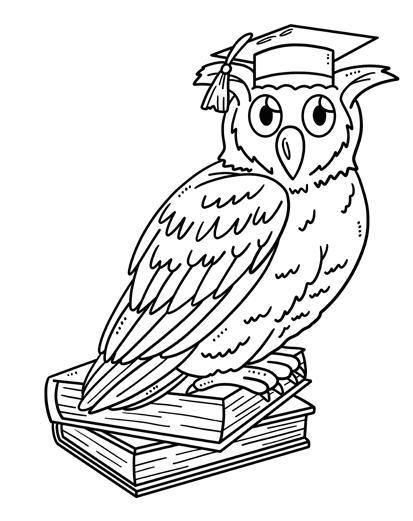
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 91 - 102
K. 1/S. 94/1
Ballungsraum: Hohe Bevölkerungsdichte – Viele Menschen leben auf engem Raum. * Gute Verkehrsanbindung – Autobahnen, Bahnhöfe, öffentlicher Verkehr sind meist gut ausgebaut. * Vielfältige Arbeitsplätze – Besonders viele Jobs in Industrie, Dienstleistungen und Verwaltung. * Breites Bildungsangebot – Universitäten, Fachhochschulen, viele Schulen. * Umfangreiche Freizeitmöglichkeiten – Kinos, Sportstätten, Einkaufszentren, kulturelle Angebote. * Starke wirtschaftliche Leistung – Hier wird viel produziert und konsumiert.
Peripherie: Geringe Bevölkerungsdichte – Weniger Menschen leben auf größerer Fläche. * Schwache Infrastruktur – Wenige Bus- und Bahnverbindungen, oft langsames Internet. * Weniger Arbeitsplätze – Vor allem in Landwirtschaft, Tourismus oder kleinen Betrieben. * Abwanderung junger Menschen – Viele ziehen für Ausbildung oder Job in Städte. * Mehr Natur und Ruhe – Viel Grünraum, weniger Verkehr, oft schöne Landschaft. * Weniger Bildungs- und Freizeiteinrichtungen – Selten höhere Schulen oder große Sportanlagen.
K. 1/S. 94/2 individuelle Lösung
K. 1/S. 94/3 mögliche Lösung: Zentrum: Wien
Begründung anhand der Karte zur Bevölkerungsdichte:
• Wien weist mit über 4.500 Einwohnerinnen und Einwohnern pro km² die höchste Bevölkerungsdichte in ganz Österreich auf.
• Auf der Karte ist Wien deutlich dunkel eingefärbt – das zeigt: Hier leben besonders viele Menschen auf engem Raum.
• Die Stadt ist vollständig urban geprägt – es gibt kaum landwirtschaftlich genutzte Flächen oder große Grünräume außerhalb der Parkanlagen.
Weitere Merkmale von Wien als Zentrum:
• Verkehrsknotenpunkt: Wien ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden (Autobahnen, Schnellbahnen, Straßenbahn, Flughafen).
• Wirtschaftliches Zentrum: Viele Unternehmen, Institutionen, internationale Organisationen und Konzerne haben hier ihren Sitz.
• Verwaltung und Politik: Als Hauptstadt Österreichs ist Wien Sitz der Bundesregierung, Ministerien und zahlreicher Behörden.
• Bildung und Forschung: In Wien gibt es zahlreiche Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsinstitute.
• Vielfältige Arbeitsplätze: Besonders viele Jobs im Bereich Dienstleistungen, Verwaltung, Medien, Gesundheit und Bildung.
• Kulturelle Angebote: Theater, Museen, Kinos, Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten prägen das Stadtleben.
K. 1/S. 94/4 mögliche Lösung: Periphere Region: Bezirk Zwettl (Waldviertel)
Begründung anhand der Karte zur Bevölkerungsdichte:
• Der Bezirk Zwettl ist auf der Karte zur Bevölkerungsdichte hell eingefärbt – das bedeutet:
• Weniger als 50 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer, also eine sehr dünne Besiedelung.
• Die Siedlungsstruktur ist zersplittert, mit vielen kleinen Orten und Dörfern.
• Es gibt keine größeren Städte in der Umgebung.
Typische Eigenschaften peripherer Räume wie Zwettl:
• Schwache Verkehrsanbindung: Es gibt keine Autobahnen oder Schnellbahnverbindungen, oft nur Busse oder kleinere Landesstraßen.
• Weniger Arbeitsplätze: Vor allem in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und kleinen Betrieben.
• Abwanderung: Viele junge Menschen ziehen weg – besonders wegen Ausbildung, Arbeit oder Freizeitmöglichkeiten.
• Wenig Infrastruktur: Schulen, ärztliche Versorgung oder Kulturangebote sind seltener oder weiter entfernt.
• Naturraum: Die Region ist landschaftlich reizvoll mit viel Wald, aber wirtschaftlich eher strukturschwach.
Olympe Verlag
• Bevölkerungsrückgang: Die Einwohnerzahlen sinken in vielen Gemeinden – das zeigt sich auch auf Karten zur Bevölkerungsentwicklung.
K. 1/S. 94/5 Große Stadt: Infrastruktur und Arbeitsplätze
In einer großen Stadt ist die Infrastruktur meist sehr gut ausgebaut. Es gibt viele Straßen, U-Bahnen, Busse und Bahnhöfe, die den Menschen helfen, schnell und bequem von einem Ort zum anderen zu kommen. Auch das Internet ist meistens schnell und zuverlässig. Die Arbeitsplatzmöglichkeiten in der Stadt sind sehr vielfältig. Es gibt viele Jobs in Büros, Krankenhäusern, Geschäften, Schulen, Universitäten, bei Behörden oder großen Firmen. Auch Berufe in der Forschung, Technik, IT oder Medien sind dort häufiger zu finden.
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 91 - 102
K. 1/S. 94/5 Ländliche Region: Infrastruktur und Arbeitsplätze
In einer ländlichen Region ist die Infrastruktur oft schwächer. Es gibt weniger Busverbindungen oder Bahnanschlüsse, viele Menschen sind auf das Auto angewiesen. In manchen Gegenden ist auch das Internet langsamer oder nicht überall verfügbar. Die Arbeitsplätze in ländlichen Regionen sind oft auf Landwirtschaft, Tourismus, Handwerk oder kleine Betriebe beschränkt. Es gibt weniger Firmen und oft auch weniger Auswahl bei Berufen. Viele junge Menschen ziehen deshalb in Städte, um dort bessere Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten zu finden.
K. 1/S. 95/6 individuelle Lösung
K. 1/S. 95/7 individuelle Lösung
K. 2/S. 98/1 individuelle Lösung
K. 2/S. 98/2 individuelle Lösung
K. 2/S. 98/3 mögliche Lösung:
Was ist ein Flächenwidmungsplan – und wie wird er geändert?
Ein Flächenwidmungsplan zeigt, wie das Land in einer Gemeinde genutzt werden darf. Zum Beispiel:
• Bauland (für Häuser, Betriebe, Wohnungen),
• Grünland (für Landwirtschaft oder Natur),
• Verkehrsflächen (für Straßen, Parkplätze, Bahnen).
Wenn jemand ein großes Haus, ein neues Geschäft oder eine Straße bauen möchte, muss geprüft werden, ob das auf der geplanten Fläche überhaupt erlaubt ist.
Manchmal muss dafür der Flächenwidmungsplan geändert werden.
Wie läuft eine Änderung ab?
1. Antrag stellen: Eine Privatperson, ein Unternehmen oder die Gemeinde selbst möchte die Nutzung eines Grundstücks ändern.
2. Prüfung: Die Gemeinde prüft den Antrag – zusammen mit Fachleuten (z. B. Raumplanerinnen und Raumplaner, Juristinnen und Juristen, Umwelt-Expertinnen und -Experten).
Verlag
3. Entwurf: Ein Entwurf der Änderung wird erstellt und der Gemeinderat befasst sich damit.
4. Öffentliche Auflage: Der Entwurf wird mehrere Wochen öffentlich aufgelegt – meist im Gemeindeamt oder online.
5. Bürgerbeteiligung: Alle Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Meinung sagen und schriftlich Einwendungen abgeben.
6. Beratung & Beschluss: Der Gemeinderat diskutiert alle Rückmeldungen und beschließt die Änderung.
7. Genehmigung: Der Plan wird von der Landesregierung überprüft und genehmigt.
8. Veröffentlichung: Die Änderung wird öffentlich bekannt gemacht und tritt danach in Kraft.
Warum ist die Öffentlichkeit wichtig?
Es geht oft um wichtige Entscheidungen für viele Menschen – etwa wenn neue Häuser gebaut werden sollen oder ein Stück Wald für einen Betrieb weichen soll. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert sind und ihre Meinung sagen dürfen. So können Konflikte früh erkannt und vielleicht sogar verhindert werden.
Welche Auswirkungen hat das auf eine Gemeinde?
• Neue Wohngebiete können mehr Menschen in die Gemeinde bringen – das schafft Leben, aber auch mehr Verkehr und höhere Nachfrage nach Schulen, Ärzten oder Wasserleitungen.
• Wenn Betriebsbauflächen entstehen, bringt das neue Arbeitsplätze und Steuereinnahmen –aber es kann auch zu mehr Lärm oder Umweltbelastung führen.
• Wird Grünland bebaut, verringert sich die Naturfläche, was sich auf Tiere, Erholung und das Klima auswirken kann.
Zusammenfassung: Eine Änderung des Flächenwidmungsplans ist ein wichtiger und komplexer Vorgang. Damit alle Interessen beachtet werden, ist die Meinung der Bevölkerung ein wertvoller Teil des Verfahrens. Es geht dabei um Zukunftsentscheidungen für alle, die in der Gemeinde leben.
K. 2/S. 98/4 individuelle Lösung
K. 2/S. 98/5 individuelle Lösung
Bonus/S. 101/1 mögliche Lösung: Bodenversiegelung bedeutet, dass natürliche Flächen – wie Wiesen, Felder oder Wälder – mit Beton, Asphalt oder Gebäuden bedeckt werden. Das passiert zum Beispiel, wenn neue Straßen gebaut, Einkaufszentren errichtet oder große Parkplätze angelegt werden.
LÖSUNGEN
Lösungen Buch S. 91 - 102
Bonus/S. 101/1
Bonus/S.
101/2
Das ist ein Problem, weil der Boden dann kein Wasser mehr aufnehmen kann. Regen kann nicht versickern und fließt schnell ab – das kann zu Überschwemmungen führen. Auch Grundwasser wird dadurch weniger gebildet. Versiegelte Flächen heizen sich stark auf, was die Temperatur in Städten steigen lässt und das Klima belastet.
Außerdem verlieren Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum, wenn immer mehr Flächen verbaut werden. Die Natur wird zurückgedrängt und die Biodiversität nimmt ab.
Bodenversiegelung ist also schlecht für das Klima, die Umwelt und die Lebensqualität der Menschen. Deshalb ist es wichtig, sparsam mit dem Boden umzugehen und Flächen möglichst naturnah zu gestalten – zum Beispiel mit Parks, begrünten Dächern oder entsiegelten Bereichen.
mögliche Lösung: Bodenversiegelung hat viele negative Folgen für die Umwelt, besonders für Bodenlebewesen, Pflanzen und den Wasserkreislauf.
Folgen für Bodenlebewesen:
Wenn der Boden versiegelt wird – also mit Beton, Asphalt oder Pflaster bedeckt ist – können Regenwürmer, Käfer, Pilze und Mikroorganismen nicht mehr im Boden leben.
• Sie finden keinen Sauerstoff, keine Nahrung und kein Wasser.
• Viele dieser Lebewesen sind aber wichtig: Sie lockern den Boden auf, zersetzen organisches Material und helfen, dass Pflanzen gut wachsen können. Wenn sie verschwinden, verarmt der Boden – er wird trocken, hart und unfruchtbar.
Folgen für Pflanzen:
• Versiegelter Boden bietet keinen Platz für Wurzeln.
• Pflanzen können dort nicht wachsen – es entstehen keine Wiesen, Bäume oder Sträucher
• Auch in Städten bedeutet das: weniger Schatten, schlechtere Luft und weniger Kühlung im Sommer. Pflanzen sind außerdem wichtig für die Luftqualität und das Stadtklima – ohne sie wird es heißer und trockener.
Folgen für den Wasserkreislauf:
In einem natürlichen Boden kann Regenwasser langsam versickern. Das ist wichtig für den Grundwasserspeicher und verhindert, dass es zu viel Wasser auf einmal gibt.
Wenn aber alles versiegelt ist:
• Regen fließt oberflächlich ab – oft in die Kanalisation oder direkt in Flüsse.
• Es kommt häufiger zu Überschwemmungen, weil das Wasser nicht mehr im Boden aufgenommen wird.
• Das Grundwasser sinkt, weil es nicht mehr regelmäßig aufgefüllt wird – das kann später zu Wassermangel führen.
Zusammenfassung: Bodenversiegelung ist eine große Gefahr für die Umwelt. Sie zerstört Lebensräume, stört den natürlichen Wasserkreislauf und verhindert, dass Pflanzen und Tiere sich entwickeln können. Darum ist es wichtig, weniger Boden zu versiegeln und Flächen zu erhalten, auf denen Natur weiterleben kann.
Bonus/S. 101/3 individuelle Lösung
Bonus/S. 101/4 individuelle Lösung
Olympe Verlag
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft S. 55 - 57
AB 1 C * A * E * D * B
AB 2 6 – 8 * 44 – 46 * 39 – 41 * 46 – 48 * 2 – 4 * 8 - 11
Lernstandserhebung
1. Wien * Graz * Klagenfurt * Linz * Salzburg * Innsbruck
2. Richtig: dünn besiedelt * wenig bis gar keine Infrastruktur * hohe Wohnqualität * Leben und Wirtschaften ist beschwerlich * Problem der Abwanderung * wenig Arbeitsplätze
3. mögliche Lösung: Immer mehr Menschen ziehen in Ballungsräume, also große Städte oder dicht besiedelte Regionen. Ein Grund dafür ist, dass es dort mehr Arbeitsplätze, bessere Ausbildungsmöglichkeiten und eine gute medizinische Versorgung gibt. Außerdem sind in Städten viele Dinge des täglichen Lebens leicht erreichbar – zum Beispiel Geschäfte, Schulen, Freizeitangebote oder öffentliche Verkehrsmittel. Das macht das Leben in der Stadt für viele attraktiv. Doch das Leben in der Stadt hat auch Nachteile. In vielen Ballungsräumen ist der Wohnraum knapp und teuer. Es gibt oft mehr Verkehr, Lärm und Luftverschmutzung als auf dem Land. Viele Menschen leben auf engem Raum, was zu Stress führen kann. Naturflächen wie Wiesen oder Wälder sind seltener – wer Ruhe sucht, muss oft weit hinausfahren. Insgesamt bietet das urbane Leben viele Chancen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Darum ist es wichtig, Städte so zu gestalten, dass sie für alle lebenswert bleiben – mit Grünflächen, leistbarem Wohnraum und guter Infrastruktur.
Verlag
4. Zersiedelung: bedeutet, dass immer mehr Häuser, Straßen oder Einkaufszentren außerhalb von Dörfern oder Städten gebaut werden – oft ohne klare Planung. Dadurch werden Wiesen, Felder und Wälder verbaut, die Natur wird zerstört, und es entsteht ein unübersichtliches Nebeneinander von Siedlungen. * Pendeln: heißt, dass Menschen nicht an dem Ort wohnen, an dem sie arbeiten oder zur Schule gehen. Sie fahren zum Beispiel jeden Tag mit dem Auto, Bus oder Zug von ihrem Wohnort in eine Stadt und am Abend wieder zurück. * Ballungsraum: Ein Ballungsraum ist eine Region mit vielen Städten, Dörfern und sehr vielen Menschen, die nahe beieinander wohnen. Es gibt dort viele Arbeitsplätze, gute Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser. Beispiele in Österreich sind der Raum Wien oder Linz. * Strukturschwäche: Strukturschwäche bedeutet, dass eine Region schlecht entwickelt ist. Dort gibt es wenige Arbeitsplätze, wenig Industrie, schlechte Verkehrsverbindungen oder kaum gute Schulen und Ärztinnen und Ärzte. Viele junge Menschen ziehen deshalb oft weg – in Städte oder besser entwickelte Gebiete.
LÖSUNGEN
Lösungen Anhang S. 103 - ???
S. 103
S. 104
A. Bregenzer Wald * B. Rätikon * C. Silvretta * a. Bodensee * b. Bregenzer Ach * c. Ill * 1. Bregenz * 2. Feldkirch * 3. Bludenz
Brennerautobahn * Innsbruck * Tourismus * Textilindustrie * Zugspitze * Fernpass * Wattens
A. Lechtaler Alpen * B. Zillertaler Alpen * C. Stubaier Alpen * D. Lienzer Dolomiten * a. Inn * b. Ziller * c. Achensee * 1. Innsbruck * 2. Lienz * 3. Kitzbühel
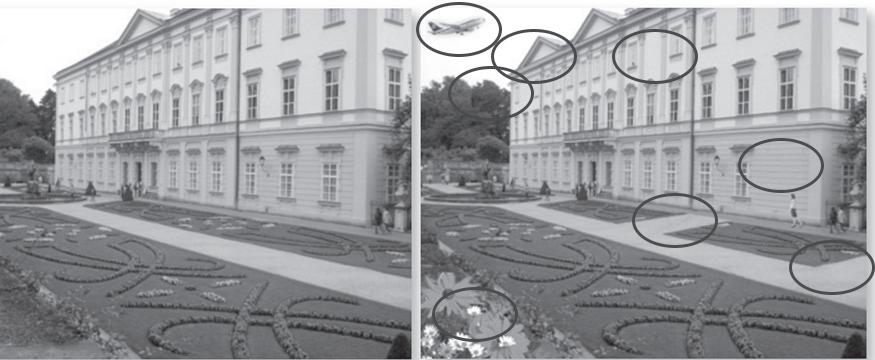
S. 105 A. Hochkönig * B. Kitzsteinhorn * C. Großvenediger * D. Großglockner * a. Salzach * b. Zeller See * c. Wallersee * 1. Salzburg * 2. Zell am See * 3. Tamsweg von oben nach unten: Oberösterreich * 76 * Kaiser Franz Joseph I.
S. 106 A. Höllengebirge * B. Sengsengebirge * C. Dachstein * a. Donau * b. Attersee * c. Traunsee * 1. Linz * 2. Schärding * 3. Gmunden * 4. Bad Ischl A. Ennstaler Alpen * B. Fischbacher Alpen * C. Seetaler Alpen * 1. Graz * 2. Liezen * 3. Leoben * a. Mur * b. Mürz * c. Grundlsee * LÖSUNGSWORT: Mariazell
S. 107
A. Gurktaler Alpen * B. Saualm * C. Karawanken * a. Drau * b. Millstätter See * c. Wörthersee * 1. Villach * 2. Klagenfurt * 3. Wolfsberg von oben nach unten: Wörthersee * Seen * mediterranen * Sonnenstunden * Alpenseen
S. 108 A. Leithagebirge * B. Günser Gebirge * 1. Eisenstadt * 2. Pinkafeld * 3. Jennersdorf * a. Neusiedler See * b. Rabnitz * c. Pinka * d. Wulka
Aussage 2 und 4 sind falsch
S. 109 senkrecht: 1. Wien * 2. Manhartsberg * 4. Rathaus * 5. Donau waagrecht: 3. Thermenlinie * 6. Schneeberg * 7. Statutarstadt
A. Hermannskogel * B. Leopoldsberg * a. Donau * b. Wien * c. Liesing * 1. Penzing * 2. Innere Stadt * 3. Donaustadt * 4. Margareten * 5. Brigittenau
Olympe Verlag
BILDQUELLEN
Birgit Kozak: 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 33/1, 45/1 Istockphotos: abbydesign: 12/1, 25/1, 46/1, 60/1, altmodern: 39/4, Andreas Rose: 39/7, Bertl123: 34/4, Borisb17: 34/9, cifotart: 7/1, DaveLongMedia: 39/3, Deepak Sethi: 18/1, ferlistockphoto: 39/1, Fredex8: 35/2, frentusha: 34/6, inigofotografia: 34/7, julos: 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, Leonsbox: 34/2, nickylarson974: 33/2, phbcz: 39/6, RenePi: 39/5, sSplajn: 38/1, Taha Kara: 39/8, theowl84: 34/5, TheYok: 34/3, thumb: 35/1, TomasSereda: 39/9, urfinguss: 58/1, verve231: 34/1, Vesnaandjic: 39/2, Yulia Pavlova: 31/1, Raoul Krischanitz: 24/, 30/1, Wikimedia Commons: 36/2, 37/2, 36/3, 37/3, 56/2, 56/3, A.Savin: 34/8, David Liuzzo: 36/5, 37/5, 36/6, 37/6, 56/5, 56/6, Gryffindor: 36/9, 37/9, 56/9, http://www.fahnen-gaertner.com: 36/1, 37/1, 36/4, 37/4, 56/1, 56/4, Jürgen Krause: 36/7, 37/7, 56/7, Mglanznig: 36/8, 37/8, 56/8,
Umschlagbilder: istockphotos.com/duncan1890, istockphotos.com/Harvepino
© Olympe Verlag GmbH, NÖ, 2025
Lektorat: Marion Ramell, BA
Umschlaggestaltung: Raoul Krischanitz, Wien, transmitterdesign.com
Verlag
Satz, Layout: Birgit Kozak (www.hellbunt-design.at)
Druck, Bindung: druck.at; Leobersdorf
ISBN: 978-3-903328-57-0
Olympe Verlag