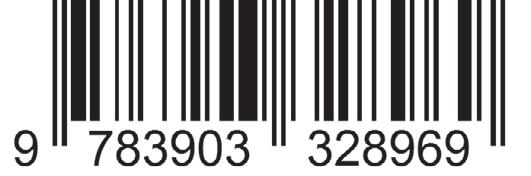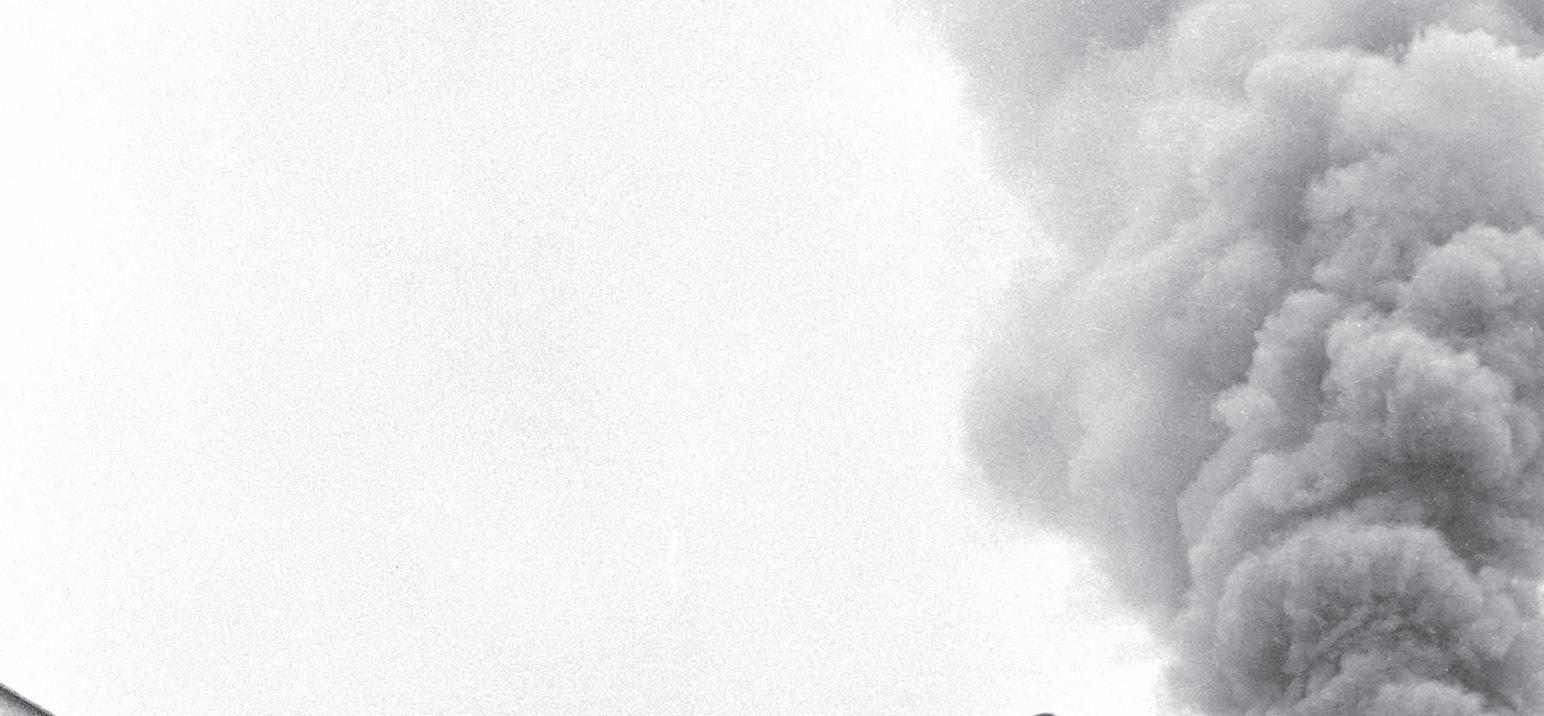3 LEHRERHEFT
Monyk, Schreiner, Brzobohaty, Mann

www.eS quirrel.at

Verlag



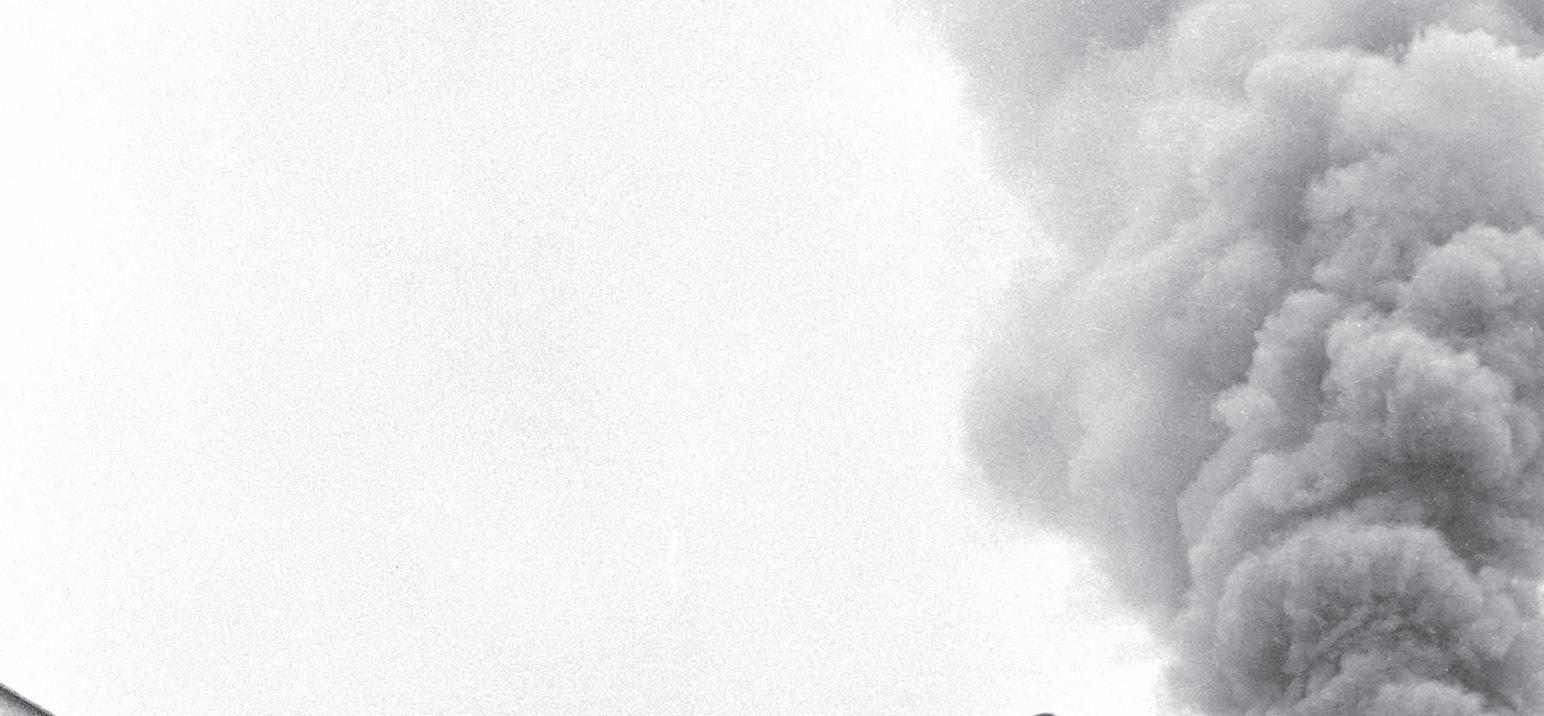
Vorwort
Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Dieses Lehrbuch ist eine Neubearbeitung nach dem neuen kompetenzorientierten Lehrplan. Geschichte für alle bietet einen Überblick vom Beginn der Neuzeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Drei Module beschäftigen sich mit zentralen Bereichen des Politischen Handelns. Zwischen den einzelnen Kapiteln finden sich neun Methoden, die die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich Arbeitsweisen anzueignen und Kompetenzen aufzubauen.
„Geschichte für alle“ ist so aufgebaut, dass Ihre Schülerinnen und Schüler nach den einzelnen Kapiteln mithilfe der „Aufgaben für schlaue Köpfe“ ihr zuvor erlerntes Wissen wiederholen und vertiefen können. Damit wird ihre Selbsttätigkeit gestärkt und die Freude an Geschichte geweckt. Die Arbeitsaufgaben zeichnen sich durch eine leichte Handhabung aus und sind farblich entsprechend der drei Kompetenzbereiche (Reproduktion – Transfer – Reflexion) gekennzeichnet.
Ebenso dienen vielfältige Arbeitsanregungen in der Seitenspalte neben dem Fließtext dem Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Die drei Anforderungsbereiche sind auch hier durch ein Farbleitsystem gekennzeichnet. Schwierige Begriffe werden im Fließtext orange gekennzeichnet und in der Seitenspalte erklärt.
Verlag
Im vorliegenden Lehrerheft finden sich bis auf Modul 4 (Längsschnitt) folgende Bausteine:
• eine Fülle von 1:1 kopierbaren Arbeitsblättern
• Vorgaben für schriftliche Lernstandserhebungen sowie deren Lösungen
• Lösungen für alle „Nun geht‘s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“ aus dem Hauptbuch
All dieses Zusatzmaterial ist in der Praxis erprobt und soll Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern!
Und nun: Viel Spaß mit Ihrem neuen Geschichtsbuch!
Ihr Autorinnenteam

LEHRERBUCHKAPITEL
1. Gelehrte beginnen die Welt zu erforschen
2. Technische Erfindungen verändern das Leben
NEUZEITLICHER KULTUREN
ASPEKTE
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
September … das geozentrische und das heliozentrische Weltbild erklären und deren historische Bedeutung vergleichen. … die Leistungen von Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei für die Wissenschaft benennen. … erläutern, welche Bedeutung das Teleskop für die Himmelsbeobachtung hatte. … nachvollziehen, warum die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Konflikt mit der katholischen Kirche standen. … den Einfluss neuer wissenschaftlicher Methoden (Beobachtung und Experiment) auf die Entwicklung der Naturwissenschaften beschreiben.
3. Humanismus und Renaissance
Olympe Verlag
… bedeutende Erfindungen der frühen Neuzeit (z. B. Buchdruck, Fernrohr, Mikroskop, Taschenuhr) nennen und deren Funktionsweise in Grundzügen erklären. … erläutern, welche Auswirkungen technische Erfindungen auf das Leben der Menschen in der Neuzeit hatten. … beschreiben, warum der Buchdruck als „Schwarze Kunst“ bezeichnet wurde.
… erklären, welche Fähigkeiten Menschen entwickeln mussten, um von neuen Erfindungen wie dem Buchdruck zu profitieren.
… die Bedeutung von Erfindungen wie Buchdruck und Digitalisierung für Gesellschaft, Kultur und Kommunikation vergleichen.
… die langfristigen Folgen der Einführung von Schießpulver auf die Kriegsführung und den Ritterstand bewerten.
… reflektieren, warum neue Technologien bestehende gesellschaftliche Strukturen und Arbeitsweisen tiefgreifend verändern können.
… die Grundideen des Humanismus erklären und die Bedeutung des Begriffs „Humanität“ erläutern. … zentrale Merkmale der Renaissance in Kunst, Architektur und Wissenschaft benennen.
… die Bedeutung antiker Vorbilder für den Humanismus und die Renaissance erläutern.
… wichtige Persönlichkeiten der Renaissance (z. B. Leonardo da Vinci, Michelangelo) vorstellen und deren Leistungen zusammenfassen.
… erklären, wie der Buchdruck zur Verbreitung humanistischer Ideen beigetragen hat.
… den Einfluss der Renaissance auf heutige Kunst, Wissenschaft und Bildung erkennen und Beispiele nennen.
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können … LEHRERBUCHKAPITEL
M1: Herrschergemälde entschlüsseln
… ein Herrschergemälde genau beschreiben und wichtige Symbole wie Krone, Zepter oder Thron erkennen. … erklären, welche Absichten Herrscherinnen und Herrscher mit solchen Bildern verfolgen. … ein Herrschergemälde analysieren und deuten, welche Macht, Eigenschaften oder Botschaften damit gezeigt werden sollen. … anhand gezielter Fragen die Wirkung eines Herrscherbildes auf die Betrachterinnen und Betrachter beurteilen.
MONAT
Oktober
* (Diese Jahresplanung können Sie für Ihre individuelle Planung als W ord-Dokument auf unserer Homepage downloaden.)
LEHRERBUCHKAPITEL
BONUS-SEITE: Der Aufstieg der Habsburger
ASPEKTE NEUZEITLICHER KULTUREN
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
4. Glaubenskonflikte und Machtpolitik
Oktober … erklären, wie die Habsburger durch Heiratsund Erbpolitik ihre Macht vergrößerten. … mit einer Karte belegen, welche Gebiete die Habsburger durch geschickte Heiraten gewannen. … Vorund Nachteile der Heiratspolitik der Habsburger beurteilen. … in eigenen Worten erklären, was der Spruch „Du, glückliches Österreich, heirate!“ bedeutet. … erklären, warum Martin Luther die Kirche kritisierte und was er mit der Reformation erreichen wollte. … die Folgen der Kirchenspaltung für Europa beschreiben und erklären, warum es zu religiösen Konflikten kam. … den Augsburger Religionsfrieden von 1555 in eigenen Worten erklären und beurteilen, warum dieser wichtig war. … die Ziele der Gegenreformation beschreiben und erklären, wie die katholische Kirche darauf reagierte.
5. Der Dreißigjährige Krieg
… die wichtigsten Ursachen und den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges in eigenen Worten erklären.
… beschreiben, wie der Krieg das Leben der Menschen in Europa verändert und viele Regionen verwüstet hat. … erklären, was im Westfälischen Frieden beschlossen wurde und warum dieser für Europa bedeutend war.
6. Gericht und Gerichtsstrafen in der Neuzeit
7. Liebe, Ehe und Sexualität
Verlag
… anhand von Bildern und Quellen beschreiben, wie Gewalt, Hunger und Krankheiten die Bevölkerung betroffen haben.
… verschiedene Gerichte und Strafen der Neuzeit nennen und ihre Bedeutung erklären.
… beschreiben, wie Menschen in der Neuzeit öffentlich bestraft oder verbannt wurden.
… erklären, warum bestimmte Strafen wie die Prügelstrafe oder die V erbannung eingesetzt wurden. … zwischen Quellen und Darstellungen unterscheiden und ihre Aussagen über das Rechtssystem der Neuzeit beurteilen.
… beschreiben, welche Bedeutung Ehe und Familie in der Neuzeit für das Zusammenleben der Menschen hatten.
… erklären, wie Heiraten damals geregelt waren und welche Rolle Eltern und Gesellschaft dabei spielten.
8. Menschen mit Behinderung –zwischen Ausgrenzung und Inklusion
… Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Liebe und Ehe in der Neuzeit und heute erkennen und benennen. … darstellen, wie Menschen in der Neuzeit mit Regeln zu Liebe, Ehe und Sexualität umgegangen sind. … erklären, wie Menschen mit Behinderungen in der Neuzeit gelebt haben und mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hatten. … Unterschiede zwischen Ausgrenzung in der Vergangenheit und dem Ziel der Inklusion heute beschreiben. … sich in die Sichtweise von betroffenen Menschen hineinversetzen und ihre Situation mit der heutigen vergleichen. … Vorschläge machen, wie unsere Gesellschaft heute noch mehr Inklusion erreichen kann.
3. Klasse“
JAHRESPLANUNG „GESCHICHTE FÜR ALLE -
BRINGT VERÄNDERUNG
NEUZEIT
DIE
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Ein neues Wirtschaftssystem –der Frühkapitalismus
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
2. Die Gesellschaft veränderte sich
November … erklären, wie Handel, Geldwirtschaft und neue Berufe in der Neuzeit das Leben der Menschen verändert haben. … beschreiben, was unter Frühkapitalismus verstanden wird und wie er sich von der früheren Wirtschaftsweise unterscheidet. … erklären, warum der Handel mit Übersee und die Entstehung von Banken für den Frühkapitalismus wichtig waren. … Auswirkungen des Frühkapitalismus auf verschiedene soziale Gruppen erkennen und benennen.
3. Die Bauernaufstände
4. Die absolute Monarchie in Frankreich
BONUS-SEITE: Barocke Pracht –Schloss Versailles
Olympe Verlag
… die Ständegesellschaft der Neuzeit beschreiben und erklären, welche Rechte und Pflichten die Menschen in den einzelnen Ständen hatten.
… beschreiben, warum es schwer war, aus seinem Stand aufzusteigen, und was sich daran langsam zu verändern begann.
… erklären, wie sich das Leben von Adel, Klerus und Bauern durch Handel, Geldwirtschaft und neue Berufe veränderte.
… die Bedeutung der Städte für die gesellschaftlichen Veränderungen der Neuzeit erklären.
… erklären, warum viele Bäuerinnen und Bauern in der Neuzeit gegen ihre Herrscher aufbegehrten.
… die wichtigsten Forderungen der Bauern in eigenen Worten zusammenfassen.
… beschreiben, wie die Herrschenden auf die Bauernaufstände reagierten und warum die meisten scheiterten.
… Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Zielen der Bauern und der Reaktion der Herrschenden erkennen und benennen.
… erklären, was eine absolute Monarchie ist und wie König Ludwig XIV . in Frankreich seine Macht dargestellt hat.
… beschreiben, welche Rolle Schloss Versailles für die Selbstdarstellung des Königs spielte.
… Beispiele nennen, wie der König Adel, Kirche und Bevölkerung kontrollierte, um seine Macht zu sichern.
… die Vorteile und Nachteile der absoluten Monarchie für verschiedene Gruppen der Gesellschaft beurteilen.
… erklären, warum König Ludwig XIV. Schloss Versailles bauen ließ und was er damit zeigen wollte.
… beschreiben, wie das Leben am Hof von Versailles organisiert war und welche Bedeutung das für den Adel hatte. … Beispiele nennen, wie Architektur, Kunst und Feste in Versailles zur Selbstdarstellung des Königs beigetragen haben.
M2: Eine Mind-Map erstellen –Gedanken strukturieren
… beurteilen, welche Wirkung Schloss Versailles auf die Bevölkerung und andere Herscherinnen und Herrscher in Europa hatte. … wichtige Begriffe und Ideen zu einem Thema sammeln und übersichtlich in einer Mind-Map darstellen. … Hauptund Unterbegriffe in einer Mind-Map ordnen und sinnvoll miteinander verbinden. … eine Mind-Map nutzen, um ihre Gedanken zu einem Thema zu strukturieren und sich auf einen Text oder eine Präsentation vorzubereiten. … mithilfe einer Mind-Map ihre Ergebnisse anderen verständlich erklären.
LEHRERBUCHKAPITEL
5. Eine neue Wirtschaftsform –der Merkantilismus
BRINGT VERÄNDERUNG
NEUZEIT
DIE
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
November … erklären, was Merkantilismus bedeutet und warum Frankreich diese Wirtschaftsform eingeführt hat .… beschreiben, wie der Staat durch Zölle, Manufakturen und Exportförderung die Wirtschaft steuern wollte. … erklären, wie der Merkantilismus das Leben der Menschen in Frankreich und den Kolonien beeinflusst hat. … den Merkantilismus mit heutigen Wirtschaftsformen vergleichen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten benennen.
LEHRERBUCHKAPITEL
REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN
1. Die Aufklärung
M3: Karikaturen deuten
2. Die Französische Revolution
M4: Historienmalerei entschlüsseln
Olympe Verlag
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
Dezember … erklären, was die Aufklärung bedeutet und warum sie eine wichtige Zeit des Umdenkens war.
… zentrale Forderungen der Aufklärer, wie Freiheit, Gleichheit und Bildung für alle, in eigenen Worten beschreiben. … erklären, warum die Aufklärung für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft große Veränderungen brachte. … Beispiele nennen, wie die Ideen der Aufklärung bis heute unser Denken und Zusammenleben beeinflussen. … eine Karikatur genau beschreiben und wichtige Bildelemente erkennen.
… die Aussage einer Karikatur erklären und die dargestellte Kritik oder Botschaft benennen.
… die Wirkung von Übertreibungen und Symbolen in einer Karikatur erklären.
… eine Karikatur nutzen, um die Sichtweise von Menschen in einer bestimmten Zeit zu verstehen und zu bewerten.
… analysieren, warum es zur Französischen Revolution kam und welche Ziele die Revolutionäre verfolgten.
… wichtige Ereignisse und Symbole der Revolution, wie den Sturm auf die Bastille oder die Menschenrechte, beschreiben und einordnen.
… die Folgen der Revolution für die Gesellschaft in Frankreich und Europa erklären. … die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Gegenwart übertragen und ihre Bedeutung heute einschätzen.
… eine Historienmalerei genau beschreiben und die dargestellten Personen, Gegenstände und Handlungen benennen.
… erklären, welches historische Ereignis in einem Bild dargestellt wird und warum dieses Bild entstanden ist.
… die Botschaft und Wirkung einer Historienmalerei deuten und überlegen, was betont oder ausgelassen wurde. … zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler mit solchen Bildern Geschichte aus ihrer Sicht erzählen oder bewerten.
LEHRERBUCHKAPITEL
3. Frankreich wird Kaiserreich
REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
4. Die Neuordnung Europas
5. Die Zeit des Vormärz
BONUS-SEITE: Die Kultur des Biedermeiers
Dezember … analysieren, wie Napoleon durch seine Krönung zum Kaiser seine Macht darstellte und festigte. … erklären, welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen Napoleon in Frankreich und Europa bewirkte. … beurteilen, wie sich das Leben der Menschen in Frankreich unter Napoleons Herrschaft verändert hat. … reflektieren, warum Napoleon bis heute unterschiedlich bewertet wird –als Held, Reformer oder Unterdrücker. … analysieren, wie Europa nach Napoleons Niederlage auf dem Wiener Kongress neu geordnet wurde. … erklären, welche Interessen die Siegermächte beim Wiener Kongress verfolgten. … reflektieren, welche Folgen die Neuordnung Europas für die Menschen in den betroffenen Gebieten hatte. … beurteilen, ob die Ziele des Wiener Kongresses –Frieden und Ordnung –tatsächlich erreicht wurden. … erklären, warum viele Menschen im Vormärz mehr Freiheit, Mitbestimmung und nationale Einheit forderten. … analysieren, wie Herrscher und Polizei im Vormärz versuchten, diese Forderungen zu unterdrücken. … reflektieren, warum die Ideen der Freiheit trotz der Unterdrückung weiterlebten und später zu Revolutionen führten. … beschreiben, wie die Ereignisse des Vormärz den Weg für spätere politische Veränderungen vorbereiteten. … beschreiben, wie sich die Menschen im Biedermeier auf das Privatleben, Familie und Gemütlichkeit konzentrierten.
Olympe Verlag
6. Europa brennt
… analysieren, wie Kunst, Möbel und Mode die Werte und das Lebensgefühl des Biedermeiers widerspiegeln. … reflektieren, welche Parallelen es zwischen dem Rückzug ins Private damals und heute geben könnte. … erklären, warum es 1848 in vielen Ländern Europas zu Revolutionen kam.
7. Jüdisches Leben in Österreich –zwischen Reformen und Vorurteilen
… beschreiben, welche politischen und sozialen Ziele die Revolutionärinnen und Revolutionäre verfolgten. … analysieren, warum viele Revolutionen scheiterten und welche Folgen das für Europa hatte. … reflektieren, ob und wie die Ideen von Freiheit und Mitbestimmung trotz des Scheiterns weiterwirkten. … erklären, wie Jüdinnen und Juden in Österreich zwischen Ausgrenzung und ersten Reformen lebten. … beschreiben, welche Vorurteile und Einschränkungen sie erlebten und wie sich ihre Situation im 19. Jahrhundert veränderte.
LEHRERBUCHKAPITEL
JAHRESPLANUNG „GESCHICHTE FÜR ALLE -
REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN
8. Revolutionen des 20. Jahrhunderts
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Die Industrielle Revolution
M5: Historische Fotografien untersuchen
2. Wirtschaftlicher Wandel
3. Klasse“ Olympe Verlag
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
Dezember … analysieren, wie politische Entscheidungen das Leben jüdischer Menschen in Österreich beeinflusst haben. … reflektieren, warum es wichtig ist, sich mit der Geschichte des jüdischen Lebens in Österreich auseinanderzusetzen. … erklären, warum es im 20. Jahrhundert in verschiedenen Ländern zu Revolutionen kam. … beschreiben, welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen durch diese Revolutionen angestoßen wurden. … analysieren, welche Ziele die Menschen in den unterschiedlichen Revolutionen verfolgten und ob sie diese erreichen konnten. … reflektieren, welche Folgen Revolutionen für das Leben der Menschen und für den weiteren Verlauf der Geschichte hatten.
DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
… erklären, was die Industrielle Revolution war und warum sie das Leben vieler Menschen stark veränderte.
… beschreiben, wie Maschinen, Fabriken und neue Verkehrsmittel Arbeit und Alltag veränderten.
… analysieren, welche Vorteile und Probleme die Industrielle Revolution für die Gesellschaft brachte.
… reflektieren, welche Spuren der Industriellen Revolution bis heute sichtbar sind und was wir daraus lernen können.
MONAT
Jänner
… historische Fotografien genau beschreiben und wichtige Details erkennen.
… analysieren, was eine historische Fotografie über das Leben der Menschen zu einer bestimmten Zeit zeigt.
… reflektieren, was eine Fotografie nicht zeigt oder verschweigt und welche Fragen offen bleiben.
… erklären, warum Fotografien wichtige Quellen für das Verständnis von Geschichte sind.
… darstellen, wie neue Erfindungen die Landwirtschaft, das Handwerk und die Industrie verändert haben.
… beschreiben, welche neuen Verkehrswege entstanden sind und warum diese wichtig waren.
… erläutern, warum viele Menschen vom Land in die Stadt zogen und welche Folgen das hatte.
… beurteilen, ob der wirtschaftliche Wandel für alle Menschen Vorteile brachte oder auch Probleme verursachte.
3. Die Gesellschaft veränderte sich
… erklären, wie die Gesellschaft in der Zeit der Industriellen Revolution neu aufgebaut war … aufzählen, welche Unterschiede es zwischen der Oberschicht, der Mittelschicht und der Arbeiterschaft gab. … vergleichen, wie das Leben der Menschen auf dem Land und in der Stadt unterschiedlich war . … bewerten, ob die soziale Ungleichheit in dieser Zeit zugenommen oder abgenommen hat.
JAHRESPLANUNG
LEHRERBUCHKAPITEL
INDUSTRIALISIERUNG
DAS ZEITALTER DER
4. Frauen fordern Mitbestimmung
5. Die soziale Frage und politische Programme
6. Sozialgesetzgebung und Gründung von Parteien in Österreich
LEHRERBUCHKAPITEL
Klasse“ Olympe Verlag
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
Jänner … schildern, warum Frauen im 19. und 20. Jahrhundert für mehr Rechte und politische Mitbestimmung kämpften. … Beispiele nennen, wie Frauen sich für bessere Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht einsetzten. … untersuchen, welche Hindernisse Frauen überwinden mussten, um ihre Ziele zu erreichen. … bewerten, wie wichtig diese Errungenschaften für die Gleichberechtigung heute sind … erklären, was mit der „sozialen Frage“ gemeint war und warum sie im 19. Jahrhundert entstand. … Beispiele für die Probleme der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Industriellen Revolution benennen. … politische Programme und Ideen (z. B. Sozialismus, Liberalismus) zusammenfassen, die eine Lösung versprachen.
… beurteilen, welche dieser Programme die Lebensbedingungen der Menschen tatsächlich verbessert haben.
… beschreiben, warum in Österreich Sozialgesetze eingeführt wurden und was sie bewirken sollten.
… erläutern, wie sich erste politische Parteien in Österreich gründeten und welche Ziele sie verfolgten. … aufzählen, welche Gruppen von diesen politischen Veränderungen besonders profitierten.
… bewerten, warum die Einführung von Sozialgesetzen ein wichtiger Schritt für den Schutz von Arbeiterinnen und Arbeitern war.
KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
1. Kolonialismus
Februar … erklären, warum europäische Staaten ab dem 15. Jahrhundert begannen, Kolonien zu erobern und auszubeuten.
… aufzählen, welche Folgen der Kolonialismus für die Menschen in Afrika, Asien und Amerika hatte.
… untersuchen, wie die Kolonialmächte ihre Macht in den eroberten Gebieten sicherten.
… bewerten, warum der Kolonialismus bis heute Auswirkungen auf viele Länder und Gesellschaften hat.
2. Imperialismus
… erklären, was mit dem Begriff „Imperialismus“ gemeint ist und warum europäische Staaten ihre Macht weiter ausdehnten. … beschreiben, wie wirtschaftliche, politische und militärische Interessen den Imperialismus vorantrieben. … vergleichen, wie der Kolonialismus und der Imperialismus zusammenhängen und sich unterscheiden.
… beurteilen, welche Folgen der Imperialismus für die betroffenen Völker und Länder hatte.
3. Die Aufteilung der Welt
… darstellen, wie die europäischen Mächte im 19. Jahrhundert die W elt unter sich aufteilten.
… beschreiben, welche Gebiete besonders betroffen waren und welche Rohstoffe und Märkte sie den Kolonialmächten boten. … untersuchen, welche Rolle Konferenzen wie die Berliner Kongokonferenz bei der Aufteilung spielten. ... bewerten, welche langfristigen Auswirkungen diese Aufteilung für die betroffenen Regionen hatte.
LEHRERBUCHKAPITEL
4. Der Vielvölkerstaat Österreich
JAHRESPLANUNG „GESCHICHTE FÜR ALLE
KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
5. Das Osmanische Reich –ein Vielvölkerstaat
BONUS-SEITE: Alltag, Kunst und Kultur im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn
Februar … darstellen, welche verschiedenen Völker und Sprachen im Vielvölkerstaat Österreich zusammenlebten. … erläutern, warum das Zusammenleben der vielen Volksgruppen im Habsburgerreich sowohl Chancen als auch Probleme brachte. … untersuchen, wie sich die Forderungen nach mehr Rechten und Selbstbestimmung in den verschiedenen Völkern äußerten. … bewerten, wie der Vielvölkerstaat versuchte, Einheit zu schaffen und warum das schwierig war. … erklären, welche Gebiete und Volksgruppen zum Osmanischen Reich gehörten. … beschreiben, wie das Osmanische Reich den unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Religionen begegnete. … untersuchen, welche Herausforderungen und Konflikte das Zusammenleben vieler V olksgruppen im Osmanischen Reich mit sich brachte. … beurteilen, warum das Osmanische Reich schließlich zerfiel und welche Folgen das für die Region hatte. … darstellen, wie sich der Alltag der Menschen im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn durch die Vielfalt an Sprachen, Religionen und Kulturen auszeichnete.
… Beispiele für Kunst und Kultur nennen, die aus dem Zusammenleben verschiedener Volksgruppen entstanden sind. … untersuchen, wie sich diese kulturelle Vielfalt im Stadtleben, in der Architektur und im Musikleben widerspiegelte. … reflektieren, was wir heute aus der kulturellen Vielfalt des Vielvölkerstaates für ein friedliches Zusammenleben lernen können.
BIS IN DIE GEGENWART
LEHRERBUCHKAPITEL
1. MigrationIntegrationAsyl
M6: Statistiken untersuchen
Verlag
MIGRATION VOM 19. JAHRHUNDERT
MONAT Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
2. Wien im 19. Jahrhundert –Zentrum der Zuwanderung
März … erklären, was die Begriffe Migration, Integration und Asyl bedeuten. … Beispiele nennen, warum Menschen ihre Heimat verlassen und in andere Länder ziehen.
… beschreiben, welche Chancen und Herausforderungen Migration für die Gesellschaft mit sich bringt.
… reflektieren, wie ein gutes Zusammenleben zwischen Zugewanderten und Einheimischen gelingen kann.
… eine Statistik genau lesen und die wichtigsten Informationen herausfiltern.
… beschreiben, was eine Statistik über Entwicklungen oder Zusammenhänge zeigt.
… die Ergebnisse einer Statistik in eigenen Worten zusammenfassen und verständlich erklären.
… beurteilen, welche Aussagen eine Statistik zulässt und welche Fragen offen bleiben.
… erklären, warum Wien im 19. Jahrhundert für viele Menschen ein attraktives Ziel für die Einwanderung war. … beschreiben, wie sich die Bevölkerung Wiens durch die Zuwanderung verändert hat.
… untersuchen, welche Spuren die kulturelle Vielfalt bis heute im Stadtbild und im Leben in Wien hinterlassen hat.
LEHRERBUCHKAPITEL
3. Auswanderung in die USA
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
4. Österreich –ein Einwanderungsland?
März … beurteilen, welche Herausforderungen und Chancen die Zuwanderung damals für die Stadt mit sich brachte. … Gründe nennen, warum viele Menschen im 19. Jahrhundert aus Europa in die USA auswanderten. … darstellen, mit welchen Hoffnungen und Erwartungen die Auswanderer ihre Reise begannen. … untersuchen, welche Herausforderungen und Chancen die Menschen in ihrer neuen Heimat erlebten. … reflektieren, welche Parallelen es zwischen der damaligen Auswanderung und heutigen Migrationserfahrungen gibt. … erklären, warum Österreich heute als Einwanderungsland bezeichnet wird. … beschreiben, aus welchen Ländern und aus welchen Gründen Menschen nach Österreich kommen. … aufzeigen, wie Migration das Leben, die Kultur und die Gesellschaft in Österreich verändert. … beurteilen, welche Chancen und Herausforderungen sich durch Migration für alle Menschen in Österreich ergeben.
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Nationalismus und Imperialismus führen zum Ersten Weltkrieg
2. Der Verlauf des Ersten Weltkriegs
DER ERSTE WELTKRIEG
Verlag
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
April … beschreiben, wie Nationalismus und Imperialismus das Verhältnis der europäischen Staaten vor dem Ersten Weltkrieg beeinflusst haben.
… darstellen, warum Bündnisse und das Wettrüsten zu Spannungen zwischen den Großmächten führten. … erklären, warum der Mord an Thronfolger Franz Ferdinand als Auslöser, aber nicht als alleinige Ursache für den Ersten Weltkrieg gilt. … analysieren, welche Interessen verschiedene Staaten verfolgten und warum sie letztlich in den Krieg zogen. … den Verlauf des Ersten Weltkriegs anhand wichtiger Stationen und Schlachten zusammenfassen. … erläutern, warum der Krieg länger dauerte als viele erwartet hatten und Millionen Menschen betroffen waren. … erklären, wie sich der Krieg an der Front und im Alltag der Bevölkerung gezeigt hat. … bewerten, warum der Erste Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wird.
3. Kindheit und Jugend während des Ersten Weltkriegs
… schildern, wie der Erste Weltkrieg den Alltag von Kindern und Jugendlichen veränderte.
… Beispiele nennen, welche Aufgaben und Pflichten junge Menschen in dieser Zeit übernehmen mussten.
… untersuchen, wie der Krieg das Leben von Familien und das Aufwachsen von Kindern prägte.
… reflektieren, was wir heute aus den Erlebnissen von Kindern und Jugendlichen im Krieg lernen können.
ERSTE WELTKRIEG
DER
LEHRERBUCHKAPITEL
M7: Feldpostkarten und Feldpostbriefe untersuchen
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
4. Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen
April … eine Feldpostkarte oder einen Feldpostbrief genau lesen und den Inhalt zusammenfassen. … untersuchen, welche persönlichen Erlebnisse, Gefühle oder Hoffnungen darin beschrieben werden. … analysieren, was Feldpost über das Leben von Soldaten und ihren Familien im Ersten W eltkrieg verrät. … reflektieren, warum solche persönlichen Quellen wichtig sind, um Geschichte besser zu verstehen. … erklären, warum der Erste Weltkrieg 1918 zu Ende ging und welche Staaten als Verlierer galten. … die wichtigsten Bestimmungen der Friedensverträge von Versailles und St. Germain zusammenfassen. … analysieren, welche politischen und wirtschaftlichen Folgen der Krieg für Europa und die W elt hatte.
BONUS-SEITE: Humanitäres Völkerrecht
… beurteilen, warum der Frieden von 1918 für viele Menschen unzufriedenstellend war und neue Konflikte auslöste. … erklären, was das humanitäre Völkerrecht ist und warum es zum Schutz von Menschen im Krieg wichtig ist. … Beispiele nennen, welche Regeln für Soldaten, Zivilpersonen und Kriegsgefangene im Krieg gelten sollen. … untersuchen, warum das humanitäre Völkerrecht trotz seiner Bedeutung oft verletzt wird. … reflektieren, warum es wichtig ist, solche Regeln auch heute in allen Kriegen einzuhalten und zu stärken.
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Was ist Identität?
Verlag
IDENTITÄTEN
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
M8: Eine Pround Contra-Diskussion führen 2. Nationale Identitäten
Mai … erklären, was der Begriff Identität bedeutet und welche Merkmale ihre Identität ausmachen.
… Beispiele dafür nennen, wie Familie, Freunde, Sprache und Herkunft ihre Identität beeinflussen. … Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ihrer Identität und der Identität anderer Menschen erkennen und respektieren.
… reflektieren, warum Identität für jeden Menschen wichtig ist und sich im Laufe des Lebens verändern kann.
… Argumente für und gegen ein Thema sammeln und übersichtlich gegenüberstellen.
… in einer Diskussion ihre eigene Meinung klar und verständlich ausdrücken.
… auf Argumente anderer eingehen und darauf passend reagieren.
… eine Diskussion fair führen und die Meinung anderer respektvoll anhören.
… erklären, was mit „nationaler Identität“ gemeint ist und wie sie entsteht.
… Beispiele für Symbole, Traditionen und Werte nennen, die zur nationalen Identität eines Landes gehören. … vergleichen, wie sich nationale Identitäten in verschiedenen Ländern unterscheiden oder ähneln.
… reflektieren, warum nationale Identitäten sowohl verbinden als auch trennen können.
„GESCHICHTE FÜR ALLE3. Klasse“
JAHRESPLANUNG
IDENTITÄTEN
LEHRERBUCHKAPITEL
3. Europäische Identität
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
LEHRERBUCHKAPITEL
1. Du hast die Wahl
Mai … erläutern, was mit „europäischer Identität“ gemeint ist und welche gemeinsamen W erte Europa verbinden. … Beispiele für europäische Symbole, wie die Flagge oder die Hymne, benennen und ihre Bedeutung erklären. … darstellen, warum Vielfalt und gemeinsame Geschichte wichtige Bestandteile der europäischen Identität sind. … refl ektieren, was eine europäische Identität für mein eigenes Leben und für das Zusammenleben in Europa bedeutet.
BONUS-SEITE: Die Entwicklung des Wahlrechts
M9: Wahlplakate analysieren 3. Wahlwerbung
Olympe Verlag
WAHLEN UND WÄHLEN
Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können …
MONAT
Juni … erklären, warum freie und geheime Wahlen wichtig für die Demokratie sind. … die wichtigsten Regeln für Wahlen in Österreich nennen, z. B. Wahlalter oder Wahlrecht für alle. … darstellen, wie sie selbst bei Wahlen mitbestimmen können, wenn sie alt genug sind. … refl ektieren, warum es wichtig ist, zur Wahl zu gehen und Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. … beschreiben, wie sich das Wahlrecht in Österreich von früher bis heute entwickelt hat. … erklären, wer früher wählen durfte und warum sich das im Laufe der Zeit verändert hat.
… Beispiele nennen, wie bestimmte Gruppen –wie Frauen oder Menschen ohne Besitz –um ihr Wahlrecht kämpfen mussten.
… beurteilen, warum ein allgemeines, gleiches Wahlrecht für alle Menschen so wichtig für die Demokratie ist.
… Wahlplakate genau betrachten und die wichtigsten Aussagen erkennen.
… beschreiben, mit welchen Farben, Bildern und Schlagworten Parteien auf Plakaten werben.
… analysieren, welche Wirkung ein Wahlplakat auf die Wählerinnen und Wähler haben soll.
… bewerten, wie glaubwürdig und überzeugend sie ein Wahlplakat fi nden.
… erklären, warum Parteien Wahlwerbung machen und welche Ziele sie damit verfolgen.
… verschiedene Formen von Wahlwerbung (z. B. Plakate, Videos, Social Media) nennen und ihre Wirkung vergleichen.
… untersuchen, mit welchen Strategien Parteien versuchen, Menschen zu überzeugen.
… beurteilen, welche Art von Wahlwerbung sie persönlich als glaubwürdig oder weniger glaubwürdig empfi nden.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
NAME:
Verlag
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
DATUM:
Und sie bewegt sich doch!
Stell dir vor, du lebst zur Zeit von Galileo Galilei! Schreibe einen kurzen Tagebucheintrag aus der Sicht einer Unterstützerin oder eines Unterstützers bzw. einer Kritikerin oder eines Kritikers von Galileo! Versuche, deine Gedanken und Gefühle glaubwürdig darzustellen!
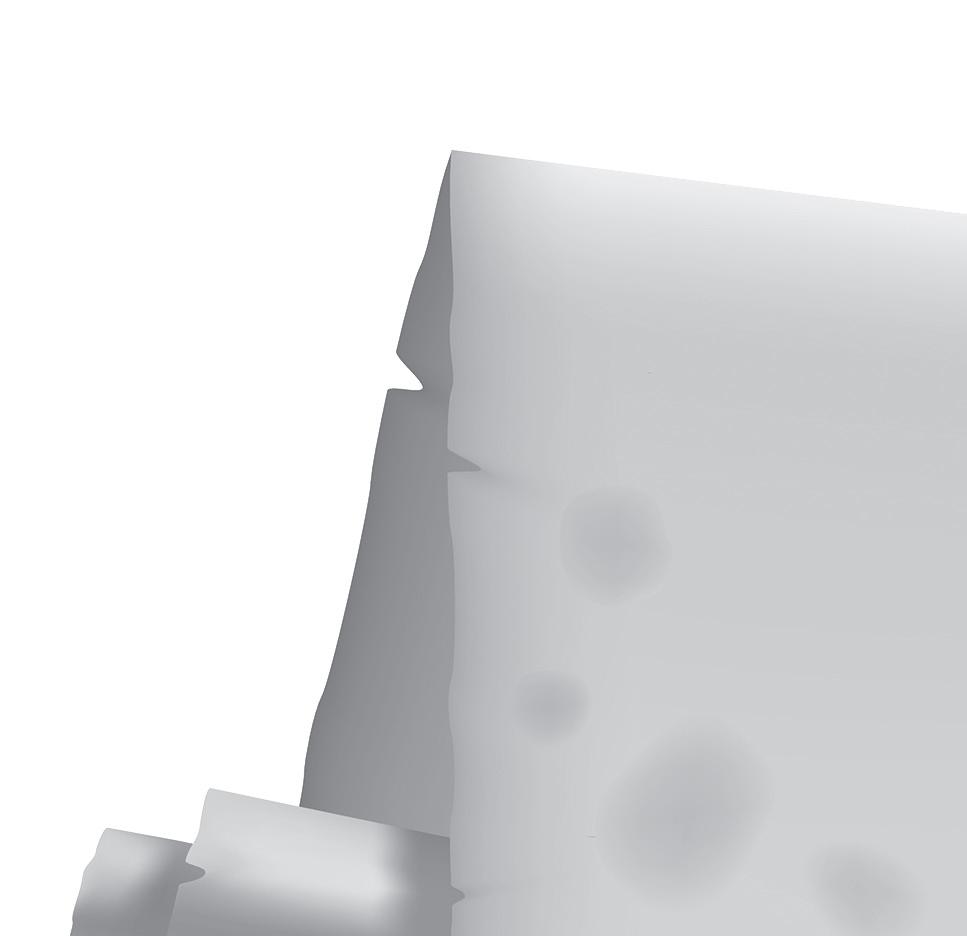


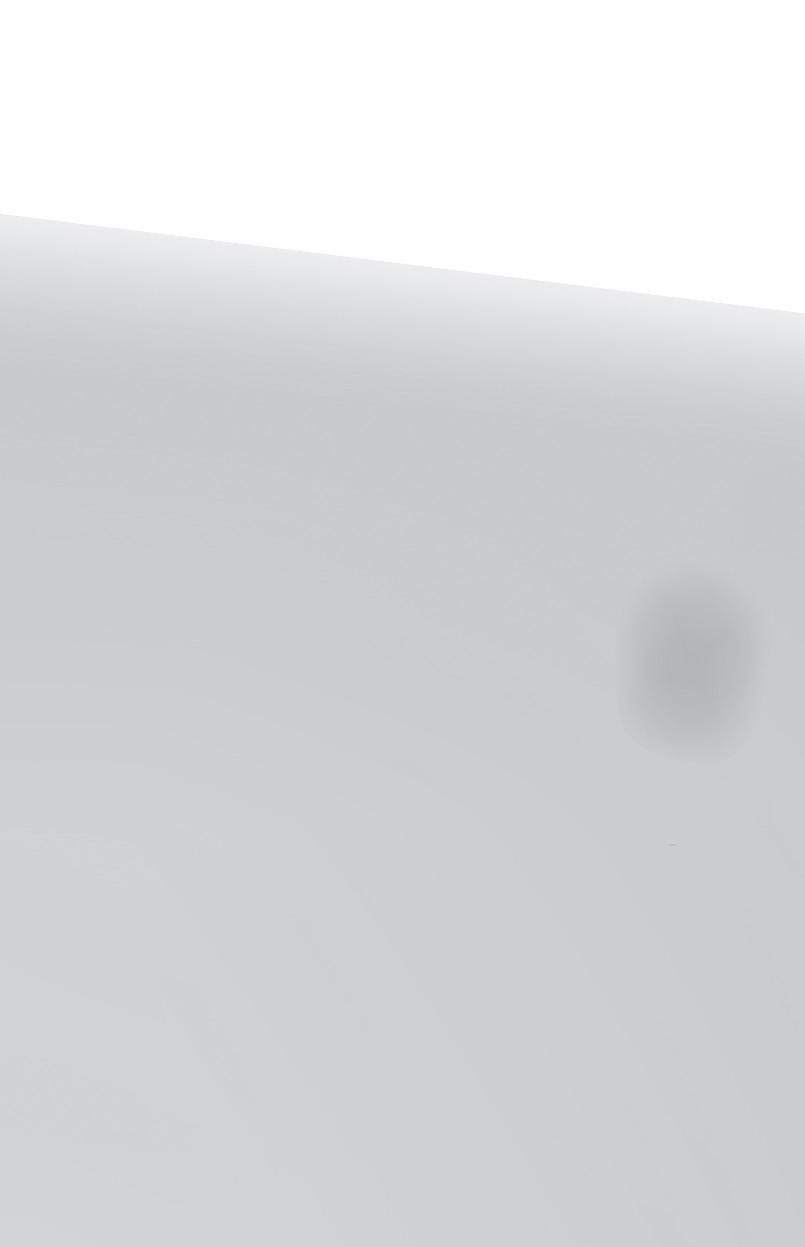









Olympe Verlag












Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
Rätsel: Der verrückte Kaufmann – Auf der Spur der Schokolade
Stell dir vor, du reist zurück in das 17. Jahrhundert nach Venedig!
Dort sitzt ein bekannter Kaufmann namens Giovanni di Rossi in seinem kleinen, aber prunkvollen Handelshaus am Markusplatz. Er ist bekannt dafür, die besten Gewürze, Stoffe und Lebensmittel aus aller Welt zu verkaufen.
Doch heute erzählt Giovanni eine seltsame Geschichte. Er behauptet, er habe ein ganz besonderes Produkt entdeckt: die erste Tafel Schokolade der Welt. Viele Menschen im Laden sind begeistert –doch einige glauben, dass Giovanni die Geschichte erfunden hat, um mehr zu verkaufen. Giovanni gibt dir vier verschiedene Hinweise, woher er die Schokolade angeblich bekommen hat. Nur ein Hinweis kann stimmen.
Hier sind die vier Hinweise von Giovanni:
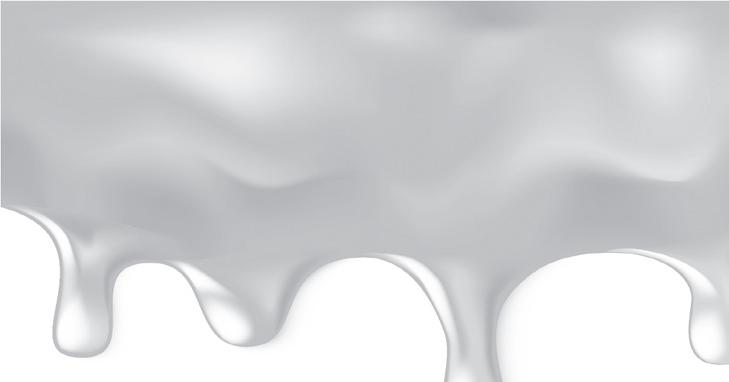
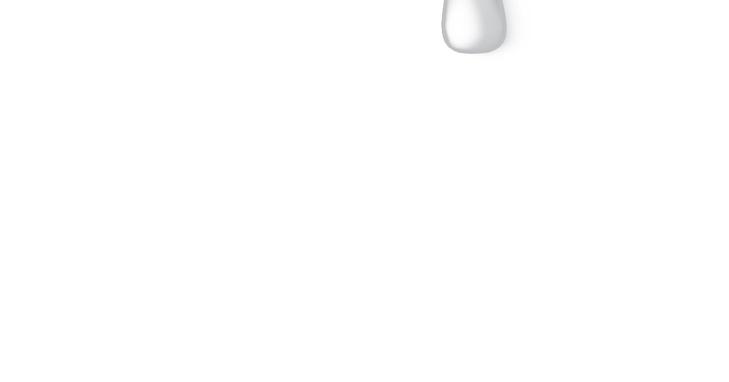

Verlag

1. Hinweis A: „Ich habe die Schokolade von Marco Polo, der sie von einer langen Reise aus China mitgebracht hat. Dort trinken die Menschen schon seit Jahrhunderten heiße Schokolade.“
2. Hinweis B: „Ich habe die Schokolade von Seeleuten, die mit einem großen Schiff aus Amerika zurückgekommen sind. Dort trinken die Menschen ein bitteres Getränk aus Kakaobohnen.“
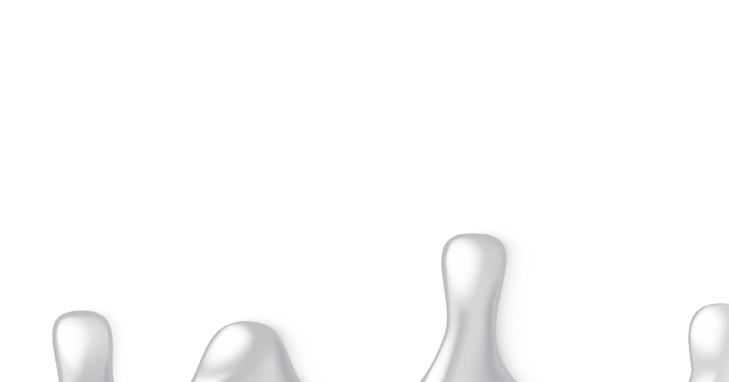
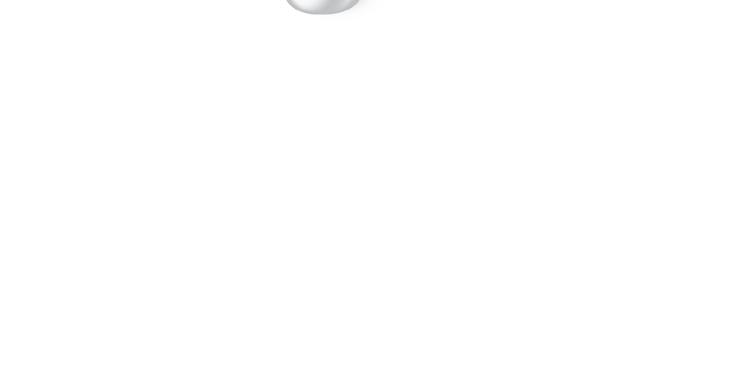
3. Hinweis C: „Ich habe die Schokolade von einem alten römischen Kaiser geerbt. Schon die Römer liebten Schokolade und verteilten sie bei Festen.“


4. Hinweis D: „Ich habe die Schokolade selbst auf einem Baum am Mittelmeer entdeckt. Dort wachsen die süßen Kakaobohnen direkt neben den Orangen.“




Dein Auftrag: Markiere den Hinweis, der richtig sein kann! Begründe deine Entscheidung in 2–3 Sätzen! Erkläre, warum die anderen Hinweise nicht stimmen!
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
Gehirnjogging
Dieses Rätsel ist schon ausgefüllt! Allerdings sind die Buchstaben durcheinandergekommen. Setze sie zu sinnvollen Wörtern zusammen und trage sie in das untere Rätsel ein! Tipp: Alle gesuchten Begriffe drehen sich um die Neuzeit!
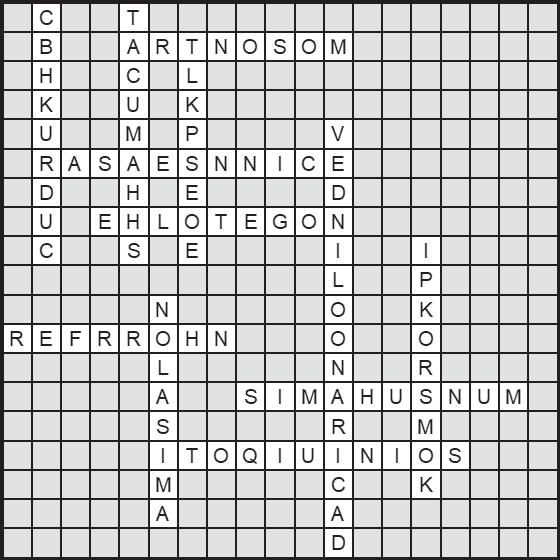



Olympe Verlag






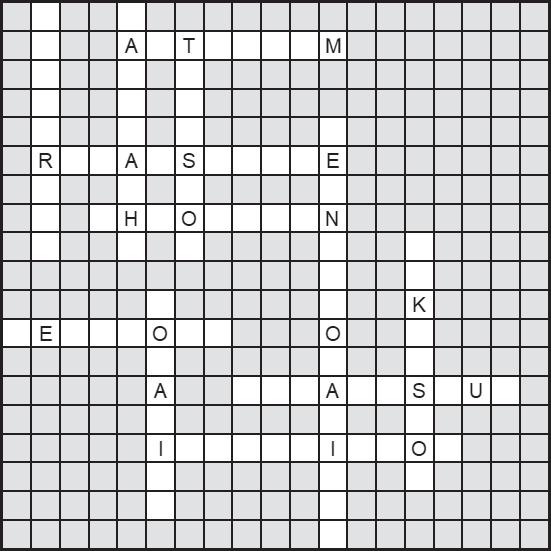
Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
NAME:
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
DATUM:
Leserätsel
Wenn du diese 6 Bücher in die richtige Reihenfolge bringst, erhältst du einen Text über eine Erfindung am Beginn der Neuzeit. Trage die Zahlen 1 bis 6 in die Kreise ein! Sie geben an, in welcher Reihe der Text zu lesen ist.


Nun schreibe diesen Text auf den Zettel! nutzte beobachtung. Ober äche Ist. größten heute Zwischen dunkle Außerdem die besteht. Entdeckungen Er z. B. Spiegel, ganze erfand p ücker, auch einen bers. der Fernrohr fest, rau er Jupiters, Galileischen 1611 der Galilei unzähligen vielen auch von von Licht zu automa kamm, verwenden heutigen
Verlag
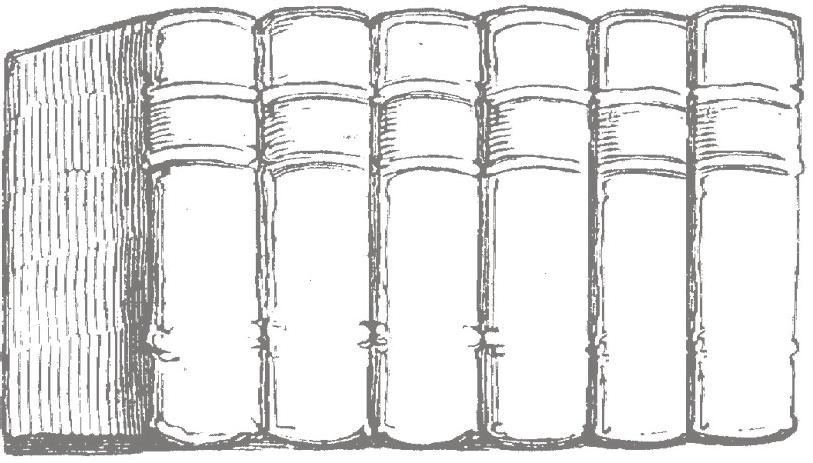
Als Galileo Er des Auch Monde noch 1610 Flecken stellte Milchstraße Neben war zeichnete die um Haus er einen als Vorläufer


ersten zur dass und die die Monde entdeckte Sonnen fest, einzelnen astrono sehr Geräten Kerze durch können. tischen den konnte Kugel einer ein stellte Mondes entdeckte des die und auf Galileo aus seinen Galileo Skizzen Kombination damit leiten einen Taschen Besteck unseres


Menschen Himmels die uneben vier man nennt. er scheibe. dass Sternen mischen er nderisch. wie und das Ebenso Tomaten man und schrei
Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE
OLYMPE Verlag
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
Mona Lisa ganz anders
Male diese Mona Lisa an! Du kannst sie auch ganz modern gestalten!
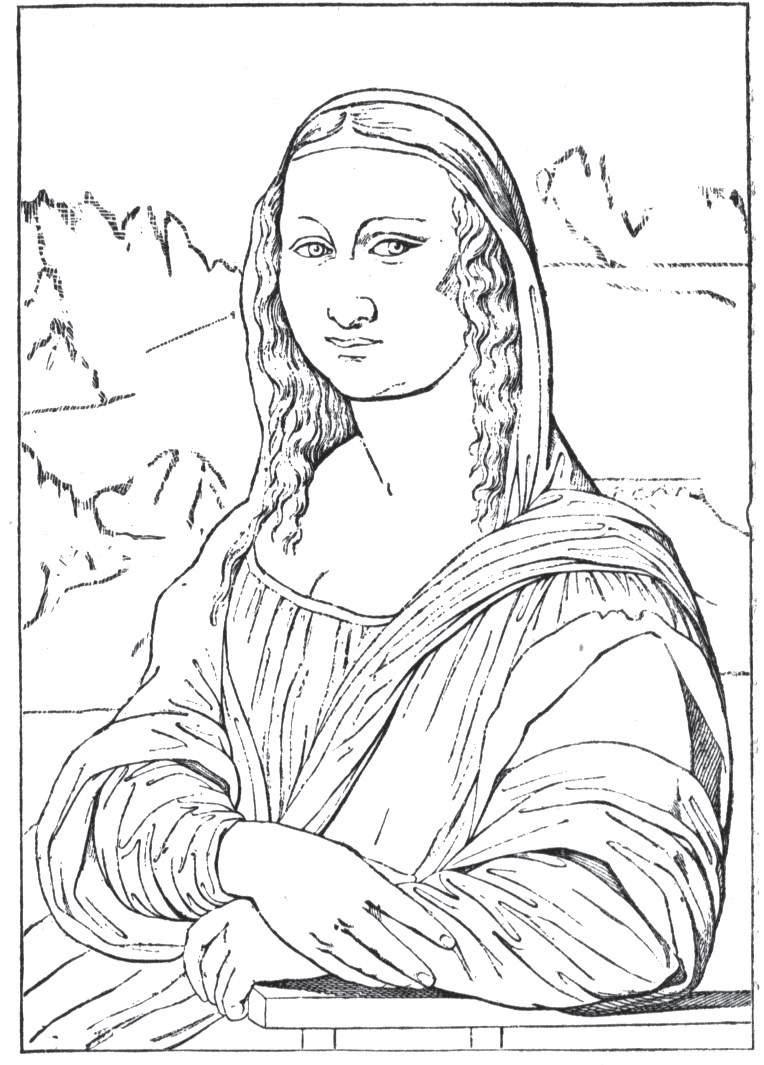
Olympe Verlag
Arbeitsblatt 6 / KOPIERVORLAGE
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
Der Aufstieg der Habsburger
1. Sehr oft tragen Herrscherinnen und Herrscher Beinamen wie Philipp der „Schöne“ und seine Frau Johanna die „Wahnsinnige“. Suche nach einem ähnlichen Beispiel in der Geschichte, von dem du schon in der 2. Klasse gehört hast! Verfasse kurz die Lebensgeschichte dieser Person!
Philipp der „Schöne“

Johanna die „Wahnsinnige“
Als sie das erste Mal Philipp trifft, will sie ihn am selben Tag heiraten. Sie liebt ihn leidenschaftlich und ist sehr eifersüchtig. Als Philipp stirbt, zieht sie monatelang mit dem einbalsamierten Philipp im Sarg durch das Land.
2. Auf dieser Landkarte siehst du alle Gebiete, die die Habsburger durch geschickte Heirats- und Erbpolitik erwarben. Male zuerst das Meer in Blau an und dann die übrigen Gebiete entsprechend der Vorgabe!
Verlag
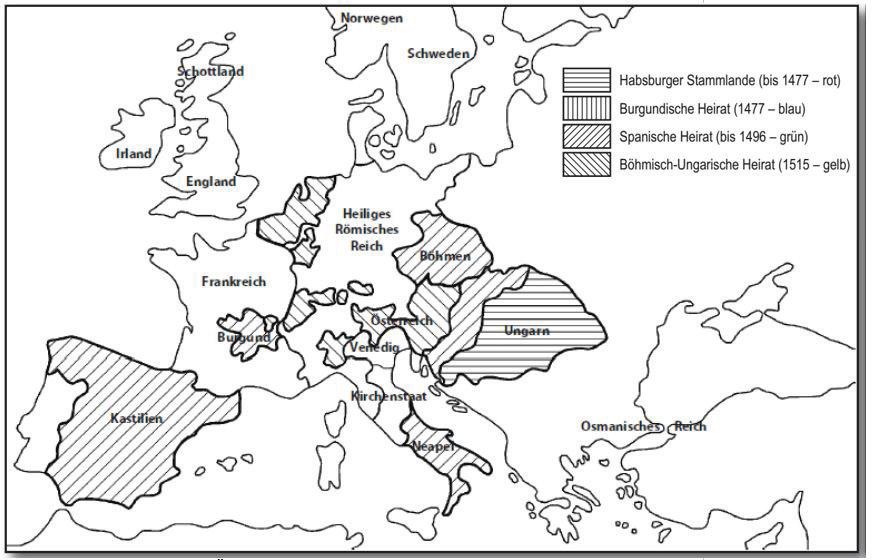
3. Erstelle in deinem Heft eine Übersicht und trage die Länder ein!
Stammlande Burgundische Heirat Spanische Heirat BöhmischUngarische Heirat
Spielvorlage / KOPIERVORLAGE
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
SPIELANLEITUNG:
Geschichte Quiz
Material:
• Overheadprojektor – Spielplan auf OH-Folie
• Spielchips
• Würfel
• Frage- und Antwortbogen
Ablauf:
• Spielplan auflegen
• Klasse in 2 Gruppen teilen
• Gruppe mit der höheren Augenzahl beginnt



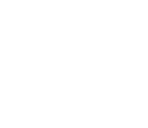









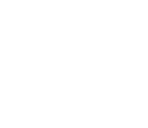






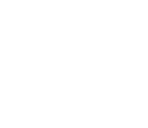









• Gruppe wählt Feld aus; dieses wird mit Chip markiert (die Höhe der Zahl auf dem Spielfeld gibt den Schwierigkeitsgrad an)
• Lehrerin/Lehrer stellt die Frage mit Hilfe des Fragebogens
• bei richtiger Antwort erhält die Gruppe die Punkteanzahl des gewählten Spielfeldes und darf weiterspielen
• bei falscher Antwort geht die Frage an die andere Gruppe
• wenn die Gruppe einen Joker wählt, müssen zwei der eigenen Gruppe den Begriff/ Ausspruch darstellen - der Joker zählt 10 000 Punkte
• wird der Begriff nicht erraten, geht er an die andere Gruppe weiter
• gewonnen hat jene Gruppen mit der höchsten Punkteanzahl
Olympe Verlag
Spielvorlage / KOPIERVORLAGE
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
Wer weiß am meisten?
Reformation Gegenreformation









Calvinismus und Anglikanismus
Dreißigjähriger Krieg
100 1000 5000
100 200 200









5000 500 100 Olympe
500 5000 100 500






200 500 1000












Spielvorlage / KOPIERVORLAGE
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
Frage- und Antwortbogen
Reformation Gegenreformation






100
F: Wie hieß der bedeutendste Reformer jener Zeit?
A: Martin Luther
100
F: Wie erneuert sich die katholische Kirche?
A: von innen her
200
F: Welcher neue Orden wurde gegründet?
A: Jesuiten
Calvinismus und Anglikanismus Dreißigjähriger Krieg
1000
F: Wer ist bis heute das Oberhaupt der Anglikanischen Hochkirche?
A: Die Königin oder der König von England
200
F: Warum gründete der englische König Heinrich VIII. eine eigene Kirche?
5000
F: Welche beiden Staaten wurden nach dem Westfälischen Frieden selbstständig?
A: Schweiz u. Niederlande






Ablasshandel Prager Fenstersturz
500
F: Wie viele Thesen veröffentlichte Luther 1715?
A: 95
200
F: Für welche Kirche brauchte der Papst viel Geld?
A: Petersdom
5000
F: Wo und wann wurde der Religionsfriede mit den Protestanten geschlossen?
A: Augsburg - 1555
5000
F: Auf welchem Konzil wurde die Gegenreformation eingeleitet?
A: Trient






500
F: Welches Gericht wurde in Rom eingerichtet?
A: Inquisition
A: Weil der Papst ihm die Auflösung seiner Ehe verweigerte.
100
F: Wer begründete im 16. Jahrhundert den Calvinismus?
A: Johannes Calvin in der Schweiz
500
F: Welche Tugenden sind im Calvinismus besonders wichtig?
A: Fleiß und Pflichterfüllung






Anglikanische Hochkirche
500
F: Wer war der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee?
A: Wallenstein
1000
F: Wie hießen die beiden Bündnisse der Protestanten und der Katholiken?
A: Union und Liga
100
F: Welches Ereignis löste den 30-jährigen Krieg aus?
A: Prager Fenstersturz
Arbeitsblatt 7 / KOPIERVORLAGE
NAME:
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
DATUM:
Alles Liebe
Versuche zuerst, dieses alte Liebesgedicht zu lesen, dann übertrage es auf die alte Postkarte!

Die Liebe lehrt
Mich lieblich reden, Da Lieblichkeit Mich lieben lehrte.
Arm bin ich nicht In Deinen Armen, Umarmst du mich Du süße Armut.
Wie reich bin ich In Deinem Reiche, Der Liebe Reichtum Reichst du mir.
Olympe Verlag
O Lieblichkeit! O reiche Armut! Umarme mich In Liebesarmen.
Clemens Brentano 1778 - 1842, deutscher Schriftsteller
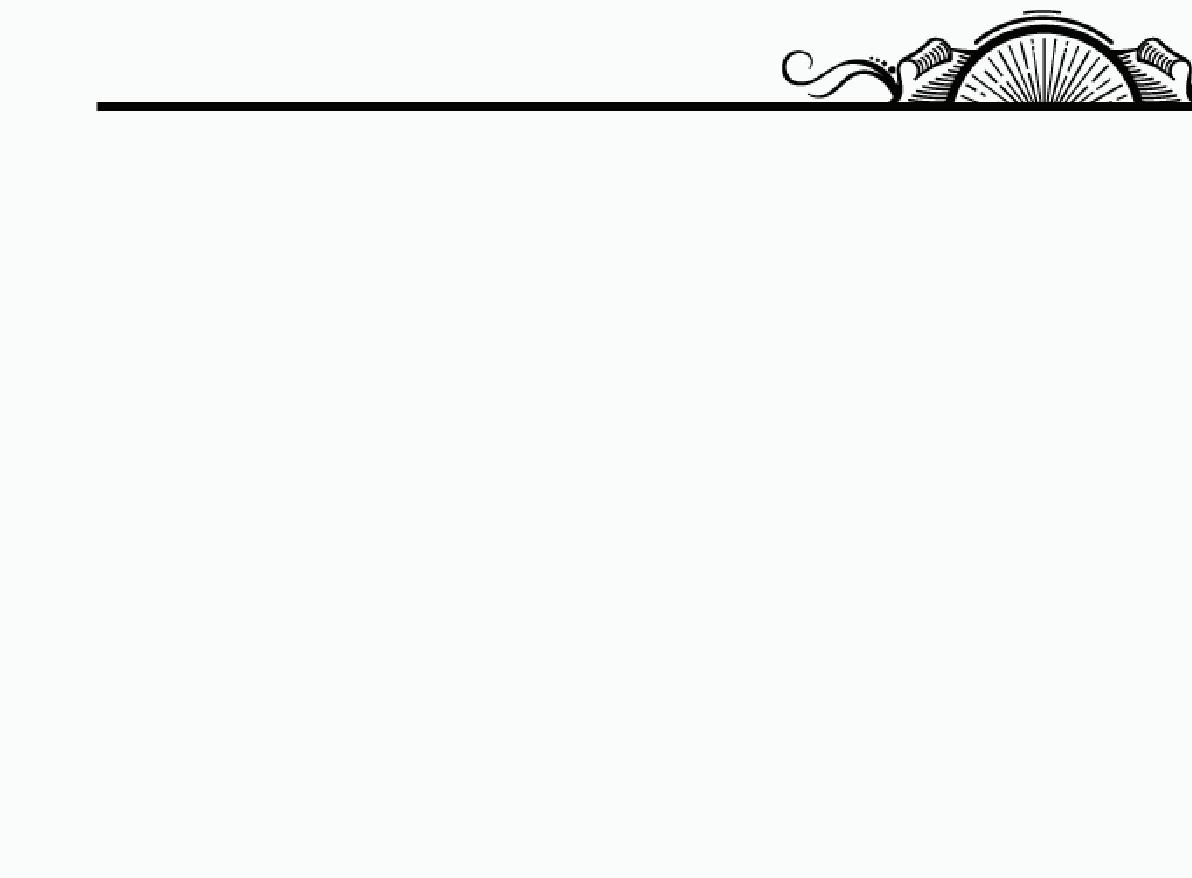
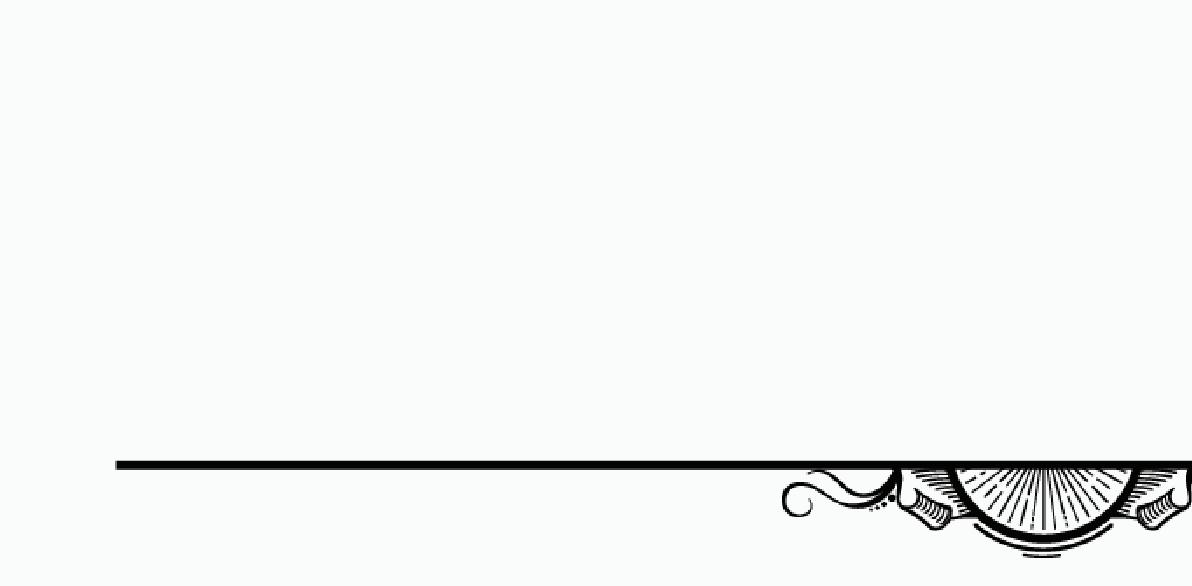

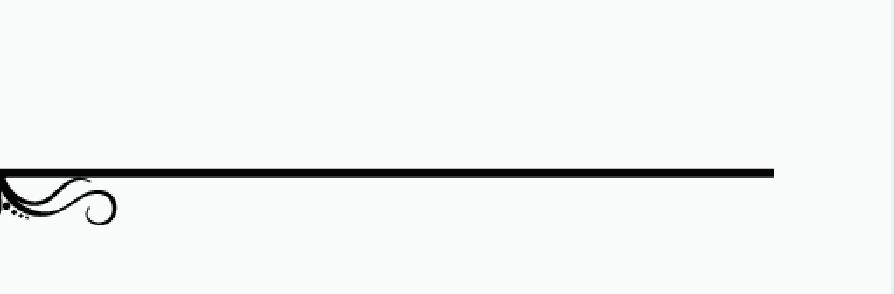
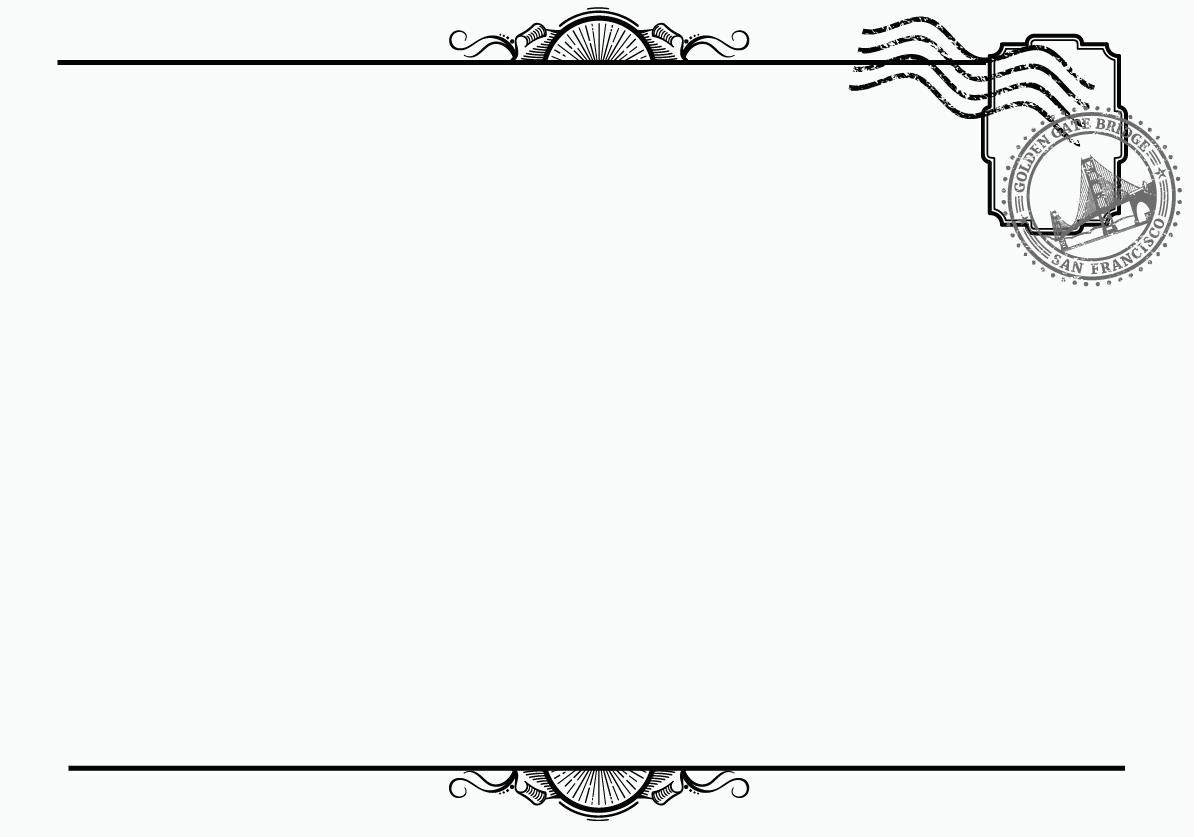
Lernstandserhebung
Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
1. Um welche Weltbilder handelt es sich hier? Schreibe die Namen auf und erkläre sie!
Name:












Erklärung:






























Name:
















Erklärung:




















2. Beantworte folgende Fragen! 4/
Von wem stammt der Ausspruch „Eppur sie muove“?
Übersetze diesen Ausspruch:
Womit beschäftigt sich ein Astronom?
Was ist die Inquisition?
3. Ergänze die Lücken!
Olympe Verlag
7/ Um 1450 erfand Johannes in Mainz den Buchdruck. Der Buchdruck wurde auch genannt. Peter Henlein erfand in Nürnberg die erste . Das Schießpulver kam ursprünglich aus . Bis zur Erfindung des orientierten sich die Seeleute an den Sternen. Mit dem kann man die Planeten und Sterne beobachten. Mit dem konnte man eine 250-fache
Vergrößerung erreichen.
Lernstandserhebung Aspekte neuzeitlicher Kulturen
NAME: DATUM:
4. Nenne 2 berühmte Künstler der Renaissance! 2/ a) b)
5. Durch welche 3 Heiraten vergrößerten die Habsburger ihre Hausmacht? 3/ 1477: 1496: 1515:
6. Wie versuchte die katholische Kirche, mit der Gegenreformation ihre Macht zu sichern? 2/
UNIION
LIGA
7. Nenne jeweils drei Länder, die auf Seiten der Union und drei Länder, die auf Seiten der Liga kämpften! 6/
8. Entscheide, welche Antwort richtig ist! 5/
a) Früher mussten alle jungen Menschen die Partnerin oder den Partner selbst auswählen.
□ stimmt □ stimmt nicht
b) Auch heute dürfen Menschen weltweit immer frei entscheiden, wen sie heiraten.
□ stimmt □ stimmt nicht
c) Früher war es wichtig, dass beide Partner den gleichen Stand hatten.
□ stimmt □ stimmt nicht
d) Heiraten war im Mittelalter und in der Neuzeit auch eine wirtschaftliche Entscheidung der Familien.
□ stimmt □ stimmt nicht
Olympe Verlag
e) Die Kirche hatte früher großen Einfluss darauf, wer heiraten durfte.
□ stimmt □ stimmt nicht
30-33= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
25-29 = du hast dir viel gemerkt
21-24 = du weißt schon einiges
17-20 = du solltest noch viel üben
< 16 = du solltest dir dieses Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
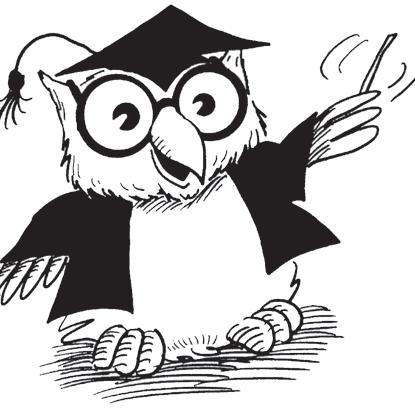
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 43
K.3/S. 11/11
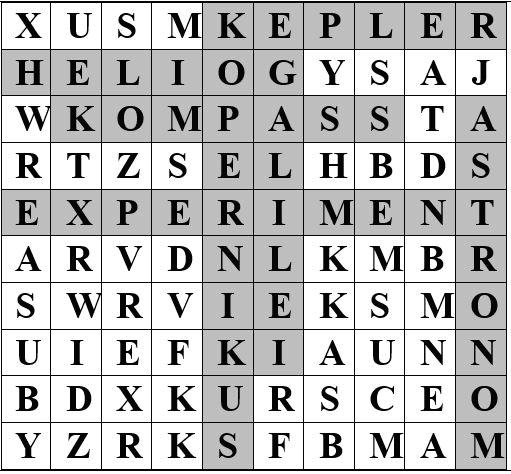
K.3/S. 11/2 1. Bild: Holzfahrrad
• Inhalt: Das Bild zeigt ein Fahrrad ganz aus Holz.
• Thema: Fortbewegung auf zwei Rädern.
• Zweck: Erfindung eines neuen Fahrzeugs.
K. 3/S. 12/3 +4
• Zusammenhang: Im Text steht, dass eine Stange fehlt. Das ist richtig.
• Gestaltung: Das Bild zeigt einfache Linien und große Räder.
2. Bild: Flügel-Anzug
• Inhalt: Ein Mensch trägt Flügel und möchte fliegen.
• Thema: Flugversuch wie ein Vogel.
• Zweck: Erfindung, um das Fliegen zu erforschen.
Verlag
• Zusammenhang: Der Text erklärt, dass diese Idee später wichtig wurde.
• Gestaltung: Das Bild zeigt viele dünne Linien für die Flügel.
3. Bild: Luftschraube / Helikopter-Modell
• Inhalt: Eine Art große Schraube, die sich drehen kann.
• Thema: Fliegen durch Drehung.
• Zweck: Erfindung eines Fluggeräts.
• Zusammenhang: Im Text steht, dass es sich selbst hochziehen soll.
• Gestaltung: Das Bild zeigt zwei gedrehte Flächen.
4. Bild: Fahrzeug mit Zahnrädern
• Inhalt: Ein Wagen mit Rädern und Zahnrädern.
• Thema: Bewegung mit Technik.
• Zweck: Erfindung eines lenkbaren Fahrzeugs.
• Zusammenhang: Im Text steht, dass sich die Räder unterschiedlich drehen.
• Gestaltung: Man sieht viele kleine Teile und Zahnräder.
1. Bild: Mona Lisa von Leonardo da Vinci: Q (Quelle) * Begründung: Dieses Gemälde stammt aus der Zeit der Renaissance. Es ist ein Originalwerk von Leonardo da Vinci und zeigt, wie damals gemalt wurde.
2. Bild: Parlamentsgebäude mit Pallas-Athene-Statue in Wien: D (Darstellung) * Begründung: Das Parlamentsgebäude ist zwar alt, aber das Foto zeigt es aus heutiger Sicht. Es ist also eine moderne Abbildung und keine Quelle aus der Entstehungszeit.
3. Text: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948): Q (Quelle) * Begründung: Der Text stammt direkt aus dem Jahr 1948 und wurde von der UNO veröffentlicht. Er ist eine Quelle aus dieser Zeit, weil er das Originaldokument ist.
4. Text: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: D (Darstellung) * Begründung: Der Text beschreibt die Entstehung und den Inhalt der Menschenrechtserklärung in eigenen Worten. Er ist kein Originaltext von 1948, sondern ein nachträglicher Erklärtext, der informiert und zusammenfasst. Deshalb handelt es sich um eine Darstellung und nicht um eine Quelle.
5. Bild: Mehrfache bunte Mona Lisa von Andy Warhol: D (Darstellung) * Begründung: Dieses Bild wurde viele Jahre später von Andy Warhol gestaltet. Es zeigt die Mona Lisa in neuem Stil und ist keine Quelle aus der Renaissance, sondern eine künstlerische Darstellung.
6. Bild: Ruine des Parthenons in Athen: D (Darstellung) * Begründung: Der Tempel stammt aus der Antike, aber das Foto wurde heute gemacht. Es ist also eine Darstellung aus der heutigen Zeit.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 43
K. 4/S. 18/1
A. Sichtbare Elemente auf dem Bild: Barett (Hut aus Samt) * Schaube (Überrock aus Pelz) * Dolch * Jacke mit langen Ärmeln * Strümpfe * Goldkette * Ringe * Ordenskette * Schnallenband am Knie
B. Symbole der Herrschaft: Schaube (edle Kleidung zeigt Reichtum und Macht) * Dolch (Waffe, Zeichen von Macht und Wehrhaftigkeit) * Goldkette und Ordenskette (zeigen Reichtum und Rang) * Ringe (zeigen Wohlstand und Status)
C. Eigenschaften des Herrschers: stolz * bestimmt * imposant
D. Wichtige Fragen zur Bildanalyse: 1) Lebten Künstler und dargestellte Person zur gleichen Zeit? * 2) An wen richtet sich das Bild? * 3) Wer könnte die Auftraggeberin oder der Auftraggeber gewesen sein? * 4) Was wurde mit der Darstellung bezweckt? * 5) Wofür wurde das Bild verwendet?
K. 4/S. 18/2 Quelle * Begründung: Dieses Gemälde wurde im Jahr 1537 vom zeitgenössischen Künstler Hans Holbein dem Jüngeren gemalt, der damals am Hof von Heinrich VIII. lebte und arbeitete. Das Bild wurde zu Lebzeiten des Königs erstellt und zeigt, wie er sich selbst darstellen wollte. Es ist also ein Original aus der Zeit des dargestellten Herrschers und somit eine Quelle.
K. 4/S. 19/4 Bedürfnisbefriedigung * Arbeitszeit * Freizeit * Verschwendung und Luxus
K. 5/S. 22/1 „Wie jämmerlich stehen nun die großen Städte […] verbrannt, zerfallen, zerstört.“ * „[…] sie haben sie verbrannt, zu Pferdeställen […] gemacht.“ * „In allen Dörfern sind die Häuser voll Leichname […] vom Hunger und von der Pest erwürgt.“ * „Man wandert bei zehn Meilen und siehet nicht einen Menschen.“
K. 5/S. 22/2 Marlene, das Bauernmädchen: „Ständig müssen meine Mutter und ich Hunger leiden!“ Söldner: „Ich kämpfe für jeden, der mir genügend bezahlt!“
Statthalter Martinitz: „Ich überlebte einen Sturz aus 17 Meter Höhe.“
Bürgermeister Guericke: „Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern und Peinigen gewesen!“ Gustav Adolf von Schweden: „Ich landete mit meinem Heer in Norddeutschland.“
Fürst Wallenstein: „Ich werde des Verrats bezichtigt.“
K. 8/S. 29/5 Vorschlag: Mar Galcerán ist die erste Abgeordnete mit Down-Syndrom in einem Regionalparlament in Spanien und vielleicht in ganz Europa. Sie hat schon 26 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und wurde 2023 gewählt. Ihr Ziel ist es, die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Früher wurde sie in der Schule ausgegrenzt und schlecht behandelt, was sie sehr belastet hat. Sie sagt, dass es noch viel zu tun gibt, damit Menschen mit Behinderungen in Gesundheit, Bildung und Arbeit besser unterstützt werden.
K. 8/S. 29/6 1. „Damals habe ich gemerkt, dass ich anders behandelt wurde. In dieser Zeit hatte ich keine Freunde, sondern Klassenkameraden. Sie sahen mich anders, sie wandten sich von mir ab. Damals habe ich wirklich unter Ablehnung gelitten, und das ist eine Phase, die mich geprägt hat.“
2. „Es gibt noch viel zu tun. In der Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist Behinderung ein Querschnittsthema, das sich auf Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Beschäftigung auswirkt, und es gibt noch viel zu tun.“
K. 8/S. 29/7 Mögliche Lösung: Mar Galcerán zeigt durch ihre Wahl, dass Menschen mit Behinderungen genauso viel leisten können wie alle anderen. Ihre Arbeit beweist, dass sie eine Stimme im Parlament haben und mitentscheiden können.
Sie setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen nicht ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Ihr Einsatz ist ein wichtiges Vorbild für andere Betroffene und ermutigt die Gesellschaft, offener und gerechter zu werden.
Olympe Verlag
Sie macht darauf aufmerksam, dass es noch viele Probleme gibt, zum Beispiel in der Schule, bei der Arbeit und im Gesundheitsbereich. Ihre Leistung hilft, diese Themen sichtbar zu machen und Veränderungen anzustoßen, damit alle Menschen die gleichen Rechte und Chancen haben.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 13 - 24
AB 1 individuelle Lösung
AB 2 Richtige Antwort: Hinweis B – „Ich habe die Schokolade von Seeleuten, die mit einem großen Schiff aus Amerika zurückgekommen sind. Dort trinken die Menschen ein bitteres Getränk aus Kakaobohnen.“
Begründung: Schokolade stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Schon die Maya und Azteken tranken ein bitteres Getränk aus Kakaobohnen. Europäische Seefahrer brachten den Kakao im 16. Jahrhundert nach Europa.
Darum sind die anderen Hinweise falsch:
AB 3
Hinweis A: Marco Polo war zwar in Asien, aber Kakao kommt nicht aus China, sondern aus Amerika.
Hinweis C: Die Römer kannten noch keine Schokolade, weil Kakao erst viele Jahrhunderte später entdeckt wurde.
Hinweis D: Kakaobohnen wachsen nicht am Mittelmeer, sondern in tropischen Ländern wie Mexiko oder Mittelamerika.
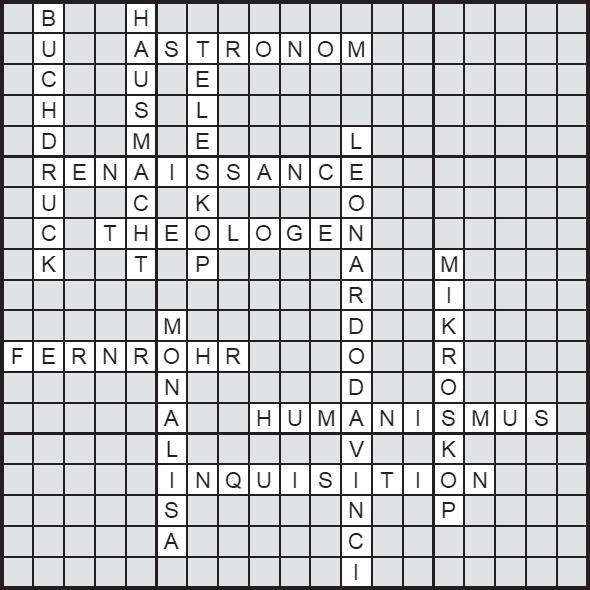
Verlag
AB 4 Als einer der ersten Menschen nutzte Galileo ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Er stellte fest, dass die Oberfläche des Mondes rau und uneben ist. Auch entdeckte er die vier größten Monde des Jupiters, die man heute noch die Galileischen Monde nennt. Zwischen 1610 und 1611 entdeckte er dunkle Flächen auf der Sonnenscheibe. Außerdem stellte Galileo Galilei fest, dass die Milchstraße aus unzähligen einzelnen Sternen besteht. Neben seinen vielen astronomischen Entdeckungen war Galileo auch sehr erfinderisch. Er zeichnete Skizzen von Geräten wie z. B. die Kombination von Kerze und Spiegel, um damit Licht durch das ganze Haus leiten zu können. Ebenso erfand er einen automatischen Tomatenpflücker, einen Taschenkamm, den man auch als Besteck verwenden konnte und einen Vorläufer unseres heutigen Kugelschreibers.
AB 5 individuelle Lösung
AB 6 1. individuelle Lösung
2. siehe Lehrbuch S. 14
3. Stammlande: Österreich * Schweiz * Slowenien * Italien (teilweise)
Burgundische Heirat: Niederlande * Belgien * Luxemburg * Frankreich (teilweise)
…Spanische Heirat: Spanien * Italien (teilweise)
Böhmisch-Ungarische Heirat: Ungarn (teilweise) * Slowakei * Tschechische Republik * Kroatien (teilweise)
AB 7 Die Liebe lehrt
Mich lieblich reden, Da Lieblichkeit
Mich lieben lehrte. Arm bin ich nicht
In deinen Armen, Umarmst du mich
Du süße Armut.
Wie reich bin ich
In deinem Reiche, Der Liebe Reichtum Reichst du mir.
O Lieblichkeit!
O reiche Armut! Umarme mich
In Liebesarmen.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 13 - 24
Lernstandserhebung
1. links: Geozentrisches Weltbild – Die Sonne dreht sich um die Erde. rechts. Heliozentrisches Weltbild – Die Erde dreht sich um die Sonne.
2. Galileo Galilei * Und sie bewegt sich doch! * beschäftigt sich mit der Stern- und Himmelskunde * kirchliches Gericht
3. Gutenberg * bewegliche * Taschenuhr * China * Galileo Galilei * Mikroskop
4. Leonardo da Vinci * Michelangelo Buonarotti
5. Burgundische Heirat * Spanische Heirat * Böhmisch-Ungarische Heirat
6. Die katholische Kirche wollte mit der Gegenreformation ihre Macht sichern, indem sie die Menschen wieder stärker zum katholischen Glauben zurückführte und neue Klöster, Schulen und Orden gründete. Ein wichtiger Orden waren die Jesuiten, die viele Schulen gründeten und den katholischen Glauben durch Bildung und Mission verbreiteten.
7. Union: Niederlande * Schweden * Dänemark * Frankreich * englische Truppen Liga: Spanien * Bayern * kaiserliche Truppen * Truppen des Papstes
8. a) stimmt nicht * b) stimmt nicht * c) stimmt * d) stimmt * e) stimmt
Verlag
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
Löse dieses Rätsel!
Geld veränderte die Welt
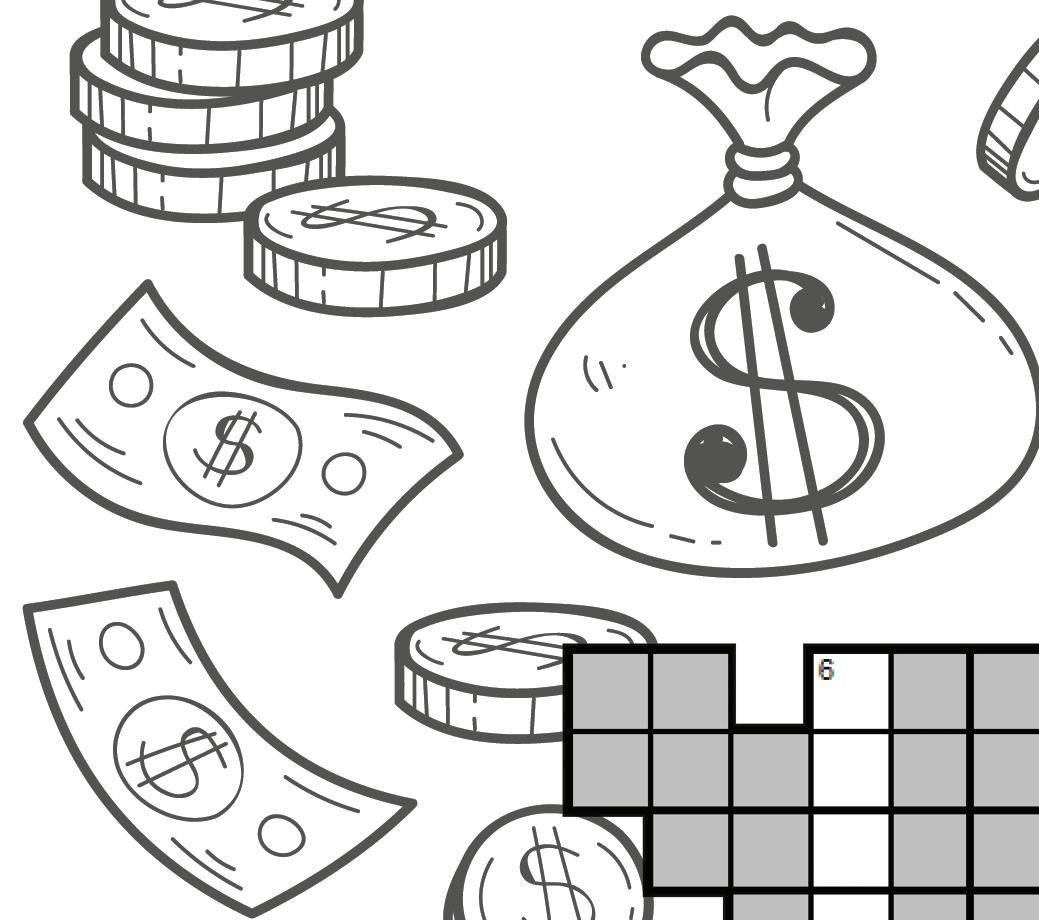
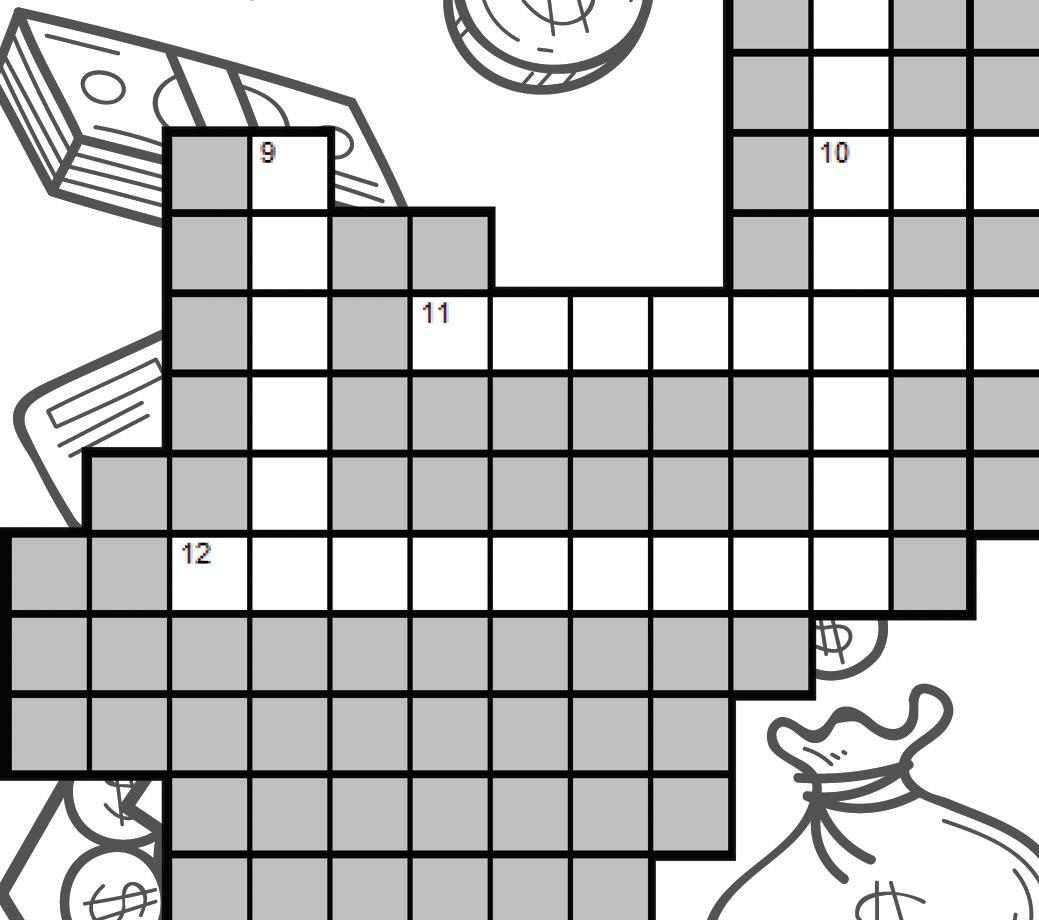
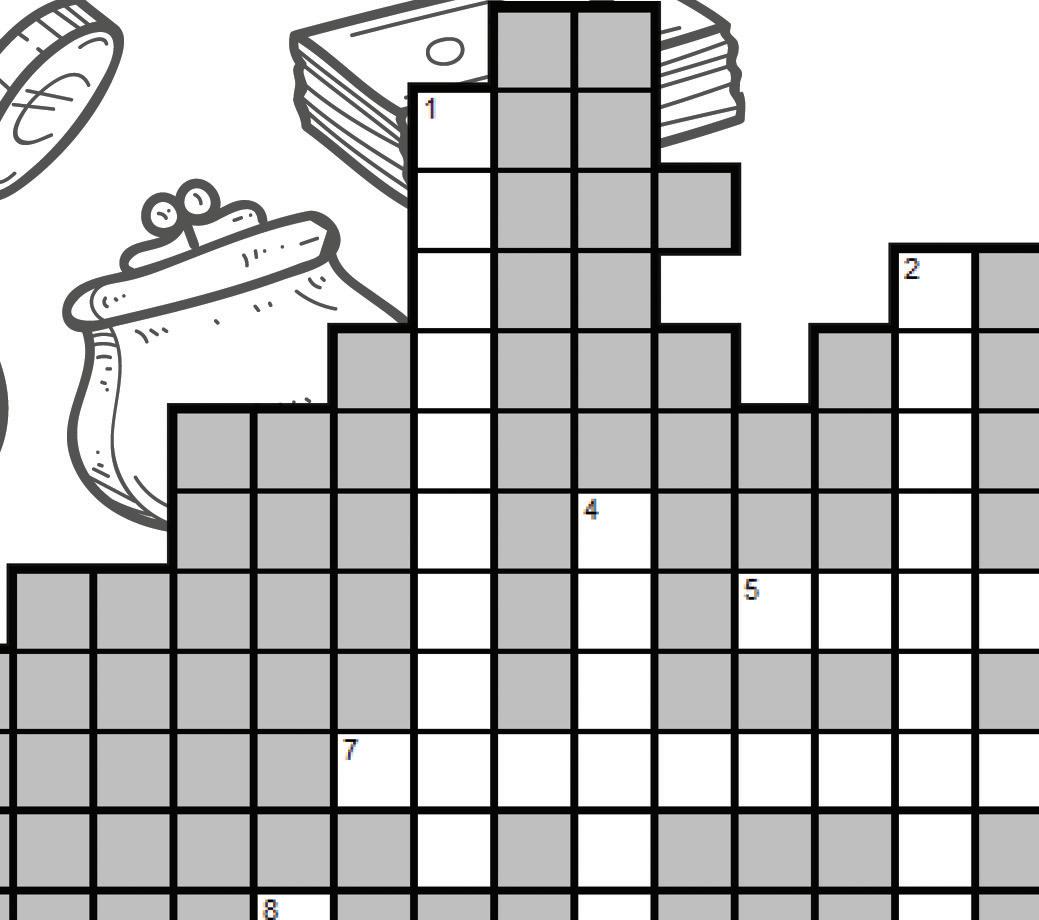

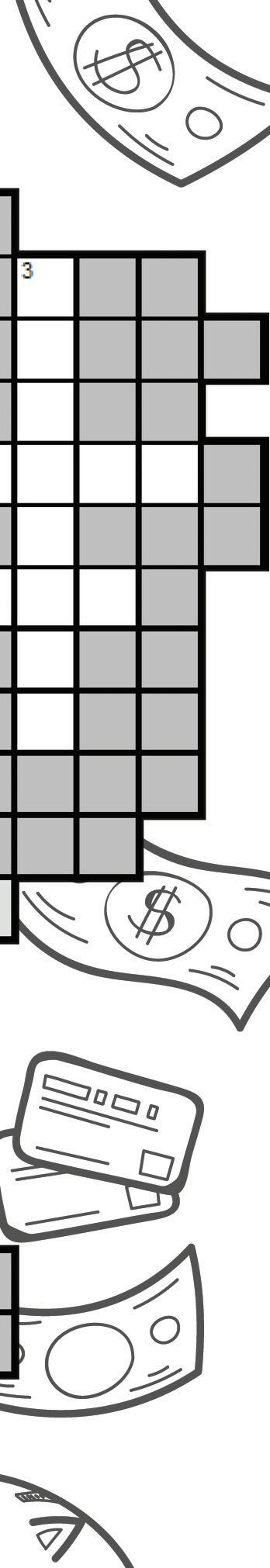

senkrecht:
1. Handel mit weit entfernt liegenden Ländern oder Gebieten
Olympe Verlag
2. gesellschaftliche Gruppe im Mittelalter, zu der Ritter gehörten und die zwischen dem Adel und einfachen Bauern stand
3. in dieser Stadt lebten die Fugger
4. diese löste im Frühkapitalismus die Naturalwirtschaft ab
6. Vorteile, die nur eine bestimmte Personengruppe hat
waagrecht:
5. Gebiete, die jenseits des Meeres, des Ozeans liegen
7. Gesellschaftssystem im Mittelalter, bei dem der König Land an Adelige vergab
10. zu Fuß kämpfender Söldner
11. Wie nennt man das Wirtschaftssystem vor der Industrialisierung, bei dem Händler Materialien an Heimarbeiter gaben und die fertigen Produkte dann verkauften?
12. Bezahlung für die Vermittlung eines Kaufes oder Verkaufes
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
Der Sonnenkönig
1. FRANZÖSISCH FÜR ANFÄNGER! Französisch war zur Zeit des Absolutismus in vielen Ländern die Sprache der Vornehmen. Viele uns bekannte Wörter leiten sich von französischen Begriffen ab. Wähle die passenden Übersetzungen und schreibe die Buchstaben neben den französischen Begriff! Tipp: Verwende dein Wörterbuch und überprüfe dein Ergebnis anhand des Lösungswortes!
____ Taille ____ Perücke ____ Madame
____ Kavalier ____ Armee ____ Restaurant
____ Kompliment ____ Cousin ____ Salon
____ Visite ____ Kostüm ____ Etage
T. Schmeichelei * S. eleganter Wohnraum * A. Körpermitte * L. Heer * O. höflicher Mann * M. ärztlicher Hausbesuch * S. Stockwerk * I. Vetter * U. Essenslokal * B. künstliches Kopfhaar * S. Dame * U. Kleidung für Schauspielerinnen und Schauspieler
LÖSUNGSWORT:
Verlag
2. Du lebst am Hofe Ludwigs XIV. und musst dich natürlich zurechtfinden. Löse dieses Kreuzworträtsel mit allen wichtigen Begriffen!
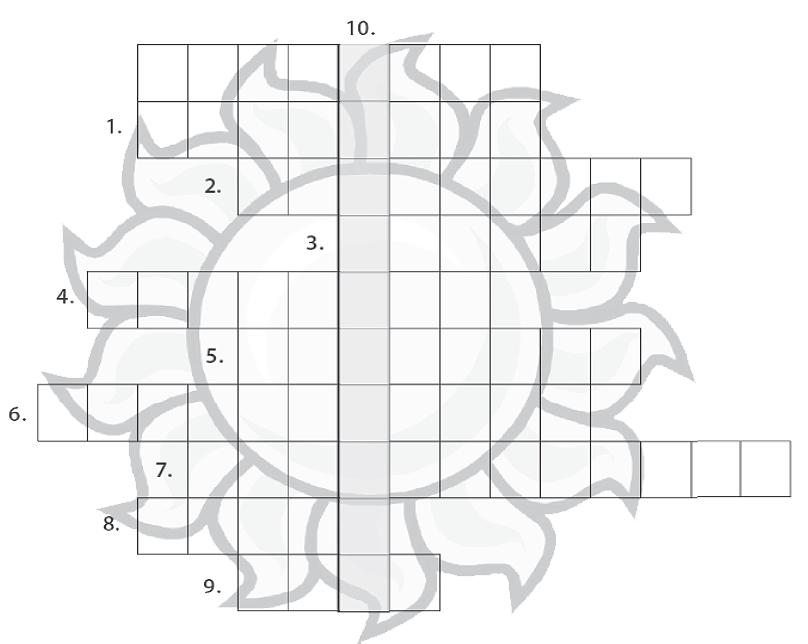
1. Regeln, wie sich die Menschen am Hofe zu verhalten haben
2. feierliche, nach bestimmten Regeln ablaufende Handlung
3. eine Beschäftigung am Nachmittag
4. Adelige, die am Hofe Ludwigs XIV. lebten
5. Was fehlte im Schloss Versailles?
6. ein Element des barocken Baustils
7. gesellschaftlicher Mittelpunkt des Schlosses
8. Symbol des Königs
9. Was konnte mehrere Tage dauern?
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
Der Sonnenkönig
Im Schlosspark von Versailles gibt es Büsche mit wunderschönen Sternblüten. Du fliegst als Schmetterling von Blüte zu Blüte. Den Weg geben dir dabei die richtigen Antworten auf die Fragen vor. Zeichne mit einem Stift deinen Weg von Blüte zu Blüte ein. Wie lautet die richtige Antwort auf die letzte Frage? (ACHTUNG: Es gibt auch falsche Antworten!)



Wie kann der Grundgedanke des Absolutismus beschrieben werden?






• König von Volkes Gnaden!“
• Ludwig XIV.







Die Säulen der absoluten Macht waren:

• „Keiner kommt ihm gleich!“
• Mit 30 Jahren









In welchem Kunststil wurde Schloss Versailles erbaut?




Ein absoluter Herrscher sah sich als:


• Schlossadel
• Weil sie das vornehmste Zeichen darstellt.
Verlag
Mit welchem Alter übernahm Ludwig XIV. die Regierungsgeschäfte?


Die Inschrift auf Ludwigs Fahne heißt übersetzt:
• Ludwig XIII.


• Weil sie das hellste Zeichen darstellt.
• Hofadel


Letzte Antwort:









• Mit 22 Jahren



Warum wählte Ludwig die Sonne als Symbol?
• Barock





• Regierung, Beamte, Adel und Geistlichkeit.
• „Ein König, ein Gesetz, ein Glaube!“







Wer war das Vorbild für andere absolute Herrscher?



• „König von Gottes Gnaden!“
• Regierungschef


In Versailles lebten viele Adelige. Man nannte sie:






Das Volk nannte Ludwig XIV.:
• Finanzminister

• „Ein Staat, ein König, eine Regierung!“




• Sternenkönig



• Sonnenkönig

• Gotik






Jean-Baptiste Colbert war:


• „Keiner kommt ihm nahe!“
• Hof, Verwaltung, Kirche und Heer.



Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
Sonnenkönigspiel - Anleitung
Würfelspiel für 2 – 4 Spielerinnen und Spieler.
Material:
1 Würfel, Spielfiguren und Fragenkärtchen
Spielverlauf:
• Kommt eine Spielerin oder ein Spieler auf ein Feld mit einer Sonne, so stellt ihr/ihm die nächste Spielerin oder der nächste Spieler die Frage des obersten Kärtchens.
• Ist die Antwort richtig, so darf die Spielerin oder der Spieler drei Felder vorziehen, ist sie falsch, muss sie/er drei Felder zurück.
• Kommt eine Spielerin oder ein Spieler auf ein Feld mit einem Ausrufungszeichen, muss sie/er dem Pfeil folgen.
• Landet eine Spielerin oder ein Spieler auf einem Stoppfeld, so muss sie/er einmal aussetzen.
• Sonnenkarten sind Aktionskarten
• Siegerin oder Sieger ist, wer als Erste/Erster das Ziel überschreitet.























































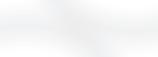
































































































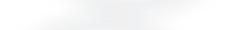





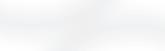




















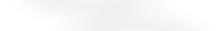























Frage- und Antwortkarten / KOPIERVORLAGE
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
Was heißt Absolutismus?
Welches Schoss ließ Ludwig XIV. erbauen?
Wie hieß der Finanzminister Ludwigs XIV.?
Welche Religion war in Frankreich Staatsreligion?
Was ist ein stehendes Heer? Was sind Memoiren
Was sind Manufakturen?
In welchem Baustil wurde Schloss Schönbrunn erbaut?
Wer schrieb von der Arbeitsteilung?
Welcher Raum war der Mittelpunkt des Schlosses Versailles?
In welchem Baustil wurde Versailles erbaut? Was ist Etikette?
Was ist eine Zeremonie?
Wer gehörte zum 3. Stand?
Welches Symbol wählte Ludwig XIV.?
Wer gehörte zum 2. Stand?
Wen setzte Ludwig zur Verwaltung seines Staates ein?
Wie hieß das von Colbert eingeführte Wirtschaftssystem?
Wer gehörte zum 1. Stand?
Was waren die Säulen der absoluten Macht? Was sind Zölle?
Frage- und Antwortkarten / KOPIERVORLAGE
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
Katholische Religion Jean Baptiste Colbert
Du warst Gast auf einem rauschenden Fest - zur Erholung eine Runde aussetzen
Aufzeichnungen
über das eigene Leben
Genaue Regeln, wie man sich am Königshof verhält Barock
Du verlierst dein ganzes Geld beim Kartenspiel3 Felder zurück
Merkantilismus
Mache einen Hofknicks vor deinen Spielpartnerinnen und Spielpartnern
Unumschränkte Herrschaft einer oder eines Einzelen
Verlag
feierliche, nach bestimmten Regeln ablaufende Handlung
Im Theater bist du eingeschlafen1 Runde aussetzen
Geistlichkeit Beamte
Abgaben für Waren an der Greze
Hof, Verwaltung, Kirche, Heer
Berufssoldaten, die dem König auch im Frieden dienen Versailles
Großbetriebe, wo in Handarbeit gearbeitet wird
Du darfst mit dem König auf die Jagd2 Felder vor
Das Schlafzimmer Barock
Sonne Adam Smith
Du musst dem König ein Lied vorsingen!
Bürger, Bauern, Lohnarbeiter
Adel
Du must allen Damen die Hand küssen!
Lernstandserhebung
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
1. Nenne zwei Beispiele für neue Berufe oder Tätigkeiten, die im Frühkapitalismus entstanden sind! 2/
2. Warum war der Seehandel im Frühkapitalismus so wichtig für die Kaufleute? 2/

3. Wer ist das? 6/

Wie hieß dieser König?
Welches Land regierte er?
Wann lebte er?
Welches Schloss baute er?
Was war sein Symbol?
Wie nannte ihn das Volk?
4. Was stimmt hier nicht? Streiche durch und schreibe das richtige Wort darüber! 3/
Der König war zugleich Gesetzgeber, militärischer Oberbefehlshaber und Kardinal. Ludwig XIV. war König von Volkes Gnaden. Der König, seine Familie und viele Bürger lebten in prachtvollen Schlössern.
5. Vervollständige folgende Aussagen. Die Wörter im Kästchen helfen dir. 4/ Der Staat
Kleiner als Gott -
Keiner kommt
Olympe Verlag
Wer als Untertan geboren ist, hat
als * ich * gleich * hat * der * Erdball * zu * gehorchen * ihm * bin * aber * größer * willenlos
Lernstandserhebung
Die Neuzeit bringt Veränderung
NAME: DATUM:
6. Nenne die vier Säulen der absoluten Macht: 4/

7. Setze die Sätze fort, indem du die richtige Antwort ankreuzt! 4/
a) Geistliche und Adelige waren von der Steuer befreit wahlberechtigt arm.
b) Viele Adelige lebten … in kleinen Häusern in den Städten am Hofe des Königs.
c) Der Adel war der 1. Stand 2. Stand 3. Stand.
d) Die Mehrheit der Bevölkerung waren … Adelige Bauern Handwerker.
8. Ordne zu, indem du die Zahlen richtig einsetzt! 7/
1 Jean-Baptiste Colbert
2 Merkantilismus
3 Manufaktur
4 Zölle
5 Absolutismus
6 Fugger
7 Arbeitsteilung
Olympe Verlag
Großbetrieb, in dem Waren in Handarbeit hergestellt werden
Abgaben, die beim Transport von Waren über Staatsgrenzen eingehoben werden
Staatsform, bei der der König alles bestimmt
Wirtschaftssystem im Absolutismus
Finanzminister Ludwigs XIV.
Bekannteste Handelsfamilie im Frühkapitalismus
Jeder Arbeiter macht nur einen Teil eines Werkstückes.
29-32= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
25-28 = du hast dir viel gemerkt
20-24 = du weißt schon einiges
16-19 = du solltest noch viel üben
< 16 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
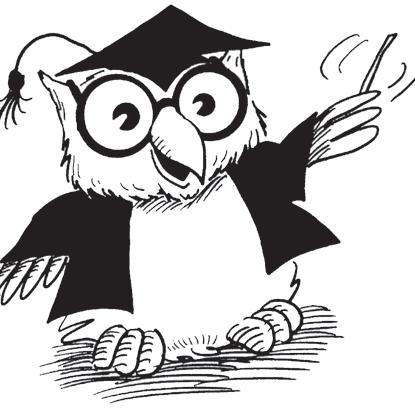
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 44
K 1/S. 32/2
mögliche Lösung: 1. Schritt: Beide Texte erzählen über historische Ereignisse und Personen, ohne selbst Zeitzeugen zu sein. * Sie verwenden Fachbegriffe wie „Handelshaus“, „Faktoreien“, „Monopol“, „Verlagswesen“, „Schürfrechte“. * Sie beschreiben Zusammenhänge und Entwicklungen über einen längeren Zeitraum. * Beide nennen Quellenangaben mit Autor, Titel und Jahr. * Beide erklären die Bedeutung der Fugger im Handel, in der Politik und für die Wirtschaft.
2. Schritt:
Merkmale
Ziel
Lexikontext
Schulbuchtext
Kurze, sachliche Faktenübersicht Verständliche Erzählung mit Zusammenhängen
Sprache Fachlich, nüchtern, dicht Anschaulich, einfacher zu verstehen
Schwerpunkt
Betonung auf Daten, Ereignissen, wirtschaftlichem Einfluss
Leserinnen und Leser Eher für Erwachsene / Fachpublikum
3. Schritt:
Betonung auf Familiengeschichte, persönlichem Werdegang
Für Schülerinnen und Schüler / Jugendliche
Formulierungen „Faktoreien, Agenturen, Reichspolitik“ „silberne Fäden“, „aufwändiges Leben“, „Reichtum und Ansehen“
Lexikontext: Die Fugger werden als wirtschaftlich mächtig und politisch einflussreich dargestellt. * Sie nutzten ihre finanzielle Macht, um Politik zu beeinflussen (z.B. durch die Wahl von Karl V.). Schulbuchtext: Die Fugger werden als erfolgreiche Kaufleute, aber auch als Profiteure der Geldnot der Herrscher gezeigt. * Sie profitierten von Luxuswünschen und Kriegen der Fürsten und sicherten sich Minenrechte als Gegenleistung.
K.1/S. 32/4 mögliche Lösung: Lexikontext: Betonung der wirtschaftlichen Weltgeltung und des Einflusses auf höchste politische Entscheidungen (z.B. Kaiserwahl).
Schulbuchtext: Betonung der gegenseitigen Abhängigkeit von Wirtschaft und Politik sowie der Rolle der Fugger als Kreditgeber für verschuldete Herrscher.
K. 1/S. 32/5 mögliche Lösung:
Erzählstruktur
Einstieg
Lexikon-Darstellung
Sachlich, kurz und faktenorientiert, typische Lexikon-Form
Startet mit der Familiengeschichte ab Jakob I. († 1469)
Schwerpunkt Wirtschaft Fokus auf Welthandel, Kupfermonopol, Überseehandel, Ablasshandel
Schwerpunkt Politik Konzentriert auf Finanzierung von Maximilian I. und Karl V.
Persönliche Ebene (z.B. Ausbildung, Familie)
Sprachstil
Olympe Verlag
Wenig persönliche Details, eher wirtschaftliche und politische Machtstellung
Knappe, dichte Fachsprache, viele Fachbegriffe und Aufzählungen
Schulbuch-Darstellung
Erzählend und bildhaft, personenbezogen, für Schülerinnen und Schüler leichter nachvollziehbar
Erzählt vom Weber Hans Fugger (1367) als Ursprung des Aufstiegs
Schwerpunkt auf Handel mit Textilien, Metallen, Gewürzen und Schürfrechten als Sicherheiten
Betonung der Abhängigkeit der Fürsten vom Geld der Fugger und des luxuriösen Lebensstils der Herrscher
Mehr persönliche Erzählung über Ausbildung in Italien, Firmenübernahme und familiären Aufstieg
Anschauliche Sprache, Bilder wie „silberne Fäden“, alltagsnahe Formulierungen
Zielpublikum
Wissensvermittlung für Fachpublikum oder Erwachsene
Verständliche Einführung für Schülerinnen und Schüler mit Fokus auf Motivation und Nachvollziehbarkeit
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 44
K. 4/S. 38/1
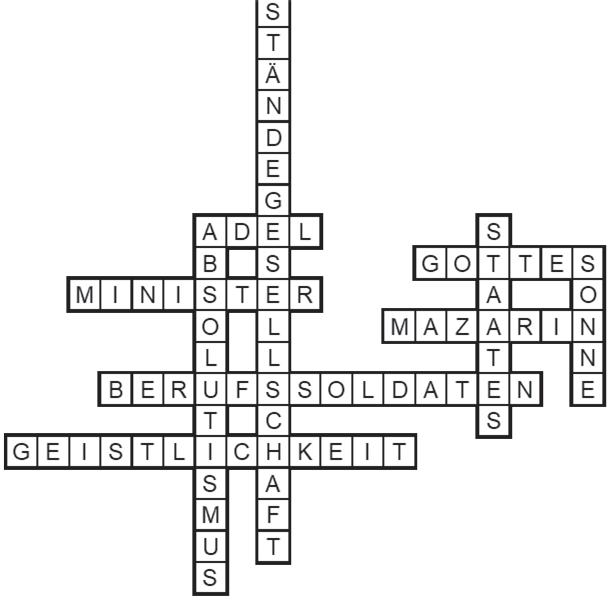
K. 4/S. 38/2 Lohnarbeiter: Wir leben in der Stadt und werden ausgebeutet. * Bauern: Wir liefern alle Nahrungsmittel und haben trotzdem Hunger. * Bürger: Wir sind gebildet, haben im Staat aber keine Macht. * Geistlichkeit: Wir sind die Vertreter der einzigen Religion im Staat. * Hofadel: Wir leben im Schloss des Königs und haben alles im Überfluss. * König: Der Staat bin ich!
Verlag
K. 4/S. 39/4 mögliche Lösung: Der französische Schriftsteller Montesquieu beschreibt 1717, wie wechselhaft und launenhaft die Pariser Mode ist. Die Menschen vergessen schnell, was gerade in Mode war, und wissen nicht, was sie als Nächstes tragen sollen. Besonders aufwendig und teuer sei es für einen Mann, wenn seine Frau immer das Neueste tragen will. Es wäre sinnlos, die Mode genau zu beschreiben, da sie sich ohnehin ständig ändere.
Montesquieu vergleicht die schnellen Modewechsel mit den Verhaltensweisen der Menschen. Auch die Sitten und Gebräuche ändern sich oft – vor allem abhängig vom König. Dessen Charakter beeinflusst den Hof, der Hof beeinflusst die Stadt, und die Stadt beeinflusst schließlich das ganze Land. Am Ende passen sich alle der Art des Herrschers an.
K. 4/S. 39/5 mögliche Lösung: Montesquieu stellt die Beziehung zwischen dem König und seinem Land als eine Art Kettenreaktion dar.
• Zuerst beeinflusst der König mit seinem Verhalten und seinem Charakter den Hof (also den Kreis von Adeligen und Höflingen um ihn herum).
• Der Hof übernimmt die Art und Weise des Königs und gibt diese an die Stadt, besonders an die feine Gesellschaft in der Hauptstadt, weiter.
• Schließlich verbreitet sich das Verhalten von der Stadt aus in die ganzen Provinzen des Landes. Montesquieu meint, dass die ganze Gesellschaft dem König nacheifert, also seinen Stil, seine Einstellungen und sogar seine Sitten übernimmt. Der Herrscher gibt also den Ton für das ganze Land an – egal, ob dieser Ton ernsthaft, oberflächlich, streng oder verspielt ist.
K. 4/S. 39/6 mögliche Lösung: Der Text von Montesquieu könnte vom König wahrscheinlich eher als gutgemeinte Kritik aufgenommen worden sein, da Montesquieu sehr beobachtend und beschreibend, aber nicht direkt anklagend oder beleidigend schreibt.
Er macht sich eher über die launische Mode und die Anpassungsbereitschaft der Gesellschaft lustig, als den König offen zu beschuldigen. Allerdings deutet er klar an, dass der König sehr großen Einfluss auf das Verhalten des ganzen Landes hat. Damit zeigt er indirekt, wie mächtig und bestimmend der Monarch ist – genau das ist das Prinzip des Absolutismus:
• Der König steht über allen.
• Sein Verhalten und Wille bestimmen das Leben aller Menschen im Staat. Die Quelle passt genau zum System des Absolutismus, weil Montesquieu aufzeigt, wie sich alle nach dem König richten. Er beschreibt damit, wie das Volk abhängig von der Person des Herrschers ist – typisch für den Absolutismus, wo der König als „Sonnenkönig“ oder „Staat in Person“ gesehen wird.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 31 - 44
K. 4/S. 40/7 von links nach rechts: Hofdame * Bäuerin * Bürgerin
K. 4/S. 40/8 mögliche Lösung: Aufwändige Stoffe und Verzierungen: Mehrere Lagen feiner, kostbarer Stoffe wie Samt und Seide. Reiche Verzierung mit Stickereien und Borten. * Unpraktische, übertriebene Kleiderformen: Sehr breiter, ausgestellter Rock mit starren Formen. Langes Kleid, das von Dienern hinterhergetragen werden muss. * Hervorgehobene Körperhaltung und Machtdemonstration: Elegante Haltung mit aufrechtem Rücken und Spazierstock. Die Kleidung zwingt zu einer langsamen, stolzen Bewegung. * Aufwändige Frisur und Accessoires. Hochtoupierte, verzierte Frisur mit Schmuck. Zusätzliche Accessoires wie Spazierstock, Fächer oder Handschuhe.
K. 4/S. 40/9
Mögliche Lösung: Die Mode am Hof war viel mehr als nur Kleidung. Sie zeigte Reichtum, Macht und Rang. Nur Adelige konnten sich so aufwendig und teuer kleiden – das einfache Volk hatte dafür weder Geld noch Anlass.
Die Mode war bewusst unpraktisch:
• Die weiten Kleider, hohen Frisuren und aufwendigen Accessoires erschwerten bewusst die Bewegung.
• Wer so gekleidet war, brauchte Personal, das beim Ankleiden half oder das Kleid hinterhertrug.
• Damit zeigte man: „Ich bin reich und wichtig – ich brauche nicht zu arbeiten.“
• Am Hof von Versailles unter König Ludwig XIV. wurde Mode zu einem Mittel der Kontrolle:
• Wer modern und modisch sein wollte, musste nach Versailles kommen und sich dort zeigen.
• So band der König die Adligen an seinen Hof und verhinderte, dass sie zu Hause Macht ausbauten.
• Mode wurde zum politischen Werkzeug, um Rang und Abhängigkeit sichtbar zu machen.
Verlag
K. 5/S. 43/1 mögliche Lösung: Im Merkantilismus wollte der Staat, dass das Land möglichst viel selbst herstellt und dabei wenig Geld ausgibt. Dafür gab es mehrere Maßnahmen, um die Produktionskosten niedrig zu halten:
1. Günstige Rohstoffe: Der Staat sorgte dafür, dass Rohstoffe billig eingekauft oder aus den Kolonien geliefert wurden.
2. Staatliche Unterstützung: Manche wichtigen Betriebe bekamen Geld vom Staat, damit sie gut und günstig produzieren konnten.
3. Niedrige Löhne: Die Arbeiterinnen und Arbeiter sollten wenig Lohn bekommen, damit die Produkte im Land billig hergestellt werden konnten.
4. Zölle auf fertige Waren: Ausländische Fertigprodukte wurden mit Zöllen verteuert, damit die Menschen heimische Produkte kauften.
5. Verbesserung der Arbeitsorganisation: In Manufakturen wurden viele Arbeiter in großen Werkstätten beschäftigt. Jeder machte nur einen kleinen Schritt, damit schnell und günstig produziert werden konnte.
K. 5/S. 43/2 mögliche Lösung: Die Maßnahmen des Merkantilismus hatten folgende Auswirkungen:
1. Auf die Arbeitsbedingungen: Die Arbeit war oft eintönig und streng organisiert. * Die Menschen mussten immer denselben Handgriff ausführen. * Es gab wenig Schutz und harte Arbeitszeiten in den großen Werkstätten (Manufakturen).
2. Auf die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter: Die Löhne blieben sehr niedrig, weil die Herrscher wollten, dass die Produkte billig hergestellt wurden. * Viele Arbeiterinnen und Arbeiter lebten trotz harter Arbeit in Armut.
3. Auf die Qualität der Produkte: Die Produkte sollten schnell und billig hergestellt werden.
* Dadurch war die Qualität oft schlechter, als wenn ein Handwerker ein Einzelstück sorgfältig hergestellt hätte.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 29 - 36
AB 1
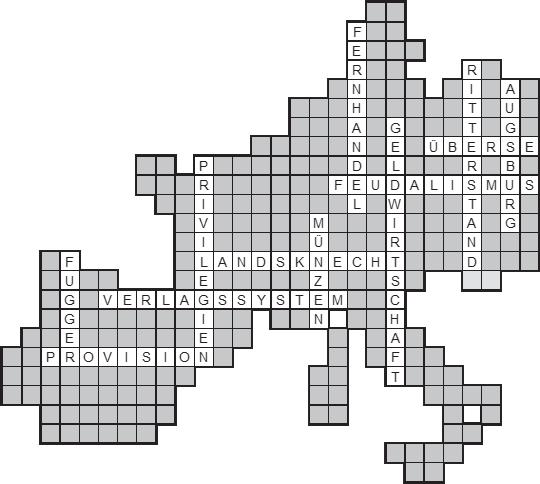
AB 2
1. Taille: Körpermitte * Perücke: künstliches Kopfhaar * Madame: Dame * Kavalier: höflicher Mann * Armee: Heer * Restaurant: Gasthaus * Kompliment: Schmeichelei * Cousin: Vetter * Salon: eleganter Wohnraum * Visite: ärztlicher Hausbesuch * Kostüm: Kleidung für Schauspieler * Etage: Stockwerk
Lösungswort: ABSOLUTISMUS
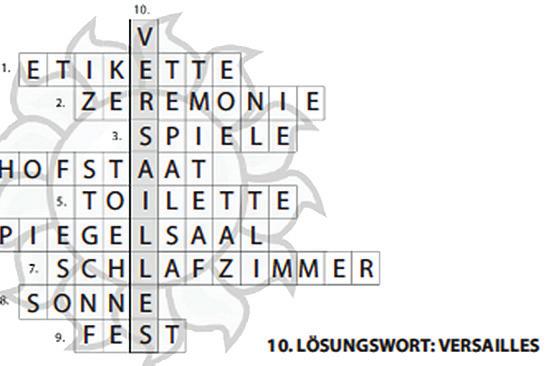
AB 3 letzte Antwort: „Ein König, ein Gesetz, ein Glaube!“ Lernstandserhebung
1. Fabrikarbeiterin/Fabrikarbeiter * Unternehmer * Geldwechsler * Händler im Fernhandel * Seeleute * Bergarbeiter * Fuhrunternehmer * Verlagsbuchhändler
2. mögliche Lösung: Weil der Seehandel den Zugang zu begehrten und teuren Waren aus fernen Ländern ermöglichte, zum Beispiel: Gewürze, Tee, Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle, Seide, Farbstoffe, Gold, Silber, Edelhölzer. Diese Waren konnten in Europa mit großem Gewinn verkauft werden. Außerdem war es möglich, große Mengen auf einmal zu transportieren, was den Fernhandel lohnender machte als den Handel zu Land. Seehäfen wie Amsterdam, London, Lissabon oder Venedig wurden zu mächtigen Handelszentren. Kaufleute verdienten dort am Warentransport, dem Weiterverkauf und an Handelsgesellschaften, die ganze Flotten finanzierten.
3. Ludwig XIV. * Frankreich * 17./18.Jhdt. * Schloss Versailles * die Sonne * Sonnenkönig
Olympe Verlag
4. Der König war zugleich Gesetzgeber, militärischer Oberbefehlshaber und Richter. Ludwig XIV. war König von Gottes Gnaden. Der König, seine Familie und viele Adelige lebten in prachtvollen Schlössern.
5. Der Staat bin ich * Kleiner als Gott – aber größer als der Erdball * Keiner kommt ihm gleich * Wer als Untertan geboren ist, hat willenlos zu gehorchen.
6. Hof, Verwaltung, Kirche, Heer
7. 2. Stand * am Hof des Königs * von der Steuer befreit * Bauern * gebildet
8. Jean-Baptiste Colbert – Finanzminister Ludwig XIV. * Merkantilismus – Wirtschaftssystem im Absolutismus * Manufaktur - Großbetrieb, in dem Waren in Handarbeit hergestellt werden * Zölle - Abgaben, die beim Transport von Waren über Staatsgrenzen eingehoben werden * Arbeitsteilung - jeder Arbeiter macht nur einen Teil eines Werkstücks * Export – Waren werden ins Ausland verkauft
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Berühmte Aufklärer
Erstelle für diese drei berühmten Aufklärer kurze Steckbriefe in deinem Heft! Vergleiche ihre Lebensbedingungen:
Jean-JacquesRousseau



JeanJacques Rousseau wurde am 18. Juni 1712 in Genf als Sohn eines Uhrmachers geboren. Seine Mutter starb kurz nach seiner Geburt. Rousseau wurde vom Vater und einer Tante aufgezogen. Mit zehn Jahren kam er als Pflegekind zu verschiedenen Verwandten. Er hatte eine schwere und unglückliche Kindheit. 1728 wurde er Privatsekretär von Madame Louise de Waren, einer wohlhabenden Dame. Sie hatte als mütterliche Freundin großen Einfluss auf sein Leben und seine Bildung. Später lebte Rousseau häufig in Paris. Mit seiner Lebensgefährtin hatte er fünf Kinder, die er alle gleich nach der Geburt ins Waisenhaus brachte, weil er, wie er sich entschuldigte, zu arm sei, um Kinder aufzuziehen. Rousseau galt als sehr belesen, interessierte sich für Musik und reiste viel. Er arbeitete als Lehrer, Schreiber und Sekretär. Obwohl Rousseau nie eine richtige schulische Ausbildung erhalten hatte, versuchte er sich als Schriftsteller und Komponist. Nach anfänglichen Misserfolgen gewann er 1750 für sein Werk „Abhandlung über die Wissenschaften und die Künste“ einen Preis und wurde in ganz Europa bekannt. 1762 erschien sein Bildungsroman „Emile, oder über die Erziehung“, in dem er dafür eintrat, Kinder und Jugendliche freier und toleranter zu erziehen. Nach seiner Ansicht waren alle Menschen „von Natur aus gut“. In seinem Hauptwerk „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts“ trat er gegen den absolutistischen Staat auf und lieferte damit die geistigen Grundlagen für die Französische Revolution. Jean-Jacques Rousseau starb am 2. Juli 1778.



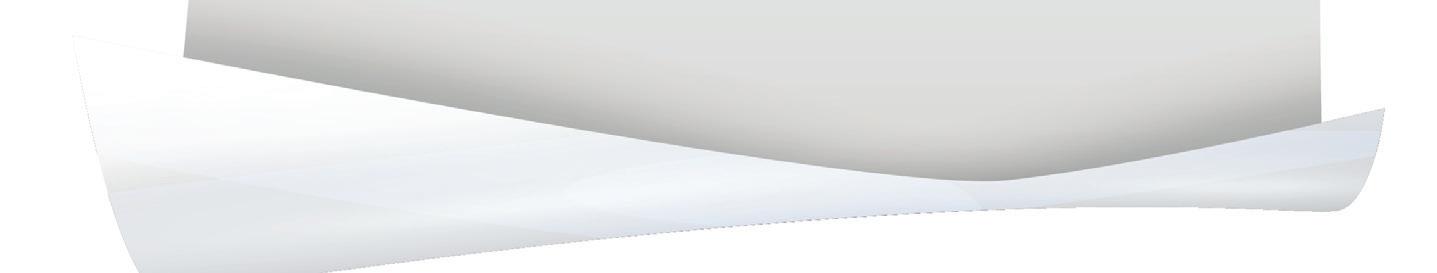






Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 als viertes von zehn Kindern einer Handwerksfamilie in Königsberg (Ostpreußen) geboren. Nach seiner Schulzeit studierte er Naturwissenschaften, Mathematik, Philosophie, Theologie und klassische lateinische Literatur. Um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, arbeitete er nebenbei als Hauslehrer. Kant lebte nur für die Wissenschaft. Er war nie verheiratet und er kam nie weit aus Königsberg hinaus. Nach seinem Studium hielt er Vorlesungen an der Universität in Königsberg. Mit seinen beiden Hauptwerken „Kritik der reinen Vernunft“ und „Kritik der praktischen Vernunft“ wurde er in ganz Europa bekannt, obwohl seine Bücher nur schwer verständlich waren. Er bezeichnete die Aufklärung als den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“.


Kant schuf den Begriff des „Kategorischen Imperativ“: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ (Handle so, dass deine Taten mit den Gesetzen übereinstimmen.)


Kant starb am 12. Februar 1804 in Königsberg.


François Marie Arouet de Voltaire wurde am 21. November 1694 in Paris geboren.
Olympe Verlag


Sein Vater war ein vermögender Notar. Schon in seiner Schulzeit verfasste Voltaire Gedichte. Nach dem Willen seines Vaters sollte er aber Rechtsanwalt werden. Trotzdem hielt er an seinem Ziel, Schriftsteller zu werden, fest.
Er verfasste Gedichte, Theaterstücke und Romane. Voltaire wurde zu einem der wichtigsten Autoren der Aufklärung. Er war viel auf Reisen, besuchte England, Preußen, Belgien und Holland. Von 1733 bis 1749 lebte er mit der verheirateten Émilie du Châtelet zusammen. Durch sie, eine Mathematikerin und Naturforscherin, vertiefte Voltaire seine Kenntnisse über Naturwissenschaften. Mit seiner Kritik an den Missständen des Absolutismus und an der katholischen Kirche machte er sich viele Feinde. Mehrmals musste er deswegen aus Frankreich fliehen, einige Male wurde er sogar ins Gefängnis geworfen. Viele seiner Werke wurden verbrannt. Im Gegensatz zu Kant waren seine Werke allgemein verständlich geschrieben. Mit Witz und Sarkasmus kritisierte er die Missstände seiner Zeit. Er starb am 30. Mai 1778.






Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Reformen unter Maria Theresia und Joseph II.
Weißt du noch, welche Reformen Maria Theresia und welche ihr Sohn Joseph II. durchgeführt hat? Ordne die Aussprüche richtig zu! ACHTUNG: Ein Ausspruch stammt nicht von beiden!

Für die Armen lasse ich das Allgemeine Krankenhaus bauen. * Keiner meiner Untertanen soll länger als eine Stunde zur Kirche gehen. * Alle Häuser müssen nummeriert und in ein Grundbuch eingetragen werden. * Ich reise nach Burgund, um Maria zu heiraten. * In meinem Reich dürfen auch die Juden ihre Religion frei ausüben. * 1774 werde ich die Unterrichtspflicht einführen. * Alle Bauern sind nun persönlich frei. * Die Folter ist unmenschlich. * Ich brauche eine zentrale Verwaltungsstelle in Wien.
Olympe Verlag
Falscher Ausspruch:
Wer sagte das?

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Revolutions - ABC
Finde zu jedem Buchstaben des Alphabets so viele Begriffe wie möglich, die zu diesem Kapitel passen!
Anfangsbuchstabe Begriff
Verlag
Gesamtpunkteanzahl:
Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
OLYMPE Verlag
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Fehlersuchbild
Am 20. Juni 1789 trafen sich die Abgeordneten der Nationalversammlung in Versailles. Auf dem zweiten Bild haben sich aber 10 Fehler eingeschlichen. Suche sie!
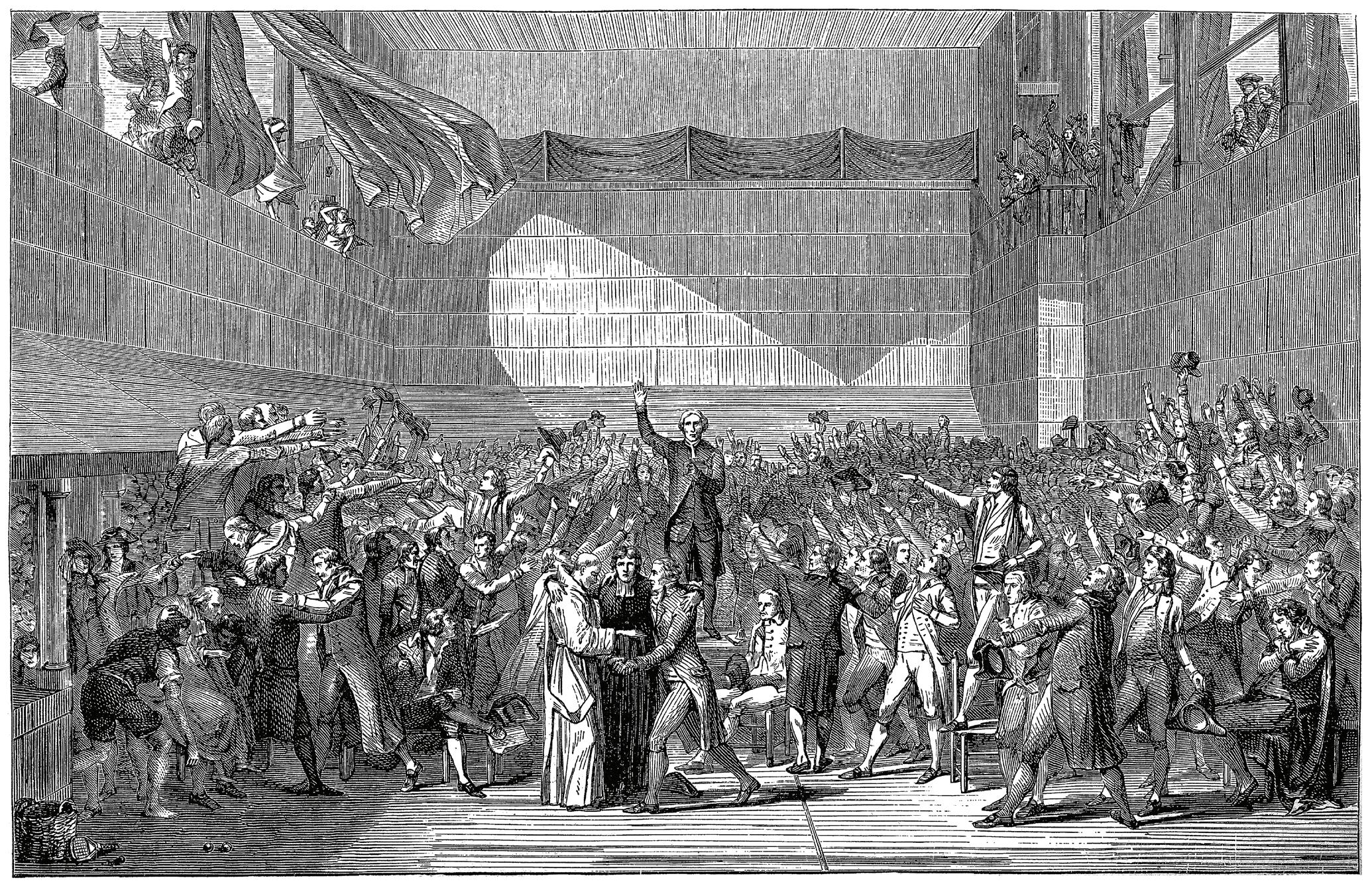
Olympe Verlag
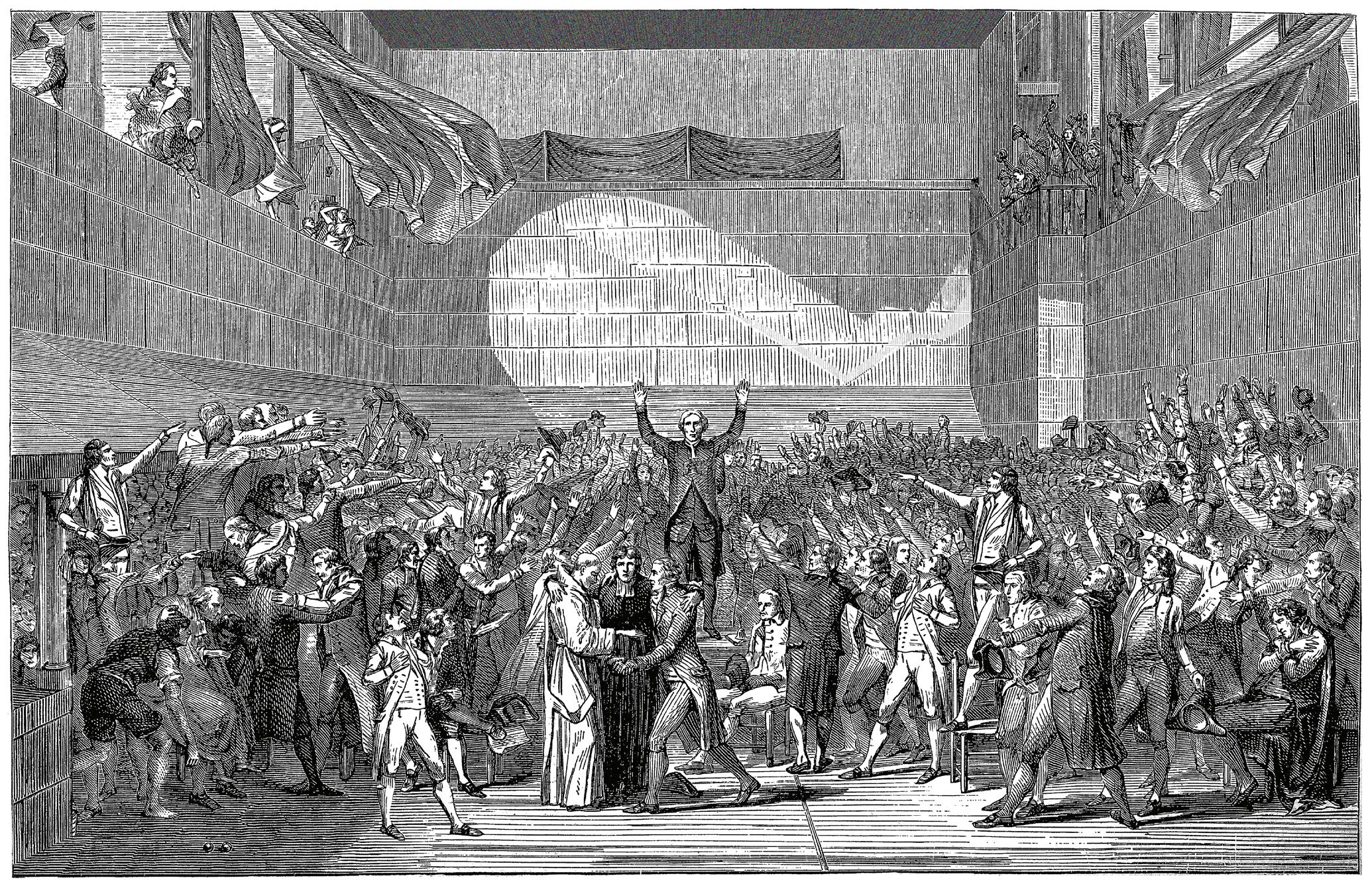
Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Würfelspiel: Revolutionen
Für dieses Spiel brauchst du einen Würfel und für jede Spielerin und jeden Spieler einen Spielstein. Wenn du auf ein Ereignisfeld (E) kommst, beantworte eine Frage! Wenn du die Frage richtig beantworten kannst, darfst du ein Feld vorrücken. Bei einer falschen Antwort musst du eine Runde aussetzen! ACHTUNG: Das Ziel muss genau erreicht werden.

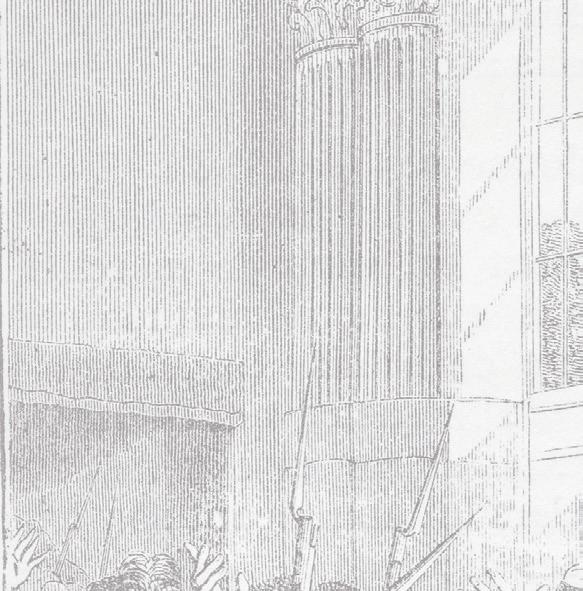


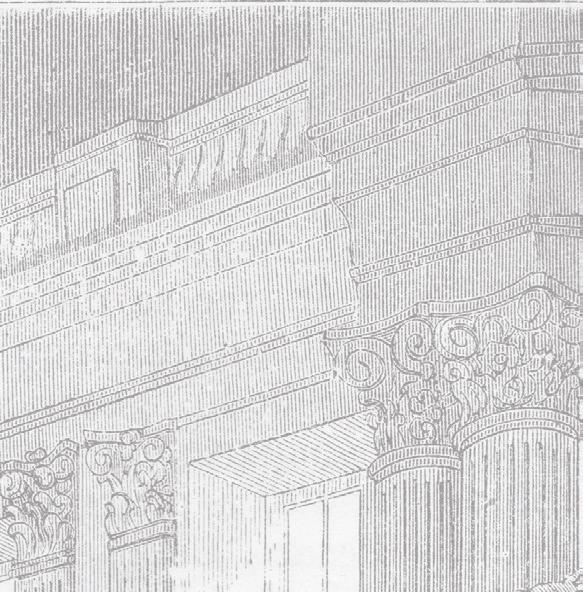
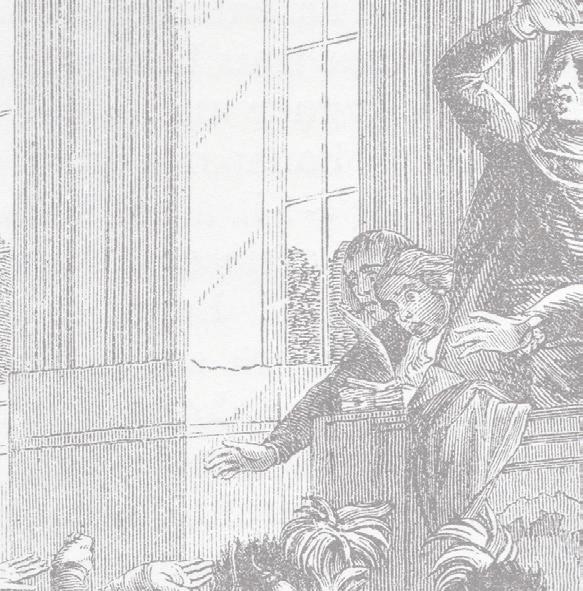
Verlag








Arbeitsblatt 6 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Frageblatt zum Würfelspiel: „Revolutionen“
Welche Herrscherin führte in Österreich die Unterrichtspflicht ein?
Wie hieß das französische Staatsgefängnis?
Wie heißt die französische Nationalhymne?
In welcher Stadt fand 1814/1815 ein Kongress zur Neuordnung Europas statt?
Welcher Sohn Maria Theresias war ein überzeugter Anhänger der Aufklärung?
Wie lauteten die Schlagworte der Französischen Revolution?
Welche Herrschaft errichteten Robespierre und Marat?
Verlag
Was versteht man unter Bankrott?
Wer sind die Bourbonen?
Wie nennt man die Bemühungen, die absolute Herrschaft wiederherzustellen?
Wer verfasste die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“?
Wer ließ sich 1804 zum Kaiser der Franzosen krönen?
Wie hieß der letzte Zar?
Welches Volk erhob sich 1821 gegen die türkische Fremdherrschaft?
Was versteht man unter einer Allianz?
Wie wird die Zeit zwischen dem Wiener Kongress und der Revolution 1848 genannt?
Wie hießen die Herrscher in Russland?
Auf welche Insel wurde Napoleon 1815 verbannt?
Arbeitsblatt 7 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Antwortblatt zum Würfelspiel: „Revolutionen“
Zahlungsunfähigkeit
Olympe de Gouges
Napoleon
Vormärz
Kaiser Joseph II. Maria Theresia
Freiheit
Gleichheit
Brüderlichkeit
Schreckensherrschaft
Verlag
Restauration
Bastille
Marseillaise
Wien
Zaren die Griechen französische Herrscherdynastie
St. Helena ein Bündnis
Nikolaus II.
Arbeitsblatt 8 / KOPIERVORLAGE
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
Jugenderinnerungen aus dem Biedermeier Versuche, diesen Bericht aus dem Biedermeier über die Erziehungsmethoden zu lesen! Dann beantworte die Fragen dazu!
Der Vater, meist mit „Sie“ angesprochen, schlägt, und ebenso der Lehrer. Peinliche Schulstrafen sind an der Tagesordnung wie Zwicken und der Stock.
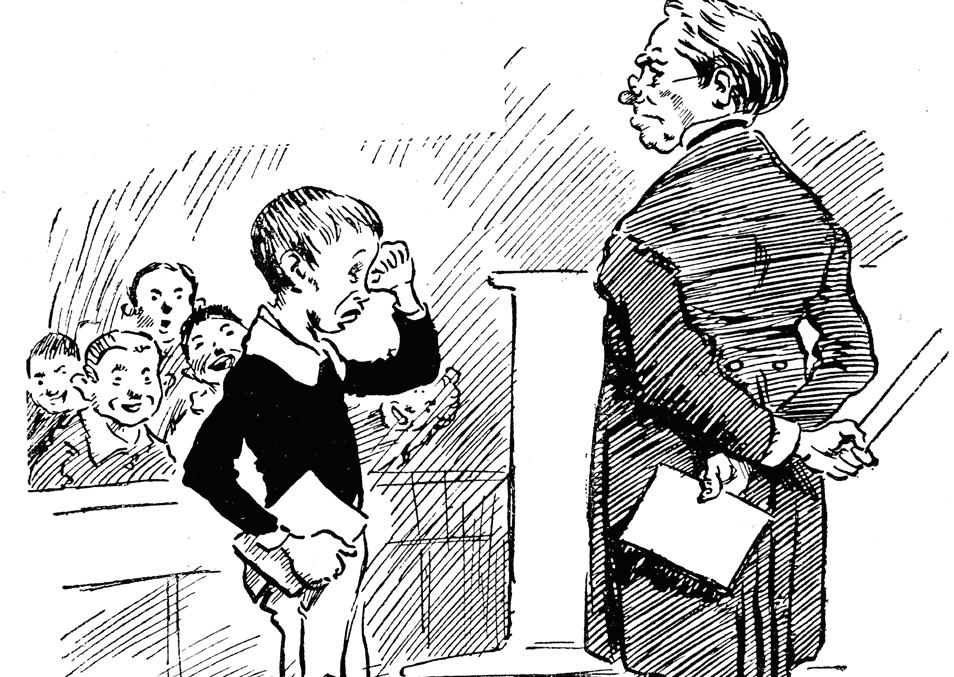
Die Prügel, deren ich oft gedacht, waren ein zwar häufiges Zuchtmittel (und einigen Lehrern schien das Prügeln förmlich Vergnügen zu machen), doch gab es noch andere Strafarten, welche eigentlich die Regel bildeten. In der ersten Zeit fanden sich einige Täfelchen vor, welche sehr saubere Bilder eines Schweins und eines Esels zeigten, zur Auszeichnung für unreinliche und faule Knaben um den Hals zu tragen. Sehr häufig war die Strafe des Ringumhängens. Holzringe, wie man sie beim Reifenspielen benutzte, wurden als Zeichen der Ausgeschlossenheit aus der menschlichen Gemeinschaft umgehängt, oft mehrere Tage lang.
Wer einen solchen Ring um hatte, durfte mit keinem Mitschüler reden. Tat er es dennoch, so wurde er und auch der Angeredete, der sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen hatte, noch besonders bestraft. Der Lehrer, der den Ring umgehängt hatte, hatte allein das Recht, ihn wieder abzunehmen.
Als schwerstes Verbrechen galt die Lüge. Wer absichtlich frech gelogen hatte, bekam auf fünf Tage einen schwarzen Ring um und musste an abgesondertem Platz bei Tisch sitzen.
Fragen:
Wie wurde der Vater angesprochen?
Was war ein häufiges Zuchtmittel?
Was war auf den Täfelchen abgebildet?
Olympe Verlag
Wozu dienten die Reifen aus Holzringen?
Wer durfte diese Ringe abnehmen?
Was galt als das schwerste Verbrechen?
Wie lange musste man den schwarzen Ring tragen?
Lernstandserhebung
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
1. Vervollständige die folgenden Sätze, indem du die richtigen Nummern in die Kästchen einträgst! 6/
1. Alle Menschen sind … frei wählen.
2. Jeder Mensch hat ein Recht auf … haben ein Recht auf Hilfe.
3. Hexenprozesse und Folter … vor dem Gesetz gleich.
4. Jeder Mensch darf seine Religion … Schulbildung.
5. Kranke und Arme … sondern soll vom Volk bestimmt werden.
6. Der König ist nicht von Gott auserwählt, … sollen abgeschafft werden.
2. Ordne die Reformen richtig zu! 9/


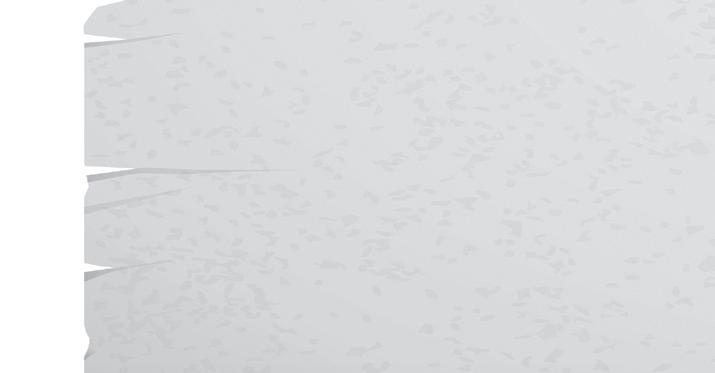


Verlag
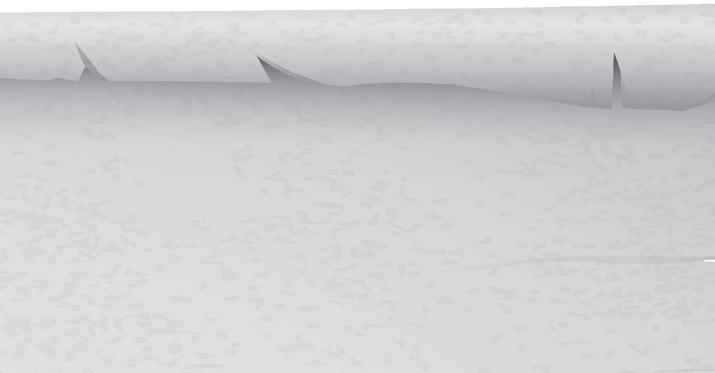




Einführung der Wehrpflicht * Adelige müssen Steuern bezahlen * Gründung von Waisenhäusern Gründung der „Haus-, Hof- und Staatskanzlei“ * Erlaubnis der freien Religionsausübung * Einführung der Unterrichtspflicht * Abschaffung der Folter * Schließung von Klöstern * Aufhebung der Leibeigenschaft
3. Welche Bevölkerungsgruppe gehörte zum „dritten Stand“? Kreuze richtig an! 1/
der Adel
die Bauern und das einfache Volk
der Klerus (Geistliche)
die königliche Familie
Lernstandserhebung
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
4. Ordne die Ereignisse der Reihe nach, indem du die Zahl 1 für das früheste Ereignis, die Zahl 2 für das nächste usw. einsetzt! 10/
6 000 Frauen ziehen nach Versailles.
Frankreich wird konstitutionelle Monarchie.
Die königliche Familie wird unter Arrest gestellt.
Der 3. Stand erklärt sich zur Nationalversammlung.
Der König wird hingerichtet.
Eine Schreckensherrschaft beginnt.
Ludwig XVI. beruft die Generalstände ein.
Ein Direktorium übernimmt die Regierungsgeschäfte.
Die Bastille wird gestürmt.
Die Nationalversammlung beschließt die Menschenrechte.
5. Vervollständige diesen Steckbrief!

Verlag
Wie hieß dieser Herrscher?
Welches Land regierte er?
Wann wurde er Kaiser?
Welches Land griff er am Höhepunkt seiner Macht an?
Wo starb er?
Lernstandserhebung
Revolutionen, Widerstand, Reformen
NAME: DATUM:
7. Streiche die Wörter durch, die nicht zum Vormärz passen: 3/ Karlsbader Beschlüsse * Konzil * Nestroy * Zensur * Biedermeier * Spitzel * Fugger * Vatermörder * Johann Strauß * Salon * Metternich * Liga * Restauration
8. Kreuze die richtigen Antworten an!
Welcher Staat erklärte sich 1821 als unabhängig vom Osmanischen Reich?
Belgien Griechenland Frankreich Italien
10/
Welches Land wurde 1830 durch eine Revolution vom Königreich der Niederlande unabhängig?
Luxemburg Belgien Schweiz Italien
Wie wird Louis Philippe von Orleans nach der Julirevolution genannt?
Bürgerkönig Sonnenkönig Soldatenkönig Priesterkönig
Welche Gesellschaftsschicht gewann durch die Julirevolution an politischem Einfluss?
Adel Kirche Bürgertum Bauernschaft
Was forderten viele Menschen in Europa zwischen 1821 und 1848?
Adelsherrschaft Zensur Freiheit und Mitbestimmung geringere Steuern
Welches Land war das erste unabhängige Land auf dem Balkan nach dem Freiheitskampf gegen das Osmanische Reich?
Kroatien Griechenland Albanien Bulgarien
Wogegen richtete sich der Aufstand in Belgien 1830?
gegen Frankreich gegen die Niederlande gegen Deutschland gegen England
Welcher König wurde 1830 nach der Revolution in Frankreich eingesetzt?
Karl X. Louis XVI. Louis Philippe von Orleans Napoleon III. Welche Entwicklung gab es in vielen Ländern Europas zwischen 1821 und 1848?
mehr Macht für die Herrscher Rückkehr zur Monarchie
Revolutionen und Forderungen nach Freiheit Stärkung der Kirche
Was zeigt der Titel „Europa brennt“?
Europa wurde von Naturkatastrophen heimgesucht
In ganz Europa gab es revolutionäre Unruhen und Kämpfe.
Olympe Verlag
45-50= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
39-44 = du hast dir viel gemerkt
32-38 = du weißt schon einiges
26-31 = du solltest noch viel üben
< 25 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
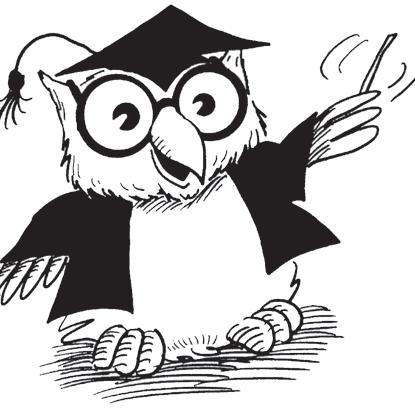
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 45 - 74
K. 1/S. 48/1 Hauptaussage: Nicht die Erweiterung des Herrschaftsgebiets, sondern die Modernisierung und Zentralisierung durch Reformen waren die entscheidenden Veränderungen in der Habsburgermonarchie, auch wenn diese Reformen weiterhin stark vom Absolutismus geprägt waren.
K. 1/S. 48/2 Klassischer Absolutismus: Der Herrscher entscheidet allein und hat uneingeschränkte Macht. * Es zählt vor allem der Machterhalt des Herrschers und seines Staates. * Alte Traditionen bleiben oft bestehen, Veränderungen sind selten. * Die Untertanen haben keine Mitbestimmung und sind oft schlecht informiert. * Alles bleibt meist so wie es war, um die Macht zu sichern.
Aufgeklärter Absolutismus: Der Herrscher entscheidet auch allein, versucht aber zum Wohl des Staates und der Bevölkerung zu handeln. * Es geht auch um Reformen, Bildung, Verwaltung und die Förderung von Wirtschaft und Gesellschaft. * Es werden viele Reformen eingeführt, z. B. bessere Verwaltung, Steuerreformen, Schulpflicht. * Es wird viel neu geordnet, aber die Macht des Herrschers bleibt trotzdem unangetastet.
Zusammenfassung: Der aufgeklärte Absolutismus unterscheidet sich vom klassischen Absolutismus vor allem durch die vielen Reformen und das Ziel, den Staat zu verbessern und zu modernisieren. Die Macht bleibt aber weiterhin beim Herrscher allein, ohne echte Mitbestimmung der Bevölkerung.
K. 1/S. 48/3 Mögliche Lösung: Im Text steht, dass die Herrscher Maria Theresia und ihre Söhne viele Veränderungen durchführten haben. Sie wollten den Staat besser und moderner machen. Dafür haben sie zum Beispiel die Verwaltung einfacher gemacht, also die Organisation vom Staat verbessert.
Sie sagten, dass dies für das Wohl der Menschen sei. Aber: Die Menschen durften trotzdem nicht mitbestimmen. Die Herrscher hatten alleine die Macht. Außerdem wollten sie die Menschen noch besser überwachen, damit sie alles kontrollieren können.
Das nennt man Zentralisierung: Der Staat wird von einer einzigen Stelle (dem Kaiser oder der Kaiserin) ganz streng gelenkt und kontrolliert.
Verlag
Obwohl das alles „aufgeklärt“ genannt wurde, war es eigentlich immer noch Absolutismus – also eine Herrschaft, bei der das Volk nichts zu sagen hat.
K. 1/S. 48/4 Mögliche Lösung: Das Wort „aufgeklärt“ klingt zuerst so, als wäre diese Herrschaft besonders gut oder gerecht gewesen. Es klingt so, als hätten die Menschen im Land mitreden dürfen oder als wäre es viel besser als der alte Absolutismus gewesen.
Doch der Text zeigt, dass das nicht ganz stimmte. Zwar führten Maria Theresia und ihre Söhne viele Verbesserungen und Reformen durch, zum Beispiel in der Verwaltung. Aber die Macht blieb ganz beim Herrscher. Die Menschen im Land durften nichts mitbestimmen.
Dazu kam, dass die Kontrolle und Überwachung der Menschen sogar noch stärker wurde. Das war also kein echter Fortschritt für die Freiheit der Menschen.
Vorteile der Herrschaftsform:
• Der Staat wurde besser organisiert.
• Es gab Reformen, zum Beispiel in der Verwaltung oder bei den Schulen.
• Das Leben für viele Menschen wurde dadurch etwas besser geordnet.
Nachteile der Herrschaftsform:
• Die Macht blieb allein beim Herrscher.
• Die Menschen hatten keine Mitbestimmung.
• Es gab mehr Kontrolle und Überwachung.
• Der „aufgeklärte“ Absolutismus war eigentlich immer noch absolutistisch.
K. 1/S. 48/5 Schulreform: Alle Kinder sollen Zugang zu Bildung haben. * Wissen für alle, nicht nur für Reiche. * Förderung von Vernunft und Aufklärung.
Steuerreform: Alle (auch Adel und Kirche) sollen Steuern zahlen, nicht nur die Bauern. * Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Staat. Rechtsreform: Alle Menschen sollen vor dem Gesetz gleichbehandelt werden. * Schutz der Menschen vor Willkür und ungerechter Strafe.
K. 1/S. 49/7 Mögliche Lösung: Auf dem Bild ist ein Klassenraum zu sehen. Viele Kinder sitzen eng auf Holzbänken an einfachen Tischen. Ein älterer Lehrer steht vorne mit einem langen Zeigestock in der Hand. Er wirkt streng. Die Kinder wirken unterschiedlich – manche hören aufmerksam zu, andere schauen gelangweilt oder reden miteinander. Links sitzen einige Mädchen mit Büchern in den Händen. Die Kleidung der Kinder ist altmodisch und einfach. Der Raum ist aus Holz gebaut und wirkt sehr schlicht. An den Wänden hängen Werkzeuge. Das Bild zeigt, wie Schule früher ausgesehen hat. Es wirkt eng, ernst und streng, aber auch lebendig.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 45 - 74
K 1/S. 50/11
Schwerpunkt 1: Kritik an Macht und Herrschaft: Die Aufklärer kritisierten, dass der König seine Macht alleine ausübte und sich vom Adel und der Kirche beeinflussen ließ. Sie lehnten diese Form der Herrschaft ab und wollten, dass der König nicht wie ein Despot (Gewaltherrscher) regierte. Diese Kritik trug dazu bei, dass immer mehr Menschen forderten, dass die Regierung für das Wohl aller Menschen da sein sollte – nicht nur für Adelige oder Geistliche. Dadurch wurde der Ruf nach mehr Mitbestimmung und Gerechtigkeit in der Politik stärker.
Schwerpunkt 2: Freiheit und Toleranz: Die Aufklärung setzte sich für individuelle Freiheit ein – zum Beispiel für die freie Wahl der Religion. Herrscher wie Joseph II. versuchten sogar, die Macht der Kirche zu verringern und religiöse Toleranz durchzusetzen. Menschen sollten selbst entscheiden dürfen, woran sie glaubten. Das stärkte die Freiheit der Bürger. Doch es zeigte sich auch, dass diese Freiheit nicht für alle gleich galt, zum Beispiel für Menschen jüdischen Glaubens.
Schwerpunkt 3: Gleichheit und Menschenrechte: Die Aufklärung forderte, dass alle Menschen gleichbehandelt werden sollten, egal welchen Glauben oder welchen Stand sie hatten. Diese Idee wurde später in die Erklärung der Menschenrechte aufgenommen. Diese Forderung nach Gleichheit und gleichen Rechten führte dazu, dass Menschen sich für gerechtere Gesetze und eine bessere Gesellschaft einsetzten. Auch wenn das noch viele Jahre dauern sollte, war dies ein wichtiger Schritt zu den heutigen Grund- und Menschenrechten.
K. 1/S. 51/14 Blau: D2: „… sich um das Wohlergehen ihrer Völker zu kümmern …“ * D3: „… oder das Wohl des Volkes im Blick hatten …“
K. 1/S. 51/15
Grün: D2: „… die individuelle Freiheit der Untertanen so wenig wie möglich anzutasten und die freie Religionsausübung zu gewährleisten.“ * D2: „… religiöse Toleranz im kirchlichen Leben zunehmend durch.“ * D2: „… galt die Religionsfreiheit, die später sogar in die Erklärung der Menschenrechte aufgenommen wurde …“ * D3: „… 1781 veröffentlichte er für Protestanten, Orthodoxe und Juden ein Toleranzpatent …“
Rot: D3: „… war das 18. Jahrhundert durch die Zentralisierung der Staatsgewalt gekennzeichnet.“ * D3: „… eine von der Aufklärung beeinflusste Modernisierungspolitik.“ * D3: „… rationalisierten die Verwaltung und das Rechtssystem.“ * D3: „… schaffte die Folter und die Todesstrafe ab.“ * D3: „… ordnete die Schließung der Klöster an, die er für sozial nutzlos hielt.“
Bauern: Die Bauern profitierten von der Abschaffung der Leibeigenschaft. Sie waren rechtlich freier als zuvor und mussten nicht mehr vollständig dem Grundherrn gehorchen. Trotzdem blieben viele wirtschaftlich abhängig.
Sie verloren Macht und Einkommen, weil die Bauern nicht mehr völlig unter ihrer Kontrolle standen. Sie mussten Abgaben leisten und waren nicht mehr völlig frei von Pflichten gegenüber dem Staat.
Einfache Priester: Sie waren stärker an den Staat gebunden und mussten sich an neue staatliche Vorschriften halten. Viele kleine Klöster und Orden wurden geschlossen, was auch ihre Lebensgrundlage gefährdete. Hoher Klerus: Sie verloren viele Sonderrechte und mussten sich dem Staat unterordnen. Der Einfluss der Kirche auf das tägliche Leben wurde eingeschränkt, der Staat bestimmte immer mehr über kirchliche Angelegenheiten.
Lösungen LehrerInnenheft, S. 41 - 51
AB 1 Maria Theresia: Alle Häuser müssen nummeriert und in ein Grundbuch eingetragen werden. * 1774 werde ich die Unterrichtspflicht einführen. * Die Folter ist unmenschlich. * Ich brauche eine zentrale Verwaltungsstelle in Wien.
AB 4
Joseph II.: Für die Armen lasse ich das Allgemeine Krankenhaus bauen. * Keiner meiner Untertanen soll länger als eine Stunde zur Kirche gehen. * In meinem Reich dürfen auch die Juden ihre Religion frei ausüben. * Alle Bauern sind nun persönlich frei. *
Falscher Ausspruch: Ich reise nach Burgund, um Maria zu heiraten. * Maximilian I.
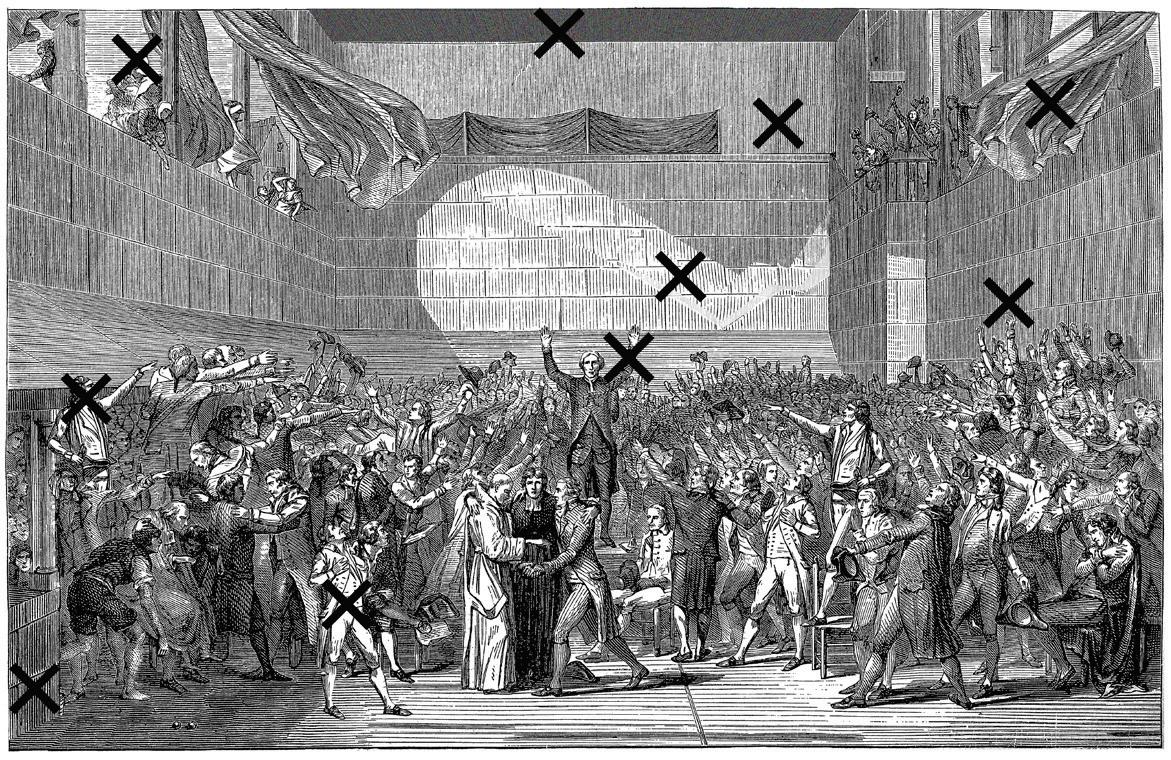
Olympe Verlag
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 42 - 52
AB 7 Der Vater, meist mit „Sie“ angesprochen, schlägt, und ebenso der Lehrer. Peinliche Schulstrafen sind an der Tagesordnung wie Zwicken und der Stock. Die Prügel, deren ich oft gedacht, waren ein zwar häufiges Zuchtmittel (und einigen Lehrern schien das Prügeln förmlich Vergnügen zu machen), doch gab es noch andere Strafarten, welche eigentlich die Regel bildeten. In der ersten Zeit fanden sich einige Täfelchen vor, welche sehr saubere Bilder eines Schweins und eines Esels zeigten, zur Auszeichnung für unreinliche und faule Knaben um den Hals zu tragen. Sehr häufig war die Strafe des Ringumhängens. Holzringe, wie man sie beim Reifenspielen benutzte, wurden als Zeichen der Ausgeschlossenheit aus der menschlichen Gemeinschaft umgehängt, oft mehrere Tage lang.
Lernstandserhebung
Wer einen solchen Ring um hatte, durfte mit keinem Mitschüler reden. Tat er es dennoch, so wurde er und auch der Angeredete, der sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen hatte, noch besonders bestraft. Der Lehrer, der den Ring umgehängt hatte, hatte allein das Recht, ihn wieder abzunehmen.
Als schwerstes Verbrechen galt die Lüge. Wer absichtlich frech gelogen hatte, bekam auf fünf Tage einen schwarzen Ring um und musste an abgesondertem Platz bei Tisch sitzen.
ANTWORTEN: „Sie“ * Prügeln * Schwein oder Esel * Zeichen der Ausgeschlossenheit * Lehrer * Lüge * fünf Tage
1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. * Jeder Mensch hat ein Recht auf Schulbildung.
* Hexenprozesse und Folter sollen abgeschafft werden. * Jeder Mensch darf seine Religion frei wählen. * Kranke und Arme haben ein Recht auf Hilfe. * Der König ist nicht von Gott auserwählt, sondern soll vom Volk bestimmt werden.
2. Maria Theresia: Gründung der Haus-, Hof- und Staatskanzlei, Einführung der Unterrichtspflicht, Abschaffung der Folter, Einführung der Wehrpflicht, Adelige müssen Steuern bezahlen
Joseph II.: Erlaubnis der freien Religionsausübung, Schließung von Klöstern, Aufhebung der Leibeigenschaft * Gründung von Waisenhäusern
3. die Bauern und das einfache Volk
Verlag
4. Ludwig XVI. beruft die Generalstände ein. Der 3. Stand erklärt sich zur Nationalversammlung. Die Bastille wird gestürmt. 6 000 Frauen ziehen nach Versailles. Die königliche Familie wird unter Arrest gestellt. Die Nationalversammlung beschließt die Menschenrechte. Frankreich wird konstitutionelle Monarchie. Der König wird hingerichtet. Eine Schreckensherrschaft beginnt. Ein Direktorium übernimmt die Regierungsgeschäfte.
5. Napoleon * Frankreich * 1804 * Russland * St. Helena
6. Vor dem Gesetz sind alle gleich. * Jeder hat das Recht auf Eigentum. * Jeder ist persönlich frei. * Jeder hat das Recht, seinen Wohnsitz frei zu wählen. * Die Religion hat keinen Einfluss mehr auf die Rechtsprechung.
7. falsch: Konzil * Fugger * Liga
8. Griechenland * Belgien * Bürgerkönig * Bürgertum * Freiheit und Mitbestimmung * Griechenland * gegen die Niederlande * Louis Philippe von Orleans * Revolutionen und Forderungen nach Freiheit * In ganz Europa gab es revolutionäre Unruhen und Kämpfe.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Leseblatt
Achtung Geheimtext! Versuche zuerst, diese Berichte zu lesen. Dann finde Überschriften zu den Texten. Zum Schluss suche dir eine Erfindung aus und fasse die wichtigsten Entwicklungsschritte in einer kurzen Übersicht in deinem Heft zusammen!
Verlag
Während seine drei Brüder gemeinsam eine Schule besuchten, müsste Claude Chappe alleine in die benachbarte Schule gehen. Da sich die vier Brüder nicht treffen durften, verständigten sie sich über Sichtzeichen mithilfe von Holzlinealen. 1790 baute Chappe dieses System aus, indem er am Ende eines 4 m langen Balkens 2 m lange Flügel befestigte. Über ein System von Rollen und Seilen wurden die drei Teile bewegt. Jede Flügelstellung des optischen Telegrafen entsprach einer bestimmten Botschaft. Ab 1794 wurde in Frankreich ein 5 000 km umfassendes Netz von Telegrafenstationen aufgebaut. Etwa alle 10 km wurde ein Telegraf auf einer Kirche oder einem Turm auf einem Hügel errichtet.
1843 stellte der Amerikaner Samuel Morse den ersten elektrischen Telegrafen vor. Im Gegensatz zum optischen Telegrafen funktioniert sein System auch nachts und bei Nebel. Samuel Morse stellte jeden Buchstaben und jede Zahl durch eine Kombination von Punkten und Strichen dar. Der elektrische Telegraf war so erfolgreich, dass zehn Jahre später durch den Ärmelkanal ein Kabel verlegt wurde, das Paris und London verband. 1858 gelang auch die Verbindung zwischen Europa und Amerika.
Der Schotte Alexander Graham Bell bemerkte als Lehrer an einer Gehörlosenschule, dass man beim Sprechen die Luft in der Umgebung zum Schwingen bringt. Diese Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen. Bell brachte ein Plöttchen aus Eisen vor einem mit elektrischem Draht umwickelten Magneten an. Sobald die Schallwellen auf das Plöttchen treffen, veröndern sie den elektrischen Strom, der im Draht flieöt. Am 10. Mörz 1876 sprach Bell öber dieses System erstmals mit seinem Assistenten, der sich im Nebenzimmer befand. Ab 1890 wurde das Telefon stöndig weiterentwickelt und Vermittlungsstellen eingerichtet. Wenn man jemanden sprechen wollte, nahm man den Hörer ab, gab dem „Fröulein vom Amt“ die gewönschte Nummer und wurde von ihr verbunden. Ab den 1920er Jahren bekamen die Telefone Wöhlscheiben. Mit diesen wöhlte man die Nummer seines Gespröchspartners direkt. Das Funktelefon wurde Ende des Zweiten Weltkrieges för militörische Zwecke entwickelt und seit den 1980er Jahren der öffentlichkeit zugönglich gemacht. Bei einer sehr groöen Entfernung wird die Verbindung mithilfe eines oder mehreren Satelliten hergestellt.
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Bilderquiz
Hier ist einiges verloren gegangen! – Erkenne diese Gegenstände und finde passende Überschriften! Tipp: Die Silben helfen dir dabei!
Au- * -bahn * -be * Dampf- * Ei- * Flug- * -fon * Hoch- * -ke * Lauf- * -le- * ma- * -ma- * -mar- * -mit- * Näh- * -ne * -ne * Post- * -rad * -rad * -schi- * -schi- * Schiffs- * -schrau- * -sen- * -stuhl * Te- * -tel * -to * Wasch- * Web- * -zeug
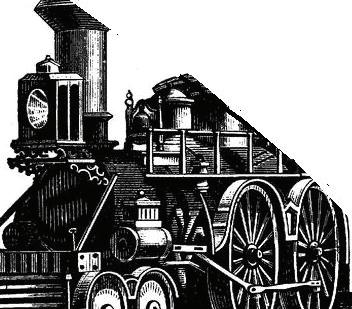
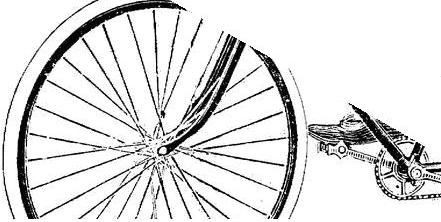
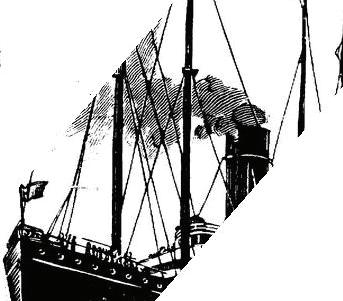
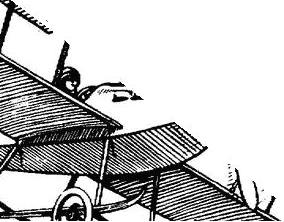
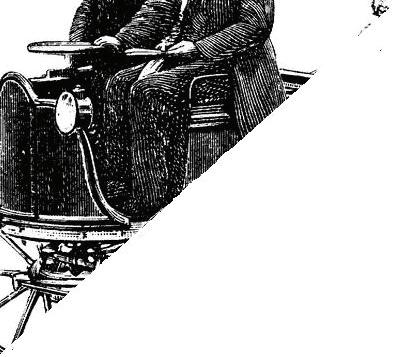

Olympe Verlag
Mich interessiert am meisten:
Interessantes über diese Erfindung:


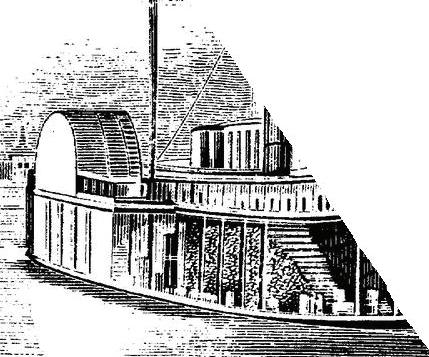

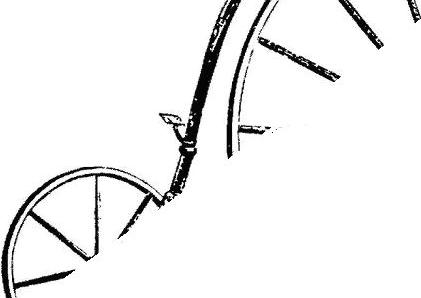

Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Geheim - geheim - geheim
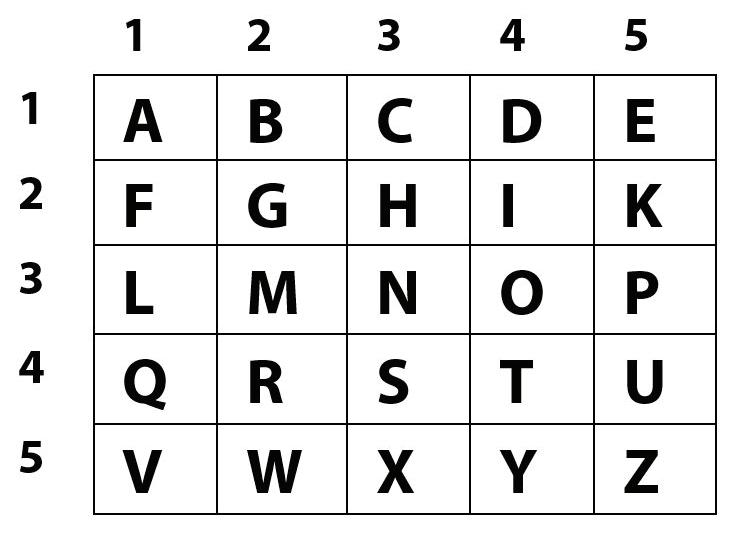
1. In diesen 25 Feldern steht das ganze Alphabet von A bis Z (ohne J). Jeder Buchstabe lässt sich mit einer zweistelligen Zahl verschlüsseln. Die erste Ziffer gibt die Zeile an, die zweite die richtige Stelle in der Zeile.
I = 24 (I in der 2. Zeile an 4. Stelle)
C = 13 (C in der 1. Zeile an 3. Stelle)
H = 23 (H in der 2. Zeile an 3. Stelle)
Die Wortenden werden mit einem Schrägstrich markiert.
Entschlüssle nun die folgende Zahlenbotschaft!
15–32–24–31/12-15–42-31–21–33–15–42/15–42–21–11–33–14/15-24-15/43-13-23-11-31-31-35-31-11-44-44-15/11-4543/52-11-23-23-43-32-11-43-43-15/32-24-44/42-24-31-31-15-33

2. BUCHSTABENUHR: Bei dieser alten Taschenuhr stehen statt Ziffern rundherum die Buchstaben des ABC. Wenn es 5 Uhr ist, deutet der Stundenzeiger exakt auf den Buchstaben L. Dreißig Minuten später, also um 5:30, wird der kleine Zeiger beim M stehen und um 6 Uhr beim N.
Verlag
Entschlüssle nun die folgende Nachricht!
13:30-14:00-20:00/0:00-5:30-15:00-8:00-16:00-4:30-12:0018:00-2:00-8:00/14:00-1:30-4:00-6:30-18:00/14:00-20:002:30-12:00-18:00-1:30/12:00-21:00-1:00-3:30/13:30-14:0018:00/4:30-16:00-18:00-2:00-9:00-18:30-3:00-8:00-12:0019:00-3:30-14:00-18:00.
3. Diese Nachrichten wurden als erste in der Geschichte mit dem Telegrafen verschickt. Übersetze sie mit Hilfe des Morsealphabets in deinem Geschichtsbuch auf S. 108!
Erste Nachricht von Morse am 4. September 1837:
Zweite Nachricht von Morse am 24. Mai 1844:
Verfasse nun selbst verschlüsselte Nachrichten. Dann suche dir einen Partner/eine Partnerin und entschlüsselt gegenseitig die ausgetauschten Listen!
Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Leben im 19. Jahrhundert I.
1) Stelle als Buchhalterin oder Buchhalter der Firma Brauerpech eine Rechnung aus! Großhändler Kronbichler hat folgende Waren eingekauft:
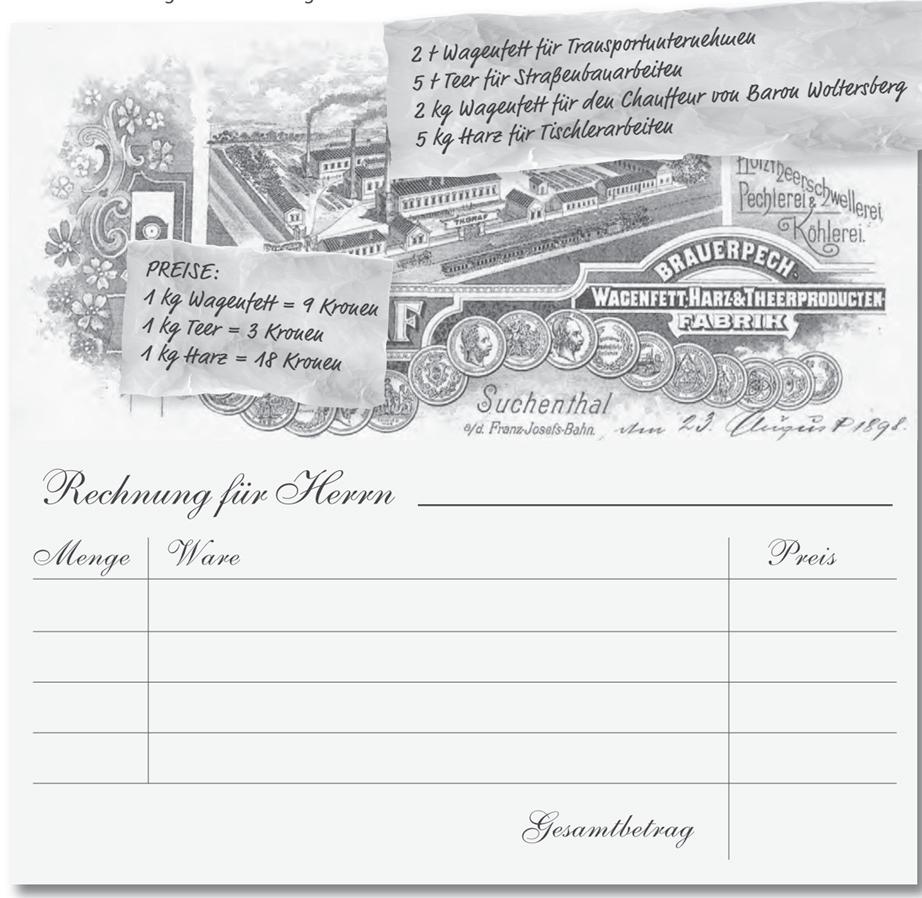
2) Richte diese Zimmer-Küche-Wohnung für 6 Personen (4 Kinder, Vater, Mutter) praktisch ein! Zeichne dazu die angegebenen Möbel ein!
Überlege: Wo wuschen sich die Menschen? Wo machten die Kinder ihre Hausübungen?
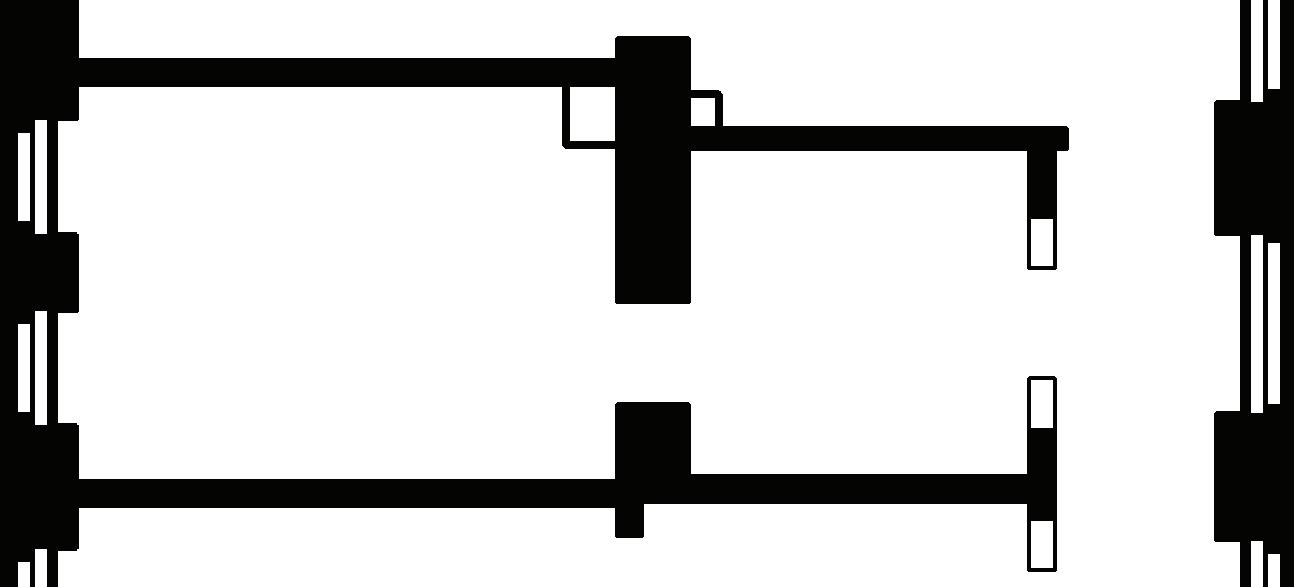
Olympe Verlag
3 Betten * ein Schrank * eine Truhe * einen Tisch * eine Kochstelle * Bassena auf dem Gang * Küchenkommode
Arbeitsblatt 5 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Leben im 19. Jahrhundert II.
3) Hier siehst du den Grundriss einer Bürgerwohnung. Als Innenarchitekt der reichen Bürgersfamilie Hochmeister sollst du nach ihren Angaben die Zimmer einrichten. Schreibe diese in den Grundriss!
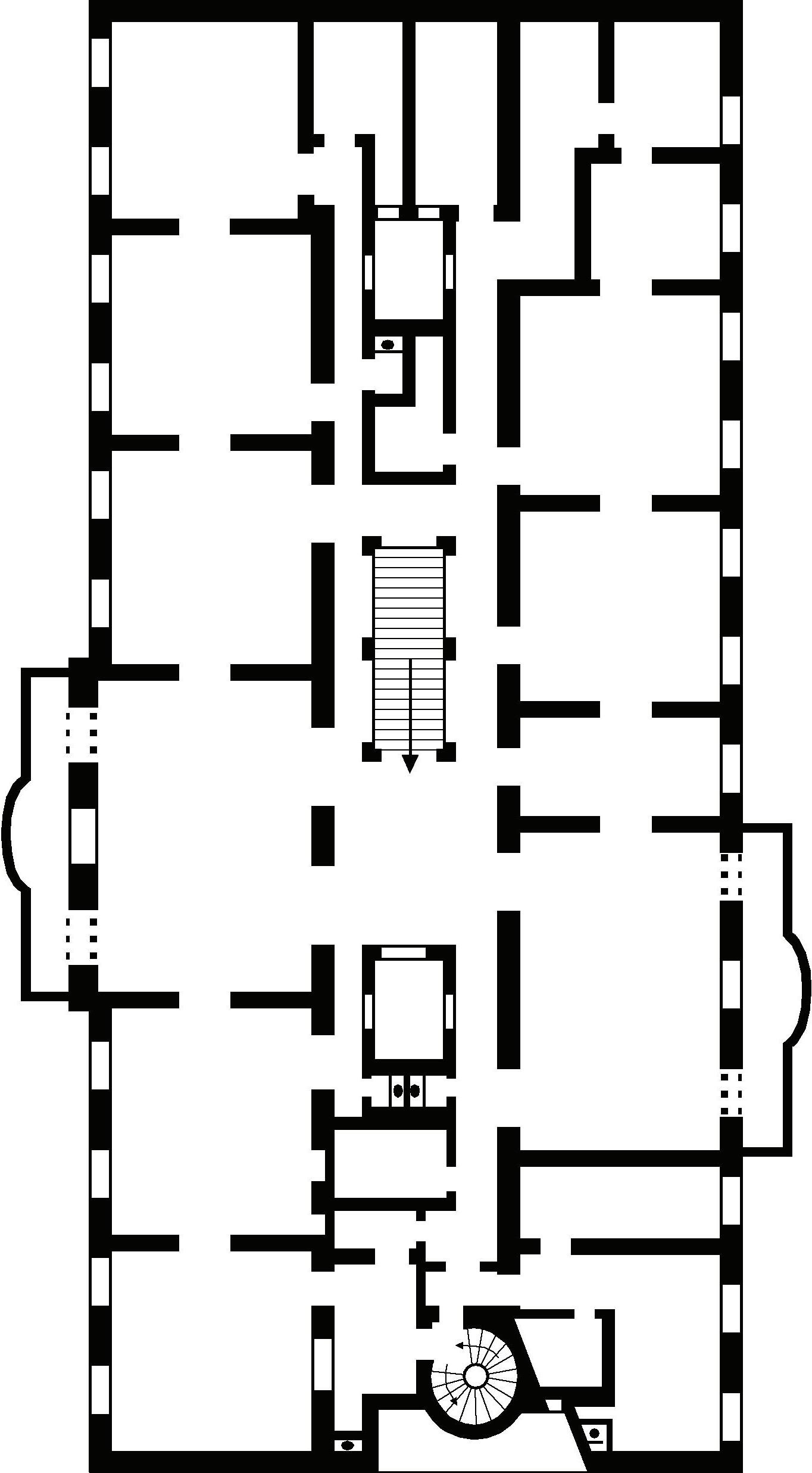
Olympe Verlag





Wenn man über den Stiegenaufgang die Wohnung betritt, soll man in einen großen Vorraum kommen. Den größten Raum hin zur Straße will ich als Großen Salon nutzen. Gleich daneben links möchte ich den Kleinen Salon und im Anschluss daran mein Damenzimmer. Rechts vom Großen Salon benötigt mein Gatte ein Herrenzimmer und daneben ein Büro. Zum Hof hin links soll die Kammer der Zofe sein. Daneben benötige ich ein Toilettezimmer, an das nach rechts mein Schlafzimmer und das Schlafzimmer meines Mannes anschließen. Der große Raum zum Innenhof hin wird das Speisezimmer sein. Links davon liegt das Frühstückszimmer, rechts davon das DienstbotenZimmer, das mit der Küche und einer kleinen Speis zum Aufbewahren der Lebensmittel verbunden ist. An das Zimmer der Zofe schließt die Garderobe an. Das Gästezimmer, das Kindermädchenzimmer und das Kinderzimmer liegen an der linken Seite der Wohnung. Hinter dem Stiegenaufgang soll das Badezimmer liegen. An der rechten Seite der Wohnung soll eine eigener Stiegenaufgang für das Personal in einen Vorraum münden, von dem man auch das Büro betreten kann.
Arbeitsblatt 6 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Leseblatt: Kinder als Arbeitskräfte
Vor über 100 Jahren war es auch bei uns in Europa noch ganz normal, dass Kinder arbeiten. Fünfjährige mussten etwa Tiere hüten oder bei der Feldarbeit helfen
Frage: Gab es auch in Österreich Kinderarbeit? Wenn ja, wann war das?
Antwort: Kinderarbeit, also Arbeit von unter 14-Jährigen, gab es angeblich schon immer – auch in Europa. Besonders stark verbreitet war sie zur Zeit der Industrialisierung, im 18. und 19. Jahrhundert, als vermehrt Maschinen zur Fertigung von Dingen eingesetzt wurden. Für arme Familien bedeuteten Kinder eine zusätzliche Arbeitskraft. Waisenhäuser wurden in Österreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu wahren Zentren der Kinderarbeit – und viele blieben es bis ins 19. Jahrhundert hinein. Vor allem bei der Herstellung von Textilien wurden kleine Kinderhände eingesetzt. Der Staat benötigte die billigen Arbeitskräfte und förderte den Einsatz von Kindern anfangs bewusst. Arbeit galt auch als nützliches Erziehungsmittel. Rund ein Viertel der Schulkinder dürfte um 1900 neben der Schule auch gearbeitet haben.
Verlag
Frage: Welche Arbeiten haben Kinder ausgeführt?

Antwort: Rund zwei Drittel der arbeitenden Kinder waren in der Landwirtschaft tätig. Dort halfen sie vor allem bei der Rüben-, Kartoffel- und Krauternte. Oft hatten sie auch Tiere zu hüten, meist Ziegen. Für manches wurden Kinder gerade wegen ihrer Körpergröße eingesetzt. Zum Beispiel bei Arbeiten im Bergbau oder wie erwähnt bei Textilarbeiten. Außerdem haben Kinder auch als Dienstboten und im Haushalt geschuftet. Ihre Arbeitszeit betrug nicht selten mehr als acht Stunden am Tag.
Frage: Wie „alt“ waren die jüngsten arbeitenden Kinder?
Antwort: Für einfache Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind Kinder im Vorschulalter eingesetzt worden. Sie mussten zum Beispiel Hühner hüten. Auch die Mehrzahl der Kinder, die Heimarbeit wie etwa Sticken verrichtet hat, begann oft mit fünf Jahren zu arbeiten.
Frage: Wann besserte sich die Situation?
Antwort: Mitte des 19. Jahrhunderts begann eine Debatte um die Kinderarbeit. Ab 1842 gab es in Österreich ein Verbot dafür, Kinder unter zwölf Jahren in Fabriken einzusetzen. Diese Verordnung hat aber noch zahlreiche Ausnahmen zugelassen. Wirklich als soziales Problem erkannt wurde die Kinderarbeit in Österreich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schulbildung und landwirtschaftliche sowie militärische Interessen (die Arbeit nahm der Armee den gesunden Nachwuchs weg) waren von da an oft im Mittelpunkt politischer Debatten. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde den Unternehmern mit neuen Regelungen laufend der legale Einsatz von Kindern in Fabriken weiter verboten. Ab den 1880er-Jahren wurden Inspektoren beauftragt, zu überprüfen, ob die Regeln von den Unternehmern auch eingehalten werden.
Artikel aus der Zeitung DER STANDARD von Gudrun Springer (9. Mai 2008)
Arbeitsblatt 7 / KOPIERVORLAGE
Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
Frageblatt: Kinder als Arbeitskräfte
1) Wann war Kinderarbeit in Europa besonders stark verbreitet?
2) Wo gab es Zentren der Kinderarbeit in Österreich?
3) Warum förderte der Staat die Kinderarbeit? (2 Antworten)
4) Wie hoch war der Anteil der Kinder um 1900, die nebenbei noch arbeiten mussten?

5) Welche Arbeiten haben Kinder ausgeführt? Nenne mindestens drei!
Verlag
6) Wie viele Stunden arbeiteten sie durchschnittlich am Tag? Stunden
7) Ab wie vielen Jahren begannen Kinder zu arbeiten? ab Jahren
8) Was regelte das Gesetz von 1842 in Österreich?
9) Wie und wann veränderte sich gesellschaftlich die Einstellung in Österreich zu Kinderarbeit?
10) Was geschah ab den 1880er-Jahren in Bezug auf Kinderarbeit in Österreich?

Lernstandserhebung Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
1. Was erfanden oder entdeckten diese Personen? Verbinde mit Pfeilen! 7/
James Watt
Joseph Madersperger
Thomas Alva Edison
Marie Curie
Joseph Ressel
Peter Mitterhofer
Justus von Liebig
Schiffsschraube
Radioaktivität
Schreibmaschine
Kohlenfadenlampe
Kreislauf der Stoffe bei Pflanzen
Dampfmaschine
Nähmaschine
2. Ergänze die fehlenden Begriffe! 3/
Durch die wurden viele Handarbeiten durch Maschinen ersetzt. Die ermöglichte es, Fabriken mit Energie zu versorgen. Viele Menschen zogen in die , um Arbeit zu finden.
3. Erkläre in jeweils einem Satz! 3/
Was ist eine Manufaktur?
Was ist eine Fabrik?
Was bedeutet Massenproduktion?
Verlag
4. Warum sind viele Menschen während der Industrialisierung vom Land in die Stadt gezogen? Notiere zwei bis drei Gründe! Formuliere ganze Sätze! 4/
5. Welche Ziele verfolgten die ersten Frauenbewegungen? Achtung: Mehrere Antworten sind richtig! 3/
Gleiche Bezahlung wie Männer
Alleinige Herrschaft der Frauen
Zugang zu Bildung und Berufen
Wahlrecht für Frauen
Lernstandserhebung Das Zeitalter der Industrialisierung
NAME: DATUM:
6. Warum war das Wahlrecht für Frauen so wichtig? Notiere eine kurze Begründung! 2/
7. Ordne richtig zu! 3/
Großbürgertum:
Mittelschicht:
Kleinbürgertum:
Beamter * Handwerker * Unternehmer
8. Fehlertext – Streich die sechs falschen Wörter durch und schreibe die richtigen darüber! 6/
Verlag
Im Römischen Manifest begründeten Karl Müller und Friedrich Meier den Kommunismus. Zu Beginn des 20. Jh. kam es zur Trennung von Kommunismus und Absolutismus. 1891 verfasste König Leo XIII. die Enzyklika rerum novarum. Frauenrechtlerinnen nannte man in Russland Suffragetten.
9. Kreuze an, ob diese Forderungen sozialdemokratisch oder christlichsozial waren! 6/
Forderungen: sozialdemokratisch christlichsozial staatliche Arbeiterschutzgesetzgebung
Schutz des Privateigentums
8 Stunden Arbeitszeit pro Tag
staatliche Schutzgesetze für Bauern und Handwerker
allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer
allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen
34-37= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
29-33 = du hast dir viel gemerkt
24-28 = du weißt schon einiges
20-23 = du solltest noch viel üben
< 19 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
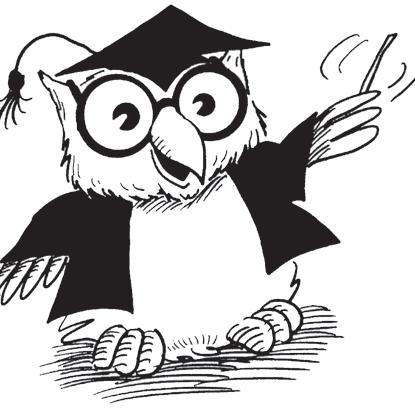
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 75 - 95
K. 1/S. 78/3
mögliche Lösung:
Für die Arbeiterinnen und Arbeiter: Schwere körperliche Arbeit im Gebirge bei Wind, Wetter und Staub * Gefahr von Unfällen, viele Verletzte und Tote (89 bei Unfällen) * Gesundheitsgefahr durch Krankheiten, mehrere Hundert starben daran * Einfachste Werkzeuge und keine Maschinen wie heute * Unsichere und harte Arbeitsbedingungen
Für die Bauleitung (Carl Ritter von Ghega und Ingenieure): Planung einer weltweit einzigartigen Gebirgsbahn – das gab es zuvor noch nicht * Technische Herausforderungen beim Bau von Brücken, Tunneln und Gleisanlagen in schwierigem Gelände * Verantwortung für die Sicherheit von 20.000 Arbeiterinnen und Arbeitern * Druck, das Bauvorhaben erfolgreich abzuschließen
K. 1/S. 78/4 mögliche Lösung:
Aspekt
Themenfokus
Technische Aspekte
Soziale Auswirkungen
D3: Allgemeiner Überblick über die Industrielle Revolution
Überblick über viele Erfindungen und deren Bedeutung für Kommunikation und Verkehr
Allgemein: Eisenbahn, Telefon, Telegraph, Auto, Radio, Fernsehen usw.
Wird kaum erwähnt
Verlag
Gesellschaftlicher Wandel Allgemein: Verbesserung der Verbindungen zwischen Menschen und Orten, schnellere Kommunikation
Zeitlicher Rahmen Großer Zeitraum: 19. bis 20. Jahrhundert
Darstellungsart
Zusammenfassung der technischen Entwicklungen
D4: Bau der Semmeringbahn – ein konkretes Beispiel
Beschreibung eines einzelnen Bauprojekts (Semmeringbahn)
Konkret: Bau einer Gebirgsbahn, technische Meisterleistung
Stark betont: harte Arbeit, Gefahren, Todesfälle, Frauenbeteiligung
Wird kaum angesprochen, aber indirekt durch die Bedeutung der Bahn für den Verkehr erkennbar
Konkrete Zeit: 1848–1854
Detaillierte Beschreibung eines Bauvorhabens
D3 bietet einen Überblick über den allgemeinen technischen Fortschritt.
D4 zeigt am konkreten Beispiel, welche sozialen Kosten solche Projekte für die Arbeiterinnen und Arbeiter bedeuteten.
K. 1/S. 79/8 von links nach rechts: Draisinde/Laufrad (1817) * Niederrad (1870) * Hochrad (1890) * Rennrad (2017)
K. 4/S. 87/4 „Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Schlüsselwörter: Proletarier, verlieren, Ketten, gewinnen, vereinigt euch * Ideologie: Kommunismus / Sozialismus * Absicht: Arbeiterinnen und Arbeiter aus aller Welt sollen sich solidarisieren und gemeinsam für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen, um die Herrschaft der Reichen (Kapitalisten) zu überwinden und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst.“ Schlüsselwörter: Nächsten lieben, wie Dich selbst * Ideologie: Christentum / christliche Nächstenliebe * Absicht: Menschen sollen füreinander da sein, helfen und friedlich zusammenleben, unabhängig von Herkunft, Reichtum oder Stellung.
K. 6/S. 92/2 mögliche Lösung:
Die Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter lebten und arbeiteten unter sehr schlechten Bedingungen. Viele von ihnen kamen aus ärmeren Regionen wie Böhmen, Mähren oder Ungarn. Sie wohnten in einfachen, oft überfüllten Baracken ohne richtige sanitäre Anlagen. Die Arbeit war sehr hart, oft im Freien, egal bei welchem Wetter. Sie mussten schwere Lehmziegel formen, tragen und stapeln. Besonders im Sommer war die Arbeit durch Hitze und Staub extrem anstrengend.
Die Bezahlung war sehr niedrig, und es gab keine Absicherung, wenn jemand krank oder verletzt war. Auch Frauen und Kinder mussten oft mithelfen, um das Überleben der Familie zu sichern.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 75 - 95
K. 6/S. 92/3
mögliche Lösung:
Früher (19. Jahrhundert, z.B. Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter am Wienerberg): sehr harte körperliche Arbeit ohne Maschinenhilfe * lange Arbeitszeiten (oft 12–16 Stunden täglich, auch Kinder mussten arbeiten) * schlechte Bezahlung, kaum zum Leben genug * kein Schutz vor Unfällen oder Krankheiten, keine Krankenoder Unfallversicherung * schlechte Wohnverhältnisse, oft in einfachen Baracken * kaum Rechte, keine Mitbestimmung, keine geregelten Arbeitsverträge
Heute (Österreich, 21. Jahrhundert): technische Hilfsmittel und Maschinen erleichtern die Arbeit * geregelte Arbeitszeiten (meist 8 Stunden, Wochenende oft frei) * gesetzlicher Mindestlohn und faire Bezahlung geregelt * Gesundheits- und Unfallversicherung, bezahlter Krankenstand * bessere Wohnungen mit Strom, Wasser, Heizung * Arbeitnehmerrechte, z.B. durch Gewerkschaften und Betriebsräte * Schutzgesetze für Kinder und Jugendliche (keine schwere Kinderarbeit erlaubt)
Zusammenfassung: Heute sind Arbeit, Bezahlung und soziale Absicherung viel gerechter und sicherer geregelt als früher. Früher waren Arbeiterinnen und Arbeiter ausgeliefert, heute haben sie Rechte und Schutz.
K. 6/S. 92/4 mögliche Lösung: Vermutung über die Folgen: Die schlechte Bezahlung und die harten Arbeitsbedingungen haben wahrscheinlich dazu geführt, dass die Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter ständig in Armut leben mussten.
Sie hatten zu wenig Geld für gutes Essen, Kleidung oder Medikamente.
Die schwere Arbeit und die Gefahr von Unfällen und Krankheiten machten viele früh krank oder schwach.
Auch für die Familien hatte das schlimme Folgen:
• Frauen und Kinder mussten mitarbeiten, damit die Familie überleben konnte.
• Kinder konnten oft nicht zur Schule gehen, weil sie arbeiten mussten.
• Die Familien lebten in überfüllten und schlechten Unterkünften ohne sauberes Wasser oder richtige Toiletten.
Verlag
• Es gab wenig Hoffnung auf ein besseres Leben, weil sie keine Ausbildung oder Chancen auf andere Berufe hatten.
Insgesamt führte das zu einem Leben in ständiger Unsicherheit, Armut und Krankheit.
K. 6/S. 93/6 Zusammenschluss von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; treten für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ein. – Gewerkschaften * Genossenschaften, die die landwirtschaftlichen Produkte ihrer Mitglieder verkaufen. – Bäuerliche Genossenschaften * Genossenschaften, die Waren zu günstigeren Preisen an ihre Mitglieder verkaufen. – Konsumvereine * Sie geben Kredite zu günstigen Zinsen. – Sparkassen, Raiffeisenkassen, Volksbanken
K. 6/S. 93/7 Eine Kurie war eine Wählergruppe, die nach Besitz, Steuerleistung oder Berufsstand eingeteilt war. Sie bestimmte, wer wählen durfte und wie viele Stimmen diese Gruppe hatte. * 1897 * Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs * Für den 1. Wahlkreis „Stern“ * Es war die letzte Wahl mit Kurienwahlrecht, bei der das allgemeine Männerwahlrecht noch nicht galt. Es ging um die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter, die bisher kaum vertreten waren. * Nur jene Männer, die in einer bestimmten Kurie eingetragen waren – meist Wohlhabendere oder Bürger mit Steuerleistung. * individuelle Lösung * Früher war das Plakat textlastig und handschriftlich ergänzt. Heute sind Wahlplakate bunter, auffälliger und meist mit großen Fotos und klaren Botschaften gestaltet.
K. 6/S. 94/8 mögliche Schlüsselwörter: Industrialisierung * Energieverbrauch * 19. Jahrhundert * Produktion von Eisen und Stahl * Bau von Maschinen * Kohle * Verbrennung * Luftverschmutzung * Ballungszentren * Rauch * Schwefeldioxidverbindungen * Waldsterben * Gewässer * Böden * Klärwasser * giftige Chemikalien * Düngemittel * industrielle Abwässer * verseuchte Flüsse * untrinkbares Wasser * Bodenverseuchung * Blei, Cadmium, Quecksilber * Gifte * Altlasten
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 55 - 63
AB 1 Claude Chappe und der erste optische Telegraf: Während seine drei Brüder gemeinsam eine Schule besuchten, musste Claude Chappe alleine in die benachbarte Schule gehen. Da sich die vier Brüder nicht treffen durften, verständigten sie sich über Sichtzeichen mithilfe von Holzlinealen. 1790 baute Chappe dieses System aus, indem er am Ende eines 4 m langen Balkens 2 m lange Flügel befestigte. Über ein System von Rollen und Seilen wurden die drei Teile bewegt. Jede Flügelstellung des optischen Telegrafen entsprach einer bestimmten Botschaft. Ab 1794 wurde in Frankreich ein 5 000 km umfassendes Netz von Telegrafenstationen aufgebaut. Etwa alle 10 km wurde ein Telegraf auf einer Kirche oder einem Turm auf einem Hügel errichtet.
Die Erfindung des elektrischen Telegrafen durch Samuel Morse: 1843 stellte der Amerikaner Samuel Morse den ersten elektrischen Telegrafen vor. Im Gegensatz zum optischen Telegrafen funktioniert sein System auch nachts und bei Nebel. Samuel Morse stellte jeden Buchstaben und jede Zahl durch eine Kombination von Punkten und Strichen dar. Der elektrische Telegraf war so erfolgreich, dass zehn Jahre später durch den Ärmelkanal ein Kabel verlegt wurde, das Paris und London verband. 1858 gelang auch die Verbindung zwischen Europa und Amerika. Vom ersten Telefon bis zum Funktelefon – die Entwicklung der Sprachverbindung: Der Schotte Alexander Graham Bell bemerkte als Lehrer an einer Gehörlosenschule, dass man beim Sprechen die Luft in der Umgebung zum Schwingen bringt. Diese Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen. Bell brachte ein Plättchen aus Eisen vor einem mit elektrischem Draht umwickelten Magneten an. Sobald die Schallwellen auf das Plättchen treffen, verändern sie den elektrischen Strom, der im Draht fließt. Am 10. März 1876 sprach Bell über dieses System erstmals mit seinem Assistenten, der sich im Nebenzimmer befand. Ab 1890 wurde das Telefon ständig weiterentwickelt und Vermittlungsstellen eingerichtet. Wenn man jemanden sprechen wollte, nahm man den Hörer ab, gab dem „Fräulein vom Amt“ die gewünschte Nummer und wurde von ihr verbunden. Ab den 1920er Jahren bekamen die Telefone Wählscheiben. Mit diesen wählte man die Nummer seines Gesprächspartners direkt. Das Funktelefon wurde Ende des Zweiten Weltkrieges für militärische Zwecke entwickelt und seit den 1980er Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bei einer sehr großen Entfernung wird die Verbindung mithilfe eines oder mehreren Satelliten hergestellt.
AB 2 1. Reihe: Eisenbahn, Telefon, Laufrad, Webstuhl * 2. Reihe: Waschmittel, Flugzeug, Nähmaschine, Webstuhl 3. Reihe: Auto, Postmarke, Hochrad, Dampfmaschine
AB 3 1. Emil Berliner erfand die Schallplatte aus Wachsmasse mit Rillen. * 2. Der Amerikaner Edison erfand auch den Kinetografen. * 3. Gelungener Versuch mit Telegraf * Was hat Gott bewirkt?
AB 4 18 000 * 15 000 * 18 * 90 * 33 108
AB 5
Olympe Verlag
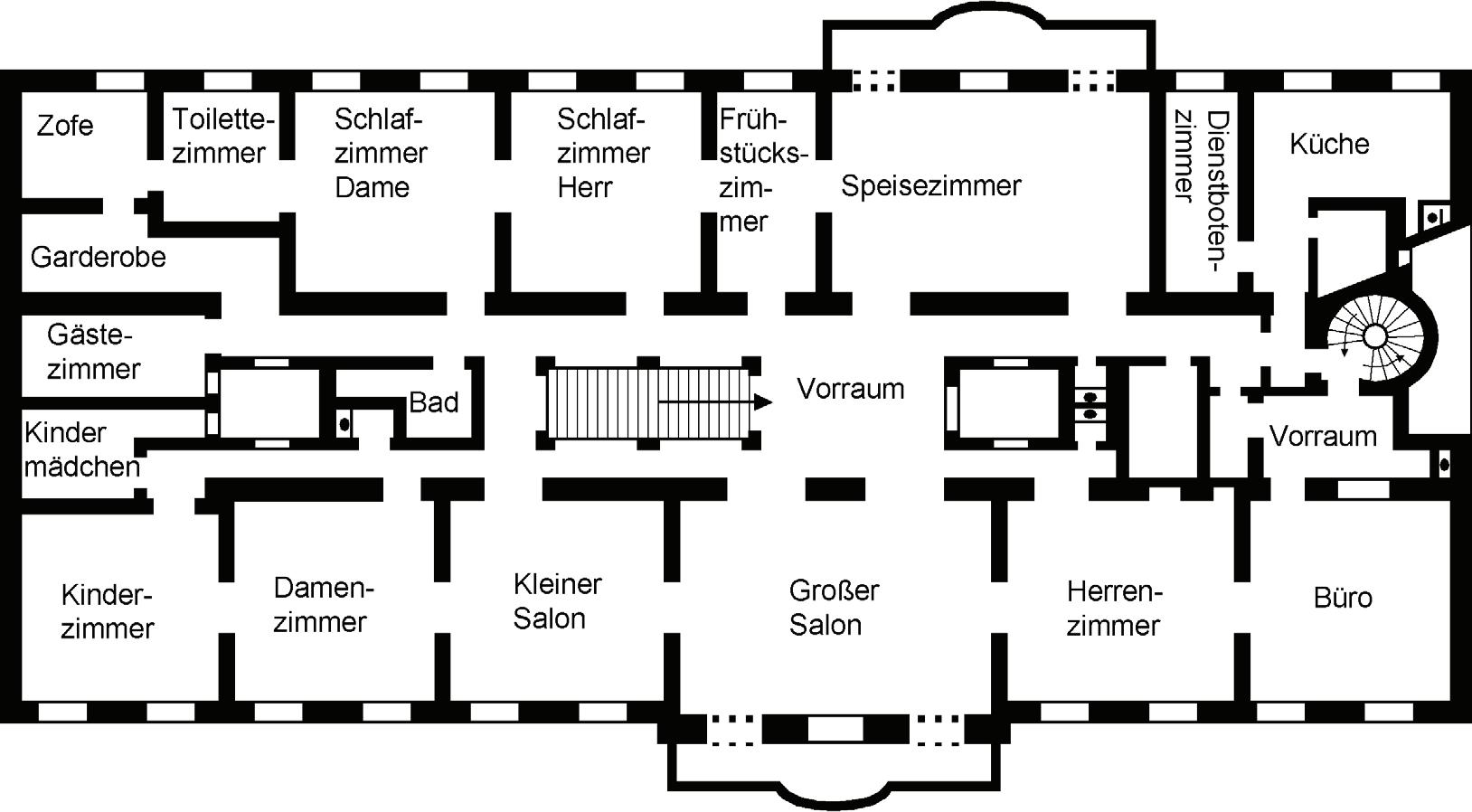
AB 7 1) zur Zeit der Industrialisierung * 2) in den Waisenhäusern * 3) billige Arbeitskräfte, nützliches Erziehungsmittel * 4) Grafik in der Mitte (1/4) * 5) geholfen bei der Rüben-, Kraut- und Kartoffelernte, Tiere gehütet, Arbeiten im Bergbau, Textilarbeiten, Dienstboten, Haushalt * 6) mehr als 8 Stunden am Tag * 7) ab fünf Jahren * 8) Verbot der Kinderarbeit in Fabriken unter 12 Jahren * 9) zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Kinderarbeit wurde als soziales Problem erkannt * 10) Inspektoren wurden beauftragt, zu überprüfen, ob die Regeln von den Unternehmern auch eingehalten werden.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 55 - 63
Lernstandserhebung
1. James Watt: Dampfmaschine * Joseph Madersperger: Nähmaschine * Thomas Alva Edison: Kohlenfadenlampe * Marie Curie: Radioaktivität * Joseph Ressel: Schiffsschraube * Peter Mitterhofer: Schreibmaschine * Justus von Liebig: Kreislauf der Stoffe bei Pflanzen
2. Industrialisierung * Dampfmaschine * Städte
3. Eine Manufaktur ist ein großer Handwerksbetrieb, in dem viele Menschen mit der Hand arbeiten, aber arbeitsteilig produzieren. * Eine Fabrik ist ein Betrieb, in dem Maschinen die meiste Arbeit übernehmen und viele Waren schneller hergestellt werden. * Massenproduktion bedeutet, dass sehr viele gleiche Produkte in großer Stückzahl hergestellt werden.
4. Viele Menschen sind in die Stadt gezogen, weil es dort in den neuen Fabriken mehr Arbeitsplätze gab. * Auf dem Land reichte die Arbeit in der Landwirtschaft oft nicht mehr für alle aus, um genug Geld zu verdienen. * In der Stadt hofften die Menschen auf ein besseres Leben und mehr Verdienstmöglichkeiten.
5. Gleiche Bezahlung wie Männer * Zugang zu Bildung und Berufen * Wahlrecht für Frauen
6. Das Wahlrecht war für Frauen wichtig, weil sie damit endlich politisch mitbestimmen konnten und nicht mehr von den Entscheidungen der Männer abhängig waren.
7. Großbürgertum: Unternehmer * Mittelschicht: Beamter * Kleinbürgertum: Handwerker
8. Im Kommunistischen Manifest begründeten Karl Marx und Friedrich Engels den Kommunismus. Zu Beginn des 20. Jh. kam es zur Trennung von Kommunismus und Sozialdemokratie.1891 verfasste Papst Leo XIII. die Enzyklika rerum novarum. Frauenrechtlerinnen nannte man in England Suffragetten.
9.
Forderungen sozialdemokratisch christlichsozial staatliche Arbeiterschutzgesetzgebung
Schutz des Privateigentums
8 Stunden Arbeitszeit pro Tag
Verlag
staatliche Schutzgesetze für Bauern und Handwerker
allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer
allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus
NAME: DATUM:
Kolonialismus damals – Rassismus bis heute?
Löse dieses Rätsel! Tipp: Ob du richtigliegst, siehst du am Lösungswort.
1. Was war der direkte Anlass für den amerikanischen Bürgerkrieg?
2. Wer entdeckte die Victoriafälle?
3. Ein landwirtschaftlicher Großbetrieb heißt ...
4. Name der Theorie mit der die Entwicklung von Gesellschaften als „Kampf ums Dasein“ beschrieben wird
5. Wo fand 1884 eine Afrikakonferenz statt?
6. Das Streben nach Macht und Besitzerweiterung nennt man ...
7. In welchem Land war Fürst Bismarck Staatskanzler?
8. Vorname des britischen Regierungschefs Rhodes?
9. Was entdeckte Roald Amundsen 1911?
10. Begriff für natürlich vorhandenen Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck benötigt wird
11. Gesamtheit der Veränderungen durch Wissenschaft und Technik
12. englische Handelsgesellschaft, die mit besonderen Privilegien ausgestattet war
13. Name der Kaiserin von Indien
Verlag
14. ein in der Verwaltung selbständiges Land des Britischen Reiches oder Commonwealth
15. Wie nennt man den Bürgerkrieg zwischen dem Norden und Süden Amerikas (1861 – 1865) noch?
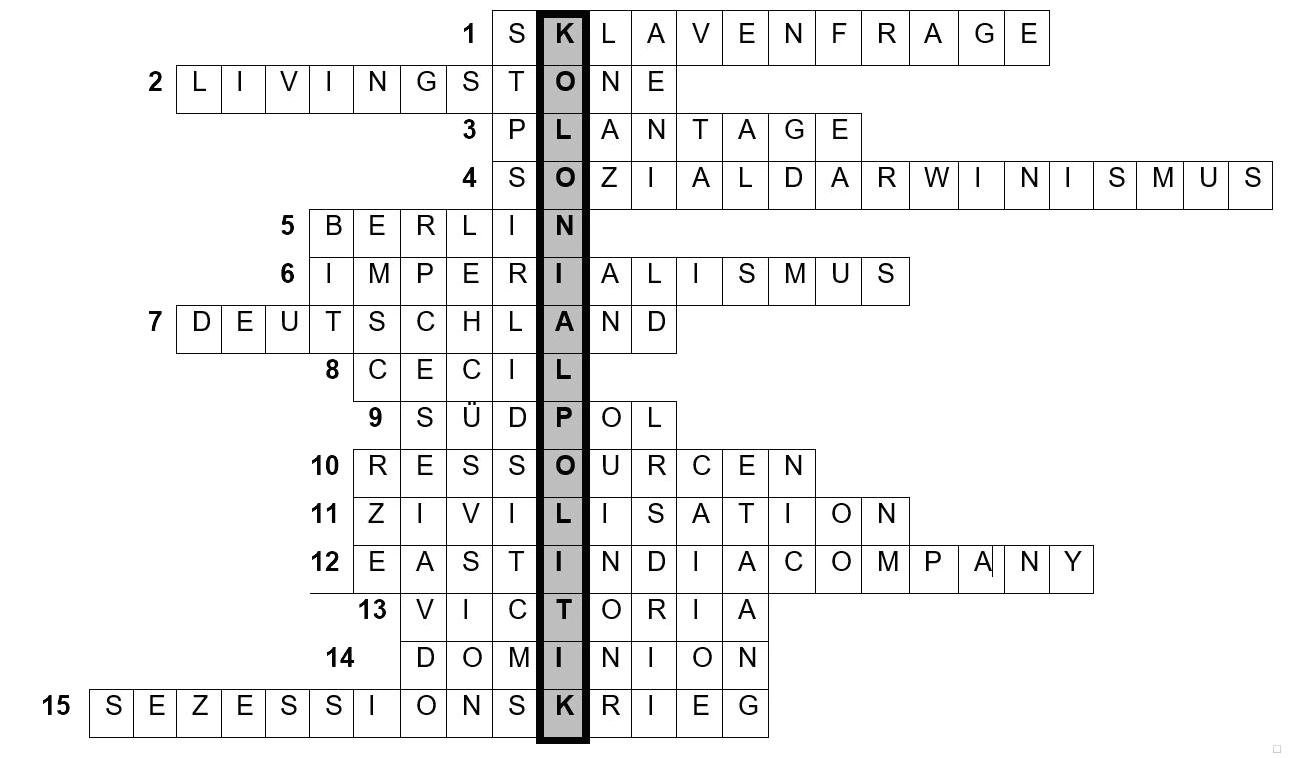
LÖSUNGSWORT:
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus
NAME: DATUM:
Der Vielvölkerstaat Österreich
Lies die Informationen in den Kästchen zuerst aufmerksam durch! In welchem Kästchen findest du die passende Aussage?
Vielfalt der Völker im Vielvölkerstaat
Im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn lebten viele unterschiedliche Völker gemeinsam in einem einzigen großen Reich. Dazu gehörten Deutsche, Tschechen, Ungarn, Slowaken, Polen, Kroaten, Slowenen, Serben, Rumänen, Italiener und viele weitere Volksgruppen. Diese Menschen hatten ihre eigenen Sprachen, Bräuche, Traditionen und Religionen. Trotz dieser Unterschiede sollten sie im selben Staat miteinander leben und zusammenarbeiten. Das war nicht immer leicht, weil jede Volksgruppe ihre eigenen Interessen hatte und anerkannt werden wollte.
Der Aufbau des Vielvölkerstaates
Der Vielvölkerstaat war in viele verschiedene Länder und Regionen unterteilt, wie zum Beispiel Böhmen, Ungarn, Galizien, Tirol oder Kroatien. Kaiser Franz Joseph I. regierte alle diese Gebiete von Wien aus. Viele Völker forderten jedoch mehr Mitbestimmung für ihre eigenen Sprachen und Kulturen. Vor allem Ungarn setzte eigene Rechte durch und bekam 1867 sogar eine eigene Regierung in Budapest. Doch viele andere Völker fühlten sich weiter benachteiligt und kämpften um Gleichberechtigung im Staat.

Verlag
Das Zusammenleben der Sprachen und Kulturen Im Vielvölkerstaat wurden viele verschiedene Sprachen gesprochen. In Böhmen sprach man zum Beispiel Deutsch und Tschechisch, in Ungarn Ungarisch und Kroatisch, in Galizien Polnisch und Ukrainisch. In den Städten, bei der Post oder im Gericht war es oft schwer zu entscheiden, welche Sprache verwendet werden sollte. Das führte manchmal zu Streit und Unzufriedenheit. Trotzdem lebten Menschen aus verschiedenen Kulturen im Alltag zusammen, handelten miteinander und feierten auch gemeinsame Feste.
Was den Vielvölkerstaat zusammenhielt
Trotz aller Unterschiede gab es Dinge, die die Menschen im Vielvölkerstaat miteinander verbanden. Dazu gehörten die gemeinsame Armee, das Postwesen, das Eisenbahnnetz und die Regierung in Wien. Der Kaiser Franz Joseph war für alle Völker das gemeinsame Staatsoberhaupt. Viele Menschen waren stolz darauf, Teil dieses großen Reiches zu sein. Doch die Spannungen zwischen den Volksgruppen blieben bestehen, weil sich nicht alle gerecht behandelt fühlten. Diese Spannungen führten später sogar dazu, dass der Staat auseinanderbrach.
Trage nun hier den Buchstaben richtig ein!
Viele Völker forderten mehr Rechte, weil sie ihre Sprache und Kultur besser geschützt sehen wollten.
Obwohl alle Menschen zum selben Staat gehörten, unterschieden sie sich durch ihre Kultur und ihre Lebensweise.
Dinge wie das gemeinsame Eisenbahnnetz, die Post und die Armee verbanden die verschiedenen Völker miteinander.
In vielen Gegenden des Vielvölkerstaates sprachen die Menschen verschiedene Sprachen, was oft zu Streit führte.
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus
NAME: DATUM:
Blumen, Schwung und bunte Farben – dein Eintrag ins Stammbuch der Jugendstilzeit
Verfasse einen Eintrag auf dieses Blatt eines Stammbuches! Da es aus der Jugendstilzeit stammt, solltest du es besonders farbenprächtig anmalen!
Verlag
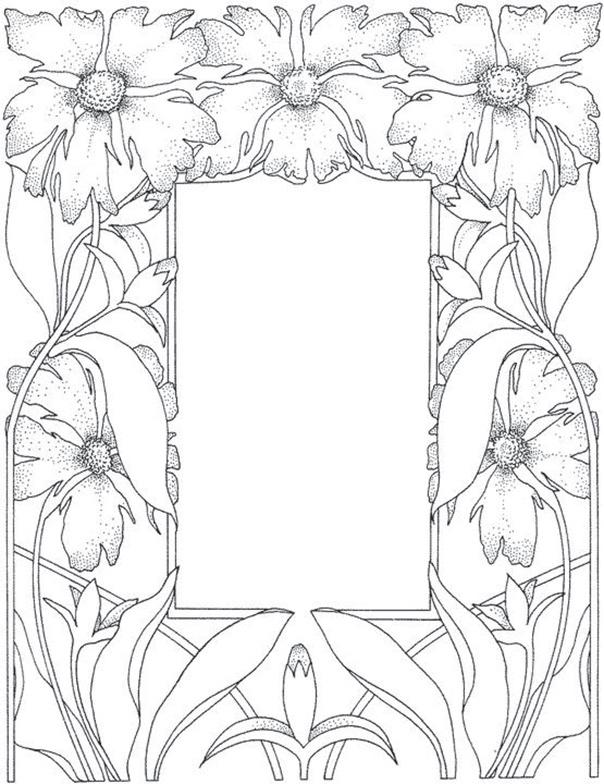
Lernstandserhebung
Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus
NAME: DATUM:
1. Ordne richtig zu! Verbinde mit Pfeilen! 3/
Begriff
Kolonialismus
Imperialismus
Rassismus
Erklärung
Menschen werden nach ihrer Herkunft oder Hautfarbe als „weniger wert“ angesehen.
Ein Land beherrscht andere Gebiete und nutzt sie für seine eigenen Interessen.
Mächte wollen ihre Gebiete und ihren Einfluss immer weiter ausdehnen.
2. Setze die Begriffe richtig ein! 5/
Der Kolonialismus diente dazu, wie Gold, Baumwolle oder Kaffee aus anderen Ländern zu holen.
Die europäischen Länder wollten mit den viel Geld verdienen.
Oft wurde der benutzt, um die Ausbeutung zu rechtfertigen.
Mit ihren vergrößerten die Mächte ihren auf der Welt.
Verlag
4. Was war das Ziel der imperialistischen Politik? 4/ Kolonien * Handel * Rohstoffe * Rassismus * Macht
3. Nenne zwei europäische Länder, die besonders viele Kolonien hatten! 2/
Lernstandserhebung / KOPIERVORLAGE
Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus
NAME: DATUM:
5. Wer ist das? 5/
Name: ________________________________________________
Land: _________________________________________________
Regierungsbeginn: _______________________________________
War verheiratet mit: ______________________________________
Regierte: absolut aufgeklärt
6. Nenne 4 Völker aus der Donaumonarchie!

7. Kreuze die richtigen Antworten an! Achtung: Bei einigen Fragen sind mehrere Antworten richtig! 10/
Wie nannte man den Herrscher des Osmanischen Reiches?
Kaiser Sultan Pharao Präsident
Welche Regionen gehörten über viele Jahrhunderte zum Osmanischen Reich?
Nordafrika der Balkan Skandinavien der Nahe Osten
Was war eine wichtige Aufgabe des Sultans?
Er sollte alle Menschen gleich behandeln, egal welcher Religion sie angehörten.
Er musste alle Völker unterdrücken.
Er musste das Land vor Angriffen schützen.
Er war gleichzeitig religiöser Führer des Islam.
Warum gab es im Osmanischen Reich immer wieder Konflikte?
Weil viele verschiedene Völker und Religionen zusammenlebten.
Weil alle Menschen die gleiche Sprache sprachen.
Weil nicht alle Völker die gleichen Rechte hatten.
Weil das Reich zu wenig Land hatte.
Olympe Verlag
30-33= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
26-29 = du hast dir viel gemerkt
22-25 = du weißt schon einiges
17-21 = du solltest noch viel üben
< 16 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
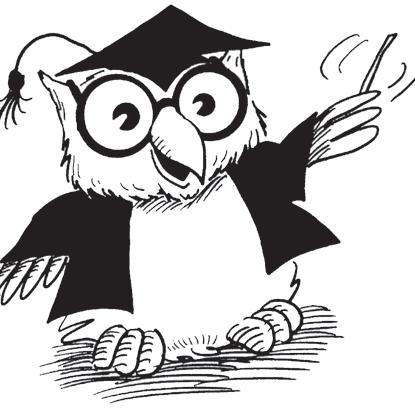
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 96 - 113
K. 1/S. 97/3 mögliche Lösung: Die europäischen Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Belgien wollten im 19. Jahrhundert immer reicher und mächtiger werden. Deshalb suchten sie nach neuen Gebieten, in denen sie Rohstoffe wie Gold, Elfenbein, Baumwolle, Kautschuk oder Öl finden konnten.
Entdecker wie David Livingstone reisten nach Afrika, um den Kontinent zu erforschen. Sie berichteten von den reichen Bodenschätzen und den vielen Menschen, die dort lebten. Diese Berichte machten die europäischen Länder neugierig und gierig.
Die europäischen Staaten begannen daraufhin, Afrika aufzuteilen und zu erobern. Sie sagten, sie wollten den Menschen helfen – in Wirklichkeit wollten sie aber das Land, die Rohstoffe und die Arbeitskraft der Afrikaner ausnutzen.
Viele Afrikaner wurden zur Arbeit gezwungen oder unterdrückt, und die reichen Erträge gingen meist nach Europa, während die Menschen in Afrika arm blieben.
K. 1/S. 97/4 mögliche Lösung: Auf dem Bild sieht man zwei europäische Männer in der Mitte, die sich begrüßen. Einer von ihnen ist Henry Morton Stanley (rechts mit blauem Anzug), der andere vermutlich David Livingstone (links in heller Kleidung). Ein Mann mit nacktem Oberkörper und rotem Tuch steht zwischen ihnen und hält eine amerikanische Flagge. Rundherum stehen viele afrikanische Männer, die meist weiße Gewänder und Turbane tragen. Links sieht man auch Menschen, die Lasten tragen. Im Hintergrund sind Hütten mit Strohdächern zu sehen, die auf ein afrikanisches Dorf hindeuten.
Wie sind Stanley und Livingstone dargestellt? Die beiden stehen im Mittelpunkt und werden respektvoll begrüßt. Stanley erscheint mächtig, weil er die Flagge präsentiert und die Afrikaner ihm zuhören. Livingstone wirkt wie ein wichtiger Gast. Beide sind klar hervorgehoben, während die Afrikaner am Rand stehen oder knien.
Was fällt auf? Die amerikanische Flagge wirkt fehl am Platz, da es eigentlich um europäische Kolonialisten ging. * Die Afrikaner werden nicht als gleichwertige Partner gezeigt, sondern eher als Zuschauer oder Helfer. * Die Szene stellt die Europäer als Helden dar und zeigt nicht die Leidensgeschichte der einheimischen Bevölkerung.
Verlag
K. 1/S. 97/6 mögliche Lösung: Das Bild stellt Stanley und Livingstone als Helden und „Retter“ dar. Sie stehen im Mittelpunkt, während die afrikanische Bevölkerung um sie herum passiv dargestellt wird. Die amerikanische Flagge wird auffällig gezeigt, obwohl es sich eigentlich um eine europäische Expedition handelt. Sie soll vermutlich den Eindruck vermitteln, dass die Europäer bzw. Amerikaner Frieden und Zivilisation bringen. Auch die Kleidung ist auffällig gewählt:
• Die Europäer tragen westliche, elegante Kleidung, was sie mächtig, überlegen und gebildet wirken lässt.
• Die Afrikaner tragen traditionelle oder einfache Kleidung, viele stehen barfuß da oder tragen Lasten, was sie untergeordnet und „rückständig“ erscheinen lässt.
Die Hütten im Hintergrund und die bewaffneten Träger sollen vielleicht ein exotisches, gefährliches Afrika zeigen, das von den „fortschrittlichen“ Europäern erobert und geordnet wird.
Wirkung auf die Betrachterinnen und Betrachter:
• Die Europäer wirken wie mutige Entdecker.
• Afrika erscheint als ein „unerforschtes, zurückgebliebenes“ Land, das auf die Hilfe von Europäern angewiesen sei.
• Die koloniale Sichtweise wird verstärkt, weil die einheimische Bevölkerung keine eigene Stimme oder Macht zu haben scheint.
Solche Bilder sollten damals den Kolonialismus rechtfertigen und den Europäern ein gutes Gefühl geben, obwohl er für viele Menschen in den Kolonien Leid und Ausbeutung bedeutete.
K. 4/S. 97/7 mögliche Lösung: Der Künstler hat Stanley und Livingstone sehr hervorgehoben:
• Ihre Kleidung zeigt sie als wohlhabend, gebildet und überlegen.
• Ihr selbstbewusster Stand und die Geste der Begrüßung wirken überlegen und kontrolliert.
• Beide sind freundlich und würdevoll dargestellt, fast so, als wären sie Friedensbringer oder Helden.
Im Gegensatz dazu sind die afrikanischen Menschen:
• in schlichte, traditionelle Kleidung gehüllt,
• meist ernst oder unterwürfig dargestellt,
• eher am Rand der Szene, nicht im Mittelpunkt.
Durch diese Darstellung will der Künstler wahrscheinlich den Eindruck vermitteln, dass die Europäer zivilisiert, überlegen und ordnend wirken, während die afrikanische Bevölkerung passiv und abhängig gezeigt wird.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 96 - 113
Was sagt uns das Bild über die Begegnung?
Das Bild erzählt nicht die ganze Wahrheit.
• Es zeigt die Begegnung als harmonisches, bedeutendes Ereignis, das von Respekt und Frieden geprägt ist.
• Probleme wie Gewalt, Ausbeutung oder Machtinteressen werden komplett ausgeblendet.
• Die afrikanische Sichtweise fehlt völlig.
Das Bild diente vermutlich dazu, den Kolonialismus zu verherrlichen und die Europäer als Helden darzustellen – es zeigt also eine einseitige, europäische Perspektive, die den wahren Charakter der Kolonisierung verschleiert.
K. 3/S. 104/1 mögliche Lösung:
1. Beschreiben
• Zu sehen ist ein dunkelhäutiger Mann, der von einer Schlange umwickelt wird.
• Der Kopf der Schlange ist das Gesicht von Leopold II., dem König von Belgien, mit einer Krone.
• Im Hintergrund sieht man einfache Hütten und weitere Menschen, die offenbar fliehen oder Angst haben.
• Die Schlange hält den Mann in einem festen Würgegriff, der Mann kämpft verzweifelt dagegen an.
2. Deuten
• Die Schlange steht symbolisch für Gefahr, Gewalt und Unterdrückung.
• Leopold II. wird hier als Täter dargestellt, der die Menschen im Kongo ausbeutet und würgt.
• Der Mann steht für die afrikanische Bevölkerung, die sich gegen diese gewaltsame Ausbeutung wehrt, aber wenig Chancen hat.
• Die fliehenden Menschen zeigen, dass die Angst und das Leid viele betrifft.
3. Historischer Zusammenhang
• Leopold II. war belgischer König und ließ den Kongo brutal ausbeuten, um Rohstoffe wie Kautschuk und Elfenbein zu gewinnen.
• Dabei wurden Millionen Menschen versklavt, gefoltert oder getötet.
Verlag
• Die Karikatur kritisiert diese grausame Kolonialherrschaft und zeigt, dass Leopold II. für viele das Symbol für Unterdrückung war.
4. Zentrale Aussage
• Die Karikatur zeigt, dass Leopold II. mit Gewalt und Unterdrückung die Bevölkerung im Kongo ausbeutet, so wie eine Schlange ihre Beute erwürgt.
K. 3/S. 104/3 mögliche Lösung: Meine Meinung: Ich finde, dass der Karikaturist König Leopold II. sehr kritisch gegenübersteht. Begründung: Der König wird nicht als ehrenvoller Herrscher gezeigt, sondern als gefährliche Schlange, die Menschen im Kongo brutal erwürgt. Das zeigt, dass der Karikaturist seine Taten als grausam, unmenschlich und zerstörerisch verurteilt. Die Karikatur macht deutlich, dass Leopold II. nur Macht und Profit im Sinn hatte und dafür das Leid der Menschen in Kauf nahm.
K. 3/S. 105/5 waagrecht: 3. Dominion * 4. Sezession * 5. Absatzmarkt * 6. Legitim senkrecht: 1. Terminisierung * 2. Kolonialismus
K. 3/S. 105/6 mögliche Lösung:
a) Beschreibung der Darstellung: Die Karikatur zeigt links Premierminister Benjamin Disraeli, verkleidet in einem orientalischen Gewand, das stark übertrieben und fast wie ein Theaterkostüm wirkt. Er hält in seinen Händen eine große, prunkvolle Krone und bietet sie Queen Victoria an, die rechts steht. Die Queen ist in einem dunklen, würdevollen Kleid dargestellt, das sie schlicht und ernst wirken lässt. Beide stehen auf Stufen vor einem palastartigen Gebäude, was Macht und Herrschaft andeutet.
b) Historischer Bezug: Die Karikatur bezieht sich auf das Jahr 1876, als Disraeli Queen Victoria den Titel „Kaiserin von Indien“ verschaffte. Die Darstellung ist eher kritisch: Disraeli wirkt wie ein geschäftiger Händler, der der Queen „neue Kronen“ verkauft, was darauf hinweist, dass der Titel mehr ein politischer Handel als eine echte Errungenschaft war.
c) Bedeutung des Spruchs: „New crowns for old ones“ spielt auf den angeblichen Gewinn an Macht an, der in Wahrheit vielleicht keinen echten Wert hat. Die Krone für Indien soll wie ein neues Schmuckstück wirken, das aber eigentlich nichts an der realen Machtposition der Queen ändert. Der Künstler kritisiert damit, dass der Titel nur ein leeres Prestigeobjekt sein könnte.
d) Stilistische Mittel: Die Karikatur übertreibt Disraelis Darstellung durch seine auffällige Kleidung und sein aufdringliches Händlerverhalten. Diese Überzeichnung macht ihn lächerlich und zeigt, dass der Künstler ihn als jemanden darstellen möchte, der mehr „verkauft“ als politisch ernsthaft handelt.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 96 - 113
e) Wirkung der Personen: Disraeli wirkt durch die übertriebene Kleidung und Haltung unseriös und wenig glaubwürdig. Queen Victoria hingegen wirkt streng, würdevoll und etwas skeptisch gegenüber dem „Angebot“. Die beiden wirken ungleich, was die Machtverhältnisse infrage stellt. f) Botschaft über Rollen und Handlungen: Die Karikatur zeigt Disraeli als treibende Kraft hinter der Machterweiterung, aber auch als jemanden, der aus politischem Kalkül handelt. Die Queen wird eher passiv dargestellt, was den Eindruck vermittelt, dass sie sich von Disraeli beeinflussen lässt.
g) Kommentar zu Karikaturen: Karikaturen wie diese sind ein starkes Mittel, um politische oder gesellschaftliche Entwicklungen zu kritisieren. Durch Übertreibung und Humor regen sie zum Nachdenken an. Sie können helfen, politische Absichten und Machtspiele zu entlarven, aber auch einseitige Bilder vermitteln. Sie fordern die Betrachtenden heraus, ihre eigene Meinung zu hinterfragen.
K. 5/S. 110/1 Aussagen zu Österreich-Ungarn: Tagespolitik in den Parlamenten von Wien und Budapest * Brennpunkte in Böhmen und Mähren, wo Tschechen und Deutsche zusammenlebten * Balkanstaaten wandten sich gegen Österreich-Ungarn
K. 5/S. 110/2
Aussagen zum Osmanischen Reich: Osmanisten, die eine imperiale Identität wollten * Jungtürken und andere nationale Bewegungen an der Peripherie * Enormer Machtverlust durch die Balkankriege und Verlust fast aller europäischen Territorien
Gemeinsame Aussagen: Beide monarchistisch geprägte, multiethnische Reiche * Beide mit Nationalitätenproblemen und inneren Konflikten * Krisenstimmung und Untergangsstimmung seit Ende des 19. Jahrhunderts * Beide galten vor 1914 als die schwächsten Imperien * Beide in der Defensive gegenüber den Balkanstaaten
Aussagen
Die Balkanstaaten verlangten ihre Unabhängigkeit.
Alle europäischen Territorien gingen verloren.
Verlag
ÖsterreichUngarn Beide
In den Parlamenten wurde zum Großteil über das Nationalitätenproblem debattiert.
Die Herrschaftsform war die Monarchie.
Es lebten viele unterschiedliche Ethnien im Reichsgebiet.
Eine imperiale Identität wurde angestrebt.
Der europäische Nationalismus beeinflusste die „Jungtürken“.
Zeitungsberichte gaben eine Untergangsstimmung wieder.
Brennpunkte waren Böhmen und Mähren.
K. 5/S. 111/4 mögliche Lösung:
Türkische Regierung:
• Umgang mit den Armenierinnen und Armeniern: Die türkische Regierung sah die Armenier als Bedrohung und nutzte den Krieg als Vorwand für einen Völkermord. Männer wurden ermordet, Frauen und Kinder auf Todesmärsche geschickt, viele verhungerten oder verdursteten. Rund eine Million Menschen starben.
• Maßnahmen: Enteignung und Vertreibung * Massaker und Todesmärsche * Zerstörung der armenischen Gemeinschaft
• Interessen: Aufbau eines rein türkischen Nationalstaats ohne starke Minderheiten * Ausschaltung einer wirtschaftlich und politisch einflussreichen Bevölkerungsgruppe
Britische Regierung:
• Umgang mit den Kurdinnen und Kurden: Zunächst wurde den Kurdinnen und Kurden ein eigener Staat versprochen, später aber von den Briten fallengelassen. Die Kurden wurden auf fünf Staaten aufgeteilt, ihre Sprache und Selbstverwaltung vor allem in der Türkei unterdrückt.
• Maßnahmen: Bruch des Versprechens eines eigenen Staates * Tolerierung der Unterdrückung durch andere Staaten
• Interessen: Kontrolle über die ölreiche Region um Kirkuk * Stärkung eigener wirtschaftlicher und politischer Macht im Nahen Osten
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 96 - 113
K. 5/S. 111/5 a) Analyse des Bündnisses und der Herrscher:Die Postkarte zeigt das Bündnis der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg. von links nach rechts sind folgende Herrscher dargestellt: Wilhelm II. (Deutsches Reich) * Franz Josef I. (Österreich-Ungarn) * Mehmet V. (Osmanisches Reich) * Ferdinand I. (Bulgarien)
b) Politischer Zweck der Postkarte: Die Postkarte entstand 1916 mitten im Ersten Weltkrieg. Ihr Ziel war es, die Bevölkerung zu ermutigen und den Eindruck zu vermitteln, dass das Bündnis der Mittelmächte stark und siegessicher sei. Sie sollte den Durchhaltewillen stärken und Vertrauen in den militärischen Erfolg schaffen.
c) Interpretation des Spruchs: „Vereinte Kräfte führen zum Ziel“ soll vermitteln, dass nur durch das enge Zusammenarbeiten dieser vier Staaten der Sieg erreichbar ist. Die Botschaft lautet: Gemeinsam sind wir stark und können den Krieg gewinnen.
d) Analyse der Herrscherdarstellung: Alle Herrscher sind in prunkvollen Uniformen und mit Orden geschmückt dargestellt, was Macht und Stärke symbolisieren soll. Ihre ernsten, selbstbewussten Blicke und die enge Anordnung ihrer Porträts betonen Einigkeit und Entschlossenheit.
e) Stimmungsbeurteilung und Wahrnehmung: Die Postkarte vermittelt eine optimistische und kraftvolle Stimmung. Die leuchtenden Farben der Nationalflaggen, die Lorbeerzweige (Siegessymbol) und der eindrucksvolle Spruch wirken motivierend. Das Zusammenspiel von Symbolen und Herrscherporträts soll Zuversicht schaffen und den Eindruck eines unbesiegbaren Bündnisses erwecken. Für damalige Betrachterinnen und Betrachter sollte die Karte Hoffnung und Stolz erzeugen.
Lösungen LehrerInnenheft, S. 69 - 73
AB 1 Lösungswort: Kolonialpolitik
AB 2 von oben nach unten: C * A * D * B
AB 3 eigene Lösung
Lernstandserhebung
Verlag
1. Kolonialismus: Ein Land beherrscht andere Gebiete und nutzt sie für seine eigenen Interessen. * Imperialismus: Mächte wollen ihre Gebiete und ihren Einfluss immer weiter ausdehnen. * Rassismus: Menschen werden nach ihrer Herkunft oder Hautfarbe als „weniger wert“ angesehen.
2. Der Kolonialismus diente dazu, Rohstoffe wie Gold, Baumwolle oder Kaffee aus anderen Ländern zu holen. Die europäischen Länder wollten mit den Kolonien viel Geld verdienen. Oft wurde der Rassismus benutzt, um die Ausbeutung zu rechtfertigen. Mit ihren Kolonien vergrößerten die Mächte ihren Einfluss auf der Welt.
3. Großbritannien * Frankreich
4. Das Ziel der imperialistischen Politik war es, den Einfluss und die Macht des eigenen Landes über andere Regionen der Welt auszudehnen. Die europäischen Großmächte wollten möglichst viele Kolonien besitzen, um dort wertvolle Rohstoffe wie Gold, Öl, Baumwolle, Kaffee oder Edelholz zu gewinnen. Gleichzeitig suchten sie nach billigen Arbeitskräften, die für sie auf den Plantagen oder in den Minen arbeiteten.
Außerdem wollten die Länder ihre eigenen Industrieprodukte – wie Maschinen, Kleidung oder Waffen – in den Kolonien verkaufen. Diese neuen Märkte waren für die Wirtschaft sehr wichtig. Ein weiteres Ziel war es, militärisch und politisch möglichst stark zu erscheinen und Prestige zu gewinnen. Viele Staaten dachten damals, dass ein Land nur dann als mächtig gilt, wenn es möglichst viele Gebiete und Völker beherrscht.
5. Kaiser Franz Joseph I. * Österreich * 1848 * Elisabeth (Sisi) * absolut
6. Deutsche * Tschechen * Slowaken * Polen * Ruthenen * Slowenen * Italiener * Ungarn * Kroaten * Serben * Rumänen
7. Sultan * Nordafrika, der Balkan, der Nahe Osten * Er sollte alle Menschen gleich behandeln, egal welcher Religion sie angehörten. Er musste das Land vor Angriffen schützen. Er war gleichzeitig religiöser Führer des Islam. * Weil viele verschiedene Völker und Religionen zusammenlebten. Weil nicht alle Völker die gleichen Rechte hatten.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Migration vom 19. Jh. bis in die Gegenwart
NAME: DATUM:
Viktor Adler und die Sozialreportage
Diesen Text über Viktor Adler sollst du nur kurz überfliegend lesen!
1 5 10 15 20 25
Bereits 1775 hatte das Militär am Wienerberg Ziegelbrennereien, die k. k. Fortifikationsziegelöfen, errichtet. Mitte des 19. Jahrhunderts schufen zwei Privatunternehmer einen Großbetrieb zur Ziegelgewinnung. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur und der Bauboom ließen die Nachfrage nach Ziegeln sprunghaft ansteigen. 1869 wurden die Ziegelwerke im Süden Wiens von einer Aktiengesellschaft übernommen. Doch während diese Aktiengesellschaft hohe Gewinne machte, arbeiteten und lebten ihre Tausenden Arbeiterinnen und Arbeiter unter schrecklichen Bedingungen in den Ziegelwerken. Von den beiden Ziegelarbeitern Johann Raab und Ludwig Halder wurde der Nerven- und Armenarzt Viktor Adler auf die Zustände am Wienerberg aufmerksam gemacht. Als Maurer verkleidet, schlich sich Viktor Adler in das Ziegelwerk am Wienerberg ein. Seine Eindrücke schilderte er in mehreren Sozialreportagen, die in der Zeitschrift „Die Gleichheit“ veröffentlicht wurden. In diesen Reportagen beschrieb Adler ausführlich das Elend der „Ziegelsklaven“.
Er schrieb überAusbeutung und unvorstellbares Elend. Damit wurde die Öffentlichkeit erstmals auf die fürchterliche Ausbeutung der, meist aus Böhmen und der Slowakei zugewanderten, Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter aufmerksam gemacht. Victor Adler prangerte die überlangen Arbeitszeiten an. Siebenmal in der Woche musste damals täglich, bis zu 15 Stunden, gearbeitet werden. Adler klagte aber auch die grauenhaften Wohnverhältnisse an: Die Artikelserien vom Dezember 1888 erregten so viel Aufsehen, dass die Gewerbebehörde einschritt. Als eine der ersten in einer Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation wurde das ohnehin verbotene „Trucksystem“ abgeschafft. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden fast ausschließlich in „Blechgeld“ bezahlt. Dieses sogenannte „Truck-System“ bedeutete, dass die ausbezahlten Blechmarken nur in den Kantinen und Geschäften am Betriebsgelände eingelöst werden konnten. Dort wurden meist Waren schlechter Qualität zu überhöhten Preisen angeboten. Die Wienerberger Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter verehrten Viktor Adler wegen seines Engagements für ihre Arbeits- und Lebensbedingungen Zeit seines Lebens beinahe religiös.
Finde nun, so schnell du kannst, die folgenden Informationen!
In welchen Zeilen steht, dass …
… Viktor Adler die überlangen Arbeitszeiten anprangerte?
… seine Sozialreportagen in der Zeitschrift „Die Gleichheit“ veröffentlicht wurden?
… die Wiener Ziegelarbeterinnen und Ziegelarbeiter Viktor Adler verehrten?
Olympe Verlag
… bis zu 15 Stunden pro Tag gearbeitet werden musste?
... der Großteil der Ziegelarbeiter aus Böhmen und der Slowakei stammte?
… dass die Gewerbebehörde einschritt?
… die Nachfrage nach Ziegeln sprunghaft anstieg?
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Zeilen: ___________
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Migration vom 19. Jh. bis in die Gegenwart
NAME: DATUM:
Begriffslexikon
Im folgenden Suchrätsel haben sich 14 Begriffe zum Thema Migration versteckt. Suche diese und markiere sie mit Leuchtstift! Tipp: Suche waagrecht, senkrecht und diagonal!
Verlag
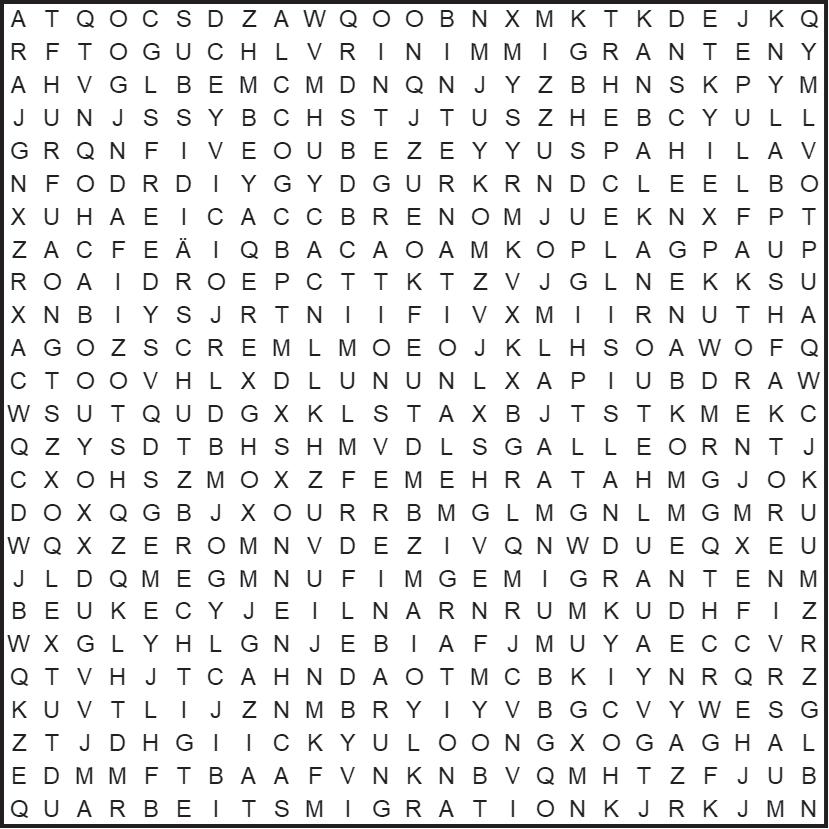
Wähle nun drei Begriffe aus und erkläre ihre Bedeutung!
WORT BEDEUTUNG




Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Migration vom 19. Jh. bis in die Gegenwart
NAME: DATUM:
Auswanderung in die USA
Schnippeltext – Hier ist einiges durcheinandergekommen. Schneide zuerst die Textteile aus! Dann lege die Textteile in der richtigen Reihenfolge auf! Beginne mit „1867 wurde …“! Zum Schluss klebe die Textteile auf ein Blatt Papier!
Menschen versprachen sich durch die Auswanderung eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Andererseits wurde die Auswanderung durch verbesserte Bahn- und Schiffsverbindungen erleichtert. Nicht zuletzt wurden in den USA billige
Bremen oder Hamburg (Deutschland), Le Havre (Frankreich), Antwerpen oder Rotterdam (Niederlande) sowie Triest (Österreich) waren jene Häfen, von denen Schiffe nach Amerika ablegten. Die Überfahrt erfolgte zumeist im Zwischendeck, in
1867 wurde im Staatsgrundgesetz das Prinzip der Freiheit der Auswanderung aller Bürgerinnen und Bürger verankert. Daraufhin stieg die Auswanderung aus der Habsburgermonarchie in die USA stetig an. So zählten ab 1900 neben Russen
Arbeitskräfte gesucht. Auch die Löhne waren für ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter wesentlich höher als in Österreich-Ungarn. Die meisten Auswandererinnen und Auswander traten ihre Reise zu Fuß, dann mit der Bahn zum nächstgelegenen Hafen an.
Verlag
Einwanderungsinspektoren entschieden, wer einreisen durfte und wer zurückgeschickt wurde. Einerseits wurden die Dokumente der Immigrantinnen und Immigranten genau geprüft, andererseits wurden die Menschen
und Italienern Einwandererinnen und Einwander aus Osterreich-Ungarn zur größten Gruppe. Die Gründe für die Auswanderung waren vielfältig. Einerseits war die wirtschaftliche Situation in vielen Teilen Österreich-Ungarns schlecht. Die
das provisorisch kleine Kabinen eingebaut wurden, die auf der Rückreise nach Europa wieder herausgenommen wurden. Dann wurden an Stelle der Passagiere Waren befördert. Der überwiegende Teil der Einwandererinnen und Einwander
auch medizinisch untersucht. War jemand zu krank oder zu schwach zum Arbeiten, schickte man ihn in seine Heimat zurück. 1954 wurde das Durchgangslager Ellis Island geschlossen. 1990 wurde dort ein Museum errichtet.
kam in New York an. 1892 wurde auf einer Insel vor New York, auf Ellis Island, eine Kontrollstation eingerichtet. Zwischen 1892 und 1954 kamen Millionen Einwandererinnen und Einwander auf Ellis Island an. In diesem Durchgangslager wurde von
Lernstandserhebung
Migration vom 19. Jh. bis in die Gegenwart
NAME: DATUM:
1. Erkläre in eigenen Worten folgende Begriffe! 4/ Arbeitsmigration:
Flucht:
Integration:
Push- und Pull-Faktoren:
2. Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind! 8/
Die meisten Menschen fliehen freiwillig aus ihrem Heimatland. Push-Faktoren sind Bedingungen, die Menschen zur Auswanderung bewegen.
Migration hat es nur in der heutigen Zeit gegeben.
Verlag
Alle Migrantinnen und Migranten finden sofort Arbeit im Zielland. Migrationsbewegungen betreffen weltweit alle Kontinente.
Alle Menschen, die ihr Land verlassen, bekommen automatisch Asyl in Europa.
Migration kann für das Aufnahmeland auch wirtschaftliche Vorteile bringen.
Integration bedeutet, dass Migrantinnen und Migranten ihre eigene Kultur vollständig aufgeben müssen.
richtig falsch
3. Setze die passenden Begriffe ein! 7/
Im 19. Jahrhundert wanderten viele Menschen aus nach aus, weil sie unter und litten. Heute fliehen viele Menschen aus nach , weil dort herrscht.
18-19= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister 15-17 = du hast dir viel gemerkt
12-14 = du weißt schon einiges
10-11 = du solltest noch viel üben
< 9 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
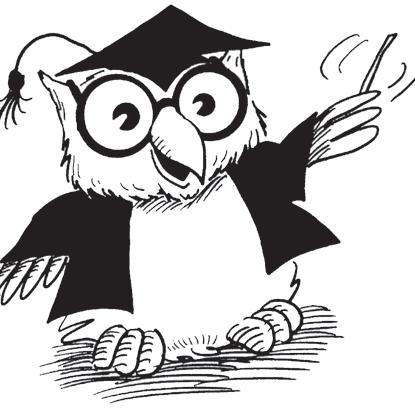
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 114 - 127
K. 1/S. 116/2 mögliche Lösung:
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Er ist ein europaweit einheitliches System, um die Sprachkenntnisse von Menschen zu vergleichen und einzuordnen. Zum Beispiel bedeutet das Niveau A2, dass jemand einfache Sätze versteht. Das Niveau B1 zeigt, dass jemand die Standardsprache schon gut benutzen kann.
2. Subsidiär Schutzberechtigte: Das sind Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, aber keinen vollen Asylschutz bekommen. Sie erhalten einen vorübergehenden Schutz, der regelmäßig erneuert werden muss, damit sie weiter im Land bleiben dürfen.
K. 1/S. 116/9 mögliche Lösung: Asyl: Asyl bedeutet, dass ein Mensch, der in seinem Heimatland verfolgt wird, in einem anderen Land Schutz sucht und bleiben darf, um sicher zu leben.
* Genfer Flüchtlingskonvention: Das ist ein internationaler Vertrag, in dem festgelegt ist, wer als Flüchtling gilt und welche Rechte Flüchtlinge haben, zum Beispiel Schutz vor Verfolgung und das Recht auf Sicherheit.
* Binnenmigration: Binnenmigration bedeutet, dass Menschen innerhalb eines Landes von einem Ort zum anderen ziehen, zum Beispiel von einem Dorf in eine Stadt.
K. 4/S. 122/1 mögliche Lösung: D1 – Paris um 1879: Migration vom französischen Land in die Hauptstadt * D2 –Von London nach Kanada um 1905: Europäische Auswanderung nach Übersee * D3 – Istanbul ab den 1950er-Jahren: Massenmigration aus Anatolien in die türkische Großstadt * D4 – Amsterdam um 1992: Migration aus Marokko in niederländische Vororte
K. 4/S. 122/2 mögliche Lösung: D1 (Paris 1879): Armut, Hungersnot, Hoffnung auf bessere Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt. * D2 (Kanada 1905): Elend in den Slums von London, Hoffnung auf Landbesitz, Arbeit und ein besseres Leben in Kanada. * D3 (Istanbul ab 1950): Suche nach Arbeit und besseren Lebensbedingungen, Flucht vor Armut und Perspektivlosigkeit auf dem Land. * D4 (Amsterdam 1992): Suche nach Arbeit als Lehrer, Hoffnung auf bessere Zukunft, gesellschaftliche Teilhabe in Europa.
Verlag
Gemeinsamkeiten: Alle Migrantinnen und Migranten verließen arme oder aussichtslose Lebenssituationen. * Arbeit und bessere Lebensbedingungen waren zentrale Gründe für alle. * Alle mussten große Umstellungen und Enttäuschungen erleben. * In allen Fällen zeigt sich, dass Migration Hoffnungen und Schwierigkeiten zugleich bringt.
Unterschiede: D1 und D3 zeigen Migration innerhalb eines Landes (Land-Stadt). * D2 und D4 zeigen internationale Migration über große Entfernungen. * D2 betont die Auswanderung ins „Neuland“ Kanada, mit dem Ziel eines eigenen Stücks Land. * D4 zeigt, dass es trotz guter Arbeit große Integrationsprobleme gab (Sprache, Ausgrenzung). * D1 und D3 zeigen Massenbewegungen, während D2 und D4 eher Einzelschicksale schildern.
K. 4/ S. 122/3 mögliche Lösung: Migration bedeutet, dass Menschen ihren Wohnort dauerhaft verlassen, um anderswo ein besseres Leben zu finden. Die Darstellungen zeigen, dass Migration oft aus Armut, Hoffnungslosigkeit oder Krisen heraus geschieht. Viele Menschen suchen in Städten, anderen Ländern oder sogar auf anderen Kontinenten Arbeit, Bildung oder Sicherheit. Typisch ist, dass Migrantinnen und Migranten häufig mit schwierigen Lebensbedingungen am neuen Ort konfrontiert sind. Dazu gehören schlechte Unterkünfte, geringe Löhne und soziale Ausgrenzung. Manche schaffen es, Fuß zu fassen und ein neues Leben aufzubauen, andere bleiben arm oder ausgeschlossen.
Migration geschieht seit Jahrhunderten und betrifft viele Regionen der Welt. Sie ist sowohl ein wirtschaftliches als auch ein soziales Phänomen, das Gesellschaften verändert und herausfordert. Alle Beispiele zeigen auch: Migration ist selten ein einfacher Schritt. Sie ist immer verbunden mit Hoffnungen, Ängsten, Neuanfängen und oft auch mit Enttäuschungen.
K. 4/S. 123/4 mögliche Lösung: Arbeitsmigration bedeutet, dass Menschen frei entscheiden, in ein anderes Land oder eine andere Stadt zu ziehen, um dort bessere Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Sie suchen meist freiwillig nach besseren Löhnen, Karrierechancen oder Lebensbedingungen. Flucht dagegen passiert, weil Menschen gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen – zum Beispiel wegen Krieg, Verfolgung, Naturkatastrophen oder Lebensgefahr. Sie haben oft keine andere Wahl, weil ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht ist.
Während Arbeitsmigrantinnen und -migranten meist geplant und mit Zukunftshoffnungen reisen, geschieht Flucht oft ungeplant, unter Zeitdruck und mit großer Unsicherheit. Auch die Aufnahmebedingungen in den Zielländern sind häufig unterschiedlich: Flüchtlinge erhalten meist Schutz, während Arbeitsmigrantinnen und -migranten Arbeitserlaubnisse oder Visas benötigen.
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 114 - 127
K. 4/S. 124/6 + 7 mögliche Lösung: Die Statistik zeigt die Entwicklung der Asylanträge und der Anerkennungen von Flüchtlingen in Österreich von 2012 bis 2022. Insgesamt ist erkennbar, dass die Zahl der Asylanträge im Jahr 2015 mit rund 90.000 einen ersten Höchststand erreichte. Das war in der Zeit der sogenannten „Flüchtlingskrise“. Danach sanken die Anträge wieder, bis sie 2022 mit über 100.000 einen neuen Höchstwert erreichten.
Auffällig ist, dass die Zahl der Anerkennungen von Flüchtlingen deutlich unter der Zahl der gestellten Asylanträge liegt. Besonders groß ist der Unterschied in den Jahren 2015 und 2022: Obwohl sehr viele Asylanträge gestellt wurden, blieb die Zahl der Anerkennungen vergleichsweise niedrig. 2016 und 2017 war das Verhältnis etwas ausgeglichener, die Zahl der anerkannten Flüchtlinge war in diesen Jahren relativ hoch im Vergleich zu den Anträgen.
In den Folgejahren 2018 bis 2021 sanken sowohl die Asylanträge als auch die Anerkennungen, wobei die Anerkennungen immer auf einem niedrigeren Niveau blieben. 2022 stiegen die Asylanträge wieder stark an, während die Anerkennungen weiterhin deutlich geringer blieben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Österreich in den letzten zehn Jahren immer mehr Asylanträge erhalten hat, die Zahl der tatsächlich anerkannten Flüchtlinge jedoch in keinem Jahr mit der Zahl der Anträge Schritt halten konnte. Das zeigt, dass viele Anträge entweder abgelehnt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden.
K. 4/S. 126/12 mögliche Lösung:
1. Beschreibung der Karikaturen
Bild 1: Willkommen in der „Arche USA“ Personen: Viele unterschiedliche Menschen aus Europa mit Koffern und Bündeln, die in die „Arche“ steigen. Uncle Sam begrüßt sie freundlich.
Ort: An einem Ufer mit einem großen amerikanischen Schiff („U.S. Ark of Refuge“).
Symbole: Schild mit Versprechen wie „Free Land“, „Free Speech“ etc. * US-Flagge * Großes Plakat gegen Steuern, Könige, Militärdienst und Gewalt.
Farbgebung: Hell, freundlich, einladend.
Botschaft: Die USA präsentieren sich als Zufluchtsort für alle, die in Europa unterdrückt werden.
Bild 2: Ablehnung am Hafen
Verlag
Personen: Gut gekleidete Männer, die mit abwehrender Geste einen Neuankömmling (mit Bündeln, Werkzeugen und einer Flasche) zurückweisen.
Ort: An einer Hafenkante mit sichtbarem Seil.
Symbole: Die wohlhabenden Männer stellen die „etablierten Amerikaner“ dar. * Der Einwanderer wird als bedrohlich, schmutzig oder unerwünscht dargestellt.
Farbgebung: Deutlich kühler, weniger einladend.
Botschaft: Die einstige Willkommenskultur schlägt in Ablehnung um.
2. Vergleich der beiden Karikaturen
Gemeinsamkeiten: Beide zeigen Einwanderer an einem Hafen. * Beide zeigen gesellschaftliche Reaktionen auf Migration.
Unterschiede: Bild 1 vermittelt Offenheit, Hoffnung und Integration. * Bild 2 zeigt Ablehnung, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. * In Bild 1 ist der Staat (Uncle Sam) Gastgeber, in Bild 2 lehnen Bürger ab.
3. Analyse der Mittel der Übertreibung Überzeichnete Gesichtszüge und Gesten. * Übertrieben große Schilder und Plakate. * Stereotypische Darstellung der Einwanderer. * Einsatz von HellDunkel-Kontrasten.
4. Wirkung auf die Betrachterinnen und Betrachter: Bild 1: Ermutigend, Hoffnung auf ein besseres Leben. * Bild 2: Ernüchternd, Angst vor Ablehnung und Rassismus.
5. Fazit: Beide Karikaturen zeigen deutlich den Wandel im Umgang mit Migration – von einer offenen, willkommen heißenden Gesellschaft zu einer abweisenden und skeptischen Haltung. Die Karikaturen machen sichtbar, wie Meinungen und politische Haltungen sich innerhalb weniger Jahrzehnte verändern können.
K. 4/S. 126/13 1880: wellcome all * 1893: looking backward
K. 4/S. 126/14 mögliche Lösung: Die beiden Karikaturen zeigen, wie sich die Einstellung der USA zur Einwanderung im Laufe des 19. Jahrhunderts gewandelt hat.
In der ersten Karikatur (1880) werden alle Migrantinnen und Migranten freundlich empfangen. Symbole wie das Schild „wellcome all“ und die Versprechen von Freiheit, Bildung, Wahlen und freiem Land zeigen, dass die USA stolz darauf waren, ein Zufluchtsort für Menschen aus aller Welt zu sein. Einwanderung wurde als Bereicherung dargestellt. In der zweiten Karikatur (1893) hat sich das Blatt gewendet. Die wohlhabenden Bürger wenden sich ab und halten die Hand ablehnend hoch. Der Titel „looking backward“ (Zurückblicken) zeigt, dass diese Menschen vergessen haben, dass auch sie oder ihre Vorfahren einmal eingewandert sind. Statt offener Arme herrscht nun Misstrauen und Ablehnung gegenüber Neuankömmlingen. Die Karikaturen machen deutlich, wie aus einem Land der offenen Türen ein Land mit wachsender Ablehnung gegenüber Einwanderung wurde.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 77 - 80
AB 1 Zeile 35-40; Zeile 25; Zeile 60; Zeile 40; Zeile 35; Zeile 45; Zeile 5-10
AB 2

Verlag
AB 3 1867 wurde im Staatsgrundgesetz das Prinzip der Freiheit der Auswanderung aller Bürgerinnen und Bürger verankert. Daraufhin stieg die Auswanderung aus der Habsburgermonarchie in die USA stetig an. So zählten ab 1900 neben Russen und Italienern Einwandererinnen und Einwanderer aus Österreich-Ungarn zur größten Gruppe. Die Gründe für die Auswanderung waren vielfaltig. Einerseits war die wirtschaftliche Situation in vielen Teilen Osterreich-Ungarns schlecht. Die Menschen versprachen sich durch die Auswanderung eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Andererseits wurde die Auswanderung durch verbesserte Bahn- und Schiffsverbindungen erleichtert. Nicht zuletzt wurden in den USA billige Arbeitskräfte gesucht. Auch die Löhne waren für ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter wesentlich hoher als in Österreich-Ungarn. Die meisten Auswandererinnen und Auswander traten ihre Reise zu Fuß, dann mit der Bahn zum nächstgelegenen Hafen an. Bremen oder Hamburg (Deutschland), Le Havre (Frankreich), Antwerpen oder Rotterdam (Niederlande) sowie Triest (Österreich) waren jene Häfen, von denen Schiffe nach Amerika ablegten. Die Überfahrt erfolgte zumeist im Zwischendeck, in das provisorisch kleine Kabinen eingebaut wurden, die auf der Rückreise nach Europa wieder herausgenommen wurden. Dann wurden an Stelle der Passagiere Waren befördert. Der überwiegende Teil der Einwandererinnen und Einwander kam in New York an. 1892 wurde auf einer Insel vor New York, auf Ellis Island, eine Kontrollstation eingerichtet. Zwischen 1892 und 1954 kamen Millionen Einwandererinnen und Einwander auf Ellis Island an. In diesem Durchgangslager wurde von Einwanderungsinspektoren entschieden, wer einreisen durfte und wer zurückgeschickt wurde. Einerseits wurden die Dokumente der Immigrantinnen und Immigranten genau geprüft, andererseits wurden die Menschen auch medizinisch untersucht. War jemand zu krank oder zu schwache zum Arbeiten, schickte man ihn in seine Heimat zurück. 1954 wurde das Durchgangslager Ellis Island geschlossen. 1990 wurde dort ein Museum errichtet.
Lernstandserhebung
1. Arbeitsmigration: Das bedeutet, dass Menschen in ein anderes Land oder eine andere Region ziehen, um dort zu arbeiten und bessere Verdienstmöglichkeiten zu finden. * Flucht: Flucht bedeutet, dass Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, weil ihr Leben durch Krieg, Gewalt oder Verfolgung bedroht ist. * Integration: Integration heißt, dass Menschen aus anderen Ländern in der neuen Gesellschaft mitmachen können, z. B. in der Schule, im Beruf oder in der Freizeit, ohne ihre eigene Kultur aufgeben zu müssen. * Push- und Pull-Faktoren: Push-Faktoren sind Gründe, warum Menschen ihr Land verlassen müssen (z. B. Krieg, Armut). Pull-Faktoren sind Dinge, die Menschen in ein neues Land ziehen (z. B. Arbeit, Sicherheit).
2. von oben nach unten: falsch * richtig * falsch * falsch * richtig * falsch * richtig * falsch
3. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Menschen aus Europa nach Amerika aus, weil sie unter Armut und Hunger litten. Heute fliehen viele Menschen aus Krisengebieten wie Syrien nach Europa, weil dort Krieg herrscht.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Der erste Weltkrieg
NAME: DATUM:
Überblick – Erster Weltkrieg
Erstelle einen Überblick zum Ersten Weltkrieg! Nimm dazu die Stichwörter im Kästchen zu Hilfe!
Nationale Spannungen in Europa * Revolution in Russland * Zerfall der österreichischungarischen Monarchie * Kämpfe im Schützengraben * Giftgaseinsatz * Bündnissysteme in Europa * Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand durch einen serbischen Nationalisten in Sarajevo. * Entente * Gründung des Völkerbundes * Rache für die Unterdrückung der Serben in der ÖsterreichischUngarischen Monarchie. * Mittelmächte * ca. 10 Mill. Tote * Rumänien, Belgien, Deutsches Reich, Portugal, Österreich-Ungarn, Frankreich, Italien, Bulgarien, Serbien, Griechenland, Osmanisches Reich, Großbritannien, Russland * Wettrüsten der europäischen Großmächte * Bombenangriffe aus der Luft * Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich * Hunger und Not in der Heimat * Kriegseintritt der USA * Not und Hunger in der Nachkriegszeit * 1914 – 1918
URSACHEN:
Verlag
ANLASS:
MOTIV FÜR DAS ATTENTAT:
DAUER DES KRIEGES:
SCHRECKEN DES KRIEGES:
BÜNDNISSE:
1917 - DAS JAHR DER WENDE:
FOLGEN DES KRIEGES:
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Der erste Weltkrieg
NAME: DATUM:
Wer bin ich?
Hier erzählen einige Personen aus ihrem Leben. Du sollst erkennen, wer diese Personen sind!
1. Person: Ich bin: ……………………………………………………
Ich wuchs als Tochter böhmischer Adeliger behütet auf. Als Kind und Jugendliche lernte ich mehrere Sprachen, beschäftigte mich mit Musik und reiste viel. Nachdem unser Familienvermögen aufgebraucht war, nahm ich in Wien eine Stelle als Gouvernante an. Dort lernte ich meinen späteren Mann kennen. Unseren Lebensunterhalt verdienten wir mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, Romanen und Zeitungsartikeln. In meinem berühmtesten Roman beschrieb ich die Schrecken des Krieges. Für dieses Werk erhielt ich als erste Frau den Friedensnobelpreis.
2. Person: Ich bin: ……………………………………………………
Ich wurde 1863 als Sohn von Erzherzog Karl Ludwig geboren. Kaiser Franz Joseph I. war mein Onkel. Verheiratet war ich mit Sophie Gräfin Chotek. Obwohl ich Thronfolger war, hatte ich auf das politische Geschehen nur wenig Einfluss. Meine liebste Beschäftigung war die Jagd. Im Juni 1914 reiste ich mit meiner Gattin nach Sarajewo, wo wir einem Attentat zum Opfer fielen. Begraben wurden wir in unserem Schloss Artstetten in Niederösterreich. Heute gibt es dort auch ein Museum.
Verlag
3. Person: Ich bin: ……………………………………………………
Ich wurde 1809 als Sohn eines Farmers geboren. Bis zu meinem 19. Lebensjahr half ich meinem Vater bei der schweren Arbeit. Die Schule besuchte ich deshalb nur selten. Ich lernte aber wenigstes so weit lesen und schreiben, dass ich eine Stellung als Kaufmannsgehilfe antreten konnte. Später eignete ich mir selbständig weiteres Wissen an. Im Jahr 1834 begann meine politische Laufbahn. Gleichzeitig studierte ich die Rechtswissenschaften und wurde Anwalt. 1860 wurde ich zum Präsidenten gewählt und zog ins Weiße Haus ein. Unter meiner Führung gewannen die amerikanischen Nordstaaten den Bürgerkrieg.
4. Person: Ich bin: ……………………………………………………
Ich bestieg bereits mit 18 Jahren den österreichischen Thron. Mit 24 Jahren heiratete ich gegen den Willen meiner Mutter. Anders als mein Vorgänger regierte ich meine Länder absolut. Einen Aufstand in Ungarn ließ ich mit militärischer Gewalt niederschlagen. Beinahe 20 Jahre später kam es zum Ausgleich mit Ungarn. Großen Anteil daran hatte meine Gattin. Seither gab es die „kaiserlich-königliche“ Doppelmonarchie. In meinem langen Leben musste ich viele Schicksalsschläge hinnehmen. Mein ältester Sohn nahm sich das Leben und meine geliebte Frau wurde ermordet.
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Der erste Weltkrieg
NAME: DATUM:
Endlich Frieden!
Erstellt in Gruppen eine Sonderausgabe zum Ende des Ersten Weltkriegs! Folgende Inhalte könnten enthalten sein:
- Eine Schlagzeile über das Kriegsende
- Ein Interview mit einem Soldaten
- Bericht von der Heimatfront
- Leserbriefe von Bürgerinnen und Bürgern
- Nachruf für gefallene Soldaten
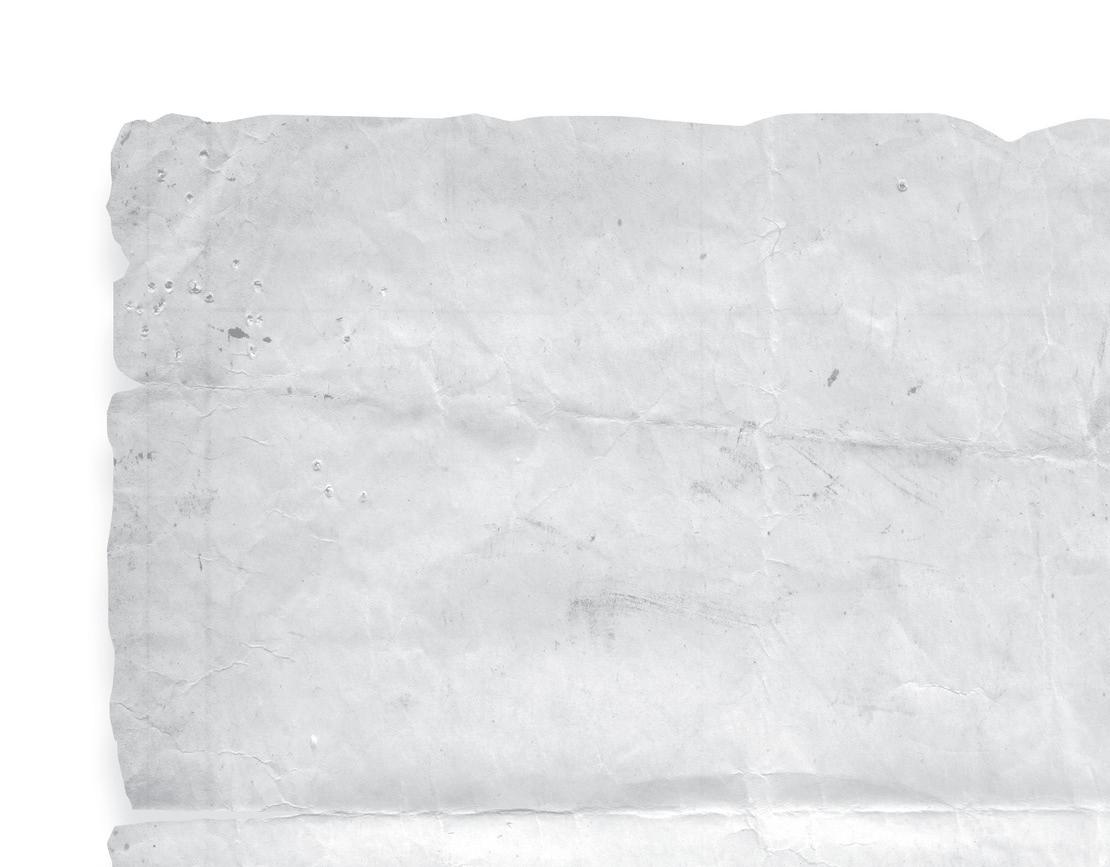

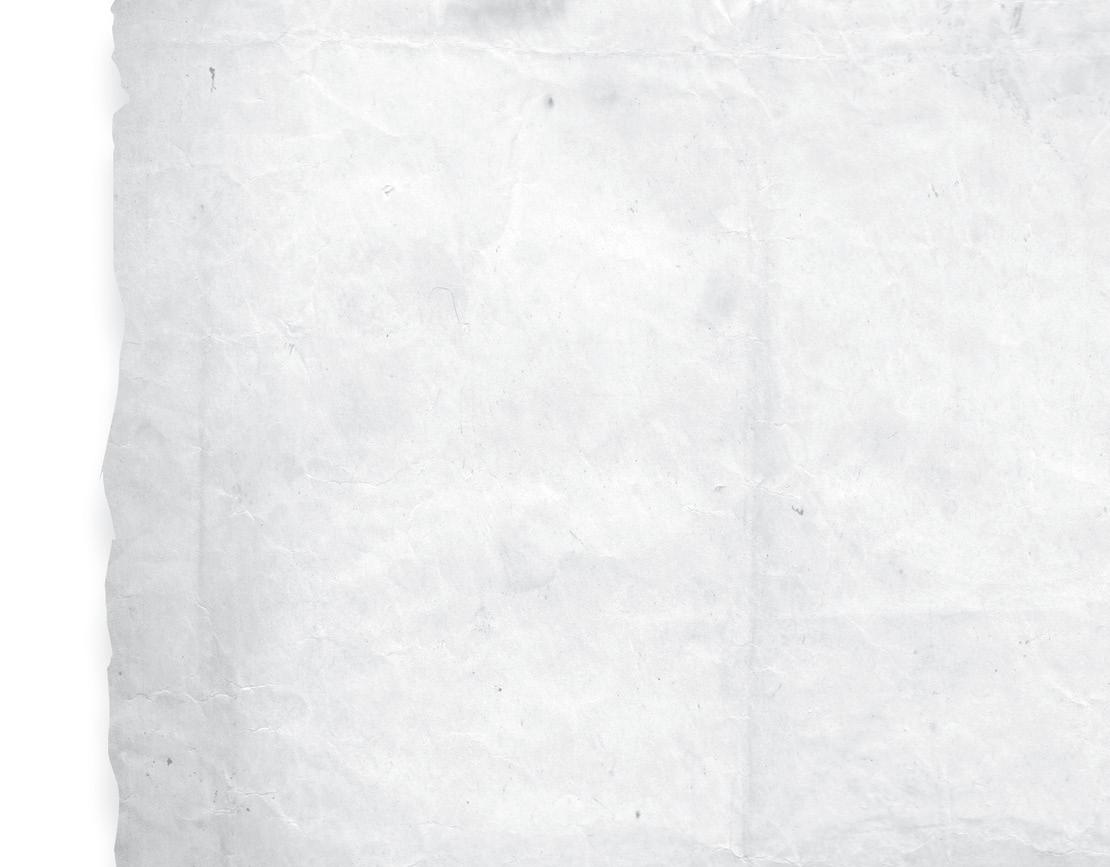
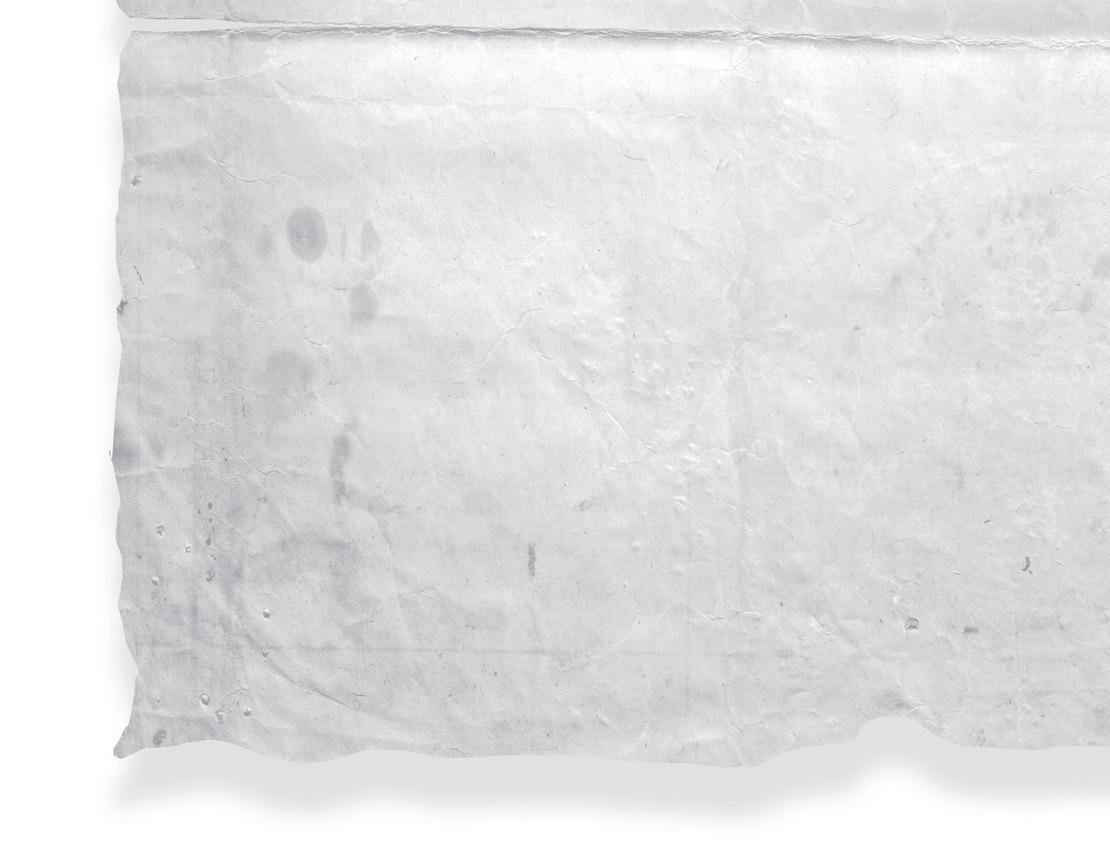
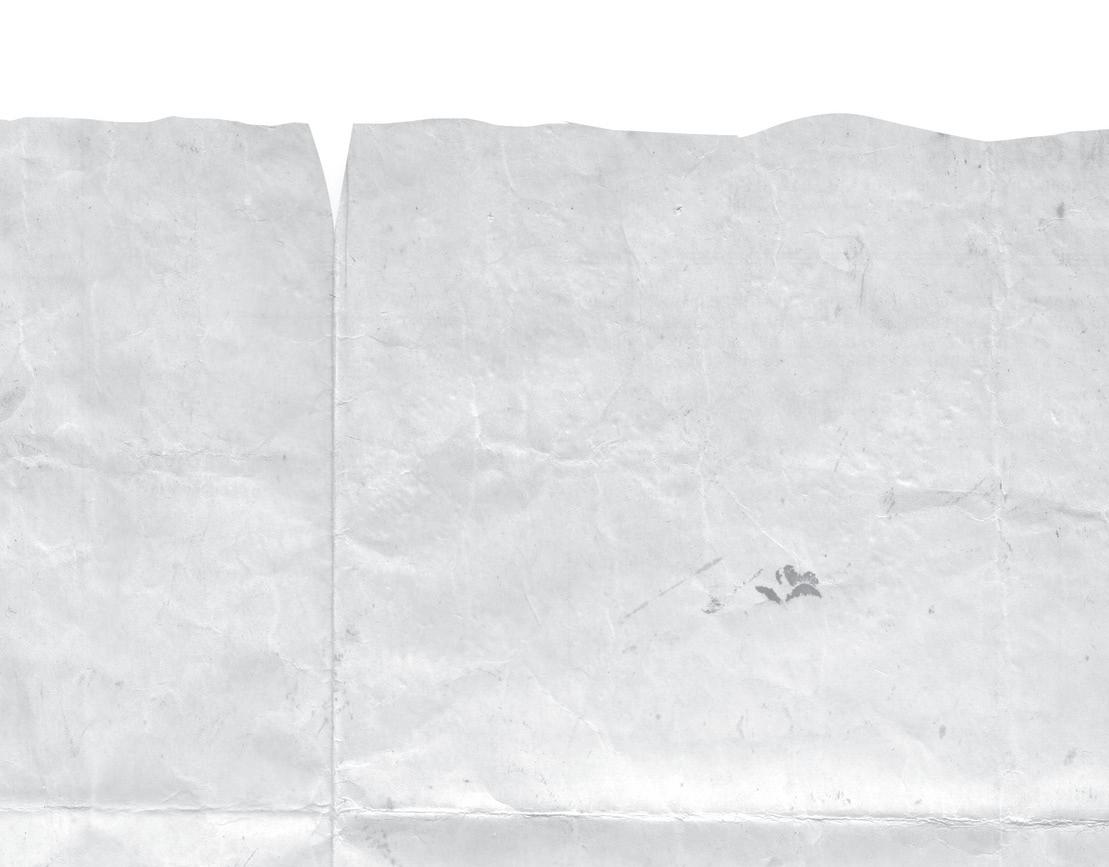
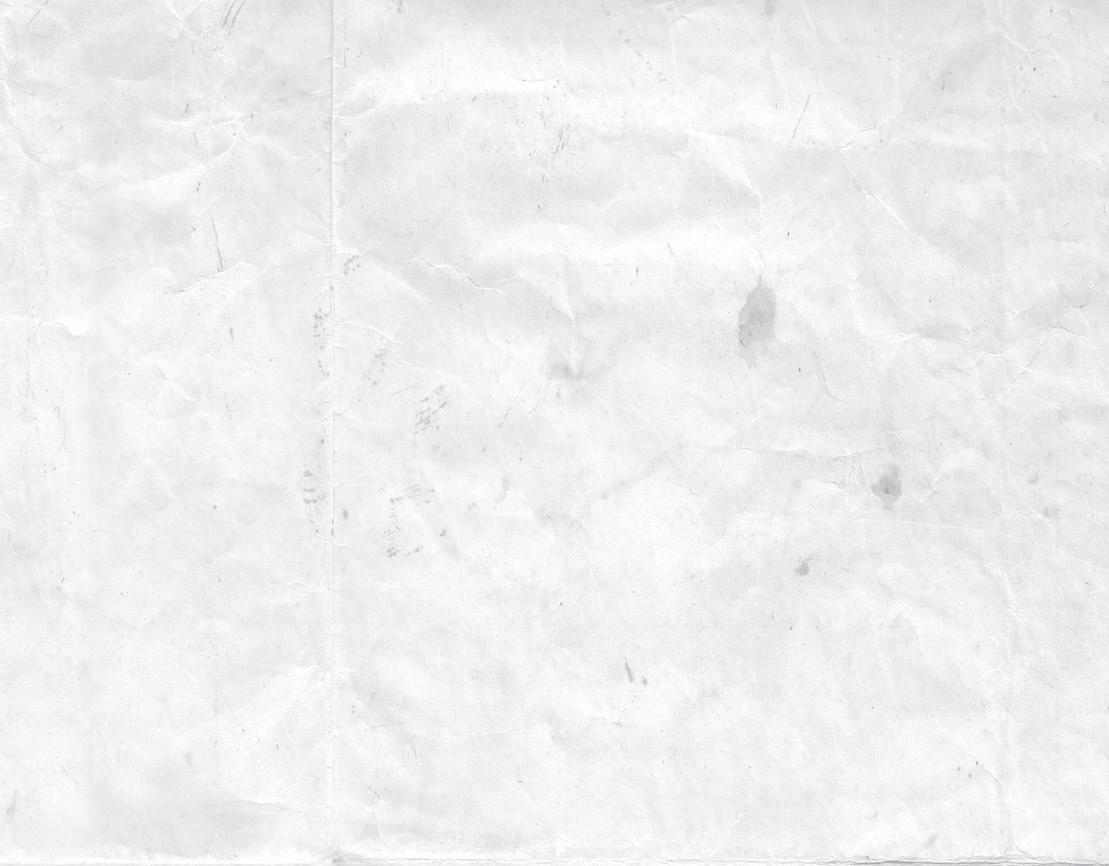
Verlag
Schreibt eure Artikel und gestaltet die Zeitung mit Zeichnungen oder digitalen Tools!

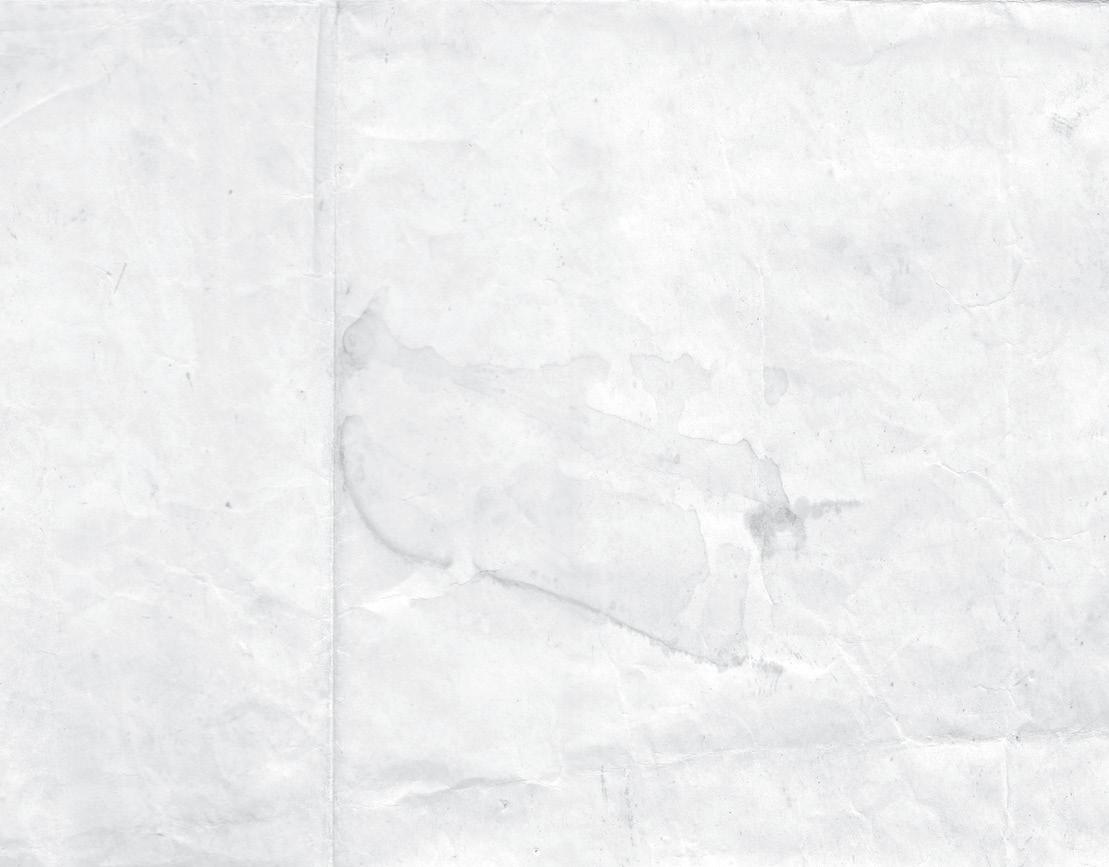
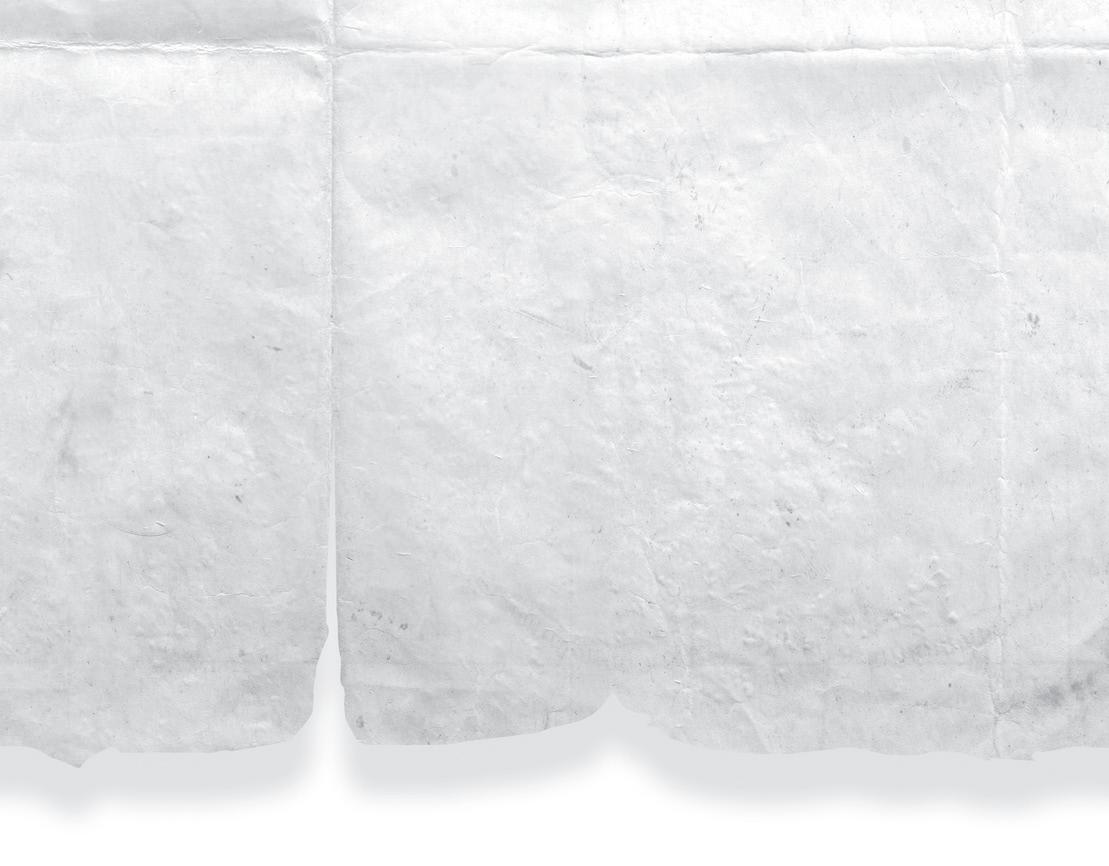
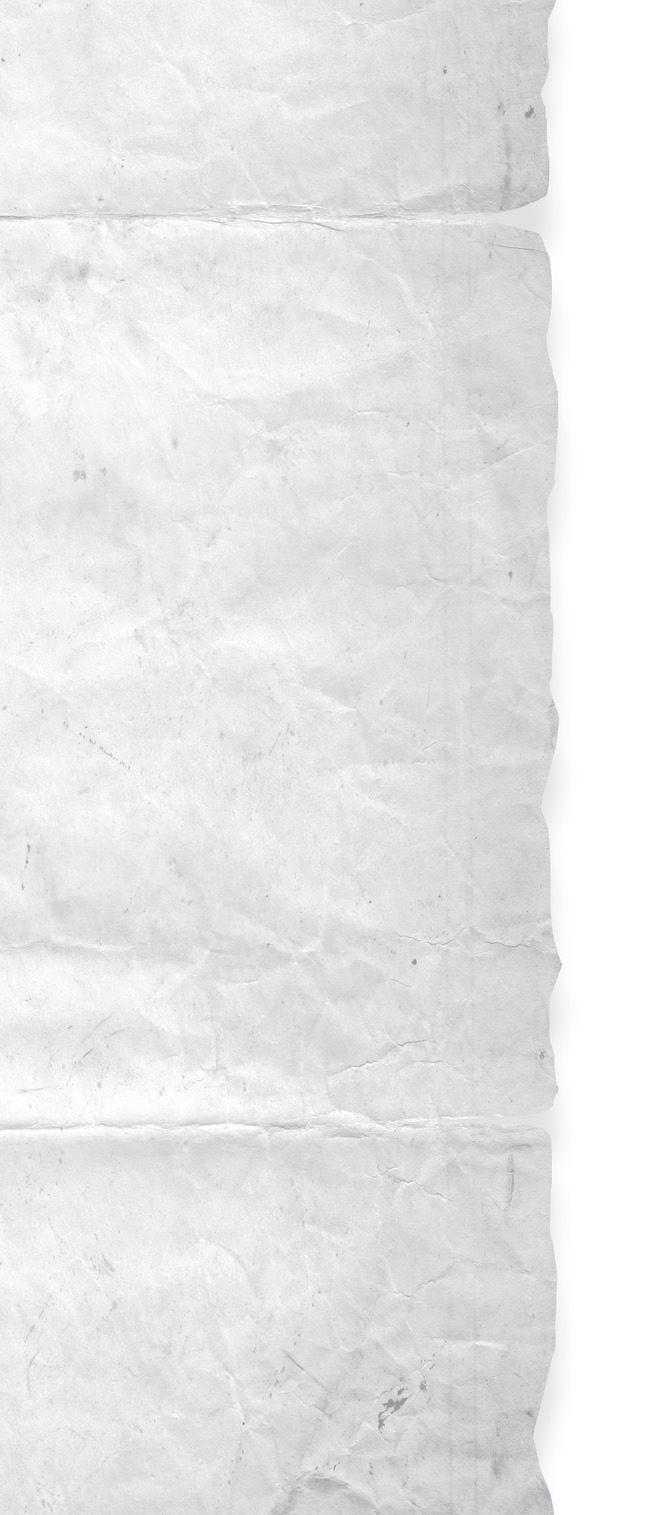

Lernstandserhebung Der erste Weltkrieg
NAME: DATUM:
1. Setze die Begriffe richtig ein!
5/
Der Erste Weltkrieg begann 1914. Zu den Ursachen gehörten der starke in Europa, der , bei dem Länder glaubten, sie seien besser als andere, und der , bei dem viele Länder Kolonien erobern wollten.
Das sorgte dafür, dass viele Länder sich gegenseitig unterstützten. Ausgelöst wurde der Krieg durch das auf den Thronfolger von Österreich-Ungarn.
Wettrüsten * Nationalismus * Imperialismus * Bündnissystem * Attentat von Sarajewo
2. Bring die Ereignisse in die richtige Reihenfolge, indem du die Nummern 1 bis 10 in die Kästchen schreibst! 10/
Kriegseintritt der USA.
Kaiser Franz Joseph stirbt.
Kriegserklärung Österreichs an Serbien.
Ausrufung der Ersten Republik in Wien.
Verlag
Für die Mittelmächte ist der Krieg verloren.
Bündnispartner treten in den Krieg ein.
Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand.
Gründung des Völkerbundes.
Österreich-Ungarn zerfällt in mehrere Staaten.
Russland scheidet aus dem Krieg aus.
3. Erkläre folgende Begriffe! 5/
Heimatfront:
Mobilmachung:
Kriegspropaganda:
Kriegsanleihe:
Stellungskrieg:
Lernstandserhebung
Der erste Weltkrieg
NAME: DATUM:
4. Finde die Fehler im Text und schreibe die richtigen Wörter darüber. 7/
Das Attentat von Budapest löste 1924 den Ersten Weltkrieg aus. Als Motiv für die Tat nannte der Attentäter Rache für die Unterdrückung der Tschechen in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Der österreichische Kaiser Karl erklärte Ungarn den Krieg. Aufgrund ihrer Bündnisverpflichtung traten kurz darauf fast alle amerikanischen Staaten in den Krieg ein. Die Erwartung aller Kriegsteilnehmer bald zu siegen, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, der Erste Weltkrieg dauerte fünf Jahre.
5. Ordne die Länder richtig zu: 4/
MITTELMÄCHTE: ENTENTE:
Belgien * Frankreich * Russland * Deutsches Reich * Italien * Rumänien * Österreich-Ungarn * Portugal * Osmanisches Reich * Serbien * Bulgarien * Großbritannien * Griechenland
6. Kreuze die richtigen Antworten an! Achtung: 3/
Welches Land trat 1917 auf der Seite der Entente in den Krieg ein?
□ USA □ Österreich-Ungarn □ Italien
Wer musste im Versailler Vertrag große Gebiete und Kolonien abgeben?
□ Frankreich □ Deutschland □ Russland
Was war der Auslöser des Ersten Weltkriegs?
□ das Attentat auf Franz Ferdinand □ der Versailler Vertrag □der Bau der Berliner Mauer
Olympe Verlag
31-34= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
26-30 = du hast dir viel gemerkt
21-25 = du weißt schon einiges
17-20 = du solltest noch viel üben
< 16 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
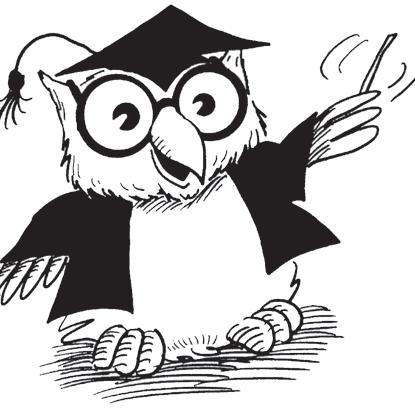
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 128 - 140
K. 3/S. 134/1 mögliche Lösung: Zuerst glaubt man, es selbst besser zu haben. Dann hofft man, dem Gegner soll es schlechter gehen. Man freut sich, wenn es dem Gegner auch schlecht geht. Schließlich erkennt man, dass beide verloren haben. * Beide Seiten, egal wer angefangen hat oder gewinnen wollte – alle verlieren. * treffen zu * Begründung: Auch heute gibt es in vielen Kriegen keine echten Gewinner.
Oft leiden alle beteiligten Länder, die Menschen auf beiden Seiten verlieren ihr Zuhause, ihre Familien oder ihr Leben.
Das zeigt, dass Krieg immer Verluste für beide Seiten bedeutet, auch wenn es zuerst anders erscheint.
K. 3/S. 134/2 beantwortet: Warum war die Situation zu diesem Zeitpunkt in Sarajewo so kritisch? * Weshalb war Franz Ferdinand ein Feindbild für die Serben? * Wieso gab es schon seit langem Spannungen auf dem Balkan?
nicht beantwortet: Warum herrschten die Habsburger über Serbien? * Weshalb kam es zur Entstehung von Bündnissystemen?
K. 3/S. 134/3 mögliche Lösung: Der Autor erwähnt, dass Franz Ferdinand „paradierte“, also demonstrativ auftrat, und das ausgerechnet am Vidovdan, einem für die Serben emotional aufgeladenen Tag. Er schreibt auch, dass Franz Ferdinand Pläne verfolgte, Serbien zu annektieren und die Südslawen unter österreichischer Führung zu vereinen – eine „Lieblingsidee“ des Thronfolgers. Diese Wortwahl („paradierte“, „Lieblingsidee“) lässt darauf schließen, dass der Autor Franz Ferdinand zumindest eine indirekte Mitschuld an den Spannungen zuschreibt.
Durch die Betonung seiner Provokation und seiner politischen Pläne gegen serbische Interessen wird Franz Ferdinand nicht neutral dargestellt.
Die Darstellung wirkt weniger objektiv, da der Autor eine wertende Sprache verwendet:
• „paradierte an einem sehr sensiblen Tag“ klingt nach einer bewussten Provokation.
• Die „Lieblingsidee“ wird nicht sachlich beschrieben, sondern klingt abwertend oder ironisch. Zudem fehlt eine ausgewogene Betrachtung anderer Seiten (z. B. politische Zwänge, Friedensbemühungen). Der Fokus liegt einseitig auf Franz Ferdinands Fehlverhalten und Provokationen.
K. 3/S. 135/6 mögliche Lösung: Wer schreibt? Ein Soldat namens Karl, der an der Front kämpft. * An wen? An sein „Frauchen“, wahrscheinlich seine Ehefrau oder Verlobte. * Wo? Aus einem Graben an der Front, ein genaues Land ist nicht genannt, aber es dürfte sich um die Westfront handeln. * Wann? Kurz nach Weihnachten, vermutlich im Winter 1914/15 oder später. * Inhalt: Ankündigung, 12 Tage in den Schützengraben zu gehen, berichtet über Granaten und Verletzte sowie über schlechte Versorgung, auch darüber, dass die Preise im Feld extrem hoch sind, schreibt, dass er keine Versorgung mit Tabak bräuchte, da er genug hätte * Gefühle: Tapferkeit und Hoffnung, dass alles gut wird, Ekel und Frust wegen des Essens und der Läuseplage, Sorge um seinen Magen, Vorsicht und Angst vor Beschuss, aber auch viel Routine * Hinweise auf Kriegssituation: Leben im Schützengraben mit großer Gefahr * Verletzungsgefahr durch Granaten, schlechte Versorgung und hohe Preise, ein Vergleich mit Russland zeigt, wie schlimm die Front empfunden wird
K. 3/S. 136/10 Zeitraum: 1914 – 1918
Beteiligte Länder: Mittelmächte: Deutschland, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Bulgarien * Entente-Mächte: Frankreich, Großbritannien, Russland (bis 1917), Italien (ab 1915), USA (ab 1917), zahlreiche Kolonien und kleinere Staaten
Olympe Verlag
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 84 - 88
AB 1 URSACHEN: Nationale Spannungen in Europa; Bündnissysteme in Europa; Wettrüsten der europäischen Großmächte; ANLASS: Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand durch einen serbischen Nationalisten in Sarajevo. MOTIV FÜR DAS ATTENTAT: Rache für die Unterdrückung der Serben in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. DAUER DES KRIEGES: 1914 – 1918; BÜNDNISSE: Entente: Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland, Serbien, Griechenland, Portugal, Rumänien, Belgien; Mittelmächte: Deutsches Reich, ÖsterreichUngarn, Osmanisches Reich, Bulgarien; SCHRECKEN DES KRIEGES: Bombenangriffe aus der Luft; Giftgaseinsatz; Kämpfe im Schützengraben; Hunger und Not in der Heimat; 1917 – DAS JAHR DER WENDE: Kriegseintritt der USA; Revolution in Russland; FOLGEN DES KRIEGES: ca. 10 Mill. Tote; Not und Hunger in der Nachkriegszeit; Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie; Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich; Gründung des Völkerbundes; AB 2 von oben nach unten: Bertha von Suttner * Franz Ferdinand * Abraham Lincoln * Kaiser Franz Joseph I.
Lernstandserhebung
1. Der Erste Weltkrieg begann 1914. Zu den Ursachen gehörten der starke Nationalismus in Europa, der Wettbewerb bei dem Länder glaubten, sie seien besser als andere, und der Imperialismus, bei dem viele Länder Kolonien erobern wollten.
Das Bündnissystem sorgte dafür, dass viele Länder sich gegenseitig unterstützten.
Ausgelöst wurde der Krieg durch das Attentat auf den Thronfolger von Österreich-Ungarn.
2. von oben nach unten: 5 + 4
3. Heimatfront: Die Menschen zu Hause, die im Krieg nicht kämpfen, aber zum Beispiel Waffen herstellen oder Lebensmittel sammeln, um das Militär zu unterstützen. * Mobilmachung: Die Vorbereitung auf den Krieg – Soldaten, Waffen und Material werden bereitgemacht, um kämpfen zu können. * Kriegspropaganda: Werbung, die den Krieg als notwendig oder gut darstellt, um die Bevölkerung zu überzeugen und zu motivieren. * Kriegsanleihe: Geld, das die Bevölkerung dem Staat leiht, damit dieser den Krieg bezahlen kann. * Stellungskrieg: Ein Krieg, bei dem Soldaten sich in Schützengräben eingraben und über lange Zeit von dort aus kämpfen, ohne große Geländegewinne.
4. Das Attentat von Sarajewo löste 1914 den Ersten Weltkrieg aus. Als Motiv für die Tat nannte der Attentäter Rache für die Unterdrückung der Serben in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Der österreichische Kaiser Franz Josef erklärte Serbien den Krieg. Aufgrund ihrer Bündnisverpflichtung traten kurz darauf fast alle europäischen Staaten in den Krieg ein. Die Erwartung aller Kriegsteilnehmer, bald zu siegen, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, der Erste Weltkrieg dauerte vier Jahre.
5. Mittelmächte: Deutsches Reich * Österreich-Ungarn * Osmanisches Reich * Bulgarien Entente: Belgien * Frankreich * Russland * Italien * Rumänien * Portugal * Serbien * Großbritannien * Griechenland
6. USA * Deutschland * das Attentat auf Franz Ferdinand
Olympe Verlag
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Identitäten
NAME: DATUM:
Wer bin ich?
Lies die folgenden Fragen zunächst aufmerksam durch!
Worauf bin ich besonders stolz?

Was ist mir derzeit besonders wichtig?


Welche Ängste, Zweifel und andere negative Gedanken habe ich?
Was möchte ich in meinem Leben erreichen?
Woher kommt meine Familie?
Welche Hobbies habe ich?
Was ist das Besondere an mir?

Olympe Verlag
Welche Menschen sind wichtig für meine Identität?

Welche Sportarten übe ich aus?


Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?
Welche Träume habe ich?
Welche Traditionen und Rituale gibt es in meiner Familie?
In welchen Situationen bin ich glücklich?

Wo sehe ich mich in fünf Jahren?
An welchen Gegenständen hänge ich besonders?
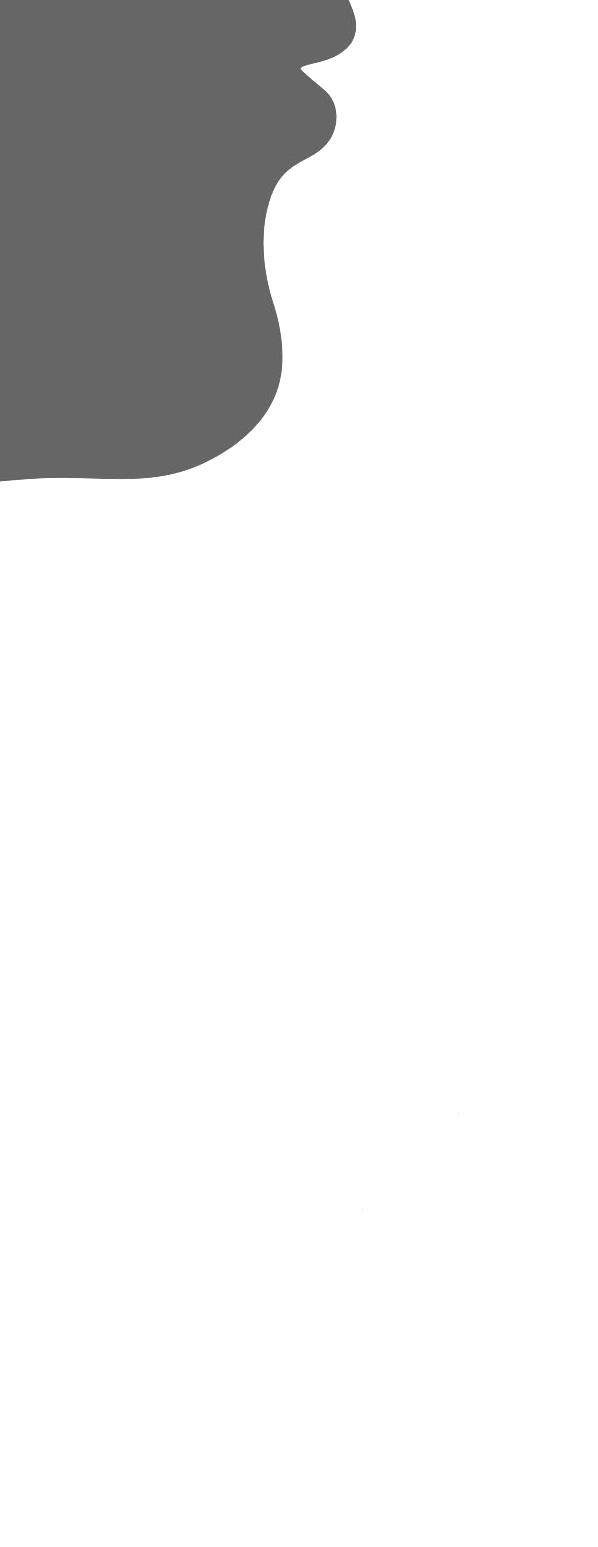
Beantworte die Fragen ganz persönlich für dich auf einem Blatt Papier! Du kannst auch einige auslassen bzw. neue formulieren!
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Verlag
Identitäten
NAME: DATUM:
Vielfältige Identitäten I.
1. Betrachte die Bilder und wähle jenes aus, dass dich am meisten anspricht bzw. das stärkste Gefühl bei dir auslöst!





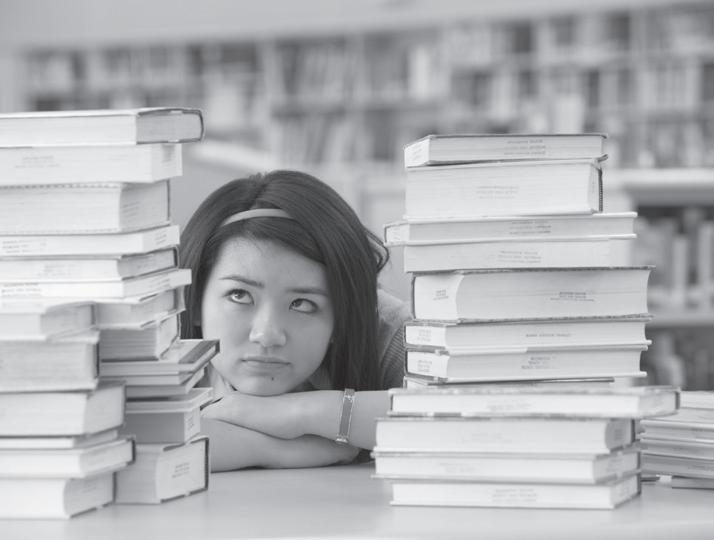
Verlag


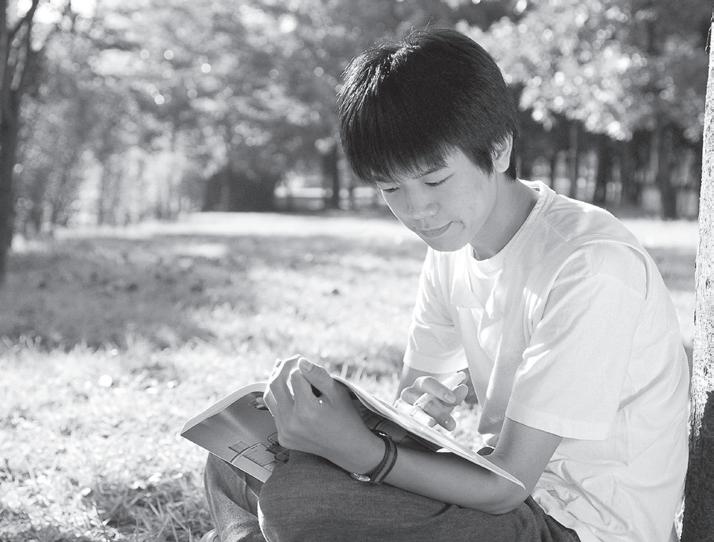


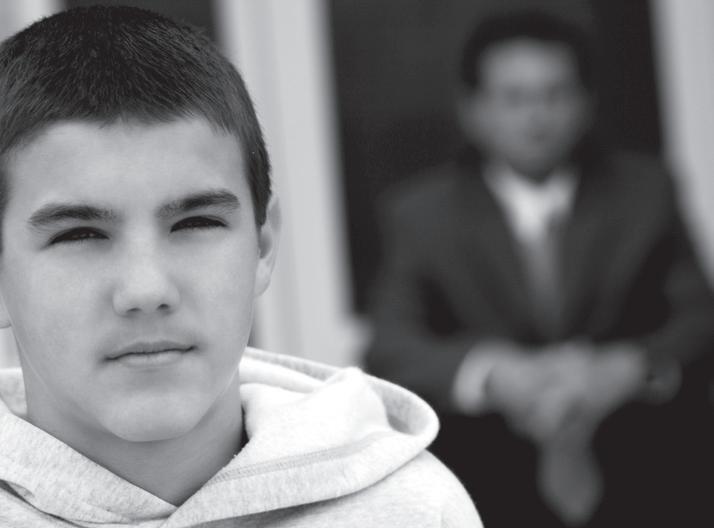
2. Erzähle über die momentane Situation der ausgewählten Person in der Ich-Form! Erfinde anschließend eine Biografie zu der ausgewählten Person in deinem Heft!
Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Identitäten
NAME: DATUM:
Vielfältige Identitäten II.
3. Schreibe deiner ausgewählten Person einen Brief!


Verlag






4. Besprecht in Kleingruppen (drei bis vier Schülerinnen/Schüler), warum ihr diese Person ausgewählt habt, welche Identität ihr dieser Person zugedacht habt und warum!
Lernstandserhebung
Identitäten
NAME: DATUM:
1. Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind! 12/
Die eigene Herkunft prägt die Identität eines Menschen. Identität verändert sich im Laufe des Lebens nie. Sprache kann Teil der Identität sein. Kleidung und Musik haben nichts mit Identität zu tun.
Jeder Mensch hat nur eine einzige Identität. Freundschaften können Teil der eigenen Identität sein. Die Identität wird nur durch die Familie bestimmt.
Menschen können sich gleichzeitig mehreren Gruppen zugehörig fühlen.
Identität ist für jeden Menschen gleich wichtig. Die Herkunft eines Menschen bestimmt für immer seine Identität.
Die eigene Identität kann sich durch neue Erfahrungen verändern. Identität zeigt sich nur in der Sprache, die jemand spricht.
richtig falsch
Verlag
2. Setze die richtigen Begriffe ein! 5/
Zur Identität eines Menschen gehören viele Dinge, zum Beispiel die ___________________, die Erstsprache oder die _____________________. Auch persönliche Überzeugungen und _______________________ spielen eine Rolle. Oft prägen auch die __________________ und die _____________________ die eigene Identität.
Werte * Nationalität * Sprache * Familie * Religion
3. Warum braucht Europa eine gemeinsame Identität? Formuliere zwei Gründe! 2/
18-19= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister 15-17 = du hast dir viel gemerkt 12-14 = du weißt schon einiges 10-11 = du solltest noch viel üben < 9 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
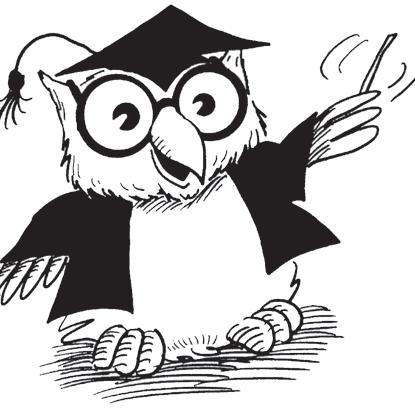
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 141 - 150
K. 2/S. 145/2 mögliche Lösung: Pro-Argumente (Dafür): Stärken das Gemeinschaftsgefühl – Menschen fühlen sich als Teil einer Nation verbunden. * Erinnern an Geschichte und Kultur – Symbole wie Flaggen oder Hymnen zeigen die Traditionen eines Landes. * Erleichtern die Identifikation – Besonders bei internationalen Veranstaltungen (z. B. Sport) zeigen sie, woher jemand kommt. * Vermitteln Stolz und Zusammenhalt: Sie können Menschen motivieren, sich für ihr Land einzusetzen.
Kontra-Argumente (Dagegen): Können ausgrenzen – Wer sich mit den Symbolen nicht identifiziert, fühlt sich womöglich ausgeschlossen. * Gefahr von Nationalismus – Zu starke Betonung kann zu Überheblichkeit gegenüber anderen Ländern führen. * Können Spaltungen fördern – Unterschiedliche Gruppen in einem Land könnten sich benachteiligt fühlen. * Missbrauch möglich: Manche nutzen sie, um Hass oder Abgrenzung zu schüren.
K. 2/S. 147/8 Patriotismus: Patriotismus bedeutet, dass man sein eigenes Land liebt und stolz darauf ist. Man möchte, dass es dem Land gut geht, achtet aber auch andere Länder und Kulturen. * Nationalismus: Nationalismus bedeutet, dass man das eigene Land für besser oder wichtiger hält als andere. Menschen, die nationalistisch denken, grenzen andere oft aus oder lehnen andere Länder ab. * Unterschied: Patriotismus bedeutet, sein Land zu lieben ohne andere abzuwerten. Nationalismus bedeutet, das eigene Land über andere zu stellen und oft andere Länder oder Menschen abzulehnen.
K. 2/S. 147/13 mögliche Lösung: 1. Beschreiben (Was ist zu sehen?): Die Karikatur zeigt einen modernen Hochgeschwindigkeitszug mit einer EU-Flagge, der von einer alten Dampflok mit der Aufschrift „Nationalismus“ zurückgehalten wird. Aus der Lok steigen Rauchschwaden mit dem Wort „Nationalismus“ auf. Auf dem modernen Zug steht „Demokratie en marche!“ (Deutsch: „Demokratie in Bewegung!“).
2. Deuten (Was bedeutet das?): Die beiden Züge stehen sinnbildlich für zwei entgegengesetzte Entwicklungen in Europa:
• Der moderne Hochgeschwindigkeitszug steht für eine fortschrittliche, demokratische und vereinte Europäische Union, die vorankommen möchte.
• Die alte Dampflok symbolisiert den Nationalismus, der versucht, diese Entwicklung zu bremsen oder zurückzuhalten.
3. Absicht (Welche Botschaft will der Zeichner vermitteln?): Die Karikatur kritisiert, dass nationalistische Kräfte in Europa die demokratische und gemeinsame Weiterentwicklung der EU behindern. Sie zeigt, dass die „Reise nach vorne“ durch Nationalismus aufgehalten oder sogar zurückgedreht werden könnte.
4. Bewertung (Was halte ich davon?): individuelle Lösung
K. 2/S. 147/14 mögliche Lösung: Die Karikatur verwendet den Gegensatz zwischen einer modernen Hochgeschwindigkeitsbahn und einer alten Dampflokomotive, um einen politischen Stillstand oder Rückschritt zu verdeutlichen.
• Der Schnellzug steht für eine dynamische, moderne und fortschrittliche Europäische Union, die demokratische Werte voranbringen möchte. Das Motto „Demokratie en marche!“ unterstreicht, dass Europa sich eigentlich weiterentwickeln und gemeinsam in die Zukunft fahren will.
• Die alte Dampflok mit der Aufschrift „Nationalismus“ steht für rückwärtsgewandte Kräfte, die versuchen, diese Entwicklung zu stoppen oder sogar zurückzudrehen. Die Abgase, die das Wort „Nationalismus“ in die Luft schreiben, zeigen, dass diese Haltung veraltet und „verstaubt“ ist.
• Die Darstellung des Bremsens macht deutlich, dass Nationalismus die gemeinsame europäische Zukunft gefährdet, indem er die EU in ihrer Bewegung zurückhält oder sogar ausbremst.
Insgesamt kritisiert der Karikaturist, dass nationale Alleingänge und Abgrenzungen Europa ausbremsen und verhindern, dass Demokratie, Zusammenarbeit und Fortschritt verwirklicht werden.
Olympe Verlag
K. 3/S. 149/3 mögliche Lösung: Gemeinsame Werte – Alle Mitgliedsstaaten bekennen sich zu Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. * Binnenmarkt – Alle Mitgliedsstaaten sind Teil des europäischen Binnenmarktes mit freiem Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr.
* Europäische Institutionen – Alle Mitgliedsstaaten arbeiten in den gemeinsamen Institutionen wie dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission und dem Rat der EU zusammen. * Gemeinsame Gesetze – Alle Mitgliedsstaaten übernehmen europäische Gesetze (EU-Richtlinien und -Verordnungen) in ihr nationales Recht. * Frieden und Zusammenarbeit – Alle Mitgliedsstaaten verfolgen das Ziel, Frieden und Zusammenarbeit in Europa zu sichern.
LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 91 - 94
Lernstandserhebung
1.
Die eigene Herkunft prägt die Identität eines Menschen.
Identität verändert sich im Laufe des Lebens nie.
Sprache kann Teil der Identität sein.
Kleidung und Musik haben nichts mit Identität zu tun.
Jeder Mensch hat nur eine einzige Identität.
Freundschaften können Teil der eigenen Identität sein.
Die Identität wird nur durch die Familie bestimmt.
Menschen können sich gleichzeitig mehreren Gruppen zugehörig fühlen.
Identität ist für jeden Menschen gleich wichtig.
Die Herkunft eines Menschen bestimmt für immer seine Identität.
Die eigene Identität kann sich durch neue Erfahrungen verändern.
Identität zeigt sich nur in der Sprache, die jemand spricht.
richtig falsch
Verlag
2. Zur Identität eines Menschen gehören viele Dinge, zum Beispiel die Nationalität, die Erstsprache oder die Religion. Auch persönliche Überzeugungen und Werte spielen eine Rolle. Oft prägen auch die Familie und die Sprache die eigene Identität.
3. Zusammenhalt und Frieden stärken: Eine gemeinsame europäische Identität kann den Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Ländern fördern und helfen, Konflikte friedlich zu lösen. * Gemeinsame Herausforderungen meistern: Ob Klimaschutz, Digitalisierung oder soziale Gerechtigkeit – viele Probleme lassen sich besser gemeinsam lösen, wenn sich die Menschen in Europa als Teil einer Gemeinschaft fühlen. * Demokratische Werte verteidigen: Eine gemeinsame Identität kann das Bewusstsein für Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit stärken und so helfen, diese Werte besser zu schützen. * Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten fördern: Wenn sich die Menschen in Europa verbunden fühlen, sind sie eher bereit, einander in Krisenzeiten zu unterstützen – sei es wirtschaftlich, sozial oder humanitär. * Jugendliche für Europa begeistern: Eine europäische Identität kann jungen Menschen zeigen, dass Europa mehr ist als Politik –nämlich ein Raum für Austausch, Bildung (z. B. Erasmus), Mobilität und gemeinsame Zukunft. * Kulturelle Vielfalt als Stärke erleben:
Eine gemeinsame Identität kann helfen, die kulturelle Vielfalt Europas nicht als trennend, sondern als bereichernd zu verstehen und zu leben. * Europa auf der Weltbühne stärken: Mit einem gemeinsamen Bewusstsein für europäische Interessen kann die EU international geschlossener auftreten und globale Entwicklungen besser mitgestalten.
Arbeitsblatt 1 / KOPIERVORLAGE
Wahlen und Wählen
NAME: DATUM:
Die Geschichte des Wahlrechts
Hier kannst du viel Wissenswertes über die Geschichte des Wahlrechts erfahren. Einige Wörter sind aber in einer Geheimschrift verschlüsselt. Knacke den Code, schreibe die Wörter richtig darüber und du kannst die geheime Nachricht lesen! Tipp: Lies zuerst den Text und suche ein verschlüsseltes Wort, das du aus dem Sinninhalt ableiten kannst! Das Alphabet hilft dir dann weiter!
Bereits 1848 während der Revolution kam es zu k s t k i Ausarbeitung einer Verfassung in Österreich. Ebenso j e t m k t die ersten freien Wahlen zum Reichstag in diesem Jahr statt. Die I k o f x h y s f t wurde jedoch mit Gewalt t s k m k i z k u q a x e z k t und die folgenden Jahre regierte Kaiser Franz B f u k j I. alleine. Im Jahre 1861 erließ der N e s k i das Februarpatent. Von da an u e v es in Österreich ein Abgeordneten- und ein Herrenhaus. Die Abgeordneten w h c Herrenhaus wurden vom Kaiser bestellt. In das Abgeordnetenhaus l h i m k t die Abgeordneten von den X e t m y e z k t geschickt. Diese Landtage wurden mittels N h i s k t l e a x i q a y u gewählt.
Im Jahr 1873 v i e q a y k eine Reichstagswahlreform die Einführung des Zensuswahlrechts.
Verlag
Wahlberechtigt waren ab m s k i k c Jahr ungefähr 6 % der männlichen Bevölkerung ab 24 Jahren. Erst 1896 erhielten e x x k männlichen Staatsbürger das Wahlrecht. Noch immer wurde der Z k i y der einzelnen Stimme nach der Steuerleistung v k u y s c c y. 1907 wurde das
Kurienwahlrecht abgeschafft und alle männlichen Staatsbürger über 24 Jahren erhielten das Z e a x i k q a y. Jede Stimme zählte z x k s q a viel. 1918 wurde das Frauenwahlrecht in Österreich eingeführt.
A: _ B: _ C: _ D: _ E: _ F: _ G: _ H: _ I: _ J: _ K: _ L: _ M: _ N: _ O: _ P: _ Q: _ R: _ S: _ T: _ U: _ V: _ W: _ X: _ Y: _ Z: _
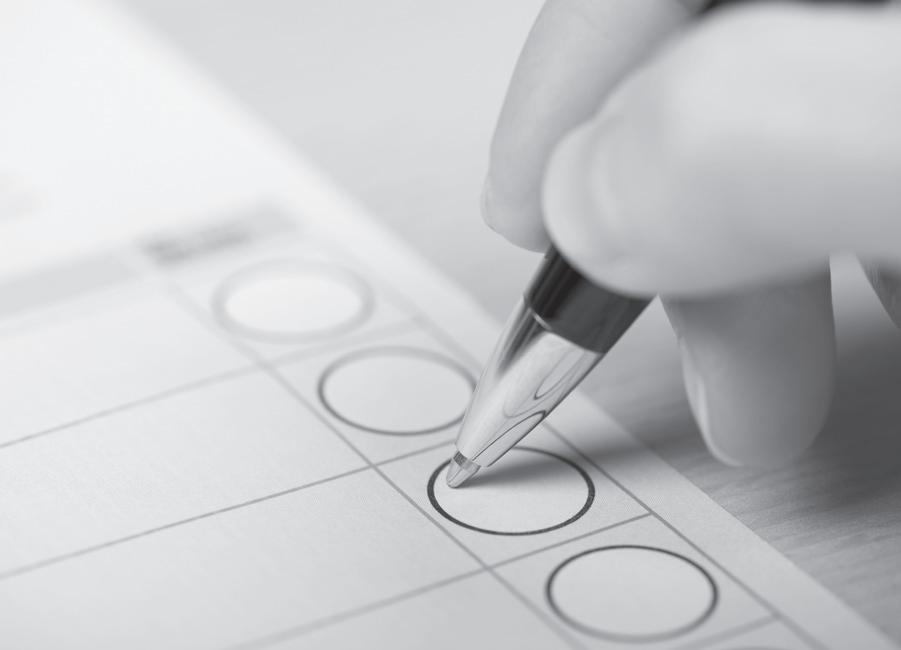
Arbeitsblatt 2 / KOPIERVORLAGE
Wahlen und Wählen
NAME: DATUM:
Die Geschichte des Wahlrechts
Löse dieses Rätsel! Die Buchstaben aus der Wahlurne helfen dir dabei! ACHTUNG: ä= ae, ü = ue;

1. gewählte Vertreter der Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen
2. wortgetreue Niederschrift über eine Sitzung
3. Sitz oder Amt einer oder eines Abgeordneten
4. Zusammenfassung der Regeln
5. Abkürzung für Sozialdemokratische Partei Österreichs
6. anderes Wort für Anwesenheit
7. nur wer eine bestimmte Summe Steuern im Jahr bezahlte, durfte wählen
8. Parteien, die in den 1970er und 1980er Jahren in Europa entstanden
9. gibt Antworten auf aktuelle politische Fragen und wird in Verbindung mit bevorstehenden Wahlen veröffentlicht
10. Vereinigungen von Menschen mit gleichen Werten und gleichen gesellschaftspolitischen Vorstellungen
11. der Wert der Stimme hat unterschiedliches Gewicht, abhängig von der Wählerinnen- oder Wählergruppe, der man angehörte
Verlag
12. legte 1861 fest, dass es in Österreich ein Abgeordneten- und ein Herrenhaus geben wird






Arbeitsblatt 3 / KOPIERVORLAGE
Wahlen und Wählen
NAME: DATUM:
Was wäre, wenn…? – Zukunftsszenarien I.
Stell dir vor, das Wahlrecht würde sich plötzlich ändern oder ganz verschwinden! Was würde das für dich, deine Familie, dein Land und die Demokratie bedeuten? Denke über die folgenden Szenarien nach und beantworte die Fragen.
Was wäre, wenn niemand mehr zur Wahl ginge?
Was würde mit der Demokratie passieren?
Wer hätte dann die Macht im Land?
Wie würde sich das auf dein Leben auswirken?

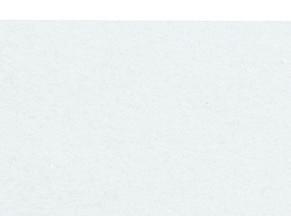

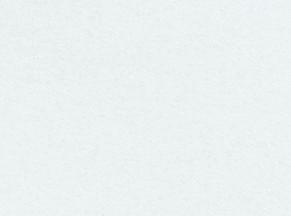

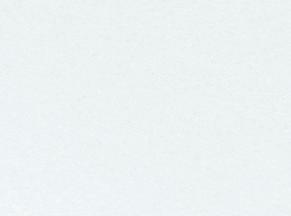

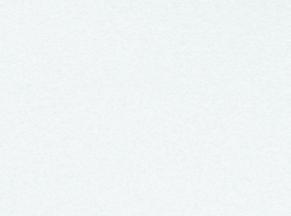


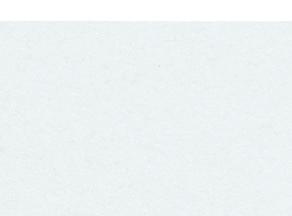

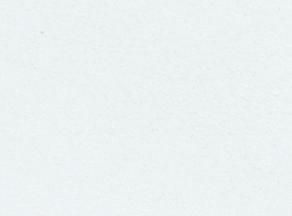


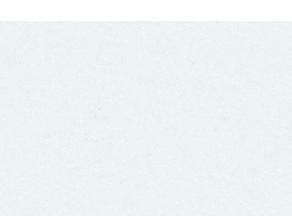
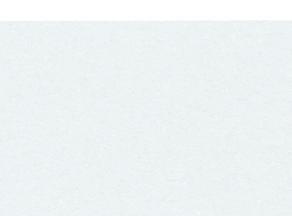
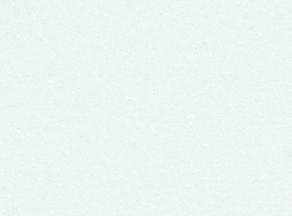
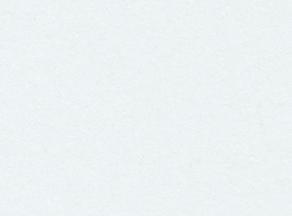

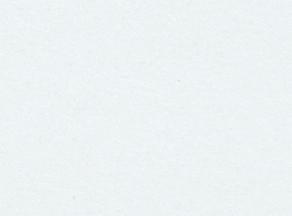
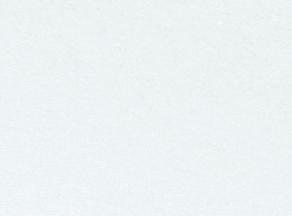
Verlag


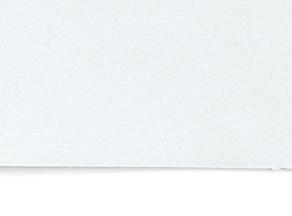
Was wäre, wenn nur reiche Menschen wählen dürften?
Wäre das gerecht? Begründe deine Meinung?
Was würde sich in der Politik ändern?
Welche Gruppen wären benachteiligt?





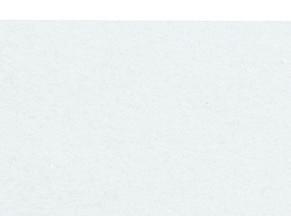
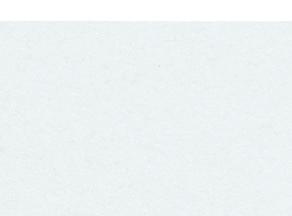
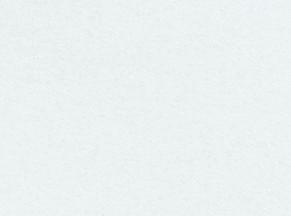
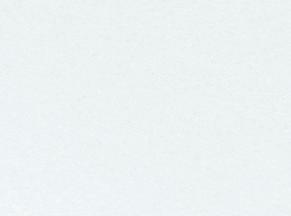
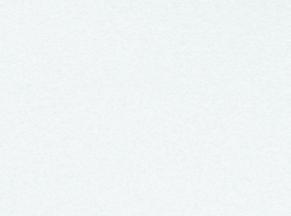


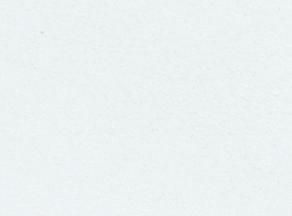


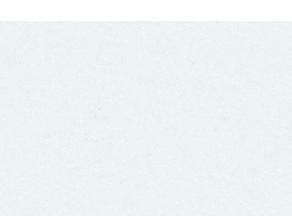
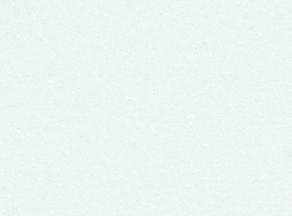

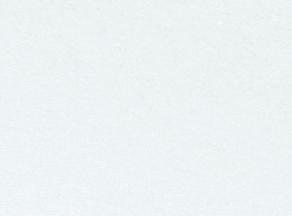

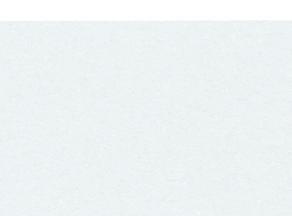
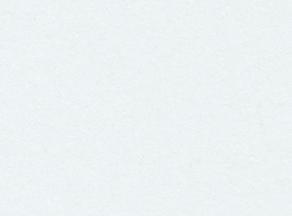
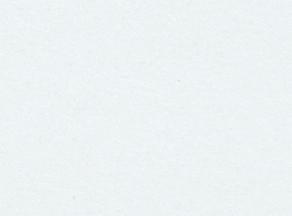

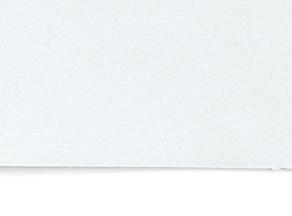


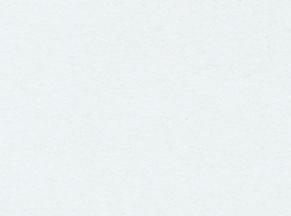


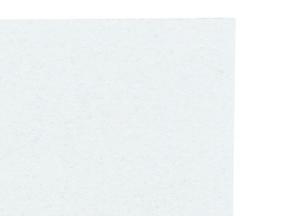


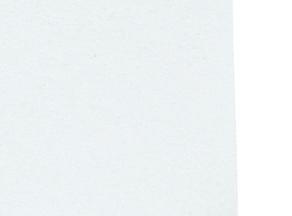





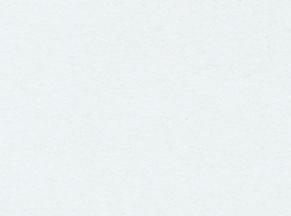


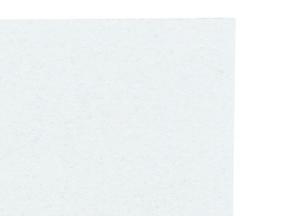


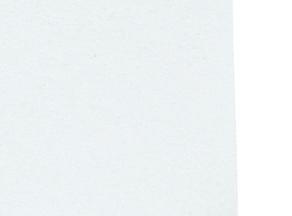




Arbeitsblatt 4 / KOPIERVORLAGE
Wahlen und Wählen
NAME: DATUM:
Was wäre, wenn…? – Zukunftsszenarien II.
Was wäre, wenn du schon mit 10 Jahren wählen dürftest?
Würdest du dich gut informiert genug fühlen, um zu wählen?
Was würdest du bei einer Wahl wichtig finden?
Wie würde sich das Wahlverhalten verändern?

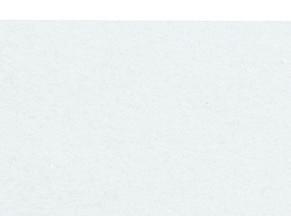

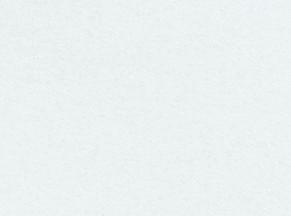

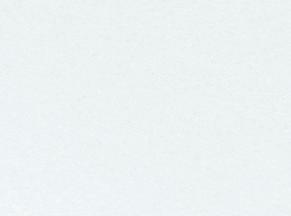

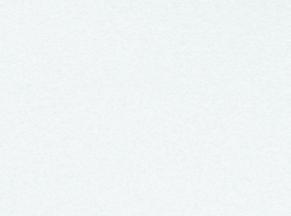


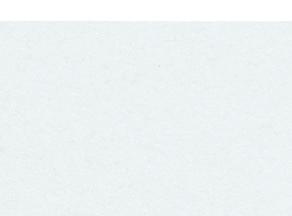

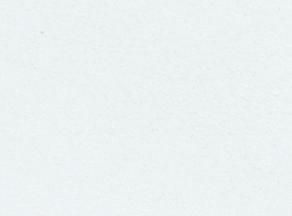


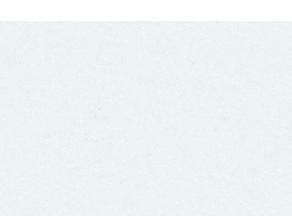
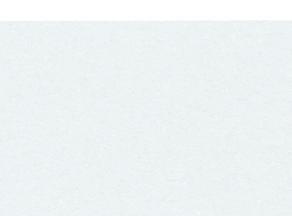
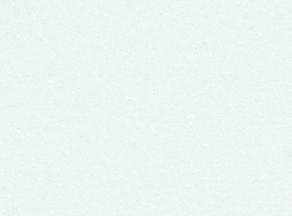
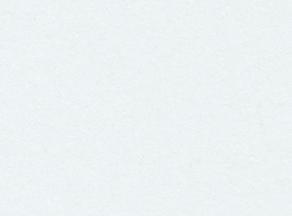

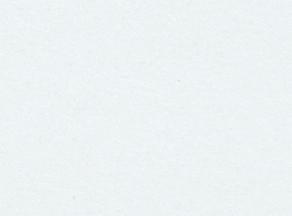
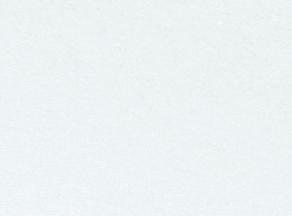


Verlag
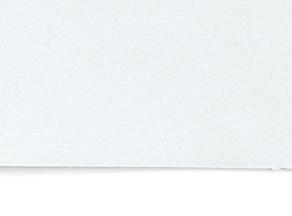

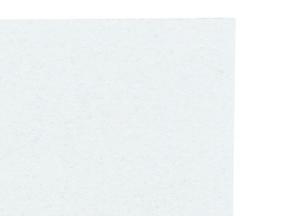


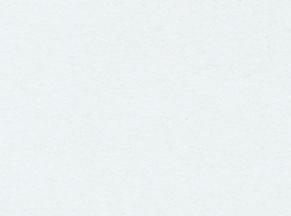


Was wäre, wenn Wahlen geheim wären, aber kontrolliert würden?
Was bedeutet eine geheime Wahl für die Freiheit?
Wie wichtig ist es, dass niemand weiß, wen du wählst?
Was wäre, wenn du gezwungen wirst, jemanden zu wählen?





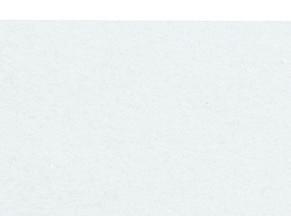
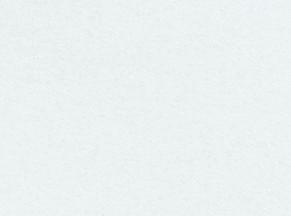
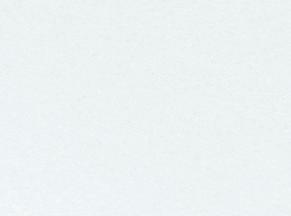
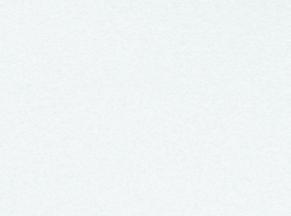

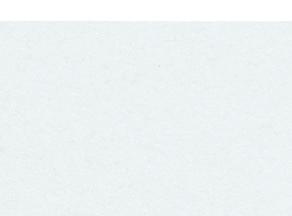

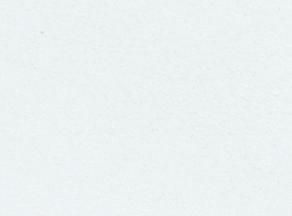


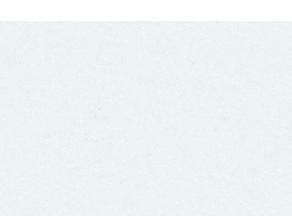
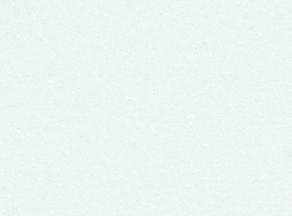

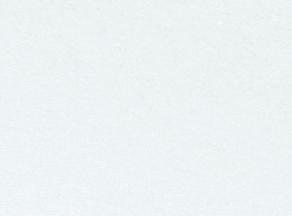

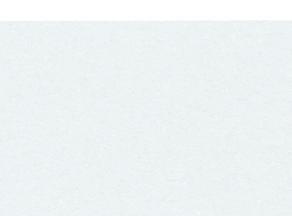
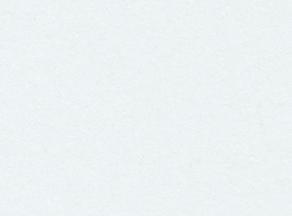
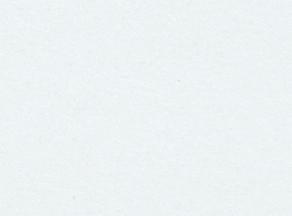

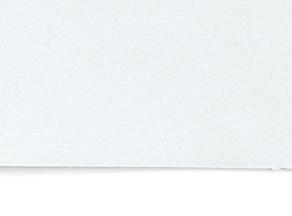


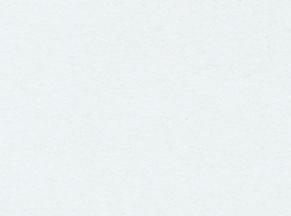



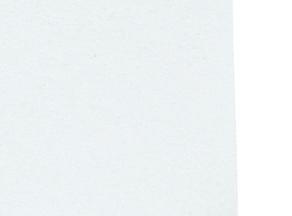



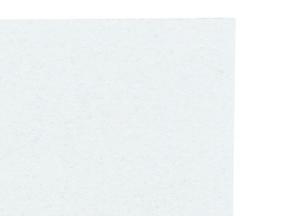


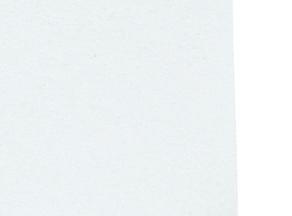



Lernstandserhebung Wahlen und Wählen
NAME: DATUM:
1. Erkläre mit eigenen Worten, was „aktives Wahlrecht“ bedeutet! 2/
2. Erkläre mit eigenen Worten, was „passives Wahlrecht“ bedeutet! 2/
3. Ordne richtig zu, indem du mit Pfeilen verbindest!
6/ Herabsetzung des aktiven Wahlalters bei Nationalratswahlen auf 19 Jahre. 1907
Allgemeines Wahlrecht für alle männlichen Personen ab 24 Jahren 1968
Einführung des Zensuswahlrechts 1848
Einführung des Frauenwahlrechts 2007
Erste freie Wahlen zum Reichstag 1873 Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre. 1918
4. Warum ist es wichtig, das Wahlrecht zu nutzen und zur Wahl zu gehen? 4/
5. Fülle die Lücken richtig aus! 5/
Ursprünglich war das Wahlrecht nur ____________________ Männern vorbehalten. Erst im Jahr __________________ wurde in Österreich das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt. Frauen dürfen seit __________________ in Österreich wählen. Heute dürfen alle __________________
Bürgerinnen und Bürger ab __________________ Jahren wählen
Olympe Verlag
18-19= du bist Geschichtsmeisterin/Geschichtsmeister
15-17 = du hast dir viel gemerkt
12-14 = du weißt schon einiges
10-11 = du solltest noch viel üben
< 9 = du solltest dir diese Kapitel im Buch noch einmal durchlesen
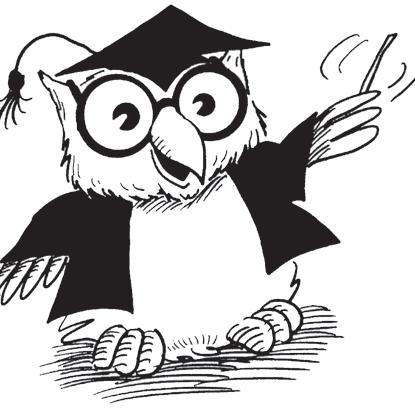
LÖSUNGEN
Lösungen „Aufgaben für schlaue Köpfe“, Buch S. 151 - 161
K. 1/S. 153/4 Teilnahme an einer Wahl (z. B. Klassensprecherin oder Klassensprecher, Gemeinde-, Landtagsoder Europawahl) * Unterschreiben einer Petition * Beitritt zu einem Verein, einer Jugendorganisation oder einer Partei * Mitbestimmung in der Schule (z. B. im Klassenrat oder Schulforum) * Verfassen eines Leserbriefes oder Kommentars zu einem politischen Thema * Teilen oder Kommentieren von politischen Themen in sozialen Medien * Verhalten im Alltag, z. B. durch bewussten Einkauf oder Umweltschutz * Mitwirken bei einer Bürgerinitiative * Gespräche über Politik führen und andere über wichtige Themen informieren *
K. 1/S. 153/5
K. 3/S. 158/1
SIGNALWÖRTER:
Anzahl der Abgeordneten: Nationalrat: 183 Abgeordnete * Bundesrat: 61 Mitglieder (je nach Größe der Bundesländer kann sich die Zahl leicht ändern) Funktionen der beiden Kammern: Nationalrat: wichtigste gesetzgebende Kammer * beschließt die meisten Gesetze * kontrolliert die Bundesregierung * wird direkt vom Volk gewählt Bundesrat: vertritt die Interessen der Bundesländer * kann bei vielen Gesetzen mitentscheiden (Zustimmung oder Einspruch) * wird von den Landtagen der Bundesländer gewählt
FPÖ: rechtspopulistisch * EU-skeptisch * Heimatland Österreich * Europa der freien Völker und Vaterländer
ÖVP: christliches Menschenbild * Stärkung der Wirtschaft * Sicherung des Wohlstandes * Bürgerinnen und Bürger
SPÖ: humane, demokratische und gerechte Gesellschaft * Gleichheit * Gerechtigkeit * Solidarität
NEOS: Öffnung der Gesellschaft * berufliche und persönliche Gerechtigkeit * Bildung und Leistung * persönliche Vorteile
Die Grünen: Klimaschutz * Rechte von Minderheiten * ökosoziale Steuerreform * basisdemokratisch, gewaltfrei, ökologisch, solidarisch, feministisch, selbstbestimmt
Lösungen LehrerInnenheft, S. 97 - 99
Verlag
AB 1 A:E B:V C:Q D:M E:K F:J G:Z H:A I: S J:B K:N L:X M:C N:T O:F P:D Q:G R:I S:U T:Y U:H V:O W:L X:P Y:R Z:W
AB 2

LÖSUNGEN
Lösungen LehrerInnenheft, S. 98 - 101
AB 3 / 4 individuelle Lösung
Lernstandserhebung
1. Aktives Wahlrecht bedeutet, dass man bei einer Wahl selbst wählen darf – also seine Stimme abgeben kann. In Österreich darf man ab dem Alter von 16 Jahren aktiv wählen, wenn man die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Das aktive Wahlrecht ist ein wichtiger Teil der Demokratie: Es ermöglicht allen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, mitzubestimmen, wer sie im Parlament oder in anderen politischen Gremien vertritt.
2. Passives Wahlrecht bedeutet, dass man selbst bei einer Wahl gewählt werden darf, also zum Beispiel als Abgeordnete oder Abgeordneterr ins Parlament einziehen kann. In Österreich hat man das passive Wahlrecht meist ab 18 Jahren – für bestimmte Ämter, wie das des Bundespräsidenten, gilt ein höheres Alter. Wer passives Wahlrecht hat, darf kandidieren und sich zur Wahl stellen lassen, um ein politisches Amt zu übernehmen.
3. Herabsetzung des aktiven Wahlalters bei Nationalratswahlen auf 19 Jahre. → 1968 * Allgemeines Wahlrecht für alle männlichen Personen ab 24 Jahren → 1907 * Einführung des Zensuswahlrechts → 1848 * Einführung des Frauenwahlrechts → 1918 * Erste freie Wahlen zum Reichstag → 1873 * Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre. → 2007
4. Es ist wichtig, das Wahlrecht zu nutzen und zur Wahl zu gehen, weil man so mitbestimmen kann, wie das Land regiert wird. Wer wählt, entscheidet mit über wichtige Themen wie Bildung, Umwelt, Gesundheit oder soziale Gerechtigkeit. Außerdem stärkt jede abgegebene Stimme die Demokratie – nur wer mitmacht, kann Veränderungen bewirken und verhindern, dass andere über die eigene Zukunft entscheiden.
5. Ursprünglich war das Wahlrecht nur wohlhabenden Männern vorbehalten. Erst im Jahr 1907 wurde in Österreich das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt. Frauen dürfen seit 1918 in Österreich wählen. Heute dürfen alle österreichischen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren wählen.
Olympe Verlag
BILDQUELLEN
Umschlagbilder:
Eva Schreiner, Elisabeth Monyk, istockphotoscom: Thomas_Marchhart, wikimedia commons: ford company
Bildquellen:
Birgit Kozak: 23/1, 44/2, 53/1, 57/1
Christian Monyk: 18/2, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 58/1, 58/2, 59/1, 61/1, 66/1
Clipart.com: 16/1, 17/1, 22/1, 24/1, 30/1, 32/1, 36/2, 51/1, 59/2, 63/1, 72/2, 80/1, 88/1
Freepik: 29/1, 31/1, 36/1, 41/1, bagas2argo: 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, macrovector : 22/2, oligo22: 19/1
Istockphotos.com: 70/1, bilhagolan: 13/2, Christine_Kohler: 45/1, clu: 48/1, 69/1, ilbusca: 72/1, Jane_Kelly: 13/1, kbeis: 49/1, Nastasic: 44/1, Ninell_Art: 14/1, RiseAboveDesign: 86/1, samarets1984: 91/1, stanley45: 15/1, Thomas Faull: 60/1, tomograf: 35/1, VadymKheylyk: 78/1, whitemay: 61/2
Kunsthistorisches Museum, Wien: 18/1
© Olympe Verlag GmbH, NÖ, 2025
Lektorat: Marion Ramell, BA
Verlag
Umschlaggestaltung: Raoul Krischanitz, Wien, transmitterdesign.com
Satz, Layout: Birgit Kozak (www.hellbunt-design.at)
Druck, Bindung: Druckerei Berger, Horn
ISBN: 978-3-903328-96-9