Special Nachhaltig handeln

Softwarelösungen
«Digitale Lasagne» für bessere CO2-Bilanz
Erneuerbare Energien
Turbulenzen auf den
Strommärkten
Klimaschädliche Kondensstreifen


Softwarelösungen
«Digitale Lasagne» für bessere CO2-Bilanz
Erneuerbare Energien
Turbulenzen auf den
Strommärkten
Klimaschädliche Kondensstreifen
Bis zu 92 % weniger CO₂ 100 % Edelstahl
Für Küchen, die die Zukunft im Blick haben.

Die Green Line Serie kombiniert sowohl ressourcenschonende Materialien als auch deren Produktion: Der Edelstahl wird mit bis zu 92 % weniger CO₂Emissionen hergestellt, dank CO₂armer Elektrizität und recyceltem Stahl.
suter.ch
Sustainable Switzerland In diesem Jahr werden erstmals Persönlichkeiten ausgezeichnet, welche die nachhaltige Entwicklung prägen und gestalten – in und aus der Schweiz heraus. Nominierungen sind noch bis zum kommenden Montag, 30. Juni 2025, möglich.
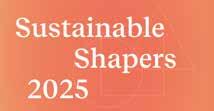
Sie sind Pionierinnen und Pioniere, Macherinnen und Macher, Vordenkerinnen und Vordenker auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Doch sie haben zumindest eines gemeinsam: Mit ihrem unternehmerischen oder gesellschaftlichen Engagement und mit innovativen, wegweisenden Konzepten setzen sie ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Für ihre herausragenden Leistungen werden diese Persönlichkeiten nun erstmals von Sustainable Switzerland, der Nachhaltigkeitsplattform des Unternehmens NZZ mit starken Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, ausgezeichnet.
Die Auswahl der «Sustainable Shapers» trifft eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Netzwerkpartner von Sustainable Switzerland sowie un-
abhängigen Fachleuten. «Mit der Auszeichnung wollen wir die Aufmerksamkeit und Relevanz des Themas Nachhaltigkeit in der breiten Öffentlichkeit weiter stärken – über Vorbilder und zukunftsfähige Visionen», so Felix Graf, CEO der NZZ. «Im Zentrum stehen bewusst Menschen und nicht Organisationen, Unternehmen oder Projekte.»
Drei Kategorien
Nominierungen und Selbstbewerbungen können noch bis zum kommenden Montag, 30. Juni 2025, online unter sustainableswitzerland.ch/shapers eingereicht werden. Über ein mehrstufiges Auswahlverfahren werden dann die Gewinnerinnen und Gewinner aus drei Kategorien ermittelt:
1. «Leadership & Transformation» Hier wird danach gefragt: Wer prägt die politischen Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere Schweiz? Welche Führungspersönlichkeiten treiben die Transformation in Unternehmen beispielhaft voran? Welche Mäzene, Philanthropen oder Investorinnen fördern nachhaltige Entwicklungen gezielt und wirksam?
2. «Knowledge & Opinion»
In dieser Kategorie geht es darum: Welche Wissenschaftler und Forscherinnen liefern zentrale Erkenntnisse für die nachhaltige Entwicklung? Welche Künstler schaffen Inspiration und Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit? Und welche Persönlichkeiten stärken die Vermittlung von Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit und im Bildungssystem?
3. «Vision & Innovation»
Im Vordergrund steht hier: Wer entwickelt bahnbrechende Innovationen und Technologien für eine nachhaltigere Welt? Wer hat erfolgreiche und effektive Startups, NGOs oder NPOs gegründet? Welche Architektinnen oder Raumentwickler schaffen nachhaltige Lebensräume? Und welche Persönlichkeiten treiben Paradigmenwechsel wie die Post-Wachstums-Idee erfolgreich voran?
Einzigartiges Netzwerk
Die Auszeichnungen werden im Rahmen des diesjährigen Sustainable Switzerland Forums am 2. September in Bern verliehen (siehe Vorbericht Seite 9). Die «Sustainable Shapers» und ihre jewei-

SIPI für ganzheitlichen Ansatz
Die Swiss Impact & Prosperity Initiative (SIPI) will Erfolg für die Schweiz neu definieren: Sie geht nach eigenen Angaben über das Bruttoinlandprodukt (BIP) und traditionelle Wirtschaftskennzahlen hinaus und entwickelt einen «ganzheitlichen Rahmen für die Messung und Entscheidungsfindung, der wirtschaftliche Vitalität mit gesellschaftlichem Wohlergehen, ökologischer Integrität und langfristiger Resilienz verbindet». Die Initiative wird von namhaften Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, darunter Sustainable Switzerland NZZ, unterstützt. Sie basiert auf dem Ethos der Schweizer Stiftung B Lab, die dafür eintritt, Wirtschaft als positive Kraft zu nutzen.
ligen Leistungen werden anschliessend über mehrere Wochen in einer Serie aus verschiedenen medialen Formaten vorgestellt, so auch in der nächsten Ausgabe dieser Verlagsbeilage. Zudem erhalten die «Sustainable Shapers» Zugang zur Sustainable-Switzerland-Community, die ihnen einzigartige Netzwerk-
möglichkeiten und Synergiepotenziale im Bereich Nachhaltigkeit bietet. Zum Netzwerk von Sustainable Switzerland zählen die Unternehmen BCG, BMW, Die Mobiliar, Google, Swisscom und UBS als Hauptpartner, Lidl Schweiz als Focus-Partner sowie die ETH Zürich und die EPFL als Wissenschaftspartner.
Fragen an Marc Geissmann von Sustainable Switzerland
Aus welchem Grund wurde die Auszeichnung «Sustainable Shapers» ins Leben gerufen?
Marc Geissmann: Angesichts der enormen Herausforderungen unserer Zeit ist es eminent wichtig, Persönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen, die das Thema Nachhaltigkeit in und aus der Schweiz heraus gestalten und voranbringen. Die Auszeichnung unterstreicht unser Anliegen, die Bedeutung von Nachhaltigkeit in all ihren Facetten noch stärker in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Wir nutzen dazu auch die Medienkanäle unserer Plattform Sustainable Switzerland. Dort beleuchten wir in Storys, Hintergrundberichten und Videointerviews aktuelle Fragestellungen und zukunftsweisende Lösungen.
Welche Kriterien sind für die Entscheidung der Jury ausschlaggebend? Bewertet werden unterschiedliche Fokusbereiche. Diese umfassen unter anderem Impact, Relevanz, Transformation und Leadership. Um dieser Bandbreite gerecht zu werden, setzt sich auch die Jury aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen, von der Nachhaltigkeitsexpertin bis zum CEO. Das Jurierungsverfahren wurde übrigens von einem unserer Hauptpartner, der Boston Consulting Group, entwickelt. Es bildet die Grundlage für eine objektive Bewertung der Nominierten.
Die Auszeichnungsträgerinnen und -träger werden ganz unterschiedliche Profile haben? Ja, wir möchten bewusst das ganze Spektrum nachhaltigen Engagements abbilden: Unternehmerpersönlichkeiten,

Mäzene, Influencer, Forscher, KMUInhaber, Startup-Gründer und viele weitere, welche ihren Beitrag für eine nachhaltige Schweiz leisten. Die Auszeichnungen werden erstmals am 2. September 2025 im Rahmen des Sustainable Switzerland Forums verliehen. Die Partner von Sustainable Switzerland freuen sich schon darauf. Das Forum mit seinen rund 750 Teilnehmenden bietet die ideale Bühne. Es ist die führende Nachhaltigkeitskonferenz der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Hier kommt die nachhaltige Community zusammen, um sich auszutauschen, praxisnah über neue Entwicklungen zu informieren und von spannenden Persönlichkeiten inspirieren zu lassen.
Marc Geissmann ist Business Unit Director bei NZZone und verantwortlich für die Plattform Sustainable Switzerland.
Ein neues Online-Tool von Sustainable Switzerland macht es viel einfacher, optimale Aus- und Weiterbildungsangebote rund um das Thema Nachhaltigkeit zu finden.
Der Weg in eine nachhaltige Zukunft erfordert spezielles Wissen und praktisches Know-how. Das Angebot an Ausund Weiterbildungen im Bereich Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren erfreulicherweise stark gewachsen. Zugleich jedoch wurde der Markt immer unübersichtlicher. Es fehlte bisher eine benutzerfreundliche Plattform, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, gezielt und ohne grossen Aufwand die passenden Aus- und Weiterbildungsangebote zu finden. Zudem mangelte es an Vergleichsmöglichkeiten und personalisierten Empfehlungen. Diese Lücke schliesst nun der brandneue «Bildungskompass» von Sustainable Switzerland. Das Online-Tool ist seit wenigen Tagen verfügbar und wurde entwickelt, um den individuellen Entscheidungsprozess
von A bis Z zu erleichtern. Die Plattform bündelt alle nachhaltigkeitsbezogenen Bildungsangebote der Schweizer Fachhochschulen und Universitäten und hat darüber hinaus Folgendes zu bieten:
Massgeschneiderte Empfehlungen: Mithilfe von KI und datengetriebenen Algorithmen werden Weiterbildungsvorschläge gemacht, die genau auf die individuellen Interessen und Ziele der Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt sind.
Vergleichsfunktionen: Das digitale Tool macht es möglich, Weiterbildungsangebote nach Kriterien wie Kosten, Dauer, Inhalten und Karrieremöglichkeiten auf einen Blick zu vergleichen.

Praxisnahe Einblicke: Persönliche Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten von Alumni sowie konkrete Anwendungsbeispiele werden künftig dabei helfen, den Mehrwert eines vorgeschlagenen Weiterbildungslehrgangs realistisch einzuschätzen.
Intuitive Benutzeroberfläche: Durch ein benutzerfreundliches Design und eine klare Navigation wird der Entscheidungsprozess effizient und stressfrei gestaltet.
Für den Zugang zum «Bildungskompass» diesen QR-Code
Zahlen & Fakten Die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist auch für die Schweiz eine grosse Herausforderung. Es geht dabei um ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche und Themenfelder – soziale, wirtschaftliche und ökologische.
Gesundheit und Ernährung
In der Schweiz sind nach Angaben des Bundesrats rund 2,2 Millionen Menschen von einer nichtübertragbaren Krankheit betroffen, Tendenz steigend. Eine ausgewogene Ernährung sowie Bewegung und Normalgewicht trügen massgeblich zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs bei, heisst es. «Die Schweizer Bevölkerung ernährt sich jedoch unausgewogen: Auf dem Speiseplan stehen zu viel Süsses, Salziges und Fettiges und zu wenig Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte.» Und das hat Folgen: Untersuchungen zufolge sind rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen und 43 Prozent der Erwachsenen
Der Ausstoss von Treibhausgasen ist in der Schweiz zurückgegangen. Er belief sich 2023 auf 40,8 Millionen Tonnen CO2Äquivalente, rund 1 Million Tonnen weniger als 2022. Insgesamt lagen die Emissionen 26 Prozent tiefer als im Jahr 1990. Dies geht aus dem im April 2025 veröffentlichten jährlichen Treibhausgasinventar des Bundesamts für Umwelt hervor. Gegenüber 2022 am stärksten gesunken ist der Treibhausgasausstoss im Industriesektor, gefolgt vom Gebäudesektor. Beide Bereiche tragen aktuell jeweils 22,2 Prozent zum totalen Treibhausgasausstoss bei. Die Emissionen des Verkehrs und der Landwirtschaft sind gegenüber 2022 gleich geblieben. Der Verkehrsektor trägt derzeit 33,6 Prozent zum gesamten Treibhausgasausstoss bei.
in der Schweiz übergewichtig oder fettleibig. Gleichzeitig belastet unsere Ernährungsweise die Umwelt, insbesondere durch weggeworfene Lebensmittel, den sogenannten Food Waste. Die Schweiz produziert davon jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen. Die jüngst vom Eidgenössischen Departement des Innern veröffentlichte «Schweizer Ernährungsstrategie 2025−2032» legt daher den Fokus auf Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit. Sie setzt auf ein erweitertes Wissen der Bevölkerung über Ernährung und fördert ein gesundes Lebensmittelangebot sowie die Forschung im Bereich Ernährung und Lebensmittel.

Windenergie: klimafreundlich und unerschöpflich Eine moderne Anlage produziert Haushaltsstrom für bis zu 10 000 Personen, und das 30 Jahre lang
Rekord bei der Windenergie
Mit einer Produktion von 170 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2024 hat die Windenergie in der Schweiz einen neuen Rekord erreicht, wie die Schweizerische Vereinigung zur Förderung der Windenergie (Suisse Eole) meldet. Damit kann der Stromverbrauch von rund 45 000 Haushalten gedeckt werden. Zwei Drittel der Windstromproduktion werden in den Wintermonaten generiert. Mit einem Anteil der Windenergie von 0,3 Prozent am gesamten Stromverbrauch im Jahr 2024 liegt die Schweiz noch weit hinter den Nachbarländern zurück: Der Anteil der Onshore-Windenergie (Land) am Strommix liegt in Deutschland bei über 26 Prozent, in Frankreich bei 9 Prozent und in Österreich bei 13 Prozent.
Pflegekräfte dringend gesucht
Die Gesundheitsbranche ist eine der stabilsten und gleichzeitig dynamischsten Wirtschaftszweige in der Schweiz. Der demografische Wandel, die wachsende Bevölkerung und der technologische Fortschritt lassen den Bedarf an qualifizierten Fachkräften stetig weiter ansteigen. Laut einer Studie von Swiss Healthcare Research wird der Personalbedarf im Gesundheitswesen in diesem Jahr um etwa 20 Prozent steigen, was rund 70 000 zusätzliche Stellen bedeutet. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit fehlen allein in der Pflege derzeit etwa 65 000 Fachpersonen. Der Bedarf an Spitex-Personal werde voraussichtlich um 25 Prozent steigen.
Ladestationen für E-Autos
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein zentraler Aspekt der Elektromobilität. Die Schweiz hat hier in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Laut Bundesamt für Energie gab es im März 2025 insgesamt 15 819 öffentlich zugängliche Ladepunkte an 7232 Standorten im Land. Spitzenreiter ist der Kanton Zürich mit 2299 Ladepunkten, gefolgt von den Kantonen Bern (1534) und Waadt (1452). Besonders entlang der Hauptverkehrsachsen wurden Schnellladestationen ausgebaut, um auch bequeme Langstreckenfahrten zu ermöglichen. Zum Vergleich: In Deutschland sind mehr als 145 000 Ladepunkte verfügbar, und auch Österreich treibt den Ausbau mit 25 236 Ladepunkten (Stand Oktober 2024) intensiv voran.
Frauen in Leitungspositionen
Über die ganze Schweiz hinweg besetzten Frauen per Anfang Februar dieses Jahres 28,4 Prozent aller im Handelsregister eingetragenen Führungspositionen. Damit hat sich die Frauenquote im Management zwischen 2014 und 2024 um 2,9 Prozentpunkte erhöht, wie aus einer jüngst veröffentlichten Auswertung des Wirtschaftsauskunftsdiensts Crif hervorgeht. Die meisten Managerinnen gibt es demnach in den Kantonen Aargau und Basel-Land, wo knapp ein Drittel der Führungskräfte weiblich sind. Schlusslicht ist mit 25,5 Prozent der Kanton Fribourg.
Stromrechnung Haushalte
Die durchschnittliche Stromrechnung eines Privathaushaltes wird 2025 insgesamt 1305 Schweizer Franken betragen. Sie liegt damit laut Statista um mehr als 140 Franken niedriger als im Vorjahr. Zugrunde gelegt wird ein Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden. Die leicht sinkenden Preise sind unter anderem auf die Stabilisierung der Preise auf dem Stromgrosshandelsmarkt zurückzuführen. Nach Angaben des Dachverbands der Schweizer Stromwirtschaft (VSE) verbrauchen Haushalte hierzulande etwa ein Drittel des Stroms. Mit fast 55 Prozent Verbrauchsanteil sind Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen die Hauptstromnutzer.
000 000
Stärkung der Kreislaufwirtschaft
Mit neuen Gesetzen, die Anfang dieses Jahres in Kraft getreten sind, soll die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz nachhaltig gestärkt werden. Ziel ist es, Materialkreisläufe zu schliessen, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren sowie umweltschonende Bauweisen zu fördern. Auch Produkte und Verpackungen unterliegen nun strengeren Vorgaben, im Einklang mit europäischen Standards. Laut dem Bundesamt für Umwelt ist die Schweiz trotz Effizienzgewinnen noch weit entfernt von einer nachhaltigen Ressourcennutzung. So werden hierzulande pro Jahr

163 Millionen Tonnen an neuen Materialien verbraucht, das sind 19 Tonnen pro Kopf – mehr als der europäische Durchschnitt (17, 8 Tonnen pro Person) und mehr als das Doppelte des geschätzten nachhaltigen Verbrauchs (8 Tonnen pro Person). Anders als im noch immer vorherrschenden linearen Wirtschaftssystem mit seinen Abfall- und Umweltproblemen wird in der Kreislaufwirtschaft, auch «Circular Economy» genannt, die Nutzungs- und Lebensdauer von Produkten erhöht, indem sie geteilt, wiederverwendet, repariert und wiederaufbereitet werden (s. Interview Seite 22).
Gender-Gap beim CO2-Ausstoss
Männer verursachen durchschnittlich 26 Prozent mehr CO2-Emissionen als Frauen. Das hat eine neue Studie der London School of Economics and Political Science ergeben. Untersucht wurde das Konsum- und Mobilitätsverhalten von 15 000 Menschen in Frankreich. Selbst unter Berücksichtigung des Alters, Bildungsstands und Einkommens verzeichnen Männer ein Emissionsplus von 18 Prozent. Laut Studie sind der Konsum von rotem Fleisch und längere Fahrten mit dem Auto – beides Güter mit hohem Schadstoffausstoss, die oft mit der männlichen Identität in Verbindung gebracht werden – für die meisten Unterschiede im CO2-Fussabdruck verantwortlich.
Modelle der Kreislaufwirtschaft Weniger Rohstoffe, weniger Abfall, weniger Emissionen
Geschwächte Wälder
Der Schweizer Wald steht unter Druck wie noch nie. Extremereignisse wie Hitze, Trockenheit, Stürme, Waldbrände, der Befall durch Schadorganismen und anhaltend hohe Stickstoffeinträge haben ihm so stark zugesetzt. dass sein Gesamtzustand heute als geschwächt gilt. Regional wird er sogar als «kritisch» eingestuft. Dies zeigt der Waldbericht 2025 des Bundesamts für Umwelt. Fast ein Drittel der Schweizer Landesfläche ist heute bewaldet. Das entspricht rund 1,3 Millionen Hektaren. Der Anteil von Schutzgebieten an der Waldfläche ist den Angaben zufolge in den letzten zehn Jahren von 5 Prozent auf 7 Prozent gestiegen.
Meinung Anstatt über eine lebenswerte Zukunft zu debattieren, diskutieren wir über die Fortsetzung der Gegenwart mit neuen Technologien. Dabei gibt es längst positive Alternativen. Von Leonard Creutzburg
Zahlreichen Studien zufolge blickt die Mehrheit der Menschen weltweit pessimistisch in die Zukunft – auch in der Schweiz. Besonders gross ist die Sorge um Umwelt und Klima. Das ist verständlich, denn wer die aktuellen Debatten verfolgt, stellt fest: Zukunft erscheint oft als Bedrohung, nicht als Versprechen. Zwar reden wir über Klimaziele, Energieversorgung und Mobilität, doch allzu oft bleiben die Antworten technokratisch. Die Zukunft wird als optimierte Fortsetzung der Gegenwart gedacht. Anstelle echter Visionen stehen neue Technologien im Mittelpunkt: E-Motoren, Wasserstoff, CO2-Abscheidung oder synthetische Kraftstoffe. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber unvollständig. Denn dieselbe Techniklogik, die viele der aktuellen Probleme mitverursacht hat, wird nun als alleinige Lösung präsentiert. Dabei zeigen sich deren Schattenseiten schon heute: Der Abbau seltener Rohstoffe für Batterien zerstört Ökosysteme und verstärkt geopolitische Abhängigkeiten, und Rechenzentren verbrauchen enorme Energiemengen. Vor allem aber steht fest: Technik allein kann keine sinnstiftende Zukunft schaffen. Sie macht uns aber glaubhaft, dass Verhaltensänderungen in der Zukunft nicht notwendig seien. Gleichzeitig mangelt es an positiven Bildern: Was bedeutet ein gutes Leben im 21. Jahrhundert? Wie wollen wir wohnen, arbeiten, konsumieren? Wie sieht Fortschritt aus, der nicht nur effizient, sondern auch lebenswert und umweltverträglich ist? Wenn Zukunft primär als Bedrohung wahrgenommen wird – oder als technische Reparatur der Gegenwart –, erstaunt es kaum, dass viele Menschen resignieren. Dabei gibt es längst Alternativen, die zeigen, dass Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Vernunft und Lebensqualität kein Widerspruch sein müssen. Zum Beispiel das Konzept der «15-Minuten-Stadt», bei der man von (E-)Autos unabhängig ist: Alles Lebensnotwendige – vom Einkauf bis zur Kinderarztpraxis – soll in kurzer Gehdistanz erreichbar sein. Das reduziert nicht nur den Verkehr und verbessert die Luftqualität, sondern stärkt auch die lokale Wertschöpfung und das soziale Miteinander. In dieser «regenerativen Stadt» geht es um eine Rückbesinnung auf Nähe, Sicherheit und Zeit –

Zukunftsvision Bern 2045, ein Visual aus der «Infothek für Realutopien».
«Es mangelt an öffentlichen Debatten über positive Perspektiven.»
klassische Werte, die angesichts wachsender Komplexität wieder Sinnhaftigkeit kreieren können. In Städten wie Paris und Barcelona werden diese Konzepte bereits erfolgreich umgesetzt. Verkehrsberuhigte Quartiere, begrünte Innenhöfe und lokale Versorgungskonzepte tragen dort messbar zur Lebensqualität bei. In Basel-Stadt wird das Konzept als
10-Minuten-Nachbarschaft diskutiert –initiiert durch die Liberal-Demokratische Partei. Solche sozialen Innovationen machen deutlich: Eine zukunftsfähige Gesellschaft entsteht nicht allein durch technologischen Fortschritt, sondern durch das innovative gesellschaftliche Zusammenspiel von Gestaltung, Verantwortung und Gemeinsinn. Woran es jedoch mangelt, ist eine breitere öffentliche Debatte über diese positiven Perspektiven. Dadurch fehlt der gesellschaftliche Kompass, der zeigt, wofür der Wandel eigentlich stehen kann. Dabei liegt das eigentliche Potenzial in der Frage, wie wir als Gesellschaft wieder zu einer Vorstellung kommen, was ein gutes Leben bedeutet. Eine Vorstellung, die über Konsumniveaus und Wachstumsraten hinausgeht. Wir brauchen keine technikfreien, aber auch keine technikgläubigen Utopien, sondern eine pragmatische Vision einer modernen, verantwortungsvollen und ökologisch tragfähigen Gesellschaft, in der Menschen gerne leben und wieder positiv in die Zukunft blicken. Dafür braucht es Politikerinnen, Stadtplaner, Unternehmerinnen und Bürger, die sich für solche Modelle einsetzen – und den Mut haben, über das Bestehende und Immergleiche hinauszudenken. Denn Zukunft entsteht nicht von selbst – und sie ist nicht alternativlos. Sie wird gestaltet und sollte nicht verwaltet werden. Und sie beginnt mit einer einfachen, aber entscheidenden Frage: Wie wollen wir eigentlich leben – im Bewusstsein unserer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft? Vielleicht so: In einer Nachbarschaft, in der man keinen Parkplatz mehr braucht, um Freiheit zu spüren.
Der Autor ist Verantwortlicher für neue Wirtschaftsmodelle und Zukunftsfragen beim WWF Schweiz.
Gesellschaft Die Reisebranche will den klimakompensierten Tourismus weiter fördern und hat dazu konkrete Massnahmen umgesetzt. Viele Passagiere sind allerdings nach wie vor nicht bereit, einen freiwilligen Extra-Obolus für Klimaschutzprojekte zu entrichten.
FELIX E. MÜLLER
Als vor etwa drei Jahren eine Welle heftiger Kritik das klimakompensierte Reisen in ein schiefes Licht rückte, war der Schock in der Branche gross: Die galt bis dahin als Verkörperung des Guten im Reisegeschäft, weil sie dessen klimapolitisch problematische Seite wie etwa den CO2-Ausstoss gewissermassen neutralisierte. Medienberichte wiesen nun darauf hin, dass viele Projekte die Versprechungen nicht erfüllten, weniger Kompensationswirkungen zeigten als versprochen, zuweilen schlampig organisierten und vereinzelt gar betrügerischer Natur waren.
Dies traf eine Branche ins Mark, die vor gut zwanzig Jahren entstanden war, um die Anliegen des Klimaschutzes vor
Nachhaltig handeln
allem im Tourismus zu fördern. Sie tat dies, indem sie etwa Aufforstungen förderte oder im Flugverkehr nachhaltige Bio-Treibstoffe finanzierte, immer mit dem Ziel, die CO2-Emissionen zu senken. Plötzlich sah sich dieses Geschäftsmodell auf den Prüfstand versetzt.
Standards verschärft
«Diese Kritik hat kurzfristig zu einer gewissen Verunsicherung geführt, und wir mussten einen Rückgang der Klimaschutzbeiträge verzeichnen», sagt Irina Ignat, Teamleiterin Marketing bei der Stiftung MyClimate, einer führenden Anbieterin von Klimaschutzprojekten. Auch Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands (SRV), spricht davon, dass das Vertrauen in
Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln ist das Fliegen die klimaschädlichste Art der Mobilität. Flugzeuge stossen tonnenweise CO2 aus, ausserdem Stickoxide, Russpartikel, Aerosole und Wasserdampf, wodurch die Atmosphäre zusätzlich erwärmt wird. Eine CO2-Kompensation ermöglicht
Reisenden, die Emissionen, die durch ihren Flug verursacht werden, auszu-
gleichen. Das heisst: Es wird an anderer Stelle dieselbe Menge Kohlendioxid eingespart, in der Regel durch Klimaprojekte. Global gesehen trägt die Kompensation allerdings kaum zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens bei, da es hier darum geht, die Emissionen drastisch zu vermeiden und zu reduzieren und nicht nur auszugleichen.
den Kompensationsgedanken «teilweise schon etwas beeinträchtigt» worden sei.
Doch jede Krise kann eine Chance sein. Die Tourismusbetreiber wie die Kompensationsbranche erhöhten in der Folge die Transparenz, verschärften die Standards und verbesserten die Kontrollmechanismen. Bei der Lufthansa Group werde seither mit noch grösserer Sorgfalt darauf geachtet, dass alle Projekte die «hochwertigen Standards und strengen Kriterien» erfüllen, welche die Allianz-Stiftung für Klima und Entwicklung entwickelt habe, sagt Swiss-Sprecher Michael Weinmann. Für MyClimate ergaben sich aus der Kritik «wichtige Impulse für die Weiterentwicklung» von Klimaschutzprojekten.
Diese Reaktionen hatten zur Folge, dass der Vertrauensverlust zu einem guten Teil aufgefangen werden konnte und damit die Idee der Klimakompensation weiterhin eine Zukunft hat. Bei der Swiss sehe man auf jeden Fall einen «positiven Trend bei der Zahl der Passagiere, die von den bereitgestellten Angeboten Gebrauch machen», sagt Michael Weinmann. SRV-Geschäftsführerin Andrea Beffa teilt diese Beurteilung.
Die Einschätzung von Irina Ignat fällt ambivalenter aus. Es sei kein klarer Trend auszumachen, sagt sie. Einerseits werde der CO2-Rechner auf der Webseite von MyClimate immer häufiger benutzt, doch sei die Zahl der tatsächlich finanzierten Klimaschutz-Tonnen rückläufig. «Das heisst: Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, wie hoch der CO2-Ausstoss ihrer Reise ist, zeigen sich aber weniger bereit, dafür auch
einen konkreten Beitrag zu leisten.» Gegenwärtig nutzen bei der Lufthansa Group rund vier Prozent der Fluggäste eine der verschiedenen Möglichkeiten zu nachhaltigerem Fliegen. Bei Hotelplan Suisse enthält laut Andrea Beffa rund jede vierte Buchung einen Beitrag an nachhaltigem Flugtreibstoff. MyClimate wiederum stellt fest, dass das Interesse von Tourismusfirmen zunehme, Klimaschutzbeiträge in ihre Leistungen zu integrieren.
CO2-reduzierte Pauschalreisen
In der Reisebranche will man den klimakompensierten Tourismus weiter fördern. Laut Andrea Beffa schult der Verband seine Mitglieder über Nachhaltigkeit und entwickelt ein Projekt, den Klimafussabdruck aller Reiseangebote sichtbar zu machen. MyClimate weist auf Anbieter wie Twerenbold-Reisen hin, die CO2-reduzierte Pauschalreisen fest in ihr Angebot integriert hätten, ohne Mehrkosten für die Gäste. Besonders stolz ist man auf die guten Resultate des Programms «Cause we care», bei dem die Gäste einen Klimabeitrag leisten können, der vom Reiseunternehmen verdoppelt wird. Und die Swiss pusht erfolgreich den «Green Tarif». Dieser beinhaltet auf Europastrecken einen CO2-Ausgleich, der zu 20 Prozent von nachhaltigem Treibstoff und zu 80 Prozent von Klimaschutzprojekten stammt. Gesteigert wird die Attraktivität dieses Angebots mittels flexibleren Umbuchungsmöglichkeiten und zusätzlichen Statusmeilen.

Klimawandel hin oder her: In der Schweiz wird wieder so viel geflogen wie zu VorCorona-Zeiten. PIXABAY
Michael Weinmann von der Swiss weist darauf hin, dass diese Massnahmen nur einen Teil der Bemühungen darstellen würden, um die Nachhaltigkeitsbilanz der Airline zu verbessern. So spiele in diesem Zusammenhang auch die Erneuerung der Flotte eine gewichtige Rolle. «Der Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Luftfahrt ist aufwendig und nur möglich, wenn alle mithelfen: Airlines, Politik, Wirtschaft und Passagiere.» Was für die Luftfahrt gilt, gilt auch für die ganze Tourismusbranche.
Kreislaufwirtschaft Was einst auf dem Schrottplatz landete, wird heute zum Rohstoff für nächste Fahrzeuggenerationen. Mittendrin: das Recycling- und Demontage-Zentrum von BMW. Mit seinem Knowhow wird dort nicht nur die Kreislaufwirtschaft im eigenen Konzern vorangetrieben – das Zentrum unterstützt auch Verwerter weltweit dabei, die Autoindustrie nachhaltiger zu gestalten.
ROBERTO STEFANO
Soll das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht werden, müsste der globale CO2Ausstoss in den kommenden Jahren dramatisch sinken. Doch statt zu fallen, steigen die Emissionen kontinuierlich an. Umso wichtiger ist es, neben bewährten Ansätzen, neue, innovative Wege zu gehen, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Dies gilt auch in der Autoindustrie. Dort richtet sich der Hauptfokus vieler Hersteller bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen primär auf die Elektromobilität. Tatsächlich lassen sich damit erhebliche CO2-Reduktionen erzielen. Doch ein wichtiger Hebel im Kampf gegen den Klimawandel, der bislang unterschätzt wurde, liegt in den Rohstoffen, genauer in den Sekundärrohstoffen. Schliesslich muss, was recycelt und wiederverwendet werden kann, nicht energieintensiv neu gewonnen werden – und spart damit erhebliche Mengen CO2. So verursacht etwa die Herstellung von Aluminium aus recyceltem Material bis zu 95 Prozent weniger CO2-Emissionen. Signifikante Einsparpotenziale ergeben sich auch bei Stahl, Kupfer oder Kunststoffen. Die Aufbereitung wertvoller Materialien aus Altfahrzeugen, Altbatterien oder Produktionsresten wird damit zur tragenden Säule für eine zukunftsfähige Mobilität. Im Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) der BMW Group in München ist diese Erkenntnis schon lange gereift. Hier werden seit mehr als 30 Jahren Prozesse und Methoden analysiert und entwickelt, um alte Fahrzeuge so weit wie möglich und gleichzeitig effizient zu zerlegen. Ziel ist es, die darin enthaltenen Wertstoffe zurückzugewinnen. Dieses gesammelte, umfangreiche Recyclingwissen hält die BMW Gruppe nicht unter Verschluss, sondern teilt es mit rund 3000 Verwertern weltweit. Das Ziel: bewährte Recyclingmethoden auf globaler Ebene voranzubringen und wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung neuer Fahrzeuge zu gewinnen. Informationen dazu erhalten die Verwerter unter anderem über die kostenfreie Plattform IDIS (International Dismantling Information System), an deren Aufbau das RDZ massgeblich beteiligt war. Inzwischen nutzen etwa 3000 Betriebe in 32 Ländern die gemeinsame Recyclingdatenbank.
Systematisch zerlegt
Laut dem Bundesamt für Umwelt werden alleine in der Schweiz jährlich rund 200 000 Fahrzeuge aus dem Verkehr genommen. Die Unfall- und Altfahrzeuge werden systematisch zerlegt, um die hochwertigen und kostbaren Rohstoffe abzutrennen. Im Jahr 2022 lag die Recyclingquote für Altfahrzeuge hierzulande gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) bei gut 95 Prozent des Gesamtgewichts eines Fahrzeugs. Ein erheblicher Anteil entfällt dabei auf Metalle wie Stahl, Aluminium und Kupfer, die in Schmelzwerken erneut verarbeitet werden. Im Idealfall entnehmen die Autoverwerter in einem ersten Schritt aus den Fahrzeugen alle Flüssigkeiten, die Reifen und die Batterie. Danach bauen sie weiter verwendbare Fahrzeugteile aus, die als Ersatzteile wieder in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Erst das ausgeschlachtete Fahrzeug kommt für den Transport in die Presse und danach in den Schredder. Über Schmelzwerke gelangen die Rohstoffe wieder in die Produktion von Fahrzeugen und anderen Produkten. Was übrig bleibt, wird in thermi-

gestartet.
schen Verwertungsanlagen genutzt, um Wärmeenergie zu erzeugen – und damit Strom und Fernwärme zu produzieren.
Beispiel Hochvoltbatterien
Ein eindrückliches Beispiel für die Fortschritte im Fahrzeugrecycling kommt aus dem Bereich der Hochvoltbatterien aus Elektrofahrzeugen. Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit dem Technologiespezialisten für Lebenszyklen, SK tes, hat die BMW Group kürzlich einen solchen Recyclingprozess in Europa eingeführt. Nicht mehr verwendbare Hochvoltbatterien aus Entwicklung, Produktion und Marktbetrieb werden gesammelt und an SK tes übergeben. Dort werden sie zunächst mecha-
nisch zerkleinert und anschliessend im Verfahren der Hydrometallurgie in ihre wertvollen Bestandteile zerlegt. Nickel, Kobalt und Lithium lassen sich so effizient zurückgewinnen – und fliessen als Sekundärrohstoffe unter anderem in die Entwicklung neuer Antriebsgenerationen.
Bis 2026 sollen Hochvoltbatterien auch in den USA und Mexiko in einem geschlossenen Kreislauf verwertet werden. Die neusten Erkenntnisse aus diesen Recyclingprojekten kommen schliesslich den Entwicklungsabteilungen zugute. Diese nutzen das Wissen bei der Planung von Neuwagen. Schliesslich beeinflussen die Wahl der Bauteile und Materialien die spätere Recyclingfähigkeit eines Fahrzeuges entscheidend. Die BMW
Group nennt das Prinzip «Re:Think, Re:Duce, Re:Use und Re:Cycle». Das Ziel dabei ist ein zirkuläres Design, durch das die Fahrzeuge am Ende ihrer Lebensdauer als wertvolle Rohstoffquelle für neue Modelle nutzbar werden sollen. Ein entscheidendes Element bildet die Verwendung von Monomaterialien anstelle von Verbundwerkstoffen, die eine vereinfachte Wiederverwertung durch höhere Sortenreinheit ermöglichen.
Faktor Zeit
Eine wichtige Rolle spielt im Recycling auch der Faktor Zeit: Je schneller ein Verwerter das Produkt in seine Einzelteile zerlegen kann, desto attraktiver ist für ihn die Rückgewinnung der Se-
kundärrohstoffe. Deshalb kommen immer öfter Methoden zum Einsatz, die eine einfache Demontage von Bauteilen und eine saubere Trennung der Materialien ermöglichen. Anstelle von Verklebungen setzt man auf innovative Verbindungslösungen, die das Recycling weiter optimieren. Seit seiner Gründung liefert das RDZ hierbei wichtige Impulse für neue Fahrzeugmodelle, Materialien und Technologien – stets mit einem klaren Fokus auf Recycling. Mit der zunehmenden Elektromobilität baut das RDZ seine Rolle als Kompetenzzentrum für Fahrzeugrecycling weiter aus. In einer Zeit, in der die Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie an Bedeutung gewinnt, werden die Erkenntnisse des RDZ immer wichtiger.
«Am Ende bringt es dem Klima mehr, wenn wir unser Knowhow teilen»
Fragen an Jörg Lederbauer, Leiter des Recycling- und Demontagezentrums (RDZ) der BMW Group
Der gebürtige Österreicher ist Hauptabteilungsleiter für Kreislaufwirtschaft, Ersatzteilversorgung Hochvoltspeicher und elektrischer Antrieb bei der BMW AG.
Die BMW Group hat das Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) in München vor über 30 Jahren gegründet. Weshalb machen Sie das dort gewonnene Recyclingwissen öffentlich? Sie könnten damit einen Wettbewerbsvorteil erzielen?
Jörg Lederbauer: Das wäre zu kurz gedacht. Wir selbst recyceln im RDZ nur einen sehr geringen Teil der Fahrzeuge. Deutlich mehr passiert dagegen bei den Verwertungsbetrieben weltweit. Wir haben ein vitales Interesse daran, dass Sekundärrohstoffe zurückgewonnen werden, die wir für neue Fahrzeuge verwenden können. Also haben wir auch ein Interesse daran, dass die Verwerter auf das Knowhow zurückgreifen können, das wir bei der Zerlegung von Prototypen und Versuchsfahrzeugen im RDZ ge-
winnen. Wir stellen allen Partnern weltweit diese Informationen kostenlos über eine von uns entwickelte Onlineplattform zur Verfügung. Am Ende ist das also eine klassische Win-win-Situation. Mit der Elektromobilität stehen Sie vor neuen Herausforderungen im Recycling, unter anderem wegen der Hochvoltbatterien mit ihren wertvollen Rohstoffen. Wie reagieren Sie? Batterien sind ein zentrales Thema. Deshalb arbeiten wir mit dem Recyclingspezialisten SK tes zusammen, der ein Verfahren zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus Fahrzeugbatterien entwickelt hat. Grundsätzlich recyceln wir dabei den kompletten Speicher, also auch das Gehäuse. Ein besonderes Augenmerk liegt aber auf Rohstoffen der Zellchemie wie beispielsweise Kobalt, Nickel oder Lithium. Diese Rohstoffe fliessen dann direkt in die Produktion neuer Batteriezellen zurück. Solche Partnerschaf-
ten sind essenziell – sie sichern nicht nur Ressourcen, sondern schaffen echte Materialkreisläufe. Solche Closed Loops hat die BMW Group übrigens bereits auch für diverse andere Rohstoffe etabliert.

Jörg Lederbauer
Recycling beginnt längst nicht mehr erst am Lebensende eines Fahrzeugs. Welche Rolle spielt zirkuläres Design schon in der Entwicklung neuer Modelle? Eine sehr zentrale Frage. Recyclingfähigkeit wird bei uns bereits in einer frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mitgedacht – von der Wahl der Materialien über die Art der Verbindungen bis zur Demontierbarkeit. Je sortenreiner und modularer ein Fahrzeug gebaut ist, desto effizienter lassen sich Bauteile und Rohstoffe später wiederverwenden. Ein gutes Beispiel ist auch hier der Hochvoltspeicher. Theoretisch könnte man ihn mit der Karosserie verkleben oder verschrauben. Dadurch, dass wir uns für das Verschrauben entschieden haben, wird eine Demontage oder eine Reparatur deutlich effizienter und kostengünstiger. Zirkuläres Design ist also kein Zukunftsthema mehr – es ist heute schon ein integraler Bestandteil unserer Entwicklungsarbeit.
Klima Flugreisen erweitern den Horizont, beeinflussen aber auch das Klima. Google arbeitet daran, die weissen Kondensstreifen am Himmel mit künstlicher Intelligenz kostengünstig zu vermeiden –ein Ansatz mit erstaunlich positivem Effekt.
STEPHAN LEHMANN-MALDONADO
Wenn weisse Linien den blauen Himmel durchschneiden, träumen die einen von fernen Ländern – die anderen erinnern sich schmerzlich daran, wie sehr der Mensch ins Ökosystem eingreift. Kondensstreifen können bis zu 10 Prozent des Himmels über Zentraleuropa bedecken. Nur den wenigsten ist bewusst, dass sie auch unser Klima beeinflussen.
Doch wann entstehen diese hellen Spuren? Immer dann, wenn Flugzeuge heisse, wasserdampfhaltige Abgase in die kalte, feuchte Höhenluft ausstossen. Diese kann oft kein Wasser mehr aufnehmen, deswegen kondensiert der Wasserdampf um die winzigen Abgaspartikel.
Wie Wolken bestehen die Kondensstreifen vor allem aus kleinen Wassertröpfchen – die sich in Windeseile zu Eiskristallen verwandeln. Das Problem: Tagsüber reflektieren die Eiskristalle die Sonnenstrahlen, nachts aber halten sie die Wärme, die die Erde abstrahlt, zurück – ähnlich wie Treibhausgase. So tragen sie zur Erderwärmung bei. Laut einem Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aus dem Jahr 2022 sind CO2-Emissionen für mehr als die Hälfte der Klimawirkung der Luftfahrt verantwortlich – mehr als 35 Prozent gehen jedoch auf Kondensstreifen zurück.
Kleine Umleitung, grosser Effekt «Wenn Flugzeuge besonders feuchte Luftschichten umfliegen könnten, liessen sich Kondensstreifen vermeiden und reduzieren», dachten sich ein paar kluge Köpfe bei Google. Doch woher sollten Pilotinnen, Piloten und Flugdienstberatende wissen, in welchen Regionen die Luftverhältnisse gerade suboptimal sind? Genau dafür haben die Ingenieurinnen und Ingenieure eine Lösung entwickelt – mithilfe von künstlicher Intelligenz. Diese kann riesige Mengen an Wetter-, Satelliten- und Flugdaten auswerten und vorhersagen, wann und wo Kondensstreifen auftreten werden. Das ist eine ideale Entscheidungsgrundlage für Pilotinnen, Piloten und Flugberatende, um die Flughöhe den Umweltbedingungen anzupassen. Zusammen mit American Airlines hat Google diese Lösung ein halbes Jahr lang getestet. Rund 70 Testflüge orientierten sich an den KI-gestützten Prognosen – und siehe da: Es gelang, 64 Prozent der Kondensstreifen zu vermeiden und sie um 54 Prozent zu verkürzen. Die Umleitungen erhöhten zwar den Treibstoffverbrauch bei den betroffenen Flugzeugen um 2 Prozent. Wenn man aber
die ganze Airline-Flotte berücksichtigt, ergibt sich nur ein 0,3 Prozent höherer Mehrverbrauch. Der Grund: Nur wenige Flüge müssen ihre Routen geringfügig anpassen.
«Unter dem Strich ergibt sich ein positiver Effekt fürs Klima», ist Max Vogler, Softwareingenieur bei Google, überzeugt. Er hält die Routenänderungen auch wirtschaftlich für sinnvoll. Laut Google lässt sich eine Tonne CO2Äquivalent für 5 bis 25 Dollar respektive Franken einsparen. Zum Vergleich: Ein Bericht des Bundesrates geht von Kosten zwischen 150 und 320 Franken pro reduzierte Tonne CO2 in der Schweiz aus. Nach erfolgreichen Tests in den USA weitet Google das Projekt nun auf Europa aus. Gemeinsam mit Eurocontrol, der Organisation für die europäische Flugsicherung, und weiteren Partnern aus der Industrie sollen die KIModelle verfeinert werden. In einigen Jahren könnte die Technologie weltweit Standard sein.
Mit TIM zum klimaschonendsten Flug
Nicht jeder ist ein Kapitän der Lüfte. Aber auch Passagiere können sich für einen Flug mit möglichst wenig Schadstoffemissionen entscheiden. Bei Google Flights zum Beispiel findet man unter «Emissionen» die CO2-Äquivalente jedes Flugs. Klickt man nun auf die Funktion «nach Emissionen sortieren», wird die umweltfreundlichste Verbindung angezeigt. Die Ergebnisse sind verblüffend: Ein Direktflug von Zürich nach Miami verursacht zum Teil nur halb so viele Treibhausgase wie ein Flug mit Zwischenlandung.
Die Angaben von Google basieren auf dem Travel Impact Model, kurz TIM genannt. Es berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren – vom Flugzeugtyp über die Route bis zur Fracht an Bord – und rechnet diese auf den einzelnen Sitzplatz herunter. TIM wird bereits bei mehr als 50 Prozent der weltweiten Flugbuchungen eingesetzt. Plattformen wie Booking.com, Skyscanner, Expedia und viele andere zeigen seine Werte an. Das Modell ist breit abgestützt: Hinter jeder Änderung steht ein Gremium aus Wissenschaftlern, Mitgliedern europäischer und US-amerikanischer Luftfahrtbehörden sowie Vertretern von Fluggesellschaften. Nicht zuletzt engagiert sich auch Prinz Harry mit seiner gemeinnützigen Organisation Travalyst für TIM.
Mit den neuen Technologien kann man vielleicht den weissen Streifen am Himmel weniger oft nachschauen. Doch dafür bleibt der Traum vom Fliegen auch für die nächste Generation lebendig.

«Wir verbinden Innovation mit Nachhaltigkeit»
Softwareingenieur Max Vogler verrät, warum Google die Kondensstreifen am Himmel mithilfe von KI verhindern will, welche Rolle der Standort Zürich dabei spielt und wie die Branche auf diese Offensive reagiert.
Warum befasst sich Google intensiv mit der Reduktion von Klimagasen in der Luftfahrt?
Max Vogler: Google hat ambitionierte Ziele. Wir wollen nicht nur klimaneutral werden, sondern ab 2030 sogar eine Gigatonne CO2-Äquivalent pro Jahr reduzieren. Wie schaffen wir das? Unsere Climate-AI-Forschungsabteilung hat herausgefunden, dass Kondensstreifen ein vielversprechender Ansatzpunkt sind. Denn wenige Flüge sind für den Grossteil der Kondensstreifen verantwortlich.
Mithilfe von Googles KI-Knowhow lassen sich Kondensstreifen vermeiden. Wie ist der Standort Zürich in dieses Projekt involviert?
Googles Team für Nachhaltiges Reisen ist in Zürich angesiedelt. Hier verbinden wir die innovative Firmenkultur mit dem europäischen Fokus auf Nachhaltigkeit. Unser Team arbeitet daran, die Klimaforschung für Fluglinien und Flugplanungssoftware zugänglich zu machen. Wir helfen unseren Industriepartnern, die Vorhersagen in ihre Systeme zu integrieren. Zudem schulen wir Mitarbeitende in der Flugplanung, Flugrouten effektiv anzupassen.
Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von bisherigen Bemühungen, den Klimawandel zu bremsen? Bisherige Programme konzentrierten sich auf die CO2-Emissionen. Doch da
sind Einsparungen zunehmend schwieriger zu realisieren. Zudem sind herkömmliche Wettervorhersagen für Flughöhen von rund 10 000 Metern unzureichend. Wir haben nun effektivere Lösungen entwickelt – durch die Kombination von KI mit besseren Wettersatelliten und Durchbrüchen in der Klimaforschung. Das ermöglicht es uns, kleine Flugplanänderungen mit grosser positiver Wirkung vorzuschlagen.
Wie verlässlich sind die KI-Vorhersagen?
Unsere Vorhersagen sind akkurat genug, um Klimaauswirkungen signifikant zu reduzieren. In unserer Studie mit American Airlines konnten die Piloten und

Pilotinnen mehr als die Hälfte der Kondensstreifen mithilfe unserer Flugrouten vermeiden. Das haben auch unabhängige Forschende bestätigt.
Wie reagieren Fluggesellschaften auf Ihre Lösung?
Das Vermeiden von Kondensstreifen ist eine der kosteneffizientesten Klimalösungen in der Luftfahrt. Kein Wunder, dass viele Fluggesellschaften sehr positiv reagieren!
American Airlines hat Ihre Lösung getestet. Welche Gesellschaften kommen als nächstes?
Wir sind offen für alle Partnerschaften – nicht nur mit Fluglinien, sondern auch mit Dienstleistern in der Flugplanung und Flugsicherung. Aktuell arbeiten wir mit der europäischen Flugsicherung Eurocontrol zusammen. Weitere Partnerschaften verraten wir im Laufe des Jahres.
Was können Passagiere unternehmen, um «klimafreundlich» zu fliegen?
Die Klimaauswirkung hängt von vielen Faktoren ab: Sitzklasse, Auslastung, Flugzeugtyp, Route und Tageszeit. Unsere Emissionsschätzung auf Google Flights zeigt auf einen Blick, welcher Flug klimafreundlicher ist. Darüber hinaus stellt die Google-Suche umweltfreundliche Reisealternativen vor – zum Beispiel Zugverbindungen.

EPFL-Professorin Giulia Tagliabue ist Expertin für Nanophotonik: Sie erforscht die Wechselwirkungen von Licht und Materie im Milliardstel-Meter-Bereich. EPFL
Forschung Wenn Nanomaterialien mit Licht interagieren, treten spannende Effekte auf. Giulia Tagliabue will sie für die nachhaltige Produktion und Speicherung von Energie nutzen – und setzt dabei auch auf die Verdunstung von Wasser.
SUSANNE WEDLICH
Manche alltäglichen Phänomene scheinen kaum der Rede wert: Flüssiges Wasser erhitzt und steigt als Dampf auf. Es verdunstet. Keine grosse Sache, richtig? Für Giulia Tagliabue schon. Sie sieht in der Verdunstung kein Allerweltsphänomen, sondern ein fast unendliches Potenzial – für Anwendungen, die zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen sollen.
Tagliabue leitet das Laboratory of Nanoscience for Energy Technology (LNET) an der EPFL und fokussiert sich dabei auf Nanophotonik. Dieser noch recht junge Forschungsbereich schreitet seit einiger Zeit mit vielen spannenden Resultaten rasant voran. Es geht hier, einfach gesagt, um die Wechselwirkungen von Licht und Materie im Nanometerbereich. Dazu muss man wissen: Wenn Photonen, die kleinsten Einheiten von Licht, auf Teilchen, Drähte oder Oberflächen im Nanomassstab treffen, können neuartige Effekte auftreten. Denn die Materialien verhalten sich im Nanobereich anders als gewohnt. Das macht ihre Interaktionen mit Licht so spannend: Wenn wir diese Effekte verstehen, können wir sie kontrollieren und nutzen, etwa für die Produktion und Speicherung von Energie. Das Ziel ist klar, der Weg aber trotzdem weit. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Auf dieser Skala nimmt selbst ein menschliches Haar mit einem Querschnitt von bis zu 100 000 Nanometern plötzlich riesenhafte Dimensionen an. Das bedeutet, dass die Nanowelt für das blosse Auge unsichtbar und ganz grundsätzlich schwer zu durchdringen ist, aber eben auch viel zu bieten hat. So kann etwa die Sonnenstrahlung allein den Transfer von Energie im Nanobereich antreiben, was Tagliabue über ihre Forschung nutzbar machen möchte. «Wir müssen dafür aber zuerst die wichtigsten Zusammenhänge verstehen»,
sagt sie. «Das ist so komplex, weil im Nanobereich viele verschiedene Phänomene gleichzeitig auftreten und ganz unterschiedliche Effekte auslösen. Wir wollen zumindest entschlüsseln, welche jeweils besonders wichtig sind.» Deshalb hat sie sich vor allem der Grundlagenforschung verschrieben. Deshalb sucht sie über die Grenzen ihrer Diszplin hinweg Kooperationspartner, wo in ihrer Gruppe die Expertise oder Ausstattung fehlt.
Wie etwa die Zusammenarbeit mit Modellierern zeigt, ist dieser interdisziplinäre Ansatz ein Erfolgsrezept. «Wir legen unsere Experimente so an, dass wir den Theoretikern sehr saubere Daten liefern können», sagt Tagliabue. «Dafür bekommen wir von ihnen Vorhersagen, um zu testen, ob diese sich mit unseren Ergebnissen decken. Wir erhalten auf dem Weg Informationen, die anderweitig nicht zugänglich gewesen wären.» Informationen, die auch in die drei Forschungsbereiche in Tagliabues Labor einfliessen.
Licht wird «eingefangen»
Ein erster Forschungsbereich, die Plasmonic Catalysis for Photochemical Energy Storage, will chemische Reaktionen über Licht kontrollieren. Ganz allgemein lassen Katalysatoren chemische Prozesse schneller ablaufen – und in der plasmonischen Variante spielt Licht ebenfalls eine Rolle. Die Katalysatoren bestehen meist aus Silber oder Gold in Nanogrösse, weil Metalle wie diese eine wichtige Eigenschaft haben: Sie sind gute Katalysatoren, können aber auch effizient Licht «einfangen» und auf diese Weise viel Energie erzeugen, die dann wiederum chemische Reaktionen starten, beschleunigen und steuern kann. Ein wichtiger Ansatz, weil herkömmliche Katalysen oft unter hohem Druck und hohen Temperaturen arbeiten, also viel Energie verbrauchen. Die plasmonische Katalyse
wäre ungleich nachhaltiger und könnte zukunftsträchtig etwa für die Produktion von «grünem» Wasserstoff eingesetzt werden: mithilfe von Gold-Nanopartikeln im Sonnenbad.
«In diesem Bereich bin ich am längsten tätig, weil ich mich schon in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt habe», sagt Tagliabue. «Dank dieser Vorarbeiten stützt sich unsere Arbeit auf ein sehr grundlegendes Verständnis dieser mikroskopischen Prozesse.» Was Früchte trägt: Wie vor einiger Zeit in der Fachzeitschrift «Light: Science and Applications» berichtet, konnte das Team einen bislang unbekannten Effekt bei der Interaktion von Nanogold mit Licht nachweisen.
Neuartige Linsen
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind die Thermonanophotonics for Reconfigurable Systems, bei der es im Kern um die Interaktion von Nanomaterialien mit Licht und mit Wärme geht. Hier erhofft sich die Forschung etwa für die Sensorik oder Optoelektronik innovative Systeme, die ihre Struktur oder ihre Funktionen reversibel, also umkehrbar, an Umweltbedingungen anpassen können. «Ein Beispiel wären Linsen für bildgebende Anwendungen», sagt Tagliabue. Die Rede ist von sogenannten Metalinsen: neuartige optische Bauteile, die Licht nicht wie herkömmliche Linsen fokussieren, sondern auf Oberflächen mit Nanostrukturen beruhen. Dadurch können sie bis zu 1000mal flacher ausfallen und künftig bisher unerreicht kompakte, leichte und kostengünstige optische Systeme ermöglichen. Anwendungsbereiche wären zum Beispiel Smartphone-Kameras oder medizinische Endoskope. «Es ist bereits bekannt, wie man Metalinsen perfekt flach herstellt», sagt Tagliabue. «Aber wir würden ihre Eigenschaften gerne nachträglich verändern. Das hängt von ihrer Struktur ab,
die wir über die Temperatur – also über das Licht – beeinflussen wollen. Ein Beispiel wäre eine Linse, die bei Raumtemperatur eine bestimmte Brennweite hat, die sich aber ändern könnte, wenn die Linse mit Licht bestrahlt und erwärmt wird. Wir könnten das ohne Berührung tun, wenn die Linse nur schwer zugänglich ist.»
Elektrische Ströme
Der dritte Forschungsbereich ist die Hydrovoltaic Generation – die Nutzung der Verdunstung von Wasser. Etwa die Hälfte der Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, feuert diesen Vorgang an. Er steht für ein enormes Energiepotenzial, weil die Verdunstung einen kontinuierlichen Wasserfluss antreibt: wie eine Pumpe. Das lässt sich mithilfe spezieller Geräte nutzen, die in ihrem Inneren nanogrosse Kanäle haben. Strömt Wasser durch sie hindurch, um zu verdunsten, entstehen elektrische Ströme und Spannung. Diese Geräte sind noch nicht reif für eine industrielle Anwendung, auch weil bisher nicht alle relevanten Effekte verstanden sind. Tagliabue und ihr Team haben eine neuartige experimentelle Plattform mit präzise angeordneten SiliziumNanosäulen entwickelt, um den hydrovoltaischen Effekt der Verdunstung unter streng kontrollierten Bedingungen zu testen. Wie sie in der Fachzeitschrift «Cell Press Device» berichten, konnten sie damit eine wichtige Erkenntnis gewinnen. «Solche Hydrovoltaikgeräte müssen, anders als bislang angenommen, nicht mit hochgereinigtem Wasser betrieben werden», sagt Tagliabue. «Sie funktionieren auch mit Leitungs- oder Meerwasser.»
Dies könnte spannende Anwendungsmöglichkeiten in Ergänzung zu bestehenden Energieerzeugungslösungen eröffnen. «Ich denke, wir brauchen einen Mix aus nachhaltigen Ansätzen, die wir flexibel und je nach Umwelt-
bedingungen einsetzen können», sagt sie über die Energieversorgung der Zukunft. «Und dieser Ansatz könnte uns eine weitere Alternative bieten.» Mit ihrem Team möchte sie nun eine Förderung des Schweizerischen Nationalfonds auch dafür nutzen, ein hydrovoltaisches Prototypmodul unter realen Bedingungen zu testen: am Genfersee. Gleichzeitig sind aber auch kleinteilige Anwendungen denkbar, weil hydrovoltaische Geräte nur wenig verdunstende Flüssigkeit benötigen. Möglicherweise können in Zukunft also auch tragbare Fitnesstracker auf diese Weise betrieben werden – sobald der Schweiss fliesst.
Giulia Tagliabue wurde 1985 in Bologna geboren. Sie studierte Maschinenbau an der Universität Udine und kam 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die EPFL. Später wechselte sie als Doktorandin an die ETH Zürich und promovierte 2015 in Maschinenbau mit einer Arbeit über nanophotonisches Design für Licht-Wärme- und Licht-LadungsUmwandlungsgeräte. Dank zweier Postdoktoranden-Mobilitätsstipendien des Schweizerischen Nationalfonds konnte Tagliabue während mehrerer Jahre am California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena forschen. Seit Anfang 2019 ist sie Assistenzprofessorin am Institut für Maschineningenieurwesen der EPFL. Sie leitet das Laboratory of Nanoscience for Energy Technology (LNET). Seit Dezember 2022 ist sie auch Managing Editor der Zeitschrift «Nanophotonics». Ihre Arbeit wurde unter anderem mit dem Latsis University Award EPFL 2024 und ihre hervorragende Lehrtätigkeit mit dem EPFL Award for Best Teaching 2024 ausgezeichnet.
Sustainable Switzerland Forum Das SSF, jährliches Konferenz-Highlight der Plattform Sustainable Switzerland, bringt am 2. September 2025 in der Bern Expo Entscheiderinnen und Entscheider für eine nachhaltige Entwicklung in der Schweiz zusammen.
ELMAR ZUR BONSEN
In rund zwei Monaten ist es wieder so weit, dann treffen sich Fachleute und Nachhaltigkeitsverantwortliche aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik am 2. September 2025 zur bereits vierten Ausgabe des Sustainable
Switzerland Forum (SSF) in Bern. Als ein Highlight der Plattform Sustainable Switzerland dient diese schweizweit führende Nachhaltigkeitskonferenz dazu, Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen, neue Lösungsansätze vorzustellen und gemeinsam aktiv zu werden. Die insgesamt 750 Teilnehmenden
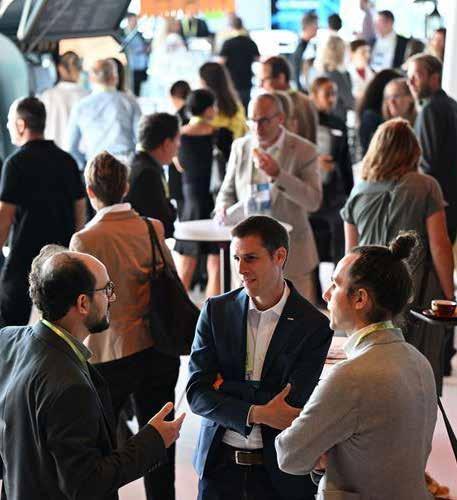
Klima Die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre werde von Politikern in Europa «sträflich vernachlässigt», kritisiert der Klimaforscher und Ökonom Ottmar Edenhofer.
KALINA OROSCHAKOFF
Für eine Gruppe von einflussreichen europäischen Klimawissenschaftlern steht fest: Ohne Technologien, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, kann sich die Europäische Union von ihren klimapolitischen Ambitionen verabschieden. «Die EU muss neben den notwendigen Emissionsminderungen zusätzlich verstärkt Kohlendioxid aus der Luft filtern, um ihre Klimaziele zu erreichen», betont Ottmar Edenhofer. Der deutsche Wissenschaftler leitet das European Scientific Advisory Board on Climate Change (ESABCC), einen 2021 gegründeten Expertenrat, und berät die EU-Führungsriege dabei, die Klimaziele der Staatengemeinschaft zu erreichen. Und die sind ambitioniert: Im Rahmen ihres «European Green Deal» hat sich die EU verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null zu drücken. Dafür muss einerseits der Ausstoss massiv reduziert werden –er lag zuletzt bei rund 3,4 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr –, andererseits aber auch CO2 in grossem Masstab aus der Luft entfernt werden. Denn klar ist: Weder in der Schwerindustrie noch in der Luft- und Schifffahrt lassen sich die umweltschädlichen Emissionen so einfach mindern.
Im Februar dieses Jahres veröffentlichte das Expertengremium Vorschläge, wie die EU Anreize für den Einsatz der
erwartet ein dichtes Programm mit inspirierenden Vorträgen und Podiumsdiskussionen. In drei parallel veranstalteten Themenstreams unter Beteiligung der Plattformpartner werden am Vormittag aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Nachhaltigkeit vertieft behandelt – praxisnah und mit konkreten Fallbeispielen. Die Themenschwerpunkte sind dieses Mal «Kreislaufwirtschaft», «Lieferketten im Spannungsfeld» und «KI & Energiemanagement». Die Konferenzteilnehmenden haben die Wahl.
Kreislaufwirtschaft
In diesem Themenstream geht es um den Status quo und die Perspektiven der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz. Behandelt wird ausserdem die grundsätzliche Frage, mit welchen Strategien Ressourcen geschont und die Lebensdauer von Produkten verlängert werden können. Und: Wie profitieren Unternehmen von Modellen, die auf das Teilen, Wiederverwenden und Reparieren setzen? Anhand von zukunftsweisenden Unternehmensbeispielen wird untersucht, wie sich zirkuläres Denken und Wirtschaften in Wettbewerbsvorteile umwandeln lassen.
Lieferketten im Spannungsfeld Wie können Unternehmen nachhaltige Lieferketten erfolgreich gestalten? Welche Rolle spielen EU-Vorgaben und andere Regulatorien für Schweizer Firmen und wer ist die treibende Kraft hinter nachhaltigen Produkten – die Unternehmen, die Kunden oder die Gesetzgeber?Anhand von Praxisbeispielen und in Expertendiskussionen wird in diesem Themenstream aufgezeigt, wie
Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit wirkungsvoll kommunizieren und regulatorische Anforderungen erfolgreich bewältigen können.
KI & Energiemanagement
Künstliche Intelligenz bietet ganz neue Möglichkeiten, Nachhaltigkeit voranzutreiben. Allerdings steigt der Energieverbrauch durch datenintensive KI-Anwendungen erheblich. Wie lässt sich dieser Zielkonflikt auflösen? Wo liegt die richtige Balance zwischen Effizienzsteigerung und Ressourcenverbrauch? In diesem Themenstream werden Chancen, Herausforderungen und Lösungsansätze für eine nachhaltige Nutzung von KI im Energiemanagement beleuchtet und an Best-PracticeBeispielen illustriert.
Fortgesetzt wird das Programm am Nachmittag mit Vorträgen und Diskussionen im Plenum. Beteiligt sind insgesamt rund 40 namhafte Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland. Ein Vordenker auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit ist der Schweizer Mathis Wackernagel. Der Mitgründer und Präsident des Global Footprint Network hält eine Keynote zum Thema «Planetare Übernutzung: Wo ist die frohe Botschaft?». Im anschliessenden Fire-SideChat spricht der Aufsichtsratsvorsitzende des Siemens-Konzerns, Jim Hagemann Snabe, über «Rethinking Leadership: Führen in Zeiten der Verantwortung». Die Umweltwissenschaftlerin Sandrine Dixson-Declève zeigt in ihrer Keynote auf, warum Krisenbewältigung nicht bei kurzfristigen Massnahmen enden darf. Statt «Band-Aid-Politik» brauche es tiefgreifende Systemveränderungen, die soziale Gerechtigkeit, ökologi-
sche Belastungsgrenzen und wirtschaftliche Resilienz gemeinsam in den Blick nähmen, so die Vorstandsvorsitzende von Earth4All und Ehrenpräsidentin des Club of Rome. Im abschliessenden Vortrag erläutert der ehemalige Präsident von Costa Rica, José María Figueres., warum globale Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und geopolitische Spannungen nur durch internationale Kooperation lösbar sind. Ein weiterer Höhepunkt des SSF ist die erstmalige Verleihung der Auszeichnung «Sustainable Shapers». Sie rückt Persönlichkeiten ins Zentrum, die das Thema Nachhaltigkeit in und aus der Schweiz heraus entscheidend gestalten, prägen und voranbringen.
Nachhaltig handeln
Transformation im Fokus
Unter dem Motto «Driving Change. Creating Impact» wird auch das diesjährige SSF fundierte Denkanstösse vermitteln und konkrete Handlungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit aufzeigen. Die Konferenz findet am 2. September von 9 bis 17 Uhr in der neuen Festhalle der Bern Expo statt.
Für weitere Informationen zum SSF diesen QR-Code scannen.
verschiedenen Techniken zur CO2-Entnahme schaffen könnte. Edenhofer zufolge würde das nicht nur Innovationen fördern, sondern auch die Position der EU im weltweiten Wettlauf um die Marktführung bei grünen Technologien stärken. Edenhofer ist dabei nicht nur in wissenschaftlichen Beratungsgremien aktiv, er ist auch Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Professor an der TU Berlin. Man habe im klimapolitischen Diskurs bisher vor allem über Emissionsminderungen gesprochen, sagte er vor wenigen Wochen bei einer Rede an der Universität Luzern. Auch die notwendige Anpassung an die unvermeidbaren Auswirkungen steigender Temperaturen – dazu gehören häufiger auftretende Hitzewellen – sei Teil der Debatte. Aber «die dritte Säule der Klimapolitik, die aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt wird, das ist die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre», so Edenhofer.
Temperaturkurve zurückbiegen Es gibt einige Gründe dafür, warum die Forscher europäische Politiker nun verstärkt dazu drängen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Netto-Null-Emissionen bis 2050? Das sei kein realistisches Szenario mehr für die Welt, sagte Edenhofer in Luzern. Alles deute darauf hin, dass das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Cel-
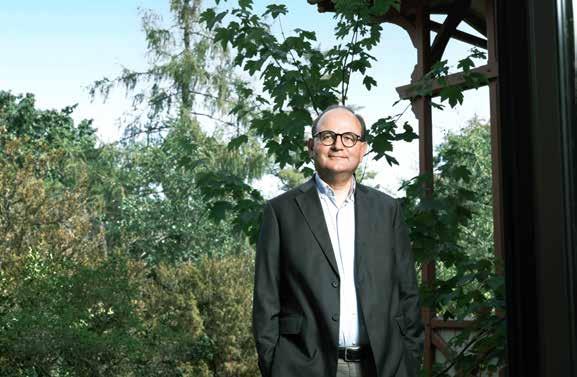
sius gegenüber der vorindustriellem Zeit zu bremsen, erst einmal nicht erreicht werde. Das Scheitern wäre für viele Ökosysteme und Lebewesen mit grossen Risiken verbunden, warnen Forscher seit Jahren. Mit Glück könne man die «Temperaturkurve wieder zurückbiegen», so Edenhofer. Konkret bedeutet das, den Temperaturanstieg wieder nachträglich zu reduzieren. Das würde aber wohl bis zum Ende des Jahrhunderts dauern und sei nur möglich, wenn der Atmosphäre mehr Kohlendioxid entzogen werde, als Fabriken, Autos oder Schiffe noch ausstossen. Für den Klimaforscher steht fest: «Ohne diese Option werden wir klimapolitisch scheitern». Für Europa steht viel auf dem Spiel. Die Politik hat sich allzu lange darauf verlassen, dass die Wälder und Böden grosse Mengen an Kohlenstoff aufnehmen. In Zukunft, so sehen es neue Klimagesetze vor, sollen Europas Bäume und Böden sogar noch grössere Mengen spei-
chern. Jetzt aber zeigen Daten der europäischen Umweltagentur EEA, dass Wälder seit einigen Jahren weniger Kohlenstoff aufnehmen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Waldbestand älter wird und mehr Bäume gerodet werden.
In tiefes Gestein gepresst Hinzu kommt das Problem, dass technische Methoden, um CO2 aus der Luft zu filtern und zu speichern, nur schleppend vorankommen. Die Technologien sind teuer, benötigen grosse Mengen an Energie und bringen weitere Risiken mit sich. Dazu gehört, dass sie teilweise viel Fläche benötigen, die für landwirtschaftliche Zwecke verwendet werden könnte. Zu dieser Gruppe gehören sogenannte DACCS-Technologien, die Kohlenstoff direkt aus der Luft filtern und speichern. Dabei wird das aus der Umwelt «eingefangene» Kohlendioxid erst verflüssigt und dann mit hohem Druck
in tiefe Gesteinsschichten gepresst – was in der Öffentlichkeit und bei Umweltorganisationen allerdings auf Widerstand stossen könnte. Ein anderes Verfahren beruht auf dem Einsatz von Bioenergieanlagen, die das beim Verbrennen von pflanzlichem Material frei werdende CO2 sofort abscheiden und speichern. Der Beitrag solcher Techniken ist jedoch noch sehr winzig. Mit keinem von ihnen lässt sich derzeit die gewaltige Menge an CO2 entnehmen, die nötig wäre, um das Klimaproblem ansatzweise in den Griff zu bekommen. Zudem stellt sich die Frage, wie lange die verschiedenen Techniken überhaupt CO2 speichern können. Für Edenhofer ist angesichts der vielen Unsicherheiten klar: «Entscheidend ist, es geht um ein breites Portfolio von Optionen, die auch regional sehr unterschiedlich verteilt sind». Europa müsse anfangen, ernsthaft in die Techniken zu investieren. «Die Kernfrage ist nur, wer soll das alles finanzieren?»
Best Practice Die Uhrenmarke Breitling sorgt mit einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie für Aufsehen – weit über die Luxusbranche hinaus. Aurelia Figueroa, Chief Sustainability Officer bei dem Schweizer Unternehmen, erläutert im Interview die wichtigsten Veränderungen.
Die traditionsreiche Schweizer Uhrenmarke Breitling zählt heute zu den nachhaltigsten Unternehmen der Luxusbranche. Kürzlich wurde es unter anderem von EcoVadis mit einer Platinmedaille ausgezeichnet – eine Auszeichnung, die nur den besten ein Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen für ihre umfassende Nachhaltigkeitsleistung vergeben wird.
Noch in diesem Jahr wird Breitling als erster grosser Uhrenhersteller vollständig auf Diamanten umsteigen, die im Labor erzeugt werden und nicht mehr aus Minen stammen. Begonnen hatte diese Umstellung bereits in den Jahren zuvor, als Breitling – neben vielen anderen Initiativen – 2022 ihre erste «rückverfolgbare» Uhr, die Super Chronomat Origins, lancierte. Breitling setzte auf die Beschaffung von Gold aus kleinen, handwerklich betriebenen Minen sowie auf rückverfolgbare, aus dem Labor gewonnene Diamanten.
An der Spitze vieler dieser Veränderungen steht Aurelia Figueroa, Chief Sustainability Officer bei Breitling. Die Amerikanerin hat sich zum Ziel gesetzt, den Nachhaltigkeitsgedanken noch stärker in der Luxusindustrie zu verankern, neue Standards einzuführen und so eine breitere Wertschöpfung zu ermöglichen.
Frau Figueroa, Breitling hat sich vorgenommen, in der Uhrenbranche neue Standards auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit zu setzen. Worum geht es Ihnen konkret?
Aurelia Figueroa: Wir setzen alles daran, um innerhalb unseres Einflussbereichs die soziale und ökologische Auswirkung unserer Geschäftstätigkeit zu optimieren. Unser Engagement stützt sich auf drei Säulen: Gesellschaft, Natur und Governance. Ein wichtiger Teil besteht darin, dass wir die Art und Weise, wie wir unser Gold und unsere Diamanten beziehen, in den vergangenen Jahren ganz neu aufgesetzt haben. Das Ergebnis sind Uhren mit dem Origins-Label von Breitling hergestellt mit «besserem Gold» und «besseren Diamanten».
Woher stammen diese besseren Rohstoffe? Das Gold für unsere Produkte beziehen wir nur noch von handwerklichem Bergbau und vom Kleinbergbau, die die strengen Kriterien der Swiss Better Gold Association (SBGA) erfüllen. Die SBGA etabliert rückverfolgbare Lieferketten zwischen den Ursprungsminen und dem Schweizer Markt und verlangt von ihren Mitgliedern die Einhaltung hoher sozialer und ökologischer Standards. Seit März 2025 kann Breitling die Hälfte des erworbenen Goldes bis zu den Herkunftsminen zurückverfolgen. Für jedes Gramm, das Breitling erwirbt, leistet das Unternehmen über den Better-Gold-Fund einen Beitrag –aktuell 1.35 US-Dollar pro Gramm – zur


direkten Unterstützung der Bevölkerung in den Gebieten, aus denen wir unsere Rohstoffe beziehen. Die Menschen dort profitieren, unter anderem, von unseren Investitionen in die Infrastruktur, in die Ausbildung, den Schutz der Artenvielfalt und in Massnahmen zur Sanierung eines stillgelegten Bergwerks.
Recyceltes Gold kommt für Sie nicht in Frage?
Das ist für uns keine Option, weil wir die Bedingungen, unter denen es gewonnen wurde, nicht kennen. Recyceltes Gold ist ein wichtiger Bestandteil der Goldbeschaffung insgesamt, aber es ist keine Grundlage, auf der man soziale und ökologische Auswirkungen nachweisen kann. Wenn wir hingegen beim frisch geförderten Gold ansetzen, können wir den Übergang zu einer nachhaltigeren Industrie aktiv unterstützen.
Der Begriff «Recycled Gold» ist insofern irreführend, da das Gold lediglich wiederverwendet wird. Die Wiederverwendung hat zwar einen positiven Umweltnutzen, aber es besteht zum Beispiel das Risiko, dass das als recycelt deklarierte Gold, dessen ursprüngliche Herkunft nicht nachweisbar ist, zur Finanzierung von Konflikten oder illegalen Praktiken beigetragen hat.
Und woher beziehen Sie die Diamanten für Ihre Luxusuhren?
Wir sind das erste Unternehmen in der Uhrenbranche, das vollständig auf Diamanten umsteigt, die im Labor erzeugt werden – aktuell von drei Produzenten in Indien: Fenix Diamonds, ABD Diamonds und ALTR Diamonds. Für den Luxussektor ist das eine echte Neuerung.
«Transparenz ist der Schlüssel zu unseren Nachhaltigkeitsbemühungen.»
Die im Labor hergestellten Edelsteine sind komplett identisch mit abgebauten Diamanten. Durch unsere Kenntnis des genauen Ursprungs können wir jedoch sichergehen, dass jegliche Verbindung mit Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung ausgeschlossen ist. Noch dazu leistet Breitling für jedes erworbene Karat einen Beitrag zu einem Sozialfonds, der in der Diamantenproduktion tätige Gemeinschaften unterstützt. Dieser Sozialfonds fördert Bildungsprogramme für Führungskräfte im indischen Bundesstaat Gujarat, die sich im Wesentlichen für die frühkindliche Bildung, die Stärkung der Rolle der Frau und den Umweltschutz einsetzen. Unsere Bemühungen erlauben uns, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung ihrer Arbeit auf lokaler Ebene zu leis-
ten – und gleichzeitig den Systemwandel in den Gemeinschaften voranzubringen, mit denen wir für die Beschaffung unserer Labordiamanten zusammenarbeiten.
Wie werden die Labordiamanten hergestellt?
Indem Diamantscheiben mit Gas und extremer Hitze behandelt werden, sodass der Kohlenstoff kristallisiert und Diamanten unter kontrollierten Bedingungen entstehen. Dieser kontrollierte Prozess gewährleistet ein Material von sehr hoher Qualität, das im Anschluss mit denselben traditionellen Methoden des Schneidens und Polierens verarbeitet wird, die auch für abgebaute Diamanten angewandt werden. Das kostet allerdings viel Energie. Der Energieverbrauch bei der Herstellung ist ein Faktor sowohl bei Labordiamanten als auch bei Diamanten, die aus Minen stammen. Aber mit unserer Lieferkette erreichen wir eine vollständige Rückverfolgbarkeit, die in der Uhrenindustrie, die kleine, sogenannte MeléeDiamanten verwendet, selten gegeben ist. Wir haben eine Lieferkette eingerichtet, bei der wir nicht nur die Rückverfolgbarkeit gewährleisten, sondern auch darauf achten, dass die Lieferanten bereits erneuerbare Energien nutzen oder zumindest klimaneutral sind und einen Plan für den Übergang zur Produktion mit erneuerbaren Energien haben. Ein Teil dieses Übergangs zu erneuerbaren Energien wurde von uns sogar mitfinanziert.
Wie stellen Sie fest, dass Ihre Lieferanten wirklich nachhaltig unterwegs sind?
Zur Verifizierung unserer Lieferketten arbeiten wir direkt mit unseren Lieferanten sowie mit bestimmten Zertifizierungsorganisationen zusammen. Wir überprüfen unabhängige Bewertungen, die unter anderem von EcoVadis durchgeführt werden. Stand heute sind mehr als 70 Prozent unserer direkten Lieferanten bewertet. Wir arbeiten auch mit Auditoren zusammen, die Zertifizierungsprozesse entwickelt haben, die auf bestimmte Lieferketten zugeschnitten sind. Zudem treffen wir auch unser eigenes Urteil vor Ort. Einmal im Jahr besuche ich zusammen mit Breitling-Kollegen Mitglieder der Goldlieferketten in Lateinamerika. Wir treffen dort auch die Bergleute persönlich an ihren Arbeitsplätzen. Um den breiteren Kontext zu verstehen, habe ich sogar illegale Bergbaubetriebe aufgesucht. Mit diesen Betrieben arbeiten wir nicht zusammen, aber diese Erfahrung und Einblicke haben mir viel Hintergrundwissen über die Branche vermittelt. Und sie haben uns darin bestärkt, dass wir uns für einen positiven Wandel im gesamten System einsetzen, der sich ebenso auf die Communitys vor Ort und die Natur auswirkt. Welche Klimaziele haben Sie sich für Breitling gesetzt? Wir verfolgen eine umfassende NettoNull-Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels. Der Fahrplan zur Reduktion des Kohlenstoffausstosses ist von der Science Based Target initiative (SBTi) validiert und auf den Corporate NetZero Standard ausgerichtet. Gemeinsam mit unseren globalen Stakeholdern haben wir einen klaren und zeitlich definierten Plan entwickelt, um bis 2032 und 2050 absolute Emissionsreduktionen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Wir gehören auch zu den ersten Anwendern weltweit, die einen Nachhaltigkeitsbericht basierend auf den Leitlinien der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) veröffentlicht haben. In unserem jährlichen Report, der auf breitling.com einsehbar ist, berichten wir im Detail über alle unsere Bemühungen. Interview: Elmar zur Bonsen
Nachhaltig handeln
Worauf Firmen achten sollten
Empfehlungen von Aurelia Figueroa für Unternehmen, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzen: Beziehen Sie von Anfang an eine repräsentative Gruppe von Interessensvertretern (Stakeholdern) aus Ihren globalen Communitys ein, um gemeinsam Ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln.
Legen Sie zu Beginn eine fundierte Ausgangsbasis fest, um Fortschritte im weiteren Verlauf messbar und nachvollziehbar zu machen.
Definieren Sie Ihre Schwerpunktthemen klar und fundiert im Rahmen einer hochwertigen Doppelten Wesentlichkeitsanalyse –idealerweise orientiert an den Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren wichtigsten Stakeholdern ein klares Verständnis der Werte, die Ihrer Arbeit zugrunde liegen und Ihren weiteren Weg leiten sollen.
Kommunizieren Sie Ihren aktuellen Stand sowie Ihre Massnahmen transparent, um Vertrauen zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen und Ihre Transparenz als Treiber für Fortschritt zu nutzen.
ROBERTO STEFANO
Stellen Sie sich vor, Sie kochen eine Lasagne. Schicht für Schicht fügen Sie die Zutaten hinzu: Hackfleisch, Käse, Pasta –ein Fest für den Gaumen. Doch schon bevor der erste Bissen genommen ist, hat dieses Gericht in der Lieferkette einen beachtlichen CO2-Fussabdruck hinterlassen. Was wäre aber, wenn Sie die Rezeptur ändern könnten – nicht geschmacklich, sondern klimatisch? Weniger Rindfleisch, dafür mehr Pilze –kaum ein Unterschied auf der Zunge, aber ein grosser bei den Emissionen. Ob Lasagne, Elektronik oder Maschinen: Der Blick auf die Lieferkette bietet den Unternehmen ein riesiges Einsparpotenzial. Schliesslich fallen hier bis zu 90 Prozent der Emissionen an. Eine detaillierte CO2-Analyse unter Einsatz von Daten und smarten Softwarelösungen hilft den Firmen, ihre Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Effizienzgewinne sowie Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern zu erzielen –ohne das Endprodukt zu verfälschen.
Vorteile im Wettbewerb
Dies gilt für sämtliche Firmen, stellt aber insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor die Herausforderung, ihre Einsparungen konkret zu beziffern. Mehr und mehr müssen die Betriebe heute Emissionsvorgaben erfüllen, wollen sie am Markt als Zulieferfirmen von anderen Unternehmen in Erscheinung treten. Gefragt sind dann –vielfach von den Grosskunden, die ihre eigene Supply-Chain optimieren wollen –entsprechende Dokumente und Belege, welche die Reduktionsbemühungen der Zulieferer festhalten. In vielen Fällen sind solche Unterlagen sogar eine Voraussetzung, um überhaupt für die Selektion als Lieferanten zugelassen zu werden. «Sind die Firmen Zulieferer für andere Hersteller, ist die Reduktion der Emissionen ein entscheidendes Argument, um weiterhin oder neu als Lieferant berücksichtigt zu werden», erklärt Res Witschi, Delegierter für nachhaltige Digitalisierung bei Swisscom. Gleichwohl konzentrieren sich viele Unternehmen nach wie vor hauptsächlich auf ihren eigenen Betrieb: Sollen Emissionen gesenkt werden, versuchen sie es über Anpassungen im eigenen Fahrzeugpark, über den Ausstieg aus fossilen Energiequellen oder über den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. «Ein Blick auf die sogenannten Scope-1- und Scope-2-Emissionen, sprich jenen Ausstoss, der direkt in einem Unternehmen anfällt oder die von einem Betrieb verwendete Energien betrifft, macht natürlich Sinn und sollte in einem ersten Schritt auch priorisiert werden», sagt Witschi. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Lieferkette kommt in der Folge aber oft zu kurz – obwohl die indirekten Emissionen im Normalfall ein viel höheres Reduktionspotenzial aufweisen. «Die eigenen Emissionen bilden einen guten Startpunkt. Wer aber die wirklich grossen Fortschritte erzielen will, muss sich mit der Liefer- und Wertschöpfungskette auseinandersetzen», ergänzt er.
Komplexe Überwachung
Klima Um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen, muss der CO2 -Ausstoss weltweit drastisch sinken. Besonders kleine und mittlere Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungsketten zu identifizieren und zu verringern. Daten und smarte Softwarelösungen sind der Schlüssel: Sie decken Einsparpotenziale auf.

werden, um die Auswirkungen auf den CO2-Ausstoss zu simulieren.
Dass die Steuerung der Wertschöpfungskette dennoch weniger Beachtung erfährt, liegt unter anderem an der Komplexität der Aufgabe. Ohne geeignete technologische Unterstützung ist es nicht nur für KMU ein schwieriges Unterfangen, an diesem Hebel anzusetzen und entsprechende Massnahmen zu verwirklichen. Mit weitreichenden Folgen: Viele Initiativen stützen sich unter diesen Umständen eher auf Intuition, als dass tatsächlich gemessene Werte eine solide Basis für Entscheidungen bilden. Die Berechnung der CO2-Intensität einer Produktion erfolgt dann anhand der getätigten Ausgaben in Franken (sogenanntes Spend-based-Prinzip), ohne dass genauer eruiert wurde, wo die Hebel für die Dekarbonisierung der Rohmaterialien genau liegen. Eine solche Berechnungsmethode ist entsprechend ungenau und fehleranfällig. Dabei wären belastbare Zahlen umso nötiger. «Es ist wichtig, dass sich KMU, insbesondere als Zulieferfirmen von Grossunternehmen, auf verlässliche Angaben stützen können», ergänzt Witschi. Ein softwarebasiertes Datenmanagement gewinnt dadurch mehr und mehr an Bedeutung. Schliesslich lassen sich damit auch die indirekten, sogenannten Scope-3-Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette eines
«Es ist wichtig, dass sich KMU auf verlässliche Angaben stützen können.»
Res Witschi, Swisscom
Unternehmens erfassen, bewerten und steuern. Bei dieser Aufgabe kann heute künstliche Intelligenz bereits zusätzliche Unterstützung bieten. Sie hilft unter anderem bei der Bewirtschaftung der Daten oder bei der Erstellung von Rapporten. Besonders für KMU eröffnen sich dadurch interessante Möglichkeiten.
Digitaler Zwilling
Ein konkretes Beispiel aus der Lebensmittelindustrie liefert ein englischer Hersteller, der jährlich eine Million Lasagne für einen grossen Retailkunden produziert. Durch den Einsatz eines digitalen Lasagne-Zwillings, der mithilfe von Product-Life-Management (PLM)-Daten erstellt wurde, gelang es dem Unternehmen, den CO2-Fussabdruck der Speise nachhaltig zu verbessern – ohne auf die Bolognese zu verzichten. Der digi-

tale Zwilling ermöglichte es den Produktentwicklern auf eine einfache Art und Weise, Veränderungen an den Zutaten vorzunehmen und deren Auswirkungen auf den CO2-Ausstoss zu simulieren. Mit Blick auf die Lasagne konnte man beispielsweise untersuchen, welche CO2-Einsparungen der Ersatz von etwas Hackfleisch durch Pilze bewirken würde. Eine Geschmacksveränderung wäre aufgrund der geringen Menge kaum zu spüren. Bei einer entsprechend grossen Produktionsmenge liesse sich der CO2-Ausstoss aber merklich reduzieren. Wie bei der Lasagne können auch andere Produkte und sogar komplette Systeme anhand eines digitalen Zwillings optimiert werden – und zwar vom Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette. Dasselbe gilt für die Lieferanten: Auch sie sind eingeladen, am digitalen Zwilling zu arbeiten, um die Her-

stellung des Produkts emissionsärmer zu gestalten. «Diese differenzierte Analyse der einzelnen Produkte hilft nicht nur, die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern kann auch weitere Effizienzpotenziale offenbaren», erklärt Michele Savino, Business Development DataDriven Sustainability bei Swisscom. Zusätzlich zum digitalen Zwilling kann künstliche Intelligenz noch eine weitere Hilfestellungen bieten – beispielsweise wenn es darum geht, die Daten besser zu strukturieren (zum Beispiel Daten automatisch der richtigen Materialklasse respektive dem Emissionsfaktor zuzuordnen). «Die für die Nachhaltigkeit relevanten Daten einer Nebenkostenabrechnung müssen dank künstlicher Intelligenz nicht mehr manuell erfasst werden, sondern werden automatisch verarbeitet», nennt Savino ein Beispiel. «Einen besonders grossen Nutzen bietet KI bei der Erstellung der Reports und beim Formulieren von Antworten, die immer häufiger von Zulieferunternehmen verlangt werden», ergänzt er.
Einsparpotenziale nutzen
Ob mit oder ohne KI – eine umfassende und detaillierte Analyse der Lieferketten mithilfe einer geeigneten Software lohnt sich für Unternehmen aus mehreren Gründen: Neben einer gezielten CO2-Reduktion lassen sich Einspar- und Effizienzsteigerungspotenziale erkennen, sodass – selbst wenn an manchen Orten etwas teurere Lösungen eingesetzt werden – die Gesamtrechnung günstiger ausfallen dürfte. So profitieren am Ende alle von einer optimalen Zusammensetzung der «Lasagne»: Die Unternehmen als Zulieferer und Produzenten, deren Abnehmer – und vor allem das Klima, dank der sinkenden CO2-Emissionen.
Sustainable Switzerland Die Partner der Schweizer Nachhaltigkeitsplattform erläutern, welche Handlungsfelder für sie aktuell im Vordergrund stehen.
Environment, Social, Governance (ESG) – diese drei Begriffe stehen für die grossen Ziele und Herausforderungen unserer Zeit: den Schutz der Umwelt und des Klimas, die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Gewährleistung einer soliden, nachhaltigen Unternehmensführung. Um diese Ziele zu erreichen, darüber besteht weitgehend Einigkeit, ist eine grundlegende Transformation unserer Wirtschaft erforderlich. Dieser Prozess hat längst schon begonnen, wenn auch nicht überall gleich schnell und gleich dynamisch. ESG-Themen wie CO2-Reduktion, nachhaltige Lieferketten und faire Arbeitsbedingungen gewinnen im Zuge dieser Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen zu mehr
Transparenz und messbaren Nachhaltigkeitszielen verpflichten. Dazu zählen gesetzliche Vorgaben wie die EU-Taxonomie und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), aber auch verschiedene weitere Gesetze und Richtlinien auf nationaler und internationaler Ebene. Trotz des damit verbundenen Aufwands können Unternehmen daraus wertvolle Vorteile im Wettbewerb ziehen –unter anderem Kosteneinsparungen oder eine höhere Energie- und Ressourceneffizienz. Wir haben nachgefragt: Welche Nachhaltigkeitsthemen sind für Unternehmen und Organisationen derzeit besonders relevant – in der Schweiz und darüber hinaus? Die Partner der Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland geben Auskunft – aus ihrer jeweils eigenen Sicht. Hier ihre Statements:
Umweltthemen wie Klima, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität sind trotz geopolitischer Lage nach wie vor von höchster Aktualität. Gleichzeitig haben Datentransparenz und nachhaltige Lieferketten an Bedeutung gewonnen. In dieser sich ständig weiterentwickelnden Welt rückt durch die rasante Digitalisierung auch die soziale Dimension zunehmend in den Fokus. Als ICT-Unternehmen wollen wir Menschen befähigen, sich in der digitalen Welt kompetent und sicher zu bewegen. Ein zentrales

Thema ist die digitale Inklusion: Wir fördern gezielt die Medienkompetenz der Schweizer Bevölkerung und setzen uns gegen digitale Ausgrenzung ein. Mit Bildungsangeboten, Ratgebern, technischen Hilfen und unserer Plattform Swisscom Campus unterstützen wir jährlich rund 2 Millionen Menschen. Zudem spielt aus ESG-Sicht Transparenz innerhalb der Lieferkette eine zunehmend grössere Rolle. Auch im Umweltbereich verfolgen wir ambitionierte Ziele: Bis 2035 wollen wir Netto-Null erreichen und unsere Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung ihrer Klimaziele unterstützen – etwa mit energieeffizienter IT, smarten Netzen, kreislauffähigen Produkten, und digitalen Lösungen für mehr CO2-Einsparung. Mit datengetriebener Nachhaltigkeit und modernen Tools vereinfachen wir das Nachhaltigkeitsmanagement. Unsere Carbon-Management-Software ermöglicht faktenbasierte Entscheidungen und legt die Grundlage für wirksame Reduktionsmassnahmen – im Einklang mit dem SBTi-Standard.
Nachhaltigkeit erfordert Zusammenarbeit – auch mit externen Partnern –, da nur so schneller, effizienter und mit höherem Impact Lösungen angeboten werden können, die Kundenbedürfnisse erfüllen. Wir sehen das als Chance, mit Nachhaltigkeit neue Businessmodelle voranzutreiben. Deshalb setzen wir auf Transparenz, Dialog und Wirkung.
Saskia Günther, Head of Sustainability, Swisscom
Nachhaltig handeln
Ambitionen und Ziele unserer Partner
Zusammen packen wir’s: Die Partner der Plattform Sustainable Switzerland verfolgen in ihren Unternehmen und Organisationen ambitionierte Ziele auf ganz unterschiedlichen Feldern der Nachhaltigkeit. Sie wollen die nachhaltige Entwicklung der Schweiz beschleunigen –und gehen mit gutem Beispiel voran. Was sie in den nächsten Jahren in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Governance (ESG) erreichen möchten, haben sie für uns auf den Punkt gebracht.
Für weitere Informationen diesen QR-Code scannen.

Die EPFL ist überzeugt, dass Spitzenforschung notwendig ist, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen, denen die Menschheit gegenübersteht. Ob es darum geht, physikalische Phänomene besser zu verstehen, kohlenstoffarme Energieformen zu entwickeln oder neue Formen des friedlichen Zusammenlebens zu konzipieren: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer Hochschule setzen sich unermüdlich für eine bessere Zukunft der Gesellschaft ein. Um ihre Überzeugungen in konkrete Massnahmen umzusetzen, hat die EPFL Solutions 4 Sustainability finanziert: eine Initiative, die 26 Labore mit 7 Projekten zusammenbringt. Diese Projekte zielen darauf ab, Demonstratoren auf unserem Campus zu entwickeln, um unsere Energieabhängigkeit und unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Parallel dazu ist die EPFL bestrebt, ihre Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig die hohe Qualität ihrer Forschung aufrechtzuerhalten. Wir entwickeln insbesondere einen CO2-Rechner, mit dem sich die Treibhausgasemissionen auf Laborebene schätzen und letztlich reduzieren lassen. Die Hochschule stellt daher die Entwicklung mittel- und langfristiger nachhaltiger Lösungen in den Mittelpunkt ihrer Strategie und hat sich verpflichtet, bei ihrer eigenen Tätigkeit die Grundsätze der Inklusion, der Chancengleichheit sowie der sozialen und ökologischen Verantwortung zu beachten. Bereits in den ersten Semestern vermitteln wir unseren Studierenden ein gemeinsames und systemisches Verständnis für Nachhaltigkeitsfragen in einem Kurs über die Grundlagen der Nachhaltigkeit für alle Studienanfänger im Bachelorstudium. Wir haben uns ausserdem verpflichtet, einen speziellen Kurs mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in jeden Bachelor- und Masterstudiengang der EPFL aufzunehmen. Agnès Le Tiec, Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit, EPFL


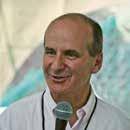

Sandrine Dixson-Declève Earth4All & Ehrenpräsidentin Club of Rome Jim Hagemann Snabe Vorsitzender des Aufsichtsrats,
José María Figueres Ehemaliger Präsident von Costa
ETH Zürich
Klimaneutrale Geschäftsmodelle, Kreislaufwirtschaft und soziale Verantwortung – für die ETH Zürich sind dies keine Schlagworte, sondern konkrete Handlungsfelder, die auf verschiedenen Ebenen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der ETH-Ge-

schäftsbericht 2024 zeigt: Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Forschung, Lehre und Betrieb. Die ETH Zürich wird im Rahmen der internationalen Universitätsrankings zunehmend entlang der ESG-Kriterien bewertet. Aussagekraft und Vergleichbarkeit sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Universitäten weltweit sowie der raschen Veränderungen der Methodik zwar beschränkt. Nichtsdestotrotz werden die Resultate solcher Einschätzungen einer kritischen Prüfung unterzogen. Davon lernt die ETH Zürich.
Kürzlich wurde die Schaffung eines Nachhaltigkeitsrats an der ETH Zürich beschlossen. Und die soziale Verantwortung wird mit Programmen zu Chancengleichheit, Inklusion und psychischer Gesundheit seit Langem bewusst gestärkt. Die Verankerung von ESG-Kriterien in der Institution sowie datenbasierte Geschäftsberichte schaffen Transparenz und fördern stete Verbesserung. Unser Ziel: Generationen miteinander verbinden und gemeinsam lernen, um die Herausforderungen unserer Zeit nicht nur zu verstehen, sondern auch mit Lösungen zu meistern.
Dr. Claudia Zingerli, Head ETH Office of Sustainability, ETH Zürich
Wir befinden uns inmitten einer Rekalibrierungsphase: Die jüngsten Anpassungen in der EU durch das Omnibus-Paket mit dem Ziel, die EU-Vorschriften zur nachhaltigen Berichterstattung zu vereinfachen, werden die Nachhaltigkeitsregulierungen und die Offenlegungspflichten für viele Unternehmen beeinflussen. Davon betroffen sind auch Schweizer Unternehmen als Kunden und Zulieferer ihrer ausländischen Geschäftspartner. Das Omnibus-Paket entlastet zwar KMU in der EU, doch der regulatorische Druck auf Grossunternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bleibt bestehen. Viele Grossunternehmen in der EU dürften gesetzliche Vorgaben wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nach wie vor an Schweizer Vorleister weitergeben. Zudem bleiben CO2-Steuern und das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) von den jüngsten

Anpassungen weitgehend unberührt und damit für Schweizer Abnehmer von betroffenen Branchen wie die Energieversorgung weiterhin relevant.
Auch die Schweiz verfolgt ihre Nachhaltigkeitsziele konsequent weiter: Bis 2050 will sie ihr NettoNull-Ziel erreichen. Unternehmen, die sich frühzeitig auf die Anforderungen vorbereiten, sichern sich langfristig einen Wettbewerbsvorteil. Als UBS unterstützen wir unsere Kunden mit unserem Knowhow und unserem Partnernetzwerk, welches wir kontinuierlich weiterentwickeln, damit sie diese Übergangsphase erfolgreich meistern können. Dazu können unsere KMU-Kunden von einfachen und kosteneffizienten Partnerlösungen, wie beispielsweise dem Self-Service-Analyse- und Reporting-Tool «esg 2 go», profitieren. Damit erhalten kleine und mittlere Unternehmen entlang den ESG-Kriterien einen detaillierten Einblick in ihre Nachhaltigkeit und einen Bericht, den sie gegenüber Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden kommunizieren können. Dies hilft ihnen, ihre Stärken und Verbesserungspotenziale besser zu verstehen und einzuordnen.
Auch für grössere Unternehmen ist die Nachhaltigkeitsanalyse relevant – vor allem bei der Auswahl und Überprüfung von Lieferketten, Produktionspartnern und Logistikunternehmen. Das Rating bereitet Unternehmen frühzeitig auf potenzielle regulatorische Vorgaben und Einschränkungen im In- und Ausland vor. Für eine gezielte Erfassung und Optimierung von Energieund CO2-Daten bietet UBS zudem gemeinsam mit den Partnern ACT und EnAW praxistaugliche Lösungen an.
Brigitte Krapf, Relationship Manager Multinationals, Institutional & Multinational Banking, UBS
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir übernehmen Verantwortung, indem wir höchste Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Dies umfasst detaillierte Sorgfaltspflichten sowie die Verpflichtung unserer Partner zu erweiterten Umwelt- und Sozialstandards, zur Achtung der Menschenrechte und zur Nutzung

Google hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 weltweit und rund um die Uhr (24/7) mit kohlenstofffreier Energie (CFE) zu arbeiten. Dies stellt die bisher ehrgeizigste Phase unserer Energiebestrebungen dar, aufbauend auf Erfolgen wie der 100 Prozent jährlichen Deckung des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien (seit 2017).
Während die jährliche Deckung bedeutet, dass stundenweise immer noch auf Kohlenstoffquellen zurückgegriffen werden muss, zielt 24/7 CFE darauf ab, jede Stunde des Verbrauchs an jedem Stand-

ort und in jedem Netz durch regionale CFE-Quellen zu decken. Dadurch sollen die mit der Stromnutzung verbundenen Kohlenstoffemissionen vollständig eliminiert werden. Die Umsetzung ist herausfordernd, unter anderem wegen der Variabilität erneuerbarer Energien, begrenzter regionaler Ressourcen, unzureichender Politik und Märkte sowie der Kosten für Zukunftstechnologien.
Googles Roadmap zur Erreichung dieses Ziels konzentriert sich auf:
Entwicklung neuer Beschaffungsmodelle
Förderung technologischer Innovationen (inklusive Speicher, Lastmanagement)
Aktives Eintreten für förderliche öffentliche Politik
Das Ziel ist nicht nur die eigene Dekarbonisierung, sondern die Beschleunigung der Energiewende für alle. Dies erfordert die enge Zusammenarbeit mit Regierungen, Industrie und Versorgungsunternehmen. Langfristig soll jede:r Zugang zu bezahlbarer, sauberer Energie erhalten.
Dennis Tietz, Strategic Partnerships Manager & Sustainability Lead, Google Schweiz
Genossenschaftliche Verankerung heisst für die Mobiliar: Wir übernehmen Verantwortung. Gegenüber Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden –und der Gesellschaft insgesamt. Wir setzen uns für Prävention und Resilienz ein, zum Beispiel mit dem Schutz vor Naturgefahren.
Seit 20 Jahren engagieren wir uns intensiv für den Hochwasserschutz und haben in dieser Zeit rund 170 Projekte in der ganzen Schweiz mit insgesamt 46 Millionen Franken unterstützt. Wo Gefahren nicht mit baulichen Massnahmen eingedämmt werden können, kommen mobile Hochwasserschutzsysteme zum Einsatz. 23 Feuerwehrstützpunkte haben wir mit solchen Systemen ausgerüstet. Die Massnahmen wirken: Jeder in die Hochwasserprävention investierte Franken vermeidet schon heute bis zu sechs Franken an Schäden. Angesichts steigender Niederschläge und zunehmender Hochwassergefahren ist dieses Engagement wichtiger denn je.

von Managementsystemen, die den Schutz von Arbeitern und Umwelt gewährleisten. Überall wo die BMW Group aktiv ist, pflegen wir eine Unternehmenskultur, die von Verantwortung, Vertrauen, Transparenz, Offenheit und Wertschätzung geprägt ist – auch in der Schweiz. Als BMW Group Switzerland sind wir seit 50 Jahren in der Schweiz zu Hause und leben diese Werte täglich. Heute beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende, die sich gemeinsam für einen positiven Einfluss auf die lokale Gesellschaft einsetzen, beispielsweise im Rahmen unserer BMW und MINI Social Days. Um eine nachhaltige Zukunft zu sichern, erkennen wir die Dringlichkeit, die Umwelt zu schützen, und streben an, den CO2-Ausstoss über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren. Bis 2050 möchte die BMW Group klimaneutral sein. Dafür setzen wir auf technologische Innovationen und betrachten die Elektromobilität als zentralen Treiber. Auch Zirkularität spielt eine bedeutende Rolle in der Dekarbonisierung unserer Lieferkette. Wir priorisieren die Verwendung von Sekundärmaterialien in zukünftigen Fahrzeugen und streben an, gemeinsam mit Partnern eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren.
Melanie Reinwald, Direktorin Marketing BMW, BMW (Schweiz) AG
Mit unserem Schwammstadt-Engagement gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir fördern die Resilienz von dicht besiedelten Orten: Flächen werden entsiegelt. So kann Wasser vor Ort gespeichert und von Pflanzen genutzt werden oder verdunsten. Das führt zu weniger Oberflächenabfluss, weniger Hitze, weniger Schäden und mehr Lebensqualität. Ein aktuelles Beispiel ist die Bluefactory in Fribourg – ein Projekt für die künftige Stadtentwicklung mit einem Fokus auf dezentrales Wassermanagement. Ein neues Quartier entsteht, das Parkanlage, Kulturleben, Unternehmen und Forschungsinstitute integriert und Menschen, die dort leben und arbeiten, verbindet.
Walther Weger, Leiterin Public Affairs & Nachhaltigkeit, die Mobiliar
Wir beobachten aktuell einen grundlegenden Wandel des globalen wirtschaftlichen Rahmens für die ESG-Transformation. Unsere Arbeit mit Führungskräften zeigt, dass Unternehmen nicht nur ESG-Anforderungen erfüllen, sondern sich auch mit geopolitischer Unsicherheit sowie technologischen und gesellschaftlichen Umbrüchen auseinandersetzen müssen.
Drei Entwicklungen gewinnen dabei besonders an Bedeutung:

Die Kosten der Untätigkeit beim Klimaschutz steigen rapide. Viele Unternehmen unterschätzen die finanziellen Risiken durch Extremwetter, CO2-Bepreisung und regulatorische Anpassungen –und damit verbunden drohende EBITDA-Verluste. Unternehmen, die heute in Dekarbonisierung und Resilienz investieren, handeln nicht nur vorausschauend, sondern sichern sich konkrete Wettbewerbsvorteile.
Der technologische Wandel – insbesondere durch generative KI – verändert nicht nur Wertschöpfungsketten, sondern auch ESG-Potenziale. Das Potenzial von GenAI ist sicherlich immens. Entscheidend ist ein klarer strategischer Fokus, die Priorisierung relevanter Vorhaben und eine aktive Rolle des Topmanagements.
ESG wird zunehmend zur Führungsaufgabe. In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung sind CEOs gefordert, als verbindende Kraft zu wirken, klare Werte vorzuleben und Raum für respektvollen Austausch zu schaffen. Verantwortung ist dort gefragt, wo eigene Werte, Mitarbeitende oder Geschäftspraktiken betroffen sind.
«Grosspapi, wer passt eigentlich auf die Berge auf?»
Damit wir für unsere Kinder eine Antwort haben, setzen wir uns für den Schutz der Schweizer Berggebiete ein.
Taten statt Worte Nr. 234: Mit Pro Montagna unterstützen wir die Schweizer Berggebiete.
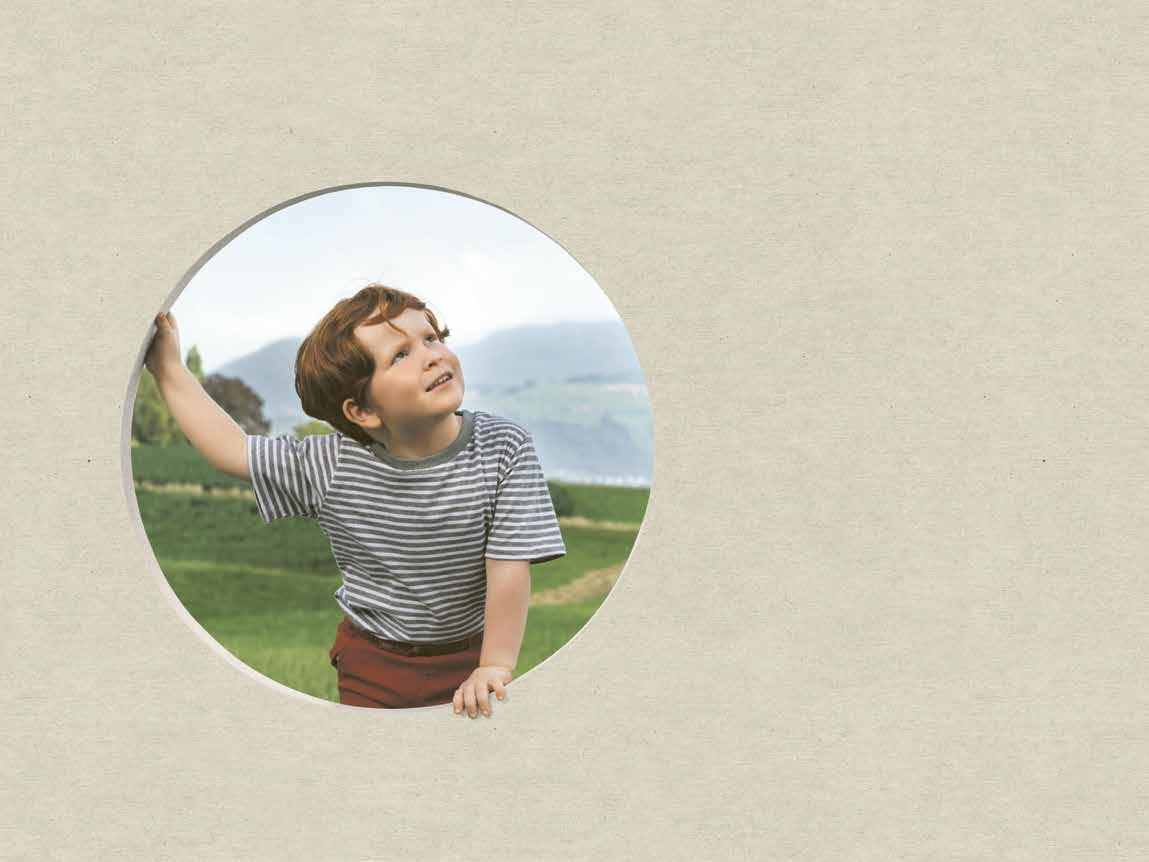
taten-statt-worte.ch
Noch bis 30. Juni nominieren!
Die Auszeichnung für herausragende Persönlichkeiten der nachhaltigen Entwicklung
Sustainable Switzerland ist die Plattform für Nachhaltigkeit in der Schweiz – eine Initiative des Unternehmens NZZ mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft.
Kreative Ideen und mutige Gründerpersönlichkeiten: So viel Potenzial steckt in der Schweiz.



Sie tüfteln an neuen Mobilitätslösungen, retten Lebensmittel oder schaffen digitale Tools für grünes Investieren –junge Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, die mehr wollen als Profit. Was treibt sie an? Und wie entstehen aus Ideen nachhaltige Geschäftsmodelle mit echtem Impact? In unserer neuen Serie «Sustainable Startups» gehen wir diesen Fragen nach, stellen mutige Gründerpersönlichkeiten vor und zeigen, wie viel Innovationskraft in der
Schweizer Startup-Szene steckt. 2024 sind hierzulande mehr als 53 000 neue Firmen gegründet worden – ein Rekordjahr. Und dieser Trend setzt sich fort: Laut dem Institut für Jungunternehmen (IFJ) sind im ersten Quartal dieses Jahres 13 983 Neugründungen registriert worden, was einer Zunahme von 3,9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Die Schweiz bleibt damit ein attraktiver Nährboden für Startups. Viele von ihnen nehmen die gros-
sen Herausforderungen unserer Zeit ins Visier: Klimakrise, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit und Umweltzerstörung. In unserer Serie, die wir mit dieser Beilage starten und mit regelmässigen Beiträgen auf der Online-Plattform sustainableswitzerland.ch fortsetzen, zeigen wir, wie junge Unternehmen mit kreativen Ideen und praktischen Lösungen einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten – und was ihnen dabei im Weg steht.
Das Bündner Startup Novaziun elektrifiziert Maschinen für Landwirtschaft und Gemeindebetriebe – dort, wo Elektromobilität bisher kaum angekommen ist.
Mit Elektromobilität verbindet man meist Autos in urbanen Gebieten. In alpinen Regionen, wo Maschinen auf steilen Hängen oder in abgelegenen Weilern im Einsatz stehen, ist der Umstieg auf elektrische Antriebe bislang selten. Genau hier setzt das 2021 gegründete Startup Novaziun AG an. Das Unternehmen mit Sitz in Vella GR und einer Zweigniederlassung in Zürich entwickelt modulare elektrische Antriebslösungen für Maschinen im kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz. Im Zentrum steht die ePowerUnit –ein nachrüstbarer Elektroantrieb, der Benzinmotoren im Leistungsbereich von 5 bis 15 Kilowatt ersetzt. Ältere Geräte müssen damit nicht ausrangiert werden, sondern können umgerüstet werden. Dadurch verlängert sich auch die Lebensdauer der bestehenden Maschinen. Ein zweites Produkt ist der Monotrac: ein vollelektrischer Einachstraktor mit rund 20 Kilowatt Leistung, speziell für steile, unwegsame Hänge konzipiert. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu neun Stunden eignet sich der Traktor für einen ganzen Arbeitstag im Gelände. Er kann auch als mobile Stromquelle – etwa auf dem Feld – genutzt werden.
diertes Wissen aus Maschinenbau, Produktentwicklung und Elektromobilität mit. Für ihre Entwicklung wurde Novaziun 2024 mit dem Innovationspreis Startfeld Diamant ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere die enge Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben und die praxisnahe Umsetzung nachhaltiger Technologien. novaziun.com
Hinter Novaziun stehen die vier Gründer Daniel Vincenz, Gian Caduff, Nico Bernold und Marco SangklinSchneider. Gemeinsam bringen sie fun-
Unbemannte, nachhaltige Fluggeräte wie die «Aero2» des Startups Dufour Aerospace haben grosses Potenzial in den Bereichen Transport, Vermessung und Monitoring.
Im Hangar 9 am Flugplatz Dübendorf ZH steht eine weiss glänzende Riesen-Drohne, die ganz so aussieht wie eine Kreuzung aus Propellerflugzeug und Helikopter. Genau das ist auch die Idee: Während des Starts wuchten die vier Propeller die «Aero2» vertikal in die Luft. Ist die Flughöhe erreicht, wird die Tragfläche nach vorn gekippt, und die Propeller bewegen das Fluggerät im Reiseflug vorwärts. Die Drohne ist imstande, in ihrem Bauch eine Last von bis zu 40 Kilogramm über mehrere Hundert Kilometer zu befördern. Sie eignet sich beispielsweise für den Eiltransport von dringenden Medizingütern und Ersatzteilen. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Überwachung und Datenerfassung
aus der Luft. Die sogenannte Tilt-wingDrohne ist eine Entwicklung der Dufour Aerospace AG, die 2017 unter anderem von dem Air-Zermatt-Helikopterpiloten Thomas Pfammatter gegründet wurde. Nach Abschluss einer Vorserie soll 2026 die Serienproduktion beginnen. Die Drohne folgt auf die «Aero1», ein elektrisch angetriebenes Kunstflugzeug. Die Aero2 verfügt über einen Hybridantrieb: Bei Start und Landung werden die Propeller elektrisch angetrieben, im Reiseflug mit Kerosin. Bei einem Verbrauch von lediglich vier Kilogramm Treibstoff auf 100 Kilometer kommt die Drohne mit einem 12-Kilogramm-Tank aus. Erreicht wird eine Reisegeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern. Die Drohnentechnologie ist skalierbar: Gestützt auf die Erfahrungen mit der Aero2, plant Dufour Aerospace bereits eine grössere Version mit sechs Propellern und einer Nutzlast von 750 Kilogramm. Bisher wurden drei Aero2-Drohnen als Prototypen produziert, in diesem Jahr folgen einige weitere. Diese Fluggeräte haben eine etwas tiefere Nutzlast und dürfen noch nicht über Städte fliegen. Sie sind aber einsatzbereit und wurden auch schon von ersten Kunden in Schweden und den USA bestellt. Die bisherige Entwicklungsarbeit wurde durch Privatinvestoren finanziert. Die Innovationsagentur Innosuisse förderte das Startup 2023 überdies mit mehr als 2,5 Millionen Franken. dufour.aero
Food2050, eine innovative Lösung für die Gastronomie, zeigt die Klimawirkung von Menüs in Grad Celsius Erderwärmung an und bewertet zudem die Ausgewogenheit der Speisen.
Die Ressourcen des Planeten schonen und gleichzeitig die Gesundheit fördern: Darum geht es beim Schweizer Startup Food2050. Das Team um die drei Firmengründer Christian Kramer, Adrian Hagenbach und Leopold Weinberg hat ein ganzheitliches Menüleitsystem für Gastronomiebetriebe entwickelt, das sowohl die Umweltauswirkungen als auch die ernährungsphysiologische Ausgewogenheit von Gerichten analysiert. So zeigt es den Gästen von Speiselokalen, Personalrestaurants oder Mensen den Einfluss der eigenen Ernährung auf das Klima – und inspiriert sie bei ihrer Menüwahl.
Als Basis der Softwarelösung dient das sogenannte Climate Impact Model (CIM): Es übersetzt die wissenschaftlich berechneten Umweltemissionen der Gerichte von CO2-Äquivalenten in x Grad Celsius Klimawirkung. Die
Gradangaben können dann in Speisekarten oder auf digitalen Screens ausgewiesen werden. Nur als Beispiel eine «Happy Bowl» mit Poulet, Hummus und Pinsa-Streifen. Neben den Zutaten des Gerichts wird auf dem Screen der Wert 1,9 Grad Celsius angezeigt. Das dazugehörende Tellersymbol ist gelb umkreist, was gemäss dem Farbcode von Food2050 «mittlere Klimaauswirkung» bedeutet. Anders gesagt: Würden alle Menschen auf dem Planeten sich von der «Happy Bowl» ernähren, stiege die globale Temperatur langfristig um 1,9 Grad Celsius – also mehr als die im Pariser Klimabkommen angepeilten 1,5 Grad zur Begrenzung der Erderwärmung. Zusätzlich zur Auswirkung der Menüwahl auf Klima und Umwelt sehen die Restaurant- oder Mensagäste dank der Food2050-Lösung auch, wie gesund und ausgewogen sie sich mit dem jeweiligen Gericht ernähren. Anhand des «optimalen Tellers» der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) werden die einzelnen Speisen nach Nährwertkategorien bewertet. Digitale FoodProfile liefern zudem weitere Angaben zu Allergenen oder Zutaten. Über einen Live-Ticker kann auch angezeigt werden, welche Gesamtwirkung alle in einem Restaurant aktuell konsumierten Speisen auf die Klimaerwärmung haben. Das Menüleitsystem ist Anfang 2022 zunächst in einer von ZFV-Unternehmungen betriebenen Campus-Mensa der Universität Zürich eingeführt worden. Inzwischen wird Food2050 bereits in fast 200 Gastronomiebetrieben in der Schweiz eingesetzt. food2050.ch

Nahrungsmittel von morgen: Eine Wissenschaftlerin kontrolliert das Wachstum nachhaltig angebauter Pflanzen in einem Hydrokultur-Gewächshaus.
STEPHAN LEHMANN-MALDONADO
Seit seiner Wiederwahl sorgt US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen. In den ersten 100 Tagen seit Amtsantritt hat er mehr Dekrete unterzeichnet als alle seine Vorgänger in den letzten 50 Jahren. Viele davon betreffen die Umwelt- und Sozialpolitik – so auch der von Trump verfügte Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Dies signalisiert, dass Washington fossile Brennstoffe wieder stärker fördern will.
Wenn das Weisse Haus eine solche Kehrtwende vollzieht, sollten sich Anlegerinnen und Anleger nicht vorschnell verunsichern lassen, sagen die Finanzexpertinnen und Finanzexperten von UBS. In turbulenten Zeiten sei es generell ratsam, einen kühlen Kopf zu bewahren und in Ruhe zu prüfen, ob die eigene Anlagestrategie angesichts der makroökonomischen Fundamentaldaten noch passend ist.
Fakt ist, dass bisher kein anderer bedeutender Staat dem Beispiel der USA gefolgt ist und sich aus dem Pariser Abkommen verabschiedet hat. Zwar mag eine zweite Amtszeit Trumps die Förderung einiger ESG-Strategien (Environment, Social, Governance), wie etwa solche für Diversität und Inklusion, bremsen und die Dekarbonisierung der Wirtschaft verlangsamen. «Aber der langfristige Trend zur Nachhaltigkeit und zu erneuerbaren Energien scheint unumkehrbar zu sein», resümiert die Analyse «How is President Trump affecting sustainability» von UBS. Denn der Kampf gegen den Klimawandel wird zunehmend von der Privatwirtschaft getragen. Gemäss UBS stammen 54 Prozent der globalen Finanzierung aus privatem Kapital – und übertreffen damit die öffentlichen Investitionen.
TRIOs beflügeln die Märkte Unabhängig davon, welche Politiker in welchem Land an der Regierung sind, sieht das Chief Investment Office (CIO) von UBS drei Megatrends, welche die Aktienmärkte im kommenden Jahrzehnt antreiben dürften: künstliche Intelligenz (KI), Energie und Ressourcen sowie Langlebigkeit (Longevity). Die Rede ist von TRIO – ein Akronym für «Transformational Innovation Opportunities». Das Besondere daran ist, dass die Chancen in diesen globalen Phänomenen letztlich Nachhaltigkeit voraussetzen.
Wirtschaft Seit die USA eine Kehrtwende in der Klimapolitik vollzogen haben, stellt sich zunehmend die Frage: Haben nachhaltige Anlagen noch Zukunft? Laut dem Chief Investment Office von UBS sprechen drei Megatrends dafür, weiterhin in nachhaltige Strategien zu investieren.
Wachstumsstory KI
UBS geht davon aus, dass die KI-Wachstumsstory erst in ihren Anfängen steht – und sich noch viele interessante Anlagemöglichkeiten eröffnen dürften. Dabei ist KI ein zweischneidiges Schwert: Einerseits verschlingen die enormen Datenmengen und Prozesse immer mehr Energie. Damit sich die Rechenzentren nicht überhitzen, müssen sie gekühlt
Nachhaltig handeln
werden – wofür es viel Wasser braucht, das sich mancherorts weiter verknappen könnte. Andererseits verbessert KI die Effizienz von Lieferketten und Energiemanagementsystemen und ermöglicht smarte Lösungen für die Abfall-, Wasser- und Landwirtschaft. Zudem hat sie das Potenzial, das Gesundheitswesen zu revolutionieren. Zum Beispiel kann KI bestimmte Krankheiten wie Krebs schon im Frühstadium erkennen.
Wie investiert man verantwortungsvoll in einer Welt im Wandel? Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS, gibt in seinem Buch «The New Rules of Investing: Essential Wealth Strategies for Turbulent Times» Antworten. Zusammen mit dem Wirtschaftsjournalisten Richard C. Morais präsentiert er Leitlinien für Strategien, die über blosse Zahlen hinausgehen und sich an konkreten Praxisbeispielen orientieren. So rät Haefele dazu, sich an staatlichen Investitionen zu orientieren und auf nachhaltige Anlagen zu setzen. Er identifiziert fünf grosse Investmenttrends unseres Jahrhunderts, die er die «fünf D» nennt: Digitalisierung, Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Verschuldung («Debt») und Demo-
grafie. Haefele empfiehlt, mit dem Ersparten Töpfe für drei Strategien zu bilden: Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe («Liquidity», «Longevity», «Legacy»).
Dieser Ansatz ist auch als «UBS Wealth Way» bekannt. Im Kern geht es darum, a) jederzeit über genügend liquide Mittel für seinen Lebensstil zu verfügen, b) Vermögenswerte für seine langfristigen Lebensziele anzulegen sowie c) die Zukunft der Vermögenswerte – etwa für die nächsten Generationen oder philanthropisch für die Gesellschaft – zu planen.
Für weitere Informationen diesen QR-Code scannen.
Für Anlegerinnen und Anleger bietet sich ein weites Feld an Chancen: Sie können beispielsweise auf Unternehmen setzen, die nachhaltige KI-Anwendungen entwickeln – oder auf solche, die daran arbeiten, die Umweltauswirkungen von KI zu reduzieren. Schliesslich ist klar, dass erhebliche Investitionen in Energieeffizienz und Infrastruktur erforderlich sind. «Da die Digitalisierung zu einem Grundbedürfnis geworden ist, besteht nicht die Gefahr, dass ihr Ausbau politischen Auseinandersetzungen zum Opfer fällt», erklärt UBS.
Erneuerbare im Aufwind
Der zweite Megatrend «Energie und Ressourcen» ist eng mit den Themen KI, Rechenzentren und E-Mobilität verbunden. Denn diese Sektoren verlangen nach immer mehr Strom. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit einer Verdoppelung des weltweiten Energieverbrauchs von Rechenzentren zwischen 2022 und 2026. Derweil geht das Electric Power Research Institute – eine kalifornische Non-ProfitOrganisation, die Forschung zur elektrischen Energieversorgung betreibt – davon aus, dass bis 2030 bis zu 9 Prozent des Stromverbrauchs auf Rechenzentren in den USA entfallen werden. Dabei dürfte der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung laut UBS CIO weiter zunehmen. Der Grund: Solar- und Windkraft eignen sich am besten, um den rasch wachsenden Energiehunger zu stillen. Die Anlagen lassen sich zum einen kurzfristig planen und bauen, zum anderen sinken die Kosten
für erneuerbare Energien. Langfristig könnten nach Ansicht der Experten auch Zukunftstechnologien wie Wasserstoff und Kernenergie in Form kleiner modularer Reaktoren – sie sind möglicherweise erst ab 2030 realisierbar –eine wichtige Rolle spielen. Ein solcher Um- und Ausbau der Stromversorgung verlangt zwar einen langen Atem. Er eröffnet aber langfristig auch Opportunitäten für Anlegerinnen und Anleger, die auf zukunftsträchtige Technologien setzen – von Batteriespeicherlösungen bis zur Ladeinfrastruktur für Elektroautos.
Grundlagen für langes Leben
Ebenso schafft der Trend «Langlebigkeit» respektive der demografische Wandel ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten – und dies in unterschiedlichen Branchen. Eines ist klar: Wer lange leben will, braucht eine gesunde Ernährung, sauberes Wasser, sicheren Wohnraum und eine moderne Gesundheitsversorgung. Das erfordert unter anderem Investitionen in eine regenerative Landwirtschaft, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, innovative Wassersysteme und altersgerechte Wohnformen bis hin zur Telemedizin, mit der man bestimmte Krankheiten von zu Hause aus behandeln kann. Gefragt sind Technologien und Dienstleistungen, die präventiv wirken und bezahlbar sind.
Risiken und Chancen
Nachhaltigkeit ist keine politische Modeerscheinung. Sie ist eine ökonomische Logik, die weltweit immer mehr Konsumenten, Unternehmen und Investoren teilen. Unternehmen, die ihre Emissionen sukzessive reduzieren, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen und transparent über ihre Risiken informieren, dürften bei den Aktionärinnen und Aktionären weiter punkten. «Wer auch ESG-Kriterien berücksichtigt, erhält ein umfassenderes Bild der Risiken und Chancen eines Unternehmens», betont UBS-Chief Investment Officer Mark Haefele – zusammen mit dem Wirtschaftsjournalisten Richard Morais – in seinem neuen Buch «The New Rules of Investing». Die Aktien von Unternehmen, die verantwortungsbewusst wirtschaften, dürften daher geringere Kursschwankungen aufweisen und sich stabiler durch Konjunkturzyklen bewegen.
Wirtschaft Im Energiesektor kündigen sich fundamentale Veränderungen an. Laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) werden mit wachsendem Anteil der Erneuerbaren am Energiemix die Strompreise häufig bei nahe null liegen und zugleich grösseren Schwankungen unterworfen sein.
Auf den Energiemärkten wird voraussichtlich nichts mehr so sein, wie es einmal war. Da sind sich die Experten von BCG sicher. Auf dem Weg zu einer Netto-Null-Zukunft werde sich die Funktionsweise der Stromwirtschaft fundamental wandeln, heisst es in ihrer Studie «Five Forces Transforming Power Markets». Und mehr noch: «Die Veränderungen – von denen viele bereits im Gange sind – werden mit dem wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Stromerzeugungsmix noch ausgeprägter werden.»
Folgt man den Angaben der Internationalen Energieagentur und ihrer Roadmap «Net Zero by 2050», werden Photovoltaik und Windkraft bis Mitte des Jahrhunderts bereits 72 Prozent der Stromerzeugung ausmachen, verglichen mit 11 Prozent im Jahr 2020. Dies dürfte enorme Auswirkungen auf sämtliche Marktakteure haben – auch was die Gestaltung der Energiepreise angeht. «Um sich angemessen auf das globale Energiesystem von morgen vorzubereiten, müssen die Akteure verstehen, wie sich die Dynamik des Strommarkts heute entwickelt», betonen die Autoren der Studie. Sie haben zu diesem Zweck im BCG-eigenen Center for Energy Impact verschiedene Modelle und Szenarien entwickelt.
Zwei zentrale politische Initiativen bilden die Grundlage ihrer Annahmen: die Verpflichtung der Europäischen Union, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent (gegenüber 2021) zu senken, und ihr Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Obwohl der Schwerpunkt der BCG-Analyse hauptsächlich auf Nordwesteuropa liegt, sei davon auszugehen, dass «einige dieser Entwicklungen auch in den meisten anderen liberalisierten Märkten weltweit zutreffen werden», heisst es. Konkret haben die Expertinnen und Experten fünf treibende Kräfte identifiziert, die die Strommärkte im Zuge der Energiewende – und darüber hinaus – prägen werden:
Trend zu Fixkosten
Angetrieben durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird sich die Stromerzeugung zunehmend weg von variablen hin zu fixen Kosten bewegen. Laut Studie könnten bis zu 85 oder 90 Prozent der gesamten Erzeugungskosten künftig fix sein, verglichen mit aktuell etwa 65 bis 70 Prozent. Der Grund: Windkraft- und Solaranlagen verursachen im Unterschied zu Kohle- oder Gaskraftwerken im Betrieb keine Kosten, von Wartungsarbeiten abgesehen. Wind und Sonne gibt es gratis, fossile Energieträger nicht.
Kostenloser Strom
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Strom künftig oft kostenlos sein wird. Perioden, in denen die Strompreise «relativ niedrig oder sogar nahe null sind», dürften nach Voraussage der BCG-Experten deutlich häufiger auftreten. «20 bis 25 Prozent der Zeit im Jahr
werden die Preise unter 20 Euro pro Megawattstunde liegen, verglichen mit 5 bis 10 Prozent heute.»
Ausnahmen bei hoher Nachfrage
Das gilt allerdings nicht für jene Perioden, in denen Energie am meisten gebraucht wird. Obwohl Solar- und Windkraftanlagen zunehmend die Strompreise bestimmen, wird die thermische Stromerzeugung weiterhin eine zentrale Rolle spielen – und in kritischen Zeiten die Preise nach oben ziehen. Denn die Einnahmen in den wenigen Stunden, in denen diese Kraftwerke laufen, reichen oft nicht aus, um deren Fixkosten zu decken.
Höhere Preise im Winter
Deutlich grösser dürften die Preisunterschiede zwischen Sommer- und Wintermonaten werden. Im Jahr 2050, wenn die EU-Staaten klimaneutral sein wollen und entsprechend viel Erneuerbare im Netz sein sollen, könnten die Strompreise im Winter bei naturgemäss niedriger Erzeugung von Solarstrom laut der Studie um 40 bis 100 Prozent höher liegen als im Jahresdurchschnitt.
Stärkere Preisschwankungen
Die verstärkte Nutzung von Solar- und Windenergie wird den Experten zufolge zu einer grösseren Preisvolatilität führen. Dieser sogenannte Volatility Vortex («Volatilitätswirbel») könnte sich innerhalb eines Tages bis 2030 im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Jahr 2019 möglicherweise verdoppeln. Die Erklärung für die Schwankungen ist einfach: Ein immer grösserer Anteil an erneuerbaren Energien im Stromerzeugungsmix führt zu längeren Zeiträumen, in denen man sich auf Sonnen- und Windenergie verlassen kann. Die Strompreise werden in diesen Zeiten stark sinken. Ebenso wird es aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen aber immer noch Zeiten mit sehr geringer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien geben. Einspringen müssen dann etwa Gaskraftwerke, die laut Studie «in mehreren nordwesteuropäischen Märkten um 2040 bis 2050 immer noch zu 10 bis 25 Prozent der Zeit den Preis bestimmen, selbst wenn sie nur einen geringen Anteil am Erzeugungsmix haben».
Der Volatilitätswirbel wird das Aktionsumfeld für Energieunternehmen, einschliesslich der Produzenten, Versorger und Händler, grundlegend verändern. Herkömmliche Geschäftsmodelle reichen dann angesichts der Marktdynamik nicht mehr aus. Der Studie zufolge müssen die Unternehmen ihre Fähigkeiten, Systeme und auch die Rahmenbedingungen für ihr Risikomanagement neu bewerten, um wettbewerbsfähig und resilient zu bleiben. Antti Belt, Managing Director und Partner bei BCG in Helsinki, bringt es so auf den Punkt: «Die Intraday-Energiemärkte verlangen mehr als nur schnelle Reaktionen – sie erfordern Echtzeitdaten, intelligente Algorithmen und eine präzise Ausführung. Der Erfolg des Handels hängt jetzt davon ab, dass man Volatilität in Marge umwandelt und nicht nur das Risiko verwaltet.»

Der Energiesektor entwickelt sich dynamisch und stellt Unternehmen vor grosse Herausforderungen.
«Energiebeschaffung grundlegend überdenken»
Ivan Bascle, Managing Director und Senior Partner bei BCG, und Pierre Laugeri, Partner und Director bei BCG, zeigen auf, wie sich Unternehmen erfolgreich positionieren können.
Wie sollten Unternehmen mit dem Wandel auf den Strommärkten umgehen? Was empfehlen Sie ihnen?
Ivan Bascle: Industrieunternehmen sollten ihre Energiebeschaffung grundlegend überdenken, etwa durch den Einsatz flexibler oder dynamischer Stromabnahmeverträge, sogenannter Power Purchase Agreements (PPAs), und die Ausrichtung ihres Verbrauchs auf Zeiten mit kostengünstigem erneuerbarem Strom. Investitionen in Energieflexibilität – dazu zählen Speicherlösungen und intelligente Energiemanagementsysteme – können helfen, die Volatilität des Strompreises in einen strategischen Vorteil zu verwandeln. Angesichts zunehmender saisonaler Preisschwankungen gilt es, Betriebsabläufe gezielt anzupassen, um von günstigen Phasen zu profitieren und sich gleichzeitig gegen hohe Winterpreise abzusichern. Zudem kann eine aktive Beteiligung an Diskussionen zur Marktgestaltung und in Branchenallianzen dazu beitragen, den fairen Zugang zu den Energiemärkten von morgen mitzugestalten.
Was sind die grössten Herausforderungen in den kommenden Jahren?
Bascle: Eine der grössten Herausforderungen für Industrieunternehmen wird sein, den Übergang zu überwiegend fixkostenbasierten, erneuerbaren Energiesystemen erfolgreich zu gestalten. Sie müssen sich auf häufige Phasen tiefer Strompreise einstellen, die insbesondere im Winter durch abrupte Preisspitzen unterbrochen werden – verbunden
mit wachsender Komplexität in der Prognose und Beschaffung.
Pierre Laugeri: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, gezielt in Energieflexibilität, digitale Technologien und robuste Beschaffungsstrategien zu investieren, die auf einen volatileren und stärker saisonal geprägten Strommarkt ausgerichtet sind. Ebenso zentral ist die Fähigkeit zu einer schnellen und wirkungsvollen Transformation – durch die Anpassung von Betriebsmodellen, Denkweisen und Kompetenzen an eine fundamental veränderte Energiewelt.
Gibt es Industrieunternehmen, die für die Transformation der Strommärkte bereits besser aufgestellt sind als andere? Laugeri: Ja, führende Industrieunternehmen – besonders in Nord- und Westeuropa – sichern sich bereits heute den direkten Zugang zu erneuerbarer Energie über Corporate PPAs und investieren in eigene Solar- oder Windkraftanlagen sowie in Batteriespeicher. Zudem setzen einige Unternehmen auf erweiterte Energiemanagementsysteme, mit denen der Betrieb dynamisch an Preissignale des Strommarkts angepasst und die Volatilität als Vorteil genutzt werden kann. Mit diesen proaktiven Strategien profitieren sie von Phasen tiefer Strompreise, senken ihren CO2-Fussabdruck und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit in zunehmend dekarbonisierten Märkten. Die erhöhte Gefahr von Störungen, wie sie in Spanien im April dieses Jahres auftraten, ist möglicherweise noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt worden. Sie lassen Raum für weitere Verbesserungen.


Best Practice Mit einem intelligenten Mobilitätsmonitoring unterstützt das E-Health-Unternehmen Qumea das Gesundheitspersonal bei der Arbeit.
JOHANNES STETTLER
Die Gefahr ist leider nie auszuschliessen: Patientinnen und Patienten, die sich in Gesundheitseinrichtungen aufhalten, können stürzen oder andere Zwischenfälle erleiden, die ihre Gesundheit und Genesung beeinträchtigen. Die persönliche Betreuung durch Pflegefachperso-
nen ist unersetzlich – gerade deshalb gewinnen unterstützende Technologien zur Entlastung und Ergänzung zunehmend an Bedeutung. Das Solothurner Unternehmen Qumea hat sich dieser Herausforderung angenommen und ein innovatives Monitoringsystem speziell für Spitäler, Pflegeheime, Psychiatrien und andere Gesundheitsinstitutionen ent-

wickelt. Die Technologie ermöglicht ein kontinuierliches Monitoring der Patientinnen und Patienten dank modernen Radarsensoren und fortschrittlichen Algorithmen, die kritische Situationen oder ungewöhnliches Verhalten erkennen können.
Wenn die App Alarm gibt «Das System ist so konzipiert, dass es das Personal alarmiert, bevor es zu einem Zwischenfall kommt. Wenn zum Beispiel ein Sturzgefährdeter versucht, aus dem Bett aufzustehen, wird sofort ein Alarm an das Pflegepersonal gesendet, damit dieses schnell eingreifen und einen möglichen Sturz verhindern kann», erklärt Cyrill Gyger, CEO und Co-Founder von Qumea. Das System wahrt dabei die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten: «Ein an der Decke angebrachter Radarsensor detektiert Bewegungen im gesamten Zimmer. Wenn Hilfe benötigt wird, wird das Pflegepersonal über eine App alarmiert. Das System garantiert dabei vollständige Anonymität, da keine Kameras eingesetzt werden», so Gyger weiter. Bereits sechs Jahre nach der Firmengründung
Dasnachhaltigste Gebäude isteines,das 100 und mehr Jahrebestehenbleibt.
EinGebäude miteiner langenLebensdauer minimiertKosten und Emissionenpro Nutzungsjahr.Das leuchtet ein. Neubautenkönnenheute so geplantwerden, dass sieauchin100 Jahrennochrelevantbleiben –funktional, sozial undgestalterisch Doch wasbraucht es,damit einGebäude dauerhaftnachhaltig wird?
wird die von Qumea konzipierte Lösung heute von mehr als 120 Gesundheitseinrichtungen in der Schweiz und in mehreren anderen europäischen Ländern eingesetzt. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit der Eröffnung von Niederlassungen in Schweden und Deutschland ins Ausland expandiert.
Unterstützung von Innosuisse Nach Angaben von Anna Windisch, Business Development bei Qumea, beruht das schnelle Wachstum auf mehreren Faktoren: «Erstens haben wir unsere Technologie mithilfe des Pflegepersonals entwickelt, damit sie dessen Bedürfnissen entspricht. Zweitens unterstützt die Technologie das Personal im Gesundheitswesen in einer Zeit des weltweiten Personalmangels. Sie fördert die Effizienz und reduziert den Arbeitsaufwand.» Auch die Unterstützung von Innosuisse habe einen Unterschied gemacht: «Sie war von der Gründung des Unternehmens bis zum Ausbau entscheidend. Der Zugang zu wertvollen Empfehlungen von Branchen- und Geschäftsexperten hat uns geholfen, Abläufe zu optimieren und neue Märkte zu erschliessen», so Windisch. «Darüber hinaus haben wir von einem starken Netzwerk von Partnern und finanzieller Unterstützung profitiert, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.»
Neue Perspektiven In Solothurn ist man weit davon entfernt, sich mit dem bisher Erreichten zufriedenzugeben – im Gegenteil: «Wir testen laufend neue Funktionen, um unsere Lösung weiterzuentwickeln», sagt Jonas Reber, Chief Technology Officer (CTO) von Qumea. Derzeit werde erforscht, wie Pflegefachpersonen noch gezielter unterstützt werden könnten, etwa bei der Erkennung und Interpre-
tation von Vitalparametern. Auch strategisch blickt man in Solothurn nach vorn. «Wir suchen aktiv neue Partnerschaften mit Gesundheitseinrichtungen und Forschungsstätten, um die Anwendungsmöglichkeiten unserer Technologie zu validieren und auszubauen», sagt CEO Cyrill Gyger. «So leisten wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Gesundheitswesen.»
Nachhaltig handeln
Innosuisse, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung, unterstützt KMU, Startups, Forschungsinstitutionen und andere Schweizer Organisationen bei ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Sie erleichtert die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer, um vielversprechende neue Produkte oder Dienstleistungen zu konzipieren. Durch ihre Förderungsmassnahmen trägt Innosuisse zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene bei. Der «Innosuisse Guide» führt online in wenigen Schritten zu den passenden Förderangeboten: innosuisse.guide

Diesen QR-Code scannen und Videotestimonial ansehen.

DerErweiterungsbau des KunsthausesZürichwurde mitüber90% Recyclingbeton errichtet. ©Kunsthaus Zürich
NachhaltigeArchitektur erschöpftsichabernicht in technischenund formalen Kriterien. EinGebäude brauchteinestarkeIdentität. Andernfalls fehlt dieemotionale Bindung und dieGefahrwächst, dass es nach wenigenJahrzehnten wieder verschwindet. Gerade dersoziale Aspekt derNachhaltigkeit wird heuteoft vernachlässigt: DieAkzeptanz einesOrtes hängtauchdavon ab,oberdie Menschen ansprichtund ihnenetwas zurückgibt Architektur,die alldiesenAnforderungen
–funktional, gestalterisch, sozial undmateriell– gerechtwird, entsteht seltenzufällig. Umso wichtigersindPlattformen,die solche Leistungen sichtbar machen und fördern. DerBetonpreis von Betonsuisse isteinesolchePlattform:Seit1977 zeichnet er alle vier Jahreherausragende Bauten des Hoch-und Ingenieurbausaus,die sich durcheine besonderssinnvolle,innovative und nachhaltigeAnwendung desBaustoffsBeton auszeichnen. Im Vordergrund stehen dabeider respektvolle Umgang mit demOrt,einedurchdachte Tragkonstruktionsowie Nachhaltigkeitineinem umfassendenSinn. Ausgezeichnet werden Beispiele, diezeigen, wieBetonimbestenFallnicht nur Material,sondernauch Träger vonHaltung, Kontextund Dauerseinkann.
Ausgezeichnete Architekturist von Dauer Damitein Gebäudeoderein Infrastrukturbauwerk lange Bestandhat,braucht es grundsätzlichein darauf ausgerichtetes architektonischesKonzept. Das klingt banal.ImIdealfall soll einHaus, eine Siedlung odereineBrückenicht nur überGenerationenhinweg funktionieren,sondern auch nach vielen Jahren noch alsgelungenund stimmigempfundenwerden. Auch dasist keineneueErkenntnis. Es brauchtaberein gewisses Mass an Feusacré. Es brauchtBauherrschaften, Architektur- und Ingenieurbüros,die mit Weitblickund Sorgfalt planen und realisieren– auch wenn es sich nur um einkleines Wartehäuschenhandelt Weitblick und Sorgfalt bedeuten mehr alsreine Funktionalitätoderformale Ästhetik.Aspekte wieEinbettung in denbaulichenund sozialen Kontext, Energieeffizienz, Sicherheit undNachhaltigkeit sind integrale Bestandteile einerverantwortungsvollenArchitektur Bauenfür dieZukunft –mit langlebigenBaustoffen Werheute fürdie Zukunftbaut, kommtanBeton nicht vorbei. Kein andererBaustoff vereintDauerhaftigkeit, Tragfähigkeitund Kreislauffähigkeitsoüberzeugend JederBaustoff hatseine spezifischenEigenschaften, und oftmacht erst diedurchdachte Kombinationden Unterschied. Werfür dieZukunftbaut, brauchtBaustoffe, dierobust, wandelbar, langlebigund recycelbar Wo Nachhaltigkeit dasZielist,mussauchder Baustoff diesen Anspruch erfüllen.Beton nimmtdabeieineSchlüsselrolle ein– nichtnur wegenseinerDauerhaftigkeit,sondern auch wegenseiner regionalen Verfügbarkeitund Kreislauffähigkeit
Baustoffe rezyklieren, Kreislaufwirtschaft ankurbeln Beider Planung vonNeubauten sollte immerauch berücksichtigt werden,wie dieverwendetenMaterialien im Falleeines Rückbaus wiederverwendetwerdenkönnen.Wer natürliche Ressourcenund knappe Landreserven schonen will, erkennt denWerteiner funktionierendenKreislaufwirtschaft.Die SchweizerZement- undBetonindustrie setztdiesesPrinzip seit Jahrzehnten um:Als Beton- und Mischgranulate fliessendie wertvollenRohstoffe wieder in denBaustoffkreislauf zurück –und tragen so zurAbfallvermeidung und zurSchonungvon Primärressourcenbei Ressourcen schonen– Recyclingbeton bewährt undzukunftsfähig Recyclingbetonist längst fester Bestandteilvieler Bauprojekte. InsbesondereimHochbau –obNeubauoderSanierung –kannBeton mit rezyklierten Gesteinskörnungen heutefastüberall ohne Einschränkungeneingesetztwerden. Optisch unterscheidet sich Betonmit rezyklierten Gesteinskörnungen in derFarbe noch in derOberfläche kaum vonBeton mit primären Gesteinskörnungen. Zudem schreitetdie CO₂-Speicherung, beider Betongranulatgezieltmit CO₂angereichertwird, weiter voran Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sind also nicht nurtechnische Kriterien,sie spiegeln dieHaltung allerBeteiligten wider, dieein Bauwerkmit
Weitblickplanenund realisieren. Denn werbaut, greiftindie Zukunftein und gestaltet, wasbleibt.

DieOberfläche vonRC-Betonist gleichmässigund frei vonoptischenVerfärbungen. ©Kunsthaus Zürich
beton2030.ch
Wirtschaft Regionale Produktion mit kurzen Wegen: Lidl Schweiz wird immer helvetischer. Unter dem Label «Qualité Suisse» bietet der Detailhändler immer mehr Produkte aus der Schweiz an – vom Rauchmöckli über Biomilch bis hin zu Äpfeln vom Bodensee.
CORNELIA GLEES
Bleiben wir doch gleich bei den Apfelbäumen am Bodensee, die gerade erst herrlich geblüht haben. So auch in Dozwil bei Romanshorn, wo sich Jürg Stadler, Geschäftsführer der bofru AG (bofru steht für Bodensee-Frucht), und sein Team das ganz Jahr über um das beliebte Kernobst kümmern. Sein Betrieb ist «SwissGap»- und «Suisse Garantie»zertifiziert sowie dem Culinarium angeschlossen, ein Gütesiegel für Regionalität.
Auf 40 Hektaren der bofru AG reifen die Äpfel, mit denen Jürg Stadler Lidl Schweiz beliefert. Hier werden die Früchte geerntet, im Wasserbad gereinigt und etikettiert, dann in Kisten verpackt, um sie schliesslich auf den Weg in das Warenverteilzentrum zu schicken –nach Weinfelden, nur wenige Kilometer entfernt. Dort erfolgt eine strenge Qualitätskontrolle. Und bereits am nächsten Tag gelangen die Äpfel in die Lidl-Filialen in der ganzen Schweiz. Die Wege vom Baum zum Verbraucher sind also transparent, kurz und reduzieren so Emissionen. Qualität ist dabei alles – und die kommt nicht von ungefähr. Denn Lidl Schweiz sucht sich gezielt geeignete Zulieferer im Land. Mit Jürg Stadler und seinem Unternehmen zum Beispiel verbindet das Unternehmen bereits seit 2013 eine vertrauensvolle und bewährte Partnerschaft, so wie mit weiteren mehr als 300 Produzenten aus der Schweiz. Allein 60 dieser Kooperationen bestehen bereits seit Markteintritt des Lebensmittelhändlers im Jahr 2009. «Langjährige und ehrliche Partnerschaften sind uns bei Lidl Schweiz sehr wichtig», betont Einkäufer Stefan Hobi, der speziell für Früchte und Gemüse zuständig ist. Und ergänzt: «Bereits heute beliefern uns mehr als 50 Schweizer Lieferanten mit ‹Qualité Suisse›-Produkten. Mit vielen von ihnen arbeiten wir schon seit Markteintritt zusammen.» Auch die Molkerei Forster AG aus Herisau im Appenzellerland gehört zum hiesigen Lidl-Lieferantennetzwerk. «Unsere Partnerschaft ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und dem gemeinsamen Ziel: Qualität zu fairen Preisen», erklärt Molkereiinhaber Markus Forster. Um das «Bekenntnis zur Schweiz» noch weiter zu stärken, ist man bei Lidl den nächsten Schritt gegangen und hat eine neue Marke eingeführt: «Qualité Suisse». Sie steht für Qualität, regionale Herkunft und erschwingliche Preise. Alle so gekennzeichneten Produkte halten die Kriterien des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) ein: Mindestens 80 Prozent der Rohstoffe stammen aus der Schweiz, bei Milch und Milchprodukten müssen es sogar 100 Prozent sein. Und – ganz wichtig: Der wesentliche Verarbeitungsschritt des Lebensmittels muss ebenfalls in der Schweiz erfolgen. Lidl Schweiz will mit bezahlbaren Preisen dafür sorgen, dass sich dieses Stück Heimat jede und jeder auch leisten kann. Laut Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, soll «Qualité Suisse» im Alltag «überall präsent sein, wo Menschen in der Schweiz zusammenkommen».
Einprägsames Design
Das Label ist jedenfalls nicht zu übersehen: Es zeigt ein Schweizerkreuz in einem grossen roten Herzen und unterstreicht so die Verbindung zur einheimischen Produktion und zu den Werten Vertrauen, Verbundenheit, Qualität und Heimat. Mit anderen Worten: Swissness pur. Die Marke, die jetzt auf jedem einzelnen Produkt mit heimischer Herkunft zu sehen ist, ersetzt die bisherigen Eigenmarken wie Milbona, Fromani, Maestade und Bonvalle. Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl Schweiz, und verantwortlich für den Gesamtauftritt der Marke, erläutert das Design: «Mit Qualité Suisse wird der Einkauf noch einfacher, weil die Schweizer Qualitätsprodukte durch

«Langjährige Partnerschaften sind uns sehr wichtig.»
Stefan Hobi, Einkäufer bei Lidl Schweiz
ein einheitliches Verpackungsdesign sofort ersichtlich sind.» Auch das Erscheinungsbild der Filialen hat sich mit Marktplatz-Feeling am Früchte- und Gemüsestand, Expresskassen und der Kunden-App Lidl Plus dem hohen Standard des Landes angepasst. Ein Update à la Suisse gewissermassen.
CEO Nicholas Pennanen hat grosse Ambitionen, eingebettet in die konsequente Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Doch dazu später mehr. «Mit Qualité Suisse setzen wir uns hohe Ziele. Qualité Suisse wird nicht nur die grösste Marke bei Lidl Schweiz, sondern soll auch zur beliebtesten Marke der Schweiz für authentische Schweizer Qualitätsprodukte werden.»
Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass Lidl Schweiz offenbar auf dem richtigen Weg ist: Das Sortiment umfasst derzeit rund 2500 Artikel, es wurde von Anfang an fortlaufend mit hochwertigen einheimischen Produkten ergänzt. Zu diesen 2500 Artikeln gehören aktuell mehr als 700 Frischeprodukte, von denen wiederum zwei Drittel aus der Schweiz stammen. Der bofru-Apfel vom Bodensee zählt übrigens auch dazu.
Regionale Wertschöpfung
Seit Anfang Mai dieses Jahres bietet Lidl Schweiz nun den Kundinnen und Kunden zunächst rund 200 Produkte unter der neuen Marke an, darunter 30 komplett neue, die gleich seit dem Start erhältlich sind. Bis Ende 2025 soll der Anteil auf 500 Produkte anwachsen. Das Qualité-Suisse-Sortiment wird also weiter ausgebaut und damit die Wertschöpfung immer regionaler. Heute schon erzielt Lidl Schweiz mehr als 50 Prozent seines Umsatzes mit Produkten aus Schweizer Herkunft.
Das ist nicht nur für das Unternehmen von Vorteil. Die regionale Wertschöpfungskette des stark wachsenden Unternehmens Lidl Schweiz schafft umgekehrt Arbeitsplätze, stärkt die Bau-

branche hierzulande und – was viele nicht wissen – eröffnet Schweizer Produzenten dank internationaler Vernetzung neue Absatzmärkte im Ausland. In Zahlen ausgedrückt, heisst das: Lidl Schweiz beschäftigt heute rund 5000 Mitarbeitende in 187 Filialen. Jährlich eröffnet das Unternehmen 10 bis 15 neue Filialen. Von dieser Expansion profitiert das lokale Bau- und Immobiliengewerbe, denn rund 95 Prozent der Bauinvestitionen fliessen an Schweizer Dienstleister. Seit Markteintritt waren das mehr als zwei Milliarden Franken. Zu den Profiteuren gehören aber auch Markus Forster und seine Molkerei im Appenzellerland. Denn in der Partnerschaft mit Lidl Schweiz ist er ebenfalls stark gewachsen, was 2021 in den Neubau des Produktionsstandorts in Herisau mündete. Und das internationale Einkaufsnetz bringt den Schweizer Produzenten signifikante Vorteile: Immerhin sind von den mehr als 3000 Tonnen Schweizer Käse, die jährlich in den europäischen Export gehen, rund 5 Prozent allein Lidl Schweiz zu verdanken.
Nachhaltiges Engagement
Zu guter Letzt sind eine regionale Wertschöpfung mit kurzen Transportwegen und Arbeitsplätze mit fairer Entlöhnung und guten Rahmenbedingungen wie etwa vier Wochen zu 100 Prozent bezahltem Vaterschaftsurlaub und 18 Wochen zu 100 Prozent bezahltem Mutterschaftsurlaub wichtige Elemente einer nachhaltigen Unternehmensführung. Und damit kommen wir zum Engagement von Lidl Schweiz in puncto Nachhaltigkeit. Lidl Schweiz hat in seiner Nachhaltigkeitsstrategie sechs Fokusthemen für sich identifiziert: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Zu diesen Themen hat die Geschäftsleitung bereits zahlreiche Projekte lanciert und die Massnahmen auf der Website «Gesagt, getan» publiziert. Zudem wurden in Kooperation mit dem WWF Schweiz verbindliche und ambitionierte Ziele erarbeitet. Priorität haben umweltverträgliche Produkte
Nachhaltig handeln
Gut zu wissen
Lidl Schweiz unterhält ein starkes Netzwerk aus Schweizer Lieferanten und kann somit höchste Schweizer Qualität garantieren. Durch das internationale Einkaufsnetz bietet Lidl den Schweizer Lebensmittelproduzenten einen zusätzlichen Absatzkanal. So werden in 25 von insgesamt 31 Ländern weltweit, in denen Lidl Filialen betreibt, Schweizer Qualitätsprodukte angeboten.
Schweiz in der Einkaufstasche: Mehr als 50 Prozent des Umsatzes wird mit Produkten aus der Schweiz erzielt.
100 Prozent Schweiz: Kalbfleisch, Rahm, Butter und Trinkmilch stammen bei Lidl Schweiz vollständig aus der Schweiz. Sehr hoch ist auch der Anteil bei Schweine- und Rindfleisch: Er liegt bei 96 respektive 92 Prozent.
Bio-Rindfleisch aus der Schweiz: 100 Prozent aller Bio-Weiderindprodukte stammen aus der Schweiz.
Initiative «Klein aber fein»: Lidl Schweiz ermöglicht es auch sehr kleinen Lieferanten, ihre Produkte in der ganzen Schweiz bekannt zu machen. Dazu nimmt der Lebensmittelhändler mehrfach im Jahr im Zuge von Sonderaktionen gut 200 Produkte von rund 60 Lieferanten ins Sortiment auf.
sowie die Reduktion von CO2-Emissionen. Auch das Tierwohl steht weit oben auf der Nachhaltigkeitsagenda: Lidl Schweiz kennzeichnet als erster Schweizer Detailhändler tierische Produkte mit einem Tierwohl-Rating des Schweizer Tierschutzes (STS).
Interview 2025 ist das internationale Jahr der Genossenschaften. Damit rückt ein Unternehmensmodell in den Blickpunkt, das wie kein anderes für Nachhaltigkeit steht. Auch die Mobiliar ist genossenschaftlich verankert. Ihr Verwaltungsratspräsident Stefan Mäder erläutert die Vorteile, spricht aber auch von einer besonderen Verantwortung.

Warum passt das Genossenschaftsmodell so gut zur Mobiliar?
Stefan Mäder: Eine Genossenschaft ist seit jeher eine solidarische Rechtsform und eignet sich deshalb besonders gut für eine Versicherung. Bei einer Genossenschaft steht man füreinander ein. Und genau dies passt zum Bild der Gefahrengemeinschaft der Versicherung.
Gilt das heute auch noch?
Ja, das gilt immer noch. Die Mobiliar ist seit ihrer Gründung 1826 eine Genossenschaft. Diese Rechtsform ist eine tragende Säule unserer Unternehmensstrategie. Wir haben einen langfristigen Horizont, sind dezentral und nachhaltig aufgestellt. Das spüren auch unsere Kunden, wenn wir sie zum Beispiel in Krisenzeiten aufgrund unseres genos-
senschaftlichen Zwecks stärker unterstützen können.
Trotzdem sind die genossenschaftlich organisierten Versicherer in der Schweiz an einer Hand abzuzählen. Früher gab es mehr. Damals hatte das internationale Geschäft noch nicht den heutigen Stellenwert. Für viele der international aufgestellten Versicherer ist heute die Rechtsform Genossenschaft zu kompliziert. Eine Aktiengesellschaft eignet sich besser für ihre Geschäftstätigkeit.
Was sind die Vorteile gegenüber einer Aktiengesellschaft?
Genossenschaften können langfristig denken und müssen ihren Gewinn nicht für die Aktionäre kurzfristig ma-
ximieren. Wir sind unseren Kundinnen und Kunden verpflichtet. Gewinnoptimierung und Stabilität stehen bei uns im Vordergrund. Allerdings ist es klar, auch wir müssen Geld verdienen, damit wir Erfolg haben. Rund die Hälfte unseres Gewinns fliesst an unsere Kundinnen und Kunden zurück. Tradition hat für uns als Genossenschaft auch unser Engagement für die Gesellschaft. Gibt es auch Nachteile? Die Kapitalbeschaffung ist schwieriger, weil wir nicht einfach unser Aktienkapital erhöhen können. Deshalb sind ein hohes Eigenkapital und der verantwortungsvolle Umgang damit für uns essenziell. Der Kapitalmarkt wirkt ausserdem disziplinierend. Er fordert zum Beispiel ein hohes Kostenbewusstsein. Deshalb
müssen sich Genossenschaften manchmal etwas mehr selbst disziplinieren. Unsere Kundinnen und Kunden haben hohe Ansprüche und ein sehr grosses Vertrauen in uns. Dem gilt es besonders Rechnung zu tragen.
Genossenschaften gelten als sehr solidarisch und wertebasiert. Was bedeutet das?
Wir halten uns, wie alle anderen auch, an unsere Verträge. Unser Engagement geht allerdings über den Versicherungsvertrag hinaus. Als Genossenschaft engagieren wir uns stark für die Gesellschaft – zum Beispiel im Bereich Forschung und Prävention von Naturgefahren. Wir bezahlen nicht einfach nur die Schäden, sondern wollen einen wesentlichen Beitrag leisten, die Men-
schen in der Schweiz besser vor Naturgefahren zu schützen.
Was heisst das konkret?
Wir haben in den letzten 20 Jahren rund 170 Projekte zur Prävention von Naturgefahren unterstützt. Ausserdem haben wir schon über 20 Gemeinden mit einem mobilen Hochwasserschutzsystem ausgerüstet. Seit etwa zwei Jahren unterstützen wir Schwammstadtprojekte zur Milderung der Folgen des Klimawandels in dicht besiedelten Gebieten. Wir engagieren uns auch für die Forschung: Das Mobiliar Lab für Naturrisiken an der Uni Bern forscht zu Hagel, Sturm und Hochwasser und stellt den Wissenstransfer in die Praxis sicher.
Können Genossenschaften umsichtiger und nachhaltiger agieren als börsenkotierte Unternehmen?
Eine Genossenschaft kann sich andere Ziele setzen und muss nicht ständig auf den Aktienkurs schielen. Wir können langfristig planen und haben mehr Spielraum, weil wir nicht kurzfristig auf Teufel komm raus profitabel sein müssen. Die Mobiliar zum Beispiel verwendet einen Teil ihres Gewinns für gemeinnützige Aktivitäten.
UN-Generalsekretär António Guterres sagt, Genossenschaften könnten viele globale Herausforderungen lösen. Haben sie tatsächlich die Kraft, die Welt zu retten? Genossenschaften können viel Gutes tun. Gerade in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie spielen Genossenschaften eine sehr wichtige Rolle. Sie sind eine geeignete Form, sich gemeinsam zu organisieren und zum Beispiel den Ein- und Verkauf besser managen zu können.
Sind Genossenschaften nicht doch ein Auslaufmodell? Auf keinen Fall! Genossenschaften haben Zukunft. Denken wir nur an unsere demokratischen Strukturen in der Schweiz. Die Schweiz basiert auf einer Genossenschaft – der 1291 gegründeten Eidgenossenschaft. Da ging es um Gemeinsinn und Solidarität. Bis heute sind Genossenschaften ein wichtiger Bestandteil unsere Kultur geblieben. Als Beispiele möchte ich die vielen erfolgreichen Wohnbau- und Einkaufsgenossenschaften nennen. Solche Organisationen sind wichtig für unseren Zusammenhalt. Werte wie Solidarität, Verantwortung oder Stabilität, die mit ihnen verbunden werden, entsprechen dem Zeitgeist. Interview: Jürg Thalmann
Die Mobiliar zählt zu den zehn grössten Genossenschaften der Schweiz – ein Erfolgsmodell.
Die heutige Rechtsform der Genossenschaft gibt es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, sie entstand im Zuge der Industriellen Revolution. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von Menschen oder Unternehmen, die gemeinsam wirtschaftliche oder soziale Interessen verfolgen. Der Fokus liegt auf der Förderung und der wirtschaftlichen Selbsthilfe der Mitglieder. Ihr Nutzen wird im politischen Diskurs oft unterschätzt: verstaubte Gesellschaftsform oder zu komplexe Verwaltungen, lauten etwa die Vorurteile. Ein falscher Eindruck.
Weltweit gibt es heute mehr als drei Millionen Genossenschaften, jede zehnte erwerbstätige Person ist bei einer angestellt – das sind über 280 Millionen Arbeitsplätze.
In der Schweiz sind rund 8200 Genossenschaften im Handelsregister eingetragen. Dies entspricht etwa einem Prozent aller Unternehmen hierzulande. Zum
Vergleich mit unseren Nachbarn: Trotz zehnmal grösserer Bevölkerung sind es in Deutschland ungefähr gleich viele. In Frankreich ist die Genossenschaftsform vor allem in der Landwirtschaft weit verbreitet. Schätzungsweise ist jeder zweite Franzose Genossenschaftsmitglied.
Die zehn grössten Genossenschaften in der Schweiz, darunter Migros, Coop, Raiffeisen oder die Mobiliar, beschäftigen vier Prozent aller Erwerbstätigen. Sie tragen 11 Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei. Hinsichtlich der Wertschöpfung der Genossenschaften belegt die Schweiz im internationalen Vergleich hinter Neuseeland und Frankreich sogar den dritten Rang. Genossenschaften denken langfristig und engagieren sich für die Interessen ihrer Genossenschafter. Das zeigt sich zum Beispiel bei Wohnbaugenossenschaften, die bezahlbaren Wohnraum schaffen. Genossenschaften sind auch
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil. Das gemeinschaftliche Modell fördert nachhaltiges Wirtschaften und mindert Risiken. Genossenschaften stärken ausserdem die soziale Verantwortung und engagieren sich oft für die Gesellschaft.
Bei der Mobiliar, 1826 als «Schweizerische Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung des Mobiliars gegen Brandschaden» gegründet, vertreten 150 Delegierte die Genossenschafter (alle Versicherten). Sie wahren die Interessen der verschiedenen Kundengruppen und Regionen gegenüber der Gesellschaft. Kundengruppen sind insbesondere Private, die Landwirtschaft, das Gewerbe, die Industrie, die Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie die öffentliche Hand. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Versicherungsgruppe gewahrt bleibt.


ANJA RUOSS
Die Energiewende in der Schweiz gleicht einer Gratwanderung: Das Land muss seine CO2-Emissionen drastisch senken und zugleich eine verlässliche Stromversorgung sicherstellen. Zwar stammten 2022 bereits knapp 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen, doch Sonnen- und Windenergie schwanken stark: Im Sommer gibt es einen Überschuss, im Winter droht ein Engpass. Ohne leistungsfähige Speicher geht wertvolle Energie verloren – und die Versorgungssicherheit gerät unter Druck. Hier setzt eine von der ETH Zürich und der EPFL gegründete «Coalition for Green Energy and Storage» an: Sie bündelt Fachwissen aus Forschung, Politik und Wirtschaft, um Technologien für die langfristige Speicherung von erneuerbarer Energie zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Drei Projekte zeigen, wie vielfältig diese Ansätze sind –und welches Potenzial sie haben.
Wasserstoff verstromen
Auf dem ETH-Campus Hönggerberg in Zürich steht Wendelin Stark zwischen drei silbernen Stahlfässern – gross wie kleine Silos, verbunden durch Kabel und mit Alufolie umwickelte Rohre. «Wir haben den langweiligsten Reaktor der Welt gebaut», sagt der ETH-Professor und lacht. Doch die unscheinbare Anlage hat es in sich: Sie speichert Sonnenenergie – nicht in Batterien, sondern in Eisen.
Stark und sein Team haben dafür einen innovativen Prozess entwickelt: Strom wird im Sommer in Wasserstoff umgewandelt. Dieser reduziert in einer chemischen Reaktion Eisenoxid zu elementarem Eisen. Im Winter kehrt man den Prozess um – Wasserdampf reagiert mit dem Eisen, es entsteht erneut Wasserstoff, der sich dann verstromen oder verbrennen lässt. «Im vollgeladenen Zustand ist der Speicher einfach ein Fass voller Eisen», sagt Stark. Keine Explosionsgefahr, keine Hochdrucktanks – nur ein metallisches Pulver, das auf Temperatur gebracht werden muss. Das Verfahren ist sicher, günstig und skalierbar – ideal für abgelegene Regionen oder energieautarke Quartiere. Noch allerdings ist es wenig effizient: Aufgrund der vielen Umwandlungsschritte bleibt am Ende nur rund ein Drittel der eingesetzten Energie als nutzbarer Strom übrig. Um das Verfahren zu optimieren, arbeiten Stark und sein Team auf dem Hönggerberg aktuell am Bau einer deutlich grösseren Pilotanlage. Sie soll bis 2026 in Betrieb gehen und im Winter ein Fünftel des Campus mit Strom versorgen.
Forschung Die Schweiz setzt stark auf erneuerbare Energien –doch im Winter droht eine Stromlücke. Wie lässt sich der Energieüberschuss aus dem Sommer in die kalten Monate retten? Eine von der ETH Zürich und der EPFL gegründete Koalition arbeitet an zukunftsweisenden Lösungen.
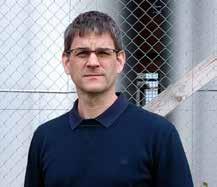
Pilotanlage in Zug
Etwa 40 Kilometer südwestlich soll das nächste Projekt der Koalition entstehen. Vorausgesetzt, die Finanzierung ist sichergestellt, entwickeln im Kanton Zug Forschende des ETH-Bereichs gemeinsam mit Industriepartnern eine Pilotanlage für grünes Methanol – einen klimaneutralen, flüssigen Energieträger. «Ein grosser Teil der Energiewende wird darin bestehen, fossile Brennstoffe durch Strom zu ersetzen», sagt Gianfranco Guidati von der ETH Zürich. «Das wird aber nicht überall möglich sein – etwa in der Luftfahrt oder in Teilen der Industrie. Dort brauchen wir weiterhin flüssige Treibstoffe, nur eben emissionsfrei hergestellt.» Grünes Methanol könnte dafür die Lösung sein. Hergestellt wird es aus Wasserstoff und CO2. Der Was-
serstoff wird durch Elektrolyse gewonnen, betrieben mit Solarstrom. Das CO2 soll aus einer nahegelegenen Kläranlage stammen. Das Ergebnis ist ein flüssiger Energieträger, der sich gut lagern und transportieren lässt – und bei der Verbrennung als Treibstoff kein fossiles CO2 freisetzt. Zudem kann Methanol in einem weiteren Schritt in grünes Kerosin umgewandelt werden. «Mit unserer Pilotanlage in Zug wollen wir zeigen, dass dieser Prozess auch bei schwankender Stromzufuhr funktioniert – wie sie bei Solarenergie typisch ist», erklärt Guidati. Denn chemische Prozesse bevorzugen stabile Vorgänge. «Diese Schwankungen auszugleichen, ist unsere grösste Herausforderung.»
Im Kanton Zug soll allerdings kein Methanol im grossen Stil produziert werden – sondern vor allem Wissen.
Die Forschenden wollen den Prozess optimieren und Schweizer Firmen die Möglichkeit geben, sich mit der Technologie vertraut zu machen. «Die eigentliche industrielle Produktion wird anderswo stattfinden müssen», sagt Guidati. Denn dafür benötige man Solaranlagen in einer Grösse, die sich in der Schweiz nicht realisieren lasse. «Aber die Technologie und die Firmen, die diese Technologie liefern, könnten aus der Schweiz kommen.»
Tiefe Löcher, grosse Ideen Würde grünes Methanol künftig breit eingesetzt, eröffnet dies neue Möglichkeiten, etwa zur Erzeugung sogenannter negativer Emissionen. «Das CO2 stammt nicht aus fossilen Quellen. Man könnte es daher nach der Verbrennung wieder aus der
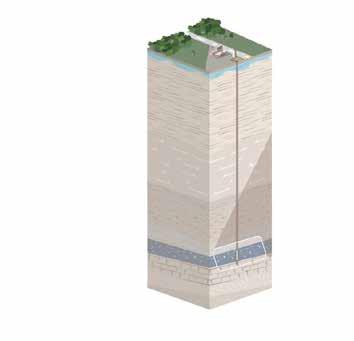
Nachhaltig handeln
Abluft der Anlage filtern – und dauerhaft unter der Erde speichern», sagt Guidati. Damit liesse sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre aktiv senken. Genau daran arbeitet der ETH-Seismologe Stefan Wiemer. In Trüllikon im Zürcher Weinland untersucht er, wie sich CO2 dauerhaft in tiefen Gesteinsschichten einlagern lässt. Ein geeignetes Bohrloch ist bereits vorhanden – ursprünglich von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) zur Erkundung möglicher Endlager gebohrt, dient es heute der Forschung. Mit seismischen Wellen und hochsensiblen Sensoren tastet Wiemers Team den Untergrund ab. Gesucht wird eine geologische Doppelschicht: Unten poröses Gestein, das das CO2 aufnehmen kann, oben eine dichte Tonschicht, die es wie ein Deckel zurückhält. Nur wenn die Lagerung als sicher, umweltverträglich und technisch machbar gilt, dürfen erste Tests starten. Frühestens 2026 könnten die ersten CO2-Moleküle in der Tiefe verschwinden – um dann dort für immer zu bleiben.
Die «Coalition for Green Energy and Storage» (CGES) ist eine Initiative des ETH-Bereichs, geleitet von der ETH Zürich, der EPFL und dem Paul-Scherrer-Institut (PSI). Ziel ist es, Technologien zur Speicherung und zum Transport erneuerbarer Energien schneller zur Marktreife zu bringen – für ein klimaneutrales und flexibles Energiesystem der Zukunft. Geplant sind Pilotanlagen und sogenannte Demonstratoren im industriellen Massstab. Diese sollen als Testplattformen dienen, um vielversprechende nachhaltige Technologien weiterzuentwickeln. Langfris-
tig sollen daraus wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die Schweiz und den internationalen Markt entstehen. Die Koalition wurde 2023 ins Leben gerufen und wächst seither laufend. Neben mehreren Forschungsinstitutionen, darunter die Empa und das PSI, gehören auch Startups, Energieunternehmen und Industriepartner zum Netzwerk. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, Netto-Null zu erreichen und gleichzeitig eine zuverlässige Energieversorgung in der Schweiz sicherzustellen. Die Koalition ist als Verein organisiert und offen für neue Partner.
Interview Walter Rudolf Stahel ist ein Pionier der Kreislaufwirtschaft. Der Gründer des Genfer Instituts für Produktdauer-Forschung hat schon vor Jahrzehnten Ideen für nachhaltiges Wirtschaften entwickelt. Er ruft Politik und Unternehmen zum Umdenken auf.
Sie sind bereits seit den 1970er Jahren ein leidenschaftlicher Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Sind Sie mit dem bis anhin Erreichten zufrieden?
Walter Rudolf Stahel: Ja und nein. Ja, weil das Wort Kreislaufwirtschaft inzwischen in den allgemeinen Wortschatz eingegangen ist. Nein, weil die Schlüsselbotschaft – also die Werterhaltung von natürlichem, kulturellem, menschlichem und gefertigtem Kapital – in der politischen Diskussion der Kreislaufwirtschaft meist ignoriert wird.
Inwiefern?
Eine Wirtschaft in Kreisläufen, wie ich es nenne, zielt darauf ab, die Nutzungsqualität und den Nutzwert von Infrastruktur, von Gebäuden und Gütern über eine möglichst lange Dauer zu erhalten – und zwar durch Wiederverwenden (Reuse), Reparieren und Aufarbeiten (Remanufacture), wobei man sich an neue technische und modische Anforderungen anpasst (Upgrading). Dafür braucht man andere Fähigkeiten und Akteure als in der «linearen» Wirtschaft, die Güter produziert und nach dem Gebrauch einfach wieder entsorgt. Erforderlich sind arbeitsintensive Dienstleistungen, welche dezentral und zeitnah dort erbracht werden, wo sich die Kunden und ihre defekten Güter befinden. Es wird also nicht auf Vorrat produziert. Wie hat man sich eine «Wirtschaft in Kreisläufen» konkret vorzustellen?
Es geht um eine Bestandsbewirtschaftung von Gütern gemäss dem Trägheitsprinzip: kürzeste Transportwege und geringste Aktion. Die Prioritätenabfolge lautet: Verzichten vor Reduzieren vor Wiederverwenden vor Reparieren. Für jeden, der ein Gut nutzt, gilt damit, dass er dieses pflegt, reparieren lässt und an Drittpersonen weitergibt oder verkauft, wenn er oder sie das Gut nicht mehr braucht – Beispiel Secondhand-Kleidung. Statt Güter zur Nutzung zu kaufen, kann man diese auch teilen wie bei Werkzeug-Bibliotheken oder ausleihen. Für Hersteller ist Kreislaufwirtschaft mit dem Umstieg auf ein grundlegend anderes Geschäftsmodell verbunden. Statt immer schneller und möglichst kostenarm neue Güter zu produzieren und zu verkaufen, werden langlebige Güter mit Serviceverträgen für Betrieb, Instandhaltung und Rücknahme angeboten. Hersteller können auch Flottenmanager werden, welche ihre Güter reparieren und bei Bedarf wiederaufbereiten mit dem Ziel, ihre Produkte möglichst lange intakt zu halten und geringe Entsorgungskosten zu verursachen. Dazu braucht man ein Produktdesign, welches am Ende eine sortenreine, stofflich getrennte Sammlung von Materialien erlaubt.
Wer profitiert am meisten von einer Kreislaufwirtschaft?
Die grossen Gewinnerinnen sind, kurz gesagt, die Umwelt und die Gesellschaft. Denn einerseits entstehen bedeutend weniger CO2-Emissionen entlang der Lieferkette, ausserdem sinkt der Rohstoffbedarf inklusive des Wasserverbrauchs. Andererseits entstehen Arbeitsplätze in lokalen Reparaturwerkstätten, welche preisgünstige Alternativen zu Neugütern schaffen.
Was können Industriestaaten bei diesem Thema tun?
Die Industriestaaten müssen ihren Material- und Energieverbrauch um einen Faktor zehn, also um 90 Prozent reduzieren. Nur so ermöglichen sie es den Menschen in ärmeren Ländern, ihre Grundbedürfnisse in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Nahrung, Wohnen, Sicherheit und Mobilität befriedigen zu können, ohne die weltweite Masse an Infrastruktur und Gütern zu vergrössern.
Diese Masse an gefertigten Objekten hat bereits 2020 diejenige an Biomasse überholt. Nimmt die Masse an gefertigten Gütern weiterhin zu, schrumpfen

Abkehr von der Wegwerfwirtschaft: Statt Produkte nach Gebrauch einfach zu entsorgen, setzt die Kreislaufwirtschaft auf Wiederverwendung. Das gilt auch für Baustoffe. ADOBE STOCK
Biodiversität und Biomasse auf dem Planeten Erde unaufhaltsam – mit katastrophalen Folgen für uns. In gleichem Umfang nimmt auch der weltweite Verbrauch an fossiler Energie und damit der CO2-Ausstoss zu. Denn diese Energie wird gemäss OECD und IEA mit fünf Billionen Dollar pro Jahr subventioniert, um die Transportwege der globalen Produktionswirtschaft zu verbilligen und Heiz- und Fahrzeugkosten sozial abzufedern.
Für die Schweiz hätte das Wirtschaften in Kreisläufen übrigens grosse Vorteile: Da wir über keine Ressourcen ausser Elektrizität verfügen, würde die Abhängigkeit von Importen stark abnehmen und damit die nationale Resilienz steigen.
Welche Rolle spielen kulturelle Faktoren bei der Kreislaufwirtschaft? Sie haben einen bedeutenden Einfluss auf unser Verhalten in Bezug auf Ressourcennutzung und Abfallvermeidung. Für den Einzelnen braucht es ein Umdenken im Sinne einer weitgehenden Beschränkung der Bedürfnisse und eines Verzichts. Auf nationaler Ebene ist Japan ein Leuchtturm dafür: «Mottainai» ist ein Lifestyle-Konzept, welches Bedauern für die Verschwendung von Ressourcen oder Besitz ausdrückt. Auch für Politiker gilt es umzudenken: Statt der Slogans «Net zero Carbon» und «Zero Ressourcenverbrauch», die nur bedingt erfolgreich sind, sollte es das Ziel sein, den Wert und die Nutzung eines Gutes möglichst lange zu erhalten. Kurzfristige Finanzplanung führt jedoch zu einer Vernachlässigung von Instandhaltungsarbeiten und später zu riesigen Ausgaben und enormen Risiken – man denke nur an Brückeneinstürze.
Was sind die grössten Hürden für Unternehmen beim Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft? Regulatorische Vorgaben zur Förderung der Industriegesellschaft behindern diese Wirtschaftsweise. Dazu gehören die Besteuerung von menschlicher Arbeit statt von Ressourcenverbrauch, die Erhebung von Mehrwertsteuern
auch auf werterhaltende Aktivitäten der Kreislaufwirtschaft oder die Zeitwertvergütung statt Realersatz bei Haftpflichtschadenfällen. Es herrscht auch viel Unkenntnis in der BWL-Lehre, in Firmen und in der Beratung. So wird meist übersehen, dass die Aufarbeitung (Remanufacture) von Gütern einen fünfmal höheren Return
«Die Hersteller müssen lernen, dass sie beim Wirtschaften in Kreisläufen ihr Geld nicht am Verkaufspunkt verdienen, sondern in der Nutzung.»

on Investment (ROI) hat als die Fertigung derselben Güter. Zudem fehlen in der Wirtschaft entsprechende Compliance-Regeln.
Sie rufen die Verantwortlichen von Unternehmen zum Umdenken auf? Kreislaufwirtschaft ist disruptiv und braucht deshalb eine bewusste Abkehr der Geschäftsleitungen vom «Business as Usual». Es geht um eine Abkehr von der bisherigen Maxime möglichst tiefer Fertigungskosten zugunsten einer Kostenoptimierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die eigene Wettbewerbsfähigkeit wird durch tiefere Nutzungskosten gesteigert. Eine Modulbauweise mit standardisierten Komponenten verringert die Kosten und die Risiken in der Wartung von Gütern, die Ausbildungskosten des Personals sowie die Lagerhaltungskosten von Ersatzteilen – so hat es Airbus zum Beispiel vorgemacht. Es gibt gute Ansätze auch in zahlreichen weiteren Unternehmen.
Wo sehen Sie vielversprechende Innovationen in diesem Zusammenhang?
Textilien sind das neue Plastik! Für die Rückgewinnung von Fasern aller Art, sei es Viskose, Wolle oder Baumwolle, wer-
Walter Rudolf Stahel
Was heute als «Kreislaufwirtschaft» bekannt ist, beruht grösstenteils auf den Ideen von Walter Rudolf Stahel. Der gebürtige Zürcher, Jahrgang 1946, studierte einst an der ETH Zürich Architektur und ist seit 1984 als unabhängiger Wirtschafts- und Politikberater in zahlreichen europäischen Ländern, den USA und Asien tätig gewesen. Er war Gründer und Direktor des Instituts für Produktdauer-Forschung in Genf und hat in unterschiedlichen Funktionen die Europäische Kommission in Nachhaltigkeitsfragen beraten. Seit 2012 ist Stahel Mitglied des Club of Rome.
den in der Schweiz und in Europa laufend neue Technologien entwickelt. Das Unternehmen Climatex aus Altendorf im Kanton Schwyz hat ein Verfahren zur sortenreinen Trennung von Mischgeweben entwickelt. Anstatt wie 99 Prozent aller Textilien zum globalen Abfallproblem zu werden, gehen die Materialien von Climatex am Ende ihres Lebenszyklus zurück in ihren jeweiligen Kreislauf, um wieder und wieder verwendet zu werden. Mengenmässig sind jedoch Beton, Asphalt und Stahl die wichtigsten nichterneuerbaren Ressourcen. Heute fräst die Wirtgen Group, ein Baumaschinenspezialist, den Asphalt von Strassenbelägen und verwendet ihn für neue Deckschichten. Wichtig wäre in Zukunft zudem eine sortenreine Trennung von Stahllegierungen für ein grünes Stahlrecycling. Diese Trennung fehlt derzeit aber noch.
Ein weiteres Beispiel: Per Zufall haben Forscher der ETH Zürich ein neues, kreislauffähiges Polymer entdeckt: Polyphenylene methylene (PPM). Dieser fluoreszierende Kunststoff schützt Metalle vor Korrosion, repariert sich selbst und kann Schäden in der Schutzschicht durch Leuchten anzeigen.
Wo stehen wir in zehn Jahren in puncto Kreislaufwirtschaft?
Die internationalen Vorgaben auf EUEbene wie der Critical Raw Material Act CRMA, neue ESG-Anforderungen, aber auch Strafzölle auf industriell gefertigte Produkte sowie Energie- und Materialressourcen verschaffen lokal tätigen Akteuren der Kreislaufwirtschaft einen finanziellen Vorteil gegenüber der globalen linearen Fertigung. Dieser positive Trend wird sich verstärken. Künftig werden Unternehmen vermehrt Systemlösungen statt Produkte entwickeln. Startups werden ganz neue Lösungen auf den Markt bringen, wie etwa den Bau und Betrieb von Kühlräumen durch Leasing in ländlichen Gegenden Indiens durch die Basler Stiftung BASE. Insgesamt wird die Forschung auf dem Gebiet der zirkulären Materialwissenschaften zunehmen.
Interview: Elmar zur Bonsen
Gesellschaft Sapocycle ist die erste Non-ProfitOrganisation in Europa, die übrig gebliebene Seifen in Hotels sammelt und in lebensrettende Hygieneprodukte verwandelt. Die Seifen werden von Menschen mit Beeinträchtigungen recycelt und an Familien in Not verteilt.

VIKTORIA STAUFFENEGGER
In Industrienationen gelten Badezimmer als Selbstverständlichkeit, Hygiene als Privatsache. Doch für Menschen am Rand der Gesellschaft – Obdachlose, Armutsbetroffene oder Geflüchtete –kann der Zugang zu Wasser und Seife den entscheidenden Unterschied machen: zwischen Ausgrenzung und Teilhabe. Wer sich waschen kann, gewinnt nicht nur an körperlichem Wohlbefinden, sondern auch an sozialer Würde –und erhöht die Chancen auf einen Weg zurück in ein geregeltes Leben.
Enormer Ressourcenverlust
Die Schweizer Organisation Sapocycle aus Basel zeigt, dass Hygiene mehr ist als Sauberkeit: Sie ist eine Frage der Menschenwürde. Während in vielen Ländern Menschen keinen Zugang zu Hygieneprodukten haben, landen täglich Millionen kaum genutzter Hotelseifen im Müll. In der Schweiz allein werden jährlich rund 150 Tonnen Hotelseife weggeworfen – ein enormer Ressourcenverlust, der zudem einen CO2-Fussabdruck von etwa 340 Tonnen verursacht. Sapocycle will diesen Kreislauf durchbrechen. Die Organisation wurde 2014 von Dorothée Schiesser gegründet und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer sozialen Bewegung. Schiesser sammelt unbenutzte Seifen aus Hotels, recycelt sie. Die wiederaufbereiteten Produkte werden kostenlos an soziale Organisationen in der Schweiz verteilt – darunter Frauenhäuser, Notunterkünfte oder Hilfswerke. «Was für Hotels Abfall ist, kann für andere Menschen den Zugang zu grundlegender Hygiene ermöglichen und den Selbstwert steigern», erklärt Schiesser. Ein zentrales Element von Sapocycle und seinem Programm «Bubbles saving lives» (Seifenblasen retten Leben) ist die Zusammenarbeit mit dem Wohnwerk Basel, einer sozialen Einrichtung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Dort werden die gesammelten Seifen unter strenger bak-
teriologischer Kontrolle gereinigt, aufbereitet und neu geformt. Je nach Auftragslage arbeiten sechs bis zehn Personen für das Projekt. «Unsere Seifen nutzen nicht nur ungebrauchte Ressourcen, sie bieten auch Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit, Teil einer nachhaltigen Bewegung zu sein», sagt Schiesser. Einige Mitarbeitende seien bereits seit zehn Jahren bei dem Projekt und hätten über die Jahre grosse Entwicklungsschritte gemacht. Was viele nicht wissen: Flüssigseife ist im Vergleich zur festen Variante ökologisch deutlich problematischer. Sie besteht zu 80 Prozent aus Wasser, benötigt Konservierungsstoffe auf Erdölbasis und ist meist in Einwegplastik verpackt. Ersetzt man einen Liter Flüssigseife durch feste Seife, so lässt sich dadurch rund ein Kilogramm Plastik einsparen. «Feste Seifen sind unterschätzte Helden im Kampf gegen Plastikmüll», betont Dorothée Schiesser.
«Ein Stück Würde zurückgeben»
Dorothée Schiesser, Gründerin von Sapocycle, über ihr nachhaltiges Engagement.
Wie sind Sie auf Ihre Recycling-Idee gekommen?
Dorothée Schiesser: Mein Mann war lange Zeit im Verwaltungsrat des Grand Hotels Les Trois Rois in Basel. Die Frage der Abfallentsorgung in der Luxushotellerie war schon immer ein Diskussionsthema bei uns.
Dank einer Partnerschaft mit dem Sammelsystem «Bring Plastic Back» werden die weggeworfenen, nur halbbenutzten Kunststoffbehälter mit Flüssigseife nicht einfach entsorgt, sondern nach der Entleerung an die Thurgauer InnoRecycling AG, einem führenden Schweizer Unternehmen für Kunststoffverwertung, übergeben. Dort wandelt man die Spenderflaschen in neue Materialien um – so wird der Kreislauf für Plastikmüll geschlossen.
Internationale Partnerschaften Ein weiterer strategischer Pfeiler sind Kooperationen mit Seifenherstellern. Viele dieser Firmen haben Produktionsüberschüsse – etwa durch Farbfehler oder veränderte Duftnoten. Diese Restprodukte werden oft verbrannt, anstatt wiederverwendet zu werden. Besonders problematisch ist dies bei Flüssigprodukten in Plastikverpackungen – sie setzen bei der Verbrennung
Was reizt Sie persönlich an der Verbindung zwischen Hotellerie und sozialem Engagement?
Ich mag den Spagat zwischen zwei Welten – zwischen Luxus und Armut. Ich kenne die Hotelbranche gut. Doch mir war immer wichtig, auch sozial etwas zu bewegen. Ich brauche beides, Luxus allein wäre mir zu langweilig.
Worauf sind Sie besonders stolz? Ich bin stolz, dass wir ein einzigartiges Projekt aufgebaut haben. Besonders bewegt mich, wie Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bei uns Verantwortung übernehmen und wachsen können. Und dass wir Menschen in Not mit etwas so Alltäglichem wie Seife ein Stück Würde zurückgeben können.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Sapocycle? Mein grosser Wunsch ist, dass mehr Menschen verstehen, welche Vorteile feste Seife gegenüber Flüssigseife bie-
schädliche Stoffe frei. «In Frankreich arbeiten wir bereits mit Seifenherstellern, in anderen Ländern ist das noch schwierig», berichtet Schiesser. So fehle es in der Schweiz bisher an Transparenz und öffentlicher Unterstützung. In Frankreich dagegen sei die Corporate Social Responsibility (CSR) weiterentwickelt, und das gesellschaftliche Engagement lasse sich gegenüber Aktionären und Konsumenten sehr glaubhaft kommunizieren. «Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Umweltschutz, sondern auch soziale Verantwortung – das darf man nicht trennen», ist Schiesser überzeugt.
Heute zählt Sapocycle mehr als 280 Hotels, zwei Werkstätten und einen Logistikpartner in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland zu seinem Netzwerk. Partnerschaften in Italien sollen folgen. Schiesser: «Ziel ist es, unser Programm auch in Ländern zu etablieren, in denen Tourismus auf Armut trifft.»
tet – nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Haut. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir noch mehr Seife bekommen, um sie an Bedürftige weiterzugeben.

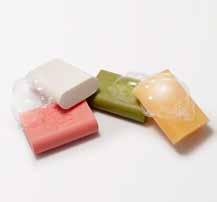
Aus Alt wird Neu: frisch duftende
Nachhaltig handeln
Händewaschen mit Seife ist ein einfacher, effektiver und erschwinglicher Do-it-yourself-Schutz, der Infektionen vorbeugt und Leben rettet. Rund um den Globus werden täglich Millionen gebrauchter Hotelseifen auf Deponien geworfen, was zunehmend ein Umweltproblem darstellt. Zugleich sterben jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen an weitgehend vermeidbaren Krankheiten wie Lungenentzündung und Durchfall. Händewaschen mit Seife vor den Mahlzeiten und nach dem Toilettengang reduziert laut Unicef Durchfallinfektionen nachweislich um 40 Prozent. Wer die Non-Profit-Organisation Sapocycle unterstützen möchte, hat online unter de.shop.sapocycle. org die Möglichkeit zu spenden. Als Dankeschön gibt es eine Hüüsli-Seife: Sie sieht aus wie ein kleines Haus und verdeutlicht, dass mit der Spende einem Haushalt geholfen wird.
CAS Sustainable Finance
Welche ist die richtige für dich?
Finde deinen Kurs
MAS Nachhaltige Transformation