LUCERNE FESTIVAL









Christian Wildhagen Albert Einstein jonglierte nicht nur virtuos mit Zahlen, er war auch ein Meister des treffsicheren Worts Von ihm stammt unter anderem der Ausspruch «Abschiede sind Tore in neue Welten». Ob der geniale Physiker dabei ans Lucerne Festival gedacht hat? Sicher nicht. Aber das Bonmot beschreibt genau die Situation, in der sich die Musikfestspiele diesen Sommer befinden.
Denn deren Intendant Michael Haefliger hat beschlossen, dass es auch für ihn noch einmal «neue Welten» geben soll – er wird dem Festival nach 26 Spielzeiten Ende Jahr den Rücken kehren
Wenn jemand, der eine Institution so tiefgreifend geprägt hat wie Haefliger, nach mehr als einem Vierteljahrhundert geht, führt so ein Abschied zwangsläufig zu einem Wechselbad widersprüchlicher Stimmungen – nicht nur bei Kollegen und Weggefährten, sondern vermutlich auch bei manchen Besuchern, die dem Festival seit langem die Treue halten. Was wird kommen? Was wird bleiben von diesen 26 Jahren, die man fraglos eine «Ära» nennen darf? Wird jetzt alles ganz anders werden? Bietet ein Neuanfang nicht auch Chancen? Entsprechend wechseln die Gemütslagen derzeit nahtlos zwischen Ungewissheit, Nostalgie und Bedauern, aber auch vorausblickendem Optimismus und sogar ein wenig Aufbruchsstimmung hin und her. Das Lucerne Festival macht genau diesen Schwebezustand zum Thema der finalen Haefliger-Saison: «Open End» steht als Motto über dem Programm der Luzerner Sommerkonzerte, das wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem NZZ-Schwerpunkt vorstel-
len. Darin wird es ab dem 12 August knapp fünf Wochen lang um die Frage gehen: Wie hört man auf, ohne zu enden? Und das Paradoxe an dieser Frage ist beabsichtigt
Denn einerseits gilt es, den Einschnitt zu markieren, den solch ein Wechsel der künstlerischen Leitung immer bedeutet, zumal nach einem so langen Zeitraum. Andererseits steht aber schon jetzt fest, dass Haefligers designierter Nachfolger, Sebastian Nordmann, in Luzern vieles fortführen wird. Zentrale Einrichtungen wie die von Haefliger und Pierre Boulez gegründete Festival Academy oder das zusammen mit Claudio Abbado ins Leben gerufene Lucerne Festival Orchestra standen und stehen nicht zur Disposition
Folgerichtig will man im diesjährigen Sommerprogramm die Türen nicht mit theatralischer «Nach uns die Sintflut»-Geste zuwerfen. Vielmehr wird Offenheit hier auch musikalisch zum Thema gemacht. Etwa dadurch, dass etliche Konzerte den Fokus auf Werke richten, die sich durch ein besonderes Ende auszeichnen. Oder dadurch, dass sie gar kein Ende haben – wie zahlreiche berühmte Fragmente der Musikgeschichte, die sich als roter Faden durch die Programme ziehen, von Schuberts «Unvollendeter» bis zu Bruckners Neunter Den Ton setzt Riccardo Chailly schon im Eröffnungskonzert: mit Gustav Mahlers 10. Sinfonie Das Stück wurde vollständig entworfen, aber nicht mehr in allen Details ausgearbeitet; es hat ein bewegendes Ende, lässt aber zugleich Raum, das Erreichte weiterzudenken Das ist das Leitmotiv für diese ungewöhnliche Saison in Luzern Lucerne Festival ist ein Schwerpunkt


Die Musikwelt tut sich schwer mit dem Unvollendeten. Trotzdem werden viele berühmte Fragmente regelmässig aufgeführt. Sie eröffnen einen einzigartigen Blick in die schöpferische Praxis
MICHAEL STALLKNECHT
Wenn Komponisten sterben, bleibt in ihren Nachlässen meist eine Fülle offener Enden zurück. Manche Projekte wurden durch wichtigere verdrängt, andere haben sich aus formalen Gründen als unausführbar erwiesen; gelegentlich haben es sich auch Auftraggeber anders überlegt. Für die dadurch entstandenen Fragmente interessieren sich in der Regel vor allem Fachleute Doch gibt es eine kleine Gruppe von Werken die ungeachtet ihres fragmentarischen Charakters regelmässig aufgeführt werden. Nennen wir sie die «legendären Unvollendeten»: Mozarts Requiem, Schuberts «Unvollendete», Bruckners neunte und Mahlers zehnte Sinfonie, die Opern «Turandot» von Puccini und «Lulu» von Alban Berg. Diese Unvollendeten verbindet, was die Sozialwissenschaften im Anschluss an Michel Foucault ein «Dispositiv» nennen: ein Netz von kulturellen Praktiken und Diskursen, das nicht nur den Charakter des Fragments immer wieder ins Gedächtnis ruft, sondern auch entscheidet, wie wir mit ihm umgehen. Dies beeinflusst nicht zuletzt auch das Denken und Fühlen des Publikums: Es gibt wohl keinen Musikliebhaber, den bei den ersten Takten des «Lacrimosa» aus Mozarts Requiem nicht ein Schauder rührte Spannen wir also ein Netz um die legendären Unvollendeten, natürlich in Fragmenten:
• Die legendären Unvollendeten sind Produkte des Geniezeitalters, entstanden zwischen dem späten 18 und dem frühen 20 Jahrhundert. Sie setzen voraus, dass Komponisten einem Personalstil und einer individuellen Intention folgten, nicht mehr nur Konventionen einer Gattung.Wenn ein Komponist des 17 Jahrhunderts eine weitere Messe oder Oper unvollendet hinterliess fiel sie in der Regel durchs Netz, wie gelungen sie auch sein mochte Hätte ein Auftraggeber das Werk zwingend benötigt, hätte er es von fremder Hand vollenden lassen, gemäss den damals gültigen Regeln der jeweiligen Gattung Ganz ähnlich geschah es in der Architektur bei einer Kirche oder einem Schloss wenn der ursprüngliche Baumeister starb.
• Entsprechend suchte Constanze Mozart nach dem Tod ihres Mannes 1791 einen Komponisten, der das unfertige Requiem fertigstellte Allein schon deshalb, weil sie ansonsten die Anzahlung auf das Honorar des anonym gebliebenen Auftraggebers hätte rückerstatten müssen. Mozarts Schüler Franz Xaver Süssmayr erstellte schliesslich eine Fassung, die im Grossen und Ganzen bis heute überzeugt, auch wenn ihr bis heute immer wieder handwerklich stärker reflektierte Vollendungsversuche an die Seite gestellt werden.
• Im Geniezeitalter wird der Künstler zu einem Rollenmodell für die Gesellschaft. Wie er seine Werke entwirft, entwirft der Bürger sein Leben. Es zu vollenden, war bis dahin Gott vorbehalten gewesen. Gleichgültig in welchem Alter und in welchen Projekten ein Mensch starb: Ein Leben konnte sich nur im Paradies vollenden. Erst in einer Welt, in der das Individuum mit sich selbst fertig werden muss, wird der vorzeitige Abbruch zum Skandal.
• Das bedeutet keineswegs, dass Gott tot ist. In seinem Buch «Von realer Gegenwart» deutete der 2020 verstorbene Literaturwissenschafter George Steiner das künstlerische Werk als «Gegenschöpfung», den ästhetischen Akt als Imitation des göttlichen Schöpferakts Der Autor wird zum Rivalen Gottes: Er macht vollkommener, was dieser an seiner Schöpfung hat fehlen lassen, zuvorderst aber an ihm selbst: dass er in der Welt ist ohne sich selbst entworfen zu haben. Und dass er ster-

Unvollendete Werke vieler Komponisten stellen die Nachwelt vor Herausforderungen. SARA SPARASCIO
ben muss Das Genie überwindet symbolisch den Tod, indem seine Werke überdauern. Spinnt man Steiners Überlegungen weiter dann bewiese im unvollendeten Fragment Gott seine Macht auf alttestamentarisch grausame Weise: Er erschlägt den Rivalen.
• Fragmente wie Mozarts c-MollMesse oder Schönbergs Oper «Moses und Aron» werden nicht den legendären Unvollendeten zugerechnet: Beide sind nicht in Todesnähe entstanden sondern aus anderen Gründen nicht beendet worden Auch darf das Fragment nicht zu vollständig oder unvollständig sein, um ins Dispositiv eingesponnen zu werden: Béla Bartóks drittes Klavierkonzert gilt nicht als unvollendet, weil nur die letzten 17 Takte fehlten; ebenso wenig Beethovens zehnte Sinfonie zu der die Skizzen nie über dreissig aufeinanderfolgende Takte hinausreichen Und latent muss das Werk vollendbar sein: Für Alexander Skrjabins unabgeschlossenes Projekt «Mysterium» hat noch niemand zweitausend Mitwirkende auftreiben wollen, die es unter einer Halbkugel in Indien aufführen.
• Ein Fragment auch als solches zu veröffentlichen, also mit offenem Ende oder mit erkennbaren Fehlstellen, war noch Mitte des 18 Jahrhunderts ohne Präzedenz Carl Philipp Emanuel Bach schrieb deshalb Musikgeschichte, als er 1751 die «Kunst der Fuge» seines Vaters Johann Sebastian in den Druck gab samt einer unfertigen Fuge am Schluss
Immerhin hätte der Sohn sie auch einfach zu Ende komponieren können, wie es dann nach ihm viele versucht haben. Zur Rechtfertigung schuf der BachSohn im Vorwort einen Mythos: Der «selige Herr Verfasser» sei, bereits erblindet, über dem Werk gestorben Die Musikwissenschaft weiss schon lange, dass das nicht wahr ist; sie konnte den Befund aber bislang nicht deuten. Im vergangenen Jahr hat Meinhard Brüser eine faszinierende These vorgelegt: Johann Sebastian Bach habe die letzte Fuge bewusst unvollendet gelassen, als Zeichen der Demut Der gläubige Komponist hätte somit freiwillig auf die letzte Rivalität mit dem Schöpfer verzichtet.
• Ins Netz der legendären Unvollendeten hat sich ein Werk gemogelt, das nicht hineingehört: Vor seinem Tod im Jahr 1828 arbeitete Franz Schubert nicht an seiner «Unvollendeten» in h-Moll, vielmehr an einer anderen Sinfonie in D-Dur. Die zwei (statt der üblichen vier) Sätze der «Unvollendeten» entstanden schon 1822 als Abschluss einer Reihe von weiteren Fragmenten, in denen sich der damals noch junge Komponist an der Gattung Sinfonie erprobte Dennoch wurde die «Unvollendete» lange als achte Sinfonie gezählt, die später komponierte «Grosse» C-Dur-Sinfonie in vier Sätzen als siebte Das Dispositiv war hier wirkmächtiger als die Realität: Schuberts früher Tod mit 31 Jahren wurde auf das Werk rückprojiziert, zumal h-Moll als Tonart der Schicksalsergebenheit galt.
• Neun Sinfonien hat Beethoven abgeschlossen, der dem 19 Jahrhundert als Vollender der gesamten Gattung galt. Wer eine Neunte schrieb konkurrierte deshalb nicht nur mit der göttlichen Dreifaltigkeit, multipliziert mit sich selbst, sondern auch noch mit dem irdischen Gott der Sinfonie «Dem lieben Gott» wollte Anton Bruckner laut mündlicher Überlieferung seine Neunte widmen, wofür er laut Auskunft seines Arztes «einen Kontrakt abgeschlossen» habe: Stürbe er vor dem Finale so habe «sich das der liebe Gott selber zuzuschreiben, wenn er ein unvollendetes Werk bekommt» Doch der Allmächtige hatte andere Pläne und liess Bruckner über den Entwürfen zum Finalsatz sterben
• Todesangst löste die Neunte auch bei Gustav Mahler aus Um die Zahlenfolge etwas zu verschleiern, schob er zuvor sicherheitshalber das «Lied von der Erde» ein, das von höherer Warte als Sinfonie betrachtet werden konnte oder auch als Zyklus von Orchesterliedern. Mit der Neunten wurde er fertig, mit seiner Zehnten nicht mehr
• Zu jeder legendären Unvollendeten gibt es eine Vielzahl von Vollendungsversuchen. Komponisten und Musikwissenschafter, die sich der Sache annehmen, studieren dafür jede erhaltene Skizze und noch die kleinste Notiz des ursprünglichen Schöpfers Dennoch löst jeder Vollendungsversuch zuverlässig Kritik aus Er wird als Sakrileg gewertet, so aufführungspraktisch er auch gedacht
sein mag Die Diskussion um die richtige Ausführung der Intention des Urhebers kommt – siehe Mozart, siehe Bach – nie an ein Ende, sie geht potenziell immer weiter.
• Als Giacomo Puccini 1924 über seiner «Turandot» starb, arbeitete Franco Alfano das Finale der Oper aus Doch der Dirigent Arturo Toscanini brach nicht nur die Uraufführung an der Stelle ab, an der Puccinis Reinschrift der Partitur endet er strich auch für die Folgeaufführungen Alfanos Komposition rüde zusammen. Bis heute wird sie meist in dieser gekürzten Version gespielt, begleitet von der immer gleichen Kritik: Die Titelfigur wandele sich allzu rasch von der männermordenden zur liebenden Frau 2002 entwarf Luciano Berio eine neue Version mit einer ausgiebigen Verwandlungsmusik, die etwas ambivalenter ausklingt. Und dabei ist Alfanos ungekürztes Finale nicht nur kompositorisch gelungen. Es vertont vor allem auch den vollständigen Originaltext, der Turandots Wandlung motiviert Toscaninis Geniekult verhinderte auf Jahrzehnte die theaterpraktisch sinnvolle Lösung.
• Selbst grösste philologische Akribie führt nicht notwendigerweise zum Ziel. Jahrelang vertiefte sich der Komponist Friedrich Cerha in Alban Bergs Notizen zum dritten Akt der «Lulu» und studierte sogar die unterschiedliche Dicke der Bleistiftstriche im Autograf Als das Ergebnis schliesslich erklang wurde Cerhas Instrumentation allgemein als zu üppig kritisiert. Berg selbst hätte sicher nicht jeden orchestralen Einfall weiterverfolgt, den er sich während des Kompositionsprozesses notiert hatte.
• Ende des 19 Jahrhunderts wurde in London Beethovens zehnte Sinfonie uraufgeführt, erlebte allerdings ein Fiasko Der Meister hatte sie angeblich einem Medium vom Jenseits aus diktiert, schien im Paradies allerdings einen erheblichen Teil seiner irdischen Fähigkeiten eingebüsst zu haben.
• Weitere Versuche Beethovens spärliche Skizzen zu einer zehnten Sinfonie fortzuspinnen, wurden davon natürlich nicht verhindert.Vor vier Jahren verkündete die Deutsche Telekom Group, Beethovens erhaltenes Material mithilfe einer künstlichen Intelligenz vervollständigt zu haben. Als das Ergebnis der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ging ein Aufatmen durch den Musikbetrieb: Obwohl der digitale Output von einem menschlichen Komponisten betreut und überwacht worden war, glich er eher einem harmonischen Auffahrunfall als einer Sinfonie von Beethoven. Die KI hatte versagt. Um eine plausiblere Version vorzuschlagen, müsste sie nicht nur die schöpferischen Intentionen im Skizzenmaterial verstehen, sondern zusätzlich auch selbst welche entwickeln.
• In jüngerer Zeit scheint sich eher die Tendenz zu etablieren, Fragmente als solche auszustellen. «Turandot» wird nun gelegentlich ohne Finale gespielt, wie etwa 2023 am Opernhaus Zürich. Hörbare Lücken liessen auch die Bearbeiter Eberhard Kloke und Detlef Heusinger, als sie 2010 und 2019 Neufassungen zum dritten Akt der «Lulu» vorlegten Kloke distanziert sich dabei vom Anspruch einer «Vollendung», indem er an manchen Stellen unterschiedliche Varianten anbietet Heusinger setzt sogar neuere Instrumente wie E-Gitarre und Keyboard ein, um zu betonen, dass Bergs Intentionen sich nicht mehr vollständig umsetzen lassen
• Über das Geniezeitalter wird gern gespottet. Doch im Umgang mit den legendären Unvollendeten scheint das Dispositiv wirkmächtiger denn je: Der finale Wille der Komponisten bleibt so unergründlich wie der Wille Gottes
Herr Haefliger, Goethe hat in seinem Gedicht «Unbegrenzt» den schönen Satz geprägt: «Dass du nicht enden kannst, das macht dich gross.» Ist das auch der geheime Sinn hinter dem diesjährigen Festival-Motto «Open End»?
Es fragt sich immer, was endet, nicht wahr? Intendanzen enden – die müssen ja auch irgendwann einmal enden. So wie meine nach dieser Saison Aber das Festival endet nie Es geht immer weiter Jedenfalls solange es genügend Geld zur Verfügung hat.
Ja, aber das ist die Aufgabe des jeweiligen Intendanten: die Organisation hochzuhalten, das Festival, die Kunst; aber eben auch, die wirtschaftliche Situation so abzusichern, dass es weitergehen kann. Und nicht zuletzt dafür zu sorgen, dass man einen guten Übergang hat, wenn es zu einem Wechsel kommt. Das meine ich mit «Es hört nie auf».
Sobald es in der Kulturwelt zu solch einem grösseren Einschnitt kommt, wird oft befürchtet, nun breche gleich alles zusammen.
Als Claudio Abbado 2014 gestorben ist, haben viele gemutmasst, nun könne es mit dem Lucerne Festival Orchestra nicht weitergehen. Weil das Orchester seit 2004 so umfassend durch Abbado geprägt worden war. Aber es ging weiter Es kommt immer etwas Neues Auf Abbado folgte Riccardo Chailly, und in meinem Fall ist «der Neue» auch schon benannt: Mein Nachfolger Sebastian Nordmann ist schon emsig am Planen. So muss es sein.
Nehmen Sie die Sache wirklich so gelassen? Immerhin werden Sie das Festival nach dieser Saison 26 Jahre lang geleitet haben.
Wie man selbst damit umgeht, das ist dann wieder etwas anderes Das ist meine persönliche Herausforderung Aber es ist ja nicht so, dass man in der Schweiz nicht schön verabschiedet wird Das Festival versammelt zum Abschluss noch einmal wichtige Weggefährten aus all diesen Jahren. In Anspielung auf Beethoven haben wird das Konzert «Les Adieux» genannt
Die gleichnamige Beethoven-Sonate mündet allerdings in ein Finale mit dem Titel «Das Wiedersehen» oder «Le Retour» Geht es Ihnen bei dem Motto «Open End» zentral um das Paradox, dass solch ein «offenes Ende» eigentlich keines ist?
Das ist zum einen der Versuch die Situation des Übergangs in diesem Jahr auf den kürzesten Nenner zu bringen Eine Intendanz endet, aber die Zukunft des Festivals ist gesichert und damit im weitesten Sinne offen Und das Thema spiegelt sich, wie bei den früheren Saison-Mottos, auch konkret in vielen Programmen wider.
Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben aktuell zahlreiche Werke bedeutender Komponistinnen und Komponisten im Programm, die aus unterschiedlichen Gründen nicht fertig sind. Entweder, weil sie die Arbeit daran abgebrochen haben – wie Schubert bei der «Unvollendeten» Oder weil sie immer wieder neue Fassungen erstellt haben – wie Anton Bruckner oder Pierre Boulez. Oder weil ihnen, leider wohl der häufigste Anlass, der Tod sozusagen die Feder aus der Hand genommen hat. Eines der berühmtesten Beispiele ist Mozarts Requiem; aber auch Alban Bergs «Lulu» und Gustav Mahlers zehnte Sinfonie, die
Seit 1999 steht Michael Haefliger an der Spitze des Lucerne Festival Doch die Im Gespräch mit Christian Wildhagen erklärt Haefliger, wie man nach 26
Chailly gleich im Eröffnungskonzert in der Vervollständigung von Deryck Cooke dirigieren wird
Strenggenommen fällt das Beiseitelegen oder das fortwährende Überarbeiten eines Stücks aber in eine andere Kategorie als ein Fragment, das durch den Tod des Urhebers entsteht Wo liegt die Verbindung?
Für mich liegt sie in der Frage der Niederschrift, also in der Notwendigkeit, ein Projekt oder ein Werk in einer finalen Form auf dem Papier zu fixieren. Wir wissen aus der Kulturgeschichte, dass dies für viele Künstler oft ein intensiver Kampf mit sich selber ist. Wann ist der Endzustand erreicht, wo setzt man einen Schlusspunkt? Bei allen genannten Werken ist es aus unterschiedlichen Gründen nicht dazu gekommen.
Bei den notorischen Überarbeitern, die den Endpunkt immer aufs Neue infrage stellen, spricht man von einem «Work in progress» Ist das mehr als eine schöne Umschreibung dafür, dass jemand nicht zum Ende kommen konnte oder wollte?
Es geht tiefer Für Wolfgang Rihm, den langjährigen Leiter unserer Festival Academy, der leider im vergangenen Sommer verstorben ist, war das Konzept essenziell Er verstand Musik als etwas Organisches, das potenziell unaufhörlich weiterwuchert und -wächst. Oder denken Sie an Boulez, dem wir anlässlich seines 100. Geburtstags einen Schwerpunkt widmen. Für viele seiner wichtigsten Kompositionen hat Boulez unablässig neue Fassungen erstellt, ohne übrigens die früheren immer ausdrücklich zu verwerfen Eines der Kern- und Schlüsselwerke für diesen Sommer ist «Poésie pour pouvoir», das wir erstmals seit 1958 wieder aufführen.
Was macht das Stück zum Schlüsselwerk?
Boulez hat darin erstmals versucht, instrumentale und elektronische Klänge zu verbinden. Nach der Uraufführung in Donaueschingen hat er das Stück zurückgezogen, weil ihm die Möglichkeiten der damaligen Tontechnik nicht genügten. Marco Stroppa, unser Composer in Residence, hat die Tonspur nun mit Billigung der Boulez-Erben rekonstruiert und gleichzeitig auf das heutige, viel höhere Niveau bei elektroakustischen Zuspielungen gebracht. Durch die notwendige Aktualisierung entsteht hier eine besondere Form von «work in progress»
Postume Bearbeiter wie Stroppa, aber auch schon Franz Xaver Süssmayr beim Mozart-Requiem und Cooke bei Mahlers Zehnter, bringen zwangsläufig eigene Vorstellungen und Lösungsideen in die jeweiligen Kompositionen ein, um sie möglichst «vollendet» erscheinen zu lassen. Ist das nicht problematisch?
Bearbeiter müssen sich in das Vorhandene einfühlen, sie denken zunächst einmal das weiter, was vorliegt. Vom Prinzip her macht das inzwischen auch künstliche Intelligenz. Bloss ist KI nie so kreativ, weil sie bislang vor allem Kopien und immer vielfältigere Varianten von vorgegebenen Mustern erzeugt, aber keine eigenen schöpferischen Ideen entwickelt. Noch nicht
Bereits 2021 wollte man aus vorhandenen Entwürfen mithilfe von KI eine zehnte Sinfonie von Beethoven entwickeln Das Ergebnis klang aber nach drittklassigem Bonner Kleinmeister
Der Versuch an sich ist trotzdem interessant Vielleicht sollten wir uns grund-

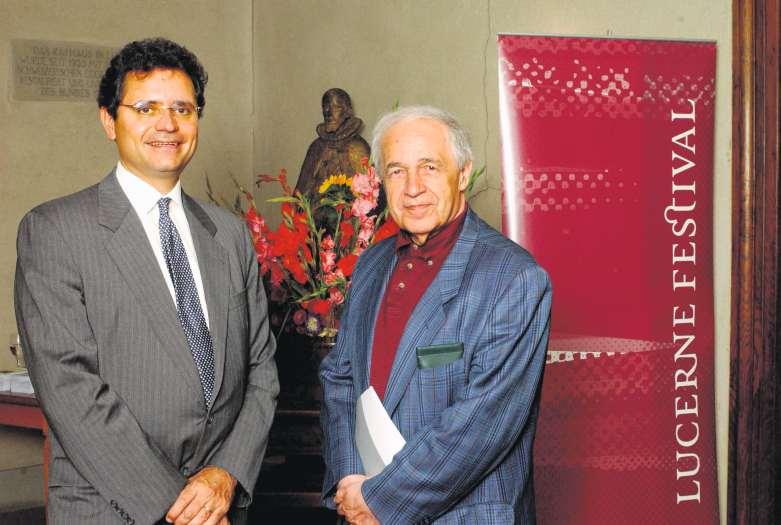
sätzlich von der Idee der «Vollendung» verabschieden. Das ist eine romantische Vorstellung und in erster Linie ein Gefühl. Wir empfinden eine Interpretation möglicherweise als «vollendet», weil sie so stimmig wirkt Jeder selbstkritische Musiker weiss jedoch, dass es die «perfekte» Wiedergabe nicht gibt, allenfalls Annäherungen. Ähnlich ist es mit Bearbeitungen: Sie sind Aufführungsfassungen, die ein sonst nicht spielbares Stück für die musikalische Praxis erschliessen. Gleichzeitig repräsentieren sie den jeweiligen Stand der Technik wie bei Boulez’ «Poésie pour pouvoir» und im besten Fall auch den der Forschung
zu einem Werk, die immer wieder Neues ans Licht bringt.
Wenn Aufführungsfassungen also in gewisser Weise Momentaufnahmen sind: Was halten Sie von dem radikalen Gegenkonzept, bei unfertigen Werken dort aufzuhören, wo die Niederschrift abbricht oder nicht mehr umsetzbar ist?
Bei Puccinis «Turandot» wird das häufiger gemacht, beim Mozart-Requiem auch. Die Wirkung ist oft verstörend Aber sie schärft unseren Sinn dafür, was überhaupt ein Ende ist Und es kommt auch darauf an wie es jeweils konzeptionell eingebettet wird. Das Mindeste
ist sicher ein Hinweis im Programmheft, damit man nicht kalt erwischt wird Und der Interpret kann den Abbruch auch gestalterisch so vorbereiten, dass man nicht in ein Loch fällt Ausserdem würde ich kein Dogma daraus machen. Ebenso interessant finde ich das Experiment, wenn andere Komponisten versuchen, etwas weiterzuführen und sogar etwas Neues dazuzuschreiben. Wie es Luciano Berio bei «Turandot» oder Friedrich Cerha bei Bergs «Lulu» getan haben. Das bedeutet gerade für etablierte Komponisten ein Risiko: Sie müssen das Eigene bis zu einem gewissen Grad hinter der Kreativität eines
Saison 2025 soll auf eigenen Wunsch die letzte seiner Luzerner Intendanz sein Jahren einen Abschied gestaltet, ohne einfach die Tür hinter sich zuzuwerfen.

«Es ging nie bloss um ein Konservieren des Status quo, sondern immer ums Weiterdenken. Davon sollte sich jede Kulturinstitution leiten lassen.»

Kollegen zurückstehen lassen. Diesen Mut bewundere ich gerade bei Cerha sehr
Woher rührt der Wunsch, dass ein Werk formal befriedigend beendet werden muss? Das kommt sicher zum einen aus Hörgewohnheiten. Wahrscheinlich wird es aber schon viel früher und grundsätzlicher in unserer Erziehung angelegt. Man muss etwas fertig machen, diese Maxime begleitet uns durchs Leben. Man macht die Schule fertig, eine Ausbildung, ein Studium. Ein Projekt muss abgeschlossen, ein Vertrag erfüllt wer-
den Das gesellschaftliche Zusammenleben basiert auf solchen organisatorischen Strukturen oder Denkmustern, und die sind in den seltensten Fällen offen angelegt Wir brauchen in vielen Prozessen einen Anfang und ein klares Ende das gibt uns nicht zuletzt ein Gefühl von Sicherheit
Sie selbst haben Klarheit geschaffen und das Ende Ihrer Luzerner Intendanz nach dieser Saison schon im November 2022 angekündigt. Was war der ausschlaggebende Impuls? Mir war schon vor dem Ausbruch der Pandemie 2020 klar, dass ich 2025 auf-
hören möchte Doch dann waren erst einmal die Herausforderungen zu bewältigen, die Corona für das Festival wie für den gesamten Kulturbetrieb mit sich gebracht hat. Wir mussten genau überlegen wann der richtige Zeitpunkt gekommen war meinen Entscheid öffentlich zu machen Damit setzt man nämlich unweigerlich etwas in Gang, das eine eigene Dynamik entwickelt und kaum mehr abgebrochen werden kann – von Diskussionen über die Zukunft der Institution bis zur Ausschreibung der Intendantenstelle und dem anschliessenden Berufungsverfahren. Ich wollte das nicht in einer so schwierigen
Situation wie 2020 anstossen, als wir das Festival wegen der Pandemie absagen mussten. Dennoch stand für mich nie zur Debatte dass 26 Jahre an der Spitze des Festivals das Maximum sind.
Warum sehen Sie da eine Grenze erreicht?
Mit dem regulären Auslaufen meines Vertrages wird es wirklich mehr als ein Vierteljahrhundert geworden sein –ohne dass ich das je so geplant hätte Noch länger fände ich fast schon unanständig. Natürlich hat man immer noch Ideen, man möchte Dinge weiterentwickeln oder neu aufstellen. Aber mit dieser Begründung immer weiterzumachen und dann irgendwann die 30 Jahre anzupeilen oder noch mehr, das fand ich grundfalsch. Das ist für keine Institution gut. Es braucht auch den Wechsel. Sonst entsteht eine Fixierung auf die jeweilige Leitungsperson oder ein Machtvakuum. Auch die Institution könnte stagnieren, weil sich jeder in der Organisation in eingespielten Abläufen eingerichtet hat. Es müssen neue Kräfte kommen, und wir müssen ja auch den natürlichen Wechsel der Generationen aufrechterhalten.
Wenn solche Wechsel anstehen, gibt es, gerade bei Kulturinstitutionen, zwei Strategien. Die eine ist disruptiv, macht im Extremfall Tabula rasa und baut institutionell wie personell das meiste neu auf. Die andere ist evolutionär und versucht, das Bestehende unter neuen Vorzeichen weiterzuentwickeln In Luzern hat man sich für die zweite Option entschieden. Wäre ein kompletter Neustart für das Festival undenkbar gewesen? Denkbar wäre es schon gewesen. Aber es ist das eine, so etwas theoretisch oder als Konzept einzufordern Es in der Praxis umzusetzen ist jedoch anspruchsvoll und ausgesprochen heikel. Gerade bei einem Festival, das sich, wie wir, weitestgehend privat finanziert Denn Sie müssen alle erst einmal für den neuen Kurs gewinnen: von den treuen Besuchern, die uns mit ihren Kartenkäufen wesentlich mittragen, bis hin zu den Sponsoren Auch in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Künstlern und Ensembles ist während der Jahre vieles gewachsen. Ich bin froh, dass dies nicht vorschnell geopfert wird.
Das heisst, es gab während der Regelung Ihrer Nachfolge die «heiligen Kühe» namens Lucerne Festival Orchestra und Academy, die nicht angetastet werden durften?
Die «Kühe» sind Ihre Wortwahl Doch es ging nie bloss um ein Konservieren des Status quo, sondern immer ums Weiterdenken Davon sollte sich jede Kultureinrichtung leiten lassen, die Kultur selbst bleibt ja nicht stehen So ist die Festival Academy beispielsweise zu Beginn meiner Intendanz aus den Meisterkursen hervorgegangen, die in Luzern schon länger gepflegt wurden
Das Engagement für die kommenden Generationen ist immer bedeutsamer geworden. Heute ist die Academy eine der grössten Einrichtungen für die Nachwuchsförderung und für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik. Das ist organisch gewachsen und dann immer weiter ausgebaut worden Ich bin sicher, mein Nachfolger wird es ähnlich handhaben. Und ich bin froh über den Zeitpunkt, ab dem er dies tun wird.
Wieso ist dies der richtige Zeitpunkt? Sind Sie doch ein bisschen amtsmüde? Das wird ja immer in solchen Situatio-
nen vermutet. Aber keine Sorge, ich hätte noch viele Pläne Es ist der richtige Moment, weil das Festival sehr solide aufgestellt ist und mit seinen Programmsparten ein äusserst klares Profil hat, auf dem man aufbauen kann Das Gegenteil wäre schlimm: wenn jetzt erst ein Troubleshooter nötig wäre, der seine konzeptionelle Energie zuerst darauf verwenden müsste, die Finanzen oder die Organisation in Ordnung zu bringen. Das ist alles nicht der Fall. Wir hatten auch Glück, dass wir die Folgen der Pandemie, die ja viele Institutionen lange gespürt haben, etwa beim Kartenverkauf, vergleichsweise schnell überwinden konnten.
Sie steigen, bildlich gesprochen, im vollen Galopp vom Pferd? Nicht ganz einfach, aber besser im vollen Galopp abspringen, als von einer lahmenden Mähre zu rutschen Ich würde mich grässlich fühlen, wenn ich jetzt wüsste, dem Festival ginge es nicht gut und wir kratzten sozusagen am Existenzminimum
Wird auch Wehmut dabei sein, wenn Sie das Festival-Ross davongaloppieren lassen? Ja, ich glaube schon. Es beinhaltet natürlich schon eine gewisse Melancholie, aber es ist auch eine grosse Freude dabei. Natürlich werde ich weiterverfolgen, was aus den Institutionen des Festivals wird Doch das liegt dann nicht mehr in meiner Hand, und ich werde mich auch nicht einmischen. Vielmehr freue ich mich darauf, irgendwann in diesen wunderbaren Saal zu gehen und ein Konzert im KKL zu geniessen, ohne dass ich das Ganze organisieren muss Wir konnten hier eine Menge aufbauen, das ist eine grosse Genugtuung Aber mir wurde schon in meinem Elternaus eine gewisse Bescheidenheit gegenüber beruflichen Erfolgen vorgelebt. Sie sprechen natürlich von Ihrem Vater, dem berühmten Schweizer Tenor Ernst Haefliger
Mein Vater hat am Abend auf der Bühne einen berührenden Tamino in der «Zauberflöte» oder einen Evangelisten in der Bach-Passion gesungen, und am nächsten Morgen war er da und hat den Müll geleert Wir konnten das als Kinder manchmal gar nicht fassen Heute weiss ich, dass diese Gelassenheit gegenüber dem Beruf meinem Bruder Andreas und mir überhaupt den Freiraum eröffnet hat, dass wir uns auch künstlerisch entwickeln konnten. Und vielleicht ist das sehr schweizerisch Wir lassen es gerne mal krachen, aber dann ist auch Schluss
Als Gustav Mahler 1907 als Direktor der Wiener Oper zurücktrat, hat er sich von der Belegschaft mit dem Satz verabschiedet: «Statt etwas Ganzem hinterlasse ich Stückwerk, Unvollendetes, wie es dem Menschen bestimmt ist.» Haben Sie das Gefühl, etwas Unvollendetes zu hinterlassen?
Nein, das Gefühl habe ich, ehrlich gesagt, eigentlich nicht Ob es am Ende eine runde Sache geworden ist oder ob eben auch manches offenbleibt, dürfen und sollen andere beurteilen. Ich kann aber meinen Platz in dem Bewusstsein räumen, dass hier vieles entstanden ist, das mittlerweile prägend für die Institution geworden ist. Aber es ist genauso wichtig, dass eine neue Person die Chance hat, das weiterzuentwickeln. Mit neuen Führungskräften, mit neuen künstlerischen Leitgedanken. Die Aussicht gefällt mir gut.
Die preisgekrönte Bratschistin Tabea Zimmermann präsentiert als Luzerner «artiste étoile» das ganze Ausdrucksspektrum ihres oft verkannten Instruments.
CORINA KOLBE
Die Künstlerin Tabea Zimmermann sucht stets Wege die aus ihrer Komfortzone herausführen. Routine beim Musizieren ist ihr ein Graus. «Mir geht es nicht darum, zu einer einzigen, ewig gültigen Interpretation zu finden. Von Komponisten habe ich gelernt, offen für alle Sichtweisen zu bleiben», sagt die Bratschistin, die als «artiste étoile» beim Lucerne Festival viele Facetten ihres Könnens zeigt. «Um die Musik lebendig zu halten, muss man Dinge in Zweifel ziehen und immer wieder andere Perspektiven einnehmen. Und dazu brauchen wir unbedingt LiveKonzerte, denn jede Tonaufnahme ist bereits ein abgeschlossenes Ganzes.» Auch altbekannte Werke erwachen zu neuem Leben, werden sie nur kritisch hinterfragt, davon ist die Bratschistin überzeugt Béla Bartóks Konzert für Viola und Orchester regte Zimmermann dazu an, einer Archäologin gleich weiter in die Tiefe vorzudringen. Der schwer an Leukämie erkrankte Komponist konnte das Stück, das er für den legendären Bratschisten William Primrose schrieb, vor seinem Tod im September 1945 nicht mehr fertigstellen. Sein Freund Tibór Sérly vervollständigte die fragmentarischen Skizzen, wobei er sich einige Freiheiten erlaubte Zimmermann nahm sich das Konzert erstmals mit 16 Jahren vor, kurz nach ihrem zweiten Wettbewerbssieg in Paris
Austausch mit Komponisten
«Ich fühlte mich diesem Werk gleich sehr nahe und habe es jahrelang in dieser Version gespielt», erinnert sie sich. Als 1995 ein Faksimile von Bartóks Manuskript veröffentlicht wurde war aber ein Wendepunkt erreicht. Mit dem Dirigenten David Shallon, ihrem damaligen Mann, begann Zimmermann, nach und nach die verborgenen Schichten des Werks freizulegen Daraus entstand eine eigene Fassung, die sie jetzt in Luzern mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Leitung von Maxim Emelyanychev aufführt Die Arbeit sei
herausfordernd: «Bartóks Handschrift lässt sich nur schwer entziffern, ausserdem ist die Reihenfolge der Sätze bis heute nicht abschliessend geklärt. Somit passt das Stück gut zum diesjährigen Festivalmotto ‹Open End›.»
Eine erste neue Spielfassung präsentierte Zimmermann schon 2019 bei ihrem Debüt am Lucerne Festival mit dem Royal Concertgebouw Orchestra unter Tugan Sokhiev Seither habe sie weiter an der Partitur gefeilt. Das Werk sei musikalisch so wertvoll, dass es sie nicht zur Ruhe kommen lasse. «Manche Bratschisten befassen sich vor allem mit Werken, die original für ihr Instrument geschrieben wurden. Nicht nur bei Bartók stösst man mit einer solchen Haltung rasch an Grenzen. Ich ziehe es immer vor das gesamte Œuvre und den Menschen der es geschaffen hat, im Blick zu behalten», sagt die im Jahr 2020 mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnete Künstlerin. Die Zusammenarbeit mit lebenden Komponisten ist für Zimmermann von grösster Wichtigkeit. Mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) spielt sie nun auch Dieter Ammanns neues Violakonzert «No templates», das im Januar in Basel uraufgeführt wurde «Im engen Austausch mit Komponisten habe ich miterlebt, wie sie darum ringen, ihre Gedanken aufzuschreiben. Das hat auch meine Sicht auf ältere Werke verändert», betont sie «Wann immer ich mich mit Partituren beschäftige möchte ich ebenso darum ringen, aus den schwarzen Pünktchen auf dem Papier Klänge zu entwickeln. Dieses Suchen nach der momentanen Wahrheit hat mich als Interpretin am stärksten geprägt.» Ammanns Stück wolle sie sich so frei annähern, als würde sie es selbst aus der Taufe heben. «Ich sehe mich als Hebamme neuer Kompositionen. Deswegen versuche ich mir die Werke so weit einzuverleiben, dass ich sie praktisch improvisierend spielen kann Sprechen kann ich über diese Erfahrungen allerdings erst, nachdem ich solche Stücke über Jahre mit verschiedenen Orchestern und in unterschiedlichen Sälen aufgeführt habe. Erst dann habe ich meine Sicht ausrei-
chend geschärft.» Ammann, der auch das Composer Seminar der Lucerne Festival Academy leitet habe eine rhythmische vom Jazz geprägte Sprache geschaffen, die viele Menschen ansprechen könne, erklärt sie «An seiner Musik schätze ich das Grenzüberschreitende, auf das ich mich als Interpretin gern einlassen möchte.»
Brücken zur Vergangenheit
Im Rahmen ihrer Luzerner Residenz freut sich Tabea Zimmermann, bei einem Kammerkonzert auf Solisten des von Claudio Abbado gegründeten FestivalOrchesters zu treffen. Das Programm spannt einen grossen Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart: von in Instrumentalklänge übersetzten Gesängen der Äbtissin Hildegard von Bingen bis zu zeitgenössischen Klängen. Die Bratschistin sieht eine Verbindung zwischen der Mystikerin und der im März verstorbenen russischen Komponistin Sofia Gubaidulina, deren von asiatischer Spiritualität geprägtes Stück «Garten von Freuden und Traurigkeiten» im KKL erklingen wird Zimmermann musiziert mit dem Flötisten Jacques Zoon und der Harfenistin Sarah Christ «Gubaidulinas Werk hat etwas Meditatives, ich empfinde es als Klangmalerei. Die Musik ist nicht stark rhythmisch orientiert Wir Interpreten können uns frei bewegen und treffen an einigen Punkten aufeinander.»
Interpretatorische Freiheiten bietet auch György Kurtágs Sammlung «Signs, Games and Messages» «Mit Kurtág verbindet mich eine lange Beziehung», sagt Zimmermann, die zahlreiche seiner Werke zur Uraufführung gebracht hat. In diesem Zyklus ist ihr das Stück mit dem schönen Titel «… eine Blume für Tabea …» gewidmet. «Mich begeistert bei Kurtág das Gestische das Suchende das Sprechende und auch die Notation, die mir als Instrumentalistin zusätzliche Freiräume gibt ‹Signs, Games and Messages› bietet Möglichkeiten, das Instrument als Stimme einzusetzen.»
Der menschlichen Stimme kommt wiederum eine besondere Rolle in Luciano Berios Stück «Naturale» zu,

Das Instrument zu ihrer eigenen Stimme zu machen, darin liegt für Tabea Zimmermann die Essenz ihres Musizierens.
in dem neben der Bratsche der Schlagzeuger Raymond Curfs mitwirkt. In dieser «tänzerischen Handlung», so der Untertitel, verarbeitet Berio sizilianische Melodien, dazu wird vom Band die Stimme eines Strassenverkäufers aus Palermo zugespielt. Zimmermann fasziniert, dass dessen raue Naturstimme gewissermassen eine Brücke zur Vergangenheit schlägt: «Es entsteht ein Dialog über die Zeit hinweg, der uns noch intensiver mit Berio verbindet. Wenn ein Sänger von heute den Part übernähme wäre das ganz anders.» Das Streichinstrument komme der Stimme des Menschen hier besonders nahe, meint sie «Man spielt nicht einen präzisen Ton wie auf einer Taste Vieles wird durch ein Glissando, eine kleine Verzierung oder ein Pizzicato mit dem kleinen Finger ausgedrückt. Das Tonspektrum wird dadurch eindrucksvoll erweitert.»
Das Instrument zu ihrer eigenen Stimme zu machen, darin liegt für Tabea Zimmermann die Essenz ihres Musizierens «Ich möchte nicht die Bratsche in den Vordergrund rücken, sondern mit ihr vor allem den Klang übersetzen. Sie ist mein Instrument, aber die Musik geht darüber hinaus – sie ist immer noch viel grösser farbiger und gestenreicher.»
Zum zweiten Mal gastiert das Ukrainian Freedom Orchestra am Lucerne Festival – auch diesmal mit einem hochpolitischen Programm
CORINA KOLBE
«Bum-Bum-Bum-Bom …»: So begannen im Zweiten Weltkrieg die deutschsprachigen Nachrichtensendungen im Londoner Rundfunk. Die vier dump-
fen Trommelschläge entsprachen dem Morsecode des Buchstabens «V», der für «Victory» steht. Das Sendezeichen, ein Symbol des Widerstands gegen die Nazis, wurde bald mit dem berühmten Kopfmotiv aus Beethovens 5. Sinfo-

nie in Verbindung gebracht. Ironie der Geschichte:Ausgerechnet eines der vom Hitler-Regime für völkische Propaganda vereinnahmten Werke diente dessen Gegnern dazu, dem Dritten Reich die Stirn zu bieten Auf die Symbolkraft von Beethovens Fünfter setzt nun auch das Ukrainian Freedom Orchestra um seinen Durchhaltewillen zu demonstrieren.
Die Gräuel des Krieges
«Zum vierten Mal seit Russlands brutaler Invasion gehen wir auf Tournee, um für das Recht der Ukraine auf Freiheit einzutreten» sagt die Dirigentin Keri-Lynn Wilson, die den Klangkörper im Frühjahr 2022 gegründet hat. Dem Orchester, das von der Metropolitan Opera in New York, der polnischen Nationaloper in Warschau und dem ukrainischen Kulturministerium unterstützt wird, gehören geflüchtete Musiker, ukrainische Mitglieder europäischer Orchester und in der Ukraine lebende Instrumentalisten an Wilson,
die Ehefrau von Met-Intendant Peter Gelb, hat selbst ukrainische Wurzeln. Im August kehrt das Ukrainian Freedom Orchestra nun ans Lucerne Festival zurück, wo es vor zwei Jahren bereits mit Beethovens «Eroica»-Sinfonie gastierte Auf dem Programm steht neben Beethoven auch ein Stück des 1981 in Kiew geborenen, international preisgekrönten Komponisten Maxim Kolomiiets
Die Suite aus seiner Oper «Die Mütter von Cherson» kommt erstmals in der Schweiz zur Aufführung Das gesamte Bühnenwerk, zu dem der amerikanische Dramatiker George Brant das Libretto geschrieben hat, wird im Oktober 2026 in Warschau uraufgeführt.
Die Oper handelt vom Leid der Menschen, die mit ihren Familien die Gräuel des Krieges am eigenen Leib erfahren müssen. Zwei Frauen aus der umkämpften Stadt Cherson begeben sich auf eine gefährliche Reise, um ihre Töchter zu retten, die von den Russen auf die Krim verschleppt worden sind «Die Welt soll nicht vergessen, was gerade vor sich
geht. Wir wollen sie mit den Mitteln der Kunst daran erinnern», sagte Peter Gelb der «New York Times»
Ein unabgeschlossenes Kapitel Die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen wird in dem Konzert ausserdem die «Vier letzten Lieder» von Richard Strauss singen. Die auf Gedichte von Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff komponierten Lieder kreisen um die Themen Abschied und Tod. Strauss schrieb sie 1948 in der Schweiz, wo er nach Kriegsende vorübergehend mit seiner Frau Zuflucht gefunden hatte. Der durch seine Nähe zum NS-Staat kompromittierte Komponist, der im folgenden Jahr im Alter von 85 Jahren starb, erlebte die Londoner Uraufführung mit der Sängerin Kirsten Flagstad unter Leitung von Wilhelm Furtwängler nicht mehr Seine Rolle im Unrechtsstaat ist bis heute ein unabgeschlossenes Kapitel in seiner Biografie und Gegenstand von Diskussionen.
CHRISTIAN WILDHAGEN
Der Anfang eines Musikstücks muss sitzen, aus ihm ergibt sich alles Folgende Auch Komponisten kennen daher die Angst vor dem leeren Blatt. Und auf die grandiose Idee, ein Werk mit einem simplen «Ta-ta-ta-taaa» zu beginnen wie Beethoven seine fünfte Sinfonie muss man erst einmal kommen Spätestens seit dieser Titan die Bühne der Musikgeschichte betreten hat, stellt sich kreativen Köpfen jedoch auch die Frage:Wie hört man ebenso originell wieder auf?
Bis dahin gab es in der Musik einen allgemeinverständlichen Code, Klauseln oder Kadenzen, die Hörenden unmissverständlich klar machten dass alles gesagt sei. Der Unruhestifter Beethoven hat die Axt auch an diese Konvention gelegt, indem er sie raffiniert umging oder demonstrativ verweigerte Oder indem er unser Bedürfnis nach einem befriedigenden Abschluss so exzessiv bediente wie am Ende der besagten fünften Sinfonie Mit vollem Orchester hämmert er den Hörenden die angepeilte Zieltonart dort regelrecht ein. In schlechten Aufführungen gerät das manchmal an den Rand zur Parodie. Wie aber sollte man nach Beethoven zum Ende kommen, ohne die Konvention zu bedienen? Beethoven-Bewunderer wie Wagner und Richard Strauss trieb das Problem um – die oft überraschenden Aktschlüsse ihrer Opern belegen es Unter den Sinfonikern war wohl Gustav Mahler der hellhörigste «Finalist»: Bei ihm wird jeder Schluss zu einem mit Bedeutung aufgeladenen Moment Seine Werke ziehen sich deshalb wie ein roter Faden durch das Programm des Lucerne Festival das seine Saison ebendiesem Thema widmet: Wie hört man auf? Und welche Botschaft vermittelt solch ein Ende?
Hintersinnige Pointen
In den ersten drei Mahler-Sinfonien erscheinen die Schlüsse noch recht eindeutig Die Dritte etwa, Mahlers grandiose Schöpfungssinfonie, endet mit den sattesten, strahlendsten D-DurAkkorden, die je komponiert wurden Die Musik ist auf ihrem Weg von den Uranfängen des Kosmos bis hinauf in den Himmel sozusagen am Ziel angelangt. Ähnlich hymnisch schliesst, ihrem Thema gemäss, schon die Zweite, die «Auferstehungssinfonie»: «Zu Gott wird es dich tragen», verkündet der Chor am
Berühmte Anfänge in der Musik gibt es zuhauf Doch seit Beethoven sind auch Schlüsse eine Herausforderung für Komponisten. Bei Gustav Mahler werden sie zum entscheidenden Moment


Schluss zu machtvollen Orgelklängen. Doch mit der Vierten wird es hintersinnig Der Solosopran singt im Finalsatz eigentlich vom Erwachen paradiesischer Freuden – Mahler hat in fast allen seinen Werken solche Jenseitsvorstellungen beschworen, am anschaulichsten im zweiten Teil der Achten, die den Übergang der Seele in «höhere Sphären» imaginiert Was aber tut die Musik hier am Ende der Vierten? Statt zu erwachen, versinkt sie leise in der Tiefe – und bringt dadurch listig zum Ausdruck, dass die Töne des Himmels wohl doch nicht für unsere Ohren bestimmt sind
Der finnische Dirigent Klaus Mäkelä hat sich vor zwei Jahren mit der doppelbödigen Vierten als Mahler-Interpret am Festival vorgestellt. Mit dem Amsterdamer Concertgebouw-Orchester, dem der Shooting-Star ab 2027 als Chefdirigent
vorstehen wird, lässt er in dieser Saison nun die fünfte Sinfonie folgen, und auch deren Ende hat es in sich. Spätestens hier wird deutlich, dass Mahler das Finalproblem, das Beethoven mit seiner Fünften auf die Spitze getrieben hatte, nun seinerseits auf originelle Weise angeht; die beiden Werke verbindet ein Netz aus Bezügen. Allerdings erkannte Mahler, dass Beethovens exzessiver Triumphschluss kaum zu überbieten war – es sei denn als subversive Parodie wie später bei Schostakowitsch.
Mahler wählt einen anderen Weg: Er lässt sein Finale auf einen himmelstürmenden Choral zusteuern, der bereits im zweiten Satz angeklungen, dort aber in sich zusammengebrochen war Hier nun scheint der Triumph zu gelingen, doch auf dem Höhepunkt wechselt der Charakter abrupt vom
Erhabenen ins Übermütige:Als stürmte eine Truppe lärmender Musikanten den Konzertsaal, komplimentiert sich die Musik in wildem Durcheinander selbst hinaus Das ist gar nicht comme il faut, aber ein prächtiges Beispiel für Mahlers oft verkannten Humor.
In die Stille In Mahlers Spätwerk, das dieses Jahr vollständig in Luzern erklingt, gibt es für Scherze nur noch wenig Raum Der Ton dieser letzten Dreiergruppe ist ernst, kompromisslos, von existenzieller Dringlichkeit. Mit dem «Lied von der Erde» gibt Simon Rattle am 23 August seinen Einstand am Pult des Lucerne Festival Orchestra. Und als wäre dieses Debüt allein nicht spannend genug, hat Rattle sogleich ein «offenes Ende»
Man glaubt es kaum: Schon seit 40 Jahren ist Cecilia Bartoli ein Publikumsmagnet.
MARIANNE ZELGER-VOGT
Es war eines jener Debüts, bei denen man sofort spürt: Hier wohnt man einem Ereignis bei, dem Beginn einer grossen Karriere. Welch hinreissendes Temperament, welch aussergewöhnliche Intensität des vokalen und mimischen Ausdrucks! In der Saison 1988/89 sang Cecilia Bartoli ihre erste Partie im Zürcher Opernhaus, die Hosenrolle des Cherubino in Mozarts «Figaro» Dieser Einstand bedeutete für die blutjunge Römerin bereits eine entscheidende künstlerische Weichenstellung: Durch Nikolaus Harnoncourt, den Dirigenten, lernte sie die historische Aufführungspraxis kennen, die ihr Wirken fortan prägen sollte Zunächst erarbeitete sie sich mit Opernpartien von Mozart, Händel und Rossini den Grundstock ihres Repertoires im Mezzosopranfach Bald meldeten sich die grossen internationalen Bühnen und Festivals;noch im selben Jahr schloss sie einen Exklusivvertrag mit dem Label Decca ab – Resultat: rund 12 Millionen verkaufte Tonträger. Nicht einmal zwei Covers von durchaus eher zweifelhaftem Geschmack, auf denen Bartoli sich als glatzköpfiger Mönch («Mission») und mit angeklebtem Bart

eine
à la Conchita Wurst («Farinelli») porträtieren liess, konnten dem aussergewöhnlichen Erfolg Abbruch tun.
Lust auf Raritäten
Bartoli hätte sich mit ihrem Starstatus begnügen können.Vielmehr aber nutzte sie ihre Position, um selbst entwickelte
Projekte zu realisieren. In Zürich hat sie sich immer wieder für Raritäten stark gemacht, etwa «Nina» von Paisiello, «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» von Händel, «Clari» von Halévy «Le Comte Ory» und «Otello» von Rossini. Betrachtet man umfassend die Summe
ihrer Einspielungen und Auftritte, stellt sich der Eindruck ein, Bartolis Wirkungsfeld kenne keine Grenzen. Es gibt sie sehr wohl, und sie weiss darum. Ihre Stimme ist tragend und unverwechselbar aber nicht voluminös Auftritte in der New Yorker Met oder in der Mailänder Scala waren zwar für die Weltkarriere unabdingbar, doch viel angemessener sind für Bartolis Kunst kleinere Häuser, vor allem aber Originalklang-Ensembles mit tieferer Stimmung Dies erst hat es ihr ermöglicht, in den letzten Jahren auch die Titelpartie von Bellinis «Norma» zu singen und die Abgrenzung zwischen Mezzo-
zu gestalten: «Der Abschied», das letzte dieser sechs sinfonisch überhöhten Orchesterlieder, mündet in einen schwebenden Klang, schillernd zwischen Dur und Moll, der die finale Auflösung gänzlich verweigert Dazu singt die Mezzosopranistin – in Luzern Rattles Frau Magdalena Kožená – siebenmal das Wort «ewig».
Gut eine Woche später dirigiert Kirill Petrenko am Pult der Berliner Philharmoniker einen ähnlich epochemachenden Schluss: Mahlers Neunte verklingt in einem minutenlangen Auflösungsprozess in dem die Musik ihr eigenes Verstummen zelebriert. Manche Zuhörer hören darin einen Ausdruck tiefster Resignation; andere empfinden diesen Ausklang als visionäre und hoffnungsvolle Öffnung – in die Stille hinein. Mahler selbst wollte seinen Weg in die Moderne mit einer zehnten Sinfonie weitergehen. Doch er konnte das lückenlos in fünf Sätzen entworfene Stück nicht mehr ausarbeiten. Dies haben schliesslich postum etliche Bearbeiter getan. Als gelungenster Versuch gilt die «Performing Version» von Deryck Cooke. Riccardo Chailly bringt sie zur Eröffnung mit dem Festivalorchester zur Aufführung
Dies ermöglicht die Begegnung mit einem durch und durch autobiografischen Werk: Die Zehnte widerspiegelt den seelischen Ausnahmezustand Mahlers, nachdem er 1910 von der Affäre seiner Frau Alma mit dem späteren Bauhaus-Gründer Walter Gropius erfahren hatte Die Krise liess ihn zu Klängen einzigartiger Radikalität und Emotionalität finden. Und abermals zu einem besonderen Schluss: Nach rund 80 Minuten verklingt die Musik mit einem gewaltigen Seufzer, der in sich die gesamte Bandbreite widerstreitender Gefühle verdichtet. «Für dich leben! Für dich sterben! Almschi!», schrieb Mahler dazu in die Noten. Acht Monate später war er tot. Doch das Ringen der Musikwelt mit diesem gewaltigen Torso wird weitergehen, Ausgang offen.
Bartoli hat sich immer wieder für Raritäten stark gemacht.
und Sopranfach aufzuheben. So hat sie längere Zeit mit La Scintilla, dem Barockorchester des Zürcher Opernhauses, zusammengearbeitet; seit 2016 sind es die von ihr gegründeten Musiciens du Prince – Monaco Von ihrem künstlerischen Verantwortungsbewusstsein, das weit über persönliche Ambitionen hinausweist, zeugt auch die im Jahr 2007 von ihr gegründete Bartoli-Stiftung, die sich der Förderung von Musikforschung und der Verbreitung von Musik in einem weiten Sinn widmet. Wie schon ihre Namensgeberin, die Heilige Cäcilie wirkt Bartoli damit gleichsam als Schutzpatronin der Musik.
Die Intendantin
2010 wurde Bartoli als künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele ab 2012 nominiert Ihnen hat sie seither mit jährlich wechselnden thematischen Schwerpunkten – von Händel, Gluck, Mozart, Rossini bis zu Bernsteins «West Side Story» – zu einem starken eigenen Profil verholfen. Und zusätzlich zu ihren Salzburger Verpflichtungen hat Bartoli 2023 die Intendanz in der Opéra de Monte-Carlo übernommen und verhilft nun dem Opernleben an der Côte d’Azur zu neuem Glanz.
40 Jahre nach ihrem Bühnendebüt in Rom mit der Rosina in Rossinis «Barbiere di Siviglia» und 30 Jahre nach ihrem ersten Auftritt beim Luzerner Musikfestival wird Bartoli am 21 August mit den Musiciens du Prince wieder im KKL zu erleben sein, in einer konzertanten Aufführung der populärsten aller Rossini-Opern
Nach der Erdbebenkatastrophe von Fukushima schufen der Pritzker-Preisträger
Arata Isozaki und der britisch-indische Künstler Anish Kapoor gemeinsam die erste aufblasbare Konzerthalle der Welt Jetzt kommt sie erstmals nach Luzern
besteht aus einer PVC-Membran, deren Statik allein der Luft bedarf und ohne zusätzliche Tragkonstruktion auskommt. Pumpen halten das Gebilde in Form und sorgen für Zu- und Abluft Der Aufbau benötigt theoretisch nicht mehr als zehn Minuten. Doch um die empfindliche Kunststoffhülle zu schonen, erfolgt die Aufrichtung behutsam: Die «Ark Nova» erhält ihre pralle Form durch langsames Aufblasen während mehrerer Stunden
Ein ephemeres Gebilde
Es war ein eigentümlicher Anblick: Auf den sanften Hügelzügen oberhalb der kleinen Stadt Matsushima im Nordosten Japans erhob sich vor Jahren ein merkwürdiges Gebilde Dass sich hier, in einer der malerischsten Gegenden Japans, ein UFO abgesetzt haben könnte, würde niemanden weiter verwundern. Die idyllische Bucht mit ihren rund 260 mit Kiefern bewachsenen Inseln wurde schon vom grossen HaikuDichter Bashobesungen. Das fremdartige Ding aber war von Menschenhand geschaffen Es hatte die Form eines Ovals und erinnerte – wegen seiner zwischen Braun und dunklem Rot changierenden Farbe – an eine riesige Aubergine Das Objekt gibt es noch. Und bald ist es in der Schweiz zu bewundern, nämlich vom 4 bis zum14 September in Luzern Geschaffen haben es der britischindische Künstler Anish Kapoor und der Ende 2022 verstorbene Architekt Arata Isozaki. Bei dem riesigen und wunderschön geformten «Gemüse» handelt es sich denn auch um ein hybrides Objekt zwischen Architektur und Kunst. Vor allem aber ist das faszinierende Ding, was seine Funktion betrifft, die erste mobile Konzerthalle der Welt
Arche der Hoffnung
Die sonderbare Halle nennt sich «Ark Nova» und hat eine schöne Geschichte Sie war eine Arche der Hoffnung für die Überlebenden der Fukushima-Katastrophe von 2011 Damals brachten die Fluten des Tsunami in der Gegend bei Sendai und Fukushima eine der grössten Naturkatastrophen über die Menschen, die Japan je erlebt hat.
Die Konzerthalle war eine Idee von Michael Haefliger, dem Intendanten des Lucerne Festival Er wollte die Menschen in der Krisenzone mit einem kulturellen Hilfsprojekt unterstützen. Die Halle sollte obdachlos Gewordenen einen Ort bieten, an dem sie Kultur erleben konnten.Aufgrund ihrer aubergine-pinken Farbgebung vermittelt diese atmende Arche tatsächlich Geborgenheit und Wärme
Die Klangwolke
Im Herbst 2013 war sie Schauplatz einer vom Festival organisierten Reihe von Konzerten und anderer kultureller Veranstaltungen. Nun reist die «Ark Nova» nach verschiedenen Stationen in Japan an den Vierwaldstättersee Die aufblasbare, mobile Konstruktion bietet etwas mehr als 300 Personen Platz
Der Bodenbelag und die Sitzbänke sind aus Zedernholz gefertigt, das ausschliesslich von totem Gehölz stammt –angeschwemmt vom Tsunami Die Hülle der beinahe schwebenden Konzerthalle
Das Provisorische ist ein wesentliches Merkmal der Baukunst des renommierten Architekten Arata Isozaki, Träger des Pritzker-Preises Sein Mantra lautete stets, dass «unsere Städte nur für einen flüchtigen Moment existieren» Angesichts der Zerstörung von Fukushima hatte sich diese Aussage auf bittere Weise bewahrheitet. Für wichtiger als Raum und Zeit erachtete Isozaki den Zwischenraum und die Zwischenzeit –ein Gedanke, den er in seinen Texten über das japanische Raumprinzip des «Ma», des «Dazwischen», immer wieder reflektierte Der Raum als immer neu zu füllende Möglichkeit – das gilt auch für das ephemere Gebilde der «Ark Nova» Anish Kapoor wiederum ist international bekannt für seine organischen Formen. Seine Riesenskulptur «Cloud Gate» in Chicago ist die grosse Attraktion im zentral gelegenen Millennium Park Wie ein auf Hochglanz polierter Donut spiegelt das silbern glänzende Objekt die Wolkenkratzer der Umgebung Die 2004 errichtete Skulptur aus Stahl – liebevoll auch «The Bean» genannt – weist wie die «Ark Nova» ein Innenleben auf: Die bogenförmige Hochwölbung auf der Unterseite bietet einen etwa drei Meter hohen Durchgang.
In dieser verblüffenden, spiegelnden Höhle lassen sich bestens Selfies schiessen. Mit solch optischen Phänomenen strebt Kapoor eine Erfahrung von Transzendenz an Der 1954 in Mumbai geborene Künstler ist ein Virtuose des Immateriellen In seinen Skulpturen sucht er nach der Entmaterialisierung der Materie. Berühmt sind seine konkaven, in Edelstahl und Lack geschaffenen Rundbilder deren optische Sogwirkung das Bild an der Wand gleichsam verschwinden lässt Der Blick verschwimmt in den Farben dieser runden Spiegelbilder – am Ende sieht man nur noch ein Loch in der Wand
Die «Ark Nova»-Konzerthalle erinnert in Grösse und Farbe zudem an die riesige braunrote Kugel, die Kapoor 2020 für die Rotunde im Eingangsbereich der Pinakothek der Moderne in München geschaffen hat.
Die Installation war 14 Meter hoch, 22 Meter breit – und erstreckte sich über drei Etagen. Der immense, monochrome Hohlkörper – ein Ballon, der die Architektur fast zu sprengen schien – zielte auf die sinnliche Wahrnehmung von Innen und Aussen von Materialität und Immaterialität Mit dieser Kugel zelebrierte Kapoor die Wirkung des nicht sichtbaren Raumes – ein Werk, das Objekt war und zugleich, wie Kapoor es nennt, ein «Nichtobjekt»
Akustischer Raum
Das gilt auch für die «Ark Nova»: ein beinahe immaterielles Objekt, das dennoch als Raum erfahrbar wird – und vor allem als akustischer Raum funktioniert Während der Luzerner Konzerttage werden darin nicht weniger als 35 Konzerte aus den Bereichen Pop, Folk, Jazz und Weltmusik stattfinden, die das Festivalprogramm erweitern (siehe rechts). Dann wird dieses wunderschöne Zelt gleichsam zur Klangwolke
Dessen Genese und Nutzung werden übrigens in einer Ausstellung im Museum Hans Erni (bis 12. Oktober 2025) dokumentiert: Modelle und Pläne, Fotografien und Filme erläutern das Konzept dieser temporären Veranstaltungsarchitektur bis ins Detail
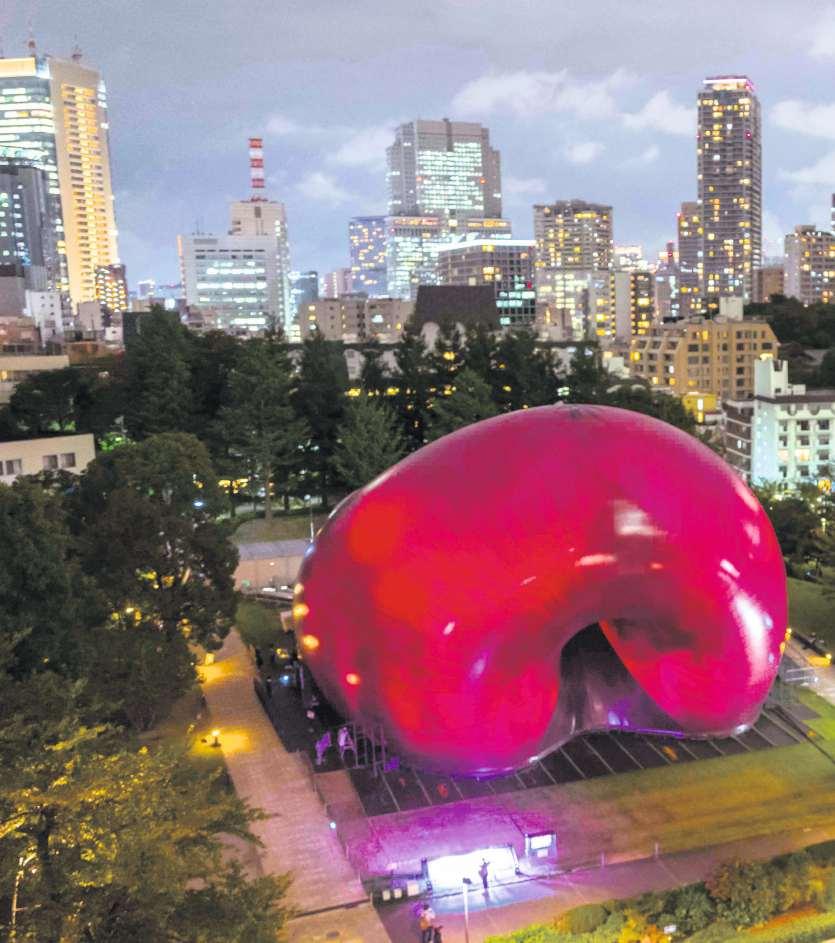


sergewöhnliche Konzerte bieten.
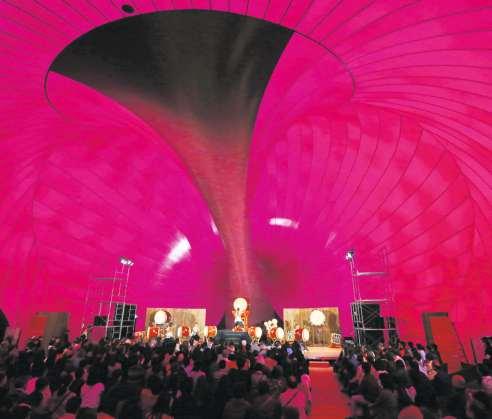

Die begehbare Skulptur ist nach einer Japan-«Tournee» vielleicht zum letzten
Mit der «Ark Nova» eröffnet das Festival in diesem Jahr eine spektakuläre zweite Konzertbühne am Vierwaldstättersee Das ungewöhnliche Programm in der luftigen Arche reicht vom klassischen Beethoven-Septett bis zur Geisterbeschwörung und ist Wagnis und Chance zugleich
DOROTHEA WALCHSHÄUSL
Superlative gefragt? Die «Ark Nova», die Mitte August auf der Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus der Schweiz zunächst mit Luft, ab Anfang September dann mit musikalischem Leben gefüllt wird, liefert davon reichlich. Schliesslich handelt es sich bei dem vonAnish Kapoor entworfenen Kunstobjekt um die erste aufblasbare und damit mobile Konzerthalle der Welt Zudem weckt das Objekt nicht nur von aussen mit seinen organischen Formen und den warmen Farbtönen zwischen Rot, Violett und Rosa vielerlei Assoziationen – es wartet auch im Innern mit einem einzigartigen Raumerlebnis auf Einen solch aussergewöhnlichen Raum mit Musik zu füllen, ist Wagnis und Chance zugleich. Wagnis deshalb, weil Show und Spektakel der durchaus dominanten Raumwirkung einiges an originellen Konzepten entgegensetzen müssen, um dagegen zu bestehen. Doch genau darin liegt auch die Chance: Der Raum kann selbst zum Mittler werden – und in seiner aufsehenerregenden Gestalt auch Menschen anziehen, die sich bislang von traditionellen Konzertsälen ferngehalten haben.
Unkonventionelle Programme
«Ein grosses Konzerthaus wie das KKL wirkt auf manche Menschen wie ein Tempel Tagsüber ist es oft geschlossen, und abends steht Security vor dem Eingang, während Menschen in edler Konzertkleidung durch die Türen gehen. Das schreckt viele ab», sagt Christiane Weber Aus Sicht der Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros beim Lucerne Festival bietet sich mit der «Ark Nova» die Möglichkeit, dieses starre Setting aufzubrechen – und mit einer niederschwelligen Dramaturgie Menschen quer durch die Generationen zu erreichen.
Das Programm soll sich dementsprechend sowohl an neugierige Ersthörerinnen und Ersthörer richten wie an langjährige Festivalbesucherinnen und -besucher «Was in der ‹Ark Nova› passieren
wird, unterscheidet sich vom restlichen Festival», unterstreicht Weber Der Rahmen sei legerer, die Konzerte mit etwa 45 Minuten bewusst kürzer gehalten als die Programme im KKL. «Wir haben das Programm so konzipiert, dass es möglichst leicht zugänglich ist und sich auch Leute trauen, die sonst selten oder gar nicht in Konzerte gehen», sagt Weber Dazu beitragen sollen auch niedrige Eintrittspreise und ein breiter stilistischer Mix – dargeboten von Weltstars ebenso wie von passionierten Laienmusikerinnen und -musikern.
Ob dieser Ansatz der bewussten Öffnung und Grenzerweiterung in der Praxis funktioniert, wird sich ab dem 4. September zeigen, wenn die «Ark Nova» ihre Pforten öffnet.Wer den Weg in den futuristischen Luftbau am Ufer des Vierwaldstättersees findet, wird zahlreichen Werken und Programmkonzepten begegnen, die man so nur ganz selten am Lucerne Festival erlebt.
Von Japan bis nach Kuba
Als die «Ark Nova» erstmals nach dem verheerenden Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima in Japan aufgeblasen wurde, lautete der Slogan «Music is Hope»: Hoffnung und Zuversicht stiften angesichts der Katastrophe, Halt bieten inmitten des Chaos – das waren damals die Ziele des Projekts Am idyllischen neuen (und voraussichtlich letzten) Standort in Luzern bedeutet die Weiterführung dieser Botschaft eine Herausforderung Doch einige Programmpunkte knüpfen daran an etwa verschiedene Sozialprojekte denen eine besondere Bühne geboten wird – beispielsweise dem Surprise-Chor, einer Gruppe von Strassenzeitungsverkäuferinnen und -verkäufern, oder dem Chor Prostir, in dem Geflüchtete aus der Ukraine gemeinsam singen. Zudem gibt es ein Konzert mit Kindern und Jugendlichen aus dem Superar-Förderprogramm, das jungen Menschen kostenlosen Zugang zu Musikkursen ermöglicht. Der Entstehungsgeschichte der «Ark Nova» will man durch einen engen Japan-Bezug Tribut zollen. Die Pianistin Yuka Funabashi erinnert in einer «Hommage à Ryuichi Sakamoto» an den 2023 verstorbenen Filmkomponisten, der 2013 bei der Eröffnung der «Ark Nova» mitgewirkt hat.Ausserdem interpretiert das Schwesternpaar Mari und Momo Kodama, ein international erfolgreiches Klavierduo, eine eigene Version von Peter Tschaikowskys Ballettmusik zu «Dornröschen»
Die Konzerte in der «Ark Nova» sind nicht nur bewusst zugänglich, sondern
auch ausgesprochen vielfältig gehalten In ihnen wechseln die Genres ebenso wie die beteiligten Künstlertypen – darunter auch etliche bekannte Namen. Igor Levit spielt Schubert und Schumann, das Ensemble der Wiener Philharmoniker tritt mit Beethovens bekanntem «Septett» auf, der georgische Pianist Giorgi Gigashvili, diesen Sommer auch in der Debüt-Reihe des Festivals zu erleben, präsentiert Folk Music, und die Hornistin Sarah Willis musiziert mit ihrer Band aus Havanna. Ergänzend gibt es ein SonnenaufgangKonzert mit Solistinnen der Lucerne Festival Academy, einen Bachata-PaartanzWorkshop und sogar eine Art musikalische Geisterbeschwörung, bei der die Performerin Winnie Huang Karlheinz Stockhausens «Inori» ausdeuten wird
So klingt die Schweiz
Ein wilder Mix, keine Frage Doch die Botschaft lautet: Fast alles ist möglich im luftigen Gewölbe der «Ark Nova», und neue Klangerfahrungen sowie stilistische Grenzüberschreitungen sind ausdrücklich erwünscht. Horizonterweiterung ist auch bei jenen zahlreichen Konzerten die Devise, die sich der Schweizer Musiktradition widmen – und dabei die unterschiedlichen Landesteile und -sprachen zum Klingen bringen. Der Trompeter Reinhold Friedrich spielt zusammen mit der Pianistin Eriko Takezawa, der Flötistin Andrea Loetscher und Intendant Michael Haefliger (an der Kuhglocke!) Musik aus den Bergen. Das Ensemble Vent Negru bringt Musik aus dem Tessin auf die Bühne das AcousticTrio Ursina interpretiert Folk und Pop aus Graubünden, und die Gruppe Vox Blenii aus dem Valle di Blenio im Tessin präsentiert uralte Volkslieder Zum Abschluss gibt es zudem einen ganz der Musikstadt Luzern gewidmeten Tag. Eine reizvolle Unwägbarkeit gibt es obendrein: Wie der einzigartige Raum der «Ark Nova» die Konzerteindrücke beeinflussen wird, lässt sich nur bedingt voraussagen. Dass alles ein wenig anders wirken wird als in der gewohnten Umgebung eines Konzertsaals, ist jedoch gewiss «Es ist ein sehr weicher Raum mit spezieller Atmosphäre, die sicher auch die Wahrnehmung der Musik beeinflusst» sagt Christiane Weber. Je nach Tageszeit leuchten die Wände in unterschiedlichen Farbnuancen, vielleicht dringt das Tuten eines Schiffshorns durch die Membran – und für 45 Minuten betritt man eine eigene Welt. «Man ist wie eingepackt in diesem Raum», sagt Weber. «Mir vermittelt die ‹Ark Nova› durch ihre Farbe und Form ein Gefühl der Geborgenheit.»
Wer in die Welt von Marco Stroppa eintaucht, stösst auf viele Schlagworte. Der 1959 in Verona geborene Komponist und Musikforscher wirke, liest man, an der Schnittstelle zwischen instrumentaler und elektronischer Musik, er entwerfe Klangarchitekturen und musikalische Räumlichkeiten. Alles richtig –aber Stroppas Musik changiert genauso faszinierend zwischen Sinn und Sinnlichkeit, sie ist poetisch und wird zugleich oft von einem gesellschaftlichen Impetus getragen. Das verrät auch die Werkschau, die ihm das Festival diesen Sommer widmet. Manche Werktitel verweisen auf Literaten, so das neue AkkordeonStück «far and wee» Es zählt zum Zyklus «The Enourmous Room», inspiriert von E. E. Cummings.
In «Osja. Seven Strophes for a Literary Drone» von 2005/19 wird hingegen Joseph Brodsky gewürdigt, der als «Parasit» in Sowjetrussland verfolgt wurde Die «Literarische Drohne» das ist sein Gedicht «How to extend a monument to a lie» In Zeiten von Fake News atmet dieses Werk eine ähnliche Dringlichkeit wie «La vita immobile» von 2014 In den Lockdowns während der Corona-Pandemie wurde direkt erfahrbar, was passiert, wenn das Leben stillsteht: ein Stück der Stunde Doch wie passt das alles zusammen? Und warum wird in Luzern die StroppaWerkschau in Teilen mit dem «Kosmos Boulez» verbunden?
Herr Stroppa, können Sie mit den Begriffen «Poesie» und «gesellschaftlicher Impetus» in Verbindung mit Ihrer Musik etwas anfangen?
Natürlich, das ist sehr präzise Ich denke nur, dass Poesie und formale Architektur kein Widerspruch sein müssen – im Gegenteil. Um eine echte Poesie erreichen zu können, braucht man eine sinnstiftende Architektur Anders formuliert: Um eine starke Werk-Architektur zu schaffen, braucht man eine gewisse poetische Dimension. Sonst fehlt etwas
Wie finden Sie diese Dimension? Das ist ein weites Feld Es gibt geheime und öffentliche Inspirationen. Geheime Inspiration kommt oft aus soziopolitischen Bereichen. Ich bin mit der Gesellschaft eng verbunden jedenfalls empfinde ich mich so Aber ich reagiere dann auf Entwicklungen künstlerisch. Ich bin kein Politiker, sondern Musiker Für mich hat Musik immer eine Unabhängigkeit Das halte ich auch für wichtig, weil die Musik erst dadurch künstlerische Dimensionen erreichen kann, die über das reine Statement hinausgehen.
Und die öffentliche Inspiration?
Ich habe Musik bereits als eine Art «pensiero sensibile» beschrieben. Im Italienischen hat das Wort «sensibile» eine mehrschichtige Bedeutung, es meint die Sinne, aber auch Sinnhaftigkeit. Gleichzeitig geht es auch um einen Gedanken, einen «pensiero» Musik ist also kein Wasserfall von Emotionen, und das berührt auch die Form – die Architektur Man kann nicht ein Gebäude bauen, indem man einfach ohne Plan ein Loch in die Erde schaufelt. Die Architektur ist für die Musik extrem wichtig, um den Zeitablauf gestalten zu können
Auch musikalische Architektur wandelt sich. Wie kann man die Form erneuern? Das ist die zentrale Frage Im 20 Jahrhundert gab es viele Versuche mit alten und neuen Formen Bei mir ist es eine Idee, die schon Karlheinz Stockhausen hatte Er hatte verstanden, dass es nur möglich ist, wenn das Material geändert wird. Mit altem Material kann man nur alte Formen erschaffen. Mit Steinen kann man Pyramiden bauen, aber keine Wolkenkratzer
Für Marco Stroppa steht deshalb fest: «Nur wenn man als Komponist neue Materialien findet, kann man auch neue Formen denken.» Das berührt auch den Einsatz von Elektronik in der Musik. Von Pierre Boulez persönlich 1982 an das IRCAM in Paris eingeladen, wo er bis heute wirkt, entwickelte Stroppa auch Software mit Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) rundete er seine Studien ab unter anderem in kognitiver Psychologie und künstlicher Intelligenz. Schon früh behandelte Stroppa

«Nur am Widerstand kann man wachsen»
Der Italiener Marco Stroppa ist dieses Jahr Composer-in-Residence in Luzern Eine originelle Wahl, denn seine Musik ist ein «Work in progress» – häufig mit offenem Ende.
akustische Instrumente und technische Mittel gleichberechtigt; da tut sich für ihn bis heute ein schier unerschöpfliches Feld an Beziehungsmustern auf Das offenbart auch die Luzerner Werkschau.
Während in «Spirali» von 1987/88 ein Streichquartett noch durch im Saal verteilte Lautsprecher projiziert wird, entwickelte Stroppa ein eigenes Konzept, das er seit 15 Jahren «elektroakustisches Totem» nennt. In «Come Play with Me» mit Orchester wird dieses zum Solisten. Für die dritte in Luzern zur Uraufführung kommende Fassung hat Stroppa nun sogar eine Tastatur entwickelt. Mit ihr kann im Orchester die Elektronik flexibel bedient werden Im neuen Stück «far and wee» mit Akkordeon scheint das Rollenspiel zwischen dem besagten «Totem» und dem Soloinstrument immer plastischer zu werden. Doch was hat es genau mit diesem elektroakustischen «Totem» auf sich?
Herr Stroppa, woher kommt Ihre Totem-Idee?
Das war in den frühen 1990er Jahren am IRCAM. Die Idee kam aus der Schwierigkeit, akustische Instrumente mit elektronischen Klängen integral zu verbinden. Einige Klänge kommen von einem Lautsprecher, andere von akustischen Instrumenten. Diese zwei unterschiedlichen Klangquellen mischen sich nicht so gut, ähnlich wie Wasser und Öl Ich kam deshalb auf die Idee, dass ich statt einer immersiven Diffusion im Raum eine multiple Klangquelle aus vielen
Lautsprechern auf die Bühne stelle Dabei habe ich bemerkt, dass man eine Mehrdimensionalität der Klangprojektion erreicht, die so bisher nicht vorstellbar war.
Ein Totem ist in der Ethnologie ein Objekt, das zwischen Menschen und Naturerscheinungen eine Verbindung herstellt – durchaus mystisch-spirituell Inwiefern berührt das Ihre Musik? Ich habe den Begriff absichtlich gewählt, wegen der erweiterten ethnologischen Bedeutung Sonst hätte ich auch von einer Säule von Lautsprechern reden können. «Totem» aber hat als Wort diese Resonanz. Das berührt einen anderen Begriff, der auch von mir stammt, nämlich «Kammerelektronik». Er bedeutet, dass alles auf der Bühne passiert – also keine im Raum verteilten Klangquellen. Die Elektronik wird zum Partner der Instrumentalisten.
Wie gestaltet sich diese Partnerschaft? Sie folgt nicht dem herkömmlichen Muster etwa eines Solokonzerts, sondern der Idee einer kammermusikalischen Verbindung Gleichzeitig denke ich, dass die Elektronik ihren eigenen Geist darstellen und erreichen kann – anders als akustische Instrumente Die Elektronik stellt eine unsichtbare Dimension dar, allein weil man nicht sieht, wie die Klänge entstehen. Sie kommt aus dem Lautsprecher, wie ein Geist oder Energie Die Suche nach einer dritten Dimension vollzieht sich dann wenn akustische Instrumente gemeinsam mit dem Totem erklingen
Kollege. Rein musikalisch ist diese Kombination gerade durch die Konfrontation und Spiegelung interessant. Es zeigt zugleich, wie offen Boulez war. Wie meinen Sie das? Er hat mich am IRCAM akzeptiert, hat mit mir diskutiert obwohl wir einer komplett anderen Ästhetik folgten. Es war ihm wichtig, dass jemand ein eigenständiges und tiefergehendes Verständnis von Musik hatte Das hat er gesucht, unabhängig davon, ob diese Person nun dachte wie er oder nicht. Er hat eben nicht kleine Klone von sich selbst geschaffen und unterstützt, wie manchmal behauptet wird. Das ist nicht wahr Gleichzeitig wollte ich am IRCAM aber auch nicht meine eigenen Gewohnheiten pflegen.
Sondern?
Ich wollte einen Widerstand finden. Nur am Widerstand kann man wachsen. Noch heute wird Boulez oft vornehmlich als Erfindungsgenie von gewichtigen Institutionen genannt oder als grosser Dirigent. Seine Musik wird weniger beachtet, obwohl ihre Qualität und Stärke überragend ist.
Hierin zeigt sich zugleich, wie sehr Stroppa am IRCAM von Anfang an seinen eigenen Weg gegangen ist. Das berührt auch sein Verhältnis zu Pierre Boulez. Im Gespräch nennt Stroppa ihre Musik «extrem unterschiedlich» Schon während der 1980er Jahre hat er das in Schriften skizziert, so auch in «Musical information organisms An approach on Composition» Es ist eine Art Replik auf Boulez’ Essay «Penser la musique aujourd’hui» aus dem Jahr 1963 Für Stroppa ist Boulez ein «kombinatorisches Genie». Das zeige sich unter anderem darin, wie Boulez beispielsweise Motive, Akkorde, Tonfolgen aufbaut, kombiniert und wandelt Dagegen sieht sich Stoppa als «kognitiven Komponisten» Das berührt die Deutung des Wahrgenommenen. Ideen kehren subtil wieder und werden in ihrer Ähnlichkeit erkannt. So bilden in «Spirali» choralartige Passagen eine versteckte Hommage an den «Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit» aus Beethovens Streichquartett op 132. Die in Luzern miteinander gekoppelten Werke von Stroppa und Boulez verlebendigen also auch differierende Haltungen.
Fühlen Sie sich wohl mit den BoulezVerbindungen? Biografisch sehr, weil ich vierzig Jahre lang mit Boulez Kontakt hatte Er hat keine Werke von mir dirigiert, ich habe nicht bei ihm studiert. Wir haben aber zusammen gearbeitet am IRCAM. Für mich ist Boulez auch ein Partner und
Das gilt auch für Boulez’ Werk «Poésie pour pouvoir» für drei Orchester und Elektronik nach dem gleichnamigen Gedicht des Surrealisten Henri Michaux. Stroppa nennt es Meisterwerk, obwohl es keine nennenswerte Aufführungsgeschichte hat. Nach der Uraufführung im Oktober 1958 an den Musiktagen in Donaueschingen wurde das Stück nämlich nicht mehr dargeboten. Mehr noch: Boulez hat es aus seinem Werkkatalog gestrichen. Die nun geplanteWiederaufführung in Luzern geht auf eine Initiative des inzwischen verstorbenen AcademyLeiters Wolfgang Rihm zurück. Sie ist zugleich die Uraufführung einer Rekonstruktion der originalen Elektronik durch Stroppa und seinen IRCAM-Kollegen Carlo Laurenzi. Hierzu wurde auf eine Aufzeichnung der Uraufführung von 1958 zurückgegriffen. Es ging darum, dem Originalklang so nah wie möglich zu kommen. Eine Wiedergabe der historischen Tonspuren war schon deswegen nicht möglich, weil die Geräte der damals noch vollständig analogen Welt nicht mehr existieren oder nicht mehr einsatzfähig sind.Auch die darin integrierte Stimme von Michel Bouquet, der seinerzeit das MichauxGedicht vorgetragen hatte, war nicht verwendbar Der Schauspieler Yann Baudot hat sie daher simuliert, und mithilfe künstlicher Intelligenz wurden die Timbres der beiden Stimmen dann synchronisiert. Aus welchem Grund hat Boulez «Poésie pour pouvoir» verworfen? Ich denke, weil es damals keine Technologie gab, die ihm zeitliche Flexibilität beim Einsatz der Elektronik erlaubte Telefunken hatte damals das erste achtspurige Bandgerät für dieses Stück gebaut Allein ein solches Gerät zu starten, war anders als heute Es lärmt und lässt sich nicht präzise synchronisieren Die Technologie war damals starr, und Boulez hatte nur vier Monate, um die komplexe Elektronik zu entwerfen. Das ist sehr wenig im Vergleich etwa zu Stockhausen, der bis zu anderthalb Jahre an elektronischen Zuspielungen feilen konnte Wie reagierten die Boulez-Erben auf die Idee einer Wiederaufführung? Wir haben natürlich auch die Erben davon zu überzeugen versucht, dass es sich lohnt, dieses Werk wieder zum Leben zu erwecken. Sie wollten zunächst nicht, dass es wieder aufgeführt wird. Vor einigen Jahren hatten wir ein erstes Treffen, bei dem wir unser Konzept erklärt und die erste von insgesamt neun Sequenzen präsentiert haben.
Warum ist «Poésie pour pouvoir» so wichtig?
Weil es der Ausgangspunkt ist für viele spätere Werke, die Boulez am IRCAM entwickelt und komponiert hat. Es ist zudem sein einziges Werk, in dem die Elektronik auch eine Stimme integriert. Schliesslich zählt dieses Werk zu den ersten für Orchester und Elektronik überhaupt. Die Orchestrierung spiegelt kongenial das Gedicht von Michaux wider Interview: Marco Frei
Die Pianistin Beatrice Rana kam schon im Mutterleib mit Musik von Bach in Berührung. Bis heute ist er ein Fixstern in ihrer Karriere Nach Luzern kehrt sie nun mit Rachmaninow zurück Rana sieht aber eine Verbindung zwischen den Werken der beiden Komponisten.
DOROTHEA WALCHSHÄUSL
Gerade einmal 250 Gramm wiegt ein Embryo in der 20. Schwangerschaftswoche, seine Ohren aber sind bereits feinsinnig auf Empfang eingestellt Rhythmisch pocht der Herzschlag der Mutter, und Gespräche der Eltern oder Geschwister dringen durch die Bauchdecke. Manchmal kommen weitere Klänge hinzu, die zu dem werdenden Menschen nach innen dringen: Alltagsgeräusche aus dem Haushalt, öffentlichem Verkehr Musik.
Bei Beatrice Rana war dies die Stimme des Klaviers, und bis heute wirkt die pränatale Prägung nach. «Der Klang des Klaviers war immer schon da in meinem Leben und mir so vertraut wie die Stimme meiner Mutter und meines Vaters», erzählt Rana, die sich an keine Zeit ohne den vibrierenden Sound des Tasteninstruments erinnern kann
Eigentlich habe in ihrem Elternhaus immer jemand Klavier gespielt, sagt sie, Instrumente gab es mehrere, beide Eltern waren Pianisten und unterrichteten als Klavierlehrer auch zu Hause Als Rana im Jahr 1993 im apulischen Copertino auf die Welt kam, war die Musik längst ein Teil von ihr Und es schien schlicht selbstverständlich, dass sie wenige Jahre später selbst das erste Mal die Tasten drückte «Ich habe erst deutlich später erkannt, dass es in anderen Familien nicht völlig normal war, dass alle Klavier spielen», erzählt Rana und lacht.
«Mein Gravitationszentrum»
Nach erstem Unterricht bei ihren Eltern studierte Rana in Monopoli, Hannover und Rom, bald gewann sie Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben, darunter die Montreal International Competition und den bedeutenden Van-Cliburn-Wettbewerb Es war ihr Durchbruch, bedeutete aber gleichzeitig eine «schockierende Veränderung für eine gerade 18-Jährige», wie sie im Rückblick sagt. «Ich hatte mit einem Mal die Möglichkeit, weltweit sehr viele Konzerte zu spielen, aber es entstand auch ein enormer Druck.» Dank guter Ratgeber habe sie damals gelernt, auch einmal Nein zu sagen und
ihre Agenda so zu organisieren, dass noch Privatleben übrigbleibe Ruhe und Halt findet Rana bis heute in ihrer alten Heimat Süditalien, aber auch in ihrer jetzigen Wahlheimat Rom «Dort liegt mein Gravitationszentrum», sagt Rana; wann immer sie kann, kehrt sie dorthin zurück, sei es nur für einen Tag zwischen zwei Konzerten. Nicht zuletzt durch diese Erdung hat sich Rana ihren eigenen intuitiven Zugang zum Instrument und zur Musik bewahrt, ergänzt durch ein feinsinniges Durchdringen des Notentextes und ebenso lichtes wie emotionales Ausdeuten der Phrasen. In ihrem Spiel liegen dabei stets auffallend viel Grazie und Demut, gepaart mit der energetischen Power etwa in der Tradition einer Martha Argerich.
Ohrenputzer
Wann immer die Künstlerin an die Erarbeitung eines neuen Werks geht, will sie «dem Stück so nahe wie möglich kommen», wie sie es ausdrückt. Andere Interpretationen anzuhören, vermeidet sie, denn zuerst will sie «die Architektur des Werks» verstehen. Dann folgt akribische Detailarbeit, Note um Note Takt um Takt Geleitet von der kompromisslosen Hingabe an die Musik selbst, hat sich Rana in den vergangenen Jahren beispielsweise die vier Klavierkonzerte (BWV 1052 – 1054 und 1056) von Johann Sebastian Bach vorgenommen. Sie wurden jüngst auch in einer Aufnahme mit der Amsterdam Sinfonietta veröffentlicht.
Zu Johann Sebastian Bachs Musik hat Rana denn naturgemäss auch ein ganz eigenes Verhältnis: «Ich habe schon immer eine grosse Verbindung zu diesem Komponisten gespürt, und meine Beziehung zu Bachs Musik ist sehr stark und stabil. Bei anderen Komponisten hat sich mein Gefühl sehr verändert im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bei Bach überhaupt nicht.»
Verwunderlich ist das kaum: Bachs Musik erreichte Rana ähnlich früh wie die Klänge des Klaviers selbst. Als Korrepetitor hat ihr Vater am Theater die Proben zu grossen Opern begleitet, wuchtige Werke von Verdi oder Puccini; war eine Produktion jedoch zu Ende
LeikoIkemura,2025
«Awakening»(2025) Glas, gegossen undfarbig
Masse: ca.9×12,5×7,5cm Edition vonje18Exemplaren +5AP
Einzelpreis: CHF 7900.–4er-Set-Preis: CHF28000.–
Bestellungen finden in der Reihenfolge ihres EingangsBerücksichtigung. Der Kauf bedingteinen Wiederverkaufsausschluss von36Monaten. DerVersand findet nur mitKunstspedition statt, wofür zuzüglich Verpackungs- und Versandkostenanfallen. BeiBestellungen ausdem Auslandfallen zusätzlich diejeweiligeMehrwertsteuerdes Lieferlandes sowie individuelleVersandkosten an. Voraussichtlicher Liefertermin: Anfang September2025
+4144258 13 83

spielte er einen ganzen Tag lang Bach –«um seine Ohren zu reinigen, hat er damals immer gesagt» Sie kann das selbst inzwischen nachvollziehen. «Alles in Ordnung» – diese deutsche Formulierung passt aus ihrer Sicht perfekt zur Tonsprache Bachs «In seinen Werken gibt es eine universelle Ordnung bei der jede einzelne Stimme gleich wichtig ist, jede hat eine Rolle und alle Stimmen zusammen ergeben ein phantastisches Bild.» Gleichzeitig spreche aus der Musik eine grosse Freude, die Kunst in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu teilen. Das gelte auch und gerade für seine geistlichen Werke. «In Bachs Musik wird ein starker Glaube und eine Liebe zu einem spirituellen Vater ausgedrückt, auf eine ausgesprochen menschliche Art und
Exklusive Glaswerkevon LeikoIkemura für dieNZZ LeikoIkemura, geboren in Japan, zähltzuden bedeutendsten Malerinnenund Bildhauerinnen derGegenwart.IhreWerkesind international in bedeutenden institutionellenSammlungen vertretenund werden weltweit museal ausgestellt. Demnächst im BündnerKunstmuseum in Chur (23. August bis23. November 2025), an der 36.Biennalevon SãoPaulo (6. Septemberbis 11.Januar 2026)sowie in derAlbertinainWien(14.November 2025 bis8.Februar 2026).
Die Glasobjekte –gelb, rosa, violett oder blau, getönt –wechseln zwischen Figurund Abstraktion. Sienehmen Bezug aufIkemuras zentralesMotiv derChimären,eines mythischen Hybrids aus Menschund Tier. Jede Skulpturträgt Zügedes Unvollendeten undUneindeutigen.Die glänzende Oberflächebrichtdas Licht aufsubtileWeise,sodasssie wievon innen herauszuleuchten scheinen.


Weise», sagt Rana Gleichzeitig habe die Musik auch etwas Göttliches an sich, geschaffen von einem Menschen. Schon bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Kind hat Rana ein BachProgramm gespielt und auch wenn sie heute über ein äusserst breites Repertoire verfügt, hat der deutsche Komponist sie immer wie ein Fixstern begleitet Für sie liegt das auch an der Emotionalität, die sie in dessen Musik spürt. Bei Bach seien die Unterschiede zwischen Dur- und Moll-Sätzen extrem. «Passagen in einer Dur-Tonart sind bei ihm voller Freude und absolut erhebend, in Moll-Teilen ist eine unglaubliche Tiefe erfahrbar, da wird die Musik sehr persönlich», meint Rana.
«Was man empfindet, stimmt» Bei ihrer diesjährigen Rückkehr ans Lucerne Festival, dem sie bereits seit 2017 verbunden ist, wird Beatrice Rana in diesem Sommer eine ebenfalls hochemotionale, stilistisch aber denkbar anders gelagerte Musik interpretieren Im zweiten Programm, das der italienische Dirigent Riccardo Chailly mit dem Lucerne Festival Orchestra erarbeitet, spielt sie den anspruchsvollen Solopart in Sergei Rachmaninows «Rhapsodie über ein Thema von Paganini» Mit diesem Programm beschliesst Chailly zugleich einen über mehrere Spielzeiten aufgespannten Zyklus mit den sinfonischen und konzertanten Hauptwerken Rachmaninows Dessen Musik spricht durch die Intensität der wechselnden Stimmungen und Gefühle die in ihr geballt zum Ausdruck kommen, viele Menschen sehr unmittelbar an. Wegen dieser Unmittelbarkeit stand Rachmaninows Musik bei manchen Kritikern allerdings auch lange unter Kitsch-Verdacht. Heute sieht man das entspannter. Beatrice Rana unterscheidet zwischen ihrer eigenen, durchaus streng kontrollierten Emotionalität beim Spielen und dem, was die Hörer empfinden. «Es geht bei der Musik immer um eine grössere Geschichte, die erzählt wird», sagt sie. «Menschen können ganz Unterschiedliches fühlen, wenn sie Musik hören – doch es gibt hier kein Richtig oder Falsch: Ganz gleich, was man empfindet – es stimmt.»


Wie man um das Letzte ringt: ultimative Sonaten, freche Fantasien und unspielbare Etüden am Lucerne Festival
WOLFGANG STÄHR
Zur Kultur des Abendlandes gehört auch die beharrliche Klage über dessen Untergang Das Ende wird beschrien, gepredigt oder befürchtet, manchmal regelrecht herbeigesehnt. Wie das einst unerschütterliche Fortschrittsdenken beherrscht auch das Abschiednehmen die europäische Geschichte.Andauernd geschieht etwas zum letzten Mal, und die Europäer kultivieren diese melancholische bis misanthropische Weltsicht wie eine aparte Schwäche: Wonnen der Vergeblichkeit als Phantomschmerz der verlorenen Zeit. Unsere besten Jahre –sind sie nicht längst vorbei?
In der Musik wird namentlich und allen voran Ludwig van Beethoven mit dem Mythos des Letztmaligen, Endgültigen und Unwiderruflichen identifiziert. Er schuf – angeblich – die letzte Sinfonie (die Neunte), die letzte Oper (den «Fidelio», der im uninszenierbaren Befreiungsfinale jede Theaterbühne sprengt), die letzten Streichquartette und selbstverständlich auch: die letzte Klaviersonate Das ist selbstredend ein Mythos, dennoch aber ein ausgesprochen wirkungsvoller.
Auf Nimmerwiederkehr?
«Höheres gibt es nichts als der Gottheit sich mehr als andere Menschen nähern und von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten», bekannte Beethoven gegenüber seinem Schüler und Förderer, dem Erzherzog Rudolph von Österreich. Ihm hat er – neben so vielen anderen Meisterwerken – auch die besagte letzte Sonate gewidmet, in c-Moll op 111. Ihre zwei Sätze verhielten sich zueinander wie «Diesseits und Jenseits», urteilte der Pianist Edwin Fischer Wirklich scheinen Pathos und Passion des einleitenden c-Moll-Allegros in der erhabenen Ruhe der C-Dur-Arietta aufgehoben und verklärt: in einem hymnischen Gesang der mit jeder Verwandlung sich den «Strahlen der Gottheit» ekstatischer nähert. Warum Beethoven nach dieser Variationenfolge keinen einzigen weiteren Satz mehr geschrieben habe, lässt Thomas Mann den Organisten Wendell Kretzschmar im achten Kapitel seines Romans «Doktor Faustus» fragen: «Ein dritter Satz? Ein neues Anheben – nach diesem Abschied? Ein Wiederkommen – nach dieser Trennung? Unmöglich! Es sei geschehen, dass die Sonate im zweiten Satz, diesem enormen, sich zu Ende geführt habe, zu Ende auf Nimmerwiederkehr Und wenn er sage: ‹Die Sonate›, so meine er nicht diese nur, in c-Moll, sondern er meine die Sonate überhaupt, als Gattung, als überlieferte Kunstform.»
Die britische Pianistin Mitsuko Uchida beendet damit ihre Luzerner Sonntagsmatinee am 7. September, bei der sie alle drei letzten Klaviersonaten Beethovens spielt Auf Nimmerwiederkehr? Das wäre allerdings kein gutes Motto für Festivalbesucher «Open End» hingegen ist ein tröstlicher und vielversprechender Leitgedanke – und das glatte Gegenteil dieser «Alles zu spät, alles ist vorbei»-Mentalität. Immerhin entstand die Trias der letzten Beethoven-Sonaten in zeitlicher und ideeller Verschränkung mit der Missa solemnis und der Verbrüderungsvision der neunten Sinfonie, von Anfang 1820 bis 1822. Die E-Dur-Sonate op 109 zielt unfehlbar, wie alle diese späten Sonaten, auf das Finale, die Variationen über ein «gesangvoll, mit innigster Empfindung» zu spielendes Thema, das in Wahrheit eher zelebriert als gespielt wird: Es ist, durchaus passend, eine aus der Zeit gefallene Sarabande In gut zweihundert Takten und sechs Variationen durchschreitet Beethoven darin alle Höhen, Sphären und Zeiten, wie der Apoll des Ovid: «Durch mich wird Zukünftiges, Vergangenes und Gegenwärtiges offenbar, durch mich tönt harmonisch das Lied zu den Klängen der Saiten.» Das kontrapunktische Denken des Barockzeitalters prägt

Wie einst das unerschütterliche Fortschrittsdenken beherrscht auch Abschiednehmen die europäische Geschichte.
einzelne dieser Variationen; andere entfalten die unendliche melodische Freiheit der aufkommenden Romantik, ja sogar die reine Klanglichkeit und Auflösung der thematisch gebundenen Form kündigt sich an – bevor zum Schluss noch einmal ruhig und feierlich, die Sarabande erklingt, nahezu unverändert, wie am Anfang so am Ende Eine Musik, die gleichermassen zurück wie nach vorne blickt, aber eben nicht stehen bleibt.
Freiheit und Eigensinn
Das Finale der As-Dur-Sonate op 110 beginnt, ähnlich avanciert, in der Manier einer freien Fantasie: Beethoven hebt die Taktordnung auf, er zeichnet eine buchstäblich nach Sprache ringende Musik auf, ein wortloses Rezitativ, das Abbild eines heillos zerrissenen, desolaten Gemütszustandes Nach einer derart verstörenden Einleitung hebt – psychologisch folgerichtig – ein instrumentaler Klagegesang an, ein «Arioso dolente», dem Beethoven mit einer lichten, majestätisch ruhevollen Fuge begegnet, fast wie ein Hymnus Aber indem er diese Fuge zu guter Letzt radikal übersteigert, ihr hymnisches Thema in einer atemberaubend kontrapunktischen Zuspitzung zugleich vergrössert und verkleinert, da es gleichzeitig
monumental verbreitert und rasant beschleunigt wird, entsteht am Ende der Eindruck, als würde die Fuge sich selbst verzehren, sich selbst aufheben in einem letzten, paradoxen Befreiungsakt. Ende und Öffnung zugleich mit einem Wort: Open End!
Zwei Tage nach Mitsuko Uchidas Beethoven-Matinee kehrt Igor Levit wieder, um im selben Konzertsaal des KKL eine Schubert-Sonate zu spielen. Sie widerlegt zugleich aufs Schönste das verkündete Ende «der Sonate als Kunstform». Allerdings tönt ausgerechnet Franz Schuberts letzte Klaviersonate in B-Dur D 960, die er nur wenige Wochen vor seinem Tod im Herbst 1828 niederschrieb, ganz wie Abschied und Abkehr, wie ein Traumpfad hinaus auf die andere Seite der Wirklichkeit: eine Musik, die sich in Trance zu bewegen scheint, langsam und gedämpft, von merkwürdigen Stimmen, Zeichen, Zurufen aus der Tiefe geleitet in die Tiefe gelockt. Und doch erbrachte gerade diese somnambule Sonate, diese fragile, weltentrückte Musik den Beweis, dass mit Beethovens letzten Sonaten keineswegs das Ende der Geschichte gekommen war Auf – und trotz – Beethoven folgten Schubert, Schumann, Chopin, Liszt Brahms und Skrjabin; obgleich unbestreitbar keiner je die späte Sonaten-
dreifaltigkeit des Klassikers zu überbieten vermochte an Radikalität, Freiheit und Eigensinn. Beethoven komponierte sie mit Anfang fünfzig, ein Indiz dafür, dass Thomas Manns scharfsinniges Wort vom «Greisen-Avantgardismus» strenggenommen nicht recht passen will. Dennoch dachte ein anderer Schriftsteller, der Engländer Aldous Huxley, gerade an Beethoven, als er über die «aussermenschliche, postume Qualität» charakteristischer Spätwerke philosophierte Was sie auszeichne, sei die «Kontemplation ewiger Wirklichkeit», der «abgeklärteste Kommentar zur Welt», aber auch die Ausbrüche eines «heftigen und doch irgendwie abstrakten Gelächters, deren Echo von irgendwo jenseits der Weltgrenzen zu uns herabschallt»
Fantasien mit viel Fantasie Alle Komponisten, die hier aufgerufen werden, vereint eine Gabe die Huxley zu den Erleuchtungen der Spätwerke zählte: Sie alle lebten, «ohne je aufzuhören, vom Leben zu lernen» Unter diese beachtenswerte Devise liesse sich auch die Matinee mit Sir András Schiff stellen, am letzten Sonntag im August. Denn sein unorthodoxes Programm besteht vom Anfang bis zum offenen Ende aus lauter Fantasien oder, in Beethovens
Fall, einer «Sonata quasi una Fantasia» Die Fantasie trägt als Begriff und Praxis einen doppelten Sinn in die Musik hinein. Sie steht für das freie Fantasieren, die Improvisation, das Stegreifspiel; aber auch für die Vorstellungskraft und die Erfindungsgabe, den Einfallsreichtum, durchaus mit einem Stich ins Verrückte und Übertriebene ins Phantastische Die Fantasien aber, die András Schiff spielt, leben aus dem Widerspruch, dass sie die flüchtige Kunst des Extemporierens für alle Zeiten in Notenschrift fixiert haben:Augenblicke für die Ewigkeit. Johann Sebastian Bach schrieb seine «Chromatische Fantasie» womöglich als ein «Tombeau» – eine traditionelle Trauermusik – auf den Tod seiner ersten Frau Mozart dagegen öffnete seine c-Moll-Fantasie KV 475 für theatralische Effekte, den Übergang ins Balladeske und Melodramatische Joseph Haydn wiederum erfand ein Capriccio mit abgründigen Scherzen, wenn der Pianist mittendrin zu spielen aufhört und das Publikum in Verwirrung stürzt.Auch Beethoven hintertrieb schon in seiner Es-Dur-Sonate op 27 Nr 1 die klassische Ordnung und liess sich subversive Störmanöver einfallen. Mendelssohn dichtete seine fis-MollFantasie unter den Eindrücken einer romantischen Schottlandreise Und Schumann versteckte in seiner berühmten C-Dur-Fantasie Beethoven-Zitate: als Geheimbotschaften an seine «ferne Geliebte» Clara Wieck. Wer nicht genug bekommen kann von solch experimenteller und exzentrischer Klaviermusik, dem seien die «Virtuosen-Studien» empfohlen. Diesen Titel zog Franz Liszt ursprünglich für eine Sammlung von zwölf Etüden in Erwägung, die er 1851 vollendete. Veröffentlich wurde die Sammlung schliesslich unter dem Titel «Études d’exécution transcendante», eine Bezeichnung, die im deutschen Sprachraum mit «Etüden in aufsteigender Schwierigkeit» oder «Etüden für die hervorragende Ausführung» wiedergegeben wird. Zehn der zwölf Stücke versah Liszt (nachträglich) mit poetischen Überschriften, die sofort klar machen, dass es sich hier nicht um stupide Übungsstücke handelt. Wer will, mag bei der «Eroica»-Etüde an Beethoven denken, bei «Paysage» eine arkadische Landschaft vor sich sehen, mit der «Wilden Jagd» das Geisterheer des deutschen Volksglaubens assoziieren oder sich bei «Mazeppa» an das Gedicht von Victor Hugo erinnern, an den Todesritt des gefesselten Helden, der am Ende doch noch als König triumphiert Freilich könnte gerade dieses Virtuosenstück auch Gedanken an Zirkus und Varieté provozieren. Liszts Etüden repräsentieren eine schillernde Musikalität, effektbewusst bis zur Reklame und raffiniert bis zur Klangalchemie Vor allem aber sind und bleiben sie das zutiefst beeindruckende Zeugnis einer überbordenden, ungebundenen und stets grenzenlosen Fantasie Grenzenlos bis ans Ende: Die letzte Etüde in b-Moll nannte Franz Liszt «Chasse-neige», ein Bild des Schneetreibens, in Tremoli, chromatische Läufe, in weite und rasche Sprünge übersetzt, das bis zum Extrem getrieben wird, ins Elementare, Geräuschhafte und Vormusikalische Eine bodenlose, geradezu verzweifelte Endzeitstimmung spricht aus dieser avantgardistischen Studie «Unglücklicherweise kann man nicht hoffen, Musik dieser Art häufiger zu hören», klagte Hector Berlioz. «Liszt schuf sie für sich selbst, und niemand in der Welt darf sich schmeicheln, dass er jemals fähig wäre, sie aufzuführen.»
Diese pessimistische Prognose hat sich zum Glück so wenig bewahrheitet wie der Nachruf auf die an ihr Ende gekommene Klaviersonate Vsevolod Zavidov, der in jungen Jahren schon vielfach preisgekrönte Pianist und Gewinner des Prix UBS Jeunes Solistes 2025, hat sich Liszts unspielbare Etüden komplett für sein Luzerner Konzert am 21 August sein Debüt am Festival, vorgenommen. Es geschieht eben doch nicht alles zum letzten Mal.
Die australische Künstlerin Winnie Huang hat das Zusammenspiel von musikalischem Ausdruck und körperlichen Gesten zu ihrem Markenzeichen gemacht In dieser Saison ist sie «artiste étoile» am Festival
THOMAS SCHACHER
Auf dem Video ist, ganz nahe herangezoomt, das Gesicht einer Frau zu sehen.
Abwechselnd starrt sie den Betrachter teilnahmslos an oder schliesst die Augen. Wenn sie guckt, ist es still; wenn sie die Augen schliesst, erklingt ein gurgelndes Geräusch. Sie setzt sich Linsen ein und dreht die Augen nach rechts und nach links; dabei ist die Vokalise einer Frauenstimme zu hören. Später befestigt die Frau mit einer Pinzette zwei Klebestreifen auf den Augenlidern, eine Stimme aus dem Off erklärt den Vorgang. Dann starrt die Frau den Betrachter wieder an. Diesmal erklingt dazu rhythmisch geprägte Musik, aus der sich immer deutlicher ein Kinderlied entwickelt. Hochziehen der Augenbrauen und Schliessen der Lider schaffen einen Zusammenhang mit dem Gehörten. Die Frau setzt sich nun künstliche Wimpern auf und bewegt sie mit entsprechenden Muskelbewegungen wie Fächer Zum Schluss ist der Text des Gesangs klar zu verstehen: «I love my monolid.» Die Frau wippt dazu den Kopf im Takt und schaut mit grosser Anteilnahme aus ihren dunklen Augen. Das Video ist ein Trailer zu dem Stück «Mono», realisiert wird das experimentelle Werk für Soloperformer von seiner Komponistin selbst, von Winnie Huang Doch wer ist die Frau, die derart eigenwillige Kunstwerke erschafft? Dass die in China geborene und in Australien aufgewachsene Musikerin am diesjährigen Lucerne Festival als «artiste étoile» auftritt, dürfte manchen erstaunen.Aber diese Ehre fiel ihr nicht aus heiterem Himmel zu
Phänomenales Multitalent
Es gibt dazu eine Vorgeschichte: Schon vor elf Jahren hat sie als Geigerin an der Lucerne Festival Academy teilgenommen. Später hat sie in verschiedenen Alumniprojekten mitgewirkt In den letzten Jahren bekleidet sie am Festival eine der Leaderpositionen und wirkt in dieser Eigenschaft im Sommer als Tutorin für die Academy-Teilnehmer und beim Foreward-Festival im November als eine der Kuratorinnen. Als «artiste étoile» präsentiert sie sich in sechs Performances unterschiedlichen Zuschnitts Man darf Winnie Huang als Multitalent bezeichnen. Sie ist nicht nur Geigerin, Performerin und Komponistin,

sondern auch Musikforscherin und Pädagogin. Nach dem Violinstudium in Australien kam sie, wie viele Musiker ihrer Generation, die sich der klassischen westlichen Tradition widmen wollten, nach Europa.
In Paris hat sie «soundinitiative» gegründet, ein Ensemble für zeitgenössische Musik, in dem sie selbst als Geigerin mitspielt. «Wir sind neun Musiker», erklärt sie, «die Dinge ausprobieren, die wir im normalen Konzertbetrieb nicht machen können.» Ihr auch wissenschaftlich grundiertes Interesse für den Zusammenhang zwischen Klang und Geste führte zu einer Dissertation an der Universität Antwerpen. Seit kurzem ist Huang assoziierte Professorin für künstlerische Forschung am Conservatorio della Svizzera italiana in Lugano
Die Verbindung zwischen musikalischem Ausdruck und körperlichen Gesten bildet das Markenzeichen von Winnie Huangs Kunst. Darauf gekommen ist sie durch das Studium der zeitgenössischen Musik «Was ist das für eine Welt», fragte sie sich, «und wie kann ich daran teilnehmen?» Und sie
«Ich glaube inzwischen, dass alle Kunst interdisziplinär ist.»
entdeckte dass dabei die Perspektive eine wichtige Rolle spielt: «Ich glaube inzwischen, dass alle Kunst interdisziplinär ist», erklärt sie, «und wir haben die Wahl, welche Perspektive wir auf diese Kunst anwenden wollen, und zwar sowohl als Ausführende wie als Hörende.» Sie führt das Beispiel einer MahlerSinfonie an: «Wenn der Paukist bei einem Kulminationspunkt einen ohrenbetäubenden Wirbel ausführt, zeigt sich
auf seinem Gesicht ein bestimmter Ausdruck. Das Publikum sieht das und ist davon berührt.» Historische Vorbilder für ihre «Gestural Performances» sieht Huang im Instrumentalen Theater der Nachkriegsavantgarde, also bei Mauricio Kagel, Dieter Schnebel oder Karlheinz Stockhausen. Dazu nennt sie die Fluxus-Bewegung und John Cage «den grossen Philosophen der Musik» «Eine Art von Wiedergeburt»
Wie unterschiedlich sich Musik und Gesten verbinden lassen, zeigt sie bei ihrer Porträtdarbietung in der Eventlocation Moderne Einen Höhepunkt bildet die Uraufführung eines Stücks der Komponistin Jessie Marino und des Videokünstlers Constantin Basica, es heisst sprachspielerisch «In the Gates of Hell, Off course, Of course» und ist im Auftrag des Lucerne Festival entstanden. Besonders gespannt ist Huang dabei auf die erstmalige Zusammenarbeit mit Basica und seinem Videomapping einer Technik, mit der sie bislang keine Erfahrungen hat. Noch.
Die intimste Performance nennt sich «One to One» und findet in einer verdunkelten Box in den Clubräumen des KKL statt. Über 70 Mal führt sie dabei das Stück «Tend» des Australiers Charlie Sdraulig auf – aber stets nur für einen einzigen Gast. «Der Komponist hat eine Abfolge von Gesten festgelegt», erklärt sie, «aber je nach der Reaktion des Zuschauers kommt etwas ganz anderes heraus.» Entfernt scheint dieses Setting an die Performance «The Artist Is Present» zu erinnern, bei der die Konzeptkünstlerin Marina Abramović unter anderem im New Yorker Museum of Modern Art der Reihe nach während Tagen Menschen anblickte, die sich ihr an einem Tisch gegenübersetzten. Doch Huang widerspricht: «Das ist etwas ganz anderes, dort schauen viele Leute zu, hier befindet sich eine einzige Person unbeobachtet mit mir. Das ist ein grosser Unterschied in der Intimität.» Auf das grosse Publikum ausgerichtet ist die Aufführung von Karlheinz Stockhausens «Inori» in der Ark Nova. Das Werk erklingt hier in einer Fassung für Solistin und Tonband, nachdem es 2018 bereits in der Orchesterfassung am Festival aufgeführt worden ist. Für Huang schliesst sich damit ein Kreis: Damals spielte sie als Violinistin einen der Soloparts dieses Jahr bildet sie als Mimin das optische Zentrum der Aufführung «Es ist eine Art von Wiedergeburt.» Zum spirituellen Charakter von Stockhausens Komposition – sie muss dabei Gebetsgesten ausführen, die verschiedenen Weltreligionen entnommen sind – hat sie ein positives Verhältnis nicht zuletzt durch ihr regelmässiges Yoga, bei dem sie auch spirituelle Erfahrungen macht.
Obwohl Winnie Huang viel arbeitet, lebt sie nicht nur für die Musik. «Musik ist nur eine, wenn auch sehr wichtige Farbe meines Lebens», betont sie Gerade die Geburt ihres Sohnes vor drei Jahren habe ihre Prioritäten verändert. Sie tut vermehrt auch Dinge die ihren Geist in andere Räume versetzen. Neben Yoga nennt sie das Joggen und –überraschend – Kochen und Essen. Die kulinarischen Freuden sind ihr jedoch ein Mittel zum Zweck. «Durch Speisen erkunde ich die Persönlichkeit anderer Menschen und verbinde mich mit ihnen.» Das ist dann, darf man vermuten, auch eine Art von «One-to-One»Situation – eine, die alle Sinne anspricht
Der junge Pianist Giorgi Gigashvili verbindet gern Gegensätze Bei seinen Konzerten will er auch die Instagram-Generation für seine abwechslungsreichen Programme begeistern.
MICHAEL STALLKNECHT
Schulterlange Locken, Schnauzer, Hornbrille: Wie der typische klassische Pianist sieht Giorgi Gigashvili nicht unbedingt aus Auch wenn der 24-Jährige auf dem Klassikmarkt gerade einen ziemlichen Senkrechtstart hinlegt. In den vergangenen Jahren erreichte er hohe Platzierungen bei international wichtigen Wettbewerben, etwa den zweiten Preis beim Arthur-RubinsteinWettbewerb in Tel Aviv Derzeit debütiert er bei vielen grossen Orchestern und Veranstaltern. Doch Musik ist für ihn ein deutlich weiterer Begriff. Schon deshalb weil er in der Volksmusiktradition seiner georgischen Heimat aufgewachsen ist.
Mit zwölf Jahren gewann er dort die Castingshow «The Voice» – tatsächlich als Sänger, nicht als Pianist. Und bis heute arrangiert er georgische Lieder für die weltumspannenden Klänge des Elektronikzeitalters Dazu nutzt er gern auch das Keyboard und singt gelegentlich noch immer selbst.
Beim Beethoven-Fest in Bonn präsentierte Gigashvili im vergangenen Herbst sogar ein eigenes Werk für Klavier, Orchester und Elektronik, neben einem Konzert mit der Singer-Songwriterin Nini Nutsubidze. Gleichzeitig hat er als Pianist eine harte Schule durchlaufen: die legendäre Technik aus Sowjetzeiten, die bis heute die Ausbildung in Georgien prägt. Beide dieser Impulse bringt er am 4. September mit zum Lucerne Festival: mittags ein Konzert mit Chopin und Prokofjew, technisch ausgesprochen anspruchsvoll; am gleichen Abend dann noch ein weiteres in der «Ark Nova», in dem er Klassisches mit georgischem Folk verbindet. Sehr typisch für diesen Künstler.
Ein Ich mit mehreren Profilen
Sein erster Auftritt in Luzern ist es nicht, bereits im vergangenen Jahr war Gigashvili hier gemeinsam mit einer Landsmännin zu erleben, der Geigerin Lisa Batiashvili. Deren Stiftung fördert ihn heute, wie auch die Zürcher Orpheum-

Stiftung Überhaupt fühlt sich der Georgier der Schweiz stark verbunden, seit er im Alter von 20 Jahren nach Genf gezogen ist. Er wollte seine Studien dort bei Nelson Goerner fortsetzen. Im Jahr darauf wurde ihm beim Concours Géza Anda als einem der jüngsten Teilnehmer
der Hortense-Anda-Bührle Förderpreis zugesprochen. «Die Schweiz hat mich als Person geformt», sagt Gigashvili im Gespräch. Weil hier alles gut funktioniere, müsse man selbst «pedantisch und gut organisiert» werden. Das habe ihm Struktur gegeben.
Ein grosses Ziel Mit Genf als Wohnort wurde er dennoch nicht recht warm: «zu introvertiert» für einen wie ihn, der sich selbst als extrovertiert bezeichnet, der «ausgehen und Spass haben» wollte. Seit 2023 studiert er bei Kirill Gerstein in Berlin, wo die Angebote in Sachen Ausgehen deutlich diverser sind. Er nimmt sich Zeit dafür, auch wenn sein Terminkalender für die kommenden zwei, drei Jahre voll ist. Momentan jedenfalls stimme für ihn die Balance zwischen Privatleben und der notwendigen Zeit fürs Üben, das er aber ohnehin liebe «Es gibt nur ein Ich, aber mit zwei oder drei Profilen» sagt Gigashvili, ein echtes Kind des Instagram-Zeitalters Was diese Profile verbindet? «Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu meinen Auftritten.»
Das bewahrheitet sich, wenn man ihn bei Konzerten mit klassischem Repertoire erlebt. Sein Zugang überzeugt durch eine ungemeine Frische, aber auch durch die Risikobereitschaft, mit der er stets aus dem Moment heraus agiert. Auf der Bühne bewegt sich Gigashvili mit einer gelassenen, sicheren Selbstverständlichkeit, als trete er gerade mit Band in einem kleinen Club auf Bei Zugaben improvisiert er auch schon einmal drauflos, wenn ihn gerade die Lust darauf packt Schliesslich gibt es etwas, das er selbst als sein grosses Ziel bezeichnet: mehr junge Menschen in klassische Konzerte zu bringen. In Georgien gelingt ihm dies bereits, dort mischen sich bei seinen Auftritten die Fans seiner unterschiedlichen Profile schon längst. Dass das in westlicheren Gefilden nicht so selbstverständlich ist, weiss er Aber er fordere sich selbst ohnehin immer wieder gern heraus: «Ich möchte klassische Musik zu etwas für jedermann machen.»
William Christie bringt mit Sängernachwuchs aus seinem Projekt «Le Jardin des Voix» zwei äusserst selten zu hörende Opern von Marc-Antoine Charpentier ans Lucerne Festival Christie versteht sich wie kein Zweiter auf die Delikatesse der französischen Barockmusik.
MARTINA WOHLTHAT
Lange komponierte Marc-Antoine Charpentier im Windschatten des französischen Hofes Anerkennung erhielt er erst spät. Und obwohl sein riesiges Œuvre rund 550 Werke umfasst, die von einer fabelhaften Kompositionskunst zeugen, geriet er nach seinem Tod im Jahr 1704 in Vergessenheit – bis er genau 250 Jahre später, 1954, doch noch zu spätem Ruhm kam: als Komponist der Eurovision-Hymne. Die Fanfarenklänge die natürlich auch jüngst wieder die Übertragung der ESC-Shows eröffneten, stammen ursprünglich aus dem Prélude zu Charpentiers «Te Deum». Der amerikanische Wahlfranzose und Dirigent William Christie ist ein Kenner des komponierenden Chamäleons Marc-Antoine Charpentier und bringt nun gleich zwei seiner Opern ins KKL Luzern, darunter das Operndivertissement «Les Arts florissants», nach dem sich auch Christies 1979 gegründetes Barockensemble benannte Kombiniert wird diese Hymne auf die blühenden Künste mit einer Rarität – der Orpheus-Oper «La Descente d’Orphée aux enfers»
Ein Schatten in der Unterwelt
Diese zwei Juwelen barocker Theatermusik enthalten alle Ingredienzien der damaligen Gesangskunst: Chöre im Stil der römischen Schule, beredte deklamatorische Soli, anrührende Arien und Anklänge an Lullys Komödien mit prächtigen Ouvertüren und grazilen Instrumentalstücken. Die jungen Sängerinnen und Sänger, die von William Christie und Paul Agnew ausgewählt wurden, treten in Luzern gemeinsam mit den Musikern von Les Arts florissants auf und tauchen ein in das Kernrepertoire des Ensembles: die französische Musik des Grand Siècle. Bei seinen musikalischen Projekten war Charpentier nicht zu bremsen, hinsichtlich seiner eigenen Person hielt er

sich aber stets bedeckt. Lediglich eine biografische Notiz aus seiner Feder ist überliefert; sie hat es aber in sich: In seiner Kantate «Epitaphium Carpentarii» porträtiert sich der Komponist als Geist in der Unterwelt und legt seinem eigenen Schatten selbstironische Worte in den Mund: «Ich bin der, der vor kurzem geboren wurde und in der Welt bekannt war; hier bin ich, tot, nackt und nichtig im Grab, Staub, Asche und Nahrung für den Wurm Ich habe genug gelebt aber nicht genug wenn man die Ewigkeit in Betracht zieht. Ich war Musiker, galt als
gut unter den Guten und als unwissend unter den Unwissenden. Und da die Zahl derer, die mich verachteten, grösser war als die Zahl derer die mich lobten, war die Musik für mich von geringer Ehre, aber von grosser Last; und so wie ich bei meiner Geburt nichts in diese Welt brachte, so nahm ich auch beim Sterben nichts mit.»
Sich selbst als Schatten in der Unterwelt zu porträtieren, das ist in der Musikgeschichte einzigartig und erinnert an das Selbstbildnis des Malers Michelangelo an der Wand der Sixtinischen Kapelle Mit
zwanzig Jahren reiste Charpentier nach Rom und nahm Unterricht beim Oratorienkomponisten Giacomo Carissimi
Die Nähe zum italienischen Stil wurde Charpentiers Markenzeichen, mit dem er sich von seinen französischen Zeitgenossen unterschied. Nach dreijährigem Italien-Aufenthalt kehrte er Ende der 1660er Jahre nach Paris zurück, wo ihm Maria von Lothringen, die Herzogin von Guise, eine Wohnung in ihrem Palast im Marais-Viertel zur Verfügung stellte. Für ihren Haushalt komponierte Charpentier insgesamt acht Kammeropern, darunter das Divertissement «Les Arts florissants» und die Orpheus-Oper «La Descente d’Orphée aux enfers».
Musik und Tanz
Wie die Aufführungen damals ausgesehen haben, wissen wir nicht. Bekannt ist, dass Charpentier selbst im Stimmfach des Haute-contre, der typisch französischen, hohen Variante der Tenorstimme, mitwirkte. Bei der Luzerner Wiederaufführung soll daraus nun ein Fest der Künste werden, das das Regieteam Marie Lambert-Le Bihan und Stéphane Facco gemeinsam mit dem Choreografen Martin Chaix und seinen Tänzern als halbszenische Aufführung realisiert.
Moderne Choreografie verbunden mit Barockmusik im Originalklang, das verspricht ein attraktives Gefüge Der französische Choreograf Martin Chaix war als Tänzer Solist beim Leipziger und beim Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg, wo er bis 2015 unter der Leitung von Martin Schläpfer tanzte Seither arbeitet er als Choreograf für renommierte Ensembles wie das Ballet de l’Opéra national du Rhin, das Ballet de l’Opéra national de Paris oder das Ballett am Rhein. Seine emotionale und musikalische Bewegungssprache lebt von der Verbundenheit und Menschlichkeit der Bühnencharaktere – eine ideale Besetzung für
Christies barockes Nachwuchsprojekt. Das Opern-Divertissement «Les Arts florissants» schildert, wie die Künste (Musik, Dichtung, Malerei,Architektur) unter der Herrschaft Ludwigs XIV. blühen, bevor sie in einen Streit zwischen den Hauptfiguren La paix (Frieden) und La discorde (Zwietracht) hineingezogen werden. Nach einem kurzen Kampf, in dem La discorde und die Furien die Oberhand gewinnen, bittet der Friede den Göttervater Jupiter, zu intervenieren. Prompt werden die Zwietracht und ihre Anhänger durch einen Hagel von Blitzen zurück in den Hades gejagt. Damit lässt sich eine Brücke schlagen zu «La Descente d’Orphée aux enfers». In Charpentiers Vertonung dieses Ur-Mythos der Gattung Oper spielt das Orchester leuchtkräftiger, mit einer dramatischen Wucht, die in der französischen Oper sonst erst mit Rameau, vierzig Jahre später Einzug hält. Zwei Akte von Charpentiers Orpheus-Oper sind heute überliefert, wahrscheinlich ist sie ein Fragment. Es müsste noch ein weiterer Akt folgen, um die Geschichte von Orpheus und Eurydike zu Ende zu erzählen.
Nach Eurydikes Tod steigt Orpheus, dem Rat Apolls folgend, in die Unterwelt um die Rückkehr seiner Gemahlin zu erbitten. Im zweiten Aufzug verzaubert der Sänger die Verdammten und Furien Damit rührt er das Herz der Göttin Proserpina, die ihren Gatten Pluto überredet, Eurydike zu den Lebenden zurückkehren zu lassen. Pluto macht zur Bedingung, dass Orpheus sich auf dem Weg aus der Unterwelt nicht nach Eurydike umsieht. Zu den ahnungsvollen Worten «Liebe, glühende Liebe, kannst du dich wohl beherrschen? Ach, wie der liebende Orpheus sich vor sich selbst fürchtet» geht Orpheus ab, worauf der Chor der Schatten seinen Abschied beklagt Damit endet Charpentiers Manuskript. Wie die Geschichte ausgeht, bleibt offen – durchaus im Sinne des diesjährigen Festivalmottos
Ein Orgelfest mit Naji Hakim und Wayne Marshall setzt die bedeutende Goll-Orgel des KKL ins rechte Licht.
WOLFGANG STÄHR
Ein Thronjubiläum gilt es zu feiern und einen runden Geburtstag obendrein. Beides trifft zusammen beim Orgelfest am 10 September, wenn der bekannte britische Organist Wayne Marshall auf der 25 Jahre jungen Goll-Orgel, der «Königin» im Konzertsaal des KKL Luzern, eines der Orgelkonzerte des vor 70 Jahren in Beirut geborenen Organisten Naji Hakim spielt. Hakim repräsentiert die ebenso glamouröse wie experimentierfreudige französische Orgeltradition. Über Jahrzehnte widmete der Komponist und Katholik sein Leben und seine Kunst der Kirche, diente als Organist an der Basilika Sacré-Cœur und – als Nachfolger des grossen Olivier Messiaen – an der Église de la Sainte-Trinité in Paris.
Musik der Freude
Aber wer hört in der katholischen Kirche noch auf die Musik? In dieser Frage erweist sich Naji Hakim durchaus als Skeptiker – und steigert sich leicht in eine regelrechte Wutrede wenn er beklagt: «Die christlich inspirierte Tonkunst hat die Liturgie verlassen und ihre Zuflucht im Konzert oder im Aufnahmestudio gefunden.» Mit geradezu existenziellen Folgen: «Viele Künstler gehen wegen des kulturellen Niedergangs der Liturgie nicht mehr in die Kirche Andere aus nichtchristlichen Milieus sind von jeglicher religiö-

sen Praxis abgeschreckt.» Hakim ging schon früh daran, dies grundsätzlich zu ändern Sein Arbeitgeber hat ihm die harsche Kritik an der musikalischen Verödung der Messfeier denn auch nicht verübelt oder gar vergolten. Im Gegenteil: 2007 wurde Hakim wegen seiner Verdienste um die Kirche vom damaligen (bekanntlich sehr musikliebenden) Papst Benedikt XVI. mit dem Ehrenkreuz Pro Ecclesia et Pontifice ausgezeichnet. Ausserdem ist er Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Kirchenmusik in Rom, die den «Heiligen Stuhl» in Fragen der Musik und der
Liturgie berät. Zudem ist Hakim durch die von ihm angeprangerte Geringschätzung der liturgischen Kunst nicht in kreative Schockstarre verfallen
Der Organist kennt keinen Unterschied zwischen Religion und Kunst, zwischen geistlicher und profaner Musik. In seinen liturgisch definierten Werken wie der «Messe Solennelle», die er ausdrücklich «zu Ehren des Organisten und Dirigenten Wayne Marshall» für Chor und Orchester bearbeitete, entfacht er wie in seinem fünften Orgelkonzert, das in Luzern erklingt, eine feierliche packende, menschenfreundliche Musik
Zwei verwandte Orgelkonzerte brausen und stürmen durch die prächtige, klanggewaltige Goll-Orgel.
(mitsamt Ohrwurmeffekten). Eine Musik, die nicht bloss zum Vergessen des Alltags verlockt, sondern vielmehr ins Bewusstsein ruft, worauf es im Leben am meisten ankommt: auf eine unbeirrbare, gemeinschaftliche in der Not auch lautstarke Freude, die allen Zweifeln trotzt und alle Ängste hinwegfegt
Geistesverwandte
Hakim schrieb sein Konzert für Orgel, Streicher und Pauken als Hommage an das identisch besetzte Werk von Francis Poulenc, der sein Konzert wiederum als
Hommage an Johann Sebastian Bach verstand Poulenc, 1899 in Paris geboren ein Protagonist der undogmatischen, urbanen Avantgarde, war zunächst mit provozierend unernsten, gegen den Strich gebürsteten Stücken bekannt geworden, mit geradezu unverschämtem Witz und hemmungslosem Eklektizismus
Doch nach 1930 geriet er in eine schwere Krise Ausgelöst durch den Unfalltod eines Freundes litt er an Depressionen und Identitätszweifeln. Sie führten schliesslich zu einer Rückbesinnung auf den katholischen Glauben seiner Kindheit, inklusive einer Wallfahrt zur Schwarzen Madonna nach Rocamadour Zwischen diesen Ereignissen und spirituellen Erweckungen wandelte sich unweigerlich auch der Ton seiner Musik
Diese beiden offenkundig geistesverwandten Orgelkonzerte, das einzige von Poulenc und das fünfte von Hakim, wird Wayne Marshall mit den Festival Strings Lucerne und Daniel Dodds in einem unorthodoxen und dabei aber höchst vergnüglichen Festkonzert musizieren, zur Feier und Ehre der fast schon königlichen Jubilarin: der vor 25 Jahren im KKL eingeweihten GollOrgel mit ihren 4387 Pfeifen, 66 Registern, 4 Manualen und 1 Pedal. Der Geist weht, wo er will: Am 10. September braust und stürmt er durch diese klanggewaltige und prachtvolle Orgel, die den Konzertsaal krönt und den Himmel aufreisst über Luzern
Kent Naganos aufsehenerregende Interpretation von Wagners «Ring» auf Originalinstrumenten ist beim dritten Teil des Zyklus angekommen. Dessen Titelheld wird bis heute oft missverstanden
ROBERT JUNGWIRTH
Der Held erschrickt. So etwas hat er noch nie gesehen. Eine Frau! Der Held hat Angst, er möchte am liebsten davonlaufen. Er der das Fürchten nicht gelernt hat, kennt es nun – und ruft nach der Mutter: «Das ist kein Mann! Brennender Zauber zückt mir ins Herz; feurige Angst fasst meine Augen Mutter, Mutter! Gedenke mein!» Aber Siegfried ist auch fasziniert von der Frau, die da schlafend vor ihm liegt; mehr noch: Er ist umgehend schockverliebt. Das gibt es in Opern häufiger, es hilft den Komponisten, ohne lange Vorrede gleich zur Liebesgeschichte vorzudringen, die sich viel leichter in Musik übersetzen lässt als eine mühsame Annäherung Doch zurück zum Fürchten. Fürchten könnte sich unser Held Siegfried sogar gleich aus zwei Gründen. Zum einen hat er bei seinem Ziehvater Mime noch nie eine Frau zu Gesicht bekommen Zum anderen müsste ihn eigentlich irritieren, dass die Frau, in die er sich da gerade verliebt, seine Tante ist. Aber davon weiss unser Held ohne Vergangenheit und feste Moralbegriffe nichts, denn er kennt ja noch nicht einmal seine Eltern Und ein Inzest mehr oder weniger macht im Sündenbabel von Wagners «Ring» auch nicht mehr viel aus Schliesslich ist Siegfried selbst das Ergebnis eines Geschwisterinzests Seinem Grossvater Wotan zerhaut er obendrein den Speer, ohne zu wissen, wer da vor ihm steht. Das erinnert an Ödipus Immerhin kommt der Göttervater anders als Laios bei Sophokles, mit dem Leben davon. Keine Frage, Sigmund Freud hätte an den tiefenpsychologischen Implikationen dieser Oper seine Freude gehabt Nicht wenige behaupten, Wagner habe manche Themen und Theorien Freuds vorweggenommen. Darauf hat beispielsweise Leonard Bernstein hingewiesen; und schon vor ihm Thomas Mann, der feststellte: «Nichts kann wagnerischer
sein als diese Mischung aus mythischer Urtümlichkeit und psychologischer, ja psychoanalytischer Modernität». Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass in dieser Oper nicht nur der Titelheld ein Naturbursche ist, sondern dass der urwüchsigen Natur selbst eine heimliche Hauptrolle zugewiesen wird Der erste Akt spielt «im Wald» der zweite «im tiefen Wald», der dritte in einer «wilden Gegend am Fuss eines Felsenberges». Inspiration gewann Wagner dafür unmittelbar aus seinem Erleben der Schweizer Natur – weite Teile des «Siegfried» sind in Zürich und am Vierwaldstättersee entstanden.
Inspiration aus dem Sihltal Wagner notierte in seiner Autobiografie: «Meine täglichen Spaziergänge richtete ich an den heiteren Sommernachmittagen nach dem Sihltal, in dessen waldiger Umgebung ich viel und aufmerksam nach dem Gesange der Waldvögel lauschte Was ich von ihren Weisen mit nach Hause brachte, legte ich in der Waldszene ‹Siegfrieds› in künstlerischer Nachahmung nieder.» Gerade hier dürfte die nach dem Originalklang der Wagner-Zeit strebende Interpretation Kent Naganos Zeichen setzen Und auch das «Heldische» dürfte mit historischen Instrumenten anders hörbar werden als mit den im 20. Jahrhundert vorwiegend auf Brillanz und Lautstärke getrimmten Instrumenten, vor allem dem sehr präsenten Blech. Wagners «Siegfried» ist freilich nicht nur eine Natur-Oper mit märchenhaften Zügen, sondern auch ein Sex-andCrime-Drama Es gibt Mord und Totschlag, einen versuchten Giftmord, Gier nach Gold und Macht, Lug und Trug und hemmungslosen Sex – davor senkt sich allerdings der Vorhang Zudem laufen im «Siegfried» alle Handlungsstränge zusammen: Die Weichen werden gestellt für das Ende des gesamten «Rings». Mit der Liebesbegegnung zwischen Sieg-

fried und Brünnhilde scheint für einmal alles offen, noch könnte die Welt gerettet werden. Es gibt Hoffnung und die Hoffnung heisst Siegfried.
Ein Weltenretter?
Wir blicken heute kritischer auf diesen Helden, den Wagner als potenziellen (aber in der «Götterdämmerung» scheiternden) Weltenretter in Szene setzte Der Naturbursche kann zwar Schwerter schmieden und den Drachen töten, aber er ist doch recht einfältig und leicht zu manipulieren, wenn ihm nicht gerade ein Vogel erzählt, was wirklich abläuft. Frei nach Thomas Bernhard könnte man ihn treffender als «Untergeher» bezeichnen. Siegfried ist zum Untergang bestimmt wie die Götterwelt Erst wenn die alte Ordnung untergeht, kann etwas Neues erstehen. Und Siegfried ist nolens
volens Teil der überkommenen Welt, die zusammen mit ihm untergeht. Das macht seine Tragik aus – ganz im Sinn der klassischen Tragödientheorie, nach welcher der schuldlos schuldige Held scheitern muss Ist Siegfried also ein positiver Held? Er ist kein Kämpfer für eine gerechte Sache, kein reflektierter Held und taugt heute auch kaum mehr als Identifikationsfigur Eher erscheint er wie eine Naturgewalt – schöpferisch, aber auch zerstörerisch.
Für Wagner war Siegfried ursprünglich eine Utopie Er sollte der Mensch sein, der ausserhalb der alten, korrupten Ordnung steht; einer, der nicht durch Verträge, Besitz oder Angst motiviert ist, sondern durch Liebe, Mut und Spontaneität Von seinem Schöpfer als «freier Held» gedacht, als Verkörperung einer neuen Menschlichkeit jenseits von Gier Macht und Intrige, wird Siegfried in der
Siegfried wird zum Spiegelbild unserer Zivilisation: Hochfliegend im Anspruch, tragisch im Scheitern.
tatsächlichen Ausgestaltung dennoch zur zwiespältigsten Figur des ganzen Zyklus Denn so frei Siegfried scheinen mag so erschreckend ist seine Blindheit gegenüber den moralischen, emotionalen und politischen Dimensionen seiner Welt Seine Unkenntnis der eigenen Herkunft, seine Gleichgültigkeit gegenüber Geschichte und Verantwortung machen ihn zum Spielball ebenjener Mächte, die er zu überwinden glaubt Und so mündet seine Freiheit in Zerstörung Nicht weil er böse wäre, sondern weil ihm die Einsicht fehlt. Unversehens wird dieser «Held» zu einem Spiegel unserer heutigen Zivilisation: hochfliegend im Anspruch, tragisch im Scheitern.Am Ende des Liebesduetts zwischen Siegfried und Brünnhilde, das die Oper krönt, hat Wagner dies auf eine vieldeutige Formel gebracht: «Leuchtende Liebe – lachender Tod!»
Benjamin Brittens Oper «Peter Grimes» erzählt das Drama eines Aussenseiters, den seine Umgebung zum Mörder stempeln will. Die Luzerner Neuinszenierung kann auf einer spannenden Deutungsgeschichte aufbauen
THOMAS SCHACHER
Alles begann mit einem Zeitungsartikel 1941 las Benjamin Britten in einem Magazin der BBC einen Artikel über den englischen Dichter George Crabbe, der im frühen 19 Jahrhundert in der Grafschaft Suffolk gelebt hatte. Auch Britten stammte aus dieser Gegend, war aber zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mit seinem Partner, dem Tenor Peter Pears, in die USA ausgewandert Dem Pazifisten schienen die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Amerika besser als in England. In einem Antiquariat stiess Pears dort auf Crabbes Versgedicht «The Borough», das die tragische Geschichte des Fischers Peter Grimes enthält. Nach der Lektüre war Britten Feuer und Flamme: «Blitzartig realisierte ich zwei Dinge: dass ich eine Oper schreiben muss, und wohin ich gehöre.» Britten und Pears begannen noch in den USA mit dem Ausarbeiten eines Szenarios, und als die Beiden 1943 nach England zurückkehrte fanden sie in Montagu Slater den geeigneten Dichter, der das Szenario in ein Libretto verwandelte Im Januar 1944 begann Britten mit der Komposition, ein gutes Jahr später war sie vollendet Die Uraufführung von «Peter Grimes» fand am 7. Juni 1945 am Sadler’s Wells Theatre in London statt. Sie wurde Brittens internationaler Durchbruch. Peter Grimes wird verdächtigt, seinen Lehrling um-
gebracht zu haben. Der Richter erklärt dessen Tod zwar für einen Unfall, doch die Dorfbewohner zweifeln nicht daran, dass Grimes der Mörder ist. Die Einzigen, die zu ihm halten, sind die Witwe Ellen Orford und der Kapitän Balstrode Der Apotheker Ned Keene verschafft dem Fischer einen Gehilfen, einen Jungen aus dem Armenhaus An einem Sonntag als die Dorfbewohner in der Kirche sitzen, zwingt Grimes den Gehilfen zur Ausfahrt auf die sturmbewegte See. Bei dem Versuch, das Schiff zu erreichen, stürzt der Knabe über eine Klippe und stirbt. Wiederum sind die Dorfbewohner überzeugt, dass Grimes den Gehilfen umgebracht hat. Um der Rache der fanatisierten Menge zu entgehen, rudert er allein aufs Meer hinaus und versenkt sein Schiff
Schuldig oder nicht?
Die Unterschiede zwischen Brittens Libretto und der literarischen Vorlage zeigen sich hauptsächlich in der Charakterisierung der Titelfigur. Crabbe hatte Grimes aus der Optik eines anglikanischen Geistlichen als unverbesserlichen
Bösewicht dargestellt Bei Britten bleibt dagegen vieles in der Schwebe Ist der Fischer schuldig oder nicht? Ist er ein
Opfer des Mobs, oder hat er den Jungen tatsächlich umgebracht? Spielt womöglich sogar Pädophilie eine Rolle?
Es bleibt alles offen, unserer Deu-
tung und der einer klugen Regie überlassen Was den Komponisten am Stoff zweifellos interessierte, war die Aussenseiterthematik, ein Thema, mit dem er sich auch persönlich stark identifizierte Damit verbunden ist der Konflikt zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Weil Grimes anders ist als die Dorfbewohner wird er erbarmungslos gemobbt Das Libretto ist mit zahlreichen Chornummern ausgestattet, die diesen Konflikt eindrucksvoll in den Vordergrund rücken. Und nicht zuletzt ist auch das Meer, mit dem Britten die Erinnerung an seine Kindheit an der Küste Ostenglands verband, ein Akteur des Geschehens Es gibt in «Peter Grimes» sechs grosse OrchesterZwischenspiele, bekannt als «Sea Interludes», in denen Britten unterschiedliche «Aggregatszustände» des Meeres darstellt. Dramaturgisch schaffen diese den Zusammenhang zu den nachfolgenden Szenen Das Interludium vor der zweiten Szene des zweiten Akts beispielsweise bereitet in seinem Wechsel von milden und aufgepeitschten Stimmungen die Begegnung Grimes’ mit dem Jungen vor.
Gegensätzliche Rollenbilder
Die Oper «Peter Grimes» verbindet traditionelle Formen und zeitgenössische Kompositionstechniken, eine an Henry Purcell angelehnte Deklamation

und die an Igor Strawinsky und Dmitri Schostakowitsch geschulte ironische Distanz zu einem Gebilde von starker Ausstrahlungskraft. Der Erfolg des Werks zumal so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestärkte ihn in seiner Absicht, die Gattung Oper künftig zu einem Schwerpunkt seines Schaffens zu machen. Zu den insgesamt neun folgenden Werken gehören «Billy Budd», «A Midsummer Night’s Dream» und schliesslich noch «Death in Venice» nach der Erzählung von Thomas Mann. Die Aufführungsgeschichte von «Peter Grimes» ist durch hochkarätige Ein-
spielungen bestens dokumentiert. Bei der Besetzung der Hauptfigur lassen sich zwei Stränge der Interpretation ausmachen Der Tenor Peter Pears, der bei der Uraufführung und bei frühen Tonaufzeichnungen (zum Beispiel 1958, Decca) unter der Leitung des Komponisten sang, zeichnete Grimes als grüblerischen und zerrissenen Charakter Nach Brittens Tod wurde der Kanadier Jon Vickers zum führenden GrimesInterpreten (1978, Philips, Colin Davis) und entdeckte noch andere Seiten: Er verwandelte den streitbaren Fischer in einen positiven Helden.
Eine bemerkenswerte Interpretation der Rolle realisierte am Opernhaus Zürich der als Parsifal bekannt gewordene Tenor Christopher Ventris (2005, EMI, Franz Welser-Möst, David Pountney), der Grimes «als sensiblen, introvertierten Charakter» zeichnete, wie damals die NZZ berichtete Mit Spannung blickt man nun nach Luzern, wo «Peter Grimes» ab dem 6. September als Koproduktion des Luzerner Theaters mit dem Lucerne Festival gezeigt wird. Der Dirigent ist Jonathan Bloxham, der Musikdirektor des Theaters Regie führt Wolfgang Nägele, den man hierzulande von seiner «Macbeth»Inszenierung kennt. In der Titelrolle ist Brett Sprague zu erleben: Als hier noch weitgehend unbeschriebenem Blatt stehen dem Amerikaner alle Möglichkeiten einer Neudeutung der Figur offen.











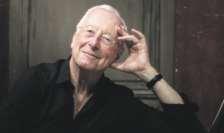

Sa16.August
18.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal LucerneFestivalOrchestra|Andrés Orozco-Estrada Dirigent |IsabelleFaust Violine Dvořák|Mussorgsky/Ravel
Di19.August
19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal LucerneFestivalOrchestra|Riccardo Chailly Dirigent |BeatriceRana Klavier Rachmaninow
Do21.August
18.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal LesMusiciensduPrince—Monaco| GianlucaCapuano Dirigent |EdgardoRocha| PeterKálmán|CeciliaBartoli|NicolaAlaimo| Ildebrandod’Arcangelo RossiniIlbarbierediSiviglia
Mo25.August
19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal OrchestrePhilharmoniquedeRadioFrance| MirgaGražinytė-Tyla Dirigentin | JuliaHagen Violoncello Elgar|Debussy|Ravel
Sa30.August
18.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal OrchestredeParis—Philharmonie| Esa-PekkaSalonen Dirigent |StefanDohrHorn Strauss|Salonen|Sibelius
So31.08.August
19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal RoyalConcertgebouwOrchestra| KlausMäkelä Dirigent |JanineJansen Violine Mozart|Prokofjew|Bartók
Di02.September
19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal BerlinerPhilharmoniker| KirillPetrenko Dirigent |AlbrechtMayerOboe Schumann|B.A.Zimmermann|Brahms
Do04.September
19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal MahlerChamberOrchestra|MaximEmelyanychev Dirigent|TabeaZimmermann Viola Mozart|Bartók|Tschaikowsky
Fr05.September
19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal WienerPhilharmoniker| FranzWelser-Möst Dirigent Berg|Bruckner
So07.09.September
11.00Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal MitsukoUchida Klavier Beethoven
So07.09.September
18.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal LucerneFestivalContemporaryOrchestra (LFCO)|ElenaSchwarz Dirigentin | Pierre-LaurentAimard Klavier Neuwirth|Ravel|Boulez
Mo08.September 19.30Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal LesArtsFlorissants|WilliamChristie Dirigent | Solist*innendes«JardindesVoix»2025 Charpentier
Fr12.September
17.00Uhr|KKLLuzern,Konzertsaal DresdnerFestspielorchester|ConcertoKöln| KentNagano Dirigent |Solist*innen WagnerSiegfried
Di 12.08 19.30
WorldsBeyondOrchestra|DanielSchnyderu.a.| «KlingendeSeidenstrasse» Mi 13.08 19.30 KS MozartyMambo HavanaLyceumOrchestra JoséAntonioMéndezPadrón|SarahWillis Mozart,Bizet/Olivero,Oliva,kubanischeEvergreens Fr 15.08 18.30 KS LucerneFestivalOrchestra1 Eröffnung LucerneFestivalOrchestra|RiccardoChailly ElīnaGaranča Jacques Zoon|WinnieHuang|Boulez,Mahler 18.30 ILakesideSymphony Live-Übertragung:DasEröffnungskonzertfüralle
Sa16.08 18.30 KS LucerneFestivalOrchestra2 LucerneFestivalOrchestra|AndrésOrozco-Estrada|IsabelleFaust| Dvořák,Mussorgsky/Ravel
So 17.08 16.00|LS PortraitBoulez&Stroppa1 ArdittiQuartet Stroppa,Boulez
19.30 KS West-EasternDivanOrchestra West-EasternDivanOrchestra|DanielBarenboim LangLang Mendelssohn,Beethoven
Mo 18.08 19.30 KS UkrainianFreedomOrchestra UkrainianFreedomOrchestra|Keri-LynnWilson|RachelWillis-Sørensen| Kolomiiets,Strauss,Beethoven
Di19.08 19.30 KS
LucerneFestivalOrchestra3 LucerneFestivalOrchestra|RiccardoChailly BeatriceRana Rachmaninow
Mi 20.08 19.30 KS RezitalLangLang LangLang|Fauré,Schumann,Chopin
Do 21.08 12.15|LK DebutPrixUBS JeunesSolistes VsevolodZavidov|Liszt
18.30 KS IlbarbierediSiviglia LesMusiciensduPrince—Monaco GianlucaCapuano|CeciliaBartoli| EdgardoRocha|PeterKálmán|Ildebrandod’Arcangelou.a.|Rossini Fr 22.08 19.30 KS LuzernerSinfonieorchester LuzernerSinfonieorchester| MichaelSanderling|DanielLozakovich Sibelius,Tschaikowsky 22.00 MBKPortraitWinnieHuang WinnieHuang|EnsembledesLucerneFestivalContemporary Orchestra(LFCO) vanEck,Barrett,Marino/Basica
Sa23.08 11.00|LS
LucerneFestivalAcademy1 LucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)|JonathanNott ProduktionsteamIRCAM|Fujikura,Boulez
ab14.00 E40minOpenAir RosamundBrassQuartet|LucerneFestivalContemporaryOrchestra (LFCO)|MathiasLandtwingQuartett|SaraTaubman-Hildebrand
18.30 KS LucerneFestivalOrchestra4 LucerneFestivalOrchestra|SirSimonRattle|ClayHilley| MagdalenaKožená Schostakowitsch,Mahler 21.00|LS
LucerneFestivalAcademy2 EnsembledesLucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)| Teilnehmer*innendesContemporary-ConductingProgram|AnthonyMillet| Stroppa,Boulez,Kwong,Lin,Louilarpprasert,Regent
So 24.08 11.00|KS LucerneFestivalOrchestra5 Solist*innendesLucerneFestivalOrchestra|TabeaZimmermann| vonBingen,Gubaidulina,Kurtág,Berio
15.00|LS ComposerSeminar: Abschlusskonzert InternationaleEnsembleModernAkademie(IEMA-Ensemble2024/25)| Teilnehmer*innendesContemporary-ConductingProgram
18.30 KS RoyalPhilharmonicOrchestra RoyalPhilharmonicOrchestra|VasilyPetrenko|Anne-SophieMutter| Korngold,Williams,Rimsky-Korsakow Mo 25.08 19.30 KS OrchestrePhilharmoniquede RadioFrance OrchestrePhilharmoniquedeRadioFrance MirgaGražinytė-Tyla| JuliaHagen|Elgar,Debussy,Ravel
Di26.08 12.15|LK DebutJakobManz JakobManz JohannaSummer Jazz-ProgrammnachAnsage
19.30 KS LucerneFestivalOrchestra6 LucerneFestivalOrchestra|YannickNézet-Séguin Seong-JinCho| Beethoven,Bruckner
Mi 27.08 19.30 KS räsonanz—Stifterkonzert NetherlandsRadioPhilharmonicOrchestra&Choir| KarinaCanellakis|LivRedpath|BertrandChamayou Boulez,Chin,deRaaff
Do 28.08 12.15|LK DebutGabrielPidoux GabrielPidoux|Poulenc,Tschaikowsky,Dranishnikova,Holliger, Brahms,Schumann
19.30 KS OrchestradiSantaCecilia Orchestradell'AccademiaNazionalediSantaCecilia—Roma| DanielHarding|MarthaArgerich|Beethoven,Brahms
Fr29.08 ab16.00|CR Onetoone WinnieHuang|Kurz-PerformancesfürjeeinenGast
19.30 KS OrchestredeParis Philharmonie1 OrchestredeParis—Philharmonie|Esa-PekkaSalonen| AugustinHadelich Brahms,Prokofjew
Sa30.08 14.30|KS LucerneFestivalAcademy3 LucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)|MichelleDiRusso| DavidRobertson SebastianZinca|TabeaZimmermann Palomar,Raab,Ammann
18.30 KS OrchestredeParis Philharmonie2 OrchestredeParis—Philharmonie|Esa-PekkaSalonen StefanDohr Strauss,Salonen,Sibelius
21.00|LS LucerneFestivalAcademy4 LucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)|DavidRobertson| ProduktionsteamIRCAM|Stroppa,Boulez
So31.08 10/15 NFamilienkonzert «BarkaBach».EininszeniertesKonzert
11.00|KS RezitalAndrásSchiff SirAndrásSchiff| J.S.Bach,,Mozart,Haydn,Beethoven,Mendelssohn,Schumann
16.00|LS WerkstattPierreBoulez LucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)|DavidRobertson| Boulez
19.30 KS RoyalConcertgebouw Orchestra1 RoyalConcertgebouwOrchestra|KlausMäkelä|JanineJansen| Mozart,Prokofjew,Bartók
Mo 01.09 19.30 KS RoyalConcertgebouw Orchestra2
RoyalConcertgebouwOrchestra|KlausMäkelä|Schubert/Berio,Mahler
Di02.09 12.15|LK DebutDavidNebe DavidNebel|Mozart,Ravel,Schostakowitsch,Franck 19.30 KS BerlinerPhilharmoniker1 BerlinerPhilharmoniker|KirillPetrenko|AlbrechtMayer| Schumann,B.A.Zimmermann,Brahms
Mi03.09 19.30 KS BerlinerPhilharmoniker2 BerlinerPhilharmoniker|KirillPetrenko|Mahler
Do04.09 12.15|LK DebutGiorgiGigashvili GiorgiGigashvili Prokofjew,Chopin
19.30 KS MahlerChamberOrchestra MahlerChamberOrchestra|MaximEmelyanychev|TabeaZimmermann| Mozart,Bartók,Tschaikowsky
Fr 05.09 19.30 KS WienerPhilharmoniker1 WienerPhilharmoniker|FranzWelser-Möst Berg,Bruckner Sa 06.09 11.00|LS LucerneFestivalAcademy5 LucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)|VimbayiKaziboni| ClaireChase|StefanJovanovic Gubaidulina,Ustwolskaja,Czernowin
16.00|LS PortraitBoulez&Stroppa2 EnsembleHelix/StudiofürzeitgenössischeMusikderHochschule Luzern—Musik Boulez,Verunelli,Stroppa
18.30 KS WienerPhilharmoniker2 WienerPhilharmoniker|FranzWelser-Möst Mozart,Tschaikowsky
19.00|LT PeterGrimes OpernensembleundOpernchordesLuzernerTheaters| LuzernerSinfonieorchester|Britten
So07.09 10/16|LS Familienkonzert «Klangmission».EineScience-Fiction-OpermitderTaschenoperLübeck
11.00 KS RezitalMitsukoUchida MitsukoUchida Beethoven
18.30|KS LucerneFestivalAcademy6 LucerneFestivalContemporaryOrchestra(LFCO)|ElenaSchwarz Pierre-LaurentAimard|Neuwirth,Ravel,Boulez
Mo08.09 19.30 KS LesArtsFlorissants LesArtsFlorissants|WilliamChristie Charpentier
Di09.09 12.15|LK DebutTamtaMagradze TamtaMagradze Liszt,Franck,Ravel,Schubert/Liszt
19.30 KS RezitalIgorLevit IgorLevit Schubert,Schumann,Chopin
Mi 10.09 19.30 KS Orgel-Jubiläum FestivalStringsLucerne|WayneMarshall|DanielDodds| Poulenc,Hakim,Mozart
Do 11.09 12.15|LK DebutErinysQuartet ErinysQuartet|Webern,Saariaho,Debussy 19.30 KS MünchnerPhilharmoniker MünchnerPhilharmoniker|LahavShani|LisaBatiashvili| Beethoven,Schubert,Wagner
Fr 12.09 17.00 KS Siegfried DresdnerFestspielorchester|ConcertoKöln KentNagano| Solist*innen|Wagner
Sa 13.09 16.00|KS TeatroallaScala ChorundOrchesterdesTeatroallaScala|RiccardoChailly|Verdi,Rossin
So14.09 15.00|KS LesAdieux «EinAbschiedsfestfürMichaelHaefliger» MitdemLucerneFestival OrchestraundRiccardoChailly,einemEnsembledesLucerneFestival ContemporaryOrchestra(LFCO),demWest-EasternDivanEnsemble, SolGabetta,PatriciaKopatchinskaja,IgorLevitundvielenanderen
KKLLuzern: KSKonzertsaal|LSLuzernerSaal|CRClubräume weitereSpielstätten: EEuropaplatz|IInseli|LKLukaskirche|LTLuzernerTheater| MBKModerneBar&Karussell|NNeubad