Naturland
Fachinformationen für den Öko-Landbau NACHRICHTEN

Fit für den Sommer


Koppelweide
Das kann
Ab in die agroforst
Ausgabe 02 | 2024





Bilder:



AUS DER LUFT GEGRIFFEN – SO GEHT N-DÜNGUNG HEUTE
Utrisha N verbessert die N-Effizienz Ihrer Kultur
· Liefert bis zu 3 kg N/ha und Woche; bei optimalen Witterungsbedingungen
· Ergänzt die Düngestrategie
· Eine starke Lösung für rote Gebiete
· Geeignet für Bio-Betriebe, FiBL gelistet
In viele Kulturen einsetzbar: Getreide, Raps, Mais, Kartoffeln

2 | ANZEIGEN
TM ® Markenrechtlich geschützt von Corteva Agriscience und Tochtergesellschaften. © 2024 Corteva.
cl_stock, zorandim75, kunewave (stock.adobe.com)
corteva.de
naturland_nachrichten_UTRISHA N_Apr_2024_210x145.indd 1 01.03.24 10:44
DER RICHTIGE WEG
Wenn es um die Weiterentwicklung des Öko-Landbaus geht, gilt es, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Insofern ist es ein gutes Signal, das Bioland, Naturland und Gäa setzen, wenn sie die Rohwaren ihrer Mitgliedsbetriebe durch eine Branchenvereinbarung gegenseitig anerkennen (Seite 6 – 9).
Denn: Um den Partnerschaften der Öko-Verbände in Sachen Verarbeitung und Handel gerecht zu werden und diese weiter ausbauen zu können, ist eine größere Flexibilität beim Rohstoffbezug sinnvoll und notwendig. Profitieren können Öko-Verbände, Handel, Verarbeitung und natürlich die Bäuerinnen und Bauern. Es ist auch gut, dass die Akteure dieser Kooperation nicht an der Qualität rütteln. Denn die Glaubwürdigkeit darf hierbei nicht leiden, berechtigte Verbrauchererwartungen dürfen nicht enttäuscht werden. Biokreis ist nun seit März ebenfalls dabei und Gespräche mit den anderen Öko-Verbänden laufen. Der gemeinsame Weg scheint also für die Bio-Akteure zu passen.
Auch der von Naturland und Bioland gemeinsam erarbeite Orientierungspreis für Bio-Milch oder die überverbandliche Tierwohl-Checkliste zeigen: Die Öko-Verbände können miteinander im Wettbewerb stehen und dabei trotzdem gemeinsam den Öko-Landbau weiterentwickeln. Oder wie es Naturland-Präsident Huber Heigl sagt: Zwischen den Höfen klappt die Zusammenarbeit längst. Darum sollten wir sie auch in der Verbandsarbeit noch tiefer verankern.

IMPRESSUM
NATURLAND NACHRICHTEN
Herausgeber:
Beratung für Naturland
Öko-BeratungsGesellschaft mbH
Eichethof 1, 85411 Hohenkammer
Telefon: +49 (0)8137/ 6372-902 info@naturland-beratung.de www.naturland-beratung.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P): Martin Bär
Vertrieb: Regina Springer
Telefon: +49 (0)8137/6372-912 r.springer@naturland-beratung.de
Anzeigen: Tanja Edbauer
Telefon: +49 (0)172/3126816 t.edbauer@naturland-beratung.de
Redaktion: Ralf Alsfeld, Roman Goldberger, Walter Zwingel
Titelfoto: Christoph Jorda
Grafik & Layout: Werbeagentur Oberhofer, Ingolstadt Alison Goldberger, Rainbach
Druck: Riegler Druck, Pfaffenhofen
Papier: Circle Offset Premium White, 100 % Recycling, nach Blauer Engel zertifiziert, Umschlag 200 g/qm, Innenteil 90 g/qm
Bezug: Die Fachzeitschrift erscheint sechsmal im Jahr im Umfang von mind. 80 Seiten. Der Bezugspreis der Naturland Nachrichten ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Alle namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion zulässig.
Wir formulieren in unseren Texten die weibliche und männliche Form aus.
Wenn dies die Lesbarkeit beeinträchtigt, verwenden wir die generische Form – diese schließt Frauen dann selbstverständlich ein.
DER UMWELT ZULIEBE
Die Naturland Nachrichten werden aus Recyclingpapier (Blauer Engel) und mit natürlichen Farben ohne Mineralöl hergestellt. Druck und Versand erfolgen CO2-neutral durch Kompensation. Daher darf die Zeitschrift – als Ganzes – den Blauen Engel tragen.

LEITARTIKEL | 3
Ralf Alsfeld
Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Naturland e.V. r.alsfeld@naturland.de

Fit für den Sommer
24 KEIN PLATZ IN DER SONNE
Selbstbaulösung: Beschattung für Kühe
29 DAS GRÜNDACH KÜHLT Aufbau und Wirkung eines Gründachs
30 FRISCHE LUFT
Milchviehställe mit Ventilatoren ausrüsten
34 KÜHLEN KOPF BEWAHREN Kühlmöglichkeiten für Geflügelställe
36 SCHWEINE WOLLEN’S KÜHL
Suhlen und Duschen für Schweine



MARKT & VERMARKTUNG
40 MARKT & PREISE Aktuelle Entwicklungen
42 INTERVIEW
„Bio ist das neue Normal“
46 BIOFACH
Starker Auftritt auf der Biofach

SEITE 66

RIND & GRÜNLAND
48 WEIDE
Ab in die Koppelweide
53 BERATERTIPP Mortellaro-Bekämpfung
54 HERDENMANAGEMENT
Der Kuhversteher am Naturland-Betrieb Rutz
58 RAUS AUS DER ANBINDEHALTUNG Praktische Lösung am Naturland-Betrieb Grünwald
SEITE 18
SEITE 62
SEITE 24
4 | INHALTSVERZEICHNIS

SEITE 84

SCHWEIN & GEFLÜGEL
62 7 TIPPS… für einen guten Ferkelstart
66 HYBRIDRASSEN „Eier legen sie alle“
69 BERATERTIPP

SEITE 48
SEITE 6
AUS DEM NATURLAND
6 INTERVIEW
Schulterschluss für Bio
10 AKTUELLES
Das Naturland in Bildern
12 POLITIK & VERBAND Mehr Mitglieder in schwierigen Zeiten
70 AUS DER PRAXIS Naturland-Betrieb Warnke
84 DIE ROLLHACKE
Immer öfter zu sehen
86 NEUHEITEN
Neue Technik für den Klimawandel
90 KLEESEIDE
Anträge für Geflügelzukauf ACKERBAU
Das Spiel mit dem Feuer
92 KLEE-ANBAU
Mehr Geld mit KleeUntersaat
17 NATURLAND-APP Die meistgelesenen Beiträge
18 GEMEINSAM BODEN GUT MACHEN Naturland-Gewinner des NABU-Wettbewerbs
20 WALD „Hin zur Vielfalt“
22 AUS DER KONTROLLE Antworten auf häufige Fragen AGROFORST
76 INTERVIEW
„Der beste Zeitpunkt...“
81 RECHTLICHES
aus dem Förderdschungel
INHALTSVERZEICHNIS | 5
& TECHNIK

Schulterschluss für Bio
Naturland, Bioland und Gäa haben als Gründungsverbände die Branchenvereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Rohwaren verbandlicher Öko-Zertifizierer in Deutschland unterzeichnet.
Über Hintergründe, Ziele und Vorteile der Branchenvereinbarung sowie über die weitere Zusammenarbeit der Verbände sprachen wir mit den Präsidenten von Bioland und Naturland, Jan Plagge und Hubert Heigl.
Heigl & Plagge
Jan Plagge (li) ist Präsident von Bioland und des europäischen Dachverbands IFOAM Organics Europe. Hubert Heigl ist Naturland-Präsident und Vorstand Landwirtschaft des deutschen Dachverbands Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Gemeinsam vertreten Naturland und Bioland ca. 13.000 Verbandsmitglieder in Deutschland.


Der Bio-Markt hat turbulente Jahre hinter sich. Welche Bedeutung kommt vor diesem Hintergrund der Branchenvereinbarung zu?
Hubert Heigl: Die letzten Jahre waren sehr turbulent, aber Bio hat sich dabei als krisenfest erwiesen. Und das ist vor allem ein Erfolg des verbandsgebundenen Öko-Landbaus in Deutschland. Es ist Bioland und der Naturland Zeichen GmbH unabhängig voneinander gelungen, erfolgreiche Handelspartnerschaften zu entwickeln, um die Leistungen der Betriebe in Wert zu setzen. Dadurch konnten wir auch unsere Richtlinienhoheit als Verbände sichern: Was hochwertiges Bio ist, entscheiden in Deutschland die Bäuerinnen und Bauern, nicht der Handel.
Jan Plagge: Wenn wir auf diesen Erfolgen aufbauen wollen, brauchen wir den Schulterschluss zwischen den Bio-Verbänden. Die Branchenvereinbarung bildet dafür eine wichtige Grundlage. Die steigende Nachfrage verlangt nach einem neuen, einfacheren System der gegenseitigen Anerkennung von Rohwaren. Das kann nicht mehr wie bislang jeder für sich leisten, mit jeweils eigenen Verfahren, mit vielen Direktabsprachen, Einzelfallentscheidungen und so weiter. Von der Branchenvereinbarung geht deshalb das Signal aus, dass wir Bio-Verbände enger zusammenrücken, um die anstehenden Herausforderungen besser zu meistern.
Welche Rolle spielen verbandliche Strukturen und Richtlinienentscheidungen?
Heigl: Eine entscheidende, denn die Mitgliedsbetriebe haben das Sagen und das soll auch so bleiben. Die Branchenvereinbarung sichert, dass die Richtlinienhoheit der einzelnen Verbände nicht angetastet wird, stellt aber zugleich eine Gleichwertigkeit der ausgetauschten Rohwaren sicher, mit Fokus auf einfacher Umsetzbarkeit. Richtlinienunterschiede spielen nur da eine Rolle, wo sie wirklich relevant sind, gegenseitiges Vertrauen und Transparenz ersetzen unnötige Doppelkontrollen.
Plagge: Dennoch stehen wir als Verbände weiter im Wettbewerb miteinander. Gegenseitige Absprachen über Anerkennungsverfahren sind kartellrechtlich verboten. Insofern war die Branchenvereinbarung auch unverzichtbar, um unsere Zusammenarbeit auf eine dauerhaft rechtssichere Grundlage zu stellen.
Reibungsloser Warenaustausch ist das eine, aber wie sieht es mit der Qualitätssicherung aus?
Plagge: Qualitätssicherung ist die Grundlage für Vertrauen und Fairness. Die Branchenvereinbarung hat deshalb auch den Zweck, ein gemeinsames Mindestniveau zu sichern, das jeder Verband in seinen Richtlinien und Verfahren erfüllen muss, um
AUS DEM NATURLAND | 7
Fotos:
Naturland / Sabine Bielmeier, Bioland

„Was hochwertiges Bio ist, entscheiden in Deutschland die Bäuerinnen und Bauern, nicht der Handel.“
teilnehmen zu können. Das hilft uns auch dabei, mögliche Zusatzkontrollen auf die wenigen Fälle zu beschränken, in denen sie aufgrund deutlicherer Richtlinienunterschiede wirklich unabdingbar sind.
Heigl: In der Praxis ändert sich für viele Betriebe gar nichts. Dass im Moment trotzdem manchmal Unsicherheit herrscht, hängt mit dem Übergang zusammen. Vieles muss sich noch einspielen, etwa wie das Ziel der Äquivalenz bei neuen, mehrfachzertifizierten Verarbeitungspartnern in der Praxis gehandhabt wird.
Was bedeutet das?
Plagge: Grundsätzlich soll zum Beispiel eine Molkerei in etwa so viel Rohware von Betrieben eines be

8 | AUS DEM NATURLAND
„Bioland und Naturland sind glaubhafte Marken für hochwertiges Bio, weil hinter ihnen die Bäuerinnen und Bauern stehen.“
hinter ihnen die Bäuerinnen und Bauern selbst ste hen. Das ist die Grundlage dafür, dass wir ein so ho hes Vertrauen bei den Verbrauchern, aber auch bei Herstellern und im Handel, genießen. Eine erfolg reiche verbandsübergreifende Marke gibt es nur in der Schweiz mit der Knospe. Aber auch da ist der Erfolg dadurch bedingt, dass es unter dem Dach der BioSuisse eine gemeinsame Fach- und Richt linienarbeit sowie ein gemeinsames Parlament für Entscheidungen gibt.
Heigl: In Deutschland hingegen haben wir mehrere starke Marken und sichern genau dadurch unse re bäuerliche Unabhängigkeit. Denn unsere Ver bandsmarken sorgen dafür, dass wir für den Handel nicht einfach austauschbar sind. Der Weg ist also ein anderer als in der Schweiz, aber in beiden Fäl len ist die Verständigung zwischen den Verbänden zentral.
Ist die Branchenvereinbarung also nur der An fang eines engeren Zusammenwachsens der Verbände oder doch schon das Ziel?

Plagge: Zunächst einmal geht es darum, das Erreichte zu sichern durch praxisnahe Anerkennungsverfahren. Darüber hinaus ist auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den richtliniengebenden Gremien der einzelnen Verbände durchaus denkbar. Mit der neuen gemeinsamen Arbeitsgruppe Richtlinien machen Bioland und Naturland da gerade einen wichtigen Anfang.
Heigl: Auf der praktischen Ebene zwischen den Höfen klappt die Zusammenarbeit längst. Darum sollten wir sie auch in der Verbandsarbeit noch tiefer verankern.

Im Rahmen der Öko-Feldtage 2022 unterzeichneten Kornelie Blumenschein (Vorsitzende Gäa), Jan Plagge (Präsident Bioland) und Hubert Heigl (Präsident Naturland) die Branchenvereinbarung.
AUTOR
AUTOR
Gerald Wehde
Bioland e.V. gerald.wehde@ bioland.de

ANZEIGEN

AUS DEM NATURLAND | 9
Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH www.kult-kress.de +49 7258-200 96-00 info@kult-kress.de K.U.L.T. Argus Hacksystem - leicht und flexible f ü r F ron t-, Heck - u nd Zwis ch en achsanb au
Naturland
m.fadl@naturland.de
Markus Fadl
e.V.
&
in Bildern Das Naturland




1 Die Naturland-Mitarbeitenden des internationalen Geschäftsbereichs trafen sich auf einem knapp zweitägigen Summit, um sich über die Weiterentwicklung einiger Fokusregionen auszutauschen. Auch dabei: Kolleginnen und Kollegen aus Georgien, Vietnam, Ruanda, USA und China.
2 „Beste Bioläden 2024“: Gesamtsieger in der Kategorie über 400 Quadratmeter Verkaufsfläche wurde der Bioladen Urban in Dülmen (NRW). Die Naturland Zeichen GmbH spendete
10 | AUS DEM NATURLAND
1
2 3 4


5

6
Fotos: Naturland e. V., Naturland Zeichen GmbH, StMUV, Sabine Bielmeier, Beratung für Naturland, MLV / Simon Geiger

7
als Preis eine Schubkarre voll Naturland-Fair-Produkten und einen Besuch beim neuen Naturland Fair-Partner Herbaria.
3 Der langjährige Naturland-Wegbegleiter Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald hat das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. V.l.n.r.: Thorsten Glauber (Staatsminister im StMUV), Theo Gottwald (Honorarprofessor Uni Berlin), Andrea Klepsch (modem conclusa gmbh) und Michael Stienen (Naturland Zeichen GmbH).
4 Naturland-Pioniere unter sich: Paul Knoblach (links, Mitglied des Bayerischen Landtags und Naturland-Bauer) und Peter Warlich (Naturland-Präsidium) nutzten die Grüne Woche zum Erfahrungsaustausch.
5 Lust machen auf Bio, informieren und probieren: Unter diesem Motto tourt unser Being Organic in EU-Foodtruck durch ganz Deutschland. Er hält auf Festivals, vor Uni-Mensen, Supermärkten usw. Auch auf der Biofach hat der Foodtruck viele Menschen angelockt.
6 Der Vorstand des Naturland Landesverbands Bayern während der Haushaltsplanung. Gastreferenten waren Jörg Große-Lochtmann, Sebastian Hubert (beide Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG) und Dr. Klaus Wiesinger (LfL), die zu Markt und Forschung berichteten.
7 Besuch der NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (rotes Jackett) am Stand der Teutoburger Ölmühle auf der Biofach. Der Naturland-Partner verarbeitet Rapssaaten.
AUS DEM NATURLAND | 11

KOMMENTAR
von Jan Ulrich
Referent Agrarpolitik bei Naturland e.V.
Das Europäische Parlament hat die Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR) abgelehnt. Es ist ein Armutszeugnis und Symptom der Angst vor einer komplexen und nachhaltigen Agrarpolitik. Durch die nahenden Wahlen zum EU-Parlament im Juni sind besonders die konservativen und liberalen Parteien bestrebt, immer mehr Inhalt aus den Nachhaltigkeitsprogrammen auszuräumen. Hier spielt die Angst vor den erstarkenden Rechten in Europa eine tragende Rolle, nur unterliegt dieses Vorgehen einer irreführenden Logik: Wer kritische Positionen abräumt, um sich in einer Wahl weniger angreifbar zu machen und mögliche Wähler nicht zu vergraulen, unterscheidet sich nicht mehr von populistischen Parteien. Zu einer verlässlichen und konsistenten Politik gehört, den Wählenden auch vermeintlich unbeliebte Programme verständlich zu machen.
ZUKUNFT DES GREEN DEALS
Mit dem Green Deal will die Europäische Union den Klimawandel bekämpfen und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Die Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use Regulation = SUR) hätte dabei eine bedeutende Rolle bei der Umsetzung der Green Deal-Ziele spielen sollen. Im November 2023 wurde es vom Europäischen Parlament überraschend komplett abgelehnt. Das kann für die ökologische Landwirtschaft eine Chance sein, denn die europäische Agrarwirtschaft steht vor der Herausforderung,
nachhaltige Praktiken zu implementieren, um die Umweltauswirkungen zu minimieren und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die ökologische Landwirtschaft bietet bereits viele Lösungsmöglichkeiten, indem sie auf den Erhalt der Biodiversität, den Schutz natürlicher Ressourcen und den Verzicht auf schädliche Chemikalien setzt. Der Europäische Green Deal kann somit durch Betonung und Förderung der ökologischen Landwirtschaft eine positive Wendung nehmen.
Jan Ulrich
AUSSETZUNG VON GLÖZ 8
Bereits am 14.02.2024 gab die europäische Union den Weg frei für die erneute Aussetzung des GLÖZ 8-Standards für 2024. Damit wurde in den Mitgliedsländern die Möglichkeit geschaffen, über die Bedingungen zur Aussetzung der Flächenstilllegung zu entscheiden.
Seit 29.02.2024 ist klar, dass auch Deutschland die Pflichtbrache für 2024 aussetzten wird. Als Kompensation der Flächenstilllegung ist eine Bepflan zung von 4 % der Wirtschaftsflä che mit Zwischenfrüchten oder Leguminosen vorgesehen. Diese können als Futtermittel genutzt werden, der Einsatz von Pflan zenschutzmitteln ist auf diesen Flächen allerdings untersagt.
Die Diskussion zwischen dem BMUV und dem BMEL über die Einführung neuer Ökoregelun gen als Bedingung für den Weg fall der Stilllegung endete, ohne dass zusätzliche Maßnahmen
eingeführt werden. Dafür bleibt das Niveau der Basisprämie bei 14 Euro/ha. Es soll jedoch die Möglichkeit geschaffen werden, die Ökoregelung 1 im Mehrfachantrag („Zusätzliche Flächenstilllegung“) zu wählen, auch wenn auf die 4 % Pflichtbrache verzichtet wird.
Jan Ulrich

12 | AUS DEM NATURLAND
GENTECHNIK-UPDATE
In der europäischen Union tobt weiterhin die Debatte über die Neubewertung des Gentechnikrechts. Nach dem Vorschlag der europäischen Kommission zur Deregulierung hat sich nun das Parlament zu einer Position durchgerungen. Laut dieser bleibt der ökologische Landbau von der Kategorie 1 der NGTPflanzen ausgeschlossen. Unter diese Kategorie fallen etwa 96 % aller mit CRISPR-CAS erzeugten Pflanzen. Eine Kennzeichnung der genetisch veränderten Pflanzen soll jedoch auf ein Minimum beschränkt werden und nur für Saatgut gelten. Eine weitere Kennzeichnung bis in den Verkauf ist nicht vorgesehen, eine ausführliche Risikoprüfung und Durchführung des Vorsorgeprinzips ebenfalls nicht. Auch
der Ausschluss von Patenten auf Gensequenzen ist in der abge stimmten Position nicht befrie digend geklärt.
Der nächste Schritt wird nun die Positionierung des europäischen Rates sein, bevor der Trilog zwi schen Kommission, Parlament und Rat starten kann. Im Rat enthält sich Deutschland bisher, da in den Regierungsparteien keine Einigkeit bei dem Thema gefunden wird.

Bis zur Wahl des europäischen Parlamentes im Juni wird das Patt vermutlich erhalten bleiben. Erst die nächste Ratspräsidentschaft wird wieder Zugriff auf das Thema bekommen.
Jan Ulrich
KEIN GREENWASHING
Die EU will in Zukunft Greenwashing stärker kontrollieren. Mit der sogenannten GreenClaims-Richtlinie will sie für Rechtssicherheit in Bezug auf die Kommunikation von Umweltleistungen (engl.: Green Claims) sorgen. Grundsätzlich ist das eine gute und wichtige Entwicklung. Die dafür zugrundeliegende Bewertung anhand des Product Environmental Footprint (PEF) führt allerdings zu groben Bewertungsfehlern. So werden Eier aus Käfighaltung aufgrund des geringeren Flächenverbrauchs besser bewertet als Freilandeier. Hinzu kommt, dass es für ökologisch erzeugte Produkte bisher kaum geeignete Datensätze gibt, die zur Berechnung des PEF herangezogen werden könnten. Im Ergebnis führt dies sowohl bei Öko- als auch bei konventio-
nellen Produkten zu Verzerrungen. Produkte, die auf Basis der EU-Öko-VO hergestellt werden, sind von der Nachweispflicht zwar ausgenommen, aber für die privatwirtschaftlichen BioStandards der Öko-Verbände gilt diese Ausnahme nicht. Alle Aussagen, die über die Öko-Verordnung hinausgehen, sind also weiterhin nachweispflichtig. Damit konterkariert die EU mal wieder ihre eigenen Bio-Ausbauziele. Im Juni wird eine Einschätzung des EU-Rats erwartet. Der Trilog wird erst nach der Europawahl stattfinden. Wir von Naturland werden uns aktiv in den Prozess einbringen, um die Interessen der Öko-Verbände und ihren Betrieben zu verteidigen.
Lea Ilgeroth-Hiadzi
VbÖ-Vorstand Thomas Handrick mit Peter Warlich, Naturland-Präsidiumsmitglied und Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt.
NATURLAND UND VERBUND ÖKOHÖFE KOOPERIEREN
Naturland und der Verbund Ökohöfe (VbÖ) werden in Zukunft bei der Zertifizierung von Bio-Rohwaren eng zusammenarbeiten. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung besiegelten die beiden Öko-Verbände auf der Biofach in Nürnberg. Sie sieht vor, dass Mitgliedsbetriebe des Verbund Ökohöfe, die dauerhaft in Naturland-zertifizierte Wertschöpfungsketten liefern wollen, künftig eine NaturlandZertifizierung erhalten können. Interessierte Betriebe werden in Bezug auf einzelne Rohwaren ins System der Naturland-Qualitätssicherung einbezogen, bleiben aber Mitglied beim Verbund Ökohöfe. Eine Doppelmitgliedschaft oder gar ein Verbandwechsel sind ausdrücklich nicht notwendig, sondern sollen dadurch vielmehr vermieden werden.
Der Verbund Ökohöfe gehört mit aktuell 109 Mitgliedern zu den kleineren Bio-Anbauverbänden in Deutschland, mit regionalem Schwerpunkt auf Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie angrenzenden Bundesländern.
Markus Fadl
AUS DEM NATURLAND | 13
Fotos: Naturland / Sabine Bielmeier; Naturland / Sebastian Stiphout; Naturland e.V.
„JUNGE ÖKOLOGISCHE LAND- UND LEBENSMITTELWIRTSCHAFT” GEGRÜNDET
Auf der Biofach hat sich das Bündnis „Junge ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft“ (JöLL) gegründet. Zunächst einmal möchte das Bündnis die Funktion als bundespolitische Vertretung der jungen ökologischen Lebensmittelwirtschaft übernehmen
tragen beschlossene Themen und Forderungen nach außen in Politik und Wirtschaft.
Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), würdigte die Initiative auf der Biofach. „Eine nachhal-

– eine Institution, die bisher gefehlt hat. Das Bündnis JöLL wird beim Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) angesiedelt. Mitglieder sind bislang Vertreterinnen und Vertreter der Verbände Biokreis, Demeter, Junges Naturland, Junges Bioland, BNN.Next und Slow Food Youth. Neben einem Arbeitskreis, in dem die Mitglieder gemeinsame Positionen erarbeiten, gibt es einen repräsentativen Sprecherkreis, bestehend aus jungen Ehrenamtlichen aus der Praxis. Diese
tige Zukunft unserer Landwirtschaft und Ernährung braucht Vielfalt und die Perspektive von Jung und Alt. Das Bündnis JöLL bündelt jetzt die Stimmen der nächsten Generation. Ich bin gespannt auf die Vorschläge vom JöLL, insbesondere was die Zukunft unserer Höfe oder Bäckereien, unserer Tierhaltung oder der Agrarpolitik angeht – sei es in Deutschland oder der EU. Im Sommer 2025 veranstalten wir am Rande der Öko-Feldtage auf dem Wassergut Canitz das Organic Future Camp, ich lade
das Bündnis jetzt schon herzlich dazu ein.“
Das Bündnis versteht sich als Dachverband für junge Organisationen, die sich bereits entlang der gesamten ökologischen Lebensmittel-Wertschöpfungskette engagieren — von ÖkoLandbau über Erzeugung, Naturkostfachhandel bis hin zum Konsum.
Lea Ilgeroth-Hiadzi
NEUE BIO-FOTODATENBANK
Wer kennt das nicht: Die neue Webseite für den Hofladen ist fast fertig, aber es fehlen noch gute Fotos. Alles kein Problem mehr! Dafür sorgt eine neue, von Naturland aufgebaute Bio-Fotodatenbank. Unter https://being-organic-ineu-bio.px.media gibt es eine reiche Auswahl an kostenfreien druckfähigen Bildern. Die Bilder können frei verwendet werden, einzige Bedingung: als Bildquelle bitte „Being Organic in EU“ angeben. Die Fotodatenbank ist Teil der gleichnamigen EU-Info-Kampagne.
 Markus Fadl
Markus Fadl
14 | AUS DEM NATURLAND
MEHR PARTNER UND FLÄCHE
Naturland hat 2023 wieder einen überdurchschnittlich starken Beitrag zum Ausbau des Öko-Landbaus in Deutschland geleistet. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr fast 30.000 Hektar Äcker und Wiesen auf ökologische Bewirtschaftung nach Naturland-Richtlinien umgestellt, ein Zuwachs um 9,5 Prozent auf fast 338.000 Hektar (ohne Wald). Die gesamte ÖkoFläche in Deutschland legte im gleichen Zeitraum nur um 4,3 Prozent zu.
Die Zahl der Naturland-Mitglieder in Deutschland legte ebenfalls zu, wenn auch weniger deutlich als die Fläche. Bundesweit gab es zu Jahresbeginn 4.802 Naturland-Betriebe in Deutschland, 131 mehr als ein Jahr zuvor (ein Plus von 2,8 Prozent). Das deutliche Flächenwachstum war unter anderem einigen flächenstarken Betrieben geschuldet, die den Schritt der Bio-Umstellung gewagt haben. Auch bestehende Naturland-Betriebe haben ihre Anbauflächen erweitert.
In der positiven Entwicklung der Mitglieder- und Flächenzahlen spiegeln sich die jüngsten Erfolge der Naturland Zeichen GmbH beim Gewinnen neuer Partnerunternehmen aus Handel und Verarbeitung. Insgesamt gibt es aktuell fast 1.400 NaturlandPartner, die Naturland-Rohstoffe verarbeiten und handeln. Das sind 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und sogar über 50 Prozent mehr als noch 2021.
Davon profitieren neben den
deutschen auch die österreichischen Naturland-Betriebe. Die Naturland-zertifizierte Fläche im Nachbarland legte im vergangenen Jahr noch einmal um außergewöhnliche 36 Prozent auf nunmehr 44.000 Hektar zu. Ende 2023 gab es damit 1.979 Naturland-Betriebe in Österreich. Insgesamt ging in Österreich die Zahl der Bio-Betriebe von 2022 auf 2023 aber um 933 Betriebe zurück.
Markus Fadl

Mehr als 1.000 Betriebe wurden 2023 Mitglied von Naturland.
Unser Angebot:
führende Legehennen Genetik
Volierenaufzucht & Mobilstallimpfung
Bruderhahn Aufzucht
Auf Anfrage Mastgeflügel: Gänse & Enten
Unsere Genetik:
H&N - Brown Nick, Super Nick
Lohmann - Braun, LSL, Sandy
Novogen - Braun, Weiß
Hendrix - Dekalb, Bovans, Isabell
AUS DEM NATURLAND | 15 biokuekenstube +49 5251 1428370 info@bio-kuekenstube.de www bio-kuekenstube de Bio Kükenstube GmbH Christoph Huster Geflügelaufzucht mit erstklassiger Qualität! Junghennen & Mastgeflügel Junghennen & Mastgeflügel
Kontaktieren Sie uns!

NATURLAND IN USA
Naturland wird künftig auch in den USA aktiv sein. Gemeinsam mit dem Real Organic Project (ROP) wurde Anfang 2024 ein gemeinsames Joint Venture gegründet: die „Real Organic Naturland, LLC“. Vertriebs- und MarketingLeiter Aaron Flamini stellte auf der Biofach die gemeinsamen Pläne vor. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Bewusstsein der amerikanischen Verbraucher für hochwertige Bio-Produkte zu stärken und so die Marktchancen für Bio-Betriebe in den USA zu verbessern. Zu diesem Zweck soll das Joint Venture sich um
die Zertifizierung von Bio-Verarbeitern in Nordamerika bemühen. Gleichzeitig soll der Import von Naturland-zertifizierten Produkten vor allem aus Ländern des globalen Südens in die USA unter einem gemeinsamen Siegel ermöglicht werden. Dieses Siegel integriert das Naturland-N in das Logo von ROP. Gegründet wurde ROP 2018 als Reaktion auf die Entscheidung unter dem staatlichen Bio-Siegel künftig auch Hydrokulturen und Massentierhaltung zuzulassen.
Markus Fadl
VIETNAM: BEWUSSTSEIN FÜR BIO-LEBENSMITTEL STÄRKEN
Rund 33 Millionen Menschen in Vietnam gehören bereits zur Mittelschicht, bis 2030 dürften es 95 Millionen werden. Bio trifft dort den Nerv der Zeit: Das Interesse an Produkten, die gesünder und wertiger sind, steigt rasant. Mit dem Projekt „Trust EOP“ informiert Naturland darum vietnamesische Verbraucher über die Vorteile von Naturland- und EU-Bio-Produkten: Bei Bio-Häppchen im Lieblingsrestaurant, mit Re-
zept-Tipps auf Facebook, im Radiointerview oder mit einem Computerspiel in der Shoppingmall, in dem der Spieler einem Bio-Bauern beim Gemüseanbau hilft und so nebenbei etwas über die Anbauprinzipien in der ökologischen Landwirtschaft erfährt. Das Projekt „Trust European Organic Products“ läuft noch bis Anfang 2025 und wird durch die EU kofinanziert.
Minou Yussefi-Menzler

NATURLAND ACADEMY ONLINE
Landwirtschaftliche Fortbildung und Wissensaustausch sind wichtige Schlüssel für den Erfolg als Bio-Betrieb. Die Naturland-Betriebe in Deutschland und Österreich werden dabei durch die Beratung für Naturland unterstützt. International existierte ein vergleichbares Angebot bislang nicht. Genau hier setzt die webbasierte Bildungsoffensive Naturland Academy an.
Kernstück ist die E-Learning-Plattform https://academy.naturland.org/. Sie bietet verschiedene Formate zum angeleiteten oder selbstständigen Lernen. Das Angebot reicht von Lernvideos über vertiefende Seminare bis hin zu komplexen mehrteiligen Kursen zu speziellen Fachthemen. Es wird ergänzt durch eine umfangreiche Bibliothek mit weiteren Videos und Fachbücher zum Stöbern.
Die Naturland Academy beschränkt sich aber nicht auf digitale Lernangebote. Vielmehr werden diese gerade bei komplexeren Kursen häufig auch ergänzt durch analoge Praxis-Workshops. Solche Exkursionen ins Feld, für die man sich über die Plattform anmelden kann, erweitern das ELearning dann zum „blended learning“.
 Markus Fadl
Markus Fadl
DIE MEISTEN KLICKS
Sie möchten in Kürze erfahren, was im ÖkoLandbau und der Naturland-Welt gerade passiert oder suchen Tipps bei aktuellen Problemen? Mit den Push-Mitteilungen, Chat-Foren und dem Terminkalender der Naturland-App bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Überzeugen Sie sich selbst: Wir stellen Ihnen hier die drei am häufigsten gelesenen Beiträge in der Naturland-App vor.

1
Lahmheiten bei Schweinen
veröffentlicht am 23.02.2024
Durch Verletzungen oder Gelenksinfektionen treten Lahmheiten auf. Zu lange Klauen bei Sauen sind oft ebenfalls ein Grund. Daher wird die regelmäßige Kontrolle (ggf. schneiden) empfohlen. Wichtig ist der Klauenabrieb durch leicht aufgerauten, rutschfesten Boden. Eine ausreichende Versorgung mit Calcium, Phosphor und Aminosäuren kann gegen das Beinschwächesyndrom helfen.
gehts zur NATURLANDApp


2 3
Biestmilchqualität beurteilen
veröffentlicht am 26.02.2024
Gute Biestmilch hat eine hohe mütterliche Antikörperdichte. Die Dichte kann unmittelbar nach Gewinnung im Stall mit einem Refraktometer oder Colostro-Ball bestimmt werden. Bei schlechtem Ergebnis kann die Tränkemenge der ungünstigen Milch erhöht oder die minderwertige Milch mit einer hochwertigeren gemischt werden. Gute Biestmilch kann auch eingefroren werden.

Biodiversität Ackerbau
veröffentlicht am 29.01.2024
Der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine der großen Herausforderungen. Öko-Landwirte schützen Ackerflora, Insekten, Vögel und Säugetiere durch ihre Wirtschaftsweise – und können darüber hinaus auf ihrem Betrieb die Artenvielfalt gezielt fördern. Wie das konkret im Ackerbau aussehen kann, berichten Naturland-Landwirte und Berater in kostenlosen Online-Veranstaltungen.
AUS DEM NATURLAND | 17
DIE KOMPLETTEN ARTIKEL FINDEN SIE IN DER NATURLAND-APP
Hier
Fotos: Naturland / Lara Freiburger, Pixabay / indigoblues38, BLE / Dominic Menzler

10 NATURLAND-BETRIEBE
ERHALTEN 180.000 €
UMSTELLUNGSFÖRDERUNG
GEORG JOSEF SCHÖFFMANN
im Tölzer Land hat 2021 mit seiner Familie mit viel Eigenleistung einen neuen Kuhstall gebaut. Sein Augenmerk legte er dabei auf die Nachhaltigkeit – entstanden ist ein Wohlfühlort für Mensch und Tier. Die Grundfutterversorgung der Rinder gewährleistet er durch Eigenanbau. Als Erlebnisbauernhof und Markenbotschafter der Molkerei bringt der Hof Schulklassen und Kindergärten die ÖkoLandwirtschaft näher.
ANDREAS KROLL UND SEINE FRAU JACQUELINE
betreiben eine Schäferei im nördlichen Harzvorland Niedersachsens. 2016 packte beide die Leidenschaft, mit Schafen und Ziegen die Landschaft zu pflegen. So übernahmen sie 2017 die Pflege von 14 Hektar Orchideenwiesen. Inzwischen haben sie ihren Betrieb auf 80 ha erweitert. Die Schafe pflegen dort Grünland und Photovoltaikanlagen, fördern die Biodiversität und vernetzen Lebensräume.
Naturland e. V. s.strass@naturland.de


18 | AUS DEM NATURLAND
1.
2.
2.
AUTORIN Sonja Straß

Die Teilnahme am NABU-Wettbewerb „Gemeinsam Boden gut machen“ hat sich für zehn NaturlandBetriebe ausgezahlt. Von insgesamt 17 Gewinnern stellen sie eindeutig die Mehrheit und teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 180.000 Euro. Der Wettbewerb soll Betriebe bei der Umstellung auf Öko-Landbau finanziell unterstützen. Wir gratulieren allen Gewinnern. Sie stehen beispielhaft für viele andere Betriebe, die sich im vergangenen Jahr zur Umstellung entschieden haben. Wir stellen vier Preisträger vor.

MORITZ UND CARINA MAACK
betreiben den Betrieb in 5. Generation nahe der Schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Dies ist auch das Zuhause ihrer 600 Bio-Mastschweine. Der neue energetisch ausgeklügelte Stall sorgt für das Wohl der Tiere – und ein Besucherraum ermöglicht Schulklassen und Berufskollegen einen Blick in Stall und Auslauf. Mit dem Förderpreis soll der Anbau von Getreide und Körnerleguminosen auf weite Reihe umgestellt und in Hacktechnik investiert werden.
ZUM HOF VON JOHANN UND TANJA MÜLLER
in Isarwinkel (Oberbayern) gehören 30 Hektar Mischwald und zwei anerkannte Almflächen, die ihre Rinder beweiden. Bei der Umstellung hat Familie Müller ihren Betrieb umfassend umgebaut: die Anbindehaltung musste einem Laufstall weichen und viele Maßnahmen fördern nun Biodiversität und Artenreichtum. Mit Erfolg: Mehrere Flächen wurden bereits in das Programm NATURA2000 aufgenommen.

INTERESSIERT?
Die nächste Bewerbungsrunde startet am 1. April 2024. Es werden Betriebe gesucht, die den gesamten Betrieb auf Bio umstellen (Vertragsbeginn frühestens 1.1.2022) und bis zum 11. September 2024 einen Vertrag mit einem Öko-Verband abgeschlossen haben. Außerdem müssen sie mindestens weitere fünf Jahre lang ökologisch produzieren. Auch bereits länger umgestellte Betriebe können sich bewerben, wenn sie einen neuen Betriebszweig aufbauen möchten, der mindestens 30 % Flächenzuwachs ausmacht. Weitere Infos unter www.nabu. de/gbgm oder bei Sonja Straß (siehe Autorenbeschreibung).
AUS DEM NATURLAND | 19
zVg
Für Familie Schöffmann hat das Wohl der Tiere Priorität.
Fotos:
3.
4.
4.
3.
1.

AUTORIN
Daniela Schröder
Naturland e. V. wald@naturland.de

Hin zur Vielfalt
Peter Langhammer im Interview
Der Privatwaldbetrieb Eichelberg MEG Leeb ist seit mehr als 20 Jahren Naturland-zertifiziert. Der Waldbetrieb in Niederbayern umfasst 225 ha. Wir haben mit dem Betriebsleiter Peter Langhammer über die Rolle der ökologischen Waldbewirtschaftung und die Rückkehr des Wolfs gesprochen.
20 | AUS DEM NATURLAND
„Wenigstens den Wäldern zuliebe sollten wir uns über die Rückkehr der Beutegreifer freuen.“
Wie bewirtschaften Sie ihren Wald?
Eichelberg war ein Nadelholzrevier mit überwiegend Fichten und knapp 20 % Tannen. Laubbäume machten weniger als ein Viertel aus, waren aber gut verteilt. Vor 25 Jahren haben wir angefangen, den Wald nach dem Gedanken des Dauerwaldes zu bewirtschaften. Bäume werden nur einzelstammweise oder in kleinen Gruppen entnommen, dadurch ist der Wald weniger anfällig bei Stürmen oder Insektenmassenvermehrung.
Auf welche Baumarten setzen Sie dabei?
Das Ziel ist ein an Naturwäldern orientierter Mischwald mit möglichst vielen heimischen Arten und allen Waldentwicklungsphasen. Wir entwickelten den Wald hin zu innig gemischten Beständen mit hohen Anteilen an heimischen Laubbäumen wie Buchen, Eichen, Edellaubbäumen und Weichlaubhölzern. Gerade unsere Stiel- und Traubeneichen sind mir wichtig, aber auch die hier heimische Weißtanne wird verwendet. Wir gehen weg von der dominierenden Fichte, hin zur Vielfalt.
Wie vertragen sich Programme des Vertragsnaturschutzes mit der Wirtschaftlichkeit im Wald?
Ganz hervorragend, darauf habe ich lange gewartet: Wir können den Wald weiter im Sinne eines sehr naturnahen und artenreichen Dauerwaldes entwickeln, ihn für die Zukunft stark machen und erzielen Einnahmen unabhängig von der Holznutzung. Wir können alte Bäume, Habitatbäume und wasserspeicherndes, humusbildendes Totholz anreichern, ohne auf Erträge verzichten zu müssen. Das ist wertvoll für vitale Böden, große Lebensvielfalt und resiliente Waldökosysteme.
In unseren Wäldern leben auch Rehe, die maßgeblich für den Verbiss von Jungpflanzen verantwortlich sind. Nun kehren mit Luchs und Wolf die

großen Beutegreifer zurück, die hier maßgeblich unterstützen könnten.
Wie sehen Sie diese Rückkehr?
Ich war selbst 20 Jahre Weidetierhalter und lebe im Wolfs- und Luchsgebiet, dieses Thema frustriert mich. Es gibt in vielen Ländern Mitteleuropas wieder Wölfe. Sie sind die wirkungsvollsten Jäger von Huftieren im Wald. In etlichen Ländern waren die großen Beutegreifer auch nie ausgerottet, gerade dort ist das Verhältnis zu ihnen entspannter.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Beutegreifern?
Trotz aller Versuche gelingt es uns nicht, sie im Wald zu ersetzen und großflächig eine artenreiche Waldverjüngung zu ermöglichen. Wenigstens den Wäldern zuliebe sollten wir uns über die Rückkehr der Beutegreifer freuen. Weidetierhalter sind selbstverständlich zuverlässig zu unterstützen.
WALD & HOLZ
Naturland zertifiziert als einziger Öko-Verband auch Wald und Holz. Derzeit sind in Deutschland 56.000 ha Wald mit dem Naturland-Siegel zertifiziert. Voraussetzung hierfür ist eine FSC-Zertifizierung, auf dieser bauen die Naturland-Richtlinien auf. Das lohnt sich derzeit nur für größere Betriebe. Mit der Einhaltung der Naturland-Richtlinien wird eine nachhaltige Bewirtschaftung nachgewiesen. Oft wird zertifizierte Ware von den Holzeinkäufern bevorzugt. Aber auch der Zugang zu Förderprogrammen wird durch eine Zertifizierung erleichtert.
Weitere Informationen zur Waldzertifizierung nach Naturland-Richtlinien finden Sie online unter www.naturland.de.

AUS DEM NATURLAND | 21
Fotos: zVg
AUS DER KONTROLLE
Naturland-Betriebe halten die EU-Bio-Verordnung und Naturland-Richtlinien ein. Gemeinsam mit den Kontrollstellen Gesellschaft für Ressourcenschutz und Austria Bio Garantie GmbH beantworten wir hier Ihre Fragen.
Ich habe die Sackanhänger des Gerstensaatguts weggeworfen. Reicht die Rechnung für die Kontrolle?
Deutschland: Es gibt keine Verpflichtung, die Sackanhänger des Saatguts aufzubewahren. Es müssen Unterlagen vorgelegt werden, die eine Prüfung der Zulässigkeit des Saatguts ermöglichen, z. B. Sorten oder bei Saatgutmischungen ggf. Informationen zu konventionellen Mischungsanteilen. Wenn diese Informationen aus der Rechnung hervorgehen, reicht diese aus.
Österreich: Sackanhänger werden im Rahmen der Kontrolle eingefordert. Diese dienen als zusätzliche Sicherheit in der Überprüfung. Es ist schon öfter vorgekommen, dass die auf der Rechnung angeführte Ware nicht jene war, die man erhalten hat – Sackanhänger bieten hier Gewissheit. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihre Kontrollstelle.

Haben Sie Fragen
ZUR BIO-KONTROLLE
Dann schicken Sie uns diese an redaktion@ naturland-beratung.de

Ich möchte unser Bio-Getreide im Silo eines konventionellen Landwirts lagern und dort Zellen anmieten. Ist das erlaubt?
Das ist erlaubt – aber nur, wenn dieses Auslagern ins Öko-Kontrollsystem eingebunden wird. Dazu muss das Lager bei der Kontrollstelle angemeldet und eine Mietvereinbarung mit dem konventionellen Landwirt abgeschlossen werden. Wichtig ist dabei: Das Bio-Getreide darf während Annahme, Lagerung und Auslagerung nicht mit konventionellen Partien vermischt werden. Eine eventuelle Kontamination mit Lagerschutzmitteln muss ausgeschlossen werden. Für eventuelle Mängel haften Sie als Auftraggeber. Diesen Schritt sollte man also nur gehen, wenn man sich darauf verlassen kann.
Ich pachte zwei Hektar Grünland von einem konventionellen Landwirt. Wann kann ich den Aufwuchs am Bio-Betrieb einsetzen?
Der Umstellungszeitraum beträgt 24 Monate, danach können BioFuttermittel geerntet werden. Schon im ersten Umstellungsjahr darf der Aufwuchs bis zu 20 % in der Jahresration (bezogen auf TM) verfüttert werden, im zweiten Umstellungsjahr (Ernten 12 Monate nach Umstellungsbeginn) unbeschränkt. Wichtig ist, dass die Neufläche gleich bei der Öko-Kontrollstelle gemeldet wird. So beginnt sofort die Umstellungszeit. Unter bestimmten Umständen können frühere Umstellungszeiten anerkannt werden, hier helfen die Öko-Kontrollstellen weiter.
2: Austria Bio Garantie
1: Gesellschaft für Ressourcenschutz
22 | AUS DEM NATURLAND
Erprobte Produkte preiswert und gut!

BIOCO GmbH, D-88677 Markdorf, Tel. 07544/1444, www.bioco.de


Ihr Spezialist für Silage, Fütterung, Gülle, Bodenverbesserung
Tel.: 0 83 04 / 92 96 96
Fax.: 0 83 04 / 92 96 98 info@em-sued.de
Größe 78 x 58 mm
www.em-sued.de
EM, Pflanzenkohle, Vulkan Mineralfutter
CarboVit Futterkohle
Speicherkohle für Gülle
Biogas und Klauen


m hacken – Das geht nur mit
3 m säen & 6 m hacken – Das geht nur mit garford TwinShift
3 m säen & 6 m hacken – Das geht nur mit garford TwinShift


SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN


SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN
SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN

Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite
Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung 0160 / 91794533 elmar.reuter@garford.com www.garford.com
Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung 0160 / 91794533 elmar.reuter@garford.com www.garford.com
Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung 0160 / 91794533 elmar.reuter@garford.com www.garford.com
RANTAI ®
Kultur-Schutznetze gegen Gemüsefliegen
• Typ K (Kohl-, Möhrenfliege etc.)
• Typ S48 (zusätzlich gegen Erdfloh, Lauchminierfliege)
• Typ ABN Taubennetz
• eb ultra Verfrühungs- und Frostschutz v liese von 17 bis 60 g/m²
• diverses Zubehör
Rudolf Schachtrupp KG
Osterbrooksweg 37–45
D-22869 Schenefeld
T +49 40 822 97 78-0
F +49 40 822 97 78-29
E mail@schachtrupp.de
W www.schachtrupp.de



DE-ÖKO-006









ANZEIGEN | 23
JETZT ZWEINUTZUNGSHÜHNER EINSTALLEN! Beratung & Bestellung: +49 (0) 151 625 591 88 pauline.seyler@oekotierzucht.de oekotierzucht.de/tiere/ bezugsquellen/ ötz: Eine Initiative von Bioland & Demeter Ich würd´s machen!
Küken & Jungtiere ganzjährig verfügbar.
RSH_AZ_Naturland-Nachrichten_Rantai_78x58mm_ENTW.indd 1 15.01.24 11:35 Naturland_Anzeige_03_2024-Pfade.indd 1 05.03.24 13:09
Fordern KatalogunserenSie an!

FIT FÜR DEN SOMMER
Nur noch wenige Monate, dann ist wieder Sommer. Unter den Hitzeperioden leiden dann vor allem die Nutztiere. Ist Ihr Stall fit für den Sommer? Auf den folgenden Seiten finden Sie praktische Anregungen.

Kein Platz in der
Sonne
Den Lichtfirst seines Milchviehstalls hat Ulrich Stich „von der Stange“ gekauft. Eine Beschattung dafür gibt es im Handel allerdings nicht. Doch der Besuch in einer Gärtnerei und eine Rolle Siloschutzvlies brachten seinen Kühen am Ende den ersehnten Schatten.

AUTOR
Marzell Buffler
Redakteur der Zeitschrift LANDWIRT bio
Ulrich betreibt zusammen mit seinem Vater einen Bio-Milchviehbetrieb in Oberostendorf (Ostallgäu). Unterstützt wird er von seiner Frau Hedwig und den Kindern Johanna, Klara und Kathi.
„Im Winter bringt der First viel Licht. Aber im Sommer brennt die Sonne richtig herunter.“
Hedwig Stich steht am Fressgitter ihres Milchviehstalls und kneift die Augen zusammen. Sie legt die flache Hand über ihre Augen. Ihren Mann Uli am anderen Ende des Futtertisches erahnt sie mehr, als dass sie ihn wirklich sieht. Zu sehr prallt die Mittagssonne durch den Lichtfirst und blendet die BioBäuerin. „Bist du soweit?“, hört sie die Stimme von Uli aus dem Nichts rufen. „Ja“, ruft sie zurück und greift nach der Handwinde, die an der Giebelwand befestigt ist. Während Hedwig kurbelt, werden die großen sonnenbeschienenen Felder auf dem Futtertisch immer kleiner. Nach fünf Minuten sind sie ganz verschwunden. Die Fleckviehkühe haben es im Offenstall jetzt immer noch hell – aber das unangenehm blendende Licht und die Hitze sind weg.
Unbeliebte Sonnenplätze
Nun sieht man auch Ulrich Stich den Futtertisch entlangkommen. Er stellt sich neben seine Frau und
erklärt das Problem: „Wir haben den zwei Meter breiten Lichtfirst über die gesamte Stalllänge. Im Winter bringt er viel Licht. Aber im Sommer brennt die Sonne richtig herunter.“ Uli schreitet den Futtertisch einmal quer ab und stellt mit seinen Händen den Weg des Sonnenstandes nach: „Der Lichtstreifen beginnt morgens am Fressgitter des Jungviehs. Über den Tag wandert er dann über den Futtertisch zu den Milchkühen und endet bei deren Liegeboxen. Die Sonne strahlt den Tieren also entweder beim Fressen oder beim Liegen direkt auf Kopf und Rücken.“ Der Landwirt hat die Temperatur eines solchen Sonnenplätzchens am Betonboden gemessen. „Es waren 42 °C bei einer Lufttemperatur von gerade einmal 26 °C. Für das Futter ist das ja auch nicht besonders gut.“ Eine Lösung musste her.
„Ich habe mich mit der Stallbaufirma schon einmal über getönte Scheiben unterhalten. Aber im Winter will man es ja hell.“ Eine andere Möglichkeit, um den
26 | FIT FÜR DEN SOMMER


Zwischen zwei Holzbindern des Dachs hängt jeweils ein Modul. Die Latten laufen an den Halteseilen. Die Zugseile ziehen die vorderste Latte. Die letzte Latte ist am Holzbinder befestigt und dient als Seilführung.

Lichtfirst zu beschatten, gab es nirgends zu kaufen. So musste sich der findige Allgäuer selber etwas einfallen lassen. Die zündende Idee kam, als er in einer Gärtnerei eingekauft hat. Dort waren die Gewächshäuser innen mit Beschattungsbahnen abgehängt, die man nach Bedarf öffnet und schließt. So etwas könnte doch auch im Stall funktionieren…
Silovlies von der Rolle
Uli Stich suchte nach einem geeigneten Material für die Beschattung. Dieses sollte strapazierfähig, wetterfest, großformatig, aber auch günstig sein. Normales Siloschutzgitter auf dem First zeigte kaum einen Beschattungseffekt. Zufällig brachte ein Bekannter zu dieser Zeit aber Reststücke eines Silovlieses vorbei. Genau das Richtige für die Beschattung, wie sich im Praxistest herausstellte.
Nun brauchte der Landwirt noch eine Möglichkeit, um die Beschattung unterm Dach befestigen zu können. Er deutet mit seinem Zeigefinger nach oben und erklärt: „Meine Beschattung besteht aus einzelnen Modulen. Jede Vliesbahn ist fünf Meter lang und passt genau zwischen zwei Holzbinder.“ Als Breite hat er die Lichtfirstbreite plus 30 Zentimeter angenommen.

Für seine Lösung hat Ulrich Stich 2021 den Bayerischen TierwohlPreis für Nutztierhaltung erhalten. Ein Video finden Sie hier.

FIT FÜR DEN SOMMER | 27
Im Winter lässt sich die Beschattung komplett zurückfahren.

Uli Stichs Konstruktion ist ebenso einfach wie kostengünstig. An den beiden Enden der Module sowie im Abstand von 125 Zentimetern dazwischen, klemmen das Vlies jeweils zwei gegeneinander geschraubte Dachlatten ein. Das Modul ist so der Länge nach in vier gleiche Abschnitte unterteilt. In die Enden der Latten hat der Landwirt jeweils zwei 10er-Löcher im Abstand von rund 30 Zentimetern gebohrt. Durch diese laufen die Halte- und Zugseile.
Einfacher Zugmechanismus
Die Beschattung haben Uli und sein Bruder Gerhard mit Hilfe einer Scherenarbeitsbühne an den Holzbindern montiert: „Wir haben die Latten eines Moduls aneinandergelegt und provisorisch miteinander verschraubt. Wichtig dabei ist, dass die Löcher genau aufeinander liegen. Die Latten am unbeweglichen Ende der Module sind länger. Wir haben sie am Binder als Seilführung festgeschraubt.“ Nachdem alle Module fixiert waren, haben die Brüder dünne Stahlseile über die komplette Stalllänge
„Das würde vielen Milchbauern und ihren Tieren sicher helfen.“
durch alle Löcher gezogen. Die äußeren Seile dienen dabei als Halteseile, die fest an den Giebelseiten des Stalls mit Seilschlössern verspannt sind. Im Anschluss haben die Stichs die Lattenpakete gelöst. Somit waren alle Abschnitte frei auf dem Seil beweglich.
Zwischen den Halteseilen liegen die Zugseile zum Öffnen und Schließen der Beschattung. Die Zugseile führen über Umlenkrollen zu zwei Handwinden an den Giebelseiten. Hier hat Uli Stich seine Konstruktion schon einmal nachgebessert: „Am Anfang hatten wir nur eine Handwinde. Auf der Gegenseite hing ein Gewicht, das die Beschattung aufzieht, wenn man die Kurbel nachlässt. Das hat aber nicht richtig funktioniert.“ Aber auch jetzt ist der Landwirt noch nicht ganz glücklich: „So braucht man halt immer zwei Leute an den Kurbeln. Am besten wäre es, wenn wir es elektrisch mit einem Schalter steuern könnten.“
Beschattung mit Auszeichnung
Ansonsten ist der Landwirt mit seiner Konstruktion aber sehr zufrieden. Sie hat ihn am Ende weniger als 1.000 Euro gekostet. Allerdings steckt auch einiges an Arbeitszeit dahinter: „Insgesamt haben wir rund 100 Arbeitsstunden investiert, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Aber nicht nur das. Für ihre Beschattung hat Familie Stich den 3. Platz beim Bayerischen Tierwohlpreis 2021 bekommen.
Wenig Resonanz kommt dagegen von Stallbaufirmen, was Uli Stich bedauert: „Ich habe ihnen vorgeschlagen, dass sie es sich anschauen. Aber da hat sich bis heute niemand gemeldet. Da ich darauf kein Patent habe, könnten sie es einfach nachbauen. Das würde vielen Milchbauern und ihren Tieren sicher helfen.“ So kommen bislang nur die Kühe von Ulrich und Hedwig Stich in den Genuss der begehrten Schattenplätze.
28 | FIT FÜR DEN SOMMER
Somit kommt das volle Licht über den First in den Stall.
Fotos: Christoph Jorda
DAS GRÜNDACH KÜHLT
Unerträglich heiß wird es im Sommer in so manchem Stall oder Auslauf.
Darunter leiden vor allem die Tiere. Ein Gründach könnte helfen.
Werden Auslauf- oder Stalldächer begrünt, können Wärmespitzen verringert werden. Das liegt an der besseren Hitzeisolierung des Gründachaufbaus und am Kühleffekt der Verdunstung des im Substrat gespeicherten Wassers. Dadurch wird der Dachaufbau gekühlt, ohne, dass dabei die Luftfeuchtigkeit im Stall steigt. Im Vergleich zu einem Blechdach kann dadurch die Anzahl der Stunden, in denen Tiere Hitzestress ausgesetzt sind, um 20 % gesenkt werden. Dabei werden vor allem die Stunden mit erhöhtem Hitzestress reduziert.*
Basis für den Aufbau ist die Dachabdichtung. Dazu geeignet sind zum Beispiel EPDM-Folien, aber auch Kautschuk-Folien und ähnliches Material. Wichtig ist, dass die Dachabdichtung von Spezialisten durchgeführt wird. In Regionen mit viel Niederschlag und auf Flachdächern mit wenig Neigung wird das Wasser über eine darüberliegende, 2-3 cm
dünne Drainageschicht (z. B. Rollkies, Ziegelbruch, Kunststoffmatte) abgeführt. Die 10 bis 15 cm dicke Vegetationsschicht wird von der Drainage mit einem Vlies getrennt. Als Vegetationssubstrat kann Muttererde oder ein Gemisch mit Sand verwendet werden. Im Handel werden spezielle, leichte Substrate (z. B. Claylit) angeboten. Wichtig für eine extensive Begrünung ist, dass das Substrat nicht zu nährstoffreich ist. An den Rändern bleibt ein ca. 50 cm breiter vegetationsfreier Streifen, damit der Bewuchs nicht über das Dach hängt.
Gründächer können auf bestehende Dächer nachgerüstet werden. Optimal eignen sich Flachdächer mit einer geringen Neigung (2 bis 5 Grad). Ab 15 Grad sind meist Sicherungen gegen das Abrutschen notwendig. Dazu gibt es – ähnlich wie gegen Dachlawinen – verschiedene Systeme im Handel. Hinsichtlich Statik sollte in jedem Fall Rücksprache mit einem Fachbetrieb gehalten werden. Je nach Substrat ist mit einem zusätzlichen Gewicht von 150 bis 300 kg/m² (wassergesättigt) zu rechnen. Vor allem in schneereichen Regionen bietet die Statik aufgrund der berechneten Schneelasten oft genügend Spielraum für dieses Zusatzgewicht.
*laut einer Untersuchung der LfL Bayern.
„Das Gründach kann die Hitzestress-Stunden reduzieren.“

Foto: landplan.bayern

Goldberger
für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de
AUTOR Roman
Beratung


AUTOR
Johannes Rutz
Beratung für Naturland johannes.rutz@ naturland-beratung.de
FRISCHE Luft
Erhöhte Luftgeschwindigkeit ist die wichtigste Maßnahme gegen Hitzestress im Milchviehstall. Sind keine, oder falsch ausgerichtete Ventilatoren vorhanden, besteht hier enormes Verbesserungspotenzial. Dazu müssen die Ventilatoren richtig im Stall platziert werden.
Mit Beginn der Weidesaison steigen auch die Temperaturen. Spätestens, wenn diese zu richtiger Hitze werden, tun sich Rinder schwer damit. Kühe fliehen vor der heißen Nachmittagssonne oft in den Stall. Hier gilt es, ein verträgliches Klima zu schaffen. Das ist vor allem in älteren Ställen mit geschlossenen Wänden, niedrigen Deckenhöhen und unzureichendem Luftaustausch eine echte Herausforderung. Doch genau hier hat ein Lüftungskonzept viel Potenzial, um Hitzestress und die negativen Folgen für Futteraufnahme oder Leistung zu reduzieren.
Wann hat die Kuh Hitzestress?
Milchkühe fühlen sich bei Temperaturen von 5 bis 15 °C am wohlsten. Können die Tiere ihre Körperwärme nicht mehr in ausreichendem Maß an die Umgebung abgeben (ab etwa 23 °C), wird es für die Tiere belastend. Dabei spielt neben der Temperatur auch die relative Luftfeuchtigkeit eine Rolle. Beide Faktoren werden im sogenannten Temperatur-Luftfeuchte-Index zusammengefasst, ab einem THI von 8 beginnt für Rinder der Hitzestress. Dieser äußert sich anhand einer erhöhten Atemfrequenz. Ein Wert von 30 bis 50 Atemzüge pro Minute gilt als normal. Je höher die Atemfrequenz, desto höher der Hitzestress. Sinkende Futteraufnahme und geringere Milchleistung sind die Folgen. Auch Fruchtbarkeitsprobleme und erhöhte Zellzahl können daraus resultieren. Die Kuh wird insgesamt krankheitsanfälliger.
Kühleffekt durch Ventilatoren
Die Ausrichtung des Stalls spielt hinsichtlich möglichst optimaler natürlicher Querlüftung eine wichtige Rolle. Im Idealfall steht der Stall quer zur Hauptwindrichtung. Die Trauf-First-Lüftung funktioniert aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen innen und außen. Wenn die Luft im Stall an heißen Tagen jedoch „steht“, können Kühe ihre produzierte Wärme kaum noch an die Umgebung abgeben. An solchen Tagen ist es sinnvoll, die Wärmeabgabe mit einer Unterstützungslüftung durch Ventilatoren zu fördern. Die höhere Luftgeschwindigkeit führt so zu einem Kühleffekt. Erreicht werden sollte eine Luftgeschwindigkeit von mindestens 2 m/s am Tier. Das reduziert die „gefühlte“ Temperatur.

FIT FÜR DEN SOMMER | 31


Welchen Ventilator wählen?
Die Lüftungstechnik unterscheidet sich im Wesentlichen zwischen axialen und vertikalen Ventilatoren sowie Schlauchbelüftungen.
Bei Schlauchbelüftungen drückt ein Ventilator Luft von außen durch einen Schlauch mit Löchern in den Stall. So wird die Luft gezielt an die gewünschte Stelle befördert, z. B. in die Liegeboxen. Schlauchbelüftungen werden zum Beispiel bei geschlossenen, langen Ställen verwendet, in denen die Zuluftführung schwierig ist. Der Schlauch wird vom Anbieter individuell angefertigt. Zu beachten ist, dass das System rund um die Uhr in Betrieb ist und laufend Kosten verursacht.
Deckenventilatoren haben oft große Durchmesser und sind häufig in der Mitte des Futtertisches angebracht. Sie drücken die Luft nach unten und von dort nach außen. Dabei reduzieren Hindernisse wie Aufkantungen am Fressgitter oder Liegeboxenabtrennungen die Luftgeschwindigkeit. Folglich ist der Kühleffekt im Randbereich des Stalls geringer. Vertikale Ventilatoren laufen langsamer und sind da-
durch leiser. Direkt unter den Ventilatoren entstehen hohe Luftgeschwindigkeiten, welche zu den Seiten schnell abnehmen. Besonders in Altgebäuden ist es oft aufgrund geringer Traufen- oder Dachhöhe schwierig, vertikale Ventilatoren sinnvoll zu positionieren.
Am häufigsten werden Axialventilatoren eingesetzt, bewährt haben sich hier mehrere, kleinere axiale Ventilatoren. Der Wirkungsbereich bzw. die Wurfweite ist u. a. abhängig vom Durchmesser. Als Faustzahl gilt: 1,0 1,2 m pro 10 cm Rotordurchmesser. Wichtig ist, den Ventilator im Winkel von 15 bis 25 Grad nach unten aufzuhängen.
Liegebereich berücksichtigen
In der Regel werden Axial-Ventilatoren (Durchmesser ca. 1 m) in Längsrichtung über den Liegeboxen mit einem Abstand von 15 bis 20 Metern angebracht, dies entspricht in etwa der Wurfweite. Die Belüftung des Liegebereichs ist besonders wichtig, weil sich die Tiere hier am längsten aufhalten sollen. Auch der Wartebereich vor dem Melkstand oder Roboter sowie der Fressgang sollten berücksichtigt
32 | FIT FÜR DEN SOMMER

Kurz & knapp
Die wichtigste Maßnahme zur Verringerung von Hitzestress im Milchviehstall sind ausreichend hohe Luftgeschwindigkeiten am Tier. Die zusätzliche Abkühlung über Verdunstungskälte durch Einsatz von Wasser kann eine zusätzliche Maßnahme sein, reicht aber alleine (häufig) nicht aus.
Bei der Investition in neue Technik sollten nicht nur die Preise für die Ventilatoren, sondern vor allem auch die laufenden Kosten berücksichtigt werden. Stromsparend ist eine automatische Frequenzsteuerung.
Um unnötige Stromkosten zu vermeiden und die Leistung zu erhalten, sollten Ventilatoren mindestens einmal jährlich vor der Lüftungssaison gereinigt werden. Abhängig von Einstreu und Einstreutechnik ist es sinnvoll, mehrmals zu entstauben.
werden. Um möglichst im gesamten Aufenthaltsbereich der Tiere – auch bei Trockenstehern — für angenehme Bedingungen zu sorgen, sind mehrere Lüfter erforderlich. Bei Anordnung in Längsrichtung des Stalles sind häufig zwei bis drei Lüfterreihen erforderlich, um die gesamte Stallbreite abzudecken. Alternativ können die Lüfter auch quer zum Stall ausgerichtet werden.
Wichtig ist, dass die Luftführung nicht gestört wird. Kraftfutterstationen mit Silos, Abtrennungen der Boxenübergänge oder niedrige Decken und Traufhöhen von Anbauten sind typische Störer. Vor der Anbringung der Ventilatoren sollte daher überlegt werden, wo Zuluft und wo Abluft möglich sind.
Ab einer Höhe von 2,70 m (Ventilatorunterkante) über der Standfläche ist kein Schutzgitter am Ventilator erforderlich. Schutzgitter reduzieren die Leistung des Ventilators, dies gilt insbesondere für verschmutzte Schutzgitter. Wegen der höheren Drehzahl sind Axial-Ventilatoren auch sehr viel lauter als Deckenventilatoren. Je höher die Temperatur, desto höher ist die erforderliche Drehzahl der Ventilatoren. Frequenzsteuerungen helfen in einem
Leistungsbereich von 10 bis 80 %, Strom zu sparen. Bei Ventilatoren, die permanent mit mehr als 80 % ihrer Leistung laufen, ist eine Frequenzsteuerung hingegen nicht sinnvoll.
Wer in neue Ventilatoren investiert, sollte auf jeden Fall auch eine automatische Steuerung mit Sensoren kaufen. Diese messen Temperatur und Luftfeuchte und passen die Lüftungsstärke an. Das hilft, damit es erst gar nicht zu Hitzestress kommt: Schon ab 18 °C sollten Lüfter langsam anlaufen und ab etwa 24 °C auf Volllast laufen. Wer seine Belüftung automatisch regeln lässt, wird erstaunt sein, wie frühzeitig die Ventilatoren im Stall anfangen zu arbeiten.
Wasserverdunstung
Zusätzlich wird der Kühleffekt durch Wasser über Verneblungs- oder Berieselungsanlagen erhöht. Der begrenzende Faktor ist jedoch die Luftfeuchtigkeit, bei über 70 % sollte der Einsatz von Wasser zur Befeuchtung unterlassen werden. Durch den sogenannte „Saunaeffekt“ ist eine Wärmeabgabe der Kühe dann nicht mehr möglich.
FIT FÜR DEN SOMMER | 33
Ein Ventilator mit 60 cm Rotordurchmesser hat eine Wurfweite von ca. sechs bis sieben Metern. Wichtig ist, den Ventilator im Winkel von 15 bis 25 Grad nach unten aufzuhängen.
Fotos: Agrarfoto, Schauer, Naturland / Sebastian Stiphout
Kühlen Kopf
BEWAHREN
Heiße Sommer stellen Geflügelbetriebe vor neue Herausforderungen. Zu warme Temperaturen können das Wohlbefinden der Tiere negativ beeinflussen und die Wirtschaftlichkeit verschlechtern. Machen Sie daher Ihren Stall fit für den Sommer.

AUTOR
Hans-Peter Jud
Beratung für Naturland hp.jud@ naturland-beratung.at
Um den Tieren auch an heißen Sommertagen ein angenehmes Klima bieten zu können, sollten schon jetzt Anpassungen stattfinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stalltemperaturen zu kühlen. Bis zu acht Grad Kühlung sind möglich, wie Versuche zeigen. Möglichkeiten dazu sind beispielsweise Hochdruckvernebelung von Wasser oder Wasserverdunstung mit sogenannten Coolpads.
Hochdruckkühlung
Bei der Hochdruckkühlung wird Wasser über Hochdruckdüsen mit einem Druck von circa 70 bar im Stall vernebelt. Die Düsen sollten sich dabei in der Nähe der Zuluftklappen befinden. Somit kann eine effiziente Verringerung der Temperatur im Stall erreicht werden. Die Sprühkühlung sollte dabei unbedingt gesteuert werden, um feuchte Einstreu und zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Wird etwa eine Luftfeuchtigkeit von circa 80 Prozent erreicht, muss die Verneblung unbedingt gestoppt werden. Sobald die Luftfeuchtigkeit durch die Lüftung wieder gesenkt wor-
den ist, gibt der Steuercomputer die Einbringung des Sprühnebels wieder frei. Die Investitionskosten für dieses System hängen von der Stallgröße ab, wobei die Preisunterschiede zwischen kleineren und größeren Ställen gering sind. Bei einer Größe von 1.000 Quadratmetern ist mit etwas mehr als 5.000 Euro (netto) zu rechnen. Kosten für Montage und Steuerung kommen hinzu. Bei kalkhaltigem Wasser stellt eine Entkalkungsanlage die Funktion der Hochdruckdüsen sicher.
Coolpads
Eine zweite Möglichkeit ist die Kühlung mit Coolpads. Die aus Zellulose oder Kunststoff bestehenden Pads werden dabei auf der Außenseite des Stalls angebracht und von oben mit Wasser (3 - 5 bar) berieselt. Die warme Frischluft wird durch die feuchten Pads über die Zuluftklappen in den Stall gesogen, nimmt Feuchtigkeit auf und kühlt sich ab. Auch bei diesem System ist eine Steuerung sinnvoll. Oft wird das Wasser für die Pads in einem Reservoir aufgefangen und dem
34 | FIT FÜR DEN SOMMER

Über Düsen in der Nähe der Zuluftklappen wird bei der Hochdruckkühlung Wasser vernebelt. Coolpads (li) eignen sich für Naturland-Ställe nur bedingt.

Kreislauf wieder zugeführt. Dies ist aber nicht empfehlenswert, da Keimbelastung entstehen kann, die Zuluft das Kreislaufwasser stetig erwärmt und dadurch die Kühlleistung sinkt.
Für Bio-Ställe ist dieses System aber nur bedingt einsetzbar. Das Problem besteht darin, dass im Stall Unterdruck vorherrschen muss, damit die Luft durch die Coolpads eingesogen wird. Sobald die Auslaufluken geöffnet werden, sinkt der Unterdruck und in weiterer Folge auch die Kühlleistung. Deshalb ist dieses System nur bedingt für Naturland-Ställe empfehlenswert.
Beide Kühlungsvarianten können auch in der kälteren Jahreszeit zur Luftbefeuchtung verwendet werden. Auch der Einsatz von Mikroorganismen ist mit diesen Systemen möglich. An sehr schwülen Sommertagen funktionieren diese Arten der Kühlung jedoch nur bedingt, da die maximale Luftfeuchtigkeit schnell erreicht ist.
Dach und Auslauf
Je schlechter die Dämmung ist, desto stärker erhitzt sich der Stall im Sommer. Es macht einen enormen Unterschied, ob ein Stall mit Blech-, Ziegel-, oder Paneeldach ausgestattet ist. Es empfiehlt sich in heißen Regionen, das Dach von alten, schlecht gedämmten Stallungen auf Paneele oder gar Gründächer (siehe S. 29) umzurüsten.
An heißen Tagen wird der Auslauf vorwiegend in den Morgen- und Abendstunden genutzt. Wenn
es zu warm wird, ziehen sich die Tiere in den Stall zurück. Deshalb ist es umso wichtiger, auch im Auslauf Schutz vor Sonne zu bieten. Zusätzlich zu natürlichem Schutz wie Bäumen und Sträuchern kann man auch technische Elemente gegen die Sonneneinstrahlung verwenden. Kleine Hütten aus Paneelen und Holzplatten eigen sich gut.
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Auslauf und Stall fit für den Sommer zu machen. Die meisten Geflügelstallbaufirmen bieten Kühlsysteme an. Für eine individuelle Lösung setzen Sie sich mit der Beratung für Naturland in Verbindung.

Tel. 0 71 56 / 95 92 04 www.mezger-landtechnik.de Günstige Neugeräte in bewährter Qualität POM Leichtgrubber Meteor 3 - 7,5 m 5,0 m mit Rohr- o. Stabwalze € Weitere Angebote: Ballenwagen, Kurzscheibeneggen ... finden Sie auf unserer Homepage! + Mwst. und Fracht FIT FÜR DEN SOMMER | 35
ANZEIGE
Fotos: Big Dutchman, Sterrer GmbH

AUTOR Roman Goldberger
Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de

WOLLEN‘S KÜHL Schweine
36 | FIT FÜR DEN SOMMER
Am Naturland-Betrieb Kloning haben die Schweine immer Zugang zur Suhle.

Schweine brauchen an heißen Tagen Abkühlung. In der Praxis weit verbreitet sind Duschen im Auslauf. Neuerdings findet man auch Suhlen.
An jedem heißen Sommertag das gleiche Bild: Schweine liegen im Kotbereich des Auslaufs, während der eingestreute Liegebereich fast leer ist. Verschmutzte Schweine, Emissionen und Tiere, die sich sichtlich unwohl fühlen, sind die Folge. Oft blockieren die im Kotbereich liegenden Schweine die Tränker. Das ist besonders an heißen Tagen ein Nachteil, weil die Tiere ihre Wasseraufnahme steigern und Körperwärme über den Harn abgeben. Läuft es ganz blöd, suchen sich die ansonsten sauberen Schweine alternative Ausscheidungsbereiche im Stall. Ausmisten mit Mistgabel und Schubkarren ist die Folge. Wie kann man das vermeiden?
Schweine brauchen Abkühlung
Schweine haben keine Schweißdrüsen und können daher nicht schwitzen. Bei Außentemperaturen jenseits der 20 Grad zeigen Schweine relativ rasch erste Stresssymptome. Höhere Atemfrequenzen und weniger Futteraufnahme sind die vorerst unsichtbaren Folgen. Sichtbar ist hingegen das natürliche Bedürfnis der Schweine, die Körpertemperatur durch Suhlen zu senken. Da solche Suhlen in den meisten Ställen fehlen, wird nicht selten der Kotbereich dafür herangezogen. Hohe Emissionen und schmutzige Schweine sind die Folge.
Zur Linderung der Hitzebelastung bietet der Handel eine Reihe technischer Lösungen (z. B. Cool Pads, Vernebelungsanlagen), die sich aber vorwiegend für zwangsbelüftete Ställe eignen. Für die in der ÖkoHaltung häufig vorkommende freie Lüftung sind
diese Methoden nicht empfehlenswert. Not macht bekanntlich erfinderisch. Die in der Öko-Schweinehaltung vorzufindenden Kühlmethoden sind meist Selbstbaulösungen.
Suhlen im Auslauf
Der wohl tiergerechteste Ansatz ist der Einbau von Suhlen im Auslauf. Der international bekannte Haltungsexperte Rudolf Wiedmann hat in den letzten Jahren einige Suhlen in Bio-Schweineställen geplant, eine davon am Naturland-Betrieb von NikkiAndrea und Konrad Kloning im schwäbischen Oettingen. Der Auslauf für ihre 240 Mastschweine ist in einen eingestreuten Liege- und einen Kotbereich unterteilt. Über eine Schwelle betreten die Schweine den Kotbereich, der zusätzlich eine 80 cm breite und 4 cm tiefe Rinne hat. „Diese Rinne befülle ich das ganze Jahr über mit Wasser“, erklärt Konrad Kloning. Der Grund: Die Schweine nutzen die Suhle laut Konrad Kloning so gut wie immer. Deshalb befüllt er die Suhle täglich neu mit dem Wasserschlauch. Einzige Ausnahme sind Frosttage. Andere Betriebe führen Wasser automatisch und regelmäßig in kleinen Portionen über Magnetschalter mit Zeitschaltuhren zu. Das Schwein als Bauchkühler kann sich in Suhlen wirkungsvoll abkühlen. Dazu reichen wenige Zentimeter tiefe Suhlen. Eine andere Möglichkeit, Suhlen in betonierten Ausläufen zu integrieren, sind sogenannte Stauschwellen am Ende einer schiefen Ebene. So wirkungsvoll und tiergerecht Suhlen im Auslauf sind, so vorsichtig sind Veterinäre bei der Empfehlung dieser Lösung. Hier
FIT FÜR DEN SOMMER | 37



gibt es hygienische Bedenken: Krankheitserreger oder Spulwürmer könnten über die Suhle von Bucht zu Bucht getragen werden. Eine einheitliche Ferkelherkunft ist jedenfalls empfehlenswert.
Nachbau mit Duschen
Der nachträgliche Einbau von Suhlen in bestehende Ausläufe ist oft schwierig. Als „schnelle Lösung“ verwenden daher viele Bio-Schweinehalter Duschen im Auslauf. Diese helfen – je nach Aktivierungsdauer – ebenfalls, die Körpertemperatur der Schweine kurzfristig zu senken, wie eine Studie an der Universität für Bodenkultur in Wien bestätigt. Besonders der Anteil der verschmutzten Schweine ging laut dieser Studie zurück. Ähnlich wie bei der Suhle sind Duschmöglichkeiten nur in Ausläufen mit verschiedenen Funktionsbereichen möglich. Dazu wird die Wasserleitung in den Auslauf verlegt, die Düse muss über dem Kotbereich platziert werden. Je nach Wasserdruck können unterschiedliche Düsen verwendet werden. Sognannte Bügeldüsen aus dem Gemüsebau sorgen für eine sehr feine Vernebelung und einen geringen Wasserverbrauch. Der Nachteil einer zu feinen Vernebelung ist allerdings die Windanfälligkeit. Wasser sollte nicht in den eingestreuten Liegebereich gelangen. Viele Landwirte regeln die Duschhäufigkeit mittels Zeitschaltuhr und Magnetventil. In den heißen Nachmittagsstunden sollte die Dusche regelmäßig laufen. Sinnvoll sind Absperrhähne an jeder Bucht, sodass leere Buchten oder Buchten mit Ferkeln abgedreht werden können.
Berieselung statt Dusche
Ein noch einfacherer Ansatz ist die Berieselung der Schweine mit einem Berieselungsschlauch. Dieser hängt über dem Kotbereich des Auslaufs. Erhältlich sind diese eigentlich für den Garten gedachten Berieselungsschläuche in Baumärkten. Der Wasserdruck muss zur Schlauchlänge passen, sodass Wasser auch aus den letzten Poren in Form von feinem Nebel spritzt.
1 Das Schwein als Bauchkühler kann sich in Suhlen wirkungsvoll abkühlen. Dazu reichen wenige Zentimeter tiefe Suhlen.
2 Oft werden Duschen über dem Kotbereich des Auslaufs eingesetzt. Sogenannte Bügeldüsen vernebeln das Wasser sehr fein.
3 Eine sehr einfache und kostengünstige Möglichkeit ist die Kühlung mit einem Berieselungsschlauch.
38 | FIT FÜR DEN SOMMER
Fotos: Martina Kozel, Roman Goldberger
1 2 3
Bis zu -35% Gebrauchtmaschinenrabatt

BioAgenasol ®
Bringt alle Kulturen zum Wachsen
Organisches Düngergranulat (NPK 6-3-2)
Auf rein pflanzlicher Basis Zügige N-Freisetzung
Zulässig im ökologischen Anbau (FiBL gelistet)


Rudolf-Diesel-Str. 2 | 72525 Münsingen | Tel. 07381 9354-0 contact@biofa-profi.de | www.biofa-profi.de
Auch keine Lust mehr auf Fertigfutter?
Flexibilität trifft Präzision
FLEXCARE
V Hackgeräte
Werkzeuglose Verstellung von Hackelementen & Werkzeugen Einzelreihenaushub (manuell oder GPS gesteuert): Schonung der Kultur in Feldkeilen
Top-Deal Angebote anfragen unter: www.poettinger.at/go/topdeals2024
Dünger für den Bio-Anbau

Pellet 105 Nord
(11 % N + 1 % P2O5 + 1 % K2O)
Gut ausbringbare 3,5 mm Pellets. Nahezu geruchsneutral. Besonders geeignet für die Düngung im Gewächshaus.
Pflanz-Kali-Pellets
(5 % N + 3 % P2O5 + 8 % K2O)
Rein pflanzlich, bestens verträglich, mit milder und nachhaltiger Stickstofffreisetzung auch für empfindlichste Kulturen.


Telefon: 0 42 44 / 92 74-0 ● info@beckhorn.de

Frisches Futter in bester Qualität – jederzeit!
Mahl- und Mischtechnik
Fahrbare Kraftfutterwerke ➜ ➜ ➜ ➜
Getreidelagerung
Getreideförderung bis 200 t/h
Einzel- und Komplettlösungen
Th. Buschhoff GmbH & Co. Kruppstraße 44, 59227 Ahlen, T. 0 23 82.80 84-0
www.buschhoff.de
ANZEIGEN | 39

KOMMENTAR
Von Johann Pinczker, Bioprodukte Pinczker GmbH
Rund um den Frühjahrsanbau laufen die Telefone heiß. Landwirte informieren sich: Was wird benötigt? Was soll man anbauen? Eine berechtigte Frage nach den enttäuschenden Preisentwicklungen der letzten Saison. Speisegetreide anstelle von Futtergetreide, lautet seit Jahren unsere Empfehlung. Das gilt auch in diesem Jahr. Das einzige Kauf- und Verkaufsargument bei Futtergetreide ist der Preis. Es gibt immer jemanden, der Futtergetreide billiger anbietet. Und darüber hinaus? Nach einer enttäuschenden Hafer-Ernte im Vorjahr ist dieser nun gesucht wie selten zuvor! Die Gefahr ist zwar groß, dass vom Baltikum bis Osteuropa im Frühjahrsanbau darauf reagiert wird und das Pendel bereits nächste Saison wieder umschlägt. Dennoch: Man startet mit leeren Silos und attraktiven Vorverträgen in die neue Saison – und für Verbandsware wird die Nachfrage hoch bleiben.
GETREIDEMARKT
Am Speisegetreidemarkt ist eine klare Fokussierung auf Verbandsware zu erkennen. Vor allem bei Hafer und Dinkel hat die Nachfrage in den letzten Monaten spürbar angezogen. Hafer ist nach einer schwachen Ernte gefragt. Die überjährigen Dinkelbestände bauen sich allmählich ab. Auch für die kommende Ernte werden keine großen Dinkel-Mengen prognostiziert, weshalb spätestens zur Ernte ein Preisanstieg möglich ist. Bei Weizen und Roggen ist derzeit kaum ein Impuls spürbar.
Großhandelspreise für deutsche Verbandsware im Februar 2024 bei Abnahme von
Erzeugerpreise liegen – je nach Vermarkter und Transportkosten – um 30 bis 50 Euro/t darunter. In Einzelfällen kann die Differenz auch größer sein. * prompt/ex Ernte, Preise ohne Stern = Termin/Jahreskontrakt
Futterweizen und Mais sind weiterhin reichlich verfügbar, vermutlich über die kommende Ernte hinaus. Insofern erwarten Marktkenner keine höheren Preise. Leguminosen hingegen sind nach wie vor gesucht. Importe aus dem Baltikum wurden zuletzt mehr, was das Preisniveau trotz Mangel auf aktuellem Niveau halten dürfte. Die Preise für BioSojakuchen haben sich auf hohem Niveau gefestigt. Folglich haben sich auch die Mischfutterpreise nach einem Rückgang eingependelt.
loser
an Verarbeiter bzw. Mühlen frei Rampe (netto, Euro/t) Gewichteter Durchschnittspreis Von Bis Ackerbohne 587 570 600 Körnermais (vorger.) 327 320 340 Brotweizen (vorger.) 395 385 450 Futterweizen 301 290 310 Futtergerste* 286 260 300 Futterroggen* 234 200 267 Speisehafer 433 410 470 Speisehafer glutenfrei 475 465 490 Futterhafer* 277 260 315 Roggen (vorger.) 329 320 335 Sojabohne (lose) 751 600 775 Triticale* 262 250 280
Ware
Quelle: AMI anhand 19 Meldestellen 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Alleinfutter für Legehennen, Endmast für Schweine 18/4 Milchleistungsfutter Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz Alleinfutter für Legehennen, Verband, Phase 1 Endmast für Schweine ab 80 kg, Verband 18/4 Milchleistungsfutter mit Mais, Verband 2021 2022 2023 2024 Quelle: AMI
FUTTER
MARKT & PREISE
MILCHMARKT
Auch Anfang 2024 setzten die Bio-Milchpreise ihre leichte Aufwärtsbewegung fort. Gegenüber dem Vorjahr erhielten die Bio-Milcherzeuger im Durchschnitt trotzdem um 6,9 Ct/kg weniger. Die Mehrheit der Bio-Molkereien in Deutschland zahlte zu Jahresbeginn konstantes Milchgeld aus. Vieles spricht dafür, dass sich der Bio-Milchmarkt weiterhin konsolidiert. Die private Nachfrage nach vielen Bio-Produkten zieht an. Die Milchanlieferung folgt zwar ihrem saisonal steigenden Verlauf, deutschlandweit wird für 2024 aber nicht mit einem großen Mengenzuwachs gerechnet, zu gering ist aktuell das Umstellungsinteresse. Außerdem reicht der Rohstoff bei einigen Molkereien nicht aus. Insofern erwarten Marktkenner mittelfristig auch einen Anstieg der Verkaufspreise im Laden. Dort spielt Verbandsmilch eine zunehmend wichtige Rolle, was den Rohstoff weniger austauschbar macht. Es spricht also vieles dafür, dass sich bei den Erzeugerpreisen für Bio-Milch der leichte Anstieg in den kommenden Monaten fortsetzt.
SCHWEIN & RIND
In Deutschland ist die Versorgung mit NaturlandSchweinen weiterhin knapp. Neben dem positiveren Konsumklima liegt dies vor allem an Neulistungen im Lebensmittelhandel. War noch vor einem Jahr ein Überhang an Naturland-Schweinen zu beobachten, so ist heute die Nachfrage größer als das Angebot. Folglich sind neue Lieferanten – Ferkelerzeuger und Schweinemäster – jederzeit willkommen. Auch in Österreich scheint sich der Markt ins Positive zu drehen. Die über mehr als ein Jahr anhaltende Überschusssituation scheint sich zu entspannen.
Ähnlich sieht die Situation am Markt für Bio-Rinder aus. Hier lösen sich Wartelisten langsam auf – im Süden rascher als im Norden. Bei Kühen ist saisonal sogar ein leichter Mangel spürbar. Ansonsten wird der Markt von Experten als ausgeglichen beschrieben.
Preise für ökologisch und konventionell erzeugte Kuhmilch in Deutschland (4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, in Cent/kg netto)
Durchschnittliche Milchpreise ab 2012 in Deutschland (4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, in Cent/kg netto)
Quelle: BLE, AMI
Quelle: BLE

Zertifziert: DE-037-ÖkoKontrollstelle



Wir sind auch Öko!




» Frühbezugskonditionen für öko Saatgetreide + Leguminosen sichern
» Große Auswahl an öko Maissorten
» Öko Kleegras und Nachsaatmischungen für alle Lagen und Nutzungen inkl. Stilllegungen


» Öko Düngemittel Schwefeldünger Granugips, Kieserit, Patentkali, Spower-Dünger für Acker und Grünland


» Einstreumittel & Güllezusätze wie Steinmehl, Leonardit, Pflanzenkohle, Dekamix
Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land

Betrieb St. Wolfgang Raiffeisenstr. 3 • 84427 St. Wolfgang • Tel. 0 80 85 - 15 32 www.rwg-erdinger-land.de www.bio-kleegras.de

35 40 45 50 55 60 65 70 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Konventionell Öko 25 30 35 40 45 50 55 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Konventionell Öko
ANZEIGE
MARKT & VERMARKTUNG | 41

Normal.“ „ Bio ist das neue
AUTORIN Claudia Mattuschat
freie Journalistin

KARIN ROMEDER
Als Mitglied der Geschäftsleitung ist Karin Romeder bei der Naturland Zeichen GmbH für den Bereich Außer-Haus-Verpflegung, Hofverarbeitung und Direktvermarktung zuständig.

Karin Romeder war im Februar auf der Biofach und hat mit ihrem Team unter anderem die Naturland Gastro Lounge betreut. Expertinnen und Experten haben dort gezeigt, wie man Bio in der Außer-Haus-Verpflegung erfolgreich umsetzen kann. Eines vorweg: Die Landwirtschaft spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Eindrücke hast Du auf der Biofach diesmal gewonnen?
Auch in der Außer-Haus-Verpflegung ist Bio das neue Normal. Das zeigte sich unter anderem an zahlreichen Produktneuheiten. Sehr gefreut hat mich, dass unsere Naturland-Gastro-Lounge so gut besucht war. Menschen aus Gastronomie, Landwirtschaft und Verarbeitung kamen dort zusammen, um erfolgreiche Praxisbeispiele zu erleben und Kontakte zu knüpfen.
Was ist der Grund für diese positive Entwicklung? Bio wird als Wettbewerbsvorteil gesehen – vor allem dann, wenn der Ursprung der Lebensmittel für den Gast erlebbar wird. Deshalb legen wir bei der Beratung der Naturland-Gastropartner ja auch so
viel Wert darauf, mindestens zwei bis drei Direktvermarkter aus der Region einzubinden, die zum Beispiel Eier, Fleisch oder Gemüse liefern. Die Basis kann der Bio-Großhandel mit rund 13.000 Bio-Artikeln optimal abdecken. Noch spezialisierter ist die Bio Partner Deutschland Foodservice GmbH, in der sich EPOS, Terra Naturkost, Kornkraft Biohandel und Naturkost Erfurt jetzt zusammengeschlossen haben. Sie beliefert ausschließlich die Außer-HausVerpflegung, das ist natürlich sehr praktisch.
Wie viel Bio ist in der Gastronomie aus deiner Sicht realistisch?
100 Prozent schaffen die wenigsten Küchen. Die meisten starten mit einem überschaubaren BioWareneinsatz, um sich dann je nach Möglichkeit zu steigern. Das wird auch durch die neue Bio-AHV-Verordnung unterstützt, die eine stufenweise Auszeichnung von eingesetzten Bio-Anteilen vorsieht und dem dänischen Vorbild folgt. Bronze steht dabei für 20 bis 49 Prozent Bio, Silber für 50 bis 89 Prozent, und Gold für 90 bis 100 Prozent Bio. Diese Einteilung ist von den Verbraucherinnen und Verbrauchern gelernt und lässt sich gut kommunizieren.
Welche Rolle spielen die Bäuerinnen und Bauern in der Außer-Haus-Verpflegung?
Viel wichtiger als Gold-Standard finde ich, dass
MARKT & VERMARKTUNG | 43
Fotos: Naturland / Sabine Bielmeier


Bio in der Außer-Haus-Verpflegung ein Gesicht bekommt. Die Zutatenliste ist auf der Speisekarte ohnehin obligatorisch geworden. Wie toll ist es da, wenn man die Bäuerinnen und Bauern vorstellen kann, von denen die Zutaten stammen. So eine Transparenz schätzen die Gäste heute, und ganz nebenbei entsteht ein weiterer Nutzen: Man setzt sich mit dem Thema Bio auseinander, lernt Landwirtschaft aus der Region kennen, und so mancher hat vielleicht einen Hofladen, in dem man auch für die eigene Küche einkaufen kann.
Wie trägt die Naturland Zeichen GmbH zu der Entwicklung bei?
Als ich 2020 bei der Naturland Zeichen GmbH anfing, kam zeitgleich die Pandemie. Die hat mein Team ausgebremst, aber wir haben die Zeit für Ideenentwicklung genutzt, um danach richtig durchzustarten. In München haben wir Speed Datings unter dem Motto „Küche trifft Region“ veranstaltet, da dort der Bio-Anteil in der Außer-HausVerpflegung von aktuell 40 Prozent auf 60 Prozent in 2025 gesteigert werden soll. Mit unserem Veranstaltungsformat haben wir Landwirtschaft und Gastronomie erreicht und den Weg für zahlreiche
Auf der Biofach ermöglichte Karin Romeder mit ihrem Team einen Austausch zwischen Gastronomie, Landwirtschaft und Verarbeitung. Die Firma Herbaria mit Geschäftsführer Erwin Winkler wurde neuer Naturland Fair Partner.
neue Lieferpartnerschaften geebnet. Ein weiteres Beispiel ist unsere Workshop-Reihe „Mehr Bio in der Betriebsgastronomie“, die seit 2023 Küchenleiter, Landwirte, Verarbeiter und Händler anspricht. Bio-Mentorinnen und Mentoren zeigen dabei auf Basis ihrer Praxiserfahrungen, wie Bio zum Erfolg wird: nämlich durch optimierten Einkauf, effizienten Wareneinsatz und intelligente Logistik. Am 24. April widmen wir uns mit dem Bund Naturschutz dem Thema „Getreide – das heimische Superfood“.
Was muss ich als Landwirtin mitbringen, um gastro-fit zu sein?
Auch dazu haben wir einen Workshop unter dem Motto „Fit für die Bio-Gastronomie“ entwickelt. Denn natürlich gibt es einige Dinge, die man als Direktvermarkter gerade auch im Bereich IFS Standard und Hygienemanagement beachten muss. Grundsätzlich ist all dies gut machbar.
44 | MARKT & VERMARKTUNG

„Bio wird als Wettbewerbsvorteil gesehen – vor allem dann, wenn der Ursprung der Lebensmittel für den Gast erlebbar wird.“
Mit Bio handeln. Für Bio handeln.


Wie sinnvoll ist es, sich als Bio-Betrieb in der Vermarktung Richtung Außer-Haus-Verpflegung zu orientieren?
Das ist eine echte Chance. Die Außer-Haus-Verpflegung ist ein vielversprechender Absatzmarkt, in dem die Regionalität eine wichtige Rolle spielt. Ich kenne landwirtschaftliche Betriebe, die einfach an die örtliche Gastronomie herangetreten sind und ihre Bio-Produkte vorgestellt haben. So entstehen oft die perfekten Matches. Und ansonsten sind gastro-interessierte Bäuerinnen und Bauern bei der Naturland Zeichen GmbH natürlich genau richtig: Wir haben das Know-how und die Kontakte, um tragfähige Partnerschaften vom Feld bis in die Küche zu knüpfen.
Wie bist Du eigentlich zur Expertin der AußerHaus-Verpflegung geworden?
Netzwerkerin wurde ich schon beim Ökoring, der als Bio-Großhandel gegründet wurde und sich schnell zum Bio-Gastropartner entwickelt hat. Die Tollwood Initiative „Bio für Kinder“ habe ich von Anfang an begleitet, ebenso die BioHotels und viele Kitas und Schulen, die ihr Verpflegungskonzept ändern wollten. Da wusste ich schnell: Mir liegt die Zusammenarbeit mit Menschen, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Und ich mag diesen Zusammenhalt im Kleinen, bei dem es ja immer auch um ein großes Ganzes geht. Durch Robert Dax, der nicht nur den Ökoring, sondern auch Naturland mitgegründet hat, kam ich damals viel in Kontakt mit Naturland-Betrieben und dort mit den Themen Hofverarbeitung und Direktvermarktung. So war mein weiterer Weg, der mich 2020 in den Bereich Außer-Haus-Verpflegung der Naturland Zeichen GmbH geführt hat, quasi schon vorgezeichnet.


















BioWest Düsseldorf
7. April 2024 | 9 – 17 Uhr biowest.info
BioOst Leipzig
21. April 2024 | 9 – 17 Uhr bioost.info
Besuchenden- und Ausstellendenservice: T 05 11.35 90 100 und über info@biomessen.info. Gutscheine für die Akkreditierung über Ausstellende/ausstellenden Großhandel. Aktuelles Ausstellendenverzeichnis auf biomessen.info. Besucht uns auf Facebook und Instagram!
CO₂
20 JAHRE
Starker Auftritt auf der
BIOFACH
Im Februar stand Nürnberg wieder für vier Tage ganz im Zeichen von Bio. Auf der Biofach, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, präsentierten sich Naturland e.V. und Naturland Zeichen GmbH zusammen mit 55 Partnern aus Verarbeitung und Handel. Mit rund 1.900 Quadratmetern war es erneut die größte Gemeinschaftspräsentation auf der Biofach. Einen Überblick über das bunte Messetreiben gibt unser Fotorückblick.
Autor: Markus Fadl, Naturland e.V.


2 3


1
4 46 | MARKT & VERMARKTUNG


1 Schwerpunkt Bio in der AußerHaus-Verpflegung: Das Gastro-Team der Naturland Zeichen GmbH war gleich doppelt am Start – am Naturland-Stand und auf der neuen Gastro-Sonderfläche der Messe. Dort gab Bio-Spitzenkoch Konrad Geiger Tipps aus der Praxis, hier gemeinsam mit Katharina Mayer vom Gastro-Team.
2 Die Biofach bietet immer auch zahlreiche Gelegenheiten für politische Gespräche. Eröffnet wurde die Messe von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Auf dem Bild stehen Hubert Heigl (Naturland) und Jan Plagge (Bioland) in lockerer Runde zusammen mit Özdemirs Staatssekretärin Silvia Bender, dem

5

6
baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Harald Ebner und ExMinisterin Renate Künast.
3 Zur Biofach veröffentlichten Naturland und Bioland gemeinsam einen neuen Orientierungspreis für BioMilch nach den Standards der beiden Verbände. Die entsprechende Veranstaltung im Kongressprogramm stieß auf reges Interesse. Auf dem Podium u. a. Wilhelm Heilmann, Geschäftsführer der Naturland Zeichen GmbH
(2.v.l.).
4 Die Biofach ist längst auch eine Jobbörse. Studierende und Azubis aus landwirtschaftlichen Bildungsgängen checken hier potenzielle Ar-
beitgeber ab. Wer die besten jungen Talente bekommen will, ist gut beraten, sich entsprechend zu präsentieren.
5 Mehr Frauen ins Ehrenamt: Das von Präsidiumsmitglied Marion Bohner (ganz rechts) organisierte Naturland-Frauentreffen griff das Fokusthema der Messe „Food for the Future: Frauen und nachhaltige Ernährungssysteme“ auf.
6 Per Virtual-Reality-Brille in eine Bio-Aquakultur eintauchen. Die Informationskampagne „Being Organic in EU“, die Naturland gemeinsam mit dem italienischen Verband FederBio umsetzt, war allgegenwärtig.
MARKT & VERMARKTUNG | 47
Fotos: Sabine Bielmeier / Naturland

Ab in die Koppelweide
48 | RIND & GRÜNLAND


AUTOR
Timo Manger
Beratung für Naturland t.manger@ naturland-beratung.de
Braune, ausgetrocknete Grünlandbestände und totaler Zusammenbruch des Wachstums – diese Bilder traten in den Sommermonaten der vergangenen Jahre immer wieder auf. Ein Ausweg kann die Koppelweide sein.
Grenzen der Kurzrasenweide
In den letzten zwei Jahrzenten erfuhr die Kurzrasenweide einen regelrechten Hype. Besonders ihre arbeitswirtschaftlichen Vorteile und hohen Futterqualitäten sprechen für sie. Doch nun kommt das System Kurzrasenweide an seine Grenzen. Bei ausgeprägter Trockenheit und auf flachgründigen, wenig wasserhaltefähigen Böden bricht das Wachstum schnell komplett ein. Auch die bisher mit Niederschlag ausreichend versorgten Mittelgebirgslagen bekommen bei Trockenperioden zunehmend Probleme. Auf vielen Betrieben stellt sich die Frage, mit welchem Weidesystem sie durch den Sommer kommen. Wenn man sich den oberirdischen Pflanzenbestand auf einer Weide anschaut, kann man
RIND & GRÜNLAND | 49

Die Weidesaison sollte mit einem stundenweisen Austrieb auf die gesamte Weidefläche gestartet werden. Später wird die Fläche in Koppeln geteilt.
diesen auch unter die Erde „spiegeln“. Kurzrasenweiden weisen eine extreme Durchwurzelung in den oberen zehn Zentimetern des Bodens auf. Schnellwüchsige Gräser wie Deutsches Weidelgras oder Wiesenrispe bilden zusammen mit Weißklee als Leguminose und manchmal Spitzwegerich die typische Pflanzengemeinschaft einer Kurzrasenweide. Diese Pflanzen haben keinen tiefen Wurzelgang, ihre Reservestoffe lagern
fehlt, stellen die Pflanzen ihr Wachstum sehr schnell ein.
Tiefere Durchwurzelung
Bei einer Koppelweide hingegen bekommen Gräser mehr Zeit, um aufzuwachsen. Somit haben die Pflanzen die Möglichkeit, tiefer zu wurzeln und auch an tiefergelegene Wasserspeicher im Boden zu kommen. Wird bei einer Kurzrasenweide eine Aufwuchshöhe von 6 – 8 cm angestrebt, so sind
„Der große Vorteil der Koppelweide zeigt sich in trockenen Zeiten.“
sie dicht am Oberboden und ihre Blätter haben eine geringe Wachstumszeit. Stimmen hier Wasserversorgung und Nährstoffangebot, kann eine sehr leistungsfähige Weide entstehen. Sobald aber das Wasser
bei der Koppelweide 15 – 20 cm Wuchshöhe beim ersten Auftrieb in die Koppel sinnvoll. Durch den höheren Aufwuchs können Verdaulichkeit und Leistungen niedriger sein. Das hängt allerdings davon ab, aus welchen Pflanzen
sich der Bestand zusammensetzt. Der große Vorteil der Koppelweide zeigt sich in trockenen Zeiten: Hier verschafft man sich durch den höheren Aufwuchs eine gewisse Futterreserve. Zudem schützen die hohen Pflanzenbestände den Boden besser vor Austrocknung durch Wind und Sonne. Durch die Verdunstung im hohen Gras entsteht ein Mikroklima mit niedriger Umgebungstemperatur, somit geht weniger Wasser verloren. Höherer Pflanzenbestand kann auch Tau besser einfangen und somit Wasser besser nutzen.
So gelingt die Koppelweide
Vor dem Kauf von Zaunmaterial sollte festgelegt werden, wie die Koppeln, Triebwege und eventuelle Tränken angelegt und gestaltet werden sollen. Dazu kann ein Luftbild sehr wertvoll sein.
50 | RIND & GRÜNLAND
Koppel 1 2 3 4 5 6 7 8
Frühjahr
1. Aufwuchs
2. Aufwuchs
3. Aufwuchs sehr
Weide
Koppel 1 2 3 4 5 6 7 8
Frühjahr
1. Aufwuchs
2. Aufwuchs
3. Aufwuchs sehr
Weide
Abb.: Schematische Darstellung zweier Weidesysteme mit acht Koppeln
Quelle: HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Im zeitigen Frühjahr sollte die gesamte Weidefläche einmal überweidet werden. Das gilt auch für die Winterfutterflächen. Die Überweidung regt die Gräser zur Bestockung an und bricht den riesigen Futterzuwachs im Frühjahr. Würde man bei einer Koppelweide bis zur gewünschten Aufwuchshöhe mit dem Weide-
austrieb abwarten, so wäre das Futter auf der Weide schnell viel zu alt. Deshalb startet man die Weidesaison am besten mit einem stundenweisen Austrieb auf die gesamte Weidefläche und fängt dann langsam an, in Koppeln zu unterteilen. Um in den später beweideten Koppeln kein altes Futter zu haben, werden
diese als Winterfutter konserviert. Zur besseren Planung ist es unabdingbar, die Graszuwächse einmal pro Woche zu messen. Die Abbildung zeigt Möglichkeiten, wie beispielsweise acht Koppeln eines Weidesystems beweidet und gemäht werden können.
Futter im Koppelweidesystem ist eventuell schlechter zu verdauen. In diesem Fall sollten die Tiere mit den höchsten Futteransprüchen zuerst geweidet werden. Später lässt man die Koppel von Trockenstehern oder älterem Jungvieh fertig fressen. Der obere Teil des Pflanzenbestandes ist der nährstoffreichste und kann so von den Milchkühen genutzt werden.
Gute Beobachtung der Tiere auf der Weide beugt unter anderem Blähungen vor. Weiden mit hohen Leguminose-Anteilen sowie schnell wachsendes, junges Futter nach Trockenperioden stellen ein höheres Risiko dar. Die Tiere sollten in diesen Fällen nur stundenweise oder nicht mit leerem Pansen auf die Weide gehen.
ANZEIGE

Ihre Profis für tiergerechte Flächen und nachhaltige Bodenbefestigung ohne Schlamm und Matsch!
www.ecora.de
zeitige Frühjahrsüberweidung
Weide Weide Weide Weide Mahd Mahd Mahd
Weide Weide Weide Mahd Mahd Mahd Mahd Mahd
Weide Weide Weide Weide
Weide Weide
Weide Weide
Frühjahrsüberweidung
zeitige
Mahd Mahd Mahd Weide Weide Weide Weide Weide
Weide Weide Weide Mahd Mahd Mahd Mahd Mahd
Weide Weide Weide Weide Weide Weide Weide

Kurz & knapp
„Im zeitigen Frühjahr sollte die gesamte Weidefläche einmal überweidet werden.“
Beide Systeme zusammen denken
Interessant ist die Kombination aus Koppelweide und Kurzrasenweide. So kann die Weide im Frühjahr bei optimalen Wachstumsbedingungen als Kurzrasenweide genutzt werden. Aus Gründen der Futterqualität ist der Einstieg durch großflächige Beweidung sowieso zu empfehlen. Im späten Frühjahr und Frühsommer kann dann
zu höheren Weideaufwüchsen mit Koppelweide umgestellt werden. Wenn die Wachstumsbedingungen im Herbst für das Grünland wieder besser werden, ist erneut die Kurzrasenweide möglich. Auch im Hinblick auf das Blährisiko kann dies von Vorteil sein. Wichtig ist bei allen Weidestrategien, die Nutzung im Herbst rechtzeitig zu beenden. Dafür sollte im Frühjahr meistens früher ausgetrieben werden.
Mit hohen Anteilen Weidefutter in der Ration können die Produktionskosten deutlich gesenkt werden. Die trockenen Sommermonate bringen das System Kurzrasenweide an seine Grenzen. Mit der Koppelweide verschafft man sich hingegen durch den höheren Aufwuchs eine gewisse Futterreserve. Zudem schützen die hohen Pflanzenbestände den Boden besser. In Regionen, die häufiger von ausgeprägter Trockenheit betroffenen sind, kann die Artenzusammensetzung in Richtung horstbildender Obergräser (z. B. Knaulgras, Wiesenschwingel, Glatthafer, Wiesenlieschgras etc.) gelenkt werden. Zusammen mit Luzerne oder Rotklee kommen diese Gräser durch ihr tiefes Wurzelwachstum mit trockenen Bedingungen besser zurecht.
52 | RIND & GRÜNLAND
Fotos: Agrarfoto, Sabine Bielmeier, Franziska Müller

BERATERTIPP
Helene Paulsen Beratung für Naturland h.paulsen@ naturland-beratung.de

Foto: Agrarfoto
Lebensaufgabe Mortellaro-Bekämpfung
Mortellaro ist einer der Hauptgründe für Klauenprobleme bei Milchkühen. Die Bestandssanierung dauert Jahre.
Hautentzündungen am Übergang zum Ballenhorn, offene Hautstellen oder lahmende Tiere. Mortellaro hat viele Gesichter und ist eine lebenslange Infektion. Akut erkrankte Tiere müssen separiert und der Keimaustausch zwischen den Tiergruppen vermieden werden, denn Mortellaro ist ansteckend. Das betrifft z. B. das Melkgeschirr, Handschuhe und Gülle/Mist. Um Einträge zu vermeiden, sollte nach Möglichkeit auf Tierzukäufe verzichtet oder nur Tiere zugekauft werden, die nachweislich Mor-
tellaro-frei sind. Gemeinschaftsweiden, gemeinsam genutzte Viehanhänger oder die Gummistiefel externer Besucher sind weitere Eintragsrisiken.
Auch augenscheinlich gesunde Tiere können Träger sein. Zum Ausbruch kommt die Krankheit erst bei hohem Infektionsdruck und Kühen mit vermindertem Immunsystem (Stress). Optimale Fütterung und Haltung sind daher wichtige Vorbeugemaßnahmen.
Bei Mortellaro im Bestand ist es ratsam, zusammen mit Klauenpfleger und ggf. Tierarzt eine Behandlungsstrategie zu überlegen. Diese beinhaltet zwei- bis dreimal jährlich einen Pflegeschnitt. Akute Fälle müssen sofort behandelt werden. Bei kleinen
Wunden unter 2 cm reicht oft ein Spray samt Verband. Bei größeren Läsionen empfiehlt sich eine Behandlung mit Novaderma (Achtung Wartezeit) oder dem Mortella-Heal-Pflaster – und in beiden Fällen einem Verband. Ganz wichtig: Nachbehandlung und Jungvieh nicht vergessen!
Die Klauen der Milchkühe sollten täglich begutachtet werden, Jungvieh alle zwei bis vier Wochen.
TIPP
Online finden Sie ein E-LearningProgramm zum Thema Klauengesundheit:

RIND & GRÜNLAND | 53

DER
Kuhversteher
Wer kennt das nicht: Bemerkt man eine Erkrankung in einem frühen Stadium, ist die Behandlung erfolgsversprechender. Mit dem Pansenbolus ist diese Früherkennung in der Kuhherde möglich. Naturland-Milchviehhalter Johannes Rutz verwendet das System seit drei Jahren.
54 | RIND & GRÜNLAND
AUTOR
Roman Goldberger
Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de

„Der Tierarzt schimpft schon“, sagt Johannes Rutz mit einem Augenzwinkern und lacht. Der Milchviehhalter aus Rosenheim in Bayern setzt seit drei Jahren auf den Pansenbolus des österreichischen Anbieters smaXtec – und er ist zufrieden. „Ich erspare mir damit Zeit, Besamungs- und Tierarztkosten.“ Dass sein Veterinär deswegen schimpft, meint der Landwirt nicht ernst. „Der ist natürlich auch zufrieden“, fügt er lächelnd hinzu.
So funktioniert der Bolus
Der Pansenbolus wird der Kuh oral eingeführt und bleibt im Netzmagen. Nach der Eingabe braucht er eine gewisse Zeit, um seine Kuh kennenzulernen. Schon nach wenigen Stunden sind die ersten Kuhdaten im System sichtbar. Der Bolus misst Körpertemperatur, Bewegungsaktivität und Wiederkautätigkeit. Den Beginn des Wiederkauens erkennt der Bolus beispielsweise an den typischen drei aufeinanderfolgenden Kontraktionen des Netzmagens. Neuerdings erkennt der Bolus auch die Trinkzyklen
sowie die aufgenommene Wassermenge der Kuh und schlägt Alarm bei Abweichungen. Rutz: „Damit bemerke ich recht rasch, wenn zum Beispiel das Tränkebecken verunreinigt ist.“ Dass die Kuh trinkt, erkennt der „Kuhversteher“ am kurzzeitigen Absinken der inneren Körpertemperatur. Sind einzelne Werte der Kuh auffällig, erhält Johannes Rutz eine Pushmeldung auf sein Smartphone. Somit werden Erkrankungen früher erkannt. „Wir haben seither so gut wie keine festliegenden Kühe mehr“, berichtet Johannes Rutz. Kühe, die der Bolus meldet, behandelt der Bio-Bauer mit Calcium. „Früh dran zu sein, ist hier ein Riesenvorteil“, so der Bio-Milchviehhalter. Doch das ist nicht der einzige Nutzen.
Hilfe bei Brunst und Abkalbung
„Der Pansenbolus hilft mir beim Herdenmanagement, indem er mich bei Entscheidungen unterstützt“, erklärt Johannes Rutz. Anhand der vom Bolus gesendeten Informationen errechnet die Software zum Beispiel die voraussichtliche Abkalbezeit. „Die Abkalbung ist meist 18 bis 20 Stunden nach der Meldung auf meinem Handy. Es bleibt also noch genügend Zeit, die Kuh in die Abkalbebox zu treiben“, erklärt Rutz. Auch den optimalen Besamungszeitpunkt grenzt das System auf wenige Stunden ein. Am Betrieb Rutz ist diese Unterstützung bei der Blockabkalbung der 35-köpfigen Kuhherde besonders wichtig. „Von September bis Januar kommen laufend Kühe zur Abkalbung. Wenn die letzten Kühe abkalben, geht bei den ersten schon wieder die Brunst los. Da kann es für einen Nebenerwerbslandwirt auch mal stressig werden“, erzählt Johannes Rutz, der neben der Landwirtschaft bei

smaXtec-Früherkennung klinische Anzeichen sichtbar
RIND & GRÜNLAND | 55
Fotos: Goldberger, Grafik: Hersteller
Die grüne Kurve zeigt die Wiederkautätigkeit, die Blaue die innere Körpertemperatur und die Rote die Bewegungsaktivität. Die Frühwarung mit Symbolen hilft, Erkrankungen oder Ereignisse frühzeitig zu erkennen.

ich während der Blockabkalbung jeden Tag am Abend noch schnell in den Stall gegangen. Heute bin ich dank der Unterstützung des Herdenprogramms entspannter.“
Überblick über die Herde
Im Webportal von smaXtec kann Johannes Rutz alle Daten seiner Herde einsehen. Dazu nutzt er entweder den Büro-PC oder die smaXtec-App für das Smartphone. Die Übersichtsseite zeigt den Gesundheits- und Fruchtbarkeitsstatus der Herde sowie anstehende Maßnahmen. Neben dem Wochenvergleich der Gesamtherde ist auch die Ansicht des Einzeltiers möglich. Innere Körpertemperatur (+-0,01 °C), Wiederkautätigkeit, aufgenommene Wassermenge und Trinkzyklen sowie Aktivität werden dabei als Kurven angezeigt. Zudem informiert das Programm via Messenger-Meldung, welche Kühe demnächst abkalben, besamt oder trockengestellt werden. Die Datenanalyse des Systems ist



Die Eingabe des Pansenbolus‘ erfolgt oral, dieser bleibt fortan im Netzmagen.
selbstlernend und lebt von der wachsenden Datenmenge in der smaXtec Cloud TruDTM.
Kosten
Die Kosten setzen sich aus mehreren Punkten zusammen, teilweise ist hierfür eine Förderung möglich. Die Kosten pro Bolus liegen beim NaturlandBetrieb Rutz bei 30 Euro. Für den Bolus gibt der Hersteller eine „kuhlebenslange“ Garantie. Bei Bedarf wird ein kostenloser Bolusersatz zur Verfügung gestellt. Rutz: „Bislang habe ich noch keinen Ersatz gebraucht.“ Ein weiterer Kostenfaktor ist eine sogenannte Gesundheitsmonitoring-Gebühr, die laut Hersteller bei drei Euro pro Kuh und Monat liegt. Rutz: „In Bayern werden die Kosten vom Sonderprogramm Landwirtschaft Digital gefördert.“ Der dritte Kostenfaktor ist die Basisstation, für die zu Beginn einmalig Kosten anfallen. Über deren Höhe gibt der Hersteller auf unsere Anfrage keine Angaben. Diese Basisstation ist im Stall platziert und empfängt
ANZEIGE
Vor der oralen Eingabe speichert das System den Pansenbolus mittels Code ab.

„Der Pansenbolus hilft mir beim Herdenmanagement, indem er mich bei Entscheidungen unterstützt.“
Daten aus den Boli bis zu einer Entfernung von rund 50 Metern. Optional bietet smaXtec eine Station mit einer größeren, empfangsstärkeren Antenne an. Diese kann Daten von durchschnittlich 100 Metern entfernten Boli empfangen. Selbst wenn die Kühe tagsüber auf einer weiter entfernten Weide sind, gehen die Daten nicht verloren. Der Bolus ist mit einem internen Speicher ausgestattet, der die Messwerte der vergangenen sechs Tage zwischenspeichert. In der Basisstation sind ein GSM-Modem und eine SIM-Karte eingebaut. Das Gerät wählt sich in ein verfügbares Mobilfunknetz ein und sendet die Daten an die smaXtec Cloud TruDTM.
Täglicher Begleiter
Für Johannes Rutz ist die smaXtec-App ein wichtiger Begleiter. „Ich schaue täglich drauf“, erklärt der Landwirt. Mit einer Pushnachricht zeigt ihm das System eine Kuh, bei der die Körpertemperatur steigt. „Das ist oft eine beginnende Mastitis“, spricht Rutz aus Erfahrung. „Oft reicht es, die Tiere besser auszumelken, das Euter zu massieren oder homöopathisch zu behandeln. Aufgrund des frühen Stadiums reicht das meist aus.“ Für ihn als Nebenerwerbslandwirt sei der Pansenbolus ein wertvoller Helfer, so der Naturland-Bauer. „Mit dem Bolus habe ich die Situation im Stall immer im Blick.“























RIND & GRÜNLAND | 57 +49 (0) 8203 / 96 08 0 kontakt@meika-biofutter.de www.meika-biofutter.de DE ÖKO-006 Vertragspartner von: - Milchvieh - Legehennen - Mast-Geflügel - Schweine - Ziegen und Schafe Vollsortiment Bio-Futter und Fachberatung Bio im He rzen PATURA KG • 63925 Laudenbach www.patura.com • Tel. 0 93 72 / 94 74 0 PATURA KG • 63925 Laudenbach Tel. 0 93 72 / 94 74 0 • info@patura.com www.patura.com ProfiPlus Solar-Weidezaungeräte P 240 + P 340 Jetzt Katalog anfordern! Leistungsstark und mobil NEU 5 JAHRE GARANTIE
Mit dem Bolus haben Bio-Milchviehhalter Johannes Rutz und seine Töchter die Situation im Stall immer im Blick.
ANZEIGEN

Nikolaus Fuchs
Beratung für Naturland n.fuchs@ naturland-beratung.at



2 1 3 58 | RIND & GRÜNLAND
AUTOR
RAUS AUS DER
Anbindehaltung
Von Anbindehaltung zu einem Laufstall mit Auslauf – dazu gibt es schon einige „Standardlösungen“. Was am Betrieb Grünwald in Österreich umgesetzt wurde, zeigt aber eine völlig neue Möglichkeit auf.
In Untertauern im Salzburger Pongau sind die Winter lang und die Sommer kurz. Der Betrieb Grünwald liegt auf über 950 Metern Seehöhe an der Nordseite des Radstädter Tauernpasses. In dieser idyllischen aber gleichzeitig für die Bewirtschaftung auch benachteiligten Gegend hat es der Naturland-Betrieb Grünwald geschafft, Milcherzeugung mit der Erhaltung alter Nutztierrassen sowie gefährdeter Tier- und Pflanzenbestände und sanftem Hoftourismus geschickt zu verbinden.
Idyllisch ist inzwischen auch der Stall für 24 horntragende Milchkühe und das dazugehörige Jungvieh der Rasse Pinzgauer. Dieser wurde im Rahmen des EIPProjektes „Berg-Milchvieh“ umgebaut und gemeinsam mit einem regionalen Holzbau-Unternehmen geplant. Neben einer geräumigen Bergehalle und einem breiten, befahrbaren Futtertisch waren auch Laufstall und Aus-
1 Martin Grünwald mit Tochter Julia vor den neuen Liegeboxen, um die der Auslauf als Rundgang herumführt.
2 Für die zwei Liegeboxenreihen wurde ein eigenständiges Gebäude mit Strohbühne erbaut.
3 Mit einem Hoftrac mistet Familie Grünwald den Außenbereich in eine seitlich angeordnete Güllegrube aus.
lauf für das Jungvieh bereits vorhanden. Die damals 16 Kühe befanden sich aber noch in Anbindehaltung, und das entsprach weder den eigenen Ansprüchen noch den Erwartungen der Urlaubsgäste am Hof. Eine Lösung musste her.
Völlig neue Möglichkeit
„Für eine solche Ausgangssituation gibt es Standardlösungen. Was hier aber umgesetzt wurde, zeigt eine völlig neue Möglichkeit auf“, erzählt Walter Breininger. Der Bauberater plante bereits viele Umbaulösungen für An-
Abb.: Grundriss des Umbaus am Betrieb Grünwald
AUSLAUF MELKGRUBE BESTAND DÜNGESTÄTTE BESTAND 13 24 1 12 GESCHLOSSENE GÜLLEGRUBE GRUBE GRUBE FRESSPLATZ FUTTERTISCH FRESSPLATZ LIEGEBOXEN JUNGVIEH AUSLAUF LIEGEBOXEN



bindeställe. Am Loizhof – so heißt der Betrieb der Familie Grünwald – wurde aber keine Standardlösung eingesetzt. Für die zwei Liegeboxenreihen wurde ein eigenständiges Gebäude mit Strohbühne erbaut.
„Es macht Freude, den Tieren zuzusehen“
Das Einzigartige daran ist, dass der rundherumführende Laufgang gleichzeitig den Auslauf darstellt. Die Auslauffläche ist somit nicht integriert, sondern wird um die Liegeboxenreihen herumgeführt. Mit einem Hoftrac mistet Familie Grünwald den Außenbereich in eine seitlich angeordnete Güllegrube aus.
Der großzügig dimensionierte Laufstall setzt sich aus einem Fressgang im Stallinneren (Altbau) und einem Auslauf zusammen. Der Auslauf ist aus Holz konstruiert und überdacht. Die Liegeboxen sind zentral angeordnet. Große Trogtränken versorgen die Tiere mit Wasser. Ca. 160 Tage im Jahr steht den Tieren Weide zur Verfügung.
Weniger Arbeit
Durch die Trennung vom Altbestand wurde wesentlich günstigeres Bauen möglich. Die Investitionskosten betrugen im Jahr 2017 in Summe knapp 300.000 Euro. Nach Abzug der Förderung wurden 10.500 Euro pro Kuhplatz investiert. Pro Kuh und Jahr reduzierte sich die Stallarbeitszeit enorm von 111 auf 74 Stunden, inkl. Nachzucht. Pro Tag schlagen knapp fünf Stunden Arbeitszeit zu Buche. Der Tierbestand wurde bisher nicht auf die möglichen 24 Milchkühe erhöht, es werden zwischen 18 und 20 Kühe gehalten. Unbezahlbar ist, dass Familie Grünwald und ihre Gäste die Rinder zu jeder Jahreszeit im Auslauf beobachten können. „Es macht Freude, den Tieren zuzusehen“, lacht Julia Grünwald. Sie ist das älteste von fünf Kindern und gemeinsam mit ihrem Vater im Zuchtverband der Pinzgauer Rinder engagiert. „Schön, wenn sich die Kinder für unsere Tiere interessieren“, freut sich
1 Tochter Julia Grünwald ist begeisterte Jungzüchterin und mit dem Liegeboxenstall samt Auslauf sehr zufrieden.
2 Der Futtertisch und die Fressplätze verblieben im Altbestand.
3 Der Rundgang um die Liegeboxen wird bei jedem Wetter und auch im Winter als Auslauf genutzt.
1
3 60 | RIND & GRÜNLAND
2
Tipp
Weiterführende Informationen über den Umbau am Betrieb Grünwald sowie über weitere innovative Baulösungen finden Sie unter www.bergmilchvieh.at oder durch Scannen des QR-Codes.


Im Rahmen der Initiative „Wild & Kultiviert“ wird am Loizhof Saatgut in artenreichen Wiesenbeständen gewonnen, um die regionale, genetische Vielfalt zu erhalten.
der Bio-Bauer. Schon allein deshalb war für die Familie der tiergerechte Umbau wichtig.
Geheimtipp für Urlaubsgäste
Auf den Einsatz von Kraftfutter für Rinder wird auf dem extensiven Bergbauern-Betrieb zur Gänze verzichtet. „Dazu müssten wir Getreide aus den Ackerbaugebieten zukaufen. Das passt nicht zu uns“, erklärt Martin Grünwald. Die Milchleistung beträgt daher lediglich 3.800 kg im Stalldurchschnitt. Der Mehrwert der Rinder sei auch in Wechselwirkung mit dem „sanften Hoftourismus“ zu sehen, wie die Familie ihr zweites Standbein nennt. Besonders für Familien mit Kindern und Wintersport-Begeisterte ist der Loizhof der Familie Grünwald ein Geheimtipp.
Sabine und Martin Grünwald betreiben ihren Hof im Haupterwerb. Insgesamt umfasst der Loizhof 125 Hektar, davon sind 90 Hektar Wald. Doch Forstwirt-






schaft, Milchproduktion und Tourismus sind nicht die einzigen Einnahmequellen. Eine weitere wirtschaftliche Säule für den Betrieb sind Förderungen für Naturschutzmaßnahmen. Der Loizhof ist Partnerbetrieb der Initiative „Wild & Kultiviert“. Im Rahmen dieser Initiative wird Saatgut in artenreichen Wiesenbeständen gewonnen, um die regionale, genetische Vielfalt zu erhalten. Von diesen extensiven Wiesenbeständen profitieren zahlreiche Insektenarten, die in intensiver genutzten Flächen nicht überdauern können.
Genügend Zeit für Planung
Mit Planung und Umbau ist Familie Grünwald zufrieden. Martin Grünwald betont: „Die Planung sollte so gut sein, dass während der Bauphase nichts mehr abgeändert werden muss.“ Daher sollte man sich genügend Zeit für die Planungsphase geben. „Und während der Bauphase besser keine Urlaubsgäste am Hof“, lacht Sabine Grünwald.





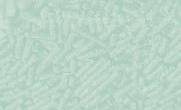
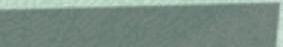




Bio-Futter DE-ÖKO-006 Saatgut und Getreidehandel DE-ÖKO-001 www.bio-futter.sh www.gut-rosenkrantz.de (nur Handelsgesellschaft) Jetzt mit zwei Werken in Bassum und neu in Süderbrarup BIOFUTTER Maren Maitra, Tel. 0172 446 0465 maitra@bio-futter.sh für Schleswig-Holstein Thies Thamling, Tel. 0162 765 4297 thies.thamling@bio-futter.sh Getreide-Team Telefon 04321 990-102 getreide@gut-rosenkrantz.de GETREIDEHANDEL Saatgut-Team Telefon 04321 990-105 saaten@gut-rosenkrantz.de SAATGUT Kontrollstellen: Bio - Futter & Saatgut aus dem Norden! Wir sind für Sie da. ANZEIGE
Fotos: Grünwald, EIP Berg-Milchvieh Projektteam

7 TIPPS FÜR EINEN GUTEN START INS FERKELLEBEN
62 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
Wussten Sie, dass eine intensive Geburtsüberwachung die Totgeburtenrate um 40 % senken kann? Die Beobachtung des Geburtsverlaufs ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten, den Ferkeln einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Weil sie so wichtig sind, können sie gar nicht oft genug in Erinnerung gerufen werden.
1.
GEBURT VORBEREITEN
Der optimale Start für die Ferkel fängt mit der richtigen Vorbereitung für die Geburt an. Der Abferkelstall ist gereinigt und frisch eingestreut. Die Sauen sind auf Kondition gefüttert und werden schon in der letzten Woche im Wartestall an das Säugefutter gewöhnt (Säugefutter mit Tragefutter verschneiden). Die Heizung oder Wärmelampe wird auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft.
2. GEBURT ÜBERWACHEN
In der Regel beginnt die Geburt am 114. oder 115. Trächtigkeitstag und dauert zwei bis sechs Stunden, wobei alle 10 bis 20 Minuten ein Ferkel geboren wird. Während der Geburt sollten die Sauen
immer wieder beobachtet (ev. mit Videokamera) und der Geburtsfortschritt kontrolliert werden, um bei Komplikationen schnell reagieren zu können. Werden beispielsweise trotz Presswehen über 30 bis 60 Minuten keine Ferkel geboren, sollte mittels vaginaler Untersuchung festgestellt werden, ob zu große oder tote Ferkel im Geburtskanal stecken. Wehenschwäche hingegen kann u. a. Calciummangel oder Stress als Ursache haben. Durch das Massieren des Gesäuges kann Oxytocin ausgeschüttet werden, das die Geburt anregt. Gleiches gilt bei aggressiven Sauen. Hier wird die Geburt durch die Gesäugemassage angeregt. Die Ferkel werden vorerst ins Nest gesperrt und immer wieder ans Gesäuge gesetzt. Bei eitrigem Scheidenausfluss ist die Tierärztin bzw. der Tierarzt zu kontaktieren.
3. KOLOSTRUMAUFNAHME SICHERSTELLEN
Kolostrum beinhaltet wichtige Immunglobuline, essenzielle Aminosäuren, Infektionshemmer und Endorphine. Ziel ist es, dass jedes Ferkel mindestens 250 g des wertvollen Kolostrums aufnimmt – und das möglichst schnell nach der Geburt. Die Qualität des Kolostrums hängt auch von der Gesundheit der Sau ab. Bei großen Würfen muss z. B. durch split nursing (abwechselndes Wegsperren) sichergestellt werden, dass das Kolostrum gleichmäßig unter den Ferkeln aufgeteilt wird.
Wichtig ist, Sauen nach der Geburt gesund zu halten. Achten Sie besonders darauf, dass die Sauen nach der Geburt viel Wasser trinken.
„Die Qualität des Kolostrums hängt von der Gesundheit der Sau ab.“


SCHWEIN & GEFLÜGEL | 63

1

2 3


AUTORIN
Marie Lüke
Beratung für Naturland m.lueke@ naturland-beratung.de
4. MMA VORBEUGEN
Leidet die Muttersau nach der Geburt unter Gesäuge- und Gebärmutterentzündungen, kann das zu Milchmangel führen. Ursachen dafür gibt es viele: zu kalte oder zu warme Umgebungstemperaturen (optimal: 18 - 22 °C), fehlende Bewegungsmöglichkeiten, ungenügende Reinigung und Desinfektion, mangelhafte Kondition, Fütterungsfehler, zu wenig Tränkewasser und ein geschwächtes Immunsystem.
Vorbeugende Maßnahmen:
• Rohfaserreiches und quellfähiges Futter für weichen Kot, z.B. Weizenkleie, Leinsamen
• Gute Wasserversorgung
• Sauen vor Umstallung waschen und entwurmen
• Körpertemperatur und Fresslust regelmäßig überprüfen
• Hygiene im Stall und bei der Geburtshilfe beachten
5. BEDARF AN SPURENELEMENTEN GEDECKT?
Bei unklaren Ursachen von Krankheiten oder Problemen sollte immer die ausreichende Versorgung mit Spurenelementen geprüft werden. Spurenelemente sind wichtig für bestimmte Vorgänge im Körper. Mangel an Kupfer kann z.B. eine hohe Totgeburtenrate und Wachstumsdepressionen auslösen, Eisenmangel zeigt sich durch ein schwaches Immunsystem, Muskelschwäche und angestrengte Atmung. Jodmangel führt bei Sauen zu geringer Fruchtbarkeit und Milchleistung und kann ebenfalls hohe Ferkelsterblichkeit und Kannibalismus auslösen.
1 Ein warmes und trockenes Ferkelnest ist ein wichtiger Faktor gegen Saugferkeldurchfall.
2 Ziel ist es, dass jedes Ferkel mindestens 250 g des wertvollen Kolostrums aufnimmt und das möglichst schnell nach der Geburt.
3 Ferkel sind in den ersten Tagen noch sehr empfindlich und schwach. Daher sollte in Absprache mit dem Hoftierarzt frühstens ab dem 10. Lebenstag geimpft werden. Eisengaben sind natürlich früher nötig.
64 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
Mögliche Erreger und Anzeichen
Erreger Anzeichen Bemerkungen
Rota-Viren
E. coli
Wässriger Durchfall Erbrechen Verluste
1.-2. Lebenswoche
Wässriger oder pastöser Durchfall
Corona Erbrechen Durchfall
Leichte und schwere Verlaufsformen
Wässriger, schaumiger Durchfall
Clostridien
Kokzidien (Parasit)
Teilweise blutig
Pastöser, cremiger, gelber Durchfall
2.-3. Lebenswoche
Abmagern der Ferkel
Die häufigsten Erreger bei Saugferkeln sind Viren wie PRRS und PCV II und bakterielle Erkrankungen wie Mycoplasmen, Streptokokken oder Staphylokokken. Gegen viele Erkrankungen sind Impfstoffe verfügbar, Mutterschutzimpfungen können das Kolostrum aufwerten. Ferkel sind in den ersten Tagen jedoch noch sehr empfindlich und schwach. Die Körpertemperatur wird erst nach zehn Tagen stabil aufrechterhalten, sodass zuvor bei Behandlungen ein Unterkühlungsrisiko besteht. Auch die Energieversorgung kann beeinträchtigt werden, da die Ferkel nach einer Impfung erst spät an der Sau säugen. Daher sollte in Absprache mit dem Hoftierarzt frühstens ab dem 10. Lebenstag geimpft werden.
Fäkale-orale Übertragung bei Geburt
Meistens Sekundärinfektion
Mutterschutzvakzine als passive Impfung
Fäkale-orale Übertragung Oft in der kalten Jahreszeit
Durchseuchung des Bestandes notwendig
Mutterschutzvakzine
Übertragung durch die Sau oder kontaminierte Umwelt
Sehr widerstandsfähig
Durchfall bei Saugferkeln kann von unterschiedlichen viralen, bakteriellen oder parasitären Erregern ausgelöst werden. Eine Darminfektion trifft Saugferkel aufgrund der geringen Energiereserven besonders hart. Daher müssen Tierhalter und ggf. der Tierarzt schnell reagieren und den Ferkeln Flüssigkeit, Elektrolyte und Styptika mit Gerbsäuren, beispielsweise in Form von Torf, Kohle und Cola, geben. Wichtig ist auch ein warmes und trockenes Ferkelnest. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass die Krankheit nicht von Bucht zu Bucht verschleppt wird und Ferkel nicht zwischen gesunden und kranken Würfen ausgetauscht werden.

Unser bestes Bio-Mischfutter von der Naturmühle Höltinghausen.
Herstellung von hochwertigen Mischfuttern, optimiert nach dem Bedarf der ökologischen Tierhaltung
Enge Partnerschaft mit etablierten Bio-Verbänden
Regionale und direkte Ernteabwicklung
Du brauchst ein individuelles Futterkonzept? Melde dich bei uns!
GS Die Genossenschaft eG Raiffeisenstr. 4 · 49685 Schneiderkrug Tel. 04473 92683-10 · gs-bio.de
DE-ÖKO-005 ANZEIGE
Fotos:
Agrarfoto, Bioschwein Auistria, Marie Lüke
6. FERKEL NICHT ZU FRÜH IMPFEN
7. SAUGFERKELDURCHFALL
„EIER LEGEN SIE ALLE“
Legehybriden und deren Eigenschaften

Von Legehybriden wird häufig gesprochen, um Hybridkreuzungen mit hoher Legeleistung von Zweinutzungshühnern abzugrenzen. Tatsächlich liegt der Fokus dieser Hybriden auf der Legeleistung. Genauso wie es nicht DAS Zweinutzungshuhn gibt, so gibt es auch nicht DEN Legehybriden. Zu unterschiedlich sind die Eigenschaften der jeweiligen Rassen und Hybriden. Wir stellen hier die aktuell für Bio-Betriebe verfügbaren Hybriden und deren Leistungsdaten vor. Für welches Tier sich der Bio-Betrieb entscheidet, bleibt ihm überlassen –Eier legen sie alle. Die ökologische Aufzucht des Bruderhahns ist bei Naturland selbstredend. Die Praxis zeigt, dass die Tiere zum Betrieb und dem Team vor Ort passen müssen. So nutzt es nichts, eine leistungsstarke Henne zu halten, mit der man aber vor Ort nicht zurechtkommt. Kurzum: Es ist in der folgenden Aufstellung für Alle was dabei.

LOHMANN BROWN CLASSIC (LOHMANN)
• Ruhige, ausgeglichene Henne mit attraktiv brauner Eischale und gutem Eigewicht
• Gefiederfarbe Henne: Braun
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen*: 1,49 kg
• Schalenfarbe: Braun
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen**: 388
• Gefiederfarbe Hahn: Hell mit unterschiedlichen Anteilen von braunem Gefieder
*im Alter von 18 Wochen **bis zum Alter von 85 Wochen
LSL LITE EUROPE (LOHMANN)
• Ausgeglichene Henne mit hoher Nestakzeptanz und sehr guter Futterverwertung
• Gefiederfarbe Henne: Weiß
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen: 1,31 kg
• Schalenfarbe: Weiß
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 408
• Gefiederfarbe Hahn: Weiß

66 | SCHWEIN & GEFLÜGEL





• Schalenfarbe: Creme
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 399
• Gefiederfarbe Hahn: Weiß-Beige, vereinzelte schwarze Punkte
H&N BROWN NICK (LOHMANN)
• Ausgeglichenes Tier mit guter Befiederung und attraktiv brauner Eischale
• Gefiederfarbe Henne: Braun
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen: 1,52 kg
• Schalenfarbe: Braun
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 392
• Gefiederfarbe Hahn: Hell mit unterschiedlichen Anteilen von braunem Gefieder



ANZEIGE

DEKALB WHITE (AB OVO)
• Legehenne mit ausgeglichenem Wesen und sehr guter Futterverwertung
• Gefiederfarbe Henne: Weiß
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen: 1,26 kg
• Schalenfarbe: Weiß
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 399
• Gefiederfarbe Hahn: Weiß

Tipp
Eine Liste aller Anbieter von Naturland-Junghennen und -Mastgeflügel finden Sie in der Naturland-App sowie auf der Website www.naturland-beratung.de.
WARREN (AB OVO)
• Schwere Henne mit hoher Toleranz und guter Adaption (verfügbar ab KW 40)
• Gefiederfarbe Henne: Braun
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen: 1,65 kg
• Schalenfarbe: Braun
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 385
• Gefiederfarbe Hahn: Hell mit unterschiedlichen Anteilen von braunem Gefieder
NOVOGEN WHITE LIGHT (VERBEEK)
• Weiße Henne mit hoher Nestakzeptanz
• Gefiederfarbe Henne: Weiß
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen: 1,27 kg
• Schalenfarbe: Weiß
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 399
• Gefiederfarbe Hahn: Weiß

NOVOGEN BROWN (VERBEEK)
• Ausgeglichene leistungsbereite Henne
• Gefiederfarbe Henne: Braun
• Körpergewicht Henne bei 18 Wochen: 1,42 kg
• Schalenfarbe: Braun
• Eier je Anfangshenne bis 85 Wochen: 386
• Gefiederfarbe Hahn: Hell mit unterschiedlichen Anteilen von braunem Gefieder


AUTORIN
Franziska Müller
68 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
Fotos und Quelle: Züchterblatt Lohmann Breeders, Züchterblatt Ab Ovo, Züchterblatt Verbeek, Naturland / Sebastian Stiphout
f.mueller@ naturland-beratung.de
Beratung für Naturland

BERATERTIPP
Annette Alpers Beratung für Naturland a.alpers@ naturland-beratung.de

Anträge für Geflügelzukauf
Konventionelle Tierzukäufe müssen genehmigt werden. In Deutschland und Österreich können Anträge online gestellt werden.
Wenn konventionelle Tiere zugekauft werden sollen, muss das in Deutschland über die Datenbank organicXlivestock.de genehmigt werden. Dazu müssen Sie sich auf der Website registrieren. Sollte die Online-Registrierung Probleme bereiten, können Sie sich auch per E-Mail an organicXlivestock@fibl.org wenden. Sie erhalten auch über diesen Weg Ihre Zugangsdaten. Ein Antrag wird genehmigt, wenn es keine Öko-Tiere in entsprechender Qualität oder zumutbarer Entfernung gibt. Meist trifft das bei Putenküken, Küken für Wassergeflügel (Enten, Gänse) und Zuchttieren zu.
Behördenanträge werden in Rechnung gestellt. Hier bemühen wir uns um eine Verringerung der Gebühren. Außerdem wollen wir eine Allgemeinverfügung für Tierarten erwirken, für die es keine Öko-Elterntiere gibt (z. B. Puten).
In Österreich erfolgt die Antragstellung über das Verbrauchergesundheitsinformationssystem VIS (vis.atatistik.at). Unterstützung bei der Antragstellung bieten der Antworten-Katalog im Onlineportal des VIS sowie die Landwirtschaftskammern und Bio Austria.
Zukauf von Nicht-Naturland-Tieren
Für den Zukauf von Öko-Tieren ohne Naturland-Zertifizierung bzw. gleichwertiger Verbandsherkünfte müssen Naturland-Betriebe das bekannte Belegverfahren einhalten:

Für Nicht-Naturland-Junghennen muss der Beleg 21 Wochen vor Einstallung vorliegen. Lassen Sie sich von Ihrem Junghennen-Lieferanten eine Bestellbestätigung für die Junghennen mit dem Hinweis auf den Zertifizierungsstatus (z. B. Naturland, Bioland, Bio Austria etc.) schicken.
SCHWEIN & GEFLÜGEL | 69
Foto: Agrarfoto
Land für morgen

SCHWERPUNKT AGROFORST
Stefan Lemmerer
Beratung für Naturland s.lemmerer@ naturland-beratung.at

Ausgeräumte Landschaft, riesige Schläge und Winderosion. Der Hitzesommer 2018 war für Christian Warnke der endgültige Auslöser. Seither setzt der Naturland-Bauer auf Agroforst.

2.000 Hektar umfasst die Warnke Agrar GmbH in Sachsen-Anhalt. Seit 2011 wirtschaftet der Naturland-Betrieb von Christian Warnke nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Ackerbau, Grünland, Milch- und Mutterkuhhaltung zählen zu den Betriebszweigen. Doch zufrieden war Christian Warnke allein mit dem Schritt zu Bio noch nicht: „Bei Schlaggrößen von durchschnittlich fünfzig Hektar in einer seit DDR-Zeiten ausgeräumten Landschaft ist Biodiversität trotz Öko-Landbau eher ein Fremdwort.“ Warnke begann, Schläge zu teilen, alte Feldwege wieder zu öffnen und Blüh- und Brachestreifen als Schlagbegrenzungen einzurichten.

Sandige Böden als Herausforderung
Die sehr sandigen Böden mit im Schnitt nur 25 Bodenpunkten waren aber enorm anfällig für Winderosion. Warnkes sehr weite zehn- bis zwölfjährige Fruchtfolge basiert zwar auf fünf Jahren Luzerneanbau als Rinderfutter und zum Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, aber: „Wenn ich nach einigen Jahren Humus aufgebaut habe und die Flächen umbreche, treiben riesige Sandstürme den Humus schnell weg – und machen das Werk von Jahren zunichte“, berichtet der Betriebsleiter.
Vielseitiger Nutzen
Der Hitzesommer 2018 mit nur 230 mm Jahresniederschlag zeigte Christian Warnke endgül-
tig, dass eine langfristig nachhaltige Bewirtschaftung seiner Böden nur möglich ist, wenn er mehr Gehölzstrukturen in die Landschaft integriert. Bäume und Sträucher bieten Wind-
„Ich möchte den Hof zu einem blühenden Betrieb entwickeln.“
schutz, verringern Erosion und Verdunstung und schaffen ein Mikroklima, das vor allem in sehr trockenen Phasen das Pflanzenwachstum der umliegenden Kulturen begünstigt. Für Warnke ist Agroforst allerdings mehr als Windschutzhecken am Acker:
„Wir wollen eine reich strukturierte Landschaft gestalten, die vielfältige Funktionen erfüllt und positive Wechselwirkungen schafft.“ Der Naturland-Bauer will zukünftig die Mutterkuhhaltung sukzessive über die Beweidung von Luzerne in die Ackerbewirtschaftung integrieren. Hecken und Agroforstsysteme sollen den Tieren Schutz und Schatten bieten sowie Wertholz und Futterlaub (als Nebenprodukt der Stammerziehung) produzieren. Warnkes Vorstellungen sind klar: Die aufgemachten Feldwege, von Hecken und Alleen gesäumt, sollen als Leitsystem die Bewegung der Tiere über die Ackerschläge steuern. Und sie sollen der ansässigen Bevölkerung Möglichkeiten bieten, sich in der Landschaft zu bewegen und sich an den „essbaren Hecken“ zu erfreuen. Den Vögeln, Insekten
72 | AGROFORST
Mit Agroforststreifen aus Nuss-, Obst-, Wildobstbäumen und Forstpflanzen will Christian Warnke eine strukturierte Kulturlandschaft schaffen.

Im Vorjahr pflanzte Christian Warnke ein Agroforstsystem auf 8,5 Hektar Ackerfläche.
und anderen Tieren bieten diese Strukturen Rückzugsmöglichkeiten, Nahrung und einen vernetzten Lebensraum. „Ich möchte mit meinen Mitarbeitern den Hof zu einem blühenden Betrieb entwickeln, der wirtschaftlich erfolgreich ist und eine Landschaft gestaltet – mit Tieren, Wald und einer für Menschen und Tiere lebensfreundlichen Umwelt.“
Dies jedoch auf 2000 ha umzusetzen, ist eine enorme Herausforderung. Neben Eigentums-, Naturschutz- und förderrechtlichen Aspekten ist vor allem die Finanzierung ein Knackpunkt: Agroforstsysteme verursachen in den ersten Jahren durch Pflanzung und Pflege hohe Kosten. Ein „finanzieller Return“ ist jedoch erst in Jahrzehnten zu erwarten. So arbeitet die Warnke GmbH mit verschiedenen Pro-
jektpartnern zusammen, um ihre Vision zu realisieren.
Finanzierung über Kooperationspartner
Ein für Warnke zentrales Instrument sind die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 13 des Bundesnaturschutzgesetzes. Seine GmbH arbeitet mit verschiedenen Ingenieurbüros zusammen, die Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete und dergleichen umsetzen und finanzieren. Der Vorteil sei, dass die Ingenieurbüros nicht nur die Kosten der Pflanzung, sondern in den ersten Jahren auch die Pflege der Flächen übernehmen, so Warnke. „Außerdem gibt es eine Entschädigung für den Verlust der Anbaufläche.“ So wurden in den letzten Jahren bereits sieben Hektar Hecken und eine
SOJABOHNE
RGT SPHINXA


000-Sorte
– Proteinertrag Bestnote 9 – sehr gute Standfestigkeit – zügige Jugendentwicklung

ragt.de

PROTEIN
Fotos: zVg


Die riesigen Schläge am Betrieb Warnke wurden geteilt, alte Feldwege wieder geöffnet sowie Hecken und Bäumen gepflanzt.
Streuobstwiese auf 1,6 Hektar mit 54 Obstbäumen angelegt und finanziert. Die Hecken seien förderrechtlich großteils als Landschaftselemente eingestuft, die landwirtschaftliche Flächen umgeben und gelten daher nicht als Agroforstsystem im engeren Sinn.
200 Hektar Agroforst
An zwei Standorten sind auf insgesamt fast 200 ha Ackerflächen auch streifenförmige Agroforstsysteme geplant. Bereits gepflanzt ist ein „Testsystem“ auf 8,5 ha in Kooperation mit dem Naturland-zertifizierten Grillkohlehersteller Nero sowie der VRD-Stiftung. Angelegt wurden 13 Baumreihen in Abstand von
20 m. Jede zweite Baumreihe besteht aus Pappeln, die rasch einen Windschutz bietet. Die restlichen Streifen wurden mit Nuss-, Obst-, Wildobstbäumen und „gewöhnlichen“ Forstpflanzen gestaltet. Ziel ist herauszufinden, welche Arten sich hier für weitere Pflanzungen eignen. Die Pappelstreifen können laut Warnke für Hackschnitzelerzeugung beerntet und nach Etablierung der anderen Streifen bei Bedarf wieder entfernt und beackert werden. Die Hochstammbäume sollen in erster Linie als Wertholz erzogen und genutzt werden. Begleitet wird die Umsetzung von der Universität Münster. Dabei wird untersucht, wie sich Agroforstsysteme im Laufe der Zeit auf Biodiversität,
Mikroklima, Wirtschaftlichkeit und sozialen Faktoren auswirken.
Spenden und Mitmachaktionen
Derzeit entsteht auf 40 Hektar ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Verein Ackercrowd, der Spendengelder für Agroforstsysteme sammelt und Unterstützer bei der Planung und Umsetzung sucht, z. B. durch Mitmachaktionen. Bereits 2021 wurde entlang des Elberadwegs eine 230 Meter lange Windschutzhecke gepflanzt, an der Spaziergänger Beeren und Nüsse sammeln können. Zudem sollen streifenförmige Agroforstsysteme mit Nüssen, Edelkastanien, Obst und Wildobst zur weiteren Untergliederung der Fläche angelegt werden. In Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe plant der Betrieb einen 15-ha-Schlag mit einem einfachen streifenförmigen Agroforst-
74 | AGROFORST
system mit Pappeln (Kurzum trieb) und Eichen (Wertholz). Es soll in Zukunft auch als Vorzeige modell für ein einfach umsetz bares Agroforstsystem fungieren. Mit der Schweizer Firma Silvo Cultura sollen in den nächsten Jahren Wertholzalleen entlang der Feldwege angelegt werden, eine Jahresbaumallee über die Artensofortförderung des Lan des Sachsen-Anhalt wurde be reits gepflanzt.

78 x 80 mm
So sucht sich Warnke über ver schiedene Wege Unterstützung bei der Transformation seiner riesigen Flächen hin zu einer strukturierten Kulturlandschaft. Die verschiedenen Wünsche der Projektpartner ermöglichen es ihm, unterschiedliche Varianten auszuprobieren und eine Vielfalt zu sichern. Damit der Arbeitsaufwand nicht explodiert, liegt der Fokus aber auf einfach und maschinell bewirtschaftbaren Systemen, die nicht jährlich beerntet werden müssen. Angelegt werden die Reihen abgestimmt auf die Arbeitsbreite der Maschinen. Hier ist vor allem der 18-mStriegel maßgebend, auf dessen Abstände die Gehölzreihen abgestimmt sind.
Über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurde unter anderem eine Streuobst wiese auf 1,6 Hektar mit 90 Obstbäumen finanziert.
„Wir bringen Vielfalt auf den Acker und gestalten die Landwirtschaft von morgen. Daher lautet unser Slogan: ‚Land für morgen‘, das heißt, dieses Land, das uns anvertraut ist, für die nächsten Generationen zu erhalten“, erläutert der Preisträger des Bundeswettbewerbs
78x80 mm
WENN´S UM PFLANZEN GEHT
Bio Baumschule und Pflanzen-Produkte
• Beerenobst • Obstgehölze auch alte Sorten
• Auftragsveredelungen • Demo-Betrieb
Spezialitäten:
Boysenbeere, Loganbeere, Dorman Red, Japanische Weinbeere, Schwarze Himbeere. Johannis- und Stachelbeeren, auch in Stämmchen, Duo-Kiwi, Aprikosen, Pfirsich, Mispeln, Erdbeeren uvm.
Meisterbetrieb
Brechterstal · 79336 Herbolzheim-Wagenstadt
Tel. 07643-912050 · Fax: 1591
Mobil: 0171-6242499
www.baumschule-rombach.de


für insektenfreundliche Landwirtschaft. Ganz besonderen Charme bekommt dieses Motto, wenn man weiß, dass der Betrieb damit, wahrscheinlich unbewusst, den Gründungs-Slogan von Naturland aufgreift und weiterentwickelt: „Auch morgen noch Land sehen“.
ANZEIGEN

Stephan Sinn
Bio-Jungpflanzen
Bio-Jungpflanzen
Bio-Jungpflanzen
Auf der Büsche 3
Auf der Büsche 3
67363 Lustadt
Auf der Büsche 3
67363 Lustadt
Stephan Sinn
Tel: +49 6347 9720 0
67363 Lustadt
Tel: +49 6347 9720 0
Fax: +49 6347 9720 20
Tel: +49 6347 9720 0
Fax: +49 6347 9720 20
E-Mail:
E-Mail:
info@sinn-lustadt de Stephan Sinn
Fax: +49 6347 9720 20
info@sinn-lustadt de
E-Mail:
info@sinn-lustadt de DE-ÖKO-006
AGROFORST | 75
„Der beste Zeitpunkt war vor 15 Jahren“


AUTOR
Roman Goldberger
Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de
76 | AGROFORST


Klimabereichen ist eine bis zu 1,3-fach höhere Gesamt-Flächenproduktivität gegenüber Monokultur-Flächen möglich. Studien in Brandenburg und Niedersachsen kamen zu diesem Schluss, hier wurden sowohl Erträge der Ackerfrucht als auch jene der Energie-Forststreifen mitberechnet. Effizientere Photosynthese-Leistung und verbessertes Mikroklima seien demnach zwei wichtige Gründe für die Produktivitätssteigerung. Zudem können geschickt angelegte Forstelemente einen positiven Nebeneffekt über den Verkauf von Obst, Nüssen, Wert- oder Energieholz bewirken.
Kann damit auch Wind-Erosion verringert werden?
Ja. Eine wissenschaftliche Untersuchung aus Brandenburg zeigt, dass Baumreihen Winde um mehr als 90 % reduzieren können. Durch Wind-Abbrem-
sung wird auch die Verdunstung auf dem Acker reduziert und eine mögliche Erosion verhindert. Dies zeigte sich in einem Versuch in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Verdunstung auf dem Feld durch Gehölzstreifen um circa ein Drittel niedriger war als auf einem Vergleichsacker ohne Gehölzstreifen. Insgesamt sagt man, dass die Summe der Vorteile den Ertrag auf den angrenzenden Ackerflächen um bis zu 10 % ansteigen lassen kann, und zwar bis zu einem Abstand von zehn Mal der Höhe des Gehölzes. Unmittelbar neben den Gehölzstreifen mag es durch Beschattung oder Wasserentzug eine Ertragsreduktion geben, aber im Endeffekt können insbesondere Hecken, aber auch Agroforststreifen eine positive Auswirkung auf den Ertrag haben, bereichert um die genannten, zusätzlichen Vorteile aus Produkten des Gehölzes selbst.
Wie lege ich moderne Agroforstsysteme an?
Bei allen Agroforstsystemen sind die Anfangsjahre am schwierigsten. Die Etablierung kostet Geld und Zeit, die Baumscheiben sollen unkrautfrei gehalten werden, die Acker- und Grünlandflächen werden kleiner und eventuell schwieriger zu bearbeiten. Sobald aber die Gehölze Schatten spenden, Ertrag abwerfen und die Erosions- und Windreduktion spürbar wird, ist eine konkurrenzfähige Produktion gegeben. Deshalb heißt es in der Branche: Der bes-
78 | AGROFORST
Schutz vor Winderosion, eine verbesserte Bodenstruktur, sowie die Förderung der Biodiversität sprechen für Agroforstsysteme.

te Zeitpunkt, einen Agroforst anzulegen war schon vor 15 Jahren.
Bei Agroforstreihen mit Wertholzbäumen dürfte die Beschattung der Kultur nicht so stark sein. Ja, das ist richtig. Bei Wertholzbäumen wird ein gerader, starker Stamm benötigt. Wertholzbäume werden – im Gegensatz zu Energieholz – eher ein reihig und mit größeren Abständen zueinander (10 –15 Meter) gepflanzt. Es kommt deshalb in der Regel zu einer geringeren Beschattung der Kultur. Jedoch muss bei Wertholz mit Umtriebszeiten zwischen 30 und 70 Jahren gerechnet werden. Auch müssen Seitenäste regelmäßig entfernt werden, um hoch wertige Stämme zu erhalten.
Welche Baumarten wären hierfür geeignet?
Das hängt auch vom Standort ab. Grundsätzlich werden oft Kirsche, Wildkirsche, Walnuss, Birne, Ahorn, Erle, Speierling, Elsbeere und Esche gewählt. Werthölzer benötigen ausreichend Grundwasser, über 40 Bodenpunkte sind wünschenswert. Tro ckene und mineralstoffarme Standorte sind nicht geeignet. Will man Wasserkonkurrenz für die Acker kulturen vermeiden, sind tiefwurzelnde Agroforst kulturen wie Walnuss zu bevorzugen. Für feuchte Standorte nimmt man am besten Erle.

Sind diese Baumarten auch für Weide-Agroforst geeignet?
Es gibt ein paar Einschränkungen, hier ein paar Beispiele: Manche Ahornarten stehen im Verdacht, für Pferde schädliche Substanzen zu enthalten und sollen deshalb nicht auf Pferdekoppeln verwendet werden. Esche kann man in Abständen von mindestens 10 x 10 Metern über die Fläche verteilt auf
AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS. AM ANFANG KNOCHE.
SCHNITTIG. SPARSAM. SPEEDMAX.
Intelligente Konstruktion. Perfekte Klingengeometrie. Zuverlässig, hochwertig und kombinierbar. Für neue Maßstäbe in der Restpflanzenzerkleinerung.
QR-Code scannen und mehr Infos erhalten
men sind die Anfangsjahre am schwierigsten. Die Etablierung kostet Geld und Zeit.“

SEIT 1790
ANZEIGE
ACKERBAU-AGROFORSTSYSTEME (SILVOA-ARABLE AFS)
REIHENPFLANZUNG (ALLEY CROPPING)
ENERGIEHOLZ (STOCKAUSSCHLAGEND)
PAPPELN
WEIDEN ROBINIEN
STAMM-ODER WERTHOLZ:
EDELLAUBHÖLZER
Abb.: Ein- und Zuteilung typischer europäischer Agroforstsysteme
einer Schafweide kultivieren. Auch Walnuss würde sich für die Weide eignen, auch wenn die Wurzelausscheidungen das Wachstum der benachbarten Pflanzen negativ beeinflussen können. Gegenwärtig forschen Studenten der HNE Eberswalde zur Kombinierfähigkeit von Walnuss und Leguminosen.
Für den Hühner-Auslauf würden Agroforst-Systeme vor Greifvögel schützen und Schatten spenden.
Das stimmt. Am Naturland-Betrieb Frey in Bayern wurde der Hühnerauslauf zum Beispiel mit Beerensträuchern und Obstbäumen – vor allem Apfel und Zwetschke – in gleichmäßigen Abständen bepflanzt. Als Windschutz wurde die große Fläche teils mit Energieholz wie Pappeln, Weiden, Ulmen, Ahorn und Esskastanie sowie Wildhecken umrandet.
Apropos Energieholz, hier dürfte die Umtriebszeit wesentlich geringer sein als bei Wertholz, oder? Ja, das stimmt. Üblich sind sechs bis sieben Jahre, selten über zehn Jahre. Im Gegensatz zu Agroforstsystemen mit Wertholz werden Energieholzstreifen mehrreihig angelegt. Zwischen den Reihen soll der Abstand so gewählt werden, dass man mit Pflegegeräten wie der Kreiselegge in den ersten zwei Jahren durchfahren kann, um konkurrierenden Bewuchs fernzuhalten.
Welche Kulturen kommen besser neben Agroforststreifen zurecht?
Wintergetreide sowie Futter- und Weideflächen kommen mit Beschattung besser zurecht als son-
WEIDE-AGROFORSTSYSTEME (SILVO-PASTORALE AFS)
GLEICHMÄSSIGE FLÄCHENVERTEILUNG
WINDSCHUTZSTREIFEN:
SCHNELLWACHSENDE GEHÖLZE, HECKEN
OBST- UND NUSSBÄUME
nenliebende Maiskulturen und Leguminosen. Das Zusammenspiel hängt auch von der Streifenkultur ab: Zwetschen und Kernobst haben einen eher späten Blattaustrieb und sind erst dann reif, wenn das Getreide schon abgeerntet ist. Baut man hingegen Kartoffeln und Zuckerrüben auf den Ackerflächen an, könnten die jeweiligen Erntetermine zusammentreffen.
PROJEKT
Seit April 2023 läuft das internationale Projekt Carbon Farming CE, in Deutschland geleitet von der Beratung für Naturland. Ziel ist, mit gezielter Landbewirtschaftung die Kohlenstofffixierung im Boden zu erhöhen und das Treibhausgas Kohlendioxid in der Luft zu verringern. Damit kann man die negativen Folgen des Klimawandels mindern und die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Unter der Arbeitspaket-Leitung von Dr. Bettina Fähnrich hat sich schon viel im Projekt getan: Ein Katalog für Landwirte stellt geeignete pflanzenbauliche Maßnahmen vor. In Deutschland laufen eigene Versuche zu Agroforst, Diversifizierung der Fruchtfolge, Zwischenfrüchten sowie zur Kalkung und ihrer Wirkung auf den Humusgehalt. Infos dazu finden Sie online unter …
www.naturland-beratung.de bzw. über diesen CR-Code.

80 | AGROFORST
AGROFORST IM FÖRDERDSCHUNGEL
Agroforstsysteme müssen gut geplant, rechtliche Fragen und die Förderung geklärt sein. Wir geben Antworten auf die drei häufigsten Fragen.
Erhalten Agroforst-Streifen im Feld einen Schutzstatus, sodass die Gehölze nicht mehr entfernt werden dürfen?
Um landwirtschaftliche Förderung aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (1. Säule, Direktzahlungen) zu erhalten, müssen Landwirte unter anderem die GLÖZ-Standards (guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand) einhalten. GLÖZ 8 behandelt den Schutz der biologischen Vielfalt durch Erhaltung von nichtproduktiven Flächen und Landschaftselementen. Bäume und Sträucher auf landwirtschaftlichen Flächen, egal ob alt oder neu gepflanzt, können als erhaltungspflichtige Landschaftselemente eingestuft werden. Die Entfernung solcher Landschaftselemente bedarf dann einer naturschutzrechtlichen
Genehmigung und kann beispielsweise Ersatzpflanzungen oder Zahlungen zur Folge haben. Gehölze auf landwirtschaftlichen Flächen können auch zu Wald werden und dann dem Forstgesetz unterliegen, wenn beispielsweise Energieholzflächen nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums genutzt werden, z. B. 20 Jahre in Bayern und 30 Jahre in Österreich. Daher ist die Anlage eines Agroforstsystems in jedem Fall mit den Naturschutzbehörden abzusprechen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Ein in Deutschland agrarförderrechtlich anerkanntes Agroforstsystem unterliegt allerdings grundsätzlich keiner naturschutzrechtlichen Genehmigung bei Etablierung, Nutzung oder Entfernung. Dennoch empfiehlt sich eine Absprache mit den Naturschutzbehörden, vor allem, wenn die angedachte Fläche z. B. in einem Schutzgebiet liegt.
Wie werden Agroforstsysteme im Mehrfachantrag angegeben?
Das hängt von der Gestaltung des Agroforstsystems und der geplanten Nutzung und Zielsetzung ab. In Deutschland können Flächen als Agro-
„Gehölze auf landwirtschaftlichen Flächen können dazu führen, dass die Fläche die Förderfähigkeit verliert.“
 AUTOR Stefan Lemmerer Beratung für Naturland
AUTOR Stefan Lemmerer Beratung für Naturland

s.lemmerer@ naturland-beratung.at AGROFORST | 81
forstsystem codiert werden. In Österreich gibt es diese Möglichkeit noch nicht, man muss improvisieren. Allerdings sind auch für die Codierung Agroforst in Deutschland gewisse Vorgaben einzuhalten (siehe Tabelle).
Wie werden Agroforstsysteme gefördert?
Grundsätzlich haben auch landwirtschaftliche Flächen mit Gehölzen Anspruch auf Direktzahlungen, i. d. R. allerdings vorausgesetzt, dass die landwirtschaftliche Nutzung darunter nicht wesentlich eingeschränkt ist. Dafür ist von den Behörden meist eine Höchstzahl an Bäumen pro Hektar definiert. Bei als Agroforstsystem codierten Flächen wird in
Deutschland für den gesamten Schlag die Prämie für die Hauptnutzungsart des Schlages gewährt. Darüber hinaus gibt es in Deutschland seit 2023 die sogenannten Öko-Regelungen. Öko-Regelung 3 fördert die Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise. Hierbei ist die Definition Agroforst allerdings enger gefasst (siehe Tab.). Außerdem ist die Öko-Regelung 3 nicht in jedem Bundesland mit der Förderung für Öko-Bewirtschaftung kombinierbar.
In Österreich kann man im Falle einer Ausweisung als Spezialkultur oder punktförmiges Landschaftselement (z. B. Streuobst- oder Wertholzbäume) sowie bei der Anlage einer Mehrnutzenhecke ÖPULFörderungen erhalten.
Möglichkeiten der Angabe von Agroforstsystemen im Mehrfachantrag
Deutschland
Kriterien für Codierung als Agroforstsystem:
• Mindestens zwei Gehölzstreifen, die max. 40 % der Fläche einnehmen oder zwischen 50 und 200 auf dem Schlag verstreute Einzelpflanzen je ha.
• Nur Pflanzen, die nicht auf der Negativliste stehen, sind eingesetzt
• Nutzungskonzept ist Behörde vorgelegt
Sofern ein Agroforstsystem (oder Teile davon) diesen Anforderungen nicht entspricht, ist zu prüfen, wie vorgegangen werden kann (vgl. Österreich).
Grundsätzlich ist es bei Neuanlage empfehlenswert, das Agroforstsystem entsprechend der agrarförderrechtlichen Vorgaben zu gestalten.
Vorgaben für die Gewährung der Förderung im Rahmen der Öko-Regelung 3:
• Gehölzfläche zwischen 2 und 35 % des Schlages
• Breite der Streifen zwischen 3 und 25 m
• Größter Abstand zwischen Streifen bzw. zum Rand 100 m, kleinster Abstand 20 m
• Gehölzstreifen müssen weitestgehend durchgängig mit Gehölzen bestockt sein
• Holzernte nur im Dezember, Januar und Februar
Agroforstsysteme, bei denen Gehölze flächig verteilt sind, sind wahrscheinlich nicht auch nach Öko-Regelung 3 förderfähig.
Österreich
Möglichkeiten, Gehölze im Mehrfachantrag zu integrieren:
• Spezialkultur: gilt nur für Obst und Walnüsse; es muss qualitativ hochwertiges Pflanzgut verwendet werden, das in einem regelmäßigen System angelegt sein muss; die Gehölzflächen müssen unter Umständen herausdigitalisiert werden, z. B. wenn die Reihenabstände deutlich größer als für die (Rein)Kultur üblich sind.
• Punktförmige Landschaftselemente (LSE): Bäume, z. B. Wertholzproduktion oder Streuobst, können als ÖPUL-LSE angegeben werden und sind damit förderfähig, sobald der Kronendurchmesser mehr als zwei Meter beträgt. Bei Baumreihen auf Ackerflächen kann der Pflanzstreifen als Biodiversitätsfläche angegeben werden (dazu muss sie herauscodiert und die Bewirtschaftungsauflagen müssen eingehalten werden). Unter zwei Meter breite Streifen können als „traditionelles Charakteristikum“ gelten und der Hauptnutzung untergeordnet sein. Sie dürfen nicht mehr als sechs Prozent der Schlagfläche einnehmen und werden nicht extra ausgewiesen. Die Nutzung des Aufwuchses von traditionellen Charakteristika ist allerdings nicht erlaubt.
• Flächige LSE: Ist der Gehölzstreifen über zwei Meter breit, gilt er als flächiges lineares GLÖZ-LSE (Hecke) und ist somit erhaltungspflichtig und naturschutzrelevant
• Energieholzfläche: für Kurzumtriebsplantagen dürfen nur gewisse Baumarten verwendet werden und sie sind meldepflichtig; es gibt keine Förderung über das ÖPUL
• Mehrnutzenhecke: neu angelegte Hecke entsprechend einem Konzept der Agrarbezirksbehörde mit mindestens 20 % Krautsaum und angrenzend an eine Ackerfläche; Nutzung ist nicht erlaubt; gefördert über ÖPUL

82 | AGROFORST
Investitionsförderungen für die Neuanlage von Agroforstsystemen sind in Deutschland Ländersache. Derzeit bieten Bayern, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern eine Investitionsförderung an. In Österreich gibt es noch keine Investitionsförderung für Agroforst.
Außerdem gibt es in Deutschland und Österreich auf Bundesländerebene verschiedene Förderprogramme zu Anlage und Bewirtschaftung von Hecken und Streuobstflächen. Für Deutschland gibt es dazu eine sehr gute und aktuelle Übersicht unter www.baumland-kampagne.de.
INFO BOX
Für (länder)spezifische Informationen und Fragen wenden Sie sich gerne an die Beratung für Naturland, die jeweiligen Landesbehörden oder Interessenvertretungen:
• Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft: www. agroforst-info.de
• Agroforst Österreich: www.agroforst-oesterreich.at
• European Agroforestry Federation: www.euraf.net
LEICHTGRUBBER & SÄGERÄT TAIFUN MIT P-BOX-STI
Das Multitalent: Saatbettbereitung, Stoppelsturz, Zwischenfruchtanbau usw.


Nachtrag zum Artikel
„Lohnt sich Pflanzenkohle?“
(Naturland Nachrichten 01/2024)
Im Artikel wurde auf die Auswirkungen von Pflanzenkohle auf Boden, Humusbildung und Nährstoffverfügbarkeit eingegangen. Unter „Einsatzmöglichkeiten“ wurde auch ihre mögliche Verwendung als „Zusatz zu Tierfutter“ aufgezählt. Es wurde jedoch nicht erwähnt, dass Pflanzenkohle aktuell für ÖkoBetriebe (und damit auch für Naturland Betriebe) nicht in der Fütterung zugelassen ist. Die aktuelle EU-Öko-Verordnung lässt derzeit einen Einsatz von Pflanzenkohle als Futtermittel nicht zu, weil sie im dafür entscheidenden Anhang III „Zur Verwendung als Futtermittel oder zur
Futtermittelherstellung zugelassene Erzeugnisse und Stoffe“ nicht gelistet ist. Der Einsatz von Pflanzenkohle ist daher nur als Düngemittel/Bodenverbesserer erlaubt; zu diesem Zweck kann sie – wie im Beitrag dargestellt – auch im Stall eingestreut bzw. in die Wirtschaftsdünger eingebracht werden. Beim Einsatz von Pflanzenkohle ist zu beachten, dass nur Produkte mit einer CE-Kennzeichnung zur Verwendung in Deutschland zugelassen sind. Sollten Änderungen in der Zulassung erfolgen, die auch einen Einsatz in der Fütterung ermöglichen, werden wir Sie informieren.

ROTORHACKE ROTARYSTAR
Feinste Saatbettbereitung durch perfekte Krümelung!
Bis zu 35 kg Anpressdruck pro Rotorstern!
PREMIUMHACKGERÄT CHOPSTAR-PRIME
Jetzt auch mit Schneidscheiben und nachlaufenden Winkelmessern erhältlich!

WWW.EINBOECK.AT
Fotos: Paul Burgess, Agrarfoto
ANZEIGE
IMMER ÖFTER ZU SEHEN: Die Rollhacke
Immer öfter ist sie auf Öko-Betrieben zu finden: Die Rollhacke. Ist sie die Wunderlösung oder nur ein Hype? Wir stellen vor, was sie kann und was nicht.
 Jonas Wicklein
Jonas Wicklein
Beratung für Naturland j.wicklein@ naturland-beratung.de
Die Arbeitsweise einer Rollhacke ist simpel. Die Rotorsterne greifen mit ihren Spitzen in die obere Bodenschicht und brechen hier die Kruste auf. Durch die löffelähnliche Ausformung werden Erdbröckchen und Unkräuter im Fädchenstadium nach oben geschleudert. Die schwereren Erdbrocken fallen schneller zu Boden als das Unkraut, welches dann oben aufliegt und bei passender Witterung gut austrocknen kann. Die Kulturpflanzen werden bei flacher Einstellung kaum in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wenig Unkräuter, die bereits sauber aufgelaufen sind. Um also eine Unkrautbehandlung nur mit der Rollhacke zu gestalten, muss diese früh und häufig angewendet werden. In Mais- und Sojabeständen ist die Überfahrt unmittelbar nach dem Keimblattstadium möglich, im Getreide – je nach Saattiefe - ab dem Zwei-Blatt-Stadium. Entscheidend ist, dass die Kulturpflänzchen nach der Überfahrt noch fest im Boden sitzen.
Krusten aufbrechen
Der eigentliche Vorteil der Rollhacke liegt aber nicht in der
Unkrautbekämpfung, sondern im kulturschonenden Aufbrechen von Krusten. Die Rollhacke entfaltet ihre volle Wirkung besonders auf verschlämmten, schweren Böden, die der Hackstriegel im trockenen Frühjahr nicht mehr „anpackt“. Die Rollhacke sorgt für Belüftung des Bodens, dieser erwärmt sich und mineralisiert dann auch schneller. Mit dem nun schüttfähigen Boden ist im Nachgang gute Unkrautbekämpfung mit dem Striegel möglich.
Rollhacken werden mittlerweile von etlichen Herstellern in etwas unterschiedlichen Bauformen angeboten. Die Arbeitsweise ist aber sehr ähnlich. Die Tiefeneinstellung erfolgt in der Regel über Tasträder und den Oberlenker. Einige Hersteller bieten zusätzlich eine hydraulische Tiefenführung am Gerät an, diese erlaubt eine exaktere Einstellung.
Große Flächenleistung
Der Charme dieser Geräte liegt im Einsatz in frühen Stadien sowie in der großen Flächenleistung. Hohe Fahrgeschwindigkeiten von 15 km/h und mehr
AUTOR
84 | ACKERBAU & TECHNIK


machen eine sehr hohe Flächenleistung von über sechs Hektar pro Stunde bei sechs Metern Arbeitsbreite möglich. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Zugkraftbedarfs können solche Arbeitsbreiten beispielsweise bereits von Pflegeschleppern mit 90 PS gezogen werden.
Der Knackpunkt ist dann eher das Gewicht der Maschine. Die

massiv ausgelegten Rahmen sorgen bei einer sechs Meter breiten Rollhacke schnell für ein Gewicht von 1.800 kg.
Überbetrieblicher Einsatz
Aus meiner Beratungserfahrung sehe ich Rollhacken als gute Ergänzung in schwierigen Situationen. Mit ihr können verschlämmte und verkrustete Bö-
BvG Schwefeldünger
Beste Sofort- und Langzeitwirkung, seit
den aufgebrochen und für weitere Arbeitsgänge wie Striegeln oder Hacken vorbereitet werden. Aufgrund der hohen Flächenleistung und des in der Regel kurzen Einsatzzeitraumes eignen sich Rollhacken sehr gut für den überbetrieblichen Einsatz. Auch die Investitionskosten von mehr als 20.000 Euro sprechen – je nach Betriebsgröße – für ein Gemeinschaftsgerät.


BvG Düngekalk
Sparen Sie nicht am










Wir
Telefon +49 8427 985 7117 Fax +49 8427 985 7118 E-Mail info@bvg.gmbh Web www.bvg.gmbh
beraten
Sie gerne unverbindlich:
Sulfogran®SulfoLins®SCHWEDOKAL® Sulfogüll plus®
35 Jahren
Kalk, sondern mit Kalk. SulfoLins® S+Selen ANZEIGE
Fotos: zVg ACKERBAU & TECHNIK | 85
Die Rotorsterne der Rollhacke greifen mit ihren Spitzen in die obere Bodenschicht und brechen hier die Kruste auf.

AUTOR
Thomas Schmidt
Beratung für Naturland t.schmidt@ naturland-beratung.de



86 | ACKERBAU & TECHNIK
1
2
3
NEUE TECHNIK FÜR DEN Klimawandel
Mit dem GrindStar und dem ActiCut wurden auf der jüngsten Agritechnica zwei Neuentwicklungen für die ultraflache Bodenbearbeitung präsentiert. Wir haben sie in der Praxis gesehen.
Der erste Eindruck: Interessant!
Der Klimawandel ist eine der größten Herausfor derung in der Landwirtschaft. Wenn auch 2023 vielerorts überdurchschnittlich hohe Nieder schlagsmengen gefallen sind, so dominierten in den vergangenen Jahren dennoch extreme Tro ckenperioden. Wie reagiert die Landwirtschaft?
In Bewässerungstechnik zu investieren ist nicht flä chendeckend möglich, da in vielen Regionen ent weder kaum Grundwasser/Beregnungswasser zur Verfügung steht oder neue Wasserentnahmen nicht genehmigt werden. Zudem lohnt sich die Bewässe rung nicht bei allen landwirtschaftlichen Kulturen. Bewässert werden in den meisten Fällen Sonder kulturen wie Gemüse, Kartoffeln oder Zuckerrüben. Eine Stellschraube ist die ultraflache Bodenbe arbeitung. Damit soll Bodenwasser möglichst kon serviert werden. Mit dem GrindStar des Herstellers Saphir und dem Flachgrubber ActiCut von 4Disc wurden auf der Agritechnica 2023 zwei interessante Maschinen vorgestellt, die das Ziel der flachen Bodenbearbeitung mit unterschiedlichen Arbeitskonzepten verfolgen.
GrindStar hobelt Stoppeln ab

Die Rotoren des GrindStars sind mit abgewinkelten Messern ausgestattet, die in den Boden greifen und ihn „abhobeln“.
Der GrindStar wurde für die ganzflächige, ultraflache Stoppelbearbeitung konzipiert. Er besteht aus
1. Der GrindStar wurde für die ganzflächige, ultraflache Stoppelbearbeitung konzipiert.
2. Der Dreifachstriegel holt Beikräuter an die Bodenoberfläche, wo sie vertrocknen.
3. Beim ActiCut sorgen drehende Schneidscheiben für einen ganzflächigen Schnitt.
mehreren Rotoren mit einem Durchmesser von 75 cm. Diese sind auf zwei Reihen angeordnet, die sich entgegengesetzt drehen. Die einzelnen Rotoren sind mit abgewinkelten Messern ausgestattet, die in den Boden greifen und ihn „abhobeln“. Das hat die positive Begleiterscheinung, dass Pflanzenreste dabei zerkleinert werden. Bei der Bearbeitung von Maisstoppeln bringt es gleichzeitig einen Vorteil bei der Maiszünslerbekämpfung. Außerdem wird der Rotteprozess durch das „Zerfasern“ der Maisstoppeln verbessert. Jeder Rotor befindet sich in einem Parallelogramm, das für eine optimale Bodenanpassung sorgt. Das ganze Konzept kommt ohne maschinellen Antrieb aus und hat deshalb ein
ACKERBAU & TECHNIK | 87



geringes Gewicht. Die Rotoren werden ausschließlich durch die Vorfahrtsgeschwindigkeit angetrieben. Der Kraftaufwand wird vom Hersteller mit 20 PS pro Meter Arbeitsbreite angegeben, sodass kleinere und somit leichte Schlepper bodenschonend eingesetzt werden können. Der Dieselverbrauch wird mit zwei bis drei Litern pro Hektar ausgewiesen, die Arbeitsgeschwindigkeit liegt zwischen 12 und 18 km/h. Daraus ergeben sich bei einer SechsMeter-Maschine rechnerische Flächenleistungen von 7,2 – 10,8 ha/Std. Zwar liegt der Einsatzschwerpunkt der Maschine in der Stoppelbearbeitung. Nach Herstellerangaben kann sie aber auch zur Saatbettvorbereitung (brechen von Kluten) und zur Zwischenfruchtaussaat genutzt werden. Dazu wird ein Aufbaustreuer installiert. In Deutschland und Österreich kann die Maschine seit 2023 für einen Preis von ca. 40.000 Euro erworben werden. Auf der Agritechnica 2023 wurde der GrindStar mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.
Aktiver Schnitt mit ActiCut
Ebenfalls erstmals auf der Agritechnica 2023 vorgestellt wurde der Flachgrubber ActiCut der Firma 4Disc. Das Unternehmen wurde erst 2019 gegründet und ist eine Gemeinschaft zwischen einem Sonderkulturbetrieb und einem Maschinenbauer. Der ActiCut arbeitet nach einem komplett anderen Konzept als der GrindStar. Der Rahmen sieht ähnlich wie jener von herkömmlichen Grubbern aus. Die Schneidscheiben mit einem Durchmesser von 35 cm sind dreibalkig angeordnet und haben eine 33%ige Überlappung. Somit ist eine ganzflächige Bearbeitung des Bodenhorizontes gewährleistet. Die drehbaren Schneidscheiben sitzen an einer Welle und werden durch einen Hydraulikzylinder angetrieben. Durch den „aktiven“ Schnitt soll der Boden laut Hersteller offenporig bleiben. Die drehenden Antriebswellen sorgen für eine gewisse Selbstreinigung. Sollte es zum „Umwickeln“ der Antriebswellen mit organischem Material kommen, kann die Drehrichtung der Ölmotoren geändert werden. Die Tiefenführung erfolgt über hydraulisch einstellbare Räder. Hinter den Schneidscheiben folgt ein hydraulisch
1. Die drehenden Schneidscheiben des ActiCuts sollen laut Hersteller einen offenporigen Boden gewährleisten.
2. Die Arbeitsgeschwindigkeiten liegen bei beiden Geräten zwischen 12 und 18 km/h.
3. Durch die 33%ige Überlappung der Schneidscheiben erreicht der ActiCut einen ganzflächigen Schnitt.
88 | ACKERBAU & TECHNIK
1
Fotos: zVg
2 3
verstellbarer, dreifacher Striegel, der Beikräuter an die Bodenoberfläche holen soll, damit sie dort vertrocknen.
Der Leistungsbedarf liegt hier bei 30 PS pro Meter, der Ölbedarf der Gesamtmaschine bei 35l/min. Die Maschine wird in den Arbeitsbreiten 3 Meter, 4,20 Meter und 6,20 Meter angeboten. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt, wie beim GrindStar, zwischen 12 und 18 km/h – je nach Ziel der Bearbeitung. Liegt der Fokus in einer guten Durchmischung der Erntereste, wird schneller gefahren. Sollen die Erntereste sauber an der Bodenoberfläche als Erosionsschutz abgelegt werden, sind etwas geringere Geschwindigkeiten sinnvoll. Der ActiCut 300 kostet in seiner Grundausstattung ca. 19.500 Euro und 22.600 Euro mit Vollausstattung.
Interessante Konzepte
Beide Maschinen verfolgen das Konzept einer sehr flachen Bodenbearbeitung, die bei 1 cm Bearbeitungstiefe beginnen kann. Durch den geringen Eingriff wird wenig Boden bewegt und somit kann die Wasserverdunstung minimiert werden. Zusätzlich werden Humusabbau und somit Mineralisation
LEMKEN HACKMASCHINE EC-WEEDER
EINE HACKE FÜR ALLE FÄLLE.
Kurz & knapp
Sowohl der GrindStar als auch der ActiCut verfolgen das Ziel der flachen Bodenbearbeitung. Der GrindStar besteht aus Rotoren, die mit abgewinkelten Messern den Boden „abhobeln“. Angetrieben werden sie über die Vorfahrtsgeschwindigkeit. Beim ActiCut sorgen drehende und überlappende Scheiben für einen flachen Schnitt. Hydraulikmotoren treiben die Schneidscheiben an.
stark begrenzt. Die organische Masse an der Oberfläche sorgt für eine gute Bodenbedeckung, die Erosion und übermäßige Bodenerwärmung verhindert. Somit sprechen viele Argumente für diese neuen Techniken, um auch in Zukunft die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und mehr Wasser für die landwirtschaftlichen Kulturen zur Verfügung zu haben. Wie diese Konzepte Problemunkräuter im Öko-Landbau (z. B. Ackerfuchsschwanz) bekämpfen oder mit suboptimalen Bodenbedingungen klarkommen können, müssen die nächsten Jahre zeigen.

Der LEMKEN EC-Weeder ist ein wahres Multitalent unter den Hacken. Er eignet sich für alle Kulturen, die in Reihe angebaut werden und ist durch viele Werkzeugoptionen individuell sowie standortgerecht konfigurierbar.
RED SALES ANZEIGE
Kleeseide
DAS SPIEL MIT DEM Feuer
Was ist denn das? Ein auffälliges gelbes Gespinst im Kleegras schlingt sich eng um die Pflanzen. Die Nester im Klee stechen von Weitem schon ins Auge. Nur: was hat es damit auf sich?
Eines vorweg: Es ist Kleeseide, das Vorkommen häufte sich im Jahr 2023. Eingeschleppt wird dieser wärmeliebende Schmarotzer meist durch Samen, die sich im Saatgut verstecken. Legen Sie daher ein besonderes Augenmerk auf die Herkunft des Saatguts. Feinsämereien und Kleearten, die in wärmeren süd- und osteuropäischen Ländern vermehrt wurden, bergen ein höheres Risiko.
Kleeseide erkennen
Typisch ist ein nestweises Auftreten, das sich schnell ausbreiten kann. Die mit der Saat aus-

AUTORIN
Leah Hornung
Beratung für Naturland l.hornung@ naturland-beratung.de
gebrachten Samen keimen je nach Saattermin bei Wärme – im Frühjahr oder Sommer. Sobald der Keimling eine Wirtspflanze besiedelt hat, koppelt er sich komplett vom Boden ab. Die dann wurzellosen, langen gelbweißlichen, fadenförmigen und blattlosen Stängel schlingen sich wie ein Geflecht um die Pflanze. Die Kleeseide ist völlig auf ihren Wirt angewiesen, da sie sich von dessen Pflanzensaft ernährt und selbst keine Photosynthese betreibt. Aus diesem Grund verliert die befallene Pflanze den Farbstoff und wird stark geschwächt. Wie der Name verrät, kommt der Schmarotzer in der Regel bei
So gehen Sie bei Befall mit Samenreife vor
• Nester von außen nach innen abmähen und Grünpflanzen verbrennen
• Auf keinen Fall Mähwerk oder Mulcher einsetzen, da die Verbreitung dadurch großflächiger wird
• Mit thermischer Behandlung – zum Beispiel einem Bunsenbrenner – den befallenen Boden abflammen oder z.B. kleine Strohballen abbrennen
• Nach der Arbeit in einem befallenen Feld: Maschinen, Reifen etc. gründlich reinigen
• Die befallenen Flecken dokumentieren, ggf. Mitarbeiter schulen und diese Stellen in den Folgejahren aufmerksam kontrollieren
90 | ACKERBAU & TECHNIK


Kleeseide tritt nesterweise auf und ist anhand der gelb-weißlichen Stängel zu erkennen.
Klee und Luzerne vor. Es können aber alle zweikeimblättrigen Pflanzen, also z.B. Körnerleguminosen, Kartoffel, Zuckerrübe, Zwiebel, aber auch Unkräuter wie die Distel befallen werden.
Maßnahmen bei Befall
Bemerken Sie einen Befall, ist es wichtig festzustellen, ob die Kleeseide schon Blüten gebildet hat. Diese sind weiß oder leicht rosa. Sind noch keine vorhanden, kann sie durch Mähen oder Mulchen effektiv bekämpft werden: da sie nicht mehr im Boden verwurzelt ist, kann sie ohne Wirt nicht überleben. Sind jedoch bereits Blüten zu sehen, ist eine schnelle Samenbildung und -reife wahrscheinlich und damit droht die Gefahr einer Verbreitung. Die Samen sind sehr klein und können leicht verschleppt werden. Es folgt ein Spiel mit dem Feuer. Die Pflanze sollte auf keinen Fall in den Futtertrog gelangen, da die Pflanzenteile toxisch wirken und die Samen ihre Keimkraft auch durch den Verdauungstrakt der Wiederkäuer oder die Biogasanlage nicht verlieren. Wie bei Befall mit Samenreife vorzugehen ist, entnehmen Sie der Übersicht der linken Seite.
Vorbeugend für die Zukunft
Nach einem Befall im Samenstadium sollte auf der Fläche eine Anbaupause von Wirtspflanzen von mindestens sechs, besser zehn Jahren eingehalten werden. Achten Sie bei Klee, Luzerne, Feldfutter, Zwischenfrucht- und Blühmischungen auf die Herkunft, besonders dann, wenn Arten eingemischt sind, die nicht dem Saatgutverkehrsgesetz
unterliegen. Behalten Sie das betroffene Feld in den nächsten zehn Jahren besonders gut im Auge und entfernen Sie zeitnah gegebenenfalls befallene Pflanzen. Die Lebensdauer der Samen liegt zwischen sechs und zwanzig Jahren. Wählen Sie auf diesen Flächen die Fruchtfolge so, dass keine Gefahr von Befall besteht, z.B. Getreide in Sommeroder Winterung.
Eine regelmäßige Beobachtung der Bestände hilft, Nester frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist, dass Sie schnellstmöglich handeln, wenn Sie Kleeseide im Bestand bemerken. Bei Fragen rund um das Thema wenden Sie sich gerne an die Beratung für Naturland.
Sorten für Ihren Öko-Betrieb
Qualitätssaatgut bestellt?
Mais für Korn und Silo
DARRO (S240/K230)
Der trockentolerante Ökomais
OPPIDO (FAO 170)
Ultrafrüh und spätsaatverträglich





Speisesoja
JENNY
AMANDINE 000
Unser Klassiker
 Sobald die Kleeseide Blüten gebildet hat, ist von einer bereits erfolgten Samenbildung auszugehen.
Sobald die Kleeseide Blüten gebildet hat, ist von einer bereits erfolgten Samenbildung auszugehen.
ACKERBAU & TECHNIK | 91
Fotos: Irene Jacob, Leah Hornung
ANZEIGE
www.natur-saaten.de
NEU
frühe 00 Sorte Top Protein

Mehr Geld mit
Klee-Untersaat
92 | ACKERBAU & TECHNIK

AUTOREN
Peer Urbatzka und Georg Salzeder
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Die Untersaat von Kleegras führt zu einem höheren Deckungsbeitrag über die gesamte Fruchtfolge. Die bessere Vorfruchtwirkung und der höhere Kleegras-Ertrag machen es möglich. Einziger Schönheitsfleck: Ampfer!
Kleegras ist das Herz einer Fruchtfolge im Öko-Betrieb. Es ist neben der organischen Düngung die wichtigste Stickstoffquelle. Umso wichtiger ist, dass der Anbau möglichst optimal gestaltet wird. In einem sechsjährigen Versuch der LfL brachte Kleegras als Untersaat mehr Ertrag. Aber nicht nur das: Auch der Deckungsbeitrag der vierjährigen Fruchtfolge war in der Untersaat-Variante höher. Aber der Reihe nach:
Kleegras im Mai einstriegeln
Kleegras kann als Untersaat in der Vorfrucht Getreide oder als Blanksaat nach dem Drusch gesät werden. Kleegras als Untersaat wurde im LfL-Versuch Ende April bis Mitte Mai in Wintergetreide ausgebracht und anschließend eingestriegelt. Im darauffolgenden Herbst zeigte der Kleegrasbestand eine sehr geringe Verunkrautung mit
ACKERBAU & TECHNIK | 93


Kleegras nach Untersaat (li) war im Versuch viel weniger verunkrautet als nach Blanksaat. Diese Fotos wurden im April gemacht, im Herbst zuvor konnte die Untersaatvariante schon das erste Mal geerntet werden.
einem Anteil von circa zwei Prozent und einen hohen Kleeanteil mit circa 85 %. Ursache sind geringe Stickstoffgehalte im Boden nach der Saat, da die Vorfrucht Getreide den Stickstoff bereits zu großen Teilen aufgenommen hat. Zudem wurden über die fehlende Bodenbearbeitung wenig Reize zum Auflaufen des Unkrauts gesetzt. Im Herbst wuchs
UNTERSAAT IM HERBST
hier ein vollwertiger Schnitt mit einem Ertrag von 27 dt/ha Trockenmasse heran.
Ein Drittel höherer Ertrag
Ganz anders entwickelt sich das Kleegras bei einer Saat nach dem Korndrusch. Hier war das Kleegras im Herbst deutlich verunkrautet und es erfolgte meis-
tens ein Schröpfschnitt. Trotzdem war das nach dem Drusch gesäte Kleegras im Frühjahr bis zum ersten Schnitt immer noch stärker verunkrautet (im Durchschnitt 11 %). Auch der Kleeanteil lag mit gut 60 % deutlich geringer als nach Untersaat. Hieraus resultierte eine schwächere Qualität des ersten Aufwuchses und auch ein um 20 % geringe-
Bei Wintergetreide ist grundsätzlich auch eine Kleegras-Untersaat im Herbst möglich. Allerdings kann hier die Deckfrucht Wintergetreide deutlich stärker beeinträchtigt werden als bei einer Untersaat im Frühjahr. In Feldversuchen der LfL lag der Kornertrag der Deckfrucht Winterroggen bei Untersaat im Herbst um zehn Prozent geringer als bei einer Untersaat im Frühjahr. Zudem hat Kleegras bei Untersaat im Herbst einen deutlich höheren Grasanteil, da mehr Stickstoff über Herbst und Winter vorhanden ist als bei einer Untersaat im Frühjahr.
94 | ACKERBAU & TECHNIK
2. Schnitt
3. Schnitt
4. Schnitt
Kleegras wächst unter der Deckfrucht heran, in der Fahrgasse entwickelt sich die Untersaat nochmals besser.
Herbstschnitt

rer Ertrag bei Blanksaat. In der Summe aller Schnitte fiel der Ertrag des Kleegrases bei Untersaat mit 183 dt/ha Trockenmasse um ein Drittel höher aus.
Vorsicht bei Ampfer
Bei gehäuftem Ampfervorkommen eignet sich der Schlag nicht für die Untersaat. Hier ist die Blanksaat aufgrund der zusätzlichen Bodenbearbeitung vor der Saat des Kleegrases überlegen. Dadurch konnte der Ampfer bekämpft und reduziert werden, während bei einer Untersaat das Unkraut aufgrund der fehlenden Bodenbearbeitung länger ungestört wachsen konnte. Bei der Distel war übrigens das Gegenteil der Fall: Durch die höhere Anzahl an Nutzungen bei Untersaat konnten Distelnester effektiver bekämpft werden.
Deckungsbeitrag steigt
Untersucht wurde auch die Auswirkung der Kleegras-Untersaat auf die gesamte Fruchtfolge. Dazu wurde im LfL-Versuch eine vierjährige Fruchtfolge (Wintertriticale, Kleegras, Winterweizen, Wintertriticale) ökonomisch ausgewertet. Der Gesamtdeckungsbeitrag lag in der Untersaat-Variante höher – und zwar sowohl bei Abfuhr und Verkauf des Kleegrases als auch, wenn der Aufwuchs gemulcht wurde (siehe Tabelle).
Wurde das Kleegras gemulcht, lag die Summe bei Untersaat mit 2.519 Euro pro Hektar um gut 250 Euro höher als bei Saat nach dem Drusch. Ursache hierfür ist v.a. die bessere Vorfruchtwirkung bei Untersaat: Allein die höheren Erträge bei den Nachfrüchten Weizen und Triticale brachten die zusätzlichen 250 Euro Deckungsbeitrag. Auch das Kleegrasjahr verursachte bei
ACKERBAU & TECHNIK | 95
dt/ha TM-Ertrag dt/ha RP-Ertrag 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 Untersaat
Blanksaat
TM-Ertrag RP-Ertrag Untersaat Blanksaat
1. Schnitt
Kleegrasertrag aller Schnitte je nach Anbauverfahren
Deckungsbeiträge der einzelnen Kulturen in Euro/ha sowie der Gesamtfruchtfolge bei unterschiedlicher Kleegras-Saat
* Verkauf ab Feld (6,49 Euro/dt; Futter), ohne organische Düngung der Nachfrüchte
** Verkauf ab Feld (2,79 Euro/dt; Biogas), ohne organische Düngung der Nachfrüchte
Untersaat etwas geringere Kosten, was an der kostengünstigeren Etablierung lag. Lediglich bei der Deckfrucht Triticale fiel der Ertrag durch die Untersaat etwas geringer aus.
Bei Abfuhr erhöhte sich die Summe der Deckungsbeiträge in der Fruchtfolge um über 1.000 Euro/
ha durch den Verkauf des Kleegrases. Ob das und auch der Preis von 6,49 Euro/dt ein realistisches Szenario ist, kann nur betriebsindividuell entschieden werden. Nach Untersaat lag der Deckungsbeitrag über 500 Euro/ ha höher als nach Blanksaat. Dieser Unterschied ist auch v. a. auf den Verkauf des Kleegra-
Kleegras kann im Frühjahr mit pneumatischen Sägeräten auf Hackstriegeln ausgebracht und eingearbeitet werden.
ses zurückzuführen, da bei der Untersaat die Erntemenge etwa ein Drittel höher war. Der Unterschied in der Vorfruchtwirkung war aufgrund der Abfuhr der oberirdischen Biomasse gering. Bei der Deckfrucht Triticale war der Ertrag – wie bei der Mulchnutzung – durch die Untersaat etwas negativ beeinflusst.
Kurz & knapp

Untersaat von Kleegras im Frühjahr führt zu einer höheren ökonomischen Leistung der Fruchtfolge – egal, ob der Kleegrasaufwuchs gemulcht oder verkauft wird. Bei Mulch ist der ökonomische Vorteil insbesondere auf eine bessere Vorfruchtwirkung zurückzuführen. Wird Kleegras verkauft, wirkt sich der höhere Ertrag des Kleegrases selbst auf den Deckungsbeitrag aus.
96 | ACKERBAU & TECHNIK
Fotos: Urbatzka, Einböck, Goldberger
Untersaat Stoppelsaat Untersaat Stoppelsaat Untersaat Stoppelsaat Wintertriticale 1.046 1.084 1.016 1.089 1.016 1.089 Kleegras -368 -423 1.125 731 538 352 Winteweizen 963 787 716 731 716 731 Wintertriticale 878 805 780 736 780 736 Summe 2.519 2.253 3.637 3.286 3.050 2.908
Kleegras mulchen Kleegras Abfuhr* Kleegras Abfuhr**
96 | ACKERBAU & TECHNIK

Naturland
BIO-WARENBÖRSE
BIETE/VERKAUFE PFLANZLICHE PRODUKTE, FUTTERMITTEL
Mais Silageballen; Rittergut Berninger; 34326 Morschen; Tel.: 0157 52136086
Weizen und Hafer; Stefan Bender; 35641 Schöffengrund; Tel.: 0176 62202928
Quaderballen Luzerneheu und Grasheu; Paul Blume; 59505 Bad Sassendorf; Tel.: 02921 51340
Naturland Bio-Hanf; Markus Kaupp; 72189 Vöhringen; Tel.: 0160 96927292
Bergwiesenheu und Öhmd; Wolfgang Winterhalder; 79822 Baden-Württemberg - Titisee-Neustadt; Tel.: 0160 5072494
Bioheu in Qauderballen; Herbert Stark; 85128 Nassenfels; Tel.: 0162 4314204
Bio Naturland Heu in Rund- und Quaderballen und Silage in Rundballen; Klaus Gerst; 85435 Erding; Tel.: 0179 7042455
Bio-Heu 1. Schnitt; Bernadette Lex; 85461 Bockhorn; Tel.: 08122 4477
Körnermais und Weizen; Johann Tremmel; 86453 Dasing-Rieden; Tel.: 08205 266
Öhmd Rundballen; Siegfried Netzer; 88279 Amtzell; Tel.: 07522 8733
Futtererbsen und Futterhafer; Michael Süß; 89362 Offingen; Tel.: 0160 90717036
Quader Wiesen Heu zu Verkaufen 1 Schnitt 2023; Gebhard Karch; 97453 Schonungen; Tel.: 0160 92609267
BIETE/VERKAUFE ZUCHT-, NUTZVIEH
BV-Stierkalb zur Zucht; Christian Heiland; 82401 Rottenbuch; Tel.: 0173 8493463
Rinderaufzucht / Pensionsrinder / Sommer-Almweide; Johann Müller; 83661 Lenggries; Tel.: 0159 01022604
Bienenvölker Dadant-US oder MiniPlus; Michael Littmann; 88361 Boms; Tel.: 07581 202618
Angus Absetzer und Färsen trächtig nur zur Zucht und Angus-Jungbullen rot und schwarz zur Zucht; Lothar Kempfle; 89312 Günzburg; Tel.: 0170 6341650
Deckfähige Jungsauen; Stefan Rothammer; 94372 Rattiszell; Tel.: 09964 225318
BIETE SONSTIGES
Einstreuballen, geschnitten, ideal für Tiefboxen; Gabler Landwirtschaft GbR; 87466 OY/ Mittelberg; Tel.: 0160 99180534
Rotary Hoe Rollhacke zur Bodenbelüftung und Unkrautregulierung; Karl-Heinrich Kohl; 34630 Gilserberg; Tel.: 0160 7475720
Bio Kürbiskerne zum Ölpressen; Florian Jobst; 84164 Moosthenning; Tel.: 0151 12701640
Bio Naturland Dinkel; Klaus Gerst; 85435 Erding; Tel.: 0179 7042455
Buchweizen; Simon Schäfer; 85452 Moosinning; Tel.: 0157 54131436
200kg Bio-Frühjahrsblütenhonig (Naturland) in Hobbocks zu verkaufen; Daniel Zettler; 87775 Hausen; Tel.: 0176 64215645
Güttler Supermaxx Bio AB 6m und Abflammgerät Fa Reinert.; Hartmut Paulus; 91413 Neustadt an der Aisch; Tel.: 09161 876027
Futtersilo, Transportkisten, Eiersortiermaschine, mobiler Hühnerstell; Gerhard Hendlmeier; 93087 Alteglofsheim; Tel.: 0151 42812946

So wirkt TerraLife® Organic: Artenreiche TerraLife ® Organic Zwischenfruchtmischungen bieten für jede Fruchtfolge eine praxisorientierte Lösung. Ihre DSV Beratung vor Ort ist gerne für Sie da: 0800 111 2960 kostenfreie Servicenummer MEHR BODENLEBEN VERSTÄRKTER HUMUSAUFBAU BESSERE NÄHRSTOFFVERFÜGBARKEIT HOCHWERTIGERE ERTRÄGE www.dsv-saaten.de Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-039 ANZEIGE
TERMINE | 97
Frühjahrsblütenhonig, Bienenwachs, Bienenbeuten Dadant; Christian Peter; 97274 Leinach; Tel.: 09364 9453
SUCHE FUTTERMITTEL
Naturland Futterweizen/ -gerste; Schön; 92363 Breitenbrunn; Tel.: 0170 3534764
SUCHE ZUCHT-, NUTZVIEH
10 bis 25 männliche Absetzer Alter ab 10 Monaten; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Fleckvieh Kühe/Kalbinnen Bio; Andreas Leurer; 97762 Hammelburg; Tel.: 0176 64941304
SUCHE SONSTIGES
BIO-HTK, Bio Stroh, Bio Hühnermist (auf Späne und Stroh); Tegeler; 49685 Emstek; Tel.: 04473 94100
STELLENMARKT
Wir suchen eine landwirtschaftliche Fachkraft; Amadé Billesberger; 85452 Moosinning; Tel.: 0172 8654676
Solawi Bad Waldsee sucht Gemüsegärtner*in (m/w/d) ab April 2024 (mind. 70 %); Josef Wild; 88339 Bad Waldsee; Tel.: 07524 3888
PC trifft Praxis: Anlagenmanager (m/w/d) Biogasanlage gesucht; Stefan Schulze-Bergcamen; 14776 Brandenburg an der Havel; Tel.: 03320 7790924
landwirtschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d); Solf; 17209 Melz; Tel.: 0176 64935310
Fachkraft Agrar; Kevin Stanau; 29487 Luckau Wendland; Tel.: 05844 262
Suche Mitarbeiter in Vollzeit für Bio Ackerbaubetrieb; Niels Wieland; 52388 Nörvenich; Tel.: 01578 6078552
Wir suchen 2 Saisonarbeitskräfte zum Zuckerrüben hacken; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
HOF- UND FLÄCHENMARKT
Schwester u. Bruder suchen Hof o. Flächen für Gemüsebau im Lkr. Regensburg zum Kauf, Pacht o. Nachfolge. Tel. 0176 31198644; Mail: biohofgesucht@proton.me
Bio Hof in Alleinlage mit 3000 Legehennen sucht neue Besitzer; Susanne Kögl; 34414 Warburg; Tel.: 05641 7432417
Betriebsübergabe Biolegehennenbetrieb in 37170 Uslar-Ahlbershausen; Marlene Staab; 37170 Uslar; Tel.: 0176 31712921
INFO
Weitere Anzeigen finden Sie im Internet unter www. biowarenboerse.de. Dort können Sie auch Ihre Anzeige schalten oder telefonisch bei Regina Springer unter Tel: +49 (0)8137 6372-912.
Die unabhängige Fachzeitschrift für ökologische Land - und Lebensmittelwirtschaft
IN JEDER AUSGABE:
Beiträge, Interviews, Meinungen aus Praxis, Forschung und Beratung
Ein Schwerpunktthema ( Generationswechsel, Bi o 3.0, Bäuerliche Landwirtschaft, Weltmarkt Bio, ) Fachartikel aus Pflanzenbau, Tierhaltung, Ernährung, Verarbeitung, Handel, Forschung … Interviews mit dem Nachwuchs der Biobranche Serviceteil
JETZT VERGÜNSTIGTES PROBEABO SICHERN
Zwei Ausgaben für nur 9,45 Euro inkl. Versand statt 13, 50 Euro








11,20 € AUSGABE 01 2024 192692 611209 01 ÖKOLEISTUNGEN Wie sie bewertet werden können KLEEGRAS Wie es sich ohne Nutzvieh optimal nutzen lässt 30 PROZENT BIO Warum die Bio-Strategie nicht reicht Tierhaltung Jetzt testen und 30% sparen mit dem NALAND30Code
Code NALAND30 an abo@oekom.de telefonisch + 49/ (0) 89 / 54 41 84-225 oder online www.oekologie-landbau.de
Bestellung mit
98 | WARENBÖRSE
ANZEIGE

Maximale Leistung für höchsten Anspruch

M6002
M6002: Der leistungsstarke Alleskönner
Für Landwirte, die außergewöhnliche Wendigkeit, ausgezeichnete Rundumsicht und maximale Ergonomie schätzen.
www.kubota-eu.com






















mit Kubota Grubber CU1300 Wir sind Naturland Verband für ökologischen Landbau Hier wächst Bio-Kleegras in Naturland Qualität HEUTE SCHON ÜBER DEN FELDRAND GESCHAUT? Kleegras ist Öko-Landbau sehr die Bodenfruchtbarkeit, denn satz Düngernmineralisch-synthetischen ist hier Kleemischung sorgt dafür, derAckerboden gut mit versorgt wird. zu die mit Hilfe Knöllchenbakterien der können und nachfolgenden sorgen für intensiveKleegrasanbauBodendurchwurzelung. ist der Fruchtfolge. wichtig für xierung im Boden für Zudem kann gras eingesetztaufÖko-Betriebenvielseitig werden: Tiere dem Naturland Hof benachbarten Als age fürÄcker Felder. Stromerzeugung Gär- substrate aus wertvollerkönnenwiederum den Feldern eingesetzt Mitglieds-Nr: 12345 zertifiziert den Richtlinien Öko-Kontrollnummer: DE-ÖKO-123 ERZEUGNIS AUS ÖKOLOGISCHEM LAND- UND GARTENBAU GEMÜSE Erzeuger/abgepackt EG-Kontroll-Nr.: Öko-Kontrollstelle: ERZEUGNIS AUS ÖKOLOGISCHEM LAND- UND GARTENBAU OBST Produkt Gew./Anz./Größe: Ursprungsland: Öko-Kontrollstelle: Erzeuger/abgepackt könnenwiederum EINFACH UND BEQUEM ONLINE BESTELLEN, IN WENIGEN TAGEN GELIEFERT! Mit dem Code NL_START10 gibt es 10 % RABATT auf Ihren ersten Einkauf. NATURLAND-DRUCKSHOP.DE HAST DU WAS ZU DRUCKEN? EINFACH AUF NATURLANDDRUCKSHOP.DE GUCKEN! Maßgeschneiderte Technik Hohe Schlagkraft FachkompetenzÜber 50 Jahre Erfahrung Wetterunabhängig trocknen Trocknungstechnik Notstromtechnik Holzbautechnik GeräteBau Birk GmbH Spiesberger Breite 12 D - 88279 Amtzell www.gb-birk.de info@gb-birk.de 07520 953617 Heutrocknung Steigerung der Grundfutterleistung Gesunde Tiere dank bester Futterqualität “bis7.000ltr. Grundfutterleistung” ANZEIGEN | 99
Biologisch. Zukunft. Sichern.

Unser ausführliches Pflanzenschutzprogramm für den Obstbau 2024:
Ihre Vorteile
• Wirkstoffwechsel gegen Apfelwickler
• Nützlingsschonend und bienenfreundlich (B4)
• Bei DiPel® DF reduzierte Resistenzbildung durch Bt-Toxin-Mix
certisbelchim.de Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.












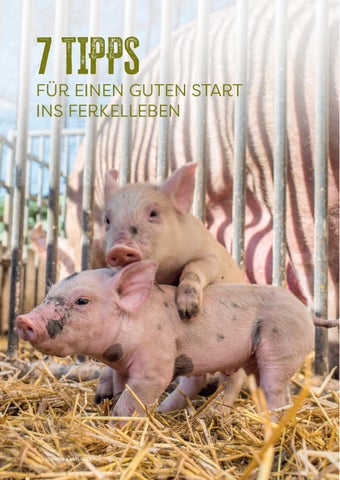





























 Markus Fadl
Markus Fadl



 Markus Fadl
Markus Fadl










































































































































































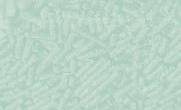




















































 AUTOR Stefan Lemmerer Beratung für Naturland
AUTOR Stefan Lemmerer Beratung für Naturland






 Jonas Wicklein
Jonas Wicklein



















































