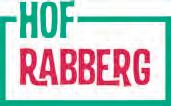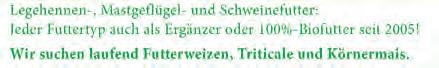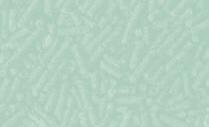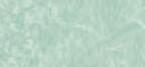Naturland
NACHRICHTEN
Fachinformationen für den Öko-Landbau

BEGRÜNUNG
Tipps zur Zwischenfrucht

richtig dreschen
VIEHTRIEB
auf der Straße DINKEL
Ausgabe 03 | 2024

„In KetoSan® B ist Dampf drin! Unsere Kühe fallen nicht ins Loch, sondern kommen zuverlässig aus einem Energiedefizit raus und die Milchmenge steigt nach kurzer Zeit wieder. Dabei wird der Fettabbau sichtlich gestoppt, ohne dass die Leber Schaden nimmt.“
Friederike und Georg Kaindl, 50 Milchkühe


KetoSan® B
88339 Bad Waldsee | Telefon: +49 (0) 7524 - 4015-0 www.schaette.de Eine Marke der SaluVet GmbH
DIE WEIDE KOMMT
Die generelle Weidepflicht im Öko-Landbau ist nicht mehr abzuwenden. Die bisherige Ausnahmeregelung bei objektiv nachvollziehbaren Gründen (z.B. Unerreichbarkeit von Weiden wegen Straßen oder Bahntrassen, Dorflagen etc.) und bei gleichzeitig ganzjährig zugänglichem Laufhof wird gestrichen. Zu groß war der Druck der EU-Kommission. Sie argumentiert, dass Konsumenten den ÖkoLandbau laut Umfragen mit Weidehaltung verbinden. Zwar hat sich der betreffende Text der EU-Öko-Verordnung seit vielen Jahren nicht geändert, die EU-Kommission vertritt allerdings die Meinung, dass die Auslegung in Deutschland nicht ausreichend war.
In Österreich fand derselbe Prozess bereits statt. Ergebnis: die vollumfängliche Umsetzung und Maximierung der Weidehaltung seit dem 1.1.2022. Die deutschen Behörden (BMEL und LÖK) nehmen Österreich als Vorlage und wollen mit ihrem Weidepapier ein Vertragsverletzungsverfahren vermeiden.
Naturland versucht an vielen Stellen, politisch sowie fachlich, die Konsequenzen im Sinne der Einzelbetriebe abzumildern. Wir nehmen unsere Aufgabe als Vertreter der Naturland-Bauern ernst, wenn es aktuell darum geht, eine praxisnahe Auslegung zu schaffen. Denn die Beratung für Naturland wird die Betriebe auch bei der Umsetzung begleiten.
Herausfordernd wird es vor allem dann, wenn die Weideflächen nicht arrondiert um den Betrieb liegen. Nicht selten muss das Vieh über oder entlang von Straßen getrieben werden. Dann wird sich schnell zeigen, wie groß der Weidewunsch der Konsumentinnen und Konsumenten ist, wenn im Straßenverkehr Rücksicht auf Tiere zu nehmen ist. Hier braucht es wieder mehr Verständnis, denn wer die Weide will, muss auch dem Viehtrieb zur Weide zustimmen (siehe Seite 46).
IMPRESSUM
NATURLAND NACHRICHTEN
Herausgeber: Beratung für Naturland Öko-BeratungsGesellschaft mbH Eichethof 1, 85411 Hohenkammer Telefon: +49 (0)8137/ 6372-902 info@naturland-beratung.de www.naturland-beratung.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P): Martin Bär
Vertrieb: Regina Springer Telefon: +49 (0)8137/6372-912 r.springer@naturland-beratung.de
Anzeigen: Tanja Edbauer Telefon: +49 (0)172/3126816 t.edbauer@naturland-beratung.de
Redaktion: Ralf Alsfeld, Markus Fadl, Roman Goldberger (leitend), Walter Zwingel
Titelfoto: Naturland / Sabine Bielmeier
Grafik & Layout: Werbeagentur Oberhofer, Ingolstadt Alison Goldberger, Rainbach
Druck: Riegler Druck, Pfaffenhofen
Papier: Circle Offset Premium White, 100 % Recycling, nach Blauer Engel zertifiziert, Umschlag 200 g/qm, Innenteil 90 g/qm
Bezug: Die Fachzeitschrift erscheint sechsmal im Jahr im Umfang von mind. 80 Seiten. Der Bezugspreis der Naturland Nachrichten ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Alle namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion zulässig.
Wir formulieren in unseren Texten die weibliche und männliche Form aus. Wenn dies die Lesbarkeit beeinträchtigt, verwenden wir die generische

Form – diese schließt Frauen dann selbstverständlich ein.
DER UMWELT ZULIEBE
Die Naturland Nachrichten werden aus Recyclingpapier (Blauer Engel) und mit natürlichen Farben ohne Mineralöl hergestellt. Druck und Versand erfolgen CO2-neutral durch Kompensation. Daher darf die Zeitschrift – als Ganzes – den Blauen Engel tragen.
Geschäftsführer Beratung für Naturland

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. www.blauer-engel.de/uz195 ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt · emissionsarm gedruckt aus 100 % Altpapier IP3
LEITARTIKEL | 3
Martin Bär

ZWISCHENFRUCHT
20 DIE MISCHUNG MACHT‘S Zwischenfrucht am Naturland-Betrieb Hummelsberger
24 DAS LEISTEN WURZELN Wurzelmerkmale der Zwischenfrüchte
28 WELCHE ZWISCHENFRUCHT PASST?
Beispiele für veschiedene Fruchtfolgen
34 UNTERSAATEN … erfolgreich etablieren
38 DROHNEN-SAAT
Am Naturland-Betrieb von Markus Traber


MARKT & VERMARKTUNG

42 MARKT & PREISE Aktuelle Entwicklungen
44 FÖRDERPROGRAMM ARTENVIELFALT
„Wir haben einiges vor!“
RIND & GRÜNLAND
46 WEIDE Viehtrieb auf der Straße
50 7 TIPPS … für eine gute Heuernte
54 HITZESTRESS

Was tun gegen hohe Zellzahlen?
57 BERATERTIPP
Zellzahlen im Sommer niedrig halten
58 INTERVIEW Arbeitskräfte finden

SEITE 92 SEITE 80 SEITE 38
4 | INHALTSVERZEICHNIS


SCHWEIN & GEFLÜGEL
62 FÖRDERPROGRAMM
Die neue Bundesförderung für Schweinebetriebe
66 INTERVIEW
„Es fehlen zwei bis drei Cent.“
68 7 TIPPS … bei Hitzestress

ACKERBAU & TECHNIK
72 KLEEGRAS … erfolgreich umbrechen
78 GETREIDELAGER … jetzt auf die Ernte vorbereiten
80 MÄHDRUSCHEINSTELLUNG
So dreschen Sie Dinkel
86 DLG-FELDTAGE
Besuchen Sie uns
88 SBR & STOLBUR
2 Erreger, 1 Überträger
92 ÖKO-RAPS
Kleines Korn, große Herausforderung

6 INTERVIEW Faire und ökologische Marktwirtschaft
10 AKTUELLES
Das Naturland in Bildern
12 POLITIK & VERBAND Kommentar zur EU-Wahl
14 INTERVIEW Nachhaltigkeit honorieren
17 AUS DER KONTROLLE Antworten auf häufige Fragen
18 NATURLAND-APP
Die meistgelesenen Beiträge
INHALTSVERZEICHNIS | 5 SEITE 46 SEITE 50 SEITE 6 AUS DEM NATURLAND
AUTOR Markus Fadl Naturland e.V. m.fadl@naturland.de

Augenhöhe Auf
Der Lebensmittelmarkt wird in Deutschland von vier großen Handelskonzernen bestimmt. Die Folge: Bio-Landwirte und Verarbeiter geraten in Verhandlungen immer wieder unter Druck. Hier gegenzusteuern, ist das Ziel der Allianz „Faire und ökologische Marktwirtschaft“ (FÖM), zu deren Initiatoren Naturland und das Forum Fairer Handel gehören. Wir sprachen mit den beiden Geschäftsführern, Steffen Reese und Matthias Fiedler.
6 | AUS DEM NATURLAND
REESE & FIEDLER
Matthias Fiedler (re.) ist Geschäftsführer des Forums Fairer Handel (FFH), dem Verband des Fairen Handels in Deutschland. Steffen Reese ist Geschäftsführer des Naturland e.V. und darüber hinaus Mitglied im Vorstand des FFH. Dem FFH gehören Organisationen an, die ausschließlich Fairen Handel betreiben und Akteure, die die Förderung des Fairen Handels als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit ansehen. Naturland mit seiner Zusatzzertifizierung Naturland Fair ist der einzige Bio-Verband im FFH.

Wie kam es zur Gründung der Allianz und was ist ihr Ziel?
Reese: Der ursprüngliche Impuls ging vom langjährigen Naturland-Partner GEPA aus. Als Pionier des Fairen Handels setzt sich GEPA aktiv für die Erzeuger ein, steht aber zugleich als Unternehmen auch selbst im Wettbewerb, kennt also die Situation, wenn Einkäufer großer Handelsketten ihre Marktmacht gegenüber Lieferanten ausspielen. Unser Ziel ist es, genau an diesem Punkt der Lieferkette in einen kritischen Dialog zu treten und selbstbewusst Handelsbeziehungen auf Augenhöhe einzufordern. So etwas macht man am besten nicht allein, sondern in einem möglichst breiten Bündnis verschiedener Bio-Verbände und Unternehmen. Deshalb hat Naturland die Bildung des FÖM-Netzwerks von Anbeginn aktiv mitgestaltet und vorangetrieben.
Wie unterscheidet sich der Ansatz der FÖM von den Instrumenten, die es schon gibt, wie etwa dem Agrarmarktstrukturgesetz oder dem Lieferkettengesetz?
Fiedler: Nicht zu vergessen das AgrarOLkG (Anm. d. Red.: Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich), das seit vergangenem Jahr die krassesten unfairen Handelspraktiken verbietet! All diese Gesetze, die einen klaren Rah-
men setzen, sind ungeheuer wichtig. Aber Gesetze können nur bestimmte unfaire Praktiken verbieten. Um ein faires Miteinander zu erreichen, braucht es darüber hinaus auch einen positiven Ansatz. Und den verfolgt die FÖM, indem wir das direkte Gespräch mit den Handelsunternehmen suchen.
Wie sieht dieser positive Ansatz aus?
Fiedler: Als Grundlage haben wir ein Leitbild für faire Handelsbeziehungen entwickelt. Das Leitbild formuliert fünf grundlegende Handelspraktiken für einen fairen Umgang im Handelsgeschäft und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Damit sind wir auf die großen Handelshäuser zugegangen und haben sie gefragt, ob sie sich zu diesen fairen Handelspraktiken bekennen wollen. Wir hatten mit einem langen Prozess gerechnet und waren dann doch erstaunt, wie schnell wir erste Zusagen hatten.
Welche Unternehmen haben die Absichtserklärung schon unterzeichnet?
Reese: Ich freue mich sagen zu können, dass die beiden Erstunterzeichner Partner der Naturland Zeichen GmbH sind, nämlich Aldi Süd und Nord sowie die Rewe Group mit Penny. An anderen sind wir dran.
AUS DEM NATURLAND | 7
Foto: Angelika Zinzow

„Wir wollen in einen konstruktiven und zielgerichteten Dialog mit den Handelsunternehmen treten.“
Ich habe auf der Grünen Woche mit Rewe und Aldi die ersten Jahresgespräche geführt,

delshäusern gibt, können wir Probleme sehr direkt ohne die Sorge, dass uns morgen oder in einem Jahr der Auftrag storniert wird. Zugleich können wir die Vielfalt der gesamten Bio- und Fair-Branche einbringen. Das wirkt ebenfalls positiv auf die Gespräche.
Kann die FÖM auch auf Erzeugerpreise Einfluss nehmen?
Reese: Sicher nicht direkt. Bessere Erzeugerpreise sind selbst gesetzlich kaum zu erzwingen. Es gibt dennoch verschiedene Wege, daran zu arbeiten. Schon 2010 haben wir Naturland Fair eingeführt, um mehr Verarbeitungsunternehmen in den Fairen Handel einzubeziehen, auch regional. Im vergangenen Jahr haben wir zusammen mit Bioland zum ersten Mal einen gemeinsamen Orientierungspreis Milch veröffentlicht. Und aktuell wird viel über den Artikel 210a im Kartellverbot der EU diskutiert, der für besondere Nachhaltigkeitsleistungen gemein-
same Preisabsprachen erlaubt, um diese besonderen Leistungen in Wert zu setzen. Die Grundlage ist aber auch hier: Freiwilligkeit.
Fiedler: Zudem stehen die Verarbeitungsunternehmen häufig selbst unter Druck durch den Handel. Und dabei geht es gar nicht immer nur um Preise. Druck durch unfaire Handelspraktiken kann auf vielfältige Weise ausgeübt werden.
Gibt es da Beispiele?
Reese: Nach dem, was uns Hersteller berichten, ist die Palette sehr breit, wobei vieles inzwischen auch schon gesetzlich verboten ist. Aber Probleme können auch ganz anders entstehen. Zum Beispiel sind ökologisch und fair produzierte Rohstoffe eben nicht immer so unbegrenzt verfügbar wie im konventionellen Bereich. Das muss der Handel bei seinen Ausschreibungen berücksichtigen, aber das ist den Einkäufern oft gar nicht bewusst. Auch mangelnde Planbarkeit ist ein Problem, wenn eine kurzfristige Ausschreibung auf die andere folgt oder Ausschreibungen über Erntetermine hinausgehen.
Für die Verarbeitungsunternehmen kann das je nach Menge erhebliche Risiken bedeuten.
8 | AUS DEM NATURLAND

Wie kann die FÖM dazu beitragen, dass so etwas nicht mehr vorkommt?
Fiedler: Hier kommt der Meldestelle eine entscheidende Bedeutung zu. Nur, wenn wir konkrete Beispiele haben, können wir etwas erreichen. Es hilft ja nichts, wenn ich im Jahresgespräch mit einem Handelsunternehmen eines von Steffens genannten Beispiele anspreche mit dem Zusatz: „Also, naja, wir vermuten zumindest, dass das so ist, ein konkretes Beispiel habe ich allerdings nicht.“ Das ist nicht überzeugend. Deshalb haben wir die Meldestelle eingerichtet.
Wie funktioniert die Meldestelle?
Reese: An die Meldestelle können sich alle Lieferanten wenden, die unfaire Handelspraktiken erleben. Voraussetzung ist natürlich, dass das Handelsunternehmen die Absichtserklärung der FÖM unterzeichnet hat. Wir prüfen dann zunächst, ob es sich um einen Verstoß nach dem AgrarOLkG handelt oder die FÖM-Grundsätze verletzt wurden. Es geht uns aber nicht nur um harte Verstöße, sondern um alles, was als unfair erfahren wird, als Grundlage für einen konstruktiven und zielgerichteten Dialog mit den Handelsunternehmen.
Fiedler: Je breiter das Bild, das wir durch die Meldungen gewinnen, desto erfolgreicher der Dialog. Unsere Jahresgespräche sind dann gut und wirkungsvoll, wenn wir so konkret wie möglich werden können. Dabei sichern wir selbstverständlich Anonymität zu. Natürlich wäre es ideal, wenn wir keine Meldungen bekommen würden und es keine unfairen Handelspraktiken mehr gäbe. Deshalb kann ich alle Naturland-Partner nur dazu aufrufen, sich bei uns zu melden, wenn sie sich unfair behandelt fühlen.
KONTAKTDATEN DER MELDESTELLE:
Forum Fairer Handel e.V. (FFH):
Tel.: 0151/57 98 99 71
E-Mail an: meldung@allianz-foem.de
Web: www.allianz-foem.de









GUT BROCKHOF, ERWITTE / LIPPSTADT (NRW) DLG-FELDTAGE.DE 11. – 13. JUNI 2024 UNTERSTÜTZT DURCH Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen MEHR ERFAHREN PFLANZENBAU OUT OF THE JETZT TICKETS SICHERN! ANZEIGEN
Das Naturland
in Bildern
Mitte Mai waren ereignisreiche Tage für Naturland. Während im Kloster Irsee im Allgäu das Naturland-Parlament – die Delegiertenversammlung – tagte, wurde 500 Kilometer östlich – in der Wachau – das 2000. österreichische Naturland-Mitglied gefeiert.

1
2

4

3





6
1 Am 15. und 16. Mai fand die Delegiertenversammlung in Kloster Irsee statt. Neben etlichen Berichten und Richtlinienänderungen verabschiedeten die Delegierten auch die Neufassung der Naturland Fair Richtlinie.
2 Mit gerade mal zehn Monaten der mit Abstand jüngste Teilnehmer war der kleine Jennepaal (friesisch für Johann Peter). Der Bio-Nachwuchs kam mit Mama Hannah Carstens, die ihre Premiere als neue Delegierte für Schleswig-Holstein feierte. Papa Thies Espermüller kam als Babysitter mit, ist aber auch als Mitglied im Fachausschuss Rind engagiert.
3 Wie sich geschlossene Kreislaufanlagen von offenen Systemen der Aquakultur unterscheiden und inwiefern das zu Bio passt? Dazu bot Dr. Fabian Schäfer vom Leibnitz-Institut eine wissenschaftliche Einordnung.
4 Das Weingut Nikolaihof in der Wachau ist das 2000. österreichische Naturland-Mitglied. Für Präsidiumsmitglied Frauke Weissang ein guter Grund, die Naturland-Hoftafel persönlich an Nikolaus Saahs und Katharina Salzgeber (re) zu überreichen. Berater Dr. Wolfgang Patzwahl (li) und Delegierter Zeno Piatti schlossen sich den Willkommensgrüßen an.
5 Ägypten, Indien, Italien, Peru, Thailand, Türkei, Uganda: Die Mitglieder des World Advisory Board haben den weitesten Weg. Sie nutzten die Delegiertenversammlung, um sich schon einen Tag zuvor in der Naturland-Zentrale zu Beratungen zu treffen.
6 Ein schwerer Wanderunfall mit anschließender Operation nur wenige Tage vor der Delegiertenversammlung war für Präsidiumsmitglied Marion Bohner kein Grund, zu Hause den Gipsfuß hochzulegen. Das Quietschen ihres schlecht geölten Rollstuhls sorgte für einiges Schmunzeln.
POLITIK | 11 BILDERBUCH 5
Fotos: Sabine
Bielmeier,
Sonja Straß

KOMMENTAR
Von Hans Bartelme, Naturland-Vizepräsident
Am 9. Juni wird in Europa gewählt. Die EU-Wahl vor fünf Jahren war der Startschuss für eine gerade im Bereich der Landwirtschaft durchaus ambitionierte politische Agenda: „Farm to Fork“ und Biodiversitätsstrategie. Doch davon ist wenig geblieben, stattdessen erleben wir einen umweltpolitischen Rollback: Unter dem Eindruck der Bauernproteste kassieren EU-Kommission und Parlament vieles von dem, was erreicht wurde, kurz vor der Wahl wieder ein – quasi aus Angst vor der eigenen Courage. Günstigen Agrardiesel gibt es trotzdem keinen, dafür aber Pestizide und Gentechnik. Bleibt zu hoffen, dass nach dem 9. Juni gerade im konservativen Lager der eine oder die andere EU-Abgeordnete den Mut wiederfindet. Denn dann steht die notwendige Neuordnung der GAP ab 2028 auf der Tagesordnung. Und da ist mit „allen wohl und keinem wehe“ nichts zu erreichen.
NATURLAND UND BIOLAND: RICHTLINIEN ANGLEICHEN
Naturland und Bioland wollen ihre Richtlinien im Bereich Kartoffelanbau angleichen. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern beider Verbände hat im März die Arbeit aufgenommen. Für Naturland leitet Präsidiumsmitglied Marion Bohner die Gespräche: „Wir nehmen die aktuelle Situation auf dem Kartoffelmarkt zum Anlass, um gemeinsam auszuloten, wie eine Harmonisierung der Richtlinien zu einem einfacheren Rohwarenaustausch beitragen kann.“
Sollte dies bei den Kartoffeln erfolgreich verlaufen, sei im nächsten Schritt auch eine Harmonisierung etwa beim Feldgemüse denkbar. „Voraussetzung ist, dass wir ehrlich aufeinander zugehen, um die beste Lösung im Sinne der Mitglieder beider Verbände zu finden. Dann können wir auch die Schwierigkeiten überwinden, die sich aus der teils unterschiedlichen Richtliniensystematik ergeben“, unterstreicht Bohner.
„HANS HOHENESTER PREIS“ ERSTMALS VERLIEHEN
Der 2017 verstorbene langjährige Naturland-Präsident Hans Hohenester hat den Öko-Landbau in Bayern geprägt wie kein Zweiter. Mit einer neu geschaffenen Auszeichnung für den ökologischen Nachwuchs ehrt die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ) fortan sein Andenken. Im Rahmen der Abschlussfeier an der Öko-Fachschule im niederbayerischen Landshut-Schönbrunn wurde Ende März erstmals der „Hans Hohenester Preis“ für herausragende Meister arbeitsprojekte der frisch gebackenen Öko-Landwirt schaftsmeister und -meis terinnen verliehen. Erster Preisträger ist Andreas Bren ner vom Bioland-Betrieb Lautenhof mit seinem Pro jekt „100 Prozent Biofütte rung in der Ferkelaufzucht“.
Die LVÖ will die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung künftig einmal jährlich für
ein herausragendes Meisterarbeitsprojekt an den Öko-Fachschulen in Landshut-Schönbrunn und Weilheim vergeben. Als langjähriger Vorsitzender der LVÖ hatte Hohenester sich unter anderem auch besonders für das Thema Bildung im ÖkoLandbau eingesetzt.
Auf dem Bild: Maria Hohenester (sen.); Michael Lobinger, Schulleiter Öko-Fachschule Landshut; Andreas Brenner, Preisträger; Josef Bauer, stv. Vorsitzender LVÖ Bayern

12 | POLITIK
NATURLAND FAIR-RICHTLINIE KOMPLETT ÜBERARBEITET
Knapp 15 Jahre nach der Einführung der Zusatzzertifizierung Naturland Fair hat Naturland die entsprechende Richtlinie komplett überarbeitet. Die Naturland Fair Richtlinie war in ihrer ursprünglichen Form 2009 von der Naturland-Delegiertenversammlung verabschiedet worden. Die grundlegende Revision war unter anderem notwendig geworden, weil die bisherige Richtlinie den aktuellen Debatten- und Entwicklungsstand beim Thema Fairer Handel nicht mehr ausreichend abgebildet hatte.
Ziel der Revision war es deshalb, Naturland Fair mit seiner einzigartigen Verbindung aus Öko & Fair in Nord & Süd auch in Zukunft einen Spitzenplatz im Wettbewerb der Fair-Zertifizie-
rungen zu sichern. An der Überarbeitung war auch das World Advisory Board beteiligt. Auf der Delegiertenversammlung am 15. und 16. Mai in Kloster Irsee wurde die Neufassung der Richtlinie einstimmig verabschiedet.
Die neue Richtlinie fasst die bislang sechs Naturland FairGrundsätze in nunmehr vier Punkten zusammen:
• Einsatz für Gesellschaft und Umwelt,
• Verlässlichkeit und Solidarität,
• Faire Preise sowie
• Transparenz.
Weiterhin werden die konkreten Anforderungen präzisiert und nach den Zielgruppen Erzeuger, Verarbeiter und Händler unterteilt. So können künftig auch
BUNDESGERICHTSHOF: FOLGEN FÜR LANDWIRTE
Seit kurzem fordern etliche Händler und Mühlen von ihren Lieferanten eine Erklärung, in welcher der Anbau von Z-Saatgut oder der rechtmäßige Nachbau bestätigt wird. Darin ent halten ist auch der Hinweis auf
eine Schadensersatzpflicht bei Zuwiderhandlung.
Hintergrund dafür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Dieser kommt darin zum Schluss, dass ein Händler von Erntegut eine

Eigenmarken von Handelsketten Naturland Fair zertifiziert werden, sofern die Handelskette 100 Prozent Bio verkauft. Zudem werden neue Indikatoren eingeführt, wie etwa die Zahlung existenzsichernder Löhne und Einkommen, was – im Gegensatz zum Konzept der FairPrämie – erst in jüngerer Zeit ins Zentrum der Fair-Debatten gerückt ist.
AUTOR
Markus Fadl
Pressesprecher Naturland e.V. m.fadl@naturland.de
nicht näher bestimmte „Erkundigungspflicht“ hat. Diese soll sicherstellen, dass der Anbau ohne Verstöße gegen das Sortenschutzrecht erfolgt ist.
Mit diesem Urteil wird die Einhaltung des Sortenrechts für die gesamte Lieferkette relevant und führt dazu, dass jeder Teil der Lieferkette einen sortenschutzkonformen Anbau sicherzustellen hat.
Autor: Marcus Nürnberger, Beratung für Naturland
POLITIK | 13
Fotos: Naturland / Christian Nusch, LVÖ
Nachhaltigkeit


AUTOR Markus Fadl
Naturland e.V. m.fadl@naturland.de
Auch Bio-Betriebe stehen vor Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit. Diese in Chancen zu verwandeln, ist das Ziel der Naturland-Nachhaltigkeitsstrategie, sagt Sebastian Mittermaier.
14 | AUS DEM NATURLAND honorieren
Sebastian Mittermaier

... ist Geschäftsleiter Politik & Nachhaltigkeit bei Naturland e.V. Er verantwortet gemeinsam mit der Beratung für Naturland und der Naturland Zeichen GmbH die Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie.
Warum braucht Naturland eine Nachhaltigkeitsstrategie?
Die gesellschaftlichen Anforderungen an eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung nehmen zu. Der Öko-Landbau ist und bleibt zwar die nachhaltigste Form der Landwirtschaft. Trotzdem müssen wir unser Profil schärfen, um diesen Anspruch gegen die wachsende Zahl anderer Angebote zu verteidigen. Zugleich liegt darin eine große Chance. Denn der Handel ist unter Druck, sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit glaubwürdig zu belegen. Umweltverbände nutzen das längst und bieten entsprechende Programme an. Das können wir auch – und zwar so, dass unsere Mitglieder auch etwas davon haben, weil ihre Leistungen anerkannt und honoriert werden.
Auf der Delegiertenversammlung im Mai 2024 ist die Strategie nun öffentlich präsentiert worden. Wie war der Weg dorthin?
Der Weg begann mit der Naturland-Gesamtstrategie, die 2020 vom Präsidium bestätigt wurde. Einer der sechs kernstrategischen Ansätze darin lautet: „Naturland als relevanten Nachhaltigkeitsakteur positionieren für Mitglieder, Partner und Gesellschaft“. Um das umzusetzen und Naturland zu einem umfassenden Nachhaltigkeits-Akteur zu entwickeln, war zunächst einige Vorarbeit notwendig.
Das macht man nicht mal so nebenher. Wir haben also begonnen, ein Team für Nachhaltigkeit aufzubauen und parallel schon die ersten Ideen und Konzepte entwickelt.
Und jetzt liegt die fertige Nachhaltigkeitsstrategie vor und es kann losgehen?
Wir sind schon längst gestartet! Die Gefahr bei solchen Strategieprozessen ist, dass man zuerst hochfliegende theoretische Konzepte schreibt, die dann an der Praxis scheitern. Um das zu vermeiden, wollten wir von Anfang an, dass Strategieentwicklung und Umsetzung quasi Hand in Hand gehen.
Die Nachhaltigkeitsstrategie, die wir nun den Delegierten und der Öffentlichkeit präsentiert haben, ist deshalb auch kein finaler Masterplan mit guten Absichten für die Zukunft, sondern eher ein Zwischenbericht, wo wir gerade stehen – nämlich bereits mitten in der Umsetzung!
Was zeichnet die Naturland-Nachhaltigkeitsstrategie aus?
Wir gehen die Nachhaltigkeit im Dreiklang von Herausforderungen, Leistungen und Chancen an: Vor welche Herausforderungen steht die Landwirtschaft angesichts von Klimawandel und Artensterben? Welchen Beitrag zur Lösung leisten Naturland-Betriebe schon heute? Und wie können wir
AUS DEM NATURLAND | 15
Fotos: Naturland / Sabine Bielmeier


Auf der Delegiertenversammlung im Mai stellten Sebastian Mittermaier (li.) und Wilhelm Heilmann (Geschäftsführer Naturland Zeichen GmbH) die Naturland-Nachhaltigkeitsstrategie vor.
Wirtschaft und Gesellschaft so einbinden, dass aus den Herausforderungen Chancen werden – für unsere Mitgliedsbetriebe und für die Umwelt?
Wie übersetzt man diesen Dreiklang in konkrete Programme und Angebote?
Der Dreiklang spiegelt sich im dreigliedrigen Aufbau der Programme und ihrer Ziele wider. Erstens wollen wir die Nachhaltigkeitsleistungen, welche die Naturland-Betriebe schon heute erbringen, digital erfassen und dadurch sichtbar machen. Zweitens geht es darum, die Betriebe durch Fortbildung und Beratung dabei zu unterstützen, zusätzliche Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Und drittens sollen bestimmte Nachhaltigkeitsleistungen auch honoriert werden. Möglich wird das durch die Naturland Zeichen GmbH, die über Förderprogramme Handel und Verarbeitung einbindet.
Du sagst, die Umsetzung hat bereits begonnen?
Das „Förderprogramm Artenvielfalt auf NaturlandHöfen“ setzt genau diesen Dreiklang auf exemplarische Weise um. Der Programmstart im März mit der Freischaltung der eigens programmierten Förderplattform war ein Riesenerfolg. Wir wuss-
ten ja vorher nicht, ob die Betriebe das Angebot überhaupt annehmen würden. Aber das Interesse war überwältigend! Schon in der ersten Förderrunde haben mehr als 100 Naturland-Betriebe in Deutschland und Österreich Maßnahmen online gebucht. Mit den dabei gemachten Erfahrungen entwickeln wir das System permanent weiter. Bei der zweiten Förderrunde 2025 werden schon deutlich mehr Betriebe zum Zuge kommen (siehe S. 44-45).
Sind auch andere Programme geplant, etwa zum Klimaschutz?
Der Erfolg mit dem „Förderprogramm Artenvielfalt“ ist auch deshalb so wichtig, weil wir damit unseren Ansatz in der Praxis erproben. Später wollen wir nach diesem Modell dann auch andere Nachhaltigkeitsleistungen honorieren können, wie zum Beispiel Klimaschutz oder Grundwasserschutz. Wir planen dazu bereits Gespräche mit weiteren Partnern aus der Wirtschaft. Parallel sind wir dabei, ein neues Pilotprojekt zur Nachhaltigkeit im Weinbau zu entwickeln. Und mittelfristig wollen wir auch Angebote für unsere internationalen Mitgliedsbetriebe entwickeln.
16 | AUS DEM NATURLAND
AUS DER KONTROLLE
Naturland-Betriebe halten die EU-Bio-Verordnung und Naturland-Richtlinien ein. Gemeinsam mit den Kontrollstellen Gesellschaft für Ressourcenschutz und Austria Bio Garantie beantworten wir hier Ihre Fragen.
Ich werde dieses Jahr zu wenig Grundfutter haben. Mein konventioneller Nachbar verkauft Silage und Heu. Darf ich es kaufen? Gibt es Ausnahmen?
Nein, der Zukauf von Silage oder konventionellem Heu ist nicht möglich. Das fehlende Grundfutter muss von einem anderen Bio-Betrieb zugekauft werden. Lediglich in Katastrophenfällen, z. B. Extremwetterlagen, können die Kontrollbehörden abweichende Regelungen treffen. In milchliefernden Betrieben muss selbst in Katastrophenfällen vor Zukauf mit der Molkerei abgeklärt werden, ob diese Bio-Milch überhaupt angenommen wird. Dies ist meist nicht der Fall.


Als Naturland-Ackerbaubetrieb möchte ich mit einem Bio-Geflügelhalter eine Futter-Mist Kooperation eingehen. Er ist jedoch Mitglied eines anderen Öko-Verbands. Ist das möglich?
Die Zusammenarbeit mit einem Tierhalter eines anderen Öko-Verbandes oder einem verbandslosen Öko-Tierhalter ist immer möglich, auch in Form einer Futter-Mist-Kooperation. Entscheidend ist zunächst, ob der Geflügelhalter die Tierbesatzgrenzen der EU-Öko-VO einhält oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, muss mindestens die Menge an Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft abgegeben werden, die 170 kg Stickstoff je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche überschreitet – und dies muss auch vertraglich geregelt werden. Allerdings wird der Mist aus dieser Form der Zusammenarbeit für den Naturland-Ackerbaubetrieb als „extern“ bewertet; er fällt damit unter die Nährstoff-Inputgrenze für organische Dünger von 0,5 DE/ha und Jahr.
Unter welchen Bedingungen kann ich Propylenglykol für Milchkühe einsetzen?
Durch die EU-Durchführungsverordnung 2023/2229 wurde Propylenglykol als Futtermittel für besondere Ernährungszwecke in die Positivliste der Futtermittel aufgenommen. Hiernach darf es „für einzelne betroffene Tiere und für einen begrenzten Zeitraum“ zur Verringerung der Ketosegefahr eingesetzt werden. Allerdings ist Propylenglykol aktuell nicht nach Naturland-Richtlinien in Anhang 3 als Futtermittel zugelassen. Bei Bedarf muss der Bestandstierarzt das Ketoserisiko des Tieres feststellen und die Gabe von Propylenglykol verschreiben.
Haben Sie Fragen
ZUR BIO-KONTROLLE
Dann schicken Sie uns diese an redaktion@ naturland-beratung.de
AUS DEM NATURLAND | 17
Fotos: Naturland / Sebastian Stiphout, Lohmann Breeders
DIE MEISTEN KLICKS
Sie möchten in Kürze erfahren, was im ÖkoLandbau und in der Naturland-Welt gerade passiert oder suchen Tipps bei aktuellen Problemen? Mit den Push-Mitteilungen, Chat-Foren und dem Terminkalender der Naturland-App bleiben Sie immer auf demLaufenden. Überzeugen Sie sich selbst: Wir stellen Ihnen hier drei der am häufigstengelesenen Beiträge in der Naturland-App vor.
Hier
gehts zur NATURLANDApp


1 2 3
Staubbäder im Wintergarten
veröffentlicht am 28.02.2024
Naturland-Geflügel muss ganzjährig im Wintergarten sandund staubbaden können. Er ist mit trockener Einstreu versehen, bietet neben Tageslicht Schutz vor Wind, Nässe, Nagern und Beutegreifern. Zur Parasitenprophylaxe sollten die Staubbäder mit Sand, Gesteinsmehl oder Silicatstaub aufgefüllt werden. So können äußere Parasiten das Geflügel nur schwer befallen.

Neue BioFotodatenbank
veröffentlicht am 11.03.2024
In der von Naturland aufgebauten Bio-Fotodatenbank finden Sie ab sofort zahlreiche druckfähige Bilder aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Die Online-Fotodatenbank https:// being-organic-in-eu-bio.px. media ist Teil der gleichnamigen EU-Info-Kampagne. Die Bilder können frei verwendet werden. Als Bildquelle geben Sie bitte „Being Organic“ an.

Schwellungen bei Schweinen
veröffentlicht am 23.02.2024
Das Liegen auf harten Böden oder Spalten kann Schwellungen an Gelenken oder Klauen verursachen. Gegenmaßnahme: eine ausreichend eingestreute und trockene Liegefläche sowie ein ausreichend großer Liegebereich für alle Schweine. Auch Infektionen können Schwellungen auslösen. Mögliche Begleiterscheinungen sind Fieber, Appetitlosigkeit, Apathie und Lahmheit.
DIE KOMPLETTEN ARTIKEL FINDEN SIE IN DER NATURLAND-APP
18 | AUS DEM NATURLAND
Fotos:
Naturland / Sebastian
Stiphout, Being Organic in EU
Erprobte Produkte preiswert und gut!




Säen Hacken Striegeln und noch mehr! Cameleon NG 3.00 m fahren 6-8-9 m Arbeiten



3 m säen & 6 m hacken – Das geht nur mit
3 m säen & 6 m hacken – Das geht nur mit garford TwinShift
PRÄZISER HACKEN 3 m säen & 6 m hacken – Das geht nur mit garford TwinShift
SCHNELLER UND



SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN
SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN

Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung
Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite
Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung 0160 / 91794533 elmar.reuter@garford.com www.garford.com
0160 / 91794533 elmar.reuter@garford.com www.garford.com
0160 / 91794533 elmar.reuter@garford.com www.garford.com


Reduzieren von Beikräutern während des Wachstums der Hauptfrucht ohne Pestizide www.lyckegard.com Christian Puls +49 175 59 42 513





Größe 78 x 58 mm
ANZEIGEN | 19

ZWISCHENFRUCHT
In wenigen Wochen werden Zwischenfrüchte gesät, besonders im Öko-Landbau haben sie große Bedeutung. Grund genug, sich auf den nächsten Seiten intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
20 | ZWISCHENFRUCHT
Die Mischung
macht‘s
Sie fördern Humusaufbau und biologische Aktivität im Boden. Sie unterdrücken Unkräuter, konservieren Nährstoffe und schützen vor Erosion. Dies und vieles mehr machen Zwischenfrüchte. Für Naturland-Bauer Matthias Hummelsberger und Berater Hubert Weigand sind sie daher ein wichtiger Baustein der Fruchtfolge.

Mit Spaten und Sonde bewaffnet streifen Matthias Hummelsberger und Hubert Weigand durchs Feld – den Blick prüfend nach unten gerichtet. „Dass sich der Bestand trotz des starken Regens nach der Saat so gut entwickelt hat, ist schon bemerkenswert“, murmelt der Berater. Matthias Hummelsberger nickt. Der Naturland-Bauer hatte im Vorjahr nach der Getreideernte die Zwischenfrucht-Mischung MaizePro Organic angebaut, als Folgekultur soll nun bald Mais als Futter für den 65-köpfigen Milchviehbestand gesät werden*. Von den 78 Hektar, die Hummelsberger bewirtschaftet, stehen auf knapp 40 Hektar Ackerkulturen. In seiner Fruchtfolge wechseln sich Stickstoff-Zehrer und Stickstoff-Mehrer ab:
1. Mais
2. Sommer-Ackerbohne
3. Winterweizen
4. Kleegras
5. Triticale
6. Winterharte Zwischenfrucht
Winterharte Zwischenfrucht
Die vorwiegend winterharte Zwischenfruchtmischung vor Mais besteht aus Felderbse, Öllein, Phacelia, Winterwicke, Inkarnatklee, Sorghum, Leindotter, Sonnenblume, Sparriger Klee und Winterroggen. An den winterharten Komponenten schätzt Hummelsberger die gute Unkrautunterdrückung im Frühjahr: „Roggen, Wicke und Inkarnatklee machen im Frühjahr schnell zu.“ Auch die bessere Nährstoffspeicherung winterharter Zwischenfruchtarten ist für den Niederbayer ein Argument. In diese Kerbe schlägt auch Hubert Weigand (Beratung für Naturland): „Mit winterharten Zwischenfrüchten werden Nährstoffe – vor allem Stickstoff – konserviert. Mit der Zersetzung der organischen Masse stehen sie dann der Folgekultur zur Verfügung.“ Aber es ist nicht nur die Nährstoffkonservierung: „Bei dieser Mischung kommt noch hinzu, dass wir mit Luftstickstoff düngen“, ergänzt der Berater und zeigt auf die stickstoffsammelnden Rhizobien der Inkarnatkleewurzel. Hummelsbergers Mischung hat einen Leguminosenanteil von 40 %.
Der Artikel wurde im April verfasst.
ZWISCHENFRUCHT | 21

AUTOR
Roman Goldberger
Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de

Bodenverbessernde Wirkung
„Mit
winterharten Zwischenfrüchten werden Nährstoffe konserviert.“
Den wesentlichsten Vorteil einer Zwischenfrucht sieht Hubert Weigand aber in der bodenverbessernden Wirkung: „Die oberirdische organische Masse sowie die Wurzelausscheidungen fördern das Bodenleben. Die sogenannte grüne Brücke schützt vor Erosion und die Wurzeln der unterschiedlichen Mischungspartner sorgen für eine gute Bodenstruktur.“ Genau in der Kombination unterschiedlicher Eigenschaften sieht Weigand den Vorteil von Mischungen. Pflanzengesellschaften ergänzen sich in der Durchwurzelung, können dadurch verschiedene Nährstoffe aufschließen und durch die Etagenverteilung der Blätter das Sonnenlicht effizi-
enter nutzen. „Außerdem sind sie eine Absicherung für witterungsbedingte Widrigkeiten. Wenn sich ein Mischungspartner schlechter entwickelt, können das die anderen kompensieren.“ Generell sei aber auch die Begrünung mit einer Einzelkomponente möglich. „Alexandrinerklee ist zum Bespiel für Futterbaubetriebe eine beliebte abfrostende Einzelzwischenfrucht.“
Einarbeitung mit Fräse
Im Frühjahr bringt Matthias Hummelsberger Rindermist auf die Begrünung aus und arbeitet diese flach mit einer Bodenfräse ein. „Der Mist passt gut zum Nährstoffbedarf des Maisbestands“, erklärt
22 | ZWISCHENFRUCHT

Der wesentlichste Vorteil einer Zwischenfrucht ist ihre bodenverbessernde Wirkung. Im Frühjahr arbeitet Matthias Hummelsberger die Begrünung flach mit einer Bodenfräse ein (rechts).

der Bio-Bauer. Um den Rotteprozess vor der Maissaat in Gang zu bringen, versucht Hum melsberger, die Bodenbearbeitung zwei, drei Wochen vorher durchzuführen. Durch das enge C:N-Verhältnis werden die Leguminosen relativ rasch umgesetzt. Für die Bodenfräse spricht laut Hummelsberger, dass damit im Gegensatz zum Pflug kein Luftabschluss erfolgt und ein aerober Rotteprozess ablaufen kann. Unmit telbar vor der Maissaat wird das Feld mit einer Kreiselegge auf Saattiefe bearbeitet.
Mit der Einbettung dieser Zwischenfrucht in seine Fruchtfolge ist Hummelsberger sehr zu frieden. Durchweg gute Maiserträge geben ihm recht. Für Berater Hubert Weigand sind Zwischenfrüchte alternativlos: „Wer nach Ernte der Vorfrucht bis zur Saat der Frühjahrskultur den Boden brach lässt, verschenkt Nährstoffe — und lässt auch alle anderen positiven Wirkun gen liegen.“
Die Knöllchenbakterien an den Wurzeln des Inkarnatklees sind klar zu erkennen.

ZWISCHENFRUCHT | 23
Fotos:
Naturland / Sabine Bielmeier (4),
Matthias Hummelsberger (1)
Das leisten Wurzeln
Wollen Sie Nährstoffe aus dem Unterboden mit Zwischenfrüchten mobilisieren und eine Nitratauswaschung vermeiden?
Oder ist die Strukturbildung im Oberboden das Ziel? Je nach Anspruch stehen Zwischenfruchtarten mit unterschiedlichen Wurzelmerkmalen zur Wahl.

AUTOR
Dr. Roman Kemper
Universität Bonn
Fachgebiet Agrarökologie und Organsicher Landbau
Zwischenfrüchte erfüllen im Ackerbau wichtige Funktionen: Sie mindern Erosion, bilden Bodenstruktur, reduzieren Nitrat-Auswaschung und mobilisieren Nährstoffe. Zudem fördern sie den Erhalt organischer Bodensubstanz. Die Wurzeln der Zwischenfrüchte sind für all diese Aufgaben von zentraler Bedeutung. Da es bisher kaum Informationen über die Wurzelmerkmale gibt, hat die Arbeitsgruppe Agrarökologie und Organischer Landbau der Universität Bonn in den letzten Jahren intensive Untersuchungen zur Durchwurzelung von Zwischenfrüchten auf dem ökologischen Lehr- und Forschungsbetrieb Wiesengut in Hennef durchgeführt. Um dem zunehmenden Trend Richtung Zwischenfrucht-Mischungen gerecht zu werden, wurden auch Mischungen hinsichtlich möglicher Vorteile in der Durchwurzelung untersucht.
Wurzeln im Ober- und Unterboden
In einem ersten Schritt wurde zunächst ein Screening zu Wurzeleigenschaften von Reinsaaten an einer Profilwand durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Zur genaueren Erfassung wurden im Herbst Bodenziegel (sogenannte Bodenmonolithe) an der Profilwand entnommen. Als Maß für die Durchwurzelungsintensität wurde unter anderem die Wurzellänge pro Bodenvolumen in cm pro cm³ (= Wurzellängendichte) untersucht. Grünroggen fiel hier mit einer besonders hohen Wurzellängendichte im Oberboden auf. Ölrettich, Phacelia, Winterrübsen und Mischungen mit Ölrettich zeigten hingegen im Unterboden eine höhere Durchwurzelungsintensität (siehe Abb. 1). Eine insgesamt geringe Wurzellängendichte zeigte die Blaue Lupine. Sie punktete hingegen mit einem großen Durchmesser der Pfahlwurzel, hatte aber weniger Seitenwurzeln.
Zwischenfrucht-Mischungen
Mischungen verursachten positive Durchwurzelungseffekte in tieferen Bodenschichten. Insbesondere in Mischungen mit Ölrettich wurden höhere Wurzellängen- und -massendichten im Unterboden
Abb.1.: Wurzellängendichte* von ZwischenfruchtReinsaaten und -Mischungen im Herbst
Wurzellängendichte [cm/cm3]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100

Grünroggen
Sandhafer
Inkarnatklee
Lupine
Lupine-Grünroggen
Winterrübsen
Ölrettich
Ölrettich-Grünroggen
Phacelia
*ermittelt mit der Monolithmethode am Standort Wiesengut in Hennef (Mittelwerte der Jahre 2018 und 2019)
im Vergleich zum Mittel der Reinsaaten erreicht. Trotz reduziertem Saatanteil in der Mischung kann der Ölrettich den unteren Wurzelraum sehr gut erschließen. Über das gesamte Bodenprofil zeigten sich jedoch kaum positive Effekte hinsichtlich der Durchwurzelung durch Mischungen (Abb. 2). Mit zunehmender Tiefe nahm der Wurzelanteil der tiefwurzelnden Partner Lupine und Ölrettich zu. Im Gegenzug nahm der Anteil an Grünroggenwurzeln mit der Tiefe stark ab. Über die Tiefen aufsummiert erreichte der konkurrenzstärkere Partner in den Mischungen den höheren Anteil an der gesamten Wurzelmasse (Grünroggen gegenüber Lupine; Ölrettich gegenüber Grünroggen und Inkarnatklee). Somit dominierte die konkurrenzstärkere Art in den Mischungen sowohl die Spross- als auch die Wurzelmasse. Im Vergleich zum Spross waren die Wurzelmassen deutlich geringer. Die höchste Wurzelmasse erreichte der Grünroggen mit max. 1 t/ha Trockenmasse. Im Spross erreichten abfrierende Arten wie Ölrettich, Sandhafer und Phacelia im Herbst höhere Sprossmassen (bis zu 5 t/ha Trockenmasse) und damit höhere Stickstoffaufnahmen als die winterharten Arten Grünroggen und Winterrübsen.
Tab. 1: Übersicht verschiedener Wurzelmerkmale der untersuchten Zwischenfrucht-Reinsaaten
Sandhafer Inkarnatklee Lupine Winterrübsen Ölrettich Phacelia viele Feinwurzeln
+, + +: stark bzw. sehr stark; 0: mittel; -, - -: schwach bzw. sehr schwach
ZWISCHENFRUCHT | 25
++ 0 + - - -
++ 0 + 0 0 -
Winter + - + - 0 -Pfahlwurzler - - 0 ++ + + + Intensive Unterbodendurchwurzelung 0 - - ++ ++ + Bioporen-Nutzung - 0 - - + + +
Grünroggen
Intensive Oberbodendurchwurzelung
Zunahme an Wurzellänge über
Kemper
Quelle: Kemper Quelle:

Zur Erforschung der Zwischenfruchtwurzeln wurden Bodenziegel (sogenannte Bodenmonolithe) im Parzellenversuch entnommen.
Unterschiedliche Eigenschaften
Stellt man sich die Frage, was Zwischenfruchtwurzeln leisten sollen, so sind folgende vier Funktionen zentral: Strukturbildung im Oberboden, Nährstoffaufnahme aus dem Unterboden, Kohlenstoffspeicherung und Bildung großlumiger Bioporen. Bioporen sind runde, vertikal verlaufende Poren, die Gasaustausch, Wasserinfiltration und Unterbodendurchwurzelung erleichtern. Welche Wurzeleigenschaften einen Hinweis auf diese Funktionen geben
Abb. 2: Spross- und Wurzelmasse von Zwischenfrüchten im Herbst vor dem ersten Frost am Standort Wiesengut in Hennef (Mittelwerte der Jahre 2018 und 2019)

können und wie hoch die Funktion anhand der erhobenen Wurzeleigenschaften ist, zeigt Tabelle 2.
Oberbodenstruktur durch Gräser
Hohes Potenzial zu Strukturierung des Oberbodens und Erosionsminderung haben die Gräser Sandhafer und Grünroggen mit ihrer hohen Wurzellängendichte. Der Vergleich mit mehrjährig angebautem Futtergras (oder Mischungen) zeigt jedoch, dass die Durchwurzelungsintensität von Zwischenfrüchten im Oberboden nach nur wenigen Monaten Vegetationszeit deutlich geringer ist.
Mobilisierung aus dem Unterboden
Intensive Durchwurzelung des Unterbodens und damit Nährstoffaufnahme aus tieferen Schichten und Minderung von Nitratverlagerung zeigen die tiefwurzelnden Zwischenfruchtarten Ölrettich, Winterrübsen und Phacelia. Ihre Unterboden-Durchwurzelungsintensität erreichte im Vergleich zu den weniger tief wurzelnden Zwischenfruchtarten ähnliche Größenordnungen wie die mehrjährigen Futterpflanzen. Bei dem vorrangigen Ziel des Festhaltens von Nitrat sollte also immer eine tiefwurzelnde Art wie z. B. Ölrettich, Winterrübsen und Phacelia, min-
26 | ZWISCHENFRUCHT
Tr ockenmasse [t/ha] 6 2 1 0 1 2 3 4 5 Grünroggen Ölrettich-GrünroggenPhaceliaLupine-GrünroggenWinterrübsenÖlrettich Lupine SandhaferInkarnatklee
Quelle: Kemper
Tab. 2: Wurzeleigenschaften und mögliche Funktionen im Ackerbausystem von Zwischenfrüchten und mehrjährigem Futterbau
Funktion
Wurzeleigenschaft
Strukturbildung im Oberboden
Wurzellängendichte [cm pro cm3 ] in 0-30
Nährstoffaufnahme aus dem Unterboden/ Minderung von Nitratverlagerung
Kohlenstoffspeicherung Schaffung von Bioporen im Unterboden
destens als Mischungspartner, verwendet werden.
Kohlenstoffspeicherung
Beim Potenzial zur Kohlenstoffspeicherung wurde als Wurzeleigenschaft in der Übersicht die Wurzeltrockenmasse dargestellt. Nicht gemessen wurde die sogenannte Rhizodeposition. Dabei handelt es sich um Wurzelausscheidungen und bereits abgestorbene Wurzeln. Die Rhizodeposition kann jedoch einen erheblichen Anteil des Kohlenstoffeintrags durch Pflanzenwurzeln in den Boden ausmachen. Im Vergleich zu Zwischenfrüchten erreichte der mehrjährige Futterbau deutlich höhere Wurzelmassen. Allerdings stehen diese Kulturen auch über eine längere Zeit auf dem Acker. Entscheidend ist aber auch, in welcher Tiefe der Kohlenstoff eingebracht wird, da dieser in Tiefen unterhalb des Bearbeitungshorizonts eine höhere Verweildauer im Boden hat. Hier punkten wieder die Tiefwurzler.
Mehrjährige Arten schaffen Bioporen
Bis auf die Blaue Lupine schaffen es die Zwischenfrüchte nicht, großlumige Bioporen unterhalb des Bearbeitungshorizontes zu generieren. Die Lupine
erreicht jedoch deutlich geringere Werte als mehrjährige Arten wie z.B. Luzerne. Mehrjährige Arten investieren mehr in die Wurzel als Reserveorgan und erreichen so auch dickere Wurzeln, die großlumige Bioporen bilden können.
Was braucht der Acker?
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Zwischenfruchtarten unterschiedliche Wurzelmerkmale aufweisen und damit auch die Funktionen der Wurzeln unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Daher ist es wichtig, die Zwischenfruchtart nach der Funktion auszuwählen, die für die entsprechende Situation auf dem Acker besonders wichtig ist. Dabei sind weitere, hier nicht untersuchte Funktionen wie Unkrautunterdrückung und das Unterbrechen von Krankheitszyklen zu beachten. Der Vergleich von Reinsaaten und Mischungen zeigte, dass die Mischungen sich im Wurzelbild nicht allzu sehr von der stärksten Einzelkomponente unterschieden. Verglichen mit dem mehrjährigen Futterbau zeigten die Zwischenfrüchte eine deutlich geringe Durchwurzelungsintensität. Uns muss klar sein, dass wir von den Wurzeln der Zwischenfrüchte mit einer wesentlich kürzeren Anbaudauer die Funktionen von Kleeoder Luzernegraswurzeln nicht erwarten dürfen.
ZWISCHENFRUCHT | 27
Fotos: Naturland / Sabine Bielmeier, Johannes Siebigteroth
cm Tiefe Wurzellängendichte [cm pro cm³] in 30-90 cm Tiefe Wurzel-Trockenmasse [t pro ha] Wurzelstücke/m2 mit einem Durchmesser > 2 mm in 40-50 cm Tiefe Inkarnatklee 2,3 0,2 0,39 0 Blaue Lupine 1,4 0,3 0,43 22 Grünroggen 7,5 0,6 1,02 9 Sandhafer 5,0 0,5 0,73 0 Ölrettich 3,8 1,1 0,79 5 Winterrübsen 4,8 1,0 0,55 4 Phacelia 4,0 1,1 0,62 1 mehrj. Kleegras 22 0,6 2,85 74 mehrj. Luzerne 12 0,9 6,04 87 - 115 mehrj. Rohrschwingel 20 0,9- 3,2 4,27 6 - 195 mehrj. Wegwarte 9 0,6 - 2,0 3,23 53 - 76
Quelle: Han et al. (2015a), Han et al. (2015b), Perkons (2018), Kemper (2024), Kemper et al. unveröffentlicht

Welche
Zwischenfrucht
passt?
Zwischenfrucht ist nicht gleich Zwischenfrucht. Je nach Stellung in der Fruchtfolge sind die Ansprüche sehr unterschiedlich. Welche Mischungen für welche Fälle passen, lesen Sie in unseren Beispielen.
28 | ZWISCHENFRUCHT
WINTERZWISCHENFRUCHT #1
• Vorfrucht: Getreide oder frühräumende Leguminose (z. B. Ackerbohne, Erbse)
• Nachfrucht: Mais
Zwischen der Ernte von Getreide oder frühräumenden Leguminosen und der Maissaat liegt viel Zeit. Weil Mais als Hackfrucht organische Masse gut umsetzt, hat der Zwischenfruchtanbau hier eine besonders wichtige Bedeutung. Der späte Aussaattermin des Maises im Frühjahr bringt mehrere Vorteile: So ermöglicht er einen bodenschonenden Umbruch von winterharten Zwischenfrüchten, gleichzeitig kann verholzter Aufwuchs von abfrierenden Zwischenfrüchten mit weitem C/N-Verhältnis durch die lange Vegetationsdauer noch mineralisiert und vom Mais aufgenommen werden. Exemplarisch werden hier zwei Beispiele angeführt:
Vorfrucht Ackerbohnen/ Erbsen
Nach einer frühräumenden Leguminose geht es darum, den Stickstoff zu fixieren. Dabei wird auf eine Kombination aus Ausfallleguminosen und Nachsaat gesetzt:
• 80 kg/ha Ackerbohnen bzw. Erbsen: Zur N-Fixierung und für eine gleichmäßige Verteilung über die Fläche bei ungenauer Verteilung der Ausfallleguminosen durch den Mähdrescher
• 30 kg/ha Rauhafer/Kulturhafer: Aufnahme des Reststickstoffs, Förderung der Mykorrhizierung des Maises
• 2 kg/ha Phacelia: Phosphoraufschließend, Förderung der Mykorrhizierung
Durch den Wegfall der Greening-Bedingungen beim Zwischenfruchtanbau kann statt Rauhafer auch Kulturhafer verwendet werden. Bei Kulturhafer sollte aber die Rostgefahr im Herbst beachtet werden, dieser Rost kann sich auch auf andere Getreidearten übertragen. Diese Zwischenfrucht ist sehr kostengünstig, da sie mit Ausnahme der Phacelia aus selbst geernteten Ackerbaukulturen besteht. Trotzdem erfüllt sie vielfältige Anforderungen.
Die Winterhärte hängt davon ab, ob Winterhafer und Winterackerbohnen eingesetzt werden. Der notwendige Anbauabstand zu den nächsten Leguminosen verlängert sich durch die Ausfallackerbohnen bzw. die Nachsaat nicht über den regulären Abstand hinaus.
Vorfrucht Getreide
Nach Getreide ist eine winterharte Mischung in der Lage, bis ins Frühjahr Biomasse zu bilden, den Boden zu schützen und Stickstoff zu fixieren.
• 60 kg/ha Grünroggen: Förderung der Mykorrhizierung des Maises
• 12 kg/ha Inkarnatklee: N-Fixierung
• 18 kg/ha Pannonische Wicke: N-Fixierung, Vorteil gegenüber Winterwicke: nicht samenfest

Mischungen aus winterharten und abfrostenden Zwischenfrüchten können im Frühjahr vor Mais bodenschonend umgebrochen werden.
Je nach Wasserversorgung des Standorts wäre eine Futternutzung vor Mais denkbar.

AUTOR
Julius Heise
Beratung für Naturland j.heise@ naturland-beratung.de
ZWISCHENFRUCHT | 29
Foto: Naturland / bsp media GmbH, Hummelsberger
WINTERZWISCHENFRUCHT #2
• Vorfrucht: Sojabohne
• Nachfrucht: Mais
Die zu erwartende Vegetationszeit für Zwischenfrüchte ist nach der Sojaernte begrenzt. Die Wahl der Zwischenfrüchte hängt nicht zuletzt auch vom Erntezeitpunkt ab. Grundsätzlich ist der Zwischenfruchtbau aber auch hier sinnvoll, weil Sojabohne nach der Ernte noch etwas Stickstoff hinterlässt, der mit der Begrünung gebunden bleibt. Vor allem in frühen Soja-Erntejahren, wenn die Aussaat der Zwischenfrucht bis Ende September möglich ist, kann der Begrünungsvorteil genutzt werden.
Foto: Agrarfoto

Gleichzeitig muss aber darauf geachtet werden, den Zwischenfruchtbestand vor Mais wieder gut umbrechen zu können. Je ebener das Saatbeet der Zwischenfrucht und je beständiger die Witterung beim Umbruch ist, desto einfacher und flacher kann ein „Durchwuchs“ in der Folgefrucht vermieden werden. Gerade in Regionen mit Frühjahrstrockenheit gilt: Je später der Zwischenfrucht-Umbruch durch-

Beratung für Naturland t.klein@ naturland-beratung.de

Bei früher Sojaernte ist der Zwischenfruchtbau sinnvoll, weil Sojabohne noch etwas Stickstoff hinterlässt, der mit der Begrünung gebunden bleibt.
geführt wird, desto mehr Wasser kann der Folgekultur fehlen. In trockenen Regionen sollte diese Zwischenfrucht daher auch kritisch hinterfragt werden.
Überwinternde Zwischenfrüchte sind z.B. Winterrübsen und Winterraps aus der Familie der Kreuzblütler. Die Aussaat sollte bis spätestens Ende September erfolgen, die Saatstärke liegt bei Einzelsaat bei 10-15 kg/ha. Aus der Gattung der Leguminosen kommen Inkarnatklee (Saatstärke ca. 25-35kg/ha) oder Winterwicke, Pannonische Wicke oder Wintererbse (Saatstärke 80160kg/ha) in Betracht. Gerade bei der Wicke ist beim Umbruch besondere Sorgfalt geboten. Aus dem Bereich der Gräser seien Deutsches bzw. Welsches Weidelgras (Saatstärken 35-50kg/ ha) genannt. Vorherig genannte Leguminosen und die beiden
Weidelgräser sollten bis spätestens Ende September in die Erde. Die spätsaatverträglichste Zwischenfrucht kommt ebenfalls aus der Gattung der Gräser: der Grünschnittroggen (Saatstärke ca. 160-200kg/ha), dieser kann noch bis in den Oktober hinein ausgesät werden. Bis auf die Winterwicke sind alle genannten Kulturen auch zur Futternutzung geeignet. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, die Saatstärken anzupassen und eine Mischung aus mehreren Kulturen zu verwenden, um z.B. eine intensivere Durchwurzelung bis zum Frühjahr zu erreichen. Eine fertige Mischung, die aus dem Futterbau bekannt ist, ist „Landsberger Gemenge“, welches zum Beispiel so abgewandelt werden kann:
• 50 kg Grünroggen
• 50 kg Wintererbse
• 10 kg Inkarnatklee.
30 | ZWISCHENFRUCHT
AUTOR
Thomas Klein
WINTERZWISCHENFRUCHT #3
• Vorfrucht: Getreide
• Nachfrucht: Sojabohne
Getreide ist für die nachfolgende Zwischenfrucht eine sehr dankbare Vorfrucht. Sie ist früh räumend und bietet der Zwischenfrucht meist die Gelegenheit, sich vor dem Winter ausreichend zu entwickeln. Somit kann die Begrünung ihre Aufgaben Bodenbedeckung und Nährstoffbindung gut erfüllen. Bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischung muss immer auf die Ansprüche der Folgekultur eingegangen werden. Sojabohne als Folgekultur spricht für leguminosenfreie Mischungen: Soja sollte möglichst wenig mineralisierten Stickstoff vorfinden wegen ihrer dann besseren N-Fixierung; gleichzeitig bremst dies die Unkrautkonkurrenz. Aus diesem Grund sollte man Komponenten wählen, die Nährstoffe über den Herbst und Winter fixieren und eher langsam wieder freisetzen. Für diesen Zweck ist z.B. diese leguminosenfreie Mischung zu empfehlen:
• 25 kg Rauhafer oder Sandhafer
• 1 – 2 kg Phacelia
• 1 kg Sommerfutterraps
• 0,5 kg Ölrettich
• 1 kg Leindotter
• 1 kg Sudangras.
Achtung: Die Fruchtfolge spielt bei der Auswahl der Zwischenfrucht eine entscheidende Rolle. Es sollten wegen der Gefahr der Krankheitsübertragung keine verwandten Kulturen in der Zwischenfrucht angebaut werden. Falls Sonnenblume als Hauptfrucht ein Fruchtfolge-
Tipp
Die Beratung für Naturland steht für alle Fragen zu Zwischenfrüchten, zur optimalen Mischung und pflanzenbaulichen Fragen jederzeit zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Berater.
glied darstellt, ist sie in der Zwischenfrucht tabu. Wird Mais als Hauptfrucht angebaut, sollte auf Sudangras als verwandte Frucht verzichtet werden. Gleiches gilt auch für Kreuzkontamination. So schließen sich z.B. Sonnenblume und Sojabohne ebenfalls aus, da beide als Wirt für Sclerotinia in Frage kommen.

Beratung für Naturland l.hornung@ naturland-beratung.de

So wirkt
TerraLife® Organic:
MEHR BODENLEBEN
VERSTÄRKTER HUMUSAUFBAU
BESSERE NÄHRSTOFFVERFÜGBARKEIT
HOCHWERTIGERE ERTRÄGE
Artenreiche TerraLife ® Organic Zwischenfruchtmischungen bieten für jede Fruchtfolge eine praxisorientierte Lösung.
Ihre DSV Beratung vor Ort ist gerne für Sie da: 0800 111 2960 kostenfreie Servicenummer
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-039
AUTORIN
Leah Hornung
www.dsv-saaten.de
ANZEIGE
SOMMERZWISCHENFRUCHT
• Vorfrucht: Getreide oder frühräumende Leguminose (z. B. Ackerbohne, Erbse)
• Nachfrucht: Wintergetreide oder Leguminose im Herbstanbau (Winterackerbohne etc.)
Durch die Auflagen des ÖPULFörderprogrammes „System Immergrün“ bekommen Sommerzwischenfrüchte in Österreich eine besondere Bedeutung. Es ist dabei eine flächendeckende Begrünung von mindestens 85 % der Ackerfläche zu jedem Zeitpunkt mit Haupt- oder Zwischenfrüchten zu gewährleisten. In Deutschland gibt es diese Fördermaßnahme nicht, weshalb Sommerzwischenfrüchte hier eine andere Rolle spielen.
Aufgrund der begrenzten Zeit gilt: Je früher die Begrünung nach der Ernte angebaut wird, desto länger kann das Potenzial der Vegetationsperiode ausgenutzt werden. Generell gilt die Faustregel: Ein Tag im Juli ist besser als eine Woche im August - und eine Woche im August ist besser als der ganze September.
Auf trockenen Standorten kann ein Anbau von nicht-überwin-
 AUTOR Nikolaus Fuchs
AUTOR Nikolaus Fuchs
Beratung für Naturland n.fuchs@ naturland-beratung.at
ternden Zwischenfrüchten aber kontraproduktiv sein, da die Zwischenfrucht das ohnehin knapp vorhandene Wasserangebot für die Folgekultur weiter einschränkt. Auch bei hohem Unkrautdruck ist von Sommerzwischenfrüchten eher abzuraten, da eine Unkrautkur dann aufgrund des kürzeren Zeitraumes sehr schwierig werden kann.
Die Wurzelleistung ist wegen der kurzen Vegetationszeit nicht besonders hoch. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es daher sinnvoll, kostengünstige Komponenten einzusetzen. Eine interessante Sommerzwischenfrucht-Komponente ist Sudangras. Bei warmen Bedingungen erreicht die stark frostempfindliche C4-Pflanze hohe Biomasseerträge und eignet sich auch als Futter. Kalte, nasse und schwere Standorte sind für diese Pflanze ungeeignet. Aus der Familie der Kreuzblütler kann Sommerraps einen wertvollen Beitrag als Zwischenfrucht leisten, da er geringe Standortansprüche hat, den Boden rasch bedeckt und den verfügbaren Stickstoff gut verwertet.
Steht die Sommerzwischenfrucht zwischen Wintergetreide, ist auch eine Leguminose in der Mischung sinnvoll. Die Sommerwicke hat geringe Ansprüche an Boden und Klima und trägt zur Stickstofffixierung bei. Auch klassische Sommerklee-Arten kommen bei zeitiger Aussaat in Frage.

Je früher die Begrünung nach der Ernte angebaut wird, desto länger kann das Potenzial der Vegetationsperiode ausgenutzt werden.
Es kann auch auf fertige Saatgutmischungen zurückgegriffen werden. „Warmseason“ der DSV setzt sich aus Öllein, Ramtillkraut, Sorghum, Sommerwicke, Alexandrinerklee, Abessinischer Kohl und Felderbse zusammen.
Die Mischung „Wassergüte früh“ der Saatbau Linz enthält keine Kreuzblütler und besteht aus folgenden Komponenten: Alexandrinerklee, Krumenklee, Phacelia, Mungbohne.
32 | ZWISCHENFRUCHT
Foto: Stefan Veeh
WINTERZWISCHENFRUCHT #4
• Vorfrucht: Körnermais
• Nachfrucht: Sojabohne
Der Drusch von Körnermais erfolgt oft erst Mitte bis Ende Oktober –in Einzeljahren auch erst Anfang November. Die Auswahl an geeigneten Zwischenfrüchten nach Körnermais ist daher im Vergleich zu früher räumenden Kulturen eng beschränkt, die verbleibende Vegetationszeit sehr begrenzt. Pflanzenbaulich sinnvoll sind in diesem Fall winterharte Zwischenfrüchte. Infrage kommen Mischungen aus z.B. Grünschnittroggen, Winterroggen, Winterraps, Winterrübsen, Wintertriticale oder auch Inkarnatklee:
• 100 kg Grünschnittroggen
• 3 kg Winter(futter)raps oder Winterrübsen
Werden diese Kulturarten gewählt, ist trotz der späten Aussaat mit einer ausreichenden Bodenbedeckung über den Winter zu rechnen.
Die Zwischenfrüchte Winterraps und Winterrübsen sind bei Folgefrucht Sojabohne trotz guter Durchwurzelungsleistung aufgrund einer eventuellen Sklerotinia-Übertragung eher mit Vorsicht zu betrachten.
Erhöhte Saatstärke kann einen verspäteten Aussaattermin bis zu einem gewissen Maß ausgleichen. Ziel einer späten Winterzwischenfrucht nach Körnermais sollten ausreichende Bodenbedeckung und Durchwurzelung sein. Sind diese Ziele bedingt durch den Erntetermin vom Körnermais nicht zu realisieren, die Bodenbedingungen zur Bearbeitung zu nass oder sprechen andere Gründe wie z.B. bekannter
Gräserdruck auf dem jeweiligen Schlag gegen die Ansaat einer Winterzwischenfrucht, ist unter

Winterrübsen eignen sich als winterharte Zwischenfrucht und können vor der Sojasaat flach eingearbeitet werden.
Umständen der Verzicht darauf sinnvoller.
Für den Umbruch einer winterharten Zwischenfrucht vor Soja steht ausreichend Zeit von Vegetationsbeginn bis Ende April zur Verfügung, um die jeweiligen Schläge für die Sojaaussaat vorzubereiten.
 AUTOR Klaus Girg
AUTOR Klaus Girg
Beratung für Naturland k.girg@ naturland-beratung.de




PREMIUMHACKSTRIEGEL AEROSTAR-FUSION

Beste Arbeitsergebnisse mit bis zu 6 kg Zinkendruck!
Feinste Saatbettbereitung durch perfekte Krümelung! PRÄZISIONSHACKGERÄT CHOPSTAR-TWIN
Jetzt neu: SMART-GRIP-Schnellverstellung!

ZWISCHENFRUCHT | 33 Foto: Goldberger WWW.EINBOECK.AT
ab €
BESUCHEN SIE UNS AUF DEN DLG-FELDTAGEN & ERLEBEN SIE UNSERE MASCHINEN HAUTNAH! SÄGERÄTE-AKTION P-BOX-STI ANZEIGE
3.600,einboeck.at/sti2024

Beratung für Naturland s.veeh@ naturland-beratung.de

Untersaaten
erfolgreich etablieren
Gerade im August, wenn die Sonne höchste Photosynthese-Leistungen zuließe, liegen die Äcker oft brach. Das Getreide ist geerntet und Zwischenfrüchte oder Feldfutter noch nicht gesät. Mit Untersaaten könnte man diese Lücke schließen.
AUTOR Stefan Veeh
Untersaaten erfüllen mehrere Funktionen. So können Zwischenfrüchte und Feldfutter als Untersaat etabliert werden; die Untersaat kann aber auch zum Erosionsschutz oder zur Unkrautunterdrückung in der Hauptkultur genutzt werden. Wichtig ist dabei, dass das Duo aus Untersaat und Deckfrucht aufeinander abgestimmt ist.
Natürlich gibt es auch bei der Etablierung von Untersaaten Grenzen. Wer Zwischenfruchtmischungen bereits als Untersaat etablieren möchte, muss vom Aussaatzeitpunkt eher Richtung Getreideernte rutschen. Zu diesem Zeitpunkt kommen nur noch eher „ungenaue“ Sätechniken, wie Streuer oder Drohnensaat zum Einsatz. Außerdem steigt die Gefahr, dass man mit der Etablierung genau dann in die Phase rutscht, in der kein Wasser für einen ausreichenden Auflauf zur Verfügung steht und die Konkurrenz durch die Hauptkultur zu groß ist. Aus unserer Beratungs-Erfahrung gibt es drei bewährte Varianten für die Etablierung von Untersaaten:
1: Feldfutter als Untersaat
Klee- oder Luzernegras kann gerade in frühjahrsund sommertrockenen Gebieten im Frühjahr bereits als Untersaat etabliert werden. Insbesondere in diesen Gebieten birgt die Herbst-Blanksaat von Klee- und Luzernegras ein großes Risiko. Diese sollte bis Mitte September abgeschlossen sein, um Klee und Luzerne eine ausreichende Entwicklung vor dem Winter zu ermöglichen. Leider zeigt sich immer wieder, dass nach der Getreideernte kaum Restfeuchte vorhanden ist; verbunden mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit ist eine Blanksaat oft risikobehaftet.
Die Untersaat kann in Reihenkulturen, z. B. in Getreide oder Sonnenblumen, erfolgen. Mais ist weniger geeignet, da er mit der Konkurrenz durch Rotklee oder Luzerne im Jugendstadium meist nicht gut zurechtkommt. In den Reihenkulturen ist die Untersaat bis Ende April möglich, um noch genug Zeit und Wasserreserven für die Jugendentwicklung zu haben. Dabei sind oft Kompromisse bei der mechanischen Unkrautbekämpfung notwendig. Bei der Aussaat sollte – wenn möglich – eine Technik mit guter Ablagegenauigkeit verwendet werden, besonders dann, wenn die Aussaatbedingungen für die Untersaat nicht optimal sind. In Sonnenblumen ist die Einsaat mit der Sämaschine immer zu bevorzugen, allerdings muss hier eine entsprechende Technik mit gutem Durchgang vorhanden sein, um den Sonnenblumenbestand nicht zu verletzen. Ein Striegel mit Pneumatik-Sägerät kann eine gute Al-

Erster Aufwuchs im Frühjahr eines als Untersaat etablierten Kleegrases.
meinsam mit der jeweiligen Deckfrucht erfolgen, besser aber fünf Tage nach der Saat der Deckfrucht. So ist auch kein Kompromiss hinsichtlich der Ablagetiefe notwendig. Hafer ist dabei der bessere Partner, denn bei den üblichen kurzen Sommergerstensorten ist die Gefahr größer, dass Rotklee oder Luzerne über den Bestand wachsen. Die Untersaat sollte im 90°-Winkel oder zumindest leicht versetzt zur Särichtung der Deckfrucht angebaut werden. Ein Anwalzen verbessert den Bodenschluss und sichert den kapillaren Aufstieg des Wassers. Die feinen Samen dürfen jedoch nicht zu tief in den Boden eingedrückt werden.
Die Untersaat in Winterungen kann nur mit reduzierter Aussaatstärke der Deckfrucht erfolgen. Immer dann, wenn sich die Deckfrucht gut entwickelt, wird die Untersaat kümmern und umgekehrt.
ZWISCHENFRUCHT | 35

Kurz & knapp
Untersaaten können ein hilfreicher Baustein in der Fruchtfolge sein, bringen jedoch auch ein gewisses Risiko mit sich. Unsere BeratungsErfahrung zeigt, dass Untersaaten nicht immer den gewünschten Effekt und Erfolg bringen. Die besten Erfahrungen gibt es in der Praxis bei Feldfutter-Untersaaten in Hafer oder Roggen. Aufgrund der vielfältigen Vorteile einer Untersaat empfiehlt es sich, Untersaaten in der betriebseigenen Fruchtfolge auszuprobieren. Wichtig ist, dass die Untersaaten in Wuchs und Konkurrenzkraft zu der jeweiligen Deckfrucht passen. Es ist außerdem von Vorteil, wenn die Äcker, auf denen eine Untersaat eingeplant ist, möglichst ohne Druck von Problemungräsern und -kräutern sind.
Wichtig ist, dass die Untersaaten in ihrem Wuchs und ihrer Konkurrenzkraft zu der jeweiligen Deckfrucht passen. Im oberen Bild überwächst die Luzerneuntersaat den Weizenbestand.
Ist der Unkrautdruck zu hoch, kann die Untersaat im Beikraut untergehen - hier Kleeuntersaat in Hafer.

Die Untersaat in Winterungen sollte immer im Frühjahr gesät werden, da sonst die Untersaat mit dem Wintergetreide hochwächst und zu Problemen bei der Ernte führen kann. Der perfekte Zeitpunkt für die Untersaat richtet sich immer nach Vegetation und Bodenzustand, sollte aber in der Regel bis Ende April erfolgt sein.
Als Untersaat eigenen sich alle Feldfuttermischungen. Weißkleegras könnte z. B. für weniger konkurrenzstarke Deckfrüchte verwendet werden, wie z. B. Sommergerste. Bei der Aussaatstärke der Deckfrucht muss man sich je nach Standort herantasten, sie schwankt in der Praxis sehr deutlich zwischen 65 und 100 % der üblichen Reinsaatmenge.
Die Untersaat von Feldfutter minimiert das Aufgangsrisiko in trockenen Gebieten. Dennoch birgt auch sie Risiken: So kann eine schlecht etablierte Untersaat unter der Deckfrucht vertrocknen oder eine zu gut entwickelte Untersaat die Deckfrucht überwachsen. Damit wird der Drusch der Hauptkultur obsolet. Es braucht daher Erfahrung und Verständnis für den jeweiligen Standort. Und ein „Plan B“ (z. B. mögliche GPS-Nutzung) ist ja generell nie verkehrt.
2: Zwischenfrucht als Untersaat
Auch eine Zwischenfrucht kann bereits als Untersaat angelegt werden. Allerdings können dazu keine Zwischenfruchtmischungen verwendet werden, die für die Blanksaat im Sommer gedacht sind, denn diese zielen auf eine schnelle Entwicklung und würden eine zu große Konkurrenz für die Deckfrucht
Fotos: Alexander Böck (1), Stefan Veeh (3)
darstellen. Besonders sinnvoll ist die Untersaat einer Zwischenfrucht dann, wenn auf eine Winterung eine weitere Winterung folgt (z. B. Winterroggen nach Winterweizen). Möchte man hier Stickstoff fixieren, kann eine Untersaat mit niedrigwachsenden Kleearten (Weiß-, Gelb- oder Erdklee) eingesät werden. Diese Saat sollte bereits im April durchgeführt werden, bei Drohnensaat (siehe Seite 38) und gegebener Feuchte auch später; die Aussaatmenge liegt zwischen 3 und 5 kg/ha. Damit sind die Kosten gegenüber sonstigen Zwischenfrüchten konkurrenzlos niedrig, von Zeit und Aufwand ganz zu schweigen. Je nach Standort kann hier die Kleeart variiert und z. B. bei sehr kalkreichen Standorten auf Gelbklee zurückgegriffen werden.
Je genauer die Aussaattechnik ist, desto gleichmäßiger ist die Bodenbedeckung. Meist sind Kompromisse bei der mechanischen Unkrautbekämpfung notwendig. Außerdem ist eine Stoppelbearbeitung im Herbst nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Wer also Wurzelunkräuter bekämpfen muss, der sollte auf eine Untersaat verzichten, um ein ausreichend großes Zeitfenster zur Bodenbearbeitung nach der Ernte offen zu halten.
3: Erosionsschutz oder Unkrautunterdrückung
Eine Untersaat kann viele Funktionen erfüllen: Sie kann in Reihenkulturen zum Beispiel als Erosionsschutz dienen und gleichzeitig z. B. bei Silo- oder Körnermais die Befahrbarkeit zur Ernte absichern. Mischungen mit narbenbildenden Gräsern, wie zum Beispiel ein Rotschwingel-Weißklee-Gemenge, können dies als Untersaat übernehmen. Grundsätzlich wäre zwar auch Weidelgrasgemenge möglich; kommt es allerdings zur Samenreife, kann dies in den nachfolgenden Kulturen zu Durchwuchsproblemen führen. Wiesen- oder Rotschwingel eignen sich daher besser.
Ein zweites Beispiel für die vielfältigen Funktionen einer Untersaat ist die Unkrautunterdrückung in dünneren Beständen. Durch trockene Bedingungen ist es in manchen Regionen zu schlechten Feldaufgängen gekommen und damit zu dünneren, aber durchaus druschwürdigen Beständen. Da hier mehr Licht auf den Boden kommt und damit das Risiko einer übermäßigen Verunkrautung steigt, empfiehlt sich die Einsaat einer bodenbedeckenden Untersaat (z. B. Weißklee). Wichtig ist hier, dass es sich um eine niedrigwachsende Sorte handelt und nicht um einen Futtertyp. Es können ebenfalls 3 bis 5 kg/ha eingestriegelt werden; auch hier gilt: nicht zu tief!


HIER WÄCHST TOFU





Wir bei Taifun sagen Danke an all unsere 150 Bio-Vertragslandwirt*innen. Egal, ob seit 25 Jahren oder seit einem. Mit euren Sojabohnen tragt ihr zur Qualität unseres Tofus bei.

DANKE, IHR MACHT






DEN
UNTERSCHIED!
taifun-tofu.de

AUTOR
Philip Köhler
Beratung für Naturland p.koehler@ naturland-beratung.de

Drohnen-Saat
Ein Erfahrungsbericht
Um die Vegetationszeit optimal zu nutzen und um Kosten und Arbeitszeit in der Ernte zu sparen, hat Markus Traber Zwischenfrüchte per Drohne säen lassen. Schnecken und Ampfer zeigten ihm aber bereits im ersten Jahr die Grenzen des Verfahrens.
38 | ZWISCHENFRUCHT
„Mich hat einfach die längere Vegetationszeit für den Humusaufbau interessiert. Das spielt bei uns im Ackerbau auf 700 Metern Seehöhe schon eine Rolle“, sagt Markus Traber, der letztes Jahr die Zwischenfruchtsaat per Drohne ausprobiert hat. Er bewirtschaftet einen Gemischtbetrieb mit Ackerbau, Grünland, Milchvieh und Biogasanlage nördlich von Stockach in Baden-Württemberg.
Fünf Hektar pro Stunde
Drohnen im Agrarbereich zu nutzen ist für ihn nichts Neues. Markus Traber war einer der ersten Landwirte in der Bodenseeregion, der vor der Mahd Drohnen mit Wärmebildkameras für die Rehkitzrettung einsetzte. Seit Jahren lässt er Trichogramma gegen den Maiszünsler aus der Luft verteilen. Die Technik zur Zwischenfruchtsaat ist ähnlich: An der Drohne sind ein Vorratsbehälter und eine Art Kleinsamenstreuer angebracht. Mit einer Arbeitsbreite von sieben Metern wird das Saatgut aus etwa vier Meter Flughöhe verteilt. Pro Stunde können so rund fünf Hektar gesät werden. Das Besondere an der Zwischenfruchtsaat mit Drohne ist, dass noch vor der Ernte bereits in den Bestand der Hauptkultur gesät wird. Markus Trabers Dienstleister bietet für die Landwirte ein Onlineportal an. Dort gibt Traber im März des entsprechenden Jahres die Flächen an, die per Drohne besät werden sollen. Dazu werden die Daten des Agrarantrags hinterlegt. Leitungsmasten und ähnliche Hindernisse auf der Fläche müssen manuell eingegeben werden, um Kollisionen zu vermeiden. Später kann der Landwirt das geplante Erntezeitfenster angeben.
„Mich hat die längere Vegetationszeit für den Humusaufbau interessiert.“
Naturland-Bauer Markus Traber
Saat zwei Wochen vor Ernte
Rund zwei Wochen vor der Ernte kommt der Dienstleister mit Drohne und Saatgut und bringt die Zwischenfrucht in den Druschfruchtbestand aus. Landwirtinnen und Landwirte müssen bei der Aussaat daher nicht anwesend sein. Sie können nach der Ernte der Zwischenfrucht beim Wachsen zuschauen – hoffentlich, denn im Dinkel gab es bei Markus Traber 2023 Probleme. Die Mitarbeiterin des Anbieters in Trabers Region vermutet, dass sich die Schnecken im dichten Dinkelbestand zu wohl gefühlt haben. Unter Wintergerste, Triticale und Weizen hat die Drohnensaat aber sehr gut funktioniert. Grundsätzlich sind alle Druschfrüchte als Deckfrüchte für die Drohnensaat von Begrünungsmischungen denkbar. Allerdings ist bei Trabers Anbieter bislang nur eine Mischung für Öko-Betriebe verfügbar. Das limitiert die Einsatzgebiete in der Fruchtfolge. Zudem muss die Mischung so konzipiert sein, dass sie gute Flugeigenschaften hat und sich nicht zu stark entmischt. Da die Samen durch den abreifenden Bestand auf den Boden gestreut werden, ist die Auswahl auf Lichtkeimer beschränkt.


ZWISCHENFRUCHT | 39

Nicht alle Flächen sind geeignet
Markus Traber betont, dass der Aussaatzeitpunkt 10 bis 14 Tage vor der Druschfruchternte möglichst genau abgepasst werden muss und fügt hinzu: „Aber ohne Regen bringt’s auch nichts. Und das wird immer schwieriger.“ Nasse Flächen
Auf Schlägen mit hohem Ampferdruck ist die Drohnensaat nicht zu empfehlen, weil damit die Stoppelbearbeitung fehlt.

zur Ernte bergen jedoch auch eine Herausforderung. Fahrspuren durch Erntearbeiten bleiben bei Drohnensaat bis zum Umbruch der Zwischenfrucht bestehen und behindern die gleichmäßige Bestandsentwicklung. Auch Stroh- und Spreuverteilung sollten möglichst genau passen, da nicht durch Bodenbearbeitung korrigiert werden kann. Die vorsichtige Strohbergung war in Trabers Fall ohne Schäden an der Zwischenfrucht möglich. Bei der Auswahl der Flächen für die Drohnensaat spielt die passende Stellung in der Fruchtfolge eine große Rolle. Allerdings sollte auch darauf geachtet werden, dass wenig Unkraut auf der Fläche ist – „und vor allem kein Ampfer“, lacht der Betriebsleiter. Ampfer, Disteln und andere Wurzelunkräuter lassen sich bei Drohnensaat nicht bekämpfen, weil die Stoppelbearbeitung fehlt. Auch Mäuse und Schnecken können zum Problem werden.
Große Vorteile, wenn alles passt
Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, bietet das Verfahren jedoch große Vorteile: ohne Zutun der Bäuerinnen und Bauern wird in der stressigen Erntezeit aus der Luft gesät. Damit hat die Vegetation einen Vorsprung gegenüber der Saat nach der Ernte. Der Boden bleibt durch die durchgängige Bedeckung kühler. Man vermeidet Überfahrten und Bodenverdichtung. Zudem ist das Verfahren in Trabers Fall mit Kosten von 32 Euro pro Hektar günstig.
Markus Traber will es in diesem Jahr wieder mit der Zwischenfruchtaussaat per Drohne versuchen. Auf die Erfahrungen aus dem letzten Jahr kann er aufbauen, die Mischung wird vom Anbieter weiter optimiert und ein Jahr ist bekanntlich kein Jahr.
40 | ZWISCHENFRUCHT
Bis Ende Oktober entwickelte sich der mit Drohne gesäte Zwischenfruchtbestand am Betrieb Traber beträchtlich.
Fotos: Traber, Köhler
Tel.: 0 83 04 / 92 96 96
Fax.: 0 83 04 / 92 96 98 info@em-sued.de
www.em-sued.de

Ihr Spezialist für Silage, Fütterung, Gülle, Bodenverbesserung
EM, Pflanzenkohle, Vulkan Mineralfutter
CarboVit Futterkohle
Speicherkohle für Gülle
Biogas und Klauen










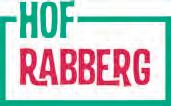
Hof Rabberg GbR Alke Thiesen
Toft 8 · 24405 Rügge
Tel.: 0160-9444 9729 erdbeeren@hof-rabberg.de www.hof-rabberg.de



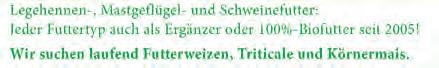

JETZT ZWEINUTZUNGSHÜHNER EINSTALLEN!


Ich würd´s machen!
oekotierzucht.de/tiere/ bezugsquellen/
Beratung & Bestellung: +49 (0) 151 625 591 88 pauline.seyler@oekotierzucht.de
Küken & Jungtiere sind ganzjährig verfügbar.

















Saatgutanalysen auf Steinbrandbefall aller Sommer- und Wintergetreidearten

Preise, weitere Informationen und Untersuchungen & Probenbegleitzettel finden Sie unter: www.nu-agrar.de
N.U. Agrar GmbH Saatgutlabor Durnidistr. 6 – 38704 Liebenburg – info@nu-agrar.de www.nu-agrar.de
ANZEIGEN | 41 Naturland_Anzeige_03_2024-Pfade.indd 1 05.03.24 13:09
73271 Holzmaden - Tel.: 07023-74 43 44 - www.eum-agrotec.de Ecocat 1 , 5 -3, 0 m für Traktoren ab 33kW/45PS NEU
DE-ÖKO-006 BioBio-ErdbeerpflanzenErdbeerpflanzenFrigos Frigos Bestellen Sie jetzt!
ötz: Eine Initiative von Bioland & Demeter
DE-ÖKO-006

GETREIDEMARKT
Dinkel, Speisehafer und Qualitätsweizen sind auch knapp vor der Ernte gefragt. Die niedrigen Kleber- und Proteingehalte der 2023er Weizenernte begleiten die Vermarkter immer noch. Weiterhin gute Nachfrage und einen Preisanstieg erlebt Speisehafer. Hier versuchen viele Verarbeiter, sich mit Vorkontrakten Ware der neuen Ernte zu sichern. Auch Dinkel setzt seinen Aufschwung fort. Dieser Marktimpuls kam erst nach dem Anbau, weshalb flächenbedingt 2024 mit keiner großen Dinkelernte zu rechnen ist.
Großhandelspreise für deutsche Verbandsware im Mai 2024 bei Abnahme von loser Ware an Verarbeiter oder Mühlen frei Rampe (netto, Euro/t)
Gewichteter Durchschnittspreis
KOMMENTAR
Von Jörg Große-Lochtmann, Vorstand
Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG
Der Bio-Markt zieht an - produktübergreifend und insbesondere bei Naturland-Ware. Das ist erfreulich, trifft jedoch nicht immer auch für die Preise zu. Wir brauchen mittelfristig eine kostenorientierte Preisentwicklung mit möglichst geringer Spekulation. Fakt ist, der Bio-Markt wächst wieder - und zwar deutlich stärker als bei unseren Nachbarn. Damit haben wir die Chance und Aufgabe, die aktuell positive Entwicklung, nachhaltig zu verstetigen. Mit Naturland-Ware haben wir uns erfolgreich im heimischen Handel positioniert. Dies gilt es, trotz in der Regel billigerer EU-Bio-Angebote aus dem Ausland, weiter zu etablieren. Damit wir vom Acker bis ins Regal einen planbaren und nachhaltigen Warenfluss erreichen. Es braucht Planbarkeit und eine intensivere Kommunikation der Marktteilnehmer in der Wertschöpfungskette. Gemeinsam haben wir viel zu gewinnen!
Von Bis
Körnermais (vorger.)* 321 318 350
Brotweizen (vorger.) 419 380 430
Dinkel (Rohware) 414 360 430
Qualitätsweizen (vorger.) 466 430 470
Keksweizen (vorger.)
(Rohware)
290
Roggen vorger. 329 250 370 Triticale 272 230 285
Erzeugerpreise liegen – je nach Vermarkter und Transportkosten – um 30 bis 50 Euro/t darunter. In Einzelfällen kann die Differenz auch größer sein. * prompt/ex Ernte, Preise ohne Stern = Termin/Jahreskontrakt
FUTTER
Der Futtergetreidemarkt ist immer noch gut versorgt. Vor allem Mais und Futterweizen sind weiterhin verfügbar. Die Futtermühlen sind häufig gut eingedeckt, weswegen sich die Verkäufe zuletzt beruhigt haben. Das wirkt sich auch auf die Mischfutterpreise aus, die leicht zurückgegangen sind. Zwar ist der Leguminosen-Markt als Eiweißfutter geräumt, immer häufiger wird aber stattdessen Ölkuchen eingesetzt.
Alleinfutter für Legehennen, Endmast für Schweine 18/4 Milchleistungsfutter Jan Mrz Mai Jul Sep Nov
Alleinfutter für Legehennen, Verband, Phase 1
Endmast für Schweine ab 80 kg, Verband 18/4 Milchleistungsfutter mit Mais, Verband
365 300 400 Futterweizen 272 255 285 Futtergerste* 288 250 330
Speisehafer
435 400 470 Futterhafer* 279 265
Quelle: AMI anhand 19 Meldestellen 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz
2021 2022 2023 2024 Quelle: AMI
42 | M ARKT & VERMARKTUNG
MARKT & PREISE
MILCHMARKT
Sowohl in Deutschland als auch in Österreich setzen sich stabile bis leicht steigende Tendenzen fort. Auch die Erzeugerpreise für konventionelle Milch legten zu. In Deutschland fiel der Anstieg der konventionellen Preise etwas deutlicher aus als bei Bio-Milch. Dadurch hat sich der Abstand zwischen den Preisen für Bio-Milch und konventioneller Milch im März auf 11,5 Cent reduziert. Noch im Oktober des Vorjahres lag die Differenz bei über 14 Cent. In Österreich entwickelten sich die Preise aufgrund der Koppelung an den konventionellen Markt mit Zuschlägen weitgehend parallel.
In Deutschland war die Nachfrage nach Molkereiprodukten aus ökologischer Erzeugung im ersten Quartal hoch. Laut AMI waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu produktübergreifend steigende Absatzmengen zu verzeichnen. Insbesondere bei Bio-Konsummilch, hiervon kauften die privaten Haushalte in Deutschland im ersten Quartal rund 10,3 % mehr ein als im Vorjahreszeitraum.
Was dem Markt hilft: Die belebte Nachfrage traf im ersten Quartal auf ein nur leicht erhöhtes Angebot. Die hohen Zuwachsraten aus dem Vorjahr haben sich dieses Jahr abgeschwächt. In den Folgemonaten sind daher weiterhin stabile bis leicht steigende Tendenzen zu erwarten.
Preise für ökologisch und konventionell erzeugte Kuhmilch in Deutschland (4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, in Cent/kg netto)
Preise für ökologisch und konventionell erzeugte Kuhmilch in Österreich (4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, in Cent/kg netto)

Unser bestes Bio-Mischfutter von der Naturmühle Höltinghausen.
Herstellung von hochwertigen Mischfuttern, optimiert nach dem Bedarf der ökologischen Tierhaltung
Enge Partnerschaft mit etablierten Bio-Verbänden
35 40 45 50 55 60 65 70 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Konventionell Öko 40 45 50 55 60 65 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Konventionell
Öko
ANZEIGE Quellen: BLE, AMA GS Die Genossenschaft eG Raiffeisenstr. 4 · 49685 Schneiderkrug Tel. 04473 92683-10 · gs-bio.de Du brauchst ein individuelles
Melde dich bei uns!
Futterkonzept?
DE-ÖKO-005 MARKT & VERMARKTUNG | 43
Regionale und direkte Ernteabwicklung
„Wir haben einiges vor.“

Verena Kittlaus im Interview
Das Interesse der Naturland-Betriebe am Förderprogramm Artenvielfalt ist enorm. Verena Kittlaus von der Naturland Zeichen GmbH ist Ansprechpartnerin für die Bäuerinnen und Bauern.
44 | MARKT & VERMARKTUNG
„Ich finde, hier entsteht etwas Großartiges für die Naturland-Betriebe.“
Nach der Entwicklungsphase haben wir dieses Jahr das Förderprogramm Artenvielfalt gestar tet. Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Verlauf?
Das immense Interesse der Naturland-Mitglieder am Förderprogramm Artenvielfalt zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist uns gelun gen, ein schlankes System aufzubauen, damit möglichst viel Fördergeld bei den Bäuerinnen und Bauern ankommt. Jetzt geht es darum, das För derprogramm in die Breite zu tragen.
Wie viele Betriebe konnten bislang teilnehmen?
Nach dem Testlauf mit zehn Pilotbetrieben im ver gangenen Jahr haben wir im März die Förder plattform zum ersten Mal allgemein freigeschal tet. Insgesamt konnten 117 Naturland-Betriebe online Maßnahmen buchen, mit denen sie auf rund 900 Hektar die Artenvielfalt aktiv fördern. Zugleich sammeln wir wichtige neue Erfahrungen mit Blick auf die Praxistauglichkeit des Buchungssystems. Das hilft uns bei der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Förderplattform, damit schon im kommenden Jahr mehr Betriebe teilnehmen können.


Das Förderprogramm Artenvielfalt wird über den Verkauf von Naturland-zertifizierten Produkten mit dem Logo „Für mehr Artenvielfalt“ finanziert.
Tipp
Das Teilnahmeinteresse war sehr groß. Was sagst Du jenen, die nicht teilnehmen konnten?
Wir stehen am Anfang unseres Wegs. Was wir hier machen, ist komplett neu: Wir honorieren mit einem Förderprogramm Öko-Dienstleistungen unserer Bäuerinnen und Bauern! Dass wir das schon zum Auftakt auf 900 Hektar umsetzen können, ist ein erster Erfolg, der uns freut. Zugleich ist das aber auch nur ein Zwischenstand. Denn wir sind zuversichtlich, dass der Fördertopf in den kommenden Jahren kontinuierlich größer werden wird. Und genauso kontinuierlich soll die Zahl der teilnehmenden Betriebe wachsen.
Was sind die nächsten Schritte?
Wir haben einiges vor! Wir arbeiten an der fachlichen Weiterentwicklung der Maßnahmen genauso, wie auch an der Optimierung des Förderportals. Zudem wird das Angebot zum Bildungsprogramm Biodiversität weiter ausgebaut. Wir wollen das Fördersystem nach dem erfolgreichen Start nun auch dauerhaft etablieren. Dabei hilft uns auch
Alle Informationen zum Förderprogramm Artenvielfalt finden Sie online unter www.wirsindartenvielfalt.de.
das konstruktive Feedback der Naturland-Bäuerinnen und Bauern, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.
Was sind die langfristigen Ziele?
Wir entwickeln das System Schritt für Schritt weiter, damit es auch bei steigenden Teilnehmerzahlen schlank und effizient bleibt. So wie wir aus der Pilotphase mit nur zehn Betrieben für die erste Förderperiode mit über hundert Betrieben gelernt haben, so lernen wir daraus nun wieder für die nächste Stufe. Langfristig ist das Ziel, die Mehrheit der Naturland-Betriebe in die Förderung aufnehmen zu können. Ich finde, hier entsteht etwas Großartiges für die Naturland-Betriebe.
MARKT & VERMARKTUNG | 45

Viehtrieb auf der Straße

AUTOR
Konrad Maier
Beratung für Naturland k.maier@ naturland-beratung.de

AUTOR
Stefan Lemmerer
Beratung für Naturland s.lemmerer@ naturland-beratung.at

Wer morgens und abends seine Rinder auf oder über öffentlichen Straßen zur Weide und zurück in den Stall treiben muss, macht mitunter einiges mit. Hupende Autos, ungeduldige Radfahrer, gestresste Tiere und die Angst vor einem Unfall sind tägliche Begleiter. Wir haben recherchiert, was erlaubt ist und wie sich Landwirte abhelfen.
Viehtrieb auf oder über öffentliche Straßen ist in der Straßenverkehrsordnung (StVO) explizit angeführt und erlaubt. Im Wesentlichen gelten die allgemeinen Verkehrsregeln wie rechts halten und die Straße nur queren, wenn frei ist. Alle weiteren Bestimmungen sind sehr allgemein gehalten, detaillierte Vorgaben sucht man vergeblich. So müssen laut StVO der Gefährdungslage entsprechend ausreichend viele Helfer eingesetzt werden. Das Tragen von Warnwesten, einer ausreichenden
&
Für den innerbetrieblichen Transport von Rindern und den Weidewechsel eignen sich mobile Viehtriebwagen.

Beleuchtung und das rechtzeitige Warnen des (Gegen-)Verkehrs sind notwendige Maßnahmen. Außerdem ist es verboten, Tiere von Kraftfahrzeugen aus zu führen.
Die Straße für das Überqueren der Rinder komplett zu sperren, ist für Privatpersonen verboten. Absperrungen müssten bei der zuständigen Behörde beantragt werden. In der Praxis wurden diese Anträge aber abgelehnt.
Absprache mit Behörden
Generell ist es sinnvoll, sich bei Neuaufnahme einer Weidehaltung und des damit verbundenen Viehtriebs vorab mit den Behörden abzusprechen. Welche Behörde das ist, hängt von der Art der Straße ab. Demnach kann es die Gemeinde, das Landratsamt, die kreisfreie Stadt oder die Große Kreisstadt sein. In Österreich ist neben der Gemeinde
die Bezirkshauptmannschaft für öffentliche Straßen zuständig. Mit der örtlichen Polizeidienstel le über die Absicherung zu spre chen, kann zusätzlich hilfreich sein.
Werden die Tiere über einen längeren Zeitraum auf oder über eine Straße getrieben, so sind Warnbeschilderungen, wie zum Beispiel das Gefahrzeichen „Viehtrieb“, vorgeschrieben. Die se werden ebenfalls von der zu ständigen Behörde genehmigt. Einzelne Naturland-Betriebe berichten, dass die Kosten dafür von der Gemeinde übernommen worden sind.
Verunreinigungen beseitigen
Auch das allseits bekannte Pro blem der Straßenverunreinigung wird in der Straßenverkehrsord nung eher praxisfern definiert. So müsse der Verursacher unver

48 | RIND & GRÜNLAND
Fotos: Konrad Maier, Shutterstock
züglich und ohne Aufforderung dafür sorgen, dass die Verunreinigungen sofort von der Straße entfernt werden. Wird eine Straße lediglich überquert, empfiehlt es sich demnach, Besen, Schaber oder Schaufel in der Nähe der täglich zu überquerenden Straße zu lagern oder diese beim Viehtrieb gleich als Treibhilfe zu nutzen. Bei großen Herden ist es denkbar, dass der letzte Treiber mit Schubkarren und Schaufel folgt und die Fladen aufsammelt. Bei längerem Treiben auf öffentlichen Straßen ist dies aber kaum umsetzbar. Um Ordnungsstrafen zu vermeiden, sollte hier der Kontakt zur Behörde aufgenommen und auf die Situation aufmerksam gemacht werden.
Viehtriebwagen als Hilfe
Für den innerbetrieblichen Transport von Rindern und den Weidewechsel eignen sich besonders mobile Viehtriebwagen. Diese kommen meist beim Umtrieb von Jung- oder Mastrindern zum Einsatz. Beispielsweise, wenn Kalbinnen auf Weideflächen müssen, die bis zu einem Kilometer entfernt sind und dafür nicht extra in einen Viehtransportwagen geladen werden sollen. Über längere Strecken haben sich absenkbare Viehtransportwagen bewährt.
Beim Führen eines Viehtriebwagens sind die Vorgaben der StVO zu beachten, dies gilt im Übrigen auch für Wasserwägen.
Beide zählen zu den Anhängern für land- und forstwirtschaftliche Zwecke (LoF-Anhänger). Folgendes muss erfüllt sein, damit LoF-Anhänger bis 25 km/h vom Zulassungsverfahren ausgenommen sind:
• Die Anhänger gehören zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb,
• werden nur für land- oder
forstwirtschaftliche Zwecke genutzt,
• werden mit einer Betriebsgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h hinter Zugmaschinen mitgeführt,
• und sind mit einem 25erSchild gekennzeichnet.
• Führerschein Klasse T und L (F in Österreich) gilt nur für LoF-Zwecke.
• In Abhängigkeit vom Vorhandensein einer Bremsanlage dürfen gewisse Höchstgewichte und -geschwindigkeiten nicht überschritten werden; zulässige Breite max. 2,55 m (inkl. Bereifung).
Haftpflichtversicherung ergänzen?
Kommt es tatsächlich beim Viehtrieb zu Unfällen und trifft den Rinderhalter ein Verschulden, so übernimmt die Betriebshaftpflichtversicherung in aller Regel die Kosten für etwaige Sachund Personenschäden. Flurschäden sollten im Vertrag mitversichert sein. Deckungssummen und Versicherungsschutz müssen regelmäßig (jährlich) überprüft werden. Als Standardversicherungssumme werden derzeit 5 Mio. € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden empfohlen. Die Betriebshaftpflichtversicherung greift im Übrigen auch, wenn Rinder aus der Weide ausbrechen und Schäden verursachen. Natürlich sollte es aber erst gar nicht so weit kommen. Informationen zum sicheren Weidebetrieb erhalten Sie in der Broschüre „Sichere Weidezäune“. Bestellmöglichkeiten finden Sie in der Naturland-App und über den QR-Code.
TIPP
Lesen Sie unseren Kommentar dazu auf Seite 3.

Jetzt auch im Süden dabei!
Biofutter mit Rat und Tat
Umfassende Futterlösungen für alle Biobetriebe und umstellungsinteressierte Betriebe.
Von spezialisierten Werken in Gescher (Nordrhein-Westfalen), Ichenhausen (Bayern) und Lochem (NL).
www.reudink-bio.de
T: 04447 – 7429 880
M: info @reudink-bio.eu





Unser team


7 TIPPS
FÜR EINE GUTE HEUERNTE

AUTOR Hubert Weigand
Beratung für Naturland h.weigand@ naturland-beratung.de
50 | RIND & GRÜNLAND
Die Heuernte scheint auf den ersten Blick eine einfache Sache zu sein, denn: „Heu ist trockenes Gras“. Tatsächlich ist gute Heuqualität aber, wie wir alle wissen, eine Kunst, die Fachwissen und Können vereint. Neben der Abhängigkeit von Schönwettertagen bestimmen viele weitere Details den Erfolg der Heuernte. Wir können sie uns gar nicht oft genug bewusst machen – um dann auch wirklich alles darauf auszurichten.
1. DÜNGUNG
Düngung und Häufigkeit der Schnittnutzung bestimmen maßgeblich den späteren Erfolg der Heuernte; sie sollten aufeinander abgestimmt sein, um mittel- und langfristig eine Übernutzung des Bestandes mit einhergehender Entartung der aufstehenden Flora zu vermeiden.
2. SCHNITTZEITPUNKT
Die wichtigste Voraussetzung für qualitativ hochwertiges Heu ist natürlich sonniges, trockenes Wetter. Auf abgetrocknetem Boden welkt das Gras einfach besser an. Bei zu feuchten Verhältnissen und guten Wetterprognosen wartet jeder lieber ab. Aber auch Tau ist nicht zu unterschätzen. Die Erfahrung lehrt, besser etwas später am Tag mit der
Ziele der Heuernte
• Heu mit einem hohen Energiegehalt von mindestens 5,9 MJ NEL
• Rohproteingehalt von mindestens 145 g/kg Trockenmasse
• Maximal 100 g Rohasche im Endprodukt
• Bröckelverluste so niedrig wie möglich halten, um möglichst viel Ertrag pro Hektar (Blattmasse) zu ernten. Besonders wichtig bei Grünlandaufwüchsen mit einem hohen Anteil an Leguminosen (Klee, Luzerne) und Kräutern -> hoher Blattanteil
• Wasseranteil in kürzester Zeit auf unter 15 Prozent verringern
• Höchste Schmackhaftigkeit für Akzeptanz im Trog
Mahd zu beginnen oder noch am Abend zu mähen. Neben dem Wetter ist es vor allem die Bestandsentwicklung, welche über Qualität und Quantität des Ernteguts entscheidet. Wichtig dabei ist vor allem die Frage, zu welchem Zweck das Heu eingesetzt werden soll: Dient es als Futtergrundlage für Heumilchbetriebe oder als reine Rationsergänzung bei Silagefütterung? Top Dressing Heu wird dazu vor der Blüte gemäht, Strukturfutter hingegen erst gegen Ende der Blüte oder gar erst, wenn der Bestand abgeblüht ist. All diese Punkte fließen bei der Wahl des richtigen Schnittzeitpunktes ein – dann muss nur noch das Wetter mitspielen.
„Das Mähwerk sollte auf eine Schnitthöhe von mindestens sieben Zentimetern eingestellt werden.“

RIND & GRÜNLAND | 51



3. MÄHEN
Das Mähwerk sollte auf eine Schnitthöhe von mindestens sieben Zentimetern eingestellt werden. Das schont die Grasnarbe, fördert den Wiederantrieb des Pflanzenbestands und vermindert den Rohaschegehalt. Ein zusätzlicher Nebeneffekt ist dabei eine leichtere Durchlüftung des Mähguts von unten, was wiederum die Trocknung begünstigt. Die Entlastung beim Mähwerk sollte so eingestellt werden, dass dieses sauber über den Boden gleiten kann. Gut entlastete Mähwerke passen sich der Bodenkontur an und verursachen so keine Narbenschäden.
4. ZETTEN/WENDEN
Bei einer Schnitthöhe von mindestens sieben Zentimetern kann der Wender gut auf Stoppelhöhe eingestellt werden. Bei laufender Maschine greifen die Zinken (Zentrifugalkräfte) etwas unter die Spitzen der Stoppeln und heben somit das Erntegut wieder gleichmäßig hoch.
Ja, auch das kann nicht oft genug in Erinnerung gerufen werden: Zu viele Wendevorgänge erhöhen die Bröckelverluste deutlich. Besonders bei hohem Trocknungsgrad steigen die Verluste der Blattmasse deutlich an. Daher gilt: Je trockener das Erntegut, desto langsamer sollten die Kreisel drehen.
Empfehlung:
- Beim ersten Wendegang: 6 km/h bzw. 400 U/min Kreiseldrehzahl
- Ab Trockensubstanzgehalt von 50 %: 11 km/h bzw. 350 U/min Kreiseldrehzahl
5. SCHWADEN
Um die Schwaden gleichmäßig und locker abzulegen, reichen 400 U/min an der Zapfwelle und eine Fahrgeschwindigkeit von 10 - 13 km/h meist aus. Was auch nicht übersehen werden darf: Die Schwadbreite soll dabei zur Pick-Up des Erntefahr-
1 Die Erfahrung lehrt, besser etwas später am Tag mit der Mahd zu beginnen oder schon am Abend zu mähen.
2 Bei einer Schnitthöhe von mindestens sieben Zentimetern kann der Wender gut auf Stoppelhöhe eingestellt werden.
3 Um die Schwaden gleichmäßig und locker abzulegen, reichen 400 U/min an der Zapfwelle und eine Fahrgeschwindigkeit von 10 - 13 km/h meist aus.
52 | RIND & GRÜNLAND
1 2 3

Quaderballen sind in der Ernte arbeitstechnisch am einfachsten zu handhaben und auch für die Qualität des Heus nicht nachteilig, solange es beim Pressen absolut trocken ist.
zeuges passen und der Schwad so geformt sein, dass der Schlepper ihn nicht überfährt.
Bei feuchteren Bodenverhältnissen ist es durchaus sinnvoll, schon am ersten Abend die guten alten Nachtschwaden anzulegen.
6. BERGUNG
Bei der Ernte sind die Voraussetzungen im heimischen Lager ausschlaggebend und welche Erntetechnik zum Einsatz kommt. Grundsätzlich sollte Bodenheu eine maximale Restfeuchte von max. 14 % haben. Für nachfolgende Boxentrocknung sollte der Wassergehalt nicht über 60 % und für Ballentrocknung nicht über 70 % gehen.
7. LAGERUNG
Für die Qualität des Heus wäre eine lose, lockere Lagerung das beste Verfahren, da so das Heu optimal auslüften kann. Rund- und Quaderballen sind während der Ernte am einfachsten zu handhaben und auch für die Qualität des Heus nicht nachteilig, solange es beim Pressen absolut trocken ist. Die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht: Wenn das Heu noch nicht vollständig getrocknet ist und es dann mit hohem Druck in Großballen gepresst wird, kann es während der Heureife zu einer starken Erhitzung kommen. Das Bodenheu hat durch die beiden Faktoren „nicht vollständig getrocknet“ und „hoher Pressdruck bei Großballen“ keine Chance, bei der Lagerung zu atmen. Dieses „Ausschwitzen“ (Mikrobielle Aktivität) ist allerdings für die Hygi-
enisierung des Heus sehr wichtig und dauert beim ersten Schnitt circa sechs Wochen (Folgeschnitte bis zu zwölf Wochen). Dabei werden einerseits schädliche Keime, Pilze und Bakterien eliminiert, aber teilweise auch Vitamine (z. B. ß-Carotin). Vorher sollte dieses Heu nicht verfüttert werden, da ansonsten gesundheitliche Probleme (Acidosen, Klauenrehe usw.) auftreten können. Belüftungsheu kann bei sachgemäßer Trocknung (Trocknungsdauer bis zu zwei Wochen ist möglich) auch sofort verfüttert werden. Eine sensorische Prüfung bzw. eine Futterprobe können die Qualitätsunterschiede der einzelnen Chargen in Zahlen verdeutlichen. Grundsätzlich sollte Heu aber immer erst abgelagert und nur in Notsituationen (wenn kein sonstiges Futter mehr vorhanden ist) sofort verfüttert werden.
Kurz & knapp
Die Heuwerbung ist ein klassisches Futterwerbeverfahren und wird allgemein als simpel abgetan: Tatsächlich spielen neben der Witterung viele Faktoren eine Rolle, damit die Heuernte ein Erfolg wird. Diese Faktoren sind:
- flächenspezifisch (Boden, Düngung, Nutzung etc.)
- technikabhängig (Art, Größe, Schlagkraft etc.)
- lagerspezifisch (Größe, technische Trocknung etc.)
Damit lässt sich dieses Futtergewinnungssystem nur bedingt verallgemeinern und bedarf immer einer einzelbetrieblichen Betrachtungsweise. Mit den beschriebenen „Erinnerern“ sollte aber die Basis für eine gute Heuernte geschaffen sein.
RIND & GRÜNLAND | 53
Fotos: Agrarfoto (5), Naturland / Sebastian Stiphout

Was tun gegen
hohe Zellzahlen?
Draußen ist es warm, die Sonne steht hoch am Himmel, die Kinder planschen im Gartenpool, die Landwirtsfamilie genießt den Kaffee auf der Terrasse – und die Kühe?!?
Zugegeben, die beschriebene Situation trifft nicht auf jeden Milchviehhalter zu – wohl aber auf jede Kuh. Rinder sind relativ kältetolerant, aber nur wenig hitzeresistent. Die Kuh ist ursprünglich ein Steppentier und bevorzugt Temperaturen von minus sieben bis maximal 17 Grad Celsius. Der optimale Temperaturbereich für unsere
Rinder liegt aber enger, nämlich zwischen vier und 16 Grad Celsius. Diesen Bereich nennt man thermoneutrale Zone, es ist der Wohlfühlbereich der Kuh. Innerhalb der thermoneutralen Zone müssen Kühe keine zusätzliche Energie aufwenden, um ihre Körpertemperatur stabil zu halten. Wärmeproduktion und -abgabe befinden sich in einem
harmonischen Gleichgewicht. Daher sollten Landwirtinnen und Landwirte versuchen, die Stalltemperatur in diesem Bereich zu halten.
Hitzestress im Sommer
Das ist im Sommer leichter gesagt als getan. Aufgrund der Klimaerwärmung und der stei-
54 | RIND & GRÜNLAND
genden Temperaturen in den Sommermonaten ist Hitzestress bei Kühen jeden Sommer ein wiederkehrendes Phänomen. Milchkühe können die Körperwärme aufgrund ihrer hohen Milchleistung nicht ausreichend an ihre Umgebung abführen. Unter den einheimischen Klimabedingungen leiden Milchkühe nicht selten unter der Wärmebelastung.
Folgen von Hitzestress
Die Kuh versucht Körperwärme abzugeben, indem sie durch verstärktes Atmen oder Schwitzen die Verdunstung steigert. Die Wärmeabgabe durch Ver-

AUTORIN
Eike Thomsen
Beratung für Naturland e.thomsen@ naturland-beratung.de
„Die Fresszeiten können in die kühlen Abend- und Nachtstunden verlagert werden.“
dunsten ist vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit begrenzt. Dann leiden Kühe besonders unter der Hitze – mit Folgen: Es sinken Futteraufnahme und Liegedauer. Dies führt im weiteren Verlauf zu sinkenden Milchleistungen.
Viel eher als die Milchleistung reagiert aber die Fruchtbarkeit auf Hitzestress. Niedrigere Hormonsekretion führt zu geringerer Brunstintensität und -dauer. Gleichzeitig steigt die frühembryonale Sterblichkeit. Beides verursacht geringere Trächtigkeitsraten und deutlich erhöhten Besamungsaufwand.
Hohe Zellzahlen
Hitzestress wirkt sich nicht nur auf die Leistung aus, sondern auch auf Immunsystem und Gesund-

Regelmäßiges Heranschieben des Futters hält die Futteraufnahme hoch. Zudem kann auf Nachtweide umgestellt werden.
heit der Tiere. So sind die Tiere unter diesen Umständen träge und nehmen unregelmäßig und zu wenig Futter auf. Damit verringert sich die Wiederkautätigkeit, die Verdauungsleistung ist niedriger und die Energieversorgung schlechter. Dadurch kann es leichter zu Pansenazidosen (Pansenübersäuerung) und Ketosen (negative Energiebilanz) kommen.
Der anhaltende Hitzestress ist auch dafür verantwortlich, dass Mastitiden häufiger auftreten. Durch Stress wird die Immunabwehr herabgesetzt, eine ausreichende Erregerbekämpfung bleibt aus, und die Kühe werden anfälliger für Eutererkrankungen. Bei entzündlichen Eutererkrankungen kann davon ausgegangen werden, dass der Zellgehalt der Milch erhöht ist. Dafür verantwortlich sind die in der Milchdrüse einsetzenden Abwehrvorgänge.
Was tun?
Um die Belastung für die Tiere zu reduzieren, können beispielsweise die Fresszeiten in die kühleren Abend- und Nachtstunden verlagert werden. Möglichkeiten, die Futteraufnahme hochzuhalten, sind eine zweimalige Futtervorlage, regelmäßiges Heranschieben des Futters und tägliches Entfernen der Futterreste.
Sofern es möglich ist, sollte man die Tiere in Außenbereichen (Grünauslauf, stallnahe Weide, Auslauf mit Liegemöglichkeiten) übernachten lassen.
RIND & GRÜNLAND | 55

„Besonders relevant ist in der heißen Jahreszeit eine gute Wasserversorgung, denn der Wasserbedarf kann um bis zu 20 Prozent ansteigen.“
Dadurch kann auch der Stall etwas abkühlen. Eine weitere Möglichkeit, mit der Wärme aus dem Stall befördert wird, sind große Lüfter. Auch Sprinkleranlagen werden in Milchviehställen eingesetzt. Hier ist aber wichtig, dass die Liegeboxen nicht feucht werden, da sich Bakterien unter feuchten Bedingungen vermehren und zu Mastitis-Probleme führen können. Außerdem muss die angefeuchtete Luft aus dem Stall abgeführt werden, nachdem sie sich erwärmt hat. Ansons-
ten wird Hitzestress durch das feucht-warme Klima sogar verstärkt. Durch Schwitzen verliert der Körper Wasser, Salz und Mineralstoffe. Deshalb ist es sinnvoll, die Salz- und Mineralstoffgabe zu erhöhen. Besonders relevant ist in der heißen Jahreszeit eine gute Wasserversorgung, denn der Wasserbedarf kann um bis zu 20 Prozent ansteigen. Weitere Maßnahmen sind isolierte Dächer und offene Stallfronten (siehe Titelthema „Fit für den Sommer“ der Ausgabe 2/2024).
Kurz & knapp
Regelmäßige und aufmerksame Tierbeobachtung hilft, Symptome für Hitzestress bei Kühen früh zu erkennen. Auch hohe Zellgehalte in der Milch können solche Hinweise sein - sie sind oft eine Folge von hitzebedingten entzündlichen Eutererkrankungen. Um die Hitzebelastung für Milchkühe zu reduzieren, bietet sich ein Strauß an Maßnahmen an: Vom Einsatz von Ventilatoren und Sprinkleranlagen, die nächtliche Beweidung, bis zur angepassten Fütterung gibt es viele Möglichkeiten zum Gegensteuern. Bei der Fütterung geht es vor allem darum, die Futteraufnahme trotz Hitze hochzuhalten. Über allem steht eine ausreichende Wasserversorgung, denn der Bedarf steigt bei Hitze spürbar an.
56 | RIND & GRÜNLAND
Fotos:
Naturland / Sabine
Bielmeier (2), Agrarfoto (1)

BERATERTIPP
Veronika Wolf Beratung für Naturland v.wolf@ naturland-beratung.de

Zellzahlen im Sommer niedrig halten
Im Sommer sind Kühe anfälliger für Eutererkrankungen, was sich alle Jahre wieder in den Zellzahl-Statistiken der Molkereien zeigt. Was Kühe zusätzlich stresst, sollte vermieden werden. Dies gilt besonders für die Fütterung.
Vorschub und Sauberkeit der Silage sind nun besonders wichtig, da Silagen im Sommer stärker zur Nacherwärmung neigen. Es gilt, bei steigender Temperatur im Frühjahr „vorzudenken“ und zu große Anschnittflächen durch Abschieben zu verkleinern. Das erhöht den Vorschub. Eine mobile Siloüberdachung ist zusätzlich hilfreich.
Die Futterration kann im Mischwagen mit Bio-Obstessig oder verdünnter Propionsäure stabilisiert werden. So können sich Keime nicht weitervermehren, Nährstoffe und Geschmack bleiben erhalten und die Kühe fressen mehr. Bewährt haben sich pro Tonne Futter drei bis fünf Liter Essig oder ein bis drei Liter Propionsäure, die zur besseren Verteilung im Verhältnis 1 : 4 mit Wasser verdünnt wird. Bei Einsatz von Propionsäure ist ein „vereinfachtes“ HACCP- Konzept notwendig.
Wenn die Kühe im Sommer weniger Grundfutter fressen, vertragen sie auch weniger Kraftfutter. Leicht lösliche Kohlehydrate können hier zum Problem werden. Grünfutter enthält viele dieser Kohlehydrate, die zu einer Pansenübersäuerung führen kön-
nen – gerade in Kombination mit getreidereichem Kraftfutter. So sollte Kraftfutter hinsichtlich Menge und Zusammensetzung an die für die Kuh ungünstigen Bedingungen angepasst und pansenschonende Komponenten wie Körnermais, Trockenschnitzel oder Kleie eingesetzt werden.
Weitere Infos zur Nacherwärmung von Futter finden Sie im gleichnamigen Naturland-Merkblatt. Fragen Sie Ihre Beraterin, Ihren Berater oder bestellen Sie das Merkblatt direkt an der Geschäftsstelle der Beratung für Naturland telefonisch unter +49 8137 63729-12 oder per E-Mail: r.springer@naturland-beratung.de
RIND & GRÜNLAND | 57
Foto: Goldberger
Tipp

AUTORIN
Helene Paulsen
Beratung für Naturland h.paulsen@ naturland-beratung.de

Arbeitskräfte
FINDEN
58 | RIND & GRÜNLAND
MARTIN SCHNEIDER
Dr. Martin Schneider ist Geschäftsführer der IAK Agrar Consulting GmbH, einem landwirtschaftlich orientierten Beratungsunternehmen aus Leipzig. Einer der Schwerpunkte des Unternehmens ist Personalmanagement.

Viele Agrarbetriebe leiden unter dem Arbeitskräftemangel. Aufbau und Pflege einer Arbeitgebermarke können helfen, meint Martin Schneider im Interview.
Herr Schneider, der Fachkräftemangel in den deutschen Wirtschaftsbranchen ist in aller Munde. Auch auf den Landwirtschaftsbetrieben ist er zu spüren. Wie schlimm ist es?
Martin Schneider: Herausfordernd und für manche Betriebe bereits existenziell. Insbesondere in den ostdeutschen Flächenländern merken wir, dass die sogenannte Baby Boomer-Generation nun in Rente geht. Dies entzieht dem Arbeitsmarkt Arbeitskräfte, da nachfolgende Generationen nicht so geburtenstark sind. In manchen Regionen Ostdeutschlands sind fünf bis fast zehn Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung verloren gegangen – und zwar innerhalb von fünf Jahren. Das ist dramatisch.
Womit kann die Landwirtschaft im Wettlauf um Arbeitskräfte punkten?
Die Landwirtschaft kann abwechslungsreiche Arbeitsplätze liefern und eine wirklich sinnstiftende Tätigkeit ermöglichen. Meist sind die Teams auf den Betrieben nicht sehr groß. Da gibt es sicherlich
Unterschiede zur Arbeit am Fließband oder zu größeren Konzernstrukturen. Aber selbstverständlich ist es die Aufgabe der Unternehmen, interessante Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen anzubieten. Was kann es Sinnstiftenderes geben, als hochwertige und nachhaltige Nahrungsmittel bzw. Rohstoffe zur Erzeugung von Nahrungsmitteln herzustellen? Dies gilt es zu kommunizieren.
Die sogenannten Baby Boomer gehen in Pension, jüngere Generationen kommen in den Arbeitsmarkt. Ändern sich damit die Ansprüche an den Arbeitgeber?
Eindeutig ja! Nachdem die Baby Boomer nun nach und nach in Rente gehen und sich die Generation X bereits in der zweiten Lebensarbeitshälfte befindet, kommen jetzt die Vertreter der Generation Z verstärkt in die Arbeitswelt. Hier merken wir, dass sich insbesondere diese Generation von den vorherigen in ihren Ansprüchen an die Arbeitsumwelt unterscheidet.
RIND & GRÜNLAND | 59

GENERATIONEN
• Babyboomer (1946-1965)
• Generation X (1965-1980)
• Generation Y (1980-1995) –auch als Millennials bezeichnet
• Generation Z (1995-2010)
• Generation Alpha (2010-2025)
Inwiefern?
In der Generation Z wird mehr hinterfragt als bei den Vorgängern. Arbeitskräfte aus dieser Generation legen besonderen Wert auf einen aus Ihrer Sicht optimalen Mix aus Arbeitsleben und Freizeit. Außerdem möchten sie mit der Arbeit etwas Sinnvolles bewirken. Es gibt Studien die aussagen, dass diese Generation die erste ist, für die Sinn als oberstes Kriterium der Berufswahl gilt.
Lassen sich Generationen tatsächlich nach Hauptmerkmalen definieren?
Menschen unterscheiden sich dadurch, wie sie in ihrer Entwicklungs- und Ausbildungszeit sozialisiert wurden. In der Generation X sehen wir Präferenzen für geradlinige Lebensläufe. Dies sind insbesondere in Ostdeutschland Kinder der deutschen Teilung, die ihre Jugend in der Wendezeit erlebten und hier viele Brüche in Lebensläufen sahen. Die darauffolgende Generation Y wuchs in den stabileren Verhältnissen der Nachwendezeit auf. Diese Generation ist gekennzeichnet durch ein gesundes Selbstbewusstsein, die Menschen sind weltoffen. Vertretern dieser Generation ist eine sinnerfüllende Arbeit wichtig und auch eine geregelte Freizeit. Die derzeit in das Berufsleben einsteigende Generation Z ist im Internetzeitalter aufgewachsen, sie ist besonders technikaffin. In Studien wird diese Generation im Vergleich zu den vorhergehenden Generationen als eher entscheidungsschwach und unverbindlich charakterisiert. Andere Studien be-
sagen, dass ein großer Anteil dieser Generation für sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Unternehmen arbeiten möchte. In dieser Generation wird mehr verglichen und grundsätzlich hinterfragt.
Agrarbetriebe sind ja durchaus sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Unternehmen. Tatsächlich kennen wir auch Landwirtschaftsbetriebe, die keine Probleme mit Arbeitskräftemangel haben. Sie sind gut darin, eine eigene Arbeitgebermarke zu pflegen und reagieren in der Personalführung auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Wer als Landwirtschaftsbetrieb zukünftig erfolgreich sein will, muss gute Arbeitskräfte finden und ans Unternehmen binden. Das ist eigentlich Chefsache Nummer 1.
Was meinen Sie mit dem Begriff Arbeitgebermarke?
Das bedeutet, dass ein Betrieb ein Werteversprechen und ein Unternehmensleitbild kommuniziert – für aktuelle und künftige Mitarbeiter, für das gesamte Betriebsumfeld und für die Region. Förderlich für einen guten Ruf ist zum Beispiel ein gepflegtes und ordentliches Hofbild. Imagefördernd ist, dass man für ein gutes Branchenimage kämpft und natürlich, dass man attraktive Arbeitsbedingungen schafft. Vorteilhaft ist, wenn der Betrieb technisch gut ausgestattet ist und selbstverständlich auch angemessen entlohnt. Unbedingt muss
60 | RIND & GRÜNLAND
Martin Schneider empfiehlt Agrarbetrieben, eine eigene Arbeitgebermarke zu pflegen und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu reagieren.
Fotos: Landpixel (2), privat (1)
„Wer als Landwirtschaftsbetrieb zukünftig erfolgreich sein will, muss gute Arbeitskräfte finden und ans Unternehmen binden.“
man auch der Landwirtschaft angepasste, aber geregelte Arbeitszeiten sicherstellen.
Was gehört noch zur Mitarbeiterführung? Wir empfehlen regelmäßige (mindestens jährliche) Mitarbeitergespräche. Diese werden im Vier-Augen-Prinzip zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem durchgeführt. Darin nimmt man sich außerhalb des täglichen Alltagsstresses Zeit. Zum Alltag sollten unbedingt auch die regelmäßige Mitarbeiterweiterbildung sowie insbesondere die Weiterbildung von Führungskräften gehören. Erfolgreiche Betriebe pflegen ein betriebsübergreifendes und jederzeit aktuelles Controllingsystem, womit betriebswirtschaftliche und produktionstechnische Kennzahlen verglichen und bewertet werden. Ausgewählte Kennzahlen daraus sollten auch an Mitarbeiter kommuniziert werden, sodass das tägliche Handeln zahlenmäßig belegt werden kann. Dies ist auch eine gute Grundlage für ein leistungsabhängiges Vergütungssystem.
Stichwort Mitarbeitergespräche: Welche Themen sollten darin angesprochen werden? Wir empfehlen unseren Mandanten, für solche Gespräche einen strukturierten Rahmen zu wählen. Dies kann beispielweise auf Grundlage eines Fragebogens basieren, den der Mitarbeiter und auch der Vorgesetzte in Vorbereitung auf das Gespräch aus-
füllen. Darin wird zunächst das vergangene Jahr reflektiert: Welche Aufgaben haben Kraft gekostet und was lief gut? Anschließend fokussiert man sich auf die kommende Periode und legt neue Ziele fest bzw. identifiziert Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit. Im Folgenden sollte eine Selbst- und Fremdeinschätzung hinsichtlich der sogenannten „weichen Faktoren“ erfolgen. Zunächst schätzt sich der Mitarbeiter ein und diese Einschätzung wird dann vom Vorgesetzten gespiegelt. Hier lassen sich erfahrungsgemäß so manche Gemeinsamkeiten finden, aber auch Unterschiede in der Wahrnehmung herausarbeiten. Schlussendlich definiert man daraus konkrete Jahresziele, die schriftlich fixiert werden und in die Personalakte gehören.
Ein letzter Tipp an die Agrarbetriebe? Wir müssen so schnell wie möglich lernen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gezogenen Menschen in den Agrarbetrieben als Arbeitskräfte zu integrieren. Erfolgreiche Betriebe praktizieren das bereits und haben damit zum Teil sehr gute Erfahrungen gesammelt. Fest steht, dass die berufstätige Bevölkerung zahlenmäßig in unserem Land weiter abnehmen wird. Mittlerweile gibt es bereits Dienstleister und Institutionen, die bei der Suche von zugewanderten Menschen für den Arbeitsmarkt helfen und ihre Integration unterstützen.



BIOFUTTER






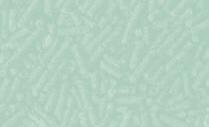

Maren Maitra, Tel. 0172 446 0465 maitra@bio-futter.sh für Schleswig-Holstein
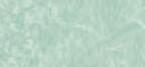

Thies Thamling, Tel. 0162 765 4297 thies.thamling@bio-futter.sh

Jetzt mit zwei Werken in Bassum und neu in Süderbrarup


Telefon 04321 990-105 saaten@gut-rosenkrantz.de

Bio-Futter DE-ÖKO-006 Saatgut und Getreidehandel DE-ÖKO-001 www.bio-futter.sh www.gut-rosenkrantz.de

(nur Handelsgesellschaft)
Getreide-Team
GETREIDEHANDEL Saatgut-Team
Telefon 04321 990-102 getreide@gut-rosenkrantz.de
SAATGUT Kontrollstellen: Bio - Futter & Saatgut aus dem Norden! Wir sind für Sie da. ANZEIGE

Das deutsche Bundesprogramm zum Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung unterstützt Schweinehalter nicht nur bei Investitionen, auch die laufenden Mehrkosten sollen damit gefördert werden. Ab sofort können Sie einen Antrag stellen. Das sollten Sie möglichst rasch machen. DIE NEUE
Bundesförderung
ZUR SCHWEINEHALTUNG
62 | SCHWEIN & GEFLÜGEL

AUTOR
Philip Köhler
Beratung für Naturland p.koehler@ naturland-beratung.de
Der Umbau zu einer artgerechten landwirtschaftlichen Tierhaltung wurde bereits im Koalitionsvertrag 2021 verankert. Drei Jahre später ist es nun so weit: Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat im Frühjahr zwei Richtlinien veröffentlicht, welche die finanzielle Förderung für den Umbau der Schweinehaltung regeln. Dabei wird der Zugang zu Außenklima, Auslauf oder Bio gefördert. Neben einem Zuschuss für Investitionen werden auch die laufenden Mehrkosten für artgerechte Haltungsbedingungen finanziell unterstützt.
Förderung laufender Mehrkosten
Für einen Antrag auf Förderung der laufenden Mehrkosten ist es nötig, dass der landwirtschaftliche Betrieb von der BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) vorab als förderfähig anerkannt wird. Als Naturland-Schweinehalter sind Sie hier bereits gut aufgestellt. Viele der geforderten Kriterien halten Sie bereits ein. Zusätzlich zu den bereits über die Naturland-Kontrolle bestätigten Bedingungen sind weitere Punkte zu erfüllen:
• Zugang zu einer Kühlmöglichkeit für alle Tiere (außer im Abferkelbereich)
• Permanente Möglichkeit zum Saufen aus offener Tränke-Fläche für alle Tiergruppen jeweils im Verhältnis 1:12

AUTOR
Roman Goldberger
Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de
• Zapfentränken für Aufzuchtferkel und Mastschweine im Verhältnis 1:12
• Einhaltung der 5 m² im Deckzentrum (Die Übergangsregelung bis 2029 gem. Tierschutznutztier-Haltungsverordnung wird nicht in Anspruch genommen)
• Berufliche Qualifikation der Betriebsleitung (Ausbildung, Studium oder mehr als fünf Jahre Berufserfahrung)
• Weiterbildungsnachweis der für die Bestandsbetreuung verantwortlichen Person über mindestens 8 h/Jahr zu Themen der tierwohlgerechten Schweinehaltung
• Betreuungsvertrag mit einer Tierarztpraxis
Außerdem muss der Betrieb Mitglied einer von der BLE anerkannten Organisation sein oder an einem anerkannten Kontrollsystem teilnehmen. Aus Gründen der Praktikabilität wird beim Bundesprogramm Umbau der Tierhaltung auf bestehende Strukturen aufgebaut. Das bedeutet, dass Organisationen und Kontrollstrukturen, welche die Einhaltung der Kriterien durch ihre Mitglieder bzw. Teilnehmenden sicherstellen können, anerkannt werden. Naturland hat sich um Anerkennung als Organisation bei der BLE beworben und geht von einem positiven Ergebnis aus. Ab Juni können Sie als Naturland-Mitglied einen Antrag auf Förderfähigkeit stellen.
Mehrkostenpauschalen pro Tier und Obergrenzen der Förderung laufender Mehrkosten
SCHWEIN & GEFLÜGEL | 63
&
Bio Stufe 1 (80 % Förderung) Stufe 2 (70 % Förderung) Sauen 503 Euro 50 Sauen 200 Sauen Aufzuchtferkel 25,12 Euro 1.500 aufgezogene Ferkel 6.000 aufgezogene Ferkel Mastschweine (MS) 37 Euro 1.500 verkaufte MS 6.000 verkaufte MS

Eine Voraussetzung für die neue Förderung ist der Zugang zu einer Kühlmöglichkeit für alle Tiere. Sprühanlagen eignen sich dafür.
Beispiel mit 8.000 verkauften Öko-Mastschweinen pro Jahr
• 1.500 Mastschweine zu 80 % gefördert:
1.500 x 37 € x 80 % = 44.400 €
• 6.000 Mastschweine zu 70 % gefördert:
6.000 x 37 € x 70 % = 155.400 €
• Die übrigen 500 Schweine werden nicht gefördert, weil sie die Obergrenzen überschreiten.
Im neuen Förderprogramm werden auch die laufenden Mehrkosten tiergerechter Haltungsformen gefördert.

Bitte beachten: Es ist wichtig, hier schnell zu sein, da die Reihenfolge der Anerkennung über die mögliche Auszahlung entscheidet (Windhund-Verfahren). Dazu benötigen Sie ein ELSTER-Unternehmenskonto. Als Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen wird eine zusätzliche Checkliste bei der Naturland-Jahreshauptkontrolle ausgefüllt. Nach der Anerkennung der Förderfähigkeit, können Sie im Folgejahr bis 31. März 2025 den Auszahlungsantrag für 2024 stellen.
Fördersätze
Wie hoch die Förderung ausfällt, hängt von Haltungsform und Tierzahl ab. Je nach Haltungsform haben das Thünen-Institut und das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft Mehrkostenpauschalen ermittelt. Für das Förderjahr 2024 gelten die Pauschalen der Tabelle. Diese sind in zwei Stufen förderfähig. Bis zu 50 Sauen, 1.500 aufgezogenen Ferkeln oder 1.500 verkauften Mastschweinen werden in Stufe 1 mit 80 % der Mehrkostenpauschale gefördert. Tiere über diesen Obergrenzen werden zu 70 % gefördert (Stufe 2) und Schweine über den Obergrenzen der Stufe 2 werden nicht gefördert. Auch wenn mehr als die Tierzahl in Stufe 1 gehalten wird, wird die der Stufe 1 entsprechende Tierzahl zu 80 % gefördert. Die darüberhinausgehende Tierzahl wird in Stufe 2 bis zu deren Obergrenze zu 70 % der Mehrkosten gefördert. Es können daher auch Betriebe, die mehr Tiere halten, gefördert werden.
In der Sauenhaltung wird der Durchschnittsbestand produktiver Sauen ab dem ersten Wurf betrachtet. Bei Ferkeln ist die Zahl verkaufter oder in die Mast umgestallter Tiere maßgeblich, in der Mast die Zahl verkaufter Mastschweine.
Stellen Sie den Antrag auf Anerkennung des Betriebes unabhängig von Fördermaßnahmen der Länder. Durch den Antrag auf Anerkennung des Betriebes als förderfähig und dessen Bestätigung entsteht keine Doppelförderung. Erst beim Auszahlungsantrag im März 2025 ist darauf zu
64 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
Roman Goldberger, Martina Kozel, Bioschwein Austria
Fotos:
achten, dass nur die Tiere und Haltungseinrichtungen bzw. Zeiträume gefördert werden, die nicht über andere Programme abgedeckt sind.
Förderung für Neu- und Umbau
Neben der Förderung der laufenden Mehrkosten unterstützt das Bundesprogramm zum Umbau der Tierhaltung auch landwirtschaftliche Betriebe beim Um- oder Neubau tierwohlgerechter Schweineställe. Dabei darf jedoch der Tierbestand laut Richtlinie nicht ausgebaut werden. Mit den Naturland-Richtlinien erfüllen Sie gleichzeitig auch die Anforderungen des Bundesprogramms. Die Förderquote ist – je nach
Höhe des gesamten Investitionsvolumens – gestaffelt:
• 60 % bis 500.000 Euro
• 50 % für weitere 1.500.000 Euro
• 30 % für weitere 3.000.000 Euro.
Damit ist die Förderung pro Betrieb auf ein förderfähiges Investitionsvolumen von 5 Mio. Euro begrenzt. Diese Obergrenze kann während der Laufzeit dieser Richtlinie (bis 2030) höchstens einmal pro Betrieb ausgeschöpft werden. Zusätzlich können weitere staatliche Beihilfen bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank beantragt werden. Bei Fragen wenden Sie sich an die Beratung für Naturland.

ANZEIGE
Es fehlenzwei bis drei Cent

Bernhard Brand im Interview

AUTOR
Roman Goldberger
Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de
Erst vor wenigen Monaten wurde der Bio-Legehennen e. V. gegründet. Sein
Ziel: Verbandsbetriebe stärken. Wir haben mit dem ersten Vorsitzenden Bernhard Brand gesprochen.
66 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
„Unser Ziel sind kostendeckende Erzeugerpreise für Verbandsware.“
Herr Brand, warum wurde der Bio-Legehennen e.V. gegründet?
Weil wir in den vergangenen beiden Jahren de solate Preise und gestiegene Kosten hatten. Eini ge Betriebe mussten sogar die Finanzierung ihres Stalls um fünf Jahre verlängern. Damit wurde ein Problem verschoben, aber nicht gelöst.
Wie wollen Sie das Problem lösen?

Unser Ziel sind kostendeckende Erzeugerpreise für Verbandsware. Es fehlen zwei bis drei Cent. Im ersten Schritt wollen wir Kosten-Bewusstsein bei den Betrieben und in der gesamten Wertschöpfungskette schaffen. Dazu möchten wir den Informationsaustausch forcieren. In den vergangenen Jahren lag der Blick vieler Betriebe fast ausschließlich auf den Futterkosten. Beinahe unbemerkt sind nach und nach auch die anderen Kosten gestiegen. Das ist aber weder bei allen Betrieben noch bei den Partnern der Wertschöpfungskette angekommen.
Der Bio-Legehennen e.V. spricht Verbandsbetriebe an. Warum?
Als Verbandsbetriebe haben wir höhere Standards einzuhalten als EU-Bio-Betriebe. Wir erzeugen mindestens die Hälfte der Futterversorgung selbst oder in Kooperation mit einem VerbandsAckerbaubetrieb. Wir haben Stall-Obergrenzen, die bei Naturland zum Beispiel bei maximal vier Einheiten á 3.000 Legehennen liegen. Wie sollen wir mit einem EU-Bio-Betrieb konkurrieren, der seine 30.000 Hühner ohne eigene Futterbasis mit importierter EU-Bio-Ware füttert und vielleicht nicht mal den gesamten Betrieb umgestellt hat? Da müssen wir uns preislich viel stärker unterscheiden.
Wenden Sie sich mit Preisforderungen an die Packstellen?
Es scheint, dass vielen Packstellen die schwierige Situation der Legehennenhalter nicht bewusst ist und der Handel davon erst gar nicht erfährt. Wir wollen daher bei der gesamten Wertschöpfungskette Bewusstsein für unsere Situation schaffen. Wir müssen einen Weg finden, mit dem alle in der Kette überleben können – angefangen vom Ko-

operations-Ackerbauern, der das Futter liefert, über den Legehennenhalter, bis zur Packstelle und zum Handel. Für diese Ziele brauchen wir Mitglieder, um Größe und Stärke auszustrahlen.
Welche Größe streben Sie an?
Unser Ziel ist, circa 40 % der Verbands-Legehennenplätze in Deutschland in unserer Erzeugergemeinschaft zu bündeln. Damit werden unsere Forderungen an Gewicht gewinnen. Einen Einzelbetrieb kann man als Marktpartner schnell mal in die Schranken weisen, eine entsprechend große Erzeugergemeinschaft aber nicht.
Wie groß ist die Unterstützung der anderen Bio-Verbände?
Wir befinden uns in Gesprächen mit den Verbänden Bioland und Naturland. Diese spielen in der Ei-Vermarktung eine wichtige Rolle, weil sich alle großen Lebensmittelketten jeweils für einen Verband entschieden haben. Unsere Mitglieder repräsentieren verschiedene Bio-Verbände, weshalb wir als Erzeugergemeinschaft die Interessen aller Verbandsmitglieder vertreten.
MITGLIED WERDEN
Das Interview mit Bernhard Brand hat Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen zum Beitritt der Erzeugergemeinschaft Bio-Legehennen e.V. finden Sie online unter www.biolegehennen.de.
Gerne wenden Sie sich auch an Ihren Berater.
SCHWEIN & GEFLÜGEL | 67
Fotos: Birgit Waterloh, Agrarfoto

7 TIPPS BEI HITZESTRESS
68 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
Die ideale Temperatur ist ein großer Faktor, um das Wohlbefinden der Tiere zu steigern - und damit auch die Wirtschaftlichkeit. Die folgenden Tipps sollen dabei helfen, genau das beim Federvieh zu erreichen.
Mit zunehmenden Temperaturen im Sommer und den häufigeren Wetterextremen wird es immer wichtiger, das Stallmanagement daraufhin anzupassen. So sollte bei den täglichen Stalldurchgängen genau beobachtet werden, wie sich die Tiere verhalten und ob das Stallklima stimmt. Im Gegensatz zur Aufzuchtphase muss in der Mast und bei Legehennen besonders auf eine gute Wärmeableitung und Kühlung geachtet werden. Da das Geflügel keine Schweißdrüsen besitzt, kann es sich im Sommer nur eingeschränkt selbst abkühlen. Es kommt zu zunehmender Schnabelatmung, vermehrtem Hecheln und Abspreizen der Flügel. Der Auslauf wird dann häufig nur noch in den kühlen Phasen des Tages genutzt. Sinkender Futterverbrauch und steigender Wasserverbrauch sind die Folgen. Dadurch können sich beim Mastgeflügel die Gewichtszunahme und bei Legehennen Eiqualität und Eigröße verschlechtern. Im schlimmsten Fall kann es in der Mast zu Dehydration und weiter zu Kreislaufversagen kom-
men. Auch Federpicken und Kannibalismus sind bei zu hohen Temperaturen häufiger zu beobachten.
Technische Anzeichen
Neben den Signalen der Tiere selbst sind Messwerte wie Außen- und Stalltemperaturen, Luftfeuchte und Enthalpiewert wichtige Parameter für die Erfassung von Hitzestress. Der Enthalpiewert ist von besonderer Bedeutung, da er die Wärmebelastung der Luft beschreibt und somit Temperatur und Luftfeuchte vereint. Auf der Website des Deutschen Wetterdienstes kann man sich über die Enthalpiewerte der kommenden Tage informieren (siehe Infobox). Von starkem Hitzestress spricht man ab 67kJ/kg (70% Luftfeuchtigkeit, 27 Grad). Mit folgenden Tipps kann der Hitzestress bei Geflügel an heißen Tagen reduziert werden.
Tipps bei Hitzestress:
Überprüfen Sie die Lüftung regelmäßig auf Funktionsfähigkeit. Gegebenenfalls kann die Lüfterrate tagsüber erhöht und abends bei Temperaturabfall wieder angepasst werden. Bei Ställen mit natürlicher Lüftung sollten zusätzliche Lüfter aufgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie gebraucht werden, steigt in Zeiten des Klimawandels.
Zugluft ist in jedem Fall zu vermeiden.
„Da das Geflügel keine Schweißdrüsen besitzt, kann es sich im Sommer nur eingeschränkt selbst abkühlen.“
Der Deutsche Wetterdienst bietet als Warnindex eine Überblickskarte mit dem jeweiligen Tagesmaximum der Enthalpie für den aktuellen Tag und die vier Folgetage. Über den QR-Code gelangen Sie auf diese Website.



SCHWEIN & GEFLÜGEL | 69
1.
TIPP




AUTOR
Hans-Peter Jud
Beratung für Naturland hp.jud@ naturland-beratung.at
Verfügen Sie über eine Hochdruck-Sprühkühlung, sollte diese an heißen Tagen auch eingesetzt werden. Leistungsfähige Systeme vermögen die Stalltemperatur um bis zu acht Grad abzusenken. Zudem kann eine Hochdruck-Sprühanlage in extrem trockenen Stallungen eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Solche Anlagen eignen sich auch gut, um beispielsweise Effektive Mikroorganismen im Stall zu versprühen.
Die Einstreu muss frisch und trocken sein, streuen Sie gegebenenfalls in den frühen Morgenstunden großzügig nach.
Da der Wasserverbrauch steigt, ist es besonders wichtig, die Wasserleitung regelmäßig zu prüfen. Das Wasser soll frisch und kühl (10 bis 15 °C) sein, das kann durch eine regelmäßige Spülung der Tränkeleitungen erreicht werden.
Die Gabe von Vitamin C unterstützt die Tiere beim Umgang mit der Hitze und der Stoffwechsel wird gestärkt. Vitamin C bekommen Sie von Ihrem Tierarzt oder Futtermittelvertreter. Wichtig zu beachten ist, dass das Präparat biologisch zugelassen sein muss.
1 Bei Hitze kann die Lüfterrate tagsüber erhöht und abends bei Temperaturabfall wieder angepasst werden.
2 Bäume und Büsche sind effektive Schattenspender im Auslauf. Fehlen diese Elemente, wird der Auslauf oft nur noch in den kühlen Phasen des Tages genutzt.
3 Sind noch keine Bäume und Büsche im Auslauf, können kurzfristig Überdachungen, Hütten etc. aufgebaut werden.
70 | SCHWEIN & GEFLÜGEL
1 2 3
2.
3. 4. 5.
Um die Tiere im Auslauf gut vor der Hitze schützen zu können, ist es wichtig, dass dieser strukturiert ist. Schutzgebende Elemente bieten kühlenden Schatten und direkte Sonneneinstrahlung wird vermieden. Sind noch keine Bäume und Büsche im Auslauf, können kurzfristig Überdachungen, Hütten etc. aufgebaut werden.
Wir sind auch Öko!

Zertifziert: DE-037-ÖkoKontrollstelle

» Öko-Kleegras- und Zwischenfruchtmischungen für alle Lagen und Nutzungen (auch Stilllegung)
» Utrisha N - biologischer Luftstickstoff-Fixierer für Getreide + Mais
» An- und Verkauf von Öko-Futter- und Backgetreide, sowie Öko-Heu und Stroh
Gerne würden wir Sie auf unserem 23. Öko-Feldtag am Do, 4. Juli um 14 und 17 Uhr bei Heindl in Öd 1, 83527 Kirchdorf begrüßen!
Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land
Betrieb St. Wolfgang Raiffeisenstr. 3, 84427 St. Wolfgang Tel. 0 80 85 - 15 32 www.rwg-erdinger-land.de www.bio-kleegras.de
KURZ & KNAPP
Die hohe Umgebungstemperatur in den Sommermonaten ist eine Herausforderung in der Geflügelhaltung – besonders in Zeiten, in denen das Klima extremer wird. Mit den richtigen Management- und Haltungsmaßnahmen kann aber effektiv entgegengewirkt werden. Bereits in der letzten Ausgabe der Naturland Nachrichten haben wir Ihnen Tipps gegeben, wie Sie Ihren Stall technisch auf die Hitze vorbereiten. Die Hinweise in diesem Artikel können Sie kurzfristig anwenden. Bereiten Sie sich in jedem Fall früh auf die bevorstehenden Hitzewellen vor.


Günstige Neugeräte in bewährter Qualität
POM Leichtgrubber Meteor 3 - 7,5 m
5,0 m mit Rohr- o. Stabwalze €
+ Mwst. und Fracht

Weitere Angebote: Ballenwagen, Kurzscheibeneggen ... finden Sie auf unserer Homepage!
Erhöhen Sie den Energie- und Mineralstoffgehalt im Futter, um insgesamt die geringere Futteraufnahme zu kompensieren. 6. 7. Tel. 0 71 56 / 95 92 04



ANZEIGEN





Neue Größe 78 x 80 mm















SCHWEIN & GEFLÜGEL | 71
www.mezger-landtechnik.de
Jud
Wir sind Mitglied ökologischen Hier wächst Bio-Kleegras in Naturland Qualität HEUTE SCHON ÜBER DEN FELDRAND GESCHAUT? von Kleegras Öko-Landbau fürdie Bodenfruchtbarkeit, satz mineralisch-synthetischen ist hier dafür, dass Ackerboden wird. Klee gehört den Leguminosen, den Sticksto die nachfolgenden bereit- sorgen intensive Kleegrasanbau ist der derökologischen Eristwichtig xierung im für Zudem kann gras aufÖko-Betriebenvielseitig werden: eigenen Naturland Mulchauflage für die Stromerzeugung Die Gär- substrate wiederum wertvoller eingesetztwerden. Naturland Verband für ökologischen Landbau e.V. Mitglieds-Nr: 12345 zertifiziert nach den Richtlinien Öko-Kontrollnummer: DE-ÖKO-123 ERZEUGNIS AUS ÖKOLOGISCHEM LAND- UND GARTENBAU GEMÜSE Erzeuger/abgepackt Gew./Anz./Größe: EG-Kontroll-Nr.: ERZEUGNIS AUS ÖKOLOGISCHEM LAND- UND GARTENBAU OBST Produkt EG-Kontroll-Nr.: Ursprungsland: Öko-Kontrollstelle: EINFACH UND BEQUEM ONLINE BESTELLEN, IN WENIGEN TAGEN GELIEFERT!
dem Code NL_START10 gibt es 10 % RABATT auf Ihren ersten Einkauf. NATURLAND-DRUCKSHOP.DE HAST DU WAS ZU DRUCKEN? EINFACH AUF NATURLANDDRUCKSHOP.DE GUCKEN!
Fotos:
(3), Agrarfoto (2)
Mit
erfolgreich umbrechen Kleegras


Beratung für Naturland j.weiss@ naturland-beratung.de

AUTORIN Annemarie Ohlwärter
Beratung für Naturland a.ohlwaerter@ naturland-beratung.de &
72 | ACKERBAU & TECHNIK
AUTOR Johannes Weiß

So wichtig Kleegras für Bio-Fruchtfolgen ist, so herausfordernd ist der Umbruch. Erfolgt dieser zum falschen Zeitpunkt, kann viel vom fixierten Stickstoff wieder verloren gehen. Auch die Durchwuchsgefahr in der Folgefrucht ist groß. Ein Gespür für Technik und Zeitpunkt ist gefragt.
Kleegras bringt viele Vorteile im ökologischen Landbau: Von der primären Futterproduktion über die symbiontische Stickstofffixierung bis hin zum Aufbau eines stabilen Bodengefüges –und dies sind nur einige der vielen positiven Wirkungen. Auch die Senkung des Beikrautdrucks durch mehrmaliges Mähen und Unterdrücken des Unkrautes ist ein wichtiger Aspekt für die gesamte Fruchtfolge. Insbesondere in trockeneren Regionen wird hierbei oft auf die Luzerne als die „Königin der Futterpflanzen“ gesetzt. Nach dem Ende der Standzeit wird jedoch insbesondere bei Luzerne der Umbruch zur Herausforderung. Ziel ist es, Durchwuchs in den Folgekulturen zu verhindern und Nährstoffverluste zu minimieren. Neben dem Zeitpunkt des Umbruchs und der verwendeten Technik spielt dabei auch die Auswahl der Nachfrucht eine wichtige Rolle.
Verluste vermeiden
Durch den Nährstoffaufschluss des Kleegrases und den gespeicherten Stickstoff der Leguminosen ist eine positive
ACKERBAU & TECHNIK | 73

Eine intensive und mehrmalige Bodenbearbeitung bewirkt eine Stickstofffreisetzung durch Mineralisierung, was in ungünstigen Fällen Stickstoffverluste zur Folge haben kann.
Düngewirkung für die Folgekulturen gewährleistet. Im Umkehrschluss bewirkt die meist intensive Bodenbearbeitung aber auch eine Stickstofffreisetzung durch Mineralisierung, was in ungünstigen Fällen Stickstoffverluste zur Folge haben kann, insbesondere während den immer milderen, regenreichen Wintermonaten. Diese Verluste gilt es möglichst zu vermeiden. Bei vielen Öko-Betrieben steht Wintergetreide, klassisch Winterweizen oder Dinkel, nach Kleegras. Dies bedingt einen Umbruch im (Spät-)Herbst vor der unmittelbaren Saat. Die mit dem Umbruch beginnende Mineralisierung birgt die Gefahr der Stickstoffauswaschung über den Winter – welche umso größer ist, je leichter und flachgründiger die Böden sind. Eine Sommerung als Folgekultur, idealerweise Mais, passt hinsichtlich der Stickstoffmineralisierung und des Nährstoffbedarfs bes-
ser zu Kleegras. Jedoch kann das nicht jeder Betrieb so einfach umsetzen. Zudem bringen Klimaänderung und GLÖZ-Vorgaben neue Herausforderungen und Einschränkungen mit sich.
Umbruchszeitpunkt
Nicht zuletzt hat die Bodenart, die Witterung und die Bearbeitungsintensität einen bedeutenden Einfluss auf die Mineralisierung der Nährstoffe. So ist beispielsweise ein Kleegrasumbruch im Frühjahr vor Sommergetreide auf einem leichten Standort in der Regel umsetzbar – nicht jedoch auf einem schweren Standort, welcher eine entsprechende Bearbeitung meist nur später im Jahr erlaubt.
Wie in der Abbildung (rechts) gut zu erkennen ist, sind Folgefrucht, Standort, Bodenart und Witterung entscheidend für eine gute Umbruchstrategie. Wichtig
ist: Neben all den Anbau- und witterungstechnischen Faktoren kommen immer mehr „politische“ Faktoren wie GLÖZ- oder Düngeverordnungsauflagen hinzu, die beachtet werden müssen. Die erste Abbildung symbolisiert einen leichten Boden mit einer geringen Wasserund Nährstoffhaltefähigkeit. Abhängig von den klimatischen Bedingungen lässt sich ein Kleegrasumbruch im Frühjahr am ehesten auf einem leichten Standort mit folgender Sommerung realisieren. Bei einem mittleren Boden kann der Standort bereits etwas mehr Wasser halten, sodass die im Boden gelösten Nährstoffe langsamer ausgewaschen werden. Auf solchen Standorten könnte sich ein Umbruch im Spätherbst gut eignen, um den Kompromiss zwischen dem Anbau einer profitablen Winterung (z. B. Qualitätsweizen) und der Verminderung der Nitratauswaschung zu
74 | ACKERBAU & TECHNIK
Pflanzen- entwicklung
Nitratdynamik in Boden
Pflanzen- entwicklung
Nitratdynamik in Boden
Pflanzen- entwicklung
Nitratdynamik in Boden
Kleegras
Frühjahrsum bruch
Sommergetreide leichter Boden
Kleegras
Quelle: Haas (2010) nach Faßbender & Heß später Herbstumbruch
üblicher Herbstumbruch
Kleegras
Wintergetreide
da überwinternder Kleegrasbestand
geringe Nitrataustragsgefahr
mittlerer Boden
Wintergetreide
da später Umbruch und mittlere Feldkapazität
geringe Nitrataustragsgefahr
da hohe Feldkapazität
geringe Nitrataustragsgefahr
schwerer Boden
SONDJFMAMJJA
Monat im Jahr
finden. Bei einem schweren Boden, der viel Wasser aufnehmen und speichern kann, ist ein Umbruch im Frühherbst vertretbar, da die Auswaschungsgefahr hier am geringsten anzusehen ist. Nichtsdestotrotz muss man aber immer die Praxis im Auge behalten: Die Entscheidung für den perfekten Umbruchszeit-
Welche Technik?
Es gibt viele Maschinen und Techniken für die Bodenbearbeitung. Auch neuartige Entwicklungen kommen ver-
punkt und die Nachfrucht hängt meist nicht von einem einzelnen Faktor ab. Vielmehr kommen zu den bisherigen Überlegungen noch wirtschaftliche und vermarktungsabhängige Faktoren dazu, um die Kultur nach dem Kleegras optimal zu nutzen. Hinzu kommen nun auch GLÖZVorgaben (Umbruchszeitpunkt etc.) sowie das inzwischen deutlich erhöhte Risiko von Frühjahrstrockenheit.
ACKERBAU & TECHNIK | 75

mehrt auf den Markt. Etabliert haben sich in der Praxis bisher größtenteils die drei Technikklassen Pflug, Grubber und Fräse.
Pflug
Der Pflug ist wohl der Klassiker für den Umbruch und hat weiterhin seine Berechtigung. Die Vorteile liegen auf der Hand: ein reiner Tisch für das Saatbeet und wenig bis keine Probleme mit Grassoden. Jedoch kommt es auf die Zusammensetzung des Kleegrasbestandes an, ob ein einmaliger Pflugeinsatz für den effektiven Umbruch ausreicht. Insbesondere die Luzerne mit ihrer tiefreichenden Pfahlwurzel sollte unbedingt vor dem Pflügen am Wurzelhals abgetrennt werden. Je mehr Wurzel am Vegetationskegel verbleibt, desto
Ziel des Umbruchs von Klee und Luzerne ist ein ganzflächiger Schnitt, bei dem Wurzel und Spross sicher getrennt werden, um den Wiederaustrieb bestmöglich zu vermeiden (links).
Die Fräse hat insbesondere bei viel Biomasse und grasrei-


mehr Energiereserven verbleiben an diesem - dementsprechend stärker ist der Wiederaustrieb der Luzerne. In der Praxis hat sich daher eine flach schneidende Bearbeitung mit einem Grubber – vorzugsweise mit Gänsefußscharen – und anschließender Pflugfurche etabliert
Grubber
Soll es eine pfluglose Bearbeitung des Kleegrasbestandes sein, kann eine mehrmalige Bearbeitung mit dem Grubber durchgeführt werden. Allerdings sind hier mehrere Bearbeitungsgänge nötig, was eine trockene Witterung zwingend voraussetzt, damit Grassoden und auch der Klee nachhaltig abgetötet werden. Hier kommt der Praktiker schnell in ein Dilemma:
Je früher ich mit dem Umbruch beginne, desto mehr Zeit bleibt für mehrere Bearbeitungsgänge und desto wahrscheinlicher ist der Eintritt von trockener und sonniger Witterung. Gleichzeitig steigt aber bei höheren Bodentemperaturen auch die Geschwindigkeit der Stickstoffmineralisierung. Das heißt: Je früher ich mit dem Kleegrasumbruch beginne, desto höher ist die Gefahr eines hohen Stickstoffgehaltes im Herbst, der nicht bzw. nur sehr geringfügig von einer Winterung genutzt werden kann. Bei mehreren Durchgängen mit dem Grubber sollte mit jeder Überfahrt tiefer als bei der vorherigen gearbeitet werden. Damit wird der Boden als Gegenschneide genutzt und ein Ausweichen der Wurzeln vor dem Schar wird verhindert.
76 | ACKERBAU & TECHNIK
Fräse
Als dritte Option in der Maschinenauswahl steht die Fräse zur Verfügung. Diese hat insbesondere bei viel Biomasse und grasreichen Beständen ihre Vorteile. Ausdauernde Grassoden werden gut zerkleinert und können mit einer Überfahrt meist gut bekämpft werden. Auch die Einarbeitung von einem höheren Kleegrasbestand ist technisch kein Problem. Jedoch sollte dies im Hinblick auf die zusätzliche Stickstofffreisetzung tendenziell vermieden werden. Besser ist es, den Aufwuchs möglichst vorher abzufahren. Die große Stärke der Fräse ist eine sehr flache Bearbeitung. Dafür ist aber ein Faktor essenziell: eine ebene Fläche! Ist diese nicht gewährleistet, muss die Bearbeitungstiefe angepasst
Kurz & knapp
Bei Überlegungen zum Kleegrasumbruch sollte immer folgende Frage im Zentrum stehen: Welche Ziele verfolge ich mit dem Umbruch? Je leichter der Boden ist, desto später im Herbst sollte ein Umbruch durchgeführt werden. Bei einem späten Umbruch im Herbst ist die Gefahr von Nitratauswaschung über den Winter geringer. Diesbezüglich sicherer wäre ein überwinternder Kleegrasbestand mit folgender Sommerung (z. B. Mais). Gerade im Frühjahr spielt aber die Witterung (Stichwort: Frühjahrstrockenheit) sowie die Umbruchstechnik eine große Rolle. Zudem gilt: Je intensiver und tiefer die Bearbeitung, desto schneller und höher die Stickstoff-Mineralisierung und desto größer der Wasserverlust.
werden, was sich dann auch auf den Dieselverbrauch niederschlägt.
Fakt ist: Mit jeder der beschriebenen Techniken kann ein effektiver und erfolgreicher Umbruch
des Luzernekleegrases erreicht werden – die Entscheidung für die richtige Technik hängt jedoch von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die jeder Betriebsleiter für seinen Standort differenziert betrachten muss.
DAS UNKRAUT IM GRIFF. MECHANISCH.



Präzisions-3-Punkt-Grubber






Präzisions-Hackgerät
Fotos: Johannes Weiß (3), Agrarfoto (1)
Präzisions-Federzahnegge Präzisions-Zinkenstriegel TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG Reichersteiner Str. 24 | 86554 Pöttmes-Echsheim | www.treffler.net | info@treffler.net ANZEIGE
JETZT DAS
Getreidelager
VORBEREITEN
In wenigen Wochen ist es wieder soweit – die Getreideernte wird in den Frühdruschgebieten mit der Wintergerste starten. Spätestens jetzt sollten Sie das Lager vorbereiten.
Das Öko-Lager muss das laufende Jahr über sauber gehalten werden und die Lagerbehälter sollten dicht abschließen. Wenn jetzt noch Restmengen vorhanden sind, entnehmen Sie diese aus den Silos und verfüttern oder sacken Sie diese Restmengen ab. Abgesackte Restmengen und Big Bags besonders gründlich und regelmäßig auf Schädlingsbefall kontrollieren.
Reinigung

AUTOR
Maximilian Bott
Beratung für Naturland m.bott@ naturland-beratung.de
Bei einer Getreideannahme mit Gosse und Elevator sollten alle Abdeckungen und Klappen geöffnet und dort zunächst händisch vorhandene Reste der letzten Ernte beseitigt werden. Anschließend muss das ganze Lager inklusive Gerätschaften wie Verladeschnecken und Siebe zuerst mit dem Besen und danach mit dem Baukompressor oder Staubsauger durchgearbeitet werden. Damit werden Körnerreste und Staub gründlich aus allen Ritzen und Ecken beseitigt. Arbeiten Sie besonders sorgsam im Dachgebälk, alte Ablagerungen bieten hier häufig die Quelle für späteren Schädlingsbefall. Ziel ist, potenziellen
Schädlingen Nahrungsquelle und Lebensraum zu nehmen.
Kontrolle
Kontrollieren Sie anschließend Silos oder Lagerboxen auf Undichtigkeit und dichten Sie – falls nötig – ab. Vorhandene Köderboxen im Lager sind auf Frequentierung von Schadnagern zu kontrollieren und ebenfalls zu reinigen bzw. neu zu befüllen. Die Reinigungs- und Fördertechnik muss vor der Ernte auf Verschleiß geprüft und gewartet werden. Wenn z. B. Einläufe in Schnecken oder Elevatoren starke Abnutzung aufweisen, sollten diese Teile ausgetauscht werden. Damit lässt sich Bruchkorn bei der Einlagerung und zu hoher Restbesatz nach der Reinigung vermeiden.
Schädlinge bekämpfen
Das leere Getreidelager kann mit Natur-Pyrethrum (ACHTUNG: keine Pyrethroide!) begast oder mit Silikat eingestäubt werden. Mittel mit Natur-Pyrethrum dürfen keinen Zusatz von Piperonylbutoxid (PBO) enthalten – dieser würde zu Rückständen führen. Der Einsatz von Silikatstaub soll-
78 | ACKERBAU & TECHNIK

Getreidereste in Gosse und Elevator müssen beseitigt werden. Sinnvoll ist ein Stabthermometer zur Überwachung des Ernteguts.
te bei Speisegetreide immer mit dem Abnehmer geklärt werden, damit es hier später nicht zu Reklamationen kommt. Ebenfalls ist ein Einsatz von Nützlingen im Leerraum möglich und sinnvoll. Die Lagererzwespe eignet sich mit ihrem breiten Wirkspektrum besonders gut. Beachten Sie sowohl beim Einsatz von Silikatstaub als auch bei Gasen und dem Umgang mit Köderboxen den Eigenschutz.

Messgeräte
Der Kauf eines Stabthermometers zur Überwachung der Temperatur des neuen Ernteguts in Silo oder Flachlager ist zu empfehlen. Die Temperatur des Erntegutes sollte nach der Ernte auf circa 15 °C sinken. In den Wochen danach sind 10 °C anzustreben, bei dieser Temperatur ist das Getreide langfristig lagerfähig. Dazu eignet sich die Belüftung mit kalter Außenluft.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit der Außenluft besteht allerdings die Gefahr, dass über die Außenluft wieder Feuchtigkeit in den Getreidestapel gelangt. Als Faustformel gilt hier: Wenn die Außenluft mindestens 5 °C kälter ist als der Getreidestapel, kann problemlos belüftet werden. Insofern sollte das Thermometer im Lagergebäude so angebracht sein, dass es die Außentemperatur misst.

Fotos: Maximilian Bott
ANZEIGE
AUTOREN
Dr. Andrea Feiffer
Franz Klüßendorf
Feiffer Consult andrea.feiffer@feiffer-consult.de



80 | ACKERBAU & TECHNIK 1
2
SO DRESCHEN SIE
Dinkel
Nach einer mehrjährigen Durststrecke ist Bio-Dinkel wieder gefragt. Ein Grund mehr, um den vollen Ertrag vom Acker auf die Waage zu bekommen. Folgende 10 Tipps können Ihnen dabei helfen.
Die Besonderheit beim Dinkel sind die Hüllblätter bzw. Spelzen; sie sind mit dem Korn verwachsen. Aufgrund dieser Besonderheit wird Dinkel auch als Spelz bezeichnet, die Einheit aus Spelze und Korn wird Fesen bzw. Vesen genannt. Anders als bei anderen Getreidearten sollen die Körner beim Dreschvorgang im Spelz bzw. in den Fesen verbleiben. Das ist nicht ganz einfach.
1) Ernten, wenn es knistert
Die Ähren des Dinkels sind länger und schlanker als die des Weizens. Trotz des längeren Strohs und der weniger aufrechten Ähren gehen moderne Dinkelsorten im Öko-Landbau selten ins Lager. Ein Grund dafür ist der oft nicht im Übermaß vorhandene Stickstoff. Da Dinkelstroh häufig etwas zäher ist, drischt man Dinkel am besten, wenn das Stroh „knistert“ – also an heißen, trockenen Tagen, noch bevor die Spindeln sehr mürbe werden und brechen. Sollte Öko-Dinkel tatsächlich ins Lager gehen, gilt dieser Grundsatz umso mehr.
2) Fallzahl im Blick
Dinkel ist bei einer Kornfeuchte unter 15 % druschreif, Feuchtigkeit durch vorübergehende Regen-
Kornfeuchte richtig messen
Kornfeuchte kann im Spelz oder im Korn gemessen werden. Wird bei Feuchtemessgeräten „Dinkel“ angegeben, bezieht es sich auf das Dinkelkorn ohne Spelzen. Die Körner vom Spelz zu befreien ist jedoch äußerst mühsam und aus Zeitgründen werden oft die Fesen gemessen. Dann sollte ein Zuschlag von etwa 1,5 % berücksichtigt werden. Zeigt das Feuchtigkeitsmessegerät „Dinkel mit Spelz“ oder „Spelz“, dann kann die Kornfeuchte tatsächlich in den Fesen gemessen werden.
schauer beeinträchtigt die Qualität kaum. Der Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit kurz vor der Ernte macht die Ähren sogar mürber und die Spindeln brüchiger, was beim Dreschen hilfreich ist. Der wochenlange Regen vor der Ernte 2023 hatte aber bei einigen Partien negative Auswirkungen auf die Fallzahl. Die außergewöhnlich langanhaltende Befeuchtung der Spelzen stimulierte die keimfrohen Körner. Vor Beginn einer länger anhaltenden Regenfront wäre es daher eine Überlegung, etwas höhere Kornfeuchte in Kauf zu nehmen. Futterdinkel bringt die größte Preisdifferenz. Zum einen fällt der Preis auf Futterware und zum anderen muss zusätzlich noch geschält werden.
1 Anders als bei anderen Getreidearten sollen die Dinkelkörner beim Dreschvorgang im Spelz verbleiben.
2 Dinkelstroh ist oft etwas zäher. Deshalb drischt man Dinkel am besten, wenn sein Stroh „knistert“.
ACKERBAU & TECHNIK | 81



3) Schneidwerk bei Dinkel
Dinkel kann mit jedem Schneidwerk geerntet werden. Variotische und Bandschneidwerke bieten jedoch klare Vorteile, besonders bei Lager. Ein kontinuierlicher Gutfluss entsteht, wenn die Halme mit den Ähren voran gegen die Förderschnecke fallen und eingezogen werden. Die Dreschtrommel zieht die Ähren dann gegen den Strich über die Korbleisten und die Fesen lösen sich besser von den Spindeln. Längeres Stroh und höhere Erträge erfordern in der Regel eine Verlängerung des Tisches. Dinkelstroh „läuft“ besser ins Schneidwerk und lässt sich sauberer abschneiden, wenn der Anstellwinkel des Messers samt Ährenheber bei 12 bis 15 Grad liegt. Das Stroh ist nicht nur lang, sondern meist auch etwas zäher. Ein intaktes, scharfes Messer zahlt sich nicht nur in verunkrauteten Beständen an Schnitt- und Flächenleistung aus.
4) Ähren nicht kämmen
Obwohl Dinkel ein Drittel mehr Stroh hat, bleibt die Förderschnecke auf gleicher Höhe wie beim Weizen, mit einem Abstand der Wendeln zum Bodenblech von 20 bis 25 mm. Die Fahrgeschwindigkeit ist aufgrund des Volumens geringer als beim Weizen. Bei älteren Schneidwerken mit kleinerem Schneckendurchmesser können sich manchmal Sträuße vor dem Messer bilden, was durch Anheben der Schnecke reduziert werden kann. Zudem hilft in diesen Fällen, die Fingerstellung mehr „auf Griff“ anzupassen. Auch gezahnte Winkeleisen oder Schrägförderleisten zwischen den Multifingern haben sich bewährt (auf Unwucht achten). Ein engerer Abstand zwischen Schneckenwindung und Abstreifer (kleiner 5 mm) reduziert die Gutübergabe durch die Multifinger an den Schacht. Da die Spindelbrüchigkeit bei reifem Dinkel stark zunimmt, sollte die Haspel vorsichtig eingesetzt werden. Bei zu intensivem Einsatz im oberen Ährenbereich fallen gebrochene Spindelstücke zu Boden. Bei variablen Tischen sollte die Haspel stets bis zum Schnittpunkt mitwandern.
1 Wird die Feuchtigkeit – entgegen den Vorgaben des Messgeräts – im Spelz gemessen, ist ein Zuschlag von circa 1,5 % zu berücksichtigen.
2 Da die Spindelbrüchigkeit bei reifem Dinkel stark zunimmt, sollte die Haspel nur vorsichtig eingesetzt werden.
3 Bei Lager wird mit der Haspel weiter vor dem Messer angesetzt, um so das Lager besser zu unterfahren.
82 | ACKERBAU & TECHNIK
1 2 3
Mähdreschereinstellung bei Dinkel
Arbeitsorgane
Bestandesbedingungen
Dreschtrommeldrehzahl (U/min)
bei Trommeldurchmesser
Ø 450
Ø 500 - 600 mm
Ø 600 - 700 mm
Ø 700 - 800 mm
Rotordrehzahl (U/min) bei Rotordurchmesser
Ø 450 - 550 mm
Ø 550 - 650 mm
Ø 650 - 800 mm
Dreschspalt (mm)
Vorsieb (mm)
Obersieb (mm) Verlängerung (mm)
Gebläse (U/min) wie Weizen + 30 bis 50 U/min etwa 3/4 der Windstärke
Restkornabscheidung Rotordrehzahl U/min wie Weizen wie Weizen wie Weizen
Bitte auch Herstellerangaben beachten!
5) Optimaler Schnitt bei Lager
Dinkel reift größtenteils synchron bis in die unteren Strohabschnitte. Dennoch ist es ratsam, so hoch wie möglich und so tief wie nötig zu schneiden.
Jeder zusätzliche Zentimeter Schnitthöhe steigert die Leistung um 2 % und spart 1,5 % Diesel ein. Bei Lager wird mit der Haspel weiter vor dem Messer angesetzt, mit senkrechten oder leicht nachgreifenden Zinken. Dabei erzeugt die Haspel eine Aufwärtsbewegung und lupft die Matte an, um so das Lager besser zu unterfahren. Verstellbare Tischlängen sind von Vorteil, um sich dem Lager je nach Fahrtrichtung anzupassen: Liegt das Getreide in Fahrtrichtung, wird mit kurzem Tisch geerntet. Liegen die Ähren in Richtung Schneidwerk, wird mit langem Tisch gearbeitet, um die Matte zu unterfahren, bevor die Schnecke die Ähren einzieht.
6) Saat- oder Konsumware?
Beim Dinkel fährt man im Vergleich zu Weizen etwas langsamer, um eine Überforderung der Abscheidung durch hohe Volumina zu vermeiden.

Da insbesondere Schüttler Probleme mit der Abscheidung haben, ist es wichtig, dass möglichst alle Fesen bereits im Dreschkorb abgeschieden werden.
Dennoch ist eine ausreichende Füllung des Dreschkorbes erforderlich, um die Reibung zu erhöhen und somit sanfter zu dreschen. Im Dreschwerk geht
ACKERBAU & TECHNIK | 83
trocken
feucht 10 – 13 % 14 – 17 % 18 – 22 %
mittel
820
920 770
850 730
680
780
750
720
920
850
800
740
800 860
950 820
900 780
850 1.020
940
880
970 800
950
900
850
-
-
- 800
- 740
- 860
- 820
- 780
- 1.020
- 940
- 880
-
-
-
-
- 1.120
- 1.040
-
- 880
- 1.050
- 990
- 930
Tangential Axial 14 – 16 16 – 20 13 – 15 15 – 17 12 – 14 14 – 16
12 15 – 16 offen 12 – 15 12 16 – 17 offen 14 – 16 12 17 – 20 offen 15 – 18
Untersieb (mm)


Wird Saatgut erzeugt, muss „schärfer“ gedroschen werden als bei Konsumware.
es weniger um das Dreschen als vielmehr um das Brechen der Fesenspindel. Die Einstellung ist stark abhängig von Grad der Reife und Spindelbrüchigkeit. Die Kurzformel für die Einstellung lautet oft: Dreschwerk wie Weizen, Siebe weit auf und Wind wie Hafer. Dennoch muss man zwischen Saat- und Konsumware unterscheiden.
Bei Saatgut ist es entscheidend, die Ähren möglichst in Einzelfesen zu dreschen, da die Aussaat hauptsächlich in Fesen erfolgt. Ährenstücke, Mehrfachfesen, Fesen mit Stielen und Kurzstroh verursachen bei der Saatgutaufbereitung Probleme. Daher wird Saatgut etwas schärfer gedroschen als Konsumware, um Einzelfesen zu erzeugen. Die Dreschschärfe wird durch den Anteil an frei gedroschenen Kernen begrenzt, idealerweise unter 2 %.
Die Prüfschale ermöglicht eine rasche Überprüfung der Druschverluste.

Für Konsumware, die nachfolgend geschält und gereinigt wird, sind die Anforderungen an Einzelfesen und Kurzstroh nicht so streng. Hier gilt: Alles, was im Bunker landet, wiegt mit. Daher will man hier so wenig frei gedroschene Körner wie möglich, denn die leeren Spelzen werden aus der Maschine geweht. Ein Prozent freie Körner im Bunker entsprechen etwa 0,3 % Gewichtsverlust durch herausgewehte Spelzen.
7) Am Dreschkorb alles abscheiden
Fesen sind schwerer zu trennen als Körner. Sie haben eine geringe Rieselfähigkeit, kullern nicht wie Körner, sind sperrig und verfangen sich leicht im Stroh. Daher ist es wichtig, dass möglichst alle Fesen bereits am Dreschkorb abgeschieden werden. Was im Dreschwerk nicht erreicht wird, kann mit Restkornabscheidern kaum ausgeglichen werden. Bei Hybridmaschinen öffnet man die Rotorklappen, damit die Fesen eher durchfallen und nicht im Schwad landen. Ältere Bauarten verwenden oft ein Spritztuch über dem Schüttler, was den Gutfluss bremst und die Abscheidung intensiviert. Entgrannerbleche sind für Dinkel ungeeignet, da sie die Abscheidefläche für die Fesen reduzieren. Eventuell kann stattdessen eine Korbdreschleiste als zusätzliches Hindernis eingesetzt werden, um die Ähren zu brechen und die Fesen besser zu trennen. Wenn der Dinkel reif und trocken ist, sollten diese Probleme gering sein.
8) Dreschwerk wie bei Weizen
Die Trommel- oder Rotordrehzahl entspricht in etwa der des Weizens. Es geht weniger um das eigentliche Dreschen als vielmehr um das „Abrubbeln“ der Fesen von der Spindel. Höhere Dreh-
84 | ACKERBAU & TECHNIK
Ein Prozent freie Körner im Bunker entsprechen etwa 0,3 Prozent Gewichtsverlust durch herausgewehte Spelzen.
Fotos: Andrea Feiffer
zahlen von Trommel und Rotoren sorgen für eine bessere Vereinzelung der Fesen und steigern so ihre Abscheidung am Dreschkorb. Dabei ist es wichtig, dass keine Körner frei gedroschen werden. Auch die Dreschspaltweite orientiert sich an der Einstellung für Weizen. Ein gewisser Reibungseffekt des Ernteguts im Korb ist erforderlich, um die Ährenspindeln zu brechen und die Fesen zu trennen. Lange Stiele an den Fesen sollten vermieden werden, da sie sich leicht im Gemisch verfangen können.
9) Einstellung der Reinigung
Die Obersiebe sind zwei bis vier Millimeter weiter geöffnet als bei Weizen, um den Fesen das Durchfallen zu erleichtern. Aber Vorsicht: Langstroh darf nicht durchfallen, es spießt sich gern in den Untersieben und behindert die Abscheidung. Bei zu viel Stroh im Bunker werden die Obersiebe in Ein-Millimeter-Schritten geschlossen. Das Untersieb ist fast genauso weit geöffnet wie das Obersieb. Ein zu enges Untersieb belastet die Überkehr, sie kann sehr schnell volllaufen. Bei Saatgut mit geforderten Einzelfesen können die Ober- und Untersiebe etwas enger sein als bei Konsumware. Spezialsiebe verbessern die Abscheidung der Fesen, optimieren die Windführung, reduzieren die Überkehrbelastung und verringern den Besatz. Diese Siebe können bei größerer Windmenge weiter geöffnet werden. Ist das Vorsieb verstellbar, sollte es wie bei Sonnenblumen oder Bohnen weiter gestellt werden. Dinkelfesen haben eine größere Angriffsfläche als Körner ohne Spelzen, daher wird der
AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS. AM ANFANG KNOCHE.
SCHNITTIG. SPARSAM. SPEEDMAX.
Intelligente Konstruktion. Perfekte Klingengeometrie. Zuverlässig, hochwertig und kombinierbar. Für neue Maßstäbe in der Restpflanzenzerkleinerung.

Im YouTube-Kanal „Erntetipps von Andrea Feiffer“ finden Sie Videos mit weiteren Tipps zur Dinkelernte.
Wind etwas niedriger als beim Weizen eingestellt (minus 30 bis 50 U/min). Es ist wichtig zu beachten, dass der Gebläsedruck auch ohne Drehzahlreduzierung sinkt, wenn die Siebe weiter geöffnet werden. Bei Saatgut wird der Wind so weit erhöht, bis erste Fesen ausgeblasen werden. Beim Konsumgut ist es umgekehrt, hier sind lose Spelzen im Schwad erwünscht, da sie das Gewicht erhöhen.
10) Verluste richtig messen
Die Prüfschale ermöglicht eine rasche Überprüfung der Druschverluste. Wenn das Grain Tablet verwendet wird, wählt man in der zugehörigen App die Option für Dinkel aus und stellt das TKG für Dinkelspelz auf etwa 110 g ein. Nach Eingabe der gewogenen oder gezählten Fesenverluste berechnet die App die Verlusthöhe. In der Schalenversion Classic werden Fesen und lose Körner in die Kästchen für Weizen geschoben. Da Fesen ein größeres Volumen haben (ein Drittel bis doppelt so viel wie Körner), bedeuten zwei Kästchen etwa 0,5 bis 0,8 % Verlust.

QR-Code scannen und mehr Infos erhalten SEIT 1790 ANZEIGE
TIPP

BESUCHEN SIE UNS AUF DEN DLG-Feldtagen

AUTORIN
Celine Grau
Beratung für Naturland c.grau@ naturland-beratung.de
Unter dem Motto
„Pflanzenbau out of the box“ finden vom 11. bis 13. Juni die DLGFeldtage auf dem Gut Brockhof in NordreinWestfalen statt.
Gut Brockhof liegt im Herzen der Soester Börde bei Erwitte/Lippstadt und wirtschaftet auf einer Fläche von 290 Hektar. Auch eine Hähnchenmast sowie eine Biogasanlage gehören zum Betrieb. Von 11. bis 13. Juni werden die DLG-Feldtage auf dem Gut Brock-
hof stattfinden. Über 340 Aussteller aus 17 Ländern werden sich auf einer Fläche von 55 Hektar präsentieren –praxisnah im Freigelände, auf dem Versuchsfeld, in der Zelthalle oder bei Maschinenvorführungen. Bei den Maschinenvorführungen werden 77 Gespanne an den Start gehen. Damit sind die DLG-Feldtage 2024 Europas größtes Live Event für kommentierte Maschinenvorführungen. Unter anderem stehen folgende Live-Demonstrationen im Fokus:
• Unkrautbekämpfung mit Striegel und Hacke in Getreide und Mais
• Flache Bodenbearbeitung: vom Flachgrubber bis zum Schälpflug
86 | ACKERBAU & TECHNIK
Fotos: Celine Grau, DLG
• Technik zum Heben, Laden und Befüllen auf dem Acker
• und vieles mehr.
Auch die Beratung für Naturland präsentiert sich gemeinsam mit der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG und den Natur-Saaten GmbH am Stand VA 24. Das Besondere: Hier können Sie in 34 Parzellen verschiedene Öko-Kulturen betrachten. Darunter sind auch zehn neue Sorten wie GL Ronja, eine trockenheitstolerante, standfeste Rispenhirse oder Elanza, ein ertragreicher, unbegrannter Winterweizen.
Viele Infos
Neben den Parzellen stehen Ihnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Beratung für Naturland, der Marktgesellschaft und der Natursaaten zur Verfügung. Außerdem bieten wir mit Kurzvorträgen – sogenannten Popup-Talks – am Gemeinschaftsstand weitere Informationen zu Kulturen und Sorten, Anbau und Kulturführung, Öko-Saatgut sowie zu aktuellen Er-
kenntnissen aus den Bereichen Fruchtfolgen, Nähstoffmanagement und Bodenansprache (siehe Tabelle) an.
Out of the Box
Das Motto der DLG-Feldtage „Out of the box“ findet sich auch im Fachprogramm wieder. Dieses fokussiert sich auf die Themen Vielfalt auf dem Acker, Biodiversität, zukunftsweisende Techniken und alternative Anbaukulturen. Auch Naturland leistet seinen Beitrag: Am Dienstag, dem 11. Juni, um 10:30 Uhr wird Werner Vogt-Kaute (Beratung für Naturland) zum Thema „Ökozüchtung“ referieren. Außerdem wird Jörg Große-Lochtmann (Vorstand Markgesellschaft der Naturland Bauern AG) mit Jan Plagge (Präsident Bioland), René Döbelt (Vizepräsident DLG) und Silvia Bender (Staatssekretärin BMEL) am Mittwoch, dem 12. Juni, um 10:00 Uhr über die „Perspektiven des Ökolandbaus“ sprechen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand V24.
Pop-up Talks am Gemeinschaftsstand VA 24:
Dienstag, 11.06.2024
10:00 Uhr
Dienstag, 11.06.2024
13:00 Uhr
Dienstag, 11.06.2024
16:00 Uhr
Mittwoch, 12.06.2024
11:00 Uhr
Mittwoch, 12.06.2024 14:00 Uhr
Donnerstag, 13.06.2024
11:00 Uhr
Donnerstag, 14.06.2024 14:00 Uhr.
Vermarktung der Sonderdruschkulturen Senf und Linse
Katharina Gräf, Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG
Rispenhirse & Co: Neue trockenheitstolerante Kulturen anbauen?
Werner Vogt-Kaute, Beratung für Naturland
Qualität bei Öko-Saatgut – worauf kommt es an?
Lukas Reis, Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG
Chancen für den Winterhafer bei verändertem Klima Johannes Herbert, Natur-Saaten
Körnerleguminosen für Teller und Trog – mit Hülsenfrüchten den Speiseplan von Mensch und Tier erweitern Annemarie Ohlwärter, Beratung für Naturland
Qualität bei Öko-Saatgut – worauf kommt es an?
Michael Konrad, Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG
Getreidelagerung, Qualitäts- und Gesunderhaltung Sebastian Huber, Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG

Sie suchen Winterhafer auf den Feldtagen?
Den und vieles mehr finden Sie bei uns!
ACKERBAU & TECHNIK | 87
Gut Brockhof liegt im Herzen der Soester Börde bei Erwitte/Lippstadt (NRW).
DLG Feldtage
Erwitte | Ökostand VA24
| 11. – 13.06. 2024
ANZEIGE

AUTORIN Franziska Blind
Beratung für Naturland f.blind@ naturland-beratung.de

SBR und Stolbur
2 Erreger, 1 Überträger
Wenn Zuckerrüben- und Kartoffelbestände welken, kann das an der sogenannten Schilf-Glasflügelzikade liegen. Sie ist Überträgerin zweier Bakterien, die aktuell für Diskussionen bei Anbauern sorgen.
88 | ACKERBAU & TECHNIK
Größe 1:1

Die Schilf-Glasflügelzikade hat sich in kurzer Zeit Zuckerrübe und Kartoffel als neue Wirtspflanzen erschlossen.


2023 wurden in Deutschland Zuckerrüben, Kartoffeln sowie vereinzelt auch Rote Bete und Möhren mit starken Welkesymptomen entdeckt. Die infizierten Pflanzen bildeten gummiartige Rüben oder Knollen. Ursache war eine Infektion mit dem Phytoplasma Stolbur, das durch die SchilfGlasflügelzikade übertragen wurde. Im Gepäck hatte die Zikade außerdem das Proteobakterium, das bei Zuckerrüben SBR (Syndrome Basses Richesses, das bedeutet: niedriger Zuckergehalt) auslöst. Vermutlich verursachte eine Mischinfektion beider Erreger die starken Symptome.
SBR verstopft Leitungsbahnen
SBR geht auf ein ɣ-3-Proteobakterium zurück, das von der Schilf-Glasflügelzikade übertragen wird. Das Bakterium verstopft die Leitungsbahnen der Zuckerrüben und stört die Nährstoffaufnahme. Bei Befall vergilben die Blätter, später kann auch Blattgewebe absterben. Blattneuaustriebe sind unnatürlich lanzettlich verformt und im Rübenkörper finden sich Verbräunungen der Gefäßbündelringe. Eine SBR-Infektion führt zu Ertragsverlusten und zwei bis sieben Prozentpunkten geringere Zuckereinlagerung. Die Schilf-Glasflügelzikade wurde zuerst im Heilbronner Raum und in Unterfranken, inzwischen auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt entdeckt.
Auswirkungen von Stolbur
Stolbur ist ein zellwandloses Bakterium, das von verschiedenen Arten von Glasflügelzikaden über-
tragen wird. Die Winden-Glasflügelzikade vollzieht als Hauptvektor einen Wirtswechsel von Wildkräutern wie Acker- und Zaunwinden, Brennnesseln und Schwarzem Nachtschatten auf Kulturpflanzen. Stolbur ist auch im Gemüseanbau bedeutend: Bekannt ist bereits ein Befall von Doldenblütlern (Sellerie, Möhre, Pastinake), Nachtschattengewächsen (Kartoffel, Tomate, Paprika, Aubergine) und Gänsefußgewächsen (Spinat, Rote Bete, Zuckerrübe). Die Krankheit kann auch in Weinreben (Schwarzholzkrankheit), Mais (Maisröte) und Lavendel auftreten. In Österreich tritt Stolbur schon seit Jahren in Sellerie epidemisch auf. Im warmen, trockenen Sommer 2018 erkrankten auch in Südhessen Selleriebestände. Deren äußere Blätter verfärbten sich zuerst hellgelb bis weißlich, später braun, bevor sie nekrotisch wurden und abstarben. Meist sind nur einzelne Pflanzen befallen, die in Wuchs und Wurzelbildung deutlich sichtbar zurückbleiben.
Bei der Kartoffel äußert sich die Infektion zunächst durch nesterartige Blattaufhellungen. Die Pflanze zeigt dann einen steifen, aufrechten Wuchs; die Triebspitzen verfärben sich rötlich. Es kommt zu einer verstärkten Seitentriebbildung, wobei die Basis der Triebe verdickt ist. Die Kartoffel bildet in den Blattachseln Luftknollen. Die Knollen im Boden bleiben meist im Wuchs zurück und sind weich, fast gummiartig. Erkrankte Pflanzen können vorzeitig absterben.
Bei einer Infektion von Zuckerrüben wird dem Rübenkörper Wasser entzogen, wodurch er weich, fast gummiartig wird und sich der Zuckergehalt – im Gegensatz zu SBR – erhöht.
ACKERBAU & TECHNIK | 89

Knollen erkrankter Kartoffelpflanzen sind weich, fast gummiartig (oben).
Gummirüben erschweren die Verladung mit der „Zuckerrüben-Maus“ (unten).

Kurz & knapp
Die Schilf-Glasflügelzikade hat sich in kurzer Zeit Zuckerrüben und Kartoffeln als neue Wirtspflanzen erschlossen. Bei der Wahl der Zielpflanzen ist sie anscheinend weniger begrenzt als die Winden-Glasflügelzikade. Da sich durch den Klimawandel die Umweltbedingungen ändern, insbesondere in Form von warmen Wintern, findet die Zikade beste Bedingungen für eine vermehrte Population mit hohen Infektionsraten – vor allem in den trockenen und warmen Regionen Deutschlands. Eine direkte Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln ist nicht erfolgsversprechend. Bisher ist das einzig wirksame Instrument zur Eindämmung der Schilf-Glasflügelzikade, die Fruchtfolge zu verändern: Kein Winterweizen nach Zuckerrüben.
Die Züchtungshäuser suchen – insbesondere bei Zuckerrüben und Kartoffeln – nach toleranten Sorten. Bis zu einer echten Resistenz ist es aber noch ein weiter Weg. 2023 hat gezeigt, dass Stolbur zu einem massiven Problem werden kann, wenn gleichzeitig das Proteobakterium SBR übertragen wird. Zurzeit bleibt nur ein intensives Monitoring des Vektors Schilf-Glasflügelzikade und eine wissenschaftliche Begleitung, um Erreger und Vektor besser verstehen und neue Ansätze zur Bekämpfung finden zu können.
Zwei Erreger, ein Überträger
Das massive Auftreten von Gummirüben und befallenen Kartoffeln in vielen Teilen Deutschlands hat offenbart, dass beide Erreger von der Schilf-Glasflügelzikade übertragen werden und eine Mischinfektion zu den starken Symptomen geführt hat. Bisher wurden beide Krankheiten eher isoliert betrachtet – in Kombination können sie jedoch großen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Die SchilfGlasflügelzikade hat sich in kurzer Zeit von ihrem eigentlichen Hauptwirt Schilf in ihrer Heimat, dem Mittelmeerraum, verabschiedet und auf Kartoffeln und Zuckerrüben spezialisiert. Durch den Fruchtfolgewechsel beider Kulturen wurden ihr hierzu beste Bedingungen geliefert. Viele Betriebe bauen nach Zuckerrüben Winterweizen an, der ebenfalls der Entwicklung der Zikade entgegenkommt.
Biologie des Insektes
Die adulten Zikaden fliegen von Mai bis September in die Bestände ein und legen ihre Eier im Boden nahe der Wirtspflanze ab. Daraus schlüpfen die Nymphen, die sich während ihrer Entwicklung 15 – 40 cm tief im Boden bewegen. Die adulten Zikaden saugen am Phloem und übertragen so den
90 | ACKERBAU & TECHNIK
Baumann, Schulz, Sesvanderhave,
Fotos:
Strube

Kartoffeln bilden bei einer Infektion mit Stolbur sichtbare Luftknollen in den Blattachseln.
Erreger(-komplex). Die Nymphen wiederum ernähren sich von den Wurzeln der Zuckerrüben und nehmen so das Phytoplasma und/ oder das Proteobakterium wieder auf. Beide Krankheiten sind nicht saatgutübertragbar. Die Infektion erfolgt also immer über die Zikade. Bei SBR ist wohl auch eine vertikale Übertragung des Proteobakteriums in der Zikade möglich, d. h. der Erreger kann eventuell auch über das Ei an die nächste Generation weitergegeben werden. Bei einem Nachbau von Winterweizen nach Zuckerrüben können sich die
Die neuen organischen Bio-Langzeitdünger von AVEMA

Nymphen ungestört weiterentwickeln und ernähren sich in dieser Zeit von Rübenresten im Boden und den Wurzeln des Weizens. Im Folgejahr fliegen die adulten Schilf-Glasflügelzikaden wieder aus und suchen sich die nächsten Wirtspflanzen. Ihre erste Wahl sind Kartoffeln, aber auch Zuckerrüben, Rote Bete, Sellerie, Möhren u. a. werden angeflogen und infiziert.
Bekämpfung
Aufgrund der kurzen Verweildauer der Zikaden an den Zielpflanzen und die lange Flugzeit von Mai bis September ist eine direkte Bekämpfung mit Insektiziden nicht erfolgsversprechend.
Maßnahmen gegen Schilf-Glasflügelzikaden:
• Veränderung der Fruchtfolge: statt Winterweizen eine Sommerung (Mais)
• (Früh-)Kartoffeln nicht nach Zuckerrüben anbauen
• Senf und Ramtillkraut senken die Überlebensraten der Nymphen, da sie keine Wirtspflanzen zu sein scheinen
• Pflügen ist wirkungsvoller als Grubbern
• Bodenbedeckung scheint in Kartoffeln Auftreten und Infektionsrate der Vektoren zu reduzieren.
ANZEIGE

ODP-N |12-0-0

ODP-N S |12-0-0

ODF-N |13-0-0
info
100 % organische Langzeitdünger mit linearer N-Freisetzung aus Kollagenfasern tierischen Ursprungs Reiner Stickstoffdünger 12-0-0 bzw. 13-0-0 mit ca. 12 % – 13 % N
FiBL-gelistet: Naturland Deutschland, Ecovin Deutschland, Betriebsmittelliste Deutschland, EU Öko Rechtsvorschriften Geeignet für Baumschulen, Staudenkulturen, Bio-Gemüse mit mittlerer bis längerer Kulturdauer, aber auch für Beet- und Balkonpflanzen
Erhältlich als Pellet (ODP-N), kurzes Pellet (ODP-N S) und Faser (ODF-N)
ACKERBAU & TECHNIK | 91
AVEMA GmbH • Metzgerstr. 32–34 • D-73033 Göppingen +49 7161-6728 261 info@avema.eu www.avema.eu REINER STICKSTOFFDÜNGER

AUTOR
Julius Heise
Beratung für Naturland j.heise@ naturland-beratung.de

Kleines Korn
– große Herausforderung
Der Rapsanbau stellt Öko-Landwirte immer wieder vor Herausforderungen. Die gute Vorfruchtwirkung sowie – je nach Ertrag und Preis – potenziell hohe Deckungsbeiträge sprechen für Öko-Raps, das hohe Ausfallrisiko dagegen. Der folgende Artikel nimmt Sie mit durch das Anbaujahr und zeigt Praktiker-Strategien für einen erfolgreichen Anbau.
Es ist März, Naturland-Bauer Marc Böttcher steht auf seinem Acker. An nassen Stellen reichen einige Fahrspuren bis auf die Pflugsohle. Doch die nasse Witterung in diesem Frühjahr ließ auf dem schweren Standort keine Unkrautregulierung unter besseren Bedingungen zu. Marc Böttcher ist froh, den Raps seit diesem Jahr in weiter Reihe anzubauen. Ansonsten wäre eine Regulierungsmaßnahme bis heute nicht möglich gewesen. Nach einer schwierigen Ernte durch hohen Kamillenanteil im Vorjahr wurde Raps zur neuen Saison in weiter Reihe angebaut. Die Hacke mit 45er Reihenabstand setzt der Naturland-Landwirt aus Göttingen auch in Zuckerrüben, Soja und Körnermais ein.
Nährstoffversorgung sicherstellen
Schon vor dem Anbau des Rapses sind Überlegungen zur Nährstoffversorgung anzustellen, denn Raps ist bezüglich Stickstoff anspruchsvoll. Raps nimmt im Herbst bis zu 100 kg N/ha auf und hat bereits zeitig im Frühjahr einen hohen Bedarf. Der Stickstoffbedarf liegt bei insgesamt 60 kg je Tonne Ertrag. Dieser Bedarf kann über schnell wirkende flüssige Wirtschaftsdünger und im Herbst über Mistgaben gedeckt werden.
Letzteres ist besonders sinnvoll, wenn die Flächen im zeitigen Frühjahr nicht rechtzeig befahrbar sind. Gleichzeitig stellt diese Option aber nur einen Kompromiss dar, denn nach einer angemessenen Herbstversorgung fällt die Nachlieferung im zeitigen Frühjahr mit noch kalten Böden erstmal gering aus.
Hilfreich ist natürlich, Raps nach einer legumen Vorfrucht anzubauen. Interessant ist der Rapsanbau vor allem nach Kleegrasumbruch. Dieser ist im Sommer deutlich einfacher als im nassen Frühjahr oder Herbst. Raps bindet den freiwerdenden Stickstoff bereits im Herbst und profitiert enorm vom geringen Beikrautdruck nach Kleegras.
Im Frühjahr verbessert eine Schwefeldüngung die Verwertung des Stickstoffs. 20 bis 30 kg/ha Sulfatschwefel decken den Bedarf.
Hybrid- oder Liniensorte?
Bei der Sortenwahl gibt es eine wiederkehrende Diskussion, ob Liniensorten die richtige Wahl sind oder der Zuchtfortschritt bei Hybridsorten deutlich größer ist. Für eine Hybridsorte (Achtung: im Verbandsanbau sind CMS- und Ogura-Hybride nicht zulässig) sprechen üppigeres vegetatives Wachs-

Naturland-Bauer Marc Böttcher begutachtet seinen Rapsbestand, der bereits im zeitigen Frühjahr einen hohen Stickstoffbedarf hat.
tum, gleichmäßigere Bestände und bessere Ertragsstabilität auch unter widrigen Bedingungen.
Liniensorten können hingegen winterhärter und standfester sein, eine höhere Widerstandskraft gegenüber Phoma und Verticillium sowie teils höhere Ölgehalte aufweisen. Ein besonderer Pluspunkt ist das günstigere Saatgut, das sogar nachgebaut werden kann – unter dem Gesichtspunkt „hohes Ausfallrisiko“ ein wichtiges Argument.
In jedem Fall sollte bei der Sortenwahl auf zügige Jugendentwicklung und hohes Unterdrückungsvermögen gegenüber Beikräutern geachtet werden.
Saatbettbereitung & Saattechnik
Damit der Bestand zur Ernte möglichst sauber ist, müssen optimale Auflauf- und Wachstumsbedingungen für die Kulturpflanze geschaffen werden. Dies beginnt bereits bei der Ernte der Vorfrucht.
ACKERBAU & TECHNIK | 93
Heise,
privat
Fotos:
Goldberger,

NEUER SCHÄDLING
Der schwarze Kohltriebrüssler breitet sich zunehmend Richtung Norden aus. Er ist ein Kühlbrüter und fliegt bereits im Herbst in die Bestände. Seine Eier werden dicht am Vegetationskegel abgelegt. In diesem erfolgt bis ins Frühjahr der Reifungsfraß der Larven. Man erkennt die befallenen Pflanzen am fehlenden Haupttrieb und stark gestauchten Wuchs mit vielen Nebentrieben – starker Befall mit Erdflohlarven verursacht jedoch ein ähnliches Schadbild.
Mit dem Schwarzen Kohltriebrüssler befallene Pflanzen erkennt man am stark gestauchten Wuchs mit vielen Nebentrieben.
Neben der Drillsaat eignet sich Raps auch für den Anbau in weiten Reihen. Oft können bestehende Hackgeräte genutzt werden.

„Die kräftige Pfahlwurzel des Rapses ist in der Lage, feste Bodenzonen zu durchwachsen.“
Hier ist auf eine gleichmäßige Strohverteilung zu achten. Besser noch wäre die Strohbergung, denn bis zur Rapsaussaat Ende August ist nur wenig Zeit zur Umsetzung des Strohs im Boden. Verbleibt es, bindet es Stickstoff, den der Raps benötigt. Eine Kleegrasvorfrucht sollte rechtzeitig umgebrochen werden. Um dem Raps möglichst zügig und viel Stickstoff zur Verfügung zu stellen, wird eine Bodenbearbeitungsmaßnahme vor dem Umbruch empfohlen.
Unabhängig von der jeweiligen Vorfrucht kann die Saatbettbereitung pfluglos erfolgen. Die kräftige Pfahlwurzel des Rapses ist in der Lage, feste Bodenzonen zu durchwachsen. Dies gilt allerdings nicht für Schadverdichtungen. Haupternteerschwernis sind in der Regel die Kamille-Arten. Diese profitieren von sauren, verdichteten, nassen und nährstoffreichen Bedingungen. Hierauf kann bei Bodenbearbeitung und Aussaat Einfluss genommen werden. Abhilfe kann zu einem gewissen Maß auch eine Kalkung vor der Rapsaussaat schaffen.
Zur Aussaat Ende August/Anfang September stellen sich dann die Fragen, ob der Raps gehackt und mit einer Begleitsaat vor Schädlingen geschützt werden soll. Spätestens an dieser Stelle werden die Anbauvarianten in der Praxis vielfältig. Jeder Landwirt hat aus den Erfahrungen der Vorjahre eige-
94 | ACKERBAU & TECHNIK
So machen‘s Praktiker




Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH www.kult-kress.de +49 7258-200 96-00 info@kult-kress.de K.U.L.T. Argus Hacksystem - leicht und flexibel für F ront-, Heck- und Zwischenachsanbau
Daniel Magers Hannover
Tab. 1: Mögliche Deckungsbeiträge von Öko-Raps — je nach Preisniveau.
Leistung Niedriges Preisniveau Hohes Preisniveau
Ertrag dt/ha 18 Erzeugerpreis
€/dt, netto ab Station 65 110 = 1.170 1.980
Variable Kosten
Dünger inkl. Ausbringung
€/ha bei 20 m3 Gärrest + 1,5 dt/ha Kieserit
+ 50 Saatgut
Aussaat durch Lohnuntern. €/ha für Einzelkornsaat
Var. Maschinenkosten
Ernte (Lohndrusch)
Reinigung und Trocknung
ne neue Erkenntnisse gewonnen und diese in sein Anbauverfahren einfließen lassen. Neben der Drillsaat mit einer Menge von 50 bis 80 Körnern/m² (Liniensorten bis 80 Kö/m², Hybridsorten bis 60 Kö/m²) gehen Praktiker ganz unterschiedliche Wege (siehe Seite 95).
Ernte und Vermarktung
Nach abgeschlossener Unkrautregulierung und dem Aushalten aller Schadinsekten zwischen Aussaat und Abreife steht schließlich die Ernte an. In guten Jahren kann Bio-Raps bis zu 40 dt/ha erbringen. In Jahren mit viel Beikraut, schlechter Mineralisation und vor allem hohem Schädlingsdruck ist allerdings auch ein Totalausfall möglich. Sollte er in diesem Fall nicht als winterharte Zwischenfrucht betrachtet und rechtzeitig umgebrochen werden, können die Erträge auch unterhalb einer Tonne je Hektar liegen. Es ist deswegen immer lohnenswert, einen Plan B für einen möglicherweise notwendigen Umbruch mit einer späten Sommerung im Blick zu haben.
Beim Mähdrusch ist viel Geduld gefragt: Einerseits erfordert Raps einen schonenden Drusch bei niedrigen Trommeldrehzahlen. Andererseits können stickstoffliebende Rauken, Kamillen und Kletten
€/ha für 2 x Grubber, Saatbettb., 2 x hacken, 2 x striegeln
zu massiven Ernteerschwernissen führen und dazu verleiten, die Trommeldrehzahl zu erhöhen, um Trommelwickler zu vermeiden. Das A und O ist daher ein möglichst gleichmäßiger Gutfluss. Die dafür bekannten Bandschneidwerke kommen im sperrigen Raps allerdings an ihre Grenzen. Hier würden zusätzliche Querförderschnecken über dem Querförderband benötigt.
Eine Möglichkeit für besonders stark verunkrauteten Raps ist, diesen in den Schwad zu mähen. So kann der Besatz vertrocknen und der Drusch wird erleichtert. Allerdings erbringen stark verunkrautete Bestände meist keine hohen Erträge, so dass sich dieser zusätzliche Aufwand nicht immer rechnet.
Je nach Ertrag und Vermarktungsmöglichkeiten ergibt sich bei Raps eine große Spreizung bei den Deckungsbeträgen. Bei aktuellen Erzeugerpreisen von 650 bis 700 Euro pro Tonne ergibt sich ein relativ geringer Deckungsbeitrag. Besser wird die Situation, wenn – wie in regionalen Vermarktungsprojekten – 1.000 Euro und mehr dafür bezahlt werden. Daher sollte sorgfältig abgewogen werden, ob der Deckungsbeitrag das hohe Ausfallrisiko angemessen entschädigt oder Alternativkulturen wie Sonnenblumen momentan sinnvoller bzw. sicherer im Anbau sind.
96 | ACKERBAU & TECHNIK
200
€/ha 120
65
130
€/ha 170
70
70
€/ha 295 1.105 Quelle: eigene Berechnung
€/ha
Hagelversicherung €/ha
= 875 875 Deckungsbeitrag

Naturland
BIO-WARENBÖRSE
BIETE/VERKAUFE PFLANZLICHE PRODUKTE, FUTTERMITTEL
Kleegrass 1. Schnitt aus dem Fahrsilo; Ulrich Niemeyer; 22397 Hamburg; Tel.: 0170 4506614
Ackerbohne & Triticale; Iris Liebich; 26725 Emden; Tel.: 0176 24119466
Futterroggen und Weizen; Bott; 34311 Naumburg; Tel.: 05622 1893
200 Rundballen Öko-Heu 1,25 -1,30 m Durchmesser unberegnet, Scheunen gelagert; Katrin Lingelbach; 35260 Stadtallendorf-Wolferode; Tel.: 06425 921962
U2-Gerste zu verkaufen; Arno Düvel; 37574 Einbeck; Tel.: 0177 8688291
Weizen- oder Triticalestroh; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Bio Silageballen 2. Schnitt aus 2022 und 2023; Wolfgang Winterhalder; 79822 Baden-Württemberg - TitiseeNeustadt; Tel.: 0160 5072494
Heu Rundballen & Grassilage Ballen; Christian Hofmann; 83043 Bad Aibling; Tel.: 0173 3806891
Stroh in Rundballen 1,25 m; Lorenz Huber; 83512 Wasserburg a. Inn; Tel.: 0173 3945095
14 Grassilage-Rundballen; Peter Zwingler; 83530 Schnaitsee; Tel.: 08628/279
Heu in Rundballen; Klaus Gerst; 85435 Erding; Tel.: 0179 7042455
Biete Bio-Heu 1. Schnitt; Bernadette Lex; 85461 Bockhorn; Tel.: 08122 4477
Heu, 1. Schnitt; Brandmair; 85737 Ismaning; Tel.: 0178 1562404
Heu 1. Schnitt 2023; Heribert Bleher; 89233 Neu-Ulm; Tel.: 0152 55824549
Luzerneheuballen oder Cobs heißluftgetrocknet; Burger; 92358 Seubersdorf; Tel.: 0160 92058074
Körnermais & Futterweizen A-Ware; Reisinger; 93093 Donaustauf; Tel.: 0160 97222818
Kleegras ab Feld; Thomas Schütz; 93191 Rettenbach; Tel.: 09462 820
BIETE/VERKAUFE ZUCHT-, NUTZVIEH
Hereford Deckbulle; Hohmeier GbR; 32457 Porta Westfalica; Tel.: 01511 4938322
18 Jungbullen 8 - 11 Monate Fleckvieh rein und Kreutzungstiere, weitere Tiere online; Andreas Aller; 56244 Maxsain; Tel.: 02626 8146
Deckbullen; Christian Zimmermann; 64760 Oberzent/ Beerfelden; Tel.: 0157 8550 7975
Reinrassige Pinzgauer Mutterkuh; Elisabeth Winkler-Pritsch ; 84178 Kröning; Tel.: 0151 41626172
1 Fleckvieh Jungkuh; Andreas Hutter; 85111 Adelschlag; Tel.: 0175 3524655
Galloway, Jungbulle; Andreas Waibel; 88484 Gutenzell-Hürbel; Tel.: 0152 02886995
18 Bienenvölker in Ertragsstärke, Dadant, Buckfast, Naturland-zertifiziert; Christopher Mann; 91241 Kirchensittenbach; Tel.: 0178 9400473
Kühe und Jungkuh; Andreas Wilhelm; 94143 Grainet; Tel.: 0171 8915270
BIETE SONSTIGES
Frühtrachthonig 2023 mit Bergahornblüte im 25-kg-Gebinde; Tim Zerneke; 06493 Harzgerode; Tel.: 0178 1812306



• Schnelle Abreife
• Sicherer Behandlungserfolg
• Gute Stängelwirkung
• Nachhaltig
POWERED BY DIE RICHTIGE WAHL ZUR ELEKTRISCHEN KRAUTREGULIERUNG



Hotline: 0221 179179-99 Weitere Infos ANZEIGE
www.nufarm.de
TERMINE | 97
Sommerweizen Expectum; Tobias Krüger; 31787 Hameln; Tel.: 0177 3939560
Rapshonig 250 kg & 250 kg Frühjahrsblütenhonig; Rolf Siegwald; 32699 Extertal; Tel.: 0151 70105731
15 m Einböck Hackstriegel (Aufbau auf Exact); Marina Grölz; 35460 Staufenberg; Tel.: 0151 70051422
„Öko Champost“ - abgeerntetes Champignonsubstrat; Tegeler; 49685 Emstek; Tel.: 04473 94100
Krone Varopack 1800, Rundballenpresse; Burkhard Reutzel; 63688 Gedern; Tel.: 0175 8840156
Feiner Bio-Ziegenkäse für Gastro und Hofladen; Wolfgang Schudt; 63825 Schöllkrippen; Tel.: 06024 9233
Salbei (Naturland); Dirk Krämer; 65618 Selters; Tel.: 0171 2204774
Reinert Abflammgerät Typ A2000200 HF1 Anbau-Abflammgerät; Fichtner; 73540 Heubach; Tel.: 0179 7608029
Eier-Nudeln für Wiederverkäufer; Daniela Gauß; 88239 Neuravensburg; Tel.: 07528 927110
Honig; Michael Littmann; 88361 Boms; Tel.: 07581 202618
STELLENMARKT
Landwirtschaftlicher Mitarbeiter gesucht; Manfred Singhof; 56355 Nastätten; Tel.: 0171 7024309
Wir suchen 2 Saisonarbeitskräfte zum Zuckerrüben hacken; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Hofkäserei sucht engagierte*n Mitarbeiter*in; Pascal Küthe; 63546 Hammersbach; Tel.: 0171 9367423
Wir suchen eine landwirtschaftliche Fachkraft; Amadé Billesberger; 85452 Moosinning; Tel.: 0172 8654676
Lehrling für 2024 /2025 gesucht; Ulrich Forsthofer; 93354 Siegenburg; Tel.: 09444 1404
HOF- UND FLÄCHENMARKT
Betriebsübergabe Biolegehennenbetrieb in 37170 Uslar-Ahlbershausen; Marlene Staab; 37170 Uslar; Tel.: 0176 31712921 ANZEIGE
INFO
Weitere Anzeigen finden Sie im Internet unter www. biowarenboerse.de. Dort können Sie auch Ihre Anzeige schalten oder telefonisch bei Regina Springer unter Tel: +49 (0)8137 6372-912.
Die unabhängige Fachzeitschrift für ökologische Land - und Lebensmittelwirtschaft
IN JEDER AUSGABE:
Beiträge, Interviews, Meinungen aus Praxis, Forschung und Beratung
Ein Schwerpunktthema ( Generationswechsel, Bi o 3.0, Bäuerliche Landwirtschaft, Weltmarkt Bio,…) Fachartikel aus Pflanzenbau,Tierhaltung, Ernährung, Verarbeitung, Handel, Forschung … Interviews mit dem Nachwuchs der Biobranche Serviceteil
JETZT VERGÜNSTIGTES PROBEABO SICHERN
Zwei Ausgaben für nur 9,45 Euro inkl. Versand statt 13, 50 Euro

Bestellung mit Code NALAND30 an abo@oekom.de telefonisch +49/ (0) 89/ 5441 84-225 oder online www.oekologie-landbau.de
















11,20 AUSGABE 02/2024 4192692611209 02 BIODIVERSITÄT Was der Ökolandbau leistet BIODEBATTE Warum wir die Perspektive wechseln müssen ZUCKER Wie er sich in Bioprodukten reduzieren lässt Regenerative Landwirtschaft Jetzt testen
30% sparen mit dem NALAND30Code
und
98 | WARENBÖRSE
Schädlinge im Getreidelager?
Zuverlässiges Monitoring und wirksame
Bekämpfung mit Produkten von Biofa
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Finden Sie unser


Biofa GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2 | 72525 Münsingen
Tel. 07381 9354-0 | contact@biofa-profi.de www.biofa-profi.de
Vollsortiment Bio-Futter und Fachberatung
-Milchvieh -Legehennen - Mast-Geflügel -Schweine -Ziegen und Schafe
+49 (0) 8203 / 96 08 0 kontakt@meika-biofutter.de www.meika-biofutter.de
Vertragspartner von:




Harte Zeiten erfordern eine neue Art von Zuverlässigkeit.
Kubota M7003: Der leistungsstarke Profi -Traktor
Mit 130 – 170 PS und 0%-Finanzierung * .
* Abbildung zeigt mögliche Sonderausstattung. Konditionen gültig für alle Neumaschinen der M-Serie ab sofort bis zum 30.06.2024 oder bis auf Widerruf. 12 - 36 Monate Laufzeit, Mindestfinanzierungsbetrag 7.500 €, 30 % Bruttoanzahlung. Je nach Berechnungsmethode können sich geringfügige Abweichungen im Zinssatz ergeben. Angebot unterliegt den üblichen Genehmigungsverfahren der Kubota Finance, ein Geschäftsbereich der BNP Paribas Lease Group S.A. Zweigniederlassung Deutschland, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln. Irrtum, Nachtrag, jederzeitige Änderung und Widerruf vorbehalten. Gültig solange der Vorrat reicht, vorbehaltlich endgültiger Finanzierungszusage. Zusätzlich: 5 Jahre Garantie oder 3.000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
DE ÖKO-006
Bio im Herzen ANZEIGEN | 99
#leistungsstark durch Zwischenfrüchte

Viel Futter in kurzer Zeit

Futter- und Biomasse-Mischungen
Ü mehr Bodenfruchtbarkeit
Ü bessere Nährstoffverfügbarkeit
Ü weniger Krankheiten









Spitzenqualität für Ihren Boden

Ü klimastabiler Ertrag Bodenfruchtbarkeits-Mischungen
Gesamtsortimenter Zwischenfruchtprogramm als Download:

www.zwischenfrucht.de
www.saaten-union.de
Weitere Sorten in Öko-Qualität erhältlich.
Besuchen Sie uns:

Stand
DE-Öko-009 DE-Öko-003
VE23
















































































 AUTOR Nikolaus Fuchs
AUTOR Nikolaus Fuchs


 AUTOR Klaus Girg
AUTOR Klaus Girg