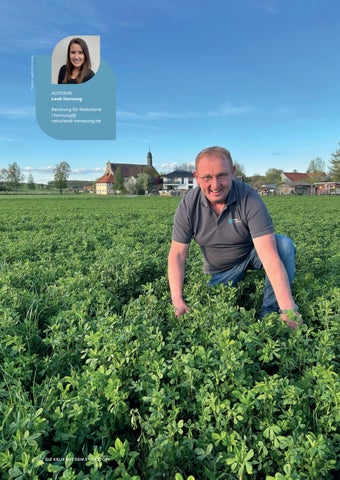Naturland
NACHRICHTEN
Fachinformationen für den Öko-Landbau


Die Krux mit dem STICKSTOFF
Geflüster am
BIO-MARKT
Was tun gegen
ENGERLINGE?
Schädlinge im Getreidelager?
Zuverlässiges Monitoring und wirksame Bekämpfung mit Produkten von Biofa Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Finden Sie unser


Biofa GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2 | 72525 Münsingen Tel. 07381 9354-0 | contact@biofa-profi.de www.biofa-profi.de






LIEBE BÄUERINNEN UND BAUERN!
Alle Rinder sollen auf die Weide, so die EU-Kommission. Nach ihrer Einschätzung ist die Weide in Bezug auf Tierwohl und Verbraucherinteresse das Nonplusultra; nur in den Wintermonaten dürften Tiere im Stall gehalten werden. Auch Betriebe mit Geflügel oder Schweinen sind betroffen; mal geht es um Grünauslauf für Küken, mal um das prozentuale Verhältnis von Stallinnen- zu Stallaußenflächen.
Als Praktiker hingegen weiß man: Tierwohl ist mehr als Weide. Über das Wohlbefinden entscheiden viele unterschiedliche Faktoren von der Fütterung bis zum Herden- und Stallmanagement. Weidegang ist dabei natürlich ein zentraler Bestandteil, aber eben nicht der einzige. Mit ihrer verschärften Auslegung der EU-Öko-Verordnung zu Weidegang und Grünauslauf schränkt die EU-Kommission notwendige Spielräume für die Betriebe unverhältnismäßig stark ein, ohne damit für mehr Tierwohl zu sorgen.
Ganz aktuell setzen wir uns bei der EU-Kommission für eine Weideregelung bei Rindern ein, die den Betrieben neben einer längeren Übergangsfrist auch die nötigen Freiheiten garantiert. Beim Geflügel und in der Schweinehaltung sind die Übergangsfristen zum Glück länger, aber auch hier brauchen wir flexiblere, praxistaugliche Vorgaben. Naturland ist auch hier bereits aktiv, um entsprechende Änderungen in Brüssel einzufordern.
Als Verband sehen wir durch das aktuelle Vorgehen der Kommission nicht allein einzelne Betriebe in ihrer individuellen Entwicklung gefährdet. Vielmehr bedrohen diese Vorgaben auch die positive Entwicklung des Bio-Markts. Offenbar waren der Kommission die weitreichenden Auswirkungen ihrer Entscheidung für den gesamten Sektor nicht bewusst. Ziel des Öko-Landbaus ist die gesunde Ernährung von Menschen und Tieren, der Erhalt der biologischen Vielfalt und einer vielfältigen Kulturlandschaft. Erreichen können wir dieses Ziel aber nur, wenn die Entwicklung des Öko-Landbaus in Zukunft wieder mit den Betrieben erfolgt statt allein in irgendwelchen Brüsseler Büros. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 9.
IMPRESSUM NATURLAND NACHRICHTEN
Herausgeber: Beratung für Naturland Öko-BeratungsGesellschaft mbH Eichethof 1, 85411 Hohenkammer Telefon: +49 (0)8137/ 6372-902 info@naturland-beratung.de www.naturland-beratung.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P): Martin Bär
Vertrieb: Regina Springer Telefon: +49 (0)8137/6372-912 r.springer@naturland-beratung.de
Anzeigen: Tanja Edbauer Telefon: +49 (0)172/3126816 t.edbauer@naturland-beratung.de
Redaktion: Markus Fadl, Roman Goldberger (leitend), Walter Zwingel redaktion@naturland-beratung.de
Titelfoto: Roman Goldberger
Grafik & Layout: Werbeagentur Oberhofer, Ingolstadt Alison Goldberger, Rainbach
Druck: Riegler Druck, Pfaffenhofen
Bezug: Die Fachzeitschrift erscheint sechsmal im Jahr im Umfang von mind. 80 Seiten. Der Bezugspreis der Naturland Nachrichten ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Alle namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder. Die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion zulässig.
Wir formulieren in unseren Texten die weibliche und männliche Form aus. Wenn dies die Lesbarkeit beeinträch-

Sebastian Mittermaier Geschäftsleiter Politik & Nachhaltigkeit Naturland e.V.
tigt, verwenden wir die generische Form – diese schließt Frauen dann selbstverständlich ein.
DER UMWELT ZULIEBE Die Naturland Nachrichten werden aus Recyclingpapier (Blauer Engel) und mit natürlichen Farben ohne Mineralöl hergestellt. Druck und Versand erfolgen -neutral durch Kompensation. Daher darf die Zeitschrift – als Ganzes – den Blauen Engel tragen.

www.blauer-engel.de/uz195
· ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
emissionsarm gedruckt
· aus 100 % Altpapier IP3

titelthema
12 DIE KRUX MIT DEM STICKSTOFF
Die Stickstoffdynamik im Boden verstehen 18 NITRAT-TEST
In 7 Schritten zum Nitratgehalt
20 STICKSTOFF ÜBER DIE FRUCHTFOLGE
Mit Leguminosen die Fruchtfolge gestalten
FUTTER-DÜNGERKOOPERATION
Eine Möglichkeit für viehlose Bio-Ackerbauern
28 STICKSTOFF ÜBER DEN WINTER RETTEN
Damit er der Folgefrucht zur Verfügung steht
30 BIO-ACKERBAU OHNE TIERHALTUNG
Lösungen am Betrieb Müller-Oelbke


MARKT
40 MARKT-GEFLÜSTER
Aus dem Nähkästchen geplaudert
42 RIND & SCHWEIN Gesucht und gesucht
43 MILCH & KARTOFFEL
Stabile Marktlage 44 SONDERKULTUREN & SPEZIALGETREIDE
Vieles noch unklar
45 GETREIDE Gute Aussichten

Ursachen und Tipps
Was ist Bio Kontor?
RIND & GRÜNLAND
48 SCHÄDEN IM GRÜNLAND Wird 2025 ein Engerling-Jahr?
54 WEIDE 9 Fragen zum Weidezaun
58 KÄLBER
Tipps gegen das Besaugen
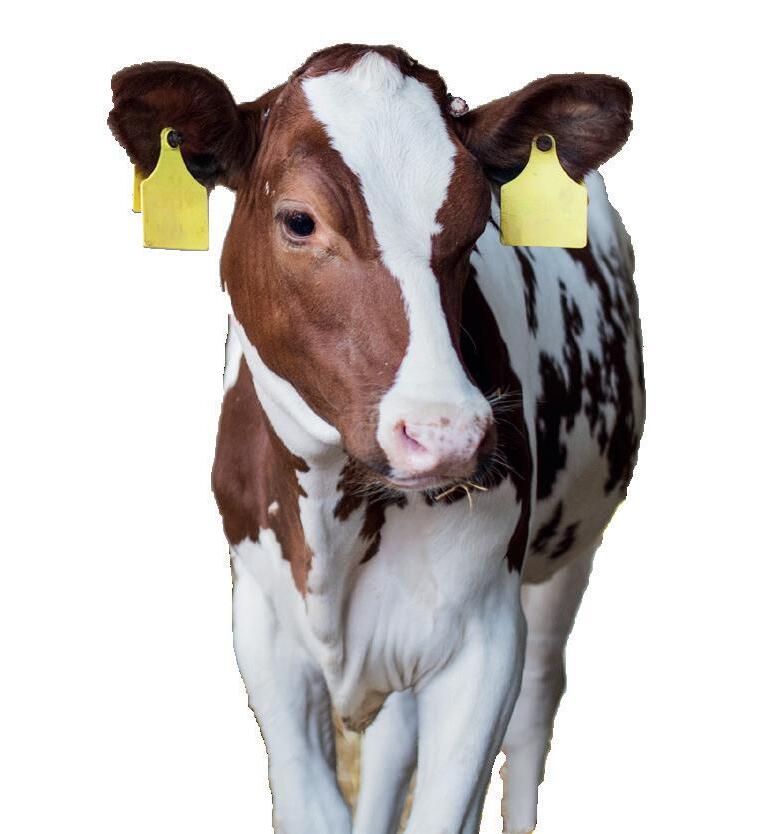



SCHWEIN & GEFLÜGEL
60 EIWEISSFÜTTERUNG
Branche sucht Proteine
64 PRAXISVERSUCH
Fütterung mit Proteinkern
66 AUS ERFAHRUNG LERNEN
ACKERBAU & TECHNIK
Bio-Hähnchenhalter Kilian Henne im Porträt AUS

70 WINTERHAFER
Eine Alternative zur Sommerung
73 DIE ROLLHACKE
Neues Video & neuer Podcast
74 ZÜCHTUNGSERFOLG
Neue Roggen-Population
76 KALK ... fördert den Humusaufbau
80 ÖKO-FELDTAGE
Besuchen Sie Naturland
6 POLITIK & VERBAND Aktuelles rund um Naturland
9 WEIDE Was Naturland fordert
10 AUS DEM BÖLW Erwartungen an die neue Bundesregierung
39 WIR BIO-BAUERN Neuer Podcast der Beratung für Naturland

KOMMENTAR
Von Marcus Nürnberger, Naturland e.V.
Unauffällig ist es der EUKommission gelungen, ihren Prozess zur Deregulierung des Gentechnikrechts voranzutreiben. Nachdem sich das Europaparlament offen zeigt, hat auch der Rat ein positives Signal abgegeben. Die Positionen werden nun innerhalb des Trilogs verhandelt. Dabei sind die zentralen Fragen nach wie vor unbeantwortet: Wie kann man eine Patentierung verhindern? Was braucht man, um eine verursacherbezogene Haftung sicherzustellen? Und wer wird überhaupt nachvollziehen können, wo gentechnisch veränderte Produkte enthalten sind, wenn diese nur als Saatgut gekennzeichnet werden würden? Bäuerinnen und Bauern sollen dagegen in die Abhängigkeit von internationalen Saatgutkonzernen getrieben werden. Vor allem aber ignoriert die EU mit ihrem Vorgehen den Willen einer deutlichen Mehrheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, die keine Gentechnik in ihrem Essen wollen.
SOZIALE ANFORDERUNGEN IM RAHMEN DER GAP
Seit dem 01.01.2025 ist die neue Verordnung über die soziale Konditionalität im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union in Kraft. Ziel ist es, auch in der europäischen Landwirtschaft die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu verbessern. Soziale Konditionalität bedeutet, dass Empfängern von Agrarzahlungen, die gegen das Arbeitsrecht des jeweiligen Landes verstoßen, Zahlungen gekürzt werden könnten. Die Verpflichtungen gelten für alle Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger, unabhängig von der Betriebsgröße. Die Naturland-Bertriebe erfüllen die Anforderungen bereits über die Sozialrichtlinie. Generell sollen in Deutschland keine über die bereits bestehenden bürokratischen Anforderungen hinausgehenden Maßnahmen eingeführt werden. Denn
kontrolliert wird die Einhaltung bereits heute von Berufsgenossenschaften, Bundesagentur für Arbeit, Zoll, Landesbehörden sowie Arbeitsgerichten. Neu durch die Verordnung dazugekommen ist, dass die Kontrollbehörden Rechtsverletzungen an die Zahlungsbehörden melden müssen. Verstöße können zu Kürzungen der Direktzahlungen oder bei den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes (inkl. Zahlungen für den ökologischen Landbau) führen. Wichtig zu wissen ist, dass die soziale Konditionalität nicht das deutsche Fachrecht ersetzt: Neben der nach deutschem Recht verhängten Strafe werden eventuelle EU-Gelder noch zusätzlich gekürzt.
Autor: Thomas Beutler, Naturland e.V.
QR-CODE AUF ZERTIFIKATEN EINGEFÜHRT
Seit Frühjahr wird auf Naturland-Zertifikate für Landwirte ein QR-Code gedruckt. Über diesen QR-Code kann jedes Zertifikat einwandfrei verifiziert werden. Auch Webzertifikate, die auf BioC zur Verfügung gestellt werden, sind von dieser Änderung betroffen. Fälschungen lassen sich somit einfach und zuverlässig erkennen, denn damit kann überprüft werden, ob das vorliegende Zertifikat mit dem Original-Zertifikat hinter dem QR-Code übereinstimmt. In der Vergangenheit gab es vereinzelt Fälschungsversuche. Verarbeiter-Zertifikate bleiben bis auf Weiteres wie bisher ohne QR-Code.

FRANZ BERNHOFER NATURLANDVORSITZENDER IN ÖSTERREICH
Der Aufbau von Verbandsstrukturen für die inzwischen rund 2.300 Naturland-Mitglieder in Österreich schreitet voran. In der neu gewählten Delegiertenversammlung ist Österreich mit insgesamt fünf Kandidaten vertreten. Beim Treffen im April in Pottenhofen (Niederösterreich) konstituierten die fünf Delegierten sich als erster Naturland-Staatenvorstand, vergleichbar den Landesvorständen in den deutschen Bundesländern. Franz Bernhofer, Milchviehbauer aus Golling (Salzburg), wurde zum österreichischen Naturland-Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Zeno Piatti-Fünfkirchen, auf dessen Ackerbaubetrieb die konstituierende Sitzung stattfand. Weitere Vorstandsmitglieder sind Hermann Huber (Ackerbau), Peter Eichhorn (Milchvieh) und Bernhard Schindler (Ackerbau und Schweine).
„Die Bildung des Staatenvorstands ist ein wichtiger erster Schritt, um Naturland in Österreich auch politisch ein eigenes

Der neue Naturland-Vorstand in Österreich, v.l.: Peter Eichhorn, Geschäftsführer Sepp Brunnbauer, Bernhard Schindler, Vorsitzender Franz Bernhofer, Zeno PiattiFünfkirchen und Hermann Huber.
Gesicht zu geben“, sagt Sepp Brunnbauer, der als Geschäftsführer seit November vergangenen Jahres die Entwicklung von Naturland in Österreich vorantreibt. Ein möglicher nächster Schritt sei die Gründung
von „Naturland Österreich“ als eigener Verein unter dem Dach des Gesamtverbands.
Autor: Markus Fadl, Naturland e.V.
Noch bis 30. Juni können sich
Betriebe für den Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau bewerben. Gesucht werden zukunftsweisende, innovative Betriebskonzepte. Außerdem gibt es die Möglichkeit, preiswürdige Betriebe vorzuschlagen.
Insgesamt stellt das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft ein Preisgeld in Höhe von 37.500 Euro bereit. Die drei Gewinner erhalten zusätzlich zum Preisgeld je einen kostenlosen Imagefilm. Infos über Teilnahmeberechtigung, Bewerbung und Bewerbungsunterlagen finden Interessierte unter www.wettbewerb-oekolandbau.de
GEMEINSAM BODEN GUT MACHEN
Betriebe in der Umstellungsphase unterstützt das NABUProjekt „Gemeinsam Boden gut machen“. Noch bis 30. Juni können sich Umstellungsbetriebe bewerben – auch Betriebe, die schon länger umgestellt sind, wenn sie einen neuen Betriebszweig mit mindestens 30 % Flächenzuwachs aufbauen wollen. Weitere Infos bei Sonja Straß (s.strass@naturland.de).
GESTEINSMEHL SOLL CO2 BINDEN
„Enhanced Rock Weathering“ (ERW) heißt übersetzt so viel wie „beschleunigte Gesteinsverwitterung“. Zusammen mit der Kölner Firma AEROC hat Naturland e.V. ein Forschungsprojekt begonnen, um die Wirkung des Verfahrens auf Ackerböden in Deutschland zu untersuchen.
Beim ERW wird fein vermahlenes Basaltgesteinsmehl auf dem Acker ausgebracht und eingearbeitet. Das Gesteinsmehl soll CO2 aus der Luft binden und im Boden in CO3 (Carbonat) verwandeln. In Versuchen in anderen Ländern konnten durchaus 300 kg CO2 pro Tonne Gesteinsmehl gebunden werden. In Deutschland gibt es aber bisher noch keine Versuchsergebnisse unter Praxisbedingungen. Naturland und AEROC haben daher an drei Standorten Exaktversuche mit zwei Basaltgesteinsmehlen angelegt. Sollten die Versuche erfolgreich sein, könnte diese Methode einen

Auf einem Bio-Acker nahe Marburg (Hessen) wird in Versuchsparzellen Gesteinsmehl ausgebracht.
nennenswerten Beitrag zur CO2 Reduzierung leisten und die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft verbessern. CO2 Zertifikate könnten dies unterstützen. Ein schöner Nebeneffekt der Gabe von vulkanischen Ge-
WALDGEBIET DES JAHRES IST
NATURLAND-ZERTIFIZIERT
Der Naturland zertifizierte Stadtwald von Wiesbaden ist das „Waldgebiet des Jahres 2025“. Die Auszeichnung, die alljährlich vom Bund Deutscher Forstleute (BDF) vergeben wird, wurde Anfang April im Rathaus der hessischen Landeshauptstadt an die Mitarbeitenden des städtischen Forstamts überreicht.
Naturland-Waldexperte Martin Reinold, der die ökologische Umstellung des Wiesbadener
Stadtwalds bereits 1999 selbst betreut hatte, gratulierte Forstamtsleiterin Sabine Rippelbeck und ihrem Team: „Die Auszeichnung würdigt die große Bedeutung, die eine naturnahe Waldbewirtschaftung für den Naturschutz wie auch für die Menschen hat. Durch die Bewirtschaftung nach den strengen Naturland Richtlinien wird die Stabilität des Ökosystems Wald gestärkt und zugleich seine Attraktivität für Besucher erhöht“, sagte Reinold.
steinsmehlen ist die Versorgung des Bodens mit Nährstoffen wie Kalk und Spurenelementen.
Autor: Werner Vogt-Kaute; Naturland e.V.
Nach dem Berliner Grunewald 2015 ist es bereits das zweite Mal, dass ein Naturland zertifizierter Forst zum Waldgebiet des Jahres gekürt wird. Bundesweit bewirtschaften derzeit 20 meist kommunale Forstbetriebe eine Gesamtfläche von mehr als 60.000 Hektar nach den strengen Naturland Richtlinien.
Autor: Markus Fadl, Naturland e.V.
AUF DER WEIDE BEWEGT SICH WAS
Es kommt Bewegung in die festgefahrene Debatte um die Weidepflicht. Die Bundesländer in Deutschland haben sich darauf verständigt, den Betrieben den Übergang zu erleichtern.
Konkret ist von einer fünfjährigen Übergangsfrist die Rede. Wenn die EU-Kommission keine Einwände gegen eine entsprechende Ergänzung des sogenannten Weidepapiers erhebt, wäre zumindest der zeitliche Druck, unter dem viele Betroffene derzeit stehen, fürs erste gelindert.
Einzelne Bundesländer gehen noch weiter. In Bayern hat der Agrarausschuss des Landtags die Staatsregierung aufgefordert, sich im Bund und auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass das Thema Weidepflicht grundsätzlich neu aufgemacht wird. Dabei müssten insbesondere die Erkenntnisse aus dem neuen Rechtsgutachten der Anwaltskanzlei Kapellmann berücksichtigt werden, heißt es in dem Anfang Mai einstimmig verabschiedeten Antrag.
Dieses Gutachten, das im Auftrag der Naturland Zeichen GmbH erstellt wurde, kommt zu dem klaren Schluss, dass die neue, starre Auslegung der Weide-
„Tierwohl ist mehr als Weide.“

pflicht durch die EU-Kommission nicht mit dem tatsächlichen Rechtsrahmen der EU-Öko-Verordnung zu vereinbaren ist. Vielmehr lasse der Verordnungstext explizit Alternativen zum Weidegang zu.
Ergänzt wird die rechtliche Klarstellung durch eine wissenschaftliche Stellungnahme der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zur Bedeutung der Weidehaltung für das Tierwohl. Demnach ist Tierwohl „ein ganzheitliches Konzept, das nicht auf einen einzelnen Haltungsparameter reduziert werden sollte. Die vereinfachende Gleichung ‚Weide = Tierwohl‘ ist wissenschaftlich schwer haltbar“, urteilt die Autorin, Prof. Dr. Dr. Eva Zeiler vom Lehrstuhl für Tierproduktionssysteme in der ökologischen Landwirtschaft.
Die EU-Öko-Verordnung erlaubt flexible Lösungen und Tierwohl ist mehr als Weide: Mit diesen beiden rechtlich und wissenschaftlich fundierten Argumenten im Gepäck kämpft Naturland weiter für eine praxisgerechte Auslegung der Weidevorgabe in der EU-Öko-Verordnung. Das tun wir im Schulterschluss mit dem Deutschen Bauernverband, um gemeinsam noch besseres Gehör in der Politik zu finden. Bei den Bundesländern gibt es bereits Bewegung, das ist ein erster Erfolg. Entscheidend wird nun sein, wie Brüssel reagiert, auch hier stehen wir in Kontakt. Bei Redaktionsschluss war das Ergebnis noch offen.


AUTOR Markus Fadl
Was der BÖLW von der neuen Regierung erwartet
VERANTWORTUNG für Bio
Die neue Bundesregierung wurde am 6. Mai vereidigt. Alois Rainer (CSU) leitet fortan das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Was erwartet die BioLandwirtschaft von der neuen Bundesregierung? Eine Einordnung des BÖLW.

AUTORIN
Tina Andres
Vorsitzende des Vorstands Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft
info@boelw.de
Merz‘ Koalition steht und hat einen 146 Seiten starken Vertrag, für dessen Umsetzung neue Köpfe verantwortlich sind. Für unsere Branche zunächst Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU), ein Mann vom Hof mit Meisterbrief. Söders Bonmot vom „schwarzen Metzgermeister“ hat Rainer gottlob von sich gewiesen. Stattdessen kündigte er schon mal an, anderthalb Milliarden Euro für Stallumbauten ausgeben zu wollen. Mit Rainer kommen zwei Frauen: Martina Englhardt-Kopf (CSU) aus der Oberpfalz und Silvia Breher (CDU)

AUTOR
Peter Röhrig
Geschäftsführender Vorstand Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft info@boelw.de
aus dem nahezu Bio-freien Landkreis Vechta werden Staatssekretärinnen.
Das Umweltministerium leitet Carsten Schneider (SPD). Er hat mit Jochen Flasbarth einen profilierten Umweltpolitiker als Staatssekretär. Flasbarths Karriere begann beim NABU. Später, als Präsident des Umweltbundesamts, warb er für eine gentechnikfreie, ökologische Landwirtschaft. Zuletzt stand er mit dem BÖLW als Staatssekretär im Entwicklungsministerium in Kontakt.
Wie Rainer kommt die neue Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) aus Bayern, einem Bundesland mit 30-Prozent-Bio-Ziel. Katherina Reiche, die neue CDUWirtschaftsministerin, war zu Künast-Zeiten lautstarke Befürworterin einer Grünen Gentechnik. Seitdem hat die Brandenburgerin allerdings den Verband kommunaler Unternehmen geleitet und dürfte wissen, wie beliebt Bio in deren Kantinen ist.
Der Koalitionsvertrag gibt den Ressorts Landwirtschaft, Umwelt, Forschung und Wirtschaft einiges

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer mit den beiden Staatssekretärinnen Martina Englhardt-Kopf und Silvia Breher. Im kleinen Bild begrüßt Bundesminister a.D. Özdemir Alois Rainer vor dem Ministerium.

auf in Sachen Bio. Hellsichtig heißt es darin: „Der Ökolandbau ist ein wichtiges Element einer nachhaltigen und klimaschonenden Landwirtschaft und ein wichtiger Innovationsmotor.“ Eine „Biostrategie“ soll zudem für mehr Bio sorgen, etwa mit „mehr Mitteln für die Forschung und Bildung für den Ökolandbau”. An diese Versprechen wird der Bio-Spitzenverband Schwarz-Rot erinnern!
Bei der GAP bleiben die Koalitionäre unterambitioniert; sie wollen nur an ein paar Schräubchen drehen. Anreize versprechen sie für Agroforste. Prima. In Berlin ist also bekannt, dass Innovation nicht zwingend in der Petrischale, sondern auf Äckern und Feldern stattfindet.
Auch die Bio-Nachfrage will man ankurbeln. So soll es „Standards für die Gemeinschaftsverpflegung“ geben und „gesunde Ernährung“ für Kinder. Wir interpretieren das als Standards für mehr frisches Bio in Kitas, Schulen und Kantinen – ein Erfolgsweg, wie immer mehr Bio-Städte zeigen.
Was Tierwohl angeht, will die Regierung „Mittel für den tier-
wohlgerechten Stallbau auf Grundlage staatlicher Verträge“ bereitstellen. Außerdem will sie die Technische Anleitung (TA) Luft und die TA Lärm vereinfachen –all das werden wir einfordern, um Investitionen für die Bio-Tierhaltung zu ermöglichen.
„Wir unterstützen Betriebsübergaben und Existenzgründungen im Handwerk“, verspricht Schwarz-Rot. Daran werden wir im Namen des Bio-Lebensmittelhandwerks anknüpfen. Ebenso wird der BÖLW bessere Strompreise auch für mittelständische Betriebe explizit einfordern. Die von der Koalition versprochenen „dauerhaft niedrigen“ Energiekosten dürfen nicht allein Großabnehmern zugutekommen. Der Bio-Mittelstand war und ist massiv von den Preissteigerungen betroffen!
Einfordern werden wir auch Mittel aus dem milliardenschweren Deutschlandfonds, mit dem Merz‘ Regierung Lücken beim „Wachstums- und Innovationskapital, insbesondere für den Mittelstand“ schließen will. Was könnte förderungswürdiger sein als kleine und mittlere Bio-Unter-
nehmen, zumal diese KMU stets innovativ und zugleich nachhaltig wirtschaften?! Die Koalition will auch den (zähen) Mittelfluss bei den GAK-Mitteln „überprüfen“. Damit sich daran etwas ändert, müssen Bund und Länder auch die komplizierten GAK-Förderungsvorgaben entbürokratisieren, die viele Bios bisher davon abschrecken, überhaupt Förderanträge zu stellen.
In Sachen Gentechnik werden wir nachdrücklich an das Koalitionsversprechen erinnern: „Wir schützen den selbstbestimmten Verbraucher umfassend und vorsorgend.“ Dazu gehört ja wohl zwingend, auch „Neue Gentechniken“ (NGT) einer Risikobewertung zu unterziehen. Und damit Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich selbst bestimmen können, was sie essen wollen (und was nicht), braucht es natürlich auch die NGT-Kennzeichnung.
Ja, Bio hat einen starken Platz im Koalitionsvertrag. Die Umsetzung wird allerdings kein Selbstläufer, sondern braucht starkes politisches Engagement von uns Bios!
TITEL THEMA

Die Krux mit dem
STICKSTOFF
Die Stickstoffdynamik im Boden zu verstehen und zu nutzen, ist der Schlüssel zum erfolgreichen BioAckerbau. Es lohnt deswegen immer wieder, sich die Zusammenhänge bewusst zu machen.
Das Gefühl eines jeden Landwirtes, dass ohne Stickstoff „nichts“ wächst, ist vollkommen berechtigt. Stickstoff ist mengenmäßig das wichtigste Nährelement für Pflanzen und Mikroorganismen. Ohne Stickstoff wären weder Photosynthese noch das Leben möglich, da er ein grundlegender Baustein für Aminosäuren und Proteine sowie ein wesentlicher Bestandteil der DNA ist.
Stickstoff im Ackerboden
In den obersten 30 cm des Bodens befinden sich in einem Hektar häufig bis zu 9.000 kg Stickstoff. Stickstoffreiche Minerale gibt es nicht; der überwiegende Anteil des Stickstoffs ist organisch im Humus gebunden. Man kann aufgrund seiner Verbindungen und Pflanzenverfügbarkeit drei Pools unterscheiden.

1. Der größte Stickstoff-Pool ist Strukturbestandteil des Humus; dieser ist sehr eng mit der Mineralmatrix und dem organischen-Kohlenstoff verbunden und kann im Boden viele Jahre und Jahrzehnte überdauern.
2. Im mittelgroßen StickstoffPool, im Ausmaß von einigen hundert Kilogramm, liegt der Stickstoff in leichter abbaubaren Verbindungen vor. Dazu gehören beispielsweise lebende und abgestorbene Biomasse von Bodenmikroorganismen und -pilzen oder Wurzelausscheidungen und Wurzelreste. Dieser Anteil wird auch als Nährhumus bezeichnet. Er kann innerhalb weniger Stunden bis Monate im Boden umgesetzt und mineralisiert werden.
3. Den kleinsten Pool am Gesamtstickstoff-Gehalt von wenigen kg pro Hektar im Boden stellt der mineralische Stickstoff in Form von Nitrat (NO3-) und Ammonium (NH4 +) dar. Dieser ist für die Pflanzen sofort verfügbar. Ammonium ist an Tonminerale oder an Humus durch seine positive Ladung gebunden und somit für die Pflanze austauschbar.
„
In den obersten 30 cm des Bodens befinden sich bis zu 9.000 kg Stickstoff pro Hektar.“


Bio Forschung Austria m.bonell@ bioforschung.at
Das Ammonium-Ion wird in belüfteten Böden Mitteleuropas aber durch die Nitrifikation sehr rasch in das negative Nitrat-Ion umgewandelt. Nitrat ist im Boden sehr beweglich und in hohem Maße auswaschungsgefährdet!
Die drei Stickstoff-Pools sind über Abbau- und Einbauprozesse in beiden Richtungen durch die Aktivität von Mikroorganismen, Bodenlebewesen und Pilzen miteinander verbunden.
„Je belebter der Boden ist, desto dynamischer laufen die Prozesse.“
Mikroorganismen bauen Dauerhumus oder Nährhumus ab, Stickstoff wird mineralisiert und pflanzenverfügbar. Umgekehrt kann gelöster Stickstoff wieder festgelegt werden, wenn ihn z. B. Mikroorganismen für den Aufbau ihres Körper-Eiweißes verwenden. Dann geht er in den Nährhumus- oder den Dauerhumus-Pool über.
Mikroorganismen fördern
Je belebter der Boden ist, desto dynamischer laufen die Prozesse ab. Für eine ausreichende und möglichst verlustarme Stickstoffversorgung ist es notwendig, den Nährhumus-Pool zu vergrößern und die Verbindungen zwischen
den Stickstoff-Pools zu stärken. Dies wird durch eine aktive und vielfältige Mikroorganismen-Population erreicht. Aus den Ausscheidungsprodukten der Bodenlebewesen oder wenn Mikroorganismen absterben –manche leben sogar nur wenige Minuten – werden laufend kleine Mengen an Stickstoff in mineralischer Form frei, auf die die Pflanzenwurzeln zugreifen können. Wie viele Mikroorganismen, Pilze und Bodentiere in einem Boden leben, kann der Landwirt beeinflussen, indem er sie nicht durch Pestizide (vor allem Fungizide) abtötet, das Bodenleben durch ausreichend organisches
Material wie Stroh, Kompost, Mist, Anbau von Begrünungen
AUTORIN
Marion Bonell

NITRAT TEST
Der Nitrat-Test ist eine einfache Möglichkeit, den Nitratgehalt im Boden abzuschätzen. Diese Nitrat-MessstreifenMethode kann jeder einfach, schnell und eigenständig am Betrieb durchführen. Sie wurde 1982 von Ruth Brantl-Maurer am Ludwig-Boltzmann-Institut für Biologischen Landbau in Wien gemeinsam mit der Firma Merck entwickelt. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für Biologischen Landbau war das Vorläufer-Institut von Bio Forschung Austria. Nitratstreifen sind im Handel in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Ablesebereich im Konzentrationsbereich von 10–500 mg/l NO3 liegt.
usw. füttert und Bodenverdichtungen vermeidet. Denn Mikroorganismen benötigen gute Durchlüftung und ausreichendes Porenvolumen, um genügend Sauerstoff zum Atmen zu haben und leben zu können. Eine gute Bodenstruktur mit vielen Poren ermöglicht zudem eine verbesserte Wasseraufnahme und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens, welche sich sowohl auf das Bodenleben als auch auf die Pflanzen positiv auswirkt.
Wann Stickstoff freigesetzt wird
Immer wenn Mikroorganismen absterben, wird Stickstoff aus ihrem Körper freigesetzt und zu Ammonium und Nitrat mineralisiert. Wenn beispielsweise durch
den Frost im Winter viele BodenMikroorganismen abgestorben sind, wird bei der Wiedererwärmung des Bodens im Frühjahr viel mineralischer Stickstoff frei. Der gleiche Effekt ist bei der Wiederbefeuchtung nach ei ner Trockenperiode oder nach einer Bodenbe arbeitung zu beob achten. Hierbei gilt: je intensiver und tiefer die Bodenbearbeitung ist, desto stärker ist die Stickstoff-Freisetzung. Auch ist die StickstoffMineralisierung bei Böden mit einem guten
Mikroorganismen benötigen gute Durchlüftung und ausreichendes Porenvolumen, um genügend Sauerstoff zum Atmen zu haben.

Fotos: Marion Bonell, Agrarfoto,


„Vor einem geplanten Leguminosen-Anbau sollten weniger als 30 kg Nitratstickstoff pro Hektar im Boden vorhanden sein.“
Speicher in Form von Dauerund Nährhumus größer als bei ausgemagerten Böden.
C/N-Verhältnis
Ein weiterer Einflussfaktor ist das C/N-Verhältnis im Boden, aber auch von Pflanzenrückständen oder der Begrünungsbiomasse. Ist das C/N-Verhältnis eng (<25), wie beispielsweise in Leguminosenbiomasse und -wurzeln, findet ein rascher Abbau statt und Stickstoff wird freigesetzt. In Böden mit weitem C/N-Verhältnis oder beim Abbau von stickstoffarmen Pflanzenrückständen erfolgt der Abbau langsamer oder der Stickstoff kann vorübergehend festgelegt werden, sodass er nicht unmittelbar wieder pflanzenverfügbar ist. So
kann beispielsweise überschüssiger mineralischer Stickstoff im Boden durch die Einarbeitung von Getreidestroh (C/N 80-100) vor Auswaschung geschützt werden. Das C/N-Verhältnis von Pflanzen ist von Art, Alter und Bodenverhältnissen abhängig, daher können Zeitpunkt und Menge der Stickstofffreisetzung über die Zusammensetzung von Begrünungsmischungen, Management und Umbruch beeinflusst werden.
Maßnahmen prüfen
Die Kunst des Ackerbaus besteht darin, den eigenen Boden gut zu kennen und die Fruchtfolge optimal auf den Standort sowie die Nährstofffreisetzung auf den Bedarf der Kultur ab-
zustimmen. Vor Starkzehrern muss eine hohe Stickstoffmobilisierung gewährleistet werden, während vor Leguminosen und Schwachzehrern möglichst geringe Stickstoffmengen im Boden sein sollten. Die Werkzeuge, mit denen dies erreicht werden kann, sind Bodenbearbeitung, Leguminosen- und Begrünungsanbau. Für ein perfektes Management ist es wichtig, die eigenen Maßnahmen zu überprüfen. Beispielsweise sollten vor einem geplanten Leguminosen-Anbau weniger als 30 kg Nitratstickstoff pro Hektar im Boden vorhanden sein: je mehr N bereits vorhanden ist, desto weniger wird über die Tätigkeit der Knöllchenbakterien neu hinzugewonnen und desto mehr werden Unkräuter da-
Wird die Begrünung umgebrochen, sollte die Freisetzung und Nutzung des Stickstoffs bedacht werden.
von profitieren. Wie viel Nitrat sich in Ihrem Boden befindet, können Sie mit dem einfachen Nitrattest selbst herausfinden. Wie Sie diesen einfach und unkompliziert in sieben Schritten durchführen können, lesen Sie auf den Seiten 18 und 19.
Der Artikel ist im Rahmen des EU Förderprogramms Interreg VI-A Österreich – Tschechien genehmigten Projektes RESISOL, ATCZ00054, welches durch die Europäische Union kofinanziert ist, entstanden. Im Projekt RESISOL wird eine innovative Methode zur Einschätzung der Klimafitness von Böden geschaffen und unter Praxisbedingungen geprüft. Die Methode wird durch die Erarbeitung von einfachen Werkzeugen und Methoden, die direkt von den Praktikern selbst angewendet werden können, ergänzt.
BioBio-ErdbeerErdbeer-Topfpflanzen Topfpflanzen
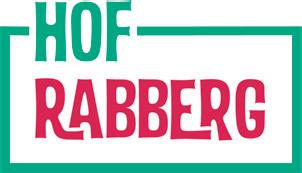
Hof Rabberg GbR
Alke Thiesen
Toft 8 · 24405 Rügge
Bestellen Sie jetzt! Bestellen Sie jetzt!
lieferbar ab August
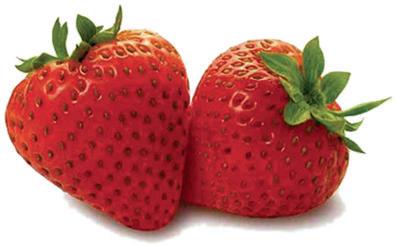
Tel.: 0160-9444 9729 erdbeeren@hof-rabberg.de www.hof-rabberg.de


SCHNELLER UND PRÄZISER HACKEN

Kameratechnik mit einzigartiger Farbintelligenz
exakte Steuerungstechnik ab 5 cm Reihenabstand
höhere Genauigkeit bis 27 m Arbeitsbreite

Die beste Hacktechnik vom Erfinder der Kamerasteuerung info@garford.de www.garford.de




















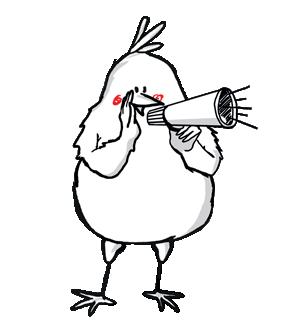


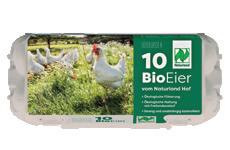






ötz: Eine Initiative von Bioland & Demeter oekotierzucht.de Mehr Infos
In 7 Schritten zum Nitratgehalt
Der Nitrat-Test ist eine einfache Möglichkeit, den Nitratgehalt im Boden abzuschätzen. Die Methode kann jeder einfach, schnell und eigenständig am Betrieb durchführen. Das Ergebnis des NitratTests ist völlig ausreichend als Entscheidungshilfe, ob beispielsweise der Anbau von Leguminosen zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, oder welche Begrünungspflanzen angebaut werden sollen, um Auswaschungsverluste zu verhindern. Die Wiedererwärmung im Frühjahr simulieren Sie, indem Sie eine Bodenprobe bereits im Winter entnehmen und anschließend an einem warmen Ort lagern.
AUTORIN
Bio Forschung Austria


1 2


3
Marion Bonell



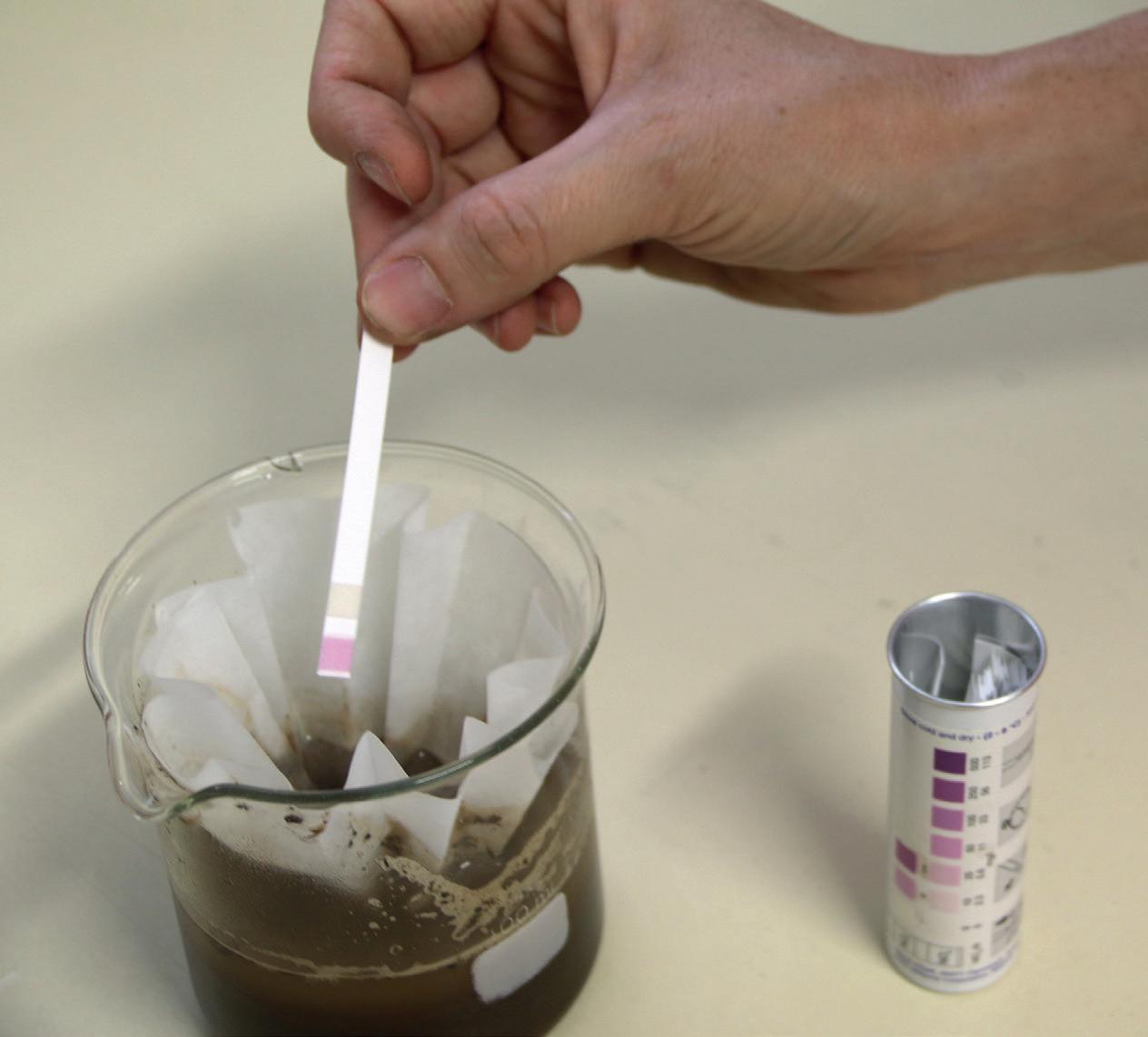
1. Bodenproben ziehen
Für den Nitrat-Test werden mit einem Bodenstecher Bodenproben entnommen und in drei Schichten (0–30, 30–60 und 60–90 cm Bodentiefe) getrennt. Um jeweils eine repräsentative Bodenprobe der drei Schichten zu erhalten, mischt man die Proben von zehn Einstichen je Versuchsfläche. Die Bodenproben sollten möglichst gleich nach der Entnahme analysiert oder gekühlt gelagert werden.
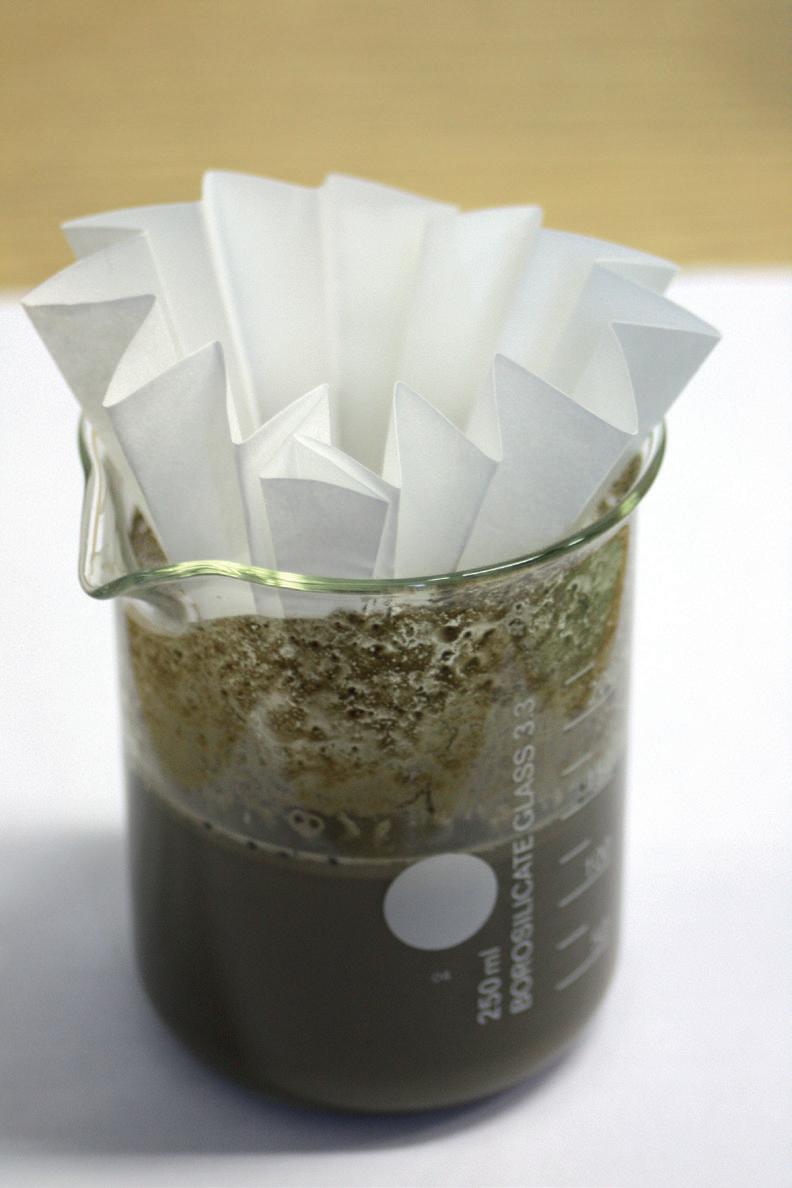
2. Feuchte messen
Zu Beginn des Nitrat-Tests wird die Bodenfeuchte mittels Fingerprobe wie in der Tabelle geschätzt. Der Feuchtigkeitsgehalt wird später für die Berechnung des Nitratgehalts im Boden benötigt.
3. Boden sieben
Anschließend wird der naturfeuchte Boden mit beispielsweise einem Nudelsieb gesiebt (Lochgröße etwa 5 mm) oder es werden zumindest die größeren Steine entfernt und größere Brocken zerkleinert.
4. Wasser hinzufügen
Mithilfe einer Küchenwaage werden daraufhin 100 g des gesiebten Bodens in einen Becher eingewogen und 100 ml destilliertes Wasser zugefügt. Es ist wichtig, destilliertes Wasser zu verwenden, weil Leitungswasser mancherorts Nitrat enthält.
5. Verrühren
Mit einem Löffel verrührt man die Bodensuspension so lange, bis keine festen Brocken mehr vorhanden sind und der Boden vollständig aufgeschlämmt ist. Bei tonigen Böden gibt man zum destillierten Wasser einen halben Kaffeelöffel Kaliumchlorid oder Kochsalz dazu. Das beschleunigt Aufschlämmen und Filtrieren.
6. Filtrieren und messen
Anschließend wird das Boden-Wasser Gemisch filtriert. Dazu wird ein gefalteter Filter in die Lösung eingetaucht und gewartet, bis ca. 2 cm hoch klare Flüssigkeit in das Innere des Filters durchgesickert ist. Durch Eintauchen eines Nitrat-Messstreifens in die Flüssigkeit wird anschließend die NitratBestimmung durchgeführt.
7. Ergebnis
Der Messstreifen wird eine Sekunde lang in das Filtrat eingetaucht, überschüssige Tropfen werden danach abgeschüttelt. Nach genau einer Minute wird die Farbe des Messfelds für Nitrat (NO3 -) mit der Skala auf der Dose verglichen. Der abgelesene Wert wird nun mit dem durch die Bodenfeuchte ermittelten Faktor aus der Tabelle multipliziert und man erhält den Nitrat-Stickstoff-Gehalt der Bodenprobe in Kilogramm pro Hektar.

STICKSTOFF ÜBER DIE
Fruchtfolge
Es ist die hohe Kunst des Ökolandbaus: Stickstoffversorgung über die Fruchtfolge. Leguminosen sind dabei die Grundpfeiler – aber auch die Bodenbearbeitung entscheidet, ob Stickstoff der Vorfrucht den Bedarf der nachfolgenden Kultur deckt.
„Was kann man im nächsten Jahr denn anbauen?“ – Keine andere Frage wird so häufig nach der Getreideernte gestellt. Meist geht es dabei in erster Linie um ökonomische Faktoren: Von welcher Kultur erwarte ich im nächsten Jahr den besten Ertrag und die besten Verkaufserlöse?
Wo liegen nun aber die entscheidenden Kriterien bei der Fruchtfolgegestaltung? Eigentlich beginnt jede Anpassung der Fruchtfolge mir der Rückbesinnung auf ihre klassischen Prinzipien. Die ökonomischen Kriterien dürfen dabei nicht die allein ausschlaggebende Rolle spielen. Viel wichtiger ist, Nährstoffkreislauf, Pflanzengesundheit und weitere Faktoren über die gesamte Fruchtfolge hinweg zu optimieren. Dabei sind die Auswahl geeigneter Kulturen sowie deren notwendige Anbaupausen entscheidend, und gerade im Hinblick auf die Stickstoffversorgung spielen Leguminosen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig geben sie uns mit ihren vielfältigen, fruchtfolgebedingten Krankheiten (Leguminosenmüdigkeit) den zeitlichen Rahmen vor. Und da gibt es auch wenig Spielraum: Der Schlüssel zu einem nachhaltig erfolgreichen Leguminosenanbau ist es, die Anbaupausen einzuhalten; das gilt sowohl für Hauptfrüchte als auch für Zwischenfrüchte (Tab.1). Bei Feldfutterleguminosen sind mindestens vier Jahre und bei Körnerleguminosen je nach Art zwischen vier und zehn Jahre (z.B.: Sojabohne: 4; Erbse: 8) Anbaupausen einzuhalten. Die Beachtung dieser Vorgaben bildet gerade im Ökolandbau das
Tab.1: Anbaupausen ausgewählter Leguminosen

AUTOR
Stefan Veeh
Beratung für Naturland s.veeh@ naturland-beratung.de
Grundgerüst der Fruchtfolge; ein dem Standort und der Vorgeschichte auf dem Acker angepasster Wechsel von Winterungen und Sommerungen sowie von Blatt- und Halmfrüchten sind auch wichtig – aber im Vergleich dazu nicht selten eher nachrangig.
Stickstoff aus Leguminosen nutzen
Um den Vorfruchtwert der Leguminosen optimal nutzen zu können, braucht es eine optimale Gestaltung der Fruchtfolge rund um die Leguminosen. Nach Umbruch der Leguminosen wird Stickstoff freigesetzt, der den Folgekulturen zur Verfügung steht. Wie viel und wie schnell, ist unterschiedlich je nach Pflanzengattung und Standzeit sowie je nach Umbruchmethode und Witterung. Gerade in diesem sensiblen Zeitfenster nach den Leguminosen kann es durchaus vorkommen, dass Stickstoff zur falschen Zeit mineralisiert. Damit kann ein Teil des Vorfruchtwertes verloren gehen. Und damit „verpufft“ die Wirkung des Werkzeugs Leguminose, das wegen der Anbaupausen nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden kann.
Kultur Anbaupausen (Jahre) Ursachen
Körnerleguminosen
Erbsen 6 – 10
Ackerbohnen 3 – 5
Sojabohnen 3 – 4
Lupinen 3 – 5
Pilzl. Schaderreger (Krankheitskomplex)
Pilzl. Schaderreger (Krankheitskomplex)
Pilzl. Schaderreger (Sclerotinia, Peronospora)
Pilzl. Schaderreger
Leguminosengemenge wie jeweilige Leguminose zu betrachten
Feldfutter
Rotklee, Luzerne, Inkarnatklee, Esparsette 4 – 7
Weißklee, Gelbklee, Schwedenklee, Serradella 1 – 3
Kleekrebs, Fusariumwelke, Blattflecken
Weißklee weitestgehend selbstverträglich, Rest wie andere Kleearten

Wird der Kleegrasaufwuchs genutzt bzw. abgefahren, so regt das die Stickstofffixierung an.
Der Erfolg der Fruchtfolge hängt im Wesentlichen von drei Fragen ab:
1. Werden Leguminosen passend mit den nötigen Anbaupausen in der Fruchtfolge platziert?
2. Wie gut können Leguminosen-Bestände etabliert werden?
3. Kann der Vorfruchtwert der Leguminosen effizient auf die Folgekulturen „übertragen“ werden?
Dabei ist wichtig zu wissen, wie viel Stickstoff von einem Leguminosenbestand überhaupt fixiert werden kann und mit welcher Geschwindigkeit dieser Stickstoff mineralisiert. Klee kann zum Beispiel leicht 200 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr fixieren. Dieser Stickstoff wird aber nicht auf einen Schlag wieder freigegeben, sondern er mineralisiert nach und nach, da die unterschiedlichen Pflanzenteile verschiedene C/N-Verhältnisse haben. So werden die Knöllchenbakterien mit einem C/N-Verhältnis von 1:5 nach dem Umbruch schnell umgesetzt, dieser Stickstoff steht der Folgekultur im Herbst schnell zur Verfügung. Der Großteil des in der Wurzelmasse gebundenen Stickstoffes steht aber erst im Laufe der Vegetation im Folgejahr zur Verfügung. Je schwerer und feuchter der Standort ist, kann der HauptMineralisierungsschub auch erst im Jahr danach erfolgen.
Umbruch von Kleegras
Was bedeutet das für die Praxis? Für die Nährstoffversorgung der Folgekultur stellt sich die Frage, ob der umzubrechende Feldfutterbestand nur aus „schwer verdaulichen“ Wurzeln besteht oder ob mit dem Einarbeiten des letzten Aufwuchses vor dem Umbruch noch „leicht verdaulicher“ Stickstoff ins System eingespeist werden soll.
Tab.2: C/N-Verhältnis im Kleegrasgemisch
Material C/N-Verhältnis
Klee Stoppel 15
Knöllchen 5
Feinwurzel 20
Pfahlwurzel 25
Gesamtpflanze 15
Gras 20
Natürlich spielt dabei auch die Art und Weise des Kleegrasumbruchs eine große Rolle. Wird der Bestand intensiv durchmischt, wird damit die Mineralisation deutlich angeregt. Wird der Bestand hingegen mit dem Pflug „gedreht“, startet die Mineralisierung langsamer. Dafür spielen auch die Umsetzungsprozesse im Boden eine wesentliche Rolle; für die Arbeit der stickstofffreisetzenden Bakterien und mögliche Stickstoffverluste ist vor allem die Bodentemperatur ausschlaggebend. Wer also Kleegras bereits im Juni umbricht und dann erst im November Weizen nachbaut, hat zum einen großes Potenzial verspielt und zum anderen ein großes Risiko für Auswaschungsverluste geschaffen. Wer also trotz Kleegrasvorfrucht wenig begeistert ist vom Wuchs der nachfolgenden Kultur, sollte sich Gedanken über Umbruchzeitpunkt, Umbruchsintensität sowie Zusammensetzung und Nutzung der Mischung machen.
Körnerleguminosen: N ist schnell verfügbar
Das Gegenteil ist oft bei Körnerleguminosen der Fall. Dort profitiert das nachfolgende Getreide häufig von der schnellen Umsetzung und viele Betriebsleiter sind dann begeistert von der guten Vorfruchtwirkung. Erbse und Ackerbohne hinterlassen allerdings „nur“ zwischen 60 und 80 kg/ha Stickstoff, denn hier wird ja ein wesentlicher Teil des Stickstoffes mit dem Korn vom Acker abgefahren.
Kultur in der Fruchtfolge: N-Management:
Kleegras Kleeanteil in der Ansaatmischung entscheidet über N-Fixierungspotenzial, Kleegrasbestand muss gut etabliert werden, Aufwuchs nutzen bzw. abfahren, um Stickstofffixierung anzuregen.
Kleegras Umbruch und letzten Aufwuchs so gestalten, dass genug „schnell“ verfügbarer Stickstoff für die Folgekultur bleibt und wenig Emissionen entstehen.
Weizen
Starkzehrer platzieren, der gutes Stickstoffangebot nutzen kann, Übergang zur Folgekultur ggf. mit Zwischenfrucht managen.
Hafer/Mais Zwischenfrucht so umbrechen, dass „gebundener“ Stickstoff passend zum Bedarf der Kultur mineralisiert wird.
Ackerbohne/Sojabohne Leguminose dann platzieren, wenn Stickstoff des Feldfutters „aufgebraucht“ ist, Ausfallleguminosen als Zwischenfrucht aufwachsen lassen, um Vorfruchtwert zu erhöhen.
Dinkel Körnerleguminosenvorfrucht nutzen, Zehrer platzieren.
Sonnenblume
Abtragende Kulturen am Ende platzieren, die mit „wenig“ Stickstoffangebot zurechtkommen, ggf. Fruchtfolge verlängern, wenn Stickstoffangebot noch ausreichend.
Viele Betriebe lassen aber die Ausfallbohnen oder -erbsen noch einmal auflaufen und arbeiten den Bestand dann kurz vor der Saat des nachfolgenden Getreides ein. Damit haben sie schnell verfügbaren Stickstoff, der vor allem in der Jugendentwicklung seine Wirkung entfaltet – allerdings potenziell auch Auswaschungsgefahren birgt. Das ist das Gegenbeispiel zu den langsam umsetzbaren Luzernewurzeln.
Beispiel einer Fruchtfolge
Wie kann ich das für die Praxis nutzen? Am Anfang der Fruchtfolge steht in der Regel ein überjähriges oder mehrjähriges Kleegras. Danach folgen meist zwei (manchmal auch drei) Stickstoffzehrer, oft Weizen und – wenn möglich – eine Sommerung, wie z.B. Hafer, Mais oder Zuckerrübe. Natürlich muss der Stickstoff zwischen Winterung und Sommerung über eine geeignete Zwischenfrucht gemanagt werden, um mögliche Verluste zu minimieren. Dabei kann es Sinn machen in die Zwischenfrucht Leguminosen wie Alexandriner- oder Perserklee oder auch Körnerleguminosen einzumischen, um zusätzlich NInput in die Fruchtfolge zu haben. Bei vielen Hauptfruchtleguminosen in der Fruchtfolge oder einem sehr hohen N-Niveau macht dies aber keinen Sinn.
Nach zwei (oder drei) stickstoffzehrenden Kulturen, die den durch die Feldfutterleguminose fixierten Stickstoff nutzen und „abtragen“, folgt eine zweite Leguminose in der Fruchtfolge, meist in Form einer Körnerleguminose, die auch für eine stärker zehrende Kultur noch genügend Stickstoff bereitstellt; am Ende der Fruchtfolge steht in der Regel eine abtragende Kultur mit geringeren Ansprüchen.
Fehler im N-Management
Fehler im Stickstoffmanagement der Fruchtfolge lassen sich meist klar erkennen: Das Bild schwach wachsender Getreidebestände als Zeichen von Stickstoffmangel ist Landwirten bekannt. Aber auch Unkräuter wie Distel, Melde und Gänsefuß gelten als wichtige Zeiger für den N-Haushalt: Sie sind sogenannte Stickstoffzeiger und erfüllen diese Funktion immer dann, wenn Stickstoffangebot des Bodens und Stickstoffbedarf der Hauptkultur nicht zusammenpassen. Dabei reagiert die Distel vor allem auf eine Verlagerung im Unterboden; Gänsefuß und Melde erwachsen sich den freien Stickstoff im Oberboden.
Kurz & knapp
Grundsätze für die Fruchtfolgegestaltung:
1. Anbaupausen der Leguminosen einhalten, um ihr Leistungspotenzial zu erhalten.
2. Umbruch der Feldfutterleguminosen steuern: so spät wie möglich, so früh und intensiv wie nötig.
3. Begleitung der Fruchtfolge mit Bodenproben (Nmin oder Nitrattests) – Stickstoff „sichtbar“ machen.
4. Stickstoff zwischen den Hauptkulturen mit angepassten Zwischenfrüchten managen.
5. Kulturen so wählen, dass Stickstoff aufgebaut, aber auch genutzt wird.
6. Organische Dünger so einplanen, dass zusätzlicher Stickstoff auch genutzt werden kann.
Tab.3: Beispiel für Fruchtfolge
Fotos: Goldberger
Fotos: Leah


AUTORIN
Leah Hornung
Beratung für Naturland l.hornung@ naturland-beratung.de
Hornung
Futter – Dünger
KOOPERATIONEN
Eine Möglichkeit für viehlose Bio-Ackerbauen, an Wirtschaftsdünger zu kommen, sind Kooperationen mit Rinderhaltern oder Biogasanlagen. Wie dies organisiert werden kann, zeigen zwei praktische Beispiele.
„Das ist unsere Schmusekuh“, sagt Landwirt Armin Zeitz und zeigt auf seine Kuh Lavendel, die gerade genüsslich das frisch gemähte Kleegras auf dem Futtertisch frisst. Der Milchviehhalter aus dem unterfränkischen Dittlofsroda füttert seine 35 Milchkühe ausschließlich mit Grünfutter und Heu als Grundfutter – viel davon stammt aus Futter-Mist-Kooperationen mit viehlosen Ackerbauern.
Ab zeitigem Frühjahr Grünfutter
Armin Zeitz verarbeitet die Milch größtenteils in der hofeigenen Käserei. Da unter anderem auch Rohmilchkäse produziert wird, verzichtet der Betrieb bewusst auf Silagen. Diese können bei der Reifung des Käses zu unerwünschten Fehlgärungen führen. Der Betrieb setzt auf eine lange Grünfutterperiode, da Heuernte und Trocknung energie- und arbeitsintensiv sind. Im Winter wird Heu (plus Kraftfutter) gefüttert. Um die hohe Qualität auch im Winter sicherzustellen, ist Ballentrocknung unerlässlich, um auch schon frühzeitige Schnitte in Form von Heu gut lagern zu können. Ab Mitte April wird den Tieren zweimal pro Tag frisches Grünfutter von Wiesen und Kleegrasäckern vorgelegt.
Futter-Mist-Kooperation
„Durch die sich ausdehnende Frühsommer- und Sommertrockenheit in Unterfranken wird die Futtermenge jedoch immer knapper“, erklärt der Betriebsleiter. Aus diesem Grund ist er froh, dass er FutterMist-Kooperationen mit viehlosen Ackerbauern aus der näheren Umgebung eingehen kann. Seine Kooperationspartner bauen für ihn Kleegras und Luzerne an und bekommen im Tausch Rindermist aus seinem Tretmiststall. Das Verhältnis von Kleegras zu Rindermist wird je nach Trockensubstanz des Ern-
Das Verhältnis von Kleegras zu Rindermist wird je nach Trockensubstanz des Erntegutes im Verhältnis 1:1 getauscht.



2

tegutes im Verhältnis 1:1 getauscht. Für eine Tonne Grünfutter erhält der Ackerbauer also eine Tonne Rindermist. Im Idealfall wird in so einer Futter-MistKooperation das Nährstoffäquivalent vom abgefahrenen Kleegras gegen den Mist getauscht. In der Praxis müssen die beiden Kooperationspartner einen Weg finden, bei wechselnden Futtermitteln (Silage oder Heu, Klee oder Gras) einen gerechten Ausgleich zu finden. „Am Ende muss es für beide passen, wir wollen ja langfristig zusammenarbeiten“, sagt Armin Zeitz. Das brauche auch Kompromissbereitschaft.
Weil auch viehlose Ackerbauern den Wert der Feldfutterleguminosen für die Fruchtfolge schätzen, ist diese Kooperation eine Win-Win-Situation: Der viehhaltende Betrieb hat Grundfutter in ausreichender Menge und Qualität und der Ackerbauer mit dem Kleegras einen Mehrwert durch die bessere Fixierungsleistung der Feldfutterleguminosen und damit mehr gesammelten Stickstoff als „Motor“ für seine Fruchtfolge. Hinzu kommt, dass er den getauschten Wirtschaftsdünger zur Verfügung hat, um diesen gezielt in der Fruchtfolge einzusetzen. Muss der Mist beim Ackerbauern zwischengelagert werden, sind diesbezüglich die jeweiligen rechtlichen Vorgaben zur Lagerung, beispielsweise am Feldrand, zu beachten. Hier ist eine Absprache zwischen den Kooperationspartnern sinnvoll, um zum einen die Vegetationsperiode zu überbrücken, aber auch, um die Lagerkapazitäten des abgebenden Betriebes zu schonen. So bekommt der Mist genug Zeit, um am Feldrand abzulagern und zu verrotten, um dann in der folgenden Kultur seine volle Wirkung zu entfalten.
Futter mit Gärrest tauschen
Thomas Eschenbach hat als viehloser Ackerbauer auch eine Kooperation, jedoch wird sein Kleegras nicht von einer Kuh verwertet, sondern von der nahgelegenen Biogasanlage der Bioenergie Bad Königshofen. Die Agrogasanlage benötigt täglich knapp 50 Tonnen Futter, um in ihrer mehr als EinMegawatt-Anlage Wärme und Strom zu erzeugen.
1 Über Kooperationen mit Biogasanlagen erhalten Betriebe Gärreste als schnell wirksame Wirtschaftsdünger.
3 Fotos: Leah Hornung
2 Im Idealfall lagert der Ackerbauer den Mist gleich am Feldrand des Ackers, auf den der Mist in der folgenden Kultur ausgebracht werden soll.
3 Um Rehkitze zu schützen, werden die Kleegrasflächen vor dem ersten Schnitt mit Drohnen beflogen. Dies wird zentral vom Betreiber der Biogasanlage organisiert. 1
Siebzig bis hundert Lieferanten bauen jährlich unter anderem Mais, Ganzpflanzensilage und Kleegras an, die an die Anlage geliefert werden. Auch Dauergrünland wird siliert und Festmist vergoren. Jeder Input wird bei Ankunft mit Gewicht und Trockensubstanz erfasst. Nach dem Masseinput richtet sich nämlich auch die Menge an Gärrest, die wieder entnommen werden darf, berichtet der Naturland-Landwirt Thomas Eschenbach. Der Gärrest wird zweimal im Jahr auf Nährstoffe untersucht, jeweils im Frühjahr und Herbst. Diese Analysen stehen den Betrieben, die Gärreste abnehmen, zur Verfügung. Zusätzlich wird von einer unabhängigen Kontrollstelle kontrolliert, ob die Anlage die Vorgaben der ökologischen Landwirtschaft einhält. 80 Prozent des Masseinputs bekommen die Lieferanten von der Anlage wieder gutgeschrieben, aus einer Tonne Kleegras können ca. 200 kg Gas gewonnen werden. Für das angelieferte Klee- und Luzernegras werden 80 bis 90 Prozent des Maispreises bezahlt. Der Gärrest wird im Verhältnis der gelieferten Substrate wieder an die Landwirte verteilt.Somit können Naturland-Betriebe den gelieferten Nährstoff-Output wieder ausgleichen.
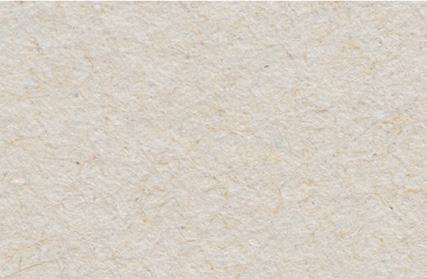
Gemeinsame Rehkitzsuche
Die Kleegrasflächen werden vor dem ersten Schnitt mit Drohnen beflogen, um Rehkitze zu entdecken. Dies ist jährlich ein großer organisatorischer Aufwand und wird zentral vom Betreiber der Biogasanlage organisiert. Frühes Abfliegen der Flächen mit bis zu fünf Drohnen wäre ohne freiwillige Helfer der Hegegemeinschaften nicht zu stemmen. „Der hohe Aufwand lohnt sich“, sagt Thomas Eschenbach.
Schnell wirksamer Dünger
Der Kreislaufgedanke steht bei der Kooperation mit der Biogasanlage im Vordergrund. Das in der Fruchtfolge notwendige Kleegras wird verwertet und dabei gleichzeitig für das naheliegende Bad Königshofen Strom und Wärme erzeugt. Gleichzeitig erhält der Betrieb dann noch schnell verfügbaren Wirtschaftsdünger für das Getreide. „Den Effekt sieht man jetzt im Frühjahr“, sagt der Betriebsleiter und zeigt seine gut entwickelten Dinkel- und Weizenbestände.

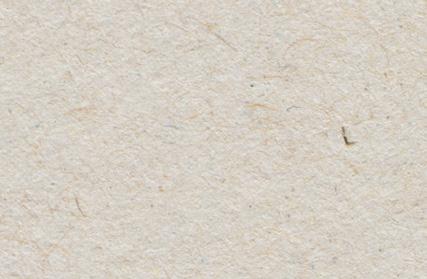
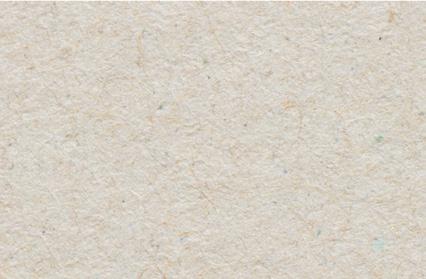
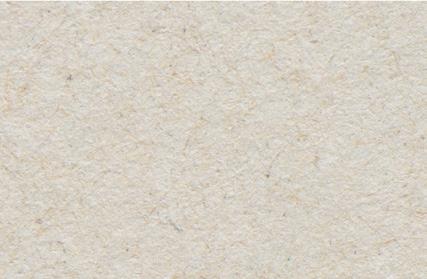
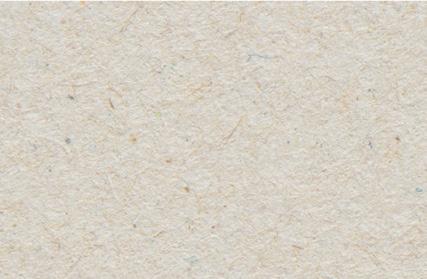
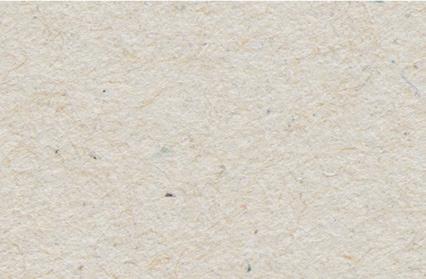
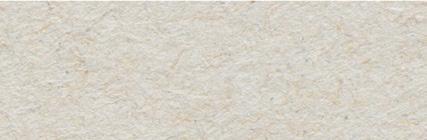

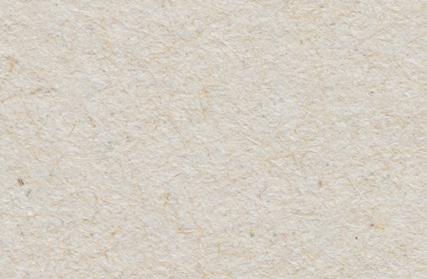


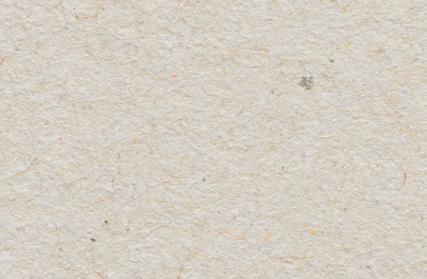
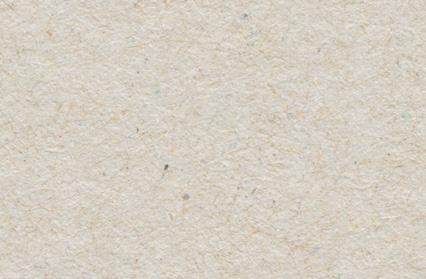
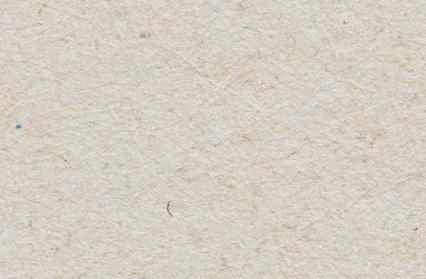
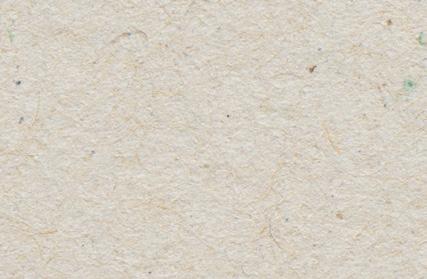
Treffpunkt der ökologischen Landwirtschaft
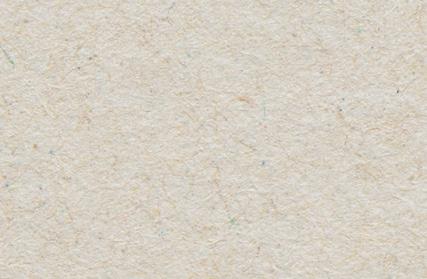

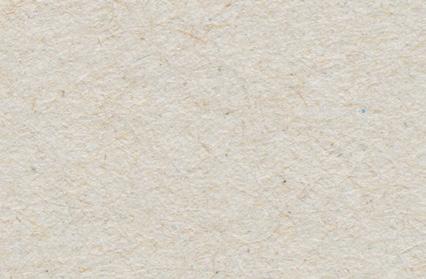
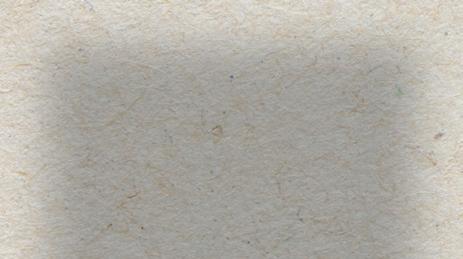
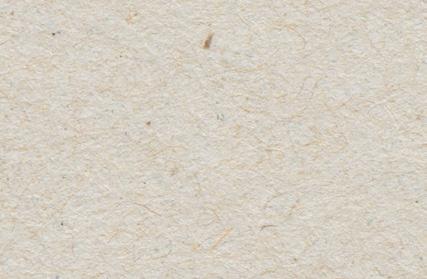






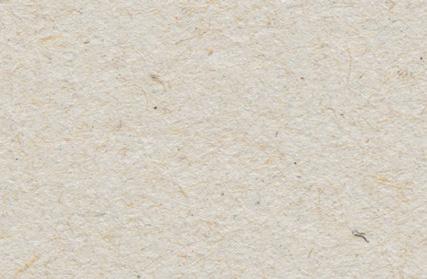
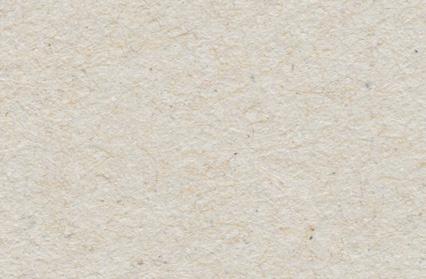






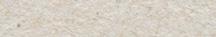
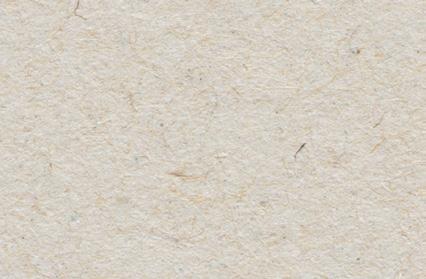


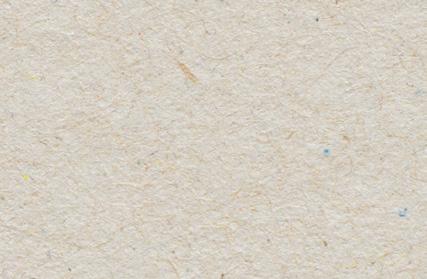




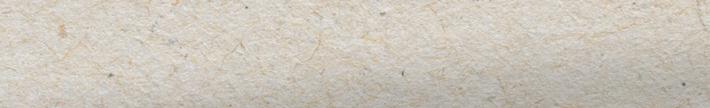

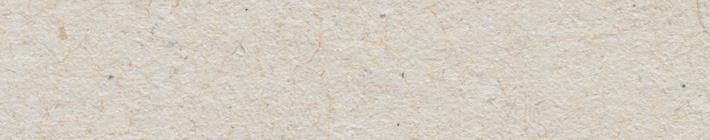



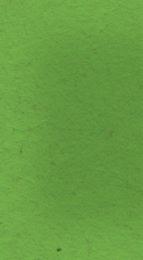

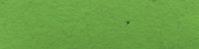




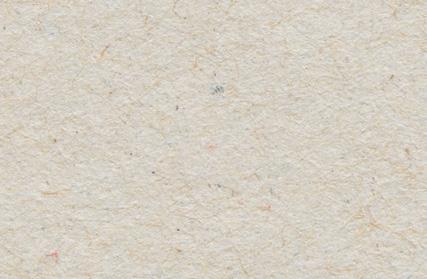



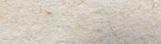
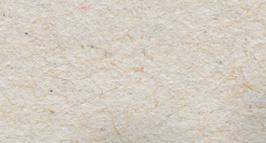




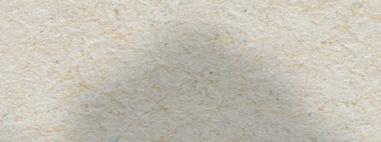

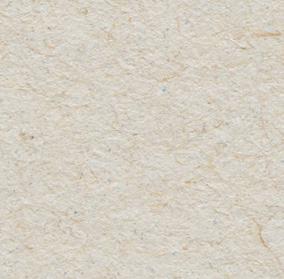
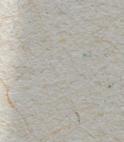













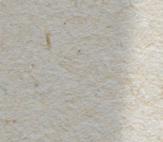
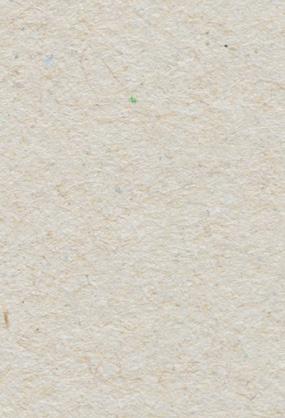
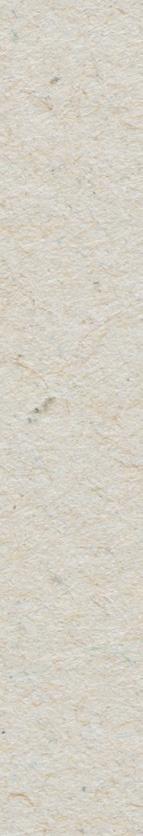


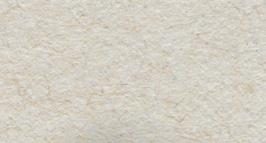
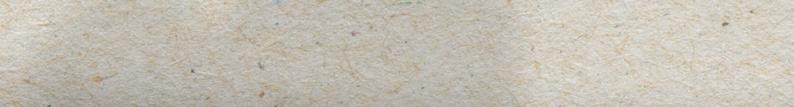






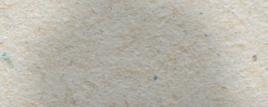
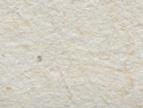

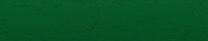

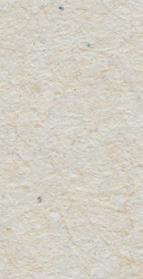













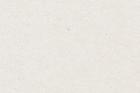
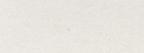
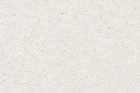

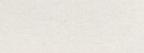
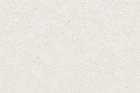
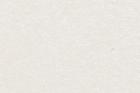
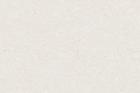
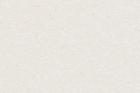



STICKSTOFF
über den Winter retten
Eine Gretchenfrage des Öko-Landbaus ist, wie man Stickstoff über den Winter im System hält und er somit der folgenden Sommerung zur Verfügung steht. Auch ein Beitrag aus der jüngsten Wissenschaftstagung beschäftigt sich damit.
Stickstoff ist im Öko-Landbau besonders wertvoll und wichtig – nicht von ungefähr wird er oft als begrenzender Faktor für Bestandsentwicklung und Erträge unter Öko-Bedingungen beschrieben. Diese Bedeutung dürfte in der Zukunft eher noch zunehmen, denn der immer stär-
ker voranschreitende Klimawandel bringt tendenziell mildere und niederschlagsreichere Winter mit sich. Damit kommt der Frage, wieviel Stickstoff über den Winter verloren geht oder eben gerettet werden kann, ein immer größeres Gewicht zu. Im Fokus steht dabei, dass der Öko-Be-
trieb sich keine N-Verluste leisten kann und darf, um die Weichen für ansprechende Bestände und Erträge zu stellen. Dass das auch im Sinne des Grundwasserschutzes ist, ist ein höchst willkommener Nebeneffekt. Bei der Aufgabe, Stickstoff (N) möglichst gut über den Winter
Fotos: Agrarfoto

AUTOR
Walter Zwingel
Beratung für Naturland w.zwingel@ naturland-beratung.de
im System zu halten, spielen Zwischenfrüchte eine wichtige Rolle.
Rolle der Zwischenfrüchte
Bei früher Aussaat können sie hohe N-Mengen aufnehmen und vor der Verlagerung in tiefere Bodenschichten bewahren. Insbesondere Mischungen aus abfrierenden und winterharten Arten können den N-Transfer in die Folgekultur positiv beeinflussen. Mit welchen Bearbeitungsverfahren und -zeitpunkten eine zielgerichtete Mineralisierung für die Nachfrucht am besten gelingen kann – damit befasst sich die Professur Agrarökologie & Organischer Landbau im Leitbetriebeprojekt NRW seit vielen Jahren. Das Ergebnis eines aktuellen Versuchs zu einem neu entwickelten Häufelgerät und einem neuen Dammumbruchverfahren ist zwar nur ein kleiner Mosaikstein - er fügt sich aber gut ins Gesamtbild.
Zwischenfrucht wann umbrechen?
Folgende Zeilen sind dem entsprechenden Bericht aus der Wissenschaftstagung 2024 entnommen: „Wurden die Zwischenfrüchte bereits Ende November mit der Scheibenegge umgebrochen, so führte dies im Vergleich zu der bis März unbearbeiteten Variante zu signifikant erhöhten
Nmin-Werten in der oberen Bodenschicht (6.12.) und zu gesteigerter Verlagerung in tiefere Bodenschichten über Winter (24.1. und 1.3.). Anders als angenommen, wurde dies auch im Damm der Häuflervariante beobachtet. Die Furche verhielt sich dagegen analog zur unbearbeiteten Variante. Eine Bearbeitung mit der Scheibenegge Mitte Januar bei Befahrbarkeit durch Bodenfrost konnte diesen negativen Effekt vermeiden und gleichzeitig die N-Verfügbarkeit zu Vegetationsbeginn (1. & 14.3.) signifikant steigern. Dieser Effekt wurde, wie vermutet, auch im Damm der Variante Häufler festgestellt.
„Der Öko-Betrieb kann und darf sich keine N-Verluste leisten.“
Auch die anderen Leitbetriebeversuche bestätigten die … Ergebnisse, dass ein früher Umbruchzeitpunkt von Zwischenfrüchten die Gefahr von Nitratverlagerung erhöhen und ein zu später sich negativ auf die zeitgerechte Mineralisierung für die Folgefrucht auswirken kann.“
Zielkonflikte in der Praxis
Die Wissenschaft steht also vor der gleichen Herausforderung wie die Praxis: der Zielkonflikt aus „Nitratverlagerung minimieren“ und „Mineralisierung für die Folgefrucht optimieren“ ist nicht ohne weiteres aufzulösen – es gibt kein einfaches „richtig“ oder „falsch“. Besonders wichtig ist deshalb, die Voraussetzungen des Standorts und die durch die Fruchtfolge gesetzten Rahmenbedingungen in die Entscheidung einzubeziehen.
Organic:
MEHR
BODENLEBEN

VERSTÄRKTER HUMUSAUFBAU
BESSERE NÄHRSTOFFVERFÜGBARKEIT
HOCHWERTIGERE ERTRÄGE
Artenreiche TerraLife ® Organic Zwischenfruchtmischungen in 100 % Ökoqualität bieten für jede Fruchtfolge eine passende Lösung. Ihre DSV Beratung vor Ort ist gerne für Sie da: 0800 111 2960 kostenfreie Servicenummer
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-039

BIO-ACKERBAU OHNE
Tierhaltung
Bio-Ackerbau ohne eigenen Wirtschaftsdünger erfolgreich zu führen, ist eine Herausforderung. Der Betrieb Müller-Oelbke zeigt aber seit vielen Jahren, dass mit den richtigen Lösungsansätzen gute Erträge erzielt werden können.
In Etzenborn, im Göttinger Hügelland, wirtschaftet Christoph Müller-Oelbke bereits seit mehr als dreißig Jahren ökologisch. Inzwischen ist auch Sohn Johannes nach dem Studium der Agrarwirtschaft in Kiel in den Betrieb eingestiegen. Als GbR führen die beiden seither den Bio-Betrieb mit ca. 380 ha Ackerflächen mit 35 bis 75 Bodenpunkten - übrigens nahezu als reinen Pachtbetrieb. Neben Getreide werden Kartoffeln, Feldgemüsekulturen und Kleegras angebaut. Mit 650 mm Regen fällt mehr Niederschlag als in manch anderen Regionen, aber die Niederschlagsverteilung ist nicht gut, es gibt eine ausgeprägte Vorsommertrockenheit. Für ihre intensiven Kulturen können die beiden Bio-Bauern nicht auf eigenen Wirtschaftsdünger zurückgreifen. Dennoch überzeugen die Bestände, denn am Betrieb Müller-Oelbke hat man sich über die Jahre ein ausgefeiltes Konzept zurechtgelegt. Wir waren vor Ort.
Fruchtfolgeprinzipien einhalten
Auf den etwas besseren Flächen werden unter anderem Gemüsekulturen und Kartoffeln angebaut. Dabei werden Fruchtfolgegrundsätze eingehalten: So werden mindestens fünf Jahre Abstand zwischen den Gemüsearten und Kartoffelkulturen eingehalten. Außerdem werden in fünf Jahren höchstens drei Sonderkulturen angebaut. In den Jahren dazwischen säen Christoph und Johannes MüllerOelbke Getreide, meist Backweizen oder Dinkel. „Im Vergleich zu konventionellen Nachbarn sind die Erträge auf den Ökoflächen um ca. 30 % geringer“, gibt Christoph Müller-Oelbke Einblick in die Ertragssituation. Kleegras werde auf den nicht gemüseund kartoffelfähigen Standorten angebaut. Einzig zur Distelsanierung komme Kleegras auch mal auf kartoffelfähige Böden, so der Landwirt.
Auf den schwächeren Standorten wird auf Kartoffeln und Gemüse verzichtet, sodass sich folgende Fruchtfolge ergibt:
1. Kleegras und/oder Luzerne (ein- oder zweijährig je nach Standort)
2. Weizen
3. Gemenge aus Winter-Erbse und Triticale, an manchen Standorten Roggen
4. Braugerste
Futter-Mist-Kooperationen sind klassische Lösungen für viehlose Ackerbaubetriebe.

AUTORIN
Annette Alpers
Beratung für Naturland a.alpers@ naturland-beratung.de
Grundsätzlich versuchen Christoph und Johannes Müller-Oelbke, in der Fruchtfolge Sommerungen und Winterungen abzuwechseln. „Wenn das mal nicht möglich ist, dann helfen wir uns zumindest mit intensivem Zwischenfruchtanbau“, sagt der Vater. Hier kommen Mischungen aus Senf, Ölrettich, Phacelia und Ramtillkraut oder andere vielfältige Mischungen zur Anwendung.
Futter-Mist-Kooperationen
Alle Kulturen sollen ausreichend mit Nährstoffen versorgt sein. Christoph Müller-Oelbke: „Als erstes muss der pH-Wert stimmen. Er liegt hier zwischen 6,5 und 7.“ Dann ist bekanntlich der Nährstoffinput bei Verbandsbetrieben begrenzt und ein Fremdzukauf an Nährstoffen von 40 kg N/ha bei landwirtschaftlichen Kulturen und bei Sonderkulturen von 110 kg N/ha einzuhalten. Das Mittel der Wahl: FutterMist-Kooperationen. Klee- oder Luzernegras wird an einen Bio-Rinderhalter abgegeben, der Gülle und Mist zurückliefert. Eine ähnliche Zusammenarbeit hat Müller-Oelbke mit einem Bio-Hühnerhalter, der das Gemenge aus Erbsen und Triticale be-

Fotos:
Annette Alpers; Agrarfoto

Für die Vermarktung ist Sohn Johannes Müller-Oelbke zuständig. Die klaren Verantwortlichkeiten sind für Vater Christoph und Johannes Müller-Oelbke sehr wichtig.
kommt und Hühnertrockenkot (HTK) zurückliefert. Zusätzlich wird Grüngutkompost eingesetzt (vor allem in den Hackkultur-Fruchtfolgen), EU-Bio-HTK über Dungbörsen zugekauft sowie Gärrest über eine benachbarte Ökogasanlage. Alle Nährstoffe werden auf ihre Inhaltstoffe analysiert. Im Durchschnitt hat der HTK 16 kg N/t (und nicht 20 kg wie nach Standardwerten). Neben der exakten Analyse wird der Dünger sehr gezielt nach einer Nmin-Probe des Bodens ausgebracht und auf die Ansprüche der jeweiligen Kultur ausgerichtet. Müller-Oelbke: „Die Nmin-Probe wird erst dann gezogen, wenn der Boden aktiv wird, also ungefähr Ende März.“
Mikronährstoffe
Neben den Grundnährstoffen, Stickstoff, Phosphor, Kali und Magnesium sind für den Betrieb auch Mikronährstoffe wichtig, vor allem im Gemüsebau. Diese sollen die Pflanzen stabilisieren, sodass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so gering wie nötig gehalten werden kann. Um herauszufinden, wie gut die Pflanzen ernährt sind, wurden über mehrere Jahre – auch mit Hilfe der Beratung für Naturland (Holger Buck) – Pflanzenanalysen durchgeführt, um daraufhin bei Bedarf Bor, Schwefel, Zink oder Molybdän ggf. über eine Blattapplikation auszubringen. Gemeinsam mit den Mikronährstoffen wird
oft Gesteinsmehl wie zum Beispiel Klinospray ausgebracht. Gesteinsmehl enthält Silizium und kann die Blattgesundheit stabilisieren. Klinospray hat gegenüber Biolith Ultrafein und Diabas den Vorteil, dass es sich gut in Wasser löst und mit der Spritze ausgebracht werden kann, ohne die Düsen zu verstopfen. Christoph Müller-Oelbke ist von der positiven Wirkung überzeugt: „Im Vorjahr haben wir in Kartoffeln bei jeder Kupferbehandlung ein bis zwei Kilo Klinospray mit 200 Litern Wasser je Hektar kombiniert ausgebracht – und die Blätter blieben schön gesund.“
Zielgerichteter Pflanzenschutz
Um besonders sensible Kulturen wie Kartoffeln und Feldgemüse gesund zu erhalten und so wenig wie möglich und so viel wie nötig an Pflanzenschutzmittel wie Kupfer auszubringen, ist der Betrieb Müller-Oelbke eine enge Zusammenarbeit mit dem Dienstleister amagrar.com-Argus Monitoring eingegangen. Der Dienstleister gibt Anwendungsempfehlungen, die auf einer modellgestützten Infektionsvorhersage von Blattkrankheiten basieren. Der Betrieb selbst muss dafür mit wenig Aufwand Flächendaten und kulturspezifische Entwicklungsstadien am PC einpflegen und auf dem Laufenden halten. Mit diesem Prognosemodell hat der Betrieb
schon viele Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht und so den termin- und mengenoptimierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sichergestellt.
Verantwortlich für das Thema Düngen und Spritzen ist Christoph Müller: „Wichtig ist eine moderne Pflanzenschutzspritze. Wir setzen eine Hardi-Spritze mit luftunterstützendem Twin Force-Gestänge zum Spritzen der Blattunterseite ein – abdriftmindernd mit sechs Bar Düsen.“
Wassersparend wirtschaften
Je nach geplanter Kultur und Wetter wird so oft wie möglich auf den Pflug verzichtet, zum Beispiel nach Möhren zu Kartoffeln oder nach Kohl zu Getreide.
Eingesetzt wird er noch beim Kleegrasumbruch Ende Oktober bis Mitte November oder auch nach Industriekohl, bei dem die Strünke über den Winter stehen bleiben und der Pflug im Frühjahr vor Hafer eingesetzt wird. Müller-Oelbke: „Im Durchschnitt wird vielleicht einmal in fünf Jahren gepflügt.“ Ansonsten wird der Flachgrubber (Koralin von Lemken) eingesetzt. Flaches Abschneiden des Bodens trägt zur Schonung des Wasserhaushalts bei und wirkt außerdem gut gegen Disteln und Ampfer. Christoph Müller-Oelbke: „Da können auch mal drei bis vier Durchgänge im Herbst nötig sein.“
Die etwas besseren Flächen in Etzenborn am Hof sind beregnungsfähig. Mit drei Tiefbrunnen, die sechs Kilometer Leitungsnetz versorgen, können die Gemüsekulturen und Kartoffeln über Düsenwagen und Kanone beregnet werden.
Gute Vermarktung aufbauen
Über die vielen Jahre im Ökologischen Landbau hat sich der Betrieb Müller-Oelbke ein Netzwerk an Abnehmern aufgebaut, die durch gute Ansprache gepflegt werden. Wegen der eigenen Lagerung aller Ernteerzeugnisse kann Johannes Müller-Oelbke seine Abnehmer das ganze Jahr über bedienen. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Svenja für die Vermarktung zuständig. Um eine ganzjährige Belieferung leisten zu können, ist 2021 am neuen Standort eine Gemüse-Aufbereitungshalle mit Bürogebäuden entstanden. Hier gibt es auch ein 2.500 t umfassendes Getreide-Flachlager mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeit. Ebenso ist Platz für ein Dunglager, um auch außerhalb der Saison Nährstoffe (z.B. HTK über die Dungbörse oder von benachbarten Rinderhaltern, die wenig Mistlagermöglichkeit haben) aufnehmen zu können.
Kurz & knapp
Der Betrieb Müller-Oelbke zeigt eindrucksvoll, dass intensiver Bio-Ackerbau auch ohne eigenen Wirtschaftsdünger möglich ist. Mit Kooperationen, Zukaufsdünger und vielen weiteren Lösungsansätzen haben Johannes und Christoph Müller-Oelbke ein gutes Konzept gefunden. Gefragt nach dem Erfolgsrezept kommen zwei Antworten: Bei der Suche nach Lösungen immer offen und flexibel sein und klare Verantwortlichkeiten vereinbaren.
Günstige Neugeräte in bewährter Qualität
POM Leichtgrubber Meteor 3 - 7,5 m
5,0 m mit Rohr- o. Stabwalze €
Weitere Angebote: Ballenwagen, Kurzscheibeneggen ... finden Sie auf unserer Homepage! + Mwst. und Fracht

ANZEIGEN
Wir sind auch Öko!


Zertifziert: DE-037-ÖkoKontrollstelle

Zum nächstmöglichen
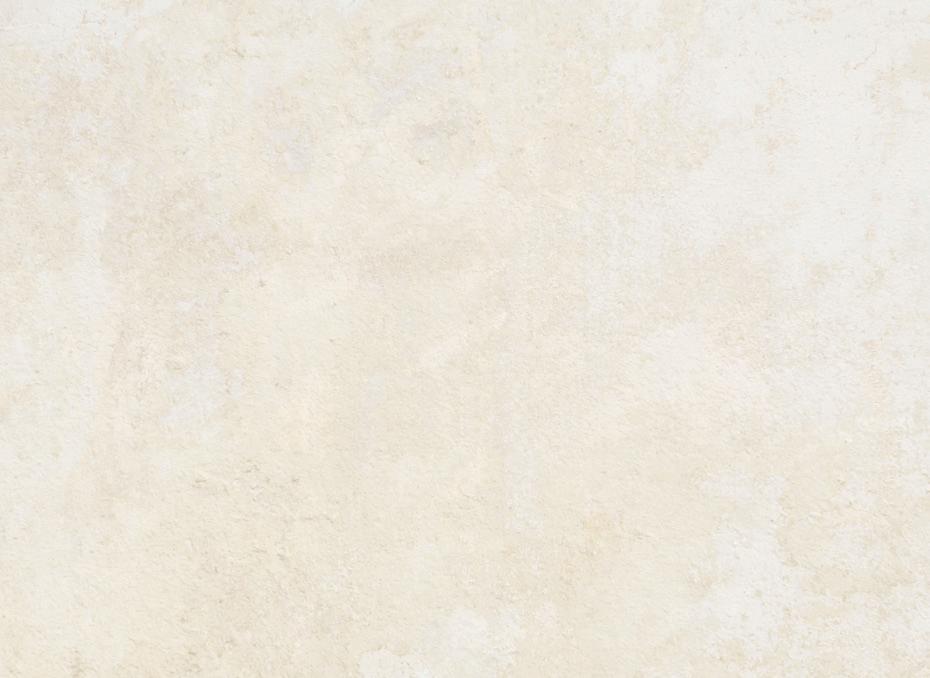
Zeitpunkt suchen wir einen Vertriebsmitarbeiter ÖKO
Mehr Infos unter: rwg-erdinger-land.de/jobs
Wir möchten Sie herzlich auf unseren 24. Öko-Feldtag am 10. Juli um 14 und 17 Uhr bei Heindl in Oed 1, 83527 Kirchdorf einladen!
Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land
Betrieb St. Wolfgang Raiffeisenstraße 3, 84427 St. Wolfgang st.wolfgang@rwg-erdinger-land.de · Tel. 0 80 85 - 15 32 www.rwg-erdinger-land.de www.bio-kleegras.de

WELCHE URSACHEN HAT
Kleemüdigkeit?
Dem Rätsel der Kleemüdigkeit auf die Spur kommen – das hatte sich das von der Beratung für Naturland koordinierte Forschungsprojekt TriSick vorgenommen. Nach dreieinhalb Jahren Forschung sind wir der Lösung ein Stück nähergekommen.

AUTORIN
Irene Jacob
Beratung für Naturland i.jacob@ naturland-beratung.de
CO-AUTOREN
Timo Seibert
Beratung für Naturland
Prof. Dr. Christel Baum
Annika Kühnl
Dr. Jürgen Müller
Kristin Steinfurth
Prof. Dr. Christine Struck
Universität Rostock
Leguminosenmüdigkeit ist ein Begriff, hinter dem sich ein komplexer Fall verbirgt. Abnehmende Wüchsigkeit und Erträge sowie schwache und mitunter lückige Bestände durch kranke oder ausgefallene Pflanzen können sich dann als Problem zeigen. Das Phänomen tritt an Körnerleguminosen auf, dabei v.a. an Körnererbse, aber auch Futterleguminosen wie Rotklee und Luzerne können betroffen sein. Dann spricht man von der sogenannten Kleemüdigkeit.
Beim Begriff der Kleemüdigkeit denken Viele zuerst an Pilzkrankheiten. Doch so einfach ist es nicht: als Ursachen kommen neben vielerlei Schaderregern auch Ungleichgewichte in der Nährstoffversorgung, nachteilige bodenphysikalische und -chemische Eigenschaften sowie biotische Faktoren wie die Besiedelung mit Mykorrhiza und Rhizobien in Betracht.
Im Projekt TriSick, das von der Eiweißpflanzenstrategie des BMEL gefördert wurde, erforschte die Beratung für Naturland gemeinsam mit der Universität Rostock von 2021 bis 2024, welche Ursachen Kleemüdigkeit bei Rotklee und Luzerne auslösen. Der Ansatz des Projektes bestand darin, Praxisflä-
chen zu untersuchen, auf denen Symptome von Kleemüdigkeit auftraten. Deutschlandweit wurden 76 Probenpaare, jeweils bestehend aus der Probe einer wüchsigen Referenz- und einer kleemüden Kontrastprobe, gesammelt und in verschiedenen Laboren analysiert. Es stammten 42 Probenpaare von Luzerneschlägen, 32 von Rotklee und jeweils eines von Inkarnat- bzw. Schwedenklee. Es wurden sowohl Reinbestände als auch Gemenge mit Gräsern und mehreren Leguminosenarten beprobt. Erreger von Pilzkrankheiten wurden auf jedem Schlag nachgewiesen und haben eine gewisse Bedeutung als Auslöser der Kleemüdigkeit. Sie traten nicht nur in den kleemüden, sondern auch in den wüchsigen Bereichen auf – dort allerdings oftmals mit geringerer Ausprägung. Generell schwankte die Befallsstärke von 5 % (kaum Befall) bis 100 % (sehr starker Krankheitsbefall) erheblich.
Interessanterweise traten Kleekrebs und Anthracnose tendenziell eher selten auf. Daneben wurden Blattbrand an Luzerne sowie Braunfleckenkrankheit und Alternaria bei Klee und Luzerne häufiger nachgewiesen. Diese Blattfleckenerreger treten jedoch eher als Sekundärinfektionen in Erscheinung, das
Die für die Fuß- und Brennfleckenkrankheit der Körnererbse verantwortlichen Erreger wurden sehr oft bei Rotklee (links und mittig) und Luzerne (rechts) gefunden. Diese Erkenntnis hilft bei der vorbeugenden Planung der Fruchtfolgen mit Körnerleguminosen.




Probenarten und Analysenziele der Beprobungen.
Probe Analysenziel
Fünf Ganzpflanzen inkl. Wurzel und anhaftendem Boden
Mind. 300 g oberirdische Pflanzenmasse (FM)
Mind. 500 g Wurzel und Boden (bis 30 cm Tiefe)
Mind. 300 g Boden (bis 10 cm Tiefe)
pilzliche Schaderreger, Mikrobiomanalyse, Mykorrhiza & Rhizobien, Wurzelchemie, massenspektrometrische Analyse
Nährstoffgehalte Pflanze, NIRSSpektren
Nematoden
Nährstoffgehalte Boden, pH, Bodenart
Falleninhalt Barberfalle Schadinsekten
Wüchsiger (oben) und kleemüder Bereich eines Standortes (unten). Neben Fruchtfolgekrankheiten können zum Beispiel Nematoden, Nährstoffmangel (z.B. Schwefel) oder auch ein zu niedriger pH-Wert Ursachen sein.

heißt, sie befallen diejenigen Pflanzen, die durch abiotischen Stress (beispielsweise Nährstoff- oder Wassermangel) geschwächt sind.
Die häufigsten Funde von Erregern von Pilzkrankheiten sind allerdings mehr als ernst zu nehmen:
Die für die Fuß- und Brennfleckenkrankheit der Körnererbse verantwortlichen Erreger Ascochyta medicaginicola und Didymella pinodella wurden am häufigsten aus den Proben isoliert. Dass diese Arten auch Futterleguminosen befallen können, war zwar bekannt, jedoch gab es bisher keine Erkenntnisse darüber, wie häufig sie auftreten. Ein sicheres Erkennen der Krankheiten auch in Beständen mit Futterleguminosen ist notwendig, um gegebenenfalls mit einer Anpassung der Fruchtfolge reagieren zu können.
Nematoden als weitere Ursache
Als weitere mögliche Ursache der Kleemüdigkeit sind pflanzenschädigende Nematoden künftig stärker zu berücksichtigen: Bisher standen sie als Schaderreger sowohl in Körner- als auch Futterleguminosen eher weniger im Fokus. Dabei gibt es eine Reihe von Arten, die spezifisch an Leguminosen vorkommen und damit vor allem in den leguminosenreichen Fruchtfolgen des Öko-Landbaus zu Problemen führen könnten. Auch das Stängelälchen mit einem weiten Wirtskreis wurde auf einigen Standorten gefunden. Schadinsekten scheinen bei der Kleemüdigkeit hingegen keine bedeutende Rolle zu spielen.
Nährstoffe und pH-Wert als Ursache
Bei den untersuchten Proben gab es keine verallgemeinerbaren Trends, wonach ein bestimmter Nährstoffmangel als Ursache der Kleemüdigkeit gelten könnte. Bekannt ist die Bedürftigkeit von (Futter-)
Fotos:
Annika Kühnl, Timo
Seibert, Roman
Goldberger

Niedrige pH-Werte und Schwefelmangel können Ursachen für Kleemüdigkeit sein. Schwefelhaltiger kohlensaurer Kalk vor den Futterleguminosen kann Abhilfe schaffen.
Leguminosen für Schwefel: Hier zeigten sich tatsächlich signifikant geringere Gehalte an pflanzenverfügbarem Schwefel auf den kleemüden Flächen im Vergleich zu wüchsigen Flächen – Schwefelmangel kann also eine mögliche Ursache der Kleemüdigkeit sein. Auf Standorten mit Verdacht auf entsprechenden Mangel zeigten sich Tendenzen zu besonders geringen Bor- und Kupfer-Gehalten auf den wuchsschwachen Boden-Bereichen, sodass gravierender Mangel an Bor oder Kupfer ebenfalls eine Ursache von Wuchsunterschieden sein kann. Bei Luzerne zeigten sich zudem Tendenzen, dass wuchsschwache Bereiche eher dort zu finden waren, wo besonders niedrige pH-Werte vorlagen. Die wuchsschwachen Bereiche zeigten außerdem tendenziell weniger Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel im Boden: dies ist ein Hinweis auf einen geringeren Gehalt an organischer Substanz. Auch gab es an einzelnen Standorten sowohl Hinweise auf höhere Bodenverdichtung und geringere Sorptionskapazitäten der Böden (Sandlinsen) in den kleemüden Bereichen.
Knöllchenbakterien und Mykorrhiza nicht verantwortlich
Die Knöllchenbildung der wuchsschwachen Bereiche war weder bei Rotklee noch bei Luzerne signifikant reduziert. Fehlende oder reduzierte Bildung von Wurzelknöllchen ist also kein Faktor, der Leguminosenmüdigkeit hervorruft bzw. anzeigt. Auch eine geringere Besiedelung der Pflanzen mit Mykorrhiza-Pilzen ist keine Ursache von Kleemüdigkeit: Zwar wurde im Mittel über alle Standorte und beide Kulturarten hinweg eine signifikant geringere Mykorrhizierungsrate der Pflanzen aus den wuchsschwachen, kleemüden Bereichen festgestellt. Aber es ist davon auszugehen, dass infolge der Wuchsschwäche der Pflanzen den Symbionten weniger
Assimilate zur Verfügung standen, so dass sich wiederum weniger Mykorrhiza an den Feinwurzeln ansiedelten.
Vorbeugende Maßnahmen
In jedem Fall sinnvoll bleiben die bekannten vorbeugenden Maßnahmen, die wüchsige Klee- und Luzernebestände sichern: Es ist auf den optimalen pH-Wert und eine ausgewogene Nährstoffversorgung zu achten. Über eine organische Düngung werden nicht nur Mikronährstoffe zugeführt, sondern auch der Boden mit organischer Substanz angereichert. Auch ausreichende Anbaupausen und sinnvolle Fruchtfolgegestaltung sind essenziell: Bei Auftreten von Kleemüdigkeit ist für den einzelnen Betrieb oder auch einzelne Schläge eine individuelle Abklärung der möglichen Ursachen notwendig. Ein Werkzeug für Praxis und Beratung dazu ist die Differenzialdiagnose. Wie sie angewendet werden kann, lesen Sie auf Seite 38.
Kurz & knapp
Ziel des Projektes TriSick war es, die Ursachen zu bestimmen, die Kleemüdigkeit bei Rotklee und Luzerne auslösen. Wie zu erwarten, gibt es nicht die eine Ursache, die das Auftreten von Kleemüdigkeit hervorruft. Auffällig war aber das häufige Auftreten der von der Körnererbse bekannten Fuß- und Brennfleckenkrankheiten in den Futterleguminosen. Darauf sollte in der Fruchtfolgegestaltung Rücksicht genommen werden. Zudem konnten u.a. Nematoden, Ungleichgewichte in der Nährstoffversorgung und pH-Wert als Ursachen für Kleemüdigkeit definiert werden.
URSACHEN EINGRENZEN
Mit der Differenzialdiagnose können Sie selbst die Ursachen für Kleemüdigkeit eingrenzen.
Die Differenzialdiagnose gibt Landwirtinnen und Landwirten die Möglichkeit, bei Verdacht auf Kleemüdigkeit ihre Flächen selbst zu untersuchen. Dabei wird Rotklee oder Luzerne im als „kleemüde“ vermuteten Boden angebaut, dieser wird unterschiedlich behandelt.
Varianten:
V 1) Unbehandelte Kontrolle
(V3) vermengt. Die Hälfte des Bodens bleibt vorerst unbehandelt (V1 und V3). Dann werden je vier entsprechend den Varianten be-
Die Töpfe sollten vor zu starken Witterungseinflüssen geschützt stehen. Von Frühjahr bis Herbst kann der Versuch draußen statt-
„Die Differenzialdiagnose gibt Landwirtinnen und Landwirten die Möglichkeit, ihre Flächen selbst zu untersuchen.“
schriftete Pflanztöpfe mit der jeweiligen Erde befüllt (insgesamt 16 Töpfe). Anschließend sollte eine
V 2) Sterilisiert: Dazu einen Teil des Bodens in Aluschalen füllen und im Backofen bei 70 °C für 24 Stunden sterilisieren, danach 12 Stunden abkühlen lassen.
V 3) Wöchentlich gedüngt
V 4) Mit Aktivkohle vermengt
Von der als kleemüde vermuteten Fläche werden ca. 10 Liter Boden genommen. Diese werden zerkleinert, gesiebt und in vier gleiche Teile aufgeteilt. Je ein Viertel des Bodens wird im Backofen sterilisiert (V2) oder mit Aktivkohle
gleichmäßige Bodenfeuchte in allen Töpfen hergestellt werden.
Dann werden jeweils fünf Samen ausgesät oder vorgekeimte Samen vorsichtig mit einer Pinzette in die Töpfe pikiert.

Differenzialdiagnose unter nicht kontrollierten Bedingungen 8 Wochen nach der Anlage mit A) Rotklee und B) Luzerne; Varianten von links nach rechts: Kontrolle, sterilisiert, gedüngt, Aktivkohle.
finden. Findet der Versuch drinnen statt, ist ein heller Ort mit einer Temperatur zwischen 16 und 20 °C optimal. Alle Varianten sollten gleichmäßig feucht gehalten werden, wobei ein Viertel der Töpfe wöchentlich mit handelsüblichem Mehrnährstoff-Dünger gedüngt wird (V3). Zeigt die sterilisierte Variante das beste Wachstum, deutet das darauf hin, dass bodenbürtige Schaderreger wie Pilze oder Nematoden für die Kleemüdigkeit verantwortlich sein könnten. Fördert die Düngung das Wachstum, liegt ein Nährstoffmangel vor. Wenn die Pflanzen im mit Aktivkohle versetzten Boden am besten wachsen, könnten Giftstoffe eine Rolle spielen. Für den Versuch sollten etwa zwölf Wochen eingeplant werden. Um eine Entscheidung für die Anbausaison zu treffen, ist die rechtzeitige Planung und Versuchsanlage sinnvoll.

Foto: Irene Jacob
AUTORIN
Irene Jacob
Beratung für Naturland i.jacob@ naturland-beratung.de
geht’s zum Podcast
WIR BIO-BAUERN
DER PODCAST FÜR

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT


Optimal mit Stickstoff versorgen
Die Kunst im Bio-Ackerbau ist es, Bio-Kulturen zum optimalen Zeitpunkt mit Stickstoff zu versorgen. Genau darum geht’s in Folge 7. Ackerbauberater Stefan Veeh gibt im Gespräch mit Podcast-Host Celine Grau und BioBauer Roman Goldberger Tipps, wie man die Mineralisierung des Stickstoffs aus Vorfrucht und/ oder Wirtschaftsdünger zeitlich lenkt.
Win-Win durch Kooperation
Zu wenig Stickstoff in der Fruchtfolge? Neben klassischen Futter-Mist-Kooperationen können auch Naturland-Pflichtkooperationen Vorteile bieten. Diese benötigen Tierhalter, meist Mastgeflügelhalter, wenn Sie den notwendigen Eigenfutteranteil von 50 % nicht erreichen. Leah Hornung von der Beratung für Naturland erklärt, was dabei beachtet werden muss.
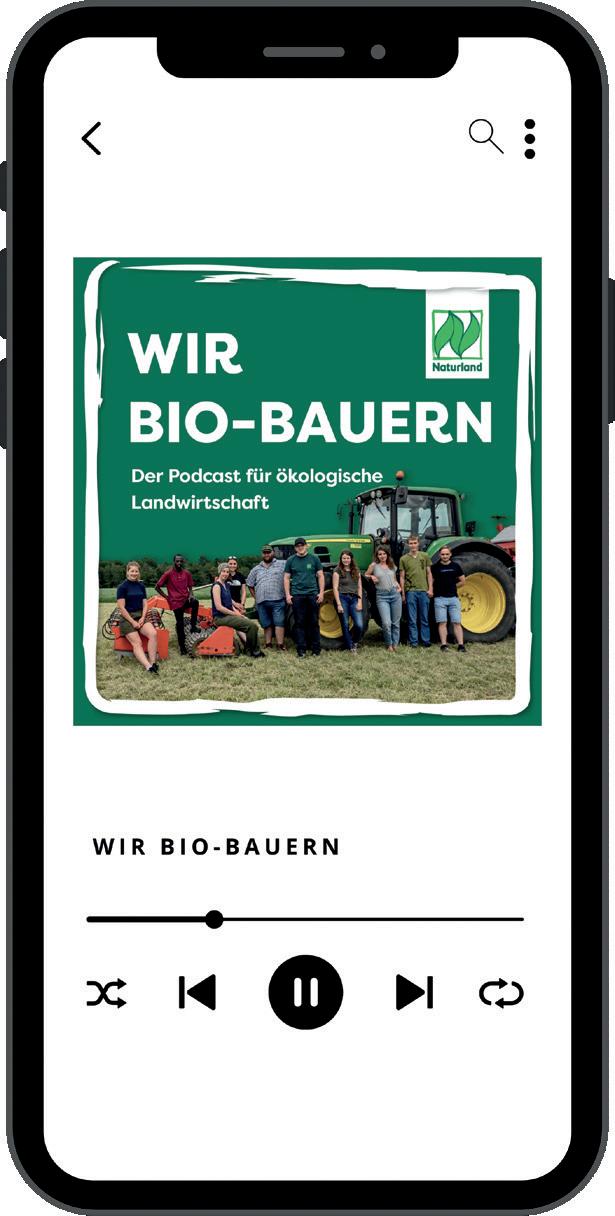

Smarte Fruchtfolgen
Über die Gestaltung der Fruchtfolge spricht Podcast-Host Celine Grau mit Ackerbauexperte Stefan Veeh von der Beratung für Naturland. „Die Fruchtfolge ist das zentrale Stellelement für alle Funktionen – egal ob Unkrautbekämpfung, Düngung oder Pflanzengesundheit“, stellt Veeh klar. Dabei geben Leguminosen und ihre Anbaupausen die Struktur die Fruchtfolge vor.
WEITERE PODCAST-FOLGEN FINDEN SIE HIER: www.naturland-beratung.de/podcast
FOLGE 7
FOLGE 10
FOLGE 11

Markt & Vermarktung
MARKTGEFLÜSTER
VON STEFAN ZEIPER
Von der Ernte auf dem Feld bis zum Produkt im Regal ist es mitunter ein weiter Weg. Diesen Weg erfolgreich zu gestalten, damit die Erzeugnisse der Naturland Betriebe ihren Absatz finden, ist Kernaufgabe der Naturland Zeichen GmbH. Stefan Zeiper leitet das Team „Verarbeitung und Handel“ und ist seit Jahren eng vertraut mit dem Bio-Markt. In der Kolumne „Marktgeflüster“ plaudert er aus dem Nähkästchen.

In der Woche nach Ostern war ich mal wieder mit Kollegen in Köln: Strategiegespräch mit Penny, der Discount-Tochter unseres langjährigen Naturland Partners REWE. Penny selbst ist erst seit Sommer 2023 Naturland Partner, hat aber einen ziemlichen Blitzstart hingelegt. Mittlerweile tragen bereits rund 120 Bio-Produkte bei Penny das Naturland Zeichen. Angeführt wir das Naturland Sortiment von Obst und Gemüse, auf Platz zwei folgen Milchprodukte. Beim Termin in Köln ging es aber nicht so sehr um das bereits Erreichte, als vielmehr um die Zukunft. Denn Penny will, neben der Bio-Eigenmarke „Naturgut“, künftig auch bei der veganen Produktlinie „Food for Future“ verstärkt auf Naturland setzen. Erste Produkte wie ein Haferdrink in Barista-Qualität sind bereits im Regal und werden dazu beitragen, Naturland auch in der jungen Zielgruppe bekannter zu machen.
Eine weitere Neuigkeit aus Köln betrifft das „REWE Wegbereiter“-Projekt zur Vermarktung von Naturland Ware aus Umstellung. Das Projekt soll ausgeweitet werden, um mehr Betriebe zur Umstellung auf Bio zu bewegen und so die langfristige Versorgung mit Bio-Rohstoffen in Naturland Qualität zu sichern.
Die Regionalisierung von Bio-Sortimenten ist ein weiteres Thema, um das es in solchen Strategiege-
sprächen immer wieder geht. Gemeinsam mit der Drogeriemarktkette dm, die in Deutschland und in Österreich jeweils ein großes Filialnetz betreibt, hatten wir uns das Ziel gesetzt, wichtige Teile des Naturland zertifizierten Sortiments von dmBio zu regionalisieren. Mit Erfolg: Wer ab Sommer bei dm in Wien oder Salzburg Bio-Mehl kauft, bekommt Weizen oder Dinkel von österreichischen Naturland Betrieben. In Berlin oder München kommt das Getreide von deutschen Naturland Betrieben. Die Herkunft ist jeweils auf der Verpackung ausgelobt, ebenso bei der Milch. Das ist ein Erfolg für die wachsende Sichtbarkeit von Naturland auch im österreichischen
Bio-Markt und ein Beispiel dafür, wie Naturland Regionalität und Internationalität erfolgreich miteinander verbindet.

Herzlichst Ihr Stefan Zeiper
Fotos: Naturland / Christoph Assmann; DM

MARKT & PREISE
Die folgenden Marktberichte entstanden in Zusammenarbeit mit der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG.
Rind- und Schweinefleisch
Tomás Sonntag tier@naturland-markt.de
Druschkulturen
Stefan Schmidt pflanze@ naturland-markt.de
Sonderkulturen
Liane Regner sonderkulturen@ naturland-markt.de
Kartoffel
Christina Schoderer pflanzgut@ naturland-markt.de

Redaktion
Roman Goldberger Beratung für Naturland r.goldberger@ naturland-beratung.de
SCHWEIN
Am Bio-Schweinemarkt hat sich die Situation in den vergangenen Monaten kaum geändert. Weiterhin übersteigt die Nachfrage der Handelsketten das zu kleine Angebot. Bestehende Verträge können zwar erfüllt, zusätzliche Anfragen aber oft nicht bedient werden. Angebotsseitig erfahren wir ein leichtes, organisches Wachstum. Neue Lieferanten
RINDFLEISCH
Der Steigflug der konventionellen Rinderpreise hat vor Ostern nochmals Fahrt aufgenommen. So waren die Bio-Vermarkter wieder am Zug, um den Preisabstand der Bio-Preise zur konventionellen Ware zu wahren. Grundsätzlich werden bei BioRindfleisch mit dem Handel zu Jahresende feste Verträge mit Preisen für das kommende Jahr vereinbart. Doch die konventionelle Preisrallye hat die Bio-Preise für Jungbullen, Ochsen und Färsen in den letzten Wochen und Monaten so schnell eingeholt und teilweise überholt, dass Bio-Vermarkter mit ihren Kun-
sind aber erst 2026 zu erwarten, auch das leichte Ferkeldefizit dürfte sich in den nächsten Monaten nicht entspannen. Die Preise sind in den letzten Monaten im Durchschnitt gestiegen, vor allem dort, wo die Preise noch unter dem Schnitt lagen. Dies ist auch nötig aufgrund der ebenfalls steigenden Futterkosten.
den erneut über Anpassungen sprechen mussten. Grund für die Entwicklung ist die knapper werdende Versorgung des konventionellen Marktes – sowohl national als auch international. Insgesamt hinkt aber auch am Bio-Rindfleischmarkt das Angebot der Nachfrage hinterher. Insofern ist keine schnelle Korrektur nach unten zu erwarten. Die höheren Rohwarenpreise sind laut AMI im April in den Läden angekommen. Es bleibt abzuwarten, wie die Konsumenten darauf reagieren.
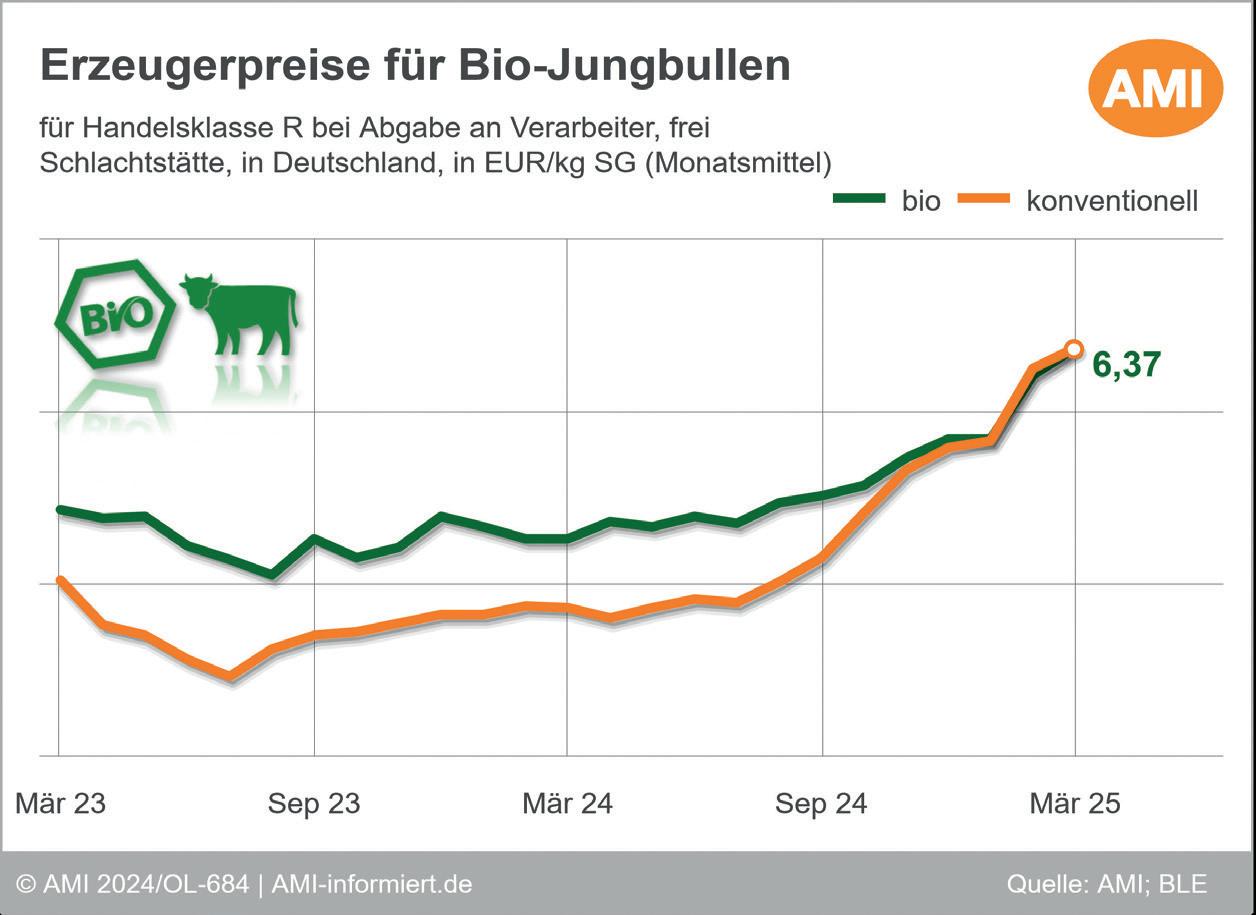
Tomás Sonntag
MARKT & PREISE
KARTOFFELN
Die Vermarktungssaison war Anfang Mai so gut wie abgeschlossen und die Lagerbestände waren weitgehend geräumt. Die gesamte Kampagne war von einer eher schwachen Nachfrage geprägt – ein Umstand, der wohl maßgeblich auf den deutlichen Preisabstand zur konventionellen Ware zurückzuführen ist. Insgesamt passte das knappe Bio-Angebot in Deutschland aber ganz gut mit dem zurückhaltenden Absatz zusammen - stabile Preise waren die Folge. Seit April finden Frühkartoffeln vorwiegend aus Ägypten ihren Platz im Handel, ab Juni/ Juli sollten sie wieder von heimischer Ware abgelöst werden.
Die Pflanzbedingungen in Deutschland waren dieses Frühjahr gut, es ist mit etwas mehr Fläche zu rechnen. Ein Grund dafür ist, dass etliche Bio-Landwirte aufgrund der Zikaden-Problematik Alternativen zur Zuckerrübe suchen. Das allein sollte aber noch nicht für Preisrückgänge sorgen, denn auch die Faktoren Qualität und Witterung spielen eine wesentliche Rolle.

Deutschland
Frankreich
Österreich
Niederlande
Dänemark
Schweden
Lettland
*Bio-Kartoffelanbau (frisch und verarbeitet) in ausgewählten Ländern Europas, 2023
MILCHMARKT
Am Bio-Milchmarkt trifft rege Nachfrage auf knappes Angebot. So stieg zum Beispiel die Einkaufsmenge von Bio-Naturjoghurt im ersten Quartal laut AMI gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 37 % an. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der Bio-Milchpreise fort, wodurch diese im Bundesdurchschnitt ein neues Allzeithoch erreichten. Die Erzeugerpreise für konventionelle Milch bewegten sich in den ersten Monaten hingegen seitwärts, was den Preisabstand der Bio-Milch auf 11,4 Cent ansteigen ließ. Seit Monaten trifft am Bio-Milchmarkt eine positive Nachfrage-Entwicklung auf meist rückläufige Rohstoffmengen. Die Gründe für das rückläufige Angebot sind vielschichtig: Zum einen sind selbst die aktuellen Erzeugerpreise immer noch nicht vollkostendeckend und somit nicht attraktiv genug, um Impulse zur Umstellung für konventionelle Landwirte zu geben. Zum anderen verschärfen Unsicherheiten bezüglich der verbindlichen Weidehaltung die knappe Angebotssituation.
Preise für ökologisch und konventionell erzeugte Kuhmilch in Deutschland (ab Hof, 4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, in Cent/kg netto)
Christina Schoderer
Top 10 des europäischen Bio-Kartoffelanbaus* (Zahlen in Hektar)
SONDERKULTUREN & SPEZIALGETREIDE
Für Sonderkulturen und einige Spezialgetreide sind die Marktaussichten durchaus positiv. So steigt zum Beispiel die Nachfrage des Handels nach Emmer stark an.
SONDERKULTUREN
Bei den Frühjahrskulturen Sonnenblume und Sojabohne war zu Redaktionsschluss noch Vieles ungewiss. Bei Sonnenblumen deuten die Vorkontrakte auf spürbar höhere Preise als zur Ernte 2024 hin, allerdings stand die Anbaufläche zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Bei Sojabohne rechnet man am Bio-Markt mit einer stabilen Preissituation in Richtung Herbst. Allerdings waren die Preise für Speisesoja zuletzt sehr gut, sodass weitere Steigerungen aus aktueller Sicht unwahrscheinlich erscheinen. Hier gilt es aufgrund der günstigeren Angebote aus dem Ausland mit Augenmaß zu agieren. Für beide Kulturen gilt aber, dass sich bis zur Ernte im Herbst noch viel tun kann und sich die Marktsituation erst in den nächsten Monaten festigen wird. Mit höheren Preisen ist bei Raps zu rechnen, allerdings noch immer auf einem zu niedrigen Niveau. Hier ist die paradoxe Situation, dass die Nachfrage nach Rapskuchen hoch ist, während das Hauptprodukt Rapsöl vom Handel weniger nachgefragt wird. Gut hingegen ist die Nachfrage des Handels nach Kichererbsen deutscher Herkunft.

SPEZIALGETREIDE

Ebenfalls steigende Nachfrage gibt es aktuell bei Goldhirse, Buchweizen, Nackthafer und ganz besonders Emmer. Wir haben hier Anfragen, besonders den Anbau von Emmer auszuweiten, um den von uns bereits belieferten Markt weiter bedienen zu können. Die Preise dafür sollten deutlich über den Dinkelpreisen liegen. Wir bieten bereits Vorverträge für die Ernte 2026 an. Buchweizen wird vor allem im Osten (grenznah zu Polen) gesucht und kann nach Gerste oder Grünroggen auch als Zweitfrucht angebaut werden. Vor allem für Buchweizen und Hirse gilt Gluten-Freiheit. Diesbezügliche Tipps für die Ernte und darüber hinaus erhalten Sie pünktlich vor der Ernte über den Newsletter der Beratung für Naturland.
NEU AB 12. JUNI WIR BIO-BAUERN
Regelmäßige Marktinformationen finden Sie ab 12. Juni auch im neuen Podcast der Beratung für Naturland. Mehr Infos unter www.naturland-beratung.de/podcast oder hinter diesem QR-Code.
geht’s zum Podcast

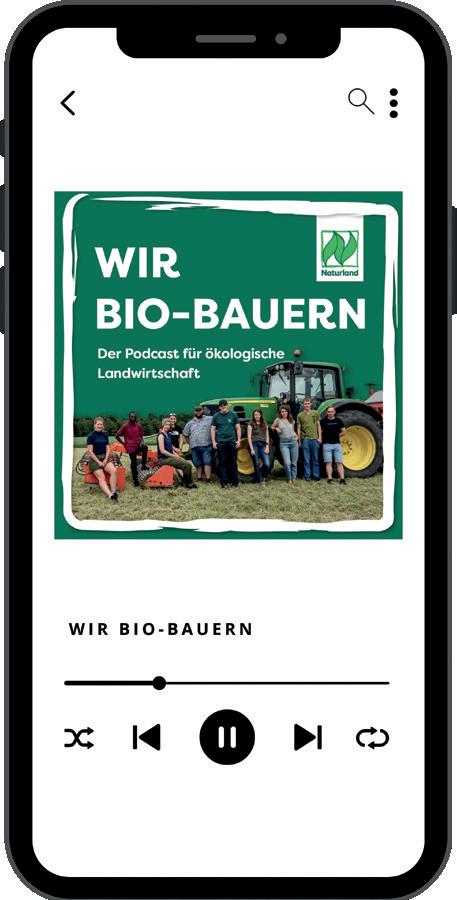
Liane Regner
DRUSCHFRÜCHTE
Kurz vor der Getreideernte sind die Aussichten positiv. Aus den bisher abgeschlossenen Kontrakten lassen sich zufriedenstellende Landwirte-Preise ableiten. Im Vergleich zum Beginn der letztjährigen Vermarktungssaison werden die Preise für Futtergetreide, Weizen und Roggen etwas höher zu liegen kommen. Hafer dürfte auf ähnlich hohem Niveau bleiben wie im Vorjahr und Dinkel scheint sich auf „vernünftigem“ Niveau zu stabilisieren.
HAFER
Spannend bleibt die Entwicklung bei Hafer. Trotz größerer Anbaufläche und zum Teil vollen Läger der Mühlen, wurde bereits ein Großteil der Kontrakte für die neue Ernte mit guten Preisen abgeschlossen. Ob sich dieses hohe Preisniveau über die neue Saison hinweg halten kann, wird man sehen.
WEIZEN UND FUTTERGETREIDE
Während sich Mühlen im Speisesegment meist für viele Monate eindecken und damit im späten Frühjahr kaum mehr Abschlüsse stattfanden, wurde Futter- und Alkoholweizen bis Ende der Vermarktungssaison nachgefragt – allerdings war auch der Futtermarkt leergefegt. Das lag zum einen an der geringen Anbaufläche und Erntemenge. Zum anderen waren die Qualitäten im Speisebereich so gut, dass wenig Speiseweizen „ins Futter ging“. An der Anbaufläche hat sich für die kommende Ernte bei Futtergetreide und Speiseweizen nichts Wesentliches verändert, denn der Preisanstieg setzte erst nach dem Herbstanbau im November ein. Aktuelle Kontrakte lassen einen ca. 10%igen Preisanstieg im Vergleich zur Vorsaison vermuten.
DINKEL
Nach der kurzzeitigen Explosion der Preise im Januar und Februar stabilisierten sich diese im Laufe des Frühjahrs wieder auf „normalem“ Niveau. Die Vorkontrakte deuten auf ansprechende LandwirtePreise mit einer „4“ am Anfang hin. Allerdings könnte die doch eklatante Ausweitung des Anbaus im Verlauf der Vermarktungssaison zu Problemen führen. Hier heißt es abwarten, wie viel wirklich geerntet wird.
ROGGEN UND BRAUGERSTE
Nochmals deutlich zurückgegangen ist die Anbaufläche von Roggen und Braugerste. Für beide Kul-
turen waren Nachfrage und Preise in der abgelaufenen Vermarktungssaison verhalten. Vor allem bei Roggen ist fraglich, ob die Nachfrage überhaupt noch gedeckt werden kann. Hier sollten die Preise daher doch wesentlich über jenen des Vorjahres zu liegen kommen.

Großhandelspreise für deutsche Verbandsware im April 2025 an Verarbeiter oder Mühlen frei Rampe (netto, Euro/t)
Gewichteter Durchschnittpreis Lieferung
Dinkel - Rohware 511 prompt/ex Ernte 2024
Dinkel - Rohware 506 Termin/Jahreskontrakt 2025
Dinkel - entspelzt 850 Termin/Jahreskontrakt 2024
Dinkel - entspelzt 832 Termin/Jahreskontrakt 2025
SchälgersteRohware 469 prompt/ex Ernte 2024
Hafer - Rohware 439 Termin/Jahreskontrakt 2025
Qualitätsweizenvorger. 520 Termin/Jahreskontrakt 2024
Futtergerste 411 prompt/ex Ernte 2024
Futterweizen 456 prompt/ex Ernte 2024
Futterweizen 396 Termin/Jahreskontrakt 2024
Erzeugerpreise liegen – je nach Vermarkter und Transportkosten – um 50 bis 70 Euro/t darunter.


Juni








Stefan Schmidt

Vermarkten über Bio Kontor
Die Getreideernte rückt näher und damit auch die Frage der Vermarktung. Unser Tipp: Bündeln Sie Ihre Bio-Druschfrüchte über die Partner der Bio Kontor. Was das ist und wie das geht, erfahren Sie hier.
WIE VERMARKTEN NATURLAND BAUERN ÜBER BIO KONTOR?
WARUM ÜBER
BIO KONTOR VERMARKTEN?
Die Bündelung des Angebots über die Partner der Bio Kontor kommt der gesamten Wertschöpfungskette zugute. Für die Abnehmer spielt die zuverlässige Lieferung durch die Bündelung eine große Rolle –gerade in einem volatilen Marktumfeld. Landwirte profitieren vorwiegend von der verbesserten Marktstellung und der gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit durch die Bündelung des Angebots. Das ermöglicht eine stabile Absatzsicherung und die Option, Partien von klein bis groß zu attraktiven Konditionen zu vermarkten. Insgesamt führen die Synergien zu mehr Effizienz, zum Beispiel in der Logistik.
Der Aufkauf der Naturland Ware wird von den drei Partnerunternehmen eigenständig und unabhängig voneinander durchgeführt, Bio Kontor tritt beim Landwirt nicht in Erscheinung. Die Ansprechpartner für die Betriebe sind die regionalen Vertriebsmitarbeiter der Gesellschafter. Die Marktgesellschaft der Naturland Bauern, BAT Agrar und Raiffeisen AgriTrading bündeln dann ihre Ware über die Bio Kontor. Die Lager- und Übernahmestellen von Bio Kontor werden ebenfalls von den drei Partnern betrieben. An den vielen Lagerstandorten wird das Komplettpaket über Ernteerfassung und Nacherfassung, Reinigung, Trocknung, Aufbereitung, Gesunderhaltung und teilweise auch Entwesung angeboten.



WAS IST BIO KONTOR?
Bio Kontor ist ein Zusammenschluss der drei AgrarhandelsUnternehmen Marktgesellschaft der Naturland Bauern, BAT Agrar und Raiffeisen AgriTrading. Gemeinsam bündeln diese drei Organisationen ihr Bio-Angebot an die Abnehmer. Damit können sie Lieferfähigkeit und Liefersicherheit erhöhen sowie größere Partien mit einheitlichen Qualitätsstandards anbieten. Das nützt Bio-Landwirten und Abnehmern gleichermaßen.

IN WELCHEN REGIONEN KANN MAN ÜBER BIO KONTOR VERMARKTEN?

WELCHE KULTUREN WERDEN VERMARKTET?
Bio Kontor vermarktet eine breite Palette an Kulturen. Dazu gehören Futtergetreide und Futterleguminosen, Speisegetreide wie Hafer, Dinkel, Weizen und Roggen sowie Ölsaaten und Soja. Bio Kontor vermarktet auch Umstellungsware, Ware anderer Verbände oder EU-Bio-Ware.
Die Lager- und Übernahmestellen von Bio Kontor sind strategisch in den wichtigen Anbauregionen Deutschlands und werden nach Bedarf weiter ausgebaut. Bio Kontor vermarktet schlagkräftig an alle bedeutenden Kunden der deutschen und europäischen Lebensmittelindustrie, an Mühlen und die Futtermittelwirtschaft. Der Einkauf erfolgt über die Partner der Bio Kontor eigenständig und unabhängig voneinander in Deutschland und Österreich. Mit zwölf zentralen Lagerstandorten sowie weiteren regionalen Lägern, bieten die Partner optimale Bedingungen auch für die Aufbereitung und Lagerung Ihrer Erzeugnisse.
TIPP
Ansprechpartner und weitere Infos zu Bio Kontor finden Sie in der Beilage dieser Ausgabe.
AUTOR Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG
Fotos: Goldberger; Naturland/Christian Nusch; shutterstock.com/Madlen

WIRD 2025 EIN
Engerling-Jahr?
Ob dieses Jahr ganze Regionen dem Maikäfer zum Opfer fallen, ist noch nicht absehbar. Umso wichtiger ist es, die Augen offen zu halten und den Befall frühzeitig festzustellen.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn sie das Wort Engerling lesen? Der eine kann sich noch grob daran erinnern, dass es sich dabei um kleine Tierchen handelt, die in Gemüsegarten oder Grünland zu finden sind. Der andere verzieht das Gesicht, da ihn die Tierchen die ein oder andere schlaflose Nacht beschert haben. Tatsächlich sind sie eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Grünlandbestände und damit auch für die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs. So waren zum Beispiel 2019 allein in Oberösterreich ca. 25.000 Hektar von Engerlingbefall betroffen. Doch wie erkennen wir nun einen kritischen Befall von Engerlingen, welche Arten gibt es, wie entwickeln sie sich und wie kann man sie bekämpfen?
Grünland gut führen
Zuerst einmal muss gesagt sein, dass ein gut geführter Grünlandbestand weniger Angriffspotenzial für Engerlinge darstellt. Dabei ist eine an die Nutzungsintensität angepasste Düngung ebenso wichtig wie die regelmäßige Nachsaat mit an Standort und Nutzungsintensität angepassten Sorten, die Erhaltungs-Kalkung und eine narbenschonende Bewirtschaftung. So werden Lücken vermieden oder rasch wieder geschlossen. Das erschwert die Eiablage der Käfer und wirkt dem Verlust an Wurzelmasse durch Fraß entgegen.
MAIKÄFER
Melolontha melolontha
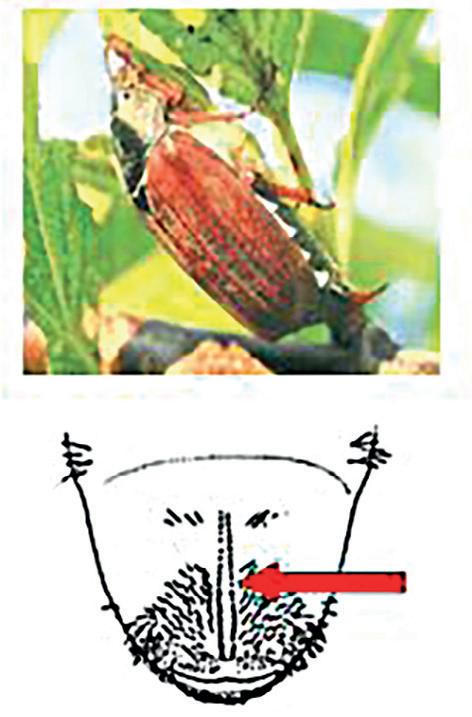
Käfer: 2-3 cm groß
Larve: bis 6 cm groß
Schadschwelle: 25-40 pro m2

AUTOR
Laurin Spensberger
Beratung für Naturland l.spensberger@ naturland-beratung.de
Entwicklung der Maikäfer-Engerlinge
Engerlinge sind die Larven von Käfern der Familie der Blatthornkäfer. Die drei bedeutendsten Vertreter in Mitteleuropa sind Feldmaikäfer, Junikäfer (auch Gerippter Brachkäfer genannt) und Gartenlaubkäfer. Dabei ist die Larve des Maikäfers der bedeutendste Schädling. Er hat – je nach Witterung und Höhenlage – einen Entwicklungszyklus von drei bis fünf Jahren, wobei der Lebenszyklus regional synchronisiert ist. Dies bedeutet, dass sich nahezu alle Feldmaikäfer in einer Region am selben Punkt ihres Entwicklungszyklus befinden und es „nur“ alle drei bis fünf Jahre zum Hauptschadenereignis kommt. Der Entwicklungszyklus setzt sich aus drei Stufen zusammen:
JUNIKÄFER
Amphimallon solstitiale

Käfer: 1-2 cm groß
Larve: bis 4 cm groß
GARTENLAUBKÄFER
Phyllopertha horticola
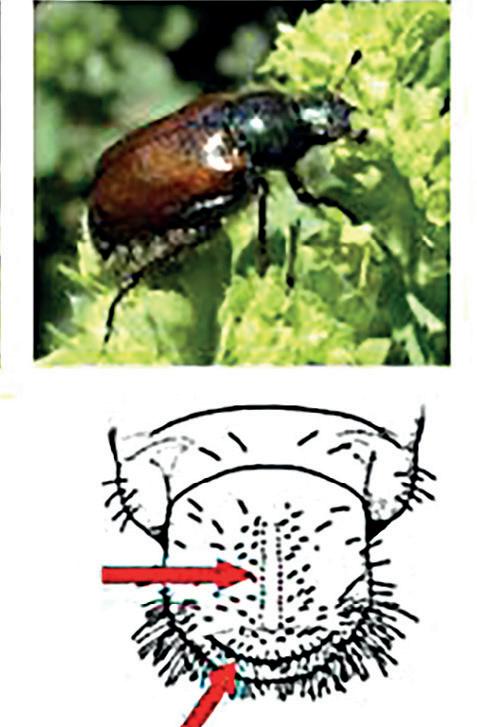
Käfer: 1 cm groß
Larve: bis 1,5 cm groß
Schadschwelle: 100 pro m2



1. Im ersten Entwicklungsjahr schlüpfen die Käfer aus dem Boden (April/Mai), führen einen Reifungsfraß an Bäumen durch, begatten sich und die Weibchen legen die Eier in offenen Stellen im Grünland ab. Dort schlüpfen die Larven und durchlaufen – ohne größeren Schaden zu verursachen – zwei Larvenstadien, bevor sie sich im Herbst in tiefere Bodenschichten zum Überwintern graben.
2. Im zweiten Entwicklungsjahr kommt es zum Hauptschadensjahr. Dabei durchläuft die Larve zwei Stadien und frisst über den Sommer Wurzeln von Gräsern und anderen Pflanzen. Anschließend wandert sie vor dem Winter wieder in tiefere Bodenschichten ab.
3 Bei Verdacht eines Engerlingbefalls: 25 cm x 25 cm große Fläche bis zu einer Tiefe von 10-15 cm freilegen und die Engerlinge zählen. 1 2 3
3. Im dritten Jahr kommt die Larve erneut kurz in den Wurzelhorizont hoch, frisst aber nicht mehr so stark an den Wurzeln. Anschließend wandert sie Ende Juli, Anfang August wieder in tiefere Bodenschichten ab. Dort verpuppt sie sich und der adulte Käfer schlüpft. Dieser überwintert erneut im Boden, bevor er im nächsten Jahr im April/Mai aus dem Boden schlüpft und es wieder von vorne los geht.
Was passiert 2025?
Folgt man diesem dreijährigen Rhythmus, wäre in diesem Jahr in den 2019 und 2022 geschädigten Regionen wieder mit verstärkten Schäden zu rechnen. Doch durch das regenreiche Jahr 2024 ist noch nicht eindeutig abzuschätzen, wie sich die Engerlinge entwickelt haben und ob oder wie stark es 2024 zu einem Flug gekommen ist. Ein entsprechendes Monitoring der LfL in Bayern läuft für 2025 an. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu regional unterschiedlichen Schadereignissen kommen kann.
Junikäfer
Der Junikäfer oder Gerippte Brachkäfer hat einen zweijährigen Entwicklungszyklus. Die Käfer fliegen zwischen Ende Mai und Anfang Juli. In dieser Zeit legen die begatteten Weibchen auch die Eier im Boden ab. Aus den Eiern schlüpfen die Larven, welche im ersten Jahr bereits an Wurzeln fressen. Den Winter verbringen die Larven in tieferen Bo-
1 Grünlandschaden durch Engerlinge in Berchtesgadener Land im Jahr 2019.
2 Engerling beim Wurzelfraß unter der Grasnarbe.

denschichten. Im zweiten Entwicklungsjahr kommt es zum Hauptschaden, die Larven kommen im Juni aus tieferen Bodenschichten, fressen an den Wurzeln und wandern im Herbst wieder unter die Frostgrenze ab. Im Frühjahr des dritten Jahres verpuppt sich der Engerling, Ende Mai schlüpft der fertige Käfer und es geht von vorne los.
Gartenlaubkäfer
Die dritte bei uns bedeutende Art ist der Gartenlaubkäfer. Dieser hat einen einjährigen Entwicklungszyklus. Dabei kommt es zwischen Mai und Anfang Juli zum Flug der Käfer, bei dem auch die Eiablage der begatteten Weibchen stattfindet. Aus den Eiern schlüpfen die Larven, die sich eben-


BIOFUTTER
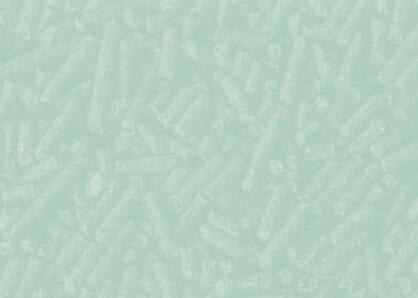
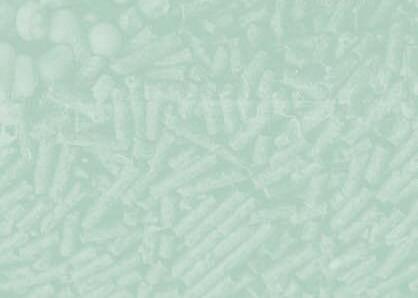

Maren Maitra, Tel. 0172 446 0465 maitra@bio-futter.sh für Schleswig-Holstein
Bei befallenen Flächen kann es passieren, dass Wildschweine nach Engerlingen suchen und somit zusätzliche Schäden anrichten.
falls von Wurzeln ernähren. Der Hauptfraß findet im Spätsommer statt. Über den Winter wandern die Engerlinge in tiefere Bodenschichten ab, bevor sie sich im nächsten Jahr verpuppen und es ab Mai wieder von vorne losgeht.
So sieht das Schadbild aus
Engerlinge ernähren sich von Pflanzenwurzeln, dadurch werden die Pflanzen geschwächt. Dies äußert sich durch geringeres Wachstum mit der Folge von weniger Ertrag bis zum Absterben der Pflanzen. Ausbleibender Niederschlag oder längere Trockenperioden während der Hauptfraßzeit verstärken das Schadbild, da die Pflanzen die Verluste weniger kompensieren können. Grundsätzlich sind Juli, August und September die Monate mit dem höchsten Schadenspotenzial. Durch den Verlust von Wurzelmasse ist die Grasnarbe nicht mehr so stark mit dem Boden verbunden und man kann ganze Graswasen vom Boden lösen. In Berggebieten besteht dann sogar die Gefahr des Abrutschens mit Maschinen und Traktoren. Bei mit Engerling befallenen Flächen kann es passieren, dass Wildschweine und Vögel nach den Tieren zur Futteraufnahme suchen und somit zusätzliche Schäden anrichten. Bei Verdacht eines Engerlingbefalls auf der Fläche sollte zur genauen Befallskontrolle eine 25 cm x 25 cm große Fläche bis zu einer Tiefe von 10-15 cm freigelegt und die Engerlinge gezählt werden. Die
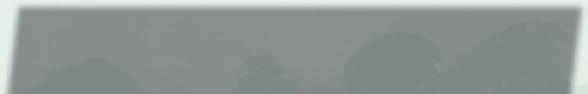


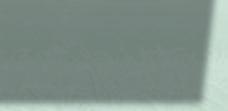



Thies Thamling, Tel. 0162 765 4297 thies.thamling@bio-futter.sh
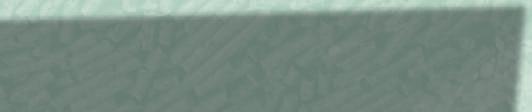





Kurz & knapp
Ein starker Engerlingbefall kann trotz der hohen Regenerationskraft des Grünlands zu erheblichen Ertrags- und Futterqualitätsverlusten führen, weshalb eine rechtzeitige Bekämpfung essenziell ist. Die Kosten für Gegenmaßnahmen sind deutlich geringer als die langfristigen Verluste durch eingeschränkte Futterproduktion. Durch das regenreiche Jahr 2024 kann man nicht eindeutig abschätzen, ob oder wie stark es in diesem Jahr zu einem kritischen Engerlingbefall kommt. Das Monitoring der LfL und anderer Institutionen läuft gerade an - verfolgen Sie also die Berichterstattung dazu aufmerksam. Mechanische Bearbeitungen und die Einsaat mit Qualitätssaatgut fördern die Regeneration des Grünlands nachhaltig. Zudem können angepasste Bewirtschaftungsstrategien zur langfristigen Stabilisierung der Flächen beitragen.
Schadschwellen variieren je nach Art:
• Maikäfer: 35-40 Engerlinge/m² im Flugjahr, 20-25 im Hauptfraßjahr
• Junikäfer: 60-80 Engerlinge/m²
• Gartenlaubkäfer: 100 Engerlinge/m²
Wichtig ist, dass die Engerlinge sich tatsächlich in den oberen 10-15 cm des Bodens befinden. Daher ist eine Befallskontrolle in den Monaten Juli, August oder September zu empfehlen.
So werden Engerlinge bekämpft
Im Ökologischen Landbau hat sich die mechanische Bekämpfung von Engerlingen bewährt. Dabei können Kreiseleggen, Zinkenrotoren oder Fräsen verwendet werden. Die Wirkungsweise der einzelnen Maschinen ist je nach Bodenart, Erosionsgefährdung und Humussauflage unterschiedlich und muss individuell abgeschätzt werden. Die Engerlinge werden durch die schlagende und quetschende Wirkung abgetötet. Zwei Überfahrten mit niedriger Fahrgeschwindigkeit und hoher Drehzahl haben sich bewährt – idealerweise bei sonnigem warmem Wetter, da die Engerlinge UV empfindlich sind. Der Einsatzzeitraum kann von Ende Mai bis Anfang September – je nach Engerlingart – variieren. Wichtiger ist, vor dem Einsatz zu prüfen, dass sich die Engerlinge im Bearbeitungshorizont befinden. Auf eine gute Bearbeitbarkeit des Bodens ist Wert zu legen, um Schmierschichten und Verdichtungen zu vermeiden. Falls eine Kreiselegge zur Bodenbearbeitung verwendet wird, sind die Zinken auf Griff zu stellen.
Dies erhöht die Wirkungsweise und reduziert die Gefahr von Verdichtungen. In einigen Bundesländern in Deutschland oder Österreich ist die Meldung einer mechanischen Engerlingbekämpfung von Nöten. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Beraterin oder Ihren Berater der Beratung für Naturland.
Einsaat der Grünlandfläche
Nach der mechanischen Bearbeitung erfolgt die Saat einer Grünlandmischung. Dabei ist auf eine geprüfte und dem Standort sowie der Nutzungsintensität angepasste Saatgutmischung zu achten. Durch die starke Bearbeitung der Fläche kann der Boden sehr locker sein. In diesem Fall verhindert das Walzen der Fläche vor der Saat eine zu tiefe Saatgutablage. Saatmengen von 25 bis 30 kg/ha haben sich bewährt. Dabei kann das Saatgut mit Nachsaatgeräten, Sämaschinen oder Schlitzgeräten flach ausgebracht werden und sollte anschließend, insbesondere bei Kluten oder unebenem Boden, angewalzt werden.
Auch die Einsaat einer Deckfrucht bereits beim zweiten Bearbeitungsvorgang mit Fräse, Kreiselegge oder Zinkenrotor ist möglich. Dies reduziert die Erosionsgefahr sowie das Austrocknungsrisiko und hilft, Unkräuter zu unterdrücken. Hafer oder andere Sommergetreide bieten sich hier an. Die Deckfrucht sollte aber im Schossen per Schröpfschnitt gemäht werden, um der Grünlandmischung nicht zur Konkurrenz zu werden. Möglichst scharfe Klingen verbessern den Wiederaustrieb und verhindern das Herausreisen der jungen Grünlandpflanzen.
Folgebewirtschaftung:
Um einen nachhaltigen Erfolg der Maßnahme zu erzielen, ist das Nährstoff- und Grünlandmanagement besonders wichtig. Da im Öko-Betrieb die Nährstoffe generell knapp sind, sei hier auf die abgestufte Grünlandnutzung hingewiesen, die über bewusst extensiv geführte Bestände die optimale Nährstoffversorgung auch intensiven Grünlands ermöglicht. Falls Sie Fragen zur abgestuften Grünlandnutzung haben, wenden Sie sich gerne an Ihre Beraterin oder Ihren Berater der Beratung für Naturland.
In jedem Fall sind gerade nach einer Neuansaat Nutzungsintensität und Düngung gut auf Standort und Pflanzenbestand abzustimmen sowie regelmäßige Nachsaaten und eine Erhaltungs-Kalkung bei Bedarf durchzuführen, narbenschonende Bewirtschaftung hat immer hohe Priorität.

„Pyrogenium compositum inject zusammen mit smaXtec ist die ideale Kombi bei Euterentzündung und Fieber. Ich bekomme frühzeitig einen Alarm aufs Handy und kann die Wirkung unmittelbar überwachen.“
Melf Hansen, Wiesenhof, 300 Milchkühe

Pyrogenium compositum inject
9 Fragen ZUM WEIDEZAUN


AUTOR Stefan Veeh
Beratung für Naturland s.veeh@ naturland-beratung.de
Sichere und funktionierende Weidezäune sind die Basis für eine erfolgreiche Weidehaltung. Immer wieder tauchen dazu Fragen auf, die wir nachfolgend beantworten.
WELCHES STROMGERÄT VERWENDE ICH FÜR MEINEN WEIDEZAUN?
Wird ein Gerät ausschließlich stationär in Stall- oder Hofnähe betrieben, kann auf ein Netzgerät zurückgegriffen werden. Für mobil betriebene Geräte sind Batterie- bzw. Akkugeräte mit 9 Volt oder 12 Volt die erste Wahl und können auch in Kombination mit einem Solarmodul betrieben werden. Die wichtigste Kennzahl eines Weidezaungerätes ist allerdings die Impulsenergie, die in Joule angegeben wird. Je länger ein Zaun ist und je stärker der Bewuchs, desto mehr Impulsenergie ist nötig, damit bei Tierkontakt die Zaunspannung für den gewünschten Warneffekt ausreicht. Für kurze Zäune bis maximal 500 Meter und bei geringem Bewuchs reicht eine Impulsenergie von mindestens 0,25 Joule aus. Damit könnte ein Zaun auch mit einem kleinen 9 VoltBatteriegerät betrieben werden. Die notwendige Impulsenergie hängt also von Zaunlänge und Bewuchs ab.
2.
WIE MESSE ICH, OB DER ZAUN HÜTESICHER IST?
Die in Frage 1 erwähnte Impulsenergie ist die Kennzahl für den maximal möglicher Schlag. Das ist für die Geräteauswahl wichtig. Messbar ist aber nur die Zaunspannung unter Belastung. Für leicht zu hütende Tiere, wie Milchvieh oder Pferde, reicht oft eine Zaunspannung bei Tierkontakt von 2.000 Volt. Bei schwerer zu hütenden Tieren wie Jungvieh, Schafen und Ziegen sollte die Zaunspannung bei Tierkontakt mindestens 4.000 Volt betragen, damit ein hütesicherer Betrieb möglich ist. Die Spannung kontrollieren Sie regelmäßig mit einem sogenannten Zaunprüfer. Dabei empfiehlt sich ein Zaunprüfer mit Simulation der Tierberührung. So kann mit dem Prüfer der Belastungsfall simuliert und kontrolliert werden, ob die verbleibende Zaunspannung für die Hütesicherheit ausreicht. Es gibt auch Spannungsprüfer mit eingebauter Fehlersuche, die die
Richtung eines Kurzschlusses anzeigen und so die Fehlersuche erleichtern. Für die Überwachung entfernter Flächen kann eine dauerhafte Spannungsmessung mit Benachrichtigungsfunktion sinnvoll sein.
3.
WIE ERFOLGT DIE RICHTIGE ERDUNG DES WEIDEZAUNGERÄTS?
Ein wichtiger und oft vernachlässigter Punkt ist die passende Erdung zum Gerät: Nur mit guter Erdung (und gutem Leitermaterial) kann das Weidezaungerät auch unter Belastung seine Impulsenergie ans Tier abgeben. Deshalb sollten nur verzinkte Erdungsstäbe verwendet werden, die tief eingeschlagen und mit den Zubehörkabeln an das Gerät angeschlossen werden. Häufig werden hierbei fälschlicherweise Kupferkabel aus der Hauselektrik oder unverzinkte Eisenstäbe verwendet. Rost ist jedoch einer der besten Isolatoren, der den Stromfluss behindert. Kann der Strom nicht fließen, bricht die Zaunspannung unter Belastung ein – und das Tier verspürt keinen Schlag. In der Praxis sind viele Geräte nicht ausreichend geerdet. Um dies zu prüfen, sollte ein Erdungstest durchgeführt werden (siehe Infobox).
Erdungstest
Der Erdungstest ist die zentrale Funktionsprüfung, nur bei ausreichender Erdung wird eine entsprechende Abschreckung beim Tier erreicht:
1. Weidezaungerät von der Stromversorgung trennen
2. Kurzschluss im Zaun erzeugen, etwa 100 Meter vom Gerät entfernt Eisenpfähle in den Zaun legen
3. Weidezaungerät wieder anschließen und einschalten
4. Spannung am Erdstab messen (Sollwert < 200V=0,2kV)
5. Weidezaungerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen
6. Weitere Erdstäbe einschlagen, Test wiederholen, bis Sollwert erreicht ist.
Elektrozäune müssen mit deutlich sicht- und lesbaren Warnschildern gekennzeichnet sein.

1.

Damit der Zaun auch bei Bewuchs hütesicher bleibt, müssen die Drähte und Litzen gut gespannt sein und die Eckpflöcke abgestützt werden.
4.
WAS IST ZU TUN, WENN DIE ERDUNG
NICHT AUSREICHT?
Wird die Erdung auch nach dem Einschlagen mehrerer Stäbe nicht besser, kann das Loch für den Erdstab auch mit Bentonit ausgeschlämmt werden, um so den Bodenschluss des Erdstabes zu verbessern. Die Erdung kann auch im Jahresverlauf schwanken. Trocknet zum Beispiel das Erdreich bei starker Trockenheit bis in Erdungstiefe aus, kann sich dadurch die Erdung zunehmend verschlechtern. Dann müssen mehr Erdstäbe eingeschlagen oder es muss durch Gießen der Erdstäbe nachgeholfen werden.

Für das Umlenken der Litzen müssen Eckrollen verwendet werden, normale Ringisolator sind nicht dafür ausgelegt.
5.
WELCHEN LEITER SOLL ICH VERWENDEN? DRAHT ODER LITZE?
In einem Festzaun können stabile Drähte verwendet werden, während in einem Mobilzaun nur Litzen Sinn haben. Wird Stahldraht im Festzaun verwendet, sollte auf eine entsprechende Legierung und Beschaffenheit des Drahtes geachtet werden. Diese Stahldrähte sind vor Korrosion geschützt und halten 20–30 Jahre der Witterung stand. Mobilzäune mit flexiblen Kunststofflitzen sind weniger lang haltbar. Trotzdem gibt es zwei Faktoren, die die Langlebigkeit eines Litzenzaunes verbessern: Wird eine Litze z. B. auf einer Haspel oft aufund wieder abgerollt, kann es zu kleinen Brüchen innerhalb der stromführenden Drähte kommen. Je mehr stromführende Drähte in den Kunststoff eingearbeitet wurden, desto besser kann so ein Bruch kompensiert werden. Und der zweite Faktor: Je besser Kunststofffäden und Metallleiter verflochten sind, desto weniger Schäden und Brüche entstehen innerhalb der Litze. Wichtig ist, dass nur Material mit guter Leitfähigkeit verwendet wird. Dies ist am Widerstand des Leitermaterials (in Ohm/m) zu erkennen. Je niedriger dieser Wert ist, desto leitfähiger ist der Zaun. Zielwert ist unter 0,1 Ohm pro Meter.
6.
WELCHE PFÄHLE EIGNEN SICH AM BESTEN?
Für Festzaunsysteme empfehlen sich Pfähle heimischer Harthölzer, die eine Lebensdauer von 20 – 30 Jahren haben. Nadelholzpfähle faulen oft an der Kontaktstelle zwischen Boden und Luft. Metallpfähle können auch verwendet werden. Bei starken Weidezaungeräten besteht jedoch die Gefahr, dass sie durchschlagen, wenn der Abstand zwischen Pfahl und Zaundraht zu gering ist.
Bei Mobilzäunen werden am häufigsten Kunststoffpfähle verwendet. Als Eckpfähle sind die Kunststoffpfähle jedoch völlig ungeeignet. Um einen Zaundraht spannen zu können, sollten die Eckpfähle eines Mobilzaunsystems aus Metall sein – mit Abstützung.
7.
WELCHE ISOLATOREN SOLL ICH VERWENDEN?
Bei den Isolatoren gibt es für jede Einbausituation die passende Bauform. Oft sieht man für den jeweiligen Zweck falsche Isolatoren verbaut. Bestes Beispiel ist die Eckrolle, die häufig eingespart wird. Der
normale Ringisolator ist allerdings nicht für das Umlenken der Litze ausgelegt. Durch Bewegung, Ausdehnung, Auf- und Abbau entstehen Reibung und Wärme, die den Isolator beschädigen. Die dadurch entstehenden Kanten und Riefen beschädigen Litze und Isolator, die dann ausgebessert oder ersetzt werden müssen.
WIE SCHÜTZE ICH DAS WEIDEZAUNGE-
RÄT VOR DIEBSTAHL?
Es kommt vor, dass Weidezaungeräte vom Zaun getrennt und gestohlen werden. Hier entsteht doppelter Schaden für den Tierhalter, weil nicht nur
Zaunhöhen für Rinder
Anzahl Einzeldrähte Höhe der Einzeldrähte in cm
1. Draht 2. Draht 3. Draht
1 90-100 (max. 110)
2 50-60 90-100 (max. 110)
3 45-60 75- 80 90-100 (max. 110)
Zaunhöhen für Schafe und Ziegen
Anzahl Einzeldrähte Höhe der Einzeldrähte in cm
1. Draht 2. Draht 3. Draht 4. Draht
4 25-30 45-50 60-65 90-120
3 30-40 50-60 90-120

Einfach scannen: Entdecke unsere Bio-Rinderfutter!
das Gerät ersetzt werden muss, sondern auch die Tiere aus der „stromlosen Weide“ ausbrechen können. Gegen Diebstahl haben sich Aufbewahrungsboxen bewährt, die vom Gerät unter Strom gesetzt werden und damit auch den potenziellen Dieb abschrecken.
9.
WELCHE RECHTLICHEN VORGABEN MUSS ICH EINHALTEN?
Für den Betrieb von elektrischen Weidezäunen gelten laut VDE 0131 folgende rechtliche Regelungen:
• Elektrozäune müssen mit deutlich sicht- und lesbaren Warnschildern (alle 100 Meter) gekennzeichnet sein.
• An jedem Tor und an jedem öffentlichen Zugangspunkt muss der Weidezaun gekennzeichnet sein.
• Die Schilder müssen eine Mindestgröße von 10 mal 20 cm besitzen und mit einer Schriftgröße von mindestens 25 mm beschriftet sein, die Aufschrift kann entweder „Achtung Elektrozaun“ oder „Vorsicht Elektrozaun“ lauten.
• An unübersichtlichen Stellen oder an Stellen, an denen kein Weidezaun vermutet wird, müssen ebenfalls Warnschilder angebracht werden.
• Stacheldraht darf nicht als Elektrozaun verwendet werden.
• Der Elektrozaun darf nur mit einem Weidezaungerät versorgt werden.
WeideOptiLak und WeideLakdie Kraft der Weide, perfekt ergänzt.
Entfessele das volle Potenzial deiner Weide mit unseren innovativen Öko-Milchleistungsfuttern
WeideOptiLak und WeideLak. Speziell entwickelt für die Weidehaltung, unterstützen sie eine optimale Milchproduktion, indem sie die natürliche Grasaufnahme gezielt ergänzen.
WeideOptiLak: Für maximale Leistung bei intensiver Weidehaltung.
WeideLak: Ideal abgestimmt auf extensive Weiden für nachhaltige Erträge.
Unsere Produkte fördern nicht nur die Gesundheit deiner Kühe, sondern tragen auch zu einer umweltbewussten Milchproduktion bei. Natürlich. Effizient. Weidebasiert.
GS Die Genossenschaft eG Raiffeisenstr. 4
49685 Schneiderkrug gs-bio.de
BESAUGEN?
Nein danke!
Das Besaugen unter Kälbern ist ein weit verbreitetes Problem in der Milchviehaufzucht. Was oft harmlos beginnt, kann ernsthafte Folgen für Tiergesundheit und spätere Milchleistung haben. Mit gezielten Maßnahmen in Fütterung und Haltung lässt sich dem Verhalten jedoch vorbeugen.

AUTORIN
Lisa Krallinger
Beratung für Naturland l.krallinger@ naturland-beratung.at
In der Natur säugen Kälber bei der Mutterkuh etwa sechs bis acht Mal täglich für die Dauer von jeweils sieben bis zwölf Minuten. Dabei wird nicht nur Milch aufgenommen, sondern vor allem auch das ausgeprägte Saugbedürfnis befriedigt. In der Milchviehhaltung hingegen erhalten die von der Kuh getrennten Kälber meist nur zwei bis drei Milchmahlzeiten pro Tag mit begrenzter Dauer, dadurch bleibt der Saugtrieb ungestillt. Das Resultat: Die Kälber versuchen, diesen Trieb an Stallgegenständen oder Artgenossen auszuleben. Besonders betroffen sind Körperstellen wie Nabel, Ohren, Maul oder – besonders problematisch – die Euteranlage. Dort kann das Besaugen zu dauerhaften Gewebeschäden führen, die im späteren Leben Euterentzündungen, schlechte Zitzenschlüsse oder den Verlust eines Euterviertels zur Folge haben können.
Tränke als Schlüssel
Ein zentrales Element zur Vermeidung des Besaugens liegt im Tränkemanagement. Folgende Tipps sollen helfen, das gegenseitige Besaugen zu reduzieren:
• Mehrere Milchmahlzeiten pro Tag oder Adlibitum-Tränken nutzen.
• Mindestens 8 bis 10 Liter Milch täglich in den ersten Lebenswochen geben – und zwar verteilt auf kleinere Portionen.
• Langsame Sauger mit hohem Widerstand verwenden, um das Trinken zu verlangsamen und das Saugen auszudehnen.
• 20 Minuten nachsaugen am leeren Kübel ermöglichen, das befriedigt den Saugreflex zusätzlich.
• Es kann helfen, die Kälber nach der Tränke für etwa 20 Minuten zu fixieren. In der Zwischenzeit sollte der Saugbedürfnis abklingen. Achtung: Eine dauerhafte Anbindung von Kälbern ist nicht erlaubt!
Ein „Geheimtipp“ kommt von Berater Hubert Weigand: „Kälber sollten nach der Tränke ohnehin etwa zwanzig Minuten fixiert bleiben. In dieser Zeit kann man ihnen eine Kraftfutterflasche mit ganzen Mais-, Gerste- oder Weizenkörnern anbieten – höher aufgehängt als die Tränke.“
Warum das sinnvoll ist
In den ersten Lebenswochen funktioniert die Verdauung vor allem im Labmagen. Ganze Körner werden dort vollständig verdaut.

Um das gegenseitige Besaugen von Kälbern in der Gruppe zu reduzieren, sollte es den Kälbern ermöglicht werden, circa 20 Minuten am leeren Tränke-Kübel „nachzusaugen“.

Sobald im Kot unverdauter Mais sichtbar wird, hat die Pansenaktivität begonnen und es ist Zeit, auf Pellets oder Schrot umzusteigen.
Wichtig: Solange getränkt wird, sollte kein Schrot gefüttert werden. Schrot bleibt oft am Milchschaumbart hängen und kann andere Kälber wieder zum Saugen animieren.
Weitere Faktoren
Neben der Fütterung spielt auch die Stallumgebung eine wichtige Rolle. Kälber, die ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten haben, sind entspannter und neigen weniger zu unerwünschtem Verhalten. Geeignet sind zum Beispiel leere Nuckel in der Box, Heunetze, Bürsten, Gummischläuche oder Beißspielzeug. Voraussetzung ist ausreichend Einstreu, Licht, Frischluft und – wenn möglich – Zugang zum Auslauf Das Besaugen tritt besonders häufig in Gruppen mit großem Altersunterschied auf. Deshalb ist es sinnvoll, Kälber in homogenen Gruppen mit einem maximalen Altersunterschied von 14 Tagen
zu halten. Gruppenwechsel oder Umstallungen sollten möglichst selten erfolgen, da sie Stress auslösen und das Risiko von Besaugen erhöhen. Achtung: Einzelhaltung von Kälbern ist verboten. Wichtig ist, dass auffällige Tiere frühzeitig erkannt werden. „Sauger“ sollten beobachtet, notiert und im Zweifelsfall kurzfristig separiert werden, um die Nachahmung durch andere Tiere zu vermeiden. Eine einfache Dokumentation von Verhalten, Tränkezeiten und Stallveränderungen kann helfen, Ursachen besser zu verstehen und gezielt gegenzusteuern.
Wenn nichts mehr hilft
Saugentwöhner, also Nasenringe mit kleinen Stiften, verhindern mechanisch das Besaugen. Sie können als Übergangslösung eingesetzt werden, lösen aber nicht die Ursache des Problems. Deshalb sollten sie immer nur in Kombination mit einer Umstellung der Fütterung oder Haltung genutzt werden.
Achtung: Nasenringe, die die Nasenscheidewand durchtrennen,
sind bei weiblichen Tieren nicht erlaubt.
Die nachhaltigste Maßnahme bleibt die kuhgebundene Aufzucht. Kälber, die bei Mutter oder Amme bleiben, zeigen dieses Verhalten kaum, da ihr natürliches Saugbedürfnis voll befriedigt wird. Diese Haltungsform ist zwar arbeitsintensiver, wird aber auf vielen Biobetrieben erfolgreich praktiziert.
Kurz & knapp
Das gegenseitige Besaugen ist kein unlösbares Problemvorausgesetzt, man kennt die Ursachen und setzt gezielt an. Angepasste Tränke, frühe Kraftfutteraufnahme, kluge Gruppenbildung und abwechslungsreiche Umgebung können das Saugen effektiv verhindern.

BRANCHE SUCHT
Proteine
Bio-Ferkel und Bio-Junggeflügel brauchen hochwertiges Eiweiß. Bis 2027 sind in Deutschland deshalb für diese Tiere noch 3 bzw. 5 % konventionelle Eiweißträger erlaubt. Aber wie geht’s danach weiter?

AUTOR
Jürgen Beckhoff
Agrarjournalist beckhoff@ bkommunikation.de
&Die Bio-Tierhaltung hat bereits große Fortschritte gemacht, Bio-Tiere mit Bio-Futter zu versorgen. Allein die bedarfsgerechte Fütterung von empfindlichen Monogastrier-Jungtieren fordert die BioLandwirtschaft und die Mischfutterhersteller noch immer heraus. Das wurde bei einem Fachgespräch deutlich, zu dem der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) Expertinnen und Experten im März eingeladen hatte. Derzeit dürfen Bio-Ferkel bis 35 kg in Deutschland seit Jahresbeginn nur noch 3 % konventionelle Futtermittel bekommen. Um den Aminosäurebedarf für die Jungtiere zu decken, kommen Maiskleber und Kartoffeleiweiß zum Einsatz. Für Junggeflügel bis 18 Wochen sind noch 5 % konventionelle Eiweißträger erlaubt. Die Regelungen für Ferkel sind damit in Deutschland strenger als es die EU-Ökoverordnung vorsieht, die 5 % noch bis Ende 2026 erlaubt, erläutert Peter Röhrig, Geschäftsführer der BÖLW die Rechtslage. Der Mangel an hochwertigem Eiweiß mit Bio-Herkunft bleibe herausfordernd, sagt er und appelliert an das Bundeslandwirtschaftsministerium, bei einer Neuregelung ab 2027 weiterhin die Möglichkeiten der Branche und die Bedarfe der Tiere abzuwägen.
Exakt Aminosäuren ergänzen
Weil Bio-Futter zu wenig essenzielle Aminosäuren wie Methionin enthält, werde die Versorgung der Jungtiere oft über größere Mengen optimiert, brachte Wilhelm Pflanz von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf die Problematik auf den Punkt. Dabei seien die Tiere dann mit Rohprotein

AUTORIN
Brigitte Stein
Bioland brigitte.stein@ bioland.de
überversorgt, Stickstoffüberschüsse die Folge. Er plädierte dafür, wie in der konventionellen Fütterung mit einzelnen essenziellen Aminosäuren zu ergänzen. Das widerspricht jedoch der aktuellen EU-Öko-Verordnung, die den Einsatz sowohl synthetisch hergestellter Aminosäuren als auch solcher, die durch gentechnisch veränderte Organismen (GVO) erzeugt wurden, verbietet. Lediglich in der Fütterung von Salmoniden (Lachsfische) ist bereits heute der Einsatz einer mikrobiell erzeugten Aminosäure (Histidin) zulässig. Pflanz hält es für notwendig, hier einen Abwägungsprozess für den Ökolandbau anzustoßen. „Die Zulassung mikrobiell hergestellter Aminosäuren wäre ein Paradigmenwechsel, aber machbar“, sagt der Fachmann. Entscheidend sei, dass eine Synthese ohne GVO sichergestellt ist. Als geeignetes Verfahren sieht er dafür zum Beispiel die Fermentation.
Raps aufbereiten
In anschließenden Diskussionsrunden zählten die Teilnehmenden auch neuartige Extraktionsverfahren ohne Hexan-Aufschluss zu den vielversprechenden Wegen. Dr. Hanna Philippi von der Universität Hohenheim hatte die Möglichkeiten vorgestellt, andere Leguminosen oder Ölsaaten (z.B. Raps) so weit aufzubereiten, dass sie mit Soja mithalten könnten. Für eine ausreichende Methionin-Versorgung blieben aber hochwertige Raps- und Sonnenblumenkuchen notwendig. Sie sieht weitere Proteinquellen – zum Beispiel Eiweißextrakte aus Grünlandaufwuchs – aber noch im Entwicklungsstadium.

Mit Klee kann in der Schweinehaltung Kraftfutter eingespart werden, für die Eiweißversorgung von Jungtieren ist er aber keine Lösung.
Rotklee und Luzerne
Geeignet seien Luzerne und Rotklee vor allem in der Schweinehaltung in Form von Silage oder Trockenfutter, um Kraftfutter einzusparen. Das berichtet Dr. Daniela Werner vom Thünen-Institut für Ökologischen Landbau in ihrem Beitrag über das Potenzial feinsamiger Leguminosen für die Eiweißversorgung. Beide Pflanzen haben laut Werner hohe Gehalte an den gewünschten Aminosäuren Lysin und Methionin. Bei Geflügel sei der Einsatz von Luzerne dagegen schwieriger, da die relativ hohen Saponingehalte Probleme bereiten können. Für die Eiweißversorgung von Jungtieren seien feinsamige Leguminosen deshalb auch keine Lösung.
Algen zu teuer
Ob Algen zukünftig Teil einer optimierten Eiweißversorgung sein könnten, skizzierte Prof. Gerhard Bellof von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf anhand eines aktuellen Forschungsprojektes. Algenarten wie Spirulina haben laut Bellof relativ gute Eiweißgehalte mit einer mittleren Verdaulichkeit für Ferkel und Junggeflügel. Die Zufütterung von Algen in der Broilermast mit Anteilen von bis zu fünf Prozent führte zu höheren Futteraufnahmen und Endgewichten. „Bei Schweinen waren
die Versuchsergebnisse dagegen insgesamt ernüchternd“, sagte Bellof. So seien Tageszunahmen bei Algenanteilen von bis zu zehn Prozent zurückgegangen, vermutlich aufgrund einer verringerten Proteinverdaulichkeit. Insgesamt könnten die betrachteten Algenarten laut Bellof hochwertige Eiweißfuttermittel wie Kartoffeleiweiß nicht ersetzen. Zudem seien Algen teuer und nicht wirtschaftlich einsetzbar.
Insektenmehl vielversprechend
Vielversprechender erscheint derzeit das Potenzial von Insekteneiweiß, wie Laura Schneider von der Technischen Hochschule Bingen berichtete. Nach Einschätzung der Expertin zeigten Fütterungsstudien mit Mehl aus Larven der Soldatenfliege gute Ergebnisse. Bei Anteilen von fünf bis zehn Prozent in der Ration als Ersatz für Sojaschrot förderte das Larvenmehl die Darmgesundheit bei Schweinen und Geflügel, stimulierte die Futteraufnahme und verbesserte bei Masthähnchen die Futterverwertung. Als wichtigen Vorteil nannte Schneider zudem die Möglichkeit der sinnvollen Verwertung von Abfallprodukten wie Schimmelgetreide oder verdorbener Silage, die problemlos für die Aufzucht der Insekten genutzt werden können. Die Aufzucht auf dem eigenen Betrieb könne so zur Optimierung der Wertschöpfungskette beitragen.
Bio-Produktion ankurbeln
Welche Auswirkungen eine Konzentration auf die bewährten Produkte Bio-Kartoffeleiweiß und Bio-Maisexpeller auf die Futterkosten haben, stellt Annette Alpers von der Beratung für Naturland vor. Beide Produkte seien Nebenprodukte der Stärkeherstellung, allerdings benötige der Markt bislang nur wenig Bio-Stärke. Ein Ansatz wäre demnach, Bio-Stärke konventionell zu vermarkten, um die wertvollen und gesuchten Bio-Proteinfuttermittel zu gewinnen. Das würde die Bio-Tierhaltung allerdings laut Annette Alpers mit zusätzlichen Kosten belasten: In diesem Vermarktungsansatz kostet Bio-Maiskleber 4,40 Euro/kg, konventioneller Maiskleber hingegen nur 1 Euro/kg, das Bio-Masthähnchen würde sich dadurch um 60 Cent je Tier verteuern. Bio-Kartoffeleiweiß müsste bei diesem Ansatz mit 13.300 Euro/t sogar das Zehnfache von konventionellem Kartoffeleiweiß kosten. Das würde die Rationen für Ferkel um 51 Prozent verteuern, rechnet Alpers vor.
Tiermehl
Als „eigentlich logische Ernährung omnivorer Tiere“ stellte Dr. Martin Alm die Möglichkeit vor, verarbeitetes tierisches Protein zu verwerten. Der technische Direktor des Europäischen Fachverbandes der Verarbeitungsbetriebe für tierische Nebenprodukte versuchte, die Vorbehalte gegenüber diesen Futtermitteln auszuräumen. Es gelte das „Kannibalismusverbot“, daher komme für Bio-Geflügel nur Bio-Schweinemehl infrage, wofür aber Menge und Logistik fehlen, für Bio-Schweine sei Bio-Geflügelmehl zu teuer.
Auf mehr Akzeptanz bei den Teilnehmenden stieß Fischmehl, das Carsten Pohl von der Bio-Eichenmühle als Futtermittel vorstellte. Das Produkt sei

Frankreichs Bio-Pionier seit 1974
291, route de Chevrières F-42140 La Gimond Frankreich
Kontakt in deutscher Sprache : Georg SCHAFF
+33 6 31 36 94 68
Mail : georg schaff@gmail com

Für Junggeflügel bis 18 Wochen sind noch 5 % konventionelle Eiweißträger erlaubt. Die EU-Öko-verordnung schreibt eine 100 % Bio-Fütterung ab 2027 vor.
bereits Naturland-zertifiziert verfügbar und besser verdaulich als Sojakuchen. Allerdings sei Fisch auch eine Senke für unerwünschte fettlösliche Stoffe und Fischmehl könne Magensäure abpuffern, was man mit Zusatzstoffen verhindern müsse.
Kurz & knapp
Die EU-Öko-Verordnung schreibt die Fütterung von Bio-Tieren mit 100 Prozent Bio-Komponenten ab dem 1. Januar 2027 vor. Wie dieser Schritt gelingen kann, sollte ein Expertenforum ausloten. Forscherinnen und Forscher stellten Projektergebnisse vor. Es wurde betont, dass für die ausreichende Eiweißversorgung von Geflügel und Schweinen im Ökolandbau heute deutlich mehr Alternativen zur Verfügung stehen als vor 20 Jahren. Auch die Forschung sei heute deutlich weiter. Dennoch sprachen sich viele Teilnehmende dafür aus, den Einsatz begrenzter Mengen an konventionellen Eiweißfuttermitteln auch nach 2026 weiter zu ermöglichen, insbesondere für die ersten zehn Lebenswochen bei Geflügel. Eine Arbeitsgruppe soll nun mit den gewonnenen Erkenntnissen eine Position des BÖLW für Deutschland entwickeln. Von Seiten Naturlands sind hier Martina Kozel und Annette Alpers Ansprechpartnerinnen.
heimische Eiweißträger verbesserte Futterverwertung weniger Stickstoff

Fotos: Goldberger, Beckhoff, bsp-media, Schön
ANZEIGE


AUTORIN
Sabrina Balters
Beratung für Naturland s.balters@ naturland-beratung.de
Der PROTEINKERN
Im Sommer 2024 wurde auf dem Naturland-Betrieb Ferlhof von Familie Demmelmair in Oberbayern ein Fütterungsprojekt in Kooperation mit der französischen Futtermühle Cizeron Bio durchgeführt. Getestet wurde der sogenannte „Proteinkern“ und dessen Einfluss auf die Legehennen.
Bis Ende 2026 dürfen in Deutschland noch bis zu 5 % konventionelle Eiweißfuttermittel eingesetzt werden. Das Schwierige an einer 100 % Biofütterung ist, die Tiere weiterhin bedarfs- und leistungsgerecht zu versorgen. Die französische Futtermühle Cizeron Bio hat einen innovativen und patentierten Herstellungsprozess entwickelt. Dabei wer-
den viele verschiedene pflanzliche Proteinträger mechanisch und thermisch aufbereitet. Es entsteht der sogenannte Proteinkern. Durch diese Aufbereitung von Eiweißfuttermitteln steigt die Verdaulichkeit und der Eiweißgehalt in der Ration kann reduziert werden. Im Versuch ging es darum, den Proteinkern in der Praxis zu testen.
Verglichen wurden zwei Herden von Braunlegern derselben Herkunft und Altersgruppe, die bis zum Start des Versuchs identisch gehalten und gefüttert wurden. Zu Beginn wurden Referenzdaten erhoben: Körpergewicht, Legeleistung, Befiederung nach dem MTool-Verfahren sowie Kotproben zur Nährstoffanalyse.
Tab.1: Nährstoffwerte der Rationen
Kontrollgruppe (ohne Proteinkern)
Tab.2: Rohprotein- und Futteraufnahme
Rohproteingehalt
In der Kontrollgruppe blieb die Ration unverändert, während in der Projektgruppe die bisher

Im Versuch wurden regelmäßige Wiegungen durchgeführt, um Veränderungen so früh wie möglich zu bemerken.
eingesetzte Eiweißkomponente durch den Proteinkern ausgetauscht wurde. Alle weiteren Komponenten wurden beibehalten, Tabelle 1 zeigt die Analysewerte der Rationen. Hier ist der
Tägl. Futterverbrauch je Henne
Tägl. Proteinaufnahme je Henne
Projektgruppe (mit Proteinkern)
unterschiedliche Proteingehalt erkennbar, 16,5 % im Standardfutter und 15,6 % im Projektfutter. Um Futterumstellungsstress zu vermeiden, erfolgte eine dreitägige Übergangsphase mit sukzessiver Zumischung der neuen Ration. Der Versuch lief über 58 Tage. Währenddessen wurden regelmäßig Daten zu Legeleistung, Eigewicht, Tiergewicht sowie Kotqualität und Mortalität erhoben.
Ergebnisse
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse des Projektes in Bezug auf Ration und Leistung der Hennen. Auffallend ist, dass die tägliche Futteraufnahme der Projektgruppe reduziert ist. Umgerechnet auf die Aufnahme von Rohprotein aus der Ration war diese um 13,9 % geringer als in der Kontrollgruppe – bei vergleichbarem Futterverwertungsindex. Die Legeleistung blieb über die Projektperiode hinweg stabil, ebenso die Homogenität des Körpergewichts. Lediglich das Eigewicht nahm im Verlauf geringfügig ab, möglicherweise infolge des geringe-
Weitere Infos zum Produkt und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 63.
ren Proteingehalts. Die geringere Proteinzufuhr durch den Proteinkern bei gleichzeitig stabiler Legeleistung weist auf eine bedarfsgerechtere Versorgung und geringere Überversorgung hin.
Eine weitere interessante Erkenntnis: Die Exkremente der Projektgruppe wiesen festere Konsistenz sowie geringere Stickstoff- und Fettgehalte auf. Dies deutet auf eine verbesserte Verdaulichkeit der eingesetzten Eiweißkomponente hin sowie eine potenziell geringere Umweltbelastung durch geringere Nährstoffausscheidung. Zudem wurde ein insgesamt ruhigeres Tierverhalten in der Projektgruppe beobachtet.
Ausblick
Die Ergebnisse decken sich mit den Erkenntnissen aus vorhergegangenen Fütterungsversuchen aus Frankreich. Um Aussagen zur Langzeitwirkung und Leistungskonstanz treffen zu können, sind weiterführende Versuche mit längerer Laufzeit über die gesamte Legeperiode sinnvoll.
TIPP

ÖKO-HÄHNCHENHALTUNG
in der Praxis
Der Markt für Bio-Hähnchen ist offen für Neueinsteiger. Kilian Henne ist diesen Weg 2022 gegangen und hat seitdem viele Erfahrungen gesammelt. Erfahrungen, die er gerne teilt.
Bio-Hähnchen sind am Markt gefragt. Anfänglich hatte sich Kilian Henne mit Bio-Legehennen beschäftigt. Dass es am Ende doch Hähnchen geworden sind und nicht Legehennen, liegt daran, dass der tägliche Aufwand zeitlich überschaubarer ist und die arbeitsreichen Tage in der Hähnchenmast im Voraus geplant werden können. Zudem kann mit einer benachbarten Biogasanlage auf eine günstige Wärmequelle zurückgegriffen werden, die für die Aufzucht von besonderer Bedeutung ist.
14.400 Mastplätze
2022 war es dann so weit: Für jeweils 14.400 ÖkoHähnchenmastplätze wurde ein Aufzuchtstall mit 720 m² Stallfläche und ein Maststall mit 1.600 m² Stallfläche inkl. Wintergarten gebaut. Kilian Henne bewirtschaftet 160 ha Acker und etwas Grünland, alles nach den Richtlinien des Naturland-Verbandes. Als er in den elterlichen Betrieb einsteigen wollte, sollte ein zweites Standbein die Wirtschaftlichkeit des Betriebes stabilisieren. Und auch eine verbesserte Nährstoffversorgung war ein weiteres Argument für die Bio-Hähnchenhaltung. Außerdem war der Masterstudent jung und interessiert an Neuem. Der elterliche Betrieb hatte zu dem Zeitpunkt Ackerbau, Schweine und eine Biogasanlage.
Die Größe des Hähnchenstalls wurde so gewählt, dass er noch nach Baurecht privilegiert ist (bis max. 30.000 Plätze). So entstand ein Aufzuchtgebäude mit zwei Gruppen à 4.800 Plätzen und zwei Gruppen mit je 2.400 Plätzen. Die Aufzucht brauchte bislang keinen Grünauslauf, da der physiologische Zustand der Küken und Jungtiere einen Auslauf nicht erlaubt. In Zukunft, also bei neuen Stallbauvorhaben oder nach Ablauf der Übergangszeit 2030, muss man aber auch in der Aufzucht einen Grünauslauf bereithalten - so will es jedenfalls die EUKommission.
Aufzucht bis ein Kilo
Wenn die Küken direkt nach dem Schlupf von der Bio-Brüterei Schwichteler wie bestellt in passender Anzahl und Zeit zum Betrieb kommen, ist der Stall auf 34,5°C aufgeheizt. Dies geschieht nicht mit einer Fußbodenheizung, sondern mit Wasserwärmetauschern, wobei der Betonfußboden durch die nur

AUTORIN
Annette Alpers
Beratung für Naturland a.alpers@ naturland-beratung.de
kurze Serviceperiode kaum auskühlt. Um die Futtertröge befindet sich Kükenpapier, damit die Küken schnell Futter finden und zu fressen beginnen. Wichtig sind Futtertröge, die man fluten kann. Das Futter kommt am Betrieb Henne von GS bio. In dem Aufzuchtstall ist eine Unterdrucklüftung mit Firstabluft im Giebel installiert. Nach 28 Tagen in der Aufzucht und einem Gewicht von fast 1 kg werden die Tiere mit Hilfe von Umstallboxen in den Maststall umgestallt. Nach einer Woche Servicezeit wird die Aufzucht wieder belegt.

Nach vier Wochen Aufzucht werden die ein Kilo schweren Tiere mit Hilfe von Boxen in den Maststall umgestallt.
Maststall mit Wintergarten
Im Maststall befindet sich eine Gleichdrucklüftung mit Firstabluft, wobei dennoch ein leichter Unterdruck gefahren wird. Zusätzlich wird über Dach-Zuluftkamine Luft in den Stall gedrückt. So wird gewährleistet, dass die Hähnchen auch bei offenen Luken keiner starken Zugluft ausgesetzt sind.
Fotos: Alpers

Die Mittelwand würde Kilian Henne heute so gestalten, dass sie nicht nur die Gruppen voneinander trennt, sondern auch Zugluft verhindert.
Im Maststall befinden sich ebenfalls zwei Gruppen mit je 4.800 Plätzen plus zwei Gruppen mit je 2.400 Plätzen. Sie haben 1.200 m² im Warmbereich zur Verfügung und zusätzlich 400 m² in einem Wintergarten, der isoliert ist und gemäß EU-Bio-VO als „zusätzlich überdachter Außenbereich“ auf die Besatzdichte angerechnet werden kann. Es sind max. 21 kg Lebendgewicht pro m² nutzbarer Stallfläche möglich. Sowohl im Aufzuchtstall als auch im Maststall befinden sich erhöhte Ebenen, die von allen Altersgruppen sehr gut angenommen werden. Bei einem Endgewicht von ca. 2,6 kg erfolgt die Schlachtung. Anschließend werden die Tiere bei Biofino zu Frischgeflügelspezialitäten und Convenience-Produkten verarbeitet.
Insgesamt beträgt der Wärmebedarf in den Ställen von Kilian Henne 850.000 kWh im Jahr. Laut dem Praktiker verstauben die Wärmetauscher stärker, je mehr Wärme benötigt wird. Hier müsse man an Umkehrlüfter denken, also Ventilatoren, die andersherum laufen können.
Tipps des Praktikers
Nach drei Jahren im Vollbetrieb hat Kilian Henne viele praktische Erfahrungen gewonnen. Vieles würde er wieder so bauen, einiges anders. Für die Leser der Naturland Nachrichten hat er seine Tipps zu 13 Punkten zusammengefasst:
1. Die Vorräume müssen groß genug sein, um beispielsweise Platz für die Fängertruppe zu bieten. Alternativen seien laut Henne ein Anbau oder ein separater Container, dann hat man diesen Umziehraum hygienisch noch mehr vom Bereich der Tiere abgegrenzt.

Auf den Futter- und Tränkelinien müssen Drähte gespannt sein, sonst koten die Tiere ins Futter.
2. Das Hygienekonzept muss gelebt werden. Henne wechselt beim Betreten des Gebäudes Schuhe und Kleidung und die Schuhe ein zweites Mal, wenn er den Stall betritt.
3. Heute würde Kilian Henne nur an einer Seite einen Wintergarten anbauen und nicht an beiden Seiten. Der Wintergarten könnte damit größer sein, so dass ein Radlader zum Entmisten mehr Platz hat. Plant man zwei Wintergärten, sollte es laut Henne im Stall eine Mittelwand geben, die nicht nur die Gruppen voneinander trennt, sondern auch verhindert, dass im Stall Zugluft entsteht.
4. Die Trennwände für die Abteilabgrenzung dürfen nicht zu schwer sein, Siebdruckplatten reichen aus und haben sich bewährt. Alternativ kann man auch Kunststofftrennwände wie in der Schweinehaltung verwenden. Die einzelnen Elemente dürfen jedoch nicht zu lang sein, um noch mit der Hand versetzt werden zu können.
5. Auf den Futter- und Tränkelinien müssen Drähte gespannt sein, sonst koten die Tiere ins Futter oder bringen beim Abspringen die Tränkelinie zum Schaukeln, was zu nasser Einstreu führt.
6. Futter, Tränken und erhöhte Ebenen sollten mit E-Winden versehen sein, das spart Kraft beim Hochkurbeln, was ja alle fünf Wochen notwendig ist.
7. Im Wintergarten verstaubt das Windschutznetz relativ schnell, besser sind Drahtgitter oder grobmaschiges Netz mit Wickelfolie.
8. Alle Aufkantungen im Stall müssen so breit sein, dass sie abschiebefähig sind, da dürfen Stützen oder Schienen von Luken nicht stören.
9. Zur besseren Reinigung müssen die Abtropfschalen der Abluft zum Runterkurbeln sein.
10. Es braucht Folien zum Abdunkeln des Stalls und Fanglicht oder zumindest sensibel dimmbares Licht, um die Tiere schonend fangen zu können.
11. Unerlässlich ist eine Sprühkühlung in Vor- und Endmast, weil dies neben Kühlung und aktiver Befeuchtung die Reinigung in der Serviceperiode erleichtert.
12. Der Vorplatzbeton vor dem Stall sollte salzfähig sein, damit die LKW auch im Winter gut fahren und wenden können.
13. In der Mast brauchen die Tiere 4 m²/Tier Grünauslauf. Der Betrieb hat einen Zaun gegen Raubtiere eingegraben, im unteren Bereich Kaninchendraht zusätzlich verwendet und eine Stromlitze gegen den Fuchs um den Zaun gespannt. Hier sollte man in der Vegetationsperiode alle drei Wochen mähen, um das Gras kurz zu halten.
Arbeitsbedarf planbar
Für die täglichen Routinearbeiten kalkuliert Kilian Henne 3,25 Arbeitsstunden pro Tag, das macht eine
Person. Hinzu kommen die Arbeitsspitzen wie Fangen und Waschen, bei denen externe Dienstleister helfen. Zum Misten und Waschen werden insgesamt ca. 50 Arbeitsstunden je Durchgang benötigt.
Auslauf ist Verbrauchertäuschung
Kilian Henne benennt die kommende Grünauslaufpflicht für Küken und Jungtiere im Aufzuchtstall als größtes Problem. Er könne das weder fachlich nachvollziehen, noch sei dies ökologisch und wirtschaftlich vertretbar. Einen Auslauf zu bauen, nur, weil die EU-Kommission die unveränderten Regelungen der EU-Öko-Verordnung nun so auslege, sei sogar Verbrauchertäuschung, so Henne: „Kein Tier wird in der Aufzucht den Auslauf nutzen und die damit höhere Heizenergie ist ganz und gar nicht ökologisch und nachhaltig.“ Dafür würden mehrere Hektar Ackerland zusätzlich aus der direkten Nahrungsmittelproduktion genommen und eine sechsstellige Investitionssumme in Beton und Stahl versenkt, ohne, dass dies den Tieren etwas nütze, so der Naturland-Bauer. Andere Berufskollegen sähen ihre betriebliche Existenz bedroht, da aufgrund begrenzter räumlicher Gegebenheiten viele Betriebe überhaupt keinen Auslauf bereitstellen könnten. Dies führe zu einer starken Reduktion der Produktionsmenge von Bio-Hähnchenfleisch. Aber auch die Bio-Putenkollegen seien von diesem „Irrsinn“, so Henne, betroffen. Er hofft auf die Erkenntnis der beteiligten Politiker und Verwaltungsmitarbeiter in Brüssel, damit diese Auslegungsänderung wieder zurückgenommen wird.


WINTERHAFER
Die Nachfrage nach Hafer ist groß, gleichzeitig nehmen die Anbaurisiken im Frühjahr zu. Eine Alternative ist Winterhafer – zumindest auf leichten Standorten.
Trockenheit, Hitze, Starkregen - Starkwetterereignisse lassen den Ackerbau immer mehr zur Herausforderung werden - zweifellos nehmen die Anbaurisiken zu. Sie können jedoch auch eine Chance sein, in der Fruchtfolge neue Kulturen zu integrieren, die mit der veränderten Witterung besser zurechtkommen. Prinzipiell ist zu empfehlen, nicht alles
auf eine Karte zu setzen – ein vielfältiger Anbau der Kulturen kann mögliche Extreme abpuffern.
Sommerungen sind in den letzten Jahren bei Frühjahrs- bzw. Sommertrockenheit immer mehr zu Verlierern geworden, so dass viele Betriebe deren Anbauwürdigkeit in Frage stellen. Total-
ausfälle bei Körnerleguminosen oder schlechte Qualitäten der Sommergetreide, z.B. geringe Hektolitergewichte bei Hafer, waren keine Seltenheit.
Hafer ist gesucht
Gerade Hafer ist ein Trendgetreide - aufgrund der ernährungsphysiologischen Vorzüge
hat die Nachfrage nach Speisehafer in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ballaststoff- und proteinreiche Ernährung liegt im Trend, ebenso sind Unverträglichkeiten (z.B. Gluten) immer mehr ein Thema in der heutigen Ernährung. Neben den altbekannten Haferflocken ist Hafer inzwischen auch Grundlage von vielen Pflanzendrinks. Dazu werden Haferpartien mit hohem Hektoliter-Gewicht (in der Regel >54 kg/hl) sowie einer guten Schälausbeute bei geringem Spelzanteil benötigt. Hier kann die Winterform des Hafers gerade in frühjahrstrockenen Lagen punkten, da die Winterfeuchtigkeit durch das schon vorhandene Wurzelsystem besser aufgenommen und in Wachstum umgesetzt werden kann; somit kann Winterhafer in frühjahrstrockenen Lagen durch den Vegetationsvorsprung auch besser ein ausreichendes Hektolitergewicht erreichen.
Anbau hat Tücken
Leider ist die Winterform durch seine begrenzte Winterhärte nicht für alle Anbaulagen geeignet. So können Kahlfröste ab minus zehn Grad schon zu Schäden führen und ab minus 15 Grad können sich deutliche Auswinterungsschäden zeigen. Auch
durch Wechselfröste im zeitigen Frühjahr mit kalten Nächten und warmen Tagen können noch Schäden erfolgen. Die Winterhärte hängt dabei auch von zusätzlichen Stressfaktoren ab, mit denen der Winterhafer möglicherweise zu kämpfen hat. So

AUTORIN Leah Hornung
Beratung für Naturland l.honrung@ naturland-beratung.de

Der Erntezeitpunkt von Winterhafer ist in er Regel ein bis zwei Wochen nach der Wintergerstenernte.
kann mit einer ausgewogenen Kaliversorgung die Winterhärte unterstützt werden; umgekehrt können Verdichtungen, zum Beispiel in Fahrspuren oder am Vorgewende, die Auswinterung begünstigen. Bei der Sortenwahl gibt es ebenfalls Unterschiede bei der Winterhärte, so dass in gefährdeten Lagen über weni-
ger anfällige Sorten Einfluss genommen werden sollte.
Gesät wird Anfang bis Mitte Oktober mit einer Aussaatstärke von 300 bis 330 keimfähigen Körnern/m². Eine zu frühe Aussaat kann die Winterhärte herabsetzen. Die Aussaattiefe liegt wie bei Sommerhafer bei 4-5

Sie suchen Winterhafer auf den Feldtagen? Den und vieles mehr finden Sie bei uns!
Fotos:
Agrarfoto

Winterhafer wird Anfang bis Mitte Oktober mit einer Aussaatstärke von 300 bis 330 keimfähigen Körnern/m² gesät. Die Aussaattiefe liegt bei 4-5 cm.
„Winterhafer kann vor allem in frühjahrstrockenen Lagen punkten.“
cm. Bei der Aussaat ist auf eine gute Rückverfestigung zu achten. Für eine Mischung mit Wintererbse oder Winterackerbohne ist der Winterhafer durch die relativ frühe Abreife nicht geeignet.
Auch im Frühjahr muss man Geduld beweisen, da das Wachstum im Frühjahr sehr langsam voranschreitet. Gerade auf kalten und langsam erwärmbaren Böden sollte deswegen kein Anbau erfolgen, da dort die Frühjahrsentwicklung standortbedingt schon verzögert ist. Das Längenwachstum findet
meist erst im April/Mai statt, so dass bis dahin der Bestand wenig Konkurrenzkraft bietet und entsprechend „sauber“ gehalten werden muss. Dabei sollten schon im Herbst ausreichende Striegel-Maßnahmen gesetzt werden, im Frühjahr kann Striegeln einen positiven Effekt auf das Wachstum durch Belüftung und Bestockungsanregung haben. Jedoch kann eine zu hohe Striegel-Intensität im Frühjahr auch Wachstumsverzögerung bewirken, die dann noch zusätzlich die Konkurrenzkraft beeinträchtigt.
10 TIPPS
1. Anbau auf zugigen Lagen wegen der erhöhten Auswinterungsgefahr vermeiden.
2. Kalte und schwer erwärmbare Böden im Anbau von Winterhafer ausschließen.
3. Problemstandorte mit Ackerfuchsschwanz meiden.
4. Aussaatzeit: Anfang bis Mitte Oktober; zu frühe oder zu späte Saat kann die Auswinterungsgefahr aufgrund einer übermäßigen oder zu schwachen Vorwinterentwicklung verstärken.
5. Saattiefe: 4-5 cm; auf ein rückverfestigtes Saatbeet achten, Verdichtungen vermeiden.
6. Saatstärke: 300-330 Kö /m² (zu dichte Bestände neigen zu geringem Hektolitergewicht).
7. Gesundungsfrucht: auch Winterhafer ist keine Wirtspflanze von Schwarzbeinigkeit und Halmbruch und hat einen guten Vorfruchtwert.
8. Eine leichte Düngegabe von 5060 kg N/ha im Frühjahr wirkt sich positiv auf die Entwicklung aus.
9. Das Striegeln im Herbst einplanen.
10. Ernte: In der Regel ein bis zwei Wochen nach der Wintergerstenernte.
ROLLHACKEN GEGEN UNKRAUT UND KRUSTEN
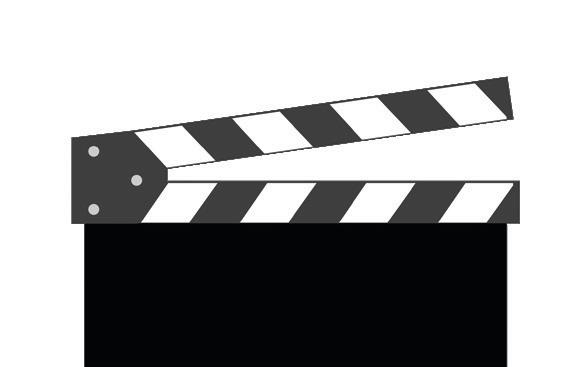

Hier geht’s zum Video!
Die Rollhacke findet man immer öfter auf landwirtschaftlichen Betrieben – egal ob bio oder konventionell. Der Grund: Neben der Unkrautbekämpfung liegt ihre Stärke vor allem im Aufbrechen von Krusten.
AUTOR
Roman Goldberger
Beratung für Naturland
Ackerbauexperte Stefan Veeh von der Beratung für Naturland kennt alle gängigen Fabrikate von Rollhacken. Er weiß, worauf beim Kauf zu achten ist und berichtet darüber in einem neuen Video, zu sehen im YouTube-Kanal von Naturland (siehe QR-Code). Am 12. Juni startet zudem auch der neue Podcast „Wir Bio-Bauern“ von der Beratung für Naturland. Auch hier diskutiert Stefan Veeh ausgiebig über die Einsatzmöglichkeiten der Rollhacke.
Die Funktionsweise von Rollhacken ist einfach. Die rotierenden Sterne der Rollhacke dringen durch die Vorwärtsbewegung des Traktors löffelfingerartig in den Boden ein. Die Hacklöffel sind dabei so konzipiert, dass sie bei richtigem Einsatz kaum Pflanzenverlust verursachen. Sie können den Boden aufbrechen, auflockern und belüften, indem sie mit ihren
VARIOFIELD DER INDIVIDUELLE

löffelförmigen Sternspitzen Erde hochschleudern. Dabei werden kleine Unkrautpflanzen ausgerissen.
Da die schweren Erdteile rascher auf den Boden fallen, liegt das Unkraut obenauf und vertrocknen im lockeren Erdmaterial.
Gerade bei verkrusteten Wintergetreide-Böden im Frühjahr kann die Rollhacke den Striegel hervorragend ergänzen. In der Praxis wird oft einige Tage nach der Rollhacke eine zweite Überfahrt mit dem Striegel durchgeführt. Das hat dann eine sehr gute Unkrautwirkung. Die Rollhacke ist aber auch in Reihenkulturen einsetzbar. Ein großer Vorteil ist die hohe Flächenleistung - aber dazu mehr in Video und Podcast.
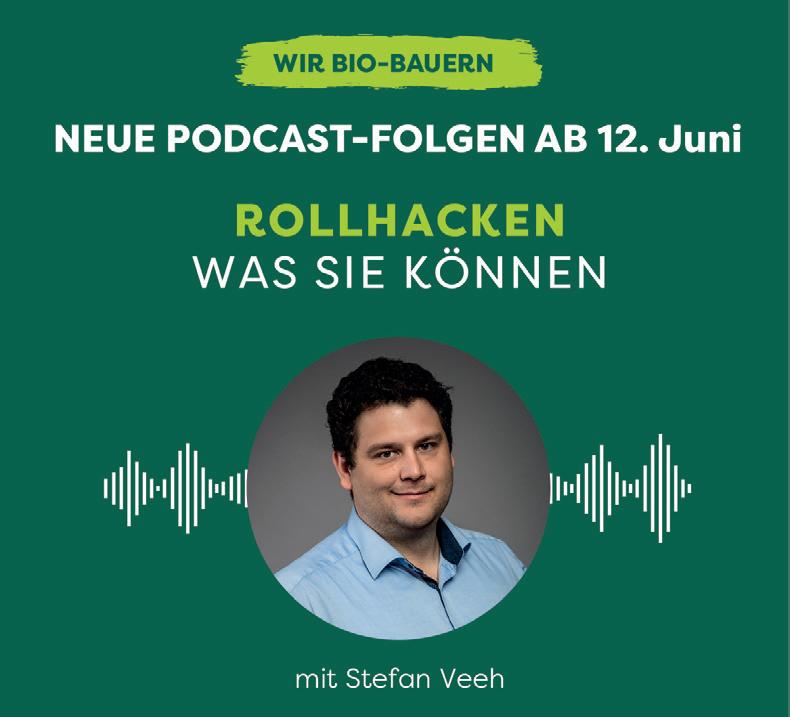
www.naturland-beratung.de/podcast
Der Variofield bietet eine universelle Lösung für alle Arten und Reihenweiten des Hackeinsatzes.
• Zweibalkiges Rahmensystem
• Versetzter Klappstoß Auswahl verschiedener Module
• Jede Reihenweite realisierbar
• Eigene Scharform
NEUE ROGGEN-POPULATION Artemis
Naturland-Mitarbeiter
Werner Vogt-Kaute hat eine neue Roggen-Populationssorte gezüchtet. Ertraglich war sie im ersten Versuchsjahr ganz oben dabei.
Artemis heißt die neue Roggenpopulation, sie wurde im Winter vom Bundessortenamt als sogenanntes „Ökologisch Heterogenes Material“ zugelassen. So werden Populationen auch in der EU-Bio-Verordnung genannt. Gezüchtet haben wir die Population auf meinem Hof, entsprechend groß war die Freude über die Zulassung. Nur der Name musste geändert werden. In den Öko-Landessortenversuchen 2024 in Bayern hatte die Population noch den Namen Hades. Sie baut auf die ältere Population Dodo auf, die um einige Kreuzungspartner erweitert wurde.

AUTOR
Werner Vogt-Kaute
Beratung für Naturland w.vogt-kaute@ naturland-beratung.de
Eigenschaften der neuen Population
Artemis ist etwas langstrohiger als die meisten Populationssorten, was in der Unkrautunterdrückung helfen kann. Die Fallzahlen sind im leicht unterdurchschnittlichen Bereich, was von Mühlen teilweise gewünscht wird. Zur endgültigen Beurteilung der Krankheitsresistenzen und -toleranzen liegen aber noch zu wenige Ergebnisse vor.
Was Populationssorten sind
Bei einer Population ist jede Pflanze genetisch unterschiedlich. Das ist das komplette Gegenteil zur „reinen“ Sorte eines Selbstbefruchters wie Weizen, bei dem jede Pflanze genetisch exakt gleich ist. Roggen ist aber als Fremdbefruchter nie ganz so homogen wie ein Selbstbefruchter. Daher spricht man bei Roggensorten in der Regel von Populationssorten.
Keine Nachbaugebühren fällig
Die Vermarktung von Artemis läuft mit einer sogenannten open-source Lizenz. Es besteht daher kein Sortenschutz. Das heißt: Der Nachbau ist zulässig. Nachbaugebühren werden nicht erhoben, allerdings wird das Z-Saatgut von Artemis etwas teurer verkauft, um Erhaltungsund Neuzüchtung zu finanzieren. Es darf sogar Saatgut an andere Landwirte abgegeben werden – einzige Bedingung ist, dass jeder Käufer bestätigen muss, die Population oder de-

Die neue Populationssorte Artemis zeigt im ersten Versuchsjahr gute Ergebnisse. Zudem sind keine Nachbaugebühren fällig.
ren Nachkommen nicht selbst mit Sortenschutz oder Patenten anzumelden. Zur Info: Auch eine „normale“, reine Sorte könnte mit einer open-source Lizenz vermarktet werden. In der Praxis ist dies aber äußerst selten der Fall.
Population soll sich an Standort anpassen
Der Sinn einer Population ist sogar, dass sie nachgebaut werden soll und sich damit an den Standort anpasst – sich also die Typen durchsetzen, die zum Standort passen. Dabei ist möglicherweise ein Vorteil, dass Artemis auf relativ schwachen Böden unter ökologischen Bedingungen gezüchtet wurde. Ob eine Sorte, die auf guten Böden mit hohem Input gezüchtet und selektiert wurde, dagegen auch auf schwachen Standorten unter nährstoffarmen Verhältnissen überzeugt, ist vermutlich eher fraglich. Speziell Roggen muss sich mit den geänderten Witterungsbedingungen durch den Klimawandel auseinandersetzen. Feuchte Winter ohne starken Frost ge-

fallen ihm nicht so gut. Auf der anderen Seite kommt er mit trockenen Bedingungen gut zurecht. Eine genetisch breit aufgestellte Population könnte da vielleicht eine Anpassungsstrategie sein.
Grundsätzlich gibt es aktuell weder mit der Züchtung, noch mit dem Anbau von Populationen viel Erfahrung, da erst sehr wenige am Markt sind, die meisten bei Weizen oder Mais. Ob es den Vorteil der Anpassungsfähigkeit tatsächlich gibt, muss sich über die Jahre zeigen. In der Umweltstabilität haben die bisherigen Populationen gegenüber auf vielen Standorten selektierten reinen Sorten bisher noch keine durchschlagenden Vorteile gebracht. Es gibt auch Fälle, in denen der Anbau einer einheitlichen Sorte sinnvoller sein kann, zum Beispiel sollten Salatköpfe bei der Ernte vermutlich ähnlich aussehen. Für eine bäuerliche Züchtung bedeutet eine Population aber, dass nicht auf die extreme Homogenität der Pflanzen geachtet werden muss. Das erleichtert den Aufwand in der
Selektion erheblich. Es reicht, unerwünschte Pflanzen zu beseitigen.
Ertraglich top
In den Ergebnissen der bayerischen Öko-Landessortenversuche war Artemis 2024 bei den Populationssorten ertraglich ganz oben dabei. Das überraschte selbst mich. Ich hoffe natürlich, dass sich die guten Ergebnisse fortsetzen. Es wird aber nicht die letzte Kreuzung sein. Bei Roggen ist es – anders als bei anderen Kulturen – nicht zu schwer, Kreuzungspartner zu finden, da die konventionelle Züchtung auch brauchbare Sorten für den Öko-Landbau entwickelt.
TIPP
Im Sommer 2025 wird Öko-Saatgut über die Natur-Saaten und die Marktgesellschaft der Naturland Betriebe AG in begrenzter Menge erhältlich sein.

AUTOR
Max Schmidt
Kalk- und Bodenspezialist schmidt@boden-max.de

Kalk
fördert Humusaufbau
Wer seine Böden verbessern will, sollte den Kalkgehalt in Ordnung bringen. Denn Humusaufbau und Bodengare sind direkt von pH-Wert und Calciumgehalt abhängig.
Freien Kalk können Sie mit Zitronensäure oder verdünnter, 10%iger Salzsäure selbst feststellen. So schäumt ein Boden mit freiem Kalk.
Der Mediziner Albrecht Daniel Thaer (1752-1828) gilt als Begründer der Agrarwissenschaften. Auf seinem Gut Möglin bewies er als Anhänger der Humustheorie, dass verarmte Böden mit dem Einsatz von Tonmergeln, organischer Düngung und dem Anbau von Leguminosen wieder fruchtbar werden. Der Mergel aus den Gruben in Möglin hatte einen Kalkgehalt von 15 bis 22 % CaCO3, sowie viele wertvolle Tonminerale; es wurden Mengen von bis zu 150 t/ ha aufgebracht. Thaer konnte mit dieser Methode die Erträge vervielfachen. Sein Schüler Philipp Carl Sprengel erweiterte das damalige Wissen im Pflanzenbau mit seiner Erkenntnis, dass mineralische Nährstoffe für Pflanzen essenziell sind. Justus von Liebig entwickelte daraus die Nährstofftheorie, welche von der aufkommenden Düngerindustrie zum alles bestimmenden Faktor bei der Ertragsbildung gemacht wurde. Durch die finanzielle Unterstützung der Industrie stand in Wissenschaft und Lehre die mineralische NPK-Düngung ganz vorne auf der Agenda. Es wurde der Eindruck erweckt, dass ein Mehr an Düngung immer auch höhere Erträge bedeutete. Mit Schlagwörtern wie „Reiche Väterarme Söhne“ oder „Kalk baut den Humus ab“ wurden Kalkung in eine Schmuddelecke gedrängt und die Bauern verunsichert. Der Ökologische Landbau ist hingegen die Fortführung der guten ackerbaulichen Traditionen von Daniel Thaer. Erfolgreiche Öko-Betriebe achten auf eine standortangepasste Kalkung und erhalten dadurch ihre Bodenfruchtbarkeit in Verbindung mit organischer Düngung und Leguminosenanbau.
Wie geht Humusaufbau?
Es ist unbestritten, dass mehr und vor allem besserer Humus die Bodenfruchtbarkeit sehr positiv beeinflussen kann. Humus besteht aus Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N) und enthält noch die Nährstoffe Phosphor und Schwefel. Auf kalkreichen Böden mit schwach sauren bis neutralen pH-Werten (pH 6-7,5) werden wertvolle, nährstoffreiche Huminstoffe mit einem C:N-Verhältnis von ca. 10:1 gebildet, welche viele Nährstoffkationen (Ca, K, Mg) austauschbar speichern. Beim Humusaufbau werden so Nährstoffe gebunden und gespeichert, welche bei der Mineralisierung (Abbau) in der Vegetationszeit wieder an Bodenlösung und Pflanzen abgegeben werden. Auf sauren Böden dagegen bildet sich ein nähr-

stoffarmer Humus mit einem sehr weiten C:N-Verhältnis, geringer Kationenspeicherung und hydrophoben (wasserabstoßenden) Eigenschaften.
Humus und Bodengare
Die mineralischen Anteile Sand, Schluff und Ton in unseren Böden sind gegeben. Veränderbar sind jedoch Kalk-, Humus und Nährstoffgehalt der Böden. Humus verbessert das Bodengefüge und damit den Luft- und Wasserhaushalt der Böden; seine Menge und Qualität wird sehr stark vom Kalkgehalt der Böden geprägt. Böden mit einer natürlichen Gare lassen das Wasser bei Regen in den Grobporen versickern, welches von den mittleren Poren pflanzenverfügbar gespeichert wird. Für Franz Sekera (1899 – 1955), einen österreichischen Bodenforscher, ist das durch die Lebendverbauung geschaffene Krümelgefüge das Ziel aller Bodenkulturmaßnahmen. Sekera betont ausdrücklich, dass vom Bodenleben (vor allem von Regenwürmern) nur Aggregate aus Ton-Humuskomplexen zu Krümeln verbaut werden können, bei denen das zweiwertig positive Ca++ die negativ geladenen Kolloide Ton und Huminstoffe zu wasserstabilen Aggregaten verknüpft. Wer seine Böden verbessern will, sollte demnach vor dem Anbau von Zwischenfrüchten, Leguminosen und organischer Düngung bei Bedarf den Kalkgehalt seiner Böden in Ordnung bringen.

Humusbindungsformen in Abhängigkeit vom pH-Wert
Relative contribution (%)
Oben: Aufgeschlämmter Boden ohne Kalk links, rechts mit Kalk geflockter Boden mit deutlich höherem Volumen und klarer darüberstehender Flüssigkeit.
Unten: Eine Erhaltungskalkung mit 2 - 4 t. kohlensaurem Kalk ist bei Böden ohne freien Kalk vor Leguminosen immer ratsam.

In sauren Böden <pH 5 unter Nadelwald komplexiert der C mit Eisen- und Aluminiumionen zu humusreicher Orterde. Wegen Kalziummangel und Al-Toxizität ist auf solchen Böden eine landwirtschaftliche Nutzung unmöglich. In einem pH-Bereich von 5 – 6 kann C an Mineraloberflächen (SRO) andocken und sich so der Oxidation entziehen. Leichtere landwirtschaftlich genutzten Böden haben jedoch in diesem pH-Bereich selten ein stabiles Krümelgefüge. Ab einem pH von > 6 übernehmen Calcium und Tonminerale die C-Fixierung, welche ab pH 7 fast gänzlich von den geflockten Kalk-Ton-Humuskomplexen übernommen wird. In den Mikroaggregaten dieser stabilen Komplexe wird der Humus am sichersten vor dem restlosen Abbau geschützt.
Die Humusforschung in den letzten Jahrzehnten hat die Thesen von Sekera größtenteils bestätigt und um neue Erkenntnisse erweitert. In unserem gemäßigt feuchten Klima wird der Kohlenstoff C bei ausreichend Sauerstoff in der organischen Masse im Rahmen der „Mineralisierung“ vom Bodenleben komplett zu CO2 oxidiert; gleichzeitig werden Nährstoffe für das pflanzliche Wachstum freigesetzt. Wie C im Boden angereichert werden kann, hat Rasmussen, ein amerikanischer Bodenkundler, in einer Grafik leicht verständlich dargestellt.
Kalkdünger
und Gips für fruchtbare Böden
Humusaufbau, Bodengare, Luft- und Wasserhaushalt sind direkt vom pH-Wert und dem Calciumgehalt der Böden abhängig. Im Öko-Landbau sind Kalkdünger wie kohlensaurer Kalk (mit und ohne Magnesium) und Carbokalk zugelassen. Sie liefern Calciumionen und sind in der Lage, saure Wasserstoffionen zu neutralisieren und dadurch den pHWert im Boden zu regulieren. Ein Blick in Ihre letzte Bodenuntersuchung zeigt, ob Ihre Böden kalkbedürftig sind und wieviel Kalk sie gegebenenfalls brauchen. Die Kalkmenge ist in „dt. CaO/ha“ angegeben und bedeutet, dass Sie bei kohlensaurem
Fotos: Goldberger, Schmidt
Grafik: Rasmussen et al., 2018 www.boden-max.de
Kalk die doppelte und bei Carbokalk die drei- bis vierfache Menge geben müssen. Eine Erhaltungskalkung mit 2 - 4 t kohlensaurem Kalk/ha ist bei Böden ohne freien Kalk vor Leguminosen immer ratsam. Freien Kalk können Sie mit verdünnter, 10%iger Salzsäure oder Zitronensäure selbst feststellen.
Neben Kalk ist auch Gips ein interessanter Calciumund Schwefeldünger. Gips (CaSO4) ist sowohl als erdfeuchter Naturgips gemahlen (21 % Ca, 15 % S) erhältlich, aber auch granuliert (28 % Ca, 20 % S) verfügbar. Gips hebt im Gegensatz zu Kalk den pHWert nicht an und löst sich im Bodenwasser in einer Menge von 2 g/l; das ist ideal für die kontinuierliche Versorgung des Pflanzenbedarfs und minimiert die Auswaschungsverluste. Das wasserlösliche Ca++ kann sofort Ton- und Humuskolloide flocken und die Bodenstruktur stabilisieren. Die Aufwandmenge richtet sich nach dem Schwefelbedarf der Kultur und kann bei Leguminosen mit 60 – 100 kg S/ha so bemessen werden, dass das nachfolgende Getreide noch davon profitiert. Grünland braucht jährlich
Kurz & knapp
Humusaufbau und Bodengare sind direkt von pHWert und Calciumgehalt der Böden abhängig. Auf kalkreichen Böden mit schwach sauren bis neutralen pH-Werten (pH 6-7,5) werden wertvolle, nährstoffreiche Huminstoffe mit einem C:N-Verhältnis von ca. 10:1 gebildet, welche viele Nährstoffkationen (Ca, K, Mg) austauschbar speichern. Bei der Mineralisierung in der Vegetationszeit werden diese wieder an Bodenlösung und Pflanzen abgegeben. Eine Erhaltungskalkung mit 2 - 4 t kohlensaurem Kalk/ha ist bei Böden ohne freien Kalk vor Leguminosen immer ratsam. Freien Kalk können Sie mit verdünnter, 10%iger Salzsäure oder Zitronensäure selbst feststellen.
etwa 40 kg S/ha. Bei den geringen Aufwandmengen von 200 - 500 kg/ha hat granulierter Gips klare Vorteile gegenüber erdfeuchter Ware.
MACHEN SIE IHREN BODEN UND IHRE PFLANZE FIT MIT DÜNGEGIPS
Unsere Naturgipse liefern wertvolles, wasserlösliches und sofort verfügbares Calcium, sowie schnell und sicher wirkenden Sulfat-Schwefel.

GranuGips®
GEKÖRNTES SPITZENPRODUKT
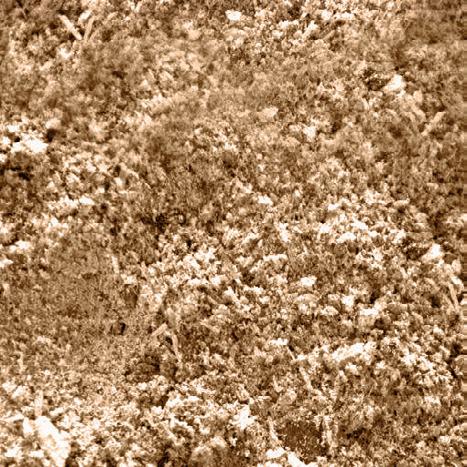
Rotgips® LOSES FEINKORN
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Stabilisiert die Bodenstruktur dank wertvollem Calcium
Schnell und sicher wirkende Schwefeldüngung durch Sulfat-Schwefel
Optimiert die Stickstoffaufnahme der Pflanzen
ANZEIGE
IHR NATURGIPSDÜNGERPRODUZENT NR. 1
Vertrauen Sie auf Qualität und Erfahrung!

Alle Naturgipse stammen aus unserem Haus und sind für die ökologische Landwirtschaft zugelassen.

www.gfr-mbh.com
E-Mail: duenger@gfr-mbh.com
Telefon: 0931 900800
BESUCHEN SIE UNS AUF DEN
Öko-Feldtagen

Die Öko-Feldtage 2025 finden am 18. und 19. Juni auf dem Wassergut Canitz in Sachsen statt. Naturland freut sich gemeinsam mit der Marktgesellschaft der Naturland Bauern und den Natur-Saaten auf Ihren Besuch.
Sonderfläche Beregnungstechnik, dem Treffpunkt WasserGut sowie an vielen Ständen der Ausstellenden.
30 Öko-Sorten
Beratung
Die Öko-Feldtage sind das bedeutendste Event für Innovationen im Öko-Landbau und für eine nachhaltige Landwirtschaft. Dieses Jahr findet die Messe erstmals in Mitteldeutschland statt, auf dem Wassergut Canitz. Das Fokusthema Wasser zieht sich durch alle Angebote der Öko-Feldtage: in den Fachforen, bei den Führungen, der
Naturland ist mit seinen Partnern an drei Ständen im Innenund Außenbereich vertreten. Sie finden uns auf der Außenfläche B 4.1 gemeinsam mit der Marktgesellschaft und den Natur-Saaten. Die Natur-Saaten GmbH ist mit 30 Öko-Sorten vertreten, davon neun Neuzulassungen. Mitgebracht wird zum Beispiel Kosima, eine neue, ökowertgeprüfte Braugerste mit top Eigenschaften und Qualitäten. Entsprechend dem Fokusthema Wasser sind auch die für Regionen mit Frühjahrestrockenheit geeigneten Sorten Mandarin (Winterweizen), Bonjour (Wintertriticale) und Eagle (Winterhafer) interessant.
In der Ausstellungshalle am Stand D 1.9 freuen sich weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratung für Naturland, der Marktgesellschaft der Naturland Bauern sowie des Naturland-Verbands auf einen Austausch mit Ihnen. NaturlandPartner REWE ist mit unserer Café-Bar am Stand B 4.5 vertreten. Die Beratung für Naturland ist mit regionaler und fachlicher Expertise vor Ort für Sie da. In mehreren Foren werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratung für Naturland und der Natur-Saaten GmbH Vorträge zu aktuellen Themen halten (siehe Tabelle.)
Weiteres Angebot
Insgesamt finden Sie auf den Öko-Feldtagen über 330 Ausstellende mit der ganzen Palette an
Naturland-Vorträge auf den Öko-Feldtagen
Titel
Futterleguminosen im Klimawandel: Herausforderungen und Strategien für den Ackerfutteranbau
Wasser sparen, Boden schützen! Strategien für zukunftsfähiges Wassermanagement
Führung: Sorten aus dem NaturSaaten Portfolio
Podiumsdiskussion: Klimaanpassung in der Landwirtschaft –Wasserhalten & Landschaftsgestaltung mit Agroforst, Keyline & Förderprogrammen
Produkten und Dienstleistungen. Davon allein über 70 Ausstellende aus dem Bereich Landtechnik und Smart Farming. Es erwarten Sie über 650 Demonstrationsparzellen – von der Ackerbohne bis zur Zuckerrübe – und 42 moderierte Maschinenvorführungen: Gezeigt werden Maschinen zur
Referentinnen
Irene Jacob (Beratung für Naturland) Charlotte Kling (HNEE)
Philip Köhler (Beratung für Naturland); Alexander Watzka (Bioland)
Michael Konrad, (Natur-Saaten GmbH)
Wolfgang Patzwahl (Beratung für Naturland); Leon Schleep (BaumLand FöbL); Janos Wack (Triebwerk)
Datum, Uhrzeit Wo?
18.06.; 11:00 – 11:45 Uhr
Forum Pflanze, Ressource & Wasser
18.06.; 17:00 – 17:45 Uhr Forum Pflanze, Ressource & Wasser
18. und 19.06; 12:00 - 12:30 Uhr B 4.1
18.06.; 10:00 – 10:45 Uhr Forum Zukunftsdialog
flachen Bodenbearbeitung sowie Striegel, Hacken und Maschinen zur Futterbergung. Außerdem sind Lösungen zur autonomen Landtechnik sowie Sonderflächen zu wasserschonenden Beregnungstechniken und zum Thema Traktion und Bodenschutz zu besichtigen.
Austausch
Diese Highlights und weitere Angebote bieten Ihnen die Möglichkeit, innovative Techniken und Produkte kennenzulernen und sich mit Fachkollegen und -kolleginnen auszutauschen und zu vernetzen.
pHom-Norway: Der 100% natürliche Pansenpuffer
Wie bewältigt die Kuh scharfe Silagen, schnell verdauliche Rationen und Hitzestress mit dem Risiko der Pansenübersäuerung und anderen Faktoren, die zu „weniger Power im Pansen” führen? Wie stabilisieren Sie Ihre Milchproduktion?
pHom puffert den Pansen und gibt ihm die Power zurück.
pHom-Norway besteht aus 100 % natürlichen Meeresmineralien. pHom ist FIBL gelistet und gibt dem Pansen langfristig Power. Dies gibt zusätzliche Sicherheit und ein nachhaltiges Ergebnis:
Mehr Milch mit optimalem Fett- und Proteingehalt je Kilo Trockenmasseaufnahme
Reduziert das Risiko einer Pansen Übersäuerung
Langfristig ein stabiler pH-Wert im Pansen (pH 5,8 - 6,2)
Unterstützt die Fermentation von Energie und Fasern
Funktioniert bei jedem Wiederkäuer und jeder Ration an 365 Tagen im Jahr
PANSENÜBERSÄUERUNG VERHINDERN
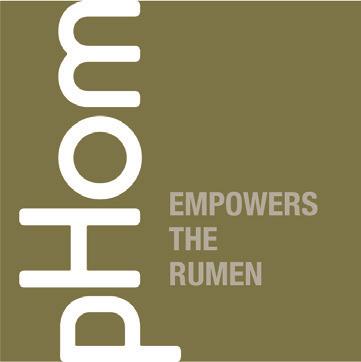
übersäure
Dosierung in der TMR: 50 - 80 Gramm/Kuh/Tag während der Laktation 100 - 120 Gramm/Kuh/Tag bei Hitzestress 10 - 20 g/Tier/Tag für Kälber, Schafe & Ziegen
Ersetzt Natriumbikarbonat 2:1 und Kreide 1:1. Beachte das Gleichgewicht von Kalium (K) und Natrium (Na): - Na-Gehalt 0,35 – 0,5% der TM - Ka: Na 3,5 – 5:1
Distribution Deutschland Behn Meyer Europe GmbH I Ballindamm 1 I 20095 Hamburg, Deutschland T +49 (0) 40 30299 305 I agrar@behnmeyer.de I www.PHOM-NORWAY.COM
ANZEIGE

Naturland INFO
BIO-WARENBÖRSE
Verkaufe pflanzliche Produkte/ Futtermittel
Heu und Heulage Rundballen; Inge Behrendt; 21710 Engelschoff; Tel.: 04144 8859
Ackerbohnen im BigBag; Thorsten Gröb; 35274 Kirchhain; Tel.: 06422 8500038
Sommerwicken; Wolfgang Ruch; 36277 Schenklengsfeld; Tel.: 0172 5356733
Futterhafer Sorte Asterion, A-Ware; Bernd Rose; 37647 Brevörde; Tel.: 0179 2422823
Körnermais 2024; Heinrich Ramme; 38539 Ettenbüttel; Tel.: 05375 348
6 Rundballen Kleegras Heu; Josef Freitag; 48163 Münster; Tel.: 02536 8528
Heuballen Ernte 2024; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Stroh in Rundballen 1,65 m Durchmesser; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Miscanthus für Hühnereinstreu, Pferde; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Kleegrassilage Rundballen ca. 100 St., gute Qualität; Wolfgang Schudt; 63825 Schöllkrippen; Tel.: 06024 9233
Heu-Quaderballen (1. Schnitt 2024, heißluftgetrocknet); Georg Sollinger; 83052 Bruckmühl; Tel.: 0151 54600856
Silage Ballen 4. Schnitt; Gerhard Schroll; 83132 Pittenhart; Tel.: 08624 829336
Heu 1.Schnitt von 2024; Peter Zwingler; 83530 Schnaitsee; Tel.: 08628 279
Sehr schönes unverregnetes Bio-Grummet (2. Schnitt) in Rundballen; Josef Stumböck; 83627 Warngau-Wall; Tel.: 08021 901614
Soja; Konrad Mauerer; 84332 Hebertsfelden; Tel.: 08728 1698
Wiesenheu; Josef Reif; 85402 Kranzberg; Tel.: 0172 5984821
Heu 2024; Klaus Gerst; 85435 Erding; Tel.: 0179 7042455
Heu 1. Schnitt; Bernadette Lex; 85461 Bockhorn; Tel.: 08122 4477
Heu, 1. Schnitt; Brandmair; 85737 Ismaning; Tel.: 0178 1562404
Mais, Körnermais A-Ware; Johann Tremmel; 86453 Dasing-Rieden; Tel.: 08205 266
Heu; Robert Wüst; 86753 Möttingen; Tel.: 0177 4740093
Grassilage - gehäckselt; Angerhof; 88167 Grünenbach; Tel.: 0171 7061465
Luzerneheu oder Cobs heißluftgetrocknet 1.Schnitt 2025; Burger; 92358 Seubersdorf; Tel.: 0160 92058074
Sojaöl; Andreas Giedl; 92548 Schwarzach; Tel.: 0176 24409950
Verkaufe Zucht- oder Nutzvieh Angus Deckbullen; Inge Behrendt; 21710 Engelschoff; Tel.: 04144 8859
Schwarzköpfiges Fleischschaf (SKF): Deck-Böcke; Beate Künneke; 33165 Lichtenau; Tel.: 05295 8015
35 Bocklämmer - 60 Schafe; Thorsten Gröb; 35274 Kirchhain; Tel.: 06422 8500038
Wagyukreuzungen; Lahnert; 55430 Oberwesel-Langscheid; Tel.: 06744 1057
Wagyubulle; Lahnert; 55430 Oberwesel-Langscheid; Tel.: 06744 1057
20 Jungziegen aus Ziegenmilchbetrieb, 6-9 Monate alt; Wolfgang Schudt; 63825 Schöllkrippen; Tel.: 06024 9233
Jungziegen-Böcke BDE und WDE aus Herdbuchzucht; Wolfgang Schudt; 63825 Schöllkrippen; Tel.: 06024 9233
Ziegenlämmer Bunte und Weiße deutsche Edelziege ml. u. wbl.; Wolfgang Schudt; 63825 Schöllkrippen; Tel.: 06024 9233
Angus Jungbullen zur Zucht rot und schwarz; Lothar Kempfle; 89312 Günzburg; Tel.: 0170 6341650
Angus Färsen deckfähig oder tragend; Lothar Kempfle; 89312 Günzburg; Tel.: 0170 6341650
Biete Sonstiges
Leindotter; Kerstin Böhme; 1744 Dippoldiswalde; Tel.: 0172 7052589
Weitere Anzeigen finden Sie im Internet unter www.biowarenboerse.de. Dort können Sie auch Ihre Anzeige schalten oder telefonisch bei Regina Springer unter Tel: +49 (0)8137 6372-912.
Süßkartoffeln Ernte 2024; Heinrich Ramme; 38539 Ettenbüttel; Tel.: 05375 348
Kiwibeerensaft; Ingo Ehrenfeld; 74239 Kochersteinsfeld; Tel.: 0176 23603296
Gelbsenf Sorte Martigena 2,6 Tonnen; Matthias Heider; 86657 Bissingen; Tel.: 0171 4406345
Sonnenblumen LO; Reisinger; 93093 Donaustauf; Tel.: 0160 97222818
Hackgerät Pöttinger Flexcare V 6200; Werner Hierstetter; 93437 Furth im Wald; Tel.: 09973 2715
Honigräume; Christian Peter; 97274 Leinach; Tel.: 09364 9453
Suche pflanzliche Produkte/Futtermittel
Futterweizen; Herbert Gürtler; 83539 Pfaffing; Tel.: 0152 02605495
Suche Zucht- oder Nutzvieh männliche Absetzer; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
abgekalbte Jungkühe; Wittmann; 96337 Ludwigsstadt; Tel.: 0159 06781673
Zu viel Kühe im Stall? FV Färsen und Kalbinnen gesucht; Wittmann; 96337 Ludwigsstadt; Tel.: 0159 06781673
Suche Sonstiges
500 kg Khorasan Weizen; Udal Wiederhold; 27386 Brockel; Tel.: 04266 505
Futter- und Speisegetreide, Verbandsware; Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG; 85411 Hohenkammer; Tel.: 08137 931820
Stellenmarkt
Betriebsleitung (m/w/d) für den Birkenhof in Goslar; Schweighöfer; 38644 Goslar; Tel.: 0178 9058316
Handhackkräfte für Zuckerrüben; Silke und Rainer Vogel; 61130 Nidderau; Tel.: 0160 4676796
Leitende Position in der Öko-Tierhaltung gesucht m/w/d; Pascal Küthe; 63546 Hammersbach; Tel.: 0171 9367423

Wir suchen einen Betriebsleiter Landwirtschaft (m/w/d) für einen 265 ha Ökobetrieb
Ihre Aufgaben
• Organisation und Durchführung aller pflanzenbaulichen Tätigkeiten im Team
• Antragstellungen in Absprache mit dem kaufmännischen Betriebsleiter (BLkm)
• Betriebsmitteleinkauf in Absprache mit BLkm
• Öffentlichkeitsarbeit
• Unterweisung der Auszubildenden und Praktikanten
• Regelmäßiger Austausch und Berichterstattung mit den Gesellschaftern von Gut Obbach
Das sollten Sie mitbringen
• Abgeschlossene Landwirtschaftliche Ausbildung (Techniker, Meister, FH)
• Technisches und landwirtschaftliches Verständnis
• Erfahrung im ökologischen Landbau
• Teamfähigkeit und Offenheit für neue Herausforderungen im Alltag
• Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit
Das bieten wir Ihnen
• Unbefristete Anstellung und motivierende Entlohnung mit einer langfristigen Perspektive
• Betriebsrente
• Vielseitige und interessante Aufgaben
• Nettes Team und Kommunikation auf Augenhöhe
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail!

Schloss Gut Obbach | Bernhard Schreyer | Dr.-Georg-Schäfer-Str. 5 | 97502 Obbach gutsverwaltung@gut-obbach.de | www.gut-obbach.de
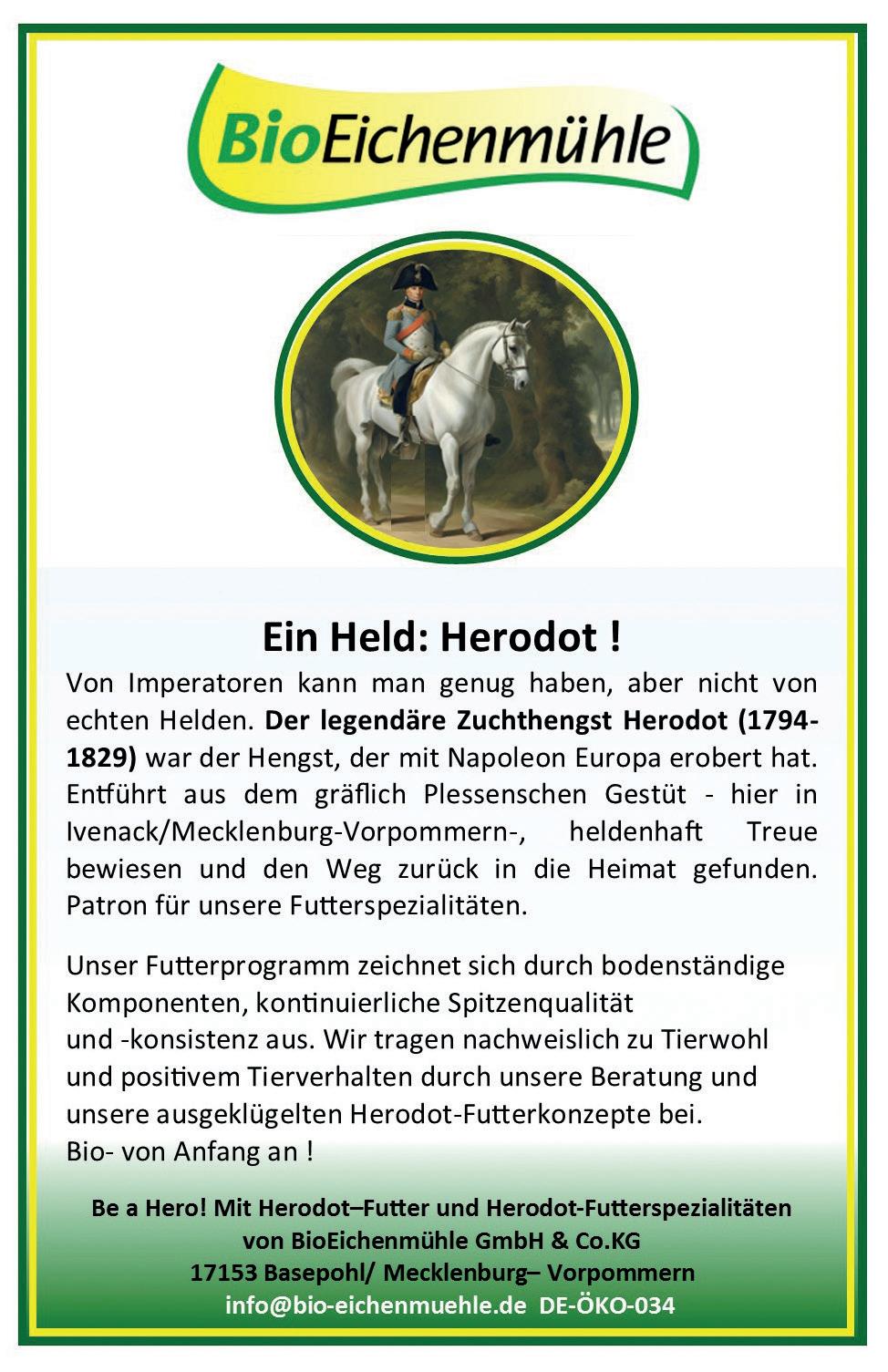
Die unabhängige Fachzeitschrift für ökologische Land - und Lebensmittelwirtschaft
IN JEDER AUSGABE:
Beiträge, Interviews, Meinungen aus Praxis, Forschung und Beratung
Ein Schwerpunktthema ( Generationswechsel, Bi o 3.0, Bäuerliche Landwirtschaft, Weltmarkt Bio, ) Fachartikel aus Pflanzenbau, Tierhaltung, Ernährung, Verarbeitung, Handel, Forschung … Interviews mit dem Nachwuchs der Biobranche Serviceteil
JETZT VERGÜNSTIGTES PROBEABO SICHERN
Zwei Ausgaben für nur 9,45 Euro inkl. Versand statt 13, 50 Euro
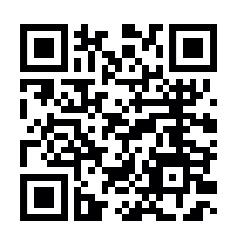

Jetzt testen und 30% sparen mit dem NALAND30Code Bestellung mit Code NALAND30 an abo@oekom.de telefonisch + 49/ (0) 89 / 54 41 84-225 oder online www.oekologie-landbau.de










Weitere Infos:

Seit über 330 Jahren wird die Rubinmühle von der Familie Rubin, heute in der 14. Generation, geleitet und das Wissen rund ums Korn konsequent weiterentwickelt.
Seit 30 Jahren sind wir Naturland Partner.
Mit insgesamt rund 300 qualifizierten Mitarbeiter / innen in Baden-Württemberg und Sachsen werden Kunden vor allem in Europa, aber auch weltweit beliefert.
Die Rubinmühle lebt höchste Qualität. Sie wählt Rohstoffe und deren Herkünfte bewusst und schafft so eine Verbindung zu den Erzeugern, die unsere Produkte ermöglichen.

thomas.staffen@rubinmuehle.de 0 78 21 / 58 04 - 405 bernd.trauvetter@rubinmuehle.de 0 37 41 / 40 59 99 - 340

Mehr Infos hier
Rubin Mühle GmbH, 77933 Lahr
Rubinmühle Vogtland GmbH, 08527 Plauen
www.rubinmuehle.de