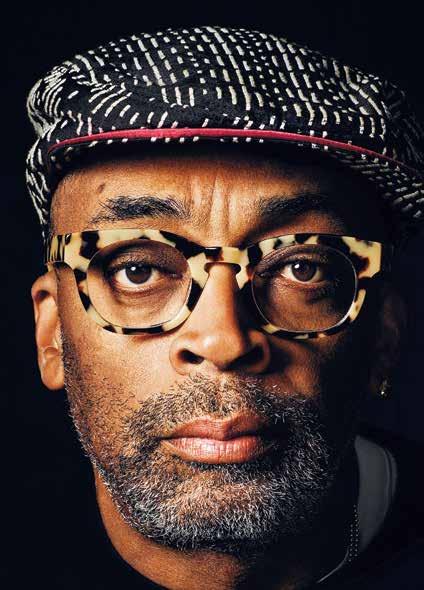3 minute read
Die Batterie des Satelliten
24 |
Bereichsleiter für „Bürgerservice & Information“ im Energieinstitut Vorarlberg und externer Lehrbeauftragter der FH Vorarlberg.
Advertisement
Im Herbst 1957 schickte die UdSSR ihren ersten Satelliten ins All, den Sputnik. 84 kg brachte er auf die Waage. Seine Aufgabe war es, nachzuweisen, dass die geplanten Messprogramme auch durchführbar waren. Brav sandte er Temperatur- und Beschleunigungsdaten an die Erde, rund um den Erdball konnten sie empfangen werden, wie geplant. 21 Tage lang. Und dann? Defekt? Nein. Die Batterien waren leer.
Der erste und auch durchaus natürliche Gedanke war: Es braucht größere Batterien. Sputnik 2 schaffte mit einem Gesamtgewicht von 503 kg schon 162 Tage. Dann hatte auch er nur noch Schrottwert.
Die Entwicklung ging weiter, Satelliten wurden größer, schwerer, leistungsfähiger, die Energiereserven, die man ihnen mitgab, wurden auch größer. Der Entwicklung war aber eine natürliche Grenze gesetzt: größere Satelliten erfordern grö ßere Raketen mit größeren Tanks, größere Tanks sind aber schwerer und fordern für sich wiederum noch größere Tanks. Es gibt aber einen Punkt, ab dem die Rakete zu schwer ist, um die Erdatmosphäre zu verlassen.
Da die Silizium-Photovoltaikzelle älter ist als der erste Sputnik – die Bell Laboratories produzierten die ersten technisch interessanten Silizium-Solarzellen seit 1953 – lag der Gedanke nahe, Satelliten im All über Photovoltaik zu versorgen. Das gelang auch bald, hatte aber auch Grenzen: Die Zahl der Paneele und damit die Solarstromernte war durch die Größe der Rakete limitiert. Man traute es sich auch nicht zu, beliebig große Photovoltaik-Felder ferngesteuert vom Boden
Eckart Drössler
aus zu entfalten. „Wie muss ein Satellit aussehen, der mit der Energie, die ihm zur Verfügung steht, auskommt?“ war dann die entschei dende Frage. Die Konzentration wurde nicht mehr auf die Energieversorgung, sondern auf die effiziente Energienutzung gelenkt. Das löste eine Effizienzrevolution aus. Völlig neue Satelliten sind entstanden und diese Entwicklung befruchtete viele andere Entwicklungen, bis hin zum Chip in der Waschmaschine und zur Leistungs fähigkeit heutiger Laptops und Smartphones. Heutige Satelliten sind wesentlich leistungsfähiger als die alten, können sehr viel mehr und arbeiten ein bis mehrere Jahrzehnte ohne Energieprobleme, bis sie entweder von Teilchen getroffen oder außer Betrieb genommen werden, weil sie mit den noch moderneren Nachfolgesystemen nicht mehr kompatibel sind.
Damit ist die Generalprobe der Effi zienzrevolution am Beispiel Satelliten gelungen. Was nun kommt ist die Premiere am „großen Satelliten“ auf dem wir leben, an unserer Erde, die auch durch das Weltall fliegt, ähnlich den kleinen, künstlichen Satelliten.
Das später folgende Gemini-Programm der NASA lieferte Anfang der 70er Jahre die ersten Bilder, auf denen die Erde als Ganzes zu sehen war. Und man begriff: Die Erde ist klein und endlich, sie hat plötzlich als Ganzes auf einem Foto Platz. Die Bilder zuvor zeigten nur Teile der Erde, unendlich Berge vom Mount Everest aus, unendlich Wüste von einer hohen Düne aus, unendlich Ozean von einem Berg aus, sie haben den Anschein einer Unendlichkeit vermittelt. Sie ist aber endlich und damit wurde auch klar, dass alles, was sich auf dieser Erde und in dieser Erde befindet, muss ebenfalls endlich sein. In dieser Zeit schrieb Den nis Meadows sein Buch „Die Grenzen des Wachstums“, der Club of Rome wurde gegründet, der „Global-2000-Report“ an den US-Präsidenten, damals Jimmy Carter, wurde verfasst und übergeben.
Die fossilen Lagerstätten, die Kohle, das Erdöl, das Erdgas, liegen in dieser begrenzten, endlichen Erde, sie müssen daher auch endlich sein. Sie haben keine andere Bedeutung als die Batterie des Sa telliten. Für einen Dauerbetrieb sind sie nicht geeignet, eher als Startbatterien, mit denen wir eine Entwicklung auf ein anderes Niveau betreiben sollten, auf dem wir dann auf Basis neuer, effizienter und sparsamer Technologien ein komfortableres, gesünderes, nachhaltigeres Leben führen können als vor der industriellen Revolu tion, mit der diese Entwicklung begann. Und das mit einem Energiebedarf, der sich aus erneuerbaren Energieträgern decken lässt.
Auch die Erdatmosphäre ist endlich, aus dem All betrachtet sie ist nicht viel mehr als der Feuchtehauch aus der Atemluft auf einem gekühlten Tischtennisball. Die Schadstoffe und vor allem Treibhausgase, die sie aufnehmen kann, ohne sich signifikant und eigendynamisch zu verändern, sind daher auch endlich – und dieses Maß ist bald erreicht. Im Bereich von 500 ppm CO2 soll der Kipppunkt liegen, 420 ppm haben wir schon erreicht. Für den Anstieg von 400 bis 420 ppm brauchte es nur die letzten vergangenen drei Jahre.