

Besucht uns auf unserem Blog leipzigerlerche.com! Jeden Donnerstag erscheinen hier Blogeinträge zu spannenden Themen rund ums Buch, lustige Anekdoten und Artikel zu aktuellen Trends.



















Besucht uns auf unserem Blog leipzigerlerche.com! Jeden Donnerstag erscheinen hier Blogeinträge zu spannenden Themen rund ums Buch, lustige Anekdoten und Artikel zu aktuellen Trends.
















Willkommen in der Feministischen Leipziger Lerche!

Liebe Leser:innen,
es ist 2024 und Frauen verdienen im Schnitt pro Stunde immer noch 18 Prozent weniger als Männer. Der Standardpatient in der Medizin ist männlich und die Menstruation ist nach wie vor ein Tabuthema. Deshalb wollen wir uns mit der 61. Ausgabe der Leipziger Lerche ganz dem Thema Feminismus widmen. Und das in Pink! Warum in Pink? Geht es beim Feminismus nicht darum, sich von alten Rollenbildern und Stereotypen zu lösen? Ja, das tut es. Genau deshalb war die Farbfindung für diese Ausgabe nicht ganz einfach, aber am Ende waren wir uns alle einig: Wir wollen uns das Pink voller Stolz zunutze machen und zeigen, dass Farbe eben kein Geschlecht hat und wir die Farbe nutzen können, ohne gleich „mädchenhaft“, „niedlich“ und „unschuldig“ zu sein.
Dafür wollen wir in dieser Ausgabe Disney-Prinzessinnen als Vorbilder kritisch hinterfragen (Seite 25), auf die Bedeutung feministischer Verlage in der heutigen Zeit eingehen (Seite 10) und vergessene Frauen in der Geschichte würdigen (Seite 28). Außerdem soll es in dieser Ausgabe um FLINTA*Personen im Kampfsport (Seite 30) und die Übersexualisierung von Frauen und weiblichen Charakteren gehen (Seite 36). Zum Schluss haben wir euch einen witzigen Persönlichkeitstest zusammengestellt (Seite 40) und ihr findet wie immer spannende Film-, Podcast- und Buchempfehlungen rund um das Thema Feminismus.
Unser Dank gebührt auch dieses Jahr wieder allen, die uns bei der Umsetzung unterstützt und die Feministische Leipziger Lerche möglich gemacht haben. Besonders danken wir Annika Le Large für das wundervolle Cover und der Steinbeis Papier GmbH, die uns sehr kurzfristig mit einer großzügigen Papierspende unterstützte. Unser Dank geht außerdem an alle Anzeigenkund:innen, Interviewpartner:innen und natürlich euch Leser:innen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühjahr 2025. Wer uns bis dahin zu sehr vermisst, findet regelmäßige Beiträge auf unserem Blog und die alten Ausgaben als E-Paper auf der Magazinplattform Issuu.
www.leipzigerlerche.com
Die offizielle Playlist zur 61. Ausgabe der Leipziger Lerche

Tauche ein in die feministische Playlist der Leipziger Lerche. Wir haben eine Mischung für alle, die neuen Input suchen, Throwbacks lieben oder gern einfach mal den Shuffle Button drücken möchten.
Shake it off, spit it out, scream out loud, laugh about it, cry for it, feel yourself.
In unserer Playlist findest du inspirierende Stimmen und Bands, die dir Mut machen. Legenden, Ikonen, Denker:innen, aufstrebende Talente und die Favoriten unseres Lerche Teams. Zu unserer Sammlung kannst du singen, voguen, twerken, schreien, schluchzen und eine Träne verdrücken oder einen Barhocker zerschmettern, für die musikalischen Akzente ist gesorgt.
Feiere deine innere Stärke und erlebe die Musik, die die Welt verändert! Entdecke jetzt die Playlist und lass dich von der Energie mitreißen.

Hier geht‘s zur Playlist!
Fenja
Eine – meiner Meinung nach – äußerst spannende und beeindruckende Persönlichkeit ist Ruth Bader Ginsburg. Sie war Richterin und ab 1993 als zweite Frau überhaupt am US Supreme Court tätig. Leider hat sie schon, als sie 1956 an der Harvard Law School ihr Studium aufnahm, Sexismus erfahren. Die juristische Branche war damals – und ist es auch heute noch – sehr stark männerdominiert. Dennoch hat sie sich nicht unterkriegen lassen, sondern weiter um ihren Traum gekämpft. Und auch im weiteren Verlauf ihrer Karriere hat sie sich immer für die Rechte von Frauen sowie insgesamt für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt. Für mich ist ihr Engagement und ihre Hingabe eine große Inspiration. Wenn jemand noch mehr über Ginsburgs Leben wissen möchte, kann ich den Film „On the Basis of Sex“ (Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit) empfehlen.
Studentin, 22 Jahre
Larissa
Ich persönlich habe nicht das eine Vorbild, sondern lasse mich von unterschiedlichen Personen immer anteilhaft inspirieren. Das braucht einen permanenten Reflexionsprozess, den ich als Kernelement feministischer Identitätswerdung verstehe. So sind Margarete Stokowski und Sophie Passmann für ihre Trotzigkeit und Bissigkeit ein Vorbild, Sophia Fritz mit ihrer Weitsicht, Introspektion und Selbstkritik und vor allem Hannah Arendt für ihr Lebenswerk. Im Kleinen finde ich feministische Vorbilder in Frauen, die zwar klassische Rollenbilder leben (Mutter, soziale Berufe, künstlerisch), dabei aber authentisch bleiben und deutlich machen, dass sie selbstbestimmt und integer diese Rollen gestalten. Ich merke, dass ich bei „Alltagsvorbildern“ sehr darauf achten muss, nicht am Ende doch Stereotype zu bilden oder kapitalistische Leistungsideale zu romantisieren.
Studentin, 24 Jahre
Im schon langanhaltenden feministischen Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung sind eine Reihe Namen und Vorbilder von großer Bedeutung und es ist besonders auf Zusammenhalt, Unterstützung und Solidarität hinzuweisen.
Ruth Bleier beeindruckt beispielsweise in ihrem feministischen Aktivismus. Sie lebte von 1923 bis 1988 und wies als Neurophysiologin auf kulturelle Voreingenommenheit in der Wissenschaft und die damit einhergehende gesellschaftlich etablierten konventionellen Geschlechterrollen hin. Des Weiteren setzte sie sich im Zuge der Frauenbewegung für das Recht auf Abtreibung, eine gleichgestellte Position von Frauen an Universitäten und Queerness ein.
Doch neben allen berühmten Persönlichkeiten, die unsere Hochachtung verdienen und für Gendergerechtigkeit eingetreten sind, sehe ich in jeder Frau ein feministisches Vorbild, die ihren eigenen Weg geht, für ihre Werte und Rechte einsteht und sich die Freiheit nimmt, sich ihr Leben nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten.
Studentin, 21 Jahre

Doggy

freepik
Mein feministisches Vorbild ist Tank Girl, weil sie tut, worauf sie und wann sie Lust hat und weil sie immer lustig ist, obwohl sie auch in Gefahr steckt. Sie lässt sich ihre Wahrnehmung nicht kaputt machen und das finde ich beeindruckend. Und sie hat einen Tank, den sie geklaut hat. Außerdem zeigt sie sich so, wie sie sein möchte.
Türsteherin, 35 Jahre
Yvonne
Meine feministische Figur ist Virginia Woolf. Weil sie den berühmten Satz geprägt hat: „Eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer[...]“ der bis heute immer wieder von emanzipierten Frauen zitiert wird, als Symbol der finanziellen Unabhängigkeit, die man als Frau braucht, um ein eigenes Leben zu führen.
Für mich ist Virginia Woolfs Literatur eine Entdeckung gewesen und ihre Biografie gleichermaßen. Wie sie alles aus tiefstem Herzen fühlt, wie sie keine Scheu hat, dies mit aller Ehrlichkeit aufzuschreiben und wie sie in ihren Werken, aber auch im wirklichen Leben, immer eine Rebellin ist, gegen die Konventionen ihrer Zeit. Das ist auch heute noch so freiheitsliebend und ansteckend, dass Virginia meine Inspiration für eine zeitlose, feministische Frau ist.
Theaterpädagogin, Journalistin, 51 Jahre
Dr. Julia Herrmann
Louise Otto-Peters ist für mich ein feministisches Vorbild, weil sie Zeit ihres Lebens unermüdlich für die Rechte und die Gleichstellung von Frauen und soziale Gerechtigkeit gekämpft hat. Die Frauenpolitikerin, Schriftstellerin, Journalistin und Publizistin ist eine der herausragenden Feministinnen des 19. Jahrhunderts. Die Frauen hatten damals kaum Rechte, Abitur und Studium blieben ihnen zum Beispiel verwehrt und damit auch der gleichberechtigte Zugang zur Erwerbsarbeit.
Louise Otto-Peters und ihren Mitstreiterinnen, wie Auguste Schmidt und Henriette Goldschmied, ging es darum, erst einmal diese Rechte zu erlangen. Dafür kämpften sie, organisierten sich erstmals in einer überregionalen Frauenbewegung und erhoben ihre Stimmen trotz starker gesellschaftlicher Widerstände. Dieses Engagement und diesen Mut finde ich bewundernswert und inspirieren mich. Und auch wenn bis zu ihrem Tod fast noch nichts von dem erreicht war, wofür sie sich stark gemacht hat, so hat sie doch den Grundstein für die Frauenbewegung in Deutschland gelegt und maßgeblich dazu beigetragen, die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu stärken. Ihre Entschlossenheit und ihr Durchhaltevermögen motivieren mich, mich für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einzusetzen, auch wenn der Erfolg nicht immer unmittelbar sichtbar ist.
Frauenbeauftragte und Lehrkraft an der HTWK
Die Frankfurter Buchmesse öffnet 2024 zum 76. Mal ihre Tore und zieht jährlich Tausende von Verlagen, Autor:innen und Buchliebhabenden aus aller Welt an. Die Messe wird vom 16. bis 20. Oktober wie gewohnt auf dem Messegelände Frankfurts ausgerichtet. Mit Ausstellern aus mehr als 100 Ländern ist die Frankfurter Buchmesse die größte Buchmesse weltweit. Dieses Jahr steht Italien als Ehrengastland im Mittelpunkt und wird seine reiche literarische und kulturelle Tradition unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ präsentieren.
2023 erreichte die Messe sowohl an den Fachbesucher:innenals auch an den Publikumstagen einen deutlichen Wachstumsschub. Somit gilt die Frankfurter Buchmesse nach wie vor als zentraler Treffpunkt für die internationale Verlagsbranche. Die Messe bietet nicht nur eine Plattform für Verlage und Autor:innen, sondern auch für den Austausch von Ideen und Trends in der Buch- und Medienwelt. Die Fachbesucher:innentage sind zwar für den Austausch zwischen Branchenexpert:innen reserviert, das Wochenende ist aber auch für das breite Publikum zugänglich. Die Messe bietet ein umfangreiches Programm, in dessen Rahmen Podiumsdiskussionen, Lesungen, Workshops und Preisverleihungen stattfinden und beispielsweise zu Themen wie den Herausforderungen des globalen Buchmarktes einladen. Außerdem bietet sich allen die Möglichkeit, Autor:innen persönlich zu treffen.

freepik

Mehr als Pizza und Pasta
Seit 1988 hat die Buchmesse einen Ehrengast, welcher jährlich ein Highlight der Frankfurter Buchmesse darstellt. In diesem Jahr gebührt diese Ehre Italien, einem Land mit einer reichhaltigen, traditionsreichen Kultur. Unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ möchte Italien die Gelegenheit nutzen, sein breites literarisches Spektrum zu präsentieren, in dem sich die Verbindung zwischen Tradition und Innovation widerspiegelt. Das Motto symbolisiert die tiefen kulturellen Wurzeln des Landes und gleichzeitig den modernen, zukunftsorientierten Charakter der italienischen Literaturszene.
In erster Linie assoziiert man Italien mit seiner kulinarischen Vielfalt, die hauptsächlich durch Pizza und Pasta in den Köpfen der Menschen verankert ist. Dabei hat Italien eine beeindruckende literarische Geschichte.
Diese reicht von Werken Dantes, Petrarcas und Bocaccios über Marino und D’Annunzio bis hin zu modernen Autor:innen wie Elena Ferrante, Umberto Eco und Italo Calvino. Insgesamt sechs Nobelpreisträger:innen für Literatur brachte Italien bislang hervor. Dazu zählen Grazia Deledda (1927), Salvatore Quasimodo (1959) und Dario Fo (1997).
In einem eigenen Pavillon wird Italien eine Vielzahl von Veranstaltungen, darunter Lesungen, Diskussionen und Ausstellungen, präsentieren. Bekannte und aufstrebende Autor:innen werden ihre Werke vorstellen und über aktuelle Themen der italienischen Literatur sprechen.
Deutschsprachige Publikationen italienischer Literatur
Im Rahmen des Gastland-Auftritts werden deutschsprachige Publikationen italienischer Literatur veröffentlicht. Die Übersetzungsprojekte stehen stark im Fokus, um die italienische Literatur einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Auf der von der Frankfurter Buchmesse erstellten Neuerscheinungsliste stehen mehr als 130 Titel, die in den Kategorien Belletristik, Graphic Novels & Comics, Kinder- und Jugendliteratur, Lifestyle, Kunst & Kultur, Lyrik, Philosophie und Sach- und Fachbuch veröffentlicht werden.
Preisverleihungen
Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Preise verliehen. Der „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels“ ist der wohl politisch bedeutendste. Daneben gibt es viele weitere Auszeichnungen, wie etwa den „Deutschen Jugendliteraturpreis“ oder auch den Preis für den „kuriosesten Buchtitel des Jahres“.
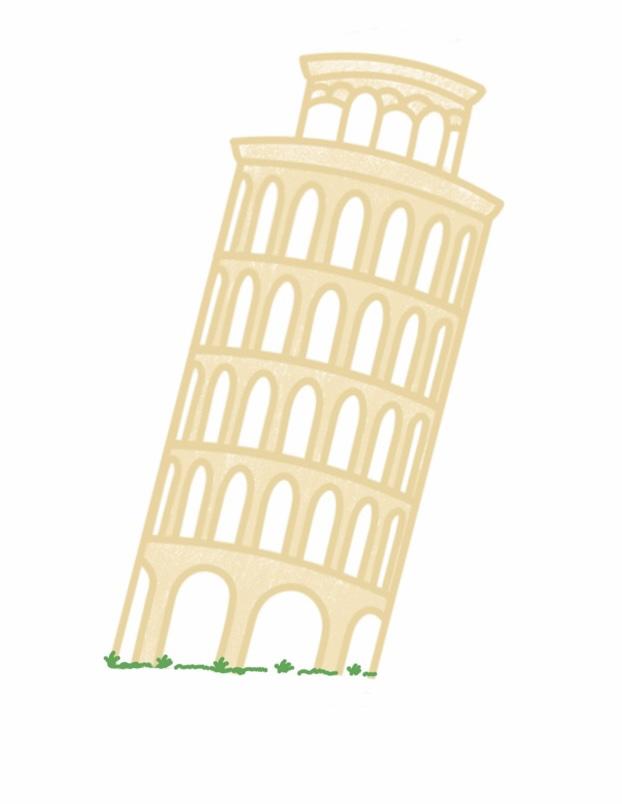
Im Rahmen des „Book-to-Screen-Day“, der am 18. Oktober zum wiederholten Male stattfinden wird, finden sich Expert:innen aus den Bereichen Rechte- und Lizenzhandel zusammen. Der Handel mit Rechten und Lizenzen ist ein weiterer zentraler Aspekt der Frankfurter Buchmesse, da Verleger:innen aus aller Welt die Möglichkeit des direkten und persönlichen Austauschs über Verlagsrechte und Lizenzverträge nutzen können. What‘s new?
Über Instagram verkündete die Buchmesse bereits eine Neuerung: In Halle 1.2 werden Genres wie New Adult, Romantasy, Dark College und ähnliches Platz finden. An den beiden Wochenendtagen wird dort ebenfalls der Treffpunkt für Autor:innen dieser Genres und ihrer Fans sein. Außerdem werden sich dort das „Meet the Author“-Areal sowie Books on Demand, Selfpublisher-Verband und Fakriro befinden.
Die Frankfurter Buchmesse verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis für alle Literatur- und Kulturinteressierten zu werden. Mit Italien als Gastland unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ wird die Messe nicht nur eine Plattform für literarische Entdeckungen bieten, sondern auch einen tiefen Einblick in die vielfältige Kultur eines faszinierenden Landes gewähren. Besucher:innen können sich auf ein buntes Programm voller inspirierender Begegnungen, spannender Diskussionen und kultureller Höhepunkte freuen.

Eine Plattform für vielfältige Stimmen
Feministische Verlage spielen eine wichtige Rolle in der modernen Literaturwelt. Sie veröffentlichen Werke, die Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und Inklusion behandeln. Dadurch geben sie Autor:innen eine Bühne, die in der Mainstream-Literatur oft übersehen werden, und bereichern so den literarischen Diskurs.
Feministische Verlage unterscheiden sich von traditionellen Verlagen durch ihre klare Mission und ihren Fokus auf soziale Gerechtigkeit. Sie entstehen häufig aus dem Bedürfnis heraus, unterrepräsentierten Gruppen eine Stimme zu geben und Themen zu veröffentlichen, die in der kommerziellen Literatur oft vernachlässigt werden. Ihre Arbeit umfasst nicht nur das Verlegen von Büchern, sondern auch das gezielte Anstoßen von Debatten und Dialogen über Geschlechtergerechtigkeit und soziale Veränderung.
Eine Bühne für diverse Stimmen
Ein wesentliches Merkmal feministischer Verlage ist ihre Verpflichtung zur Veröffentlichung von Werken, die die Vielfalt menschlicher Erfahrungen widerspiegeln. Dazu gehören Bücher von und über Frauen, LGBTQ+-Personen, Menschen mit Behinderungen und anderen marginalisierten Gruppen. Durch diesen Fokus bieten sie eine wichtige Plattform für Autor:innen, die in der traditionellen Verlagswelt möglicherweise keinen Platz finden würden. Man erhofft sich den Leser:innen neue Perspektiven auf gesellschaftliche Themen zu eröffnen.
Herausforderungen und Chancen
Trotz ihres wichtigen Beitrags zur Literatur stehen feministische Verleger:innen vor zahlreichen Herausforderungen. Finanzielle Schwierigkeiten sind häufig, da sie oft kleinere Auflagen haben und ihre Bücher nicht die gleiche kommerzielle Reichweite wie Mainstream-Publikationen erzielen. Zudem müssen sie gegen Vorurteile und Widerstände kämpfen. Dennoch bieten diese Herausforderungen auch Chancen. Die enge Zusammenarbeit mit ihren Autor:innen ermöglicht eine tiefere und persönlichere Auseinandersetzung mit den veröffentlichten Werken. Darüber hinaus haben feministische Verlage in den letzten Jahren von den Möglichkeiten des digitalen Marketings und der sozialen Medien profitiert, um ihre Reichweite zu erhöhen und neue Leser:innen zu gewinnen.
Ein weiterer Vorteil ist die starke Gemeinschaft, die sich um diese Verlage bildet. Leser:innen, die sich mit den Werten und Zielen feministischer Verlage identifizieren, sind oft besonders loyal und engagiert. Sie unterstützen die Verlage nicht nur durch den Kauf von Büchern, sondern auch durch die Teilnahme an Veranstaltungen, Lesungen und Diskussionen.
Zukunftsperspektiven
Die Zukunft feministischer Verlage sieht vielversprechend aus, insbesondere in einer Zeit, in der Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Diversität immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die zunehmende Sensibilisierung für soziale Ungerechtigkeiten und die wachsende Nachfrage nach inklusiver Literatur bieten diesen Verlagen neue Möglichkeiten zur Expansion und Einflussnahme.
In den kommenden Jahren werden feministische Verlage voraussichtlich weiterhin eine wichtige Rolle in der Literatur einnehmen. Durch ihre Arbeit schaffen sie nicht nur Raum für neue und vielfältige Stimmen, sondern inspirieren auch andere Verlage und Institutionen, ihre eigenen Praktiken zu überdenken und inklusiver zu gestalten.
Insgesamt sind feministische Verlage unverzichtbare Akteure in der literarischen Landschaft. Sie fördern nicht nur die Kreativität und Vielfalt der Literatur, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte und zum kulturellen Wandel. Ihre Arbeit zeigt, dass Literatur nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären und verändern kann.
Um die Arbeit feministischer Verlage noch genauer zu beleuchten, habe ich Tatjana Michael vom Orlanda Verlag per E-Mail einige Fragen gestellt. In ihren Antworten gibt sie uns einen tieferen Einblick in die Mission und Herausforderungen des Verlags sowie die Bedeutung feministischer Literatur in der heutigen Zeit.
Wie schätzen Sie die Bedeutung feministischer Literatur in der heutigen Gesellschaft ein?
Feministische Literatur ist nach wie vor sehr wichtig. Es gibt noch sehr viel zu tun und sie ist eine Möglichkeit, fokussiert auf die Anliegen und Notstände von Frauen hinzuweisen. Das gilt insbesondere auch für Stimmen aus anderen Kulturkreisen und Kontinenten, die hier wenig gehört werden. Das ist ein zentrales Anliegen unseres Verlages, diese Stimmen

sichtbar zu machen. Nehmen Sie zum Beispiel Djaïli Amadou Amal aus dem Kamerun, die sich für den Zugang von Mädchen zu Bildung und gegen Zwangsheirat und häusliche Gewalt in der Sahel Zone einsetzt.
Was sind die Hauptziele und die Mission Ihres Verlags im Kontext des Feminismus?
Wir setzen uns für Gleichberechtigung auf allen Ebenen ein, in dem Bewusstsein, dass die Welt eine bessere wäre, wenn Frauen mehr Einfluss hätten. Diese Sichtweisen auch im Kinder- und Jugendbuch zu platzieren ist uns ein Anliegen.
Mit welchen spezifischen Herausforderungen sehen Sie sich als feministischer Verlag konfrontiert?
Die Fokussierung auf feministische Anliegen und der von marginalisierten Gruppen im Allgemeinen bedeutet für uns, dass wir uns in einem Nischenbereich bewegen und dadurch immer noch nur Zugang zu einer kleineren Leser:innenschaft haben. Die Herausforderung wird sein, einen Weg zu finden auf Dauer zu bestehen, das heißt, die notwendigen finanziellen Ressourcen zu beschaffen. Aber auch: Noch mehr Menschen dazu zu bewegen, unsere Bücher zu kaufen und ihren Horizont zu erweitern.
Nach welchen Kriterien wählen Sie Manuskripte und Autor:innen aus?
Ist das Thema relevant? Vertritt die Autorin es (auch literarisch) überzeugend? Erzählt es uns etwas über die Welt, was wir vorher noch nicht wussten?
Gibt es neue Themen oder Trends, die Sie in Zukunft verstärkt ansprechen möchten?
Wir möchten weiter Raum schaffen, für Autorinnen, die mit ihren Themen und Büchern nur einen eingeschränkten Zugang zum Markt haben. Wichtig ist uns auch Literatur aus Teilen der Welt zu veröffentlichen, die noch weniger be -
kannt sind bei uns. Lebensrealitäten von Personen zu zeigen, die hier oft nur als „markige Headlines“ in Nachrichten auftauchen und ihnen ein Gesicht zu geben, ist uns wichtig. Deshalb wird uns auch das Thema Migration und Antirassismus weiter wichtig sein. Damit noch mehr Menschen zu erreichen und idealerweise zu einem Perspektivwechsel zu bewegen, ist uns ein Anliegen.
Haben Sie Feedback von Leser:innen, das besonders prägend oder überraschend war?
Ich bin ehrlich gesagt immer wieder überrascht, wenn ich merke, dass es hier relativ wenig Offenheit für Literatur zu „schwierigen“ Themen oder für Literatur aus kleineren Märkten gibt. Hier fehlt mir die notwendige Bereitschaft, auch über die eigenen Lebensrealitäten hinauszublicken. Prägend ist immer wieder das positive Feedback von Leser:innen, das wir für unsere Bücher bekommen. So war zum Beispiel der Erfolg unserer Autorin Florence BrokowskiShekete damals völlig überraschend. Damit hätten wir nicht gerechnet, als wir uns für die Veröffentlichung ihrer Autobiografie „Mist, die versteht mich ja!“ entschlossen haben.
Arbeiten Sie mit anderen feministischen Organisationen oder Verlagen zusammen? Wenn ja, wie?
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, arbeiten wir auch mit anderen feministischen Organisationen und anderen Verlagen zusammen. Netzwerke sind ein Erfolgsfaktor im Nischensektor. Das geht von Vertriebskooperationen über Fundraisingaktionen bis zu Solidaritätsaktion für verfolgte Autorinnen.
Welche Pläne und Projekte haben Sie für die Zukunft des Verlags?
Wir wollen den Kinder- und Jugendbuchbereich noch weiter ausbauen, uns weiter um das Thema Migration aus der Perspektive von Betroffenen kümmern, Autorinnen eine Stimme geben, die uns Lebensrealitäten näherbringen, die uns noch unbekannt sind.
Hiermit nochmal einen großen Dank an Tatjana Michael vom Orlanda Verlag, welche sich die Zeit genommen hat meine Fragen zu beantworten.
Artikel und Interview von Elias Graebner
Endlich Gleichberechtigung in der Buchbranche?

Es tut sich etwas in der Buchbranche. Während Angestellte von Verlagen und Buchhandlungen schon immer überwiegend weiblich waren, sah das in den Führungsebenen immer anders aus. Und auch bei den verkauften, prämierten und besprochenen Autor:innen kann bis jetzt nicht von einer Gleichberechtigung aller Geschlechter gesprochen werden. In letzter Zeit gab es viele Veränderungen. Das heißt nicht, dass sich das Thema mittlerweile erledigt hat, aber man kann sehen, dass die Branche dazulernt und sich in eine positive Richtung entwickelt.
Noch 2019 hat der #vorschauenzählen gezeigt, wie unterschiedlich die Zahlen der Bücher von weiblichen und männlichen Autor:innen in den Vorschauen von großen Belletristik-Verlagen ist. Die Zahl der Novitäten von Autorinnen lag bei manchen renommierten Verlagen bei gerade einmal 20 Prozent. In diesem Jahr sind die Zahlen ausgeglichener. In vielen Vorschauen sind mittlerweile sogar mehr Bücher von Frauen dabei als von Männern, vor allem im Fantasy-, Romantasy- und Young Adult-Genre.
Was hat sich verändert?
Zwei Drittel aller Jobs in der Verlagsbranche sind von Frauen besetzt. Das ist schon lange so. In den Führungspositionen war diese Zahl dennoch eher umgekehrt und die meisten Angestellten in höheren Ebenen waren Männer. Nicht zuletzt durch die eingeführte Frauenquote hat sich auch hier einiges verändert. Große Verlage wie Kiepenheuer & Witsch oder Rowohlt werden mittlerweile von Frauen geführt. Die Zahl von Frauen in leitenden Positionen in Verlagen lag 2020 schon bei 48 Prozent. Auch inhaltlich verändert sich
die Buchbranche. Feminismus und queere Literatur als Genre und Bücher von Frauen sind derzeit sehr beliebt und es wird offener über Themen wie Menstruation, weibliche Anatomie und subjektive Erfahrungen von Frauen gesprochen. Es wird sich aktiv für Frauen und Autorinnen stark gemacht und immer öfter sieht man den Slogan „Lest mehr Frauen“. Auch Biografien von Frauen werden öfter geschrieben, gelesen und sind nicht mehr weniger beliebt als die von Männern. Schaut man sich die prämierten und besprochenen Bücher, beziehungsweise Autor:innen der letzten Jahre an, sieht man auch hier, dass Frauen und ihre Werke immer öfter den Anklang finden, den sie verdient haben. Von den Gewinner:innen des Nobelpreises für Literatur waren in den letzten vier Jahren 50 Prozent Frauen. Bei anderen wichtigen Literaturpreisen sieht es ähnlich aus.
Gegenseitig unterstützen und stark machen
Für diese Entwicklung ist es wichtig, dass Frauen weiterhin gestärkt werden. Ein Verein, der sich für Frauen in der Buchbranche stark macht, ist der BücherFrauen e. V. Die BücherFrauen sind ein Netzwerk bestehend aus Frauen in ganz Deutschland, die in der Branche tätig sind und sich gegenseitig vernetzen und unterstützen. Auch der Arbeitsbereich Frauen in Kultur & Medien des Deutschen Kulturrates setzt sich für Frauen in allen Bereichen der Kultur- und Medienarbeit ein und möchte damit langfristig mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Es hat sich also schon einiges verändert, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Vor allem im Hinblick auf den Gender Pay Gap muss sich noch vieles ändern. Trotzdem entwickelt sich die Gleichberechtigung in der Buchbranche in die richtige Richtung und das darf gerne so weiter gehen.

Feminismus-Edition
Du bist aber hysterisch… Haben wir nicht wichtigere Probleme?

© Freepik
Wer schon mal versucht hat, mit anderen Menschen über Feminismus ins Gespräch zu kommen, wird sie kennen: Die vielen kleinen Mikroaggressionen. Dafür gibt es hier ein schönes Bullshit-Bingo, sodass du bei der nächsten Diskussion zumindest nebenbei Bingo spielen kannst.
Nee, den kenne ich. Der würde sowas niemals machen.
Wenn ihr nicht immer so wütend wäret, würden euch auch mehr unterstützen.
Also mir ist das ja noch nie passiert!
Och Mensch, du verstehst ja echt gar keinen Spaß.
Was ist denn daran bitte sexistisch?
Frauen müssen einfach mal selbstbewusster werden.
Auf wen sollen wir denn noch alles Rücksicht nehmen?!
Warum hattest du denn auch ausgerechnet das an?
Und was ist mit den Problemen der Männer?
Nicht das Thema schon wieder…
Ach naja, früher haben Frauen das doch auch geschafft.
Ihr seid doch längst gleichberechtigt!
Frauen sind nun mal schwächer als Männer.
Übertreibst du gerade nicht ganz schön?
Carmen Jenke
Filme, Serien, Bücher, Videospiele. Sie alle leben von einem: Charaktere, die die Geschichten in ihnen lebendig werden lassen. Sie sind es, die uns oft am meisten in Erinnerung bleiben. Denn schließlich sind sie es, denen wir in das Abenteuer folgen, mit denen wir mitfühlen und mitfiebern. Doch wer in den letzten Jahren Rezensionen von Filmen, Serien, Büchern und Videospielen gelesen oder gesehen hat, dem ist vielleicht ein Phänomen aufgefallen: die Beschwerde über schlecht geschriebene weibliche Figuren. Besonders in Hinsicht auf Mainstream Medien wie beliebte Serien oder Hollywood Filme.
Ist da etwas dran? Tatsächlich ja. Auch wenn wir in den letzten zehn Jahren einen Zuwachs an weiblichen Charakteren und vor allen Dingen weiblichen Hauptcharakteren in vielen populären Medien hatten, sind nicht alle davon gut geschrieben. In diesem Artikel will ich einige Fettnäpfchen beleuchten, in die viele Autor:innen beim Schreiben von Frauen tappen und andererseits auch einige gut geschriebene weibliche Charaktere aufführen.
„Damsel in Distress“ und männliches Beiwerk
Eine der wohl bekanntesten und unbeliebtesten Tropes, in die weibliche Figuren gesteckt werden, ist die sogenannte „Damsel in Distress“. Diese beschreibt einen sehr passiven, unselbstständigen weiblichen Charakter, der immer wieder in Gefahr gerät und in der Regel vom männlichen Hauptcharakter gerettet wird. Zwei andere ähnliche Tropes sind weibliche Figuren, die nur als „Plotdevice“ oder „Love interest“ dienen. Ähnlich wie die „Damsel in Distress“ haben sie kaum Eigeninitiative oder Persönlichkeit und sind nur dazu da, dem Hauptcharakter einen Grund zum Handeln zu geben oder an seiner Seite hübsch auszusehen und für Sexappeal zu sorgen. Manche dieser Figuren werden geradezu objektifiziert. Diese Tropes waren früher in sehr vielen Medien, wie zum Beispiel alten Hollywood-Verfilmungen, üblich. Man findet sie aber auch heute noch, besonders im Animeund Videospielbereich. Ein aktuelles Beispiel wäre die Videospielheldin Eve, welche zwar die Titelfigur des Videospiels Stellarblade, aber nicht viel mehr als eine sexy Puppe ohne Persönlichkeit ist, die den sexuellen Fantasien der männlichen Spieler zuspielen soll. Auch in der Literatur gibt es sehr seltsame und sexualisierte Darstellungen von Frauen, wer ein paar Beispiele lesen will, kann sich auf dem Subreddit „men writing women“ umschauen, auf dem solche diskutiert werden.
Und was man tun und lassen sollte Mary Sue – die perfekte Heldin
Um sich von den eben genannten altbekannten Tropes wie „Damsel in Distress“ abzusetzen, haben viele Medienunternehmen in den letzten zehn Jahren angefangen, immer mehr starke weibliche Charaktere und weibliche Hauptrollen einzuführen. An sich eine sehr gute Entwicklung, aber auch hier werden noch viele Fehler gemacht. Viele Autor:innen, die einen „strong female character“ für ihre Geschichte wollen, vergessen, dass ihre Charaktere nicht eine Repräsentation für alle Frauen sind, sondern einfach ein Charakter, der auch weiblich ist. Denn was passiert, wenn man mit einem oder einigen wenigen Charakteren eine ganze Gruppe repräsentieren will?

Man will ihnen nicht auf die Füße treten. Daher werden viele weibliche Charaktere, die als „strong female leads“ ausgelegt werden, zu sogenannten „Mary Sues“. Kurz gesagt, Charaktere, die ungeheuer stark sind und keine nennenswerten Schwächen haben. Ein Beispiel für solch einen Charakter wäre die Star Wars-Protagonistin Rey. Insbesondere im ersten Film der neuen Trilogie scheint sie ein Naturtalent in allem zu sein und kann sofort Raumschiffe fliegen und mit einem Laserschwert kämpfen. Selbst wenn sie in Gefahr gerät, kann sie sich durch eine plötzliche Offenbarung ihrer geheimen Jedikräfte retten. Aber sind makellose und perfekte Menschen Charaktere, mit denen wir uns verbunden fühlen, mit denen wir mitfühlen und uns identifizieren können? In der Regel nicht, denn Menschen sind nicht unfehlbar. Starke Charaktere sind nicht beeindruckend, weil sie keine Schwächen haben, sondern weil sie ihre Schwächen überkommen und dadurch stärker werden.
Ein weiteres Problem ist, dass viele starke Frauenfiguren so gut wie keine Gefühle zeigen und so ein Fehlen an Persönlichkeit und Menschlichkeit suggerieren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Superheldin Captain Marvel, welche die meiste Zeit sehr kalt und gefühllos erscheint. Gefühle offen zu zeigen wurde früher als ein Zeichen von Schwäche gesehen, doch dieses Denken ist schon lange veraltet und wird heute als problematisch angesehen. © Freepik
Was macht nun einen gut geschriebenen Charakter aus?
Ein gutgeschriebener Charakter hat alle Eigenschaften, die den oben genannten fehlen. Eine vielseitige Persönlichkeit, das heißt: eine Motivation zum Handeln, Ziele, Träume und Ängste. Stärken und Schwächen, die ihnen helfen oder im Weg stehen. Es sind Charaktere, denen erlaubt ist, Fehler zu machen, Gefühle zu zeigen und Momente der Schwäche zu haben. Charaktere, die sich entwickeln und am Ende der Geschichte eine andere Person sind, als sie am Anfang waren.
Gute Charaktere sind menschlich
Zwei Beispiele für gut geschriebene weibliche Charaktere sind Toph und Katara aus der animierten Serie „Avatar – The Last Airbender“. Sie sind zwei sehr unterschiedliche und großartige Charaktere. Katara ist empathisch, warmherzig und willensstark. Sie ist eine entschlossene und mutige Person, die niemals Menschen in Not ihren Rücken zukehren würde. Aber gleichzeitig sind ihre Stärken manchmal auch ihre Schwächen, zum Beispiel wenn sie sich wegen ihres Mitgefühls aufopfert, um andere zu retten. Toph wiederum ist eine ganz andere Person als Katara, sie ist unabhängig, sarkastisch und selbstbewusst. Zudem ist sie blind, was zugleich eine ihrer größten Stärken als auch Schwächen ist. Toph ist eigensinnig und dickköpfig, weswegen sie oft mit Katara aneinandergerät, welche das Team zusammenhalten möchte. Beide sind geprägt von ihrer Vergangenheit. Katara hat wegen des Todes ihrer Mutter schon früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, und spielt darum oft die Rolle der Vermittlerin. Während Toph in einer reichen Familie aufgewachsen ist, aber wenig Freiheiten hatte, und daher ein sehr freiheitsliebender und rebellischer Mensch geworden ist. Sowohl Katara als auch Toph haben starke Motivationen und agieren aktiv mit ihrer Umwelt und anderen Figuren, sie machen beide Fehler, aus denen sie lernen, entwickeln sich allein und zusammen weiter und haben eindrucksvolle Momente, in denen sich ihre Stärke zeigt. Sie haben das, was vielen weiblichen Charakteren vergönnt ist: Menschlichkeit, denn sie dürfen einfach sie selbst sein.
Ella Weindel


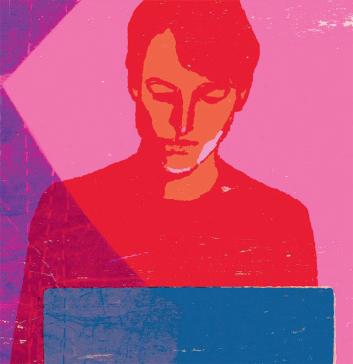
Auch als eBook und eHörbuch
Wie entsteht ein Roman?
Wie werden Figuren lebensnah und lebendig? Und wie geht man mit Krisen um? Anhand eigener und bekannter anderer Werke erzählt Benedict Wells von der Magie und Faszination des Schreibens. Ein lebenskluges, witziges und berührendes Buch –für alle, die Literatur lieben oder selbst schreiben wollen.
Mehr unter: diogenes.ch/benedictwells
Eine Betrachtung der feministischen Theorie in der Literatur aus der Vergangenheit
Schriften über feministische Theorien existieren schon seit mehreren Jahrhunderten und entwickeln sich fortlaufend weiter. Die erste Publikation, die ausdrücklich die Rechte von Frauen thematisiert, wurde bereits 1405 verfasst. Es folgt ein kurzer Überblick über einige der bedeutendsten Begründerinnen des Feminismus in der Literatur.
Bücher gelten in Deutschland als meritorische Güter. Sie werden vom Staat subventioniert, damit der Zugang zu Büchern möglichst einfach ist. So zum Beispiel in Form des reduzierten Mehrwertsteuersatzes. Auch die umstrittene gesetzliche Buchpreisbindung soll zum Erhalt des einfachen Zugangs zu Büchern beitragen. Der Grund: Der Staat sieht im Lesen einen Nutzen für die Gesellschaft. Lesen erweitert den eigenen Horizont, trägt zur persönlichen Bildung und politischen Meinungsbildung bei und spielt eine wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Diskurs. Diese Merkmale liegen einer Eigenschaft zugrunde: Schrift kann sowohl Raum als auch Zeit überbrücken. Auch der Feminismus nutzt diese Raum- und Zeitüberbrückungsfunktion, um Theorien, Ansichten und Argumente festzuhalten und zu verbreiten. Es entstanden Schriften, die Meilensteine der feministischen Bewegungen dokumentieren und sie so noch heute rezipierbar machen.
Eine Stadt aus Frauen
Vereinzelt ist feministische Literatur bereits im 15. Jahrhundert zu finden: Die italienisch-französische Schriftstellerin Christine de Pizan veröffentlichte im Jahre 1405 das „Buch von der Stadt der Frauen“ (Original: „Le Livre de la Cité des Dames“). Die Autorin stellte sich die Frage, warum Frauen in der damals aktuellen, von Männern beherrschten Literatur einer sehr negativen Darstellung unterlagen. In kurzen Essays und Anekdoten hinterfragt und entkräftet de Pizan misogyne Einstellungen männlicher Autoren. Die einzige Maßnahme, die gegen die sozial abgewertete und benachteiligte Position der Frau helfe, sei selbstbestimmtes Denken. Sie beschrieb unter anderem eine Utopie, in der Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben. Christine de Pizan war eine der ersten Frauen, die mit dem Schreiben ihr Leben und das ihrer Familie finanzieren konnte. Ihre Kindheit verbrachte Christine de Pizan in Venedig und Paris, wo sie dank der gesellschaftlichen Stellung der Familie und der Anstellung ihres Vaters stets Zugang zu Büchern, insbesondere der Bibliothek des damaligen französischen Königs Charles
V., hatte. Im Alter von 15 Jahren heiratete sie einen Sekretär des Königs. In den darauffolgenden Jahren starben sowohl der König, ihr Vater als auch ihr Ehemann, weshalb Christine de Pizan gezwungen war, ihre Familie selbst zu unterhalten. Sie schlug den ungewöhnlichen Weg des Schreibens ein. Ihr erster Erfolg war ein 1399 publizierter Gedichtband namens „Cent Ballades“. Auch stellte Christine de Pizan ihre Bücher selbst her, der Buchdruck wurde schließlich erst im Jahre 1440 erfunden.
Das Verlangen nach Bildung
Zwar steht ihre Tochter Mary Wollstonecraft Shelley, die Autorin von „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“, heutzutage weit mehr im Rampenlicht als ihre Mutter, jedoch hat auch diese sich schriftstellerisch betätigt und sich so zur Bezeichnung der „Mutter des Feminismus“ verholfen. Mary Wollstonecraft wurde 1759 geboren und erlebte eine Kindheit, in der Bildung beschränkt und Gewalt durch ihren Vater allgegenwärtig war. Dennoch gelang es ihr, selbstständig lesen und schreiben zu lernen und später als Lehrerin zu arbeiten. Der Wunsch nach gleicher Bildung für Frauen und Männer prägte ihr Schaffen: Mit weiteren Frauen gründete sie 1784 eine Schule für Mädchen. Zudem veröffentlichte sie 1787 in der Zeitschrift Analytical Review ihren ersten Artikel „Thoughts on the Education of Daughters“ auf den noch viele weitere folgen sollten. 1790 erschien ihr Buch „Verteidigung der Menschenrechte“ (Original: „Vindication of the Rights of Men“), in dem sich Mary Wollstonecraft für die Ziele der Französischen Revolution aussprach. Zudem betonte sie, dass gesellschaftlicher Wandel nur durch das Engagement von Männern und Frauen zugleich gelingen könne, weshalb Frauen und Männern die gleichen Rechte zustehen sollten. Im Jahre 1793 wurde ihr bahnbrechendstes Werk publiziert: Die „Verteidigung der Rechte der Frau“ (Original: „Vindication of the Rights of Women“). Wollstonecraft argumentierte, dass die Unzugänglichkeit der Bildung für Frauen dazu führe, dass eine intellektuelle Entwicklung kaum möglich ist und Frauen ein unwürdiges Leben führten, indem sie lediglich eine Zierde für Männer darstellten.
„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“
Ein besonders prägendes Werk der feministischen Bewegung im 20. Jahrhundert wurde von der französischen Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir verfasst. „Das andere Geschlecht“ aus dem Jahr 1949 befasst sich auf
zwei Bände verteilt mit der Position der Frau in der Gesellschaft (Original: „Le Deuxième Sexe“). Es gilt als eines der wichtigsten Werke der europäischen Frauenbewegung. Einer der wohl berühmtesten Sätze aus ihrem Werk: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ („On ne naît pas femme: on le devient.“) Es wurde unter anderem anhand von biologischen und psychoanalytischen Studien geschlussfolgert, dass die Position der Frau durch den Mann definiert werde. Simone de Beauvoir zufolge komme es bei der gesellschaftlich unterdrückten Position der Frau nicht auf das biologische Geschlecht an, sondern ist vielmehr auf die Sozialisation, die gesellschaftlichen Prägung, zurückzuführen.
Ein eigenes Zimmer
Auch der Name Virginia Woolf ist fester Bestandteil der feministischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine englische Schriftstellerin, welche ihre feministischen Überlegungen und Beobachtungen in diversen Büchern zum Ausdruck brachte. Ende der 1960er Jahre wurde ihr berühmtestes Werk „Ein Zimmer für sich allein“ (Original: „A Room of One’s Own“) wiederentdeckt, welches Woolf bereits 1929 verfasste. Es beschäftigt sich mit den Ungerechtigkeiten der Geschlechterdifferenzen und illustriert anhand der Metapher eines eigenen Zimmers die ungleichen Bedingungen von Frauen und Männern, wissenschaftliche, künstlerische und literarische Arbeiten zu vollbringen. Der Essay basiert auf von ihr gehaltenen Vorträgen, die sie am ersten Frauencollege Großbritanniens in Cambridge im Oktober 1928 hielt. Virginia Woolf veranschaulicht die Ungerechtigkeit mit Hilfe eines Gedankenspiels: Angenommen der englische William Shakespeare hätte eine Schwester namens Judith gehabt, die nicht minder talentiert wäre. Wäre sie genauso erfolgreich geworden wie Shakespeare? Ihre Antwort war ein klares Nein. Das liege Woolf zufolge an den unterschiedlichen Bedingungen von Männern und Frauen. Die meisten Frauen erhielten damals keine Schulbildung. Zudem war es undenkbar, dass sich Frauen zur Shakespeares Lebzeiten im elisabethanischen Zeitalter einer Bühne näherten.
Auf der Suche nach den Wurzeln des Patriarchats
In der Zweiten Welle des Feminismus, die in den 1960er Jahren ihren Anfang nahm, wurden auch Geschlechterrollen im Privaten in Frage gestellt. Die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Kate Millett veröffentlichte 1970 das Buch

„Sexus und Herrschaft“ (Original: „Sexual Politics“), welches sich mit der Suche nach den Wurzeln des Patriarchats in der westlichen Gesellschaft und Literatur beschäftigte. Sie stellte die These auf, dass patriarchale Strukturen auf der Sozialisierung fußten, nicht biologisch gegeben seien und als soziale Normen akzeptiert würden. Noch heute zählt ihre Publikation zu den Standardwerken der feministischen Theorie.
Funfact, der eigentlich überhaupt nicht lustig ist: Blaustrumpf
Intellektuell gebildete Frauen, die sich als Schriftstellerinnen betätigten, wurden im 19. Jahrhundert mit der Bezeichnung Blaustrumpf beschimpft. Das Schreiben und Lesen gehörten nicht zu den für Frauen vorgesehenen Aufgabenbereichen und sollten nicht dazu führen, dass Frauen die für sie vorgesehenen Tätigkeiten vernachlässigten.
That’s not all!
Es gibt noch zahlreiche weitere Autor:innen, die sich in ihren Texten der feministischen Theorie widmen, auf die es sich einen Blick zu werfen lohnt – sowohl Schriftsteller:innen aus der Vergangenheit als auch heutzutage tätige Autor:innen. Durch die Dritte Welle des Feminismus entwickelte sich der Feminismus zu einer intersektionaleren und inklusiveren Bewegung, die sich nicht mehr nur für Frauen, sondern ebenso für weitere marginalisierte Gruppen wie Trans* Personen, asexuelle und homosexuelle Menschen einsetzt. Dies wird auch in der heutigen feministischen Literatur widergespiegelt.
Antonia Faupel
Wie geht die Literaturbranche mit Büchern von Autorinnen um?
Große Literatur ist Männersache. Dieser Eindruck könnte zumindest erweckt werden, wenn man einen Schulabschluss in Deutschland macht. Man klammert sich im Deutschunterricht noch immer an Goethe, Böll, Mann, Hesse, Kästner und dergleichen. Ingeborg Bachmann, Christa Wolf, Elfriede Jelinek oder Annette von DrosteHülshoff finden kaum statt. Eine Asymmetrie, die bis heute in unserer Gesellschaft besteht, denn noch immer wird Literatur von Autorinnen anders betrachtet und wahrgenommen als Literatur von Autoren.
Für viele Kinder und Jugendliche findet ein großer Teil ihrer Sozialisation, neben den Einflüssen des Elternhauses, in der Schule statt, besonders wenn es um Literatur geht. Das literarische Frauenbild, das sich uns dort offenbart, liegt überwiegend einer männlichen Perspektive zugrunde, welche sich über Jahrhunderte hinweg ungebrochen zur Norm gefestigt hat. Auch wenn Verlagsprogramme und Themen vielfältiger geworden sind und Frauen genauso publizieren wie Männer, werden Werke von Autorinnen nicht selten mit einem Sonderplatz in der Literatur versehen, der Frauenliteratur. Weibliche Literatur bekommt also nicht nur mehr Raum heutzutage, sie bekommt in manchen Fällen schlicht ihren ganz eigenen Raum, fern ab von der gekannten Norm. Ein strukturelles Problem in Gesellschaft und Branche, welches sich ebenso in den Rezensionen und Kritiken widerspiegelt. Die Pilotstudie des Buchbranchenprojekts #frauenzählen in Kooperation mit der Uni Rostock zum Thema „Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb“ (http://www. frauenzählen.de) hat unter anderem ergeben, dass Frauen ausgeglichen über Autorinnen und Autoren schreiben, Männer allerdings überwiegend Bücher von männlichen Verfassern besprechen.
Ungelesen
Der Literatur von Männern wird durch diese Unausgeglichenheit demnach eine deutlich größere Bühne und Sichtbarkeit gewährt als der Literatur von Frauen. Dieser Umstand hat im weiteren Sinne auch Auswirkungen auf das zukünftige Schaffen der Schriftstellerinnen zum Beispiel in Bezug auf weitere Buchverträge oder Honorarverhandlungen. Eine mögliche Erklärung ist: Was nicht gelesen wird, kann nicht besprochen werden. Steht ein weiblicher Vorname auf dem Buchcover, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann das Buch auswählt, kauft und liest geringer, als wenn ein männlicher Vorname darauf gedruckt ist. Ob bewusst
oder unbewusst, sei dahingestellt. Ein Pseudonym oder die Verwendung von Initialen kann hierbei Abhilfe schaffen und ist ein nicht selten gewähltes Mittel in der Branche. Dennoch, die Frage bleibt bestehen: Wie viele Bücher werden nicht gelesen, weil sie von Frauen geschrieben wurden und wie viele davon wurden bereits wieder vergessen?
Kritik, um der Kritik willen?
Auch der Umgang mit den Büchern und Inhalten von Autorinnen, die gelesen werden, ist ein anderer, im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Noch immer kommt es vor, dass ihre Leistungen herabgestuft werden, Themen belächelt oder gar als überflüssig angesehen werden. Es sei gesagt, dass die Kritik an sich nicht das Problem ist, aber ihre Verhältnismäßigkeit. Eine grundlegende Eigenschaft von Büchern ist es, den Leser:innen neue Ideen, Gedanken, Perspektiven und Lebensrealitäten zu eröffnen. Eine vorgefertigte Meinung oder oberflächliche Betrachtung dieser, weil man Thema oder Form nicht kennt, sich nicht hinreichend damit beschäftigt oder sich ihr ganz verweigert, ist bei weitem nicht mehr zeitgemäß.
Wie wir Stereotype immer noch unbewusst leben
Frauen sind emotional. Frauen verstehen keine Technik. Frauen können nicht einparken. Vorurteile und Stereotype gegenüber Frauen existieren massenhaft. Dass diese Sachen nicht wahr sind und definitiv nicht auf alle Frauen zutreffen, ist eigentlich klar. Doch ist das in der Praxis wirklich der Fall?
So gern immer davon erzählt wird, dass alle Menschen gleich sind, sitzen Stereotype hinsichtlich des Geschlechts immer noch tief verankert in unserer Gesellschaft.
Was sind Stereotype und wo kommen sie her?
Sogenannte „Geschlechterstereotype“ sind vereinfachte Vorstellungen darüber, welche Eigenschaften, Verhaltensweisen und Rollen Frauen beziehungsweise Männern zugeordnet werden und welche auch von ihnen erwartet werden. Man müsste meinen, wir haben diese Rollenbilder bereits aus unseren Köpfen verbannt und erwarten nicht mehr, dass alle Angehörigen eines Geschlechts ähnliche Eigenschaften besitzen. Doch ganz so einfach ist es in der Realität dann leider doch nicht, denn viele dieser Stereotype werden schon im Kindesalter gelernt und unbewusst verinnerlicht. Es fängt schon damit an, dass Eltern die Farbe der Babykleidung für ihre Kinder am jeweiligen Geschlecht ausrichten. Dadurch bekommen Mädchen hauptsächlich pinke Strampler angezogen, wohingegen es bei Jungen meist blaue Kleidungsstücke sind. Auch die Spielzeuge erzeugen erste Einflüsse auf die Rollenverteilung. Während Jungen mit Autos und Actionfiguren spielen, erhalten Mädchen typischerweise Puppen, die sie dann schon als Kleinkind wie eine Mama selbst aufziehen und behüten. Wenn man einen Blick in die Kinderabteilung in Kleidungsgeschäften wagt, dann findet man in der Jungenabteilung alles von Superhelden über Piraten bis hin zu Dinosauriern. In der Mädchenabteilung dominiert immer noch die Farbe Pink in jeglicher Farbabstufung mit niedlichen Motiven von Prinzessinnen und Pferdchen.
Sind Farben geschlechtsspezifisch?
Dass Mädchen unterstellt wird, die Farbe Pink beziehungsweise Rosa zu mögen und dass Blau eine Jungenfarbe ist, ist wohl weniger eine Präferenz, sondern eher eine angelernte Neigung. Interessanterweise galt die Farbe Rosa nämlich nicht immer als Mädchenfarbe. Es ist gerade einmal hundert Jahre her, dass es sich umgekehrt verhielt. Rosa ist eine mit weiß abgestufte Farbvariante von Rot. Sie wurde deshalb
auch als „kleines Rot“ bezeichnet und früher den Jungen zugeschrieben. Die Farbe Rot ist eine sehr kräftige Farbe, die in der Natur und in vielen Kulturen als Signalfarbe vor Gefahr warnt und rein optisch an Blut erinnert. Damit drückt sie Stärke aus und wurde den erwachsenen Männern zugeordnet. Für die Jungen gab es das Rosa. Blau galt bis dahin als die Farbe der Mädchen, weil sie die Symbolfarbe der Jungfrau Maria war und mehr zum Bild des anmutigen und schönen Mädchens passte.
Frauen verstehen nichts von Technik
Das Klischee, dass Frauen sich nicht für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) interessieren, kann man aus Erfahrungen aus der Kindheit und aus dem Umfeld ableiten. Typische Mädchenspielsachen sind immer noch Miniaturküchen, die Mädchen früh das Führen des Haushalts nahebringen. Frauen werden zudem stereotypisch vor allem als einfühlsam, gefühlvoll und kommunikativ charakterisiert. Besonders in sozialen Berufen werden eben diese Eigenschaften benötigt, sodass oft erwartet wird, dass Frauen in dieser Branche arbeiten. Durch diese Erwartungshaltung sind viele überrascht, wenn sich ein Mädchen für die MINT-Fächer begeistert.
Wie baut man Stereotype ab?
Der wahrscheinlich einzige Weg, um Stereotype gegenüber Frauen effektiv aus den Gedächtnissen der Menschen zu löschen, ist es, die Individualität aller Menschen zu normalisieren. Die Medien sind die einzigen, die dieses Unterfangen wirklich umsetzen können. Repräsentation in Filmen, Serien, in der Werbung und in allen anderen Beiträgen zeigen der Bevölkerung, wie bunt unsere Gesellschaft ist. Dabei darf die Einbindung nicht erzwungen oder künstlich in den Vordergrund gerückt werden. Um wirklich ein Ergebnis zu erzielen, muss die Darstellung natürlich wirken und nicht überspitzt sein, nur um zu zeigen, man hat sich dafür eingesetzt. Eine authentische Repräsentation der Gesellschaft sollte kein Lob erwarten. Veränderung kann schwierig sind, weswegen vor allem ältere Menschen keine Änderungen an ihren Weltbildern vornehmen wollen. Aber für Kinder ist es umso wichtiger, dass ihnen alle Möglichkeiten gezeigt werden. Damit Mädchen am Ende entscheiden können, ob sie in die MINTBerufe gehen, weil es ihnen gefällt. Nicht weil jemand anderes ihnen diese Entscheidung abgenommen hat, bevor sie sie je treffen konnten.
Julia Rodner

© freepik
Die dunkle Seite des Mainstream-Feminismus
In den vergangenen 200 Jahren hat uns der Feminismus viele wunderbare Erfolge beschert. Doch profitieren wirklich alle Frauen von den bisherigen Fortschritten? Wer etwas genauer hinschaut, wird feststellen: Der Mainstream-Feminismus ist vor allem ein weißer Feminismus, der die Bedürfnisse weißer Frauen in den Mittelpunkt stellt.
In ihrem Buch „Against White Feminism“ definiert Rafia Zakaria weißen Feminismus als einen Feminismus, welcher sich ausschließlich auf die Bekämpfung von Sexismus konzentriert. Dabei verkennt er die Mehrfachdiskriminierung vieler Frauen. So ist eine Schwarze Frau nicht einfach von Sexismus betroffen, sondern von Misogynoir. Der von Moya Bailey entwickelte Begriff bezeichnet eine Diskriminierungsform, die durch das Zusammenwirken von Rassismus und Sexismus entsteht. Weißer Feminismus betrachtet diese Diskriminierungen allerdings als voneinander getrennte Probleme mit jeweils unabhängigen Lösungen. Diese Ignoranz gegenüber Intersektionalität gründet sich in der Idee der White Supremacy.
White Supremacy ist die Vorstellung von der Vorherrschaft der weißen Rasse. Nach Black-Lives-Matter-Aktivistin Blair Imani werden dafür menschliche Rassen konstruiert, deren Spitze die weiße Rasse darstellen soll. Weißsein und alle damit assoziierten Eigenschaften werden so zum höchsten Gut auserkoren. Damit wird es nicht-weißen Bevölkerungsgruppen unmöglich gemacht, diese vermeintliche Perfektion zu erreichen. Dies führt zu einer Unterdrückung der konstruierten nicht-weißen Rassen aufgrund ihrer vermeintlichen Minderwertigkeit.
Wie zeigt sich White Supremacy im weißen Feminismus?
Zakaria stellt fest, dass Erfahrungen und Arbeit von BiPoC selten beachtet werden. Das liege unter anderem daran, dass Gewalterfahrungen Schwarzer und Frauen of Color als gewöhnlich und damit nicht empörend angesehen werden. Zudem zeige die Konfrontation mit Mehrfachdiskriminierung weißen Frauen ihre Privilegien sowie ihre eigene Rolle in der Aufrechterhaltung des Systems auf. Diese Position sei weißen Frauen so unangenehm, dass sie diese Auseinandersetzung mieden.
Aufgrund der, zum Teil nur unbewussten, Vorstellung von der Überlegenheit weißer Ideen fehlt es an Verständnis und Interesse für feministische Ansätze außerhalb westlicher Kulturen. Bereits zur Kolonialzeit sahen sich weiße Feministinnen als Retterinnen kolonialisierter Frauen. Mithilfe des europäischen Feminismus sollten auch sie sich befreien. Dabei vergaßen die Europäerinnen allerdings, dass diese Frauen unter kolonialistischer Kontrolle lebten, eine wahrhaftige Befreiung ohne staatliche Unabhängigkeit also unmöglich war.
All diese Mechanismen führen dazu, dass hauptsächlich weiße Frauen Gehör finden, wodurch sich der Mainstream-Feminismus vor allem auf die Diskriminierung weißer Frauen fokussiert. Auf diese Weise verfestigt sich der MainstreamFeminismus zu einem weißen Feminismus. So freuen wir uns, dass der Frauenanteil im Bundestag im Februar 2024 bei 35 Prozent lag. Dass erst 2021 mit Awet Tesfaiesus die erste Schwarze Frau in den Bundestag einzog, wird jedoch kaum beachtet. Radikale Feminist:innen wie Alice Schwarzer fordern, cis Frauen vor trans* Frauen zu schützen. Dabei werden jedoch cis Frauen, allen voran Schwarze Frauen, durch eben diese Schutzversuche diskriminiert: Christine Mboma wurde 2021 die Teilnahme am 400m-Lauf bei den Olympischen Spielen in Tokio verboten, da bei ihr ein natürlicher, aber angeblich zu hoher Testosteronwert festgestellt wurde. Mindestens fünf weitere Schwarze Sportlerinnen sind von dieser Regelung betroffen.
Wie kann weißem Feminismus entgegengewirkt werden?
Rafia Zakaria stellt vier Bedingungen für einen echten Richtungswechsel auf: Erstens müssen weiße Feminist:innen erkennen, dass die Gleichberechtigung von Schwarzen Frauen und Frauen of Color die Gleichberechtigung weißer Frauen nicht gefährdet. Zweitens muss sich jede:r mit den rassistischen Wurzeln des westlichen Feminismus und ihren Auswirkungen auf die Gegenwart auseinandersetzen. Drittens ist es unabdingbar, dass eine klare Grenze zwischen Weißsein als einer bloßen Eigenschaft und weißen Feminist:innen als Praktizierenden des weißen Feminismus gezogen wird. Zu guter Letzt muss den Gedanken jeder Frau jeglicher Herkunft, Klasse, Sexualität oder Gesundheit Gehör verschafft werden.
Carmen Jenke

Was hörst du so? Und was hat das mit Feminismus zu tun?
Musik begleitet uns täglich. Sie weckt Emotionen in uns, erzählt Geschichten, trägt Tradition und formt Identität. Sie prägt Menschen und ganze Jahrzehnte, kann Kommunikation erleichtern und sogar gesundheitsfördernd wirken.
Musik formt unseren Geist und was wir hören, formt die Musikindustrie und ihre Künstler:innen. Wer erfolgreich ist, wird erhört und wer angehört wird, wird erfolgreich. Die MaLisa Stiftung zeigt auf, dass 85 Prozent der deutschen Charts von Männern komponiert wird und sagt: „Frauen und nichtbinäre Menschen sind in den untersuchten Bereichen der Musikbranche weiterhin stark unterrepräsentiert.“ Aber liegt das wirklich daran, dass Männer besser komponieren und wir alle lieber Männern zuhören? Oder lässt sich auch in der Musikindustrie der alltägliche Sexismus, wie er in vielen anderen Feldern wie der Politik oder im Sport und dem Handwerk bekannt ist, wiedererkennen?
Unterschätzt und übersehen
Ob auf Streaming Plattformen, der Bühne oder im Studio, Frauen sind schon immer ein starker, wichtiger Teil der Musikindustrie und der Musikgeschichte. Doch leider werden ihre Stimmen und ihre Kunst oft nicht wahrgenommen und unterschätzt. Der Blick der Industrie, der Medien und somit oft auch der Blick der Konsument:innen fällt auf andere Dinge. Schon die Dichterin Sappho (circa 630 vor Christus) besorgte Sittenwächter mit ihrem Lebensstil, obwohl sie eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der griechisch-römischen Antike war. Heute wird über Billie Eilishs Shirtgröße berichtet, als wäre der weltweite Erfolg der Zweiundzwanzigjährigen Nebensache. Frauen und nichtbinäre Menschen kämpfen seit langer Zeit für Anerkennung und Gleichberechtigung in der Musikszene. Von Weltbühnen bis zum kleinsten Kellerkonzert. Die Geschichten von Hauptacts denen in die Mischpulte gegriffen wird, Künstlerinnen mit jahrelanger Erfahrung, denen Mann erklärt wie es besser geht oder Rapperinnen, denen nicht geglaubt wird, dass sie ihre Texte selber schreiben. Die Liste ist lang und ermüdend. Doch die Versuche, ihnen das Können abzusprechen oder davon abzulenken, indem ihr Körper in den Medien kommentiert wird oder jedes Detail ihres Liebeslebens groß gedruckt in Zeitungen erscheint, bleiben immer öfter erfolglos. Die Künstlerinnen haben erkannt, wie sie sich dem Sexismus in ihrer Branche entgegenstellen können und haben einen Raum und unterschiedlichste Werkzeuge geschaffen, um sich selbst und ihre Kolleginnen zu stärken.
„Burnt me at the stake, you thought I was a witch Centuries ago, now you just call me a bitch“
Marina – „Man’s World“
„You‘ve got to walk in pairs.
Don’t we have anything else to offer? You only see the surface.
Your unwanted opinion is worthless, but not harmless“
Punch – „Worth More than Your Opinion“
Sisterhood und Girl’s Girls
Wenn beispielsweise sehr bekannte Künstlerinnen andere aufsteigende Künstlerinnen mit Gastauftritten in ihren Liedern oder auf Konzerten bestärken oder wenn in Interviews sexistische Fragen bezüglich der „Rivalinnen“ nicht mehr beantwortet werden, fällt auf, wie gut Feminismus der Musikindustrie tut. Kleine Schritte, die viel Aufmerksamkeit bekommen, haben plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Kunst allein ist ein nützliches Werkzeug gegen patriarchale Verhältnisse, vor allem in den großen Genres Pop und HipHop kann gegenseitige Unterstützung und Anerkennung aber ein genauso wichtiges Zeichen setzen. Zum einen kann durch Coverversionen an die Vorkämpferinnen und ihre Geschichte, die Verhältnisse und Strukturen erinnert werden. Dies kann zum Nachdenken und auch zur Aufklärung der Konsument:innen führen. Zum anderen ist das Brechen des Stigma der Missgunst unter den Künstler:innen in diesen Genres und auch abseits jeder Bühne wichtig. Letztlich bleibt wichtig zu betonen, dass wir als Konsument:innen eine große Entscheidungsmacht haben. Wer uns in den Ohren sitzt, bestimmen wir mit wenigen Klicks.
Wenn deine Playlist also eine besonders männliche ist, ist eine Sache sicher: dass du etwas verpasst. Du verpasst weibliche Stimmen und ihre Geschichten, ihre Kreativität und letztlich auch ihre Realität. Vielleicht kannst du dich einmal fragen, wieso sie dich bis jetzt nur zu 15 Prozent interessiert hat?

Sophie Rochlitzer
Warum Geschlechter in der Medizin unterschiedlich behandelt werden müssen
Müdigkeit, Magenschmerzen, Schwindel, Rückenschmerzen. Bei welcher Erkrankung treten diese Symptome auf? Schwierig eine Antwort zu finden. Deutlicher wird das Krankheitsbild bei diesen Symptomen: Atemnot, Schmerzen im Arm, Engegefühl in der Brust. Typische Anzeichen für einen Herzinfarkt. Auch das erste Krankheitsbild ist das eines Herzinfarktes. Jedoch mit Symptomen, die häufiger Frauen betreffen. Über diese Symptome sind aber weniger Menschen informiert, was weitreichende Folgen für Betroffene haben kann. Mit dieser Diskrepanz setzt sich die Gendermedizin auseinander.
Die Gendermedizin, oder auch geschlechtersensible Medizin genannt, erforscht den Einfluss von Geschlechtern auf Erkrankungen und deren optimale Behandlung. Dabei wird sowohl das biologische, als auch das soziale Geschlecht betrachtet. Beide haben Einfluss darauf, welche Symptome auftreten, wie eine Krankheit diagnostiziert wird und wie die Behandlung aussieht.
Die Gendermedizin ist eine noch sehr junge Disziplin. Erst seit den 1990er Jahren wird sie diskutiert. Begonnen hat die Diskussion die amerikanische Kardiologin Marianne Legato, mit der Veröffentlichung ihres Buches „The Female Heart: The Truth about Women and Heart Disease“. Legato entdeckte, dass Frauen bei Herzinfarkten oft andere Symptome zeigen als Männer.
Die Gendermedizin bezieht sich nicht nur auf die biologischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, sondern betrachtet zusätzlich das soziale Geschlecht. Der Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht wird deutlicher bei einem Blick in die englische Sprache. Im Englischen gibt es eine Trennung in „sex“, das biologische Geschlecht, und „gender“, das soziale Geschlecht. Das biologische Geschlecht bezieht sich auf die körperlichen Merkmale, wie Chromosomen, Hormone, Anatomie, Aktivitäten des Immunsystems und weitere. Dagegen beschreibt das soziale Geschlecht die Selbstwahrnehmung und Identität einer Person, sowie Verhaltensweisen, die oft mit gesellschaftlichen Normen oder geschlechtstypischen Lebensstilen verknüpft sind.
Gender und sex bedingen einander und haben Einfluss darauf, woran wir erkranken und wie schnell diese Krankheiten erkannt werden. Unsere soziale Umwelt, die Rollen, die wir
in der Gesellschaft einnehmen und die Verhaltensweisen, die uns dadurch gelehrt werden, formen uns. Familienrollen, Diskriminierungserfahrungen oder auch emotionale Intelligenz haben deshalb Anteil an unserer Gesundheit. Wie Menschen versorgt werden, hängt darüber hinaus auch von Faktoren, wie Alter, Bildung, Ethnie und ökonomischem Hintergrund zusammen. Sie können beeinflussen, wie ein Mensch medizinisch versorgt wird oder, ob es zu Diskriminierung im Gesundheitssystem kommt.
Wie gut eine Behandlung erfolgt, hängt also von vielen Faktoren ab.

Unterschiedliche Symptome
Krankheiten können sich bei Frauen und Männern mit unterschiedlichen Symptomen äußern. Auch, wenn es sich um die gleiche Krankheit handelt. Dieser Umstand führt dazu, dass Krankheiten bei Frauen oft schlechter und langsamer erkannt werden, als bei Männern. Grund dafür ist eine Datenlücke (Gender Data Gap), die in der Forschung entstand und nur langsam aufgearbeitet wird. Bis in die 1990er bezog sich die medizinische Forschung in Studien und Test häufig
nur auf Männer. Das Problem: Die Ergebnisse wurden dann teilweise ohne weitere Forschung auf Frauen übertragen. So kommt es, dass die typischen Symptome einer Krankheit in manchen Fällen größtenteils auf Männer zutreffen und typisch weibliche Symptome nicht bekannt sind beziehungsweise als atypisch gelten.
Frauen nicht in Studien einzubinden, wurde mit der Komplexität des weiblichen Körpers und möglichen Gefahren für diesen begründet. Der weibliche Zyklus, Wechseljahre, Einflüsse von Verhütungsmitteln und Schwangerschaften erschweren die Auswertung von Ergebnissen. Hormonelle Schwankungen können Ergebnisse innerhalb der Gruppe der Frauen schwer vergleichbar machen. Es bräuchte also noch Abstufungen in weitere Untergruppen. Dies hätte den Vorteil, dass die Forschung noch spezifischere Aussagen für verschiedene Gruppen treffen könnte. Dafür fehlen aber sowohl mehr freiwillige Probandinnen, als auch nötige Forschungsgelder.
Beispiel Herzinfarkt
Herzinfarkte betreffen sowohl Männer als auch Frauen. Männer erkranken dabei häufiger als Frauen. Jedoch liegt der Anteil der Frauen, die an einem Herzinfarkt sterben, prozentual höher als bei Männern. Die Symptome, die Männer bei einem Herzinfarkt verspüren sind häufig bekannt: Atemnot, ein Engegefühl in der Brust, Schmerzen, die in die Arme ausstrahlen und damit einhergehend kann Panik oder Todesangst auftreten. Frauen haben oft untypische Symptome, wie Müdigkeit, Erbrechen, Schwindel, Rückenschmerzen und allgemeines Unwohlsein. Eine unzureichende Informationslage führt dann dazu, dass Frauen ihre eigenen Symptome missdeuten oder unterschätzen und erst später einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Und dann ist der erste Schritt meist nicht schnellstmöglich die Notaufnahme aufzusuchen, sondern den Hausarzt. Selbst Ärzt:innen sind in den meisten Fällen nicht ausreichend geschult und verfügen über zu wenig Wissen über weibliche Symptome eines Herzinfarktes, weshalb auch Ärzt:innen teilweise falsche Diagnosen stellen und die Symptome zum Beispiel mit stressbedingten psychosomatischen Schmerzen begründen. Bis zur richtigen Diagnose kann viel Zeit vergehen, die für die Behandlung der Erkrankung verloren geht.
© freepik

Was kann getan werden?
Um die Gendermedizin nachhaltig zu betreiben und die Gender Data Gap aufzulösen, muss mehr Geld in die medizinische Forschung investiert werden, um beispielsweise möglichst viele Probandinnen an Studien teilnehmen zu lassen. Wie oben erwähnt, ist dies aber sehr kosten- und auch zeitintensiv.
Wichtig ist es auch, möglichst viele Ärzt:innen für die Gendermedizin zu sensibilisieren und aufzuklären, da nur wenige Ärzt:innen, die nicht auf den Bereich spezialisiert sind, sich der Thematik überhaupt bewusst sind. Deshalb ist es notwendig die Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Gendermedizin auszubauen.
Gendermedizin muss außerdem zum fest verankerten Lehrinhalt des Medizinstudiums an Universitäten werden. Derzeit bieten nur wenige deutsche Universitäten Module zum Thema an. Die Charité in Berlin hat zum Beispiel Module im Lehrplan festgeschrieben. An anderen Unis gibt es Wahlmodule, die nicht belegt werden müssen, andere Universitäten legen gar keinen Fokus auf die Gendermedizin. Dabei müssen aber vor allem die aufstrebenden Arztgenerationen in diesem Bereich geschult werden.
Ein Schritt, den jeder angehen kann, ist es, sich den eigenen Vorurteilen gegenüber Mitmenschen bewusst zu werden. Denn dieses Bewusstsein ist die Voraussetzung für eine sachliche medizinische Versorgung.
Theresa Spörl

© pexels
Sexismus, Patriarchat und Geschlechterbinäritat – Wer hat‘s erfunden?
Realität. In unseren Kulturen, Religionen, Erzählungen, Erziehungsformen und Ideologien hat das olle Patriarchat ein ständiges Comeback. Mal ermüdend und offensichtlich, mal in ganz neuer Tonlage. Der Mensch als Gewohnheitstier, der Mann als Anführer und die Übrigen. Ein zufriedenes „Das war schon immer so“ kommt dem alten, weißen Mann nicht ohne Grund am häufigsten über die Lippen.
Hexen und Smarties
Der Patriarch lässt sich aus dem Altgriechischen übersetzen und bedeutet „Erster unter den Vätern, Stammesführer”. Einzeln übersetzen lassen sich die Begriffe patér „Vater“ und archēs „Oberhaupt“. Der Begriff beschreibt also die männliche Herrschaft und die Rangordnung der Gesellschaft, in der ein cisgeschlechtlicher Mann an oberster Stelle steht. Wie ist es dazu gekommen?
Merry E. Wiesner schreibt in ihrem Buch „Gender in History: Global Perspectives“, dass sich besonders während unserer Entwicklung von Jäger:innen und Sammler:innen zu sesshaften, landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften die Welt zu einer Männerwelt formte. Kriege und andere Formen der organisierten Gewalt verliehen Männern und ihrer Idee von Herrschaft besondere Macht. Während der Reformation in Europa wurden Frauen als Hexen und Teufelsanhängerinnen verstoßen und verfolgt, wenn sie die Regeln der Kirche nicht einhalten wollten. Kolonialisten brachten ihre eurozentrischen Vorstellungen von Macht und Zivilisation gewaltvoll in die Kolonien, in denen vor der Kolonialzeit meist Strukturen bestanden, die heute wiederum als fortschrittlich und feministisch gelten würden. Auch in aktuellen Berichten ist sexualisierte Gewalt ein oft dokumentiertes Kriegsmittel. Die Reformation, Kolonialimus und andere, in der Geschichte zurückliegende Beispiele lassen Sexismus, Patriarchat und Geschlechterbinäritat aber nicht weniger aktuell sein. Für viele von uns sind die Themen, welche sich alle in die staubige Schublade mit der lustlos etikettierten Aufschrift „Patriarchat ist schuld“ stecken lassen, Alltag und
Als die Antibabypille 1961 in Deutschland für verheiratete Frauen neu erhältlich war, sorgten sich Befragte um die Frau. Die könnte den Haushalt und ihr Erscheinungsbild aus dem Fenster werfen und eine plötzliche Sexsucht entwickeln. Dass ein Mensch mit Uterus dem Teufel folgt und deswegen Spaß an Sex findet, sich den Kopf rasiert und zum Abendessen nichts auf den Tisch stellt, ist ein altbekanntes und regelmäßig wiederbelebtes Angstbild. Der rote Faden lässt sich leicht erkennen. Noch vor wenigen Jahren sorgte sich Jens Spahn um alle Menschen, die die „Pille danach“ mit Smarties verwechseln könnten. Hexen, die Smarties schmeißen. Gott bewahre! Die Zeit scheint von irgendwem regelmäßig zurückgestellt. Wie die Person, die zum Finger gehört, aussehen könnte, lässt sich erahnen. Doch die Uhr tickt, auch die letzte patriarchale Struktur hat ein Ablaufdatum. Vielleicht vergisst irgendjemand mal die Zeit, weil er damit beschäftigt war, der Hexe im Garten zu helfen (es gab Kuchen). Bis zum hoffentlich baldigen Ende gönne ich mir und dir eine Pause und stelle mir vor, wie Margarete Stokowski in ihrem Buch „Die letzten Tage des Patriarchats“:
„Ich möchte ein weißer, heterosexueller, mittelgroßer, mittelhaariger Mann sein, mittelsympatisch, […] ohne Behinderung, ohne Sprechfehler, ohne Krankheit. […] Einer, der nachts allein ganz entspannt durch den Park laufen kann. […] Gucken, wie es sich anfühlt. Einfach um zu wissen, wie man dann so drauf ist. Ob es an irgendeiner gottverdammten Stelle in seiner Seele ein bisschen juckt. […] Oder ob es gar nicht juckt und man noch beim Einschlafen immer nur so ‘Jawoll!’ denkt.“
Sophie Rochlitzer
Sind Disney-Prinzessinnen geeignete Vorbilder für junge Mädchen?
Zauberhafte Figuren wie die hart arbeitende Tiana, die mutige Mulan und die Traditionen durchbrechende Vaiana bringen Kinderaugen zum Leuchten. Angefangen hat zwar alles mit den Klassikern, die meist auf bekannten Märchen basierten. Doch mit der Zeit kommen auch neue Prinzessinnen dazu, die teilweise gar keine richtigen „Prinzessinnen“ sind, jedoch trotzdem in das Genre von Disney passen.
Für junge Mädchen sind sie Vorbilder. Sie zeigen ihnen, wer sie sein können. Doch zeigen diese Disney-Prinzessinnen ihnen wirklich eine Zukunft, in der sie nicht in eine Schublade gesteckt werden?
Die klassischen Prinzessinnen
Schneewittchen aus „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (1937), Cinderella aus dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1950 und Aurora aus „Dornröschen“ (1959) sind nicht nur die ersten drei Disney-Prinzessinnen, sondern auch die einzigen, die zu Walt Disneys Lebzeiten entstanden sind. Allein der Film „Dornröschen“ ist damit schon 65 Jahre alt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass die Repräsentation junger Mädchen durch diese Filme ziemlich veraltet ist. Schneewittchen zum Beispiel ist ein vollkommen unschuldiges, teilweise naives Mädchen, das trotz der Sabotage ihrer Stiefmutter nie ihr Mitgefühl und ihre Freundlichkeit verliert. Im Gegenzug dazu wirkt sie auch eher sanftmütig und bescheiden und wird am Ende des Films vom Prinzen gerettet. Damit erfüllt sie das Rollenbild einer zukünftigen liebenden Mutter und Frau, die sich auf die Stärke und Führung ihres Mannes verlässt. Nebenbei ist an diesem Film auch problematisch, dass Schneewittchen hier erst 14 Jahre alt ist, was aus heutiger Sicht eindeutig zu jung ist für eine tiefgreifende Romanze mit einem deutlich älteren Prinzen.
Die Prinzessinnen der „Disney Renaissance“
Hierzu zählen Arielle aus „Arielle, die Meerjungfrau“ (1989), Belle aus „Die Schöne und das Biest“ (1991), Jasmin aus „Aladdin“ (1992) sowie Pocahontas und Mulan aus den gleichnamigen Filmen aus den Jahren 1995 und 1998. Genauso wie die klassischen Disney-Prinzessinnen repräsentieren auch sie gewisse Charaktereigenschaften, die junge Mädchen dazu ermutigen sollen, selbst zu träumen. Dennoch verbindet diese Figuren auch, dass sie anders sind, als die Gesellschaft es von ihnen erwartet. Arielle möchte unbe -
dingt an die Oberfläche und ihr eigenes Abenteuer erleben. Belle interessiert sich nicht für den beliebten Gaston und ist stattdessen eine selbstbewusste, gebildete Frau, die gerne liest. Jasmin ist nicht beeindruckt vom Reichtum des verkleideten Aladdins und sehnt sich lieber nach der Freiheit, ihre große Liebe selbst zu finden. Pocahontas bringt dem Engländer John Smith bei, die Natur und andere Kulturen zu schätzen und dass Gewalt nicht die Lösung für alles ist. Mulan erkennt, dass sie nie die perfekte Tochter sein wird und entscheidet sich dazu, für ihren Vater in den Krieg zu ziehen. Anders als die ersten Disney-Prinzessinnen brauchen diese Mädchen keinen Ritter in schimmernder Rüstung. Sie können sich selbst behaupten und ihre Probleme eigenständig bewältigen. Dennoch werden sie als Außenseiter dargestellt, die von der Norm abweisen.
Die „Disney Revival Era“
Die sogenannte „Disney Revival Era“ beginnt mit Tiana aus „Küss den Frosch“ (2009). Dazu zählen noch Rapunzel aus „Rapunzel – Neu verföhnt“ (2010), Merida aus „Merida – Legende der Highlands“ (2012), Vaiana aus „Vaiana – Das Paradies hat einen Haken“ (2016) und Raya aus „Raya und der letzte Drache“ (2021). Die Schwestern Anna und Elsa aus „Die Eiskönigin“ (2013), Mirabel aus „Encanto“ (2021) und Asha aus „Wish“ (2023) zählen zwar nicht zu den Prinzessinnen, aber werden hier trotzdem erwähnt, weil sie aus den aktuelleren Filmen von Disney stammen. In Sachen Repräsentation und Vorbildfunktion sind die Prinzessinnen definitiv gewachsen, obwohl jeder Film immer noch seine Schwächen haben wird. So haben sich die Figuren im Laufe ihrer Geschichten weiterentwickelt und retten jetzt teilweise den „Prinzen“. Hinzukommt, dass die Liebe in den neueren Filmen für die Figuren absolut keine Rolle mehr spielt. Natürlich geht es in manchen Filmen immer noch darum, die eigene Familie zu beschützen, aber von der romantischen Liebe fehlt hier jede Spur. Ein Beweis, dass das Verlieben und Heiraten nicht alles im Leben einer Frau ist. Ganz im Gegenteil, in „Raya und der letzte Drache“ gibt es zum Beispiel keinen männlichen Charakter, der mehr als eine unterstützende Rolle besetzt. Auch die Antagonist:innenrolle wird hier von dem Mädchen Namaari übernommen. Es ist zudem auch der erste Film (neben „Mulan“), in dem die Disney-Prinzessin kein Kleid oder Rock trägt.
Julia Rodner
Katharina Fack bei Ullstein Buchverlage

privat
Bist du auch auf #Booktube unterwegs? Dann kennst du vielleicht den YouTube-Account „katharia“ von Katharina Fack, auf dem sie bis 2022 Bücher rezensierte und ihre Lesereise teilte. 2020 hat sie ihren Bachelor of Arts in Buch- und Medienwirtschaft erfolgreich abgeschlossen, woraufhin 2023 auch ein Masterabschluss in Publishing Management folgte. Mittlerweile ist sie Junior Digital Marketing Managerin bei Ullstein Buchverlage und gibt uns nun einen Einblick in ihre Arbeit!
Welche Aufgaben und Zuständigkeiten hast du als Digital Marketing Managerin?
Die Aufgaben im Digitalmarketing sind sehr vielfältig. So gehört zum einen Social Media- und Community-Management für die Kanäle von Ullstein zu meinen Aufgaben, aber auch die Content Creation dafür. Zum anderen bin ich auch für die Social Ads-Kampagnen auf Meta, Google und TikTok von einigen unserer Kampagnentitel, wie zum Beispiel „Das Café ohne Namen“ von Robert Seethaler oder „Die Dämmerung“ von Marc Raabe, zuständig. Davor bedarf es dafür erstmal einiges an Planung und Absprachen, wobei man richtig kreativ werden kann. Außerdem gibt es zahlreiche digitale Marketingmaßnahmen, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Die Pflege der Webseite, die Erstellung von Newslettern, die Arbeit mit Influencern oder Bloggenden oder auch das Anlegen von Zusatzinhalten zu unseren Neuerscheinungen auf Amazon gehören auch noch zu meinem Job.
Wie sieht dein typischer Arbeitstag aus?
Ich glaube, einen typischen Tag gibt es nicht! Je nach Monat und entsprechend der Anzahl an Neuerscheinungen betreue ich unterschiedlich viele Titel, für die jeweils verschiedene Digitalmaßnahmen anfallen. Zu meinen täglichen Aufgaben gehört aber auf jeden Fall das Social Media- und Community-Management sowie die Content-Erstellung für Instagram und TikTok. Viel Zeit verbringe ich manchmal auch in Meetings, um mich mit anderen Abteilungen oder innerhalb des Teams abzusprechen.
Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind als Digital Marketing Managerin gefragt?
Definitiv Kreativität! Vor allem im Marketing geht es darum, mit unseren Kampagnen, Inhalten und Büchern herauszustechen und dafür sind kreative Grafiken, Headlines und Aktionen das Wichtigste. Ich denke, man sollte aber auch eine gewisse Spontanität mitbringen, um schnell auf zum Beispiel Trends, Preisnominierungen oder Bestseller reagieren zu können. Besonders wichtig ist das bei schnelllebigen Plattformen wie TikTok.
Was macht deinen Beruf für dich besonders?
Für mich war es schon seit der Schulzeit ein Traum, später einmal in der Buchbranche zu arbeiten und Menschen von Büchern zu begeistern. Dass ich das jetzt mache, ist schon besonders für mich! Ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht.
Welche Herausforderungen sind dir bisher in deiner beruflichen Laufbahn begegnet?
Zum Glück keine großen!
Hast du Tipps für zukünftige Absolvent:innen, die nach ihrem Hochschulabschluss gerne in die Verlagsbranche einsteigen möchten?
Ich denke, die beste Möglichkeit, einen Einstieg in die Verlagsbranche zu finden, sind Praktika oder die Arbeit als Werkstudierende. So kann man schon während des Studiums erste Erfahrungen sammeln und hat für anschließende Bewerbungen gleich branchenrelevante Erfahrungen.
Alternativ sind Volontariate auch eine klassische Einstiegsmöglichkeit. Ansonsten ist es vor allem im Marketing von Vorteil, wenn man auch privat bereits Erfahrungen auf #BookTok, #Bookstagram oder wie in meinem Fall #BookTube vorweisen kann.
Wie bist du dazu gekommen, auf YouTube über Bücher zu sprechen?
Während meiner Schulzeit, als ich Lesen als Hobby für mich entdeckt haben, war ich damit in meinem Umfeld so gut wie die Einzige. Ich hatte aber total Lust, mich über Bücher, Bookboyfriends und die Leidenschaft zum Lesen auszutauschen und habe angefangen, YouTube-Videos von anderen BookTubern zu schauen. Irgendwann hat mir das aber auch nicht mehr gereicht und ich wollte selbst über Bücher sprechen. So kam es, dass ich meinen YouTube-Kanal eröffnet und dort über vier Jahre wöchentlich Videos hochgeladen habe. Mit der Zeit kamen immer mehr Menschen dazu, die meine Videos regelmäßig geschaut, kommentiert und gelikt haben, was mich riesig gefreut hat! Das größte Kompliment war es immer, wenn Leute sich auf meine Empfehlung hin Bücher gekauft haben und so teilweise auch neue Lieblingsbücher entdecken konnten. Mittlerweile finde ich leider nicht mehr die Zeit für YouTube-Videos, blicke aber unheimlich gerne auf diese Zeit zurück, da sie mich als Person auch sehr geprägt hat.
Hat dich die Arbeit an deinem YouTube-Kanal auch beruflich inspiriert oder weitergebracht?
Durch YouTube habe ich auf jeden Fall meine Leidenschaft dafür entdeckt, andere Menschen für Bücher zu begeistern. Deshalb war für mich nach meinem Studium klar, dass ich diese auch gerne für die Arbeit im Marketing in einem Verlag nutzen möchte. Außerdem konnte ich mir durch meinen YouTube-Kanal einige Kenntnisse zu Video- und Bildbearbeitungsprogrammen sowie Analytics aneignen, die mir definitiv auch bei meiner Bewerbung bei Ullstein geholfen haben und mir für meine tägliche Arbeit von Vorteil sind. Ich denke, dass meine Videos wie eine Art Arbeitsprobe waren, die gezeigt hat, dass ich kreativ arbeiten kann und weiß, wie man eine Community aufbaut.
Hast du eine aktuelle Buchempfehlung?
Ich freue mich wahnsinnig auf „Dark Venice – Deep Water“ von Antonia Wesseling, was am 17. Oktober 2024 im Forever Verlag erscheint. Darin treffen die Tropes Dark-Academia und Haters-to-Lovers auf die Lagunenstadt Venedig, die für mich ein totaler Sehnsuchtsort ist. Darin begleiten wir Merle für ein Auslandssemester, bei dem sie aber vor allem einem Familiengeheimnis auf die Schliche kommen will. Das Cover ist auch aktuell mein allerliebstes bei Forever!
Gibt es bestimmte Trends, die du im Digital Marketing beobachtest?
Aktuell hat TikTok, vor allem durch #BookTok, auch seinen festen Platz im Digital Marketing von den meisten Verlagen und ich denke, dass die Plattform auch weiterhin sehr relevant für unsere Branche sein wird. Insbesondere um junge Menschen zu erreichen und für Bücher zu begeistern, ist TikTok die momentan beste Möglichkeit. Man hat hier durch virale Videos die Chance, mit einfachen Templates oder Sounds hunderttausende Menschen für ein Buch oder eine Marke zu begeistern, was zum einen sehr viel Spaß macht und Kreativität erfordert und zum anderen eine wirklich günstige Marketingmaßnahme ist. Ich bin gespannt, welche anderen Trends, Plattformen oder Technologien in Zukunft immer relevanter werden und wie wir diese wiederum für unsere Bücher sowie Ullstein als Marke nutzen können.
Das Interview führte Antonia Faupel
Von Frauen, die wir vergessen haben

„Geschichte, die. Substantiv, feminin. Politischer, kultureller und gesellschaftlicher Werdegang […]“ Tippt man den Begriff „Geschichte“ in die Google-Suchleiste ein, taucht schnell diese Definition des Dudens auf. Dass der Begriff „Geschichte“ grammatikalisch weiblich ist, ist klar. Wie kommt es aber, dass dem (historisch gesehen) gar nicht so ist? Zumindest aus unserer heutigen, eurozentrischen und vom Patriarchat geprägten Perspektive. Die großen Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Philosophen, Genies und Erfinder, die unsere Gesellschaft und unsere Sicht auf die Welt maßgeblich mitgestaltet haben, haben durch die Jahrhunderte hinweg eines gemeinsam – sie sind männlich.
Johann Wolfgang von Goethe, Pablo Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, René Descartes, Immanuel Kant, Otto Hahn. Das sind die Namen, die mir zuerst einfallen, wenn ich spontan nach historisch bedeutenden Menschen gefragt werden würde. Allesamt europäische und weiße Männer, die als Genies bezeichnet werden. Wir lesen ihre Literatur in der Schule und lernen über sie im Physik- und Kunstunterricht. Wir wachsen mit der Vorstellung auf, unsere Geschichte sei geprägt von großen Denkern und Künstlern. Frauen spielen keine Rolle – zumindest keine sichtbare. Die wenigen Namen, die wir heute kennen, wie Marie Curie, Jane Austen, Virginia Woolf oder Simone de Beauvoir, bilden die große Ausnahme und untermauern die Grundidee des Patriarchats: dass Frauen Männern in sämtlichen Bereichen unterlegen waren und sind; weniger klug, weniger politisch, weniger gebildet. Frauen
bekommen seltener Nobelpreise verliehen, sind seltener in der Geschichte präsent und wenn, dann als schmückendes Beiwerk oder als diejenige, die „dem Mann zuhause den Rücken freihält“. Nicht selten war es jedoch so, dass Frauen mit den Männern gemeinsam arbeiteten, in einigen Fällen sogar ein Großteil der (in der Regel unbezahlten) Arbeit erledigten und bestenfalls eine wohlwollende Bemerkung im Vorwort dafür erhielten. Der eigentliche Grund, weshalb wir Frauen so selten in Geschichtsbüchern finden, ist natürlich nicht, dass sie weniger klug oder fähig waren als ihre männlichen Kollegen. Stattdessen sorgen die strukturelle Benachteiligung, der oftmals verweigerte Zugang zu Bildung und die vom Patriarchat geprägte Rolle der Frau in der Gesellschaft dafür, dass die Leistungen von Frauen belächelt, ignoriert oder Männern zugeschustert wurden.
Der Matilda-Effekt
Die Tatsache, dass Frauen vor allem in der Wissenschaft strukturell übergangen und nicht für ihre Leistungen gewürdigt werden, hat einen Namen: Matilda-Effekt. Benannt wurde dieser nach der Frauenrechtlerin und Soziologin Matilda Joslyn Gage, die 1870 das Essay „Woman as Inventor“ verfasste. Darin wies sie darauf hin, dass die Erfindung der Egreniermaschine (einer Entkörnungsmaschine, die die Baumwollproduktion in den USA revolutionierte) statt auf den Erfinder Eli Whitney zu großen Teilen auf eine Frau, Catherine Littlefield Greene, zurückzuführen war. Die Historikerin Margaret Rossiter bezog sich 1993 auf Gage in ihrer Veröffentlichung „The Matilda Effect in Science“ und benannte so erstmals das Phänomen übergangener Frauen in der Wissenschaft. Eines der bekanntesten Beispiele für den MatildaEffekt ist die Biochemikerin Dr. Rosalind Franklin. Franklin forschte seit 1950 am Londoner Kings College an der Strukturanalyse der DNA. Sie nutzte dazu Röntgenstrahlung, mit der ihr am 2. Mai 1952 die berühmte Aufnahme 51 gelang, die zur Entschlüsselung des Aufbaus der DNA essenziell wurde. Der Nobelpreis für diese Entdeckung ging jedoch in der Kategorie Medizin 1962 an Maurice Wilkins, Francis Crick und James Watson. Wilkins hatte mit Rosalind Franklin zusammengearbeitet und Franklins Forschungsbericht unter der Hand an Crick und Watson weitergegeben, die an der Universität Cambridge am gleichen Problem forschten. 1968 berichtete James Watson dann in seiner autobiografischen Erzählung „Die Doppelhelix“, dass sie die von Franklin erhobenen Daten gestohlen und als ihre eigenen ausgegeben haben. Dr. Rosalind Franklin hat das allerdings schon nicht
mehr mitbekommen – sie starb im Jahr 1958 an Eierstockkrebs, möglicherweise hervorgerufen durch die Belastung mit Röntgenstrahlung.
Die Frau von…
Eine weitere Frau, die hinter Männern unsichtbar gemacht wurde und von der wir heute nur den berühmten Ehemann kennen, ist Mileva Marić. Marić war eine der ersten Frauen, die ein Physik- und Mathematikstudium an einer deutschsprachigen Hochschule aufnehmen durfte. Obwohl es für Mädchen für die Zeit um 1880 sehr unüblich war, erhielt Mileva von ihren Eltern eine erstklassige Ausbildung an verschiedenen renommierten Schulen. Ab 1890 besuchte sie als vermutlich einziges Mädchen das königlich serbische Elitegymnasium in Zagreb. Sie benötigte eine Sondergenehmigung, um dem Physikunterricht beizuwohnen, der ansonsten nur Jungen vorbehalten war. Sie studierte unter anderem am Polytechnikum in Zürich und traf dort 1896 erstmals ihren Kommilitonen und späteren Ehemann Albert Einstein. 1903 heirateten Einstein und Marić, 1905 veröffentlichte Einstein die Relativitätstheorie, die ihn weltberühmt machen sollte. Seit Beginn der 1990er Jahre werden immer mehr Stimmen laut, die den Anteil Milevas an den Veröffentlichungen ihres Ehemannes infrage stellen. Der Mitbegründer der Annalen der Physik, der Fachzeitschrift, in der einige Arbeiten Einsteins veröffentlicht wurden, erinnert sich etwa daran, dass die eingeschickten Arbeiten mit Einstein-Marity statt mit Einstein unterschrieben worden waren (Marity ist die ungarische Schreibweise des Namens Marić). Auch sind Manuskripte einer Vorlesung Einsteins von 1910 in Milevas Handschrift verfasst. Wie genau das Ehepaar Einstein zusammengearbeitet hat, lässt sich heute nicht mehr sagen, Mileva scheint allerdings mindestens als unbezahlte Sekretärin für ihn gearbeitet zu haben. 1919 ließ sich Albert Einstein jedoch von ihr scheiden und verließ sie und ihre beiden Söhne, um in Berlin seine Cousine Elsa Einstein zu heiraten.
Unter falschem Namen
Es gibt allerdings auch Frauen, deren Werke wir bis heute kennen und die ausgezeichnet wurden – so etwa der Roman „Middlemarch“, geschrieben von der britischen Schriftstellerin Mary Anne Evans, der 2015 von einer Auswahl internationaler Literaturkritiker:innen zum bedeutendsten britischen Roman gekürt wurde. Den Autor des Werkes kennen wir allerdings unter einem anderen Namen: George Eliot. Evans
veröffentlichte unter diesem Pseudonym mehrere Gesellschaftsromane, die zu Bestsellern wurden und heute als Klassiker gelten. 1819 geboren, erhielt auch sie eine ungewöhnlich umfassende Bildung für eine Frau ihrer Zeit und lebte später offen mit dem verheirateten Autor George Henry Lewes zusammen, wofür sie in der Londoner Gesellschaft gemieden und verachtet wurde. Als George Eliot wurde sie berühmt, was sie unter ihrem weiblichen Namen zu dieser Zeit nicht geschafft hätte. Literatur von Frauen kann, so die allgemeine Ansicht, keine anspruchsvolle oder gar politische Literatur sein; die „richtigen“ und ernstzunehmenden Werke werden von Männern verfasst. Nicht nur Evans schrieb unter einem Alias, auch Charlotte Brontë (Currer Bell), Emily Brontë (Ellis Bell) und Anne Brontë (Acton Bell) veröffentlichten ihre Romane ursprünglich unter falschen, männlichen Namen. Die Brontë-Schwestern erkannten, dass die Veröffentlichungen von Frauen mit Vorurteilen behaftet sind und dass sie größeren Erfolg erzielen, wenn ein Mann als Autor auf dem Cover steht.
Eine Frage der Perspektive
Diese Namen und Geschichten sind nur wenige der heute bekannten Beispiele für die strukturelle Unterdrückung und Verdrängung von Frauen aus sämtlichen Bereichen der Gesellschaft, die nicht ihrer „natürlichen“ Aufgabe entsprachen (liebende Ehefrau und aufopferungsvolle Mutter zu sein). Nichtsdestotrotz gab es und gibt es auch heute noch zahlreiche Frauen und diskriminierte, marginalisierte Gruppen, die von patriarchalischen Strukturen unterdrückt und so daran gehindert werden, selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir die Welt und die Geschichte durch die Brille eines weißen Mannes sehen und dürfen daher nicht aufhören, über diejenigen zu sprechen, die unsichtbar gemacht und vergessen wurden. Denn es gab Frauen in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Musik, es gab sie als Kriegerin, Erfinderin und Herrscherin. Wir müssen sie nur sichtbar machen.
Mira Krevet

Kampfsport hat in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen. In dem Zuge finden auch immer mehr FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, Intersexuelle, nichtbinäre, trans und agender) ihre Wege ins Gym, um Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Boxen oder andere Kampfsportarten zu trainieren. Das Ausüben des Sports ist nicht nur Selbstzweck, sondern bedeutet auch sich immer in männlich dominierten Räumen behaupten zu müssen. Welche Kämpfe müssen FLINTA*-Personen in diesen Räumen bestreiten?
Ordentlich draufhauen, stark sein und souverän auftreten –typische Merkmale, die Männern, die Kampfsport trainieren, zugeschrieben werden. Um erfolgreich zu kämpfen, braucht es Eigenschaften wie ein gutes Reaktionsvermögen, technisches Wissen, taktische Vorgehensweise, eine entspannte Psyche, gute Kondition, Muskelausdauer und die Beherrschung des eigenen Körpers. Keine dieser Eigenschaften ist per se männlich oder anderweitig geschlechterbezogen. Trotz dieser Fakten wird häufig davon ausgegangen, ein Mann sei einer FLINTA*-Person körperlich überlegen, obwohl dafür die oben aufgezählten Eigenschaften vielbedeutender sind, als die Fähigkeit, Muskeln aufzubauen. Diese Fähigkeiten zu erlangen ist für jede Person, unabhängig des Geschlechts, möglich. Es ist allerdings noch keine Selbstverständlichkeit, als FLINTA*-Person Kampfsport zu trainieren. Kämpfen wird oftmals sowieso nur für FLINTA*-Personen im Kontext der Selbstverteidigung relevant. Manchmal, wenn es schon zu spät ist. Es wäre wünschenswert, wenn mehr Gyms Angebote und Bildungseinrichtungen Kurse für (junge) FLINTA*-Personen anbieten würden. Wie wäre unsere Gesellschaft, wenn es zur Normalität wird, dass auch FLINTA*-Personen Männern im Kampf gleichgestellt sind? Gäbe es dann weniger sexistisch motivierte Gewalt?
Ständige Konfrontation mit Sexismus
In patriarchal dominierten Kampfsportschulen erleben FLINTA*-Personen oft eine Politisierung ihrer Körper. Doch statt einer inklusiven und unterstützenden Umgebung treffen sie häufig auf ein stark ausgeprägtes Konkurrenzverhalten von Männern, das nicht selten durch Machtdemonstrationen und Dominanzverhalten geprägt ist. Diese Verhaltensweisen reflektieren tief verwurzelte patriarchale Strukturen, die den männlichen Körper als Norm und den FLINTA*-Körper als das Andere definieren. Oft werden FLINTA*-Personen unterschätzt, wie oben schon diskutiert,
FLINTA*-Personen in der Kampfsportwelt

als schwächer oder weniger fähig betrachtet, was sich in der Trainingsdynamik niederschlägt. Entweder werden diese Personen übermäßig geschont, besonders stark herausgefordert oder ihr Können wird ungefragt kommentiert, um Überlegenheit zu demonstrieren. Davon abgesehen sind sie in Trainings oft die Minderheit. Diese Diskrepanz erzeugt nicht nur ein Gefühl der Fremdheit und Isolation, sondern verstärkt auch die bereits vorhandene Geschlechterungleichheit innerhalb des Trainings. Es entsteht ein toxisches Umfeld, in dem FLINTA*-Personen ihren Körper ständig als politisches Terrain verteidigen müssen, anstatt sich auf das eigentliche Training zu konzentrieren. Mangelnde weibliche oder queere Vorbilder in Trainer:innenpositionen und fehlende geschlechtersensible Trainingsmethoden tragen dazu bei, dass FLINTA*-Personen sich nicht voll entfalten können. Die Notwendigkeit einer Veränderung ist offensichtlich: Kampfsportschulen müssen aktiv Maßnahmen ergreifen, um eine inklusive und respektvolle Atmosphäre zu schaffen. Dazu gehört die Schulung des Personals im Umgang mit Diversität, die Förderung von FLINTA*-Personen in Führungsrollen und die Etablierung eines klaren Verhaltenskodex gegen diskriminierendes Verhalten. Nur durch solche gezielten Anstrengungen kann der Kampfsport zu einem Raum werden, in dem alle Körper – unabhängig von Geschlecht, Identität und Herkunft – respektiert werden.

Lu Hilgers
Die Vorteile von BJJ für FLINTA*

In einer Gesellschaft, in der Selbstverteidigung, körperliche Fitness und mentale Stärke immer wichtiger werden, bietet Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) eine besonders wertvolle Möglichkeit für FLINTA* (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen). Diese Kampfsportart fördert nicht nur physische Gesundheit, sondern auch das Selbstvertrauen und die psychische Widerstandsfähigkeit. Doch was steckt eigentlich hinter BJJ und wie hat sich dieser Kampfsport entwickelt?
Brazilian Jiu-Jitsu hat seine Wurzeln in den traditionellen japanischen Kampfkünsten, insbesondere dem Judo. Anfang des 20. Jahrhunderts brachte der japanische Judo-Meister Mitsuyo Maeda seine Kenntnisse nach Brasilien, wo er sie an die Gracie-Familie weitergab. Die Gracies entwickelten die Techniken weiter und passten sie an, wobei sie besonderen Wert darauflegten, dass auch kleinere und schwächere Personen gegen größere und stärkere Gegner:innen bestehen können. So entstand ein neuer Kampfsport, der sich durch seine Effektivität im Bodenkampf und seine vielseitigen Hebel- und Würgetechniken auszeichnet.
Effektive Selbstverteidigung
BJJ ist eine der effektivsten Selbstverteidigungstechniken, die speziell darauf abzielt, dass auch kleinere und physisch schwächere Personen gegen größere und stärkere Angreifer:innen bestehen können. Durch den Einsatz von Hebeltechniken und Körpergewicht kann man Angreifer:innen kontrollieren und überwältigen, unabhängig von deren körperlicher Überlegenheit. Für FLINTA* ist dies besonders wichtig, da sie oft physisch unterlegen sind und in gefährlichen Situationen die Fähigkeit brauchen, sich selbstbewusst verteidigen zu können. Statistiken zeigen, dass FLINTA* häufig Opfer von Gewalt werden. Eine Studie des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) ergab, dass jede dritte Frau in der EU körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt hat. Die Zahlen für trans und nicht-binäre Personen sind noch alarmierender. Angesichts dieser erschreckenden Realität ist es umso wichtiger, dass FLINTA* Zugang zu effektiven Selbstverteidigungsmethoden wie BJJ haben.
Körperliche Fitness und Gesundheit
Das Training im BJJ bietet ein Ganzkörper-Workout, das die kardiovaskuläre Fitness verbessert, die Muskulatur stärkt
und die Flexibilität erhöht. Regelmäßiges Training hilft dabei, Kalorien zu verbrennen und einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Zudem trägt körperliche Aktivität wesentlich zur mentalen Gesundheit bei, reduziert Stress und steigert das allgemeine Wohlbefinden.
Selbstbewusstsein und mentale Stärke
BJJ stellt sowohl physische als auch mentale Herausforderungen. Das Erlernen und Anwenden der Techniken erfordert Geduld, Disziplin und Ausdauer. FLINTA* profitieren besonders von der mentalen Stärke, die sie durch das Training entwickeln. Das Erreichen von Fortschritten und das Meistern von Herausforderungen im BJJ führt zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein, das sich auch positiv auf andere Lebensbereiche auswirkt.
Gemeinschaft und Unterstützung
BJJ-Trainingsstätten sind oft eng verbundene Gemeinschaften, die Unterstützung und Zusammenhalt bieten. Für FLINTA* kann dies besonders wertvoll sein, da sie sich in einem Umfeld wiederfinden, das Respekt und Inklusion fördert. Die Trainingspartner:innen werden zu Freund:innen und Verbündeten, die einander auf dem Weg des persönlichen Wachstums unterstützen. Diese Gemeinschaft kann ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln und soziale Isolation verringern.
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität
Eine der größten Stärken von BJJ ist seine Anpassungsfähigkeit. Die Techniken lassen sich an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten anpassen, was es für Menschen aller Altersgruppen und Fitnesslevel geeignet macht. Egal, ob man Anfänger:in ist oder bereits Erfahrung in anderen Kampfsportarten hat, BJJ bietet immer neue Lernmöglichkeiten und Herausforderungen. Brazilian Jiu-Jitsu ist mehr als nur eine Kampfsportart. Für FLINTA* bietet es eine Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, körperlich fit zu bleiben, mentale Stärke zu entwickeln und Teil einer unterstützenden Gemeinschaft zu werden. Die Vorteile, die BJJ bietet, sind vielfältig und tiefgreifend. Es lohnt sich, diese Reise zu beginnen und die transformative Kraft des BJJ zu entdecken.
Maximilian Konrad
Mit Luca Graf im Interview über den Profifußball der Frauen
Auf dem Arbeitsmarkt herrscht bis heute immer noch eine Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau, ob es um die Bezahlung oder die Präsenz in den Führungspositionen geht. Auch im Profisport zeigt sich immer noch ein gewaltiger Unterschied zwischen Männern und Frauen. Vor allem im Profifußball hört man bei den männlichen Stars von surrealen Summen, wenn es um das Gehalt der Profis geht. Dahingegen wächst der Frauenprofifußball zwar immer mehr, doch hier werden keine Millionengehälter von Profifußballerinnen auf Social Media geteilt.
Der Gender Pay Gap, der den Unterschied in der Bezahlung von Frau und Mann in der gleichen beruflichen Position beschreibt, ist in der Branche des Profifußballs enorm. Aber auch von schlechteren Trainingsbedingungen und weitaus niedrigeren Marketingbudgets hört man immer wieder, wenn es um den Profifußball der Frauen im Gegensatz zu dem der Männer geht. Zudem ist der Eintritt für Frauen in diesen Job auch schwerer durch die fehlende Förderung der weiblichen Jugendmannschaften. Oft ist die Rede davon, der Frauenfußball sei nicht so gefragt oder die Spielerinnen würden einfach nicht so gut spielen wie ihre männlichen Kollegen. Fakt ist: Frauen spielen auf dem gleichen Niveau und durch schlechtere Bedingungen im Verein und fehlende Marketingpräsenz kann auch schlecht die Nachfrage im Positiven beeinflusst werden.
Ich durfte ein Interview mit der Profispielerin Luca Maria Graf führen, um sie zu ihrer Erfahrung und ihrer Karriere als weiblichem Fußballprofi zu befragen. Luca Graf ist Mittelfeldspielerin beim Frauenteam des Vereins RB Leipzig und spielt dort bereits seit 2022. Das Frauenteam von RB Leipzig spielt, wie das Profimännerteam auch, in der Ersten Bundesliga.
Seit wann spielst du Fußball und war es schon immer dein Traum Fußballprofi zu werden?
Schon als kleines Kind bin ich viel mit dem Ball umhergelaufen. Seit meinem sechsten Lebensjahr spiele ich in einem Verein Fußball. Der Traum entwickelte sich mit der Zeit. Ich habe diesen Weg nicht sofort wahrgenommen. Wenn ich es zeitlich definieren müsste, dann würde ich sagen, dass ich erst, als ich von der Sportschule in Leipzig auf die Sportschule in Jena gewechselt bin, es realisiert habe. Ich bin mit meiner Freude und Leidenschaft am Fußball meinen bisherigen Weg gegangen und möchte dies mir beibehalten.
Hattest du als Kind nur männliche Vorbilder im Profifußball oder auch weibliche?
Zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Fußballspielen angefangen habe, wurden wesentlich mehr Spiele der Männer übertragen. Aufgrund dessen waren sie für mich präsenter und ich hatte zu Beginn vermehrt männliche Vorbilder. Doch ich wechselte schon mit zirka neun Jahren zu den Mädchen vom 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Frauenmannschaft hat damals in der Bundesliga gespielt. Als Ballmädchen kam ich in den Kontakt mit Spielerinnen meines Vereins und generell mit weiteren Mannschaften. Dies und natürlich auch die Turniere der Frauen haben mich dazu bewegt, auch Frauen als Vorbilder zu haben.
Hast du früher in den Jugendmannschaften in einer Mädchenmannschaft trainiert oder mit den Jungen?
Wie bereits erwähnt habe ich, bis ich neun Jahre alt war, in einer Jungenmannschaft gespielt. Erst beziehungsweise schon in der E-Jugend habe ich bei den Mädchen gekickt. Ich denke, es ist anhand eines Beispiels nur schwer widerzuspiegeln, wie es als junges Mädchen ist, in einer Jungenmannschaft zu spielen. Dies kann von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich sein. Ich habe mit meiner Zwillingsschwester angefangen zu spielen. Wir hatten es nicht immer leicht, vom Trainer Spielzeit zu bekommen, dennoch hatten wir Spaß und wurden von den Jungs gut aufgenommen.

Fühlst du dich im Gegensatz zu den Männern, welche auf dem gleichen Niveau spielen wie du, gerecht entlohnt, auch in Bezug auf die Anerkennung im deutschen Fußball?
Sowohl wir Frauen, als auch die Männer von RB Leipzig, spielen in der höchsten Liga Deutschlands.

Es ist kein Geheimnis, dass Unterschiede zwischen diesen beiden Mannschaften, beziehungsweise ganz allgemein zwischen der Ersten Bundesliga der Männer und der Ersten Bundesliga der Frauen existieren. Ganz vom finanziellen Aspekt abgesehen haben wir auch unterschiedliche infrastrukturelle Bedingungen. Durch die Erfolge der deutschen Frauennationalmannschaft und durch die Steigerung der Attraktivität der Spiele gewinnt auch der „Frauenfußball“ immer mehr an Aufmerksamkeit und Bedeutung. Die Zuschauer:innenzahlen und die Übertragungen der Spiele werden immer mehr, das Team hinter dem Team wird größer und es geht langsam in die richtige Richtung.
Habt ihr Frauen dieselben Trainingsbedingungen wie die Männer?
Auch wir Frauen haben gute Bedingungen und profitieren von den Trainingsmöglichkeiten der Männer. Doch die gleichen Bedingungen haben wir leider noch nicht. Hier wird aber auch fast täglich nach Lösungen gesucht, um dies zu verbessern und uns noch professionellere Möglichkeiten zu bieten.
Kannst du langfristig von dem Beruf als Profifußballerin leben oder machst du noch etwas nebenbei?
©pexels
Langfristig gesehen kann ich leider noch nicht von meinem Beruf leben. Aber ich kann mir etwas beiseitelegen. Um mir ein zweites Standbein aufzubauen, auch für die Karriere nach der Karriere, studiere ich Sporttherapie und Prävention.
Unabhängig vom Geld würde ich dies allerdings auch machen. Mir tut es gut, neben dem Fußball noch einen Ausgleich zu haben und immer mal wieder in eine andere Bubble abzutauchen.
Was würdest du dir für die Zukunft für den Frauenfußball oder den gesamten Profifußball wünschen
Ich wünsche mir, dass wir mit dem Fußball weiterhin uns und viele Menschen glücklich machen und ihnen eine Freude bereiten. Dass wir Menschen zusammenbringen können, Werte und Vorstellungen vermitteln und diese Plattform öfters nutzen. Ich möchte, dass trotz der Bühne des Fußballs auch die Sportler:innen als Menschen angesehen und wertgeschätzt werden. Uns Frauen wünsche ich weiterhin den Zuwachs an Aufmerksamkeit, Unterstützung, Schaffung von optimalen Bedingungen und die Professionalisierung für die gesamte Bundesliga, um auch einen fairen Wettkampf zu schaffen. Es wäre schön, auch die Nachwuchsförderung und die Ligen unterhalb der Zweiten Bundesliga qualitativ zu verbessern und in diese zu investieren.
Artikel und Interview von Tillmann Richter
Geballtes Fachwissen für den erfolgreichen Berufseinstieg
Leitfaden Freies Lektorat
12., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2023
VFLL e. V. (Hrsg.), Bramann Verlag
Hardcover: ISBN 978-3-95903-021-2
320 Seiten
Preis: 44,00 Euro
VFLL-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 30 % auf den gebundenen Ladenpreis.
E-Book: ISBN 978-3-95903-113-4
Format: EPUB ohne DRM
Preis: 24,99 Euro www.vfll.de/leitfaden

Handbuch Übersetzungslektorat
1. Auflage 2023
VFLL e. V. (Hrsg.), BDÜ Fachverlag
Softcover: ISBN 978-3-946702-24-5
190 Seiten
Preis: 43,00 Euro
www.vfll.de/handbuchübersetzungslektorat
Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren e. V.

Warum auch Frauen misogyn sind und was Frau dagegen tun kann
„Women hate women and men hate women. It‘s the only thing we all agree on.“ – Ferrera, America (2023): Barbie [Film], USA: LuckyChap Entertainment Zu Deutsch: „Frauen hassen Frauen und Männer hassen Frauen. Es ist das Einzige, worüber wir uns alle einig sind.“ Aber warum ist das so? Dass Männer Frauen hassen und das Patriarchat FLINTA*-Personen unterdrückt, ist für die meisten schon lange kein Geheimnis mehr. Aber dass auch Frauen andere Frauen hassen – diese Erkenntnis schmerzt ziemlich. Was ist mit „Girls Support Girls“ und female empowerment? Diese Frage lässt sich mit einem Begriff beantworten: Internalisierte Misogynie.
Sexismus und Misogynie, also die Abwertung des Weiblichen, werden fälschlicherweise häufig nur Männern angelastet. Was dabei jedoch außer Blick gelassen wird, ist, dass es in einer von Sexismus geprägten Gesellschaft fast unumgänglich ist, frauenfeindliche Weltbilder bewusst oder unbewusst zu übernehmen – und das auch als Frau. Alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht, verinnerlichen diese misogynen Denkmuster über die psychosoziale Entwicklung, durch Sozialisation und Habitualisierung. Dies beginnt bereits bei unserer Sprache.
Die Abwertung von Weiblichkeit durch Sprache
Googlet man Synonyme für „männlich“, finden sich auf vielen Webseiten noch immer Adjektive wie „belastbar“, „kräftig“, „tapfer“ und „unbeugsam“. Will man hingegen Synonyme für „weiblich“ wissen, stößt man auf „verweichlicht“, „verzärtelt“ und „wehleidig“. Das Weibliche wird von vielen Menschen nach wie vor als schwach und unterlegen angesehen, während Männlichkeit mit Tapferkeit und Kraft assoziiert wird. Das wird auch in der alltäglichen Sprache von Kindern und Jugendlichen deutlich. Machst du etwas Mutiges und behauptest dich, dann „hast du Eier“. Eine vermeintlich ängstliche Person muss sich hingegen Sachen anhören wie „Sei doch nicht so eine Pussy“ oder „Du heulst wie ein kleines Mädchen“. Dass diese Bezeichnungen schlechtweg sexistisch sind, sollte hoffentlich allen klar sein. Und doch finden sich die Ausdrücke immer noch im täglichen Sprachgebrauch vieler wieder und untergraben damit die Stärke von Frauen.
Auch wenn über Fan-Liebe gesprochen wird, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für männliche und weibliche Fans. Letztere werden häufig als „hysterisch“, „peinlich“ und
„übertrieben“ bezeichnet, wenn sie aufgeregt auf ein Konzert ihrer Lieblingspopsänger:innen gehen. Fließt bei dem ein oder anderen männlichen Fußballfan aber mal eine Träne, weil der Lieblingsverein aufgestiegen ist, so wird stets von treuer, stolzer Fan-Liebe gesprochen. Gleichzeitig sind auch die Fußballspieler „Macher“ und haben sich ihren Erfolg durch harte Arbeit verdient, während man bei weltberühmten Popsängerinnen wie Taylor Swift immer wieder Kommentare liest wie „Die Frau ist mit Abstand die überschätzteste Musikerin aller Zeiten“ oder „Selten hat jemand den Hype so unverdient bekommen wie sie. Absolute 0815 Musik, wo jedes Lied absolut gleich klingt“. Diese Kommentare stammen gleichermaßen von Männern wie von Frauen, denn auch beim Thema Erfolgsneid spielt die internalisierte Misogynie eine große Rolle. Es ist jedoch schwer, etwas dagegen zu tun, denn die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen wird uns bereits in der Kindheit beigebracht, etwa in unseren liebsten Disneyfilmen.
Die Präsentation von Frauenfiguren in Disneyfilmen
Obwohl weibliche Charaktere in vielen Disneyfilmen die Hauptcharaktere sind, sehen die Statistiken zur Verteilung der Sprechzeiten von weiblichen und männlichen Figuren oft erschreckend aus. Mulan zum Beispiel, die im gleichnamigen Film quasi ganz China rettet, muss sich in ihrem eigenen Film gegen 75 Prozent männliche Redezeit behaupten. Sogar ihr kleiner, mit männlichen Attributen versehener Drache hat doppelt so viel Redezeit wie sie selbst. Auch in dem Film „Pocahontas“, der ebenfalls nach der weiblichen Protagonistin benannt ist, stehen circa 75 Prozent männlicher Redezeit den 25 Prozent weiblicher gegenüber. Noch schlimmer sieht es aus bei „Aladdin“. Yasmin als eine der wichtigsten Figuren, die sich im Film gegen Bevormundung wehrt, muss gegen 90 Prozent männlicher Redezeit ankommen. Diese ungleichmäßigen Verteilungen bleiben nicht ohne Folgen. Von klein auf werden wir mit Filmen konfrontiert, in denen Frauen, sogar als Protagonistinnen, kaum etwas zu sagen haben und männliche Redezeit klar dominiert. Das überträgt sich auch auf die Realität. Frauen, die viel und laut reden, werden oft als „zu viel“ und aufdringlich bezeichnet. Währenddessen trauen sich andere gar nicht erst viel zu sagen, da sie nicht zu viel Raum einnehmen und lästig rüberkommen wollen. Es ist an dieser Stelle jedoch wichtig hervorzuheben, dass das nicht die Schuld von Frauen ist. Genauso wenig tragen die meisten Männer Schuld daran.

Es ist vielmehr das patriarchale System, in das wir alle hineingeboren werden. Dennoch schlägt sich die internalisierte Misogynie, wenn auch oft ungewollt, im Verhalten vieler Frauen nieder und führt zu Konzepten, die uns allen vertraut sein sollten.
„Ich bin nicht wie andere Frauen“
Schon mal gehört? Internalisierte Misogynie bringt unter anderem das Konzept von sogenannten Pick me Girls hervor. Mit dem Begriff werden Frauen beschrieben, die sich bewusst von anderen Frauen abgrenzen wollen, indem sie betonen, wie anders und besonders sie doch sind. Dabei werten sie ihre eigene Geschlechtergruppe ab, um sich selbst als eine bessere Option zu präsentieren. Obwohl gar nichts verkehrt daran ist, zu sein wie andere Frauen. Doch das Patriarchat und die Stereotype, die seit Jahrhunderten existieren, vermitteln uns, dass wir stets in Konkurrenz zueinanderstehen. Und, dass wir uns hervorheben müssen, um von Männern anerkannt und als attraktiv angesehen zu werden.
Auch das direkte Abwerten und Kritisieren anderer Frauen, etwa aufgrund ihres Aussehens, ihrer Kleidung oder ihres Verhaltens finden ihren Ursprung in der internalisierten Misogynie. Dazu zählt unter anderem das Slut-Shaming einer anderen Frau bei wechselnden Sexualpartner:innen. Aber auch die klassischen Schönheitsstandards und das Beurteilen des eigenen Körpers sowie die Körper anderer nach gesellschaftlichen Schönheitsidealen werden dadurch weiter vorangetrieben. Auch hier spielt wieder das Konkurrenzdenken eine große Rolle, dass viele von uns ungewollt verinnerlicht haben.
Die Liste an Verhaltensweisen, die die internalisierte Misogynie ausdrücken, könnte an dieser Stelle noch viel weitergehen.
Zum Beispiel bei der Beurteilung der Entscheidung für oder gegen die Mutterschaft. All das ist uns vertraut und zumeist verhasst, aber kann man überhaupt etwas dagegen tun?
Smash internalized misogyny
Das Problem der internalisierten Misogynie ist ein tief verwurzeltes, das sich nicht von heute auf morgen lösen lässt. Solange wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen zwar rechtlich gleichgestellt sind, in der FLINTA*Personen aber dennoch unterdrückt werden, kann auch die Misogynie im Allgemeinen nicht abnehmen. Die Übernahme stereotyper Verhaltensweisen und die Unterstützung frauenfeindlicher Einstellungen wird noch eine ganze Weile ein großes Problem bleiben, vor allem, da das in den meisten Fällen unbewusst passiert. Oft fühlt es sich nicht einmal wie Diskriminierung an, sondern vielmehr wie die Meinung einer Einzelperson. Ein System dahinter erkennt man manchmal erst auf den zweiten Blick. Umso wichtiger ist es, sich dahingehend zu bilden und sich mit dem Thema internalisierter Misogynie auseinanderzusetzen, denn vielen Menschen ist das nicht einmal ein Begriff. Es ist wichtig, sich ein Bewusstsein für die eigenen fehlerhaften Verhaltensweisen zu schaffen und diese zu verändern, aber auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen und ihnen beim Lernen zu helfen. Denn nur durch Aufklärung, Selbstreflexion und das Erlernen von Solidarität ist die Befreiung von diesen alten Denkmustern und eine Gesellschaft, in der Misogynie ein Fremdwort ist, möglich.
Wanda Hitzing
Das Sexobjekt Frau in Film und Fernsehen
Auch Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts kommt es immer noch zu häufig zur Übersexualisierung von Frauen in Film und Fernsehen. Frauen werden auf ihre körperlichen Reize reduziert und in einer objektifizierten Art und Weise dargestellt.
Viele Frauenfiguren entsprechen gängigen Stereotypen wie der attraktiven Blondine oder der verführerischen Femme Fatale. Dabei werden häufig Aussehen und ihre Sexualität in den Vordergrund gestellt, während Persönlichkeit und Charakterzüge in den Hintergrund treten. Dies verstärkt die Reduzierung von Frauen auf ihr Äußeres. Deutlich wird das auch in den 007-Reihen um James Bond. Die schauspielerischen Leistungen von Halle Berry oder Gemma Arterton bleiben doch weniger häufig in Erinnerung als ihr Auftreten in figurbetonten Kleidern oder die verführerischen Szenen mit Herrn Bond selbst.
Besondere Kameraführung und kostümiertes Auftreten
Szenische Darstellungen vertiefen dieses überbetonte Bild in den meisten Fällen, da die Kameraführung dazu neigt Kurven und Körperformen weiblicher Charaktere zu fokussieren. Hinzu kommen oft auch aufreizende oder freizügige Kostüme, welche weniger der Handlung dienen, als primär der Objektifizierung und Sexualisierung der Frau.
Die Rettungsschwimmerin Casey Jean „C. J.“ Parker (verkörpert von Pamela Anderson) soll in der Fernsehserie „Baywatch“ Menschen vor dem Ertrinken bewahren und somit Leben retten. Stattdessen rennt sie mit einem knappen, feuerroten Badeanzug und langen, blonden, im Wind wehenden Haaren über den Strand von Malibu. Solche Sequenzen pressen die Schauspielerin Pamela Anderson in die Rolle des Sexsymbols und Männermagneten.

©freepik
Auch Megan Fox ist in ihrer Rolle als Mikaela Banes in Transformers als begehrenswerte und sexy Persönlichkeit an der Seite von Shia LaBeouf zu sehen. Leicht bekleidet und verführerisch interessant ausschauend ist sie über eine offene Motorhaube gebeugt. Eine solche Szene vereint ein stereotypisch männliches Symbol – Auto – mit einer attraktiven Frau. Ein echter Männertraum also.
Auffällig ist vor allem, dass ältere Frauen oder Frauen, die keinem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, in einer solchen Art von Filmen oft unterrepräsentiert bleiben. Dadurch wird der Eindruck verstärkt, nur junge, attraktive Frauen seien sehenswert. Diese Darstellung ist vor allem auch für die jungen Schauspielerinnen äußerst problematisch, da die berufliche schauspielerische Leistung an Bedeutung verliert und der Wert der Frauen auf ihr Aussehen und ihre Sexualität reduziert wird.

Folgen für die Gesellschaft
Eine solche unzureichende Darstellung und Übersexualisierung in Film und Fernsehen beeinflusst das Frauenbild der Gesellschaft enorm. Folglich kommt es zu Objektifizierung und Diskriminierung von Frauen im Allgemeinen – ob in der Schule, auf der Arbeit oder Zuhause.
Teilweise beginnt diese Art der weiblichen Darstellung sogar schon im Kinder- und Jugendprogramm. Hier trifft man auf Biene Maja mit schmalerer Taille oder Mia (aus „Mia and Me“) mit unnatürlich-fraulichen Kurven und sexy Outfit. Diese Rollen beeinflussen die junge Gesellschaft enorm und tragen tendenziell auch zu persönlichen Problemen bei. Junge Mädchen entwickeln Unsicherheiten oder gar Essstörungen, um ihrem Idol zu entsprechen. Umso wichtiger ist es, die jungen Zuschauer an heterogene Figuren zu gewöhnen und somit die stereotypischen Darstellungen verblassen zu lassen. Es sollten vielfältigere und realistischere Frauenrollen geschaffen werden, die die Frauen als ganze Persönlichkeiten darstellen und ihre unterschiedlichen Talente, Eigenschaften oder eben auch ihre „Fehler“ darstellen.
Male Gaze – Die Grundlage all dieser Probleme?
Der Begriff „Male Gaze“ beschreibt die vorherrschende männliche Sicht auf Frauen in den Medien. Dabei werden Frauen häufig zum Objekt männlicher Begierde. Der Begriff geht auf die Filmtheoretikerin Laura Mulvey zurück. In ihrem einflussreichen Essay „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ aus dem Jahr 1975 analysierte sie, wie der klassische Hollywood-Film die Welt aus einer männlichen, heterosexuellen Perspektive zeigt.
Die Bildkomposition in Filmen und Serien spiegelt oft den männlichen Blick wider. Kamerafokus auf Figur und sexy Posen bilden Frauen auf eine voyeuristische Art und Weise ab und fungieren als „männlicher Blick“. Dadurch wird die Frau in Film und Fernsehen häufig als Lustobjekt der männlichen heterosexuellen Schauspieler wahrgenommen und so die vermeintliche „Begehrlichkeit“ in den Fokus gerückt.

Ein erheblicher Grund dafür sei die Mehrheit der männlichen Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten in der Filmund Fernsehbranche. Dadurch dominieren oft männliche Sichtweisen und feminine Erfahrungen, Gefühle und Perspektiven werden seltener authentisch dargestellt. Der allgegenwärtige „Male Gaze“ in den Medien verstärkt das übersexualisierte Frauenbild in der Gesellschaft immer noch erheblich. Diversität hinter und vor der Kamera zu schaffen, sollte also ein fundamentales Ziel sein, um vielfältigere Perspektiven aufzuzeigen und die Chance bieten, das Mindset der Gesellschaft zu erweitern.
Ein roter Blutfleck auf der hellen Hose und schon häufen sich die Blicke, Leute tuscheln, grinsen, das Einzige was hilft: verstecken. Jacke um die Hüfte binden, schnell nachhause und umziehen. Laut Plan International empfinden 97 Prozent der Befragten es als unangenehm, wenn die Periode sichtbar wird.
Wie ist die Menstruation zum Tabuthema geworden, und können wir dieses Tabu brechen? Lasst uns das genauer betrachten.
Warum ist die Menstruation oft ein Tabu?
Zunächst müssen wir klären, wie sich überhaupt ein Tabu entwickeln kann und das lässt sich ziemlich einfach beschreiben: Schweigen, Verdrängen, als etwas Negatives und Ungewöhnliches betrachten. Religionen wie das Christentum stellten die Menstruation als Unreinheit dar. Im Hinduismus hingegen gibt es jährlich eine viertägige Verehrungszeremonie für die menstruierenden Göttinnen, demnach wird die Menstruation nicht in jeder Religion als eklig und unrein aufgefasst. Das Patriarchat sowie (pseudo-) wissenschaftliche Theorien sorgten auch für ein verzerrtes Bild der Periode. Bis in die 1980er Jahre wurden sehr wenige wissenschaftliche Erkenntnisse über den weiblichen Körper sowie über die Menstruation erhoben. Das gesamte Wissen basierte auf Spekulationen und falschen Theorien. Den (pseudo-) wissenschaftlichen Diskurs über die Periode führten hauptsächlich männliche Personen, welche offensichtlich keine Betroffenen des Themas sind. Einige Faktoren sprechen dafür, dass die Menstruation noch immer zu einem Tabuthema gemacht wird.

Der Kampf gegen das Tabu
Die Auswirkungen von Tabus
Noch immer reagiert die Gesellschaft auf einen blutigen Fleck mit Ekel- und Schamgefühlen. Viele Menstruierende entwickeln ein starkes Schamgefühl, sobald versehentlich etwas von ihrer Periode sichtbar wird. Denn es sind die negativen Blicke, die möglichen Kommentare, die Reaktionen einiger Mitmenschen, welche das Schamgefühl hervorrufen. Natürlich ist es nicht die Reaktion aller Menschen, jedoch fördern verständnislose Bemerkungen den negativen Umgang mit dem eigenen Körper. Auch in den Werbungen wird menstruierenden Personen ein reines und frisches Gefühl mit ihren Produkten versprochen. Wer legt fest, was rein ist? Kannst du dich noch daran erinnern, als in Werbungen Menstruationsblut blau war? Die Unternehmen trauten sich nicht, zu groß war die Angst vor negativen Kommentaren. Das Tabu hat auch zur Folge, dass der Zugang zu Menstruationsprodukten für viele menstruierende Personen sehr schwer ist, schon allein finanziell kommt es zu Problemen. Weit verbreitet sind auch Euphemismen. In diesem Fall werden beschönigende Wörter für das Wort Menstruation verwendet, beispielsweise die Erdbeerwoche.
Leider kann ein Tabu nicht von heute auf morgen verschwinden. Eine vollständige Enttabuisierung benötigt Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, denn auch wenn es für uns logisch erscheint, gibt es noch viele Ecken und Kanten, an denen etwas getan und verändert werden muss. Ein wichtiger Schritt ist es, über die Thematik zu sprechen, aufzuklären und ein Bewusstsein zu schaffen, doch Veränderung und Fortschritt ist auf dem Weg! In Werbungen sieht das Menstruationsblut mittlerweile wie Blut aus, in Spanien können Menstruierende einen Menstruationsurlaub erhalten – obwohl es natürlich nicht viel mit Urlaub zu tun hat. Auch der Zugang zu kostenlosen Periodenprodukten wird zunehmend erleichtert. Die Wissenschaft beruht nun auch nicht mehr auf Spekulationen, so werden Erkrankungen wie Endometriose mehr erforscht.
Der wahre Kern des Internationalen Frauentags
Der Internationale Frauentag, der jedes Jahr am 8. März gefeiert wird, hat sich weltweit zu einem Tag entwickelt, an dem Frauen mit Blumen und Pralinen beschenkt werden. Allerdings geht es an diesem Tag um weitaus mehr als um solche Gesten. Es geht um Protest und Engagement – nicht nur für die Rechte der Frauen, sondern auch für die Gleichberechtigung aller Geschlechter.
Der Internationale Frauentag hat seinen Ursprung in Arbeiterinnenbewegungen in den USA, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts für die Arbeitsrechte der Frauen und das Frauenwahlrecht einsetzten. Daraus entstand auf der Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen die Idee, einen internationalen Frauentag einzuführen, der dann 1911 das erste Mal begangen wurde. Später wurde dann der 8. März offiziell zum Internationalen Frauentag erklärt.
Feministischer Kampftag, Frauentag, Frauenkampftag…
Oft heißt es nicht mehr Frauentag, sondern Feministischer Kampftag. Mit dieser Umbenennung soll zum richtigen Verständnis dieses Tages verholfen werden. Es soll also deutlich gemacht werden, dass es an dem Tag nicht um die Ehrung von Frauen geht, sondern um den Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Aber ist das nicht sowieso klar?
Die traurige Wahrheit ist, dass es in der Realität vermutlich nicht alle Menschen so sehen wie ich. Aber reicht dann eine Umbenennung, um die Wichtigkeit des Tages zu betonen und denen zu zeigen, warum wir immer noch einen Frauentag brauchen? Vermutlich nicht.
Klar, man könnte meinen, dass heutzutage nicht mehr die gleiche Notwendigkeit für einen Protesttag besteht, wie es damals der Fall war. Frauenwahlrecht, Recht auf Bildung, politische Teilhabe, Rechte am eigenen Körper – haben wir doch alles schon erreicht, oder nicht?
Doch auch wenn in den letzten 100 Jahren sehr viel im Kampf um die Gleichberechtigung und Frauenrechte erreicht worden ist, ist noch lange nicht alles geschafft. Es gibt immer noch Länder, in denen die Rechte der Frauen sehr stark eingeschränkt sind und Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer. Und auch in einem Land wie Deutschland sind Männer in manchen Bereichen immer noch privilegierter, sei es im Berufsleben oder im Privaten.
Ein Aufruf zum Handeln
Der Internationale Frauentag ist weit mehr als eine symbolische Geste. Er ist ein Tag des Protests, der Solidarität und des Engagements für die Rechte der Frauen. Ein Tag, an dem wir die Fortschritte feiern, die bereits erzielt wurden, und gleichzeitig die Arbeit fortsetzen, die noch vor uns liegt. Angesichts der fortbestehenden Ungleichheiten und Herausforderungen ist es wichtiger denn je, diesen Tag zu nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und für eine gerechtere und gleichberechtigtere Welt zu kämpfen. Denn der Kampf für die Rechte der Frauen ist ein Kampf für die Rechte aller Menschen. Und nein, dabei helfen uns keine Blumen oder andere Geschenke.
Alina Hadshiminow



Du bist in der Dämmerung joggen, auf dem Fußweg vor dir führt eine Frau ihren Hund aus…
Ich wechsle die Straßenseite.
Aus dem Weg!
Ich mach mich bemerkbar und bitte die Frau höflich aus dem Weg zu gehen.


Du siehst eine Gruppe Frauen, die sich gut gelaunt in einer Bar unterhalten...
Ich gehe zu ihnen und frage sie, ob sie öfter hier sind.
Ich bin froh, dass ich noch nie Frauen in einer Bar gefragt habe, ob sie öfter hier sind.
Einem Freund geht es nicht gut, er lässt den Kopf hängen und ist bedrückt…
Ich klopfe ihm auf den Rücken und besorge Bier.
Ich frage ihn, was er braucht und höre ihm zu. Klarer Fall – er muss einfach eine Runde Schattenboxen!!
Dein Freund ruft bei beim Spaziergang einer Frau etwas zu ihrem Outfit hinterher…
Ich gehe nicht weiter darauf ein.
Ich frage ihn, ob er über Nacht seine gute Erziehung verloren hat.
Bei dem Outfit braucht sich die Frau nicht wundern!

Du und deine Freundin haben ein Dinner geplant, sie hat für euch und die Gäste gekocht...
Ich vergesse das Dinner und schaue mit einem Freund Fußball.
Ich setze mich nach dem Essen aufs Sofa und freue mich aufs Dessert.
Ich helfe meinem Liebling beim Abwasch.

Deine Mitbewohner:innen haben die Wohnung geputzt, du kommst gerade nach Hause und… kümmerst dich direkt um deine Aufgaben auf dem Putzplan. Viele Hände, schnelles Ende. fragst deine Mitbewohner:innen, warum es eigentlich nicht immer so schön sauber ist. ziehst die Socken aus und lässt sie liegen.


Du stehst an einer roten Ampel und möchtest die Straße überqueren…
Ein bisschen Schattenboxen hat noch keinem geschadet.
Ich warte bis die Ampel grün wird. Heute ist ein super Tag.

Die Tante deiner Freundin fragt nach eurer gemeinsamen Familienplanung…
Du fragst dich das gleiche, wann schenkt sie dir endlich einen Sohn?
Ich erzähle stattdessen von der Masterarbeit meiner Freundin.
Ich sage, in ihrem Bauch ist nur Platz für Pommes.
Die ältere Dame vor dir an der Kasse braucht ein bisschen länger...
Egal! Ich habe keinen Zeitdruck.
Ich verdrehe die Augen und bekomme schlechte Laune.
Typisch Frau, kein Wunder bei den großen Handtaschen.
Du betrittst eine Arztpraxis, am Empfang stehen ein Mann und eine Frau…
Ich grüße den Herrn Doktor freundlich und frage mich, was seine Ehefrau in der Praxis sucht.
Ich begrüße beide!
Oops, zu spät dran, ich muss morgen nochmal wieder kommen.



Kein Macker weit und breit, das Leben kann so schön sein. Für dich zwitschern die Vögel und die Sonne lacht dich an. Du bist umsichtig und meinst es gut. Du hörst den Menschen zu und erkennst deine Privilegien. Weiter so!
Jede:r hat mal schlechte Tage. Gib nicht auf, auch du kannst den Macker in dir bändigen.
Oh wie schade, du bist ein hoffnungsloser Fall! Die ersten Schritte fallen dir besonders schwer. Wichtig bleibt: T-Shirt an im ÖPNV und Kopf aus den Wolken.

„SHE
von Maria Schrader
Die New York Times Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor untersuchen sexuelle Missbrauchsfälle in der Unterhaltungsbranche. Dabei stoßen sie auf Gerüchte über Harvey Weinstein, einen berühmten Filmproduzenten, dem mehrere Vorwürfe sexueller Natur in den 90er Jahren gemacht worden sind. Die Journalistinnen folgen dieser Spur und fokussieren ihre Nachforschungen auf dessen Produktionsfirma Miramax. Im Verlauf der investigativ-journalistischen Untersuchungen können sie mehrere Opfer ausfindig machen. Verständnisvoll und unaufdringlich bitten die Journalistinnen die Betroffenen darum, ihre traumatischen Erfahrungen zu teilen, um Klarheit über das Ausmaß der Taten zu erlangen. Doch keine ist dazu bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Für Twohey und Kantor beginnt die Suche nach handfesten Beweisen und Frauen, die dazu bereit sind, öffentlich gegen Weinstein auszusagen.
Die Handlung von „She Said“ basiert auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 2017 und zeigt die Recherche zweier Journalistinnen von Anfang bis Ende. So gelang es Megan Twohey und Jodi Kantor durch eine beweisfundierte Reportage die sexuellen Straftaten von Harvey Weinstein ans Licht zu bringen, die im Nachhinein noch mehr als 80 weitere Frauen dazu bewegte, ihre Angst zu überwinden und an die Öffentlichkeit zu treten. Die Reportage fundierte den Beginn der #MeToo-Bewegung, brach die Stille über sexuelle Übergriffe in Hollywood und erzielte schlussendlich sogar eine Verurteilung.
Jullia Rodner

„PORTRAIT EINER JUNGEN FRAU IN FLAMMEN“
von Céline Sciamma

Ende des 18. Jahrhunderts wird die Künstlerin Marianne (Noémie Merlant) von einer Herzogin beauftragt, ein Hochzeitsportrait ihrer Tochter Héloïse (Adèle Haenel) anzufertigen. Dafür muss die Malerin auf eine abgeschiedene Insel in der Bretagne reisen. Bei ihrer Ankunft wird ihr schnell bewusst, dass es sich um keinen gewöhnlichen Auftrag handelt, denn Héloïse wehrt sich gegen die geplante Heirat und weigert sich gemalt zu werden. Aus diesem Grund darf sie nicht erfahren, dass Marianne beauftragt wurde, sie zu malen. So wird Marianne der jungen Adeligen lediglich als Begleitung für die kommenden Tage vorgestellt. Das soll der Malerin genug Zeit geben Héloïse zu studieren und sie einzig mithilfe von Perspektive, Betrachtung und Blicken aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Die Innigkeit und Intensität, die darin verborgen liegt, verstärkt die ursprüngliche Anziehung der beiden Frauen zueinander und Marianne wird das Dilemma ihrer Situation, was das Erfüllen ihres Auftrags und die Zukunft von Héloïse Leben betrifft, nach und nach bewusst.
Céline Sciamma inszeniert dieses Historiendrama mit schönen, ausdrucksstarken Bildern, die noch lange, nachdem der Film geendet hat, nachwirken. Auch die Präsenz und Chemie der beiden Hauptdarstellerinnen tragen die Geschichte von Marianne und Héloïse, welche den Zuschauer:innen mit feinen Zwischentönen einen weiblichen Blick auf das fremdbestimmte Frauenbild zu jener Zeit, gewehrt.
Katja Schramm
How are you?

„Danke, gut.“ – Die floskelhafte Antwort, die man gibt, wenn man gefragt wird, wie es einem geht. Doch selten entspricht das der Wahrheit, man schweigt lieber über seinen eigentlichen Gemütszustand. Leider spricht man, vor allem auch in der Öffentlichkeit und Popkultur, viel zu selten über psychische Krankheiten, obwohl viele Menschen davon betroffen sind.
Miriam Davoudvandi (Musikjournalistin, DJ, Moderatorin und Podcasterin) versucht dies mit ihrem Podcast über Pop und Psyche zu ändern. Für ihr Format lädt sie Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben oder Spezialist:innen zur psychischen Gesundheit ein und spricht mit ihnen über psychische Probleme und Erkrankungen und deren Umgang damit, oftmals auch in Bezug auf ein Leben im Rampenlicht. Unter den Gäst:innen finden sich Personen wie Dagi Bee, Kurt Krömer, BRKN, Sido, Sahra Wagenknecht, Bill Kaulitz oder Bruce Darnell – es kommen also nicht nur Personen zu Wort, die sich als Frau identifizieren. Somit wird das Stigma gebrochen, dass nur diese über „ihre Gefühle“ sprechen. Ebenso unterhalten sich Miriam und ihre Interviewpartner:innen über Themen wie Feminismus, Rassismus und deren Zusammenhang mit mentaler Gesundheit. Eine Empfehlung also für jede Person, die sich zu diesen Themen weiterbilden möchte und sich zusätzlich für Persönlichkeiten der Öffentlichkeit interessiert.
Lu Hilgers

Mit Tara ist Tara-Louise Wittwer gemeint. Autorin, Kolumnistin und seit November 2023 auch Podcasterin. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge auf den verschiedenen Podcast Plattformen, in welcher Tara mit Personen des öffentlichen Lebens über die unterschiedlichsten Themen spricht. Boobs, Business und Male Gaze, Alpha-Mann oder Alpha-Maus?, Pommes und Feminismus oder Wie wird man glücklich? Fragen und Themen, zu denen nicht nur Tara etwas zu sagen hat, sondern auch ihre Gäst:innen. Ehrlich, kritisch und unterhaltsam wird sich dabei mit beispielsweise Kim Hoss, Senna Gamour oder Aki Bosse unterhalten und über Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht. Der Podcast stellt für die Zuhörer:innen eine perfekte Ergänzung zu den Internetauftritten von Tara-Louise Wittwer dar. Auf ihrem TikTokund Instagram-Profil @wastarasagt, teilt sie neben privaten Eindrücken auch inhaltliche Videos. Mit dem Format „TikToxic“ und „What men made me do“ erlangte sie auf den sozialen Plattformen größere Bekanntheit, dabei reagiert sie in beiden Videokonzepten auf frauenverachtende Aussagen und Handlungen im Netz. Auf ihre eigene humorvolle Art ordnet sie diesen Content für die Zuschauer:innen ein und schafft es dennoch, die nötige Ernsthaftigkeit in ihren Videos zu wahren. Wem Podcast und Internetinhalte von Tara-Louise Wittwer noch nicht genug sind, kann sich weiter mit ihren Büchern, die sich mit dem Thema Misogynie oder der aktuelle Entschuldigungskultur, befassen.
Katja Schramm
„EIN
von Virginia Woolf

Kampa Pocket Taschenbuch, 182 Seiten 12,00 €
ISBN: 978-3-311-15008-4
Cover: ©Kampa
Wie würdest du antworten, wenn du darum gebeten wirst, einen Vortrag über Frauen und Literatur zu halten? Würdest du Frauen würdigen, die heute als große Schriftstellerinnen gelten, oder über Literatur reden, die über Frauen geschrieben worden ist? Oder würdest du über Herausforderungen sprechen wollen, denen schreibende Frauen auch heute noch ausgesetzt sind? Mit dieser Fragestellung wurde Virginia Woolf 1928 konfrontiert, als sie gebeten wurde, zwei Vorträge in Cambridge zu halten. Ihr daraus entstandenes Essay „Ein Zimmer für sich allein“, in dem sie sich mit Frauen und Literatur auseinandersetzt, gilt heute als Klassiker des Feminismus. Woolf verknüpft erzählende Prosa mit nüchternen Fakten und erläutert ausführlich ihre Gedankengänge zu Geschlechterdifferenzen und den strukturellen Nachteilen, denen Frauen ausgesetzt waren und sind. Gleich zu Beginn äußert sie, dass Frauen und Literatur für sie ein ungelöstes Problem bleiben, sie kann keine zufriedenstellende, „wahre“ Lösung anbieten. Diese Feststellung befreit jedoch von jeglichen Erwartungshaltungen und ermöglicht ihr, frei zu denken. Sie erörtert in Gedankenexperimenten, wie es Shakespeares fiktiver Schwester ergangen wäre, oder wieso Literatur über Frauen fast ausschließlich von Männern verfasst wurde. „Ein Zimmer für sich allein“ ist ein kluges, ironisches und damals radikales Plädoyer für die geistige und finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, das heute nichts an Aktualität verloren hat.
„Die Geschichte des Widerstandes der Männer gegen die Emanzipation der Frauen ist vielleicht interessanter als die Geschichte der Emanzipation selbst.“
Mira Krevet
von Tiffany D. Jackson „GROWN“

HarperCollins US Hardcover, 384 Seiten 19,50 €
ISBN: 978-0-06-284035-6
Cover: © HarperCollins US
Die 17-jährige Enchanted träumt schon ihr Leben lang davon, Sängerin zu werden. Neben Schule, Schwimmtraining und dem Babysitten ihrer Geschwister nutzt Enchanted jede freie Minute zum Singen. Als sie entgegen dem Willen ihrer Eltern für eine Castingshow vorsingt, wird Superstar Korey Fields auf ihr großes Potenzial aufmerksam. Enchanted kann ihr Glück kaum fassen, als Korey ihr persönlicher Coach werden will. Neben ihrer Stimme scheint er zudem auch anderweitig von ihr angetan zu sein. Enchanted schwebt auf Wolke sieben. Je näher sie ihm jedoch kommt, desto mehr offenbart sich eine ganz andere Seite von Korey. Als Koreys anfangs liebevoller Griff immer fester wird, entpuppt sich Enchanteds größter Traum als ihr schlimmster Albtraum. Tiffany D. Jacksons „Grown“ zeigt eindrucksvoll, wie Frauen, allen voran Schwarzen Frauen, weiterhin nicht geglaubt wird und ihnen ihre Erfahrungen abgesprochen werden. Angelehnt an die gesellschaftliche Rezeption der MeTooBewegung sowie die Taten R. Kellys demonstriert „Grown“ die systematische Ausbeutung junger Frauen durch die Unterhaltungsindustrie und das strukturelle Versagen all derer, die sie davor schützen sollten. Um es mit den Worten der Autorin zu sagen: „It’s about adults who know the difference between right and wrong. Because no matter where you stand on the issue…he knew better.”
von Liv Strömquist
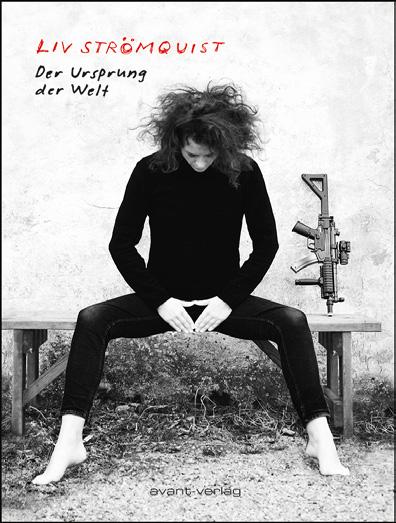
Avant-Verlag
Softcover, 140 Seiten
19,95 €
ISBN: 978-3-945034-56-9
Cover: © Avant-Verlag
Mit eindrucksvollen Illustrationen, einem provokativen und unverblümten Sinn für Humor enthüllt Liv Strömquist die Vorurteile, die die Darstellung des weiblichen Körpers noch bis heute prägen.
Vom nicht aufklärenden Biologielehrbuch bis hin zu Männern, welche in der Vergangenheit meinten, den weiblichen Körper besser zu verstehen als die Frau selbst oder auch männliche Ärzte, die Frauen nur nach Einverständnis des Ehemannes operierten. Lass dich von Liv Strömquist über die schockierenden Zustände des Menstruationstabus aufklären, ebenso findest du spannende Informationen rund um das Thema PMS. Diese und weitere interessante und schockierende Inhalte kannst du in der Graphic Novel „Der Ursprung der Welt“ lesen.
Woher kommt es, dass es der Gesellschaft schwerfällt, über Menstruation zu sprechen? Was ist überhaupt ein Tabu?
Durch die sarkastische Art der schwedischen Autorin Liv Strömquist wird man regelrecht in eine Schockstarre versetzt, denn einige der Themen kennt man so noch nicht und hat diese auch noch nie hinterfragt. Ich persönlich empfinde dieses Buch als Pflichtlektüre, um zu verstehen, wie wichtig Feminismus ist und weshalb wir diesen brauchen.
Constanze Dzialas
von Gabriella Santos de Lima

HarperCollins Taschenbuch, 288 Seiten
16,00 €
ISBN 978-3-365-00567-5
Cover: © HarperCollins
Tess Raabe ist ein That Girl. Sie ist erfolgreiche Autorin eines Buches über Dating und teilt auf ihrem Social-MediaAccount @tessteilt ihre grünen Smoothies, Morgenroutinen und Yoga-Sessions. Dabei predigt sie vor allem eines: Selbstliebe. Die 25-Jährige führt ein Leben, von dem die meisten in ihrem Alter nur träumen können. Zumindest augenscheinlich. Schaut man sich Tess‘ Liebesleben an, sieht es eher schlecht aus. Bisher ist sie immer an die Falschen geraten und scheint die Hoffnung an die Liebe aufzugeben. Bis sie auf Leo trifft. Leo, der spontan und lustig ist. Leo, der Tess seinen Freund:innen vorstellen will und sie gut behandelt. Leo, der Tess Stück für Stück die Hoffnung an die Liebe zurückgibt.
Doch wer jetzt einen klassischen Liebesroman mit ganz viel Drama und am Ende doch Friede, Freude, Eierkuchen erwartet, soll bitter enttäuscht werden. Dies ist kein typischer Liebesroman. Aber vielleicht muss es auch gar nicht immer um die Liebe zu einem oder einer Partner:in gehen. Vielleicht bedeutet Erwachsenwerden vielmehr zu erkennen, dass es auch andere Formen von Liebe gibt, die mindestens ebenso tiefgreifend sein können.
Gabriella ist für ihre ehrlichen, authentischen Bücher bekannt. Dafür, ihre Protagonistinnen Dinge fühlen zu lassen, die wir alle fühlen, aber keine:r sich traut laut auszusprechen. Vor allem dieser Roman ist ehrlicher denn je und zeigt, wie es sein kann als Frau Mitte 20. Welche Gedanken einen beschäftigen und wie das Patriarchat uns im Griff hat. Eine große Empfehlung für jede:n, die oder der Lust hat auf einen Liebesroman der etwas anderen Art.
Wanda Hitzing

Verbessertes Arbeiten in der Bibliothek
Um eine produktive Arbeit in der Gruppe zu ermöglichen, hat die HTWK Bib zwei Gruppenarbeitsräume noch besser ausgestattet. In den Räumen befinden sich jetzt mobile Tische, die sich hochklappen und rollen lassen. Außerdem gibt es ein Videokonferenzsystem mit großem Bildschirm, sodass auch eine hybride Teamarbeit vereinfacht wird. Das Whiteboard in den Räumen vervollständigt die Ausstattung. Auch das ergonomische Arbeiten wird in der Bibliothek weiterhin gefördert. Es gibt nun mobile Pulte, die ein flexibles Arbeiten im Stehen ermöglichen. Diese kompakten Pulte sollen an verschiedenen Orten in der Bibliothek nutzbar sein. Eine Abstimmung unter den Studierenden half dabei, zu entscheiden, ob und wie viele weitere Stehpulte angeschafft werden sollen. Was bei der Abstimmung jedoch rauskam und ob die Pulte auch zum Ausleihen für zu Hause angeboten werden, steht zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch im Raum. Sicher ist aber, dass die verbesserten Arbeitsbedingungen in der Bib weiterhin eine wichtige Rolle für das Bibliotheksteam spielen.
Female Scientists Network
Passend zum Thema unserer aktuellen Ausgabe gibt es auch feministische Neuigkeiten aus der HTWK: Die Auftaktveranstaltung des Female Scientist Networks war ein voller Erfolg.
IMPRESSUM „LEIPZIGER LERCHE“
ISSN: 1430-0737
Auflage: 2000 Exemplare
Herausgeber: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Informatik und Medien, Studiengang Buch- und Medienwirtschaft, Karl-Liebknecht-Str. 145, 04277 Leipzig Internet: www.fim.htwk-leipzig.de www.leipzigerlerche.com
E-Mail: lerche-online@htwk-leipzig.de
V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Gunter Janssen
Chefredaktion: Mira Krevet, Wanda Hitzing, Antonia Faupel, Julia Nonnenmann
Redaktion: Constanze Dzialas, Ella Weindel, Finja Kulp, Julia Rodner, Katja Schramm, Maximilian Konrad, Mira Krevet, Wanda Hitzing, Alina Hadshiminow, Antonia Faupel, Carmen Jenke, Elias Graebner, Julia Nonnenmann, Luise Hilgers, Saskia Wagner, Sophie Rochlitzer, Theresa Spörl, Tillmann Richter
Vertrieb: Constanze Dzialas, Finja Kulp, Elias Graebner, Tillmann Richter
Anzeigen: Finja Kulp, Katja Schramm, Alina Hadshiminov, Saskia Wagner, Sophie Rochlitzer
Neues aus der Hochschule
Das Netzwerk, dessen Ziel die Sichtbarkeit und Vernetzung von (angehenden) Wissenschaftlerinnen der HTWK ist, bietet unter anderem regen Austausch, Mentoring und Unterstützung in der beruflichen Karriereplanung. Außerdem finden regelmäßig verschiedene Workshops statt. Die Auftaktveranstaltung, die unter dem Motto „Miteinander, voneinander, füreinander – Empowerment3“ stattfand, konnte bereits mit einer inspirierenden Keynote-Sprecherin, einer Podiumsdiskussion und guten Networking-Möglichkeiten überzeugen.
FSR IM Merch und Vizemeister:innen Volleyball Mixed
Der Fachschaftsrat Informatik & Medien hat seinen eigenen Merch herausgebracht. Studierende der Fakultät Informatik & Medien konnten dafür zwischen drei Designs abstimmen, in denen sogar die Leipziger Lerche berücksichtigt wurde. Das Gewinnerdesign ist nun je nach Art – Hoodie oder T-Shirt – in den Farben Schwarz, Flieder oder Dunkellila erhältlich. Gewinnen konnte aber nicht nur ein Design für den Merch, auch das Mixed Volleyball Team der HTWK Leipzig entschied die meisten Spiele bei den Sächsischen Hochschulmeisterschaften für sich. Nur im Finale unterlag die HTWK mit einem 35:33 ganz knapp dem Team der ITK Uni Leipzig, kann sich damit aber trotzdem über den Titel als Vizemeister:innen freuen.
Layout-Chefin: Mira Krevet
Layout: Ella Weindel, Julia Rodner, Katja Schramm, Maximilian Konrad, Mira Krevet, Carmen Jenke, Luise Hilgers, Julia Nonnenmann, Saskia Wagner, Theresa Spörl
Herstellung: Ella Weindel, Maximilian Konrad, Luise Hilgers, Sophie Rochlitzer, Theresa Spörl
Cover: © Annika Le Large
Editorial: © Wanda Hitzing
Reproduktion/ Druck/ Weiterverarbeitung: Anke Schlegel, Roger Troks, Hausdruckerei der HTWK, Gustav-Freytag-Str. 40 A, 04277 Leipzig
Hast du Interesse an einem kostenlosen Abonnement der Print-
Zeitschrift der Leipziger Lerche?
Schicke uns einfach eine Mail mit Namen und Adresse an: lerche-online@htwk-leipzig.de oder schreibe uns bei Instagram: @leipziger.lerche

Wir senden euch auch gerne größere Stückzahlen zu, wenn ihr die Lerche mit Freunden und Familie teilen oder in eurer Schule oder Bildungseinrichtung auslegen beziehungsweise austeilen wollt. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.
Neuheit
NEUHEITNeuheit

Inspirierende
Gedichte und kluge Worte von starken Frauen aus allen Epochen der Literaturgeschichte
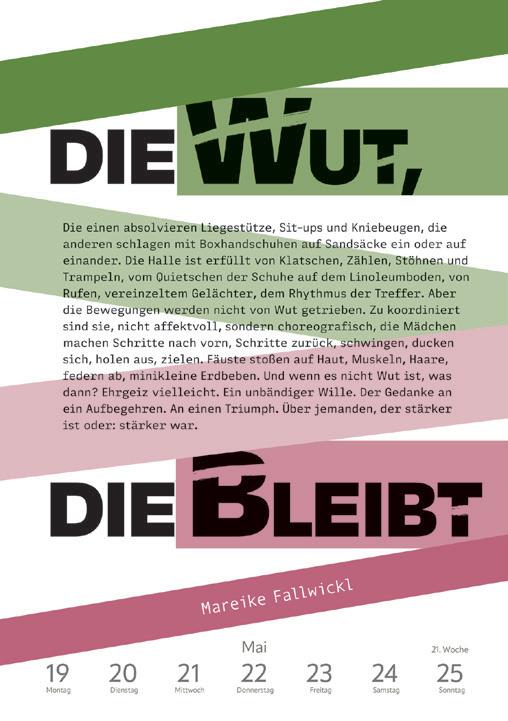

Entdecken Sie wöchentlich neue literarische Meisterwerke!

Die Leipziger Lerche wurde auf Steinbeis Select, einem umweltfreundlichen Recyclingpapier von Steinbeis Papier, gedruckt. Das Papier trägt den Blauen Engel und erfüllt strenge Umweltkriterien – ideal für hochwertige Druckerzeugnisse wie Cover und Innenseiten.
Steinbeis Select
Qualität und Umwelt in perfektem Einklang.
Mehr zu nachhaltigen Recyclingpapieren unter stp.de
Fakultät:
Informatik und Medien
Regelstudienzeit: 6 Semester (inkl. Praxissemester)
Voraussetzungen: allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife
Studienabschluss: Bachelor of Arts »Buch und Medienwirtschaft«
Studium rund ums Buch
Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand der Hochschulen auf der Leipziger Buchmesse und auf der Frankfurter Buchmesse!