BODENSEE BODENSEE













Wir haben uns auch in diesem Jahr auf die Suche nach schlauen Köpfen in der Bodenseeregion gemacht – und sind wieder fündig geworden. Der Bodenseeraum steht seit jeher für Innovationen, Ideen und Unternehmertum. Angefangen bei den Klöstern als Zentren der europäischen Wissensschmieden sind es heute die Firmen und Hochschulen, die die Wirtschaftsregion Bodensee voranbringen. Rund um den See haben wir mit Innovatoren gesprochen und erneut festgestellt, welch Koryphäen es hier doch gibt – in einer pittoresken Landschaft, dessen unternehmerisches Potenzial oft erst auf den zweiten Blick deutlich wird.
Der ein oder andere unserer Leser wird sich noch an die Fahrzeuge mit Wankelmotor erinnern. Konstruiert wurde dieser von Felix Wankel – und zwar am Bodensee, was wohl den Wenigsten bekannt sein dürfte. In seinem damaligen Forschungszentrum in Lindau hat einer seiner letzten Auszubildenden, der Erfinder und Unternehmer Frank Obrist, ein TechCenter aufgebaut und CO₂-negative (Achtung – nicht verwechseln mit CO₂-neutralen) Technologien entwickelt.
Aus dem Konstanzer Gründungs- und Innovationszentrum farm e.V. heraus forschte die junge Firma Organifarms rund um Mitgründerin Hannah Brown an der Automation der Erdbeerernte – und hat als einstiges Konstanzer Start-up nun die (Entwicklungs-)Nase vorn. Mit einem erfahrenen Produktionspartner aus Ravensburg wurde nun die Skalierung eingeleitet.
Auch hierfür steht die Bodenseeregion – die regionale Zusammenarbeit. Dass diese auch für den Tourismus wichtig ist, zeigt die Neuausrichtung der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH. Der Tourismus ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die Bodenseeregion –neben den vielfachen Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte bietet der Tourismus auch unverlagerbare Arbeitsplätze. Auch in der Politik zeigen sich Tradition und Innovationen. Mit dem neuen Oberbürgermeister Simon Blümcke in Friedrichshafen treffen wir auf einen Bodenseekenner mit Erfahrungen aus verschiedenen Stationen rund um den Bodensee. Innovative städtische Politik kennzeichnet auch Arbon und seinen Stadtpräsidenten René Walther. Dort auf Schweizer Seeseite arbeitete man zuletzt erfolgreich an der Transformation einer jahrzehntelang von der Industrie geprägten Stadt hin zu einem urbanen Zentrum mit ganz viel Lebensqualität.
Aber lesen Sie selbst –wir laden Sie herzlich auf eine spannende Rundreise rund um den Bodensee ein!
Ihr
Holger Braumann und Stephan Bickmann







Bodenseeforum Konstanz



Fondium ab
S. 12
EINWOHNER & FLÄCHE
Bevölkerung 4.305764
Prognose
BILDUNG
Hochschullandschaft REGIO Bodensee120.000 Studierende
Universitäten (7) ca. 66.000
weitere Hochschularten (25) ca. 54.000
WIRTSCHAFTSKRAFT
Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Marktpreisen
Einwohner

Quelle: www.statistik-bodensee.org/ Foto: SPOT 6-Aufnahme, © Airbus DS 2017
OFFENE STELLEN (Stand Okt. 2024)
Deutsche REGIO 10.700
Schweizer REGIO 10.115
Vorarlberg 4.261
Liechtenstein 978
ARBEITS LOSE (Stand 2024)
Deutsche REGIO2,8 %
Schweizer REGIO1,8 %
Vorarlberg 5,0 %
Liechtenstein 1,3 %
EIN- UND AUSPENDLER
Einpendelnde Grenzgänger nach Herkunftsländern (2022) aus Deutschland 26.546 (davon 22.400 in die Schweizer REGIO) aus der Schweiz 14.945 (davon 14.436 nach Liechtenstein) aus Österreich 17.549 (davon 7.758 in die Schweizer REGIO, 8.749 nach Liechtenstein) aus Liechtenstein 2.006 (davon 1.926 in die Schweizer REGIO)

LANGENARGEN | Forscher der Fischereiforschungsstelle in Langenargen haben mit einem neuartigen Fischfutter eine Lösung für verunreinigtes Wasser in Zuchtbecken aufgrund verflüssigtem Fischkot gefunden. Das Forschungsteam hat dem Fischfutter Kork und einen pflanzlichen Binder zugefügt. So verfestigen sich die Ausscheidungen der Fische zu kleinen, an der Oberfläche schwimmenden Kügelchen. Dort können sie abgeschöpft und als Dünger weiterverarbeitet werden. Die Fische in dem saubereren Wasser sind gesünder und können schneller wachsen. Das Verfahren wurde bereits in Aquakulturen getestet. www.landwirtschaft-bw.de

BADEN-WÜRTTEMBERG | Das Umweltministerium hat „Auswirkungen und Folgemaßnahmen einer Trennung der einheitlichen deutschen Stromgebotszone für Baden-Württemberg“ untersuchen lassen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Herausforderungen des deutschen Stromsystems hin zu Klimaneutralität und günstiger grüner Energie mit geringerer Eingriffstiefe und weniger Nebenwirkungen gelöst werden können als durch die Aufteilung der heute bestehenden einheitlichen deutsch-luxemburgischen Stromgebotszone. Anlass für die Studie ist die Untersuchung der europäischen Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), ob die einheitliche deutsche Stromgebotszone aufgeteilt werden sollte. um.baden-wuerttemberg.de

Leuchtturm in der Clusterlandschaft
cyberLAGO | Im Juni 2024 feierte der cyberLAGO e.V. auf der Insel Mainau mit rund 150 Gästen – Vereinsmitgliedern, Partnern sowie Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Verwaltung – sein 10-jähriges Jubiläum. Seit 2019 trägt das Netzwerk der Digitalexperten das Silber-Label der European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Bekannt ist cyberLAGO in der Region vor allem durch die zahlreichen Wissenstransfer- und Vernetzungsveranstaltungen. Seit Vereinsgründung führte cyberLAGO 269 Veranstaltungen durch, bei denen sich 14.058 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vernetzten und sich relevantes Wissen in den Themenfeldern Digitalisierung, Innovation und IT aneignen konnten. cyberlago.net


BREGENZ | Die bauliche, technische und energetische Sanierung des Festspielhauses Bregenz ist bis Frühjahr 2025 abgeschlossen. Durch den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen deckt das Kongresshaus rund 30 Prozent des Grundstromverbrauchs. Der Großteil der Dachflächen wird extensiv begrünt, wodurch die Raumtemperatur im Sommer reduziert wird und weniger Kühlenergie nötig ist. Als Teil der Klimastrategie 2030 der Landeshauptstadt Bregenz installieren die Stadtwerke Bregenz eine neue Seeenergienutzung im benachbarten neuen Seebad, die auch das Festspielhaus Bregenz mit Energie versorgt. Durch die Seewassernutzung deckt das Festspielhaus künftig rund 80 Prozent des Energiebedarfs. www.festspielhausbregenz.com


HEILIGENBERG | Der größte Batteriespeicher für Solarstrom in Baden-Württemberg ist im Februar 2024 in Heiligenberg im Bodenseekreis in Betrieb gegangen. Gespeist wird er aus dem „Solarpark Rickertsreute“. Solarpark und Großspeicher sind zusammengenommen das landesweit größte Hybridkraftwerk. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 10.000 Kilowattstunden Strom. In den Batterien wird in den sonnenreicheren Mittagsstunden Strom gespeichert, nachts kann der Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden. Der Großspeicher besteht aus der Überproduktion von Batterien für Elektro-Autos, die nicht zum Einsatz kamen. Das Projekt hat rund zehn Millionen Euro gekostet. laoco.energy
70 Jahre Trinkwasser aus dem Bodensee
SIPPLINGEN | 1954 gegründet, bis heute ohne Unterbrechung geliefert: Die Bodensee-Wasserversorgung sorgt dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg qualitativ bestes Trinkwasser aus dem Bodensee erhalten. Die 183 Verbandsmitglieder (149 Kommunen und 34 Wasserversorgungszweckverbände) sorgen dafür, dass das Wasser jederzeit bedenkenlos genutzt werden kann. Um auch in Zukunft eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten, hat die Bodensee-Wasserversorgung das Projekt „Zukunftsquelle“ ins Leben gerufen. Geplant ist u.a. der Bau eines weiteren Pumpwerks zwischen Sipplingen und Ludwigshafen. www.bodensee-wasserversorgung.net


VORARLBERG | Im Juli 1994 wurde die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) als Betriebsansiedlungsagentur gegründet. Vier Jahre nach Gründung erfolgte die Integration des Vorarlberger Technologietransferzentrums in die WISTO. Ab diesem Zeitpunkt forcierte das Team Kooperationen zwischen Unternehmen und mit Forschungseinrichtungen sowie wissenschaftlichen Partnern. Im Jahr 2000 erweiterte die Gesellschaft ihr Leistungsangebot um die Services Förderberatung und Patentrecherchen. Rund 5.000 Beratungen allein zu F&E-Förderungen realisierte das Team in den letzten 10 Jahren und verhalf Gründern und Unternehmen zu Fördermitteln aus der EU, dem Bund oder dem Land Vorarlberg. www.wisto.at

FRIEDRICHSHAFEN | Rolls-Royce Power Systems entwickelt Konzepte, die Marinestreitkräften die Möglichkeiten aufzeigen, die wachsenden Herausforderungen bei der Landesverteidigung unter Wasser zu erfüllen. Dazu gehören ein mtuU-Boot-Bordstromaggregat mit deutlich höherer Leistung sowie mtu NautIQ-Automationssysteme. U-Boote der nächsten Generation benötigen mehr elektrische Energie, die Batteriespeicher lassen schnelleres Laden zu und es besteht die Notwendigkeit zu platzsparender Bauweise. Diesen Anforderungen trägt Rolls-Royce mit dem Konzept eines leistungsstärkeren mtu-Bordstromaggregats Rechnung, der von der künftigen 20-ZylinderVariante des U-Boot-Motors der mtu-Baureihe 4000 angetrieben werden soll. www.mtu-solutions.com
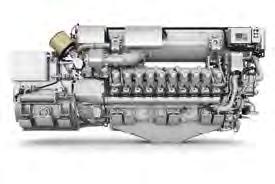
THURGAU | Ende November wurde ein neues Kapitel des Forschungsstandorts Thurgau geschrieben: Im Beisein von Prominenz aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft wurde in Tänikon das Institut für Intelligente System und Smart Farming der Ostschweizer Fachhochschule (OST) eröffnet. Institutsleiter Šeatović betonte die Wichtigkeit des neuen Instituts, schließlich seien Landwirtschaftsbetriebe heute einem enormen Wettbewerbsdruck ausgesetzt, indem sie die unterschiedlichsten Interessen und Vorgaben wie Konsumentenmitbestimmung, Umweltschutz, Klimapolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Subventionspolitik und Nahrungsversorgungssicherheit bedienen müssten. www.ost.ch

FRIEDRICHSHAFEN | Künftig wird Zeppelin in Norwegen und den Niederlanden den Vertrieb und Service von Cat Baumaschinen, Mietlösungen sowie Antriebs- und Energiesystemen von Pon Holdings übernehmen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Genehmigungsverfahren und Anhörungen. Bestandteil der Transaktion sind rund 20 Gesellschaften in Norwegen und den Niederlanden mit dem Portfolio von Neu- und Gebrauchtmaschinen, Antriebs- und Energiesystemen, Servicierung und Ersatzteile sowie Lösungen rund um die Vermietung von Equipment und dazugehörigem Service. Mit der Akquisition wächst der Zeppelin Konzern um ca. 2.000 Mitarbeitende und rund 1,1 Mrd. Euro Umsatz und wird damit zu einer der weltweit führenden Vertriebs- und Serviceorganisationen für Cat Produkte sowie zu einem noch internationaleren Unternehmen.
www.zeppelin.com

ALPENRHEIN | Meilenstein für die Internationale Rheinregulierung und das Hochwasserschutzprojekt Rhesi: Bundesrat Albert Rösti und Bundesminister Norbert Totschnig unterzeichneten den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Österreich, welcher unter anderem die Finanzierung des Projekts Rhesi regelt. Es ist nach 1892, 1924 und 1954 der vierte Vertrag zwischen der Schweiz und Österreich, welcher die Regulierung des Alpenrheins zwischen der Illmündung und dem Bodensee regelt. Zusätzlich wurde die Vereinbarung zwischen Österreich und dem Land Vorarlberg über den Kostenteiler zwischen Staat und Land unterschrieben. rhesi.org

WILHELMSDORF | Mit vielfältigen Corporate-CitizenshipInitiativen und der Förderung von Projekten im gemeinnützigen Bereich möchte Mercedes-Benz einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dabei kommt Stuttgart und Baden-Württemberg als Heimatregion des Unternehmens seit jeher eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Projekt „Klima Chance Moore“ und dem symbolischen Spatenstich im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf begann im Mai 2024 die Umsetzung des Vorhabens im Bereich Umweltschutz. Mercedes-Benz unterstützt das Projekt „Klima Chance Moore“ zur Erhaltung und Renaturierung von Mooren in Baden-Württemberg bis 2028 mit fünf Millionen Euro. www.mercedes-benz.com


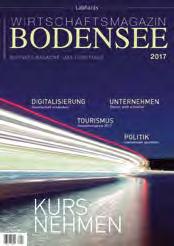

Der Bodensee, ein Lichtermeer, ist Großstadt, ist Energie – und Heimat von Menschen und Unternehmen, die auf eine gute Infrastruktur angewiesen sind (Titel aus dem Jahr 2017; Foto: Stefan Arendt)


„Wir müssen erneuerbare Energie über die Ziellinie bringen“

OBRIST GROUP | Die OBRIST Group gehört zu den weltweit führenden Innovatoren auf dem Gebiet nachhaltiger Energie. Das von Frank Obrist gegründete Unternehmen legt dabei seine Forschungstätigkeiten auf innovative, nachhaltige und CO2-senkende Konzepte. Dabei reicht das Spektrum der Firma mit Sitz in Lustenau und Lindau von einer globalen Versorgung der Menschheit mit erneuerbaren Energien bis zu CO2negativen Antriebskonzepten für die Automobilindustrie.
Firmensitz der OBRIST Group im ehemaligen Wankel-Gebäude in Lindau am Bodensee
IM GESPRÄCH | mit Frank Obrist, Geschäftsführer und Gründer der Obrist Group
Herr Obrist, wir sitzen hier in einem Gebäude mit beeindruckender Architektur, das 1960 für Felix Wankel gebaut wurde. Welche Beziehung haben Sie dazu?
Dieser komplett sanierte und revitalisierte Standort in einem Landschaftsschutzgebiet unweit des Bodensee-Ufers war jahrzehntelang ein Zentrum der Automobilwelt. Das Gebäude war aber der Zeit Felix Wankels im Grunde voraus, da es damals – ohne die heutige Elektrik – nicht im Sinne des Erbauers als Licht durchflutetes, transparentes Gebäude nutzbar war. Heute geht das so, wie es geplant war. Wir gehen also sinnbildlich einen Schritt weiter als Wankel. Als ich Ende der 1980er Jahre in dieses Gebäude gekommen bin, hat Felix Wankel Innovatives geleistet. Der Wankelmotor war eine Meisterleistung, leicht, kompakt, vibrationsarm, wenig Wartung, aber er hat einen schlechteren Brennraum und daher einen höheren Kraftstoffverbrauch als Diesel oder Benziner. So konnte er nicht konkurrieren. Daraus habe ich gelernt, auf was es außer der Bereitstellung von Technik, Patenten und Lizenzen ankommt: Innovative Technik wird sich nur dann durchsetzen, wenn sie günstiger ist als alle Alternativen. Dann greifen die Kräfte der Marktwirtschaft. Etliche Lizenzverträ ge machen es uns heute möglich, in innovative Zukunftstechnologie zu investieren, so wie bei der Low-Cost-Elektrifizierung von Automobilen. Mit dem Einbau von kleinen Batterien in Fahrzeuge von Tesla konnten wir zeigen, dass man den Preis eines E-Autos halbieren könnte. Die Batterien in den Teslas haben 75 und mehr kWh, unsere 17,30. Möglich macht das ein Zero Vibration Generator, der mit Methanol ange trieben wird.


Wie kommen Sie auf Methanol als Kraftstoff für diesen Generator? Die entscheidende Frage ist, wie wir Erdöl, Gas und Kohle ersetzen. In den von uns hergestellten Klimaanlagen ist CO₂ ein wunderbares Produkt, zu viel davon in der Atmosphäre aber ist schädlich. Das Thema CO₂ begleitet uns als Firma schon seit Jahrzehnten. Unser Ziel: Das Zuviel an CO₂ muss raus aus der Atmosphäre und zurück in den Boden verbracht oder wirtschaftlich genutzt werden. Und da kommt Methanol ins Spiel: das von uns entwickelte Konzept sieht den ersten klima-positiven Kraftstoff aFuel vor. Bei dessen Herstellung wird der Atmosphäre mehr Kohlenstoff entzogen, als er bei der Verbrennung wieder abgibt. Der überschüssige Kohlenstoff wird in Form von Grafit oder Kohle im Boden abgespeichert bzw. für industrielle Zwecke genutzt. In meinem Geburtsjahr 1961 hatte unsere Luft ein CO₂-Gehalt von ca. 310 ppm. Aktuell sind wir bei 420 ppm, Tendenz rasant steigend. Die einst im Pariser Klimaabkommen postulierten maximalen 1,5 Grad Celsius wurden bereits erreicht. Das Abkommen sah vor, dass ab 2050 keine CO₂-Emissionen mehr dazukommen sollten, damit sich die Erde erholen kann. Grundvoraussetzung für eine Erholung aber ist, dass die Natur mehr CO₂ aufnehmen kann, als sie selbst abgibt. Das aber hat sich durch massive Eingriffe der Menschen 2023 ins Negative gedreht. Uns war früh klar, dass wir zeitnah gezwungen sein werden, eine Technologie bereitstellen zu müssen, die das CO₂ aktiv wieder aus der Luft herausholen kann. Wem nützt es, wenn die Menschheit im Jahr 2050 behaupten kann, die politischen Vorgaben von Paris erfüllt zu haben, aber leider waren es nicht die richtigen. Stattdessen hätten sie lauten müssen: Wie ersetzen wir Kohle, Gas und Öl mit einem erneuerbaren Produkt? Und das im Rahmen einer Infrastruktur, die sich für die Nutzung fossiler Energien über eine Zeit von weit mehr als 100 Jahren so entwickelt hat, wie sie heute ist. Eine Infrastruktur, in die weltweit unendlich viel investiert wurde. Kohlenwasserstoffe gehören zu den zentralen Elementen, die alles Leben auf dieser Welt ausmachen. Von daher kritisiere ich die Beschlüsse von Paris. Wer den Kohlenstoff weglassen möchte, der sägt sich selbst den Ast ab, auf dem er sitzt. Wir stellten also die Frage: Wie schließen wir einen Kohlenstoffkreislauf, so wie es die Natur vorgibt? Wir suchten einen Kohlenstoffvertreter –und stießen auf Methan ol.
Aber erzeugt die Verbrennung von Methanol nicht auch CO2?
Methanol lässt sich durch die Verbindung des durch die Aufspaltung von Wasser erzeugten grünen Wasserstoffs und dem aus der Luft geholten Kohlenstoff herstellen. Bei der Verbrennung entsteht neben Wasser wieder CO₂, das stimmt. Es würde sich also zunächst mal um einen klimaneutralen Kreislauf handeln. Scheidet man aber 10 % zusätzlich oder mehr CO₂ aus der Luft ab, als für die Herstellung des Methanols notwendig wäre, kommt man auf einen klima-positiven Wert.
Was ist der Vorteil von Methanol gegenüber anderen synthetischen Kraftstoffen?
Verbrennt man Wasserstoff mit Sauerstoff, entsteht Wasserdampf. Ergänzt man den Vorgang durch den Kohlenstoff im Methanol, entsteht bei der Verbrennung demnach nur CO₂ und Wasser. Absolut sauber, ohne weitere Schadstoffe. Im Vergleich dazu würde es beim Verbrennen von synthetischem Benzin aufgrund des langkettigen Kohlenstoffs rußen. Was die Emissionen betrifft, so haben wir ja zusätzlich auch weltweit ein Feinstaubproblem, in Staaten wie Indien ist das durch Smog massiv sichtbar. Methanol würde alle Bedingungen eines Problemlösers erfüllen.
Wenn die Technologie entwickelt ist, was sind nun die nächsten Schritte? Wir liefern das Konzept, um in die Umsetzung zu kommen, benötigen wir einen Investor. Deswegen haben wir von externer Seite eine Due Diligence, also eine Machbarkeitsstudie, in Auftrag gegeben. Wir haben nun schriftlich von Expertenseite, dass unser Konzept einerseits patentrechtlich und technologisch machbar ist und andererseits es einen Markt dafür gebe. Im Sonnengürtel in den Wüsten existieren riesige Flächen, die sich eignen würden. Würde man dort Photovoltaikflächen von 20 mal 14 Kilometern aufbauen, wir nennen das Giga Plant, würde das Kosten in Höhe von 18,6 Milliarden Euro verursachen. Klingt viel, würde aber auch eine Leistung von 28,4 Gigawatt erbringen. Im Vergleich dazu leistet ein Atomkraftwerk durchschnittlich 1,4 Gigawatt. Diese Fläche würde das 20-fache an Power leisten – wobei jedes einzelne Atomkraftwerk genauso viel kostet. Die Investitionskosten wären bei errechneten Gewinnen in Höhe von jährlich vier Milliarden Euro nach rund vier bis fünf Jahren zu refinanzieren. Vier Millionen Tonnen Methanol als Energieträger und 228.000 Tonnen Kohlenstoff würden dabei jährlich entstehen – und 6,3 Millionen Tonnen CO₂ der Atmosphäre entnommen.
Wir schließen den Kohlenstoffkreislauf in einer intelligenten Form.«
Frank Obrist
Mit welchen Kosten pro erzeugter Kilowattstunde Sonnenenergie wurde kalkuliert?
Wir haben eine Roadmap erarbeitet, an dessen Ende das Zusammenschalten von zwölf Modern Forest Anlagen zu einer Giga Plant stünde. Laut Machbarkeitsstudie könnte man dann mit Kosten in Höhe von 0,43 Cent pro Kilowattstunde rechnen. Die ersten mittelgroßen Anlagen könnten 2028 oder 2029 fertig sein. Wenn man das mit dem Bau eines Atomkraftwerks vergleicht, ist das unfassbar schnell. Giga Plants könnten bis 2032 umgesetzt werden. Zunächst geht es aber um den Bau einer Demoanlage. Aber die Machbarkeitsstudie hat nun den Weg freigemacht für Investoren, insbesondere für Banken, die ohne eine solche Prüfung die technologische Seite kaum beurteilen könnten.
Welche politischen Hürden gilt es zu überwinden?
Da ist zunächst mal das Verbrenner-Verbot ab 2035. Klar ist: Der Verbrenner fossiler Energie muss verboten werden. Ohne dieses Verbot werden wir das Problem nicht los. Aber einen Verbrenner, der aktiv an einer Art Wiedergutmachung unserer globalen Probleme beteiligt ist, den darf man nicht verbieten. Das wäre widersinnig. Nach wie vor gelten Elektroautos von Seiten der Politik als die eine rettende Lösung, aber sie allein scheint nicht zu funktionieren. Wasserstoffwirtschaft ist ebenfalls ein Thema. Aber selbst, wenn die Herstellung in den Wüsten vonstattenginge, bliebe der viel zu aufwendige Transport nach Europa. Wasserstoff muss unter sehr hohem Druck oder bei Temperaturen von -252 Grad Celsius transportiert werden. Eine marktfähige Transport-Technologie gibt es nicht. Und mal ehrlich –klingt es ökonomisch, ökologisch und politisch ratsam, über viele tausend Kilometer Wasserstoffpipelines zu bauen, die durch ein Dutzend oder mehr Staaten führen? Darüber hinaus wären die Investitionskosten beim Ausbau einer Infrastruktur im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellentechnik riesig, die Kosten im Logistiksektor würden explodieren. Ein gewichtiger Unterschied unseres Konzeptes ist die Transportfähigkeit des Energieträgers. Wir verflüssigen Sonnenenergie. Methanol ist eine chemische Verbindung, Wasserstoff und CO₂ haben sich verzahnt und sind stabil. Man kann Methanol in Plastikflaschen transportieren. Und für den Transport über die Ozeane dieser Welt stünden die bisher auch verwendeten Tanker zur Verfügung. So wie vieles andere aus der bereits existierenden Infrastruktur.


Könnte Methanol auch in der Chemieindustrie Erdöl ersetzen?
Um es in aller Kürze zu erklären: letztlich handelt es sich bei allen Kunststoffen um langkettige Kohlenwasserstoffe. Mit Wasserstoff oder Strom sind keine Kunststoffe zu erzeugen. Man braucht eine Kohlenstoffbasis, so wie Methanol eine wäre. Mit aFuel hergestellt wäre jedes produzierte Plastikteil wie bei unserem Antriebsstrang ebenfalls klima-positiv. Unser Konzept wäre also in vielerlei Hinsicht wirtschaftlich voll und ganz konkurrenzfähig.
Nachteil von Methanol ist der geringere Wirkungsgrad. Was entgegnen Sie dieser Kritik?
Wenn man die Verarbeitungsprozesse hin zu Methanol betrachtet, dann sinkt der Wirkungsgrad automatisch und liegt dann nur noch bei 50 %. Ich bezahle aber nicht in Form von Wirkungsgrad, sondern in Dollar oder Euro. Legt man die hohen Kosten der Stromerzeugung von rund 15 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland zugrunde, wird die Produktion von Methanol natürlich unrentabel. Wenn man aber von Produktionskosten in den Wüsten dieser Erde von nur einem Cent und weniger ausgeht und sich dieser durch den Wirkungsgrad von Methanol dann verdoppelt, dann kostet die Kilowattstunde eben zwei Cent. Hätten wir diesen Sommer bereits ein Giga Plant zur Verfügung gehabt, hätten wir zu einem weltrekordverdächtigen Preis von 0,55 Cent produzieren können. Wir müssen erneuerbare Energie über die Ziellinie bringen, auch wenn bei uns keine Sonne scheint und kein Wind weht. Wir haben riesige Tanklager, in der wir Methanol speichern und jederzeit bei Bedarf abrufen könnten. Wir schließen den Kohlenstoffkreislauf in einer intelligenten Form. Um dorthin zu kommen, brauchen wir Mitstreiter und auch Staaten, die die Chance erkennen und sich mit uns auf den Weg machen.
Was die Staaten betrifft, so gibt es davon zumindest doch beträchtlich mehr, als es Staaten mit nennenswerten Ölvorkommen gibt. Der Klimawandel hat bereits dafür gesorgt, dass es leider sehr viele Wüsten gibt. Genauer gesagt hätten wir ungefähr 20-mal mehr Wüstenfläche zur Verfügung, als die gesamte Menschheit bräuchte, um dort sämtliche benötigte Energie zu produzieren. Die Fläche von Portugal, verteilt auf alle Wüsten der Welt, würde dafür ausreichen. Das entspräche 2.700 Giga Plants. Darüber hinaus liegen die Flächen gerade in jenen Regionen, die am allermeisten von Klimawandel betroffen sind. Und konkurrieren außerdem nicht mit den für die Landwirtschaft wertvollen Flächen. Sicher, wir brauchen zur Umsetzung die Siemens und ThyssenKrupps dieser Welt, aber es wäre dennoch eine riesige Chance für diese Staaten. Insbesondere wenn die benötigten Photovoltaikteile vor Ort produziert werden und nicht aus China kommen. Auch aus diesem Grund hat man uns seitens der UN auf die COP nach Baku eingeladen. Wir bieten eine gesamtheitliche Lösung an. Staatliche Subventionen zur Anschubfinanzierung sind wichtig, aber letztlich werden es privatwirtschaftliche Investoren sein, die die enormen Summen zur Umstellung der Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen auf Methanol als nachhaltigem Universalenergieträger aufbringen können.
Abschließend die Frage: Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
2050 werde ich 88 Jahre alt sein. Ich hoffe, dass wir mithilfe unserer Technologie tatsächlich den Wendepunkt erreichen können und dann erstmals mehr CO₂ aus der Atmosphäre entnehmen, als wir für die Entwicklung unserer Gesellschaft und unseren Wohlstand in die Atmosphäre entlassen. Ich wünsche mir, den Tag noch zu erleben, an dem die Kurve wieder in die richtige Richtung geht – nämlich nach unten.
Auszeichnung der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) im Jahr 2023 für den HyperHybrid


Frank Obrist besuchte die Höhere Technische Bundeslehrund Versuchsanstalt Bregenz (HTL) und arbeitete nach seinem Abschluss von 1984 bis 1993 als Konstrukteur am TES Wankel Institut in Lindau. Sein damaliger Lehrmeister: Felix Wankel, Erfinder des gleichnamigen Motors. Zwischen 1993 und 1996 war Frank Obrist als leitender Konstrukteur bei der TES tätig – und nach Wankels Tod der letzte Ingenieur, der das Institut verließ. Parallel zu seiner Arbeit studierte Frank Obrist von 1992 bis 1995 Betriebliches Innovationsmanagement an der Technischen Universität Graz und am Management Zentrum St. Gallen, bevor er 1996 die OBRIST Engineering GmbH in Lustenau gründete. Im Jahr 2022 kehrte Frank Obrist nach Lindau zurück: Er erwarb das im Besitz von Volkswagen stehende ehemalige Wankel-Gebäude, wo er und sein Ingenieurteam nun bahnbrechende klimapositive Technologien erforschen, entwickeln und fördern. Frank Obrist ist bei über 540 Patenten als Erfinder genannt.
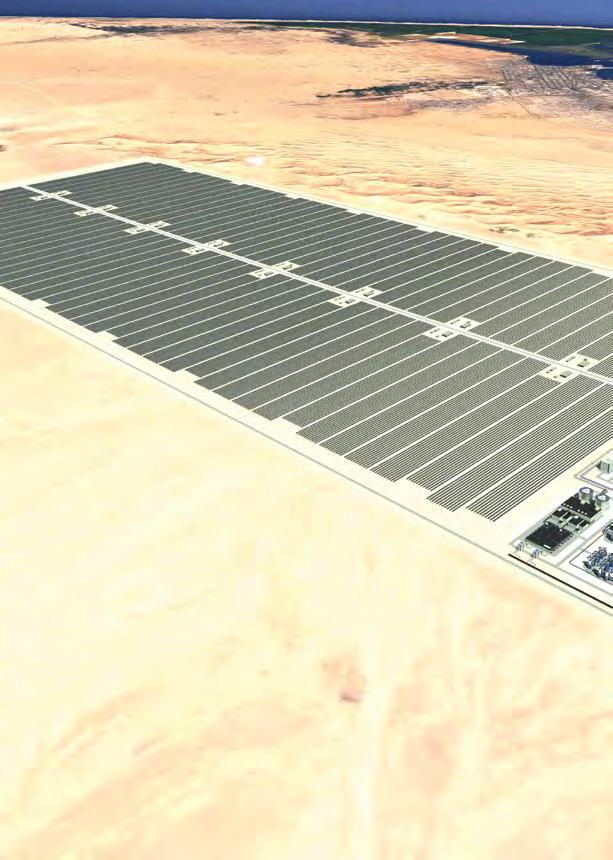


The Modern Forest
Das Konzept „The Modern Forest“ verbindet zwei von der OBRIST Group entwickelte Technologien, um den Energieträger aFuel® zu schaffen – das Direct-AirCapture (OBRIST DAC®) und das Konzept der Kohlenstoffsenke (cSink®). aFuel kombiniert dabei die Herstellung von grünem Methanol als flüssigen, global einsetzbaren Energieträger mit einem Prozess der Reduzierung von Kohlenstoff in der Atmosphäre. Der von OBRIST entwickelte Herstellungs-Prozess sieht eine höhere Abscheidung von atmosphärischem CO₂ als zur Herstellung nötig ist vor mit anschließender Verarbeitung des überschüssigen CO₂ zu festem Grafit (cSink®). Das Konzept nutzt dabei die im Überfluss vorhandene
Sonnenenergie im Sonnengürtel der Erde. So wird aFuel nicht nur zu einem CO₂-neutralen, sondern sogar zu einem CO₂-negativen Kraftstoff. Die Herstellung von aFuel ist die Basis eines sich bahnbrechend veränderten, globalen Energiesystems, das Kohlenstoffneutralität, technologische Machbarkeit, wirtschaftliche Stabilität und hervorragende Geschäftsmöglichkeiten vereint. Es steht für einen Energieträger, der universell für alle Arten von Transport, Kraftwerken, Heizungen oder chemischen Rohstoffen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus steht aFuel für Einfachheit in der Technologie, der Verteilung und der globalen Nutzung.
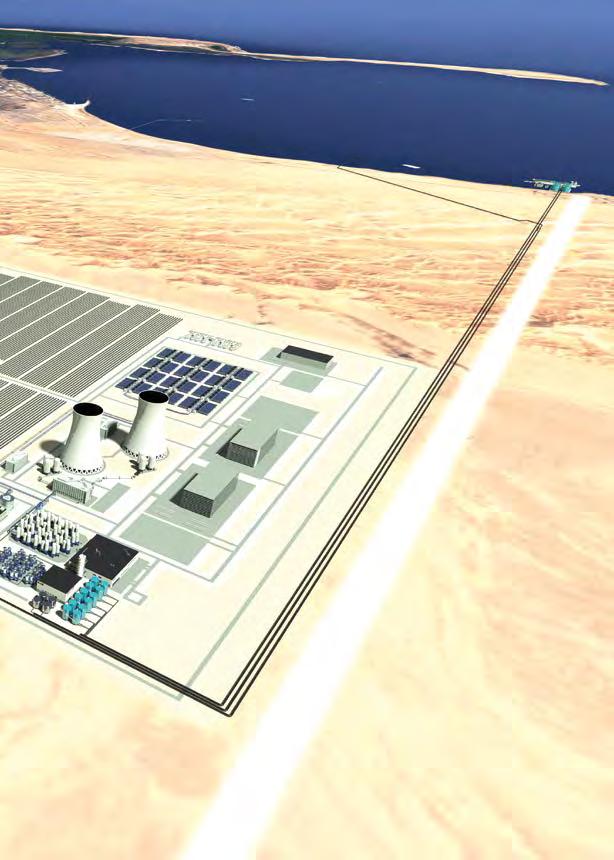
Modell einer Modern Forest Anlage: die im Sonnengürtel der Erde installierten Photovoltaikflächen in einer Größe von 20 mal 14 Kilometern könnten eine Leistung von 28,4 Gigawatt erbringen.

Nicht mehr Leistung als nötig: Elektrisches Fahren mit unbegrenzter Reichweite kombiniert der HyperHybrid-Powertrain mit maximaler Effizienz und erschwinglichen Kosten.
Wenig Gewicht, wenig Spritverbrauch: der Antriebsstrang HyperHybrid

HyperHybrid-Powertrain
Mit dem von der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) im Jahr 2023 ausgezeichneten HyperHybrid, einem seriellen Hybrid-Antriebsstrang, dessen Kernstück Zero Vibration Generator mit Methanol angetrieben wird, setzt OBRIST auf neue Konzepte in der Elektro-Mobilität. Wird der OBRIST HyperHybrid-Antriebsstrang mit aFuel betankt, kann er sogar CO₂-negativ betrieben werden.
Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zehn Prototypen des sogenannten HyperHybrid-Powertrains bestellt – das letzte Fahrzeug erhielt Anfang 2024 die Straßenzulassung. Das Konzept sieht vor, aMethanol zu tanken, aber mit einem Elektromotor zu fahren. Möglich macht das der in einen Tesla Model Y verbaute Zero Vibration Generator, der den Strom für einen Elektromotor erzeugt. Die riesigen Batterieblöcke, die herkömmliche E-Autos benötigen, entfallen bei dem Konzept des HyperHybrid. Vorteile sind die erheblich reduzierten CO₂-Emissionen und ein deutlich geringeres Gewicht des Fahrzeugs. Die unter 100 Kilogramm schwere Batterie reicht für eine Reichweite von 80 bis 90 Kilometern aus – wird mehr Reichweite benötigt, lädt der Zero Vibration Generator die Batterie nach. Der Spritverbrauch liegt bei rund 3,3 Litern auf 100 Kilometern. Der Anschaffungspreis eines HyperHybrid-Powertrains reduziert sich im Vergleich zum Preis eines herkömmlichen E-Fahrzeugs aufgrund der kleinen Batterie um ca. 50 %.


aFuel-Konzept besteht dreifache
Due Diligence
Die Umstellung der weltweiten Energieversorgung auf nachhaltig erzeugtes Methanol als Ersatz für fossile Energien wurde in einer dreifachen Due Diligence-Prüfung als realistisch, markttauglich und substanziell bestätigt. Die technische Prüfung des Konzeptes übernahm das international agierende Ingenieur- und Beratungsunternehmen ILF Consulting Engineers, die Überprüfung der das Konzept betreffenden Patente wurde durch die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei ETL-IP übernommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO wiederum führte eine Wirtschaftlichkeitsanalyse zur weitreichenden, globalen Umstellung auf grünes Methanol anstelle fossiler Energien durch. Die OBRIST Group stellt die Due Diligence-Prüfung potenziellen Investoren zur Verfügung.
Die deutsch-österreichische Industriegruppe ist ein Pionier in der Entwicklung von Innovationen zur Reduktion von Emissionen in Bereichen wie Wärmepumpenkompressoren, Antriebssystemen und CO₂-negativen Kraftstoffen. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen, Know-how-Transfer und Lizenzierung an und verfügt weltweit über mehr als 500 Patente. Die Firma blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Thermomanagementsystemen zurück und ist auf die natürlichen Kältemittel R744 (CO₂) und R290 (Propan) sowie die Entwicklung des weltweit ersten CO₂Kompressors spezialisiert.


Obrist Head Office – AT Rheinstraße 26-27 A-6890 Lustenau +43 55 77 623 70 office@obrist.at
Obrist Tech-Center – DE Felix Wankel Straße 10 D-88131 Lindau +49 8382 88 936 10 office@obrist.at


POSITIONSPAPIER DER LANDESREGIERUNG


BADEN-WÜRTTEMBERG | Die Abscheidung und Nutzung beziehungsweise die Abscheidung und Speicherung von CO₂, kurz CCU/S (Carbon Capture and Usage beziehungsweise Storage), sind wichtige Bausteine, um die Klimaschutzziele des Landes Baden-Württemberg zu erreichen. Ohne den Einsatz von CCU/S können diverse Wirtschaftszweige nicht klimaneutral werden.
Durch die nachhaltige Umgestaltung der Industrie und den damit verbundenen Verzicht auf fossile Kohlenwasserstoffe wird darüber hinaus der Bedarf an CO₂ als Ersatz für fossile Kohlenstoffquellen stark ansteigen. Das Thema Carbon Management ist daher elementar, sowohl für den klimaneutralen Umbau als auch für die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Rohstoffversorgung in Baden-Württemberg.



Anwendungsfelder für die CO₂-Abscheidung Grundsätzlich sollen nur die Treibhausgasemissionen, die sich nicht oder mit verhältnismäßigem Aufwand nicht vermeiden oder verringern lassen, für eine Anwendung von CCS in Frage kommen. Ebenso kommt für diese Emissionen CCU mit langfristiger Kohlenstoffbindung oder geschlossener Kreislaufführung in Betracht. Primäre Anwendungsfelder für die CO₂-Abscheidung werden daher derzeit in Baden-Württemberg vor allem in der Zement- und Kalkindustrie, bei Anlagen der thermischen Abfallbehandlung, in Teilen der chemischen Industrie und Raffineriestandorten sowie im Hinblick auf biogene CO₂-Emissionen zur perspektivischen Erreichung von Netto-Negativemissionen gesehen. Auch wenn bei der Herstellung von Stahl auf grünen Wasserstoff beziehungsweise erneuerbaren Strom umgestellt wird, entstehen dort weiterhin noch geringe Mengen an technisch unvermeidbaren Emissionen durch den notwendigen Kohlenstoff im Elektrolichtbogenofen.
Der Aufbau einer CO₂-Infrastruktur ist entscheidend dafür, ob der Hochlauf von CCU/S gelingen wird. Für Baden-Württemberg hat der zeitnahe Anschluss des Landes an eine europaweite CO₂-Pipeline-Infrastruktur eine sehr hohe Priorität. Küstenferne Standorte müssen ebenso schnell, wie küstennahe Standorte an die CO₂-Pipeline-Infrastruktur angeschlossen werden. Der Aufbau der CO₂-Pipeline-Infrastruktur darf folglich nicht zeitlich gestaffelt von Nord nach Süd erfolgen, sondern muss parallel an verschiedenen Punkten ansetzen, damit schnell ein deutschland- bzw. EU-weites CO₂-Transportnetz aufgebaut werden kann. An mehreren Punkten parallel mit dem Aufbau der CO₂-Infrastruktur zu beginnen, ist auch im Hinblick auf die Einbindung in ein europaweites Transportnetz sinnvoll, da Baden-Württemberg als Transitland, insbesondere für CO₂ aus der Schweiz und Österreich, fungieren wird. Die Landesregierung kann bei der Zusammenführung der unterschiedlichen [Red.: privatwirtschaftlichen] Akteure unterstützend tätig werden. Außerdem sollte die Notwendigkeit und Möglichkeit geprüft werden, eine staatliche Absicherung für den Aufbau der CO₂-Pipeline-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Landesregierung hat dies über den Bundesrat bereits in Richtung des Bundes adressiert und sieht diesen hier in der Pflicht.
Die Potenziale zur Nutzung von unvermeidbarem oder schwer vermeidbarem CO₂ müssen gleichberechtigt gegenüber der Speicherung von CO₂ betrachtet werden. Bei der CO₂-Nutzung steht die Kreislaufführung des CO₂ unter Betrachtung des kompletten Produktlebenszyklus im Vordergrund. Im Kontext von CCU muss CO₂ als Rohstoff betrachtet werden, denn perspektivisch muss der bislang vor allem fossil gedeckte Kohlenstoffbedarf, etwa in der chemischen Industrie, durch nichtfossilen Kohlenstoff ersetzt werden. Dies darf aber nicht zu einer Benachteiligung der heimischen Industrie führen und erfordert in weiten Teilen noch erhebliche Fortschritte in der Forschung, Entwicklung, industriellen Anwendung und Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Verfahren.
Für bestimmte CO₂-Nutzungsoptionen, wie erneuerbare Kraftstoffe, bei denen das CO₂ lediglich kurzzeitig gebunden ist und danach wieder in die Atmosphäre entweicht, sollte präferiert biogenes oder direkt aus der Atmosphäre entnommenes CO₂ eingesetzt werden, um den Kohlenstoffkreislauf geschlossen zu halten. Es muss möglich sein, den biogenen Anteil des im Pipelinenetz transportierten CO₂ auch für CO₂-Nutzungsoptionen mit kurzfristiger Kohlenstoffbindung einzusetzen. Um unnötigen Transport von CO₂ zu vermeiden, sollten darüber hinaus auch unvermeidbaren sowie schwer vermeidbaren Emissionen kurzfristige CO₂-Nutzungsoptionen offenstehen, wenn für diese ein bilanzieller Ausgleich über eine CO₂-Entnahme erfolgt, entweder direkt aus der Atmosphäre (Direct Air Carbon Capture and Storage) oder über Bioenergie mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung (Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Die für solch eine bilanzielle Kompensation erforderlichen Rahmen bedingungen müssen auf EU- und gegebenenfalls auch auf internationaler Ebene geschaffen werden.
Auszug aus:
„Positionspapier der Landesregierung Baden-Württemberg zu Carbon Management“ (15. Oktober 2024); QR-Code scannen und den kompletten Text lesen:


Blick auf die Stadt Singen, industrielles Zentrum des westlichen Bodensees.
ÖPNV | Seit Oktober 2024 sind sie in Friedrichshafen unterwegs –die autonomen Shuttles des „Reallabors für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV (RABus)“ werden in der Zeppelin-Stadt bis Juni 2025 sowohl im städtischen als auch im Überlandverkehr getestet.

Von WIMA-Redakteur Holger Braumann
Ziel des Projekts ist laut des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, den „öffentlichen Nahverkehr durch innovative Mobilitätslösungen flexibler, barrierefreier und zugänglicher zu machen – mit dem Fokus auf Randgebiete und ländliche Regionen“. Die umfassenden Tests seien ein wichtiger Schritt, um unterschiedliche Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse besser zu verstehen. Das Interessante an den monatelangen Fahrten durch die Stadt – wer Lust hat, an einer solchen Tour teilzuhaben, hat die Möglichkeit, die „Zukunft des ÖPNV hautnah zu erleben“.
Diese Gelegenheit ließ auch ich mir als Redakteur des Wirtschaftsmagazins Bodensee nicht entgehen. Und um das Fazit nach vorne zu stellen: ohne einen Fahrer, der im Notfall eingreifen kann, geht es natürlich noch nicht. Insbesondere während des innerstädtischen Fahrtabschnitts in der bele bten Charlottenstraße musste der Fahrer das ein oder andere Mal übernehmen.



Mit Erreichen der Hochstraße Richtung Stadtgrenze wurde die Fahrt deutlich flüssiger, als hätte sich der Bus einen kräftigen Schluck Mut angetrunken. Menschliche Unterstützung braucht der Bus ab und an vor allem, wenn es wie im Innenstadtbereich etwas enger wird, zum Beispiel wegen Fahrzeugen, die auf oder über die weißen Markierungen hinaus geparkt wurden. Auch die Kreisverkehre auf dem Weg bis zur Klinik durchfährt der Bus sehr langsam und selten ohne Unterstützung, was daran liegen mag, dass bisher nur die Sensoren nach vorne aktiv sind, seitlich kommende Fahrzeuge also spät erfasst werden. Und wie lange hätte es wohl gedauert, bis der Bus selbstständig den Weg über die Gegenfahrbahn gefunden hätte, als ein kurz vor dem Stadtteil Schnetzenhausen stehendes Baustellenfahrzeug den Weg versperrte? Da musste der Fahrer mal kurz zeigen, wie ein Mensch das so machen würde. Damit die Technologie davon lernen könne, stecke sie doch noch in den Kinderschuhen, so der mitfahrende und Daten sammelnde Entwickler des Autozulieferers ZF.
Aber um nicht falsch verstanden zu werden: die Mitfahrgelegenheit ist faszinierend, denn es gibt auch reichlich Gutes zu berichten. So schafft es die Software, den Bus über den längeren Teil der 20-minütigen Strecke zwischen Innenstadt und Krankenhaus sicher und autonom zu steuern. Entgegenkommende Autos sind kein Problem, das Abbiegen funktioniert tadellos und auch das akkurate Stoppen an den Haltestellen unterwegs wird erfolgreich durchgeführt. Die Fahrt ist ruhig, auch bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit von knapp unter 40 km/h. Unter den Passagieren wurde im Übrigen rege über die Technologie diskutiert, durchaus kritisch, im Wesentlichen aber überzeugt davon, dass sie sich in Laufe der kommenden Jahre durchsetzen wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass das „Mitschwimmen“ des Busses im fließenden Verkehr im Großen und Ganzen sehr gut gelingt. Über eine Begleitforschung des „Schlüsselprojektes des Verkehrsministeriums“ zu Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und technischen Lösungsansätzen ist die Wissenschaft eng in das Projekt eingebunden, unter anderem wie erwähnt ZF Friedrichshafen als Entwickler der Hard- und Software. In welchem Maße die Technologie Fortschritte macht, werde ich bei einer zweiten Testfahrt im Mai selbst unter die Lupe nehmen – und natürlich im Wirtschaftsmagazin Bodensee 2026 berichten.
Auf einer Route vom Klinikum Friedrichshafen über Sparbruck, Charlottenstraße, Hochstraße, Stadtbahnhof bis zum ZF Forum verkehrt der Shuttlebus im inner- und außerstädtischen Mischverkehr.
Interesse an einer RABus-Testfahrt mit dem autonomen Shuttle durch Friedrichshafen? Termin buchen unter www.projekt-rabus.de oder QR-Code scannen.


MAINAUER KLIMADIALOG | Beim zweiten
Mainauer Klimadialog drehte sich alles um den Bodensee als Wärmespeicher und die Technologie, mit der diese Wärme als CO2-neutrale Energiequelle genutzt werden kann. Ministerin Thekla Walker, Mainau Geschäfts-führerin Bettina Gräfin Bernadotte und Mainau Geschäftsführer Björn Graf Bernadotte diskutierten am 18. November 2024 gemeinsam mit rund 130 Gästen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Chancen und Herausforderungen der Seethermie für die Wärmewende in der Bodenseeregion.
In Vorträgen und einer Podiumsdiskussion wurde über die Funktionsweise der Seethermie, über ihre Bedeutung bei der kommunalen Wärmeplanung, die Wirtschaftlichkeit der Technologie, mögliche Folgen für das Ökosystem u nd die Fische sowie Forderungen nach internationalen Regeln referiert bzw. gesprochen. Außerdem boten mehrere Leuchtturmprojekte Einblicke in die bisherige Umsetzung der Seethermie, zum Beispiel die Universität Konstanz, die voraussichtlich ab 2027 mehr als zwei Drittel ihres Heizwärmebedarfs aus Seewärme decken wird.
Die Internationale Gewässerkommission für den Bodensee (IGKB) möchte die thermische Nutzung, insbesondere den Wärmeentzug, ermöglichen und hat diesbezügliche Regelungen in Abschnitt 5 der Bodensee-Richtlinie verankert. Insbesondere ist dort die Wiedereinleitung des thermisch genutzten Wassers in 20 bis 40 Metern Tiefe vorgeschrieben.


Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Luca Wilhelm Prayon (Landrat Bodenseekreis), Uli Burchardt (Oberbürgermeister Konstanz), Thekla Walker MdL (Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg), Gordon Appel, Geschäftsführer (Stadtwerke Konstanz GmbH), Tim Kazenmaier (Leiter Bereich Energietechnik, RBS wave GmbH), Julian Prietz (Moderation, Kommunikationsbüro Ulmer)
Eine der wichtigsten Aufgaben auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die Wärmewende. Mit über einem Viertel aller Treibhausgasemissionen ist der Gebäudesektor eine der größten Herausforderungen. Die Seethermie bietet ein enormes und bisher weitgehend ungenutztes Potenzial, um am Bodenseeufer CO2-neutral zu heizen. Wir brauchen genau solche kreativen, regionalen Ansätze, um die Wärmewende zu beschleunigen.«
Theresa Walker, baden-württembergische Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Potenzial rund um den See erkannt
In Bregenz wird ab Februar 2025 das Hallenbad per Seethermie beheizt, ab Mai auch das danebengelegene Festspielhaus. Das Casino und ein Hotel gehören ebenfalls zum ersten Ausbauschritt. In den nächsten Jahren soll ein Neubauviertel folgen, dann womöglich Teile der Altstadt. Das Land Vorarlberg hat zudem eine Studie erstellt, die alle Potenziale am dicht bebauten österreichischen Ufer aufzeigt.
In der Schweiz entsteht aktuell ein Nahwärmenetz für mehrere Hundert Haushalte in der Gemeinde Gottlieben (Kanton Thurgau), das sich aus Seethermie speist. Am baden-württembergischen Ufer sind abgesehen von Kleinprojekten an Einzelanwesen zwei Projekte in Meersburg und Konstanz-Dingelsdorf in fortgeschrittenem Planungszustand bekannt. Das Seewärmeprojekt in Meersburg steht dem Vernehmen nach mit einer BEW-Förderung (Förderquote 40%) kurz vor der Umsetzung. In Friedrichshafen werde innerhalb der Wärmeplanung konkret Stadtviertel benannt, die mit vorhandenen oder noch zu bauenden Wärmenetzen durch Seethermie versorgt werden können. In der Wärmeplanung der Stadt Radolfzell wird die Seewärmenutzung nicht quantitativ bewertet, aber als grundsätzliche Option aufgeführt. In der Maßnahmenliste wird eine übergreifende Machbarkeitsstudie zur Seewärmenutzung und bei vier für Wärmenetze geeigneten verdichteten Stadtbezirken eine Seewärmenutzung als mögliche Option aufgeführt.


Aber nicht nur Kommunen sehen im Rahmen ihrer Wärmeplanung Seewärmenutzungen vor, auch größere Einzelanwesen und gewerbliche Wärmenutzungen sind in der Planung. In letzterem Zusammenhang sind das Unternehmen Airbus, die Vermögen und Bau BadenWürttemberg für die HTWG Konstanz und die ZeppelinStiftung das Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen zu nennen. Für den Untersee gilt die Bodensee-Richtlinie mit den dort verankerten Anforderungen an thermische Nutzungen, unter anderem der Rückgabetiefe von 20 bis 40 Metern nicht. Unter anderem überlegen Gärtnereibetriebe auf der Insel Reichenau, Gewächshäuser mit Seethermie zu heizen.
Die Nutzung des Bodenseewassers zu Wärmegewinnung bietet wesentliche Vorteile. Zum einen ist die Wärme ist auch im Winter zuverlässig verfügbar. Zum anderen kann der Wärmeentzug die klimabedingte Erwärmung des Bodensees abfedern und somit eine positive Wirkung auf das Gesamtgewässer haben. Derzeit wird von Seiten des baden-württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft geprüft, wie zusätzliches privates Kapital aktiviert werden kann, um die Anfangsinvestitionen in erneuerbare Wärmequellen zu erleichtern. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) steht den Kommunen beratend zur Seite und unterstützt, organisatorische und technische Hürden zu überwinden.


MESSE FRIEDRICHSHAFEN | Eigener Strom für die Messe Friedrichshafen: Das Unternehmen geht mit der Installation einer Photovoltaik-Großanlage einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 5,5 Megawatt Peak, 12.350 PV-Modulen auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern wird die Dachanlage zur größten in der Bodenseeregion.
„Unser Ziel ist es, den Großteil des Jahresstrombedarfs unseres Unternehmens künftig selbst zu erzeugen, damit einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten und zusätzlich Überschüsse als grünen Strom ins Netz einzuspeisen“, sagt Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann. „Gleichzeitig tragen wir erheblich zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei.“ Geplant ist der Projektstart noch im Jahr 2024, die Inbetriebnahme der Anlage ist für Ende 2025 vorgesehen.
Mit dem Großprojekt geht nach einer kurzen Planungsphase von 1,5 Jahren ein komplexes Energieprojekt an den Start. Die Messegesellschaft schafft damit eine leistungsfähige Infrastruktur mit Zukunftsperspektive und leistet einen deutlichen Beitrag zu den Klimazielen der Stadt Friedrichshafen. Darüber hinaus wird der Überschuss als grün er Strom in das Netz für die Region eingespeist. „Diese Maßnahme ist energetisch und strategisch richtig. Mit Blick auf die Nachhaltigkeits-Strategie der Stadt muss die Nutzung von erneuerbaren Energien in allen Bereichen – auch in unseren Gesellschaften – großen Vorrang erfahren“, erklärt Andreas Brand im November 2024, zum damaligen Zeitpunkt Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Friedrichshafen und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen.
12.350 PV-Module verwandeln
Sonnenlicht in grünen Strom
Geplant ist die Installation der PV-Großanlage mit Projektkosten von 7,5 Millionen Euro auf insgesamt zehn Tonnendächern der Messe. Sie wird jährlich etwa 5.700 MWh Ökostrom erzeugen, was in etwa dem Verbrauch von 2.000 Haushalten entspricht. Technik und Architektur sind auf das anspruchsvolle Veranstaltungsgeschäft abgestimmt. Ein 2-MW-Batteriespeicher sorgt unter anderem dafür, dass auch nachts ausreichend Energie auf dem Messegelände zur Verfügung steht und den sehr schwankenden Strombezug größtenteils ausgleicht.

Der Planung der PV-Großanlage ging eine intensive Vorarbeit voraus: Diese umfasst unter anderem eine Flächenpotenzialanalyse, Machbarkeitsstudien und eine Angebotsabfrage, die besonde rs auch regionale Firmen bei der Auftragsvergabe berücksichtigt. Da die Installation ausschließlich auf den zehn bestehenden Dachflächen erfolgt, ist gewährleistet, dass keine Flächenversiegelung vorgenommen wird.
Weitere Informationen unter: www.messe-friedrichshafen.de
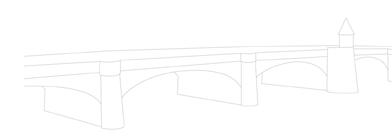

Das Angebot soll deutlich verbessert werden, Fahrgäste können zukünftig mit dem „Hochrhein-Bodensee-Express“ (HBE), der Basel und Herisau über Waldshut-Tiengen, Schaffhausen und Konstanz verbindet, von Baden-Württemberg in die Schweiz und wieder zurück fahren. Die Fahrzeit der neuen Direktverbindung zwischen Basel Badischer Bahnhof und St. Gallen wird sich auf 2 Stunden und 20 Minuten verkürzen (rund 20 Minuten schneller als die heutige Umsteigeverbindung), zwischen Basel und Romanshorn auf 2 Stunden (rund 10 Minuten schneller als die heutige Umsteigeverbindung). Der Bahnhof Waldshut wird zu einem Knotenbahnhof umund ausgebaut. Auf der modernisierten Strecke werden Halbtax- und Generalabonnemente anerkannt, was die Attraktivität des Angebots für Schweizer Fahrgäste zusätzlich erhöht.
2025 sollen dann die Hauptarbeiten beginnen: die Elektrifizierung der 75 Bahnkilometer zwischen Basel und Erzingen sowie die Modernisierung und die barrierefreie Gestaltung von 17 Stationen und 36 Bahnsteigen. In Rheinfelden-Warmbach, Bad Säckingen-Wallbach und Waldshut-West werden neue Haltepunkte eingerichtet. Die Stationen Tiengen und Lauchringen werden zu Kreuzungsbahnhöfen umgebaut. Zudem wird in Tiengen ein Umrichterwerk errichtet.
Wie der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann mitteilte, teilen sich die deutsche und schweizerische Seite die Kosten in Höhe von 434 Millionen Euro, die auf deutscher Seite vom Bundesver-
ÖPNV | Die Hochrheinbahn zwischen Basel und Herisau wird elektrifiziert und ausgebaut. Ein neuer Regionalexpress wird das Angebot auf der Strecke ergänzen. Eines der wichtigsten grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte in Südbaden geht damit in die nächste Phase. Im Rahmen des Infrastrukturprojektes wird die Hochrheinstrecke bis Ende 2027 vollständig elektrifiziert und ausgebaut.
kehrsministerium, dem Land Baden-Württemberg sowie den Landkreisen Lörrach und Waldshut finanziert werden. Die Schweiz beteiligt sich am Ausbau und der Elektrifizierung der Hochrheinbahn mit 50 Millionen Franken. Eine entsprechende Vereinbarung haben der Schweizer Bundesrat Albert Rösti und Winfried Hermann am 28. Oktober 2024 im Rahmen eines digitalen Treffens unterzeichnet.
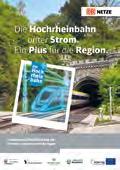

Broschüre zur Hochrheinbahn erhältlich unter www.die-hochrheinbahn.de/ mediathek oder QR-Code

www.die-hochrheinbahn.com


HOLENSTEIN AG | Die Holenstein AG ist ein führendes Logistikund Transportunternehmen in der Ostschweiz. In Konstanz ist das Schweizer Familienunternehmen seit 1990 als Holenstein GmbH mit einem eigenen Standort vertreten. Im Rahmen einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie baut das Unternehmen seine PhotovoltaikAnlagen laufend aus und hat den ersten vollelektrischen LKW in seine Fahrzeugflotte integriert.
Der Betrieb eines Logistik- und Transportunternehmens mit über 100.000 m2 Lagerfläche und 125.000 Palettenplätzen sowie der entsprechenden Gebäude- und Lagertechnik mit Gabelstaplern und Niederflurförderfahrzeugen benötigt immer mehr Strom. Deshalb setzt Holenstein bereits seit 2014 auf die Produktion von eigenem Solarstrom. Im Jahr 2015 ermöglichten die Transport- und Logistikprofis mit der Teilvermietung der Dachfläche des Logistikcenters in Schwarzenbach den Bau einer der größten Photovoltaikanlagen der Schweiz mit über 10.000 Modulen auf einer Fläche von 15.000 m2
Installierte Gesamtleistung von über 1 Megawatt-Peak
Im Jahr 2022 konnte dann auf dem Dach des Erweiterungsbaus in Schwarzenbach die erste eigene Großanlage mit 2.000 Solarmodulen auf einer Fläche von 3.500 m2 realisiert werden. Auch in Konstanz wird laufend in die Solarenergie-Gewinnung investiert. In diesem Jahr wurde die Photovoltaikanlage um eine Fläche von 1.200 m2 mit einer Leistung von 100 Kilowatt-Peak erweitert, was den Eigenversorgungsgrad von 17 % auf rund 40 % erhöhte.
Für die Jahre 2025-2026 ist in Konstanz ein weiterer Ausbau um 100 Kilowatt-Peak geplant. Insgesamt betreibt Holenstein heute an den Standorten WiI, Schwarzenbach und Konstanz auf einer Fläche von 4.150 m2 Photovoltaikanlagen mit 3.200 Solarmodulen. Mit einer Gesamtleistung von 1.010 Kilowatt-Peak decken diese den Strombedarf und sparen jährlich rund 154 Tonnen CO2 ein.

Volvo FH Aero Electric – der neue Star in der Flotte
Seit Sommer 2024 bereichert der erste vollelektrische LKW die Fahrzeugflotte von Holenstein. Der neue Volvo FH Aero Electric verfügt über sechs Batterien mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg und einer maximalen Batteriekapazität von 540 kWh. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 400 km bei einer Nutzlast von 23,8 Tonnen. Ein wichtiger Meilenstein für Holenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Gütertransport.
Modernste Technologien für Lagerlogistik und Transportabwicklung, automatisierte Hochregallager für die unterschiedlichsten Güter, 400 Mitarbeitende und rund 130 Fahrzeuge sind für die Kunden täglich im Einsatz.
Internationale Transporte: Als Mitglied verschiedener Netzwerke und Kooperationen realisieren wir europaweit kurze Lieferzeiten. Deutschland, Schweiz, BENELUX und Vorarlberg sowie die Häfen Bremen und Hamburg bedienen wir täglich.
Im Bereich Lagerlogistik bieten wir an unseren Standorten in CH-Wil, CH-Schwarzenbach, CH-Schaffhausen, CH-Bürglen und D-Konstanz auf rund 100.000 m2 Lagerfläche Platz für über 125.000 Paletten.
Verzollung: Für Ihre Export- und Importgüter übernehmen unsere rund 18 Zolldeklaranten die gesamte Zollabwicklung.
Holenstein GmbH, Max-Stromeyer-Str. 31, D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 89284 0, www.holenstein.de

VORARLBERG | In mehreren Kilometern schlummern tiefe heiße Quellen, die für eine CO2freie Wärmeversorgung genutzt werden können – eine im Mai 2024 vorgestellte Studie zeigt, dass es in Vorarlberg zwei Zonen gibt, die für eine wirtschaftliche Erschließung geeignet wären: Den Norden des Rheintals und den Raum Feldkirch.
„Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass für die Energieversorgung Vorarlbergs gleich mehrere Schätze gehoben werden können: Die Wärme aus dem Bodenseewasser oder auch die Abwärme, die bei der Industrieproduktion oder bei Kläranlagen entsteht. Jetzt wissen wir: Auch tief unter der Erde liegt enormes Potenzial, um Vorarlberg künftig unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen“, sagt Energielandesrat Daniel Zadra. Vorarlberg hat sich mit der Energieautonomie ein ambitioniertes Ziel für den Klimaschutz gesetzt. Bis spätestens 2050 soll die gesamte Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. Eine der großen Herausforderungen dabei ist die Umstellung der gesamten Wärmeversorgung in Haushalten, in Dienstleistungsbetrieben, in Gewerbe und Industrie.
„Um die Datenlage zu verbessern und die Potenziale detaillierter bestimmen zu können, sind eine ganze Reihe vertiefender Analysen durchgeführt worden. Jede dieser Analysen war begleitet von konkreten Vorschlägen für weitere Schritte in Richtung Erschließung und Umsetzung“,
Mehr Information online unter voralberg.at
so Zadra. Der Zielhorizont für Bregenz bzw. das nördliche Rheintal stellt der so genannte Autochthone Malm dar, der dort in einer Hochzone (Struktur Bregenz) und somit einer wirtschaftlich darstellbaren Tiefenlage von 4.700 bis 4.900 Meter mit erwartbaren Temperaturen von rund 150 °C vorliegt. Für einen potenziellen Standort Feldkirch kommen die Ablagerungen des Helvetikums als Zielhorizont in Frage. Die Basis des Helvetikums liegt in Feldkirch in 4.500 Meter Tiefe und umfasst den gesamten geologischen Aufbau des Umfelds.
Experten rieten als nächsten Schritt ein Seismik-Verfahren durchzuführen, das durch die flächenhafte Auslegung von Messlinien eine relativ genaue Abbildung des Untergrunds ermöglicht. Die Messanordnung besteht dabei aus einem möglichst gleichmäßigen Raster von Geophonen und Vibrationspunkten. Im September 2024 kündigte Zadra eine solche 3D-Seismik-Messung an, die nun weitere Rückschlüsse liefern soll.



Hier dreht sich was: Seit 22 Jahren haben Kommunen und Wirtschaftsförderungen gemeinsam mit den Machern des Wirtschaftsmagazins Bodensee ein Ohr am Puls des Sees (Titel WiMa 2023; aquaTurm Radolfzell, Foto: Michael Schellinger)


IM GESPRÄCH | Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Trend – sie revolutioniert unsere Welt auf allen Ebenen. Ob in der Automatisierung von Prozessen, der Optimierung von Entscheidungen oder als Treiber für Innovationen: KI dringt in fast jeden Lebensbereich vor und verändert, wie wir arbeiten und leben. Mit diesen Veränderungen gehen Risiken, vor allem aber Chancen einher – auch im Handwerk.
Über diese Chancen sprachen wir mit Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz.
Herr Hiltner, wie verändert sich das Handwerk durch neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz (KI)?
KI findet mittlerweile in vielen Branchen Anwendung, um die Effizienz zu steigern, und das Handwerk bildet da keine Ausnahme. Ob bei der Planung und Verwaltung von Bauprojekten, in smarten Werkstätten oder im Bereich 3D-Druck –KI hält zunehmend Einzug. Laut einer Studie des Mittelstand Digital Zentrum Handwerk sehen 80 Prozent der befragten Handwerksunternehmer KI als hilfreiche Unterstützung an, aber nicht als Ersatz für Manpower. Auch soll die KI eher dabei helfen, bestehende Prozesse zu optimieren als neue Produkte oder Prozesse zu schaffen.
Können Sie uns konkrete Anwendungsbeispiele im Handwerk nennen?
Gerne. CNC-Maschinen, die durch KI gesteuert werden, ermöglichen es Schreinereien, komplexe Formen präzise und effizient herzustellen. Im Bauhandwerk gibt es KI-gestützte Systeme, die
Gebäudeschäden analysieren und diagnostizieren. Auch im Bereich der Kundenkommunikation sind KI-Lösungen wie Chatbots oder virtuelle Assistenten im Einsatz, um Terminbuchungen zu vereinfachen oder individuelle Angebote zu erstellen. Die vorausschauende Wartung von Maschinen, bei der KI potenzielle Ausfälle vorhersagen kann, ist ebenfalls ein wachsendes Anwendungsfeld.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von KI im Handwerk konkret?
Zunächst einmal steigert sie die Effizienz, da Arbeitsprozesse automatisiert und optimiert werden können. Das spart Zeit und führt zu weniger Fehlern. Zudem können Kosten gesenkt werden, etwa durch eine optimierte Materialbeschaffung oder durch die Reduktion von Ausfallzeiten bei Maschinen. Auch der Fachkräftemangel kann durch KI zumindest teilweise abgefedert werden. Automatisierte Prozesse und assistierende Systeme machen handwerkliche Berufe attraktiver und verringern gleichzeitig die körperliche Belastung.

» KI wird die Rolle des Handwerkers verändern, weg von der rein manuellen Tätigkeit hin zu einem technologisch unterstützten Beruf, der mehr Fokus auf Planung, Koordination und Qualitätskontrolle legt.
Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz

Was hindert dennoch viele Betriebe, sich an das Thema KI zu wagen?
Da ist zum einen die Implementierung von KI, die natürlich mit Kosten verbunden ist. Für kleine Betriebe kann das eine große Hürde darstellen. Ein weiteres Problem ist die Datensicherheit. Vernetzte KI-Systeme greifen auf sensible Kundendaten zu, was strenge Datenschutzvorgaben erfordert. Manche Systeme sind außerdem sehr komplex, das heißt die Einführung und Bedienung von KI erfordert oft neue Kompetenzen, die erst aufgebaut werden müssen. Ohne die Investition in Weiterbildung geht es nicht. Wir führen für unsere Mitglieder immer wieder – teilweise mit Partnern - Infoveranstaltungen zum Thema KI durch. Auch als Bildungsträger sind wir bereits dabei, entsprechende Angebote zu entwickeln.
Wie könnte die Zukunft des Handwerks mit KI aussehen? Worauf müssen sich die Unternehmen einstellen?
KI wird die Rolle des Handwerkers verändern, weg von der rein manuellen Tätigkeit hin zu einem technologisch unterstützten Beruf, der mehr Fokus auf Planung, Koordination und Qualitätskontrolle legt. Dennoch werden die handwerklichen Fertigkeiten nach wie vor im Mittelpunkt stehen, die Kreativität und Expertise der Handwerker bleiben unverzichtbar. Neue Berufsfelder werden entstehen und dafür werden wir neue Rahmenbedingungen brauchen. Meine Empfehlung an Handwerksbetriebe wäre, sich frühzeitig mit dem Thema KI auseinanderzusetzen und kleine, testbare Projekte zu starten. So können Unternehmen schrittweise Erfahrungen sammeln und sich für die Zukunft wappnen. Wer jetzt nicht handelt, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren.
Handwerkskammer
Konstanz
Webersteig 3
D-78462 Konstanz
Tel. +49 7531 2050 info@hwk-konstanz.de www.hwk-konstanz.de www.bildungsakademie.de

„Wir gehören zu den wirtschafts-
IM GESPRÄCH | Die Wirtschaftsregionen rund um den Bodensee sind eng miteinander verbunden. In Konstanz ist es insbesondere die Nähe zur Schweiz, die das Leben und die Wirtschaft in der Region prägt. Darüber und warum die gute Zusammenarbeit nicht gefährdet werden darf, haben wir mit Katrin Klodt-Bußmann, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau, gesprochen.
Frau Klodt-Bußmann, Herr Müggler, wie würden Sie die deutsch-schweizerische Wirtschaftsregion beschreiben? Klodt-Bußmann: Die traditionell starke wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verflechtung im deutsch-schweizerischen Grenzraum ist das herausragende Merkmal unserer Region. Unser Wirtschaftsraum ist so eng verwoben, dass wir eigentlich nicht vor zwei Regionen sprechen können. Charakteristisch ist auch die Branchenvielfalt. Hier sind viele Unternehmen aus verschiedenen Sektoren ansässig, darunter Maschinenbau, Chemie, Pharma, Elektro- und Feinmechanik, aber auch eine bunte Gründerszene in den Bereichen Nachhaltigkeit, Medizintechnik, Bildung und KI.
Müggler: Ich kann das nur bestätigen. Auch in den Bereichen Handel, Forschung und Entwicklung, Logistik und Tourismus ist unsere Region stark. Die Wirtschaftsstruktur im Süden Deutschlands und in der Nordschweiz ist zudem sehr ähnlich
und vor allem mittelständisch geprägt. Viele Unternehmen sind inhabergeführt und „Hidden Champions“, die im globalen Markt aktiv sind.
Klodt-Bußmann: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum unsere Grenzregion gern unterschätzt wird. Es gibt nicht den einen großen Industriestandort. Deswegen ist vielen auch nicht bewusst, wie stark unsere Region ist. Wäre die internationale Bodenseeregion ein Nationalstaat, würde er mit einer Bruttowertschöpfung von 67.000 Euro pro Einwohner zu den fünf wirtschaftsstärksten Staaten Europas gehören.
Müggler: Damit das so bleibt, müssen die Grenzen für den Handel und den Personenverkehr offen sein. Offene Grenzen fördern wirtschaftliche Aktivitäten. Das kann man in Konstanz bei der Schänzlebrücke gut sehen. Täglich passieren dort tausende Autos und Lastwagen in beide Richtungen die Grenze.
Katrin Klodt-Bußmann (53) ist seit Januar 2024 die neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Hochrhein-Bodensee. Zuvor war sie Professorin für Wirtschaftsrecht sowie u.a. für Großkanzleien und einen Automobilkonzern tätig.
Jérôme Müggler (44) ist seit 2019 Direktor der Industrie und Handelskammer Thurgau. Zuvor war er für das Beratungsunternehmen KPMG in Zürich tätig. Studiert hat der Thurgauer Geschichte und deutsche Literatur an der Universität Zürich sowie strategisches Marketing und marktorientierte Unternehmensführung an der Universität Basel.
Würde man die Grenze schließen oder den Übergang erschweren, wirkt sich das direkt auf die Wirtschaft und das Leben der Menschen im Grenzraum aus.
Klodt-Bußmann: Das konnten wir gut beobachten, als während der Corona-Krise die Grenzen zeitweise geschlossen waren. Tausende Pendlerinnen und Pendler, die täglich zur Arbeit in die Schweiz fahren, waren betroffen. Dem deutschen Einzelhandel fehlte plötzlich die Schweizer Kundschaft. Und die Unternehmen, die häufig Standorte auf beiden Seiten der Grenze unterhalten, wussten zeitweise nicht, wie sie ihre Lieferketten und Produktionen aufrechterhalten können. In dieser Zeit wurde besonders deutlich, wie wichtig es ist, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert.
Wo sehen Sie Herausforderungen?
Müggler: Aktuell sehe ich vor allem die laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über die Weiterentwicklung der Bilateralen Verträge als Herausforderung, die auch die Grenzregion betreffen. Dabei geht es um eine Handvoll Marktzugangsabkommen, von welchen beide Seiten stark profitieren. Wenn der bilaterale Weg weiter erodiert, würde dies dem Handel in der Region schaden.
Klodt-Bußmann: Dass die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU so schwierig sind, hat auch mit den unterschiedlichen politischen Systemen zu tun. Für die Menschen in der Schweiz ist die direkte Demokratie mit Volksabstimmungen sehr wichtig. Das sollten wir respektieren.
Müggler: Ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen ist die Rolle des Europäischen Ger ichtshof (EuGH), der im Streitfall europäisches Binnenmarktrecht auslegen soll. Die Schweiz kennt ihrerseits keine Verfassungsgerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne. Deshalb ist es für die Schweiz
schwieriger, ein System zu akzeptieren, in dem das Stimmvolk nicht das letzte Wort haben würde. Im gleichen muss die Schweiz verstehen, dass eine Teilnahme am Binnenmarkt eben an gewisse Regeln gebunden ist, die auch für die EU-Mitglieder gelten.
Wird es eine Lösung geben?
Klodt-Bußmann: Fehlen entsprechende bilaterale Abkommen, ist das für die Unternehmen mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Abkommen schaffen Rechtssicherheit, minimieren Handelshemmnisse und unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von Unternehmen in beiden Regionen. Die Abkommen bieten klare und einheitliche Regeln und reduzieren Unsicherheiten, insbesondere bei Fragen der Produktsicherheit, Umw eltstan dar ds und technischen Vorschriften. Angesichts der zahlreichen Gespräche zwischen deutschen und Schweizer Akteuren und dem spürbaren
Willen auf beiden Seiten, die enge Zusammenarbeit zu vertiefen, bin ich dennoch optimistisch. Die Beziehungen der Schweiz und der EU gleichen manchmal einer Familie. Man setzt sich auseinander, es wird intensiv diskutiert und findet schließlich eine gute Lösung.
Müggler: Ich finde das Bild der Familie sehr schön. Wir haben einen vertrauten Umgang, sind eng verbunden und wissen, was wir aneinander haben. Manchmal wird intensiv diskutiert und verhandelt - und finden eine gute Lösung. Gerade weil die Import- und Export-Zahlen eindeutig zeigen, wie sehr beide Seiten voneinander profitieren. Selbst bei Kritikerinnen und Kritikern der Bilateralen Verträge herrscht dann oft großes Staunen.
Klodt-Bußmann: Wir müssen den Menschen immer wieder erklären, was auf dem Spiel steht. Hierfür ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Industrie- und Handelskammern (IHKs), wie zwischen Deutschland und der Schweiz, von großer Bedeutung. Der regelmäßige Austausch der IHKs stärkt die Stimme der Unternehmen in unserer Region gegenüber Regierungen und internationalen Institutionen.
Industrie- und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee
Reichenaustraße 21 D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 2860 100 info@konstanz.ihk.de www.ihk.de/konstanz

IM GESPRÄCH | Wie kann die Energiewende gelingen und was ist aus Sicht der Wirtschaft dabei wichtig? Wir sprachen mit Präsident Martin Buck der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und Dr. Sönke Voss, IHK-Hauptgeschäftsführer, über die großen Herausforderungen, vor denen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bei der Energiewende stehen.
Herr Dr. Voss, wie steht die Wirtschaft zur Energiewende? Dr. Sönke Voss: Die Energiewende kann nur mit wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen gelingen. Viele Betriebe aber stehen inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Der aktuelle konjunkturelle Abwärtstrend macht auch unserer wirtschaftsstarken Region zu schaffen. Die Attraktivität des Standorts Deutschland hat Schaden genommen. Wir haben massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Die Betriebe leiden unter einer überbordenden Bürokratie, die kaum mehr Gestaltungsraum und Platz für Ideen und Innovationen lässt, und unter der teuren Energie. Die Industrie als Leitbranche steht durch die hohe Kostenbelastung und den Strukturwandel besonders unter Druck und ist in die Rezession gerutscht. Hohe Energiepreise bremsen sowohl unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit als auch die Nachfrage insgesamt aus. Die Umsätze in und Absätze aus Deutschland sind im Sinkflug. Hier besteht dringender politischer Handlungsbedarf. Darüber hinaus ist vor allem auch die Energiewirtschaft besonders durch bürokratische Regelungen belastet. Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange. Das hemmt den Ausbau Erneuerbarer Energien. Deshalb gilt: Ohne nachhaltigen Bürokratieabbau und stimmige, verlässliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft wird die Energiewende nicht gelingen.
Herr Buck, Deutschland will bis 2030 seine Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren – und bis 2045 die Klimaneutralität erreicht haben. Wo sehen Sie die wichtigsten Voraussetzungen für ein Gelingen der Energiewende?
Martin Buck: Drei kritische Fragen sind beim Gelingen der Energiewende aus meiner Sicht entscheidend: Erstens: Wie und wo können wir möglichst viel Energie sparen? Zweitens: Wie lässt sie sich Energie am effektivsten „ernten“, also abschöpfen, und drittens: Wie bekommen wir das Speichern und Verteilen in den Griff? Und ich bin mir sicher, dass wir keinen dieser drei zentralen Punkte durch überbordende Regularien, Bürokratie und Vorschriften oder eine einseitige und sprunghafte Subventionspolitik erreichen werden. Ganz im Gegenteil. Das würde uns wirtschaftlich immer weiter in einen Abwärtsstrudel reißen. Was wir brauchen, ist die Stärkung der Wirtschaft, das Vertrauen auf marktwirtschaftliche Prinzipien und den Fokus auf deutlich mehr Innovationen. Energie einzusparen liegt im Eigeninteresse der Wirtschaft und wir brauchen hier einen CO2-Preis, der im europäischen Emissionshandel marktwirtschaftlich wirkt. Netzentgelte müssen

insgesamt reduziert werden und es darf nicht darauf ankommen, mit welcher Methode oder Technologie Einsparungen erzielt werden, sondern dass am Ende nur die Einsparung an sich finanziell attraktiv ist. Weiterer wesentlicher Punkt ist das „Beschaffen“ von Energie. Zentrale Voraussetzung hierfür ist ein deutlich beschleunigter und vor allem auch effizienterer und damit kostengünstigerer Netzausbau. Dafür braucht es endlich eine verlässliche Politik, die den Unternehmen den Raum für Innovation und unternehmerische Tätigkeit gibt und so Kreativität freisetzt. Das krampfhafte Fördern einzelner Technologien gepaart mit unendlichen Dokumentationspflichten ist ein Irrweg. Die Stromerzeugung mit dem tatsächlichen Stromverbrauch in Einklang zu bringen, ist ein Thema für sich und wird nur funktionieren, wenn wir einerseits die Speicherkapazitäten massiv erweitern und andererseits die Elektrizitätswirtschaft schnellstmöglich digitalisieren. Auch hier brauchen wir maximale Flexibilität, Innovationsfreude, die für die Unternehmen nicht zur Innovationslast wird, und zügige, einfache Genehmigungsverfahren.

Wenn uns dies alles gelingt und schlanke Genehmigungsverfahren auf hohe Skalierungseffekte neuer Technologien treffen, dann bin ich zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft auch im Bereich „Energiewirtschaft“ Exportschlager entwickeln kann. Das muss unser Ziel sein.
Wie wichtig ist das Thema Wasserstoff für die Energiewende?
Dr. Sönke Voss: Sehr wichtig. Wasserstoff ist ein zentraler Baustein der klimagerechten Transformation der Wirtschaft. Zahlreiche regionale Unternehmen sind bereits in Sachen Wasserstoff tätig. Erste Elektrolyseure und Wasserstofftankstellen werden geplant, Geschäftsmodelle entwickelt, Innovationen erprobt und getestet. Unsere IHK vernetzt die regionalen Experten, unterstützt bei Innovationsprojekten und hatte sich massiv für die nun im Wasserstoff-Kernnetz eingeplante Leitung an den Bodensee eingesetzt. Darüber kommen auf einer „Wasserstoff-Autobahn“ mittel- bis langfristig signifikante Mengen an Wasserstoff in die Region, gleichzeitig ist dies der erste Schritt in Richtung einer Anbindung an Leitungen aus Südeuropa und einen europäischen Markt für Wasserstoff. Zudem gibt es erste konkrete Planungen der regionalen Versorger, welche Leitungen im Verteilnetz auf Wasserstoff umgestellt werden und wo schon heute neue Leitungen mitgedacht werden müssen, z.B. im Zuge anderer Tiefbaumaßnahmen. Allerdings ist aus heutiger Sicht nicht mit einem flächendeckenden Wasserstoffnetz bis in alle Betriebe und Wohngebäude zu rechnen. Wasserstoff wird auf absehbare Zeit ein knappes Gut sein und vor allem in bestimmten industriellen Prozessen sowie in Kraftwerken zum Einsatz kommen. Wir brauchen daher eine neue gesamtenergetische Denkweise: Strom, Gas und Wärme – international, regional und lokal. Es muss sichergestellt werden, dass die jeweils notwendige Versorgung in der Fläche garantiert ist. Und es muss durch umfassende Informationen sowie eine transparente und öffentliche Kommunikation eine positive Akzeptanz für Erneuerbare Energieanlagen und Energieinfrastruktur geschaffen werden. Denn der Ansatz „null Flächenverbrauch, maximaler Naturschutz, flächendeckende Infrastruktur und dies alles zu geringen Kosten“ wird nicht funktionieren, zumal wir neben der Energiewende noch weitere Mammutaufgaben vom Bildungsbereich über marode Verkehrsinfrastruktur bis hin zur Verteidigung haben.
Was tut sich in Sachen Wasserstoff in der Region?
Martin Buck: Die frühzeitige Versorgung mit Wasserstoff ist wichtig, weil regionale Unternehmen in diesem Bereich Produkte, Anlagen und Dienstleistungen anbieten oder entwickeln und unter Hochdruck an neuen Lösungen arbeiten. Es besteht viel Potenzial für den Export dieser Lösungen in

die ganze Welt. Wichtig ist allerdings, dass hier die ganze Wertschöpfungskette von der Stromerzeugung über den Elektrolyseur und die Verteilung von Wasserstoff bis hin zur Verwendung in Produktionsprozessen in kleinerem Maßstab erprobt und dann skaliert werden kann. In der Praxis erleben wir aber viel zu oft, dass Unternehmen mit größtem Einsatz und unter hohen Kosten Nachhaltigkeits-Innovationen und -Projekte angehen, die dann aber durch unzählige Auflagen, Gutachten und Genehmigungsprozesse endlos in die Länge gezogen werden oder komplett scheitern. So kann eine erfolgreiche Transformation nicht gelingen. Die Politik und die Behörden sind jetzt dringend gefordert, die Genehmigungsverfahren für Elektrolyseur-Anlagen zu vereinfachen und auch verlässliche Rahmenbedingungen für deren Betrieb zu schaffen. Ansonsten werden andere Länder einen Technologievorsprung haben und unsere regionalen Unternehmen einen Nachteil.
IHK Bodensee-Oberschwaben Lindenstr. 2
D-88250 Weingarten
Tel. +49 751 409-0 info@weingarten.ihk.de www.ihk.de/bodensee-oberschwaben

IM GESPRÄCH | Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, über die Situation auf dem Arbeitsmarkt
Herr Auch, die wirtschaftliche Lage ist angespannt, der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt und gleichzeitig fehlen überall Fachkräfte. Wie blickt die Arbeitsagentur auf die Lage hier vor Ort?
Zwar stehen wir in der Region Bodensee-Oberschwaben vergleichsweise solide da, doch die konjunkturelle Lage sowie die Transformationsprozesse in der Wirtschaft schlagen sich auch auf unseren regionalen Arbeitsmarkt nieder. Dieser ist im Prinzip zweigeteilt: Einerseits steigt seit einiger Zeit die Arbeitslosigkeit nach und nach an und die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Stellen geht deutlich zurück. Andererseits wächst die Beschäftigung kontinuierlich und es gibt weiterhin Bereiche, die händeringend Personal, vor allem Fachkräfte suchen.
Wie erklären Sie sich das und was sind die Herausforderungen auf diesem Arbeitsmarkt?
Angebot und Nachfrage zusammenzubringen wird zunehmend schwerer. Nicht selten haben arbeitslose Menschen nicht die am Markt gesuchten Qualifikationen oder, was noch schwerer wiegt, gar keinen Berufsabschluss. Eine neue Arbeit aufzunehmen oder eine bestehende Tätigkeit langfristig zu halten, wird so deutlich schwieriger. In anderen Worten: Für Geringqualifizierte wird die Luft am Arbeitsmarkt immer dünner. Die laufenden Transformationsprozesse, verursacht z. B. durch Digitalisierung und Dekarbonisierung, verstärken das noch. Wir können den Wandel am Arbeitsmarkt nur erfolgreich bewältigen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend aus- und weitergebildet werden – und Arbeitgeber das nach Kräften unterstützen. Dabei sind die Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr umfangreich.
Ganz generell empfehle ich den Betrieben daher, sich direkt beim Arbeitgeber-Service individuell beraten zu lassen, um die passenden Angebote zu finden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Arbeitnehmer, ganz gleich ob Beschäftigte oder Arbeitsuchende, diese können sich entweder über die Arbeitsvermittlung oder die „Berufsberatung im Erwerbsleben“ über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.
Welche Rolle nimmt dabei die Agentur für Arbeit ein?
Wir beraten, investieren in Bildung und suchen nach konkreten Lösungsansätzen. Das beginnt bei der Berufsorientierung von jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf, gilt insbesondere aber auch für Menschen, die schon im Erwerbsleben stehen. Für diese hat die Agentur für Arbeit mit der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ ein neues Angebot geschaffen. Das frühzeitige Erkennen von Qualifizierungsbedarfen und die finanziellen Fördermöglichkeiten des Qualifizierungschancengesetzes (QCG) tragen dazu bei, Arbeitslosigkeit präventiv zu vermeiden und für Betriebe langfristig Fachkräfte zu sichern. Wichtig sind aber auch ganz konkrete Ansätze, um die Rahmenbedingungen für die Transformation zu verbessern. So z. B. das Modell „Direkteinstieg Kita“ in Baden-Württemberg. Hier können lebens- und berufserfahrene Menschen in unter zwei Jahren und bei vollem Gehalt eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz machen. In Singen, Ravensburg und Leutkirch haben sich seit September 2023 insgesamt schon 76 Personen für den neuen Bildungsgang entschieden. Das sind 76 ganz konkrete Beiträge gegen den Fachkräftemangel in Erzieherberufen.
Mathias Auch (49) ist seit Juli 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Zuvor war er in gleicher Position bei der Agentur für Arbeit in Ulm.
Der Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg umfasst die Landkreise Konstanz und Ravensburg sowie den Bodenseekreis mit etwa 800.000 Einwohnern und über 330.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Neben der Hauptagentur in Konstanz gibt es Geschäftsstellen in Singen, Überlingen, Friedrichshafen, Ravensburg und Wangen im Allgäu.
Kontakt zum Arbeitgeber-Service www.arbeitsagentur.de/vor-ort/konstanz-ravensburg/ unternehmen oder 0800 4 5555-20.
Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg Pressestelle
Stromeyersdorfstraße 1 D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 585 522 www.arbeitsagentur.de
Das Leben steckt voller Chancen. Lassen Sie sich für Ihre weitere Karriere inspirieren – von unserem Online-Erkundungstool New Plan.




Für Veränderung ist man nie zu alt. Ob Sie sich fortbilden, umorientieren oder neue Fähigkeiten aneignen wollen, wir beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten. Mehr unter www.arbeitsagentur.de/k/newplan




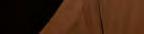
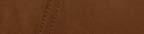




REGIONALBÜRO FÜR BERUFLICHE FORTBILDUNG | John
Naisbitt (Zukunftsforscher und Autor 1929-2021) formulierte vor 30 Jahren: Wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen. Er hat die Informations- und Wissensgesellschaft früh prognostiziert und war damit seiner Zeit voraus.
Ein weiterer großer Denker unserer Zeit, Albert Einstein, beschreibt sein Denken und Leben – im Verstehen wollen und Erkennen. Er war ein „Fan“ vom Machen und Versuchen: „Trial and Error“ – war eines seiner Mottos. Wissen gilt in unserem Kulturkreis als wichtige Säule auf dem Weg zum Erfolg. Vom Wissen allein allerdings kann sich eine Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Es braucht die Umsetzung des Wissens in praktische Anwendung!
Berufliche Fortbildung eröffnet die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten so weiterzuentwickeln, dass wir Wissen in Können erfolgreich umzusetzen lernen. Bildung ermöglicht uns die Vielfalt von Lösungsansätzen zu erkennen, aufzugreifen und gestalterisch auf einen guten Weg zu bringen! Chancen nutzen, Vorstellungskraft erweitern, über den Tellerrand hinausschauen, Umsetzen und Machen, das leistet Bildung – sie hat uns geprägt und zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Im Regionalbüro für berufliche Fortbildung erhalten Sie – ganz individuell – Antworten zu Ihren beruflichen Ideen und Zielen. Wir reden mit Ihnen über Ihr berufliches Können und Ihre berufliche Entwicklung – sprechen Sie uns an!
KOSTENFREI – NEUTRAL – UNABHÄNGIG
KARRIEREMESSE – JOBS FÜR DEN SÜDEN |
Die nächste KARRIEREMESSE findet im Mai 2025 in Ravensburg statt. Die etablierte Jobmesse für Recruiting und Personalmarketing zog letztes Jahr 112 Aussteller und 1.650 Besucher an.
Studenten, Absolventen, Berufsein-, und Umsteiger, Experten sowie erfahrenen Fach- und Führungskräfte kommen hier mit den Angeboten aus Industrie, Handel und Dienstleistung in Kontakt.
Bildungsträger, Hochschulen und Universitäten aus der Vierländerregion bieten zudem eine Übersicht der Weiterbildungsmöglichkeiten und deren Finanzierung an. Ein Arbeitgeber Pitch, Coaching-Angebote und professionelle Bewerberfotos runden das Programm ab.

» Lernen ist Erfahrung –Alles andere ist einfach nur Information.«
(Albert Einstein)
Regionalbüro für berufliche Fortbildung der Landkreise Konstanz und Sigmaringen
Rita Hafner-Degen
Kirchplatz 1, D-88630 Pfullendorf Tel. +49 7552 251156 rita.hafner-degen@stadt-pfullendorf.de www.regionalbuero-bw.de
Die KARRIEREMESSE 2025 findet am 08.05.2025 von 11 – 19 Uhr in der Oberschwabenhalle Ravensburg statt. Der Eintritt ist frei.
Ausstellerverzeichnis und Besucherinformationen unter www.karrieremesse-im-süden.de
JOBS FÜR DEN SÜDEN
08.05.2025
Eine Veranstaltung von


Bo densee M agazin Jährlich neu: Die schönsten Seiten des Sees


Oberschwa ben Ma ga zin Barock, Thermen, Genuss zwischen Ulm und Bodensee

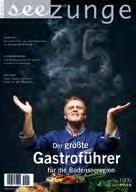










IFM-UNTERNEHMENSGRUPPE | In einer Welt, in der soziale und ökologische Verantwortung zunehmend an Bedeutung gewinnt, hat die ifm-Unternehmensgruppe eine Vorreiterrolle in der sozialen Nachhaltigkeit übernommen. Mit einem klaren Fokus auf ethische Geschäftspraktiken und sozialer Verantwortung zeigt ifm, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können.
Ein zentraler Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit bei ifm ist das Engagement für die eigenen Mitarbeitenden. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit fördert. Durch gezielte Schulungsprogramme und Mentoring-Initiativen unterstützt ifm die persönliche und berufliche Entwicklung aller Beschäftigten. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur hohen Mitarbeiterzufriedenheit bei, sondern auch zur geringen Fluktuation im Unternehmen.
ifm bietet allen ifmlern mit der sogenannten ifmLernfabrik regelmäßige Weiterbildungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse und Karriereziele abgestimmt sind. Dies ermöglicht es den Angestellten, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern und sich auf neue Herausforderungen vorzubereiten. Zudem fördert das Unternehmen eine offene Kommunikationskultur, in der Ideen und Feedback willkommen sind. Diese Transparenz stärkt das Vertrauen und die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen.
Die ifm-Lernfabrik: interne Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden zur nachhaltigen Wissensund Qualitätssicherung
Verantwortung gegenüber der Neben dem Engagement für die eigenen Mitarbeitenden zeigt ifm auch ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in sozialen Projekten und fördert lokale Initiativen. Ob durch finanzielle Unterstützung, Freiwilligenarbeit oder Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen – ifm setzt sich dafür ein, das Leben der Menschen in der Umgebung zu verbessern.
Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft
Ein herausragendes Beispiel für das soziale Engagement ist die Einführung von Pflegelotsinnen und -lotsen, die ifmlern helfen, Pflegeverantwortung und Berufstätigkeit miteinander zu vereinbaren. In Anbetracht der Herausforderungen, die viele Beschäftigte erleben, wenn Angehörige plötzlich pflegebedürftig werden, bietet ifm eine wertvolle Unterstützung. Die geschulten Pflegelotsinnen und -lotsen fungieren als erste Anlaufstelle und helfen den Mitarbeitenden, sich im Dschungel der Pflegeangebote und -möglichkeiten zurechtzufinden.
Scheckübergabe für die Lebenshilfe Ravensburg e.V. v.l.n.: Nadine Zadravec und Lena Mayer (HR-Marketing ifm), Ursula Keller (Lebenshilfe Ravensburg e.V.), Maxim Michel, Anna Engelberg (Lebenshilfe Ravensburg e.V.)
Auch die Ehrenamtskampagne reiht sich in die Maßnahmen für soziale Nachhaltigkeit ein. Sie fördert das Engagement der Mitarbeitenden in sozialen Projekten und bietet jedes Jahr einen wechselnden Schwerpunkt. ifmler können sich mit ihren Initiativen, in denen sie sich ehrenamtlich betätigen, bewerben. 2024 erhielten zehn Gewinner eine Geldspende von jeweils 1.000 Euro. Unter anderem konnte sich die Lebenshilfe Ravensburg e.V. über solch eine Zuwendung freuen. Der Verein bietet neben dem sozialen Austausch in den Clubs Tagesausflüge sowie Wochenend- und Sommerfreizeiten für Menschen mit Behinderung aus Weingarten, Ravensburg und der Umgebung an.
Diese Initiativen zeigen, wie wichtig es für ifm ist, nicht nur ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, sondern auch aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen in der Region beizutragen. Durch solche Maßnahmen wird deutlich, dass soziale Nachhaltigkeit bei ifm nicht nur ein Schlagwort ist, sondern in der täglichen Praxis gelebt wird.
Nachhaltige Produkte und Prozesse
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit bei ifm ist die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Prozesse. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, innovative Technologien zu nutzen, die nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich sind. Durch ressourcenschonende Produktionsmethoden und die Verwendung nachhaltiger Materialien minimiert ifm die Umweltbelastung und trägt aktiv zum Klimaschutz bei.
Die Produkte von ifm sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Effizienz in der Industrie zu steigern. Dies ist nicht nur gut für den Planeten, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem zunehmend umweltbewussten Markt. ifm investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Lösungen zu finden, die sowohl den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden als auch den Anforderungen an die Nachhaltigkeit gerecht werden.


Nachhaltigkeitsbericht 2023
Transparente Kommunikation und Berichterstattung
Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seine Fortschritte und Herausforderungen offen und transparent zu kommunizieren. In regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichten informiert ifm über seine Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse im Bereich der sozialen Verantwortung. Diese Transparenz schafft Vertrauen bei den Stakeholdern und zeigt, dass ifm bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich kontinuierlich zu verbessern.
Wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Einfluss im Einklang
Durch sein Engagement zeigt ifm, dass Unternehmen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein können, sondern gleichzeitig auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können. Indem ifm die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden und der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt, trägt das Unternehmen dazu bei, eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu gestalten.
ifm-Unternehmensgruppe ifm-Straße 1 D-88069 Tettnang Tel. 0800 16 16 16 4 info@ifm.com www.ifm.com




HIGHTECH VOM BODENSEE
Seit über 40 Jahren bietet das Konstanzer IT-Systemhaus Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich an.
Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen plant, entwickelt und realisiert KNDS Deutschland Mission Electronics zusammen mit ihren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Information und Kommunikation in Hardware und Software.
2024 änderte ATM ComputerSysteme GmbH ihren Brand Name in KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH. KNDS Deutschland Mission Electronics ist ein Tochterunternehmen der KNDS Deutschland GmbH & Co KG.
PRODUKTE & ENTWICKLUNG
KNDS Deutschland
Als IT-Systemhaus erbringt KNDS Deutschland Mission Electronics Leistungen in den Bereichen:
/ Applikationsentwicklung, / Taktische Kommunikationslösungen, / Computer- & Serversysteme, / Embedded Systems, / Panel-PCs, / Displaylösungen, / Netzwerk-Switche, / Stromversorgungslösungen, / Systeme mit Safety-Funktionen, / Kundenspezifische Entwicklungen, / Life Cycle Management und / Beratung & Projektmanagement.
Von der Idee über das Entwickeln bis zur Integration suchen wir zur Verstärkung unserer Entwicklungsabteilungen motivierte Mitarbeiter (m/w/d) mit den Studienschwerpunkten / Informatik, / Elektro-/Nachrichtentechnik, / Logistik/Produktionssteuerung.
Zusätzlich bietet KNDS Deutschland Mission Electronics neben dem Dualen Studium auch Praxissemester und Bachelor-/Masterthesis an.
Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter stellen-kmw-group.kmweg.de/ATM/ oder richten Sie Ihre Bewerbung initiativ an jobs-kdme@knds.de.
Mission Electronics GmbH Max-Stromeyer-Str. 116 · 78467 Konstanz · +49 75 31 80 83 · knds-electronics.de · mission-electronics@knds.de
KNDS DEUTSCHLAND MISSION ELECTRONICS | Als langjähriger Partner der Bundeswehr bilden die Lösungen aus dem Konstanzer Systemhaus das digitale Rückgrat der Kampffahrzeuge des Heeres. KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH (früher ATM ComputerSysteme GmbH) liefert als technologieorientiertes Systemhaus und Komplettanbieter für mobile und stationäre Kommunikationsund IT-Lösungen gehärtete Systeme, Hardware und Software für Anwendungen in geschützten und gepanzerten Fahrzeugen.
KNDS Deutschland Mission Electronics unterstützt Vorhaben von der ersten Idee und Studie, der Konzeption und dem Projektmanagement – über Entwicklung, Konstruktion und Serienproduktion bis hin zur Qualifizierung, Funktionstests und dem Life-Cycle-Management.
Kommunikation auf dem Gefechtsfeld
Auf dem digitalen Gefechtsfeld ist eine verlust- und verzögerungsfreie Übertragung unterschiedlichster Daten, Informationen und Medien sowie deren Management die Voraussetzung für die Führungsfähigkeit eines Einsatzverbandes. Nur mit einem funktionierenden Kommunikationsverbund lässt sich Führungsüberlegenheit erzielen. Als zentralen Backbone der Kommunikation entwickelt KNDS Deutschland Mission Electronics hierzu das System KommServer. In der Bundeswehr als KommServerBw eingeführt, ist er das zentrale Bindeglied zwischen allen eingeführten heterogenen,
schmal- und breitbandigen Kommunikationsnetzen sowie den angeschlossenen Applikationen und Sensoren.
Ohne Informationen gibt es kein optimiertes Lagebild, keine Beurteilung der Situation, keinen Handlungsentschluss. Informationen forcieren die Lage, machen das Feld dynamisch und müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Qualität adäquat und effektiv aufrufbar sowie bearbeitbar sein. Für die Informationsverarbeitung im Fahrzeug heißt das sowohl die Daten des F ührungs- und Informationssystems als auch die Sensorinformationen von Kameras, Wärmebildgeräten, Jammern, akustischen Detektoren, Radarsystemen oder Laserentfernungsmessern und angeschlossener Applikationen zu verarbeiten.
KNDS Deutschland Mission Electronics bietet hierfür unterschiedliche praxiserprobte Rechnersysteme an.
Über 40 Jahre Erfahrung im militärischen Umfeld und das langjährige Fachwissen der Mitarbeiter bilden das größte Kapital der KNDS Deutschland Mission Electronics. Das ist die Grundlage für hohe Qualität, stetige Bewährung im Einsatz und zufriedene A nwender. KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH ist Teil der deutsch-französischen Wehrtechnikgruppe KNDS, die Marktführer in Europa für hochgeschützte Rad- und Kettenfahrzeuge ist.
KNDS Deutschland
Mission Electronics GmbH
Max-Stromeyer-Str. 116
D-78467 Konstanz
Tel. +49 75 31 808 3 mission-electronics@knds.de www.knds.de


VETTER | Aus einer kleinen Apotheke zu einem global operierenden
Unternehmen: Der Werdegang von Sabrina Lieb, Produktionsleiterin in der Lösungsherstellung und Materialvorbereitung am Standort Langenargen, und die Geschichte von Vetter weisen erstaunliche Parallelen auf. Das gilt auch für ihren Job und ihr Hobby: In beiden Rollen muss sie darauf vertrauen können, dass jeder Handgriff sitzt.
„Als ich noch als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke angestellt war, habe ich im Dienst alle zehn Minuten auf die Uhr geschaut. Dort war mir viel zu wenig los, die Zeit ist nicht vergangen“, erinnert sich Sabrina Lieb an ihre ersten, etwas ernüchternden Schritte ins Berufsleben. Sie ist eher der Typ, der Herausforderungen sucht. Also holte Lieb die Fachhochschulreife nach, studierte in Freising Lebensmitteltechnologie, hängte an der Universität Tübingen den Master Pharmaceutical Sciences and Technologies dran. Hier begann sie sogar eine Promotion in der Pharmakologie zum Thema
Parkinson, die sie aber aufgrund mangelnder Datenlage bei Studienuntersuchungen an Mäusen aufgeben musste. Wie im Studium, als sie immer schon morgens um sieben in der Uni saß, während andere erst gegen zehn eintrudelten, ließ sie sich davon jedoch nicht ausbremsen. „Aus verschiedenen Gründen ging es mit der Promotion nicht voran. Ich brauche aber immer Bewegung und Dynamik“, erzählt Sabrina Lieb. Dass sie schließlich bei Vetter landete, hat auch mit dieser Rastlosigkeit zu tun, mit ihrem Drang zu neuen Aufgaben.
Neben dem Studium in Tübingen machte Sabrina Lieb ihren Trainerschein im Klettern, arbeitete in einer Kletterhalle. Dort lernte sie auch ihren heutigen Mann kennen, dessen Tante bei Vetter arbeitete. „Ich komme aus Laupheim, natürlich war mir Vetter ein Begriff. Viele aus der Ausbildung sind damals zu Vetter gegangen. Ich dachte aber nicht, dass ich hier einen Job finden würde, ich wollte auch eher in die Forschung.“ Trotzdem bewarb sie sich 2018 auf die Stelle einer Teammanagerin im Ansatz – und erhielt schon am nächsten Tag eine Einladung. Sabrina Lieb gab Vetter also doch noch eine Chance – zum Glück: „Mir hat das Unternehmen sofort gut gefallen“, erinnert sie sich an ihren Einstieg. „Ein junges Team, alle nett und motiviert … Der Teamgeist hat mich einfach gefesselt.“
Seit 2021 ist sie Produktionsleiterin in Langenargen und schätzt an ihrem Job genau das, was sie für ihr Glück braucht: „Hier ist kein Tag wie der andere, man muss immer zu 100 Prozent wach und aufmerksam sein, um flexibel und GMPkonform auf Probleme im Ablauf zu reagieren, Standzeiten einzuhalten und die Produktion zu garantieren“, sagt sie – und hat damit genau das gefunden, was sie in der Apotheke einst vermisste: Herausforderungen und Abwechslung.
Die knapp 130 Mitarbeitenden schätzen ihre Chefin, weil sie ihnen bei aller Energie und Dynamik immer freundlich, wertschätzend und gut gelaunt begegnet. Weil sie fördert und fordert und ihnen viel zutraut. „Ich möchte immer, dass sich meine Mitarbeitenden ihrer großen Verantwortung bewusst sind“, betont Sabrina Lieb. „Das erreiche ich nur, indem ich Kontrolle abgebe, Verantwortung übertrage. Natürlich überwache ich die Abläufe. Aber ich ermutige jedes Teammitglied mit immer neuen, spannenden Aufgaben dazu, den eigenen Kopf einzuschalten und sich nie zu sehr auf nachgelagerte Kontrollinstanzen zu verlassen. Alle sollen sich der Tragweite ihrer Tätigkeit und der Konsequenzen ihres Handelns bewusst sein. Nur so fördere ich sie darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“
Dass sie damit richtig liegt, zeigte zum Beispiel die für alle aufregende Inspektion durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) im vergangenen Jahr. „Als junges Team hatte niemand von uns Erfahrungen mit einer solchen Situation. Aber wir haben alle 120 Prozent gegeben, an einem Strang gezogen. In solchen Situationen merke ich diesen wahnsinnigen Zusammenhalt im Team bei Vetter. Das war großartig, sehr erfolgreich – und habe ich so noch nirgends erlebt“, erinnert sich Lieb.
Vetter Pharma-Fertigung
GmbH & Co. KG
Schützenstr. 87
D-88212 Ravensburg www.vetter-pharma.com/karriere
Auch bei ihrer Leidenschaft, dem Bergsport, geht es darum, Menschen, die man teilweise auch noch nicht gut kennt, viel zuzutrauen. Als Klettertrainerin bringt sie ganz unterschiedlichen Menschen bei, gemeinsam eine Felswand zu bezwingen. Im Miteinander einer Seilschaft entdeckt Sabrina Lieb Parallelen zu ihrem Team bei Vetter. „Das Spannende am Klettern ist: Es entsteht eine tiefe Bindung untereinander, weil man gemeinsam ein Ziel im Blick hat und anderen dabei ein Stück weit das eigene Leben anvertraut. Das genieße ich auch im Job. Wir sind füreinander da und stehen füreinander ein – um Herausforderungen gemeinsam zu meistern.“
Besser hätte es Sabrina Lieb also nicht treffen können – privat wie beruflich.

… jeder Tag neue und herausfordernde Aufgaben und Ereignisse bereithält. Ich mag besonders, dass ich durch neue Aufgaben und Themen die Möglichkeit habe, dazuzulernen und meine Fähigkeiten weiter auszubauen.
… ist Bergsport jeglicher Art. Dabei tanke ich Energie – egal ob beim Klettern, Mountainbiken oder Skifahren, am Fels, im Schnee oder im Eis.
… ist White Risk, die über die Lawinengefahr in der Schweiz informiert. Sie ist ein Muss bei der perfekten Vorbereitung auf eine Skitour am Wochenende.

STADLER RAIL GROUP | Die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) hat Stadler einen Signalling-Umsetzungsvertrag für die Modernisierung der Zugsicherungssysteme im gesamten Schienennetz erteilt. Mit dem Ersatz des alten Systems wird die Lenkung der Züge verbessert, was die Pünktlichkeit der Züge und die Sicherheit im Betrieb erhöht.
Der Großauftrag im Umfang von 500 Millionen US-Dollar sieht vor, dass Stadler das alte System innerhalb von acht Jahren nach Projektstart durch ein Zugbeeinflussungssystem der neusten Generation ersetzt.
Stadler rüstet die Metro mit dem Zugbeeinflussungssystem NOVA Pro aus. Damit können die Züge von MARTA mit höchster Sicherheit betrieben werden, wobei die Lokführer beim Führen der Züge optimal unterstützt sind. Ein Lokführer wird weiterhin an Bord sein, um den Zug zu steuern und die Fahrt zu überwachen, und er wird bei Bedarf oder im Falle eines Zwischenfalls eingreifen. Dadurch wird die Kapazität erhöht, der Bahnbetrieb pünktlich und sicher abgewickelt und hat damit einen direkten Kundennutzen. Das System ist zudem effizienter, was Kosten spart. Mit der Einführung dieses Systems wird MARTA zu einem der fortschrittlichsten Verkehrssysteme des Landes.
Für Stadler ist der Auftrag der MARTA der bisher größte Auftrag im Signalling-Bereich. „Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein und stellt für uns den internationalen Marktdurchbruch im Bereich CBTC dar. MARTA und ihre Fahrgäste können sich auf ein hochmodernes Zugsiche-
www.stadlerrail.com
rungssystem freuen, das den Metro-Betrieb pünktlicher, sicherer und effizienter macht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Metro Atlanta, bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und dass sie neben den Zügen nun auch auf unsere Lösung bei der Zugsicherung setzt”, sagt Markus Bernsteiner, Group CEO Stadler Rail. „Das CBTC-System von Stadler bietet MARTA eine robuste, zukunftssichere Lösung, die der wachsenden Nachfrage nach einem sicheren, effizienten und leistungsfähigen Verkehrssystem in Atlanta gerecht wird. Indem MARTA und Stadler dieses historische Projekt vorantreiben, rückt Atlanta näher an die Spitze der modernen Verkehrslösungen und bietet den Fahrgästen der Region ein verbessertes Reiseerlebnis“, sagt Lucy Andre, CEO von Stadler Signalling North America.
Stadler CBTC – Zugsicherungssystem der neusten Generation
CBTC steht für „Communication-Based Train Control“. Damit ist CBTC ein fortschrittliches Zugsteuerungssystem, das drahtlose Kommunikation nutzt, um Züge jederzeit präzise zu lokalisieren. Dank den dadurch gewonnen Echtzeitinformationen über die Zugposition und -geschwindigkeit können Züge präziser gesteuert werden.

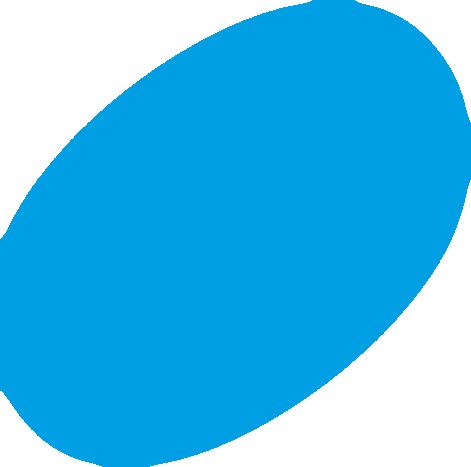
Innovationsführer, Ideengeber und Benchmark. Das ist SCHUNK für Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik. Wir sind nicht nur Komponentenhersteller. Wir sind verlässlicher Premiumpartner im Realisieren von automatisierten und digitalen Fertigungsbausteinen.
Automatisierung benötigt hochkarätige Spannelemente Auch unser Werk in Mengen setzt Maßstäbe. Das Kompetenzzentrum für Drehfutter und Stationäre Spannsysteme ist Partner für höchste Prozesssicherheit in der automatisierten Bearbeitung.
Mit überlegenen Komponenten wecken wir ungeahnte Reserven. Mit geballter Innovationskraft stehen wir an Ihrer Seite.
Erfahren Sie mehr unter schunk.com/wow




Wie FONDIUM die Zukunft der Gießerei neu definiert
FONDIUM | Die Automobilbranche steht vor einem grundlegenden Wandel. Elektromobilität, Nachhaltigkeitsziele, der wirtschaftliche Abschwung sowie eine veränderte Nachfrage in Europa stellen nicht nur die großen Automobilhersteller vor immense Herausforderungen, sondern auch deren Zulieferer. Die Unsicherheiten in der Branche sind spürbar. Niedrigere Produktionsabrufe und eine Neuausrichtung des Fahrzeugmarktes fordern die gesamte Lieferkette heraus. Fehlende politische Konjunkturprogramme sowie die aktuelle wirtschaftliche Lage verstärken diese Unsicherheiten. FONDIUM stellt sich darauf ein und investiert gezielt in innovative Technologien, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.
Insbesondere die Dekarbonisierung ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Der Kupolofen, das Herzstück der Schmelzerei, wird aktuell noch mit fossilem Koks betrieben. FONDIUM hat nun Projekte gestartet, die auf CO₂-neutrale Alternativen setzen. Diese erfordern aktuell mehr Zeit für Optimierungen, um Qualität und Produktion sicherzustellen. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen die Effizienz des Kupolofens als Recyclinganlage. Getreu dem Motto „aus Alt mach Neu“ setzt FONDIUM Schrottpakete aus der Industrie ein, um hochwertige Gussteile zu produzieren.
Zudem integriert FONDIUM Nachhaltigkeit auf allen Ebenen der Produktion: Effizienzsteigerungen in der Schmelzerei, der Einsatz von CO₂-reduzierenden Technologien und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft – diese Maßnahmen sind nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch ein entscheidender Faktor für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Kunden schätzen die nachhaltige Ausrichtung und die Innovationskraft des Unternehmens, das aktiv an zukunftsfähigen Lösungen arbeitet. Gerade in Zeiten der Veränderung bleibt
die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten essenziell. FONDIUM pflegt diese Partnerschaften, um gemeinsam neue Wege zu gehen und Lösungen zu entwickeln, die den Wandel der Mobilität erfolgreich begleiten. Die Kombination aus Dekarbonisierung, Innovation und flexibler Anpassung an Marktbedingungen macht FONDIUM zu einem verlässlichen Partner in einer sich wandelnden Industrie.
Mit dieser Ausrichtung definiert FONDIUM nicht nur die Zukunft der Gießerei neu, sondern ist gleichzeitig auch ein attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt.

FONDIUM Singen GmbH Julius-Bührer-Str. 12 D-78224 Singen Tel. +49 7731886-0
info-si@fondium.eu www.fondium.eu
THÜGA ENERGIENETZE GMBH | Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Als langjähriger Netzbetreiber kümmert sich die Thüga Energienetze zuverlässig um die Instandhaltung und den Ausbau der regionalen Energienetze in der Bodensee-Region und arbeitet als etablierter Partner in der Energiebranche, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort an einer nachhaltigen sowie wirtschaftlich sinnvollen Realisierung dieser Ziele.

So wurden allein in den letzten 10 Jahren eine Vielzahl an Leitungen saniert, neue Übernahme- und Verteilstationen gebaut und mit modernster Technik ausgestattet. Mit dem Neubau des Singener Schalthauses wurde eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, um auch in Zukunft eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Durch die fortlaufenden, umfangreichen Investitionen befinden sich die Netze in einem sehr guten Zustand. Das spiegeln die geringen Stromausfallzeiten wieder: Laut Bundesnetzagentur lag der bundesweite Durchschnitt im Jahr 2022 bei 12,2 Minuten. Bei der Thüga Energienetze GmbH lag dieser Wert im eigenen Netzgebiet in der Region Hegau lediglich im Sekundenbereich. Doch die steigende Nachfrage nach Strom, insbesondere aus Industrie und Gewerbe, sowie die Entwicklungen in Privathaushalten fordern weiterhin den starken Ausbau der Stromnetze, weshalb das Unternehmen auch in den kommenden Jahren weiter investiert.
„Um das Singener Stromnetz nochmals deutlich zu verstärken, planen wir innerhalb der nächsten 10 Jahre den Bau eines Umspannwerks in Singen“, so Stefan Filipic von den Thüga Energienetzen. „Für eine zukunftsfähige Gestaltung der Energiewende in unserer Region erarbeiten wir zudem umfangreiche Zielnetzplanungen. Das heißt wir analysieren, welche leistungstechnischen Anforderungen sich an das Stromnetz ergeben und erstellen auf dieser Basis Planungen, die das Netz für die Umsetzung solcher Anforderungen ertüchtigen. Dabei spielen verschiedene Faktoren, wie beispielsweise der steigende Ausbau von PV-Anlagen, Wärmepumpen sowie die Elektrifizierung der Industrie eine Rolle.“ Stefan Filipic, Thüga Energienetze GmbH
Diese Rahmenbedingungen erfordern eine umfangreiche Netzsteuerung und Netzdigitalisierung. Nur so werden die wachsenden Anforderungen an das intelligente Stromnetz der Zukunft gemanagt.
Energie bewegt die Welt. Und die Thüga Energienetze GmbH ist mittendrin. Als regional orientiertes Unternehmen kümmert sich der Netzbetreiber um die Gas-, Stromund Wärmenetze für rund 130 Städte und Gemeinden in Süddeutschland. Betreibt, baut auf, baut aus. Und macht unsere Versorgungsinfrastruktur fit für klimafreundliche, nachhaltige Energie.

Thüga Energienetze GmbH Industriestraße 7, D-78224 Singen Tel. +49 7731 1480-0 info@thuega-netze.de www.thuega-energienetze.de

» Um das Singener Stromnetz nochmals deutlich zu verstärken, planen wir innerhalb der nächsten 10 Jahre den Bau eines Umspannwerks in Singen.«

Geschäftsführung der TeleData GmbH im Rechenzentrum: Armin Walter, kaufmännischer Geschäftsführer (li.), Stephan Linz, technischer Geschäftsführer (re.)
TELEDATA | Unsere Lösung für Unternehmen, die sich ein Rundum-Sorglos-Paket für die eigene IT-Infrastruktur wünschen.
TeleData ist der Full-Service-Provider für Telekommunikationsdienste wie Internet, Telefon, Fernsehen, Standortvernetzung sowie Cloud-Produkte und Rechenzentrumslösungen in der Region BodenseeOberschwaben-Allgäu-Hegau.
Seit Jahren investieren wir kontinuierlich in den Breitbandausbau auf Glasfaserbasis und damit in den Aufbau eines flächendeckenden regionalen Hochgeschwindigkeitsdatennetzes.
Unsere Geschäftskunden profitieren dabei nicht nur von gigabitfähigen Breitbandanschlüssen, sondern gleichermaßen von einem vollumfänglichen Angebot an Cloud-Produkten und Rechenzentrumslösungen. Hierfür betreiben wir ein nach ISO 27001 zertifiziertes Rechenzentrum – das TeleData CENTER.
Durch die Zusammenarbeit mit regionalen IT-Dienstleistern bieten wir unseren Kun-
den skalierbare IT-Lösungen und Service aus einer Hand, sprich mit nur einem Ansprechpartner direkt vor Ort. Ziel dabei ist es, die Geschäftsprozesse des Kunden so einfach und dabei so flexibel wie möglich zu gestalten und in ein intelligentes ITGesamtkonzept zu überführen. Wir sorgen für ein hoch performantes, reibungsloses und ausfallsicheres Funktionieren der kundenseitigen IT-Systeme und damit für das Rundum-Sorglos-Paket, das es den Kunden ermöglicht, sich voll und ganz auf ihr Kernbusiness zu konzentrieren.
TeleData GmbH Kornblumenstraße 7
D-88046 Friedrichshafen Tel. +49 7541 5007-0 info@teledata.de www.teledata.de


AIRBUS DEFENCE AND SPACE | Airbus hat in Immenstaad am Bodensee offiziell mit der Herstellung und Montage des Satelliten für die polare Eis- und Schneeüberwachungsmission CRISTAL begonnen. Wie andere Copernicus-Missionen wird auch CRISTAL von der Europäischen Kommission finanziert und von der Europäischen Weltraumorganisation verwaltet.

Die CRISTAL-Satelliten werden ein fortschrittliches Multifrequenz-Höhenmessgerät an Bord haben, um die Dicke des Meereises und die Höhe der Eisschilde zu messen – wichtige Indikatoren für den Klimawandel. Dieses Höhenmessgerät mit der Bezeichnung IRIS wird zum ersten Mal die Schneebedeckung der Eisschilde messen, was die Datenqualität im Vergleich zu seinem Vorgänger CryoSat-2 erheblich verbessern wird. Diese Daten werden den maritimen Einsatz in den Polarmeeren unterstützen und zu einem besseren Verständnis der Klimaprozesse beitragen. CRISTAL wird auch Anwendungen im Zusammenhang mit Küsten- und Binnengewässern und der Beobachtung der Ozeantopographie unterstützen. Die Mission wird die langfristige Fortführung der Radar-Altimetrie zur Aufzeichnung von Eishöhen und topografischen Veränderungen sicherstellen.
Der 1,7 Tonnen schwere Satellit basiert auf einem bewährten, robusten Airbus-Satellitendesign, das auf dem Erbe von Sentinel-6 und CryoSat aufbaut. Sechs feste und zwei ausfahrbare Solaranlagen – insgesamt 18 m² – sorgen für ausreichend Energie auf CRISTALs driftender polaren Umlaufbahn in 699 km Höhe über der Erde. Der Speicher an Bord kann bis zu 4 Terabit wissenschaftlicher Daten auf einmal speichern, so dass die Wissenschaftler während der 7,5-jährigen Lebensdauer des Satelliten eine Fülle von Informationen erhalten.
Quelle: Airbus Defence an Space; www.airbus.com


VON MICHAEL HÄFNER
„Das „Felix-Wankel-Gebäude“ in Lindau hat mich seit langem in seinen Bann gezogen. Auf meinen Flügen mit dem Zeppelin und mit dem Flugzeug habe ich das Gebäude entdeckt und mich sofort für das ehemalige Institut interessiert. 2024 kam im Rahmen der Produktion des neuen Wirtschaftsmagazin Bodensee die unverhoffte Gelegenheit für aufregende Fotos. Aufgenommen wurden die Bilder mit einer Drohne sowie mit einer digitalen Vollformatkamera. Insbesondere während der Blauen Stunde kurz nach Sonnenuntergang entstanden solche Bilder, die dem Gebäude den einzigartigen Look verleihen, den es verdient hat.
Seit über 30 Jahren bin ich als Fotograf in der Region aktiv. Zu meinen Kunden und Auftraggebern gehören Unternehmen, Printmedien, Tourismusverbände sowie Städte, meine Aufnahmen mit den Drohnen wurden von diversen Fernsehsendern in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ausgestrahlt. Eine gewisse Bekanntheit erlangte ich zunächst durch meine Werbeaufnahmen des Dampfschiffs „Hohentwiel“ sowie als jahrelanger Luftbildfotograf im Zeppelin. Und sicherlich sind viele Leser dieses Magazins in irgendeiner der zahlreichen Buchhandlungen rund um den See über meinen Bildband „Erleb nis Bodensee – mit dem Zeppelin NT“ und den Kalender „Grenzenlos Bodensee“ „gestolpert“.
Ich selbst sehe mich heute als Spezialist für aussagekräftige und professionelle Aufnahmen für Industrie und Gewerbe. Meine große Leidenschaft sind dabei auch Flüge in jeglicher Form – als lizenzierter Drohnenpilot kann ich meinen Kunden sowohl Luftbildaufnahmen als auch Drohnenvideos anbieten. Zudem begleite und dokumentiere ich als Event-Fotograf große und kleine Events im Raum Bodensee und darüber hinaus.


Im Bereich 360°-Fotografie biete ich in Kooperation mit der Agentur Team360.de (www.team360.de) hochwertige 360°-Panoramarundgänge an. Eine meiner Referenzen: Das Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. In der 360°-Fotografie sehe ich eine wunderbare Erweiterung der herkömmlichen Fotografie –es ebnet den Weg zu einer gänzlich neuen Betrachtungsweise.“




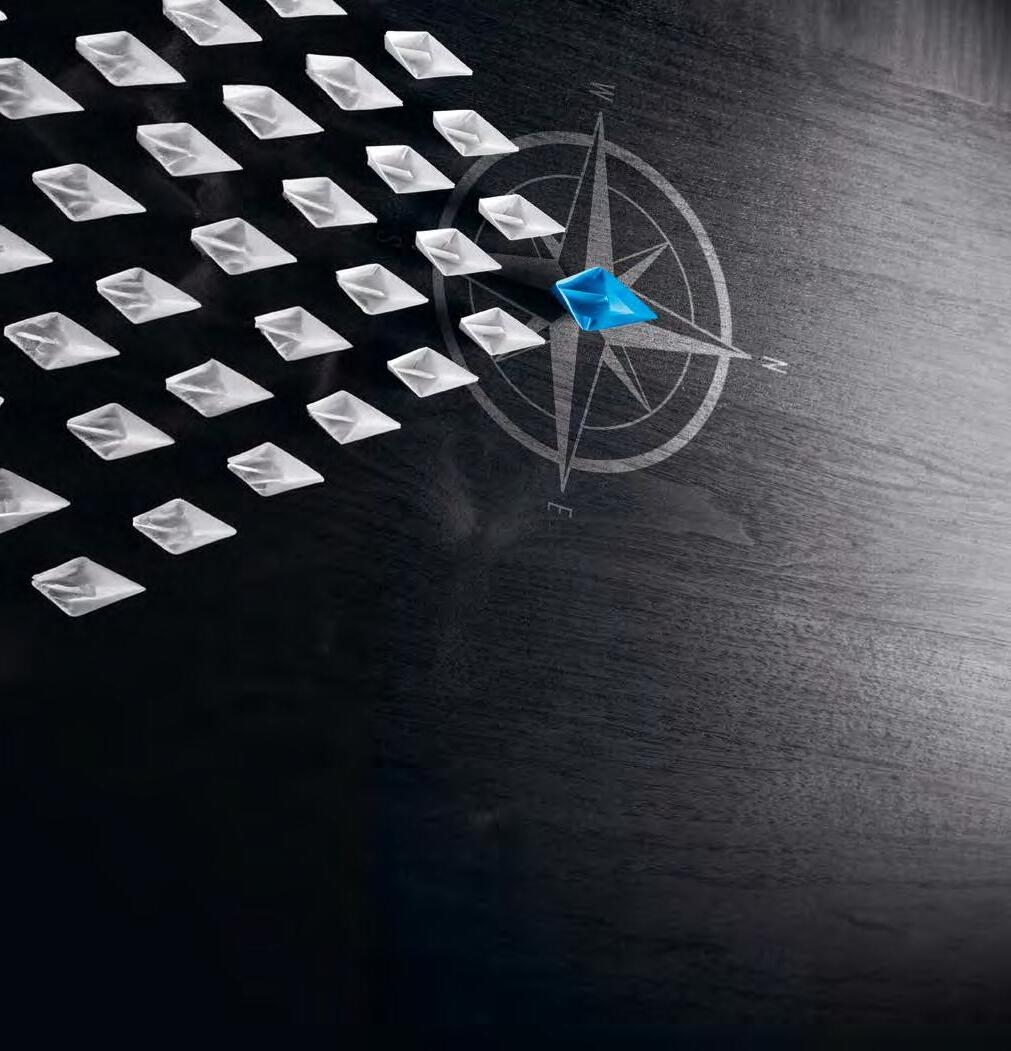
Wer die IBN – das neu gelaunchte (übrigens einzige) Boots, Wassersport & Lifestyle Magazin – abonniert, den ebenfalls neuen und seit 1964 bewährten Hafen-Guide LEG AN kauft oder eine der nautischen IBN Premium-Karten nutzt, weiss wo es langgeht auf dem Bodensee.

IBN – seit über 60 Jahren gut und jetzt noch besser!






Kunstgrenze – die kreative Antwort der Städte Kreuzlingen und Konstanz zum Thema Abgrenzung steht sinnstiftend auch für das Wirtschaftsmagazin: Grenzenlos leben und arbeiten am Bodensee (Foto Ausgabe von 2021, Achim Mende)

INTERNATIONALE BODENSEE-KONFERENZ (IBK) | Der Landammann von Appenzell Innerrhoden, Roland Inauen, reichte am 13. Dezember 2024 bei der 45. Regierungschefkonferenz das Steuerrad der IBK an seinen Nachfolger, den baden-württembergischen Staatssekretär Florian Hassler, weiter. Baden-Württemberg übernimmt 2025 den Vorsitz der IBK und wird die Zusammenarbeit in der Bodenseeregion mit Schwerpunkten auf Umwelt- und Naturschutz, Mobilität, Wirtschaft/Digitalisierung und Sicherheit/Katastrophenschutz vorantreiben.
Die symbolische Steuerradübergabe markierte die letzten Amtshandlungen von Appenzell Innerrhoden. Roland Inauen sagte zum bevorstehenden Wechsel des Vorsitzes: „Es war mir eine Ehre, die IBK 2024 zu vertreten. Wir haben in unserem Vorsitzjahr intensiv daran gearbeitet, die strategischen Projekte der IBK weiter voranzubringen. Für eine klimaneutrale Schifffahrt auf dem Bodensee wurden die nächsten Meilensteine definiert und wir konnten die Anliegen der IBK zum grenzüberschreitenden Schienenverkehr in Berlin vorbringen. Auch haben wir in Appenzell eine großartige Preisverleihung der IBK-Förderpreise organisiert.“
Staatssekretär Florian Hassler gratulierte seinerseits Roland Inauen: „Dank der jahrelangen IBK-Erfahrung von Landammann Inauen liegt ein erfolgreiches Vorsitzjahr hinter uns. Diesen Erfolgskurs möchten wir weitergehen. Wir möchten die Bodenseeregion nachhaltig weiterentwickeln – hin zu einem CO2-neutralen Kultur-, Natur- und Wirtschaftsstandort mit einer klimafreundlichen, grenzüberschreitenden Mobilität.“
Bodensee: sichtbar vernetzt
Mit dem Motto „Bodensee: sichtbar vernetzt" will Baden-Württemberg die Themen und die erfolgreiche Arbeit der IBK stärker in den Fokus rücken und die Region in ihrer Vielfalt präsentieren. Durch eine gezielte Kommunikation soll die Bedeutung der IBK für die Region in der Öffentlichkeit sichtbarer werden. Während der einjährigen IBK-Präsidentschaft des Landes Baden-Württemberg liegt ein Fokus auf dem Bereich Umwelt- und Naturschutz. So soll eine gemeinsame, grenzüberschreitende Arbeit zu invasiven Arten wie der Quaggamuschel angestoßen werden. Auch die Befassung mit dem Thema Kormoranmanagement soll weiter international begleitet werden.
Zudem möchte die IBK im Bereich Mobilität vorankommen. Dazu sollen grenzüberschreitende Eisenbahnlinien weiter ausgebaut und der Bodenseeradweg verbessert werden. Das Land hat außerdem für die klimaneutrale Bodenseeschifffahrt die Rolle des Kümmerers übernommen und wird unter anderem die Umsetzung der von den IBK-Regierungschefs beschlossenen Roadmap angehen. Auch den Bereichen Sicherheit und Katastrophenschutz sowie Wirtschaft wird sich Baden-Württemberg widmen. Der „BODENSEE SUMMIT digital“ präsentiert den Bodenseeraum als starken Forschungs-, Wirtschafts- und Innovationsstandort und die Vernetzung zu den Themen Digitalisierung/ KI in KMU und Verwaltungen wird vorangetrieben.


Während des baden-württembergischen Vorsitzjahres sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, die vom Staatsministerium bzw. den beteiligten Ministerien in der jeweiligen Zuständigkeit durchgeführt werden, darunter der „Europäische Weinsommer“ in der Landesvertretung in Brüssel, die Verleihung der IBK-Förderpreise für Kulturschaffende in der Sparte „Populäre Musik“ sowie ein ganztägiger Jugendkongress in Friedrichshafen.
Auf der Agenda der 45. Regierungschefkonferenz in Appenzell standen neben der Steuerradübergabe weitere wichtige Zukunftsthemen für die Bodenseeregion wie Wasserstoffversorgung, die Kommunikation der Stärken des Wirtschaftsraums Bodensee und die enge Zusammenarbeit mit der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz. Zudem wurde mit dem Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee eine neue Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Die Regierungschefs und -vertreter diskutierten auch über die nächsten Schritte zur Umsetzung einer klimaneutralen Schifffahrt auf dem Bodensee. Die Landesregierung von Baden-Württemberg wird im Rahmen ihres Vorsitzjahres 2025 ein vertiefendes Gutachten in Auftrag geben, das der IBK Empfehlungen zum Setzen der Leitplanken für den Transformationsprozess geben wird. In dem Gutachten soll es unter anderem auch darum gehen, welche Technologien zur CO2-Minderung in der

Bestandsflotte eingesetzt werden können und welche infrastrukturellen Voraussetzungen es benötigt, bis man in der Lage ist komplett auf klimaneutrale Antriebe umzurüsten. Zudem soll mit dem Gutachten Klarheit darüber erlangt werden, welche Rahmenbedingungen es braucht, dass die Zielerreichung in den kommenden Jahrzehnten im Einklang mit den nationalen und regionalen gesetzlichen Vorgaben sichergestellt ist.
Geschäftsstelle der Internationalen Bodensee-Konferenz Bücklestraße 3e D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 921 83 10 info@bodenseekonferenz.org www.bodenseekonferenz.org

kompetenzatlas-bodensee.com
Der neue Kompetenzatlas Bodensee ist da!
Die Zukunft gehört visionären Unternehmen, die auf digitale Innovation und Nachhaltigkeit setzen. Um sie auf diesem Weg bestmöglich zu begleiten, haben wir im Bodenseezentrum Innovation – dem Transfernetzwerk der HTWG Hochschule Konstanz für die Vierländerregion Bodensee – den Kompetenzatlas Bodensee weiterentwickelt.
Entdecken Sie die neu gestaltete, noch übersichtlichere Plattform für digitale Innovation und nachhaltige Transformation. Der Kompetenzatlas vereint Expert:innen, Veranstaltungen, Förderprogramme, Fachpublikationen und vieles mehr aus der Bodenseeregion – perfekt strukturiert für Ihre gezielte Recherche oder inspirierendes Stöbern.
Besuchen Sie uns und finden Sie passende Angebote für Ihr Unternehmen!
FORSCHUNGSKOOPERATION IOT SUSTAINABILITY LAB | Das IoT Sustainability Lab analysiert am Beispiel des Gebäudesektors, wie das Internet of Things (IoT) zur Nachhaltigkeit beitragen kann. Ziel ist es, technische Lösungen und innovative Geschäftsmodelle für IoT-Systeme zu entwickeln, um die Ressourcen- und Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern.
Die Herausforderung
Gebäudebetreiber stehen vor der Herausforderung, die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ihrer Immobilien zu verbessern. Eine Kooperation aus Wissenschaft und Praxis untersucht das Potenzial von IoT-Systemen für mehr Effizienz, Ressourcenschonung und Nutzerfreundlichkeit.
Ergebnisse für alle
Die Ergebnisse des IoT Sustainability Labs werden öffentlich zugänglich gemacht:
1. Software zur Ökobilanzierung: Betreibern von Büro-, Industrie- oder Wohngebäuden ermöglicht die Software, den CO₂-Fußabdruck eines Bestandsgebäudes zu ermitteln. Die Ergebnisse eignen sich für Nachhaltigkeitsberichte, die Außenkommunikation und das Nachhaltigkeitsmanagement.
2. Entscheidungshilfe für Ihr IoT-System: Wie können Gebäudebetreiber IoT-Geräte sinnvoll vernetzen, und welche Geräte passen am besten zu den Anforderungen? Mit einem Tool-Kit unterstützt das Lab dabei, ein optimales IoT-System zu planen oder das bestehende IoT-System zu verbessern.
3. Geschäftsmodelle für nachhaltige IoT-Services: Das Lab zeigt anhand konkreter Beispiele, wie sich IoT-Technologien mit Strategien verknüpfen lassen, die auf Ressourcenschonung, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit setzen.
4. Fallstudien aus der Praxis: Im Lab werden reale Herausforderungen analysiert und gelöst. Die Best-Practice-Beispiele liefern direkt anwendbare Lösungen für nachhaltige IoTGeräte.
5. Potenzial- und Akzeptanzstudien: Es wird die Attraktivität des Einsatzes von IoT-Systemen untersucht und aufgezeigt, für welche Gebäudetypen es sich lohnt, ein IoT-System einzuführen bzw. zu betreiben.
Mit diesen Ergebnissen macht das Lab den Weg frei für eine smartere und zugleich nachhaltigere Gebäudewelt.

Kontakt
Dr. Damian Bäumlisberger
Projektmanager
Bodenseezentrum Innovation
HTWG Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und Gestaltung iot-sustainability@htwg-konstanz.de www.bzi-netzwerk.com
Förderung des Labs
Initiiert durch den Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee wird das IoT Sustainability Lab von April 2023 bis März 2027 vom Interreg VI-Programm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» gefördert, dessen Mittel vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und vom Schweizer Bund zur Verfügung gestellt werden.


Erste Anlaufmöglichkeit für Interessierte ist das Bodenseezentrum Innovation (BZI), Koordinationsstelle des Labs. Forschungsresultate, nähere Informationen zum Lab und eine Anmeldemöglichkeit zum Newsletter des BZI finden Sie unter: www.iot-sustainability.com



DAS RITZ | Räumliche Nähe ist entscheidend für den Projekterfolg. Die Allen-Kurve von Thomas J. Allen, die auch nach Jahrzehnten nicht an Relevanz verliert, zeigt klar: Je näher Menschen räumlich beieinander sind, desto besser kommunizieren und arbeiten sie zusammen. Im RITZ Innovationszentrum in Friedrichshafen profitieren Unternehmen, Start-ups und Forschungsteams von dieser Dynamik, indem sie in unmittelbarer Nachbarschaft arbeiten. Diese kurzen Wege beschleunigen nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Innovationsprozesse. So entstehen gemeinsame Lösungen für die Digitalisierung und die Mobilität von morgen.
Ein gelungenes Beispiel für diese erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Kooperation zwischen der Tri.Merge GmbH und der IWT Wirtschaft und Technik GmbH. Während die Tri.Merge GmbH als technischer Berater und Entwick lungspartner auf digitale Transformation und Smart Mobility Entwicklung spezialisiert ist, wird am IWT das automatisierte und vernetzte Fahren erforscht, bspw. wie intelligente Verkehrsinfrastruktur das hochautomatisierte Fahren unterstützen kann.
Die Zusammenarbeit begann bei einem Event für die RITZ Community, bei dem Celina Herbers, Teamleiterin am IWT, und Philipp Röper, Geschäftsführer von Tri.Merge, ins Gespräch kamen. Celina Herbers suchte Unterstützung bei einem entscheidenden Projektaspekt: der Definition der Anforderungen an ein Testfahrzeug für hochautomatisiertes und vernetztes Fahren.
In einem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten Forschungsprojekt beschäftigte sie sich dabei mit drei zentralen Anwendungsfällen: Wie kann der Verkehr so gesteuert werden, dass Einsatzfahrzeuge Vorrang haben? Wie lassen sich Wetterwarnungen, wie Glatteis oder Starkregen, zuverlässig an die Fahrzeuge auf der Straße übermitteln? Und wie können intelligente Leitpfosten mit den Fahrzeugen kommunizieren? Dafür musste das Team herausfinden, was ein Testfahrzeug leisten muss, um diese


Übrigens: Das RITZ wurde mit dem Preis „Beispielhaftes Bauen im Bodenseekreis 2018 – 2024“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit die modernen Arbeitswelten, die kommunikative Atmosphäre und die Flexibilität der Forschungsräume im RITZ. Überzeugen Sie sich selbst!
Szenarien abbilden zu können. Zum Beispiel: Wie muss ein Fahrzeugmodul gebaut sein, damit es das Signal eines Leitpfostens empfängt und umsetzt?
Hier kam Tri.Merge ins Spiel und erarbeitete basierend auf den Anforderungen aus dem Projektteam konkrete Use Cases und entwickelte technische Lösungsansätze. Im nächsten Schritt kontaktierte Tri.Merge verschiedene Fahrzeughersteller, um die technische Machbarkeit der direkten Kommunikation zwischen Infrastruktur und Fahrzeug sicherzustellen. Schließlich fand das Tri.Merge-Team einen geeigneten Hersteller, der ein Testfahrzeug mit den
erforderlichen Messinstrumenten zur Verfügung stellte. In enger Abstimmung mit dem IWT führte Tri.Merge die Testfahrten gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller durch und validierte die Kommunikation zwischen Infrastruktur und Fahrzeug.
Besonders wertvoll waren die kurzen Wege im RITZ. Da die Büros von Celina Herbers und Philipp Röper direkt nebeneinander liegen, reichte oft ein kurzes Anklopfen, um Fragen oder Unklarheiten schnell zu klären. Termine fanden spontan statt, potenzielle Probleme wurden gelöst, bevor sie auftraten, und die entspannte Atmosphäre der Loggia bot Raum für kreative Ideen bei
einer Tasse Kaffee. Diese Nähe und die reibungslose Kommunikation waren der Schlüssel zum Erfolg der Zusammenarbeit.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testfahrten blicken beide Partner optimistisch in die Zukunft und sehen großes Potenzial für weitere gemeinsame Projekte – insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Infrastruktur. Die Vision: Verkehrsteilnehmer erhalten in Echtzeit Warnungen aus der Infrastruktur – etwa bei Glatteis – und der Straßenverkehr wird so noch sicherer und intelligenter.
Sie möchten Teil unseres Netzwerks werden und die Vorteile kurzer Wege nutzen? Kommen Sie gerne auf uns zu!
info@ritz-innovationszentrum.com Tel. +49 151 7057 6664
Das RITZ wird gefördert durch:




Flaggschiff der Magazin„Flotte“ von Labhard Medien: seit rund 30 Jahren erscheint einmal jährlich das Bodensee Magazin (Bild: Titel von 2023).


BODENSEEFORUM KONSTANZ | Die Veranstaltungsbranche wandelt sich: Gefragt sind Events, die mehr als nur reinen Informationsfluss bieten – sie sollen inspirieren, verbinden und etwas bewirken. Das Bodenseeforum als kommunales Veranstaltungshaus in Konstanz, stellt sich dieser Aufgabe und bietet Veranstaltenden nicht nur flexible Räumlichkeiten, sondern auch kreative Impulse, wie Tagungen und Kongresse nachhaltig und sinnvoll gestaltet werden können.



in die unteren Säle, was sich ideal für Break-OutSessions eignet, bei denen Teilnehmende weiterhin mit dem Eventgeschehen verbunden bleiben.
Nachhaltigkeit neu denken – über Green Meetings hinaus
Klar ist: Eine umweltfreundliche Anreise, CO₂-Reduktion und der bewusste Umgang mit Ressourcen bleiben wichtige Faktoren in der Veranstaltungsbranche. Nachhaltige Events gehen heute jedoch weit darüber hinaus. Soziale Nachhaltigkeit zeigt sich in vielfältigen Aspekten – von nachhaltigem Catering mit saisonalen und regionalen Zutaten bis hin zur Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Die vielfältigen Möglichkeiten im Bodenseeforum erleichtern es zusätzlich, Veranstaltungen zu gestalten, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch langfristig Wirkung zeigen.
„Festivalisierung“ – mehr als nur Entertainment
Der Trend der „Festivalisierung“ bringt frischen Wind in Konferenzen und Tagungen. Die moderne Technik und flexible Raumgestaltung des Bodenseeforum schaffen die idealen Voraussetzungen für kreative Inszenierungen mit Lichtinstallationen, Projektionen und musikalischen Akzenten. Diese Elemente fördern die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden und schaffen in Kombination mit der inspirierenden Aussicht auf den Seerhein und der Terrasse als Ort für kleine Auszeiten eine Atmosphäre, in der neue Ideen gedeihen können. Ein Event, das begeistert, bleibt nicht nur in Erinnerung – es motiviert Teilnehmende, das Gelernte auch umzusetzen.
Verbindungen schaffen – Dialoge statt Monologe
In einer zunehmend polarisierten Welt bieten Veranstaltungen einen wertvollen Raum, um Dialoge zu fördern und verschiedene Perspektiven auszutauschen. Gut moderierte Formate wie interaktive Workshops oder „GehSpräche“ ermöglichen den Austausch auf Augenhöhe. So erleben Teilnehmende ein Umfeld, das Raum für Diskussionen und kreative Ideen bietet – eine Investition, die sich sowohl wirtschaftlich als auch zwischenmenschlich auszahlt. Die Räumlichkeiten des Bodenseeforum bieten innovative Nutzungsmöglichkeiten. Die Konferenzräume gewähren beispielsweise einen Blick

Ein Fest für alle Sinne – QR-Code scannen und mehr Bilder und Stimmen zu den cyberFESTSPIELEN erleben

Erlebnisse gestalten –durch
Eine Veranstaltung hat das Potenzial, Menschen nachhaltig zu bewegen. Sinnstiftende Events bringen Teilnehmende dazu, mit einem Mehrwert nach Hause zu gehen – sei es durch neue Perspektiven, wertvolle Kontakte oder echte „Aha-Momente“. Das Team des Bodenseeforum unterstützt die Veranstaltenden mit Event Design Thinking Prozessen, die für innovativ denkende Eventplanende entwickelt wurden. Der „Event Canvas“, eine agile, visuelle Methode zur Eventkonzeption, ermöglicht es, sich zuerst in die verschiedenen Zielgruppen hineinzuversetzen und so eine effektive Planung zu entwickeln. Mit dem „Event Canvas“ können Firmen und Verbände potenzielle Zielkonflikte im Vorfeld identifizieren.
Ein klares Ziel: Nachhaltige und sinnvolle Veranstaltungen, die inspirieren
Im Bodenseeforum Konstanz liegt der Fokus auf Veranstaltungen, die Verbindungen schaffen, ermutigen und nachwirken. Durch die Kombination aus innovativen Formaten, modularen Räumen und einem nachhaltigen Ansatz entstehen Events, die einen klaren Mehrwert bieten – für die Teilnehmenden, die Veranstaltenden und die Gesellschaft.
BODENSEEFORUM KONSTANZ
Reichenaustraße 21, D-78467 Konstanz Tel. +49 7531 12728 0 info@bodenseeforum-konstanz.de www.bodenseeforum-konstanz


CONVENTION PARTNER VORARLBERG | Vorarlberg ist ein guter Ort für sinnstiftende Begegnungen, die in mehrerlei Hinsicht grenzüberschreitend sein können: Das westlichste Bundesland Österreichs liegt im Herzen der Vierländerregion Bodensee und besticht durch Vielfalt auf kleinem Raum – wirtschaftlich, landschaftlich und kulturell.
Wer das Individuelle sucht, wird in Vorarlberg fündig: Zwischen Bodensee und Bergwelt steht VeranstalterInnen eine breite Palette an Locations zur Verfügung – ob für mehrtägige Kongresse mit tausenden BesucherInnen oder Klausuren in kleinen Gruppen. Die vier „Großen“ – Festspielhaus Bregenz, Kulturhaus Dornbirn, Montforthaus Feldkirch und Messequartier Dornbirn – bieten viel Platz, Komfort und modernste Ausstattung für verschiedene Veranstaltungsformate. Für kleinere Events finden OrganisatorInnen in spezialisierten Hotels in urbaner und ländlicher Umgebung, gemütlichen Berghütten, malerischen Schlösschen oder ehemaligen Handwerksbetrieben den passenden Rahmen.
So unterschiedlich die Locations sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Durch die guten Anbindungen sind sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus allen Richtungen bestens erreichbar.
Convention Partner Vorarlberg – die erste Adresse für VeranstalterInnen
Ökologisch „unterwegs“ zu sein, ist Convention Partner Vorarlberg auch bei der Durchführung von Veranstaltungen wichtig. Die Serviceagentur ist seit 2013 Lizenznehmerin des Österreichischen Umweltzeichens und unterstützt bei der Zertifizierung von „Green Meetings“ und „Green Events“. Sie übernimmt zudem sämtliche Leistungen wie Raumbuchung, Registrierung, Unterkunft, Abrechnung und Rahmenprogramm. Dazu kooperiert das Bureau mit Anbietern in ganz
Vorarlberg. Ob Canyoning, Iglubauen, Käsesennen, Bierbrauen, Dorfgeschichte oder Naturschätze kennenlernen: Es stellt maßgeschneiderte Aktivitäten zusammen und nimmt VeranstalterInnen viel Arbeit ab. So bleibt mehr Zeit für die Planung des Events.
Die passenden Rahmenbedingungen sind das eine. Für ein rundum gelungenes Event braucht es vor allem eine Atmosphäre, in der Menschen sich wohlfühlen, einander offen begegnen und voneinander lernen können. Deshalb beschäftigt sich Convention Partner Vorarlberg intensiv mit den Zutaten für gute Begegnungen und lebendige Veranstaltungen, unter anderem als Mitglied im grenzübergreifenden Forschungsnetzwerk micelab:bodensee. Im Jahr 2021 startete die Serviceagentur zudem die Podcast-Reihe „Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur“. Mittlerweile können Interessierte über 40 Folgen auf den bekannten Streamingdiensten hören. Inspiration im Printformat bieten die Impulspapiere „Grenzenloses Eventdesign – Wissen für gute Veranstaltungskultur“, die Know-how und praktische Beispiele für erfolgreiche Veranstaltungen enthalten. Erst kürzlich ist die sechste Ausgabe „Sinnstiftend Tagen“ erschienen, die Convention Partner Vorarlberg auf der Website kostenlos zum Download anbietet.
Convention Partner Vorarlberg
Tel. +43 5574 4344323
service@convention.cc www.convention.cc






INTERNATIONALES BODENSEE TOURISMUSFORUM 2024 | Rund 200 Touristikerinnen und Touristiker aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein nahmen am 4. Dezember auf der Insel Mainau am Bodensee Tourismusforum der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT) teil. Die neue IBT-Geschäftsführerin Nina Hanstein betonte: „Unser Ziel ist es, die Bodenseeregion als einzigartiges und länderverbindendes Erlebnisziel für Einheimische und Gäste hervorzuheben und gemeinsam zukunftsweisende Projekte umzusetzen.“

Die Tourismusregion Bodensee zählt zu den beliebtesten Reisedestinationen Europas – rund um den See sind es öffentliche und private Tourismusunternehmen, die das Angebot dafür bereitstellen und dafür sorgen, dass sich die Gäste der Seeregion wohl fühlen

Die IBT fungiert als zentrale Destinationsmanagement- und Marketingorganisation und ist verbindend für die gesamte Vierländerregion Bodensee aktiv. Für 2025 liegt der Fokus der IBT auf vernetzenden Projekten und der Bearbeitung ausgewählter Märkte, sowohl international als auch national. Konkret zählen zu den Vorhaben unter anderem eine Quellmarktanalyse, die Vermarktung des 100-jährigen Jubiläums des Müller-Thurgau-Schmuggels, die Koordination des Bodensee-Radwegs sowie die Vorbereitung einer länderübergreifenden Datendrehscheibe – allesamt Initiativen, die den Kern des grenzüberschreitenden Miteinanders stärken. Dar-
Nina Hanstein präsentiert die Ausrichtung der IBT


über hinaus wird die Bodensee Card PLUS, die den Nutzern vielfältige Reiseanlässe in allen vier Ländern der Region bietet, verstärkt den Einheimischen vorgestellt. Besonders hervorzuheben ist im nächsten Jahr das 25-jährige Bestehen dieser Kaufkarte.
Stärkerer Schulterschluss mit dem Verband der Tourismuswirtschaft
Auch der Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee (VTWB), der die Interessen von rund 50 Tourismusunternehmen vertritt, richtet sich strategisch neu aus. Künftig will dieser einen stärkeren Fokus auf seine Rolle als Gesellschafter der IBT legen. Gegenüber der Politik und in Richtung der Öffentlichkeit werde der Verband zu einer hörbaren Stimme seiner Mitglieder werden und sich stärker als bisher in den tourismuspolitischen Diskurs einschalten. Das sagte der neue Vorstandssprecher, Mainau-Marketingleiter Franz Petzold, beim Bodensee Salongespräch, einem touristischen Fachaustausch auf der Insel Mainau. „Die Tourismusunternehmen investieren kontinuierlich in die Zukunft unserer Region. Sie sind Träger von Innovation und Angebotsgestaltung. Sie erzählen Geschichten und machen sie für die Gäste erlebbar. Für all das möchten wir die Öffentlichkeit in Zukunft kontinuierlich sensibilisieren,“ erläutert Petzold, der im September 2024 das Amt des VTWB-Vorstandssprechers übernommen hat. Um eine noch bessere Datengrundlage für die Bedeutung der Tourismusunternehmen für die Region zu erhalten, entstehe aktuell in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen DWIF aus München eine Wertschöpfungsanalyse für den Wirtschaftsfaktor Tourismus am Bodensee.
Ziel der beiden internationalen Organisation ist es, die grenzüberschreitende Sichtbarkeit weiter zu stärken und Kräfte für die Vermarktung und Entwicklung der Bodenseeregion zu bündeln. Ein deutliches Zeichen dieser Zusammenarbeit: Ab 2025 wird die Verleihung des VTWB-Innovationspreises im Rahmen des IBT-Tourismusforums stattfinden.
Internationale Bodensee Tourismus GmbH www.bodensee.eu
Verband Tourismuswirtschaft Bodensee e.V. vtwb.eu
VTWB-Vorstandssprecher Franz Petzold und IBT-Geschäftsführerin Nina Hanstein





Das Konstanz Magazin durchleuchtet alle Facetten der größten Stadt am See. Die imposante Imperia als ein Wahrzeichen der Stadt war Motiv der Ausgabe von 2023, Foto: Achim Mende.
JUBILÄUM | Am 18. Juli 2025 wird gefeiert: 40 Jahre farm e.V. (ehem. TZK e.V.) und Technologiezentrum Konstanz. Denn die größte Stadt am Bodensee ist nicht nur Urlaubsparadies. Eingebettet in die Vierländerregion Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein ist der internationale Wirtschaftsraum eine wettbewerbsfähige und dynamische Region mitten in Europa.
Ein Standortvorteil, der innovative Denker und Tüftler mit Unternehmungsgeist anzieht. Als eines der ersten Gründungs- und Innovationszentren in Baden-Württemberg wurde in Konstanz bereits 1985 das Technologiezentrum Konstanz –damals noch in der Blarerstraße im Stadtteil Paradies ansässig –durch den gleichnamigen Verein eröffnet.
Seit dem Umzug auf das Konstanzer Innovationsareal und mit der Dachmarke farm – Gründung & Innovation firmiert auch der Förderverein zu farm e.V. Die Mitglieder des Vereins sind gewachsene Konstanzer Start-ups, etablierte Unternehmer und Unternehmerinnen, relevante Akteure des Konstanzer GründungsÖkosystems sowie Kammern und Hochschulen.

#Save the date
Jubiläum 40 Jahre Gründung & Innovation in Konstanz
18. Juli 2025, 10.30 Uhr – 22.00 Uhr farm – Gründung & Innovation
Programm: Festakt mit Grußworten Keynotes und Ausstellung
Start Up BW Young Talents Pitch Gründungs- und Netzwerkparty www.konstanz.farm/jubilaeum
Seit der Gründung vor 40 Jahren steht für sie die Unterstützung von Gründenden und jungen Unternehmen sowie der Transfer von Wissen und Forschung in nachhaltiges Unternehmertum im Mittelpunkt. Öffentliche Veranstaltungen und Netzwerk-Plattformen des farm Vereins fördern die Weiterentwicklung eines innovativen und aktiv vernetzen Gründungsstandortes Konstanz. Neben dem städtischen farm Technologiezentrum, in dem junge Unternehmerinnen und Unternehmer günstigen und flexiblen Gewerberaum finden, ist farm heute einer der Knotenpunkte der Gründungszene mit großem Netzwerk und zahlreichen kostenfreien Beratungs- und Veranstaltungsangeboten für Gründende, junge Unternehmen, Start-ups und Interessierte.
#Wissenswertes
≥ Das Technologiezentrum ist eines der ersten Gründungsund Innovationszentren in Baden-Württemberg, gefördert von Land, Kommune und Stadt.
≥ Im Jahr 1985 nahm das damals im Stadtteil Paradies ansässige Technologiezentrum Konstanz seinen Betrieb auf. Geschäftsführer Rainer Meschenmoser startete im ersten Jahr mit sechs jungen Unternehmen.
≥ Heute nutzen über 40 Jungfirmen, Selbstständige und Startups das seit 2021 von der Stadt Konstanz betriebene und geförderte Mietangebot bei farm – Gründung & Innovation.
≥ Veranstaltungs- und Beratungsangebote in der farm sind öffentlich zugänglich und kostenfrei.
≥ Als Oberbürgermeister der Stadt Konstanz ist Uli Burchardt Vorstandsvorsitzender des farm e.V. Seine Stellvertreterin ist Prof. Dr. Katharina Holzinger, die Rektorin der Universität Konstanz.
≥ Weitere Gründungsmitglieder des Vereins sind unter anderem die HTWG Konstanz, vertreten durch Präsidentin Prof. Dr. Sabine Rein, und die Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, vertreten durch Vorstandsmitglied Prof. Dr. Michael Auer. Sie steuern aktiv die Interessen des farm e.V. und gestalten das Angebot seit den Anfängen mit.

#Förder:in werden
Lust auf Gründung und Innovation? Sie wollen den Gründungsstandort Konstanz voranbringen, eigene Erfahrung einbringen und Innovation fördern? Ihre Ansprechpartnerin ist Christina Groll, Geschäftsführerin farm e.V., unter +49 (0) 7531 900-2011 oder Christina.Groll@konstanz.farm
1996 sind wir als Online Agentur ins Technologiezentrum in der Blarerstraße im Paradies eingezogen. Von der günstigen Miete und dem inspirierenden Austausch der Gründungscommunity vor Ort haben wir enorm profitiert. Das möchte ich nun mit meinem Engagement im farm e.V. zurückgeben. Mein Wissen als Geschäftsführer eines erfolgreichen Konstanzer Unternehmens kann ich dabei einsetzten für ein aktives und nachhaltiges Gründungsökosystem in unserer schönen Stadt am See.«
Jan Bauer, Geschäftsführer Seitenbau GmbH und Vorstandsmitglied farm e.V.


farm e.V. Gründung & Innovation (ehem. Technologiezentrum Konstanz e.V.)
Bücklestraße 3
D-78467 Konstanz
Tel. +49 (0) 7531 900-2011
Christina.Groll@konstanz.farm www.konstanz.farm/verein

„Uns
IM GESPRÄCH | Das Konstanzer Unternehmen Organifarms hat seine Wurzeln im Technologiezentrum und verbleibt auch nach dem Auszug aus den Räumlichkeiten in der Stadt. Wir sprachen gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Beate Millauer und der Leiterin von farm, Christina Groll, mit der Mitgründerin des jungen Unternehmens, Hannah Brown.

Frau Brown, Sie sind Mitgründerin des Start-ups
Organifarms, das mit BERRY einen Pflückroboter für Erdbeeren entwickelt hat. Demnächst ziehen Sie aus der farm in eigene Räumlichkeiten. Wie waren die Anfänge?
Brown: Ende 2019 war ich auf einem Hackathon in Berlin, bei dem es um Ideen für Projekte zu den Themen Energiewende und Klimawandel ging. Mein späterer Mitgründer Dominik Feiden brachte die Idee mit, eine technologische Lösung zu entwickeln, um die Landwirtschaft zukunftsfähiger zu machen. Ein immenses Problem für Landwirte in Europa sind die Kosten aufgrund des hohen Personalbedarfs, insbesondere in der Erntezeit. In diesem Bereich herrscht ein großer Markt für technische Lösungen. So war unsere Idee geboren. 2020 begannen wir zu dritt mit der Erarbeitung eines Businessplans und eines technologischen Konzeptes und welche Personen wir brauchen, um dieses umset-

zen zu können. Wir investierten eigenes Geld in den Kauf eines Roboterarmes, entwickelten mit unserem Team die Software und bauten mithilfe eines 3D-Druckers einen Greifer. So entstand im Keller des Elternhauses von Dominik Feiden in Wollmatingen der Prototyp von BERRY.
Erzählen Sie von dem Moment, als BERRY die erste Erdbeere pflückte.
Brown: Alle sind in Jubel ausgebrochen – ein wunderschöner Moment. Es war der Moment, als endgültig klar wurde, dass unser Plan funktioniert.
Und wahrscheinlich der Moment, in dem man einsieht, dass man raus muss aus dem heimischen Keller und eigenes Geld für die Weiterentwicklung nicht reichen wird.
Brown: Das stimmt. Von da an stellten sich Fragen wie: In welcher Stadt sind die Chancen am größten, das Unternehmen aufzubauen? Wo können wir das dafür notwendige Team akquirieren? Unsere Standortanalyse umfasste Faktoren wie Ansprechpersonen vor Ort, finanzielle Fördermöglichkeiten, vorhandene Netzwerke und bezahlbare Räumlichkeiten. Natürlich zieht man Berlin oder München als typische Start-up-Standorte in Betracht. Man hat dort eine größere Bandbreite an Angeboten. Andererseits herrscht dort starke Konkurrenz um Flächen, um Fö rderung, um Unterstützung. Und es liegt die Befürchtung nahe, dass man in seiner Stadt-Bubble verbleibt und weniger die Angebote im Blick hat, die es über den Standort hinaus gibt. Uns war das wichtig. Es gibt verschiedene Hubs, in München die Robotik, in Frankfurt am Main der Agrarbereich. In Freiburg haben wir an Workshops des Smart Green Startup Accelerators teilgenommen und stießen dort auf Fördermögl ichkeiten in Baden-Württemberg und bekamen Unterstützung bei Businessplan und Pitchdeck. Konstanz selbst bietet als kleine Stadt viele Angebote für Start-ups. Darüberhinaus kommen die Leute, die man für das Team braucht, gerne in diese Stadt. Somit fiel unsere Wahl auf diesen Standort, genauer gesagt auf das Technologiezentrum. Dort sahen wir uns Räumlichkeiten an und sind gleich eingezogen.


Groll: Ich wunderte mich damals über die Anfrage, schließlich standen wir kurz vor unserem Umzug in das jetzige Gebäude der farm. Aber wir machten das möglich, auch für die wenigen verbleibenden Monate in der Blarerstraße. Insofern habe ich das noch gut in Erinnerung.
Brown: Für uns war das ein wichtiges Upgrade. Wir hatten bei der L-Bank den Start-up BW Pre-Seed beantragt, und wollten den Co-Investor in unseren eigenen Räumlichkeiten empfangen. Das war ein perfektes Timing.
Groll: Die Accelorator-Programme sind in der Regel thematisch. Als Start-up geht man hin, wo das Angebot ist. Man kann nicht alle diese Angebote an einem Ort bündeln. Über Fördermöglichkeiten wie die der L-Bank müssen wir die Gründenden von daher weniger aufklären. Wir hier vor Ort unterstützen unsere Gründerinnen und Gründer passende Anlaufstationen zu finden. Organifarms war von Beginn an aber sehr strukturiert. Für das Gründungsteam von Organifarms war derselbe Grund entscheidend, der zur Gründung des Technologiezentrums 1985 beitrug: flexible und bezahlbare Büro- und Werkstattfläche.
Brown: Das war so wichtig für uns. Ebenso, dass wir mit dem Wachstum des Unternehmens nach und nach größere und mehr Räume dazu mieten konnten und so unseren Bedarf immer decken konnten.
Gibt es denn ein Limit, wieviel Quadratmeter ein Start-up anmieten darf in der farm?
Millauer: Das nicht, aber wenn Start-ups so wachsen wie Organifarms, dann kommen wir als klassische Wirtschaftsförderung hinzu. Gemeinsam mit den Gründenden suchen wir einen Ort, an dem sie außerhalb unserer farm in Konstanz gut Wurzeln schlagen können. In diesem Fall ist uns das mit einem Standort für Büroflächen und Produktion im Konstanzer Stadtteil Oberlohn hervorragend gelungen, wo Organifarms eine große Werkstatt und Büroflächen ab 2025 zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, dass wir Menschen, die an Zukunftstechnologie arbeiten, in Konstanz halten. Und ich bin mir sicher, dieses Produkt wird sich durchsetzen.
Apropos Produkt: Wenn man anfängt, an dieser Technologie zu tüfteln, muss man sich ja sicher sein, dass es sowas nicht schon irgendwo auf der Welt gibt?
Brown: Ja, eine solche Markt- und Wettbewerbsanalyse haben wir im ersten Jahr gemacht. Und tatsächlich gibt es ein paar Wettbewerber. Das ist aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Man muss aber im Blick haben, wie weit diese sind. Wenn die weiterkommen, muss man wissen, ob das zu einem Problem für das eigene Produkt werden kann. Man will natürlich schneller sein als die anderen, damit diese nicht plötzlich den Markt einnehmen. Aber zum einen ist der Markt sehr groß und zum anderen sind sie in anderen Ländern aktiv und noch nicht so weit, dass sie sich jetzt schnell ausbreiten würden. Die haben teils zwei, drei Pilotkunden, aber wir haben in weniger Zeit deutlich mehr Fortschritte gemacht.
Wie ist die Reaktion der Landwirte, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Brown: Unsere Erfahrung ist, dass die Landwirte weit weniger zurückhaltend sind, als wir vielleicht am Anfang gedacht hätten. Sie sind sehr technologieoffen, natürlich auch aus einem gewissen Zwang heraus. Die Landwirte stehen unter dem Druck, neue Wege gehen zu müssen. Die Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, bauen die Früchte im Gewächshaus an, das an sich ist schon eine große Investition. Aber der Ernteroboter für den Einsatz im Innenbereich ist dafür vergleichsweise günstig. Leider sind die Förderungsmöglichkeiten neuer Technologien in der Landwirtschaft sehr zerstückelt. Zudem ist es für Start-ups nicht leicht, mit innovativer Technik auf die sogenannten Positivlisten zu kommen, als Produkte, die finanziell gefördert werden. Produkte etablierter Unternehmen haben es da leichter, was den technologischen Wandel und den Fortschritt sehr verlangsamt.
Kann Organifarms denn bereits in die Serienproduktion einsteigen?
Brown: Wir haben 2024 eine Vorserie produziert. Nun starten wir mit unserem Partner aus Ravensburg, der EBZ Gruppe, in die Serienproduktion. Das heißt, die Produktion wird in Ravensburg stattfind en, Forschung und Entwicklung bleibt in Konstanz. Wir gehen in die Weiterentwicklung der bestehenden Produkte, zum Beispiel der Einsatz des Roboters im Folientunnel. >
Sorte, Reifegrad und Füllhöhe können individuell eingestellt werden. Durch die innovative Software und Bilderkennung ist BERRY in der Lage, Qualität und Reifegrad präzise zu erkennen.

Ändert sich der Blick auf das eigene Produkt, wenn ein anderes Unternehmen die Produktion übernimmt?
Brown: Wir sind wirklich sehr zufrieden, wie die Zusammenarbeit läuft. Beide Unternehmen lieben die Arbeit mit neuen Technologien. Es bieten sich neue Möglichkeiten. Uns geht es darum, etwas zu bewegen, etwas zu tun, das einen Impact hat. Etwas, das die Zukunft positiv verändert. Wir wollen, dass hies ige Landwirte auch zukünftig gesunde und regionale Lebensmittel produzieren können und zum Beispiel Erdbeeren nicht um die Welt geschickt werden, um bei uns zu landen.
Millauer: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie der Übergang in die Serienproduktion für ein kleines Unternehmen gelingt. Man kann sich eigene Strukturen schaffen, einen Investor suchen oder eben eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen eingehen. Ist letztere vom Partner angestoßen und die Begeisterung für das Produkt ebenfalls groß, würde ich sagen, dass dies durchaus ein Idealfall sein kann. Wir leben in einer Stadt, in der wenig Raum für große Produktionsstätten ist. Wir leben in einer Stadt von wissensbasierten Dienstleistungen. Es sind nun bereits fünf Jahre, seitdem der Klimanotstand in Konstanz ausgerufen wurde. Bis 2035 wollen wir als Stadt klimaneutral sein. Um das zu schaffen und gleichzeitig die Neuansiedlung von Unternehmen anzustreben, müssen wir Unternehmen fördern, die in unsere Strategie passen. Und die Entwicklung von BERRY ist ja meines Wissens nicht abgeschlossen, sondern er soll in Zukunft auch den Einsatz von Pestiziden vermeiden können.
Brown: Richtig, der Roboter wird in Zukunft weitere Funktionen erfüllen. Eine davon ist die Behandlung der Pflanzen mit UVC-Licht gegen Spinnenmilben und Mehltau. Man wird durch den Einsatz dieser Technologie aber nicht nur Ressourcen schonen, sondern mit den Daten, die der Roboter sammelt, die Effizienz erhöhen. Das befindet sich momentan in der Entwicklung.
Wir wollen, dass hiesige Landwirte auch zukünftig gesunde und regionale Lebensmittel produzieren können und zum Beispiel eine Erdbeere nicht um die Welt geschickt werden, um bei uns zu landen.«
Hannah Brown, Mitgründerin Organifarms
Kontakt:
Organifarms GmbH
Robert-Gerwig-Straße 2 D-78467 Konstanz
Tel. +49 (0) 7531 71407 info@organifarms.de
Das klingt nach vielen Fachkräften, die Sie in Zukunft brauchen werden. Welche Bedeutung haben da die Hochschulen vor Ort?
Brown: Wir werden vor allem Software-Entwickler und Ingenieure brauchen, insofern sind die Hochschulen hier für uns von hoher Relevanz. Es ist natürlich von Vorteil, wenn die Mitarbeitenden nicht extra an den See umziehen müssen. Aber unser Team ist sehr divers, unsere Leute kommen schon jetzt aus sieben Nationen.
Millauer: Natürlich müssen wir als Stadt auf ein mögliches Wachstum unserer Firmen vorbereitet sein, insbesondere was den verfügbaren Wohnraum angeht. Das ist unsere Aufgabe, ebenso wie die Bereitstellung von Kinderbetreuung. Wenn ich mit Unternehmen spreche, geht es oft um diese Themen. Wir sind geografisch eingeschränkt und können natürlich am besten in die Höhe wachsen. Mit dem Handlungsprogramm Wohnen wollen wir langfristig 7.000 Wohnungen schaffen. Allein hier auf der ehemaligen Industriebrache werden demnächst 600-700 Wohnungen gebaut werden, auch im sozial verträglichen Wohnungsbau.
Groll: Organifarms hat, wie Hannah schon sagte, bereits jetzt ein sehr internationales Team. Da müssen behördliche Verfahren eingehalten werden, an denen wir zwar nichts ändern, aber für Transparenz sorgen können. Im letzten Jahr haben wir in unserer farm-Vortragsreih e die Themen Fachkräftemangel und die Anstellung ausländische Fachkräfte integriert - eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit und der Ausländerbehörde der Stadt Konstanz. Themen wie Familiennachzug ist aber auch für uns nicht gang und gebe, aber wenn der Bedarf da ist, dann haben wir als Wirtschaftsförderung die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Abschließend die Frage an Frau Groll: Auch die fa rm entwickelt sich ja immer weiter, welche Pläne gibt es für die nahe Zukunft?
Groll: Das Ziel ist eine lückenlose Begleitung von Gründerinnen und Gründern. Wir selbst haben keine Accelerator, aber wir haben eine erste Stufe, die dahin führen könnte, und das ist unsere Sproutbox. Es gibt also die Bestrebung, dahingehend etwas anzubieten. Wir haben auch die Möglichkeit eigene Formate zu entwickeln. Das haben wir aus aktuellem Anlass für das Thema Fachkräfte gemacht, ebenso zum Thema Finanzierung und Fremdinvestitionen. Start-ups ab einer gewissen Größenordnung können es ohne Fremdkapital nicht allein schaffen, gerade im Technologiebereich. Da bauen wir ein überregionales Netzwerk auf. Organifarms hat diese Kontakte über Konstanz hinaus nach Ravensburg oder zur Zeppelin Uni in Friedrichshafen selbst gesucht. Diese Vernetzung der Ökosysteme am See, das ist die Zukunft. Damit sich die Start-ups das Beste von jedem heraussuchen und am See bleiben können.
INNOVATIONSLABOR BODENSEE | In einer Welt, die von stetigem Wandel und technologischem Fortschritt geprägt ist, spielt Innovation eine zentrale Rolle. In Konstanz wird dieser Wandel aktiv gestaltet und zwar im neuen Makerspace innolab bodensee, einem Ort, der sich der Förderung von Ideen, Projekten und Unternehmergeist widmet.
Als Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Konstanz und der Stadt Konstanz ist das innolab bodensee eine Initiative zur Förderung von Innovation, Unternehmertum und technologischer Entwicklung in der Bodenseeregion. Der Makerspace bietet Unternehmen, Start-Ups und kreativen Köpfen Raum und Infrastruktur, um sehr niedrigschwellig und zeitnah neue Ideen in Prototypen umzusetzen und die ersten Hürden bei der Produktentwicklung aus dem Weg zu räumen.
Das innolab bodensee unterstützt Projekte in verschiedenen Phasen – von der Ideenfindung bis zur Markteinführung. In Zusammenarbeit mit einem breit aufgestellten Expertenteam werden für Kunden passende Lösungen gefunden. Die Hochschulen HTWG und Universität Konstanz tauschen die Expertise aus. Ob zum Thema erneuerbare Energien, digitaler Wandel oder Life-Science, die regionalen Branchennetzwerke solarLAGO, cyberLAGO oder BioLAGO kooperieren ebenso mit dem innolab wie die Handwerkskammer und die IHK. Diese Zusammenarbeit ermöglicht einen intensiven Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, von dem alle Beteiligten profitieren.

Seit Oktober 2023 befindet sich das innolab bodensee auf dem Konstanzer Innovations areal in der Bücklestraße gleich neben dem Gründungszentrum farm und der Konstanzer Wirtschaftsförderung. Auf 600 Quadratmetern wurde ein Anlagenpark mit ca. 50 Maschinen erschaffen. Hier können zum Beispiel neue Materialien und hochmoderne Fertigungsverfahren getestet sowie Prototypen hergestellt werden. Dies betrifft unter anderem die Bereiche Additive Fertigung, Textilveredelung, Messtechnik, Meta ll- und Holzbearbeitung, Laserschneidanlagen, Erneuerbare Energien, KI, Robotik, Labortechnik sowie modernste IT-Soft- und Hardware.
Des Weiteren werden zahlreiche Workshops, Seminare und Veranstaltungen angeboten, die darauf abzielen, Wissen zu vermitteln und die Fähigkeiten der Teilnehmenden zu erweitern. Wer eine Idee hat und nicht weiß, wie diese umgesetzt werden soll, findet im Kreis der ExpertInnen des innolab bodensee ideale Anprechpersonen und Unterstützung.
Weitere spannende Informationen über das innolab bodensee unter www.innolab-bodensee.de



innolab bodensee
Bücklestraße 3
D-78467 Konstanz
info@innolab-bodensee.de +49 7531 30 28 665

SOLARLAGO – SMART ENERGY NETWORK | Die „Stadt am See“ zeigt ein breites Spektrum an Modellen und Ideen für den Klimaschutz. Die Strategie hierzu ist in Konstanz seit 2021 fest verankert. Seitens der Stadt wird die Umsetzung der Maßnahmen mit Nachdruck verfolgt. Ämterübergreifende Kooperationen und die aktive Einbindung der Wirtschaft spielen dabei eine wichtige Rolle.
In ausgewählten Projekten arbeiten Wirtschaftsförderung, Amt für Klimaschutz, Amt für Stadtplanung und Umwelt und das Branchennetzwerk für erneuerbare Energien und Energieeffizienz „solarLAGO“ eng zusammen, um dem Ziel – der Konstanzer Energiewende – zügig näherzukommen. Neben der energetischen Gebäudesanierung auch im gewerblichen Umfeld steht der Wechsel auf erneuerbare Energien für Strom, Wärme, Logistik und Prozessenergie im Vordergrund. Ob große Photovoltaikanlagen auf Gewerbegebäuden, Speicherlösungen für mehr Eigenstromnutzung und Lastmanagement, Mieterstrommodelle oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung –für jedes Thema gibt es bereits Best Practice Beispiele. Die Spezialisten für die Umsetzung stehen vor Ort zur Verfügung. Mit Informationsveranstaltungen und Netz-
werk-Events werden Fragende und Wissende, Bedarfe und Angebote zusammengebracht. Auch Start-ups mit neuen Ansätzen werden aktiv eingebunden.
„Mit unseren Events setzten wir bei den größten Hürden an. Zum Beispiel informieren und beraten wir GebäudeeigentümerInnen und Gewerbetreibende beim vom Amt für Stadtplanung und Umwelt durchgeführten „Energiekarawane“ oder vermitteln Unterstützungskräfte für die Energiewende-Handwerk mit der von uns ins Leben gerufenen „Mitmach-Plattform“. Mit dem Umzug des Amts für Klimaschutz in ein denkmalgeschütztes Gebäude haben wir nun sogar eine eigene Testplattform für neue KI-Lösungen zur Energieeinsparung in alten Gebäuden“, so Dr. Alexander Schuler, Geschäftsführer solarLAGO und Klima-Wirtschaftsförderer bei der Stadt Konstanz.

Energiekarawane Industriegebiet – ein integriertes energetisches Quartierskonzept
Eine vor-Ort-Energieberatung zu allen Aspekten des Gebäudes und der Energieversorgung wird den Gewerbetreibenden und GebäudeeigentümerInnen durch die Stadt kostenfrei angeboten. Direkte Ansprache und Info-Veranstaltungen unter-stützen dabei, die ersten Schritte zu machen. Weitere Informationen zum Projekt „Energiekarawane“ und die direkte Buchung einer kostenlose Energieberatung gibt unter www.konstanz.de/energiekarawane.



Mit unseren Events setzten wir bei den größten Hürden an. Zum Beispiel informieren und beraten wir GebäudeeigentümerInnen und Gewerbetreibende beim vom Amt für Stadtplanung und Umwelt durchgeführten „Energiekarawane“ oder vermitteln Unterstützungskräfte für die Energiewende-Handwerk mit der von uns ins Leben gerufenen „Mitmach-Plattform“. Mit dem Umzug des Amts für Klimaschutz in ein denkmalgeschütztes Gebäude haben wir nun sogar eine eigene Testplattform für neue KI-Lösungen zur Energieeinsparung in alten Gebäuden.«
Dr. Alexander Schuler, Geschäftsführer solarLAGO und Klima-Wirtschaftsförderer bei der Stadt Konstanz
Neue technologische Möglichkeiten testen: KI für mehr Energieeffizienz in der Villa Rheinburg
Das Amt für Klimaschutz ist in der denkmalgeschützten Villa Rheinburg untergebracht. KI hat das Potenzial vor allem auch in schwierig zu sanierenden Gebäuden einen deutlichen Beitrag zur Energieeinsparung und Komfort zu leisten. Für eine Stadt wie Konstanz mit historischem Kern sind diese Projekte besonders interessant.
Mitmach-Plattform Energiewende-Handwerk
Das Handwerk kann zu einem gewissen Anteil handwerklich begabte Non-Professionals einsetzen und damit die Lücke bei den Fachkräften abmildern. Wir vermitteln Menschen die einen Beitrag zur Energiewende im Handwerk leisten wollen an die Betriebe. Das Match-Making für Energiewendehelferinnen und -helfer und regionale Handwerksbetriebe findet auf www.mitmachplattform.de statt. Besonders Schüler und Schülerinnen kurz vor dem Berufseinstieg sind eingeladen, diese Chance zu nutzen. Jetzt informieren und einen Beitrag zur Energiewende in Konstanz leisten.
www.mitmachplattform.de mitmachplattform.kn


solarLAGO –smart energy network e.V.
Dr. Alexander Schuler
Bücklestraße 3e c/o Wirtschaftsförderung
D-78467 Konstanz
Tel. +49 7531 900-2015
alexander.schuler@solarlago.de www.solarlago.de

IM GESPRÄCH | 2025 verabschiedet sich der langjährige Geschäftsführer des Reichenauer Verkehrsvereines Karl Wehrle in den Ruhestand. Wir sprachen mit ihm über das neue Marketing-Portfolio der Gemeinde Reichenau und über die Herausforderungen für seine Nachfolgerin Carolin Deggelmann.
Herr Wehrle, Sie widmeten sich als Geschäftsführer des Verkehrsvereins auf der Insel Reichenau vornehmlich dem Tourismus. Der Verein befindet sich nun in Liquidation. Wie geht es organisatorisch weiter?
Der Punkt war, wie Sie schon sagten, dass sich der Verkehrsverein ausschließlich um die Entwicklung des Tourismus gekümmert hat, ich persönlich in einem begrenzten zum Teil ehrenamtlichen Rahmen noch um das Thema Kultur. Das Marketing im Bereich Gewerbe blieb außen vor. Von Seiten der Gemeinde wurde der Verein finanziell unterstützt, man wollte aber mehr als Tourismus und als Gemeinde zudem näher dran sein. Statt des Vereins soll nun der 2024 gegründete Eigenbetrieb einen breiter aufgestellten Marketingbereich unter einem Dach vereinen.
Das heißt, um welche Bereiche wird es zusätzlich gehen?
Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, es gibt aber natürlich auch andere bedeutende Gewerbe in der Gemeinde. Man hat deswegen den neuen Eigenbetrieb, wie die neue Bezeichnung REICHENAU Kultur-MarketingTourismus schon vermuten lässt, auf drei Säulen gestellt. Der Eigenbetrieb hat einen eigenen Haushalt, als Teil des gemeindlichen Gesamthaushalts, und rückt damit näher
an die Gemeinde heran als es der privatrechtlich organisierte Verein zuvor gewesen war. Zuletzt hatte ich als früherer Geschäftsführer des Verkehrsvereins auch die Geschäftsführung des Eigenbetriebs übernommen. Anfang des Jahres 2025 erfolgt dann die Übergabe an die neue Geschäftsführung.
Ist der Eigenbetrieb auch personell im Vergleich zum Verkehrsverein breiter aufgestellt bzw. anders organisiert? Angelehnt an ein Organigramm steht als Überbau die Gemeinde selbst, also Bürgermeister und Gemeinderat. Darunter der Eigenbetrieb mit der neuen Geschäftsführung und den drei Säulen. Die Säule Kultur wurde neu besetzt mit Stefanie Schreiber als Kulturreferentin. Diese kümmert sich um die Bereiche UNESCO-Welterbe, Museum und Kultur allgemein. Zusätzlich gibt es einen Musikreferenten, um die notwendige Nachwuchs- und Jugendförderung im Bereich Musik aktiv gestalten zu können. Was die Tourismus-Säule betrifft, so verbleiben die Aufgaben dort bei den Mitarbeiterinnen, die auch bisher im Verkehrsverein bzw. in der Tourist-Information tätig waren. Meine bisherige Stellvertreterin Irina Drewniok wird diese Säule führen und gleichzeitig die Stellvertretung der neuen Geschäftsführung sein.

Karl Wehrel war lange Jahre Geschäftsführer des Reichenauer Verkehrsvereins. Jetzt verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Und wie verhält es sich mit der neuen dritten Säule, dem Marketing?
Diese Säule wird sich speziell mit dem Thema Wirtschaft und generell mit Marketing-Aufgaben beschäftigen. Sie ist dementsprechend breiter definiert und ist bei der Geschäftsführung angesiedelt. Wir sind viel mehr als eine Insel des Tourismus und des Gemüses, das wollen wir kundtun. Auf dem Festland gibt es zum Beispiel das Gewerbegebiet Göldern, auch auf der Insel gibt es ein kleines Gewerbegebiet. Diese Säule dient gleichermaßen der Gewerbeförderung, zum Beispiel in der Vorbereitung von Betriebsansiedlungen, wie auch ganz allgemein dem Standortmarketing. Hinzu kommt das Thema Netzwerken, um Verbindungen zu schaffen zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen – für einen stärkeren gemeinsamen Auftritt nach außen. Wir haben starke Marken in den einzelnen Bereichen, zum Beispiel beim Gemüse, auch beim Tourismus. Ein Ziel wäre das Kreieren einer gemeinsamen Marke Reichenau. Hinzu kommt in dieser Säule das Innenmarketing im Sinne einer Insel internen Kommunikation zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen und auch mit der Bürgerschaft. Den Gewerbetreibenden ist bewusst, dass es ohne den Tourismus zum Beispiel den Weinanbau in dieser Form nicht geben würde oder im Einzelhandel und der Gastronomie viele Betriebe nicht existieren könnten. Dem gegenüber steht das berechtigte Interesse der Bürgerschaft. Denen gilt es zuzuhören, was positiv und was negativ ist. Innenmarketing bedeutet auch, die Leute mit auf die Reise in die Zukunft zu nehmen. Ich denke, dieser Bereich des Marketings wird eine der Hauptaufgaben der neuen Geschäftsführung sein.
Sie gehen 2025 in den Ruhestand, wer übernimmt die Geschäftsführung?
Meine Nachfolgerin ist mit Beginn des Jahres 2025 Carolin Deggelmann. Um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, gibt es eine viermonatige Übergangsphase, die man zur Einarbeitung braucht. Insbesondere, weil es nun doch mehr Geschäftsfelder sind als zuvor. Die neue Geschäftsführerin wird dann auch als eine Art Bindeglied zur Verwaltung fungieren, als Erstansprechpartnerin in gewerblichen Fragen zur Gemeinde Reichenau. Was früher die Aufgaben des Verkehrsvereins waren, war historisch bedingt. Die jetzigen Strukturen gehen weit darüber hinaus.


Wie beurteilen Sie die ersten Schritte des REICHENAU Kultur-Marketing-Tourismus und welche weiteren Schritte könnten folgen?
REICHENAU Kultur-Marketing-Tourismus befindet noch immer in einer Phase des Aufbaus. 2024 war das erste Jahr des Eigenbetriebs. Wir wurden quasi ins kalte Wasser geworfen, auch durch die vielfältigen Aufgaben des 1300-jährigen Jubiläums. Niemand kann und konnte vorhersagen, wie es laufen wird. Teilweise wurden Aufgaben übernommen, die bisher bei der Gemeinde angesiedelt waren. Ich persönlich sehe für die Zukunft durchaus die Möglichkeit, dass der Eigenbetrieb nur eine erste Stufe darstellt auf dem Weg hin zu einer GmbH mit der Gemeinde als Teilhaber. Touristische Betriebe könnten dann ebenso Teil dieser GmbH werden, sei es das Strandbad, der Yachthafen, ein Campingplatz etc. Man könnte nochmal anders wirtschaften und wäre nicht gebunden an den Gemeindehaushalt. Aber noch ist das eine Zukunftsvision.
REICHENAU Kultur-Marketing-Tourismus Geschäftsführung Carolin Deggelmann
Pirminstraße 145 78479 Reichenau
Tel. +49 7534 9207-0
info@reichenau-tourismus.de www.reichenau-tourismus.de
Städte, Gemeinden, Kreise

IM GESPRÄCH | Emanuel Flierl ist seit Anfang 2024 neuer Wirtschaftsförderer der Stadt Radolfzell. Ein großes Thema für ihn und sein Team: den Wirtschaftsstandort Radolfzell überregional bekannter zu machen und die Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung zu unterstützen.
Herr Flierl, Sie haben einen neu strukturierten Bereich übernommen. Wie passen die verschiedenen Themen zusammen?
Dem Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften ist die Geschäftsstelle Gutachterausschuss zugeordnet. Im Arbeitsalltag ergeben sich dadurch zahlreiche Synergien. Denn die Neuansiedlung und Erweiterung von Unternehmen geht Hand in Hand mit der Vergabe von Grundstücken. Dies gilt auch für die Verbesserung der essentiellen Standortfaktoren wie zum Beispiel Telekommunikation und E-Lade-Infrastruktur.
Welche Unternehmen und somit Arbeitgeber sind in Radolfzell ansässig?
Weltweit agierende Konzerne und ein starker Mittelstand sind hier vertreten. Radolfzell zeichnet sich durch einen gesunden Branchen- und Größenmix aus produzierendem Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen sowie inhabergeführten Unternehmen und Niederlassungen aus. Wir können stolz auf unseren historisch gewachsenen Wirtschaftsstandort sein. Um attraktiv für Unternehmen und Arbeitnehmer zu bleiben, bedarf es einer weiteren gezielten Schärfung der Standort- und Ansiedlungspolitik.
An welchen Stellschrauben können Sie in der Wirtschaftsförderung drehen?
Die für Unternehmen wesentlichen Faktoren betreffen alle kommunalen Handlungsfelder, vor allem im Hinblick auf die Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter. Die beste Wirtschaftsförderung ist für mich eine attraktive und gut funktionierende Stadt. Attraktive Arbeitsorte sind auch attraktive Orte zum Leben. Denn Städte sind nicht mehr nur für die Grundversorgung zuständig, sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität.
Können Sie die Unternehmen konkret bei der Arbeitskräftegewinnung unterstützen?
Ja, wir können den Wirtschaftsstandort Radolfzell für potenzielle Arbeitnehmer überregional besser sichtbar und auffindbar machen. Aktuell arbeiten wir an einer Imagekampagne und an einer digitalen Plattform, die Infos zu Radolfzell als Arbeitsort und Lebensmittelpunkt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bündelt. Die Entscheidung für den Arbeitsstandort Radolfzell können wir ebenfalls positiv beeinflussen, indem wir Wohnraum schaffen. Denn unsere Unternehmen und auch die Bürger – also Arbeitnehmer – signalisieren uns hier einen großen Bedarf. Viele Unternehmen werden selbst aktiv, doch auch wir als Stadt sollten uns zum Wohle unseres Wirtschaftsstandortes noch stärker einbringen.
Welche Maßnahmen ergreifen Sie?
Bei größeren Bauprojekten in der Stadt bringen wir uns unter anderem immer wieder für Mitarbeiterwohnungen ein. Darüber hinaus denken wir zum Beispiel niederschwellige Lösungen für das Ankommen in Radolfzell wie etwa mit einem Boardinghouse.
In 2024 lag durch die Innenstadtoffensive ein Fokus auf der Innenstadt. Auch bei den Unternehmen?
Selbstverständlich, sie sind ein elementarer Teil der Innenstadt. Die Einkaufs- und Tourismusstadt Radolfzell am Bodensee soll attraktiv, zeitgemäß und lebendig bleiben.
Foto: Hanse Knödler Fotodesign

Daher sind wir zusammen mit der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH permanent im Austausch mit den Akteuren der Innenstadt. Die Flächensuche oder -vermittlung für Einzelhandel, Gastronomie und Ärzte gehören dazu, aber auch alle anderen Themen, die die Unternehmer bewegen. In 2024 haben wir zusammen mit kompetenten Partnern aus Wissenschaft und Forschung die Zukunftsthemen des Einzelhandels ins Blickfeld gerückt.
Welche waren das?
In Veranstaltungen und unserem Newsletter warfen wir einen Blick auf die Generation Z – die Kunden und Mitarbeiter von morgen. Das Thema Digitalisierung im Handel, in der Gastronomie und Freizeitwirtschaft haben wir ebenfalls aufgegriffen. Beim Einzelhandelsfrühstück und gemeinsamen Besuch im Zukunftslabor Konstanz ging es um Einsatzpotenziale bereits existierender, technischer Lösungen und zukünftige Entwicklungen für den Verkauf sowie die Erlebnissteigerung der Kunden. Als Wirtschaftsförderung ist es zudem unsere Aufgabe, Informationsangebote zu schaffen und Themen nach Radolfzell zu holen, die unseren Unternehmen einen Mehrwert bieten und somit unsere Stadt voranbringen. Innovation macht auch vor Radolfzell nicht halt.
Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Spielt KI auch in Radolfzell eine Rolle?
Vor Künstlicher Intelligenz kann sich Radolfzell nicht verschließen. Und wir sind hier schon stark aufgestellt. Wir haben durch eine Branchenanalyse belegt, dass Radolfzell
Nicole Stadach, 07732 81-116, wirtschaftsfoerderung@radolfzell.de Monika Wiesner, 07732 81-105, wirtschaftsfoerderung@radolfzell.de Emanuel Flierl, 07732 81-225, wirtschaftsfoerderung@radolfzell.de Marianne Lindenthal, 07732 81-106, wirtschaftsfoerderung@radolfzell.de
einen Schwerpunkt von Unternehmen aus dem Bereich IT und Kommunikation hat. Dieses Know-how ist eine Stärke unseres Standortes. Uns muss es nun durch Netzwerkarbeit gelingen, dieses Wissen künftig auf weitere Akteure in Radolfzell zu transferieren und arbeiten an Formaten genau dafür.
DER WIRTSCHAFTSSTANDORT RADOLFZELL IN ZAHLEN:
Oberbürgermeister Simon Gröger legt großen Wert auf die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Radolfzell:
„Als ehemaliger Wirtschaftsförderer in Tuttlingen ist es mir wichtig, dass wir in Radolfzell eine intensive Wirtschaftsförderung betreiben. Unser Ziel ist es, auf der kommunalen Ebene Maßnahmen umzusetzen, die die Standortwahl von Unternehmen positiv beeinflussen. Besonders gefordert sind wir als Kommune bei den harten Faktoren. Dazu zählen natürlich in erster Linie Gewerbeflächen, Verkehrs -
anbindung und Infrastruktur. Entscheidend sind aber auch die weichen Faktoren wie das Bildungs- und Kinderbetreuungsangebot, die Innenstadtattraktivität sowie das Freizeit- und Kulturangebot. Hier können wir in Radolfzell verlässliche Strukturen und ein breites Spektrum bieten.“


WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BODENSEEKREIS | Der Bodenseekreis bietet weit mehr als atemberaubende Landschaften, hochqualitative Konsumgüter wie Wein und einen hohen Freizeitwert. Er ist auch einer der wirtschaftsstärksten Landkreise Deutschlands. Um dieses wirtschaftliche Potenzial sichtbar zu machen, startet die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) die nächste Phase ihrer Standortmarketing-Kampagne Typisch Bodenseekreis. Ziel ist es, das Image der Region als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken. Unternehmen aus dem Bodenseekreis sind zur aktiven Teilnahme eingeladen.
Die Herausforderung liegt darin, die facettenreiche Wirtschaft des Bodenseekreises in den Vordergrund zu rücken. „Zu oft werden wir lediglich mit Alpenblick, See und Apfelbäumen assoziiert“, erklärt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB. „Die meisten Menschen wissen nicht, dass es im Bodenseekreis hochinnovative Unternehmen gibt, deren Produkte und Dienstleistungen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Unsere Kampagne zeigt, wo überall ein ‚Stück Bodenseekreis‘ drinsteckt.“
Die Ursprünge der Kampagne reichen zurück zu einer Idee, die für die Landesgartenschau 2021 in Überlingen entstanden ist. „Wir wollten den Besuchern zeigen, dass im Bodenseekreis sowohl die Blumen als auch die Wirtschaft blühen“, so Otte. Auch Privatpersonen, die die Region vielleicht nur als touristisches Ziel wahrnehmen, sollten für die wirtschaftliche Leistungskraft der Region sensibilisiert und begeistert werden. Um Neugierde zu wecken, werden deshalb in der Bildsprache bekannte Motive verwendet, die scheinbar nichts mit dem Bodenseekreis zu tun haben: z. B. Bananen, Eisbären,
die Sydney Harbour Bridge oder Fußballpokale. Schaut man aber genauer hin, erkennt man, dass die im Bodenseekreis ansässigen Unternehmen als weltweit gefragte Zulieferer einen wichtigen Beitrag zu den verschiedensten Produkten und Dienstleistungen leisten.
Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die Aussage, dass „Bananen typisch für den Bodenseekreis sind“. Dies mag auf den ersten Blick verblüffen, denn im Bodenseekreis werden ja keine Bananen angebaut. Doch die Plattenhardt + Wirth GmbH aus Meckenbeuren, ein führender Hersteller von Reifekammern für Obst, löst das Rätsel: „Wenn jemand eine Banane isst, die durch die Technologie dieser Firma verzehrreif wurde, hat er unbewusst ein Stück Bodenseekreis in der Hand“, sagt Otte. Ähnlich verhält es sich mit den Eisbären in der Arktis, da innovative IT-Lösungen der IHSE GmbH aus Oberteuringen zur Erforschung des Klimawandels beitragen und helfen, deren Lebensraum zu erhalten. Die Palette an Beispielen ist schier endlos.

» Die meisten Menschen wissen nicht, dass es im Bodenseekreis hochinnovative Unternehmen gibt, deren Produkte und Dienstleistungen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Unsere Kampagne zeigt, wo überall ein ‚Stück Bodenseekreis‘ drinsteckt.«
Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB
Die Typisch Bodenseekreis-Kampagne geht jedoch über diese Einzelbeispiele hinaus. Sie zielt darauf ab, die unsichtbaren Technologien, die in vielen Produkten stecken, sichtbar zu machen. So liefern beispielsweise Satelliten von Airbus aus Immenstaad Daten für die Wettervorhersage und Klimabeobachtung, während die innovative Technologie von HSM aus Frickingen den Recyclingprozess von PET-Flaschen im Supermarkt unterstützt.
Die Wirtschaftsstärke des Bodenseekreises beruht in Zahlen gemessen nicht auf der Landwirtschaft oder dem Tourismussektor. Letzterer trägt im Schnitt nur ca. 8 % zur regionalen Bruttowertschöpfung bei. Die Industrie wiederum trägt rund 46 % bei. Aber: Der Bodenseekreis wird dennoch größtenteils als Tourismusregion wahrgenommen. „Die Privatperson kennt und schätzt den Urlaub bei uns. Und als Konsument kennt und schätzt dieselbe Person das fertige Produkt, kann aber den Beitrag der Unternehmen aus dem Bodenseekreis nicht erahnen. Denn diese sind meist Zulieferer“, erklärt Otte. Dies kann dazu führen, dass Fachkräfte aus den Bereichen Informatik, Naturwissenschaft und Technik die guten Karrierechancen, die sie bei Unternehmen im Bodenseekreis haben, nicht erkennen und sich anderen Regionen zuwenden.
Ausstellung der Spitzenleistungs-Motive auf einer Netzwerkveranstaltung.
„Es geht uns nicht darum, den Bodensee als Freizeitregion klein zu reden. Schließlich profitieren von der touristischen Lebensqualität der Region alle, die am Bodensee leben. Wir zeigen mit unserer Standortmarketing-Kampagne Typisch Bodenseekreis lediglich, dass speziell der Bodenseekreis mehr zu bieten hat: nämlich Top-Arbeitsplätze bei Top-Unternehmen in einer Top-Tourismusregion“, erläutert Otte. „Mit unserer Kampagne zeigen wir auf einfache und humorvolle Weise, dass der Bodenseekreis nicht nur eine Freizeitregion, sondern auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist. So begeistern wir Talente für den Bodenseekreis und kommunizieren das wirtschaftliche Potenzial der Region“.
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Spatenstraße 10, D-88046 Friedrichshafen Tel. +49 7541 38588-0 info@wf-bodenseekreis.de www.wf-bodenseekreis.de

IM GESPRÄCH | mit Simon Blümcke, neuer Oberbürgermeister von Friedrichshafen
Herr Blümcke, Sie sind seit 1. Dezember 2024 Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen. Welche Aufgaben und Projekte haben für Sie zunächst oberste Priorität? Mir ist es wichtig, zuerst die Menschen kennenzulernen, mit denen ich gemeinsam für Friedrichshafen arbeiten darf: Das sind meine Bürgermeisterkollegen, mein Team, die Führungskräfte und natürlich die vielen Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichsten Bereichen von der Verwaltung über die Kitas, unser Pflegeheim, die Häfler Bäder bis hin zu den Städtischen Baubetrieben. Wir sind mehr als 1.500 Mitarbeitende, da gibt es unglaublich viel Wissen, viel Können und Sachverstand – darauf kann ich und können wir vertrauen. Und natürlich gibt es auch genügend Sachthemen und Aufgaben, die vor uns stehen.

Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen
Simon Blümcke wurde am 29. September 2024 im ersten Wahlgang zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Friedrichshafen gewählt. Er hat sein Amt zum 1. Dezember 2024 angetreten.
Geboren wurde Simon Blümcke 1974 in Tübingen, aufgewachsen ist er in Reutlingen und Pfullingen. Von 1996 bis 2002 hat er an den Universitäten Tübingen und Gent (Belgien) Politikwissenschaft, Zeitgeschichte und Öffentliches Recht mit dem Abschluss Magister Artium studiert. 2003 wurde Simon Blümcke zum Bürgermeister der Gemeinde Hagnau am Bodensee gewählt. Von 2015 bis zu seinem Amtsantritt in Friedrichshafen war er Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg.
Woran denken Sie dabei?
Die kommunalen Finanzen sind überall im freien Fall, auch in Friedrichshafen. Sowohl im städtischen Haushalt als auch im Haushalt der Zeppelin-Stiftung müssen wir den Gürtel enger schnallen und nicht nur kurzfristiges Einsparpotenzial heben. Fürs Klinikum ist eine langfristig tragbare Lösung zu finden. Auf der anderen Seite benötigen wir ausreichend Kita-Plätze, müssen und wollen in Bildung und Betreuung investieren. Die nächsten Jahre werden finanziell herausfordernd, das dürfte inzwischen allen bewusst sein.
Ihr Amtsantritt fällt in der Tat in wirtschaftlich turbulente Zeiten. Welchen gestaltenden Einfluss sehen Sie für sich als Oberbürgermeister auf die Unternehmen der ZeppelinStiftung?
In erster Linie bin ich Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen und nicht Superchef von ZF und Zeppelin – da habe ich ein sehr klares Rollenverständnis, das im Übrigen ja auch gesetzlich so geregelt ist. Operatives Geschäft, Strategie und Innovationen müssen aus den Unternehmen kommen, der Aufsichtsrat berät und kontrolliert.
Friedrichshafen und die Region verdanken ihren Wohlstand den großen Industrieunternehmen mit globalen Absatzmärkten. Wichtig sind aber auch die vielen, stetig wachsenden kleinen und mittelständischen Betriebe mit interessanten Geschäftskonzepten und einem großen Arbeitsplatzangebot. Was bietet die Stadt dem Mittelstand? Wir wissen um die Bedeutung des Mittelstandes für das Wohlergehen der Stadt. Keine Kommune kommt ohne eine breite wirtschaftliche Basis aus. Die Menschen in diesen Unternehmen arbeiten täglich für den Erfolg – ob sie nun Inhaberin oder Mitarbeiter sind. Unsere städtische Wirtschaftsförderung ist ihr Partner. Sie ist für die Anliegen der Unternehmen da, seien es Ansiedlungen, Erweiterungen oder sehr individuelle Herausforderungen, die es anzugehen gilt. Hochvernetzt mit Kammern, Verbänden, Behörden und vielen weiteren hilfreichen Institutionen steht die Wirtschaftsförderung dem Mittelstand eng zur Seite. Wir bieten möglichst kurze Wege in die Verwaltung, eine echte Dienstleistung an der lokalen Wirtschaft, ungeachtet der Unternehmensgröße. Für den Einzelhandel, das Gastgewerbe sowie touristische Anbieter sind das Stadtmarketing und die Tourist-Information im Einsatz. Sie kümmern sich professionell um die Innenstadt und um unsere Gäste.

Die Stadt Friedrichshafen ist Teil der internationalen und wirtschaftlich starken Region Bodensee. Wie beurteilen Sie die Rolle der Stadt innerhalb der Bodenseeregion und wie kann Friedrichshafen als Standort davon profitieren? Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Friedrichshafen verdient ihr tägliches Brot in der Produktion von Gütern. Die Unternehmen in unserer Stadt bieten fast 40.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. An jedem Arbeitstag kommen mit 23.000 Beschäftigten doppelt so viele in die Stadt als von hier in andere Gemeinden auspendeln. Mit 63.000 Einwohnern und Einwohnerinnen sind wir die größte Stadt im Bodenseekreis. Friedrichshafen wirkt auf mich wie eine Großstadt im Kleinen. In unserer Region gelingt eine besondere Mischung aus Stadt und Land, aus globaler Internationalität der Industriebetriebe und Häfler Heimatsinn. Eingebettet ist diese spannende Mixtur in eine wunderschöne Landschaft am Bodensee. Wirtschaft und Lebensqualität profitieren seit Jahrzehnten von dieser Lage und ganz sicher auch noch für eine lange Zeit in der Zukunft.
Wenn Sie über die ersten Wochen und Monate hinausblicken: Wohin möchten Sie in Ihrer achtjährigen Amtszeit die Stadt Friedrichshafen steuern?
Ich möchte Friedrichshafen bewahren und entwickeln. Ganz klar: Das schaffe ich nicht alleine, da braucht es viele Akteure, die an einem Strang ziehen. Unsere gemeinsame Aufgabe: Den industriellen Kern gilt es zu sichern, er hat uns Wohlstand gebracht und soll weiterhin dazu in der Lage sein. Da haben wir nicht alles selbst in der Hand, sind von globalen Märkten abhängig. Als Verwaltung setzen wir weiterhin gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Mittelstands,
ZAHLEN – DATEN – FAKTEN
↗ Mit 63.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt am Bodensee
↗ rund 40.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
↗ rund 23.000 Berufs-Einpendler und rund 11.000 Auspendler
↗ rund 1.500 Unternehmen mit mindestens einem Beschäftigtem
↗ jeder vierte Beschäftigte in Friedrichshafen arbeitet bei ZF
↗ Standort von zwei Hochschulen und eines Innovations- und Technologiezentrums
↗ Tourismus: rund 780.000 Übernachtungen (2023)
neben der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben. Stadtentwicklung, das sagt schon das Wort, hört nie auf. Eine Stadt lebt, eine Entwicklung geht voran. Nach meinem Eindruck ist es allen Akteuren bisher gut gelungen, einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort zu gestalten. Das möchte ich, das sollten wir fortsetzen. Die Vision einer Landesgartenschau ist mir und den Menschen ein Anliegen – daran werden wir sofort arbeiten!

Stadt Friedrichshafen
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Charlottenstraße 12
D-88045 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 203-54022 wirtschaft@friedrichshafen.de


BAD SAULGAU | Die Innenstadt von Bad Saulgau steht nach wie vor stabil und funktionstüchtig als echtes Stadtzentrum da. Dafür gibt es mehrere gute Gründe.
Gemeinsam mehr bewegen
Ein schlagkräftiger Gewerbeverein und umtriebige Einzelhändler treffen auf eine engagierte Wirtschaftsförderung. 15.000 Besucher, ein enormer Umsatzboost und richtig viel Publicity war beispielsweise das Ergebnis von „Bad Saulgau leuchtet“. Die Shoppingnacht mit Lichtevent haben Gewerbeverein „Unser Bad Saulgau“ und die Stadt vergangenes Jahr zum zweiten Mal gemeinsam organisiert.

STORE-KONZEPT BAD SAULGAU
Die Wirtschaftsförderung stellt für maximal drei Monate eine Ladenfläche in A-Lage zur Verfügung. Die Kostenpauschale für die Nutzung beträgt immer lediglich 45 Euro pro Woche. Das Ziel: Versuchsräume schaffen – für Existenzgründungen und neue Geschäftsmodelle, aber auch für etabliere Unternehmen und Einzelhandelsbetriebe. Wer langfristig weitermacht, kann bei der Stadt dann zusätzliche Fördermittel beantragen. Bis zu 6.000 Euro Starthilfe stellt die städtische Wirtschaftsförderung zur Verfügung.
Und ganz aktuell geht der Popup Store Bad Saulgau in seine insgesamt fünfte Auflage. Das ursprünglich vom Wirtschaftsministerium aus dem Sofortprogramm Innenstädte geförderte Konzept hat für die langfristige Nachnutzung von Einzelhandelsimmobilien gesorgt und so gleichzeitig neue Fachgeschäfte in die Innenstadt gebracht (mehr Infos unten oder unter www.bad-saulgau.de).
Viele inhabergeführte Fachgeschäfte
Besonders viel Einzelhandel passiert in der Bad Saulgauer Innenstadt. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Betriebe ist inhabergeführt und bekennt sich ohne Wenn und Aber zum Standort. Und sorgt dafür, dass sich Kundinnen und Kunden besonders wohl fühlen. Denn die Bad Saulgauer Innenstadt ist vielleicht nicht riesig. Aber sie ist authentisch, die Ladengeschäfte besonders und eben nicht beliebig austauschbar.
Bad Saulgau ist nicht nur Mittelzentrum (das erweiterte Marktgebiet umfasst rund 80.000 Einwohner), sondern auch Gesundheitsstandort. 300.000 Besucher kommen jährlich ins Thermalbad. Ebenso viele Übernachtungen zählen die insgesamt vier Fachkliniken. Das sorgt für zusätzliche Frequenz in der Innenstadt – und insgesamt 12 Mio. einzelhandelsbezogenem Umsatz pro Jahr (Quelle: dwif Studie 2019).
Weitere Infos/Kontakt Wirtschaftsförderung Bad Saulgau
Tel. +49 7581 207-103 / -104 wirtschaftsfoerderung@bad-saulgau.de


UNTERNEHMERVERBAND LANDKREIS SIGMARINGEN (UVS) | Der UVS lud zum traditionellen Stelldichein in die Stadthalle Sigmaringen, wo sich rund 180 Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft einfanden, um einen festlichen Abend mit abwechslungsreichem Programm und einer besonderen Preisverleihung zu erleben.
Ein besonderer Höhepunkt war die mitreißende Keynote des bekannten Wetterexperten Sven Plöger, der unter dem Titel „Zieht euch warm an, es wird heiß“ eindrucksvoll über die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels referierte. Mit einem packenden Mix aus wissenschaftlichen Fakten und unterhaltsamen Anekdoten schaffte es Plöger, die Dringlichkeit des Themas auf eindrucksvolle Weise zu vermitteln.
Auf unterhaltsame Weise referiert Wetterexperte Sven Plöger über die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels.


Im Mittelpunkt des Abends stand die Verleihung des UVS-Awards „Unternehmergeist“ an Steffen Braun, Werkleiter der Firma Trumpf in Hettingen. Steffen Braun verkörpert mit seinem beruflichen Werdegang und seinem Engagement die Werte des Unternehmens und der Region auf beeindruckende Weise. Seine Karriere begann er als Facharbeiter im Schichtbetrieb und arbeitete sich über die Jahre bis zur Werkleitung hoch. Braun blieb dabei stets bodenständig und pflegte den engen Kontakt zur Belegschaft. Diese Verbundenheit zeigte sich auch, als er vor gut 20 Jahren die Herausforderung annahm, vom Ballungsraum in die ländliche Region Hettingen zu wechseln, wo er mit seiner menschlichen Art und seinem Führungsstil rasch Anerkennung fand. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Standort Hettingen zu einem Modellstandort der Branche, der durch umfa ngreiche Investitionen von insgesamt 145 Millionen Euro und eine Vergrößerung der Produktionsfläche von 18.500 auf 45.500 Quadratmeter geprägt ist. Steffen Braun schuf in dieser Zeit 170 neue Arbeitsplätze und ermöglichte über 250 jungen Menschen ihre Ausbildung. Seine Führung geht dabei weit über betriebswirtschaftliche Erfolge hinaus: Mit Empathie, Teamgeist und einem offenen Ohr für alle Mitarbeitenden förderte er eine Kultur des Miteinanders und des gegenseitigen Respekts. Die Eigentümerfamilie schätzt Brauns Fähigkeit, innovatives Denken mit einer bodenständigen Haltung zu verbinden.
UVS-Präsident Markus Kleiner würdigte in seiner Laudatio nicht nur Brauns unternehmerische Leistung, sondern auch seine Rolle als Vorbild für die Region. Er betonte, wie selten es sei, jemanden zu finden, der sowohl das Handwerk von Grund auf gelernt habe als auch in einer Führungsposition stets mit Respekt und Empathie


Der UVS-Award „Unternehmergeist“ geht an Steffen Braun, Werkleiter der Firma Trumpf in Hettingen. Von links: WIS-Geschäftsfuhrer Dr. Bernhard Kräußlich, Steffen Braun, UVSPräsident Markus Kleiner.

agiere. „Steffen Braun hat nie den Kontakt zur Basis verloren,“ so Kleiner. „Er verkörpert die Werte, die unseren Verband und unsere Region prägen: Bodenständigkeit, Innovationskraft und ein tiefes Verantw ortungsbewusstsein gegenüber den Mitarbeitenden.“ Dr.-Ing. Mathias Kammüller, Inhaber der Trumpf Gruppe, hob hervor, dass Braun stets den Erfolg des Teams über den eigenen stellte und auch Mut bewies, Dinge anders zu sehen und anzusprechen. Im Interview zeigte sich Braun demütig und betonte die Bedeutung der Teamarbeit: „Man steht einer Entwicklung vor. Aber alleine ist man aufgeschmissen, man brauc ht ein gutes Team, und das habe ich immer gehabt“, sagte er.
Durch den Abend führte charmant und humorvoll Dr. Bernhard Kräußlich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Landkreis Sigmaringen, der das Programm mit Feingefühl und Professionalität leitete. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll die Kraft der Gemeinschaft und den Wert des Austauschs in der Unternehmerlandschaft. Mit einem gelungenen Mix aus festlichem Rahmenprogramm, inspirierenden Vorträgen und bewegenden Momenten bleibt das Stelldichein 2024 den Gästen sicherlich in lebhafter Erinnerung.


Einmal mehr empfand ich es als tiefes Privileg, das Stelldichein zu moderieren und unsere Wirtschaft im Landkreis Sigmaringen ins Rampenlicht zu cken. Die Geschichten und Erfolge, die hier erzählt und gefeiert wurden, zeigen, welche Kraft und Leidenschaft in unserem Netzwerk steckt. Es erfullt mich mit Stolz und Dankbarkeit, nun so viele Jahre Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft gewesen zu sein. Ein herzliches Dankeschön an mein Team, an den UVS-Vorstand und an meinen Präsidenten Markus Kleiner. «

Unternehmerverband Landkreis Sigmaringen Fürst-Wilhelm-Straße 12 D-72488 Sigmaringen Tel. +49 7571 72890-0 info@wis-sigmaringen.de www.wis-sigmaringen.de


IM GESPRÄCH | René Walther, Stadtpräsident von Arbon
Herr Walther, gibt es ein erstes Zwischenfazit bezüglich der „Initiative Zukunft Arbon“? Und welche weiterführenden Marketing- und Standortförderungsmaßnahmen sind geplant?
Die Initiative hat sich gut entwickelt. Es haben sich stabile Strukturen etabliert, was wichtig ist für die Partner aus der Industrie. Auf den ersten Blick mag es wie eine reine Social-Media-Geschichte wirken, aber dahinter steht ein Netzwerk, das sich regelmäßig trifft und austauscht, Stadt wie Gewerbetreibende. In der Altstadt etwa entwickelten die Ladenbetreibenden gemeinsam mit dem städtischen Arealentwickler und dem Standortförderer den "ArBon", eine Art Rabattbogen als gemeinsames Werbemittel. Wir als Stadt können Gesprächsangebote schaffen oder wie in diesem Fall mit der Übernahme der Druckkosten auch mal finanziell unterstützend wirken. Aktuell bestätigen die Ansiedlung einer neuen Firma in Arbon und möglicherweise einer zweiten den Eindruck einer guten Entwicklung. Man kann eine solche Initiative aber nicht einfach laufen lassen, sondern man muss sie immer wieder strategisch hinterfragen. Die Grundidee aber stimmt, es gibt lediglich hie und da etwas zu justieren. Was wir auf städtischer Ebene umsetzen, stößt mehr und mehr auch im ganzen Oberthurgau auf Interesse und man versucht, Vergleichbares auch auf regionaler Ebene aufzugleisen.
Finanziell gefördert wurde auch die Schifffahrtslinie nach Langenargen. Wie erfolgreich war das? Und welche touristischen Fördermaßnahmen gibt es ansonsten?
Von Juni bis September wurde die Schiffsverbindung nach Langenargen gefördert, und die Zahlen sprechen für sich. Mit 15.000 Passagieren wurde die Anzahl fast verdoppelt. Dort
lagen auch unsere Flyer aus und hingen die Plakate mit einem QR-Code, der auf den neu entwickelten Tagesplaner verweist – mit Freizeitangeboten für einen oder zwei Tage, unterteilt in Kultur, Museen, Indoor oder Kinder – je nachdem, was man möchte. Über eine Viertel Million Aufrufe über Social Media konnten wir verzeichnen. Das wollen wir weiter ausbauen. Touristisch von Belang ist auch der Erwerb der Namensrechte von „Arbori“ für die Errichtung eines Themenwegs vom Uferradweg in die Altstadt. Ziel ist es, im nächsten Sommer über den „Arbori-Weg“ Familien in die Altstadt zu lotsen.
Arbon hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt, wie geht es beim Thema Stadtentwicklung weiter?
Mit der Bebauung des Saurer-WerkZwei-Areals konnte enorm viel realisiert werden, Arbon umweht mehr als nur ein Hauch der Urbanität. Eine weitere Innenverdichtung ist die große Challenge. Laut Raumplanungsgesetz des Kantons soll im Thurgau 60 bis 70 Prozent des Wachstums in den Zentren stattfinden. Faktisch ist dort aber zu wenig Platz, um das Wachstum zu verorten. Mir ist wichtig, dass es keinesfalls zulasten der Wohnhygiene und des Ortsbildes geht. Es ist aber dennoch sehr viel im Gange. Wir haben aktuell einen Investitionsbedarf in Höhe von etwa 110 Millionen Franken. Wir sind auf dem Weg, die Planungen laufen, zum Beispiel für die Sanierung des Schlossturmes oder der Fußballplätze im Stacherholz. Bei der Sanierung des Seeufers werden die erforderlichen politischen Prozesse angestoßen. Das sind die Früchte der letzten zweieinhalb Jahre, in denen intensiv an diesen Projekten gearbeitet wurde. In der Pipeline steht auch die notwendige Sanierung der St.Gallerstrasse im Rahmen des Agglomerationsprogramms. Hier steht insbesondere

Industriecharme pur: Konzert im Presswerk Arbon
die Verzahnung unserer eigenen zweckgebundenen Sanierungsmittel und die an eine optische Aufwertung der Straße gebundenen Fördergelder des Bundes im Raum. Zudem liegt eine Betriebs- und Gestaltungsstudie für die Altstadt vor, basierend auf sämtlichen alten Planungen – was ist mehrheitsfähig, was brauchbar, was nicht. Dieses Konzept soll 2025 auf die politische Bühne kommen.
Änderungen gibt es auch beim Denkmalschutz. Um was geht es?
Bisher gab es bei der kantonalen Denkmalpflege das sogenannte „Hinweisinventar Bauten“. Dieses System der Klassifizierung wird ab 2027 abgelöst durch das neue „Inventar der erhaltenswerten und geschützten Objekte“, IDEGO. Maßgeblicher Unterschied ist, dass für alle kommunalen Objekte – unabhängig von der Empfehlung des Kantons – die Gemeinden verantwortlich sind, sobald die Objekte in die Kategorie „von kommunaler Bedeutung“ eingereiht sind. Da nicht alle Gemeinden über das entsprechende Know-how verfügen, sollen sogenannte regionale Fachbeiräte mit noch ungeklärten Befugnissen geschaffen werden. Meiner Meinung nach aber gehört der Denkmalschutz als Raumplanungsthema in die bestehenden Strukturen integriert. Eine neue Behörde dagegen wäre nicht „Schweiz-like“.
Welche Bedeutung hat das UNICEF-Label „Kinderfreundliche Gemeinde“ für Arbon?
Konkrete Beispiele sind das „Spielstädtchen“, der Arbori-Weg, ein von Eltern und Jugendlichen organisiertes Kino oder Workshops mit Jugendlichen. Bei Letzteren war ich bei der finalen Präsentation der von den Teilnehmenden durchgeführten Projekte dabei, das war sehr eindrücklich. Das ist gelebte Schweizer Demokratie. Dazu gehört auch, dass die Beteiligten erkennen, dass nicht alles umsetzbar ist. Ebenfalls auf unserer Agenda stehen ein Jugendraum und die Modernisierung der Bibliothek. Wir unterstützen zudem den Familienverein, den junge Mütter gegründet haben, wenn es etwa darum geht, Familien zu vernetzen. Wir haben als eine der ersten Städte im Thurgau die sogenannten Betreuungsgutschriften entgegen der sonst in der Schweiz üblichen objektorientierten Förderung eingeführt. Wir möchten nicht in Beton investieren, sondern attraktive Angebote für unsere Familien finanzieren. Es kommt so langsam auch auf die kantonale wie nationale Agenda. Ich weiß es aber zu schätzen, dass man in der Schweiz sehr auf Qualität achtet. Volkswirtschaftlich macht sich das bezahlt, davon bin ich überzeugt. Dazu gehört auch
der Ausbau der Schulen. In Arbon steigen die Schülerzahlen weiterhin rapide an. Man kann also klar sagen, dass das UNICEF-Label unbestritten Einfluss auf unsere Handlungen ausübt.
An den Arboner Ortseingängen steht „Museums- und Kulturstadt“. Wie ist Ihr ganz persönlicher Eindruck vom hiesigen Kulturleben?
Am Schweizer Bodenseeufer gibt es keine andere Stadt, die mit einem vergleichbar großen kulturellen Angebot aufwarten kann wie Arbon, insbesondere bei der Musik. Wir sind sozusagen das Montreux des Bodensees. Ich persönlich freue mich sehr auf die Wintersaison mit dem Presswerk – mit unglaublichen Acts, man könnte jedes Wochenende dorthin gehen. Im Sommer hatten wir die Arbon Classics, das Seenachtsfest, zweieinhalb Wochen das Kantonalturnfest, wir hatten die Daydance-Events, das Openair-Kino und nicht zuletzt das SummerDays-Festival mit 24.000 Besucherinnen und Besuchern. Wir haben tolle Museen, und auch der Start des ArboParks, eines der größten Indoor-Freizeitparks der Schweiz, verlief erfolgreich. Auf unserem Tagesplaner-Flyer befindet sich im Übrigen mit einem GoKart-Fahrer ein Motiv aus dem Park, so konnten wir das ebenfalls etwas pushen.
Die Realisierung eines neuen Historischen Museums des Kantons Thurgau in Arbon wird sich voraussichtlich um Jahre hinauszögern. Sehen Sie das als Rückschlag? Fakt bleibt, dass wir das Museum unbedingt an diesem Standort haben möchten. Und auch die Regionalplanungsgruppe Oberthurgau steht dazu. Es wird zumindest eine eingeschränkte Nutzung des Gebäudes für einen Museumsbetrieb geben, das schafft eine gewisse Art der Etablierung des Standortes. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich verstehe, dass Leute enttäuscht sind. Die finanzielle Lage ist leider angespannt, überall. Aber wer weiß, plötzlich sprudeln die Nationalbanken wieder und dann sieht die ganze Welt anders aus.

Stadt Arbon
Hauptstrasse 12, CH-9320 Arbon Tel. +41 71 447 61 61
stadt@arbon.ch www.arbon.ch
www.zukunftarbon.ch



0721 909 809 08 www.greenplaces.de
IMPRESSUM
ISBN: 978-3-910631-51-9
Das Wirtschaftsmagazin Bodensee 2025 ist eine Publikation der Labhard Medien GmbH. Das Wirtschaftsmagazin Bodensee ist ein Magazin zur Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit und dient der Darstellung des internationalen Wirtschaftsraumes der Vierländerregion Bodensee sowie der Präsentation von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen dieser Region. Das Wirtschaftsmagazin erscheint jährlich.
Labhard Medien GmbH
Am Seerhein 6
D-78467 Konstanz Tel. +49 7531 90710 verlag@labhard.de www.labhard.de
Geschäftsführung
Steven Rückert (srueckert@labhard.de)
THINK
Flexible Flächen ab 171 m2 in unserem Gewerbe-Areal für KMUs inklusive Netzwerkeffekt. Jetzt unsere Standorte in Gottmadingen und Stockach besichtigen.
Handwerk Büro


DienstleistungProduktion

Herausgeber
Markus Hotz (m.hotz@akzent-magazin.com)
Produktmanagement und Mediaberatung
Stephan Bickmann (sbickmann@labhard.de)
Redaktion
Holger Braumann (hbraumann@labhard.de)
Vertrieb
Sandra Gasanow (sgasanow@labhard.de)
Gestaltung/Satz
Brigitte Otto (brigitte.otto@buero46.de)
Helga Stützenberger (stuetzenberger@angrik.de)
Druck
Westermann Druck GmbH, D-38104 Braunschweig
Fotos
Wenn nicht anders vermerkt, wurden uns die Fotos von den betreffenden Kommunen, Organisationen und Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Titelfoto
Michael Häfner
Alle Rechte vorbehalten
Labhard Medien GmbH. Namentlich gekennzeichnete Beiträge können, müssen aber nicht die Meinung der Herausgeber wiedergeben.
Redaktionsschluss 01. Dezember 2024

Alle lieben Luxus. Die Outletcity Metzingen versteht es, Shopping auf höchstem Stil-Niveau zu bieten, ohne dabei das Portemonnaie zu strapazieren. Preisvorteile von bis zu -70 %** machen Luxus für alle erlebbar und die Flagship Outlet Stores der Premium- und Luxusmarken damit zu angesagten Hot Spots.
Mit unserem VIP Special profitieren Sie von 10 %*** Preisvorteil bei über 100 teilnehmenden Marken in Metzingen. Einfach outletcity.com/vip-WIMAG25 aufrufen, Code erhalten und Shopping-Vergnügen starten.

Geberit AquaClean Alba bietet für die Reinigung des Pos die einzigartige Geberit WhirlSprayDuschtechnologie. Das neue Dusch-WC besitzt die Qualitätsmerkmale von Geberit zu einem attraktiven Einstiegspreis. Weitere Infos auf www.geberit.de/alba.