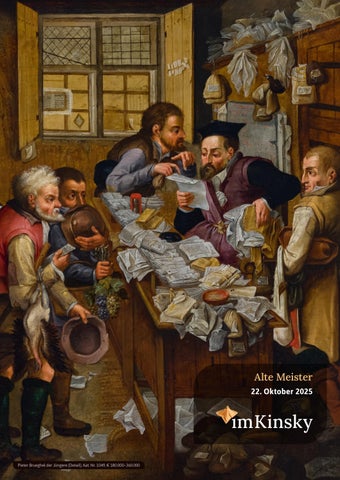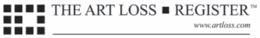Alte Meister 22. Oktober 2025






Alte Meister
Auktion 22. Oktober 2025 15 Uhr
Zeichnungen & Druckgrafik
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Auktion 22. Oktober 2025 ab 17 Uhr
Besichtigung ab 15. Oktober
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–17 Uhr
Nehmen Sie ganz einfach an der Auktion teil!
» im Saal.
» am Telefon.
» mit einem schriftlichen Kaufauftrag.
» Über unsere Online-Plattform: auction.imkinsky.com
Unsere Sensalin bietet Ihnen ein Rundum-Service!
Monika Uzman, +43 1 532 42 00-22, +43 664 421 34 59, monika.uzman@gmail.com
ExpertInnen | Specialists

Mag. Kareen M. Schmid T +43 1 532 42 00-20 schmid@imkinsky.com

Michael Kovacek T +43 1 532 42 00 M +43 664 24 04 826
Assistenz | Assistance

Maximiliane Seng, MA T +43 1 532 42 00-33 seng@imkinsky.com

Kimberly Fetko, MA T +43 1 532 42 00-28 fetko@imkinsky.com
Zustandsberichte & Beratung | Condition Reports & Consultation
Mag. Kareen M. Schmid, T +43 1 532 42 00-20, schmid@imkinsky.com
Kaufaufträge | Order Bids
T +43 1 532 42 00, office@imkinsky.com
Sensalin | Broker
Monika Uzman, T +43 1 532 42 00-22, M +43 664 421 34 59

1001
Tiroler Meister
Verkündigung, um 1480/90
Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 100 x 75 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 10.000–20.000

1002
Tiroler Meister
Geburt Christi, um 1480/90
Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 100 x 75 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 10.000–20.000

1003
Künstler des 16. Jahrhunderts
Kreuztragung Christi
Öl auf Holz; gerahmt; 48 x 58,5 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 3.500–7.000

1004
Martin Schongauer Nachfolger
(Colmar 1445–1492 Breisach)
Gefangennahme Christi, um 1500 Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 57 x 50,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 3.500–7.000
Martin Schongauer wurde aufgrund seiner überaus detailreichen und feinen Malerei bereits zu Lebzeiten „Martin Schön“ und „Hübsch Martin“ genannt. Er war jedoch auch besonders als virtuoser Kupferstecher bekannt und verbreitete damit seine Kompositionen einem breiten Publikum. Auch vorliegendes Gemälde basiert auf einem Stich Schongauers aus seinem um 1480 zu datierenden Passionszyklus (vgl. National Gallery Washington, Inv. Nr. 1941.1.44). Das zeitnah entstandene Werk ist typisch für die Renaissancemalerei aus dem oberrheinischen Gebiet, welches stark von der Malerei in den Niederlanden beeinflusst wurde. Besonders besticht das Gemälde durch seine kräftigen Farben und die expressiven Figuren, die die Szene für den Betrachter besonders greifbar machen.

Wolf Huber Umkreis
(Feldkirch 1490–1553 Passau)
Anna Selbdritt, um 1520/30 Öl auf Holz; gerahmt; 48 x 58,5 cm
Provenienz
Privatsammlung, Wien; Dorotheum Wien, 31. März 2009, Lot 242; Privatsammlung, Österreich
Ludwig Meyer, Archiv für Kunstgeschichte hat 2009 das Gemälde in die unmittelbare Umgebung von Wolf Huber eingeordnet und es um 1520/1530 datiert.
€ 5.000–10.000
Die „Anna Selbdritt“ aus dem Umkreis des österreichisch-deutschen Renaissancemalers Wolf Huber (1490–1553) zeigt eine klassische Darstellung, die durch ihre feinen Details besticht. Das Bild zeigt das Christuskind mit seiner Mutter Maria und der Großmutter Anna, zu der er sich liebevoll wendet. Über der Gruppe thront Gottvater als Weltenherrscher, begleitet vom Heiligen Geist. Neben der religiösen Signifikanz des Geschehens betont der Maler auch die Schönheit des Irdischen: ornamentale Tapeten und fein gemasertes Holz sowie die feinen Gewänder der Frauen verleihen der Szene eine sinnliche, fast greifbare Präsenz.

1006
Deutsche Schule
Dornenkrönung, um 1500
Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 69 x 65 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 7.000–14.000
1007
Flämische Schule
Dämonenszene, 16./17. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 66 x 88,5 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 10.000–20.000



Frans Francken III.
(Antwerpen 1607–1667 Antwerpen)
Blumenkranz mit Madonna, Kind und Engeln, umrahmt von vier Putten
Öl auf Kupfer; gerahmt; 35 x 28 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 18. September 1973, Lot 17 (Farbabb. Tafel V, Abb. Tafel 8; im Katalog falsches Medium angegeben: Öl auf Holz, als Jan Brueghel der Jüngere (1601 – 1678) und Frans Francken der Jüngere (1581 – 1642)); seither österreichischer Privatbesitz
Wir danken Dr. Ursula Härting, Hamm, für Ihre Hilfe bei der Katalogisierung (anhand der Besichtigung im Original).
€ 8.000–16.000
Als Sohn Frans Franckens II. (gen. der Jüngere, 1581–1642) und Elisabeth Placquets wurde Frans Francken III. bereits in eine der berühmtesten Malerdynastien Antwerpens im beginnenden 17. Jahrhundert geboren. In der florierenden Werkstatt des Vaters wurden nicht nur die Söhne Frans, Hieronymus und Ambrosius Francken III. ausgebildet, sondern auch zahlreiche weitere Mitarbeiter angestellt. Gemäß der damals verbreiteten Arbeitspraxis eines Gemeinschaftswerkes, an welchem mehrere spezialisierte Maler beteiligt waren, unterhielt die Francken-Werkstatt enge Kontakte zu jener von Jan Brueghel dem Älteren und dessen Sohn, Jan Brueghel dem Jüngeren (1601–1678), aber auch zu anderen Blumenmalern wie Andries Daniels (geb. 1580) oder Philipp de Marlier (vgl. Ursula Härting, Frans Francken der Jüngere (1581–1642). Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1989, S. 264ff., WVZ-Nr. 117–127). Dieser überlieferten Tradition ist wohl auch die einstige Zuschreibung des vorliegenden Werkes an Frans Francken den Jüngeren und Jan Brueghel den Jüngeren geschuldet. Der seit 50 Jahren in Privatbesitz befindliche Blumenkranz mit Maria und Kind, Engeln und Putten kann jedoch nun gänzlich einer einzigen Künstlerhand zugewiesen werden – jener von Frans Francken III. Das Medaillon mit dem auf Mariens Schoß stehenden Christuskind, welchem von dem Engel links Speisen dargeboten werden, während der Engel rechts auf einem Streichinstrument musiziert, zeugt von seinem am Vater geschulten, aber lockereren Pinselstrich. Auch sprechen die Komposition bis in die Zwickel belebenden vier Putten durch ihre Bewegtheit und detaillierte Ausformulierung der Muskelpartien (ebenso wie im Christuskind) für die meisterliche Beherrschung der Figurenmalerei. Frans Francken III. ist jedoch ebenfalls durch eine Quelle aus dem Jahr 1662 als Blumenmaler dokumentiert. So schreibt D.F. Hagens (wohl Daniel Hagens, ein weiterer ehemaliger Lehrling Frans Franckens II.) an den Kunsthändler G. Forchoudt: „Ich bitte Sie, einmal nachzufragen, ob Herr Francq (Frans Francken III.), der Maler in der Camerstraet neben den Augustinern (der Augustinerkirche), das Blumenstück für mich gemacht hat, um das ich ihn gebeten habe, wofür ich ihn (noch) bezahlen muss.“ („Ick bid Ul. Eens te vragen aen Monsr Francq den schilder in de Camerstraet naest den Augusteynen oft hij een stuckien van blommen voor my gemaeckt heeft als ick hem gebeden hebbe op dat ik hem moet betalen.“) Mit „Monsr Francq“, kann unzweifelhaft nur Frans Francken III. identifiziert werden, zumal dieser nach dem Tod der bereits verwitweten Mutter nach dem Jahre 1655 in der Camerstraat ansässig war (vgl. Härting 1989, S. 185f., S. 218 Fußnote 890). Das vorliegende zu einem Kranz gebundene Blumenbouquet besticht neben seiner exzellenten Ausführung durch seine botanische Vielfalt: so sind eher selten in reinen Blumenstillleben zu findende Haselnüsse sichtbar, sowie auch daneben dekorativ rot-marmorierte Blätter. Des Weiteren werden die Blumen durch eine Vielzahl von Insekten, wie Schmetterlingen, Raupen und gar Ameisen belebt. Davon wie gekonnt die in den Ecken positionierten, geflügelten und von Stoffschärpen umspielten Putten zugleich in den floralen Kranz integriert sind, zeugt die Handhaltung der beiden oberen Putten: während der Linke mit einem Fingerzeig den Betrachter auf die kleinen, zwischen größeren Blüten versteckten Vergissmeinnicht aufmerksam macht, scheint der Rechte gar selbst ein Sträußchen in der Hand zu halten. Auch durch die Einbettung der unteren Putten an den Randblättern des Kranzes und deren verweisende Haltung auf die Mittelszene werden Figurendarstellung und Blumenkranz vom Künstler zu einer Einheit verbunden.

1009
Flämischer Meister
Waldlandschaft mit Venus und Adonis, 17. Jahrhundert
Öl auf Kupfer; gerahmt; 25,5 x 38 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 4.000–8.000
Dargestellt ist die aus der antiken Mythologie überlieferte Szene des sterbenden Adonis, der in den Armen der trauernden Venus liegt. Die Szenerie ist in eine dichte, waldreiche Landschaft eingebettet, die den Kontext der Jagd hervorhebt. Im Hintergrund ist ein Hund erkennbar, dessen Präsenz die narrative Bezugnahme auf die Jagd nochmals verstärkt und den Ablauf der Erzählung, den tragischen Ausgang der Jagd Adonis', sinnfällig macht. Die zentrale Figur des verwundeten Jünglings mit entblößter Brust, von einem Pfeil getroffen, und die zärtlich über ihn gebeugte weibliche Gestalt mit gelöstem Haar und rotem Gewand verweisen auf das ikonografisch vielfach variierte Thema aus Ovids Metamorphosen (10, 710–739). Gemäß der Überlieferung findet Adonis den Tod bei der Jagd, ursprünglich durch einen Eber, in späteren Interpretationen jedoch zunehmend symbolisch durch einen Pfeil, wie auch in vorliegendem Werk, dargestellt.


1010
Künstler des 17. Jahrhunderts
Stillleben (Pendants) Öl auf Holz; gerahmt; je ca. 24,5 cm Durchmesser
Provenienz deutsche Privatsammlung
€ 2.500–5.000

1011
Jan Lievens Nachfolger
(Leiden 1607–1674 Amsterdam)
Die Wahrsagerin, wohl 17. Jahrhundert Öl auf Leinwand; gerahmt; 63 x 62 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 7. Oktober 1998, Lot 260; österreichischer Privatbesitz
€ 5.000–10.000
Das Motiv der „Wahrsagerin“ geht auf Jan Lievens zurück (Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Inv.-Nr. II.300). Das vorliegende Gemälde orientiert sich daran, weicht jedoch in einzelnen Details ab: So fehlt die dunkelhäutige Dienerin im Hintergrund, und auch der geflochtene Korb in der linken unteren Ecke wurde durch den verkleinerten Bildausschnitt entfernt. Dadurch richtet sich der Blick stärker auf die zentrale Figurengruppe. Das Motiv basiert auf Miguel de Cervantes’ Novelle „La gitanilla“ („Das Zigeunermädchen“), die von der fünfzehnjährigen Preciosa erzählt, die ihrer Familie entrissen und von einer vermeintlichen Großmutter aufgezogen wird. Im Zentrum des Bildes ist Preciosa, silberblond mit aufmerksamem Blick, zu erkennen. Während ihre Großmutter einer adeligen Dame die Zukunft deutet, folgt sie den Worten gebannt, zugleich richtet sich ihr Blick zum geöffneten Fenster auf der linken Seite. Draußen wartet bereits der Mann auf sie, in den sie sich im Lauf der Geschichte verlieben wird.
Besonders eindrucksvoll ist das Spiel von Licht und Schatten. Die Hell-Dunkel-Kontraste betonen nicht nur die Unterschiede zwischen den sozialen Ständen, sondern verleihen den Figuren auch eine klare Präsenz im Raum.
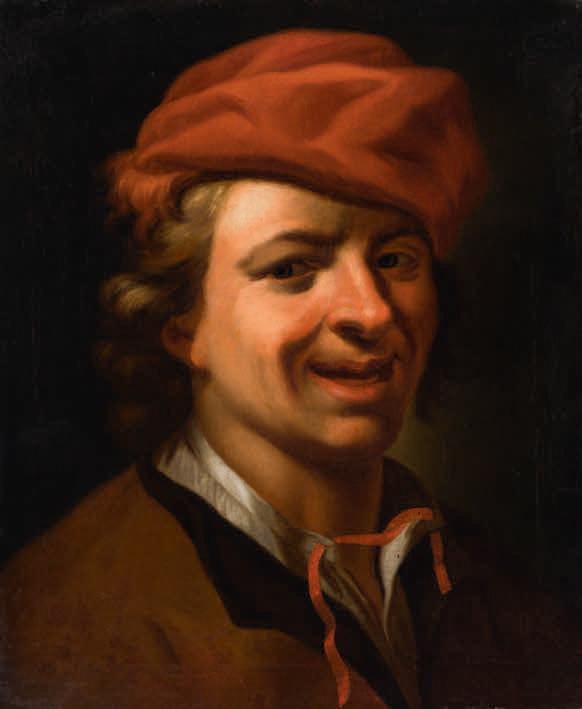

1012
Deutsche Schule
Mann mit roter Kopfbedeckung, 18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 53 × 43,5 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 19./28. Juni 1984, Lot 271; Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000
1013
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Blumenstillleben
Öl auf Leinwand; gerahmt; 70 × 52 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 1.000–2.000

1014
Johann Georg de Hamilton
(Brüssel 1672–1737 Wien)
Die Jagdhündin Adam Franz Fürst von Schwarzenberg (1680–1732), um 1700
Öl auf Leinwand; gerahmt; 24 x 28 cm
Rechts unten signiert und datiert, z.T. undeutlich: J. G. Hamilton 170(0)
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000
Johann Georg de Hamilton (1672–1737) zählt zu den bedeutendsten Tiermalern des österreichischen Barocks. Geboren in eine schottisch-niederländische Künstlerfamilie, spezialisierte er sich, wie bereits sein Vater, auf Tier- und Stilllebenmalerei. Im Jahr 1712 erfolgte unter Kaiser Karl VI. (1685–1740) seine Ernennung zum kaiserlichen Kammermaler, wodurch er fortan zum festen Kreis der Hofkünstler zählte. Neben prestigeträchtigen Aufträgen für den Wiener Hof, darunter die Ausgestaltung des Rösselzimmers in Schloss Schönbrunn, arbeitete de Hamilton auch für einflussreiche Adelsfamilien wie die Fürsten von Liechtenstein und Schwarzenberg, deren Jagdleidenschaft er mit präzisem Blick und malerischer Virtuosität festzuhalten wusste.
Das vorliegende Tierporträt zeigt eine Jagdhündin in leicht vorgebeugter Haltung, die ihren Kopf aufmerksam dem Betrachter zuwendet. Sie kann als die persönliche Jagdbegleiterin von Adam Franz Fürst von Schwarzenberg (1680–1732) identifiziert werden. In nahezu identer Pose ist die Hündin in de Hamiltons großformatigen, 1708 datierten Gemälde „Ende der Hasenjagd“ (Öl auf Leinwand; 128 x 238 cm) ebenfalls porträtiert (vgl. Nationales Institut für Kulturerbe, Tschechien, Inv.-Nr. HL 636).


1015
Franz Christoph Janneck (Graz 1703–1761 Wien)
Zwei Heiligendarstellungen
Öl auf Kupfer; gerahmt; je 22 x 17 cm
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 3.500–7.000

1016
Johann Josef Karl Henrici
(Schweidnitz 1737–1823 Bozen)
Predigt des Johannes Öl auf Leinwand; gerahmt; 70,5 x 95,5 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 3.500–7.000
Der Tiroler Maler Johann Josef Karl Henrici, ursprünglich aus Schlesien, avancierte zu einem bedeutenden Barockmaler in Tirol. Er ist vor allem für seine zahlreichen Heiligenbilder bekannt, darunter das Herz-Jesu-Gemälde der Bozener Stadtpfarrkirche. Doch auch Landschaftsdarstellungen zählen zu seinem Œuvre. In „Die Predigt des Johannes“ verbinden sich Elemente der Landschaftsmalerei mit der Geschichte des Neuen Testaments. In der Szene erhebt Johannes den Arm zu der Predigt des Wort Gottes, während die Zuhörenden mit Staunen, reger Diskussion und Faszination auf die Predigt reagieren. Eingebettet in eine idyllische Felsenlandschaft offenbart Henrici hier eindrucksvoll sein künstlerisches Können zwischen Landschaftsmalerei und christlicher Ikonografie.

1017
Peter Paul Rubens Nachfolger
(Siegen 1577–1640 Antwerpen)
Venus, Mars und Cupido
Öl auf Holz; gerahmt; 41 x 24,5 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 3.000–6.000

1018
Cornelisz van Poelenburg
(Utrecht 1586–1667 Utrecht)
Anbetung der Könige
Öl auf Holz; gerahmt; 42 x 32,5 cm
Signiert links unten: C(o) Poelemburg
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 2.500–5.000
Die vorliegende Komposition, welche die Anbetung der Könige darstellt, ist in verschiedenen, aber einander in Aufbau und Maß nahestehenden, Varianten mehrfach bei Cornelisz van Poelenburg nachweisbar. Beispielsweise befindet sich ein vergleichbares Werk in einer amerikanischen Privatsammlung (Vgl. Nicolette Sluijter-Seijffert, Cornelis van Poelenburch. 1594/5–1667. The paintings, Amsterdam 2016, S. 113, S. 301, WV-Nr. 33 (Abb. 110)) sowie eine Variante im Agnes Etherington Art Centre der Queen’s University in Kingston (Vgl. SluijterSeijffert 2016, S. 302, WV-Nr. 36).
Frans Francken der Jüngere
(Antwerpen 1581–1642 Antwerpen)
Die Göttin Diana – als dreigestaltige Mondgöttin der Fruchtbarkeit, der Jagd und der Hexerei, um 1606 Öl auf Kupfer; gerahmt; 50,5 x 66,5 cm Rückseitig die frühe (bis 1606) verwendete Schlagmarke des Kupferplattenherstellers Pieter Stas.
Provenienz
Dorotheum, Wien, 17. Oktober 2017, Lot 34; österreichische Privatsammlung
Gutachten von Dr. Ursula Härting, Hamm, 22. Juli 2017, liegt bei.
€ 25.000–50.000
Das vorliegende Gemälde ist eine in der Malerei des frühen 17. Jahrhunderts einzigartige Darstellung der „Göttin Diana – als dreigestaltige Mondgöttin der Fruchtbarkeit, der Jagd und der Hexerei“. Gerade in seiner Frühzeit, um seine Freimeisterschaft im Jahr 1605 herum, entwickelte Frans Francken der Jüngere außergewöhnliche, bis dahin ikonographisch unbekannte Darstellungen, wie beispielsweise Ballgesellschaften, Affen-und Hexenküchen, Szenen vom Hexensabbat und gemalte Galerieinterieurs.
Das zentrale Bildthema, die Göttin Diana, ist hier ihre Nacktheit zur Schau stellend nur mit einem Tuch bedeckt am Ufer eines Flusses dargestellt. Sie ist umgeben von teils ebenfalls unbekleideten, aber auch teils elegant gekleideten Frauenfiguren. Gemäß ihrer traditionellen Darstellung in der Kunst, als Göttin der Jagd, hält sie einen Pfeil in der Hand und zwei ihrer Jagdhunde sitzen bei ihr, während im Hintergrund Jäger einen Hirsch hetzen. Dass Diana, die Herrin über Wälder und Haine, jedoch keine Eindringlinge in ihrem Domizil duldet, unterstreicht die Erzählung von Actäon: Nachdem der junge Jäger Diana und ihre Nymphen beim Baden beobachtet hatte, verwandelte die Göttin ihn rücksichtslos in einen Hirsch, der von seinen eigenen Hunden zerfetzt wurde. Auf diese dunkle, zügellose Seite ihres Charakters deutet auch das Symbol der Nacht: die Mondsichel auf ihrem gelösten Haar. Nächte galten in der Zeit Frans Franckens als unheilbringend. So ist Diana – wie ihre durch Nacktheit, Musik oder offenherzige Kleidung verführerisch erscheinenden Begleiterinnen – in diesem Gemälde nicht nur als Symbol der Verführungskunst, sondern auch als „Succubus“, ein Dämon, zu deuten. Die Vorstellung von weiblichen „Succubi“ wurde seit dem Mittelalter europaweit tradiert. Diese Hexen sollten der Überlieferung nach die Schlafenden vergewaltigen, um sich zu vermehren, damit sie vom katholischen Glauben abfallen und sich zu Satan und Magie bekehren. In der althergebrachten Glaubensvorstellung galt Diana als heidnische Göttin, der unzählige Frauen in einer Gesellschaft aus Teufelsjüngerinnen (societas Dianae) folgen würden. Wie präsent dieser Glaube zu Lebzeiten Frans Franckens war, unterstreicht ein Dekret zur Hexenverfolgung, welches im Jahre 1606 von den in Brüssel residierenden erzkatholischen Habsburgern, den Erzherzögen Albrecht und Isabella, erlassen wurde. So verwundert es kaum, dass sich der Künstler eben in jener Zeit bevorzugt mit Hexenthemen beschäftigt und mehrere um 1604/06 entstandene „Hexenküchen“ stilistisch und motivisch große Nähe zu vorliegendem Gemälde aufweisen. Neben den vielen erotischen Nymphen, befinden sich jedoch am linken Bildrand bürgerlich gekleidete, junge Frauen bei einer üppigen gedeckten Tafel. Sie verkörpern ebenfalls eine „Diana-Gesellschaft“ und zeigen damit die positive Seite Dianas als Göttin der Frauen auf. Sie spielen auf die besonderen Anliegen junger Frauen, wie Kinderwunsch, leichte Entbindung oder gute Ehe, an – Wünsche, um deren Erfüllung ebenfalls Diana gebeten wurde.
Frans Francken deutet in diesem Gemälde also den traditionellen, literarischen Begriff der „societas Dianae“ zeitgenössisch um und versetzt ihn anschaulich in seine eigene Realität. Der Künstler führt hier vor Augen wofür man Diana, die Mondgöttin, zuständig hielt: sie ist offensichtlich Jägerin, Herrscherin der Hexen, aber auch Göttin der Fruchtbarkeit. Gemälde mit derart komplexen Inhalten wurden für Auftraggeber aus einem humanistisch gebildeten Umfeld geschaffen – also Theologen, Gelehrte oder Persönlichkeiten des Brüsseler Hofes. Diskurse vor Gemälden durch Kunstkenner gehörten damals zur Aufgabe solch kenntnisreicher, im besten Sinne anregender Kompositionen (vgl. ausführliches Gutachten von Dr. Ursula Härting, 22. Juli 2017).


1021
Flämische Schule
Der Sündenfall, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 28 × 38,5 cm
Provenienz
Privatsammlung, Österreich
€ 3.000–6.000
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Alchemistenszene Öl auf Leinwand; gerahmt; 29 × 34,5 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 1.000–2.000


1022
Theodor van Thulden zugeschrieben
('s-Hertogenbosch 1606–1669 's-Hertogenbosch)
Raub der Sabinerinnen
Öl auf Leinwand; gerahmt; 70 x 94 cm
Provenienz
Dorotheum Wien, 12. Dezember 2011, Lot 112; Privatsammlung, Österreich
€ 10.000–20.000
Das vorliegende Gemälde, das den Raub der Sabinerinnen darstellt, ist ein Beispiel für ein wiederkehrendes Motiv in der europäischen Kunst seit der Renaissance. Dieses Motiv bot den Künstlern eine Gelegenheit, Bewegung, Pathos und Konflikt in Szene zu setzen. Auch Theodor van Thulden (1606–1669) greift in seiner Komposition auf diese Tradition zurück und entfaltet das Geschehen mit einer dramatischen Bildsprache, die unübersehbar auf die Schule seines Lehrmeisters verweist.
Van Thulden, ein bedeutender flämischer Maler und Kupferstecher des Barock, erhielt seine künstlerische Ausbildung in Antwerpen in der Werkstatt von Peter Paul Rubens (1577–1640), dessen kraftvolle Formensprache sein Schaffen nachhaltig prägte. Bereits 1626 trat er als Vorsteher der St. Lukasgilde hervor, bevor er in Paris die Werke der Schule von Fontainebleau studierte, deren elegante Figurenauffassung sich mit den Rubens’schen Impulsen in seinem Stil vereinte. 1635 heiratete er Maria van Balen, die Tochter des Malers Hendrick van Balen I (1575–1632) und zugleich Patenkind Rubens’, wodurch er sich auch familiär in den Kreis der Antwerpener Künstlerdynastie einband. In diesem Spannungsfeld zwischen französischer Eleganz und flämischer Monumentalität entwickelte van Thulden eine Bildsprache, die in dem hier gezeigten Historiengemälde exemplarisch zum Ausdruck gelangt.


1023
Raffaello Sanzio, genannt Raphael, Nachfolger
(Urbino 1483–1520 Rom)
Heilige Familie aus dem Hause Canigiani
Öl auf Holz; ungerahmt; 23 × 21 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 3.000–6.000
1024
Spanische Schule
Ein Heiliger spendet die Eucharistie, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz; gerahmt; 64 × 53,5 cm auf der Rückseite der Platte ein Basreliefwappen des Ordens der Karmeliterinnen
Bezeichnet links unten
z.T.: Zurba... / Fr... / 1670
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 1.500–3.000

Rückseite

1025
Venezianische Schule
Ansicht des Arsenale in Venedig, um 1800
Öl auf Leinwand; gerahmt; 72 × 96 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 3.000–6.000
1026
Venezianische Schule
Kanalansicht Santa Maria di Nazareth in Venedig, um 1800
Öl auf Leinwand; gerahmt; 72 × 96,5 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 3.000–6.000

1027
Andrea Piccinelli, genannt Andrea del Brescianino (Brescia 1485–1545 Florenz)
Leda mit dem Schwan Öl auf Holz; gerahmt; 69 x 130 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 35.000–70.000
Andrea Piccinelli (1485–1545), genannt del Brescianino, ist erstmals im Jahr 1507 in Siena belegt, wo er zunächst für die Compagnia di San Gerolamo tätig war. Obwohl er in Siena ansässig war, zeigen seine Werke deutliche stilistische Einflüsse der florentinischen Malerei. Das vorliegende Gemälde thematisiert die erotisch aufgeladene mythologische Szene von Leda und dem Schwan, in der Zeus, in Tiergestalt, Leda verführt. Dieses Sujet erlebte in der italienischen Malerei des Cinquecento, angeregt durch die Bildtradition der Antike, eine erneute künstlerische Aufmerksamkeit und wurde insbesondere aufgrund seiner sinnlich-mythologischen Dimension vielfach aufgegriffen. Die vorliegende Komposition zeigt drei der vier mythologischen Kinder Ledas und verbindet sinnliche Darstellung mit mythologischer Erzählung. Besonders auffällig ist die kompositorische Nähe zu einem anderen bekannten Werk des Künstlers, das 2000 bei Christie’s in London versteigert wurde (13. Dezember 2000, Lot 60). Auch in diesem Werk ist die Göttin Venus in vergleichbarer Haltung dargestellt. In beiden Bildern nimmt die weibliche Figur mit entblößtem Körper selbstbewusst den Blick des Betrachters auf, während sie sich elegant auf den rechten Arm stützt und den Bildraum dominiert.


Jean Pillement Umkreis (Lyon 1728–1808 Lyon)
Landschaft mit Hirtenszene (Pendants) Öl auf Holz; gerahmt; je 27 x 36 cm
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 8.000–16.000


Künstler des 17. Jahrhunderts
Heilige Familie mit Johannesknaben Öl auf Leinwand; gerahmt; 94 x 77,5 cm
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000

1030
Giacomo Francesco Cipper, genannt il Todeschini, zugeschrieben
(Feldkirch 1664–1736 Mailand)
Mädchen mit Vogelkäfig
Öl auf Leinwand; gerahmt; 42 x 33,5 cm
Monogrammiert auf dem Kopftuch des Mädchens: F. C
Provenienz
Dorotheum Wien, 9. Juni 1979, Lot 26, Tafel 13; österreichischer Privatbesitz
€ 5.000–10.000

1031
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Waldlandschaft mit Wanderern Öl auf Holz (Tondo); gerahmt; Durchmesser 16 cm
Provenienz
Neumeister, München, 2. November 1988, Lot 350; Deutsche Privatsammlung
€ 800–1.500

1032
Leonardo Coccorante zugeschrieben
(Neapel 1680–1750 Neapel)
Südlicher Hafen mit antiker
Säulenarchitektur
Öl auf Kupfer (Tondo); gerahmt; ca. 13,5 cm (Durchmesser)
Provenienz
Neumeister, München, 28. Juni 1995, Lot 440; Deutsche Privatsammlung
€ 1.000–2.000


Leonardo Coccorante zugeschrieben
(Neapel 1680–1750 Neapel)
Küstenansichten mit antiker Säulenarchitektur (Pendants)
Öl auf Kupfer; gerahmt; je 9,5 x 13,5 cm
Provenienz
Deutsche Privatsammlung
€ 2.500–5.000

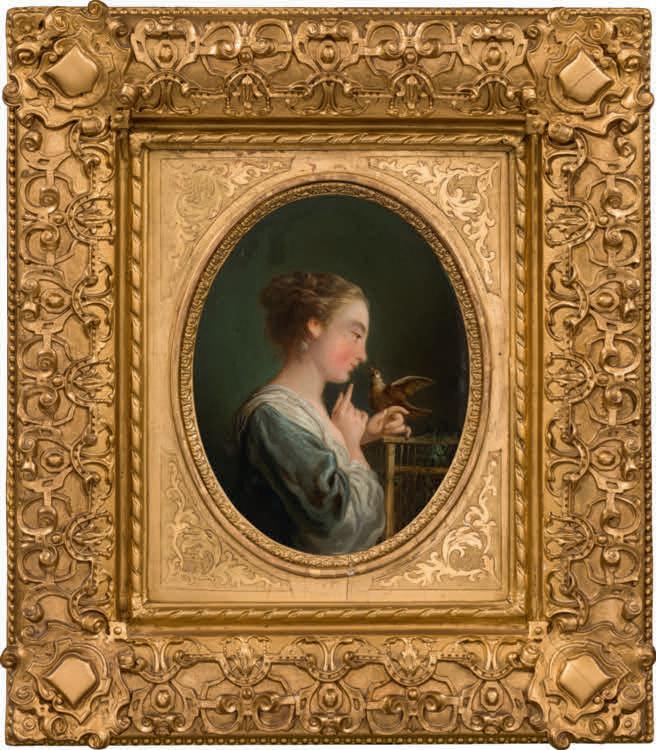
1034
Josef Ziegler
(Wien 1785–1852 Wien)
Bildnis des Grafen Stefan Illeshazy (1762–1838) in Magnatentracht mit Goldenem Vlies und Großkreuz des Stephansordens, 1815
Öl auf Kupfer; gerahmt; 18 × 13,5 cm
Signiert und datiert am rechten Rand: Ziegler pinx. 1815
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 1.000–2.000
1035
Francois Boucher Nachfolger
(Paris 1703–1770 Paris)
Mädchen mit Vogel Öl auf Holz; gerahmt; 22 × 17 cm (oval)
Signiert und datiert rechts unten: E.(G). Colbert 1864
Provenienz Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000

1036
Joos de Momper Werkstatt
(Antwerpen 1564–1635 Antwerpen)
Hügelige Landschaft mit weitem Gewässer und Staffage, wohl um 1620/30
Öl auf Holz; parkettiert; gerahmt; 40 x 59,5 cm
Provenienz
Wiener Privatbesitz
€ 2.000–4.000
Joos de Momper (1564–1635) gilt als einer der herausragenden flämischen Landschaftsmaler, der den Übergang von den manieristischen Weltlandschaften zur naturalistischen holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts widerspiegelte. Seine Werke umfassen sowohl Fantasielandschaften, die aus erhöhter Perspektive betrachtet werden, als auch solche mit einem typischen manieristischen Farbverlauf von Braun im Vordergrund zu Grün und Blau im Hintergrund. Für die figürliche Staffage arbeitete er häufig mit spezialisierten Antwerpener Malern zusammen, beispielsweise mit Jan Brueghel dem Älteren (1568–1625) und Jan Brueghel dem Jüngeren (1601–1678). Unter seinem Einfluss und in der Werkstatt arbeiteten Mitarbeiter, aber auch Familienmitglieder wie sein Sohn Philippe de Momper I. (1598–1634) und sein Neffe Frans de Momper (1603–1660/1661).
Vorliegendes Gemälde ist mit zahlreichen um 1620/30 entstandenen Kompositionen Joos de Mompers vergleichbar, z.B. der „Gebirgslandschaft mit Packeseln“, „Berglandschaft mit Reisenden zu Pferde“ oder der „Berglandschaft mit Reisenden“ (vgl. Kaus Ertz, Josse de Momper der Jüngere, Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1986, WVZ Nr. 96, 103, 175).

Künstler des 18. Jahrhunderts
Eduardus Angliae Rex
Öl auf Leinwand; gerahmt; 222 x 128 cm
Bezeichnet: EDUARDUS ANGLIAE REX
MEUS IGNIS IN ILLO EST; Bezeichnet am unteren Rand: Franc. Ignat. Per Kamer. Poeta. Non ea sunt Speculi, Sed Sunt incendia Phoebi / Huic radios sanctum Consociare licet / Pluribus o. Placeat Christe, orbem accendere flamis / Haereticus ne sit fusus abigne tuo.
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 2.500–5.000

Künstler des 18. Jahrhunderts
Magnus Sveciae Rex.
Öl auf Leinwand; gerahmt; 219 x 126 cm
Bezeichnet:
MAGNUS SVECIAE REX.
TECUM DIS PONO VIAS.
Bezeichnet am unteren Rand: F.I.P. Poeta
Disponit cum Sole vias, quibus indicet horas / Labentes recto SVETIA docta die. / Divino cum Sole vias dispone Novator. / Tartara Vel certo deuius una Petes.
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 2.500–5.000

1039
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Heiliger Ägidius in Landschaft
Öl auf Leinwand; gerahmt; 81,5 × 109 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 3.000–6.000
1040
Abraham Storck Nachfolger
(Amsterdam 1644–1708 Amsterdam)
Südlicher Seehafen mit ankerndem Dreimaster und Booten Öl auf Leinwand; gerahmt; 67,5 × 93,5 cm
Provenienz
Dorotheum Wien, 15. Oktober 2008, Lot 307; Privatbesitz, Wien
€ 3.000–6.000


1041
Franz Ignaz Joseph Flurer zugeschrieben
(Augusburg 1688–1742 Graz)
Südliche Hafenlandschaft
Öl auf Leinwand; gerahmt; 71,5 x 88,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 2.500–5.000


1042
Künstler des 17. Jahrhunderts
Heilige Familie mit Johannesknaben bekrönt von Gottvater Öl auf Kupfer; gerahmt; 52 × 28 cm
Provenienz Österreichischer Privatbesitz
€ 1.000–2.000
1043
Künstler des 17. Jahrhunderts
Maria und Elisabeth mit Jesus und Johannes Öl auf Kupfer; gerahmt; 16,8 × 12,7 cm
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 1.000–2.000

1044
Niederländischer Künstler
Landschaft mit Kühen, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz; gerahmt; 72 × 106 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 2.000–4.000
1045
Künstler des 18. Jahrhunderts
Landschaft mit Staffage Öl auf Leinwand; gerahmt; 28 × 37 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000


Frans Francken der Jüngere Werkstatt
(Antwerpen 1581–1642 Antwerpen)
Die Hochzeit zu Kana
Öl auf Holz, oktogonal; gerahmt; 25,8 x 63,9 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 15.000–30.000

Die Rahmenhandlung beschreibt eine Hochzeitsfeier in Galiläa. Festlich gekleidete Figuren sind um eine reich gedeckte Tafel versammelt. Im Bildzentrum, wie üblich unter einem Baldachin, ist die Braut platziert; ihr zugewandt der Bräutigam. Der Blick des Betrachters schweift an den zahlreichen Gästen, in reger Interaktion miteinander, vorüber. Der Blick des Betrachters schweift an den zahlreichen Gästen, in reger Interaktion miteinander, vorüber. Das zentrale Ereignis, auch bekannt als das „Weinwunder zu Kana“ ist den Erzählungen aus dem Johannesevangelium (Johannes 2, 1-12) entnommen. Während der Feierlichkeit gingen die Weinvorräte zur Neige. Daraufhin bat Jesus Krüge mit Wasser zu füllen und ein junger Mundschenk zur anschließenden Verkostung. Dieser stellte verwundert fest: Das Wasser war zu Wein geworden.
Das durchaus beliebte Sujet ist auch in weiteren Werken Frans Francken des Jüngeren und seinem Werkstattumfeld zu finden (vgl. Ursula Härting, Frans Francken d.J. Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1989, S. 269, Nr. 151, 152*, 156*).

Cornelis Willemsz Eversdyck
(ca. 1590-ca. 1644)
Rebekka und Elieser, 1632
Öl auf Holz; gerahmt; 20,5 x 31,2 cm
Signiert und datiert rechts unten: Eversdyck 1632
Provenienz
Dorotheum Wien, 29. November 1977, Lot 36; Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000

1048
Pieter van Avont Umkreis
(Mecheln 1600–1652 Deurne)
Ruhe auf der Flucht nach Ägypten Öl auf Leinwand; gerahmt; 77,5 x 101 cm
Provenienz
Sotheby's, New York, 16. Juni 1977, Lot 51; Privatsammlung, Österreich
€ 3.500–7.000


Pieter Brueghel der Jüngere
(Brüssel um 1564–1638 Brüssel)
Bauern liefern den Zehnten ab, wohl vor 1615
Öl auf Holz; gerahmt, 60,5 x 95,5 cm
Provenienz
ehemals Sammlung Fernand Jacobs (1886–1971), Antwerpen; Österreichischer Privatbesitz
Literatur
Georges Marlier, Pierre Brueghel le Jeune, Brüssel 1969, S. 435, Nr. 5 (ohne Abb.)
Klaus Ertz (Hg.), Pieter Brueghel der Jüngere (1564-1637/38). Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Lingen 2000, S. 515, WVZ-Nr. F515 (ohne Abb.)
Gutachten Dr. Ursula Härting, Hamm, den 29. Februar 2024, liegt bei (in Kopie).
€ 180.000–360.000

Das Sujet „Bauern liefern den Zehnten“, früher auch als „Der Bauernadvokat“ bezeichnet, ist eine der bekanntesten Kompositionen Pieter Brueghels des Jüngeren. Es sind heute mehr als 40 Versionen aus eigener Hand und in Versionen von Mitarbeitern erhalten. Dr. Ursula Härting hat vorliegendes Werk im Original studiert und in ihrem ausführlichen Gutachten als eigenhändiges Werk Pieter Brueghels des Jüngeren bestätigt. Sie nimmt an, dass das Gemälde vermutlich vor 1615, also vor dem frühest bekannten datierten Werk dieses Sujets entstanden ist. Es handelt es sich um eine besonders malerische Version im Vergleich zu den meist graphisch erscheinenden Fassungen.
„Die Stube ist bühnenartig in der Form eines Guckkastens angelegt. Bauern haben ihre Hüte abgenommen und bringen unterwürfig ihre agrarischen Erzeugnisse in das chaotische Amtszimmer des Procureurs oder Rentmeisters, auf dessen Schreibtisch inmitten von Papierhaufen ein Stundenglas steht. An der Wand hinter dem Rechtsgelehrten hängt ein Kalender, wie ihn die Antwerpener Druckerei Plantijn auf Niederländisch und Französisch tausendfach jeweils für ein Jahr druckte. Oben ist hier nur noch rudimentär sichtbar …Grace… - zu ergänzen etwa …l’an de grâce xx oder …au Dieu. Von den Wänden bis zum Boden ist der gesamte Raum gefüllt mit Zetteln, Papieren, durchgestrichenen Kassenbucheinträgen, die katastrophale Buchhaltung offenbart sich; viele, zu viele Geldbeutel hängen in Regalen, rechts außen hält der gut gekleidete Mann wohl einen großen weißen Geldschlauch über dem Arm, vermutlich nimmt er stellvertretend für den Gelehrten die Gelder ein – ob ordnungsgemäß, wer weiß: alles wirkt ordnungslos. Eine unordentliche Führung auch der Bücher fällt folglich auch auf den Rechtsgelehrten zurück, obwohl sein vierzipfliger Doktorhut ihn doch eigentlich und erwartungsgemäß als sorgfältigen Akademiker ausweist. Doch nun ist er wohl eher jemand, über dessen Profession sich man belustigen konnte. … Bislang blieb generell die mir wesentlich scheinende Frage ungestellt, warum derart viele, heute noch bekannte Versionen derart viele Auftraggeber und Abnehmer fanden. Die Fassungen könnten in Landhäusern in Domänen außerhalb Antwerpens gehangen haben, deren Inventare nur selten in städtischen Nachlässen erscheinen. Antwerpener Gutsbesitzer hatten im Umland zu Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts mehr als 380 Landhäuser gebaut, erworben, umgebaut. Es waren Herrlichkeiten mit Land, Dorf und Kirche, und Rechtsprechung. Dortige Villen dienten als Sommersitze, als maisons de plaisance, die man seit der Antike zur Erbauung gern mit komödiantischen Sujets dekorierte, die Lachen, auch selbstbezogenes Schmunzeln auslösen konnten. Auf diesen Domänen erzeugte man landwirtschaftliche Erzeugnisse und zog den Zehnten des Ertrags ein. Der Zehnte wurde entweder im Namen der katholischen Kirche oder eben im Namen derjenigen Gutsbesitzer eingenommen, auf deren Domänen die Agrarprodukte wuchsen, von procureuren oder Rentmeistern. Gutsbesitzer, Rechtsgelehrte, Rentmeister und Prokuratoren waren zudem Mitglieder in der Antwerpener Lukasgilde, die häufig comedies inszenierte. So war in Brueghels Darstellung die Absicht des Amüsements bislang wohl verborgen.“ (Auszug aus dem Gutachten von Dr. Ursula Härting, dort weiter mit ausführlichen Fußnoten ergänzt).


1050
Salomon Rombouts zugeschrieben
(Haarlem 1650–1702 Haarlem)
Bewaldete Dünenlandschaft mit Figuren Öl auf Holz; gerahmt; 17,5 x 24 cm
Bezeichnet rechts unten: Rombout
Provenienz
Dorotheum, Wien, 14. April 2005, Lot 85; österreichischer Privatbesitz
€ 2.500–5.000
1051
Jan Wijnants
(Haarlem um 1632–1684 Amsterdam)
Landschaft mit Jagdgesellschaft Öl auf Holz; gerahmt; 34 x 43,5 cm
Monogrammiert rechts unten: JW
Rückseitig Wachssiegel: Galerie / Sedelmeyer / Paris
Provenienz
Galerie Charles Sedelmeyer, Paris; seit mehreren Generationen Privatbesitz, Wien;
€ 5.000–10.000


1052
Gerbrand van den Eeckhout
(Amsterdam 1621–1674 Amsterdam)
Herrenporträt, 1661
Öl auf Leinwand; gerahmt; 62,5 x 52,5 cm
Signiert und datiert am rechten Rand: G. v. Eeckhout / A: 1661.
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 7.000–14.000


1053
Künstler des 17. Jahrhunderts
Aufbruch zur Jagd
Öl auf Papier auf Holz; gerahmt; 13 × 9,5 cm
Rechts unten undeutlich signiert: B...
Provenienz
Deutsche Privatsammlung
€ 800–1.500
1054
Gerard Dou Nachfolger
(Leiden 1613–1675 Leiden)
Mädchen am Fenster
Öl auf Holz; gerahmt; 35,5 × 30 cm
Provenienz
Deutsche Privatsammlung
€ 1.000–2.000


1055
Gortzius Geldorp zugeschrieben
(Löwen 1553–1618 Köln)
Dame mit Buch, 1608
Öl auf Holz; gerahmt; 56 × 42 cm
Links oben datiert: Anno. i608 (...)
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.500–3.000
1056
Gerard Dou Nachfolger
(Leiden 1613–1675 Leiden)
Dame in einer Nische Öl auf Holz; gerahmt; 31 × 22 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.500–3.000

Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt (Grafenwörth 1718–1801 Stein)
Maria als Braut des Heiligen Geistes, um 1765–75 Öl auf Leinwand; gerahmt; 66,5 x 50,5 cm
Provenienz österreichischer Privatbesitz
Wir danken Dr. Georg Lechner, Belvedere, Wien, für seine Hilfe bei der Katalogisierung.
€ 3.500–7.000
Ein charakteristisches Merkmal des Schaffens Kremser Schmidts (1718–1801) ist die reduzierte, fein nuancierte Farbpalette, die auch in diesem Gemälde ihre besondere Wirkung entfaltet. Der enge Bildausschnitt fokussiert den Betrachter unmittelbar auf die dargestellte Figur und deren Haltung sowie Kopfwendung. Dies lässt ikonografische Parallelen zu anderen Kompositionen des Meisters, etwa der Hl. Scholastika, erkennen (vgl. Rupert Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt, 1718–1801, Innsbruck/Wien 1989, Nr. 204/2, S. 394). Des Weiteren verleiht die Verwendung eines gröberen Bildträgers der Maloberfläche eine samtig-matte Struktur, die sich wiederholt im Œuvre des Künstlers nachweisen lässt. Auf Grundlage dieser stilistischen Merkmale ist das Werk der mittleren Schaffensphase des Künstlers zuzuordnen und in die Jahre zwischen 1765 und 1775 zu datieren.

1058
Wolf Nicolaus Thurman
(Waidhofen an der Ybbs 1648–1720 Waidhofen an der Ybbs)
Blick auf den Sonntagberg während der Türkenbelagerung, 1688
Öl auf Leinwand; oben geschwungener Abschluss; ungerahmt; 98 x 159 cm
Signiert und datiert unten mittig:
W.N.TURMAN F. 1688
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 5.000–10.000
Aufgrund seiner qualitätvollen Ausführung sowie der selten überlieferten Signatur und Datierung nimmt dieses Werk eine besondere Stellung im Œuvre des aus Waidhofen an der Ybbs stammenden Malers Wolf Nikolaus Thurmann (1648–1720) ein.
Das Gemälde zeigt eine klar gegliederte Darstellung, die himmlische und irdische Ebenen verbindet. Im oberen Bildfeld erscheint die der Kirche geweihte Dreifaltigkeit in Form von Gottvater, Christus und dem als Taube dargestellten Heiligen Geist, flankiert von zwei Putti. Darunter öffnet sich der Blick auf die Landschaft rund um den Sonntagberg, der zu den bedeutendsten Wallfahrtszentren Niederösterreichs zählt. Im Hintergrund steigen Rauchschwaden auf, osmanische Truppen rücken heran, während im Vordergrund Bauern aus der bedrohten Umgebung fliehen. Die Szene dürfte auf die Türkenbelagerungen von 1529 und 1683 verweisen, die die Kirche am Sonntagberg unversehrt überstand.


1059
Künstler des 18. Jahrhunderts
Heiligendarstellung
Öl auf Holz; gerahmt; 19,5 × 16 cm
Links unten undeutlich monogrammiert
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000
1060
Josef Heintz Umkreis
(Basel 1564–1609 Prag)
Maria Anna von Bayern (1551–1608), 16./17. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 73,5 × 54,5 cm
Am unteren Rand betitelt: M. BAVARICA.
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000

Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt, Umkreis
(Grafenwörth 1718–1801 Stein)
Der Alchemist
Öl auf Holz; gerahmt; 32 x 23,5 cm
Provenienz
Österreichischer Privatbesitz
€ 1.500–3.000
Das Gemälde greift ein beliebtes alchemistisches Sujet auf, das auf eine heute verlorene Zeichnung von Martin Johann Schmidt (1718–1801) zurückgeht und durch eine Radierung Ferdinand Landerers (1730–1795) bekannt ist (vgl. Rupert Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt. 1718–1801, Innsbruck/Wien 1989, S. 568, Abb. L17).

Christian Georg Schütz
(Florsheim 1718–1791 Frankfurt)
Rheinlandschaften (Pendants), 1778
Öl auf Holz; gerahmt; je 34 x 45 cm
jeweils unten signiert und datiert: SCHÜZ. fec. 1778
Provenienz
Privatsammlung Wien
€ 10.000–20.000

Christian Georg Schütz ist vor allem für seine Landschaftsgemälde bekannt. Seine künstlerische Laufbahn begann 1731 mit einer Ausbildung bei Hugo Schlegel (1679–1737), einem Fassaden- und Freskenmaler in Frankfurt am Main. Nach einer Phase der Wanderschaft ließ er sich 1743 wieder in Frankfurt nieder und arbeitete zunächst als Maler für Fassaden und Dekorationen. Mit Unterstützung seines Mäzens Heinrich Jakob von Häckel (1682–1760) wandte Schütz sich schließlich stärker der Flusslandschaftsmalerei zu, die bei Zeitgenossen großen Anklang fand. In seinen Bildern verbindet Schütz reale Eindrücke aus seinen Reisen mit frei erfundenen Elementen wie Burgen und Ruinen. Deutliche Einflüsse niederländischer Landschaftsmalerei lassen sich in seinen Werken erkennen. Die hier gezeigten Flusslandschaften illustrieren anschaulich, wie Schütz reale Naturbeobachtungen mit fantasievollen Szenen zu stimmungsvollen Kompositionen vereinte.
Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt, und Werkstatt
(Grafenwörth 1718–1801 Stein)
Die Heilige Sippe, 1770er Jahre
Öl auf Leinwand; geschwungener Abschluss am oberen Rand; gerahmt; 187 x 123 cm
Undeutlich signiert und datiert links unten: …17(7…)
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
Wir danken Dr. Georg Lechner, Belvedere, Wien, für seine Hilfe bei der Katalogisierung.
€ 8.000–16.000
Die Darstellung der „Heiligen Sippe“ gehört zu den zentralen Themen im Œuvre Martin Johann Schmidts. Im Unterschied zur „Heiligen Familie“ weitet sich hier der Kreis über Christus und seine Eltern hinaus auf weitere Verwandte aus. Als dieses Werk entstand, war Schmidt bereits ein angesehener, etablierter Maler mit eigener Werkstatt und Mitarbeitern. Die locker aufgesetzten, fast skizzenhaften Höhungen in Gesichtern und Gewändern verweisen jedoch auch auf die unmittelbare Beteiligung des Meisters selbst. Charakteristisch ist zudem das warme, dämmrige Licht, das die Szene durchzieht, zugleich lassen sich bereits Anklänge an die kräftigere Farbigkeit seiner späteren Werke erkennen. Das Bild diente vermutlich als privates Andachtsbild, könnte aber ebenso für eine Seitenkapelle bestimmt gewesen sein, dort wechselten Bildprogramme häufig. Vergleichbare Kompositionen finden sich in mehreren österreichischen Kirchen. So zeigt etwa die beliebte „Heilige Familie“ in St. Peter in Salzburg eine ähnliche Figurenordnung im gleichen sanften, warmen Licht (vgl. Rupert Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt. 1718-1801, Innsbruck/ Wien 1989, WVZ-Nr. 544). Auch das Christuskind erinnert an die Gestalt in Schmidts „Kräfte der Engel“ von 1773 im Stift Melk (Feuchtmüller 1989, WVZNr. 433): Dort blickt es auf emporstrebende Engel herab, hier hingegen wendet es sich dem kleinen Johannesknaben zu, der von seiner Mutter Elisabeth begleitet wird.
Die Aufmerksamkeit der Figuren gilt nicht allein Christus in der Mitte der Komposition, einige richten ihre Blicke in göttlicher Ekstase gen Himmel. Die Familie bekrönt der Heilige Geist, der in Gestalt einer weißen Taube über der Szene schwebt – ein ikonographisches Motiv, das Schmidt immer wieder wirkungsvoll einsetzte. Das Gemälde vereint intime Andacht mit repräsentativer Strahlkraft und bietet zugleich ein eindrucksvolles Beispiel von Schmidts ausgereifter Malerei und seiner gefragten Werkstattpraxis.

Französische Schule 18. Jahrhundert
Orpheus bezaubert mit seinem Spiel die Tiere Öl auf Leinwand; gerahmt; 81,5 x 110 cm
Undeutlich signiert unten mittig
Provenienz
Dorotheum Wien, 20. Oktober 2015, Nr. 315; Privatsammlung, Österreich
€ 15.000–30.000

Die hier vorliegende mythologische Darstellung besticht durch die Vielfalt und Lebendigkeit von Flora und Fauna. Das Gemälde stammt von einem Künstler der französischen Schule des 18. Jahrhunderts. Im Zentrum der Darstellung sitzt Orpheus, der mythische Sänger der griechischen Antike, vor einem Baum, eingebettet in eine bewaldete Landschaft. Der antiken Überlieferung zufolge bezirzt er mit seiner Musik und seinem Gesang nicht nur Menschen und Tiere, sondern vermag es, selbst Pflanzen und Steine zu bewegen.
Diese Vorstellung findet in der Bildsprache des Gemäldes ihren Ausdruck: Eine detailreiche, üppige Naturdarstellung durchzieht die gesamte Szenerie. Neben heimischen Tieren wie Hühnern, Enten, Esel und Pferd sind auch fremdländische Arten wie Löwen, Leoparden und Strauße zu erkennen, die sich dem Sänger angenähert haben und in ungewohnter Ruhe verharren. Vögel haben sich in den Ästen niedergelassen, während weitere aus der Ferne heranfliegen – allesamt angezogen vom betörenden Klang der Stimme Orpheus’, die die Natur in ihrer ganzen Vielfalt in seinen Bann zu ziehen vermag.



1065
Venezianische Schule
Elegente Gesellschaft (Pendants) , 18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; je 37,5 x 45 cm
Provenienz
Auktionshaus im Kinsky, Wien, 15.–17. Nov. 1994, Lot 3; Privatbesitz, Österreich
€ 2.500–5.000

1066
Künstler des 18. Jahrhunderts
Ausblick auf eine Küstenszene in floraler Umrahmung Öl auf Leinwand; gerahmt; 239,5 x 261 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 10.000–20.000

Johann Ulrich Mayr
(Augsburg 1630–1704 Augsburg)
Der verlorene Sohn
Öl auf Leinwand; gerahmt; 105,5 x 132,5 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 27. Mai 1974, Lot 87, Tafel 44; Privatbesitz Österreich
€ 10.000–20.000
Johann Ulrich Mayr war ein deutscher Barockmaler mit Lebensmittelpunkt in Augsburg. Seine Ausbildung erhielt er in den Niederlanden bei Rembrandt van Rijn (1606–1669) und Jacob Jordaens (1593–1678). Neben Porträts entstanden zahlreiche Werke mit religiösen und christlichen Themen, für die er unter anderem auch am Wiener Hof tätig war.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn war im Barock ein beliebtes Sinnbild göttlicher Gnade. Mayr zeigt hier den Moment der Heimkehr: Der Sohn, nachdem er sein Erbe verspielt hat, bittet in seiner zerrissenen Kleidung reuevoll um Vergebung. Der Vater nimmt ihn mit gütiger Geste auf, während zwei junge Männer das Geschehen staunend beobachten. Durch den für den Barock typischen Einsatz von Hell-Dunkel hebt Mayr Gesichter und Hände wirkungsvoll hervor und verleiht der Szene eine eindringliche emotionale Intensität.

1068
Giacomo Francesco Cipper, genannt il Todeschini
(Feldkirch 1664–1736 Mailand)
Feiernde Bauern
Öl auf Leinwand; gerahmt; 85,5 x 109 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 8.000–15.000
Jan Brueghel der Jüngere (Antwerpen 1601–1678 Antwerpen) und Pieter van Avont (Mecheln 1600–1652 Deurne)
Die Hl. Familie mit Johannes in einer Landschaft, um 1640 Öl auf Kupfer, parkettiert; gerahmt; 30 x 37,5 cm
Signiert links unten: J. Breughel
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
Gutachten von Dr. Klaus Ertz, Lingen 12. Dezember 2011, liegt bei
€ 15.000–30.000


Maria ist auf einem Stein sitzend dargestellt, bekleidet in einem roten Gewand, über das ein blauer Mantel drapiert ist. In ihren Schoß ruht das Christuskind, das sich mit ausgestreckten Armen Johannes dem Täufer zuwendet. Dieser ist mit dem Rücken zum Betrachter dargestellt und reicht dem Kind einen Apfel; neben ihm steht der Kreuzstab mit weißem Band. Zur Rechten Marias sitzend, den Kopf in die Hand gestützt, beobachtet Joseph das Geschehen aufmerksam. Vor der Heiligen Familie steht ein Lamm, den Blick auf den Johannesknaben gerichtet, während links neben Marias Kopf ein Papagei erscheint. Ein fruchttragender Baum, dichtes Gebüsch und weitere Gehölze hinterfangen die Figurenszene. In der rechten Bildhälfte öffnet sich die Landschaft zu einer Wiese mit Tieren, die in einen Wald übergeht. Sanfte Wolken schaffen eine milde Lichtstimmung, Vögel beleben den Himmel. Den Vordergrund zieren zahlreiche Waldblumen, die die Idylle der Darstellung unterstreichen. Die neutestamentarische Szene der Ruhe auf der Flucht nach Ägypten erfreute sich im 17. Jahrhundert besonderer Beliebtheit und wurde von Jan Brueghel dem Jüngeren wiederholt aufgegriffen. Mit Pieter von Avont zusammen, schuf er in den 1630er Jahren eine „Heilige Familie mit Johannes und Engeln in Landschaft“, welche sich heute im Kunsthistorischen Museum in Wien befindet (Inv.-Nr. 1683). Ein weiteres Beispiel ist das Werk „Maria mit Kind und Johannes in waldiger Landschaft“, von Brueghel d. J. gemeinsam mit Hendrick van Balen gemalt (vgl. Klaus Ertz, Jan Breughel der Jüngere 1601–1678. Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1984, S. 310, Kat.-Nr. 141, mit Abb.).
Ganz im Sinne einer in Flandern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verbreiteten Praxis der gemeinschaftlichen Ausführung durch zwei spezialisierte Maler entstand auch das vorliegende Gemälde in Zusammenarbeit. Nach Einschätzung von Dr. Klaus Ertz handelt es sich um eine Gemeinschaftsarbeit: Die Landschaft, Blumen, Pflanzen und Vögel stammen von Jan Brueghel dem Jüngeren, während die Figurenstaffage sowie das Lamm der Hand Pieter van Avonts zugeschrieben werden (vgl. Gutachten Dr. Klaus Ertz).



Niederländische Schule
Landschaft mit Herde (Pendants), 18. Jahrhundert
Öl auf Holz; gerahmt; je 25,5 x 31,5 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 2.500–5.000

1071
Künstler des 18. Jahrhunderts
Rastender Pan
Öl auf Leinwand; gerahmt; 152 x 183,5 cm (Oval)
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 5.000–10.000
Das stimmungsvolle, raumgreifende Gemälde zeigt den Gott Pan, entspannt in einer verwunschenen Waldlandschaft sitzend. Mit seinen Ziegenhörnern, der Panflöte und dem Hirtenstab verkörpert er die enge Verbundenheit zur Natur und die wilde, ungezügelte Seite des Lebens. Pan, der antike Gott der Hirten und Wälder, symbolisiert Freiheit und Ursprünglichkeit und lädt den Betrachter ein, in eine mythische Welt voller Harmonie und Gelassenheit einzutauchen. Die sanften Farben und der leicht dramatische Himmel schaffen eine geheimnisvolle, aber zugleich beruhigende Atmosphäre. Der Künstler fängt die Magie und die Schönheit der Natur ein, indem er die Spannung zwischen Ruhe und Lebendigkeit meisterhaft darstellt und so die zeitlose Kraft der Mythologie spürbar werden lässt.

1072
Mathys Schoevaerdts zugeschrieben
(Brüssel 1655–1717 Brüssel)
Landschaft mit Stadtansicht und Staffage
Öl auf Leinwand; gerahmt; 42,5 × 59,5 cm
Provenienz deutsche Privatsammlung
€ 1.500–3.000
1073
Flämische Schule
Landschaft mit Pferdewagen
Öl auf Kupfer, parkettiert; gerahmt; 20,5 x 30,5 cm
Provenienz deutsche Privatsammlung
€ 500–1.000


1074
Künstler um 1700
Weinernte (Allegorie des Herbstes)
Öl auf Leinwand; gerahmt; 32 × 38 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000
1075
Josef van Bredael (Antwerpen 1688–1739 Paris)
Schlachtenbild
Öl auf Holz; gerahmt; 26,5 × 29 cm
Signiert rechts unten: iBREDA(EL)
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000

Jan Brueghel der Ältere Umkreis
(Brüssel 1568–1625 Antwerpen)
Die vier Jahreszeiten – Frühling (Flusslandschaft mit vornehmer Gesellschaft im Boot), Sommer (Die Ernte), Herbst (Belebte Landstrasse mit Wirtshaus), Winter (Römischer Karneval)
Öl auf Kupfer (Tondo); gerahmt; je ca. 12,5 cm
Rückseitig jeweils die Schlagmarke des Kupferplattenherstellers
Pieter Stas mit der Hand von Antwerpen
Provenienz
Auktionshaus im Kinsky, Wien, 6. April 2006, Lot 432; deutsche Privatsammlung
€ 15.000–30.000

Detail Schlagmarke
Der vorliegende Zyklus entfaltet den Jahreslauf als Abfolge von Gesellschaftsszenen, in denen allegorische Motive und erzählerisch nuancierte Details eine vielschichtige Bildhandlung konstituieren. Jan Brueghel der Ältere erschuf seine Kompositionen der Jahreszeitenallegorien um das Jahr 1594 (vgl. Klaus Ertz & Christa Nitze-Ertz, Jan Brueghel d. Ä., Die Gemälde Band III, S. 1095–1101, Kat. 525, 526, 527 und 528). Die dokumentierten vier kleinen Gemälde, welche in den Maßen nahezu den vorliegenden Werken entsprechen, wurden jedoch über die Jahrhunderte hinweg getrennt und befinden sich heute in zwei verschiedenen Museen: „Belebte Landstraße mit Wirtshaus“ und „Flusslandschaft mit vornehmer Gesellschaft im Boot“ (Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum, Landesgalerie, Inv.Nr. KM 142 & KM 143), „Die Ernte“ und „Römischer Karneval“ (München Bayrische Staatsgemälde Sammlung, Alte Pinakothek, Inv.-Nr. 4911 & 1991).
Dass die vorliegenden vier runden Kupfertafeln im nächsten zeitlichen und örtlichen Umkreis von Jan Brueghel d. Ä. entstanden sein müssen, wird durch die rückseitigen Schlagmarken unterstrichen. Der Kupferplattenhersteller Pieter Stas war um 1587 bis 1610 in Antwerpen tätig und lieferte für zahlreiche Werke der Brueghel-Werkstatt den Bildträger.
Im Frühling begegnen sich vornehme Paare zu einer Bootspartie, begleitet von Musik und von einer Etikette geprägten Umgangsformen, während im Mittelgrund der Bauer mit Pflug und Saat den Neubeginn des Jahres unterstreicht. Der Sommer erscheint in der Allegorie der Ernte: Rastende Bauern im Vordergrund kontrastieren mit den Schnittern im Feld und spiegeln Fülle wie Erschöpfung. Der Herbst belebt eine Landstraße mit Wirtshaus; flankierend treten kleinfigurige Szenen der Apfelernte und des Viehtriebs hinzu, die den Zyklus der bäuerlichen Arbeit fortschreiben. Der Winter schließlich findet seine Allegorie im Karneval, dessen ausgelassenes Treiben seit dem 16. Jahrhundert ein zentrales Motiv niederländischer Kunst darstellt.





Flämischer Meister
Landschaft mit rastenden Wanderern, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 65 x 104,5 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 3.500–7.000

1078
Simon de Vos Umkreis
(Antwerpen 1603–1676 Antwerpen)
Picknick im Freien
Öl auf Kupfer; gerahmt; 54,5 x 71 cm
Provenienz
Dorotheum Wien, 16. April 2008, Lot 300; Privatsammlung, Österreich
€ 7.000–14.000

1079
Jacob Philipp Hackert
(Prenzlau 1737–1807 Florenz)
Ziegenbock in Landschaft Öl auf Holz; gerahmt; 36 x 28 cm
Rückseitig bezeichnet: Hackert / fecit
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 5.000–10.000
Jacob Philipp Hackert (1737–1807) zählt zu den bedeutendsten Landschaftsmalern seiner Epoche. Nach seiner Ausbildung in Berlin und einem Aufenthalt in Paris etablierte er sich in Rom rasch als gefragter Künstler, bevor er 1786 als Hofmaler König Ferdinands IV. nach Neapel berufen wurde. Goethe, der ihn während seiner Italienreise kennenlernte, würdigte ihn zudem in einer Biografie. Neben seiner Landschaftsmalerei wurde Hackert insbesondere für seine Tierdarstellungen geschätzt. Das vorliegende Gemälde zeigt eine weiße Ziege in eine hügelige Landschaft eingebettet. Sie ist sorgfältig ins Bildgefüge integriert und mit großer Detailtreue erfasst. Derartige Einzeldarstellungen waren bereits in den 1770er Jahren Teil seines Œuvres und stellten auch in den 1780er Jahren ein wiederkehrendes Motiv dar (vgl. Claudia Nordhoff & Hans Reimer, Jakob Philipp Hackert (1737–1807). Verzeichnis seiner Werke, 2 Bände, Akademie Verlag 1994, S. 39, WVZ.-Nr. 96, 97, 98, S. xx, WVZ-Nr. 297, 298, S. xx, WVZ.-Nr. 343).

1080
Martin Ferdinand Quadal
(Niemtschitz 1736–1808 St. Petersburg)
Junge schützt eine Kerze vor dem Wind Öl auf Leinwand; gerahmt; 70,5 x 53 cm
Provenienz
ehemals Privatsammlung K.P. (wohl Karl Pfatschbacher), Linz; Privatbesitz, Österreich
Literatur
Maria Isabella Safarik, Martin Ferdinand Quadal. L’insolta carriera di un artista indipendente nell’Europa del settecento, Rom 2006, S. 164, Nr. 32
€ 5.000–10.000
Martin Ferdinand Quadal (1736–1808) wurde in Mähren geboren und erhielt seine künstlerische Ausbildung zunächst in Wien. Im Anschluss unternahm er ausgedehnte Studienreisen durch Deutschland, England, Frankreich und Italien. Im Jahr 1797 reiste er nach Russland, wo er, mit einer zweijährigen Unterbrechung in London, überwiegend in Sankt Petersburg tätig war. Er erwarb sich als Porträt- und Tiermaler europaweit hohes Ansehen und wurde in mehreren namhaften Kunstakademien zum Ehrenmitglied ernannt. Das hier vorliegende Porträt zeigt einen jungen Mann, dessen Gesicht durch den Schein einer Kerze, die er in der Hand hält, aus dem Dunkel des Hintergrunds hervorgehoben wird. Die gezielte Lichtführung erzeugt eine spannungsvolle Hell-Dunkel-Wirkung, die das Antlitz des Dargestellten modelliert und eine intime Atmosphäre entstehen lässt. In dem Gemälde Giovane con una lanterna di carta (Junger Mann mit Papierlaterne) lässt sich eine vergleichbare kompositorische Anlage erkennen. (vgl. Safarik, S. 203, Nr. 67).

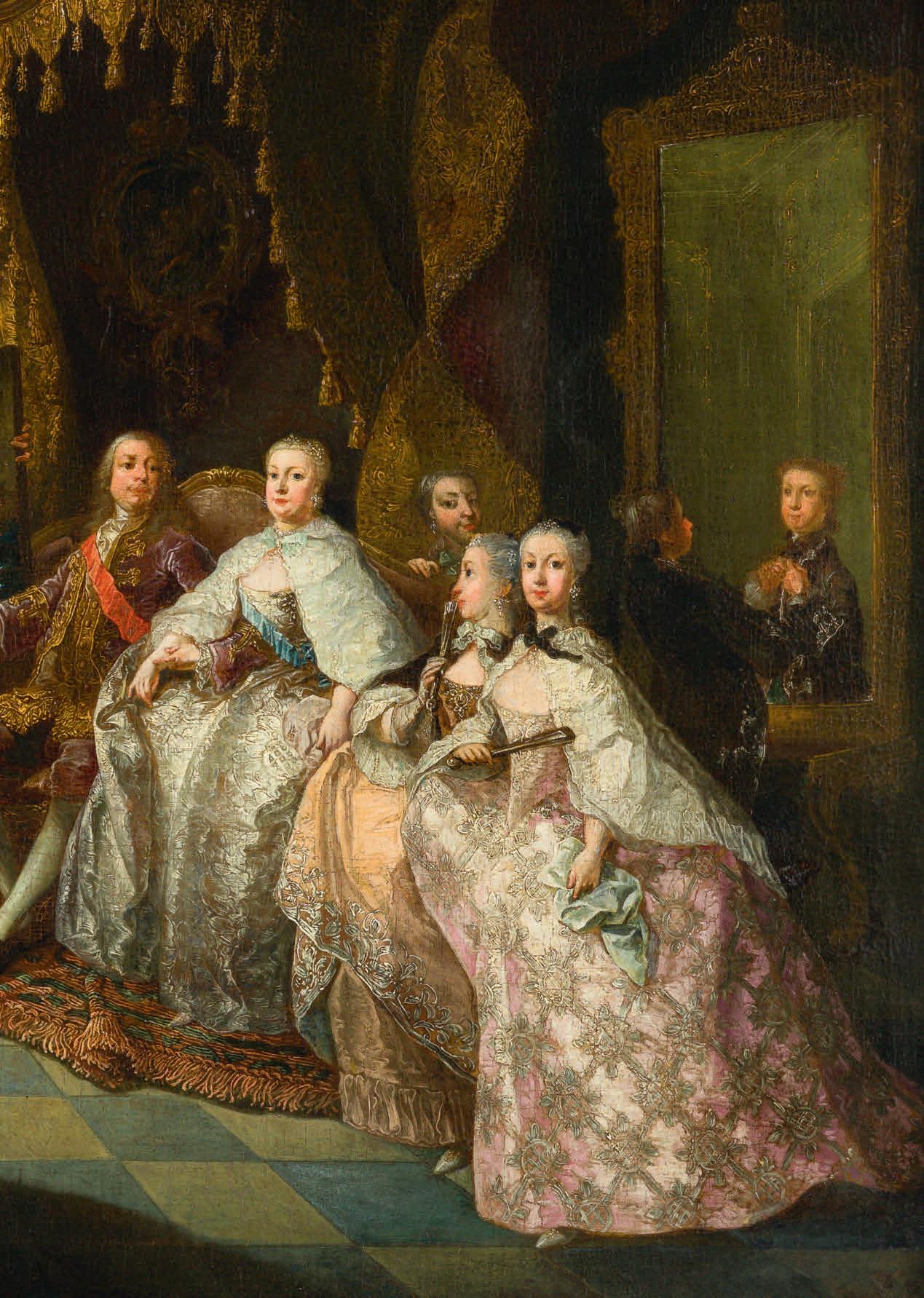
Martin van Meytens Umkreis
(Stockholm 1695–1770 Wien)
Erzherzogin Marie Christine überreicht im Kreis der kaiserlichen Familie ihrem Vater sein von ihr gemaltes Porträt, um 1757 Öl auf Leinwand; gerahmt; 61 x 75,5 cm
Provenienz
Sammlung E. Wancura, Wien; Dorotheum Wien, 28. November 1972, Lot 80; Sammlung Prof. Richard Steiskal-Paur, Wien; Privatbesitz, Österreich
Ausstellungen
1969 200 Jahre Albertina. Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Kunstsammlung, Albertina, Wien, Nr. 36,03 1980 Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr ihres Todes, Schloss Schönbrunn, Wien, Nr. 53;
Literatur
Walter Koschatzky, 200 Jahre Albertina. Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Kunstsammlung, Ausstellungskatalog, Albertina, Wien 1969, S. 42, Nr. 53; Walter Koschatzky, Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr ihres Todes, Ausstellungskatalog Schloss Schönbrunn, Wien 1980, S. 217, Nr. 36,03
Wir danken Dr. Georg Lechner, Belvedere, Wien, für seine Hilfe bei der Katalogisierung.
€ 35.000–70.000

Das Gemälde zeigt die künstlerisch begabte und favorisierte Tochter Maria Theresias (1717 –1780) Erzherzogin Marie Christine („Mimi“) (1742–1798) im Kreis der kaiserlichen Familie. Mit Palette in der Hand überreicht die knapp 15-Jährige ihrem Vater, Kaiser Franz Stephan von Lothringen (1708–1765), feierlich sein Porträt, das sie soeben selbst vollendet hat. Stolz wendet sich Franz Stephan seiner Gemahlin Maria Theresia zu, deren Blick den Betrachter unmittelbar in die Szene hineinführt.
Das Gemälde besticht durch seine detailreiche Ausführung: die spielerische Darstellung der Kinderfiguren, die reichen Draperien des Baldachins, die feine Spitze der Gewänder sowie die funkelnden Glanzlichter der Kronleuchter verleihen der Szene besondere Lebendigkeit. Im Hintergrund ist zudem ein von Ammen umsorgtes Kind zu erkennen, bei dem es sich vermutlich um den im Dezember 1756 geborenen Erzherzog Maximilian Franz (1756–1801) handelt, was eine Entstehung des Werks um 1757 nahelegt.
Das Werk steht in Bezug zu weiteren Darstellungen Meytens der Kaiserfamilie, darunter „Maria Theresia im Kreise Ihrer Familie“ im Schloss Schönbrunn (Inv.-Nr. MD 039813) (Versionen finden sich auch im Palazzo Pitti (Inv. O.d.A. 1911 no. 1431) und im Schloss Versailles (INV 2051, LP 321, INV.1850 4550)), in denen die zahlreichen Kinder um das Kaiserpaar versammelt sind. Ebenso erinnert es an das berühmte Porträt Marie Christines im Ungarischen Nationalmuseum das sie mit ungefähr 8 Jahren beim Zeichnen im Studierzimmer zeigt und ihre schon frühe Begabung als Künstlerin unterstreicht. Im vorliegenden Gemälde tritt sie aus dem Studierzimmer heraus und präsentiert nun im Familienkreis mit bemerkenswerter Selbstsicherheit ihr eigenes Werk neben dem lebenden Modell. Hier findet sich ein Beleg für ihr nicht nur zeichnerisches, sondern auch malerisches Talent. Wahrscheinlich ist das Gemälde als privater Auftrag innerhalb des Hofes entstanden, da nur die engste Familie ohne Ehepartnerinnen und Ehepartner abgebildet wurde. Als solches vermittelt das Kunstwerk eindrücklich ein Bild des höfischen Alltags im Umkreis Maria Theresias.


Französische Schule
Kinderbildnis, 18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 38 x 30,5 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 2.500–5.000

1083
Charles Gilles Dutillieu
(Paris 1697–1738 Paris)
Blumenstrauss in reliefierter Steinvase Öl auf Leinwand; gerahmt; 63,5 x 53,5 cm
Provenienz
ehemals Galerie Frost and Read, London; Dorotheum, Wien, 17. Oktober 2012, Lot 846; Privatbesitz, Wien
Gutachten Claudia Salvi, Paris 2012, liegt bei (in Kopie).
€ 3.500–7.000
Charles Gilles Dutillieu, Sohn eines verarmten Adeligen, war am französischen Hof unter Ludwig XIV. (1638–1715) tätig und spezialisierte sich auf Blumenstillleben. Durch seine Stillleben und prunkvollen Wagenverzierungen erregte er die Aufmerksamkeit der Nichte des Sonnenkönigs, die ihn mit der Ausschmückung ihrer Schlösser Sceaux und Anet beauftragte. Einer seiner bedeutendsten Aufträge führte ihn in den „Herkules-Saal“ des Schlosses Versailles, wo er unter der Leitung von François Lemoyne (1688–1737) am monumentalen Deckengemälde „L’Apothéose d’Hercule“ beteiligt war. Im Blumenstillleben tritt die Gelehrsamkeit des Künstlers klar hervor. Die Blüten sind sorgfältig in einer Steinvase arrangiert, deren figürliche Gestaltung auf antike Vorbilder verweist. Aus dem Kontrast von dauerhaftem Stein und vergänglicher Blütenpracht entsteht eine spannungsvolle Komposition, die den besonderen Reiz dieses Stilllebens aus dem Umfeld des Sonnenkönigs ausmacht.

Anton Faistenberger Umkreis
(Salzburg 1663–1708 Wien)
Italianisierende Landschaft mit Brücke und weitem Ausblick
Öl auf Leinwand; gerahmt; 72 x 58,5 cm
Provenienz
Sammlung Pfatschbacher, Linz
€ 1.500–3.000

Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Anbetung des Christuskindes
Öl auf Leinwand; gerahmt; 128,5 x 97 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 1.000–2.000
Italienischer Meister
Heiliger Rochus in Landschaft, 17./18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 160,5 x 116 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 5.000–10.000
Die Vita des Heiligen Rochus erzählt in mehreren Episoden von der Wundertätigkeit und den Leiden des Pilgers, welcher als Schutzheiliger der Pestkranken in Europa über Jahrhunderte zu den beliebtesten Volksheiligen zählte. Es entstanden Rochusbruderschaften wie die bekannte Scuola Grande di San Rocco in Venedig, jedoch auch nördlich der Alpen fand der Heilige große Verehrung. In Wien zeugt etwa die Kirche St. Rochus im 3. Gemeindebezirk von dessen Beliebtheit.
Die Legende erzählt, dass Rochus sich auf eine Pilgerreise nach Rom begeben hatte, auf dem Weg jedoch durch viele Orte kam, welche von der schwarzen Pest heimgesucht wurden, die in ganz Europa wütete. Unter großer Gefahr für sich selbst half er bei der Pflege der Kranken. Anstatt sich mit der Krankheit anzustecken, konnte er jedoch viele Menschen auf wundersame Weise heilen, indem er das Kreuzzeichen über sie machte.
Das vorliegende Gemälde zeigt eine der prominentesten Episoden aus seinem Leben: Als Rochus in die Stadt Piacenza kam, stellte er fest, dass er nicht mehr von der tödlichen Krankheit verschont war, da er sich schließlich am Bein angesteckt hatte. Um niemanden mit seiner Krankheit zu belasten, zog er sich in eine einsame, abgelegenen Waldhütte zurück, um dort im Vertrauen auf Gott den Tod zu erwarten. Dort fand ihn jedoch der Jagdhund eines örtlichen Junkers, welcher sich um den Heiligen sorgte. Täglich brachte er ihm Brot und leckte seine Wunden bis sich der Pilger schließlich von seinem Leiden erholte.


Künstler des 16. Jahrhunderts
Grablegung Christi
Öl auf Leinwand; gerahmt; 45 x 32 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 2.500–5.000

1088
Deutsche Schule
Das letzte Abendmahl, 16. Jahrhundert
Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 108 x 76 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 17./24. Januar 1984, Lot 293; Österreichische Privatsammlung
€ 3.500–7.000

1089
Francesco Guardi Nachfolger
(Venedig 1712–1793 Venedig)
Campo dei Santi Giovanni e Paolo, Venedig Öl auf Leinwand; gerahmt; 29,5 × 47 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 20. September 1977, Lot 44, Tafel 28; Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000
1090
Italienische Schule
Früchtestillleben, 17./18. Jahrhundert Öl auf Leinwand; gerahmt; 53,5 × 86 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.000–2.000


1091
Florentiner Schule
Heiliger Hieronymus in Landschaft, 17. Jahrhundert
Öl auf Schiefer; gerahmt; 21 x 26,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000

Venezianischer Meister
Apollo mit den Musen, 18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 66,5 x 86,5 cm
Provenienz
Auktionshaus im Kinsky, Wien, 26. November 2015, Lot 1326; Privatsammlung, Österreich
€ 3.000–6.000

1093
Giuseppe Zais zugeschrieben
(Forno di Canale 1709–1784 Treviso)
Landschaft mit Hirten
Öl auf Leinwand; gerahmt; 47,5 x 74 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 3.500–7.000
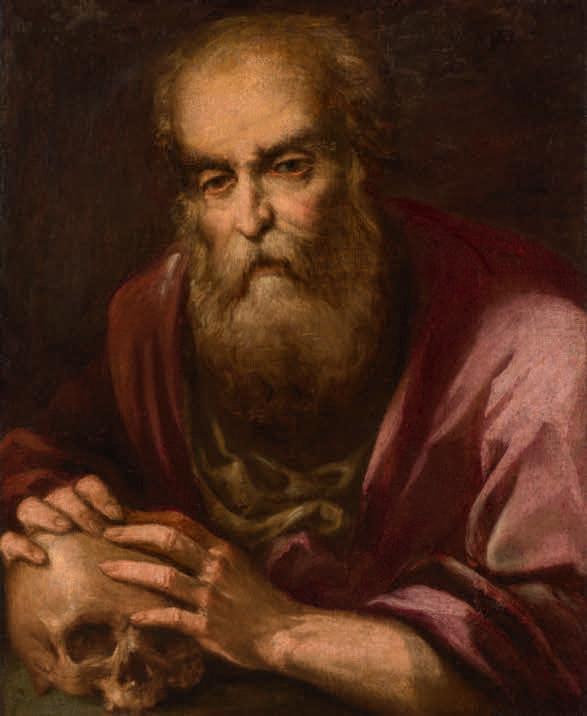

1094
Italienischer Meister
Heiliger Hieronymus, 17. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 64,5 × 52,5 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 1.500–3.000
1095
Künstler um 1700 Männerkopf
Öl auf Leinwand; gerahmt; 50 × 39 cm Rückseitig handschriftliches Etikett mit Zuschreibung an „Jan Skreta“ und Verweis auf ein altes Gutachten von Prof. Robert Eigenberger, Akademie der Bildenden Künste, Wien.
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.000–2.000

Künstler des 18. Jahrhunderts
Joseph und die Frau des Pontiphar
Öl auf Leinwand; gerahmt; 50 × 41,5 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 1.500–3.000
Raffaello Sanzio, genannt Raphael, Umkreis
(Urbino 1483–1520 Rom)
Bildnis einer jungen Dame mit Perlenschmuck und Palmzweig Öl auf Holz; gerahmt; 52,5 x 27,5 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 15.000–30.000

Das vorliegende Gemälde zeigt typische Einflüsse von den um 1500–1510 entstandenen Porträts Raffaels. Die Körperhaltung, der Ausdruck und vor allem die unscheinbaren, bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Elemente, wie beispielsweise die Perlen im Haar, weisen besondere Parallelen zu Raffaels Umbrischen und Florentiner Werken auf – beispielsweise zum Porträt der „Maddalena Doni“ (Palazzo Pitti Florenz, Inv. 1912, Nr. 59), welches um 1506 datiert wird. Der Typus entspricht weiteren Kompositionen, die die Hauptfiguren nah an den vorderen Bildrand rücken und dennoch bis auf mittlerer Höhe Platz für einen mit ‚Sfumato’ in die Tiefe wirkenden Landschaftshintergrund bereitstellen. Weitere vergleichbare Beispiele aus dieser Schaffensperiode Raffaels sind das um 1503 entstandene „Porträt eines jungen Mannes“ im Szepmüveszeti Museum, Budapest (Inv.-Nr. 72) oder die um 1502 zu datierende Darstellung des „Hl. Sebastian“ in der Accademia Carrara, Bergamo (Inv. 314).


Flämische Schule
Weite Flusslandschaft Landschaft mit Staffage, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz; gerahmt; 36,5 x 20,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000

Giandomenico Tiepolo Umkreis
(Venedig 1727–1804 Venedig)
Madonna mit Kind Öl auf Leinwand; gerahmt; 35 × 29 cm
Provenienz
Sammlung des Historienmalers
Josef Kastner (1844–1923), Wien; Versteigerung von dessen Sammlung, Dorotheum, Wien, 4./5./6. Dezember 1911, Lot 172 (Abb. tafel XXIX); Privatbesitz, Österreich
€ 3.000–6.000
Jan Brueghel der Jüngere
(Antwerpen 1601–1678 Antwerpen) und Nachfolge Hendrik van Balen
(Antwerpen 1575–1632 Antwerpen)
Allegorie der Vier Elemente, 1630–35 Öl auf Leinwand; gerahmt; 62 x 106 cm
Provenienz
Dorotheum, Wien, 26. September 2017, Lot 115; österreichische Privatsammlung
Kurz-Gutachten von Dr. Klaus Ertz, Lingen, 19. April 2018, liegt bei.
€ 15.000–30.000

In üppiger Pracht und mit zahllosen Details präsentiert dieses Gemälde die „Allegorie der Elemente“. Das Zentrum bildet dabei die sitzende Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus, Ceres, kenntlich durch das Abundantia-Attribut des überquellenden Füllhorns. Ihr zur Seite gestellt verkörpert eine Meeresgöttin oder Nymphe, wohl Amphitrite oder Galatea, das Element des Wassers. Ceres zu Füßen reicht ihr eine nackte Gestalt, wahrscheinlich Flora, eine Weinrebe. Von den beiden fliegend umschlungenen Gestalten in der linken oberen Ecke hält die eine Frauenfigur eine Fackel. Es handelt sich um die Symbole für Feuer und Luft, Vesta und Juno. Um die Personifikationen herum wird der ganze Artenreichtum des Meeres, Landes und der Luft in unzähligen Fischen, Vögeln und anderen Tieren demonstriert, ebenso wie die Fruchtbarkeit der Erde in Form von Gemüse, Früchten und Blüten (vgl. Klaus Ertz, Jan Brueghel der Ältere (1568–1625). Lingen 2008, Bd. III, S. 1080).
Ihren besonderen Reiz und eine weitere Bedeutungsebene erhält die Komposition durch die Darstellung einer Szene aus dem flämischen Alltag im Hintergrund. „Götter und Menschen befinden sich in ein- und demselben Landschaftsraum. Die Menschen stehen den Göttern nicht fern, sondern sie empfangen ihre Gaben und nehmen sie auch an. Vor den Bauern, die in ihrer Existenz ja ganz besonders von der ‚Magna Mater’ Natur (Ceres) abhängig sind, liegen ebenso Früchte ausgestreut wie vor den Göttinnen. Die Menschen haben sich die Götter geschaffen. Diese können sich nicht verselbständigen, sie werden nicht um ihrer selbst willen abgebildet (wie so oft in der Kunst), sondern wieder in Beziehung zu ihren geistigen Schöpfern, eben den Menschen, gebracht. Die gedankliche Tat des Künstlers ist von großer Tragweite, weil die Götter damit nicht mehr ‚im luftleeren Raum’ hausen, sondern unter den Menschen selbst.“ (Ertz 2008, S. 1084)
Im Jahre 1625 hatte Jan Brueghel der Jüngere nach dem Tod seines Vaters dessen florierende Werkstatt übernommen und erfolgreich weitergeführt. Er griff immer wieder die Themen des Vaters auf und interpretierte diese neu in seiner eigenen Handschrift. Jan Brueghel der Ältere hatte bereits 1604 die Grund-Komposition für die „Allegorie der Elemente“ geschaffen, ein Gemälde das sich heute im Kunsthistorischen Museum, Wien, befindet. Er hatte jedoch schon um 1615 selbst das Thema in einem weiteren Gemälde, heute im Prado, Madrid, variiert (vgl. Ertz 2008, WVZ 518 & 520). Vorliegendes Werk orientiert sich an der Prado-Version und ist zu Beginn der 1630er Jahre entstanden. Wie Dr. Klaus Ertz feststellt sind gerade die stark farbigen, für Jan Brueghel den Jüngeren typischen Farben bezeichnend für diese Zeit des Malers, in der er sich handwerklich vom Vorbild des Vaters zu lösen beginnt. „Das weitumspannende Thema der Allegorie beschäftigt nicht nur Jan Brueghel d.J. während seiner gesamten Schaffenszeit bis weit in die 1650er-Jahre. Es war dies neben den mythologischen und christlichen Darstellungen ein Thema, das die Künstler und ihre gebildeten Kunden (hier vor allem der Adel und der Klerus, die sich diese Bilder leisten konnte) in höchstem Maße interessierte. Nachdem der Vater Jan Brueghel d.Ä. gestorben war, arbeitete auch der Sohn Jan Brueghel d.J. oftmals mit dem Figurenmaler Hendrick van Balen zusammen und natürlich, nach dessen Tod, mit zahlreichen anderen Figurenmalern, deren Werk in der Nachfolge van Balens stand.“ (Gutachten Dr. Klaus Ertz, 19. April 2018)

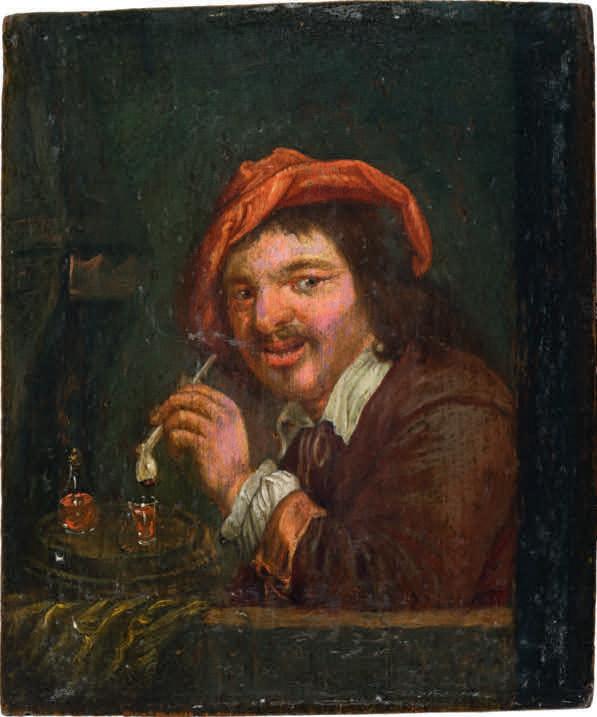

1101
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Pfeifenraucher
Öl auf Holz; gerahmt; 21 × 17,5 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000
1102
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Tischgesellschaft
Öl auf Holz; gerahmt; 32 × 24 cm
Provenienz
Deutsche Privatsammlung
€ 500–1.000


1103
Künstler des 17. Jahrhunderts
Beschneidung Christi
Öl auf Holz; gerahmt; 62,5 × 50 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000
1104
Niederländische
Schule
Drei Kinder, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz; gerahmt; 36,5 × 29,5 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.500–3.000

Erasmus Quellinus der Jüngere zugeschrieben
(Antwerpen 1607–1678 Antwerpen)
Apollo und die Musen am Berg Parnass Öl auf Holz; gerahmt; 75 x 97 cm
Provenienz
Sammlung des Künstlers Georges Dufrenoy (1870–1943); im Erbgang bis 2022 im Besitz seiner Familie; Christies, Paris, 22. November 2024, Lot 137; Österreichischer Privatbesitz
€ 5.000–10.000

1106
Karel
van Mander Umkreis
(Meulebeke 1548–1606 Amsterdam)
Die Predigt Johannes des Täufers in bewaldeter Landschaft Öl auf Holz; gerahmt; 77 x 108 cm
Provenienz
Dorotheum Wien, 18. November 2014, Lot 18; Privatsammlung, Österreich
€ 3.000–6.000
Pieter Coecke van Aelst Umkreis
(Aelst 1502–1550 Brüssel)
Anbetung der heiligen drei Könige, 1541
Öl auf Holz (Triptychon); gerahmt; 102 x 138 cm (aufgeklappt mit Rahmen); 91 x 58 cm (Mittelteil); 92,5 x 25,5 cm bzw. 93,5 x 26 cm (Flügel); Auf der Säule mittig datiert: 1541
Provenienz
Kunsthandel, Bert Winter, Dürnstein, 1986; Privatsammlung, Österreich
€ 35.000–70.000

Pieter Coecke van Aelst zählt zu den prägenden Künstlerpersönlichkeiten Antwerpens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Nach seiner Ausbildung bei Barend van Orley in Brüssel führte ihn eine Italienreise nach Rom, bevor er 1527 in die Niederlande zurückkehrte und der Antwerpener Lukasgilde beitrat, deren Vorsteher er später wurde. Im selben Jahr übernahm er zudem die Malerwerkstatt seines Schwiegervaters Jan van Dornicke (auch bekannt als der Meister von 1518). Dort entstanden gefragte Kompositionen, die in vielfältigen Varianten weitergeführt wurden.
Eine dieser Bildschöpfungen ist der Flügelaltar mit der Darstellung der Anbetung der Heiligen Drei Könige. Vergleichbare Kompositionen finden sich sowohl bei van Aelst als auch bei van Dornicke, deren Werkstattmitarbeitern und Künstler aus dem direkten Umkreis (vgl. Georges Marlier, Pierre Coeck d'Alost. La Renaissance flamande, Brüssel 1966 , Nr. 41–44, 46–49). Besonders markant ist in der Mitteltafel der kniende König im Vordergrund, dessen breitkrempiger Hut wie ein Schild auf seinem Rücken liegt und welcher in zahlreichen Varianten wiederkehrt. Mit seiner kulissenhaften Architektur schafft der Künstler eine raffinierte Bühne für das Geschehen. Details wie die bunt marmorierten Säulen des Baldachins auf der rechten Tafel sowie die lebendige Figurenfülle verleihen dem Altar eine besondere Ausstrahlung.


1108
Gillis Neyts
(Gent 1623–1687 Antwerpen)
Gebirgslandschaft mit Blick auf eine Burgruine Öl auf Leinwand; gerahmt; 44,5 x 61 cm
Signiert rechts unten: G. Neyts.
Provenienz
Dorotheum Wien, 27. März 2003, Lot 378; Privatsammlung, Wien
€ 3.000–6.000
Das vorliegende Gemälde zeigt eine ruhige, romantische Landschaft im Stil der flämischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Gillis Neyts, bekannt für seine detaillierten Landschaftsdarstellungen, vermittelt hier eine idyllische Szenerie: Im Vordergrund sehen wir ein rustikales Bauernhaus mit roten Dachziegeln, das in eine sanfte Hügellandschaft eingebettet ist. Umgeben von Bäumen und üppiger Vegetation, führt ein kleiner Bach durch das Bild, während im Hintergrund die Ruinen von Huy und weitere Gebäude zu erkennen sind. Die Komposition lenkt den Blick in die Tiefe der Landschaft und schafft eine harmonische Atmosphäre.

1109
Künstler des 17./18. Jahrhunderts
Südliche Flusslandschaft mit Brücke und Hirtin
Öl auf Leinwand; gerahmt; 79 x 108 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 3.000–6.000

1110
Georg Gsell zugeschrieben
(St. Gallen 1673–1740 St. Petersburg)
Interieur mit Paar
Öl auf Leinwand; gerahmt; 67 × 82 cm
Rechts unten undeutlich signiert
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.500–3.000
1111
Künstler um 1700
Landschaft mit Staffage
Öl auf Leinwand; gerahmt; 29 × 40 cm
Provenienz
Deutsche Privatsammlung
€ 1.000–2.000


1112
Adriaen Cornelisz Beeldemaker
(Rotterdam 1625–1701 Den Haag)
Hunde in Landschaft
Öl auf Leinwand; gerahmt; 46,5 × 56,5 cm
Rechts unten signiert, z.T. undeutlich: ABeeldem(...)
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000
1113
Künstler des 17. Jahrhunderts
Landschaft mit Jagdbeute
Öl auf Holz; gerahmt; 24 × 26,5 cm
Rückseitig Marke des Panelmachers: 4
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 1.000–2.000



Deutsche Schule
Genreszenen (Pendants), 18. Jahrhundert
Öl auf Kupfer; gerahmt; je 31 x 42 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 3.000–6.000

1115
Jan Wynants Nachfolger
(Haarlem 1632–1684 Amsterdam) und
Johannes Lingelbach Nachfolger
(Frankfurt am Main 1622–1674 Amsterdam)
Dünenlandschaft, 17. Jahrhundert
Öl auf Holz; gerahmt; 32 x 36,5 cm
Provenienz
Dorotheum Wien, 14. Nov. 1989, Nr. 690, Tafel 31; Privatbesitz Österreich
€ 2.500–5.000

(Tournai 1676–1765 Antwerpen)
Flusslandschaft, 17. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 43 x 62,5 cm
Provenienz Privatbesitz Österreich
€ 3.000–6.000
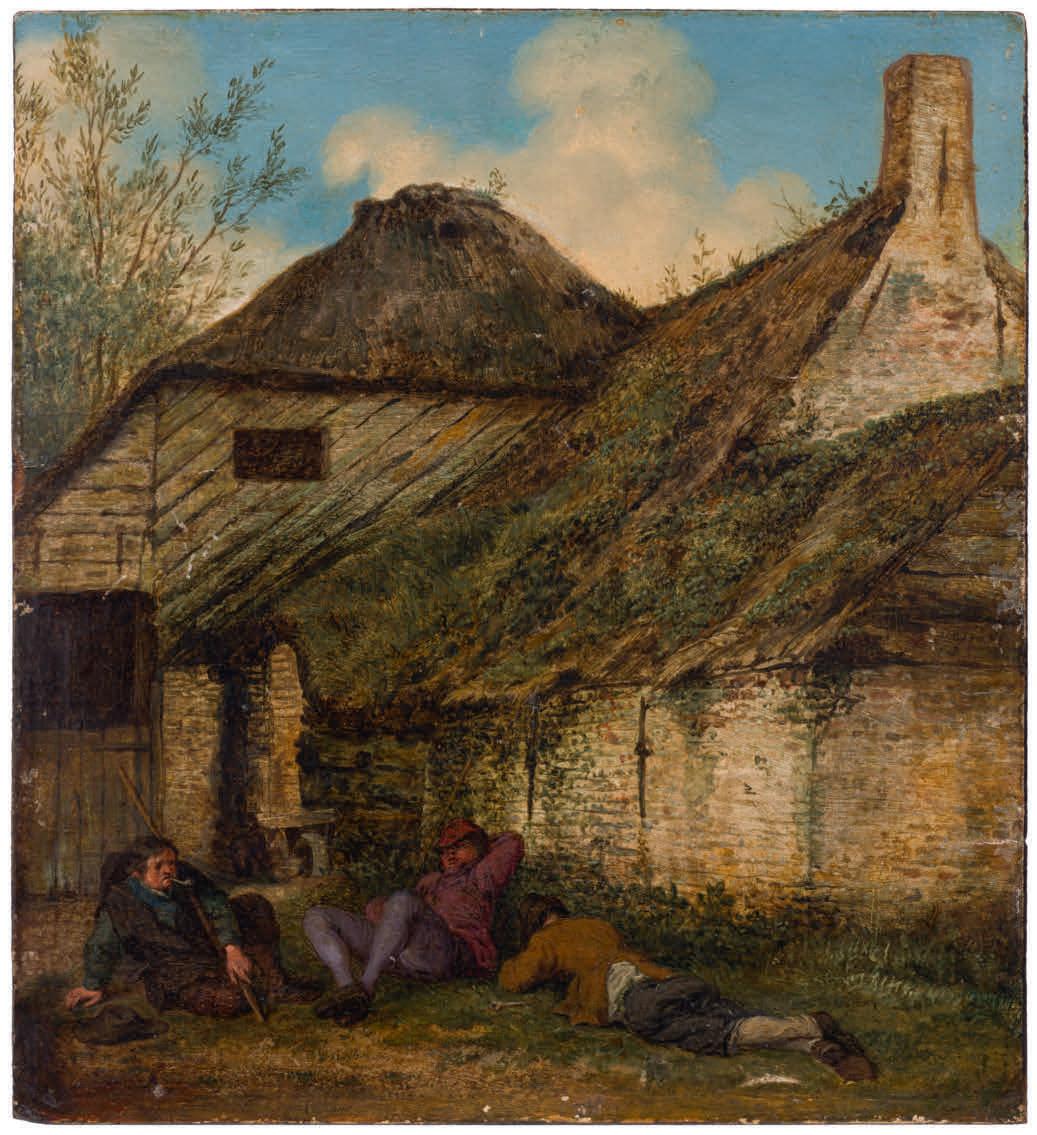
1117
Adriaen Jansz van Ostade Nachfolger
(Haarlem 1610–1685 Haarlem)
Hofansicht mit drei rastenden Bauern
Öl auf Holz; gerahmt; 28 x 25,5 cm
Bezeichnet rechts mittig: A. Ostade
Provenienz
ehemals Sammlung Villefosse (Vente Simon 1817, laut rückseitigem Etikett); Österreichische Privatsammlung
€ 1.500–3.000

1118
Francesco Casanova Nachfolge
(London 1727–1802 Wien)
Gebirgige Flusslandschaft mit Reisenden Öl auf Holz; gerahmt; 53 × 65,5 cm
Provenienz
Dorotheum Wien, 20. März 1995, Lot 42; Privatbesitz, Österreich
€ 2.000–4.000
1119
Künstler um 1700
Landschaft mit Reitern Öl auf Holz; gerahmt; 26 × 45 cm
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.500–3.000


1120
Jan Kobell
(Rotterdam 1800–1838 Rotterdam)
Landschaft mit Hirten
Öl auf Leinwand; gerahmt; 52 × 73 cm
Signiert links unten: J. v. Kobell
Provenienz
Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000
1121
Künstler um 1800
Landschaft mit Gehöft Öl auf Holz; gerahmt; 16,5 × 23,5 cm
Provenienz deutsche Privatsammlung
€ 1.000–2.000


1122
Franz Michael Siegmund von Purgau
(Linz 1677/78–1754 Linz)
Blumenstillleben (Pendants), 1747
Öl auf Leinwand; gerahmt; je 77 x 56 cm
Signiert und datiert rechts unten: V: Purgau / pinxit. (1)747
Signiert links unten: F M S. V Purgau
Provenienz
Österreichischer Privatbesitz; Auktionshaus im Kinsky, Wien, 28. November 2013, Nr. 64; Privatsammlung, Österreich
€ 12.000–24.000



1123
Paul Troger Umkreis
(Welsberg 1698–1762 Wien)
Mater dolorosa betrauert von Engeln mit Leidenswerkzeugen
Öl auf Leinwand; gerahmt;
71,5 × 73,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Wien
€ 1.500–3.000
Die den Betrachter berührende Komposition entspricht Paul Trogers Gemälde in der Benediktinerabtei St. Peter, Salzburg (vgl. Johann Kronbichler, Paul Troger. 1698–1762, Berlin/München 2012, S. 303, G86, Öl auf Leinwand, 178 x 132 cm). Aufgrund des Erfolgs wurde dieses, wie auch sein Gegenstück „Christus am Ölberg“, sowohl von Troger selbst wiederholt, aber auch von Zeitgenossen als Vorlage für weitere Darstellungen verwendet und variiert. Vorliegendes Gemälde gibt das hochrechteckige Format in Salzburg auf einer nahezu quadratischen Leinwand wieder.
1124
Künstler des 18. Jahrhunderts
Maria Magdalena
Öl auf Leinwand; ungerahmt;
70,5 × 55 cm
Bezeichnet links unten: M.J.Schmidt
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 1.000–2.000

1125
Österreichische Schule
Hl. Nikolaus von Myra, 18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 49 × 34 cm
Provenienz
Privatbesitz Österreich
€ 500–1.000
1126
Franz Xaver Hornöck
(Schönau bei Neumarkt an der Rott 1752–1822 Salzburg)
Apollo und Marsyas, 1807
Öl auf Leinwand; gerahmt; 32,5 × 38,5 cm rückseitig signiert und datiert:
F. Xavier Hornöck / Salzburg Pinxit / 1807.
Provenienz
Privatsammlung Österreich
€ 1.000–2.000

Franz Xaver Hornöck (1752–1822) wirkte in Salzburg als Porträtist, Altarbildmaler und Freskant für kirchliche wie weltliche Auftraggeber. Das vorliegende Gemälde zeigt eine seltene Darstellung vom Künstler des Mythos von Apollo und Marsyas nach Ovids Metamorphosen. Im musikalischen Wettstreit triumphiert Apollo durch die Verbindung von Lyraspiel und Gesang über den nur auf den Aulos beschränkten Satyr und demonstriert damit seine göttliche Überlegenheit. Die Szene wird so zum Sinnbild der Macht und Unantastbarkeit des Gottes und dient bis heute als Parabel über das Verhältnis von Schönem und Hässlichem, Ohnmacht und Macht.

Johann Georg Weikert
(Österreich 1743–1799 Wien)
Johann Georg von Grechtler (1705–1780), um 1775 Öl auf Leinwand; gerahmt; 92 x 75,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 2.500–5.000
Die Porträts von k. k. Hofkriegsrat Johann Georg und k. k. General-Feldwachtmeister Georg Anton von Grechtler sind Auftragsarbeiten des beliebten Hofmalers Johann Georg Weikert. Sie verdeutlichen den Wandel von Generation zu Generation: vom detailreichen Auftritt des Vaters als Stratege mit Weltkarte (Lot 1127) bis zur schlichten Eleganz des Sohnes in Uniform (Lot 1128). Beide wählten innerhalb kurzer Zeit den gleichen Porträtisten, der mit dem Bildnis des Vaters wohl auch den Sohn von sich überzeugen konnte. Nach dem kinderlosen Tod Georg Anton von Grechtlers im Jahr 1888 gelangte ein Teil des Besitzes, darunter auch die Gemälde, an die Familie von Troll. Diese ließ sich Anfang des 19. Jahrhunderts ebenfalls porträtieren (Lot 1129), angepasst an den Geschmack der Zeit mit dunklem Hintergrund und engem Bildausschnitt. Carl Eduard Ritter von Troll, noch ein junger Mann in seinem Porträt aus dieser Reihe, führte die Tradition der Familienbildnisse als Erwachsener fort: Auch er ließ vier seiner Kinder Mitte des 19. Jahrhunderts im Porträt verewigen. Als freie Geister im Stil der Romantik werden diese mit idyllischer Naturkulisse dargestellt (Lot 1130). Sie sind in einem ähnlichen Alter wie ihr Vater verewigt worden, aber auch ihre Bildnisse verdeutlichen den Geschmack der Zeit. Das Ensemble zeigt ein selten geschlossenes Zeugnis der Wiener Porträtkunst vom ausgehenden Barock bis hin zum beginnenden 19. Jahrhundert.
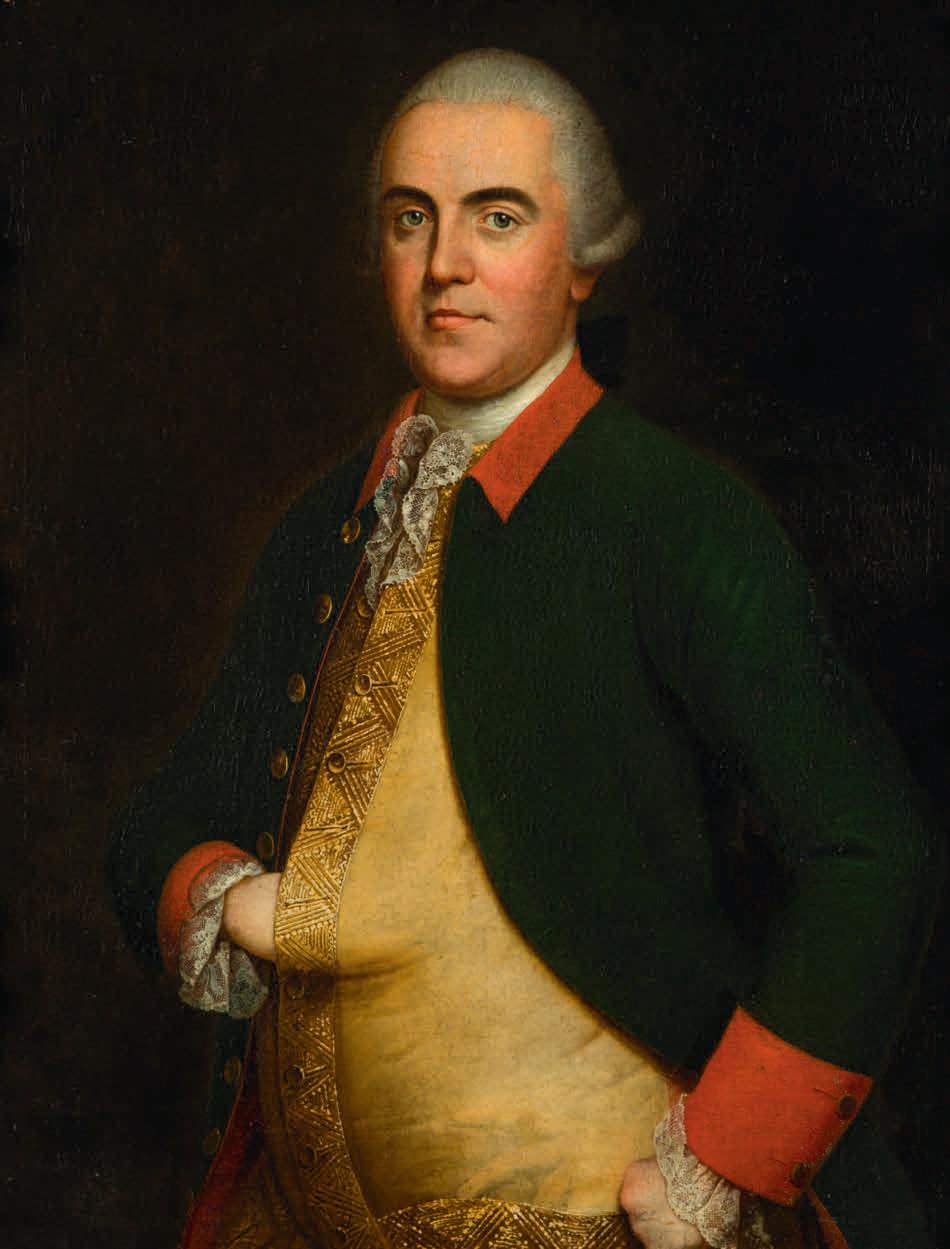
1128
Johann Georg Weikert
(Österreich 1743–1799 Wien)
Georg Anton von Grechtler (1749–1788), um 1780
Öl auf Leinwand; gerahmt; 96,5 x 76 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 1.500–3.000



1129
Künstler um 1800
Drei Porträts der Familie von Troll: Gustav Michael Ritter von Troll (1754–1830), Barbara Edle von Troll, geb. Scheffzig (Schefzig) (1776–1846), Carl Eduard Ritter von Troll (1801–1870)
Öl auf Kupfer; gerahmt; je 37,5 x 28,5 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 2.500–5.000




Johann Manschgo
(Weyer 1800–1867 Troppau)
Vier Kinderporträts der Familie von Troll: Lina von Troll (1827–1852), (Josef Karl) Eduard Ritter von Troll (1834–1865), Otto Ritter von Troll (gest. 1865), Betty (Barbara) von Troll, 1842
Öl auf Holz; gerahmt; je ca. 26 x 21 cm
Rückseitig auf Rahmung jeweils bezeichnet und datiert
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 2.000–4.000

Carl Philipp Schallhas
(Preßburg 1767–1797 Wien)
Südliche Landschaft, 1795 Öl auf Leinwand; gerahmt; 230 x 216 cm
Signiert und datiert unten mittig: C. Schallhas f. 1795
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 3.000–6.000
Carl Philipp Schallhas (1767–1797) bevorzugte in seinem Schaffen die Darstellung der Natur in ihrer gegebenen Form, was sich auch in diesem 1795 datierten Gemälde zeigt. Bekannt für seine feinsinnige Landschaftsmalerei, wirkte der österreichische Maler und Radierer in Wien, wo er zudem an der Akademie der bildenden Künste ausgebildet wurde. Vorliegende Landschaft, entstanden im Jahr seiner Berufung zum Lehrstuhl für Landschaftsmalerei an der Wiener Akademie, gehört zu den wenigen datierten und signierten Werken des früh verstorbenen Künstlers. Ein weiteres Beispiel für seine naturnahe Darstellungsweise findet sich im 1796 datierten Werk „Arkadische Landschaft“ in der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien (Inv.-Nr. 5451).

Johann Knapp
(Wien 1778–1833 Wien)
Blumenstillleben, 1810
Öl auf Leinwand; gerahmt; 55,5 x 45,5 cm
Signiert und datiert rechts unten: Knapp 1810
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 3.500–7.000
Johann Knapp (1778–1833) war ein österreichischer Blumenmaler und Aquarellist, der sich ausschließlich der Darstellung von Pflanzen und der Komposition von Stillleben mit Tieren widmete. Nach ersten Tätigkeiten in einer Tapetenfabrik wurde er Schüler von Johann Baptist Drechsler (1756–1811) und erstellte Mustervorlagen für Blumen, die lange Zeit an der Wiener Akademie Verwendung fanden. Ab 1804 wirkte Knapp als Kammermaler für Erzherzog Anton Viktor (1779–1835) und später auch für Erzherzog Johann (1782–1859). Dabei dokumentierte er unter anderem exotische Pflanzen im Holländischen Garten von Schloss Schönbrunn und die Flora der Alpen künstlerisch. Seine Werke vereinen hohe botanische Präzision mit arrangierten Kompositionen und spiegeln sowohl künstlerisches Talent als auch wissenschaftliches Interesse wider.


1133
Österreichischer Künstler
Verkündigung, 18. Jahrhundert
Öl auf Leinwand; gerahmt; 62,5 × 47,5 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 1.000–2.000
1134
Künstler des 17. Jahrhunderts
Ecce Homo
Öl auf Holz; ungerahmt; 50 × 35 cm
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 500–1.000

1135
Künstler des 18. Jahrhunderts
„Das Pferd des Feldpaters der hochgräfischen von Saurauischen Tiroler Jäger-Compagnie...“
Öl auf Papier auf Karton; gerahmt; 32 × 40 cm
Am unteren Bildrand bezeichnet: Das Pferd des Feldpaters der hochgräfischen von Saurau / ischen Tiroler – Jäger – Compagnie dringt von Sonnenhitze / und Mückenstiche getrieben unaufhaltbar über das Ufer des ausgetretenen Adda Flusses, und wird nebst dem Feldpater von Jo-/hann Klaus Fourier des Herrn Hauptmannes Hallers nur mit / höchster Noth von dem endlichen Hinsturze zurückgerissen.
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 500–1.000
1136
Künstler des 18. Jahrhunderts
Votivbild, 1764
Öl auf Holz; gerahmt; 32 × 47,5 cm
Am unteren Rand bezeichnet: Ex Voto / 1764 / I.M.G.C.W
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 500–1.000
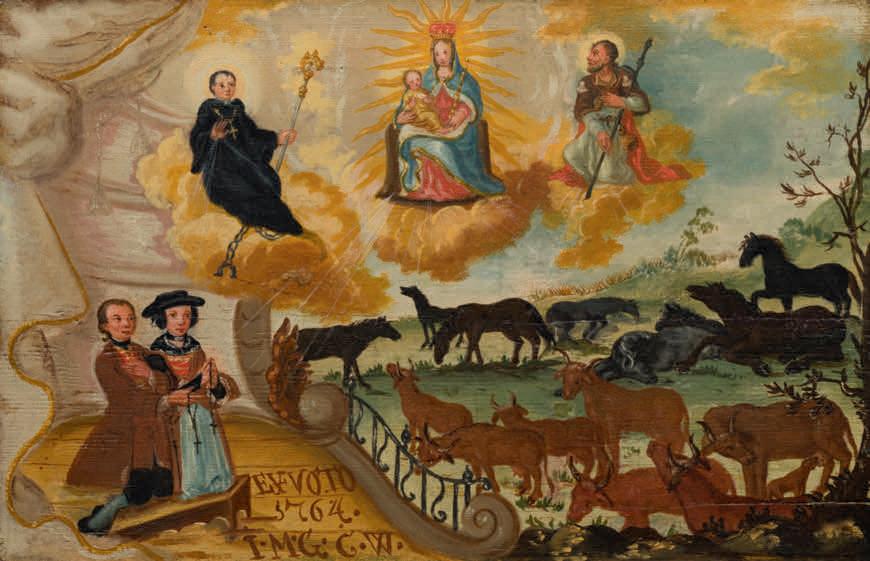
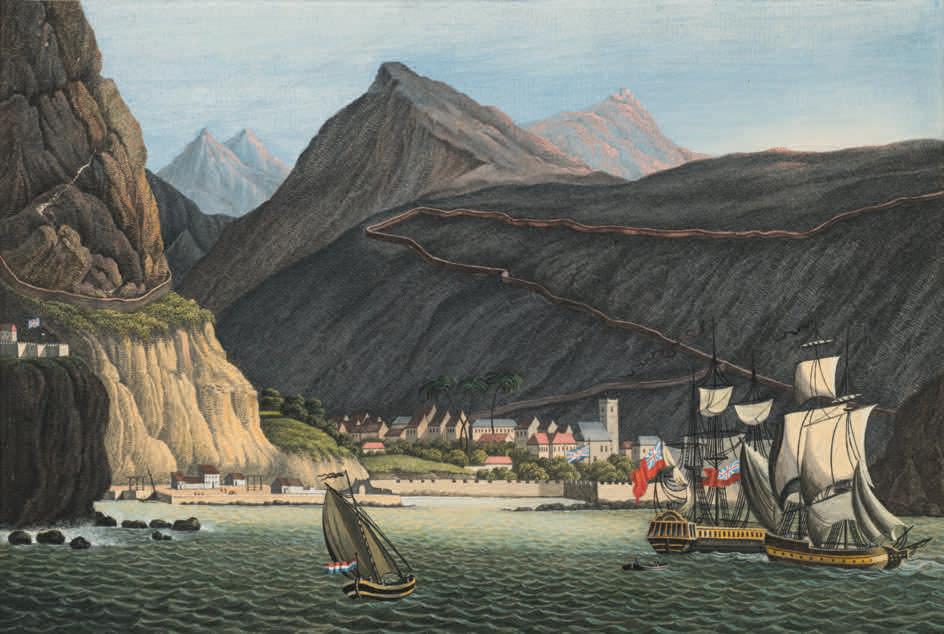
1137
Georg Hutchins Bellasis Umkreis
(1778–1822)
Ansicht von St. Helena
Mischtechnik auf Papier; gerahmt; 21,5 × 30 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 500–500
1138
Künstler um 1800
Heilige Familie mit hl. Johannes und Elisabeth, 1809
Aquarell auf Papier; gerahmt; 28,6 × 47,5 cm
Rechts unten mit brauner Feder bezeichnet: Dessiné par Caroline de SanKvitz d'après un Bas-Relief d'ivoir / Vienne 2. Mai 1809.
Provenienz
Privatbesitz, Österreich
€ 500–1.000



1139
Hans Rottenhammer Umkreis
(München 1564–1625 Augsburg)
Das Urteil des Paris
Feder in Braun, braun laviert, auf Papier, auf getöntes Papier aufkaschiert; gerahmt; 10 × 10,5 cm
Provenienz
Sammlerstempel Ludwig Zatzka (Wien, geb. 1857), Lugt 2672; Privatsammlung, Österreich; Dorotheum Wien, 28. April 2014, Lot 118; Österreichische Privatsammlung
€ 1.000–2.000
1140
Daniel Nikolaus Chodowiecki zugeschrieben
(Danzig 1726–1801 Berlin)
Porträt einer Dame mit Hut (Madame Chodowiecki?)
Rötel auf Papier; gerahmt; 33,7 × 20,9 cm unten bezeichnet, z.T. undeutlich: ...Madm. Chodowiecki / N1032 / Handzeichnungen No...
Provenienz
Prestel, Frankfurt a. M., 12. November 1918, Lot 127; deutsche Privatsammlung
€ 500–1.000

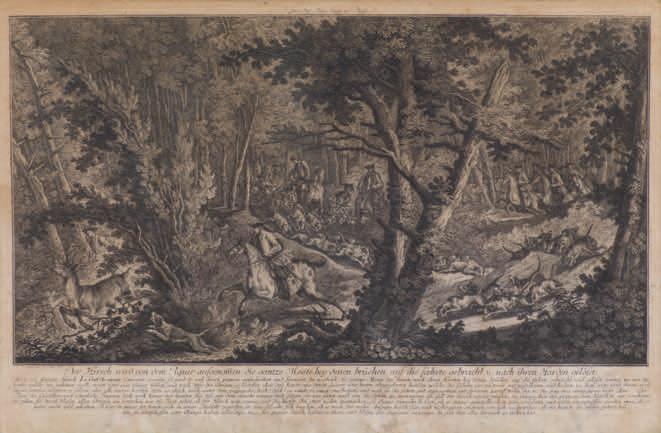

Johann Elias Ridinger
(Ulm 1698–1767 Augsburg)
Konvolut (3 Stück) aus: „Die par force Jagd des Hirschen und deren ganzer Vorgang mit ausführlicher Beschreibung“, Augsburg, 1756 Kupferstiche; ungerahmt
A: Der Hirsch wird von dem Piquer aufgenommen die gantze Meute bey denen brüchen auf die faehrte gebracht u. nach ihren Harden gelöset; 31,5 x 48 cm (Passep.-Ausschnitt)
B: Die Jagd gehet gut die Hunde haben den Hirsch en vüe und jagen aus volle(m) Halse; 31,5 x 48 cm (Passep.-Auschnitt)
C: Das Cureé; 32 x 48,5 cm (Passep.Ausschnitt)
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 300–600

1142
Künstler um 1800
Schloss Aumühle, 1783
Feder laviert auf Papier; gerahmt; 38 × 52 cm
Am unteren Rand bezeichnet: Vue de la Terre Aumühl en Autriche / Dessinec le 3rd Janvier 1783 (...)ar / Josephe Högelmüller
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 300–600
1143
Peter Johann Nepomuk Geiger (Wien 1805–1880 Wien)
Schlacht bei Pressburg (am 4. Juli 907)
Feder in Schwarz auf Papier; gerahmt; 28,5 × 39 cm
Provenienz
österreichischer Privatbesitz
€ 500–1.000
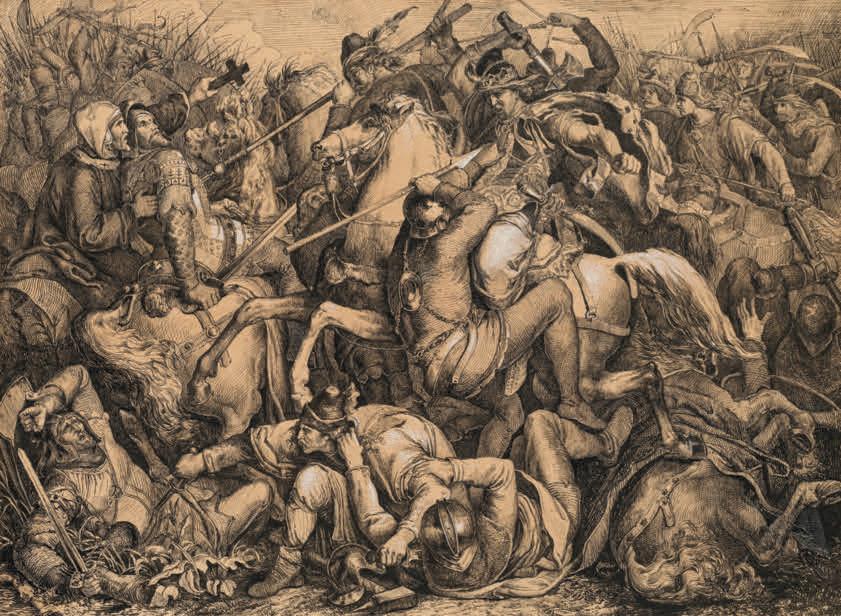
Sebastián de Córdoba Sacedo
Las obras de Boscan y Garcilasso trasladadas en materias Christianas y religiosas, por Sebastia(n) d(e) Cordovavezino d(e) la ciudad de Hubeda dirigidas al Illustrissimo y Reverendissimo señor do(n) Diego de Couarrubias, obispo de Segouia presidente del consejo Real.&c., Saragossa, Juan Soler, 1577. (Titel), 12 nicht nummerierte Blätter, 299 (richtig 292) nummerierte Blätter, 6 nicht nummerierte und zwei weiße Blätter; zahlreiche Vernummerierungen mit alten handschriftlichen Korrekturen und Ergänzungen; leicht fleckig; neuer Pergamentband mit altem Material, handschriftlicher Rückentitel, mod. Kartonschuber, 12°. Zweiter, sehr seltener Druck, der erste ist 1576 in Granada erschienen (Gallardo, II, Nr. 1900; Salvá, I, Nr. 547).
Provenienz
Privatbesitz, Wien
Literatur
B. J. Gallardo, Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos, II, 1863, Nr. 1901; P. Salvá y Mallen, Catalogo de la Biblioteca de Salvá, I, 1872, Nr. 548; J. Brigante, Diccionario espasa literatura española, 2003, S. 219; J. L. Alborg, Historia de la literatura española, I, 1969, S. 660, S. 913; J. G. Lopez/E.FGosalba/G.Pontón, Historia de la literatura española, II, 2013, S. 464 f.
€ 1.000–2.000
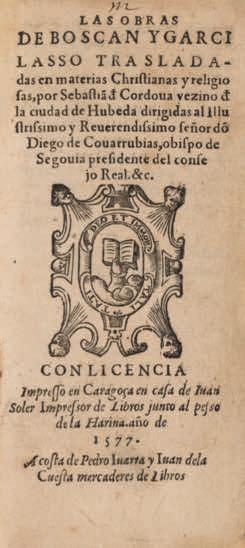
Eine Sammlung der Gedichte des Sebastián de Córdoba Sacedo (Úbeda, Jaén 1545 ? – 1604 ?), der erstmals die Liebes- und Schäferpoesie der beiden bedeutenden spanischen Lyriker Juan Boscán Almogáver (um 1490–1542) und Garcilaso de la Vega (1503–1536) auf eine religiöse Ebene hob und verwandelte („trasladadas en materias Christianas y religiosas“) und von wesentlichem Einfluß auf die Lyrik des großen spanischen Mystiker und Dichter Juan de la Cruz (1542–1591) gewesen ist.
„Und schließlich muß hier Sebastián de Córdoba genannt werden, der nichts weniger unternimmt als die Christianisierung dieser Liebeslyrik: Die neuplatonische Liebessehnsucht nach der Welt des Ideals und der Ideen wird kurzerhand moralisch interpretiert ... Das Vorhaben scheint tollkühn und gewaltsam, doch Sebastián de Córdoba, von dem man mit Ausnahme seines Geburtsortes Úbeda kaum etwas weiß, verfolgt seine didaktische Absicht mit verblüffender Konsequenz ... Das Ganze mutet an wie der verzweifelte Versuch eines dichtenden Theologen, die Diesseitigkeit der Welt und der Liebe wieder unter die Vormundschaft der Kirche zu stellen, wenn auch mit höchster und sogar poetischer Raffinesse. Und doch ist diese traslatio amoris von großer Bedeutung für die Lyrik der Zeit, denn sie bereitet den Weg für die mystischen Liebesgedichte eines Heiligen: San Juan de la Cruz“ (Hans-Jörg Neuschäfer/ Herausgeber, Spanische Literaturgeschichte, 2011, S. 106).
1145
Endter-Bibel
Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrift, Altes und Neues Testaments, Verteutscht von ... Martin Luther ... auf Verordnung ... Ernsts, Hertzogen zu Sachsen ..., Nürnberg, Johann A. Endter Sohn und Erben 1720 Kupfertitel, Titel, (119), 6, (3), 170, (2), 288 pp., Titel, 485 pp., Tite, 417, (16) pp., 39 Kupfertafeln, 5 Kupfer-Falttafeln; Ledereinband, blindgeprägtes Rückenschild, blindgeprägter Buchdeckel, 8 Eckbeschläge, 2 Deckelbeschläge, beschädigte und fehlende Schließbeschläge, leicht beschmutzt und berieben, leicht gelockert; z.T. restaurierte Seiten, stockfleckig, wasserfleckig, etwas vergilbt, gr. 2° (46 x 30 cm)
Provenienz Privatbesitz, Österreich
€ 500–1.000
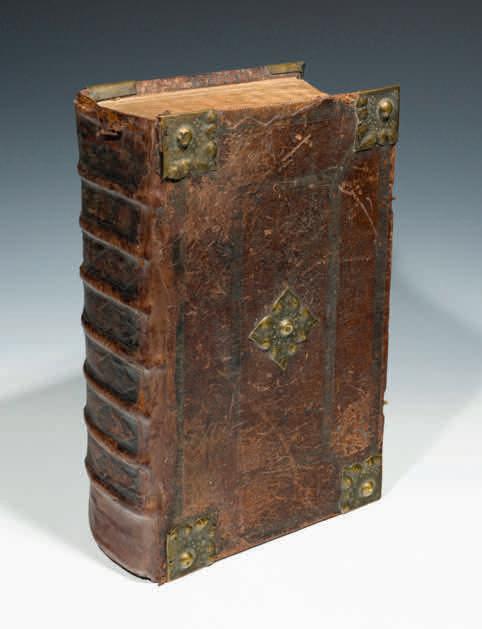
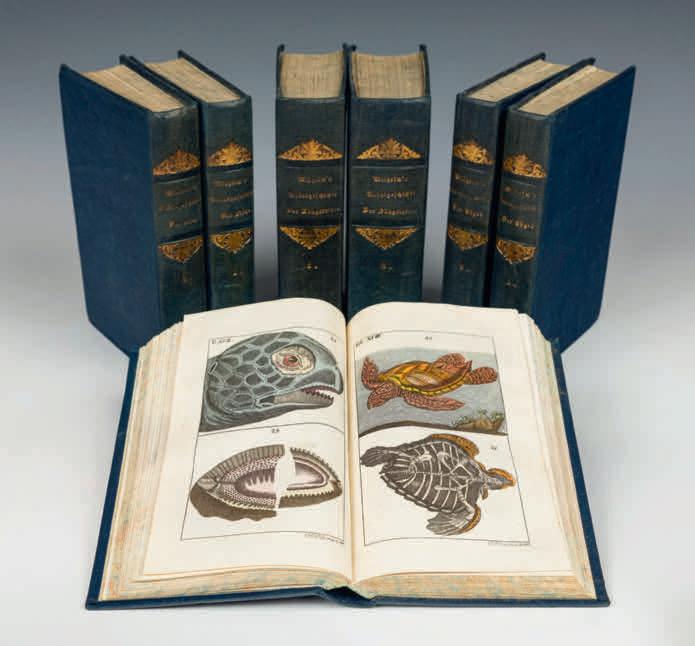
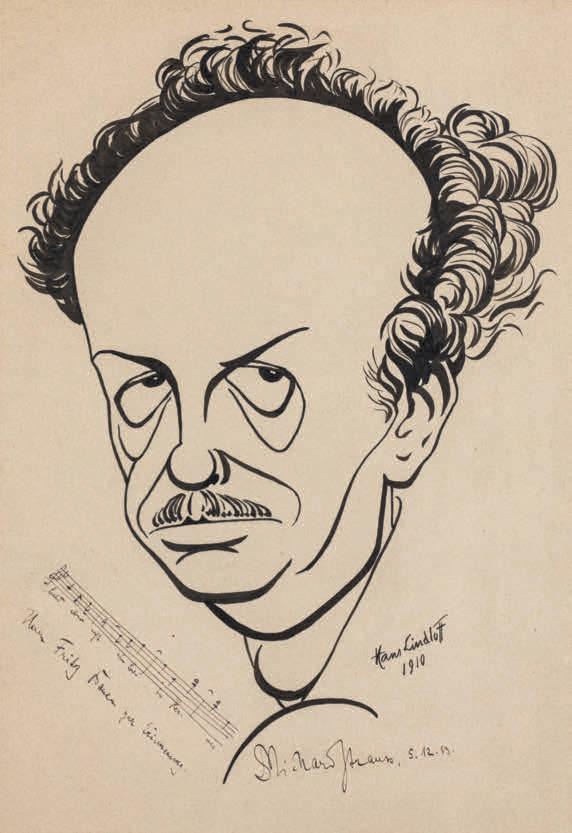
1146
Gottlieb Tobias Wilhelm (1758–1811)
Unterhaltungen aus der Naturgeschichte (7 Bände: Die Amphibien, Der Fische erster Theil, Der Fische zweyter Theil, Der Vögel erster Theil, Der Vögel zweyter Theil, Der Säugethiere erster Theil, Der Säugethiere zweyter Theil), Wien, gedruckt auf Kosten des Herausgebers bzw. Anton Pichler, 1832 zahlreiche kolorierte Kupfertafeln; Leineneinbände, goldgeprägte Rückenschilder, blindgeprägte Buchdeckel, marmorierte Buchschnitte, 8° (19 x 12,5 cm)
Provenienz
Privatsammlung, Österreich
Literatur
Nissen, Vogelb. 988; Nissen, Zool. 408
€ 1.000–2.000
1147
Richard Strauss
(München 1864–1949 GarmischPartenkirchen) und Hans Lindloff
(Berlin 1878–1960 Berlin)
Karikatur Richard Strauss mit eigenhändigem Notenzitat und Widmung, 1910/1913
Feder in schwarz, Tusche; gerahmt; 36 × 25 cm (Passep.-Ausschnitt)
Signiert und datiert rechts unten: Hans Lindloff 1910; eigenhändige Widmung und mittig
Unterschrift von Richard Strauss: „Herrn Fritz (...) zur Erinnerung“ / Richard Strauss 5.12.13 eigenhändiges Notenzitat aus der Oper Ariadne auf Naxos: „bald aber naht ein Bote, Hermes“
Provenienz
österreichische Privatsammlung
Literatur
Vergleiche: Roswitha SchlöttererTraimer, Richard Strauss in der zeitgenössischen Karikatur. In: Akademie Aktuell. Zeitschrift der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Hoffmann (Hg.), Ausgabe 02/2011, S. 24–27, Abb. 3, S. 27. € 2.500–5.000


Zeichnungen & Druckgrafik (Kat.-Nr. 1301–1336)
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Zustand/Beschreibung: Die Kunstobjekte werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich in der Ausstellung befinden. Beschädigungen und Mängel sind im Katalog nicht angegeben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass keine Zustandsberichte erstellt werden können. Wir empfehlen daher, dass die Kunstobjekte durch Sie selbst oder einen professionellen Berater besichtigt und geprüft werden. Nachträgliche Reklamationen wegen Schäden, Mängeln, unrichtiger Beschreibung, Echtheit oder Erhaltungszustand können wir bei diesen – durchwegs gebrauchten – Gegenständen nicht berücksichtigen. Konvolute: Weitere Fotos finden Sie unter www.imkinsky.com


1301
Albrecht Dürer u.a. (Nürnberg 1471–1528 Nürnberg)
Ritter und Landsknecht (wohl 16./17. Jh.); 26 Nachdrucke (wohl Gotha 1808/1810), 58 Phototypien (Berlin 1886) (Konvolut 85 Stück) zwischen 8,5 × 8,5 cm und 69,5 × 101,5 cm
Ritter und Landsknecht, wohl 16./ 17. Jahrhundert, Holzschnitt auf Papier, 39,3 x 28,1 cm, aufkaschiert, bis zur Darstellung beschnitten; ungerahmt
26 Neu- bzw. Nachdrucke des 19. Jh. nach Dürer und seinem Umkreis (wohl aus: Becker, Rudolph Zacharias Holzschnitte alter deutscher Meister in den Original-Platten gesammelt von Hans Albrecht von Derschau, Gotha 1808/ 1810); diverse Drucktechniken, ungerahmt; z.T. in Passepartout, zwischen 8,5 cm x 8,5 cm und 69,5 cm x 101,5 cm
58 Blätter, lose aus: Vier Holzschnittfolgen –Phototypisch Nachgebildet in der Grösse der Originale, Albrecht Dürer, Bruno Meyer, Berlin 1886 (Titelblatt fehlt)
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500
1302
Hans Sebald Lautensack (Bamberg 1524–1561/66 Wien),
Pieter de Witte, genannt Peter Candid (Brügge 1548–1628 München) u.a.
Druckgrafiken (Konvolut 10 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 5 × 27,5 cm und 31,5 × 38,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500


1303
Daniel Hopfer
(Kaufbeuern 1470–1536 Augsburg)
Frau Venus mit Amor und Teufel
Radierung; ungerahmt; 22,1 × 15,7 cm
monogrammiert unten mittig: D.H.
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 250
1304
Hendrick Goltzius
(Mühlbrecht (Venlo) 1558–1617 Haarlem)
Der große Fahnenträger, 1587 Kupferstich, Wasserzeichen (Bekröntes Wappen mit Lilie); ungerahmt; 28,4 × 19,1 cm
Bezeichnet mittig unten: Ao1587. HGoltzius fe.
Inschrift in der Platte: Signifer ingentes animos, et corda ministro, // Me stat stante phalanx, me sugiente fugit.
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 300
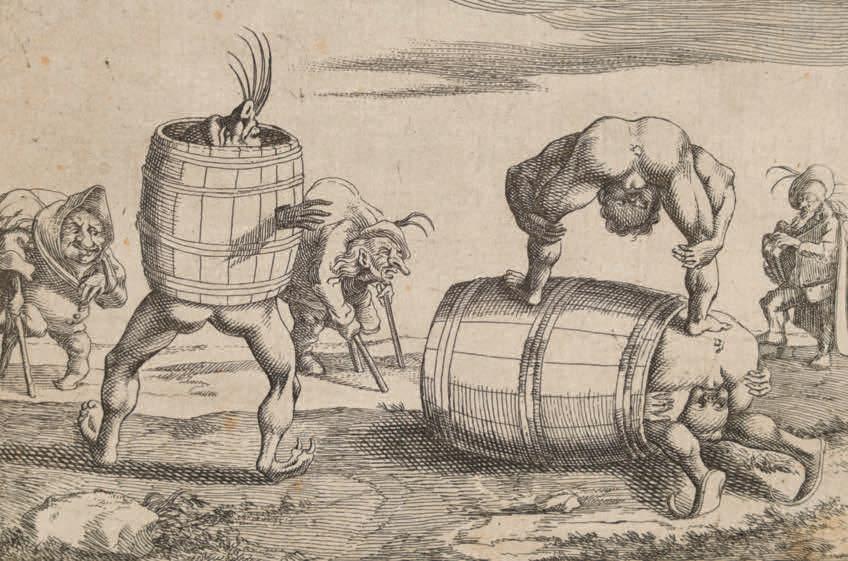
1305
Venezianische Schule
Allegorie, 17./18. Jahrhundert
Kupferstich, Wasserzeichen; ungerahmt; 10 × 15 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 250
1306
Druckgrafik nach Gemälden Alter Meister
Werke nach u.a. Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rjin, Raffaello Sanzio da Urbino, Frans Hals (Konvolut 74 Stück), 18.–20. Jahrhundert diverse Drucktechniken; ungerahmt, eines in Passepartout; zwischen 19,5 × 13,5 cm und 92 × 66 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350
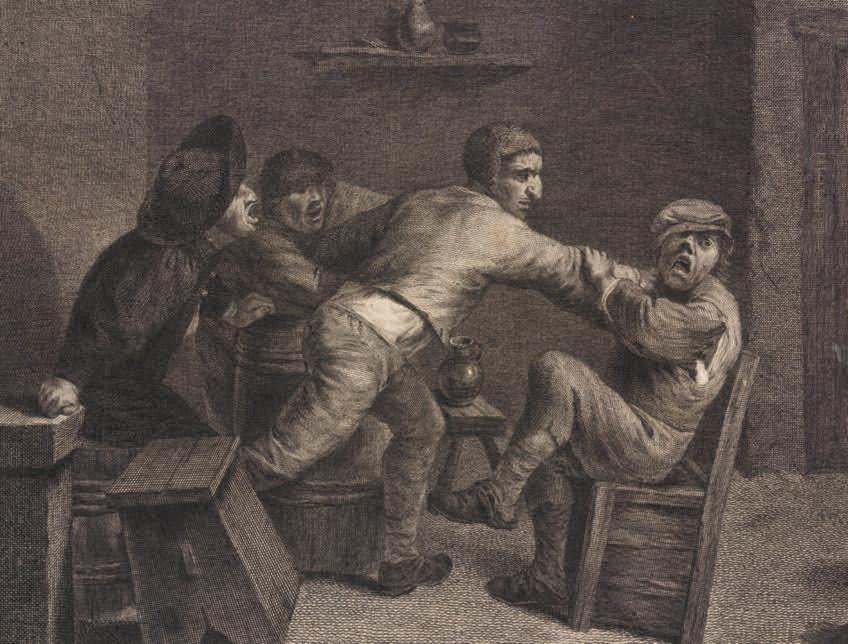

1307
Thomas Wyck (Beverwijk 1616/21–1677 Haarlem), Johann Heinrich Roos (Otterberg 1631–1685 Frankfurt a. M.), Stefano della Bella (Florenz 1610–1664 Florenz) u.a.
Landschafts- und Tierdarstellungen (Konvolut 8 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt; zwischen 6 × 11,5 cm und 29,5 × 17,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500
Adriaen Jansz van Ostade (Haarlem 1610–1685 Haarlem), Rembrandt Harmensz. van Rijn (Leiden 1606–1669 Amsterdam), Hendrick Goltzius Mühlbrecht (Venlo) 1558–1617 Haarlem) u.a
Druckgrafik (Konvolut 11 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 13 × 8,5 cm und 44,5 × 52 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500

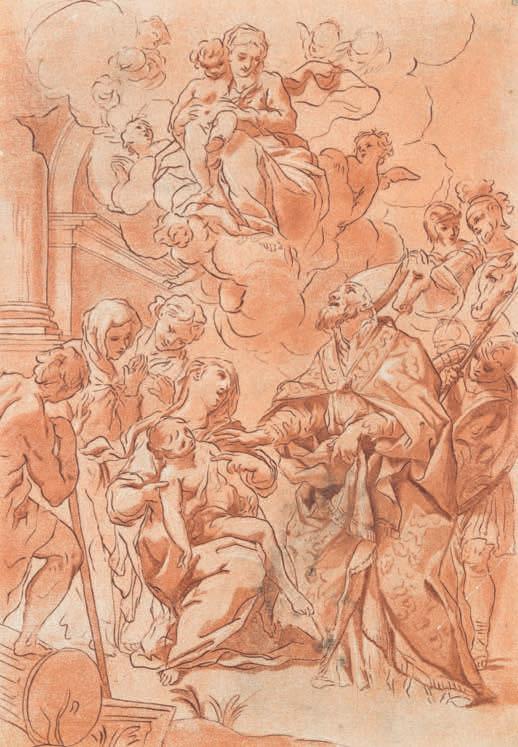
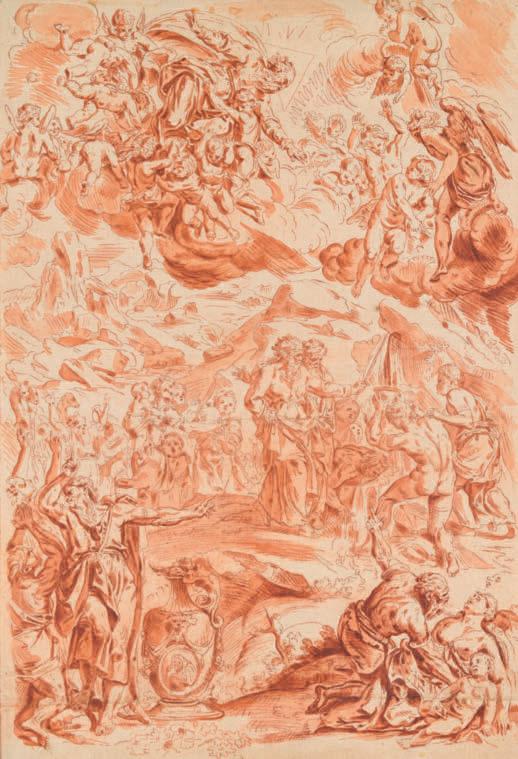
Antonio Domenico Gabbiani (Florenz 1652–1726 Florenz), Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702–1788 Florenz), Guido Reni (Calvenzano 1575–1642 Bologna) u.a.
Druckgrafiken (Konvolut 19 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 17 × 11,5 cm und 44 × 57,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500
1310
Raymond Lafage zugeschrieben
(Lisle 1656–1690 Lyon), Jean Lepautre (Paris 1618–1682 Paris), Claude Lorrain (Chamagne 1600–1682 Rom) u.a.
1 Zeichnung (Raymond Lafage zugeschrieben, Moses Quellwunder), 7 Druckgrafiken
Kreide, Bleistift, laviert auf Papier; diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout, zwischen 18 x 23,5 cm und 42 x 66 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500

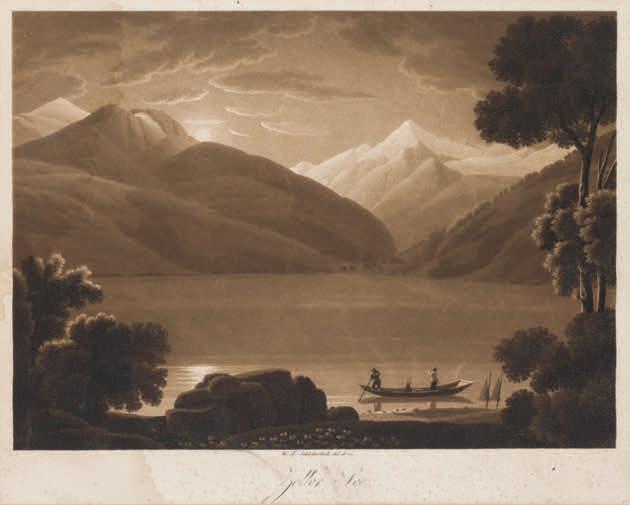

1311
Künstler des 18./19. Jahrhunderts
Landschafts- und Tierdarstellungen u.a.
R.C. Carey, Philipp Ferdinand de Hamilton, Johann Elias Ridinger, Thomas Smith of Derby, Christoph Nathe, Eugéne Bléry, G. Knorr, Karl Russ (Konvolut 20 Stück)
Diverse Drucktechniken; z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 11 × 11 cm und 39 × 54 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500
1312
Friedrich Wilhelm Schlotterbeck
(Härkingen/Solothurn 1777–1819 Wien)
Zeller See, Erlaufsee, St. Leonhard in Reith bei M. Zell (Konvolut 3 Stück)
Aquatinta; ungerahmt, 2 in Passepartout; 35,5 × 51,2 cm bzw. 42 × 54,5 cm bzw. 34,5 × 49 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350
1313
Wien Ansichten
Ansichten der Stadt Wien u.a. (Konvolut 14 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 17,5 × 23 cm und 53,5 × 61 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 250


1314
Johann Georg Hertel (Augsburg um 1701-um 1760 Augsburg), Jeremias Wolff (Deutschland um 1670–1724 Augsburg),
Johann Christoph Erhard (Nürnberg 1795–1822 Rom) u.a.
Druckgrafiken (Konvolut 23 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 12,5 × 12,5 cm und 31 × 36,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350



1315
Norbert Joseph Karl Grund (Prag 1717–1767 Prag), Christian Wilhelm
Ernst Dietrich (Weimar 1712–1774 Dresden), Wenzel Hollar (Prag 1607–1677 London) u.a.
Druckgrafiken (Konvolut 8 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 10 × 17,7 cm und 53,5 × 41 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 250


1316
Kaiserhaus
Schlachten und höfische Szenen (Konvolut 12 Stück), 16.–18. Jahrhundert
Diverse Drucktechniken; ungerahmt; zwischen 16,2 × 25 cm und 37,5 × 58 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
1317
Kaiserhaus
Porträtdarstellungen, u.a. Kaiser Rudolf II., Matthias I., Leopold I., Ferdinand II., Karl VI., Ferdinand III., Stammbaum Archiduces Austriae (Konvolut 16 Stück), 16./17. Jahrhundert
Diverse Drucktechniken; z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 15,5 × 10 cm und 67,5 × 49 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
Weitere Fotos finden Sie unter: imkinsky.com

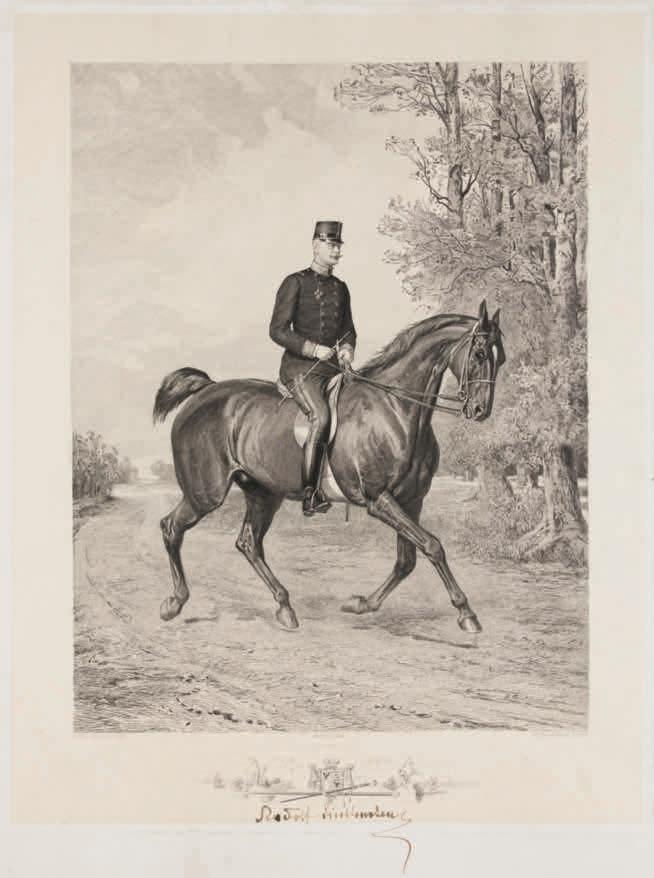
1318
Adel Europa
Porträtdarstellungen aus Deutschland, Frankreich, England,..., u.a. Graf Boris Petrowitsch Scheremetew, König Vladislaus von Polen, Arnold von Winkelried, Carl Gustaf Wrangel, König Wiliam II Orange, Francis Drake, Herzog Adolf Frederik von Cambridge, Herzog von Wellington, Königin Victoria von England, Wilhelm I. (Niederlande), Graf von Ostermann Tolstoy etc. (Konvolut 108 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt; zwischen 11 × 7 cm und 77 × 59 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 350
1319
Familie von und zu Liechtenstein
Porträtdarstellungen der Familie von und zu Liechtenstein, u.a. Leopoldine von Liechtenstein, Fürst Louis von Liechtenstein, Fürst Franz Josef I. von Liechtenstein, Alois Prinz von Liechtenstein, Eduard Fürst zu Liechtenstein (Konvolut 7 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt; zwischen 31 × 23 cm und 78 × 62,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
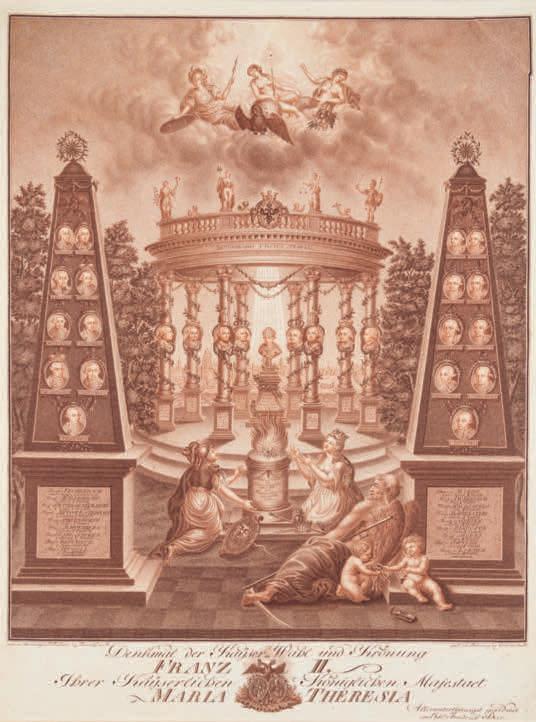
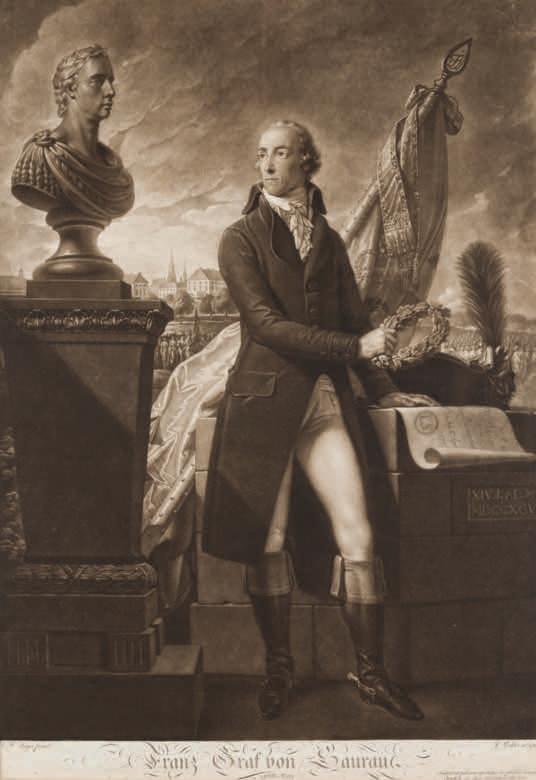
1320
Kaiserhaus 18. Jahrhundert
Porträtdarstellungen u.a. Kaiserin Maria Theresia, Kaiser Franz Stefan, Joseph II. (Konvolut 16 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 12,5 × 7,5 cm und 83 × 61 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
1321
K.u.K. Adel
Porträtdarstellungen, u.a. von Mitgliedern der Familie Sauar, Loudon, Hohenlohe, D´Orsay, Zichy zu Zich und Vásanykeö, Kray von Krajowa (Konvolut 21 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 16,5 × 10 cm und 73,5 × 51 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
Weitere Fotos finden Sie unter: imkinsky.com

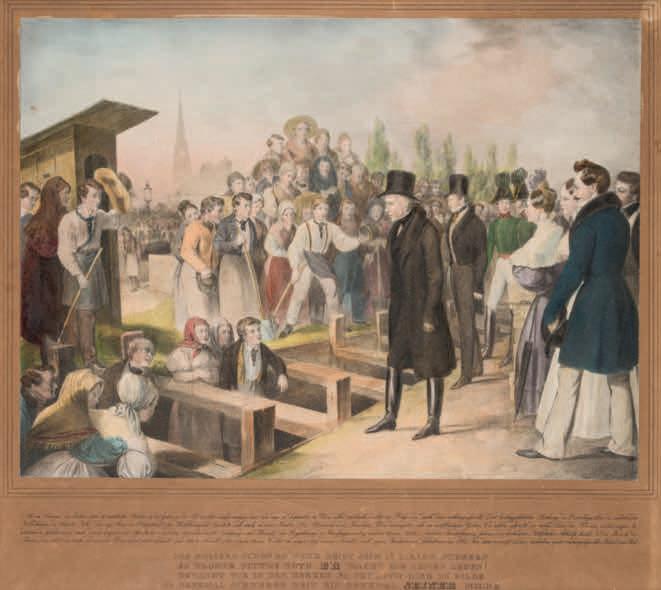
1322
Erzhaus Habsburg-Lothringen
Porträtdarstellungen u.a. von Erzherzog Johann, Erzherzog Carl, Erzherzog Rudolf, Erzherzog Ludwig, Erzherzog Anton Viktor, Erzherzogin Maria Dorothea, Erzherzog Rainer, 19. Jahrhundert
Diverse Druckgrafiken; ungerahmt, z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 13,5 × 11 und 64 × 70,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500
1323
Kaiserhaus 19. Jahrhundert
Porträtdarstellungen u.a. von Kaiser Franz II. (I.), Franz Joseph, Ferdinand, Max von Mexico, (Konvolut 40 Stück), 19. Jahrhundert
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 15 × 12,5 cm und 77,5 × 58,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500


1324
Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph u.a.
Porträtdarstellungen (Konvolut 31 Stück), 19. Jahrhundert
Diverse Drucktechniken; z.T gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 18,5 × 13 cm und 75 × 55 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
1325
Johann Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz
Porträtdarstellungen (Konvolut 15 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 21,2 × 14,5 und 97 × 68 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 250
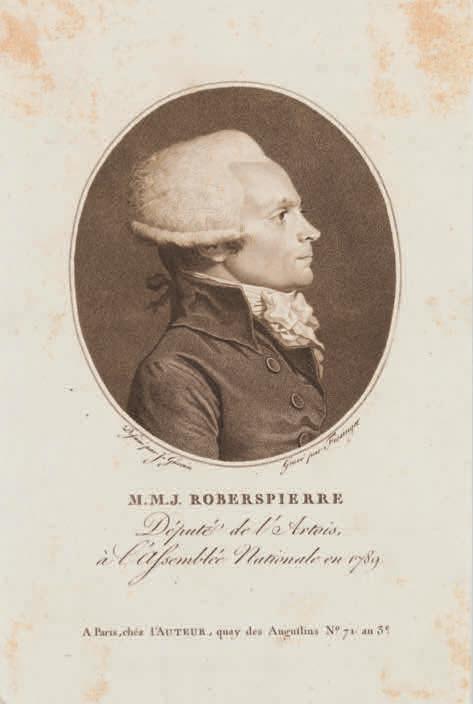

1326
Franz Gabriel Fiessinger (Offenburg 1723–1807 London)
Bildnisse der französischen Nationalratsabgeordneten der Jahre 1789 bis 1791: M.M.J. Roberspierre, Jean Rewbel, A. P. J. M. Barnave, Victor Pierre Malouet, Charles Lameth, Alexandre Lameth, Jérôme Petion, Pierre Louis Roederer (Konvolut 8 Stück)
Stich; ungerahmt; je 16,5 × 11 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350
1327
Johann Hieronymus Löschenkohl
(Elberfeld 1753–1807 Wien),
Johann Ernst Mansfeld (Prag 1739–1796 Wien),
Jakob Adam (Wien 1748–1811 Wien) u.a.
Porträts aus Kaiserhaus, Adel und Gesellschaft, u.a. Erzherzog Leopold, Friedrich von Anhalt, General Elliot, Elisabeth Wilhelmine Louise Prinzessin von Würtemberg, Anton Raphael Mengs, sowie 6 Schattenrisse (Konvolut 47 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt; je ca. 14,5 × 8,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500



1328
Künstler um 1800
Portätdarstellungen (Konvolut 3 Stück)
Kohle auf Papier; ungerahmt; 53 x 40 cm bzw. 47,1 x 39 cm bzw. 53 x 41,1 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
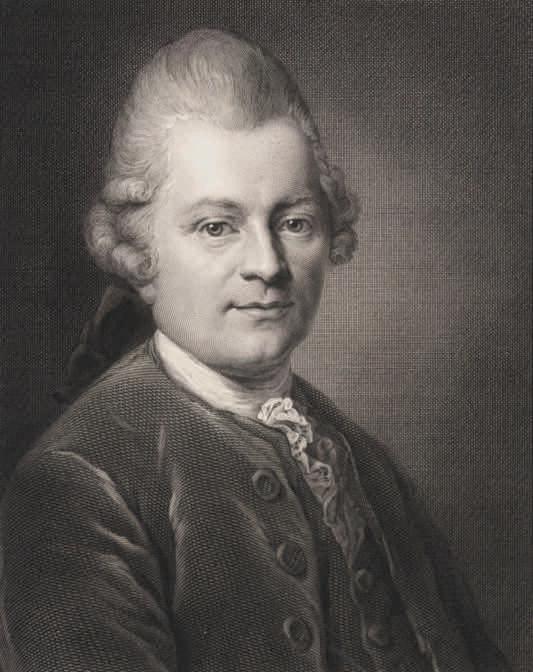

1329
Wissenschaft, Künste und Politik
Porträtdarstellungen u.a. von Gotthold Ephraim Lessing, Albrecht Dürer, Martin Luther, Thomas Moore, Johann Hieronimus Schröter, A. Trembley, Gabriel Sulzer, Torquato Tasso, Michelangelo (Konvolut 94 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt; zwischen 13 × 8,5 cm und 61 × 48 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350
1330
Schriftsteller, Schauspieler und Theater
Porträtdarstellungen u.a. Franz Grillparzer, Ferdinand Raimund, Frederike Kronau, Josefine Gallmeier, Marie Gestinger (Konvolut 15 Stück)
Diverse Drucktechniken; ungerahmt, z.T. gerahmt; zwischen 20 × 14 cm und 48 × 62 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350

1331
Reinier Vinkeles
(Amsterdam 1741–1816 Amsterdam)
Felix Meritus Auditorium, 1794
Kupferstich; ungerahmt in Passepartout; 50 × 67,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500
1332
Reinier Vinkeles
(Amsterdam 1741–1816 Amsterdam)
Der Zeichensaal, 1801
Radierung und Kupferstich; ungerahmt in Passepartout; 49,5 × 67,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
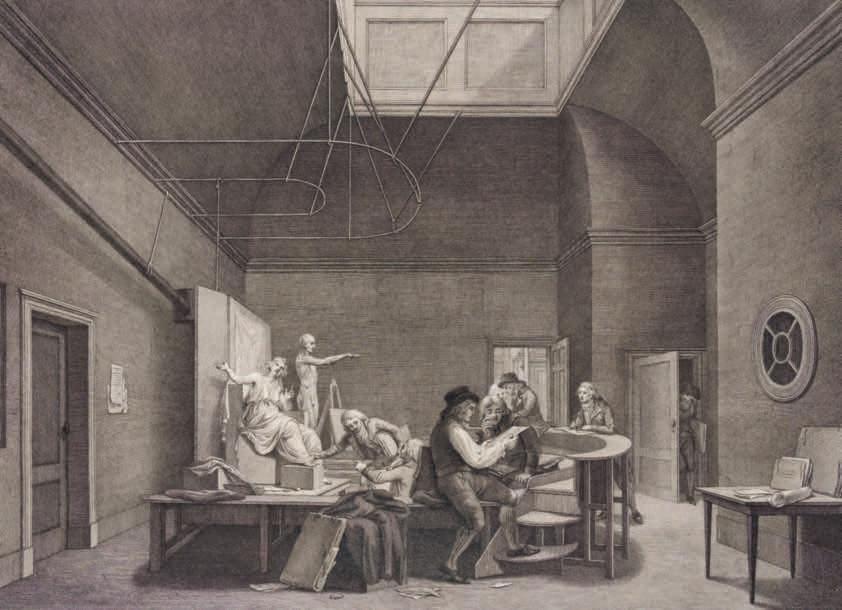


1333
Komponisten und Musiker
Porträtdarstellungen, u.a. Franz Liszt, Richard Wagner, Eduard Strauss (Bleistiftzeichnung), Johann Strauss, Richard Strauss, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Christoph von Gluck, Carl Maria von Weber, Bedrich Smetana, Ferdinand Michl, Gioachino Rossini (Konvolut 30 Stück)
1 Bleistiftzeichnung (Eduard Strauss), 29 Druckgrafiken; z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 18,8 × 14,8 cm und 55,5 × 71 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 350
1334
Anton Zampis
(Wien 1820–1883 Wien)
Soirée im Wiener Volksgarten mit einem Konzert, dirigiert von Johann Strauss
Aquarell, Bleistift auf Papier; gerahmt; 29,5 × 41 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung
Wolfdietrich Hassfurther
Rufpreis € 500

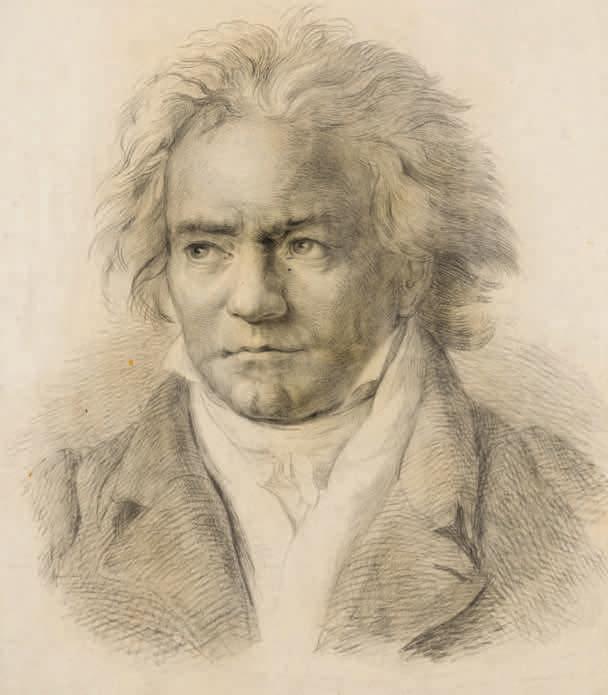
1335
Wolfgang Amadeus Mozart
(Salzburg 1756–1791 Wien)
Porträtdarstellungen (Konvolut 3 Stück)
1 Zeichnung (Feder auf Papier in KupferstichMedaillon), 2 Druckgrafiken (Edme Quenedey & Lazarus Gottlieb Sichling); ungerahmt; zwischen 19,5 × 14,9 cm und 33,5 × 25,5 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500
1336
Ludwig van Beethoven
(Bonn 1770–1827 Wien)
Porträtdarstellungen (Konvolut 6 Stück) 1 Zeichnung (Kohlestift auf Papier), 5 Druckgrafiken; ungerahmt z.T. gerahmt, z.T. in Passepartout; zwischen 24 × 17,5 cm und 45 × 39 cm
Provenienz
Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther Rufpreis € 500 Weitere Fotos finden Sie unter: imkinsky.com