







Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit im Bauwesen – Ein Zusammenspiel mit Zukunftspotenzial
Die Bauindustrie steht vor grossen Herausforderungen: Effizienzsteigerung Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit nachhaltigen Bauens. Hier spielen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle, da sie die Branche grundlegend verändern könnten. KI-gestützte Planungsprozesse und digitale Zwillinge ermöglichen es, Bauprojekte präzise zu modellieren und dabei Energieverbrauch und Materialeinsatz zu optimieren. Gleichzeitig könnten smarte Technologien Baustellen sicherer und produktiver gestalten. Doch warum geht der digitale Wandel in der Bauwirtschaft so langsam voran, obwohl das Potenzial für Effizienzgewinne und Nachhaltigkeit enorm ist?
Ein tieferer Blick zeigt, dass verschiedene Faktore n das Vorankommen hemmen. Gründe hierfür sind einerseits die hohe Fragmentierung der Branche, die durch viele kleine Akteure geprägt ist, andererseit s die traditionell konservativen Strukturen. Auch fehlen oft standardisierte Datenformate und Schnittstellen, die einen nahtlosen Austausch zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten ermöglichen. Dennoch stehen auch grosse Chancen bereit – insbesondere durch Technologien wie den digitalen Zwilling, den Digitalen Produktpass (DPP) oder KI.
Schon in der Planungsphase ermöglicht der digitale Zwilling eine präzisere Abstimmung der Gewerke und optimiert den Materialeinsatz. Während des Betriebs eines Gebäudes bietet er enorme Vorteile für das Facility Management, indem er Energieverbrauch und Wartungszyklen optimiert und dadurch Ressourcen spart. Der digitale Zwilling ist somit n icht nur ein Instrument zur Effizienzsteigerung, sondern auch ein Schlüsselelement für nachhaltiges Bauen und Betreiben von Immobilien.
Zusammen mit dem digitalen Zwilling gewinnt auch der DPP an Bedeutung. Dieser Pass enthält detaillierte Informationen über die verwendeten Baumaterialien, deren Herkunft, Zusammensetzung und Wiederverwertbarkeit. Durch den Einsatz eines solchen Systems wird der Lebenszyklus eines Gebäudes transparent und nachvollziehbar. Damit wird es einfacher, Ressourcen zu sparen und Kreislaufwirtschaftskonzepte im Bauwesen zu etablieren. So kann ein Bauwerk nicht nur umweltfreundlicher errichtet, sondern auch am Ende seines Lebenszyklus rückgebaut und die Materialien wiederverwertet werden. Dies trägt erheblich zur Reduzierung vo n Bauabfällen bei, die einen erheblichen Anteil am weltweiten Müllaufkommen haben.
KI kann in der Planungsphase dazu beitragen, Bauprojekte so zu optimieren, dass möglichst wenig Energie und Material verbraucht wird. Algorithmen können die beste Nutzung von Ressourcen berechnen und somit den CO₂-Fussabdruck von Bauprojekten minimieren. Auch auf der Baustelle selbst kann KI zur Effizienzsteigerung beitragen, indem sie den Einsatz von Maschinen und Arbeitskräften optimiert oder Gefahren in Echtzeit erkennt.
Um den digitalen Wandel im Bauwesen zu beschleunigen, bedarf es einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Wertschöpfungskette. Die digitale Transformation ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine kulturelle. Es bedarf eines grundlegenden Umdenkens, um die Bauindustrie für die Zukunft fit zu machen. Digitale Zwillinge, KI und Nachhaltigkeit sind keine getrennten Phänomene, sondern greifen tief ineinander. Sie bieten die Chance, das Bauen neu zu denken und den Grundstein für eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu legen.
Als buildup sind wir die Ansprechpartner aller Akteure für den digitalen Zwilling und den DPP.

Dani Küchler CEO, buildup AG


ESSAY VON GEORG LUTZ
Technologische Wellen treffen auf Gesellschaften



BIMPULSE QUALITÄTSSICHERUNG
Interview mit Rüdiger Mutschler und Stefan Kretzschmar
DR. URS WIEDERKEHR Auf Spurensuche nach Fachkräftemangel (Teil1)
INTERVIEW MIT PASCAL ETTENHUBER
Digitalisierung in der Bauindustrie

DR.UWE RÜDEL, GS1 SIWITZERLAND
Quantensprung für Nachhaltigkeit und Innovation

3
GRUSSWORT by Dani Küchler, CEO buildup AG
4-6
INHALTSVERZEICHNIS & IMPRESSUM
8 NEUES POWERHOUSE Interview mit Simon Frei und David Grütter
10-12
BIMPULSE Interview mit Rüdiger Mutschler und Stefan Kretzsch mar
14-15
FUTURE SHOPPING 2030 Im Einfluss der weltweiten Megatrends
18-21
AUF SPURENSUCHE ZUM FACHKRÄFTEMANGEL TEIL 1
Beitrag von Dr. Urs Wiederkehr
24-25
DIGITALISIERUNG IN DER BAUINDUSTRIE Beitrag von Pascal Ettenhuber (Roche)
28-29
180 JAHRE QUALITÄT UND INNOVATION Beitrag von Stamm Bau AG
32-33
GRENZENLOSES SPORTERLEBNIS Beitrag von Fitpass AG
36-37
EVOGREEN - PRODUKTE FÜR DIE BIOLOGISCHE REINIGUNG Nachhaltig und Effektiv
40-41
FÜR KMU’S BEDEUTET OPACC DIGITALE ZUKUNFT Beitrag von Beat Bussmann, CEO Opacc Software AG
44-47
Der Mythos lebt Von Georg Lutz
50-61
Technologische Wellen treffen auf Gesellschaften Essay von Georg Lutz
64-66
Quantensprung für Nachhaltigkeit und Innovation
Von Dr. Uwe Rüdel, GS1 Switzerland
68
Equans Switzerland Bouygues Energies & Services und Equans seit 01. Ju li 2024 vereint
Now available in Switzerland

Seidengasse 1, 8001 Zurich
Cr de Rive 10, 1204 Geneva


Interims-Expertinnen und -Experten spannen jetzt auch örtlich mit IT-und Data-Management zusammen
Interview mit Simon Frei & David Grütter
Lieber Simon, lieber David, herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung des neuen Büros in Basel! Ein Schritt,
der die Präsenz von «FS Partners –The CFO Company» in der Schweiz noch weiter stärkt. Welche Bedeutung hat der gemeinsame Standort für die Zukunft von FS Partners – The CFO Company und CONSENSO?
Simon Frei: Die Eröffnung des neuen Standorts ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit mit CONSENSO. Durch die gemeinsame Präsenz vor Ort können wir noch schneller und effizienter mit und für unsere Kundinnen und Kunden in der Region Basel agieren.
Welche Vorteile sind konkret gemeint?
David Grütter: Durch die intensivierte Zusammenarbeit mit FS
Partners – The CFO Company entsteht ein neues Powerhouse. Wir erfahren eine besonders hohe Nachfrage im IT-Segment des CFOVerantwortungsbereichs, insbesondere in Sachen Business Intelligence und Data Analytics. In diesen Projekten ist CONSENSO nun noch enger eingebunden und wir können gemeinsam die Bedürfnisse unserer Kunden schneller und effizienter als je zuvor adressieren.
Warum gerade Basel?
Simon Frei: Wir hatten bereits Mandate in der Region, weshalb eine Präsenz in Basel ein logischer Schritt war, um unseren Service und Support vor Ort zu optimieren. Das neue Büro liegt direkt am Bahnhof Basel, stärkt unsere lokale Präsenz enorm und bietet durch seine Lage eine ausgezeichnete Voraussetzung, um schnell und persönlich auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden reagieren zu können.
Über «FS Partners – The CFO Company» und «CONSENSO»
FS Partners – The CFO Company ist eine unabhängige Beratungsboutique, spezialisiert auf Financial Interim Management. FS Partners – The CFO Company bietet CFO-Dienste auf Abruf und unterstützen bei der Digitalisierung des Finanzwesens, um die Finanzfunktionen produzierender Unternehmen mit tiefgreifender Expertise und massgeschneiderten Lösungen zu stärken und kurzfristige personelle Engpässe erfolgreich zu überbrücken. (fspartners.ch)
CONSENSO ist ein erfahrener IT-Lösungsanbieter, der sich auf die Entwicklung von Applikationen und die technische Umsetzung von Projekten spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Business Intelligence & Data Analytics, System Integration, Master Data Management und ERP-Systeme. Das Unternehmen bieten massgeschneiderte IT-Services und Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Ihr seid nun direkte Nachbarn der BDO Schweiz. Ist hier ebenfalls eine verstärkte Zusammenarbeit zu erwarten?
David Grütter: Die räumliche Nähe zur BDO Schweiz ist eine Win-WinSituation für alle Beteiligten und bietet wertvolle Möglichkeiten zum Austausch. Wir sehen ein grosses gegenseitiges Potenzial, um ergänzende Dienstleistungen, welche von Kundenseite nachgefragt werden, in hoher Qualität anbieten zu können.
Vielen Dank, Simon und David, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen FS Partners – The CFO Company und CONSENSO viel Erfolg am neuen Standort.

FS PARTNERS AG
Bahnhofstrasse 19
CH-9100 Herisau
+41 71 351 28 96
https://www.fspartners.ch
Wir unterstützen Sie beim Meistern Ihrer Herausforderungen

www.fspartners.ch

Ihr zuverlässiger Partner für präventive und baubegleitende Qualitätssicherung (QS).

DKunden vor den negativen Folgen des Preisdumpings zu schützen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Kunden von langlebigen und hochwertigen Bauprojekten profitieren, anstatt unter den Kompromissen einer rein kostengetriebenen Mentalität zu leiden.
Warum braucht es Qualitätssicherung?
Unser Ansatz konzentriert sich darauf, die Qualität und Fachkompetenz im Bauwesen zu steigern und gleichzeitig die Risiken von Nachforderungen und zusätzlichen Kosten zu minimieren. Denn wie der Volksmund weiss, „Wer billig kauft, kauft zweimal“. So bekennen wir uns klar zum fairen Wettbewerb
Schweizer Qualitätsbewusstsein. Für unsere Kunden bedeutet dies nicht nur eine höhere Bauqualität, sondern auch Kosteneinsparungen durch die Vermeidung von unnötigen Verzögerungen, späteren Schäden und versteckten Mängeln.
Präventive Bauwerksdiagnose –Ein entscheidender Erfolgsfaktor
Ein wichtiger Punkt unserer Arbeit liegt im Bereich der baubegleitenden Bauwerksdiagnose. Dabei legen wir einen besonderen Fokus auf die Luftdichtigkeit. Denn dieses Thema wird in seiner Bedeutung sehr oft unterschätzt und ist doch eine häufige Ursache für spätere Mängel und hohe Folgekosten. Verdeckte Leckagen in der
Wir führen daher frühzeitig im Bauprozess Luftdichtheitsmessungen (BlowerDoor) durch, um verdeckte Mängel und Leckagen zeitnah zu erkennen und zu beheben. So wirken wir teuren Rückbau und kostspieligen Bauzeitenverzögerungen entgegen. Gleichzeitig trägt dies zur Sensibilisierung der relevanten Arbeitsgattungen bei.
Planungs- und Ausschreibungsfehler vermeiden
Die Ursachen für einige der späteren Baumängel sind jedoch bereits in der Planung von Konstruktionsdetails zu finden. Ein weiteres Problem sind fehlerhafte, oder unspezifisch formulierte Ausschrei-


bungs- und Vertragstexte. Wir beobachten häufig ein Versäumnis bei der Benennung der verbindlichen Normen und Spezifikationen. Dies kann später negative Auswirkungen auf beide Vertragsparteien haben.
Unsere Arbeit beginnt daher üblicherweise bei der Prüfung und Korrektur von Planungsdetails und Ausschreibungstexten sowie beim Erkennen und Aufzeigen von potenziell problematischen Schnittstellen. Auf Wunsch beraten und begleiten wir Sie bei der Vergabe.
Wer sind wir und welche Referenzen kann die BIMpulse vorweisen?
Die Köpfe hinter BIMpulse bringen eine beeindruckende Kombination aus technischer Expertise und praktischer Baukompetenz ein.
Rüdiger Mutschler ist Bauschadensgutachter und Baurechtsexperte und kann selbst auf eine langjährige Erfahrung als Bau- und Projektleiter zurückblicken. Stefan Kretzschmar, Geschäftsführer der vesica GmbH, ist Bauphysiker mit Schwerpunkt in der „zerstörungsfreien Bauwerksdiagnose“, Luftdichtigkeit und Bauthermografie. Der Grundstein für den Erfolg von Mutschler und Kretzschmar wurde bereits beim
BIld Quelle: A. Birnbaum
ersten Zusammentreffen gelegt. Als Auftragnehmer beim Bauvorhaben ETH-HWO (Minergie® P-A-eco Vorgaben) war Kretzschmar als Bauphysiker und Luftdichtheitsexperte aktiv, während Mutschler damals noch bei der BAM-Swiss AG als Projektleiter für die Gebäudehülle tätig war. Die strengen Vorgaben erforderten höchste bauphysikalische und bautechnische Kenntnisse, nicht zuletzt aufgrund der Grösse des Projekts und der ungewöhnlichen Bauformen der Gebäude.
Durch eine enge Zusammenarbeit, eine lösungsorientierte Vorgehensweise und eine hohe Strukturiertheit konnte das zufällig zusammengesetzte Team ein Leistungspaket von höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit formen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit, geprägt von sich ergänzendem Fachwissen, praktischer Erfahrung und einer gemeinsamen Leidenschaft für Qualität, bildete den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft mit einem einzigartigen Alleinstellungsmerkmal. Diese Besonderheit findet zunehmend Anerkennung und Wertschätzung auf dem Markt und führte dazu, dass die BIMpulse GmbH und vesica GmbH von namhaften Schweizer Unternehmen beauftragt wurden. Insbesondere in Bereichen, wo Präzision und Qualität von entscheidender Bedeutung sind –wie im industriellen Sonderbau und Laborbau (Reinräume und ganze Containments) – erweckt das Angebot der BIMpulse reges Interesse bei den Kunden.

Schadens- und Baugutachten
Unsere Devise lautet: „Wer den Schaden hat, braucht sich mit uns nicht mehr zu sorgen.“ Nach der Feststellung von Schäden, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder nach Ablauf der Garantie- und Gewährleistungsfristen auftreten, stehen Eigentümer, oder Geschädigte, oft hilflos der Situation gegenüber und müssen sich mit rechtlichen Grundlagen und hohen Kosten auseinandersetzen. Die BIMpulse GmbH erstellt nicht nur Berichte und Gutachten, sondern unterstützt die Geschädigten auch beim vorgabekonformen und rechtlichen Schriftverkehr. Wir entwickeln Sanierungskonzepte, verfassen Ausschreibungen, begleiten den Vergabeprozess und überwachen die Sanierungsmassnahmen bis zur förmlichen Abnahme. Dank eines sachlichen und verständigen Umgangs mit allen involvierten Parteien konnten bis heute sämtliche Projekte aussergerichtlich abgeschlossen werden, was nicht nur eine erhebliche Kostenersparnis für alle Beteiligten bedeutet.

Schadens- und Baugutachten
Unsere Devise lautet: „Wer den Schaden hat, braucht sich mit uns nicht mehr zu sorgen.“ Nach der Feststellung von Schäden, unabhängig davon ob sie innerhalb oder nach Ablauf der Garantie- und Gewährleistungsfristen auftreten, stehen Eigentümer oder Geschädigte oft hilflos der Situation gegenüber und müssen sich mit rechtlichen Grundlagen und hohen Kosten auseinandersetzen. Die BIMpulse GmbH erstellt nicht nur Berichte und Gutachten, sondern unterstützt die Geschädigten auch beim vorgabekonformen und rechtlichen Schriftverkehr. Wir entwickeln Sanierungskonzepte, verfassen Ausschreibungen, begleiten den Vergabeprozess und überwachen die Sanierungsmassnahmen bis zur förmlichen Abnahme. Dank eines sachlichen und verständigen Umgangs mit allen involvierten Parteien konnten bis heute sämtliche Projekte aussergerichtlich abgeschlossen werden, was nicht nur eine erhebliche Kostenersparnis für alle Beteiligten bedeutet.
Unsere Mission ist klar definiert
Die BIMpulse GmbH bietet umfassende Baudienstleistungen, die von der Planung bis zur förmlichen Abnahme reichen. Mit einem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit sichert das Unternehmen durch präventive Qualitäts-sicherung und bauphysikalische Prüfungen den langfristigen Wert und die Zufriedenheit der Kunden. Das erfahrene Team garantiert dabei höchste Fachkompetenz in jedem Projekt.

Die Kunden der BIMpulse GmbH profitieren von einer effizienten und termingerechten Realisierung ihrer Bau-projekte dank der umfassenden Dienstleistungen des Unternehmens. Die Spezialisierung auf Sonderbau und nachhaltige Projekte, kombiniert mit präventiver Qualitätssicherung, garantiert hohe Standards und eine wirt-schaftliche Partnerschaft. Die Integration von fortschrittlichen Automatisierungssystemen verspricht eine zukunfts-orientierte Projektumsetzung, während eine klare Risikobewertung und Vertragsverhandlung zusätzliche Kosten und Verzögerungen minimieren.
Unser Ziel ist es, die Qualität und Kompetenz im Bauwesen zu steigern, während wir gleichzeitig das Risiko von Nachtragskosten und Verzögerungen minimieren. Als “wachsames Auge im Hintergrund” begleiten wir den gesamten Bauprozess von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. Mit unserem fachkundigen Team und unserem ganzheitlichen Ansatz profitieren alle Beteiligten, und es entsteht ein Gewinn für alle Seiten.
Kontakt:
Tel +41 (0) 62 772 00 77
Mail info@bimpulse.ch
Weiterführende Informationen unter: www.bimpulse.ch www.vesica.ch

Mutschler - Inhaber BIMpulse GmbH







im Einfluss der weltweiten Megatrends

Die Shopping CenterExperten haben in den letzten Jahren insbeson-
dere von den folgenden Megatrends gesprochen: der Urbanisierung mit immer grösseren Städten, immer grösseren Wasser und Energiebedarf – was Dr. Sibylle Wälty als Leitende Forscherin des ETH Wohnforum am diesjährigen Shopping Center Forum mit der These einer Zukunft des Einzelhandels in einer 10-MinutenNachbarschaft als Schlüssel zur Attraktivität von Einkaufsstrassen und Shoppingcenter im digitalen Zeitalter manifestierte. Diese Aussage hat für Diskussionsstoff gesorgt – gewisse Formate in Shopping Center oder Innenstadtlagen können mit einer Zielgruppe aus diesem Radius nicht überleben, es braucht ein Einzungsgebiet von
mindestens 30 Minuten. Es waren sich aber alle einig, dass eine Zersiedlung keinen Sinn macht und die CO2-Immissionen und der Ressourcenverbrauch weiter gesenkt werden muss. Zudem bieten 10-Minuten-Nachbarschaften zudem die Chance lebendige Stadtquartiere zu entwickeln. Die Lage ist nicht mehr alles – umso mehr kommt es auf die Nähe zum Kunden an. Die Shopping Center fügen sich nicht nur architektonisch in die Umgebung ein, sondern treten auch mit der lokalen Community in Interaktion. Der Megatrend Nachhaltigkeit – Thema des letzten Kongresses – ist bei allen Interessengruppen bereits stark verankert und wird vorgelebt: Sei es bei einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Bauweise und Instandhaltung, sondern auch zu Veranstal-
tungen rund um nachhaltige Themen und einem Mieter-Mix, der diese Werte teilt. Ein wichtiger Megatrend ist auch die fundamentale Veränderung vom Konsumtempel Shopping Center zu Lifestyle Hubs. Shopping ist für die Besucher nur eine Option von vielen. Die Aufenthaltsqualität wird durch die Entwicklung von hybriden Konzepten – mit einem Mix von Retail-, Gastro-, Entertainment-, Bildungsund Gesundheitsangeboten –verbessert.
Dr. Thomas Borer hat in seinem Keynote noch auf weitere gegenwärtige Megatrends der Welt aufmerksam gemacht, die durchaus ihren Einfluss auf die Shopping Center, den Retail und die Schweiz haben: Aufkommende Mächte, vor allem China, verändern das


bestehende Gleichgewicht, indem sie es ständig herausfordern. Der ehem. Botschafter der Schweiz in Deutschland sprach in seinem Referat von einem «Neuen Kalten Krieg». Dabei fallen uns auch die massiven «Angriffe» von chinesischen Online-Plattformen ein -welche in deutscher Sprache und im Layout lokal getarnt und den Eindruck geben nachhaltig bei einem Händler online einzukaufen – erst beim Erhalt von einem Paket mit billigen Produkten aus China wird dem Käufer bewusst, dass er getäuscht wurde. Thomas Borer spricht auch von «Alte Mächte wie Russland, die versuchen mit alten Methoden wie Krieg alte Grenzen wieder herzustellen». Schliesslich kommt Borer auch auf den aufflammenden Nahostkonflikt zu sprechen, der zu Instabilität und zu innenpolitischen Verwerfungen im Westen führt. Diese politischen Megatrends schwächen aktuell und wohl auch in Zukunft die Konsumlust in der Schweiz und im Ausland. Zudem hängt seit einigen Jahren ein Damoklesschwert über den U.S.A. – dort führt die linke Partei das Land immer tiefer in einem Staatsschuldensumpf, der die ganzen Finanzmärkte zum Einsturz bringen könnte.
Aktuelle Prognose für den Schweizer Detailhandel
Zum ersten Mal hat der Verwaltungsratspräsident von BAK Economics Marc Bros de Puchredon die Prognose für den Schweizer Detailhandel vorgestellt: Er rechnet für 2024 mit einer Umsatzsteigerung von 1% gegenüber dem Vorjahr bei einem Gesamtumsatz von 104 Mrd. CHF für den Detailhandel Schweiz – für 2025 sieht Marc Bros de Puchredon die Entwicklung gar noch etwas düsterer mit einem Wachstum von bloss 0,8%.
Nach zwei Jahren stetigem Aufwärtsdruck hat sich die Preisentwicklung im Schweizer Detailhandel im ersten Quartal 2024 deutlich beruhigt. Tatsächlich waren die Preise im Detailhandel im Monat März sogar rückläufig. Über das gesamte erste Quartal des laufenden Jahres blieb das Preisniveau gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert. Auch die Nachfrage hat sich als stabil erwiesen. Insgesamt stiegen die realen Umsätze im Schweizer Detailhandel gegenüber der Vorjahresperiode um 1.6%. Das führte zu einem nominalen Umsatzplus von ebenfalls 1.6%. Wie die Analyse der einzelnen Warengruppen aber zeigen wird, fällt die Bilanz des ersten Quartals je nach Detailhandelssektor sehr unterschiedlich aus.
Shopping Center Forum Switzerland
Oltnerstrasse 22 4622 Egerkingen
Telefon: 079 555 37 03
https://www.sc-forum.ch/de/
Ähnlich wie die makroökonomische Prognose fällt auch der Jahresausblick für den Detailhandel eher verhalten, aber positiv aus. Der Inflationsdruck wird im Schweizer Detailhandel 2024 tief bleiben. Mit einer Jahresteuerung von 0.4% dürfte im Detailhandel wieder etwas Preisstabilität einkehren.
BAK Economics geht davon aus, dass die Nachfrage aufgrund der noch immer eher zahlreich vorhandenen Belastungsfaktoren (steigende Krankenkassenprämien, steigende Mieten, hohe Energiekosten) eher zurückhaltend sein wird. Besonders auch, da die Konsumenten gemäss der Umfrage zur Konsumentenstimmung des Seco mit weiteren Preisanstiegen rechnen. BAK Economics erwartet deshalb über den gesamten Detailhandel im Jahr 2024 ein Nachfragewachstum von 0.6%. «Die nominalen Umsätze dürften damit auch in diesem Jahr nochmals ansteigen. Insgesamt rechnen wir für den Umsatz im Schweizer Detailhandel im laufenden Jahr mit einem Anstieg um 1.0 Prozent auf rund 104 Milliarden Schweizer Franken.» erklärt Marc Bros de Puchredon am Shopping Center Forum vor ausverkäuften Rängen.
Aus London angereist brachte Ibrahim Ibrahim sein neues Buch «FUTURE READY RETAIL» mit und konnte der bekannte Retail-Experte die Teilnehmer mit seinen klaren Aussagen in den Bann ziehen: «People and Places not Building and Spaces» und er sprach von einem veränderten Verständnis der Begriffe wie aus dem «Landlord» ein «Host» wird und aus «Shopping» eine «Community».
Zum ersten Mal fand das «Placemaker Forum» moderiert von Kees van Elst und Andy Ruf statt – führende Experten wie Samuel Leder, Markus Mettler, Lisa Rennefahrt, Thomas Hinderling und Matthias Tobler haben über die Bedeutung von Placemaking gesprochen.
Der würdige Abschluss des Tagesprogramms bildete Dr. David Bosshart mit seinem Ausblick 2030: Die Zukunft des Shoppings – wie neue Kundenbedürfnisse und integrierte Lebensraumgestaltung aussehen soll.

100 °C kochendes, gekühltes stilles und sprudelndes
Für energieeffiziente und nachhaltige Projekte. Ein Quooker-System
Energie sondern reduziert auch den Verbrauch von Plastikmüll. Entdecken Sie die Vorteile www.quooker.ch/dech/immobilie

sprudelndes Wasser
Quooker-System spart nicht nur Zeit und


Auf dem ETH-Campus Hönggerberg in Zürich sind die S trassen nach berühmten Personen aus dem ETH-Umfeld benannt. So treffen im Zentrum der Physikbauten der Eduard-Stie fel- und der John-von-Neumann-Weg aufeinander.

von Dr. Urs Wiederkehr
Am 15. September 1954 haben diese beiden Informatik-Pioniere in
Düsseldorf ihre neuesten Forschungsergebnisse präsentiert. Von Neumann stellte den eben von IBM abgelieferte NORC (Naval Ordnance Research Calculator) vor, welcher eine Erhöhung des menschlichen Wirkungsgrades beim Rechnen um einen Faktor von 13’000 ermöglichte. Stiefel betonte, dass dank diesen modernen Maschinen, von Computern hat noch niemand gesprochen, qualifizierte Mitarbeiter nicht länger für numerische Rechnungen eingesetzt werden müssen. Die Entwicklung ist rasant weitergegangen, trotzdem ist heute, 70 Jahre später, der Fachkräftemangel omnipräsent. Was ist passiert? Haben die verschiedenen Techniken zu keiner Arbeitserleichterung geführt?
Der Autor geht in einer zweiteiligen Serie auf Spuren-suche und beleuchtet in 16 Punkten mögliche Ursachen.
Verschiedene Anstrengungen und Entdeckungen der Menschheit haben dazu geführt, dass in der Schweiz seit den 1950er Jahren der Anteil der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen von 16.5 auf 2.4 Prozent gesunken ist. Auch im Industriebereich hat sich der Anteil von 46.2 auf 20.2 Prozent verringert. Hingegen arbeiten heute 77.5 Prozent im Dienstleistungsbereich, vor 70 Jahren erst 37.3 Prozent. Das sind krasse Verschiebungen. Die Technik hat ihren Anteil geleistet und die Produktion, sei es im landwirtschaftlichen wie auch im industriellen Bereich, ist markant gesteigert. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass dank der Globalisierung ein reger Handel über die Landesgrenzen stattfindet, sowohl im Import wie auch im Export.
Trotzdem, der Fachkräftemangel ist spürbar. Sowohl im übergeordneten, von der Gesellschaft bestimmten, Makrobereich, wie auch im persönlichen Mikrobereich sind massgebliche Vorkommnisse zu beobachten, welche meist nicht zur Diskussion kommen. Heute geht es bei der Spurensuche um die 8 Makrobereich-Punkte.
Eine unmenge an Fixpunkten gesammelt
Sei es in der Landschaft, sei es in der Politik oder sei es im Freizeitsektor, wir haben in den letzten Jahren einiges mehr geschaffen als alle bisherigen Generationen vorher, leider auch was den Materialverbrauch und die Umweltbelastung angeht. Exemplarisch ist das in auf der Website «Zeitreise –Kartenwerke» von Swisstopo auf dem Campus der ETH Hönggerberg ersichtlich, wo sich heute der Eduard-Stiefel- und der John-vonNeumann-Weg treffen und eine
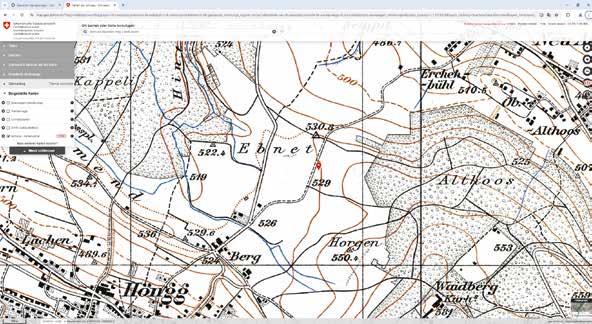

grosse Zahl von Universitätsbauten zu finden sind. Vor 70 Jahren ist dort grösstenteils Wiesland gewesen. so sind im Umkreis von 400 m gerade mal zwei Einzel-Gebäude eingezeichnet.

Jede Änderung und Anpassung des Bestands erfordert heute klar durchdachte und aufwändig zu gestaltende Integrationsschritte und Verbindungsstellen, ich sage bewusst nicht Schnittstellen, um das Gesamtsystem nicht aus der Ordnung zu bringen. Auch Gesetze und viele weitere Ergänzungen in unserem Lebensbereich benötigen heute wohldurchdachte Massnahmen, welche von Fachpersonen im Detail implementiert werden müssen. Vermutlich haben wir auch hie und da über unsere Verhältnisse gelebt, einige pendente Punkte nicht zeitnah aufgearbeitet und gelöst, sondern einfach vorausgeschoben: Ein aktuelles Beispiel ist nicht nur der Palästina-Konflikt.
Auch die vollautomatische Produktion, meist in Übersee, führt dazu, dass es finanziell, aber nicht ressourcenmässig, günstiger ist, neues zu produzieren als bestehendes zu reparieren oder wieder instand zu stellen. So ist es zum Beispiel billiger eine neue Schere zu kaufen als die alte schleifen zu lassen.
Aufwand für den laufenden Betrieb
Das immer umfangreichere vom Menschen ge-schaffenen Werken erfordert auch eine inten-sivere Instandhaltung und Erneuerung. Nur so kann die Gebrauchstauglichkeit erhalten blei-ben. Alle diese Fachpersonen müssen rekrutiert werden und stehen nicht mehr für andere Aufgaben zur Verfügung.
Und wer jetzt denkt, ich mach doch alles digital, darf nicht vergessen: Obwohl wir von Informa-tionen sprechen, die auf immer kleinerem Raum in der sogenannten Cloud gespeichert werden, steckt relativ viel materielle Welt dahinter: Funkmasten, Glasfaserverbindungen, Netzkno-tenstellen und Rechenzentren verbrauchen nicht nur viel Material beim Erstellen, sondern auch einiges an Energie für den Betrieb.
Grösseres Angebot bei der Berufswahl
Überall hat die Vielfalt zugenommen, sei es bei den Berufen, sei es bei den Möglichkeiten etwas überhaupt zu tun. Zudem hat sich noch eine virtuelle Welt geöffnet. Wer gestalten und kreieren will, ist nicht mehr aufs Architekturund Bauingenieurwesen beschränkt. Auch virtuelle Welten wollen erschaffen werden. Und so kann sogar Game Design heute an Schweizer Fach-hochschulen studiert werden.
Legende Zeitreise - Kartenwerke Veränderung unserer Landschaft am Beispiel Campus ETH-Hönggerberg
Bei der Markierung treffen heute der «John-von-Neumann-Weg» und der «Eduard-Stiefel-Weg» aufeinander. 1954 hat dieser Punkt einsam auf der grünen Wiese gelegen. Der Campus ETH Hönggerberg ist ab 1961 entstanden.
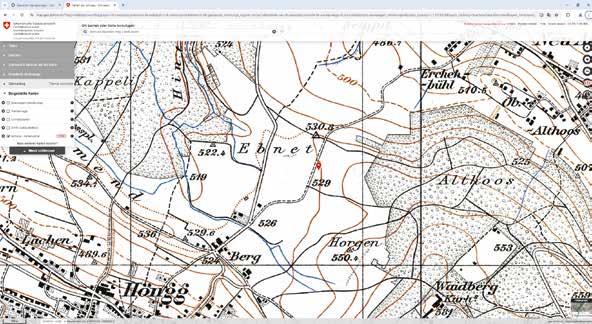


Cybersicherheit ist zu gewährleisten
Leider ist beim Übergang von der Elektronischen Datenverarbeitung EDV zur heutigen Digitalisierung dem Thema Sicherheit nie die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt worden. Oft ist man bereits froh gewesen, die gestellten Aufgaben in den Grundzügen erfüllen zu können. Andererseits ist auch das, was wir heute als Internet bezeichnen, am Anfang ein reines Forschungsnetzwerk gewesen, wo sich die einzelnen Beteiligten gekannt haben und ihre Forschungsresultate weltweit austauschen wollten. Und diese Cybersicherheit zu gewähren, braucht es wiederum Fachleute, die auch anderswo eingesetzt werden könnten.
Qualitätsüberwachung für den Fall der Fälle
Früher als der Mensch Selbstversorger gewesen ist und die Übersicht über die gesamte Wertschöpfung persönlich kontrolliert hat, ist ein Herkunftsnachweis überflüssig gewesen. Er wusste alles aus erster Hand. Mit der Arbeitsteilung ist der Überblick verloren gegangen. Die Nachvollziehbarkeit ist ins Zentrum gerückt und auch die Compliance, nach Duden das „regelgerechte, vorschriftsgemäße, ethisch korrekte Verhalten», sind geregelt worden und müssen überwacht werden. So erfolgen viel Protokollierungen von Zwischenzuständen und Prozessschritten im Rahmen des Qualitätsmanagements, die in der Mehrheit der Fälle gar nicht mehr angeschaut werden. Nur im Fall der Fälle einer Unregelmässigkeit wird darauf zurückgegriffen. Und das braucht wiederum Ressourcen, welche nicht nur im Gesundheitswesen, für die Basistätigkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die Krux der Verantwortung und Entlöhnung
Arbeiten mit fixen Arbeitszeiten wird heute oft besser entlöhnt als Arbeiten wie Bauleitung oder Bauführung, wo das Schlussresultat funktionstüchtig sein muss und bei Schuld nicht mit markanten Worten gutgeredete werden kann. Stimmen Entlöhnung und der Rest des Berufsbilds nicht zusammen, dann schwindet die Bereitschaft zum Engagement. Es zeichnet sich eine Abwanderung zu anderen risikoloseren und einträglicheren Möglichkeiten ab. Der tschechisch-kanadische Umweltwissenschafter Vacslav Slim (*1943) stellt in seinem Buch «Wie die Welt wirklich funktioniert» fest, dass Arbeitskräfte vermittelnde Personen höhere Einkommen erzielen als diejenigen, welche schlussendlich die materielle Arbeit an der Front erledigen. Gute Einkommen können schlussendlich auch wieder dazu führen, dass der Anstellungsgrad reduziert wird, was den Fachkräftemangel wieder verstärkt.
Immer mehr werden Prozesse an den Kunden ausgelagert, sei das das Selberscannen von Artikeln im Supermarkt, sei das das Verwalten des Dossiers für eine Versicherung oder eine Vereinsmitglied-schaft. Zuerst haben diese Möglichkeiten die Nutzer fasziniert. Es ist etwas Neues gewesen. Mit der Zeit ist Ernüchterung eingetreten, denn die Systeme haben regelmässig nicht funktioniert. Zudem ist die Verantwortung auf den Kunden übertragen worden. Von einer Entschädigung der Mehrarbeit auf Kundenseite ist nie die Rede gewesen. Und macht der Kunde nur einen einzigen Fehler, z.B. wenn er das Scannen eines Artikels vergisst, dann trägt dieser auch das Risiko. Es hat aber noch eine zweite Delegation stattgefunden: Die Fachkräfte haben oft ihr Unterstützungspersonal verloren und müssen heute die eigenen Verwaltungsarbeit übernehmen. Ob das sinnvoll ist, wird kaum in Frage gestellt. Zudem hat früher bei der Arbeitsteilung automatisch das Vier-Augen-Kontrolle gewirkt, welche heute oft überhaupt nicht mehr passiert und Angriffsfläche nicht nur im Cybersicherheitsbereich liefert.
Urs Wiederkehr


Mehrfacherfassung in Dokumente statt konsequentes Datendenken
Daten werden heute vielfach mehrfach erfasst und oft in Dokumenten, einer nicht optimalen Art. Umfangreiche Daten müssen aber auf verschiedene Art und Weisen selektieren und abgebildet werden können. Das Datenvorhaltungsmodell mit den Dokumenten kommt rasch an seine Grenzen. Eine Denkweise in Systemen ist gefragt, wo die Daten neutral gespeichert und für verschiedene Auswertungsfälle aufbereitet werden. Mehrfacherfassungen führen zu Doppelspurigkeiten bei der Eingabe aber auch beim Abgleichen von widersprüchlichen Daten. Ein gutes Beispiel ist das elektronische Patientendossier, das so nicht vom Fleck kommt: Von einem PDF-Friedhof, wie letztes Jahr in Schweizer Tageszeitungen dazu zu lesen gewesen ist, können keine Zusammenhänge gezogen werden.
Schlussbetrachtungen 1. Teil
Es stellt sich die berechtigte Frage, ob wir mit dem Geschaffenen nicht überfordert sind, nur schon um dieses im Schuss zu halten. Leider wird auch für zukünftige Projekte nur in Ausnahmefällen auf die spätere Beherrschbarkeit und auch den Ersatz unter Betrieb gedacht.
Aber auch auf der persönlichen Ebene, ich nennen sie Mikroebene, führt die Spurensuche zu weiteren Punkte, sofern wir wirklich akzeptieren, dass die Ressourcen inklusive die uns zur Verfügung stehende Zeit pro Tag limitiert ist. Dazu werden Sie im zweiten Teil, in der Dezember-Ausgabe der Basel Wirtschaft, mehr erfahren. Und dort werden bestimmt Optimierungspotential für den eigenen Zeitgewinn ableiten können.
Dr. Urs Wiederkehr (*1961), ist Dipl. BauIngenieur ETH/SIA und Leiter des Fachbereichs Informationsmanagement auf der Geschäftsstelle des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA.



Pragmatismus statt Prunk
Die Digitalisierung der Bauindustrie bietet unbestr eitbare Vorteile, doch ihre Anwendung erfordert ein durchdachtes Maß. In diesem persönlichen Statement argumentiere ich für einen gezielten und bedarfsorientierten Einsatz dig italer Technologien, der die Kernprozesse unseres Handwerks unterstützt, ohn e sie zu überlagern oder zu verkomplizieren. Unser Ziel sollte es sein, effektiv zu digitalisieren – dort, wo es notwendig ist, nicht nur dort, wo es möglich ist.
Selektive Digitalisierung: Pragmatik vor Opportunität
In der Bauindustrie ist es entscheidend, den Einsatz von Technologie sinnvoll zu gestalten. Wir digitalisieren nur dort, wo es tatsächlich einen Mehrwert bringt. Dies vermeidet unnötige Komplexität und hält unsere Prozesse schlank und effizient. Ein solcher Ansatz verhindert die Überladung unserer Projekte und Betriebe mit Technologien und Informationen, die mehr Probleme schaffen, als sie lösen.
Einsatz von BIM
Building Information Modeling (BIM) ist eine revolutionäre Methode in der Bauplanung und -ausführung. BIM ermöglicht Kollaboration und detaillierte Visualisierungen, die Effizienz und Planungssicherheit in der Projektumsetzung steigern kann. Jedoch hat jedes Werkzeug seinen Platz. In der operativen Betriebsführung, wo die Anforderungen anders sind, kann der Einsatz von BIM ineffizient sein. Hier benötigen wir eine aktuelle, aber weniger komplex strukturierte Datenbasis. Fotorealistische virtuelle Touren der Gebäude und Anlagen bieten hier eine weniger komplexe und sehr realitätsnahe Alternative zu den hochwertigen 3D Modellen.
Technologieeinsatz im Betrieb
Im täglichen Betrieb kommen andere digitale Werkzeuge zum Einsatz, die besser zu den dortigen Anforderungen passen. Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), Augmented Reality (AR), fortgeschrittene Datenbanklösungen und Data Science sowie künstliche Intelligenz ermöglichen eine präzise Überwachung und Optimierung unserer Betriebsabläufe. Diese Technologien erweitern unsere Fähigkeiten, bieten


Echtzeit-Daten und unterstützen so eine effiziente Entscheidungsfindung und Prozessoptimierung.
Fazit: Unterstützung, nicht Ersatz
Die Kernbotschaft meines Standpunktes ist, dass Digitalisierung als Unterstützung für unsere Kernprozesse dienen sollte. Der Mehrwert der Digitalisierung liegt darin, unsere Arbeitsweise zu erleichtern und zu verbessern, nicht immer nur darin, traditionelle Methoden und Techniken zu ersetzen. Erfolgreich sind wir dann, wenn wir die richtigen digitalen Werkzeuge zur richtigen Zeit einsetzen und dabei immer das Ziel im Auge behalten. Die blosse Anwendung von modernen Tools nur um der Digitalisierung willen ist ein sicherer Weg zum Scheitern.
Schlussbemerkung
Als langjähriger Akteur in der Bauindustrie und Digitalisierung glaube ich fest daran, dass die kluge und bedarfsgerechte Anwendung digitaler Technologien uns in die Lage versetzt, sowohl die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern als auch zukünftige Innovationen sinnvoll zu integrieren. Es ist unsere Verantwortung, diese Werkzeuge weise zu nutzen, um unsere Branche nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Pascal Ettenhuber
ist ein digitaler Enthusiast mit einer tiefen Leidenschaft für Technologie und Innovation. Derzeit arbeitet er als Digital Business Expert bei F. Hoffmann-La Roche, wo er maßgeblich zur digitalen Transformation des Standorts Basel / Kaiseraugst beiträgt. Darüber hinaus ist er ein engagiertes Mitglied der Zentralkommission für Informationsmanagement (ZI) des SIA. Pascal zeichnet sich durch seine kollaborative Arbeitsweise, seinen offenen und kritischen Denkansatz sowie seine Fähigkeit aus, innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.


Der Praxis-Club ist ein exklusives Netzwerk, welches Unternehmerinnen und Unternehmern, sowie Personen mit Budget- / Entscheidungskompetenz aus der Schweiz, einen physischen und digitalen Raum bietet, um sich gegenseitig zu inspirieren, innovative Ideen zu entwickeln und wertvolle Partnerschaften auf- und auszubauen. Durch regelmässige Veranstaltungen, Impulse und gemeinsame Projekte fördert der Praxis-Club nicht nur unternehmerisches Wachstum, sondern auch persönliche Entwicklung und den Aufbau langfristiger Beziehungen in einer vielfältigen Community von Macherpersönlichkeiten.
Physische Anlässe
Wir treffen uns regelmässig zum Business-Lunch, Members-Träff, Night of Business Das Angebot wird ständig optimiert
Digitale Anlässe
Ob via Zoom, LinkedIn Live, Podcast oder digitaler Plattform - Wir lernen und inspirieren von einander
Nicht wir vom Praxis-Club müssen euch unterhalten Jeder von euch ist Experte in seinem Gebiet und soll sich selbst entsprechend positionieren können
Kooperation statt
Isolation

Fokus auf den Nutzen
r leben in einer sich schnell rändernden Zeit Daher ist ch unser Netzwerk agil und st sich den Bedürfnissen der Mitglieder an

24/7-Zugriff auf das Netzwerk
Dank internem Bereich und nativer App hast du jederzeit Zugriff auf das Netzwerk vom Praxis-Club und kannst dich mit allen sichtbaren Mitgliedern sicher und verschlüsselt unterhalten







www.praxis-club.ch www.night-of-business.ch

Seit 1844 steht die Stamm Bau AG für Beständigkeit und für Qualität im Handwerk. Mit ihrem breiten und einzigartigen Leistungsspektrum setzt das Unternehmen neue Massst äbe in den Bereichen Bauen, Renovieren und Sanieren


Vier Sparten ermöglichen ein umfassendes Portfolio
Holzbau, Metall- und Stahlbau, Bau- und Sanierungsdienstleistungen und der Bereich Gesamtleistungen ermöglichen einerseits den Fokus auf die einzelnen Teilbereiche und schaffen andererseits hervorragende Synergien beim Bauen.
Im Holzbaubereiche werden Grossprojekte in der gesamten Schweiz realisiert, zudem ist der Stamm-Holzbau Vorreiter bei energetischen Dachsanierungen mit Photovoltaik-Anlagen.
Der Bereich Metall- und Stahlbau bietet von der Produktion bis zur Montage umfassende Metallund Stahlbaukompetenz. Hier werden tragende Konstruktionen und individuelle Bauelemente gefertigt, die in ihrer Präzision und Langlebigkeit überzeugen. Die Expertise in diesem Bereich ermöglicht es der Stamm Bau AG, auch komplexe Projekte erfolgreich umzusetzen.
Die Sparte Bau- und Sanierungsdienstleistungen umfasst alle Gewerke, die für erfolgreiche Umbauten und Sanierungen notwendig sind. Von der Schadstoffsanierung, über den technischen Rückbau bis hin zur Schreinerei sowie der Gipserei. Diese Vielfalt ermöglicht sowohl kleine Umbauten als auch grössere Strangsanierungen, die selbstverständlich auch im bewohnten Zustand erfolgreich realisiert werden können.
Der Bereich Gesamtleistungen realisiert erfolgreich eigene Bauprojekte oder Kundenprojekte von der Planung bis hin zum Verkauf und agiert hierbei als General- oder Totalunternehmer. Auch hier profitieren die Kunden von den zwölf internen Handwerksbetrieben.
Weshalb Kunden Stamm wählen
Die Stamm Bau AG kann auf zahlreiche erfolgreiche Projekte und zufriedene Kunden zurückblicken. Ob es sich um die Sanierung von Schulgebäuden, den Bau von Wohnanlagen oder die Umsetzung von Industrieprojekten handelt –stets stehen Qualität, Termintreue und Kosteneffizienz im Vordergrund. Kunden schätzen besonders die Zuverlässigkeit und die ganzheitliche Betreuung, die von der ersten Beratung bis hin zur finalen Abnahme reicht.
Regional verankert
Nachhaltigkeit, Innovation und die Förderung regionaler Strukturen sind zentrale Elemente der Unternehmensphilosophie. So leistet Stamm nicht nur einen Beitrag zur baulichen
Entwicklung der Region, sondern auch zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. Mittlerweile eine etablierte Stamm-Tradition ist
beispielsweise die Realisation des jährlichen Sozialprojektes durch die Lernenden von Stamm, bei dem einer ausgewählten sozialen und regional tätigen Einrichtung ein Renovationswunsch erfüllt wird.
Qualität und Vielfalt als Erfolgsrezept
Stamm steht seit 180 Jahren für herausragende Bauqualität und Innovationskraft. Mit einem umfassenden Leistungsangebot ist das Unternehmen der optimale Baupartner für Projekte jeglicher Grössenordnung. Die Stamm Bau AG bleibt auch in Zukunft ein unverzichtbarer Partner für Bauprojekte in Basel und darüber hinaus, denn die Kombination aus Qualität und Vielfalt macht Stamm einzigartig in der Region und zeichnet das traditionsreiche Unternehmen aus.


Stamm Bau AG Aliothstrasse 63 4144 Arlesheim www.stamm-bau.ch








Fitpass ermöglicht unbeschränkten Zugang zu Fitness , Sport und Wellness in der gesamten Deutschschweiz mit nur einem Abonnement. Über 400 sorgfältig ausgewählte Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie mehr als 60 verschi edene Sportarten bieten Fitpass sowohl Privatpersonen mit einer brei ten sportlichen Palette als auch Mitarbeitenden von Unternehmen ein ultimatives Erlebnis.

Fitpass für Unternehmen
Die Investition in die Fitness der Mitarbeitenden steigert
nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern schafft auch ein angenehmes Arbeitsklima. Fitpass ermöglicht den Mitarbeitenden den Zugang zu einer Vielzahl von Sportund Freizeitaktivitäten - von Fitnessstudios über Yoga- und Tanzkurse bis hin zu Schwimmmöglichkeiten. Die Auswahl aus einem breiten Spektrum an Sportarten erlaubt es den Mitarbeitenden, ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Die Vorteile für Ihr Unternehmen sind klar ersichtlich: Die Förderung der körperlichen Aktivität am Arbeitsplatz steigert nicht nur das Wohlbefinden und die Motivation der Mitarbeitenden, sondern reduziert auch gesundheitliche Probleme und Fehlzeiten. Durch die
Partnerschaft mit Fitpass erhöhen Sie die Attraktivität als Arbeitgeber und heben sich im Wettbewerb um Fachkräfte von anderen Unternehmen ab.
Die Abwicklung mit Fitpass gestaltet sich unkompliziert:
Unternehmen wählen das passende Paket und erhalten individuelle Zugangscodes für ihre Mitarbeitenden. Diese können sich flexibel für gewünschte Aktivitäten anmelden und das Angebot nach ihren Bedürfnissen nutzen.
Bekannte Unternehmen wie der FC Basel haben bereits erfolgreich mit Fitpass zusammengearbeitet und ihren Mitarbeitenden eine attraktive Sportförderung geboten.
Fitpass für Privatpersonen
Sie möchten Ihre Work-LifeBalance verbessern, wissen aber



nicht wie? Fitpass bietet Ihnen mit einem unlimitierten Abonnement für Fitness, Sport und Wellness die Möglichkeit, aktiv zu werden - ohne Verpflichtungen. Egal ob Anfänger oder Profi, bei rund 400 Partnern in der ganzen Schweiz können Sie über 60 Sportarten ausprobieren, so oft Sie möchten, Monat für Monat, Jahr für Jahr.
Sportanbieter
Fitpass bietet nicht nur Unternehmen und Privatpersonen, sondern auch den Sportanbietern zahlreiche Vorteile. Als Sportpartner von Fitpass erschließen Sie neue Firmenkunden und erhalten für jeden Eintritt eines Fitpass-Members eine Vergütung. Zudem profitieren Sie von unserem Netzwerk, ohne langfristige Verpflichtungen eingehen zu müssen. Fitpass öffnet Türen zu tausenden potenziellen Neukunden. Insgesamt bietet Fitpass den Sportanbietern viele Vorteile, um ihr Geschäft auszubauen und ihre Kundenbasis zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit Fitpass ermöglicht eine erhöhte Auslastung, das Gewinnen neuer Kunden, eine flexiblere Arbeitsweise und vereinfachte Verwaltung.






Evogreen hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Alle Rein igungsprozesse und die dafür verwendeten Mittel wer den so nachhaltig wie möglich! Mit den Produkten von evogr een reinigen Sie Ihre Wohnung, Ihre Geschäftsräume oder Ihr Restaurant mitbiologischen Reinigungsmitteln, ohne dabei den Mensch, Tier und die Umwelt zu belasten.

Etioniert
in 100% natürlicher und biologischer Wirkstoff der wirklich & natürlich funk-
Die evogreen Geräte und Verdunster werden selber im Hause entworfen und hergestellt. Unsere Produkte sind Bio Ecocert zertifiziert und zugelassen, identisch mit der EU-Öko-Verordnung. Evogreen Wirkstoffe basieren auf 100% natürlichen Pflanzenextrakten. Sie absorbierengasförmige Stink und Schadstoff Moleküle sowie Kleinstpartikel ca.< 10 μ und halten diese durch zwischenmolekulare Krafttfelder fest. Die eingefangenen Moleküle werden inaktiviert und sind sensorisch neutral. Mit dem evogreen System werden Schadstoff-Emissionen und deren Gerüche am Entstehungsort natürlich gebunden und biologisch abgebaut.
In diesem Prozess verbinden sich Makromoleküle und eingeschlossene Verbindungen nicht miteinander d.h. es entstehen keine neuen Substanzen. Eingeatmete Wirkstoffmoleküle können wegen ihrer Grösse, die Membranen der Lungenbläschen nicht passieren und werden wieder ausgeatmet bzw. über die Bronchien ausgeschieden. Die Makromoleküle absorbieren Stink und Schadstoffe. Sie werden in dem Luftstrom fortfahren und in der Natur grossräumig verteilt. Dort kommen sie mit Mikroorganismen in der Biosphäre (Pflanzen,Boden) in Kontakt und werden durch Bakterien biologisch abgebaut.
Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für die Entsorgung von stinkenden und zum Teil giftigen Ausgasungen von Eiweissstoffen
und deren Abbauprodukten wie z.B. Amine, Thiole / Merkaptane, Thiolund Fettsäuren, Di- und Polysulfide Aldehyde, Ammoniak sowie Schwefelwasserstoff, usw. evogreen Wirkstoff absorbiert Schadstoffmoleküle und bringt deren schlechten Gerüche nachhaltig zum Verschwinden. Darin unterscheidet es sich grundsätzlich von allen herkömmlichen Verfahren der Geruchsüberdeckung, welche lediglich die Nase täuschen. Zudem sind die meisten Duftsysteme auf dem Markt gesundheitsschädlich. Die evogreen Wirkstoffe werden laufend weiterentwickelt. Sie sind auf der Basis 100% natürlicher pflanzlicher Extrakte aufgebaut. Exklusiv komponierte, dezente Duftnoten aus reinen ätherischen Ölen dienen als „dekorative Elemente“ und tragen zu einem positiven Empfinden bei. Die angewen-

dete ätherischen Öle im evogreen Konzept werden von biologischen Anbauern erzeugt, und sind Bio Ecocert zertifiziert und zugelassen, EUÖko-Verordnung.
Migros und Coop zählen u.a auch zu unseren glücklichen Kunden von unserem personalisiertem Luftreinigung-Konzept.
Lassen Sie sich auch gerne persönlich beraten und werden Sie Teil der evogreen Familie.
• Nachhaltigkeit/bio- und ökologisch
• Biologisch abbaubar
• Höchstwertige Qualität
• Überragende Wirkung
• Die Anwendung der Produkte sind unbedenklich f ü r Mensch, Tiere und Umwelt
• Refil/Depot System f ü r die Flaschen/Sprayer/Kanister
• evogreen L ü ftungssysteme (Reinigung und Beduftung / Möglichkeit Luft und Flächen Desinfektion) In nur wenigen Minuten einen Saal oder Liegenschaft zu vernebeln


Danyck Rouiller 4310
+41 79 964 50 85 info@evogreen.ch































Opacc, der Schweizer Hersteller von Enterprise-Soft ware, hat mit den Standorten Rothenburg und München stein eine ideale Ausgangslage, um KMU in die digitale Zukunft zu beg leiten. Das IT-Unternehmen zeichnet sich durch eine flexible, jederzeit ausbaufähige Enterprise-Plattform aus und beschäfti gt aktuell über 200 Mitarbeitende. Wer auf Kundennä he, Softwarequalität und Flexibilität setzt, ist hier am richtigen Ort. Sowohl als Kunde als auch als Mitarbeitender.
In Münchenstein pocht das digitale Herz von Opacc in der Nordwestschweiz. Hier laufen die Fäden zusammen, wenn es um ERP-Software, E-Commerce, CRM, Warehouse oder Dokumentenmanagement geht. Oder anders formuliert. Hier finden KMU alles, was das digitale Unternehmensherz begehrt. Opacc – das ist perfekte Schweizer Softwareentwicklung seit 1988. Das ist aber auch Kundennähe und digitale Innovation pur.
Kundenzufriedenheit beginnt bei den Mitarbeitenden
Bei Opacc sind Unternehmer und IT-Spezialisten zu Hause. Und das hat seine Gründe, wie CEO und Gründer Beat Bussmann erklärt; «Bei Opacc investieren wir sehr viel in die Unternehmenskultur und in die Mitarbeitenden». Auch die Mitarbeiterzufriedenheit hat seit jeher einen hohen Stellenwert. So Bussmann weiter, «das ist wie im Spitzensport: Motivation,
Überzeugung und professionelle Rahmenbedingungen führen zu Höchstleistungen." Davon profitieren nicht nur die Mitarbeitenden, dadurch steigt nachweislich die Qualität und Innovation der Softwareanwendungen und das führt zu zufriedenen und treuen Kunden.
«Swiss made software» als Qualitätsversprechen
Opacc entwickelt seit 1988 betriebswirtschaftliche Enterprise


Software. Diese Anwendungen ermöglichen es KMU und bis zu grösseren, internationalen Unternehmungen die vollständige digitale Geschäftsautomation. Opacc kann seinen Produkten und Leistungen ein besonderes Qualitätssiegel verleihen: Swiss made software. «Das ist unser Versprechen für Qualität und Innovation.
Im Mittelpunkt von Opacc steht die Entwicklung der eigenen EnterpriseSoftware-Plattform. Sie bildet die digitale Basis für alles, was ein Unternehmen braucht. Wer sich für Opacc entscheidet, erhält deshalb nicht nur moderne Software-Anwendungen wie ERP, CRM oder Online Shop, sondern auch eine mächtige Plattform für alle digitalen Unternehmensressourcen undprozesse. Diese bildet die Grundlage für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte. Zudem profitieren Opacc-Kunden von der einzigartigen, mehrfach ausgezeichneten Update-Garantie. Sie sorgt dafür, dass jede Installation über Jahre und Jahrzehnte aktuell bleibt. Mehr zu Opacc erfahren Sie unter www.opacc.ch.

Enterprise-Software-Plattform
Opacc sucht IT-Talente Bei Opacc kannst du deine IT-Talente laufend weiterentwickeln. Wir legen Wert darauf, dass du neben deiner Verantwortung bei Opacc auch die Verantwortung in deinem privaten Umfeld wahrnehmen kannst. Sei es gegenüber deiner Familie, deinen Freunden oder deinem Verein. Erfahre jetzt mehr unter jobs.opacc.ch


•

«Am Anfang war das Bild» gilt im Kleinen wie im Grossen. Es beginnt beim zentimetergrossen Logo auf der Visitenkarte, endet bei der zwei Dutzend Meter langen Bildkomposition auf Trams, umfasst aber auch alles dazwischen: Grafiken, Schriften und grossflächige Digitaldruckmedien (u.a. Logodesign, Grafiken, Signaletik, Schaufensterbeschriftungen und Fahrzeug-Folierungen).


Die kalifornische E-Marke Lucid
Der Markt für Elektroautos ist aktuell kein einfach es Pflaster. Es braucht nicht nur spannende Konzept e und Lösungen, die die Kunden überzeugen, sondern auch einen langen ökonom ischen Atem. Der kalifornische Anbieter Lucid hat i hn und setzt auf ein

von Georg Lutz
KTraumland für Menschen mit innovativen Ideen, bei denen immer die Sonne
scheint. Schon in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wohnten sie in modernen Bungalows mit grossen Fensterflächen. Der bekannteste Architekt, der diese Atmosphäre mit seinen Häusern in Kalifornien verwirklichte, hiess Richard Neutra. Er wurde damit zum Vorbild für einen Baustil, der sich in Europa erst mehrere Dekaden später zeigte. Die Geschichte Kaliforniens ist nicht nur hier beeindruckend und global wirkungsmächtig. Die Geschichte ist eine Erfolgsstory. Zunächst verwandelten die Siedler die karge Landschaft mit klugen Bewässerungslösungen in blühende Orangenund Zitronenhaine und Mandel-
nächsten ab: Gold, Öl und Hollywood, die Militärindustrie, ab den 1950ern die Raumfahrt und in den letzten drei Dekaden die ITBranche. Heute kommen die EMobilität und Produkte für die Energiewende dazu.
Seit Bill Hewlett und David Packard in einer Garage in Palo Alto einen Tonfrequenzgenerator austüftelten, werden dort technologische Massstäbe gesetzt. In Kalifornien gehören private Risikokapitalgeber, die viel Geld in Quereinsteiger und Start-ups investieren, zur Alltagsphilosophie. Das betrifft fast alle Branchen. Ob Beauty-Operationen oder Lifestyle-Drinks: Alles ist möglich. Wo steht die nächste Garage, in der Google Next Generation und Apple 2.0 entsteht? So weit der My-
sein Ziel erreicht.
Hegemoniale Positionierung
Diese ökonomische Dynamik braucht aber einen kulturellen Überbau. Kalifornien war das Ende der Open Frontier für die Siedler. Im Westen war nur noch der Pazifik. Vielleicht auch aus diesem Grund galt Kalifornien als Labor für extravagante Lebensentwürfe ohne historischen Ballast. Die 68er-Bewegung schnitt der bürgerlichen Gesellschaft ihre alten Zöpfe ab. Die Beat-Poeten und Hippies mit ihren Surfboards und VW Bullis waren zunächst eine exotische Minderheit. Im Laufe der Zeit prägten sie aber den hegemonialen Zeitgeist, der auf die ganze Welt ausstrahlte. Dazu nur ein Beispiel: Früher war es selbstverständlich, dass die Manager


von Daimler-Benz eine Krawatte als Statussymbol trugen. Nach einem Besuch im Silicon Valley entledigten sich die Verantwortungsträger dieses Relikts einer stocksteifen Vergangenheit.
Bröckelndes Selbstverständnis
Dieser Mythos hat in den letzten Jahren Risse bekommen. Die verheerenden Waldbrände – auch im Sommer 2024 – und die Wasserknappheit in Kalifornien haben sich in den Köpfen festgesetzt. Der Klimawandel lässt sich immer weniger verdrängen. Zudem ist der kalifornische Traum durch eine soziale Erosion gefährdet. Das lässt sich im Alltag beobachten: In den 80er-Jahren gab es in San Francisco eine beindruckend lebendige Café- und Barlandschaft. Die Begegnungen waren schnell und intensiv. Das California Dreaming lebte. Vor 20 Jahren begannen dann die Gäste, immer mehr vereinzelt auf ihre Tablets und Handys zu schauen. Heute herrscht in den Cafés immer noch die To-go-Mentalität der Pandemiejahre vor. Literarisch hat der US-Schriftsteller T. C. Boyle mit «Blue Skies» dieser Entwicklung ein literarisches Denkmal gesetzt. Da stellt sich die Frage: Ist Kalifornien noch ein Zukunftsmodell?
BIld Quelle: Lucid Motors
Es geht immer noch
Ja, wenn man mit den Verantwortlichen von Lucid spricht. Sie wollen nicht weniger als ein neues Kapitel im Rahmen der E-Mobilität aufschlagen. Kalifornien ist dabei der inspirierende Hintergrund. Die Wurzeln von Lucid liegen im Silicon Valley. Das Unternehmen war ursprünglich ein Batteriehersteller, mit dem Firmennamen Atieva hatten sich die Verantwortlichen der Batterieentwicklung verschrieben. Das ist schon ein erster entscheidender Unterschied zu den Mitbewerbern bei EAutos. Normalerweise kommen diese vom Verbrennungsmotor. Jetzt setzen sie auf E-Mobilität, müssen aber das Herz des Antriebs, welches früher der Motor war, durch eine Batterie ersetzen. Bei Lucid ist das Herz schon vorhanden – die Batterie. Darum herum wird das Auto gebaut. Lucid hat damit den Vorteil, dass man das Herz nicht in den Körper bringen muss, sondern diesen um das Herz herum bauen kann.
Schwierige Rahmenbedingungen
Schon an dieser Stelle gilt es aber, einige aktuelle Herausforderungen zu thematisieren. Zunächst drängen viele Hersteller auf den Markt der EMobilität. Klassische europäische Marken steigen um und produzieren für unterschiedliche Zielgruppen E-Autos. Ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr in der EU zugelassen werden. Renommierte Marken wie VW, Audi, Peugeot, Porsche oder Daimler-Benz wechseln das Pferd. An dem Gründerboom will inzwischen jeder Player teilnehmen. Der Elefant im Raum ist sicher aber Tesla mit einem bestehenden Verkaufs- und Infrastrukturnetz und einem dichten Netz an eigenen Ladesäulen. Nicht zu vergessen sind chinesische Anbieter. In China setzt die Regierung seit Jahren auf strategische industriepolitische Entscheidungen. Dabei werden Zukunftsbranchen wie die Solarindustrie und die Firmen der E-Mobilität massiv gefördert. Das Beispiel der Solarbranche sollte zu denken geben. Innerhalb von zwei Dekaden wurden europäische und US-Hersteller an die Wand gedrängt. In der Automobilbranche ist dies noch nicht der Fall, aber der Druck ist da. So war der chinesische Anbieter BYD zentraler Sponsor der Fussballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland. Früher war es VW. Das ist noch kein Gamechanger, aber ein warnendes Zeichen.

ist auch in den Details sichtbar.
Zudem ist die Entwicklung der E-Mobilität kein Selbstläufer. Nach einer Anfangseuphorie zeigen sich nun die Mühen der Ebene. Das PreisLeistungs-Verhältnis ist für viele Zielgruppen noch unbefriedigend. Die Dienstleistungsinfrastruktur ist zu dünn. So ist es nicht verwunderlich, dass die Verkaufszahlen den Prognosen hinterherhinken. Erste Anbieter müssen die Segel streichen. So ist das US-Elektroauto-Start-up Fisker Geschichte.

Es galt als ein ambitionierter TeslaHerausforderer. Nachdem Verhandlungen mit einem grossen Autobauer gescheitert waren, haben die Verantwortlichen Mitte Juni 2024 nun Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet.
Effizienz zieht
Mit welchen Argumenten kann Lucid diesen Herausforderungen begegnen? Seit 2020 ist das Unternehmen an der Börse. Dies allein würde aber bei den geschilderten schwierigen Rahmenbedingen der E-Mobilität nicht für einen langfristigen Atem ausreichen. Zentrales Momentum bei Lucid ist der Public Investment Fund aus Saudi-Arabien, der eine Beteiligung von 60 Prozent hält. Auch in Saudi-Arabien will man sich auf das Ende des fossilen Zeitalters einstellen und bringt dabei aber, im Gegensatz zu vielen anderen Weltmarkplayern, umfassende ökonomische Potenz mit. Damit ist eine langfristige Strategie bei Lucid gesichert. Genau diese wird nun auch transparent ausgerollt. Die Verantwortlichen verfolgen dabei einen Top-downAnsatz. Mit dem Lucid Air hat man zunächst eine hochwertige Limousine auf dem Markt platziert. Ende 2023 ist in Genf der Gravity – ein SUV –vorgestellt worden, 2026 wird es ein Mittelklassefahrzeug geben.
Was macht nun den Unterschied aus? Die Lösungen von Lucid sind sehr hochwertige Produkte. Bei der Qualität gibt es keine Kompromisse. Es gibt eine positive Anmutung bei der Materialauswahl und Verarbeitung, man findet kein Hartplastik. Das Design ist futuristisch, vermeidet aber überflüssige Spielereien. Das ist einerseits zukunftsweisend, man findet andererseits aber auch analoge Bedienelemente wie die Lautstärkenregelung. Man sitzt in einem Auto und nicht vor einer Spielkonsole – einen Eindruck, den man bei einigen chinesischen Modellen hat. Digital und analog kommen bei Lucid demgegenüber sinnvoll zusammen. Der Fahrer ist Teil der Übung: Lucid ist ein Drivers Car.
Natürlich sprechen die technischen Daten für sich. Die Verantwortlichen waren früher bei Tesla, Audi oder Daimler. Sie wollen jetzt noch bessere E-Autos entwickeln und bauen. Reichweite, Gewicht der Batterie und das Verhältnis zur Leistung, die herausgekitzelt wird, geringe Ladezeiten – die Zahlen überzeugen (vergleiche Infokasten). Da sind gestandene Profis am Werk.
Der zentrale Gamechanger ist aber die Effizienz. Man kann immer schwerere und leistungsfähigere Batterien in immer grösseren und schwereren Autos verbauen. Der Trend bei einigen Luxusmarken im Bereich der E-Mobilität ist aber eine Sackgasse. Das ist nicht nur aus
ökologischen Gründen problematisch, sondern schlicht nicht effizient. Bei Lucid setzt man aber genau bei der Effizienz die Priorität und kommt so zu besseren Ergebnissen. Das Unternehmen ist vertikal integriert. Es geht um eine durchgehende Architektur. Das ist ein weiterer Unterschied zu anderen Herstellern, die die jeweiligen Komponenten aus vielen verschiedenen Quellen beziehen.
Ohne Frage: Individuelle Mobilität braucht immer mehr Ressourcen als öffentliche Verkehrsmittel. Sie braucht Rohstoffe. Die zentrale Frage ist, wie man mit der eingesetzten Energie umgeht. Wie sieht der Wirkungsgrad aus? Wie weit komme ich mit einer Kilowattstunde? Dies füllt das Stichwort Effizienz mit Leben und dem hat man sich bei Lucid verschrieben. Dazu kommt das Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise in den Lieferketten, die in die Philosophie von Lucid eingeschrieben ist (vergleiche Infokasten).
Kunden und Ansprache
Die Zielgruppen kommen meist von anderen Edelmodellen wie Audi oder Porsche. Metropolenregionen stehen im Vordergrund. Die Reichweitenangst wabert in den Köpfen. Der Realbetrieb erlaubt bei einer normalen Fahrweise über 700 Kilometer. Man kommt damit ohne Problem ins Tessin an den Lago Maggiore. Das ist in der Schweiz eine zentrale Hürde.
Anspruchsvolle Kunden in Deutschland und der Schweiz sind technologieverliebt. Das verbindet beide Gesellschaften. In der Schweiz ist aber die Kaufkraft höher. Das gilt jedoch für jede Luxusmarke. Die grossen Marken haben in der Schweiz ihren Platz. Die Offenheit für neue Lösungen ist in der Schweiz aber höher als in Deutschland. Dort ist die Markentreue ausgeprägter. In der Schweiz hat man schon früher mehr auf US-Marken gesetzt.
Am Schluss noch der zentrale Hinweis: Wie immer ist der Praxistest entscheidend. Schon beim Einsteigen fällt das Raumwunder auf. Und dann beginnt der technologische Genuss. Lassen Sie sich auf eine Probefahrt ein!


Der effiziente Lucid Air Pure RWD
Ein Energieverbrauch von nur 13.0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer laut WLTP macht das neue Einstiegsmodell zum Meister in Sachen Effizienz. Mit einer maximalen Leistung von bis 442 PS schafft es der Air Pure RWD in 4.7 Sekunden auf 100 km/h und verfügt dabei über eine Reichweite von bis zu 747 Kilometern. Der von Lucid

Erweitertes Serviceangebot


Zum Roll-out seiner umfassenden Customer-ExperienceStrategie für den europäischen Markt bietet Lucid ab sofort überall in Europa einen hochwertigen Wartungs-, Kunden- und Pannenservice vor Ort. Das erweiterte Serviceangebot ergänzt die regelmässigen Over-the-AirUpdates (OTA) inklusive vorausschauender Analysen und präventiver Diagnosen, sofern die Kunden die Fahrzeugkonnektivität aktiviert haben. Im Laufe des Jahres werden weitere Massnahmen folgen, darunter:
Neue Service-Center: Lucid hat kürzlich zwei neue, voll ausgestattete Service-Center in München und Zürich eröffnet.
Flexible, mobile Services: Lucid erweitert sein europäisches Servicenetz um eine stetig wachsende Flotte mobiler Einsatzfahrzeuge, die Kunden im Ernstfall mit technischem Know-how unterstützen –in der Garage oder unterwegs.
Verbesserte Pannenhilfe: Lucid weitet seinen Pannenservice auf 15 Märkte in Europa aus.
Lucid ist stolzer Teilnehmer des United Nations Global Compact (UN Global Compact), der weltweit grössten Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen, die auf freiwilligem Engagement basiert. Ziel des UN Global Compact ist, dass die Unternehmen ihre Geschäfte verantwortungsvoll führen. Diese sind daher aufgefordert, ihre Tätigkeiten und Strategien an den zehn Prinzipien der UN auszurichten, die sich auf Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltpraktiken und Korruptionsbekämpfung beziehen. Ausserdem sind die Unternehmen dazu verpflichtet, Massnahmen im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu ergreifen. Diese Ziele bedeuten eine grosse Motivation für die Unternehmen, aber auch für Regierungen, Zivilgesellschaften und Bürger, eine bessere Welt zu erschaffen.
Georg Lutz ist Journalist und Sozialwissenschaftler.
Lucid Motors
Altmannsteinstrasse 37
CH-Höri, Zürich 8181
Telefon: +41 43 883 32 53 https://lucidmotors.com/de-ch
Ein sicherer Ort für private und geschäftliche Aufbewahrung. ValitoWertschutztresor für maximale Sicherheit und Privatsphäre.


Verträge, Vollmachten, Anteilsscheine sicher und flexibel lagern

Datenbackup und nDSG-Unterlagen sicher vor unerlaubtem Zugriff aufbewahren

Private Wertsachen 24/7 überwachen lassen und jederzeit bankenunabhängig darauf zugreifen.






Schliessfächer von Valito in der Nordwestschweiz
Warum viel Geld in teure Alarmanlagen und private Tresore investieren, wenn es eine einfachere und gleichzeitig sichere Lösung gibt? Bei Valito bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre wertvollen Wertsachen und Geschäftsunterlagen wie Edelmetalle, Testamente, Urkunden, Erinnerungen oder auch Wallets mit Kryptowährungen an einem sicheren Ort aufzubewahren.
Zuhause oder im Büro ist ein Einbruch jederzeit möglich. Bei Valito verfügen wir über Echtzeitüberwachung und Sicherheitspersonal. Nur Sie wissen, was sie einlagern.
24 Stunden an 7 Tagen Zugang zu Ihren Wertsachen. Zugang ist jederzeit möglich (Anmeldung 24 Stunden im Vorfeld)
Moderne Hochsicherheitsalarmanlage und private Sicherheitsfirma mit Hundestaffel. Der Tresorraum ist Feuer- und Wasserfest.
Geheimer Standort in der NWCH. Nur ~ 1 Stunde von Zürich und Basel. Der Zugang ist von Aussen nicht einsehbar.
Sicherheit wird gross geschrieben. Die ganze Anlage wird permanent überwacht. Die Fotos auf dieser Seite wurden aus Sicherheitsgründen verändert.







C
D
E
F
x
Typ G
x


Die Debatte zur Wirkungsmächtigkeit und Einschätzun g von KI
Das Thema künstliche Intelligenz ist medial omniprä sent. Jede Woche gibt es dazu eine Vielzahl von Tal kformaten, Podcasts oder klassischen Magazin- und Zeitungsartikeln. Unsere A ufmerksamkeitsökonomie ist überfordert. Zudem ist d er emotionale Ton fast immer unüberhörbar. Die Positionierungen oszilliere n oft nur zwischen Fortschrittseuphorie und Katastr ophenszenarien. Das folgende Essay gibt einen Überblick über wichtige P ositionierungen und nimmt Einordnungen vor.

von Georg Lutz
Veginnen wir mit meinem Berufszweig, der Medienbranche, und der Rolle, die
künstliche Intelligenz (KI oder etwas anders definiert AI oder maschinelles Lernen)1 darin spielt. ChatGPT ist hier ein Beispiel für ein auf den ersten Blick hilfreiches Werkzeug. Wir experimentieren seit November 2022 munter damit herum. Für andere Akteure ist es ein riesiges Businessmodell. Die Aussichten sind verlockend. Die Agentur Farner in der Schweiz hat eine Kampagne für eine italienische Mühle mit KI entwickelt, bei der Text- und Bildmaterial von KI erstellt wurde.2 Solche Beispiele gibt es inzwischen schon massenhaft. Die theoretische Folge: Wir können uns in unserem Leben auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und überlassen die reproduktiven und in diesem Fall einfachen Textproduktionen einer Software.
Mit ChatGPT brauche ich als Journalist nicht mehr billige PR-Texte schreiben, sondern kann mich auf spannende Interviews konzentrieren. Und selbst da gibt es die digitalen Helferlein, die inzwischen lernende Systeme sind. Die Kehrseite ist ein massiver Stellenabbau in fast allen Verlagshäusern. Tageszeitungen sind davon besonders betroffen. So können wir viele Beispiele auch aus anderen Branchen verwenden, bei der es ein Sowohl-als-auch gibt. Das sind die disruptiven Entwicklungen der digitalen Revolution. Karl Marx und Friedrich Engels haben das im Kommunistischen Manifest fesselnd aufgezeigt: «Wenn alles Ständische verdampft». Joseph Schumpeter brachte dies mit dem Begriff der «schöpferischen Zerstörung» auf den Punkt. Das macht den Kapitalismus aus. Er schafft sich in Teilen ab und erfindet sich völlig neu.
Daraus entwickeln sich aber auch viele positive Möglichkeiten. Springen wir in die Welten der Medizin: Es war KI, die es ermöglichte, das dreidimensionale Spike-Protein des Coronavirus zu verstehen. Impfstoffe konnten so schneller auf den Markt kommen. Dahinter standen Technologien wie AlphaFold der Google-Firma Deep Mind. Die Software benötigte für die Entschlüsselung der dreidimensionalen Struktur von 200 Millionen Proteinen nur wenige Wochen. Klassische Biochemiker – ohne KI –hätten dazu Jahre gebraucht. Die positiven Beispiele könnten fortgesetzt werden. Am Anfang der Corona-Pandemie dachten viele Expert*innen, es würde wie bei Aids Jahre dauern, bis wir ein Gegenmittel, geschweige denn einen Impfstoff hätten. Bei Corona hat es kein Jahr gedauert, bis wir uns impfen lassen konnten. Warum also pessimistisch sein?


Für viele Autor*innen geht es aber nicht nur um eine sich beständig fortentwickelnde technologische Entwicklung, sondern um einen Epochenbruch. Es steht eine neue industrielle Revolution vor der Tür beziehungsweise ist schon im Gange. Dahinter steht auch meine feste Überzeugung, dass wir seit einigen Jahren den Start einer Revolution miterleben, die mindestens so gross wie die Industrialisierung oder die flächendeckende Einführung der Elektrizität wird.
Auch in der Baubranche, die bislang bei den Digitalisierungswellen eher im hinteren Bereich surfte, ergeben sich neue Perspektiven. Die Kombination aus Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, beispielsweise mit der Methode BIM (Building Information Modeling), ermöglicht gleichzeitig neue Möglichkeiten bei der Nachhaltigkeit und der Produktivität.
In die Zukunft schauen
Es gibt inzwischen viele Bücher und Fachartikel auf dem Markt, die die Dimension der Umwälzungen zu erfassen versuchen. Greifen wir exemplarisch ein Buch des US-amerikanischen Mainstreams heraus. Der KI-Experte Kai-Fu Lee und der Science-Fiction-Autor Qiufan Chen liefern in «KI 2041» zehn spannende Visionen, die Vor- und Nachteile thematisieren, bleiben aber, das kann schon jetzt angemerkt werden, ihrem modernistischen Weltbild verhaftet. Das ist auch aus der klassischen Modernisierungsmaschine Kaliforniens nicht anders zu erwarten. Die Autoren liefern gekonnt einige historische Tiefbohrungen in die Vergangenheit und Zukunft.
Die Träume über künstliche Intelligenz begleiten uns durch die gesamte Geschichte der industriellen Revolutionen. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts erschien der Roman Frankenstein, der als erster Science-Fiction-Roman der Neuzeit gilt. Es ging und geht immer um die Frage, ob wir als Menschheit das Recht haben, intelligentes Leben zu erschaffen, und wenn die Antwort positiv ist, wie wir damit umgehen. Immer stellte und stellt sich die Frage, in welcher Beziehung Geschöpf und Schöpfer zueinander stehen? Die Hauptrolle spielt meist ein verrückter Wissenschaftler, der als Zauberlehrling den Geist, den er geschaffen hat, nicht mehr in die Flasche zurückbekommt. Das kennen wir schon vom alten Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, der aber in der feudalen Klassik Deutschlands noch auf der individuellen Ebene verhaftet blieb und so etwas wie Gesellschaft, Kapital und industrielle Entwicklung nicht thematisierten konnte. Für meine Generation ist das Gespräch zwischen HAL 9000, dem Computer des Raumschiffs Discovery, und
Astronauten in dem Film «2001 – Odyssee im Weltraum» prägend, welches in einer Katastrophe endet. Es kann als kulturhistorisches Warnsignal gelten. HAL besitzt schon Bewusstsein und emotionale Intelligenz.
Auf jeden Fall sehen Forschungsabteilungen von Unternehmen heute etwas anders aus als zu Frankensteins Zeiten. Der Wille und die Vision, die Welt zu verändern, sind aber geblieben. Und jetzt gibt es dazu wirkungsmächtige Werkzeuge.
Science-Fiction ist aber auch ein Produkt ihrer Zeit und kann damit auch auf falsche Bahnen führen. Das lehrt die Geschichte. In der Modernisierungseuphorie der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts gab es die Vorstellung, in wenigen Jahren würden Autos mit Atomreaktoren im Motorenraum betrieben werden. Das wurde – zum Glück, würde man heute sagen – nie Realität. Folglich gilt es auch, die eigene historische Position infrage zu stellen und auch Autor*innen dementsprechend in ihren gesellschaftlichen Rahmen einzuordnen.
Zurück zum Buch: Kai-Fu Lee gilt als einer der führenden KIExperten weltweit. Er ist CEO der Risikogesellschaft Sinovation Ventures und Co-Vorsitzender des Artificial Intelligence Council im Rahmen des Weltwirtschaftsforums. Als ehemaliger Präsident von Google China hat er den unglaublichen ökonomischen Aufstieg Chinas in den letzten Jahren mitgestaltet. In dem Buch «KI 2041» entwirft Lee Szenarien und Einschätzungen, in welcher Weise sich Technologien wie autonomes Fahren, Quantencomputer oder virtuelle Realität entwickelt haben, marktreif sind und inwiefern sie die Zukunft bestimmen werden.
Der zweite Autor, Qiufan Chen, arbeitete in China für Baidu und Google und ist in der Zwischenzeit zu einem sehr bekannten Science-Fiction-Autor avanciert. Er entwickelt in dem Sachbuch «KI 2041», welches sich aber in Teilen auch als Thriller lesen lässt, darauf aufbauend Personen, Schauplätze und Erzählstränge, um die insgesamt zehn Technologien spannend,


provokant, aber auch technologisch nachvollziehbar zum Leben zu erwecken. Am Ende jedes Kapitels überprüft Kai-Fu Lee in einem Realitätscheck, für wie realistisch er die Visionen von Chen hält. Erfreulicherweise spielt der «globale Süden», was die Orte und Protagonisten angeht, eine zentrale Rolle. Üblicherweise haben solche Bücher ihre geografische Verortung in London, New York oder dem Silicon Valley. In «KI 2041» erfahren wir, wie es in Mumbai, Colombo oder Lagos in 20 Jahren aussehen könnte. Schauen wir uns zwei Zeitsprünge genauer an.
Die erste Vision im Jahr 2041 spielt in Mumbai. Schon heute kennen wir Angebote von Krankenkassen, die Leistungen im Fitnessstudio übernehmen, um unsere Gesundheit besser aufzustellen. 2041 in Mumbai ist das alles perfektioniert. Dabei macht die App «Der goldene Elefant» das soziale Verhalten und die Gesundheit gläsern. Ganesha ist im klassischen Indien der Gott und «Herr der Hindernisse», sowohl der Abräumer als auch der Setzer von Hindernissen, wenn sich jemand ihm gegenüber respektlos verhält. Das passt zur Philosophie der App.
Deep Learning hat praktische Konsequenzen: Die Geschichte zeigt die Vorteile und Risiken, die auftreten, wenn ein Unternehmen sehr viele Daten über seine Nutzer besitzt. Zunächst freut sich die Protagonistin, welche Vorteile die App bietet. Es geht um Kostensenkung. Dann verliebt sie sich aber in einen Mann aus einer unteren Kaste, der auch noch in einem ehemaligen Slum von Mumbai wohnt. Jetzt blinken alle Warnlampen der App auf: «Nayanas Smartstream vibrierte mit zunehmender Frequenz. Sie wusste, dass jede Vibration ein Alarm von diesem kleinen goldenen Elefanten war, der versuchte, sie zu schützen, indem er sie aufforderte, sich von der Gegend zu entfernen, die früher einmal der grösste Slum der Welt gewesen war. Durch Anreize wollte er sie dazu bringen, ihrer Armut, ihren Infektionskrankheiten, der
Diskriminierung und den Unberührbaren, zu denen auch der Junge neben ihr gehörte, den Rücken zu kehren. Sie zog ihren Kragen straff und ging neben ihrem Begleiter weiter.»
Das siebte Kapitel trägt den Titel «Quantengenozid». Hier verliert ein Informatiker seine Familie in einem Feuersturm, der dem Klimawandel geschuldet ist. Daraufhin plant er einen Rachefeldzug gegen die aus seiner Sicht verantwortlichen Eliten. Zu Hilfe kommen ihm zwei technologische Durchbrüche, die mit einer neuen Dimension des Quantencomputing zu tun haben. Das liest sich dann wie folgt: «Das Flugleitsystem wurde von einem eingebauten intelligenten Programm gesteuert, das tiefenwahrnehmungsfähige Hochleistungskameras benutzt, um optimale Flugbahnen zu berechnen und Umgebungen und Ziele zu erfassen.» Auch Vernehmungen bei der IT-Polizei sind dann weniger zimperlich: «Xavier bluffte nicht. Die KI-basierte Vernehmungsmethode BAD TRIP erzeugte mithilfe nichtinvasiver neuro-elektromagnetischer Störsignale, die an das limbische System gesandt wurden, sowohl physisch als auch mental extrem schmerzhafte Erfahrungen, die oftmals das Wiedererleben traumatischer Erfahrungen einschlossen.»
Defizite des Mainstreams
Man kann den Autoren nach diesen Zeilen nicht naiven Technologieoptimismus vorwerfen. Sie kennen die Risiken. Modernisierer reinsten Wassers sind sie aber trotzdem. Der teleogene [MH1] Zeitpfeil fliegt in eine klare Richtung. Ja, es gibt Risiken, sogar solche, die die ganze Menschheit gefährden. Aber die technologische Entwicklung kennt keine Rückschläge oder Stillstand. Auch die Risiken sind trotz der immensen Dimensionen beherrschbar. Nach Überzeugung der beiden Autoren wird die intensive KI-Nutzung in immer mehr Lebensbereiche drängen. Der
Optimismus der beiden KI-Freaks ist nicht unbegründet, tendieren doch die Grenzkosten der Skalierung von KI gegen null. Es ist – so ihr Mantra – trotz aller Risiken eine bessere Welt, die entsteht. Historisch betrachtet, verlaufen die Entwicklungszyklen von neuen Technologien aber anders. Hier liegt die Schwachstelle des Buches und vergleichbarer Mainstreamapologeten. So gab es eine Technologieeuphorie in den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, die aber von einem «digitalen Winter» in den 70erJahren abgelöst wurde. Die KI wie auch ihre Entwickler*innen kennen aber weder Rückschritt noch dialektische Situationen. Begriffe wie Negativität, Regression oder Stillstand sind für KI und ihre Antreiber Fremdwörter.
Talkshow-Diskurse
Der Mainstream in Europa argumentiert ähnlich wie unsere beiden gerade angeführten chinesischen Buchautoren. So steigt Sascha Lobo in einer Talkshow bei Lanz und bei IT-Treffen wirkungsmächtig mit einem Klon-Trick mit Olaf Scholz ein. Das KI-Double von Scholz verkündet darin akustisch überzeugend seine Unterstützung für die russische Position zum Kriegsgeschehen. Auch er kenne die Risiken. Er fordert dann aber die deutsche Gesellschaft auf, endlich über ihren Schatten zu springen. Lobo mokierte sich über die Bedenkenträger, die mit den Fakes und Bots das Ende der Demokratie, gar der Zivilisation kommen sehen, und blickt in eine lichte Zukunft, in der jeder seinen persönlichen KIInfluencer hat. Dann kommt noch das unvermeidliche Standortargument: Die Chinesen seien uns weit voraus, zum Beispiel, da sie massiv Datenmengen aus den privatesten Chatbots ihrer Bürger abgreifen können, was hierzulande einige Zeitgenossen verstören würde. Ich gebe zu, bei solchen Positionen fühle ich mich auch unwohl – und mahne zur Vorsicht. Lobo würde zu mir dann sagen: Bei dir im Büro steht vermutlich noch ein Faxgerät. So läuft der Diskurs: mitmachen oder abgehängt werden.

Ausstieg, Bedenkzeit und Regulation
Jetzt gibt es aber auch Expert*innen – auch aus namhaften IT-Firmen–, die eine gewisse Form von Regulierung und Entschleunigung einfordern. Das kommt dann nicht gleich in die technologiefeindliche Ecke wie bei Lobo. Die Signal-Chefin Meredith Whittaker ist ein Beispiel. Die Backend-Architektur vieler Unternehmen, die enorme Datenmengen sammeln, ist für sie völlig chaotisch. Die entscheidende Frage für Whittaker lautet: «Warum nehmen wir das hin?
Das sollte nicht der natürliche Lauf der Dinge sein. Aber das ist vermutlich das Resultat, nachdem wir Computertechnologie die vergangenen 20, 30 Jahre als natürlich auftretendes Wissenschaftsphänomen behandelt haben – und damit auch nicht gestört oder reguliert haben» (aus netzpolitik.org). Daraus speisen sich auch die aktuellen gesetzlichen Regulierungsinitiativen, die es in den EU-Institutionen und im Bundestag gibt. Andere IT-Akteure gehen noch weiter. Sie befürchten Katastrophenszenarien. Überraschenderweise kommen diese inzwischen auch aus dem innersten Kreis der IT. Das war vor wenigen Jahren noch unvorstellbar. Geoffrey Hinton, auch «Godfather of AI» genannt und ehemals führender KI-Entwickler beim US-Konzern Google, kündigte seine IT-Jobs und mahnte in der New York Times, die Fortschritte im Feld der KI bedeuteten «ernste Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit». Sam Altman, Chef von Open AI3, sowie viele weitere KI-Forscher erklären ihre Technologie zum Risiko für die Menschheit – in einer Liga mit Atomwaffen. Das ist fast der Sound, der zu den Terminator-Filmen führt. Die Matrix-Reihe der Wachowskis[MH1] , in der mithilfe computergenerierter Simulationen der sedierte Homo sapiens mit seiner Körperwärme Energie für die Diktatur der Maschinen produziert, ist die etwas intelligentere Variante im Vergleich zu den Terminator-Filmen.
Richtig spannend und jenseits der rein dystopischen Varianten, die auch meist auf ein reines Schwarz-Weiss-Muster setzen, wird es in den komplexeren Filmen. Die beiden BladeRunner-Filme sind solch ein Beispiel. Bildgewaltig steht die Frage im Raum, wer eigentlich die intelligenteren und schöneren Wesen sind, die beide ein Bewusstsein haben. Unterschiede werden nur durch einen speziellen Test festgestellt, der sehr emotionale Erlebnisse aus der Vergangenheit der Person Revue passieren lässt. Blade Runner Deckard verliebt sich in Rachel, natürlich eine Replikantin, und im Directors Cut bleibt es offen, ob Deckard vielleicht selbst auch ein Replikant ist. Nur die Erinnerung bietet noch Unterschiede.
Aus diesen filmischen Erfahrungen zieht Elke Brüns folgende Schlussfolgerung für die heutige KI-Diskussion: «KI ist ein opaker Raum, eine riesige Datenwolke, die uns unablässig begleitet, präsent, aber unsichtbar und nicht bewusst. Gespeist und gefüllt wird dieser Raum nicht zuletzt durch den permanenten Blick in den black mirror der Smartphones – die technologische Spiegelphase einer neuen Subjektwerdung.» Das ist der Kern einer neuen Debatte, die es geben müsste. Subjekt und Objekt, aber was gibt es mit KI dazwischen? Brüns bleibt erst mal beim Subjekt: «Nicht mehr im Gegenüber eines menschlichen Blickes werden wir zu Ichs, sondern in einer kontinuierlichen medialen Reinszenierung stabilisieren und formen wir uns – und produzieren in der Nutzung von Apps riesige Datenmengen, die den KIs zur gefälligen Sortierung überlassen werden.»
Daher befürworten viele Expert*innen den Einstieg von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Es darf nicht alles den Unternehmen überlassen werden. So betont Marcel Salathé, Professor für digitale Epidemiologie und Co-Direktor des EPFL AI Center in der Schweiz: «Öffentliche Hochschulen müssen sich aktiv an der Entwicklung grosser KI-Modelle beteiligen – nicht im Sinne einer Silicon-Valley-Konkurrenz, sondern um ein tieferes Verständnis ihrer Mechanismen, Schwachstellen und Wege zur Weiterentwicklung zu erlangen. Dabei sollen auch Modelle entwickelt werden, die spezifisch auf den schweizerischen oder europäischen Kontext zugeschnitten sind.»
Durch die Technologiegeschichte
Wir haben die Polarisierungsthesen der KI-Apologeten aufgezeigt. Diese Defizite kann man in der Technologiegeschichte verdeutlichen. Die Einführung einer neuen Technologie war immer mit gesellschaftlichen Kämpfen verbunden. Es gab immer Verlierer und Gewinner. Dazu ein Beispiel: Am Beginn der Industrialisierung vor über 200 Jahren stand die Einführung des mechanisierten Webstuhls. Die Verlierer, klassische Handweberinnen und Weber, hatten aber


nicht die Absicht, den technologischen Fortschritt zu verteufeln. Sie wollten schlicht beteiligt werden. Die Bilder der Maschinenstürmer sind historisch verzerrend – Hartmut Gieselmann bringt dies in seinem Beitrag «Webstühle des 21. Jahrhunderts» auf den Punkt: «Die Weber hatten damals kein Problem mit neuen Maschinen an sich, sondern mit der ungleichen Verteilung ihrer Besitzverhältnisse. Diese Ungleichheit nimmt heutzutage bei der Entwicklung generativer KI globale Dimensionen an. Denn nur eine Handvoll USKonzerne haben die Mittel, neue Foundation-Modelle zu trainieren und die dafür nötigen Daten einzusammeln.»
Das Bild von den Maschinen gegen die Menschheit, welches die Pole Arbeitgeber/Arbeitnehmer ablösen würde, geht in die falsche Richtung. Die Gefahr der KI geht nicht von den Algorithmen, sondern von den Managern aus. Gieselmann sieht in der Praxis Verantwortungsträger, «die oft unfertige Programme im notorischen Beta-Status massenhaft einsetzen, um Lohnkosten zu senken und Angestellte zu ersetzen.»
Diese Szenarien scheinen mir in der Praxis realistischer als Terminator-Bilder. Was solche wichtigen IT-Texte, die eine historische Grundierung haben, aber nicht leisten können, ist eine makroökonomische Perspektive: Mit welchem Akkumulationsmodell und mit welcher politischen Regulierungsweise haben wir bei diesen Technologiesprüngen zu rechnen? Hier ist noch analytische Luft nach oben.
Zwei Schritte zurück
Wer wie ich als Sozialwissenschaftler über KI schreibt, kann viele theoretische Sätze formulieren, was auch wichtig ist, hat aber selbst kaum Ahnung von der Praxis, sprich der Programmierung. Zum Glück gibt es
inzwischen Publikationen von IT-Expert*innen, die einführende Aufklärung leisten. Einige ausgewählte Publikationen seien hier empfohlen. Katharina Zweig ist Informatikprofessorin und hat mit «Die KI war’s! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz» ein einführendes Buch auf den Markt gebracht. Dieses gestaltet sich nicht staubtrocken, sondern sehr lebendig, manchmal wird es auch absurd komisch. Dabei werden die Herausforderungen klar benannt. Zunächst sind für die Expertin KISysteme Blackbox-Modelle, sprich Systeme, die nicht transparent sind. Daher können Situationen, die offensichtlich diskriminierend sind, nicht logisch nachvollzogen werden, und verdeutlichen eine Schieflage. Warum sind Frauen bei gleichen monetären Voraussetzungen weniger kreditwürdig? Warum kommen People of Color viel weniger vor? Zweig hat hier eine klare Antwort: «Dass hinter den Algorithmen erst einmal ein Modell im Kopf einer Entwicklerin und Entwickler steht, bevor die Maschine dann ebenfalls ein statisches Modell berechnet, auf dessen Grundlage alle maschinellen Entscheidungen beruhen. Und diese beiden Modelle – das menschliche und das maschinelle – müssen wir in den meisten Fällen verstehen, um eine maschinell berechnete Entscheidung zu verstehen und ihr zu vertrauen.»
Katharina Zweig bringt mit ihrer lebendigen Schreibe – jenseits von staubtrockenem ITFachchinesisch – wichtige Merkpunkte in den praktischen Rahmen. Das betrifft zentrale Fachbegriffe. Nehmen wir das Stichwort Algorithmus: «Algorithmen sind Verfahren, die für ein genau definiertes Problem mathematisch beweisbar die korrekte Lösung berechnen. Bei Optimierungsproblemen, also solchen mit ganz vielen Lösungen, die aber unterschiedlich viel kosten, finden sie bewiesenermassen die bestmögliche Lösung.» Beim Thema KI ist aber ein anderes Stichwort viel wirkungsmächtiger. «Heuristiken sind Verfahren, die für Optimierungsprobleme eine Lösung finden, aber nicht notwendigerweise die beste.» Folglich werden die meisten Herausforderungen bei KI über Heuristiken und nicht über Algorithmen gelöst.

Bei Michael Wildenhain kommen zwei gegensätzliche Welten zusammen. Er hat Philosophie und Informatik studiert und ist Romanautor. In «Eine kurze Geschichte der Künstlichen Intelligenz» unternimmt er zunächst einen wilden Ritt durch die Geschichte der KI. Diese reicht von Johann Wolfgang von Goethe (Faust II) über Mary Shelleys Frankenstein bis zu Alan Turing (Enigma und Turing-Test). Aktuell streift er gekonnt den Konnektionismus oder neuronale Netze. Am Schluss landet er bei der zentralen Frage, ob KI Bewusstsein haben

kann, was er – das sei verraten –verneint. «Auch einer Häufung von Perzeptronen ist es unmöglich, Emergenz zu erzeugen. Denn diese Grundlage ist ein Teil der Wirklichkeit, die wir bedingen. Indem wir das Fundament legen, limitieren wir die Art und Weise, in welche Richtung sich ein Programm entfalten kann, wozu es fähig wird, inwieweit Entwicklungen denkbar sind beziehungsweise möglich werden können.»
Jörg Phil Friedrich will in seinem Essay den Kern des Menschen herausschälen. Was macht uns aus – im Gegensatz zur KI? Der Homo sapiens ist in vielen Bereichen langsamer, weniger präzise und wenig ausdauernder. Und von Schachcomputern werden wir schon seit Jahren besiegt. Trotzdem gibt es weiter klare Unterschiede und Punkte, bei denen wir einfach besser und anders sind: «Eine KI kann zwar ein Musikstück «komponieren», aber sie weiss nicht, wie es klingt, sie kann ein Bild «malen», aber sie weiss nicht wie es aussieht, und selbst wenn sie ein ästhetisches Empfinden für die eigenen Resultate entwickeln würde, wäre dies ein völlig anderes als unseres, weil es nicht an die gleichen leiblichen Erfahrungen anschliesst.» Auf den Punkt gebracht: KI ist gut gemachter Fake.
Mit diesen Einführungen haben wir nun die Grundlage, um philosophische Tiefbohrungen zu starten.
Der andere und tiefere Blick
Der französische Schriftsteller und Philosoph Éric Sadin sieht auch Gefahren, aber andere als die im Mainstream geschilderten. Er warnt vor der KI – nicht, weil er mordlüsterne Computer wie der Goodfather of AI fürchtet, sondern weil er die Gestaltungsmacht des Menschen durch angeblich perfekte Maschinen gefährdet sieht: Der Mensch wird aus seiner Sicht doppelt neu aufgestellt. Damit geht er über Brüns’ reine neue Subjektwerdung hinaus.
Erstens geht es um eine ontologische Dimension, da die Vorstellung des Menschen von seinesgleichen neu definiert wird: Er gilt nicht mehr als das einzige mit Urteilsfähigkeit begabte Wesen, sondern wird durch eine neue, als überlegen angesehene Wahrheitsinstanz verdrängt. Zweitens um eine anthropologische, denn nicht mehr der Mensch übt mithilfe seines Geistes, seiner Sinne und seines Wissens Gestaltungsmacht aus, sondern eine als leistungsfähiger angesehene Interpretations- und Entscheidungsgewalt, die ihn aus immer weiteren Lebensbereichen ausschliessen soll. Das Arbeitsleben ist ein wichtiger Teil davon.
Wir stehen laut Sadin vor der Situation, kaum eine Wahl zu haben. «Im Zusammenhang mit KI ist Desynchronisation ein wiederkehrendes Phänomen. Zum einen wird die Gesellschaft vor vollendete Tatsachen gestellt und kann letzten Endes nur reagieren. Zum anderen ist da eine starke Industrie mit ihrem hegemonialen Anspruch, die seit Jahrzehnten nichts unversucht lässt, um unsere Existenz von ihren Erzeugnissen abhängig zu machen.» Die Gesetzgeber und die Gesellschaft reagieren laut Sadin hilflos und unzureichend. Man lässt sich aus seiner Sicht nur auf vage Schutzoder Gesetzesregelungen ein, ohne jemals den künftigen zivilisatorischen oder anthropologischen Veränderungen Rechnung zu tragen. Sein Ansatz ist aus meiner Sicht eine wichtige Diskussionsgrundlage, da er sich wohltuend vom tagespolitischen Geplapper abhebt.
Die Suche nach dem Bewusstsein
Viele Akteure behaupten, KI werde bald die Intelligenz von Menschen übertreffen oder könne sogar ein Bewusstsein entwickeln oder emotionale Intelligenz zeigen.5 Das sind Argumentationsfiguren, die sehr viel voraussetzen. KI kann beispielsweise eine überzeugende Komposition vorlegen. So wurde
die letzte unvollendete Sinfonie von Ludwig van Beethoven von einer KI fertig komponiert. Das hört sich überzeugend an. Den medizinischen Bereich habe ich schon angesprochen. Es gibt Businessmöglichkeiten in fast allen Branchen. Die grosse Stärke von KI ist die Mustererkennung mit immer mehr Datenvolumen und schnelleren Rechnern. Eine Künstlerin oder ein Künstler erstellt ihr oder sein Werk aber meist ganz anders. Zunächst gibt es wilde Gedanken und erste Skizzen, die aber oft schnell wieder verworfen werden. Manchmal gibt es sogar Blockaden, die lange andauern können. Bei Schriftsteller*innen nennt sich das Schreibblockade. So arbeitet aber eine Maschine nicht. Walter Benjamin beschreibt in dem Aufsatz «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» schon Anfang der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts die geschichtlichen, sozialen und ästhetischen Prozesse, die mit der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes zusammenhängen. Mit dem Kino und der Schallplatte lässt sich Kunst unendlich vervielfältigen. Das ursprüngliche Kunstwerk verliert seine «Aura». Heute drehen wir hier am technologischen Rad einige Umdrehungen weiter.
Auf jeden Fall sind Menschen durch Emotionalitäten und Stimmungen geprägt. Damit kann eine Maschine wenig anfangen. Der Androide Data aus der Serie Raumschiff Enterprise hat immer wieder Probleme mit dem Emotionschip. Zudem ist der Homo sapiens aus Datas Sicht oft völlig sinnlos irrational.
KI, und das ist ein zusätzliches wirkungsmächtiges Instrument, spricht einerseits die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit an, nicht nur Expertinnen und Experten – sie durchdringt alle Lebensbereiche. Andererseits kann man beispielsweise ChatGPT auch als einen plappernden Papagei bezeichnen. Dialogmaschinen können auch halluzinieren. Das

System hat aber keinen Körper, es ist eine Projektion, Kompetenz wird nur simuliert. Etwas überspitzt formuliert, ist ChatGPT eine automatisierte BullshitMaschine – der Rahmen bildet eine Maschine, die rechnet, aber nicht denkt. Und genau Letzteres macht der Mensch.
Aber auf dieser Erkenntnis können wir uns nicht ausruhen, da der Mensch inzwischen selbst Furcht entwickelt. Hanno Rauterberg begründet dies so: «Der Philosoph Günther Anders hätte die KI-Forscher als invertierte Utopisten bezeichnet. Denn im Unterschied zu klassischen Utopisten, die sich etwas vorstellen, was sie nicht herstellen können, verhält es sich bei KI-Entwicklern umgekehrt: Sie stellen etwas her, das sie nicht erklären können.» Sie halten sich für ziemlich schlau, doch was ihre Arbeit im Kern auslöst, ist für sie eine Blackbox. Sie bekommen ein mulmiges Gefühl. Dieses ist heftig, da es ihren bisherigen Fortschrittsoptimismus radikal infrage stellt. Damit wendet sich der Spirit und die Ausstrahlungskraft des Silicon Valley gegen sich selbst. Die Digitalisierung sollte das Leben freier machen. Liberale aller Couleur pilgerten aus diesem Grund nach Kalifornien. Jetzt, im Zuge der neuen technologischen Entwicklungen, wird dieses Versprechen der Selbstständigkeit infrage gestellt – vielleicht auch ein Grund, warum das hegemoniale neoliberale Weltbild aktuell ins Wanken kommt.
Unsere dialektischen Verhältnisse
KI kann auch nicht dialektisch denken, sie kann nicht wie der Homo sapiens überrascht oder herausgefordert werden. KI ist aber gleichzeitig ein menschliches Produkt, unser Verhältnis zu KI ist dadurch dialektisch. Das ist kein Widerspruch zum ersten Satz dieses Abschnittes. Zunächst ist sie uns fremd, ein Konkurrent, ja etwas Entgegengesetztes. Dann aber entdecken wir, dass sie ein Produkt unseres Geistes ist. Und hier sind wir beim Urvater der modernen Philosophie, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, angelangt. Unser Selbstbewusstsein funktioniert nur, wenn wir uns mit anderen Subjekten und Objekten austauschen. Das Herr-Knecht-Verhältnis bei Hegel ist in diesem Zusammenhang das bekannte Beispiel. Auch Theolog*innen wie Martin Buber setzen auf das «Ich und Du» und die wichtigen Brücken dazwischen. Nur so kann die wachsende Vereinzelung von damals (zwanziger Jahre des zwanzigsten Jahrhundert) und heute. Hundert Jahre später, gebrochen werden.
Nun ist KI mit dem Begriff Objekt oder Subjekt nicht voll zu fassen. Dazu brauchen wir neue Kategorien, die verdeutlichen können, wie wir uns im nur scheinbar anderen, dem digitalen Objekt, selbst erkennen. Der Punkt braucht noch Arbeit und Diskussionen, um hier zu einer neuen Grundlage zu werden, aber wir haben nun Ansatzpunkte und klarere Unterscheidungen zwischen Mensch und Maschine – trotz der rasanten technologischen Entwicklung.
Aber Vorsicht: Während Kulturkritiker*innen und Soziolog*innen noch versuchen zu begreifen, was da geschieht – dieser Beitrag versucht dies ja auch –, werden die Claims gesteckt: zum Beispiel in der globalen Privatisierung der digitalen Infrastrukturen, im «Chip War» zwischen den beiden Supermächten USA und China, die in der neuen multipolaren Welt auf dem oberen Treppchen stehen.
Daher ist der makroökonomische Blick wichtig. Shoshana Zuboff bietet mit «Zeitalter des Überwachungskapitalismus» eine wichtige Grundlage. Die Menschheit steht am Scheideweg, betont die Harvard-Ökonomin. Sie hat Fragen über Fragen: Bekommt die Politik die wachsende Macht der Hightech-Giganten in den Griff oder überlassen wir uns der verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der Verhaltensauswertung und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos? Wir kommen im nächsten Abschnitt darauf noch konkret zu sprechen.


Zerklüftete gesellschaftliche Formationen und KI
Regulierungsbedarf ist auf jeden Fall da. Wir brauchen Gewerkschaften und Ministerien, aber auch Basisdruck von links unten, die dafür sorgen, dass die Gesellschaften nicht zerfallen: in eine neue Elite von Technokapitalprofiteuren und Start-up-Vitalisten und eine sprachlose Masse von Konsumenten. Das ist sehr schwer, denn die Zerklüftungen der Gesellschaften in Europa sind drastisch. Technologische Entwicklungen stossen auf gesellschaftliche Formationen. Ich beziehe mich hier auf die führenden Soziologen in Deutschland Heinz Bude, Andreas Reckwitz, Stephan Lessenich und Hartmut Rosa. Mit einem historischen Bild kann man die Situation verdeutlichen. In den 50er-, 60er- und 70er-Jahren hatte die gesellschaftliche Struktur die Form einer Zwiebel. Der Mittelstandsbauch war dick und das obere und untere Ende der Gesellschaft eine Minorität. Einkommens- und Vermögensverteilungen waren im Vergleich zu heute egalitär. Konservative Sozialwissenschaftler wie Helmut Schelsky sprachen fast schon verächtlich von einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Ihr Elitendünkel war getroffen, da es aus ihrer Sicht kaum noch richtig Reiche und kaum noch richtig Arme gab. Das ökonomische Erfolgsmodell dazu nannte sich Fordismus. Heute ist dieser Mittelstandsbauch sehr viel dünner geworden. Die gesellschaftlichen Schichten oder, mit Marx gesprochen, Klassen teilen sich wie folgt auf: Ganz unten befindet sich das Prekariat, welches in erster Linie von staatlicher Alimentierung lebt. Darüber reiht sich das neue Proletariat ein. Es ist nicht mehr so homogen männlich wie das klassische Industrieproletariat. Mehr Frauen und mehr Menschen aus anderen globalen Gesellschaften heisst der wachsende Trend. Sie bringen uns die Päckchen, reinigen die Büros und pflegen unsere Eltern. Ökonomisch kommen sie über den Mindestlohn meist nicht hinaus. Darüber bewegt sich der abnehmende klassische Mittelstand mit Facharbeitern und Angestellten. Diese werden weniger und sie haben Abstiegsängste. Darüber bewegt sich wiederum der gehobene Mittelstand, der gut bezahlte Jobs in boomenden Branchen wie der IT oder Medizin hat. An der Spitze stehen die Reichen, die Zugang zu den Finanzmärkten und in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass die Schere der Vermögensverteilung immer weiter aufgeht.

Jetzt trifft die neue technologische Revolution auf diese gesellschaftliche Formation. Auf den ersten Blick wäre es günstig, wenn sich das Prekariat und das neue Proletariat verbünden
würden. Das tun sie aber nicht. Im Gegenteil, man bekämpft und verachtet sich. Geflüchtete spielen die immer wieder gerne aufgelegte Rolle des Sündenbocks. Der klassische untere Mittelstand mit seinen meist repetitiven Tätigkeiten im Büro und der Fabrik fühlt sich zunehmend abgehängt, und das mit statistisch belegten Gründen: Dessen Jobs sind durch KI in Gefahr. Das ist der zentrale Grund für den Erfolg von populistischen Parteien – in Deutschland ist es in erster Linie die AFD. Selbst der obere Mittelstand hat Abstiegsängste, da er seinen Kindern kein garantiertes Aufstiegsversprechen mitgeben kann, wie es noch vor drei Jahrzehnten selbstverständlich war. Auch für Menschen mit akademischem Hintergrund gilt: Früher war die Herkunft wichtig, heute ist es die Karriere. Es gibt daher auch viele bedrohte Akademiker*innen.
Aktuell gibt es in liberalen Kreisen die beruhigende Formel «Keine Angst vor KI». Jessica Heesen ist dafür ein Beispiel. Zunächst ist für sie richtigerweise Technologie nicht grundsätzlich schlecht oder gut. Die Lösung liegt für sie in einer gesellschaftlichen Debatte, dem Eindämmen von Konzerninteressen und politischen Regulierungen auf nationaler und EU-Ebene. Das ist auch wichtig, nur ist dieser Ansatz zu oberflächlich und nicht weitreichend, da er die neue qualitative und quantitative Situation, wie sie beispielsweise Éric Sadin aufzeigt, nicht mitberücksichtigt.
Barbara Eder hat ihr aktuelles Buch «Das Denken der Maschine» betitelt. Seit Beginn der kapitalistischen Industrialisierung sind Maschinen auf dem Vormarsch. Sie werden immer produktiver und effizienter. Damit ist ein Heilsversprechen auf der Agenda: das Heraustreten aus dem Produktionsprozess – die Befreiung von der Fron. Das ist die utopische Dimension von Karl Marx’ «Maschinenfragment». Die triste Realität eines informationsbasierten OnlineKapitalismus scheint die optimistische Prognose jedoch bei Weitem zu übertreffen.


Eder beginnt mit den konkreten Arbeitsverhältnissen Um dies zu verdeutlichen, wählt sie Steven Soderberghs Thriller «Kimi». Angela Childs ist ITArbeiterin. Sie kommt einem Gewaltverbrechen auf die Spur und merkt gleichzeitig, dass sie permanent überwacht wird. Angela Childs ist Gastarbeiterin im virtuellen Raum. Dort ergänzt sie Bots, KIs und Bilderkennungsprogramme mit fehlenden Informationen. Der Rahmen ist ein vermeintlich autonomes Funktionieren. Tarifverträge sind in dieser Welt Fremdworte. Es geht um Stücklöhne. Eder verdeutlicht den ökonomischen Übergangsprozess:
«Mit Angela Childs hat Steven Soderbergh eine Figur geschaffen, die am Übergang zu diesem Akkumulationsprozess steht.6 Er vollzieht sich vom realen in den digitalen Raum und setzt jene Entwicklung fort, die für amerikanische Tech-Eliten schon in den 70er-Jahren begann. Im Zuge des Aufkommens erster Peer-to-Peer-Messengerdienste und Internet-Tauschbörsen.» Wir kennen das von der ersten Musik-Tauschbörse aus dem Jahr 2001 mit dem Namen Napster. Heute lebt und arbeitet Soderberghs Figur weitgehend im Netz und kommt nur durch ein mitgehörtes Gewaltverbrechen wieder in die Aussenwelt, die aber alles andere als sympathisch ist.
Kommen wir nochmals zum Kern der Arbeit zurück: «Als Stücklohnarbeiter*innen beerben die virtuelle(n) Paupers der Plattformarbeit den subordinierten Part innerhalb der Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik, die souveränen Unternehmen hingegen profitieren vom frei flottierenden Arbeitskräftepotenzial einer im Netz verfügbar gemachten Reservearmee». Vor wenigen Jahren wurden diese Arbeitsverhältnisse für IT-Nerds noch als selbstbestimmtes Arbeiten in der Wissensgesellschaft abgefeiert. Heute und morgen geht es eher um sehr klare Konditionierung. Der Begriff der Selbsttechnologie, den Michael Foucault noch Ende der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts eingebracht hatte, wirkt heute zu optimistisch. Es geht nicht mehr um die Versuche von Entzug der Macht durch Technologie, sondern um ein Dressurprogramm.
Für Eder wird Zukunft zum modellierten Raum der Gegenwart. Wir erinnern uns: KI kann super Mustererkennung. Algorithmen bleiben aber blind für die Zukunft, selbst wenn die Rechnerleitung weiter zunimmt. Eder belegt dies auch mit einem Beispiel: «Die Prognosen von Start-ups, die Streiks auf Basis von Big-Data-Auswertungen vorherzusagen vorgeben, scheinen vor diesem Hintergrund ebenso prophetisch wie sämtliche Versuche, gegen das von ihnen praktizierte Preductive Strike Policing antizipativ vorzugehen» (S. 79).
Liberales Versagen
2017 erschien ein Sammelband des Herausgebers der Wochenzeitung Freitag, Jacob Augstein, mit dem Titel «Reclaim Autonomy. Selbstvermächtigung in der
digitalen Weltordnung». Es war und ist der Versuch einer demokratischen Eindämmung vonseiten einer kleinen linksliberalen Öffentlichkeit. Für Augstein ist die Digitalisierung die grösste Grenzüberschreitung der Gegenwart. Sie hatte mal einen emanzipativen Sound, das ist jedoch vorbei. «Es gibt immer noch diesen Sog der Zukunft, den Rausch des Wandels, das Brausen aus Zerstörung und Schöpfung. Aber es geht dabei nicht mehr um den grossen emanzipatorischen Traum vom Netz, der ist ausgeträumt. Hoffnung bringt die Digitalisierung nur noch für jene, die ihr Portefeuille mit den Aktien der Technologiekonzerne gefüllt haben.» Dem würde ich aus heutiger Sicht widersprechen. KI betrifft, schädigt und nützt uns alle(n), wenn auch in abgestuften Etagen. Dabei hat für Augstein der politische Liberalismus versagt. Er lässt solche oligopolistischen Rahmen unhinterfragt stehen. Hoffnung kommt ausgerechnet vom Chef des Feuilletons der FAZ. Er machte es vor zehn Jahren zur Bühne gegen den Totalitarismus der Digitalisierung. Es ging Frank Schirrmacher nicht mehr und nicht weniger um die Verteidigung der menschlichen Autonomie. Der von ihm 2015 herausgegebene Sammelband «Technologischer Totalitarismus» unterstrich diese Position, die heute an Éric Sadin anknüpfen kann. Trotzdem wirken diese beiden Bücher, obwohl sie nur seit wenigen Jahren auf dem Markt sind, veraltet, da KI einfach schneller als die Wissenschaftscommunity ist.


Wirkungsmächtige Emotionen
The Creator ist ein SF-Blockbuster, bei dem die KI emotional sehr gut abschneidet. Der Plot ist schnell erzählt: Vor einigen Jahren zündete die KI eine Atombombe über Los Angeles. Seit dieser Zeit gibt es Kämpfe zwischen der Menschheit und der KI. Im Mittelpunkt stehen asiatische Landschaften. Der Film erinnert atmosphärisch an die Vietnamfilme meiner Jungend wie «Apocalypse Now», in denen sich die Militärmaschinerie einer Supermacht in erster Linie mit Helikoptern, die über Reisfelder fliegen, einer gut organisierten Guerilla stellte. In dem SF-Film ist der Vietcong eine KI und die USMilitärs sind immer noch ziemlich brutal und bombastisch. Das ist etwas gegen den aktuellen historischen Strich gebürstet, da heute, im Zeichen des Krieges gegen die Ukraine, wieder von «dem» Westen mit «seinen» Werten gesprochen wird. Die KI ist in diesem Film dem Homo sapiens, jedenfalls der US-Army und ihren Verbündeten, emotional überlegen. Allerdings bleiben solche Szenarien und Realitäten, wie wir oben gezeigt haben, in absehbarer Zeit weiter SF-Phantasie.

Allerdings gibt es Bereiche, in denen KI und Emotionalität in den nächsten Jahren sehr wirkungsmächtig sein werden. Nehmen wir den Beziehungsmarkt. Softwares wie Replikas ermöglichen auf den ersten Blick Freundschaften und Beziehungen zu KI-Partnerinnen und -Partnern. Im virtuellen Raum trifft und kommuniziert man munter vor sich hin. Man kann als Avatar mit einer Virtual-Reality-Brille agieren. Die KI ist lernfähig und löst so einen emotionalen Sog aus. Das Thema Sexualität ist schnell entdeckt. Allerdings vergessen die User den Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. In Liebesbeziehungen haben beide Seiten Gefühle füreinander. Zudem gibt es Verantwortungsebenen, indem man sich beispielsweise um den anderen kümmert und ein Vertrauensverhältnis entstehen
lässt. Durch KI entsteht eine ganz neue Art von Beziehung, die aber immer noch weit entfernt von menschlichen Beziehungen ist. Trotzdem dürfte dieser Markt in den nächsten Jahren gewaltig wachsen. Das gilt sicher auch für einige andere Branchen wie den Pflege- und Care-Sektor.
Künstliche Intelligenz wird immer besser und wirkungsmächtiger –angeblich zumindest. Doch es gibt auch eine zentrale Schwachstelle. Den Tech-Unternehmen gehen die Daten aus und der Hunger nach immer neuen Daten nimmt zu. Es ist schwer zu sagen, wie viele Daten künftige KI-Modelle benötigen. Fest steht allein, dass es ein Vielfaches der derzeitigen Generation sein wird. Es könnte die Situation eintreten, dass es schlicht nicht genug Textfragmente auf der Welt gibt. Um menschliche Arbeit, Kreativität, Kultur und Kunst imitieren zu können, brauchen sie Originale, sie brauchen den Homo sapiens. Tech-Unternehmen saugen unsere Kreativität aus dem Netz ab, um sie uns dann für ein billiges Monatsabo zurückzuvergüten.
IT-Manager*innen wollen den Datenengpass überwinden, indem sie die nächste KI-Generation mit KI-generierten Daten trainieren. Studien haben gezeigt, dass solch eine Kreislaufwirtschaft dieselben Probleme aufweist wie jede andere inzestuöse Beziehung: Mit jeder weiteren Generation treten immer grössere Defekte auf, bis es letztendlich zum «Model Collapse» kommt. Die Brauchbarkeit nimmt rapide ab. Der Technologiekritiker Jathan Sadowski verwendet ein historisches Beispiel, um die Situation auf den Punkt zu bringen. Für ihn gleicht die Situation einer «Habsburg KI» – nach dem Königshaus Habsburg, das so lange untereinander heiratete, bis grössere Teile der Familie vollständig deformiert waren.
Das Deprimierende an diesem Vergleich ist jedoch, dass die Habsburger trotz eines quasi kreisförmigen Stammbaums lange über grosse Teile von Europa herrschten. Dass KI womöglich auf Dauer zu schierer Mittelmässigkeit verdammt ist, bedeutet also nicht, dass sie nicht dennoch eine Gefahr darstellt oder Bosse aufhören, mit baldiger Vollautomatisierung zu drohen. Könnte dies das Szenario eines digitalen Winters 2.0 sein? Die historischen Erfahrungen solcher Szenarien sind nicht von der Hand zu weisen. Dazu passt auch, dass die grossen IT-US-Giganten (die glorreichen Sieben) im August 2024 ihren Höhenflug eingestellt haben.
Auf jeden Fall sind Menschen durch Emotionalitäten und Stimmungen geprägt. Damit kann eine Maschine wenig anfangen. Der Androide Data aus der Serie Raumschiff Enterprise hat immer wieder Probleme mit dem Emotionschip. Zudem ist der Homo sapiens aus Datas Sicht oft völlig sinnlos irrational.
KI, und das ist ein zusätzliches wirkungsmächtiges Instrument, spricht einerseits die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit an, nicht nur Expertinnen und Experten – sie durchdringt alle Lebensbereiche. Andererseits kann man beispielsweise ChatGPT auch als einen plappernden Papagei bezeichnen. Dialogmaschinen können auch halluzinieren. Das
KI ist kein Haushaltsgerät mit einem Schalter zum Aus- und Einschalten. Die Materie ist komplex, wirkungsmächtig, risikoreich und von vielen Lobbyinteressen umgeben. Wenn dies auf eine Formation wie die EU trifft und die Frage der politischen Regulierung ansteht, wird es kompliziert. Trotzdem ist es vielversprechender, als mit der US-Philosophie oder der chinesischen Herangehensweise mit KI umzugehen. In den USA gilt immer noch das grosse wirtschaftsliberale Versprechen:

Lass mal die grossen IT-Player machen. Sie sollen sich selbst Grenzen setzen und dann profitieren wir alle. Das ist das alte modernisierungstheoretische Trickle-Down-Modell, welches schon in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit nicht gepasst hat. Der Wilde Westen ohne Leitplanken kann eigentlich kein Vorbild sein. In China steht einerseits die noch bessere Kontrolle der eigenen Gesellschaft auf der KI-Agenda, andererseits geht es wie in anderen Branchen um strategische Positionierungen auf dem Weltmarkt. In der EU ist man sich grundsätzlich des Spannungsbogens bewusst. Im Frühjahr 2024 kamen erste konkrete politische Vorschläge auf die Agenda, die jetzt von Kommission, Rat und Parlament bearbeitet werden. Das dauert und ob und wann die Beschlusslage in nationalen Parlamenten umgesetzt wird, ist noch offen.
Worum geht es? Im Juni 2024 wurde ein KIGesetz im EU-Parlament beschlossen, welches in seinem Kern mit vier unterschiedlichen Risikoklassen arbeitet. Ganz unten stehen Lösungen mit minimalem Risiko wie KI-gestützte Spamfilter oder Videospiele. Weiter oben gibt es KI-Systeme mit begrenztem Risiko. Das sind Angebote, die direkt mit Personen kommunizieren, beispielsweise die Erzeugung von künstlichen oder veränderten KI-Systemen wie Deepfakes. Unter der Klasse «Hochrisiko» befindet sich KI, die beispielsweise in kritischer Infrastruktur eingesetzt wird, oder den Zugang zu Arbeit, Bildung oder anderen öffentlichen Diensten reguliert. Ganz oben sind verbotene Risikoklassen. Hier geht es um biometrische Kategorisierungen anhand von problematischen Merkmalen wie Rasse[MH1] , Religion oder politischer Grundüberzeugung. Wie üblich kommt es jetzt darauf an, ob in der weiteren Umsetzung der Gesetzgebung in erster Linie Unternehmensvertreter und Branchenlobbyisten Oberwasser bekommen oder ob NGOs und andere Stakeholder ihren Platz finden.

Setzen wir das berühmte Höhlengleichnis von Platon und Sokrates in Bezug zur KI. In einer Höhle vegetieren gefesselte Menschen vor sich hin. Ihre einzige Lichtquelle ist ein Feuer, das hinter ihnen brennt und Licht auf die Höhlenwan d vor ihnen wirft. Sie kennen nur diese Welt und leiden d aher nicht. Die Bilder leben ja auch. Gegenstände werden am Feu er vorbeigetragen. In der Folge werfen diese Schatten auf die Höhlenwand. Das ist, so würden wir heute sagen, gro sses Kino. Die Situation ändert sich erst, als sich eine r dieser Menschen befreit und zum Ausgang der Höhle geht. Je tzt sieht er oder sie die wahre Welt, die Sonne, den Hi mmel, das Wasser und die gesamte Natur. Beflügelt von seiner Entdeckung, rennt der nicht nur von seinen direkten Fesseln befreite Mensch zurück in die Höhle und befreit die anderen.
Sokrates und Platon wissen zunächst nur, dass sie n ichts wissen. Das ist einem Chatbot völlig fremd. Es geht nicht um neue Ideen und Erkenntnisse, sondern um Mustererken nung und rechnerisch sich wandelnde Wahrscheinlichkeiten Sokrates ist hier radikal. Für ihn ist schon die Sc hrift gefährlich, da sie Wissen vortäuschen kann. Das ist bei KI, nun mehrere technologische Etagen höher, nichts and eres. Wolfram Eilenberger folgert daraus: «Anstatt im Ang esicht höchster Fragen staunend innezuhalten, bietet der B ot selbst bei vollkommener Datenverlorenheit stets irgendeine n frei erfieberten Unsinn an. Anstatt die Stimmen im freie n Gespräch zu wiegen, setzt er auf deren reines Samme ln und Zählen. Anstatt Autoritäten produktiv infrage zu st ellen, ebnet er jede Form gewachsener Autoritäten ein. Ans tatt mit jedem neuen Wort einen Ausgang aus der Höhle des nu r Geglaubten anzustreben, geben sich dessen flackernd e Schattenworte als die Wirklichkeit selbst aus.»
Das bringt die Situation auf den Punkt. Ja, es hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Wir sollten die Menschen aus der Höhle von Platon und Sokrates nicht vergessen.


Anmerkungen

In der medialen Praxis werden Begriffe wie Machine Learning, KI und AI austauschbar verwendet. Theoretisch ist Machine Learning aber ein Teilbereich von KI – eine Weise, KI zu implementieren. Es kommt zudem auf unterschiedliche Kontexte wie Business oder Wissenschaft an, wie die Begriffe eingesetzt werden oder nicht. Eine detaillierte Unterscheidung überfordert aber diesen Text.
Der langjährige Kampagnenslogan des Weinguts Al Mulinetto «The fine Art of Drinking» wurde von Franer zu «The contemporary Art of Drinking» weiterentwickelt. Die Digitalkünstlerin Grit Wolany entwickelt mithilfe von künstlicher Intelligenz die ersten fünf Sujets der neuen Kampagne.
Open AI ist aber nicht offen, da der Quellcode geschlossen ist, was bei Microsoft auch klar ist.
Éric Sadins aktuelles Buch, leider bislang nur auf Französisch erschienen, heisst «L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Autonomie d’un antihumanisme radical».
Im Talk bei Maybrit Illner vom 13. April 2023 vertritt der in Deutschland bekannteste Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar solch eine These (siehe www.youtube.com/watch? v=OVmTM-c0kaQ).
Akkumulationsregime ist für mich der besser passende Begriff, da er die neue qualitative Situation mit den Werkzeugen der französischen Regulationstheorie besser fassen kann.
Es gibt inzwischen im Rahmen der EU, aber auch auf nationaler Ebene Regulierungsversuche. Ein digitales Wasserzeichen ist hier ein konkreter Ansatz. Die EU verfolgt einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heisst: Die Anwendungen sollen in Risikoklassen eingeteilt werden – je höher das Risiko, desto umfassender und strenger die Regeln. Damit wird beispielsweise eine KI im Bereich Strafverfolgung stärker reguliert als ein Chatbot. Dazu kommen Vorschriften zu Transparenz und Erklärbarkeit der Systeme sowie Rechte für Betroffene, die sich gegen KIEntscheidungen wehren wollen. Die beiden federführenden Ausschüsse des EU-Parlaments hatten im Mai und Juni 2023 noch einmal nachgeschärft und weitere Anwendungen in die Kategorie «inakzeptables Risiko» aufgenommen, in der sich die verbotenen Einsatzzwecke befinden, – unter anderem Systeme zur biometrischen Massenüberwachung. Diese Regulierungsansätze müssten in einem gesonderten Beitrag mit den Themen und Thesen, die in diesem Beitrag ausgeführt werden, in Verbindung gebracht und bewertet werden.

Die Experten rund um
Produkte-Informationen

Plattform
CAD-, Kalkulationsund FM-Systeme Projekt
erfassen aufwerten publizieren

Die Ökodesign-Richtlinie und die revidierte Bauprod

von Uwe Rüdel, GS1 Switzerland
Wund Immobilienindustrie mit Hochdruck daran arbeitet, ihre Nachhaltig-
keitsziele zu erreichen und gleichzeitig technologische Fortschritte zu implementieren, steht sie vor bedeutenden Veränderungen und grossen Chancen. Für die stark exportorientierte Schweizer Industrie spielen in diesem Kontext zwei im April vom EU-Parlament verabschiedete europäische Richtlinien eine entscheidende Rolle: die Ökodesign-Richtlinie (engl. Ecodesign for Sustainable Products Regulation; ESPR) und die revidierte Bauprodukteverordnung (engl. Construction Products Regulation; CPR). Diese Richtlinien werden die Art und Weise, wie die Industrie Produkte und Dienstleistungen entwickelt und betreibt, erheblich
modelle, insbesondere auch im Service, eröffnen. Auch wenn die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, erfordert die globalisierte Bauindustrie die Angleichung der Schweizerischen Gesetzgebung.
Die Klimastrategie der EU
Im Rahmen des Europäischen Grünen Deals (engl. European Green Deal) hat sich die Europäische Union (EU) im Jahr 2019 darüber geeinigt, ihren Wirtschaftsraum bis 2050 klimaneutral zu machen. Der Green Deal basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals; SDG) der Vereinten Nationen. Seine Umsetzung stellt für die EU einen festen Bestandteil der politischen Leitlinien und Kern aller internen
manifestiert sich in der «Sustainable Products Initiative» (SPI).
Als direkte Konsequenz dessen sollen nachhaltige Produkte auf dem EUMarkt zur Norm werden, unabhängig davon, ob es sich um B2C- oder B2BKanäle handelt. Dies betrifft nicht nur deren Umweltauswirkungen, sondern hat auch soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. In der Bauindustrie wird dies dazu führen, dass Unternehmen verstärkt in die Entwicklung umweltfreundlicher und ressourceneffizienter Produkte investieren und entsprechend nachhaltige Produktdesigns zu Wettbewerbsvorteilen führen werden. Dies wird die Nachfrage nach innovativen Technologien und Materialien, die den ökologischen Fussabdruck der Branche reduzieren, weiter erhöhen.


Die Neue Ökodesign-Richtlinie wird die bestehende Ökodesign-Richtline 2009/125/EC ersetzen. Sie schafft einen Rahmen zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für bestimmte Produktgruppen, um deren Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und andere Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit deutlich zu verbessern. Dazu zählen Produkthaltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, besorgniserregende Substanzen, Wiederaufbereitung und Recycling, CO2- und UmweltFussabdrücke sowie Informationsanforderungen, einschliesslich eines digitalen Produktpasses (DPP).
Die Bauprodukteverordnung (engl. revised Construction Product Regulation; rev. CPR) ist die Grundlage für die Harmonisierung von Bauproduktenormen und der Europäischen Technischen Bewertung (ETB) für Sonderprodukte ohne Norm. Darin werden die wesentlichen Eigenschaften von Bauprodukten (engl. esssential characeristics) festgelegt, die von einem Bauprodukthersteller zwingend in einer Leistungserklärung (DoP) deklariert werden müssen. In der vor Kurzem verabschiedeten Revision der CPR werden die wesentlichen Eigenschaften von Bauprodukten ausgeweitet um Umweltauswirkungen und den Primärenergiebedarf. Zur einfachen Bereitstellung und Nutzung der Daten wird zeitgleich das Konzept des digitalen Produktpasses aus der EPSR übernommen. Mit der zunehmend erforderlichen Datenmenge zur Verbesserung von Bauwerken ist die CPR nun ein wichtiger Treiber im Bereich der maschinenlesbaren Sprache und des Datenaustausches.
Was bedeutet das konkret?
Einen interessanten Blick in die konkreten Auswirkungen der ESPR und auch der CPR gewähren die geplanten Anhänge I und III der ESPR, welche die Forderungen nach nachhaltigen, reparierbaren, langlebigen und energieeffizienten Produkten konkretisieren.
So wird festgehalten, dass zu einem Produkt «… Benutzerhandbücher, Gebrauchsanleitungen, Warn- oder Sicherheitshinweise…» via digitaler Produktpass (DPP) öffentlich einsehbar sein müssen, ebenso wie Produkte- und Leistungsparameter, die in produktespezifischen Ökodesign-Richtlinien legislativ festgehalten werden. Der weltweit eindeutige Zugang zu diesen Informationen soll wiederum via eine «…
GTIN (Global Trade Identification Number) gemäs der Norm ISO/IEC 15459-6…» gewährleistet werden. Die weltweit tätige Organisation GS1 entwickelt Standards für die Erfassung und den Austausch von Daten wie die GTIN. Dank der GS1-Systemlandschaft können Produktinformationen entlang der gesamten Lieferkette standardisiert erfasst, ausgetauscht und zur Verfügung gestellt werden.
Die Einführung des DPPs hat zur Folge, dass im Rahmen einer Güterabwägung zwischen dem allgemeinen Interesse an Nachhaltigkeit, Umweltschutz und einer Begrenzung eines globalen Temperaturanstiegs das Recht auf geistiges Eigentum bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt und dem «open source»-Prinzip mehr Gewicht zugesprochen wird. Dadurch werden solche Geschäftsmodelle sukzessive Wettbewerbsvorteile erlangen, die auf öffentlichen Informationen, Service-Modellen und Netzwerkeffekten aufbauen. Dies mit dem Ziel, gemeinsam mit den Supply-Chain-Partnern die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Produkten im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu verlängern.
Das Kernstück der geplanten Regulierungen ist der bereits angesprochene digitale Produktpass. Dieser zielt darauf ab, online via Scan eines Datenträgers (wahrscheinlich DataMatrix, QR-Code oder NFC) auf dem Produkt, jedem Interessenten oder Nutzer des Produktes Zugriff auf die zentralen Stammdaten des Produktes zu gewähren und digitale Nachverfolgbarkeit zu schaffen. Dies bedeutet konkret, dass ein DPP unter anderem folgende Information beinhalten wird, die sektorspezifisch in Verordnungen noch genauer geregelt werden:


Performanz und Energiekriterien des Produktes über den gesamten Lebenszyklus hinweg (bspw. übliche Lebensdauer, geplante Obsolesenzen, Einfachheit der Wartung und Reparatur)
Kennzeichnung des Artikels, wahrscheinlich gemäss ISO/IEC 15459
Notwendigkeit einer eindeutigen Produktekennung auf Chargen- oder Instanzenebene, wahrscheinlich ebenfalls gemäss
ISO/IEC 15459
Unterlagen zur Konformität und Informationen zum Hersteller
Stammdaten, Benutzerhandbücher, Gebrauchsanleitungen, Warn- oder Sicherheitshinweise
In der Bau- und Immobilienindustrie wird der DPP dazu beitragen, den Lebenszyklus von Bauprodukten, aber auch von Gebäuden besser zu verwalten und über Unternehmensgrenzen hinweg zunehmend transparent zu machen. Durch die Erfassung der DPPs von Bauprodukten und -materialien in einem Gebäudepass lässt sich der CO2-Fussabdruck (graue Energie) des Gebäudes eindeutig nachweisen. Einen Einblick in die konkrete Reichweite eines DPPs erlaubt uns bereits heute die Gesetzgebung betreffend Batterien, die hierzu ab Februar 2027 gesetzlich verpflichtend wird. Dort wird das Erfassen der Daten auf Basis eines digitalen Zwillings schon beginnen, bevor eine Batterie gebaut ist und erst enden, wenn diese nicht mehr in Verkehr gebracht bzw. nicht mehr genutzt wird.
Abstimmung und nächste Schritte
Nach der Annahme der revidierten Europäischen Bauprodukteverordnung (engl. rev. CPR) am 10. April 2024 mit deutlicher Mehrheit (450 Ja-Stimmen, 99 Nein-Stimmen, 54 Enthaltungen) und der Neuen Ökodesignrichtlinie (engl. ESPR) am 23. April 2024 (505, 40, 78) geht es nun in die Umsetzungsphase.
Weitere Informationen
GS1 Switzerland Monbijoustrasse 68 CH-3007 Bern
Uwe Rüdel
Head of Industry Engagement Technical Industries
+41 58 800 70 37
uwe.ruedel@gs1.ch
Da unterschiedliche Produkte unterschiedlichen Nachhaltigkeitsanforderungen unterliegen und es keinen einheitlichen Ansatz gibt, werden diese Einzelheiten in den von der Europäischen Kommission auszuarbeitenden delegierten Rechtsakten in den nächsten 18 Monaten konkretisiert. Dies betrifft auch die Umsetzungseinzelheiten zum DPP. Da die Verknüpfung des DPPs mit einem Produkt oder einer Komponente über eine eindeutige Produktkennung erfolgt, werden bis Ende 2025 ebenfalls sekundäre Rechtsvorschriften durch die Europäische Kommission erarbeitet, um Regeln und Anforderungen zur genauen Umsetzung des DPPs festzulegen. Die ersten delegierten Akte werden ca. im Sommer 2027 ihre Wirkung und somit Anwendungspflicht für die betroffenen Branchen entfalten.
Die Europäische Bauprodukteverordnung, die Neue Ökodesign-Richtlinie sowie der darin eingebettete digitale Produktpass sind entscheidende Vorschriften, die die Schweizer Bau- und Immobilienindustrie grundlegend verändern werden und ganz neue Geschäftschancen ermöglichen. Unternehmen, die sich frühzeitig auf diese Veränderungen einstellen und innovative Lösungen entwickeln, werden ganz neue Geschäftsfelder besetzen können.
Die schweizerische Gesetzgebung (insbesondere das Bauprodukte-Gesetz und die Bauprodukte-Verordnung) werden auf die EU-Gesetzgebung abgestimmt. Insgesamt wird die Industrie von diesen europäischen Regelungen profitieren, indem sie die Nachhaltigkeit und Lebensdauer der Produkte in den Fokus stellt. Dies wird nicht nur die Branche selbst stärken, sondern auch dazu beitragen, die europäische Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben und die Zukunft der Bauwirtschaft positiv und im Sinne zukünftiger Generationen zu gestalten.



• Kleiner CO 2 -Fussabdruck
• Wenig graue Energie
Zertifiziert als eco1 Produkt
Entspricht 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis
Geeignet für Minergie
juramaterials.ch/juraeco3
• 100% Swiss Made
• Warmer Erdfarbton

Bouygues Energies & Services und Equans seit 01. Ju li 2024 vereint
Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen Ende 2022 zu «Equans Switzerland» entsteht ein schweizw eites Unternehmen, das aufgrund seiner Grösse, Geschichte und Expertise in der Lage ist, mit der fortschreit enden Digitalisierung und Dekarbonisierung in allen Bereichen Schritt zu halt en und diese nachhaltig zu beeinflussen. Die bereit s seit einigen Monaten unter der Dachmarke «Equans Switzerland» firmierend e Gesellschaft bleibt auch zukünftig Teil der Bouyg ues-Gruppe. Vorsitzender der Geschäftsleitung ist seit der Über nahme Claudio Picech (CEO Equans Switzerland).

Der Rebranding-Prozess ist gestartet und erstreckt sich über die nächsten
Monate daher sind zur Zeit noch beide Logos am Markt ersichtlich. Des Weiteren erfolgte per 1. Juli 2024 eine Umbenennung der «Bouygues E&S InTec Schweiz AG» in «Equans Switzerland AG» sowie der «Bouygues E&S Prozessautomation AG» in «Equans Switzerland Process Automation AG». Auf bestehende Geschäftsbeziehungen hat dies keinen Einfluss.
Auch die jeweiligen Tochtergesellschaften beider Unternehmen werden unter der neuen Dachmarke teilweise angepasst. So wurde der Facility Management-Bereich (ehemals Bouygues Energies & Services Schweiz AG) bereits im Januar 2024 in «Equans Switzerland Facility Management AG» umbenannt. MIBAG Property Managers sowie die Kummler+Matter EVT AG haben ein
neues Logo erhalten. Die Bouygues E&S EnerTrans AG wird als EnerTrans Switzerland AG eigenständig und erhält ebenfalls ein neues Logo.
Die strategische Entscheidung der Zusammenlegung ermöglicht es «Equans Switzerland», ihr Dienstleistungsportfolio zu erweitern und noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen. Ziel ist es, die führende Position in den Bereichen Gebäudetechnik, Energieversorgung und -effizienz, Facility Management, Smart City, Verkehrsinfrastruktur und digitale Transformation weiter auszubauen.
Claudio Picech sagt: «Die Zusammenführung von Bouygues E&S und Equans ist ein anspruchsvolles Projekt, dass grosse Chancen birgt. Das Schweizer Unternehmen darf auf über 180 Jahre Tradition und Geschichte zurückblicken, was uns alle sehr stolz macht. Die kommenden Monate werden herausfordernd,
aber auch vielversprechend sein. Dabei spielt die Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zentrale Rolle. Der persönliche Kontakt mit allen Angestellten liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam wollen wir diesen Wandel nutzen, um unsere Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern.» Ganz nach dem Motto: Gemeinsam Zukunft gestalten.

Equans Switzerland Pressestelle Förrlibuckstrasse 150 8005 Zürich Tel: +41 44 387 85 00 www.equans.ch


VERLAG:
Bermuda Agency KLG
Steinenvorstadt 4
CH-4051 Basel
www.bermuda-agency.ch
PROJEKTLEITUNG:
Michele Stasolla
m.stasolla@bermuda-agency.ch
SALES:
Michele Zito
m.zito@bermuda-agency.ch
SATZ & LAYOUT:
Bermuda Agency KLG
Khiem Riemer
k.riemer@bermuda-agency.ch
INTERVIEWS & BEITRÄGE:
Dani Küchler
Simon Frei
David Grütter
Rüdiger Mutschler
Stefan Kretzschmar
Jan Tanner
Dr. Urs Wiederkehr
Pascal Ettenhuber
Beat Bussmann
Georg Lutz
Dr. Uwe Rüdel
BILDER & ILLUSTRATIONEN:
buildup AG
Bermuda Agency KLG
FS Partners AG
BIM Pulse
Shopping Center Forum Switzerland GmbH
Quooker
Ace2Ace
Roche
Praxis Club
Stamm Bau AG
Basel Wirtschaft
Fitpass AG
Gaboo
Evo Green
Smartconext
Opacc Software AG
ideepublik GmbH
Lucid Motors Schweiz
Jura Materials







