Beilage zu Hochparterre
Nr. 6-7 |2006

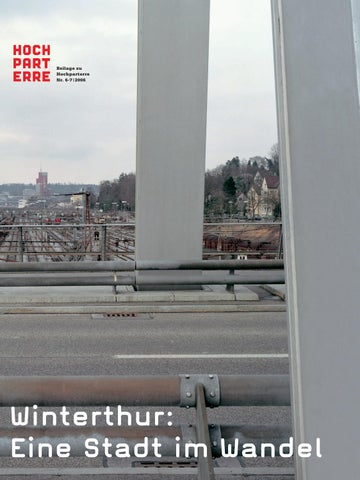
Beilage zu Hochparterre
Nr. 6-7 |2006


Impressum
Konzept und Redaktion: Werner Huber, Hochparterre;
Meta Lehmann, Martin Hofer, Wüest & Partner
Design: Daniel Klauser
Produktion: Sue Lüthi
Korrektur: Lorena Nipkow
Verlag: Susanne von Arx
Designkonzept: Susanne Kreuzer
Litho: Team media GmbH, Gurtnellen
Druck: Südostschweiz Print, Chur
Umschlagfoto und Seite 2: Michael Lio
© Hochparterre, Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich
Herausgegeben vom Verlag Hochparterre in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur und Wüest & P artner, Zürich
Zu beziehen bei: verlag@hochparterre.ch
Preis: CHF 15.– zuzüglich Versandkosten
Besten Dank für die finanzielle Unterstützung:
Inhalt
4 Geschichte: Auf und Ab der Industrie
8 Kultur und Bildung: Bilder, Bildung und Plan B
12 Wohnen: Bausteine der Wohnstadt
18 Bahnhof: Am Bahnhof kommt niemand vorbei
22 Interview: Nach Industrie kommt Kultur
24 Stadtplan: Winterthur in voller Grösse
26 Sulzer Stadtmitte: Mit kleinen Schritten zum grossen Ziel
34 Sulzer Oberwinterthur: ‹Oberi› hat Platz für Neues
40 Weitere Areale: Banane, Bier und Seidenstoff
42 Immobilienmarkt: Wohnstadt im Aufwind
44 Verkehr: Die Weichen stellen
46 Meinungen
Der Stadt beim Wachsen zuschauen
Von der Kantonsschule am Fuss des Goldenbergs schweifte unser Blick über Winterthur. Das Sulzer-Hochhaus ragte an Winterabenden hell erleuchtet über die rauchenden Fabriken und beherrschte allein das Panorama. Damals war die Welt noch in Ordnung: Sulzer und Rieter waren die Aushängeschilder der Industrie, Volkart handelte in der ganzen Welt und mit Stolz lauschten wir den Erläuterungen des Geschichtslehrers, wie die Stadt massgeblich an der demokratischen Umgestaltung des Kantons beteiligt war, dann auch auf Bundesebene eine Rolle spielte und 1848 mit Jonas Furrer den ersten Bundespräsidenten hervorbrachte. Nur auf eines waren wir nicht so stolz: Noch galt die Polizeistunde 23 Uhr, weil die Fabrikherren ihre Arbeiter beizeiten im Bett sehen wollten. «Züri brännt – Winti pennt», hatte 1980 jemand auf eine Backsteinmauer (heute Loft 48) an der Bahn gesprayt. Dieses Gefüge ist bald durcheinander geraten. «Wenn Sulzer hustet, dann schüttelt es Winterthur», hiess es. Sulzer begann heftig zu husten, die Industriestadt keuchte und am Ende blieb wenig davon übrig. Anfang der Neunzigerjahre standen die Zeichen auf Niedergang. Man plante zwar, die Industrie- in eine Dienstleistungsstadt umzuwandeln, doch die Wirtschaft war flau, die Visionen verpufften.
Weitere zehn Jahre später hat sich das Blatt gewendet: Neues Leben kehrt in die alten Industrieareale ein; Improvisiertes und Neues geben sich ein Stelldichein. Die Dynamik hat nicht nur die einstigen Werkgelände erfasst, sondern auch die Ränder der Stadt, wo die Bautafeln zu Dutzenden aus dem Boden schiessen. Nicht alle sind begeistert vom Wachstum – die Infrastruktur möge nicht mithalten, es würden zu viele Leute mit niedrigen Einkommen in die Neubauten am Stadtrand strömen, so lauten die Klagen, die manchmal übertrieben, im Kern aber oft richtig sind.

Dieses Heft liefert eine Momentaufnahme der boomenden Stadt. Thematisch gegliederte Beiträge zeichnen die Industriegeschichte nach, stellen die Kultur- und Bildungsstadt vor, werfen einen Blick auf die Wohn- und Grünstadt und ihre Stellung im Immobilienmarkt und zeigen, wo der Verkehr stockt. Gewichtige Beiträge sind den grossen Arealen gewidmet: dem Bahnhof und seiner Umgebung, dem Sulzer-Areal in der Stadtmitte, dem Sulzer-Areal in Oberwinterthur und weiteren Brennpunkten. Zu guter Letzt haben die kritischen Begleiter das Wort, die mit dafür sorgen, dass die Stadtentwicklung ein öffentliches Thema ist. Allen voran ist hier das Forum Architektur zu erwähnen, dass in diesem Sommer sein zehnjähriges Jubiläum feiert und das Thema Stadtentwicklung im Wahlkampf von 2002, der einen entscheidenden Neuanfang brachte, lancierte. Herzstück des Heftes ist die grosse Karte, auf denen mit farbigen Punkten Neubauten der letzen Jahre und aktuelle Projekte verzeichnet sind. Eindrückliche Fotos des Winterthurer Fotografen Michael Lio begleiten durchs ganze Heft, das nicht nur eine Sofalektüre sondern ein Begleiter durch Winterthur ist. Damit die Leserinnen und Leser der Stadt vor Ort beim Wachsen zuschauen können. Werner Huber
Text: Hans-Peter Bärtschi
Innerhalb von hundert Jahren stieg Winterthur zu einem Industriezentrum mit Weltgeltung auf. Im Kern standen vor allem die drei mächtigen Firmen Rieter, Sulzer und die Loki. Der Niedergang dauerte Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nur wenige Jahre – die darauf folgende Lethargie auch. Schnell rafften sich die Winterthurer zu neuem Aufschwung zusammen.
Muss man zum Verständnis der aktuellen Situation in Winterthur tatsächlich geschichtlich zurückgehen, und zwar bis ins 15. Jahrhundert? Vielleicht schon, denn 1467 gelangte Winterthur durch Verpfändung der Habsburger an den Stadtstaat Zürich. Die Zürcher Aristo kratie gewährleistete Winterthur dieselben untertänigen Freiheiten, die Habsburg garantiert hatte. So konzentrier te sich die Landstadt auf Nischenmärkte, die die Zür cher Zünfte nicht zu ihrem Monopol erklärt hatten: bun te PfauKachelöfen und Liechti-Konsolenuhren zum Beispiel. Man kannte in dieser Stadt das mechanische Handwerk und das Handeln lange vor der industriellen Revolution. Als man schnelles Geld mit Textilien machen konnte, stand Winterthur an vorderster Front. Melchior Steiner und Jakob Sulzer zum Adler zogen die Fäden vieler unermüdlicher Heimarbeiter aus dem Zürcher Oberland zusammen, in Manufakturen, die dort standen, wo sich heute das Stadttheater Winterthur befindet. Der Geschäftssitz dessen ist in der neuen Stadtvilla ‹zum Adler›, wo kürzlich die Stadtpolizei ihren zentralen Posten erneuert hat. Dazu der grösste Park, der Adlergarten. Dieser erfreut heute die Leute im gleichnamigen Altersheim.
Abgrenzung zu Zürich
Die Zürcher Zünfter und Aristokraten suchten vor dem Eindringen in ihre Märkte Schutz bei der Regierung, die ja die ihrige war. Dennoch mochte diese nicht mehr durchgreifen, wenigstens nicht in Winterthur. Mit den Aufständischen am Zürichsee hatte sie schon alle bewaffneten Hände voll zu tun. Als Napoleon dann das ‹Ancien Régime› in Zürich stürzte, setzte ein Kreis weltgewandter Winterthurer sofort auf das Ross der industriellen Revolution. Ihre bestverwaltete Stadt hiess auch Fremde willkommen, wenn sie ein Wissen mitbrachten, das man selbst nicht be sass. Dem süddeutschen Uhrmacher und Bergbauspezialis ten Johann Sebastian Clais boten führende Männer allen Luxus, Einzelne ihre Töchter, wenn er nur da bliebe. Er blieb und baute sich noch unter dem ‹Ancien Régime› die nicht unbescheidene Villa Lindengut oberhalb des Obertors, das heutige Heimatmuseum mit Stube zum Heiraten. So stand im Jahre 1800 ein eingeschworener Kreis von Kaufleuten in den Startpflöcken und gründete die Aktiengesellschaft für die erste wassergetriebene Grossspinnerei der Schweiz. Das grosse Werk nahm 1802 den Betrieb auf. Es steht noch heute wie eine isolierte Klosteranlage am Stadtrand, umgenutzt durch die Gemeinschaft Hard. Alle wesentlichen Pionierbauten sind erhalten: Fabrikkanal, Spinnfabriken, Weberei, Mühle, Werkstätte, Bauernhof, die ehemalige Wirtschaft mit Bäckerei, der Verwaltungsbau mit Schulräumen, wo sich einst der unterrichtende Pfarrer über schlafende Kinder beklagte. Im Schlafsaalgebäude hausten bis zu 200 voll erwerbstätige Kinder. Für alles war gesorgt, ausser für freie Zeit und Meinungsäusserung. Der unregulierte Liberalismus liess die Wochenarbeitszeit auf 84 Stunden ansteigen, am Sonntag blieb der Kirchgang obligatorisch.
Drei Firmen mit Weltgeltung: Rieter … Die erste Familie, die ein Unternehmen von Dauer schuf, hiess Rieter. Der Baumwoll- und Kolonialwarenhändler Johann Jakob Rieter nutzte die englische Handelssperre gegen das französisch besetzte Kontinentaleuropa – eine Verschnaufpause in der Aufholjagd gegen England. Rieter gründete ein halbes Dutzend Spinnereien. Die Eulach ➞


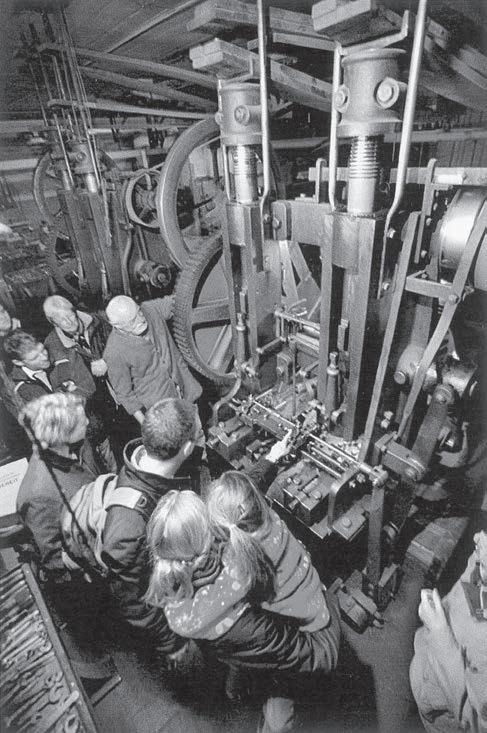
1 Produkte aus Winterthur für den Weltmarkt: Die heute noch der Lokomotivausbesserung dienende Montagehalle der SLM 1935 mit ‹Roten Pfeilen›, ‹Tabakloks› für Bulgarien und ‹Ellok› für Südafrika. Foto: Sammlung Hans-Peter Bärtschi
2 Abbruch 2002 der hölzernen Maschinenfabrikhallen von 1859. Nicht alle wertvollen Bauten werden schonungsvoll behandelt, aber der Charakter des urbanen Maschinenfabrikareals bleibt erhalten.
Foto: Sammlung Hans-Peter Bärtschi 2002
3 Von der industriellen Tradition Winterthurs sind viele Bauten, aber kaum Ausrüstungen erhalten. Eine Ausnahme bilden die 111-jährigen Nagelmaschinen, die für besondere Anlässe in Betrieb gesetzt werden.
Foto: InBahn-Aus-flüge GmbH 2005
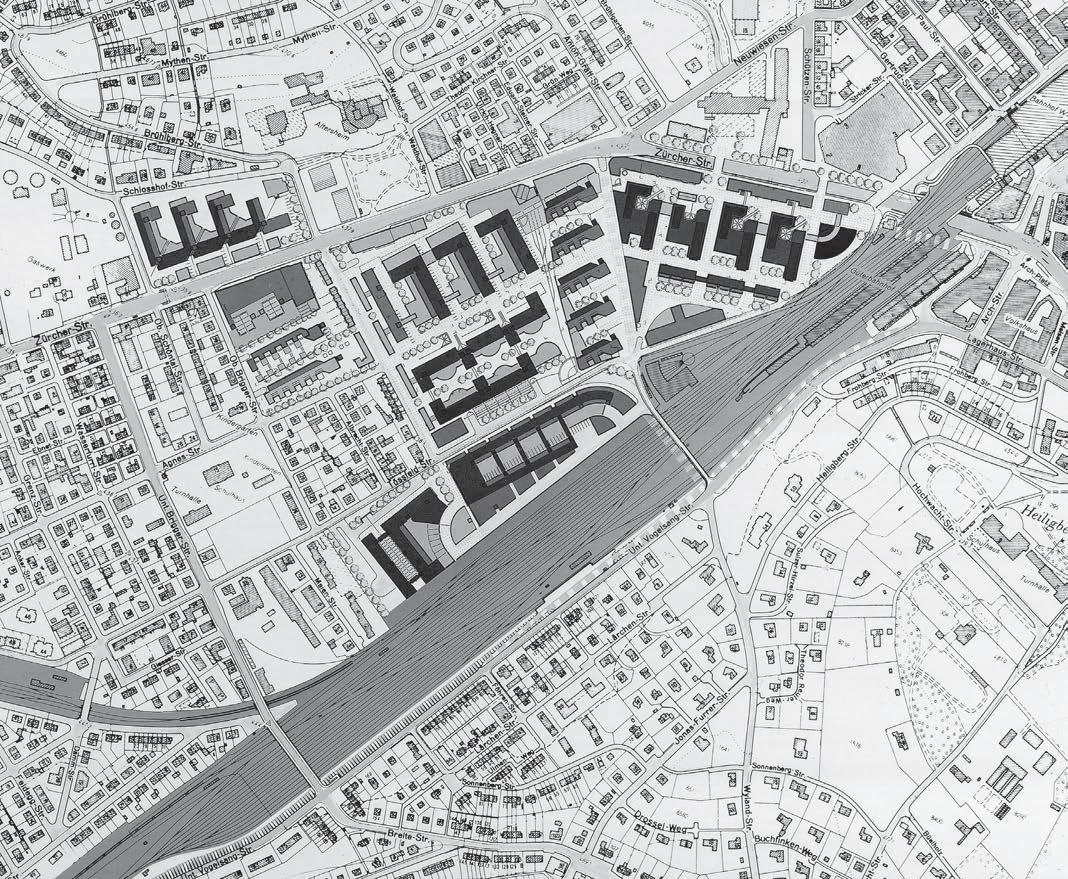
➞ war ihm bald zu unergiebig, so dass er wie die Hard AG am Waldstrom Töss seine zweite, nun mustergültige Spinnerei bauen liess. Sie dient bis heute als Rieter-Forschungslabor. Sein Sohn und sein Enkel Heinrich I. und II. führten das Unternehmen weiter. Den Erben waren die kaufmännisch-technischen und die militärischen Karrieren vorgegeben. In Töss sprach man ehrfurchtsvoll von Herrn Oberst Rieter. Das Unternehmen erwarb das Kloster und richtete dort seine Maschinenfabrik ein. Die Kirche diente als Montagehalle, bis sie zu klein war und abgebrochen wurde. Rieter wirkte als Generalunternehmer für Industriegründungen, goss und montierte alles: Spinnmaschinen, Kraftantriebe, Turbinen, Bahnwagen, Gewehre, später elektrische Ausrüstungen. In der höchsten Blütezeit, 1966, beschäftigte das Unternehmen in Winterthur allein 2700 Arbeiter für die Spinnmaschinenherstellung und bewirtschaftete 1000 werkeigene Wohnungen. Wegen langfristiger Führungspolitik arbeiten zur Zeit von über 11 000 Konzernangestellten noch 1000 in Winterthur.
… Sulzer …
Das zweite weltweit tätige Winterthurer Maschinenfabrikantengeschlecht hiess Sulzer, wobei Sulzer nicht gleich Sulzer ist. Der Gründervater der späteren Maschinenfabrik kam nicht aus der Aristokratie. Er war Metallgiesser und Stündeler, heiratete die Magd Katharina, die beim Industriellen Clais in der Villa Lindengut diente. Danach verköstigte sie ihre Kinder und Gesellen. Der Mutter Katharina Sulzer ist inzwischen der Name des grössten Platzes im Stadtareal von Sulzer gewidmet. Ihre beiden Söhne nannte man im Volksmund Gebrüder. Man ‹krüppelte› demzufolge für die Gebrüder, und später, als so viele Giesser und Metallarbeiter aus Italien kamen, hatte man Arbeit bei den
‹fratelli›. Fünf Generationen Sulzer bauten ein Unternehmen von Weltgeltung auf. Kaum ein Nachfolger wurde nicht zum ETH-Ingenieur ausgebildet. Beim Kaufmännischen haperte es manchmal. Aber man zog den Karren des Familienunternehmens auch durch die schlimmsten Krisen, verhandelte nach Lohnabbau und Entlassungen mit den Arbeitern, verhinderte so den grossen Streik 1937. Das bereitete den Weg für die Gesamtarbeitsverträge als Grundlage des Friedensabkommens zwischen Arbeitern und Unternehmern. Soziale Wohlfahrt war eine Selbstverständlichkeit. Sulzer war Hauptinitiant der Gesellschaft zur Erstellung billiger Wohnhäuser, baute Kantinen, Lehrlingsund Bildungsstätten. Mit den Produkten war Sulzer auf der Höhe der Zeit: zuerst Guss- und Dampfmaschinen, dann, nach Rudolf Diesels Praktikum bei Sulzer, Dieselmotoren, Webmaschinen und schliesslich Hüftgelenke aus Metall.
… und Loki
Der Dritte im Bunde der Grossen hiess Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM, ihr Gründer Charles Brown. Die ‹Fratelli› hatten ihn nach Winterthur geholt. Sie erwarben mit ihm das Wissen einer der weltweit führenden Maschinenfabriken, Maudsley London. Nachdem sich Charles Brown mit den Sulzers überworfen hatte, mach te er im Nachbarareal das, was er zuvor für Sulzer ent worfen hatte: Dampfmaschinen, speziell Lokomotiven. Das trug einem seiner Geldgeber bei einer Sulzer-Aktionärsversammlung eine Ohrfeige ein. Charles Brown wirkte später für die Maschinenfabrik Oerlikon, bei der auch sein Sohn Charles Brown II arbeitete. Dieser gründete den Schweizer Maschinenbaukonzern Brown Boveri Company. 1966 gliederte Sulzer die SLM in den Konzern ein, der dazumal in Winterthur 15 000 Leute beschäftigte.
Winterthur wuchs zur führenden Schwerindustriestadt der Schweiz. Dem kometenhaften wirtschaftlichen Aufstieg entsprach keine angemessene politische Macht. Im Norden von Zürich gelegen, sah Winterthur den Kreditanstalt-Bankier, Eisenbahnkönig, freisinnigen Juristen und Politiker Alfred Escher vor der Sonne stehen. Die eigene demokratische Bewegung sollte den ‹Prinzeps und seinen Hof› stürzen. Winterthurs Demokraten waren sehr erfolgreich – heftig und kurz. Sie reformierten die Verfassung auf Kantons- und Bundesebene und schufen 1872 ein neues Eisenbahngesetz. Dieses beseitigte die Vorrechte der bestehenden Privatbahnkonzerne und ermöglichte den Bau neuer, mit Steuergeldern finanzierten Bahnlinien. Winterthur sah sich als Verkehrszentrum zwischen Paris, London, Berlin und Konstantinopel. Oder zumindest als Knotenpunkt eigener Linien zwischen Rhein und Walensee, Boden- und Genfersee. Winterthur habe Zürich ausschalten, umfahren wollen, steht immer noch in den Schulbüchern. Doch so blöd waren selbst die Winterthurer Demokraten auf dem Höhepunkt ihrer Macht nicht; fertig ausgearbeitete Pläne für Bahnhöfe am Schanzengraben und im Seefeld widerlegen die Umfahrungs-These. Zürich vereitelte die Ausführung dieser Pläne juristisch und ökonomisch und trieb Winterthur in den Bankrott. Das überrissene, hektisch mehrmals umgeplante Nationalbahnunternehmen scheiterte, verursachte über Jahrzehnte Steuerschulden und die Abwahl der demokratischen Führer im Kanton und in der Stadt. Das Ziel, Zürich links zu überholen, zerrann als Utopie, und man begnügte sich fortan damit, sich über Zürichs Dominanz zu beklagen.
Niedergang …
Bis in die 1970er Jahre glaubten alle an den unendlichen Fortschritt. Die ‹Büezer› tauschten, mehrheitlich freisinnig wählend, ihr Velo gegen ein Auto. Steuergelder waren reichlich vorhanden, sie reichten sogar für den Bau des Stadttheaters. Etwas ungläubig nahm die Bevölkerung Anfangs der 1980er zur Kenntnis, dass Sulzer Kurzarbeit einführte. Dann kam es zu Entlassungen. Dann zu Massenentlassungen. Sulzer verkauft Diesel! Sulzer verkauft Webmaschinenbau! Sulzer überlässt die Lokomotivfabrik einem ‹Management Buy Out›. Sulzer verkauft das Filetstück Medizinaltechnik! Bei vielen dieser Medienmitteilungen waren die vorbereitenden Chef-Exekutier-Offiziere abwesend oder schon mit Millionenbeträgen abgefunden. Nach
1 Sulzer- und SLM-Areale Winterthur, Stilllegungs- und Überbauungsprojekt 1989/90 der Konzernleitung Sulzer, vorgestellt 1990 als Projekt ‹Winti Nova› von Burckhardt Partner. Plan: © Vermessungsamt Winterthur/Burckhardt + Partner
2 Aussenraumplan für die Erhaltung wertvoller Strassen-, Gassen- und Platzräume in den Arealen Sulzer und SLM, vorgestellt 1990 von Hans-Peter Bärtschi im Auftrag der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich. Plan: © Arias-Industriekultur
einem Vierteljahrhundert Horizontalisierung, Vertikalisierung, Konzentration durch Verkauf und Einkauf von rasch wechselnden Kernkompetenzen bleiben unter dem Firmennamen Sulzer in Winterthur 4 Prozent der ehemaligen Beschäftigten, 600. Führende Geschäftsleute und Politiker fanden das gut. Der Werkplatz Schweiz habe keine Zukunft, Dienstleistungen seien die Zukunft. Sie dachten dabei wohl an die Winterthur-Versicherungen, die im Rahmen der Allfinanz-Pläne unter Martin Ebner an die Kreditanstalt in Zürich ging und ebenfalls Arbeitsplätze abbaute. Auch beim Niedergang von Sulzer gab es einen Verdacht über die Ursache. Der als Finanzgenie gefeierte dreifache Milliardär Werner K. Rey hatte Sulzers grösstes Aktienpaket erworben. Mit der guten Absicht, «Sulzers industrielle Zukunft zu sichern», wie sie im traditionell freisinnigen Landboten beschrieben war. 1989 präsentierte Sulzer auf den 22 Hektaren zentralen städtischen Industriearealen eine Neuüberbauung, hauptsächlich mit Büroblöcken.
Das provozierte eine anfänglich belächelte Opposition. Die Architekten Arnold Amsler, Peter Stutz und Jochen Mantel schlossen sich mit Alt-Stadtpräsident Urs Widmer und dem Schreibenden zusammen, um diese Tabula rasa zu ver hindern. Monatliche Veranstaltungen thematisierten vor jeweils 400 Leuten den Umgang mit zentralen städtischen Arealen. Die Zukunft der Sulzer-Areale wurde zum Politikum. Nicht deswegen, sondern wegen der hereinbrechenden Liegenschaftenkrise fanden die Totalabbrüche nicht statt. Rey verlor seine Milliarden, entzog sich der Verhaftung durch Flucht auf die Bahamas, verweilte danach als gescheitertes Finanzgenie im Gefängnis. Auch für andere hatte die Geschichte Folgen, für den Schrei benden zum Beispiel, der in seiner Stadt keine Aufträge mehr erhielt. Sulzer setzte auf eine neue Strategie: Überzeugen durch Qualität. Jean Nouvel gewann mit einer etappierten, kreativen Arealentwicklung den eingeladenen Wettbewerb. Aus dem Milliardenprojekt war ein Bauvorhaben für 300 Millionen Franken geworden. Zu viel immer noch! Als die verlängerte Baubewilligung verfiel, entschied Sulzer sich zum partiellen Grundstückverkauf. 2002 wurde das alte politische Regiment in Winterthur abgewählt. In der Stadt arbeitet nur noch jeder Vierte für die Produktion. Doch erstmals seit dem Abschied vom Proletariat besteht wieder eine linksliberale Mehrheit, die 2006 gar links-grün geworden ist. Und diese Exekutive hat festgesetzt, was während der 12 Jahre zuvor nicht hatte festgesetzt werden dürfen: einen Erhaltungs-Gestaltungsplan für das Sulzer-Areal. Er ermöglicht Neubauten, Denkmalpflege und die Rücksicht auf 170 Jahre lang gewachsene Aussen- und Zwischenräume. Gassen, Plätze, 800 Meter Sichtbacksteinfassade entlang der Zürcherstrasse, 800 Meter pionierhaft neues Bauen entlang der Bahn. •

Text: René Ammann und Werner Huber
Fotos: Michael Lio

« Pro Einwohner ein Renoir», pflegte man schon vor über einem halben Jahrhundert halb scherzhaft, halb neidisch über die Kunst fülle in Winterthur zu sagen. Noch immer hängen in den Museen der Stadt die Klassiker à la Renoir, doch auch Zeitgenössisches ist dazugekommen. Und die florierende Fachhochschule ZHW bringt junge Leute in die Stadt, die das einst gemächliche Tempo beschleunige n.
Winterthur, die Arbeiterstadt? Von wegen. «Keine europäische Stadt hat auf so kleinem Raum so viel hochkarätige Kunst wie Winterthur», weiss der ‹Tages-Anzeiger›. Eine junge Kulturszene, die ortsübliche Lust am Feiern und 17 Museen sollen es sein, deretwegen es sich lohne, nicht in Zürich auszusteigen, sondern in Winterthur. Das rät der Kulturbeauftragte der Stadt Winterthur auch kraft seines Amtes. Also nichts wie hin; mit der S12 vom Zürcher Bellevue in 18 Minuten nach Winterthur. Den Glaskasten des Bahnhofs hinter sich lassend, wird der Besucher vom Sog der Masse in die Altstadt gezogen. Seit Jahrhunderten ist das so, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Vor 450 Jahren war die Hauptattraktion das Waaghaus, wo Handelsleute und Marktfahrer ihre Güter wogen. Das Waaghaus beherbergte im Laufe der Jahrhunderte das erste Tanz- und Theaterhaus der Stadt. Wer die Marktgasse hinabspaziert, kommt am Graben zur zweiten grossen Attraktion des Mittelalters: zum ‹Gemeinen Frauenhaus›, dem Bordell. Es wurde praktischerweise von den Winterthurer Stadtvätern selber geführt, die über Einnahmen und Gesundheit der Dirnen wachten. Der Bordellwirt hatte dafür zu sorgen, dass keine Frau an ‹Blateren› (Syphilis) litt, berufstätig oder gar ‹geschwächt›, also schwanger war. Verliess eine Frau das Bordell, musste sie eine rote Mütze aufsetzen, damit offensichtlich war: Sie gehörte nicht zu den ‹ehrbaren Damen›.
Die Kunst der Sammler
Wir verlassen diese längst vergangenen Zeiten und spazieren vom Graben an die Stadthausstrasse, wo ein wuchtiger Bau ins Auge sticht: das Stadthaus. Erbaut in den Jahren 1865 bis 1869 von Gottfried Semper, der auch das ETH-Hauptgebäude in Zürich sowie die nach ihm benan nte Oper in Dresden zeichnete. Semper überzog das Baubudget um einen Viertel und setzte seinem Gebäude zwei Statuen von Göttinnen auf: eine für Vitodura, Winterthurs Schutzherrin und Göttin der Gerechtigkeit, und eine für Pallas Athene, die Göttin der Weisheit. Doch beide mussten 1915 entfernt werden, weil ihr Sandstein bröckelte und die Gefahr bestand, dass sie hinabpurzeln. Seit 2005 thront immerhin wieder eine Figur auf dem Stadthaus: die Vitodura, 2,65 Meter gross und gespendet von einem privaten Förderverein, der zu diesem Zweck Schokolade in Form der Göttin giessen liess und verkaufte.
Die private Förderung hat in Winterthur Tradition. In jüngerer Zeit entstand so an der Grüzestrasse aus dem 1993 in Winterthur gegründeten Fotomuseum und der bis anhin im Kunsthaus Zürich logierenden Fotostiftung vor drei ➞
Kultur mit Tradition: Museums- und Bibliotheksgebäude von Rittmeyer & Furrer (1916) mit Anbau von Gigon Guyer (1995).
Auf dem ehemaligen Friedhof Rychenberg steht heute die gleichnamige Kantonsschule, die sich zurzeit im Umbau befindet.
➞ Jahren das Zentrum für Fotografie. Ohne die Unterstützung des Winterthurer Unternehmers Andreas Reinhart –ein Spross des Handelshauses Volkart – wäre eine der wichtigsten Adressen für Fotografie weltweit nicht zustande gekommen. In älterer Zeit entstanden die Sammlung Hahnloser in der Villa Flora, deren unschätzbare Van Goghs und Rodins, Hodlers und Vallottons seit 1995 der Öffentlichkeit zugänglich sind, oder die Sammlung von Oskar Reinhart, die gleich zwei Museen belegt: das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten – im einstigen Gebäude der Kantonsschule – mit der Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts und die Sammlung Oskar Reinhart ‹Am Römerholz› mit europäischer Kunst des 14. bis zum frühen 20. Jahrhundert, deren Werke von Peter Paul Rubens bis Renoir jeden Kurator neidisch werden lassen. 1998 erhielt die Sammlung Reinhart ‹Am Römerholz› einen Zusatzbau von Annette Gigon und Mike Guyer. Die gleichen Architekten ergänzten bereits früher das Kunstmuseum mit einem ‹provisorischen› Anbau. Im gleichen Gebäude, in dem bis vor ihrem Umzug in die Altstadt auch die Stadtbibliothek zu Hause war, wurde zudem vor kurzem das neu gestaltete Naturmuseum von Peter Spoerli wieder eröffnet.
Karriere des Technikums
Wer Kultur sagt, sagt auch Bildung. Universitätsstandort war Winterthur nie, dafür entstand hier mit dem 1872 gegründeten Technikum die für eine Industriestadt nahe liegende höhere technische Schule. Was damals mit 72 Schülern begann, ist heute, als Zürcher Hochschule Winterthur, eine Fachhochschule mit 3000 Studierenden. Neben den aus dem Technikum hervorgegangenen Abteilungen gehören auch die Departemente der früheren Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule, der Dolmetscherschule Zürich und der neue Fachbereich Gesundheit dazu. Entsprechend den Studentenzahlen sind auch die Standorte über das Stammareal an der Technikumstrasse hinaus gewachsen. Bereits 1991 zog die Architekturschule in ein Provisorium auf dem Sulzer-Areal, die damalige HWV übernahm den Volkart-Rundbau am St. Georgen-Platz, und im vergangenen Jahr bezog die Dolmetscherschule den Mäander auf dem Volg-Areal (Seite 41) . Zudem erwägt die Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW), auf dem Lagerplatzareal im Sulzer-Areal Neubauten für das Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen sowie die Verwaltung zu errichten – was allerdings das Provisorium

Halle 180 und die übrigen Zwischennutzungen gefährden könnte. Der Ausbildung werden auch zwei weitere Grundstücke im Stadtzentrum gewidmet, die seit Jahren schon zur Neubebauung zur Verfügung stehen, auf denen bislang aber sämtliche Anläufe gescheitert waren: das Hölken-Areal der einstigen chemischen Reinigung und das angrenzende Areal der Eulach-Garage. Auf dem HölkenAreal erstellt Colliers CSL das Eulachhaus, auf dem Areal der Eulachgarage kommt die Eulachpassage der Siska zu stehen – Eulach allenthalben also, was an diesem Ort auch passt, fliesst das Flüsschen doch, bislang weitgehend unter Tag, durch das Grundstück hindurch. Die beiden Bauplätze liegen an der Technikumstrasse, auf halbem Weg vom Bahnhof zu den Gebäuden des einstigen Technikums, der Keimzelle der ZHW, an idealer Lage also, um die wachsende Schule zu erweitern.

Ebenfalls unter den Fittichen des Kantons stehen die drei Kantonsschulen, die aus der städtischen Industrieschule und dem Gymnasium hervorgegangen sind. Die Gebäude der Kantonsschulen ‹Im Lee› und ‹Rychenberg› am Fuss des Goldenbergs zeigen einen Querschnitt durch achtzig Jahre Schulhausbau mit dem kasernenartigen Bau der Gebrüder Pfister (1928), den an den Freudenberg in Zürich erinnernden Neubauten von Eric Lanter (1963), der Erweiterung von Stutz & Bolt (1990) und mit dem Erweiterungsbau des Berliner Architekten Jost Haberland, der 2007 fertig gestellt wird. Die dritte Kantonsschule, ‹Büelrain›, hinter dem Technikum hiess einst Handelsgymnasium und besitzt neben zahlreichen Provisorien Bauten des Gestalterpaars Arnold und Vrendli Amsler.
Nachtleben statt Fabriksirenen
Insbesondere die ZHW, die dank dem Zusammenzug mit anderen Schulen ihre Studierendenzahlen innert weniger Jahre verdoppelt hat, ist auch dafür verantwortlich, dass immer mehr junge Leute nach Winterthur ziehen. Wenn viele auch nur tagsüber in der Stadt sind, und jene, die hier wohnen nach Studienabschluss wieder weiterziehen, so ist doch unübersehbar, dass die Stadt lebendiger, jünger geworden ist. Ein Zeichen dafür sind die zahlreichen Projekte für studentisches Wohnen, die bereits realisiert oder erst geplant sind; früher gab es dafür gerade mal das ‹Türmlihus› gegenüber dem Technikum.
Zu einem neuen Brennpunkt städtischen Lebens hat sich das Sulzer-Areal jenseits der Gleise entwickelt. Die – noch wenig einladende – Unterführung (Seite 21, ‹ Gleisquerung › ) bringt die Besucher in die städtebauliche Neuzeit. Die Fabriksirenen heulen längst nicht mehr. Das Sulzer-Areal ist ein Sammelsurium aus kühlen Schul- und Wohntürmen, gähnenden Baulöchern, riesigen alten, leer stehenden Industriehallen, extensiv genutzten Lagerhallen und dem Geruch von Maschinenöl und verbranntem Metall. Einzelne Läden, kleine Firmen, Künstler und ein Brockenhaus haben sich eingenistet, ausserdem gestylte Kneipen wie das ‹Plan B› im Pionierpark. In einem Raum, dessen Ästhetik zwischen asiatischer Wärme und der Geselligkeit von Neu-Oerlikon pendelt, treffen sich laut Eingeweihten «die wohl schönsten Gäste der Stadt». Sie sitzen in Plan-B-Tangas (zu 16 Franken das Stück) oder Plan-BBoxershorts (28 Franken) auf den Stühlchen und trinken Prosecco. Wer schön mitfeiern will, sollte vorab die richtige Nacht oder die richtige Nachtbegleitung wählen, denn unter der Woche fährt die letzte S12 ab Winterthur bereits um 23:52 Uhr nach Zürich.•

Das Casino-Theater hat sich innert kurzer Zeit zum Magnet entwickelt, der weit über Winterthur hinaus strahlt. Der 1862 als Gesellschaftshaus eröffnete
Bau diente bis 1979 als Stadttheater und wurde nun von einer Gruppe um Viktor Giacobbo zum Comedy-Theater umgebaut. Der Spagat zwischen alter Substanz und neuem Inhalt ist geglückt.
--› Adresse: Stadthausstrasse 119
--› Fertigstellung: 2002
--› Bauherrschaft: Casino Immobilien, Winterthur
--› Architektur: Ernst Zollinger, W’thur
--› Innenarchitektur: Grego & Smolenicky, Zürich
--› Kosten: CHF 13,5 Mio.
Erweiterung Kantonsschulen 97
Die Bauten der Kantonsschulen ‹Im Lee› und ‹Rychenberg› erhalten als vierte
Etappe einen Neubau mit Dreifachturnhalle, Musikräumen, Mediothek, Klassenzimmer und Werkräumen. Der von einem Turm beherrschte Bau wird am Rand der Spielwiese stehen. Die Bauten von 1928, 1963 und 1990 erhalten einen zeitgenössischen Partner.
--› Adresse: Rychenbergstrasse
--› Fertigstellung: 1. Quartal 2007
--› Bauherrschaft: Bildungsdirektion des Kantons Zürich, vertreten durch Baudirektion des Kantons Zürich
--› Architektur: Haberland Architekten, Jost Haberland, Berlin

Eulachpassage 98
--› Kosten: CHF 27,5 Mio.

Eulachhaus 99
Auf dem von der Eulach durchflossenen
Areal der früheren Eulachgarage entsteht eine vielfältig nutzbare Geschäftsüberbauung aus zwei Bauvolumen.
Als Mieter ist das Departement Gesundheit der ZHW vorgesehen.
--› Adresse: Technikum- / Lagerhausstr.
--› Stand: Projekt- / Bewilligungsphase
--› Realisierung: 2006–2008
--› Bauherrschaft: Siska Heuberger Holding AG, Winterthur
--› Architektur: Zambrini Architekten, Effretikon, Nello Zambrini
--› Fassade: Knapkiewicz + Braunschweiler, Winterthur
--› Bauvolumen: 72 000 m³
--› Kosten: CHF 31 Mio.
Auf dem einstigen Hölken-Areal entsteht das fünfgeschossige Geschäftshaus. Über der Arkade erheben sich drei mit Klinker verkleidete Stockwerke, darauf sitzt ein verglastes Attikageschoss. Als Mieter ist das Departement Gesundheit der ZHW vorgesehen.
--› Adresse: Technikumstrasse 61
--› Stand: Baubewilligung seit 2005
--› Bauherrschaft: Lerch Immobilien AG, Winterthur
--› Projektmanagement: Colliers CSL AG, Winterthur
--› Architektur: Weiss & Schmid, W’thur
--› GU/TU: Lerch & Partner AG, W'thur
--› Nutzfläche: 2500 m²
--› Kosten: CHF 9 Mio.


Winterthur ist anders: Statt in Mietskasernen und Einfamilienhäusern wohnen die Menschen hier im kleinen Mehrfamilienhaus; Bäume und eine starke Durchgrünung prägen das Stadtbild. Die Gartenstadt zwischen den grünen Hügeln wächst heute hauptsächlich an ihren Rändern.
Schon ein Blick auf eine Luftaufnahme von Winterthur deutet es an: Grün ist hier reichlich vertreten. Eine besondere topografische Konstellation prägt die Stadt. Auf fast allen Seiten umgeben von bewaldeten Hügeln, bildet Winterthur beinahe eine städtische Lichtung in einem grossen Forst. Das Wachstum der Stadt erfolgte naturgemäss im günstigen, also flachen Terrain. So sieht denn Winterthur aus der Luft betrachtet seltsam verzettelt aus; ein Gebilde, das sich mit langen Fangarmen in die verschiedenen Himmelsrichtungen ausdehnt. Noch etwas fällt auf beim Studium aus der Vogelschau. Mit Ausnahme der Altstadt und der Industriereviere besteht das Stadtsubstrat Winterthurs hauptsächlich aus lockerer Bebauung. Grosse Verdichtungen sind keine auszumachen, dafür schimmert zwischen den Häusern und Strassen immer wieder ein grüner Fleck oder Strang hervor. Zurück auf dem Boden bestätigt sich der zuvor aus der Luft gewonnene Eindruck. Die intensive Durchgrünung der Stadt mit Parks, Gärten und Alleen ist überall spürbar, und wo immer man durch die Strassen spaziert, sind die waldreichen Hügelzüge zum Greifen nah. Eschenberg, Brüelberg, Wolfensberg und Lindenberg bilden die Kulisse, den Hintergrund für eine Stadt, die schon früh ei-
nen eigenen Weg wählte. Die entscheidenden Weichenstellungen fanden vor über 150 Jahren statt, zur Zeit der Industria lisierung. Sowohl Zürich wie auch Winterthur erlebten damals starke Wachstumsschübe. Zürich entschied sich, das Bevölkerungswachstum in hoch verdichteten Mietshausquartieren auf dem weiten Sihlfeld aufzufangen – in den heutigen Stadtkreisen 3, 4 und 5. Die Zürcher Blockrandstadt wurde indessen in Winterthur strikt abgelehnt. Alexander Isler (1854 – 1932), städtischer Bauamtmann von 1897 bis 1919, verteufelte gar die «schreckliche, gefängnisartige» Mietskaserne und bezeichnete sie als Grundübel. In Winterthur wurde deshalb ein anderes Modell erfolgreich ausprobiert und in der Städtebaupraxis angewandt. Es handelt sich hierbei um eine Schweizer Variante der Gartenstadt idee, die sich im späten 19. Jahrhundert von England aus in ganz Europa ausbreitete. Im Grundsatz ist die Gartenstadt ein antiurbanes Konzept, da sie von einer geringen Wohndichte ausgeht. In Winterthur gelang es jedoch, die scheinbaren Gegenpole Industrie- und Gartenstadt zu einer eigenständigen Synthese zu führen. Der dafür verwendete Stadtbaustein ist das freistehende Zwei- und Dreifamilienhaus mit Satteldach. In der Regel bilden mehrere Bausteine zusammen eine Gruppe, die sich dann in mehreren parallelen Reihen zu ganzen Siedlungen versammeln. Die Bebauungsdich-



In einer ersten Etappe wurde die Wohnkolonie ‹Zelgli› saniert, in einer zweiten Etappe um zwei Neubauten erweitert. Ein drei Meter tiefer Anbau rüstet die Häuschen von 1944 für die heutigen Bedürfnisse nach. Die beiden Neubauten mit 16 Wohnungen bauen die Siedlung zu Ende und nehmen die Fassade der Anbauten auf. Bild: Thomas Flechtner
--› Adresse: Langgasse
--› Fertigstellung Sanierung: 1998
--› Fertigstellung Neubauten: 1999
--› Bauherrschaft: Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur
--› Architektur: Beat Rothen, Winterthur
--› Kosten 1. + 2. Etappe: CHF 16,5 Mio.
--› Kosten Neubauten: CHF 4,3 Mio.

Überbauung Binzhof VI 56
Zentral, und doch fast auf dem Land liegt die Wohnüberbauung. Das Sulzer-Hochhaus ist nur einen Steinwurf entfernt, ebenso der Brüelberg-Wald und die Schützenwiese. Stufenweise reduziert sich die Höhe der vier Baukör per von fünf auf drei Geschosse und vermittelt so zwischen der dichten Geschäftsbebauung und dem Quartier. Foto: Gaston Wicky
--› Adresse: Brühlgartenstrasse
--› Realisierung: 2001–2003
--› Bauherrschaft: Anlagestiftung Pensimo, Zürich / Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur
--› Architektur: Beat Rothen, Winterthur
--› Anzahl Wohnungen: 66
--› Bauvolumen: 48 464 m³

Überbauung Q-Bus 50

Überbauung Wässerwiesen 51
Der ‹Q-Bus› ist ein Experiment im als Pro blemquartier bekannten Töss.
Fassade und Statik wurden von den Architekten geliefert, die Grundrisse legten die Käufer fest. Zwei unterschiedliche Fassaden prägen den Bau: zur Töss hin verglast, auf der Rückseite Lochfenster mit orangen Holzläden.
--› Adresse: Neumühlestrasse 48–54
--› Realisierung: 2001
--› Bauherrschaft: Ges. für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur
--› Eigentümer: private Eigentümer
--› Architektur: Kreis Schaad Schaad Architekten, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 42
--› Bauvolumen: 24 762 m³

Überbauung Eichgut 57
Die Sulzer-Pensionskasse verfügt am Stadtrand im Oberwinterthur über grosse Landreserven. Ein Studienauftrag führte 1999 zu einem städtebaulichen Konzept mit 800 Wohnungen. In der ersten Etappe wurden nun 98 grosse Familienwohnungen realisiert. Die mäanderartige Überbauung thematisiert den Übergang in die freie Landschaft.
--› Adresse: Ruchwiesenstrasse
--› Realisierung: 2004
--› Bauherrschaft: Sulzer-Vorsorgeeinrichtung, Winterthur
--› Architektur: Isler Architekten, W'thur
--› Anzahl Wohnungen: 98
--› Bauvolumen: 59 985 m³
--› Baukosten: CHF 30 Mio.
Die Überbauung konzentriert sich in einem abgewinkelten, gestaffelten Volumen. Die Hülle besteht aus weiss schimmerndem, emailliertem Glas. Das Gebäude ist nach dem MinergieStandard gebaut. Foto: E. Hueber
--› Adresse: Eichgut- / Rudolfstrasse
--› Realisierung: 2004–2005
--› Bauherrschaft: 1a Immo PK (Immobilienfonds der Crédit Suisse Asset Management Funds), Zürich
--› Architektur: Baumschlager Eberle, Vaduz
--› Generalunternehmung: Senn BPM AG, St. Gallen
--› Anzahl Wohnungen: 90
--› Bauvolumen: 63 000 m³
Eine Siedlung in typischer BachmannMa nier: Punkthäuser gruppieren sich um einen grossen Hof. Einzig der Riegel im Osten fällt aus dem Schema. Er schützt die Überbauung vor dem Lärm der Autobahn. Die Häuser sind preiswert aus Element gebaut. Dies ermöglichte ausserdem eine atemberaubende Bauzeit von unter einem Jahr für fast 400 Wohnungen.
--› Adresse: Wässerwiesenstrasse 67 a-r
--› Realisierung: Januar–Oktober 2003
--› Bauherrschaft: Leopold Bachmann, Rüschlikon
--› Architektur: Cerv + Wachtl, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 390 + Kindergarten
--› Bauvolumen: 157 980 m³

Sanierung MFH Schaffhauserstrasse 60
Sanierung und Erweiterung von drei Mehrfamilienhäusern von 1939 und 1943: Zwischenbauten in den Lücken und Anbauten an der Gartenfassade, die die Höhendifferenz zwischen Garten und Hochparterre geschickt ausnutzen; sorgfältige Sanierung der Altbauten.
--› Adresse: Schaffhauserstrasse 155–165
--› Fertigstellung: 2005
--› Bauherrschaft: Gesellsch. für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur
--› Architektur: Denkwerk Architekten, Winterthur, Joachim Mantel, Veronika Martin Mantel, Winterthur
--› BGF: alt 2332 m², neu 4635 m²
--› Gesamtkosten: CHF 11,5 Mio.

Patiohäuser Stadtterrasse 61
Die Verdichtung im Villenquartier ermöglicht sieben Familien ein zeitgemässes Wohnen an stadtnaher Hanglage. Atriumhäuser mit grosszügigen Wohnflächen und privaten, von Mauern gefassten Gärten bieten ein hohes Mass an Wohnqualität und Privatsphäre.
--› Adresse: Sulzer-Hirzel-Strasse
--› Realisierung: 2004–2005
--› Bauherrschaft: Eigentümergemeinschaft Stadtterrasse
--› Architektur: Peter Kunz, Winterthur
--› Realisation: Martin Markwalder Baumanagement, Brüttisellen
--› Verkauf: Walter Wittwer, Winterthur
--› Anzahl Wohnungen: 7 Patiohäuser
--› Gesamtkosten: CHF 11,2 Mio.
Die Wohnhäuser an der Freiestrasse zeugen von der für Winterthur typischen Siedlungstradition mit gemauerten Reihenhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern.

Dichte: in der Regel gering Auf einem Rundgang durch die Stadt trifft man oft auf das typische Winterthurer Mehrfamilienhaus. Besonders in den älteren Aussenquartieren wie Töss, Mattenbach und dem Gebiet zwischen Neuwiesen und Wülflingen. Kombiniert mit einem systematisch angelegten Strassenraster wie zum Beispiel im Neuwiesen entlang der Wülflingerstrasse, entsteht ein durchaus urbaner Charakter trotz der im Vergleich zu einem zentrumsnahen Quartier in Zürich geringen Dichte. Ein respektabler Teil der Winterthurer Arbeiterhäuser wurde von der ‹Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur› gebaut, einer der wichtigsten Wohnbaugenossenschaften in der Stadt. Die ‹Billige Gesellschaft›, wie sie vom Volksmund liebevoll genannt wird, ist eine Winterthurer Spezialität, ein Beispiel für die enge Verzahnung von Industrie und Städtebau. Alle grossen Arbeitgeber der Stadt wie Sulzer, Rieter, Winterthurer Versicherungen und UBS (die ehemalige Schweizerische Bankgesellschaft – einst eine Winterthurer Bank) sind an der Gesellschaft beteiligt, die Stadt jedoch nicht. In ihrer inzwischen über 130-jährigen Geschichte baute die Gesellschaft Hunderte von Wohnungen, prägte mit der Verwendung des bekannten Stadtbausteins ganz entscheidend das Stadtbild und baut noch heute. Deutlich luftiger und um einige Steuerklassen wohlhabender als in Töss und Neuwiesen präsentiert sich das ‹Innere Lind›. Der Grünanteil ist noch höher als in der übrigen Stadt ohnehin schon, die Häuser stehen praktisch in einer offenen Parklandschaft. Umso grösser ist der Kontrast zur Altstadt, was die erklärte Absicht der ersten Stadtplaner im frühen 19. Jahrhundert war. Die biedermeierli-
chen Vorstädte und klassizistischen Vorstadthäuser entsprachen einer völlig anderen Vorstellung von Stadt. Die offene, durchgrünte, saubere und geordnete Stadt galt als Ideal, die chaotische Dichte in der Altstadt war ein Auslaufmodell. Heute ist zwar die Winterthurer Altstadt wie praktisch alle europäischen Altstädte zu einer Flanierzone mit Shoppinggelegenheiten umgebaut worden, doch noch immer wohnen hier viele Menschen. Neben den geputzten Einkaufsgassen gibt es auch Bereiche, die offensichtlich noch wenige Investoren interessiert haben.
Doch gerade diese leise Vernachlässigung erlaubt es jungen, weniger finanzkräftigen Mietern, in der Altstadt wohnen zu können. Die Umnutzungsgebiete der Innenstadt –Sulzer-Areal, Sidi-Areal, Haldengut, Stadtmitte Süd – sind für diese Leute attraktiv. Neben diesen Arealen geschieht auch einiges durch Nachverdichtungen. Die Wohnhäuser auf dem Ninck-Areal direkt neben dem Sulzer-Hochhaus sind ein Beispiel für diese Strategie. Die Stadt expandiert indessen nicht nur in den Kernbereichen, sondern auch an den Stadträndern in Wülflingen und Hegi.
Am westlichen und östlichen Ende der Stadt hat der Bauunternehmer Leopold Bachmann mit den Siedlungen ‹Wässerwiesen› und ‹Im Gern› auf einen Schlag 840 Wohnungen im unteren Preissegment gebaut. Vom Arbeiteridyll im kleinen Mehrfamilienhaus mit Garten sind diese Areale jedoch weit entfernt. Die zeitgenössische Interpretation des Stadtbausteins ist das kompakte, fünfgeschossige Gebäude mit umlaufendem Balkon und einfachen Grundrissen. Insgesamt hat die Stadt im vergangenen Jahr Baugesuche für 1100 Wohnungen bewilligt – rund um die Stadt in Oberwinterthur, Hegi, Töss und Wülflingen. Bald wird Winterthur die Industriestadt abstreifen und zur Wohnstadt werden. Kein Schlafdorf wohlgemerkt, sondern eine durchgrünte Stadt mit einer eigenen Urbanität, die wohl bald die Grenze von 100 000 Einwohnern überschreiten wird. Bis zur fünftgrössten Stadt in der Schweiz fehlt aber noch ein gutes Stück: Lausanne zählt zurzeit rund 125 000 Einwohner und Bern auf dem vierten Rang fast 130 000. •

Überbauung In Wannen 67

Oberes Alpgut 68
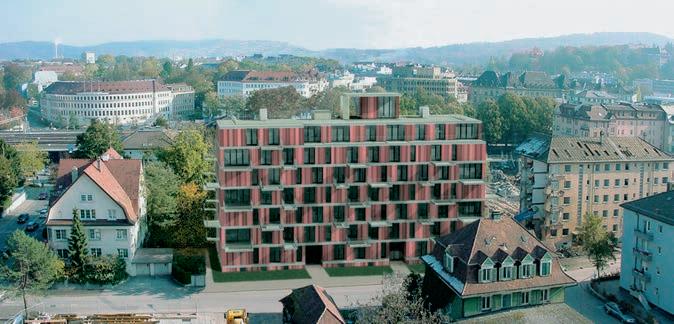

Neubau Eichgutstrasse 71
Fehlmann-Areal 72
Die drei Bauten der oberen Zeile bilden den Rücken, drei Finger greifen ins Gelände. Dazwischen entsteht eine Platzsituation als zentraler Ort der Siedlung und Eingangsebene in die Häuser.
--› Adresse: In Wannen 14–23
--› Realisierung: 2005–2007
--› Bauherrschaft: Gesell. für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur, c / o Sulzer Immobilien, Winterthur
--› Architektur: Egli Rohr Partner Architekten, Baden Dättwil
--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
--› Generalunternehmer: Halter, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: Total 50, 26 Eigentums-, 26 Mietwohnungen

Überbauung Talwies, Scheco-Areal 73
Ein offenes Bebauungsmuster aus wechselweise abgedrehten und zueinander versetzten Baukörpern verdichtet sich zur Strasse hin und öffnet sich zum Fluss. Brüstungsbänder aus farbigem Glas umspannen die Hofräume und erzeugen vielfältige Raumsequenzen von verschiedener Form und Farbigkeit.
--› Adresse: Hegistrasse
--› Projektstand: Baubeginn 2006
--› Bauherrschaft: Winterthur Versicherungen, Real Estate Management
--› Architektur: Silke Hopf Wirth & Toni Wirth, Winterthur
--› Nutzung: 186 Wohnungen, Gewerbe, Kindergarten; 192 Parkplätze
--› Bauvolumen: 113 000 m³
Die prägenden Teile der alten Anlage bleiben erhalten und werden zu Grundelementen der neuen Anlage. Mauerscheiben, nicht Volumen bestimmen die Architektur. Diese lässt viel Spielraum für individuelle Ausbauwünsche.
--› Adresse: Oberer Reutlingerweg
--› Realisierung: 2006
--› Bauherrschaft: Eigentümergemeinschaft Oberes Alpgut
--› Architektur: Peter Kunz, Winterthur
--› Realisation: Martin Markwalder Baumanagement, Brüttisellen
--› Verkauf: Walter Wittwer, Winterthur
--› Landschaftsarchitektur: Dipol, Basel
--› Anzahl Wohnungen: 12 Patiohäuser
--› Gesamtkosten: CHF 19,2 Mio.

Kälin-Areal 74
Die Überbauung liegt direkt beim Bahnhof Oberwinterthur. Sie umfasst Mietwohnungen und ein Gewerbegebäude, die sich subtil in den Park der bestehenden Villa von Rittmeyer + Furrer einfügen.
--› Adresse: Hobelwerkweg
--› Bauherrschaft: Helvetia Patria Versicherungen, Zürich
--› Totalunternehmer: Zani Generalbau AG, Dübendorf
--› Architektur: Max Schönenberg + Partner AG, Zürich, G. Lienhard
--› Landschaftsarchitektur: Vetsch Nipkow Partner, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 104
--› Garagenplätze: 114
--› Bauvolumen: 63 750 m³
Die Fassade mit den geschossweise versetzten Fenstern und Balkonen kündet schon von aussen den flexiblen Grundriss an. Statisch relevant sind nur die Aussenwände, der Kern und die Wohnungstrennwände, was für die Gestaltung der einzelnen Wohnung maximale Freiheiten zulässt.
--› Adresse: Eichgutstrasse 12, 14
--› Realisierung: 2007 / 2008
--› Bauherrschaft: Pensionskasse der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft
--› Architektur: Vera Gloor, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 41
--› BGF: 6119 m²
--› Bauvolumen: 22 523 m³

Schenkelwiese 75
Das Grundstück wird durch die Parklandschaft und die Villa Fehlmann geprägt. Die Neubauten nehmen als zeitgemässe Interpretation der ‹Villa im Park› die Körnigkeit der Umgebung auf. Die Wohnungen in drei unterschiedlichen Gebäudetypen sind variabel aufgeteilt.
--› Adresse: Römer-, Seiden-, Adler-, Palmstrasse
--› Projektstand: Baubeginn 2006
--› Bauherrschaft: Winterthur Versicherungen, Real Estate Management
--› Architektur: Bob Gysin + Partner, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 47 (Miete / Eigentum)
--› Bauvolumen: 37 400 m³

Zelgli-Areal 76
Die Überbauung mit Eigentumswohnungen im gehobenen Segment besteht aus sechs locker in die Schenkelwiese gestreuten Bauten. Sie sind dreispännig organisiert und in ihrer Ausrichtung aufenander abgestimmt.
--› Adresse: Lettenstrasse
--› Realisierung: 2007 / 2008
--› Bauherrschaft: Schweiz. Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich
--› Gesamtleitung / Bauleitung: Zani Generalbau AG, Dübendorf
--› Architektur: A.D.P. Architektur, Design, Planung, W. Ramseier, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 51
--› Garagenplätze: 59
--› Bauvolumen: 37 326 m³
Drei Freiräume überspannen das Areal der alten Eisbahn. Die Bebauung knüpft durch die leichte Ausdrehung an die Umgebung an. Alle Wohnungen basieren auf einem ähnlichen Konzept mit zentralem Ess-, Spiel- und Tagesraum.
--› Adresse: Eisweiherstrasse
--› Projektstand: Baugesuch eingereicht
--› Bauherrschaft: L + B AG, HGV, R. Hofer, W. Tobler, B. Röthlisberger
--› Architektur: Park Architekten, Zürich
--› Künstler. Begleitung: Karim Noureldin, Erik Steinbrecher
--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
--› Nutzung: 120 Wohnungen, 200 PP --› Wettbewerb: 2004 / 05


Bahnhöfe und Bahnhofplätze sind die Visitenkarten einer Stadt. In Winterthur bereitet das Parkhaus über den Gleisen den Reisenden zunächst einen kühlen Empfang. Doch zahlreiche Neubauten und Projekte korrigieren dieses Bild schnell. Die Stadt schickt sich an, mit dem Masterplan Bahnhof ihren Bahnhofplatz wieder zum Empfangssalon zu machen.
Bahnhöfe sind nicht nur Drehscheiben des Verkehrs, sie sind auch Brennpunkte der Stadtentwicklung. So ändern die Bahnhofplätze der grossen Städte ihr Antlitz im Generationentakt, und alle fünfzig oder sechzig Jahre ist die Zeit reif für Visionen – in Winterthur letztmals 1971 mit dem Ideenwettbewerb Neuwiesen-Bahnhof für die Überbauung des Bahnareals und des Neuwiesenquartiers. Die Ölkrise setzte der Zeit des grossen Massstabs zwar ein schnelles Ende, dennoch fuhren in den Achtzigerjahren die Baumaschinen auf. Im Norden und Süden baute man die Unterführungen Wülflinger- und Zürcherstrasse neu, hinter den Gleisen entstand als Fragment des Ideenwettbewerbs die dunkelbraun eloxierte, vielfach geknickte Blechbox des Neuwiesenzentrums, und am Bahnhofplatz erhielt das EPA-Gebäude aus den Dreissigerjahren einen grobschlächtigen Anbau und einen Panzer aus hellbraun eloxiertem Blech, der alt und neu gleichermassen überzieht. Auf dem Bahnhofplatz machten die provisorischen Busdächer den aufdringlichen Plexiglasdächern auf der roten Stahlkonstruktion Platz, und unter der Technikumstrasse entstand eine Fussgängerunterführung samt WC-Anlage. Den Schlusspunkt dieser Umbauphase markierte 1988, als späte Folge des Ideenwettbewerbs, die Eröffnung des heftig umstrittenen Parkhauses über den Gleisen. Seither liegen die Perrons im Dunkeln, was man mit viel Farbe etwas aufzufrischen versuchte.
Die Testplanung Stadtmitte Winterthur von 1992 (Seite 26) definierte das Gleisfeld als Freiraum zwischen den gewachsenen Quartieren Altstadt, Neuwiesen und Sulzer (und verlangt im Grunde den Abbruch des Parkhauses). Auf dieser Erkenntnis basiert das ‹Leiterkonzept›: Die Ach sen Bahnhofplatz-Untere Vogelsangstrasse und Rudolfstrasse-Bahnmeisterweg-Zur Kesselschmiede sind die Holmen dieser Leiter, ein System aus bestehenden und neuen Querverbindungen bilden die Sprossen.
Bahnhof, Platz und Arch-Areal
Nach dem Bau des Parkhauses pausierten die Baumaschinen am Bahnhof Winterthur nur wenige Jahre, bis die SBB 1995 mit der Sanierung des Aufnahmegebäudes begannen. In der Zwischenzeit passierte aber Entscheidendes: der Schritt weg von der Quantität hin zur Qualität. Atmeten die Bauten der Achtzigerjahre noch den Geist der auto- und technikgläubigen Sechziger- und Siebzigerjahre, so manifestiert sich in den Neunzigerjahren das neue Gewicht des öffentlichen Verkehrs und des öffentlichen Raums. Das Bahnhofsgebäude von 1895 erstrahlt nach der Renovation durch Stutz und Bolt Architekten äusserlich im alten Glanz und erhielt im Innern eine (leider etwas ➞
Die Schienenstränge teilen die Stadt in zwei Hälften. Beim Bahnhof sollen diese künftig besser miteinander verknüpft werden.
➞ düstere) Schalterhalle. An Stelle von Max Vogts Betonbalken des Bahnhofbuffets baute der Architekt Oliver Schwarz zwischen dem Aufnahmegebäude und der EPA das ‹Stadttor›, ein fünfgeschossiges Geschäftshaus, das den Winterthurer Bahnhof zur Rail-City macht.
Antwort auf die Busfrage
Verbindendes Element aller Bauten am Bahnhof ist der langgestreckte, schmale Bahnhofplatz, der gemäss den Plänen von Ueli Zbinden als offene Betonfläche mit einer aufs Minimum reduzierten Möblierung aus Busdächern, Plakat- und Infowänden gestaltet werden soll. Einen Vorgeschmack darauf gibt seit 2004 der Abschnitt zwischen Bahnhofsgebäude und Hauptpost. Knackpunkt auf dem Platz war bislang das Buskonzept, das die Gemüter in Winterthur seit längerem bewegt. Sollen die Busse aller Linien am Bahnhof wie an einer Endstation warten, um dann in alle Richtungen gleichzeitig loszufahren, oder sollen sie als Durchmesserlinie nur kurz anhalten und sofort weiterfahren? Mit dem ersten, heute praktizierten Regime benötigt jede Linie ihren Abstellplatz; der ganze lange Platz ist von Bussen überstellt und unübersichtlich. Im zweiten Fall



Bauten und Projekte am Hauptbahnof
Neubauten und Umbauten realisiert / im Bau
Projekte
Elemente des Masterplans Bahnhof
0 realisiert / im Bau 0 in Planung
Wohnen
Kultur und Bildung
Parks, Plätze, Strassengestaltung
Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung
Masterplan Bahnhof
4 Bahnhofplatz ausgeführt, Ueli
Zbinden, 2004 (Seite 21)
4a Projekt Bahnhofplatz Nord, verschiedene Abschnitte, Ueli Zbinden
würden wenige Haltekanten reichen, an denen die Busse im Fahrplantakt vorfahren würden. Die Antwort wird demnächst vorliegen und sie soll den Weg für den Abbruch der Plexiglasdächer ebnen. Dort wird dann der so genan nte Untertorplatz neugestaltet, das ist ein Teil des Bahnhofplatzes zwischen Altstadt und der inzwischen zu CoopCity mutierten EPA.
Ein weiteres Ziel des Umbaus des Bahnhofplatzes ist die bessere Anbindung des Arch-Areals jenseits der Technikumstrasse. Dort, wo seit bald vierzig Jahren ein provisorisches Parkhaus steht und sich bis vor kurzem das Volkshaus von Kellermüller & Hofmann erhob, ist eine gemischte Überbauung mit Läden, Restaurants, Büros, Wohnungen und Parkplätzen geplant. Brunnschweiler Denzler Erb Architekten gewannen mit ihrem Projekt ‹Cirque› den Studienauftrag für den 150-Millionen-Bau, der einen markanten Akzent ans südliche Ende des Bahnhofplatzes setzen wird. Die Baubewilligung ist erteilt, doch sind die Arbeiten durch einen Rekurs blockiert. Am nördlichen Ende des Bahnhofplatzes, wo sich seit Generationen die Schulreisen und Vereinsausflüge bei der (längst verschwundenen) ‹Milchrampe› treffen, macht in
Rudolfstrasse




4b Projekt Untertorplatz, Ueli Zbinden
4c Projekt Umgebung Arch-Areal
5 Projekt Arch-Areal, BDE Architekten Winterthur (Seite 21)
6a Projekt Rail-City Stellwerk, 1. Etappe, AGPS (Seite 21)
6b Projekt Rail-City Stellwerk, 2. Etappe, AGPS
7 Projekt Velounterführung Rudolfstrasse /Museumstrasse
8a Projekt Gleisquerung, Müller Truniger (Seite 21)
8b Projekt Bahnmeisterweg / Rudolfstrasse
8c Projekt Rudolfstrasse (Verkehrsregime)
91 Umbau Casino-Theater, Ernst Zollinger / Grego & Smolenicky, 2002 (Seite 11) 4 Bahnhofplatz
Stadt Winterthur/Metron / Hochparterre
Weitere Objekte
1 Umbau Hauptbahnhof, Stutz & Bolt, 1998
2 Stadttor (Rail-City), Oliver Schwarz, 2000
3 Umbau Restaurant National, Arnold & Vrendli Amsler, 2002
29 Umbau Kesselhaus, Projekt (Seite 33)
57 Eichgut, Baumschlager Eberle, 2005 (Seite 15)
58 Rägeboge Haus des Lebens, Blatter Eberle Partner, 2005
89 Umbau Volkart-Rundbau für ZHW, Weber & Hofer, 1996
jüngster Zeit das ‹Milchküchenareal› von sich reden. Die SBB wollen den 160 Meter langen, schmalen Streifen, auf dem heute ein Dienstgebäude mit Kantine und zahlreiche Veloabstellplätze stehen, besser nutzen und mit dem Projekt ‹Stellwerk Rail-City› von AGPS Architecture überbauen. Schon Mitte 2007 soll der Baubeginn der ersten, 80 Meter langen Etappe sein. Das Stadtparlament hat kürzlich den Gestaltungsplan genehmigt und einen Beitrag von 1,36 Millio nen Franken für ein 800-plätziges Veloparking gesprochen. Dieses ist neben den Büros und Läden ein Kernstück des Projektes, mit dem die Stadt nicht nur die heutigen 630 Plätze ersetzen, sondern auch den notorischen Mangel an Abstellplätzen rund um den Bahnhof entschärfen will. 2500 Plätze gibt es insgesamt, 3000 bis 3500 wären am Bahnhof der Velostadt Winterthur nötig. Den Zweirädern käme auch der Velotunnel zugute, der dereinst von der Rudolfstrasse unter den Gleisen hindurch direkt in das neue Veloparking führen könnte.
Ein Weg für Velos und Autos
Erst vage nimmt ein weiteres Grossprojekt im Raum Bahnhof – und ein wesentliches Element des Leiterkonzepts von 1992 – Gestalt an: die Anbindung des Sulzer-Areals ans Neuwiesenquartier und die Altstadt. Wo heute Fussgänger und Velofahrerinnen über Treppen und Rampen durch die Zürcherstrasse-Unterführung unter der Bahn hindurch schlüpfen, soll in Zukunft eine attraktive Verbindung den neuen Stadtteil im Sulzer-Areal an die Stadt anbinden. In ihrem siegreichen Projekt ‹Vis-à-vis› schlagen Müller Truniger Architekten vor, den nördlichen Fussgänger- und Veloweg in der Unterführung zu verbreitern, allenfalls mit Läden auszustatten. Die Rudolfstrasse würde nicht mehr in die Zürcherstrasse münden, sondern in Hochlage auf einen Platz und weiter ins Sulzer-Areal führen, wo das Kesselhaus (Seite 33) den attraktiven Auftakt des Areals markieren wird. Ziel ist, die heute im Gegenverkehr befahrene Strasse nur noch für Velos und Fussgänger offen zu halten. Davon profitiert vor allem das Neuwiesenquartier, das seit kurzem auch für das Wohnen wieder attraktiv ist, wie die Neubauten von Baumschlager & Eberle (Seite 15) und Vera Gloor (Seite 17) illustrieren. Doch welchen Weg nehmen dann die Autos? Und wie gelangen sie ins Parkhaus über den Gleisen? Bis 2007 möchte die Stadt die Idee zu einem Vorprojekt entwickeln und insbesondere die Verkehrsführung in der Rudolfstrasse klären. Ob sich ‹Vis-à-vis› in all seinen Teilen realisieren lässt, ist ungewiss, denn als sechste, letzte und somit ferne Etappe schlagen die Architekten vor, den Coop-City abzubrechen und durch einen zurückgesetzten Neubau zu ersetzen – eine vielleicht utopische, angesichts des braunen Blechklotzes aber durchaus faszinierende Idee. Um zu garantieren, dass die zahlreichen Bau- und Verkehrsprojekte am Hauptbahnhof nicht in einem Flickwerk enden, hat die Stadt die Projektorganisation ‹Masterplan Bahnhof› eingesetzt. Zum Masterplan gehören die privaten Bauvorhaben Arch-Areal, das Kesselhaus, die Milchküche Stellwerk Rail-City und die öffentlichen Projekte Untertorplatz, Umgebung Arch-Areal, Velounterführung und Gleisquerung Vis-à-vis. Die fachliche Erarbeitung besorgt das Planungsbüro Metron, das auch die Projektkoordination unterstützt. Der ‹Masterplan Bahnhof› soll dafür sorgen, dass sich die Puzzleteile des nächsten ‹Generationensprungs› am Bahnhofplatz in Winterthur dereinst zu einem ganzen und attraktiven Bild finden werden. •

Bahnhofplatz 4

5
Der langgestreckte Bahnhofplatz erhält mit neuen Belägen, neuen Buswartehäuschen und neuer Beleuchtung ein städtisches Gepräge. Bereits realisiert ist der Abschnitt zwischen Bahnhof und Hauptpost: der Untertorplatz, wo heute noch der Busbahnhof aus den Achtzigerjahren steht, und die Umgebung des Milchküchenareals sollen nach den gleichen Prinzipien gestaltet werden. Voraussetzung für die Realisierung ist ein neues Buskonzept.
--› Adresse: Bahnhofplatz
--› Stand: 1. Etappe fertig 2003, weitere Etappen in Planung
--› Bauherrschaft: Stadt Winterthur
--› Architektur: Büro Ueli Zbinden, Zch.

Rail-City Stellwerk 6
Der Neubau auf dem ehemaligen Milchküche-Areal steht in der nördlichen
Verlängerung des Bahnhofgebäudes und misst im Endausbau 160 Meter. In der ersten Etappe (Rendering) , entstehen 800 Veloparkplätze sowie Ladenflächen und in den Obergeschossen Büros.
--› Adresse: Bahnhofplatz
--› Stand: Gestaltungsplan bewilligt
--› Realisierung 1. Etappe: 2007–2008
--› Bauherrschaft: SBB Immobilien
--› Architektur: AGPS Architecture, Zürich, Manuel Scholl, Hanspeter Oester, Roger Naegeli, Ines Trenner
--› Studienauftrag: 2001
--› Nettofläche: 12 755 m²
--› Kosten 1. Etappe: CHF 18 Mio.
Auf dem Areal des früheren Volkshauses und des provisorischen Parkings entsteht eine gemischte Überbauung mit Lä den, Gastronomie, Büros, Wohnungen und einer Tiefgarage. www.archareal.ch
--› Adresse: Lagerhausstrasse / Archstrasse / Meisenstrasse
--› Stand: bewilligt, Rekurs hängig
--› Eigentümer: Stadt Winterthur, Halter Generalunternehmung AG, Zürich
--› Projektentwicklung: Halter Generalunternehmung AG, Zürich
--› Architektur: BDE Architekten, Winterthur
--› Studienauftrag: 2003
--› Nettofläche: 25 000 m²
--› Investitionsvolumen: CHF 150 Mio.
Gleisquerung 8

Das Projekt stellt das Erdgeschossniveau der Stadt wieder her. An Stelle von Übergängen und Brücken entstehen Plätze, die über eine breite unterirdische Passage miteinander verbunden sind.
--› Stand: Projektierung ab Herbst 2006
--› Auftraggeberin: Stadt Winterthur
--› Gesamtleitung / Koordination: Metron, Brugg / Bern
--› Projektleitung / Architektur: Müller & Truniger Architekten, Zürich, D. Truniger, A. E. Müller, P. Frei
--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
--› Bauing: Dr. Lüchinger & Meyer, Zürich
--› Verkehr: Stadt-Raum-Verkehr, Zürich
--› Wettbewerb: 2003, 2004
? Hat das nicht auch mit einem Machtverlust von Sulzer, dem einst grössten Arbeitgeber, zu tun?
Ich glaube eher, dass Sulzer als einer der grössten Grundbesitzer in der Stadt eine gute Partnerschaft braucht, um diesen Grundbesitz zu versilbern. Wir auf der anderen Seite sind darauf angewiesen, dass mit diesen Industrie brachen etwas passiert, das der Stadt nützt. Damit haben wir zum Teil parallele Interessen und sind gemeinsam auf gute Lösungen gekommen. So etwa die Vereinbarung, die wir mit dem Heimatschutz, der Denkmalpflege von Stadt und Kanton, dem Grundbesitzer und der Stadt über das Sulzer-Areal Stadtmitte erarbeitet haben (Seite 26) . Sie gibt Planungssicherheit und hat seit etwa vier Jahren einen enormen Boom ausgelöst. ? Wo liegen heute die Probleme auf dem Areal Sulzer-Stadtmitte?
Text: Werner Huber
Fotos: Michael Lio
Der Niedergang der Industrie zwang Winterthur zu einer Neuorientierung. Der Aufschwung ist auch das Ergebnis des Ge nerationenwechsels in Politik und Wirtschaft. Die ZHW (Zürcher Hochschule Winterthur) bringt jun ge Menschen und neues Leben in die Stadt. Werner Huber sprach mit dem Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend.
? Winterthur ist die sechstgrösste Stadt der Schweiz – aber sie war bislang bei vielen weitgehend unbekannt. Stimmt diese Einschätzung?
Das war lange Zeit so, doch habe ich den Eindruck, das ändert sich. Wir strengen uns auch an, um auf die Qualitäten Winterthurs aufmerksam zu machen. Ich stelle eine Zunahme an positiven Berichten fest, deren Tenor einheitlich ist: Die Stadt wurde bisher verkannt, die Vorurteile der grauen, langweiligen Industriestadt stimmen nicht mehr, und in der Stadt hat sich eine Dynamik entfaltet. ? Der Niedergang der Industrie bedeutete für Winterthur einen grossen Einschnitt. Heute ist die Stadt wieder im Aufschwung. Gibt es ein Schlüsselereignis?
Ein wichtiger Punkt waren sicher die personellen Veränderungen im Stadtrat, die 2002 stattfanden. Gleichzeitig gab es bei den Wirtschaftspartnern einen Generationenwechsel. Damit konnte die Verkrustung, bei der sich die gleichen Kreise immer um sich selbst drehten, aufgebrochen werden. Hatte man sich früher eher abgeschottet, was fast parteipolitisch abgrenzbar war, hatten die Neuen keine Berührungsängste mehr. Und gleichzeitig war die Zeit über reif für Veränderungen. ? Wie hat sich das Verhältnis von der Stadt zu Sulzer gewandelt?
Das Verhältnis ist intensiviert worden. Martin Schmidli, der Leiter von Sulzer Immobilien, hat für eines meiner Wahlinserate die Aussage gemacht, die Entscheidungswege seien kürzer und die Kontaktherstellung schneller geworden, die Regierung sei offen und suche nach Lösungen. Letztlich sind wir derart voneinander abhängig, dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können.
Probleme kann es dort geben, wo ein Objekt geschützt ist: aktuell das Kesselhaus am Eingang zum Areal. Hier muss eine Lösung gesucht werden, die den Schutz gewährleistet, aber trotzdem eine Umnutzung ermöglicht. Im Weiteren ist der Übergang von der alten in die neue Stadt noch nicht gelöst. Hier arbeiten wir mit Hochdruck an einem Masterplan, der das ganze Gebiet rund um den Hauptbahnhof umfasst und nebst einer Verbindung von der alten in die neue Stadt auch vorsieht, den Bahnhofplatz auf die Rückseite des Bahnhofs hinüberzuziehen (Seite 18) . Diese Projekte sind so wichtig, dass wir sie wohl in die nächsten Legislaturziele aufnehmen werden.
? Wo würden Sie bei der Entwicklung des Sulzer-Areals heute anders handeln? Ich frage mich, ob das Vorgehen mit Gestaltungsplänen, die zum Teil sieben Jahre dauerten, richtig war. Und dann haben wir uns in einem solchen grossen Gebiet lange Zeit auf ein Bauwerk, Jean Nouvels ‹Megalou›, konzentriert und darauf vertraut, dass dieses realisiert wird. Ich denke, man hätte schon damals mit Umnutzungen und Zwischennutzungen arbeiten und das Areal schrittweise entwickeln sollen. So war jahrelang alles blockiert. Dafür können wir nun einen Teil der alten Bausubstanz in die Entwicklung einbeziehen und so dem Areal seine Seele belassen, was für einen urbanen ‹Groove› sorgt, der mit seelenlos aneinander gereihten Neubauten kaum zu erreichen ist. Ich bin auch überzeugt, dass wir nicht die Probleme von Zürich-Nord haben werden: Anonymität, ausgestorbene Räume in der Nacht .
? Und wie sieht das Sulzer-Areal im Vergleich zu Zürich-West aus?
Es gibt Parallelen, hier wie dort hat man nicht alles abgerissen, sondern alt und neu kombiniert. Doch ich denke, dass Zürich-West bei der Freizeitnutzung möglicherweise eine gewisse Grenze überschritten hat und die Nutzung als Wohnort in Mitleidenschaft gezogen wird. Das wird in Winterthur nicht in dem Mass stattfinden.
? Für Sulzer-Stadtmitte zeichnet sich ein Charakter des Quartiers ab. In Oberwinterthur ist noch wenig zu sehen. Was wird es dort für ein Quartier geben?
Das ist noch nicht definiert, und das ist der grosse Mangel. Wir brauchen noch einen politischen Prozess, um zu de finieren, was dort passieren soll. Ich will diesen Prozess nicht vorwegnehmen, aber ich bin ziemlich sicher, dass dort etwas anderes entstehen muss als das, was wir in der Altstadt und in Sulzer-Stadtmitte haben. Ich könnte mir
vorstellen, dass der Schwerpunkt im Bereich Wohnen, Erholung und Freizeit liegt. Eine Zeit lang gab es die Idee, dort einen grossen Campus für die ZHW zu bauen. Doch dann hat Frau Aeppli entschieden, dies zu stoppen. ? Hätte die Verlagerung der Hochschulenach Oberwinterthur der Stadt genützt oder geschadet?
Die Erschliessung mit Bahn und Bus wäre zweifellos gut gewesen. Doch heute bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob der Bau des Campus eine gute Idee gewesen wäre. Denn durch den rasanten Anstieg der Studierenden hat die Stadt im Zentrum eine ganz andere Qualität erhalten; es sind neue Lokale entstanden, es gibt viele junge Leute, die hier wohnen – teilweise vorübergehend, teilweise bleiben sie hängen. Und wenn junge Leute in eine Stadt strömen, dann ist das ein Zeichen des Aufbruchs.
? Blickt man auf die Karte, so gibt es sehr viele Wohnbauprojekte. Das ist erfreulich – gibt es auch negative Aspekte?
Tatsächlich wurde 2005 mit 850 Millionen Franken so viel in den Wohnungsbau investiert wie nie zuvor. Das freut, macht aber auch Sorgen. Denn wir möchten nicht nur quantitatives, sondern auch qualitatives Wachstum erreichen. Natürlich wollen wir niemanden aus der Stadt verdrängen, doch wir müssen auch Angebote für besser verdienende Segmente zur Verfügung haben, damit sich diese nicht nur in den Aussengemeinden ansiedeln. ? Wie wollen Sie das erreichen?
Unsere Wohnungspolitik steht auf drei Beinen: Erstens wollen wir im Neuwohnungsbau eine verstärkte Ausrichtung auf gehobene Qualität. Damit stossen wir bei den Grundbesitzern auf offene Ohren. Zweitens möchten wir vermehrt unsere Altbestände sanieren. Und drittens möchten wir das Angebot in den Bereichen Alterswohnen und studentisches Wohnen ausbauen. Unsere Möglichkeiten sind zwar beschränkt, doch haben wir einiges erreicht. So konnten wir Leopold Bachmann bei einer Wohnüberbauung im Schlosstal für einen Wettbewerb gewinnen.
? Hat sich das Bild Winterthurs unter den Investoren gewandelt?
Das zeigt sich alleine daran, wie viel zurzeit investiert wird, und täglich erhalte ich neue Anfragen. Dies ist in erster Linie den Standortqualitäten zu verdanken. Winterthur ist hervorragend an den öffentlichen und den Privatverkehr angeschlossen, die Stadt ist sicher und übersichtlich, alles ist in Gehdistanz erreichbar, und – was gerade für internationale Firmen interessant ist – der Flughafen

Die Schätze in den Museen sind riesig, doch ist es erstaunlich, wie wenig Leute es etwa im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten hat. Wurde das kulturelle Angebot zu wenig vermarktet?
Ja, das wurde bis jetzt eindeutig zu wenig gemacht. Doch nun läuft einiges an: Wir haben in der Ostschweiz und im süddeutschen Raum vermehrt inseriert, und eine grössere Plakataktion ist im Anlaufen. Dann denken wir auch darüber nach, ob die 17 Museen nicht zu sehr verzettelt sind. Wir müssen uns fragen, ob wir allenfalls eine Konzentration herbeiführen können, damit das einzelne Museum auch in einem besseren Kontext steht. Vielleicht können wir im Geviert mit dem Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten und dem Kunstmuseum ein Museumszentrum mit grösserer Leuchtkraft schaffen. Denn von den hundert besten Bildern der Welt hängt ein halbes Dutzend in Winterthur –aber niemand weiss es. Doch auch im zeitgenössischen Bereich haben wir mit dem Casinotheater oder dem Fotozentrum das Angebot attraktiv ausgebaut. ? Ihre Werbeanstren gungen sind Richtung Ostschweiz ausgerichtet und nicht Richtung Westen, ist das Konzept?
Man kann das eine tun und soll das andere nicht lassen. Doch tatsächlich können wir in der Ostschweiz eine zentrale Funktion übernehmen, und wir sehen auch, dass aus dieser Richtung der Kulturtourismus angestiegen ist. Zudem können wir auch wirtschaftlich in diesem Raum eine andere Position einnehmen. Das wollen wir ausbauen.
Zudem haben wir manchmal gemeinsame Sorgen mit der Ostschweiz: etwa der Engpass der SBB zwischen Winterthur und Zürich oder die verstopfte A1. ?
Welches war Ihre grösste Freude?
Das war sicher der Entscheid der Firma Zimmer, ihren Hauptsitz für Europa, Australien und Asien in Winterthur anzusiedeln. Die Ansiedlung eines international renommierten Unternehmens in Winterthur, das war ein wichtiges Zeichen! (Zimmer ist das Orthopädieunternehmen, das den Medizinalbereich von Sulzer übernommen hat.) ? Und welches ist die grösste Sorge? Eines der grössten Probleme ist das finanzielle Gefälle, das wir im Kanton Zürich haben. Da müsste ein besserer Ausgleich bei den Steuerfüssen geschaffen werden. Doch das ist ein gesamtschweizerisches Problem. Die Finanzen sind ein Thema für jede Industriestadt, deren Bevölkerung einseitig zusammengesetzt war. Es dauert lange, bis sich die Zusammensetzung der Einwohner verändert und die Steuerkraft entsprechend ansteigt. Wir arbeiten daran. •

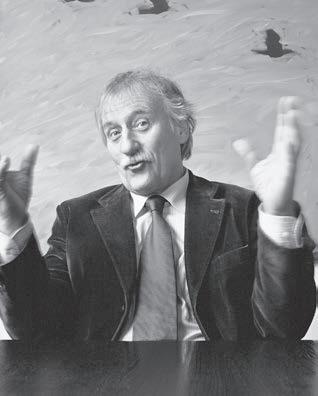
Ernst Wohlwend, seit vier Jahren der Stadtpräsident von Winterthur, schildert die Vorzüge seiner Stadt.

















Bauten und Projekte
0 realisiert in Bau 0 in Planung
Wohnen
Kultur und Bildung
Parks, Plätze, Strassengestaltung
Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung
Wald öffentliche Grünflächen
Eisenbahn
Perimeter Testplanung 1992
Bahnhofplatz Hauptbahnhof (Seite 18)
Umbau Hauptbahnhof C3
Stadttor C3
Umbau Rest. National C3
4 Bahnhofplatz C3 (Seite 21)
5 Arch-Areal C3 (Seite 21)
6 Rail-City Stellwerk B3 (Seite 21)
7 Velounterführung RudolfstrasseMuseumstrasse B3
8 Gleisquerung C3 (S. 21)
Sulzer-Areal Stadtmitte (Seite 26)
9 Stadler Winterthur (ehem. SLM Lokfabrik Werk 1) ab 1872 C3
10 ZHW-Architekturabteilung Halle 180, Zwischennutzung ab 1991 C3
11 Werkhaus, 1998 C3 (Seite 29)
12 City-Halle (Halle 87), Zwischennutzung, Umbau 1999 C3
13 Lofts G48, 2000 C3 (Seite 29)
14 Einbau Ausbildungszentrum, 2001 C3 (Seite 29)
15 Block-Tempodrom (Halle 193), Zwischennutzung ab 2001 C3
16 Arbeiterhäuser Jägerstrasse, Sanie rung 2002 C3 (Seite 29)
17 Technopark I, 2002 C3 (Seite 31)
18 Zur Kesselschmiede, Zwischennutzung 2003 C3
19 Sulzer-Konzernsitz, Umbau 2003 C3
33 Internationale Schule, 2002 B5
34 Am Eulachpark I, 2006 B5 (Seite 37)
35 Am Eulachpark II, 2006 B5 (Seite 37)
36 Zum Park, 2006 B5 (Seite 37)
37 Christengemeinde, 2006 B5
38 Eulachhof B5 (Seite 37)
39 Strassengestaltung B5
40 Eulachpark B5
weitere Areale (Seite 40)
41 Hotel Banana-City, 1997 B3 (Seite 41)
42 Winterthur-Hochhaus, Volg-Areal 2000 B3 (Seite 41)
43 ZHW-Neubau Mäander, 2005 B3 (Seite 41)
44 Haldengut B4 (Seite 41)
45 Sidi-Areal C4 (Seite 41) Wohnen
46 Weinbergstrasse Winzerstrasse, 1996 B2
47 Wohnsiedlung Am Heiligberg, 1999 C3
48 Siedlung Zelgli, Sanierung, Erweiterung 1999 C4 (Seite 15)
49 Ninck-Areal, 2002 C3 (Seite 15)
50 Q-Bus, 2002 D2 (Seite 15)
51 Überbauung Wässerwiesen, 2003 B1 (Seite 15)
52 Wohnpark Hochwacht, 2004 C3
53 Im Gern, 2004 B6
54 Im Ganzenbühl, 2004 D5
55 Überbauung Neumühle, 2004 D2
56 Binzhof VI, 2004 A5 (Seite 15)
57 Eichgut, 2005 B3 (Seite 15)
58 Rägeboge Haus des Lebens, 2005 C3
59 Wohnen Am Tössufer, 2005 D5
60 Sanierung MFH Schaffhauserstrasse, 2005 A3 (Seite 15)
61 Patiohäuser Stadtterrasse, 2005 C3 (Seite 15)
79 Zentrum Rosenberg (Wohnungen)
80 Wespimühle B1
Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung
81 Verwaltungsgebäude Swica, 2001 C4
82 Hasler-Haus, 2002 C5
83 Coop Grüzemarkt, Erweiterung 2003 C5
84 Bezirksgebäude, Erweiterung 2005 B4
85 Media-Markt, 2005 B6
86 Grüzepark (Migros), 2006 C5
87 Zentrum Rosenberg A3
Kultur und Bildung
88 Kunstmuseum-Erweiterung, 1995 B4
89 Volkart-Rundbau für ZHW, 1996 B3
90 Erweiterung Sammlung Am Römer holz, 1998 B4
91 Umbau Casino-Theater, 2002 C3 (Seite 11)
92 Umbau Technorama, 2002 A5
93 Schulhaus Wiesenstrasse, 2002 B3
94 Stadtbibliothek, 2003 C4
95 Krematorium Rosenberg, 2004 A3
96 Umbau Naturmuseum, 2005 B4
97 Erweiterung Kantonsschule, 2007 B4 (Seite 11)
98 Eulachpassage C3 (Seite 11)
99 Eulachhaus C3 (Seite 11)
Grünstadt
A Stadtgarten C3
B Lindengut C4
C Park Villa Bühler B4
D Rosengarten C3
E Frohbergpark B5
F Rychenbergpark B4
G Römerpark C4
H Hermannpark C4 Adlergarten C4
J Bäumli B4
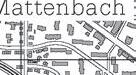


20 Kranbahn I, 2004 C3 (Seite 31)
21 Pionier-Park, 2004 C3 (Seite 31)
22 Freiraumgestaltung, 2004 C3 (Seite 31)
23 Überbauung Lokomotive, 2006 C3 (Seite 33)
24 Sanierung Wintower (Sulzer-Hochhaus), 2007 C3
25 Überbauung Sieb-10, 2007 C3 (Seite 33)
26 Hallen 9 / 10 / 11, Testplanung 2006 (ehem. ‹Megalou›) C3
27 Halle 52 53, Testplanung 2006
28 Einkaufszentrum Werk 2 C3 (Seite 33)
29 Galeria Trocadero, Kesselhaus C3 (Seite 33)
30 Technopark II C3
31 Kranbahn II C3
32 ZHW-Campus Lagerplatzareal C3

62 Überbauung Binzhof, 2006 A5
63 Überbauung Kastanienpark, 2006 A5
64 Überbauung Rümikerstr. 2006 B6
65 Wohnsiedlung Linde, 2006 D5
66 Überbauung Dättnauer- Rainstrasse, 2006 D2
67 Überbauung In Wannen, 2006 D2 (Seite 17)
68 Oberes Alpgut, 2005 B4 (Seite 17)
69 Maienried, 2006 A1
70 Schlosswiese, 2006 B6
71 Eichgutstrasse 12, 14 B3 (Seite 17)
72 Überbauung Fehlmann-Areal C4 (Seite 17)
73 Scheco-Areal B5 (Seite 17)
74 Kälin-Areal B5 (Seite 17)
75 Schenkelwiese B2 (Seite 17)
76 Zelgli-Areal C4 (Seite 17)
77 Am Berentalbach D5
78 Überbauung Schlosstal B2
K Allmend Grüzefeld C4
L Tössfeldanlage C3
M Brühlgut C3
N Friedhof Rosenberg A3


© Architekturführer Winterthur 1830-1997/Architekturfachklasse Frank Mayer


Seite 26-27 Die Überbauung Kranbahn I und der Katharina-Sulzer-Platz setzen einen deutlichen Akzent der neuen Zeit. Eingefasst von alten Industriebauten und dem neuen Pionierpark entsteht an Stelle der Halle 17 die Überbauung Sieb-10.
Nach zähen Anfängen ist in die einstigen Sulzer-Industriehallen im Stadtzentrum Leben zurückgekehrt. Den grossen Würfen hat die Immobilienflaute ein frühes Ende gesetzt, dann haben Zwischennutzungen den Weg der kleinen Schritte gebahnt. Doch die verschiedenen Partner mussten erst lernen, den Strick in die gleiche Richtung zu ziehen. Heute tun sie das mit Erf olg.
Ein Büroeinrichtungsgeschäft in den Bauten der Giesserei von 1896, ein Technopark im Schreinerei- und Magazingebäude von 1906, Lofts im Magazin von 1912 oder Architekturstudenten in der Kesselschmiede von 1924 – dass die alten Mauern der Firma Sulzer in Winterthur mit neuen Nutzungen gefüllt werden, scheint heute selbstverständlich. Vor zwanzig Jahren hat die Mühle Tiefenbrunnen in Zürich vorgemacht, wie das geht, seither ist Ähnliches in Zürich-West, in Uster und an anderen Orten entstanden. Doch so gradlinig, wie die Entwicklung heute aussieht, war der Weg dahin nicht. Kein Wunder, sind doch unzählige Personen in unterschiedlichen Funktionen – und mit unterschiedlichen Interessen – an einem solchen Prozess beteiligt. Und mitunter mussten die Akteure ihre Rolle erst finden – die Firma Sulzer, die nicht mehr einfach allein über ihr Areal verfügen konnte, und
die Stadt, die sich darüber klar werden musste, welche Bedeutung das Areal für Winterthur künftig haben soll. Einer der wenigen, die von allem Anfang an dabei waren, ist der Winterthurer Bausekretär Fridolin Störi. Noch heute sitzt ihm der Schreck in den Knochen, wenn er sich an die Sitzung erinnert, an der die Sulzer-Konzernleitung 1989 dem Stadtrat und den Chefbeamten des Baudepartementes das Projekt ‹Winti-Nova› präsentierte (Seite 6, Plan) . Ob denn im Vorfeld niemand davon gewusst habe, so die entsetzte Frage des damaligen Stadtpräsidenten Urs Widmer an den Stadtplaner und den Bausekretär – gewusst haben Einzelne zwar schon etwas, aber die Tragweite des Vorhabens offenbar verkannt. «Das war natürlich ein denkbar schlechter Start und der Anfang eines sehr langen und in den meisten Phasen positiven Prozesses», blickt Störi zurück. Einbezug der Öffentlichkeit
In der Folge der Präsentation von ‹Winti-Nova› organisierte die SIA-Sektion Winterthur im Winter 1989/90 die Veranstaltungsreihe ‹Die Neustadt aus der Werkstatt›, die mit Vorträgen und Diskussionsrunden Bevölkerung und Stadtrat gleichermassen wachrüttelten. Schliesslich er klär te der Stadtrat das Sulzer-Areal zur Planungszone. Parteien, Verbände und Grundeigentümer machten in der ‹Werkstatt 90› eine Auslegeordnung: Der Umbau des SulzerAreals wird kein Entwurf, sondern ein dauernder Prozess, so das Fazit. Die Stadt setzte die Planungsorganisation Stadtentwicklung Winterthur ein, das Gebiet wird mit ei-

ner Gestaltungsplanpflicht belegt. Die ‹Werkstatt› wird als ‹Forum Stadtentwicklung› (später umbenannt in ‹Forum Architektur›) zum kritischen Begleiter. 1992 führt die Stadt die Testplanung ‹Stadtmitte› durch, in der sich sechs Gruppen mit der Zukunft der Stadtmitte Winterthurs beidseits der Gleise befassen. Der Perimeter reicht von der Storchenbrücke bis zum Kantonsspital und umfasst als Herzstück das Sulzer-Areal.
Die wichtigsten Resultate: Das Gleisfeld wird nicht überbaut, die angrenzenden Quartiere behalten ihre Eigenständigkeit; es gilt, das Leiter-Konzept mit den beiden Strassen seitlich der Bahn als Holmen und den Unter- und Überführungen als Sprossen; das Sulzer-Areal bedarf einer offenen Planungsstrategie und keines Projektes aus einem Guss. In einer ersten Etappe sollte ein Kristallisationspunkt für das gesamte Vorhaben entstehen. Da Nouvel / Cattani mit dem Projekt ‹Megalou› gewannen. Als Informations- und Verhandlungsgrundlage wird der Rahmenplan ‹Stadtmitte› konzipiert, in dem die Bauvorhaben des Testplanungs-Gebietes miteinander verwoben sind.
Kleine Schritte statt grosse Würfe
Walter Muhmenthaler, Leiter Areal- und Projektentwicklung bei Sulzer Immobilien, hat an der denkwürdigen Winti-Nova-Sitzung von 1989 nicht teilgenommen; er ist erst seit Anfang 1991 dabei. Aber er hat miterlebt, wie die bei Sulzer zur Disposition stehenden Flächen in Winterthur auf gegen eine Million Quadratmeter anwuchsen – rund ➞


Werkhaus Zürcherstrasse 11

Altbauten von 1896 und 1905 sind zu einem als Büro-, Ausstellungs- und Schulgebäude genutzten Geschäftshaus umgebaut worden. Von aussen ist davon wenig zu sehen, vor allem blieben die filigranen Stahlfenster des Erdgeschosses erhalten. Die abgerundete Ecke bildet einen markanten Akzent an der Stel le, wo die schnurgerade Zürcherstrasse eine leichte Kurve macht.
--› Adresse: Zürcherstrasse 15–21
--› Fertigstellung: 1998
--› Bauherrschaft: SGI, vertreten durch Intershop Management Winterthur
--› Architektur: Max Lutz + Partner
--› Nutzung: Büros, Praxen, Büromöbel, Schulen

Ausbildungszentrum 14
Lofts G48 13
Einst diente das 1912 erstellte Gebäude 48 als Hauptmagazin, heute lagern in ihm 23 Lofts. Mauerwerk, Eisenskelett und Decken blieben erhalten; Wände, Wendeltreppen, Lift und grosse Gläser sind neu. Ein Laubengang an der Rückseite erschliesst die Geschosse. Die oberen Wohnungen haben einen Glascontainer auf dem Dach mit weitem Blick übers Gleisfeld und die Stadt.
--› Adresse: Pionierstrasse 10–12
--› Realisierung: 2000
--› Bauherrschaft / TU: Kamata AG, Baar
--› Architektur: Baldinger Architekten, Zürich
--› Nutzung: 23 Lofts, Dienstleistungen,

Das Ausbildungszentrum Winterthur hat die Werkstatt der früheren SulzerLehrlingsausbildung übernommen. Markus Bellwald hat für Schulzimmer ein Haus im Haus gebaut und im Kopfbau die Büros platziert. Der Einbau berührt die alte Halle – die Radiatorengiesserei von 1905 – nicht und setzt sich als Alukörper klar vom Alten ab. Foto: Thomas Aus der Au
--› Adresse: Zürcherstrasse 25
--› Realisierung: 2002
--› Bauherrschaft: J.-J.-Sulzer-Stiftung, vertreten durch Sulzer Immobilien
--› Architektur: Markus Bellwald, W'thur
--› Nutzung: Werkstatt, Schulungsräume, Büros
--› Kosten: CHF 5,1 Mio.
Sanierung Arbeiterhäuser 16
1872 erstellte die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik für ihre Arbeiter eine Häuserzeile an der Jägerstrasse. Im gleichen Jahr wurde die Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur gegründet. Diese kaufte 12 der Häuser zu ihrem 125-jährigen Jubiläum und renovierte sie sanft als Studentenunterkünfte.
--› Adresse: Jägerstrasse 25–47
--› Realisierung: 2002
--› Bauherrschaft: Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser
--› Architektur: Arnold und Vrendli Amsler, Winterthur
--› Nutzung: 12 Häuser als Wohnraum für 36 Studierende
➞ 230 000 in der Stadt und gegen 700 000 in Oberwinter thur (Seite 34) . Gleichzeitig ging die Mitarbeiterzahl von 14 000, die allein in Winterthur auf der Lohnliste standen, auf unter 1000 in der ganzen Schweiz zurück. Von der Industrie ist auf dem Areal nur noch Stadler Winterthur übrig geblieben, die als Nach-Nachfolgefirma der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in den Hallen der einstigen ‹Loki› weiterhin Schienenfahrzeuge produziert. Sulzer will sich auf den Maschinenbau konzentrieren und die freien Flächen verkaufen. Als Investor tritt die Sulzer Immobilien AG nicht auf, sie übernimmt als Bauherrenvertreterin das Projektmanagement auf oberster Ebene. «In Neubauten können wir nicht investieren, es bleibt uns nur der Freiraum, um eigene Zeichen zu setzen», meint Muhmenthaler mit Blick auf die Freiraumgestaltung von Vetsch Nipkow Partner am Katharina-Sulzer-Platz. Das wirtschaftliche Umfeld, in dem Sulzer Immobilien operieren musste, war zunächst schwierig. Nach dem auf dem Boom der Achtzigerjahre basierenden ‹Winti-Nova› scheiterte schliesslich auch Jean Nouvels ‹Megalou›, nicht zuletzt wegen eines jahrelangen Streites mit dem VCS über die Zahl und Nutzung der Parkplätze. Sowohl Sul zer als auch die Stadt mussten erkennen, dass in Winterthur nur kleine Schritte zum Ziel führen; der Druck der Wirt schaft war in Winterthur zu klein für grosse Würfe. «In ZürichWest haben wir später angefangen, waren aber früher fertig als in Winterthur», resümiert Muhmenthaler. Das Scheitern der grossen Würfe machte den Weg frei, um die leer stehenden Gebäude mit Zwischennutzungen zu belegen. Was zunächst als Verlegenheitslösung erschien, trug im Rückblick Entscheidendes zur definitiven Gestalt des früheren Industrieareals bei. Die provisorischen Nutzungen wurden zu Keimzellen neuen Lebens in den leeren Gebäuden und haben die Öffentlichkeit für das Areal sensibilisiert. Pionier war das damalige Technikum, das 1992 seine Architekturabteilung in die Halle 180 verlegte – und damals noch nicht ahnte, dass die Schule als Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) hier dereinst einen ihrer drei Hauptstandorte aufbauen wird. «Dank den Zwischennutzungen ist das Areal nie gestorben», bilanziert Fridolin Störi. Dabei habe die Bauverwaltung die geltenden Gesetze extensiv ausgelegt und bei Umnutzungen nicht auf die sofortige Einhaltung etwa der Wärmedämmvorschriften gepocht (wohl aber auf die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften). Hingegen habe sie ein Konzept verlangt, mit dem aufzuzeigen war, wie die nötigen Dämmwerte innerhalb von zehn Jahren erreicht werden konnten. Dadurch blieben die Investitionen in einem erträglichen Rahmen und verteilten sich auf einen längeren Zeitraum. So konnte das langgestreckte ehemalige Lager der Gussmodelle an der Strasse Zur Kesselschmiede in kleinere Einheiten unterteilt werden, in denen sich viele Kleinfirmen, darunter etliche Architekturbüros, eingemietet haben.
Zusammenarbeit lernen
Auch Sulzer Immobilien, denen der Abschied von den Grossprojekten nicht leicht gefallen ist, ist heute darüber nicht unglücklich: Das Zusammenspiel von Alt und Neu gibt dem Areal ein Label, mit dem es sich von der Konkurrenz abheben kann. Das freut auch den Stadtentwickler Mark Würth: «Zwischennutzungen wie Block-Tempodrom oder die Cityhalle sind die beste Promotion für das Gebiet.» Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Sulzer Immobilien beurteilen beide Seiten unter ihrem Blickwin-
kel. Der Stadtplaner Ruedi Haller unterstreicht, dass man den Umgang miteinander zuerst lernen musste, dass er heute aber reibungslos funktioniere. Dabei müsse die Rollenverteilung klar sein: «Ich kann nicht plötzlich Land verkaufen, Sulzer kann nicht plötzlich Stadtplanung machen.» Zufrieden äussert sich auch Fridolin Störi; er schätzt es, dass Martin Schmidli als Leiter von Sulzer Immobilien Ingenieur ist: «Er versteht etwas vom Bauen, kann aber auch rechnen.» Die Chefbeamten der wichtigsten Ämter –die Stadtplanung, später auch die Stadtentwicklung, die Baupolizei und die Stadtgestaltung mit der Denkmalpflege seien stets in den Entscheidungsprozess einbezogen worden, oft als Jurymitglieder oder Fachexperten. Genau diese Vielfalt hat Walter Muhmenthaler irritiert; die Stadt trete mit vier beteiligten Ämtern zu heterogen auf: «Ich hätte eine stärkere Hand erwartet», meint er, gesteht aber auch, dass er ein ungeduldiger Mensch sei, der lernen musste, dass politische Prozesse lange dauern. «‹Megalou› hat gezeigt, dass ein gutes Projekt zehn Jahre bis zur Baureife braucht», – und dann trotzdem scheitern kann. Andererseits hätten die Mühlen durchaus schneller laufen können, wenn der Markt den Druck behalten hätte.
Denkmal hindert Nutzung nicht
Einen Meilenstein der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und Sulzer markierte 2003 die Vereinbarung über die Schutzobjekte und den Schutzumfang. Diese regelt, was definitiv geschützt und was nach Möglichkeit zu erhalten ist und welche Teile abgebrochen werden dürfen. Peter Arbenz leitete die Arbeitsgruppe, die ein Dokument schuf, das schliesslich die Stadt, die kantonale Baudirektorin, Sulzer, der Heimatschutz und die Denkmalpflegen von Stadt und Kanton unterzeichneten. Das Papier ist ein Kompromiss, bei dem alle Beteiligten von ihren Maximalforderungen abrücken mussten. Dafür hat die Denkmalpflege die Gewissheit, dass wertvolle Bausubstanz und Stadträume im Areal erhalten bleiben. Sulzer Immobilien erhält im Gegenzug die Planungssicherheit, die nötig ist, um weitere Investoren an das Areal zu binden, weshalb sie auch gut zu dem Ergebnis stehen kann. Die Vereinbarung legt zwar fest, was in welchem Umfang zu erhalten ist, die Frage, wie die geschützten Hallen genutzt werden sollen, beantwortet sie freilich nicht. Eine der Knackpunkte ist die ehemalige Grossgiesserei mit den Hallen 52/53 am Katharina-Sulzer-Platz. Eine Testplanung hat kürzlich aufgezeigt, dass sich die grössere Halle 53, die zurzeit als Autoabstellplatz dient, integral erhalten lässt, wenn dafür die Nutzung bei der Halle 52 kompensiert werden kann. Dies löst zwar noch nicht die Frage nach dem künftigen Zweck der Halle 53, aber es entlastet sie vom Renditedruck. Ähnliche Fragen werden sich bei der definitiven Nutzung des ‹Rundbaus› stellen, der ab 1931 als Halle 87 erstellt wurde. «Wer hätte gedacht, dass der Rundbau, den ein namenloser Zeichner geplant hat, dereinst fast Kultstatus erhält», schmunzelt Fridolin Störi über die ‹Karriere› des in rote Schindeln gekleideten Baus. Seit 1993 wurde er sporadisch für Musical-Aufführungen genutzt, heute hat er sich als Cityhalle als Ort für Musicals und Veranstaltungen etabliert. Wie dieses Schmuckstück des neuen Bauens definitiv genutzt werden soll, ist noch ungewiss, die denkmalpflegerischen Hürden sind hier
Beim genauen Hinschauen entfalten die alten Industriebauten ihre gestalterischen Qualitäten, so die Hallen 11 (links) und 9.



Technopark I 17

Überbauung Kranbahn I 20
Die Decken, Stützen und Treppen des alten Gebäudes blieben erhalten, neu sind die Zwischenwände, Sanitärkuben und der Lift. Auf dem alten Flachdach sitzt ein zweigeschossiger gläserner Aufbau. Er nimmt, um eine Achse verschoben, das Stützenraster des Altbaus auf und demonstriert mit seiner Verschiebung den Aufbruch.
--› Adresse: Jägerstrasse 2
--› Fertigstellung: 2001
--› Bauherrschaft: Technopark Winterthur (Handelskammer und Arbeitgebervereinigung W’thur, ZHW, Stadt)
--› Architektur: Dahinden und Heim, Winterthur
--› Kosten: CHF 7,62 Mio.
Entlang der bestehenden Kranbahn steht ein Neubau, der die ehemalige Giesserei einbezieht. Das Loftgeschoss im 6. Stock übernimmt die Traufhöhen der Nachbarn und die Gliederung des ursprünglichen ‹Megalou›-Projektes.
--› Adresse: Katharina-Sulzer-Platz
--› Realisierung: 2002–2004
--› Bauherrschaft: Winterthur Versicherungen, Real Estate Management, Winterthur
--› Architektur: Kaufmann van der Meer & Partner, Zürich
--› Totalunternehmung: Implenia
--› Nutzung: 114 Wohnungen, Gewerbeund Dienstleistung
--› Bauvolumen: 84 400 m³

Pionierpark 21
Umbau eines Industriegebäudes zum Büro- und Geschäftshaus mit zweigeschossigem, klar abgesetztem Aufbau in Stahl und Glas; rückwärtiger fünfgeschossiger Neubau aus Sichtbeton. Eine neu geschaffene Passage ver bin det die Strasse mit dem Innenhof.
--› Adresse: Zürcher- / Pionierstrasse
--› Realisierung: 2003
--› Bauherrschaft: SGI, vertreten durch Intershop Management Winterthur
--› Totalunternehmer: Allreal GU, Zürich
--› Generalplaner: Büro Schoch, W'thur
--› Architektur: Nil + Hürzeler, Erlenbach
--› Nutzung: Ausbildung, Büros, Praxen, Läden im EG
--› Investitionsvolumen: CHF 25 Mio.
Freiraumgestaltung 22

Aus dem industriellen wurde ein städtischer Freiraum, kein Park. Die Eingriffe sind prägnant wie das Baumdach oder behutsam wie die Pfützen, in denen sich das Rostwasser sammelt. Die Industrie bleibt spürbar. Foto: Ralph Feiner
--› Adresse: Sulzer-Areal
--› Realisierung: 2004
--› Bauherrschaft: Sulzer Immobilien, Winterthur Leben, Crédit Suisse Real Estate Management
--› Landschaftsarchitektur: Vetsch Nipkow Partner, Zürich
--› Lichtplanung: Vogt + Partner, W’thur
--› GU: Implenia, Dietlikon
--› Kosten: CHF 5 Mio. für sichtbare Eingriffe im Plangebiet
Bauten und Projekte auf dem Areal
Gebäude im Sulzer-Besitz
Grundstück im Sulzer-Besitz
früherer Sulzer-Besitz, verkauft
Neubauten und Umbauten realisiert / im Bau
Projekte
0 realisiert / im Bau 0 in Planung
Wohnen
Kultur und Bildung
Parks, Plätze, Strassengestaltung
Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung
9 Stadler Winterthur, ehemaliges Werk
1 der Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik, ab 1872, einzige noch von der Industrie genutzte Halle
10 Halle 180, Architekturabteilung
ZHW, H. Eppler / S. Mäder, 1991
11 Werkhaus Zürcherstrasse, 1998 (Seite 29)
12 City-Halle (Halle 87) mit Zwischennutzung, 1999
13 Lofts G48, Baldinger Arch., 2000 (S. 29)
14 Ausbildungszentrum, Markus Bellwald, 2002 (Seite 29)
15 Block-Tempodrom (Halle 193) mit Zwischennutzung, ab 2001
16 Sanierung Arbeiterhäuser Jägerstrasse, A.&V. Amsler, 2002 (Seite 29)
17 Technopark I, Dahinden und Heim, 2002 (Seite 31)
18 Zur Kesselschmiede, Architekten Kollektiv, 2003
19 Umbau Sulzer-Konzernsitz, Burkhalter Sumi, 2003
20 Kranbahn I, Kaufmann van der Meer & Partner, 2004 (Seite 31)
21 Pionierpark, Nil + Hürzeler, 2004 (S. 31)
22 Freiraumgestaltung, Vetsch Nipkow Partner, 2004 (Seite 31)
23 Überbauung Lokomotive, Fickert und Knapkiewicz, 2006 (Seite 33)
24 Umbau Sulzer-Hochhaus, Unirenova, 2007
25 Überbauung Sieb-10, Kaufmann van der Meer & Partner, 2007 (Seite 33)
26 Testplanung Halle 9/10/11, 2006 (ehem. ‹Megalou›, Jean Nouvel)
27 Testplanung Halle 52/53, 2006
28 Projekt Werk 2, A2017 Arch., (Seite 33)
29 Projekt Kesselhaus, A2017, (Seite 33)
30 Projekt Technopark II
31 Projekt Kranbahn II, Kaufmann van der Meer & Partner
32 ZHW-Campus Lagerplatz-Areal
35 Überbauung Ninck-Areal (Seite 37)






➞ besonders hoch. Konflikte zwischen Nutzung und Denkmalschutz zeigen sich auch beim Kesselhaus, das 1955 als letzter Grossbau an der Spitze des Sulzer-Areals entstand: Für die Belebung des Stadtteils wäre es wichtig, hier ein attraktives Eingangstor zu schaffen, und das geplante Multiplexkino hätte durchaus das Potenzial, viel Publikum anzulocken, doch haben die Behörden ein Baugesuch kürzlich aus denkmalpflegerischen Überlegungen zurückgewiesen. Für das Areal der Hallen 9, 10 und 11, wo einst Jean Nouvels ‹Megalou› geplant war, konnte die Testplanung soeben abgeschlossen werden.
Fazit: Im Grundsatz positiv
Mit dem bisher Erreichten sind die Akteure zufrieden. Fridolin Störi freut sich an den überdurchschnittlichen Lösungen, wie bei der Überbauung Kranbahn am KatharinaSulzer-Platz, vor deren Hintergrund das Durchschnittliche, das es auch gebe, in den Hintergrund trete. Das Areal entwickle sich anders als von Sulzer gedacht – statt eine Monokultur mit hunderten neuer Büroarbeitsplätze sei ein gut durchmischter Stadtteil mit Wohnungen, Büros und zahlreichen Schulbauten am Entstehen, wie dies in der baurechtlichen Grundordnung für das Sulzer-Areal Stadtmitte bereits 1993 aufgezeigt worden sei. «Das Sulzer-Areal ist heute ein bekannter Anziehungspunkt mit attraktiven Umnutzungen», sagt der Bausekretär. Einen weiteren Pluspunkt sieht Mark Würth in der Funktion des Sulzer-Areals als Scharnier zwischen der Innenstadt und Töss, dem einstigen Arbeiterquartier: «Ein attraktiver, beleb ter Stadtteil könnte auch bis ins benachbarte Töss ausstrahlen, das heu te mit vielfältigen Problemen zu kämpfen hat.» Auch Walter Muhmenthaler registriert eine positive Entwicklung – die Arbeitermentalität sei am Verschwinden, die Stadt werde jünger und dynamischer. Dies ist sicher auch der ZHW zu verdanken, die ihre Präsenz insbesondere im Sulzer-Areal noch kräftig ausbauen möchte und zahlreiche junge Leute in die Stadt zieht. Einigkeit herrscht auch bei den Schwächen des Areals: In den Erdgeschossen gibt es noch zu wenig öffentliche Nutzungen, und die vorhandenen haben mit dem Umsatz zu kämpfen. Noch fehlt eine gute Verbindung mit der Altstadt und dem Bahnhof, wie sie das Projekt Gleisque rung im Rahmen des Masterplans Bahnhof bringen soll (Seite 21) Mark Würth bedauert es, dass die Qualitäten des Areals hinter den denkmalgeschützten Mauern von aussen (noch) kaum zu sehen sind. Alle sind sich einig, dass dem Umbau des Kesselhauses – ebenfalls Teil des Masterplans Bahnhof – eine zentrale Bedeutung zukommt. Im Grunde hätte die Entwicklung hier, vom Kopf her, beginnen sollen, meinen Stadtplaner und Bausekretär. Doch weil das Kesselhaus zunächst noch in Betrieb war, entschied sich Sulzer, im Innern des Areals und entlang der Zürcherstrasse erste Keimzellen neuen Lebens zu setzen. Wo wird das Sulzer-Areal in zehn, zwanzig Jahren stehen? Mark Würth erwartet, dass das Gebiet dann weit gehend überbaut sein wird. Walter Muhmenthaler macht die Entwicklung von der wirtschaftlichen Lage abhängig: «In Winterthur muss man sich nach dem Markt strecken», doch auch er sieht die Entwicklung positiv. Stadtplaner Ruedi Haller schliesslich fragt sich, ob man sich in zwanzig Jahren nicht plötzlich doch frage, ob man nicht zu viel abgebrochen habe. Darüber wird die nächste Generation urteilen, doch eines ist gewiss: Hätte man ‹Winti-Nova› realisiert, wäre dieser Zeitpunkt längst gekommen. •

Wohnüberbauung Lokomotive 23

Überbauung Sieb-10 25
Auf dem Areal des Werks 2 der Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik entstehen unterschiedliche Wohnungen vom 1 ½-Zimmer-Atelier bis zur mehrgeschossigen 6 ½-Zimmer-Wohnung. Die Montagehalle 1050 wird in die Überbauung mit einbezogen.
--› Adresse: Agnes- / Obere Briggerstr.
--› Realisierung: 2006
--› Bauherrschaft: CPV / CAP Coop Personalversicherung, Basel
--› Architektur: Knapkiewicz & Fickert, Zürich
--› Generalunternehmung: Implenia
--› Nutzung: 111 Wohnungen, 9 Ateliers
--› Bauvolumen: 68 500 m³
--› Investitionsvolumen: CHF 32 Mio.
Die Wohnüberbauung ersetzt eine alte Produktionshalle. Sie vervollständigt die Raumkante zur Pionierstrasse, und im Innern entsteht eine Platzfolge. Die gemischte Nutzung belebt das Quartier.
--› Adresse: Zürcherstrasse
--› Stand: im Bau, fertig 2007
--› Bauherrschaft: Immobilien-Anlagestiftung Turidomus, Zürich
--› Entwickler / TU: Karl Steiner AG, Zch.
--› Erstvermietung: Karl Steiner AG
--› Architektur: Kaufmann van der Meer & Partner, Zürich
--› Nutzung: 106 Wohnungen, 12 Ateliers, 1625 m² Dienstleistung, 159 PP
--› Bauvolumen: 112 000 m³
--› Investitionsvolumen: CHF 56 Mio.

Einkaufszentrum Werk 2 28

In das 1904 erbaute Werk 2 der Schweiz. Lokomotiv- und Maschinen fabrik soll ein Einkaufszentrum eingebaut werden. Die markante Backsteinfassade an der Zürcherstrasse bleibt erhalten. Hinter den alten Fassaden entsteht jedoch ein kompletter Neubau, der die Anforderungen an ein zeitgemässes Einkaufszentrum erfüllt.
--› Adresse: Zürcherstrasse
--› Projektstand: Baubewilligung erteilt
--› Grundstück: Sulzer Immobilien AG
--› Investor / TU: Kamata Real AG, Baar
--› Architektur: A2017 Architekten, Zürich
--› Nutzung: Verkauf, Lager, Parking
--› Nutzfläche: 15 140 m²
Das Kesselhaus von 1956 ist der letzte und markanteste Industriebau auf dem Sulzer-Areal. Als Einkaufs- und Unterhaltungszentrum ‹Galeria Trocadero› wird das Kesselhaus einen attraktiven Auftakt zum Sulzer-Areal bilden.
Den Knackpunkt bilden denkmalpflegerische Fragen: Wie viel muss erhalten blei ben, wo kann eingegriffen werden?
--› Adresse: Zürcherstrasse
--› Projektstand: in Überarbeitung
--› Grundstück: Sulzer Immobilien AG
--› Investor / TU: Kamata Real AG, Baar
--› Architektur: A2017 Architekten, Zürich
--› Nutzung: Verkauf, Gastro, Kino, Lounge, Bar
--› Nutzfläche: 12 040 m²


Text: Roderick Hönig
Fotos: Michael Lio
Seite 34-35 2006 wird die grösste Halle Winterthurs abgebrochen, um einem Wohnund Arbeitsquartier Platz zu machen.
‹Am Eulachpark› (vorne) und ‹Zum Park› heissen die Wohnüberbauungen, die zurzeit am Rand des Sulzer-Areals entstehen.
Nach der erfolgreichen Umnutzung des Areals Stadtmitte, nimmt Sulzer die Entwicklung ihres zweiten Standorts in Oberwinterthur (Oberi) an die Hand. Auf dem 600 000 Quadratmeter grossen Industrieareal soll ei ne Wohn-, Dienstleistungs- und Parklandschaft entstehen. Im November 2005 haben die Stimmbürger grünes Licht für die Initialzündung gegeben, ein 60 000 Quadratmeter grosser Volkspark.
Im März 2006 ist er gefallen, der letzte Industriezeuge auf dem Sulzer-Areal in Oberwinterthur. Stück für Stück haben die Arbeiter die gewaltige ehemalige Giessereihalle demontiert. Peinlich genau haben sie Stahl, Stein und Glas für die Entsorgung auseinander sortiert. Pendler aus der Ostschweiz konnten das Fortschreiten des Rückbaus aus dem Zug verfolgen, den anderen wurde die Geschichte des Stahlgebildes in der Zeitung nacherzählt: Im grössten Gebäude Winterthurs (220 auf 147 Me ter) haben 1959 bis 1993 etliche Arbeiter mit Schweissperlen auf der Stirn autogrosse Maschinenteile gegossen. Sie wurden zu Schiffsmotoren zusammengesetzt, die später die Weltmeere durchpflügten. Anfang der Neunzigerjahre wurden die Ar beiten in der Halle eingestellt. Der Niedergang des Industriekonzerns zwang Sulzer 1995 dazu, den Stadtbehörden die vollständige Aufgabe des Industriestandorts mitzuteilen. Das Schicksalsjahr bedeutete das Ende von Sul zer
Das 60 Hektaren grosse Industrieareal liegt am östlichen Stadtrand von Winterthur, eingeklemmt zwischen den Schenkeln der beiden Bahnstrecken von Winterthur nach Frauenfeld und von Winterthur nach St. Gallen. Rundherum grenzen Wohnquartiere und gesichtslose Gewerbegebiete mit Grossmärkten ans Areal. Die S-Bahnstationen Oberwinterthur und Winterthur Grüze liegen in unmittelbarer Nähe – in nur drei Minuten reist man von hier aus ins Stadtzentrum. Der dritte S-Bahnhof, Winterthur Hegi, ist im Bau und wird Ende 2006 eröffnet. In der Mitte durchschneidet die tiefer gelegte Seenerstrasse das Areal in einen östlichen und einen westlichen Teil.
Die 60 Hektaren sind mit öffentlichem und privatem Verkehr sehr gut erschlossen. Zwei Drittel sind heute noch Industriegebiet. Hauptsächlich im westlichen Bereich konzentriert, arbeiten mehr als 1500 Menschen in über 50 verschiedenen Firmen aus den Bereichen Life-Science, Umwelttechnik oder Maschinenbau. Es sind Sulzer-Töchter und -Buyouts wie die Unternehmen Zimmer oder Wärtsilä Schweiz aber auch wie Maag Gear und Burckhardt Compression. Auf der anderen Seite der Seenerstrasse ist kein industrielles Leben mehr zu finden. Wer einen Spaziergang durch diesen Teil wagt, muss sich auf eine trostlose Wanderung durch unwirtliches Industriebrachland einstellen. Es braucht einiges an Fantasie, sich vorzustellen, dass hier in zehn bis fünfzehn Jahren 3000 bis 4000 Menschen wohnen und 2000 arbeiten sollen. Noch führt der Weg von Baugruben zu Abbruchhalden vorbei an verlassenen Fertigungshallen. In den leer stehenden Gebäuden und Hallen haben sich wild zusammenge-

Die Geschichte des Sulzerparks Oberwinterthur, wie Marketingleute das Areal umgetauft haben, ist lang und kurz zugleich. Lang, weil man sich heute kaum vorstellen kann, dass hier einmal urbanes Leben pulsieren soll. Kurz, weil erst vor elf Jahren die Grundstückeigentümerin und Behördenvertreter zum ersten Mal zusammengesessen sind, um die Rahmenbedingungen für den neuen Stadtteil festzulegen. Erster Schritt zur Öffnung der Industriestadt war die baurechtliche Umzonung in eines von elf kantonalen Zentrumsgebieten. Gleichzeitig haben Stadt und Sulzer einen Erschliessungsvertrag abgeschlossen. Diese Abma chung regelt einerseits, wo welche Strassen gebaut werden sollen, aber auch, welche neuen Strassen Sulzer baut und unterhält und welche die Stadt oder der Kanton. 2001 konnten die Grundstückeigentümerin und die Behörden den nächsten Schritt in Richtung gemischt genutztes Stadt quartier machen: Sie verabschiedeten den Rahmenplan Oberwinterthur. Er legt Freiräume und bebaubare Flächen fest. Er definiert auch, welche Nutzungen in welcher Dichte an welchem Ort auf dem ehemaligen Industrieareal möglich sind.
Initialzündung Eulachpark
Neuralgischer Punkt des Rahmenplans ist der ‹EulachparkHandel›. Er kann mit ‹öffentlicher Park gegen höhere Ausnutzung› übersetzt werden. Konkret: Sulzer gab 60 000 Quad ratmeter Land kostenlos an die Stadt ab, diese versprach, daraus einen Park zu machen. Im Gegenzug haben die Behörden den Freiflächenanteil auf den restlichen 540 000 Quadratmetern Bauland von 20 auf 10 Prozent reduziert. Der Park soll das Zentrum werden, aber auch grüne Ost-West-Verbindung der Wohnquartiere Oberwinterthur und Hegi. Wie vor über 100 Jahren in Manhattan und vor ein paar Jahren in Neu-Oerlikon ist er aber nicht nur ein sozialer Akt, sondern auch Investitionsbeschleuniger. Der neue ‹Central Park von Oberwinterthur› soll die Wohnund Arbeitsplatzqualität des neuen Stadtteils erhöhen und Investitionen anziehen. Die Rechnung scheint aufzugehen, bereits sind rund um den künftigen Park 500 Wohnungen in Bau oder zumindest in Planung. Der Landschaftsarchitekt Stefan Koepfli aus Luzern, der den Wettbewerb 2001 gewann, schlägt einen weitläufigen Volkspark vor, der viele Nutzungen gleichzeitig zulässt. Der ‹Eulachpark› ist ein weitläufiger Landschaftspark, der die Tradition der Gartenstadt weiterschreibt. Rückgrat des Entwurfs bildet der 450 Meter lange ‹Eulachstrand›, das auf einer Seite abgeflachte Ufer des Flüsschens Eulach. Koepfli unterteilt die Fläche in vier Bereiche. Der grösste ist der Parkteil Ost (2006 / 07). Er soll zum Picknicken, Lesen und Sitzen einladen. Der Parkteil Mitte (2008 / 09) wird die bereits bestehende Fussballwiese umspülen. Sie definiert auch seine Funktion: Hier kann man kicken, Drachen steigen lassen, Zelte aufstellen und vieles mehr. Der nahe am Bahnhof gelegene Parkteil Nord (2010 / 11) soll ein Flaniergarten für die Mittagspause werden. Der Charakter des Parkteils West (ab 2015) ist noch offen. Er liegt auf der anderen Seite der Seenerstrasse und soll mit den anderen Bereichen verbunden werden.
Wie einen neuen Stadtteil bauen?


Die Überbauung von Burkhalter Sumi besteht aus zwei langen Baukörpern, dem mittleren und dem östlichen Riegel. Darin gibt es sechs Wohnungstypen, auch Maisonetten. Die Wohnungen im 1. und 2. OG sind durch eine Rue intérieure erschlossen, die anderen Wohnungen durch ein Treppenhaus.
--› Adresse: Am Eulachpark 11–49
--› Bauherr: Immobiliengruppe der Crédit Suisse Anlagestiftung, Zürich
--› Architektur: Burkhalter Sumi, Zürich
--› Totalunternehmer: Halter Generalunternehmung AG, Zürich
--› Auftragsart: Direktauftrag 2004
--› Anzahl Wohnungen: 80
--› Baukosten: ca. CHF 27 Mio.
Am Eulachpark II (Lofts, Eigentum) 35
Novaron haben die zwei Punkthäuser und den westlichen Riegel geplant. Die drei Baukörper sind drei- bis sechsgeschossig. Alle Innenräume sind nach Wunsch der Bauherrschaft flexibel einteilbar. Ihr Loftkonzept konnten die Architekten schon acht Mal umsetzen.
--› Adresse: Am Eulachpark 1–9
--› Bauherrschaft: Fincasa, Uitikon bzw. Stockwerkeigentümer
--› Architektur: Novaron Eicher Hutter Gepp, Diepoldsau
--› Totalunternehmer: Halter Generalunternehmung AG, Zürich
--› Auftragsart: Direktauftrag 2004
--› Anzahl Wohnungen: 30
--› Baukosten: ca. CHF 12,5 Mio.


Die beiden parallelen Sichtbacksteinbauten haben beide drei Geschosse. Darauf liegt noch ein Attika-Geschoss. Jeweils 24 Wohneinheiten sind darin untergebracht. Drei Treppenhäuser pro Bau erschliessen die ‹DurchschussWohnungen›, die immer Ost-West orientiert sind. Im ruhigen Hof liegen der Spielplatz und die Gärtchen der Erdgeschosswohnungen.
--› Adresse: Hegifeldstrasse 26 und 28
--› Bauherrschaft: Bautex, Wil
Weil das Sulzer-Areal Oberwinterthur im Vergleich zum Areal Stadtmitte kaum Industriezeugen aufweist, die man heute schon als schützenswert betrachtet, entwickelt Sulzer nicht die bestehende Baustruktur weiter, sondern ➞
--› Architektur: Maurice Müller, Hagenbuch
--› Auftragsart: Direktauftrag
--› Anzahl Wohnungen: 48
--› Anlagekosten: CHF 21 Mio.
Der Eulachhof ist die erste NullenergieWohnüberbauung der Schweiz und bildet den Auftakt zur Entwicklung des Quartiers. Das Projekt ist als Blockrandbebauung mit Innenhof konzipiert.
--› Adresse: Else Züblin-Strasse / Barbara Reinhart-Strasse, Winterthur
--› Bauherrschaft: Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft, Zürich, Profond Vorsorgeeinrichtung, Rüschlikon
--› Projektentwickler und TU: Allreal Generalunternehmung, Zürich
--› Architektur: Dietrich Schwarz, GlassX, Zürich
--› Anzahl Wohnungen: 136 (Miete)
--› Baukosten: rund CHF 55 Mio.
➞ hat sich dafür entschieden, sie von Grund auf mehr oder weniger neu zu definieren. Für die Umsetzung des Rahmenplans in ein Bebauungskonzept hat das Unternehmen das Zürcher Architekturbüro Dürig und die Berliner Landschaftsarchitekten Topotek1 engagiert. Zusammen haben sie vor allem den östlich der Seenerstrasse gelegenen Bereich gestaltet.
Rückgrat ist die 30 Meter breite Sulzer-Allee mit ihrer geschlossenen Mantellinie. Sie definiert den Strassenraum und verbindet Zentrumszone und Industriegebiet. Einzelne Pocketparks oder Plätze sind in den Strassenzug eingeschoben. Im Erdgeschoss sind öffentliche Nutzungen wie Läden, Schulen und Restaurants vorgesehen; den Planern schwebt ein dichter, gemischt genutzter Stadtteil vor. In den blockartigen Volumen sollen Gebäude unterschiedlicher Architektur ineinander verschachtelt werden. Die grossen Parzellen und die in den Belag eingelegten Stahlbänder und metallenen Entwässerungsrillen sollen an den Charakter des früheren Industriequartiers erinnern. Das sorgfältige Bebauungskonzept und die Gestaltung des Strassenraums zeichnen ein verheissungsvolles Bild des neuen Stadtquartiers. Seine Feuertaufe hat es schon bestanden: Auf einem 11 500 Quadratmeter grossen Grundstück liess sich Allreal davon überzeugen, das Baufeld blockrandartig zu überbauen. Bis 2008 sollen im ‹Eulach-
Im westlichen Teil des Areals produziert die Industrie noch immer, zum Teil in Betrieben, die aus der Sulzer hervorgingen.
hof› fast 15 000 Quadratmeter Wohnungen und auf Strassenniveau 660 Quadratmeter Ladenfläche entstehen. Die Entwicklungen im grossen Bruder des Sulzerparks, dem Zürcher Stadtteil Neu-Oerlikon, haben aber gezeigt, dass grosse Parks und viele Wohnungen noch nicht reichen, um einem neuen Stadtquartier Leben einzuhauchen. Für ein attraktives Quartierleben braucht es eine ‹Beiz› und einen Kiosk an der Kreuzung sowie den italienischen Pasta-Laden an der Ecke. Bei zu kleiner Nachfrage und eingeschränktem Parkplatzkontingent lässt sich jedoch kein Gastronom oder Friseur davon überzeugen, sein Geschäft in einem Wohnquartier aufzumachen, das erst in 15 Jahren zu voller Blüte erwacht.
Ob sich der Erfolg, den Sulzer mit der Entwicklung des Areals Stadtmitte vorweisen kann, auch in Oberwinterthur wiederholen lässt, ist ungewiss. Zwar sind die baurechtlichen Voraussetzungen und die städtebaulichen Vor züge gross, doch wenn sich kein Gross-Nutzer findet, mit dem sich die kritische Grösse zum städtischen Subzent rum er reichen lässt, läuft der ‹Eulachpark› Gefahr, das Schicksal der menschenleeren Parks in Neu-Oerlikon zu erleiden, das heisst, nie zu einem Volkspark zu werden. •
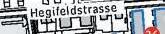
Bauten und Projekte auf dem Areal
Gebäude in Sulzer-Besitz
Grundstück in Sulzer-Besitz früher in Sulzer-Besitz, verkauft Neubauten und Umbauten realisiert / im Bau
Projekte
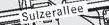



0 realisiert / im Bau 0 in Planung Wohnen
Kultur und Bildung Parks, Plätze, Strassengestaltung
33 Internationale Schule, 2002
34 Am Eulachpark I, 2006 (Seite 37)
35 Am Eulachpark II, 2006 (Seite 37)
36 Zum Park, 2006 (Seite 37)
37 Christengemeinde, 2006
38 Eulachhof (Seite 37)
39 Gestaltung der Strassen und Plätze im neuen Quartier
40 Park Oberwinterthur
72 Talwies, Scheco-Areal (Seite 17)

Text: Werner Huber und Caspar Schärer
Im Schatten der grossen Industrieareale von ‹Sulzer Stadtmitte› und ‹Oberwinterthur› wandeln sich weitere ehemals industriell genutzte Flächen. Und mit der ‹Stadtmitte Süd› macht seit kurzem ein Gebiet von sich reden, das bislang ein Dornröschendasein fristete.
Neben den grossen Sulzer-Industriearealen gibt es noch eine Reihe weiterer Flächen, die die Industrie verlassen hat und die jetzt einer neuen Nutzung zugeführt werden. Eines der zentralen Gebiete ist das Volg-Areal beidseits der Gleise nördlich des Bahnhofs. Hier stand die markante ‹Volg-Banane›, ein Lagerhaus, das sich der Verband Ostschweizerischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften 1951 baute und das seine geschwungene Front mit den schmalen Bandfenstern den Gleisen anschmiegte. 1996/97, als sich die Aufmerksamkeit auf das Sulzer-Areal konzentrierte – das damals nicht vom Fleck kam –, baute die in Winterthur verankerte Siska allen Unkenrufen zum Trotz die Banane zum Hotel ‹Banana City› mit 144 Betten um. Mit Ausnahme der soliden Tragstruktur und also der Grundform blieb vom Altbau wenig übrig; denkmalpflegerische Auflagen gab es keine. Übrigens sei die Denkmalpflege der Grund, weshalb die Siska beim Sulzer-Areal nicht mitgemacht habe, erzählt ihr Präsident Robert Heuberger: Ihm stehe dort zu viel unter Schutz, das verunmögliche vernünftige, rentable Lösungen.
Dem gegenüber ist die ‹Banana-City› äusserst rentabel und wich tig für die Stadt dazu: Fast 60 000 Personen haben 2005 die Banane besucht, als Hotelgäste oder Besucher von Veranstaltungen im Festsaal und den Konferenzzimmern. Die Banane ist so erfolgreich, dass Heuberger das Hotel ins denkmalgeschützte Gebäude des Volgs ausbreitete und zusätzliche Betten im Vierstern-Bereich schuf.
Wer in der Banane zu den Gleisen hin wohnt, blickt auf den anderen Teil des Volg-Areals an der Theaterstrasse. Hier dauerte es etwas länger, bis das Alte dem Neuen wich, doch inzwischen ist die letzte Etappe der von Burkard, Meyer Architekten projektierten Überbauung fertiggestellt. Den Anfang machte 1999 das Hochhaus, das sich die damalige Telecom PTT baute und das die Swisscom später an die Swiss Prime Site verkaufte. Dann folgte ein Bürohaus als Teil der am Fuss des Turms mäandrierenden Flachbauten und schliesslich der ZHW-Mäander, der das Areal gegen das benachbarte St.-Georgen-Schulhaus abschliesst und in unmittelbarer Nähe des einstigen Volkart-Rundbaus diesen Standort der Hochschule stärkt (Seite 8)
Aus Brauen und Weben wird Wohnen Ein alteingesessener Winterthurer Betrieb war auch die Brauerei Haldengut. Doch seit einigen Jahren braut das zum Heineken-Konzern gehörende Haldengut sein Bier in Chur, und das Winterthurer Brauerei-Areal soll zum Wohnquartier in nächster Nähe sowohl zum Stadtzentrum als auch zum Grünraum des Lindbergs werden. Der Hochkamin und das Malzsilo werden als Zeugen der industriellen Vergangenheit erhalten bleiben, die übrigen Gebäude
Testplanung Stadtmitte Süd
Perimeter Freiraumkonzept
Wasserläufe
Bildung, Aufwertung öff. Räume
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Teuchelweiher
Wachterareal (Allmend, Zirkus)
Areal Obermühle (öffentl. Betriebe)
Reitweg-Viehmarkt (ev. Parkierung)
Kehracker (Aufwertung Bestand)
Zeughausareal (Freizeit, Wohnen)
Zeughauswiese (strateg. Reserve)
weichen den Neubauten mit 200 Wohnungen, Läden und Büroräumen. Bewegung soll bald auch auf das Sidi-Areal kommen. Hier wälzt die Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich seit Jahren Projekte, nun will sie noch 2006 mit dem Bau von 150 Wohnungen beginnen. Eine Planung im grösseren Massstab läuft im Gebiet Zeughaus – Teuchelweiher. Rund 45 Hektaren umfasst der Perimeter, der südlich der Altstadt an der Technikumstrasse beginnt und sich bis zum Waldheim am Fuss des Eschenbergs erstreckt. Von der dichten, zentrumsnahen Bebauung beim Technikum über Reiheneinfamilienhäuser bis zu Familiengärten, ist fast das ganze Spektrum städtebaulicher Muster im Planungsgebiet vertreten.
Eine Stadtmitte im Süden?
2003/04 erarbeiteten die Studierenden des Instituts Bauwesen und des Studiengangs Architektur der ZHW im Auftrag des Forums Architektur stadträumliche Entwicklungsstudien für das Gebiet, das unter der Bezeichnung ‹Stadtmitte Süd Winterthur› auch gleich einen prägnanten Namen erhielt. ‹Stadtmitte›, das überrascht zunächst, doch der Blick auf den Plan zeigt (Seite 24) , dass das Gebiet bezüglich Lage und Grösse ein Pendant zum Sulzer-Areal am anderen Ende der Altstadt bildet.
Ein grosser Teil des Areals gehört der öffentlichen Hand. Die Stadt baute hier ihr Feuerwehrgebäude, ein Park haus sollte entstehen, und weitere Interessenten warfen einen Blick auf die Gegend. Dieser Nutzungsdruck veranlasste die Stadt, ein Leitbild mit Richtlinien für die Entwicklung des Gebietes zu erarbeiten. Daraus entstand die Forderung nach einem übergeordneten Entwicklungskonzept. Im Herbst 2005 lancierte das Stadtplanungsamt eine Testplanung, die Aufschluss geben soll über die dortigen Potenziale und den Umgang mit den öffentlichen Räumen. Daran beteiligt sind Teams um die Zürcher Büros Pool Architekten, Quadra Landschaftsarchitektur und Büro Z. Der Planungsprozess findet nicht im stillen Kämmerlein statt, sondern bezieht im Rahmen von Workshops ein Begleitgremium aus stadtinternen und externen Experten mit ein. Zudem können ausgewählte Interessen- und Fachgruppen ihre Meinung in ‹Echoräumen› einbringen. Bis zum Sommer 2006 sollen erste Ergebnisberichte vorliegen. Wichtiger Auslöser für die Testplanung ist die Schaffung eines Entwicklungskonzeptes für die Freiräume. Im Planungsgebiet gibt es zahlreiche öffentliche Freiräume, die aber untereinander wenig vernetzt sind. Hinzu kommen die offenen oder eingedolten Bachläufe der Eulach und des Mattenbachs, die das Gebiet durchqueren. Der Umgang mit den Gewäs sern und die Verbindung der Freiräume untereinander und mit der Stadt ist eine der Fragestellungen der Testplanung. Ausserdem sind in das Gebiet mehrere Areale eingelagert, die für neue Nutzungen zur Verfügung stehen. So das Zeughausareal, aus dem sich der Bund zurückziehen wird, sowie das Wachterareal und der Viehmarkt, auf denen die heutige Parkierung nach dem Bau eines unterirdischen Parkhauses aufgehoben wird. Der wirtschaftliche Druck zur Neunutzung, wie er etwa bei den Sulzer-Arealen besteht, ist im Gebiet Zeughaus – Teuchelweiher nur teilweise vorhanden. Doch angesichts der zahlreichen Begierden drohen gerade solche Orte, sich im Schatten der ‹Grossen Projekte› zufällig und unkoordiniert zu entwickeln, wie es heute teilweise bereits der Fall ist. Die frühzeitige Planung kann dafür sorgen, dass die Chancen, die das Areal bietet, genutzt und nicht verpasst werden. •

In das ehemalige Volg-Lagerhaus an den Gleisen wurden das Hotel Banana City, Büros und ein Fitnesscenter eingebaut. Die Tragstruktur blieb erhalten, das Innere und die Fassade sind neu.
Dun kles Glas ist an die Stelle der früheren Bandfenster getreten. Eine Grünanlage ersetzt das Parkhaus im Hof. In einer zweiten Etappe wurde das Hotel ins angrenzende Gebäude erweitert.
--› Adresse: Schaffhauserstrasse 8
--› Fertigstellung: 1997
--› Bauherrschaft: Siska Heuberger Holding AG, Winterthur
--› Architektur: Zambrini Architekten, Effretikon, Nello Zambrini
--› Nutzfläche: 30 000 m²

Haldengut-Areal 44
Auf dem Brauerei-Areal entstehen Wohnungen, Läden und Büros; Malzsilo und Kamin bleiben erhalten. An der Rychenbergstrasse stehen dichte Zeilen, dahinter ist die Struktur durchlässiger.
--› Adresse: Rychenbergstrasse
--› Realisierung: 2006–2009
--› Bauherrschaft: Karl Steiner AG
--› Eigentümer: Haldengut Immobilien
--› Erstvermietung: Karl Steiner AG
--› Architektur: Atelier WW, Zürich (Ost), Marcel Ferrier, St. Gallen (West)
--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
--› Totalunternehmung: Karl Steiner AG
--› Anzahl Wohnungen: 213
--› Bauvolumen: 170 000 m³

In drei Etappen entstanden auf dem ehemaligen Volg-Areal das Hochhaus als neues Wahr zeichen der Stadt und zwei Mäander bau ten mit der ZHW zu dessen Füssen. Die Baukörper for mulieren ein neues Stück Stadt mit vielfältigen Aussen räumen. Foto: Reinhard Zimmermann
--› Adresse: Theaterstrasse
--› Fertigstellung: 1999 / 2002 / 2005
--› Eigentümer / Bauherrschaft: Swiss Prime Site (1. Etappe), Bellevue Bau (2. und 3. Etappe)
--› Architektur: Burkard, Meyer, Baden
--› Landschaftsarchitektur: Werner Rüeger, Winterthur
--› Wettbewerb: 1992
--› Investitionsvolumen: CHF 161,7 Mio.

Sidi-Areal 45
Die Überbauung des Sidi-Areals umfasst sieben Wohn- und Geschäftshäuser mit einem vielfältigen Wohnungsangebot. Die Bauten orientieren sich an der bestehenden Bebauungsstruktur; die Industriehalle wird durch ein Hofgebäude ersetzt. Kesselhaus und Hochkamin werden als Zeitzeugen restauriert.
--› Adresse: St. Gallerstrasse
--› Bauherrschaft: Beamtenversicherungskasse, vertreten durch die Liegenschaftenverwaltung und das Hochbauamt des Kantons Zürich
--› Architektur: A.D.P. Architektur Design Planung, Walter Ramseier
--› Landschaftsarchitektur: Kuhn Truninger Landschaftsarchitekten
Text: Meta Lehmann, Wüest & Partner
Winterthur wächst und gedeiht. Die Stadt positioniert sich erfolgreich als vollwertige und attraktive Wohnalternative – unter anderem zum Standort Zürich. Winterthur: eine grüne Stadt mit urbanem Angebot und ausgezeichneter Verkehrserschliessung und einer grossen Vielfalt an Neu- und Umbauten mit modernen Wohnungen.
Winterthur, die sechstgrösste Stadt der Schweiz nach Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne hat ihren gros sen Schwestern einiges an Bevölkerungsdynamik voraus. In den letzten zehn Jahren nahm die Bevölkerung um 6 Prozent zu, während Genf nur auf 3,3 Prozent Zuwachs kam und die anderen Grossstädte bestenfalls ihre Zahlen halten konnten. Seit 2003 erhöhte sich die Einwohnerzahl Winterthurs um fast 5000 Personen auf rund 95 000 per Ende 2005 – müssig zu sagen, dass diese Dynamik nicht durch Geburtenüberschüsse, sondern in erster Linie durch Zuzüge von ausserhalb der Gemeinde bestimmt wird.
Zielpublikum: «zahlungskräftig»
Und wer zieht in die Stadt an der Eulach? Betrachtet man die Veränderung der Altersstruktur der Winterthurer Bevölkerung seit dem Jahr 2000, zeigt sich: Die Kohorte der 40- bis 49-Jährigen ist am stärksten gewachsen. Doch diese Zunahme widerspiegelt hauptsächlich das Älterwerden der 30- bis 39-Jährigen, die 2000 die grösste Bevölkerungsgruppe ausmachten. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist gleichzeitig leicht gesunken. Deshalb muss angenommen werden, dass es entgegen der landläufigen Annahme nicht hauptsächlich Familien sind, die momentan nach Winterthur ziehen, als vielmehr Einzelpersonen und Paare. Diese Entwicklung wird die Vertreter der Stadtentwicklung freuen: Nun sollen nämlich vermehrt Wohnungen für ein zahlungskräftiges Publikum, das heisst vor allem Singles, Paarhaushalte ohne Kinder oder Personen in der Nachfamilienphase, erstellt werden. Tatsächlich zeigte sich bis vor drei Jahren eine klare Abwanderungstendenz der zahlungskräftigen Klientel der 45- bis 64-Jährigen, die nun gestoppt werden soll. Die Analyse der Altersstruktur zeigt ausserdem, dass heute rund 10 Prozent mehr junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren in Winterthur leben als im Jahr 2000. Sie scheinen massgeblich zum Bevölkerungswachstum beigetragen zu haben. Diese Tatsache steht auch in Zusammen-
hang mit der Entwicklung Winterthurs zur Bildungsstadt. Die Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) beispielsweise hat ihre Studierendenzahlen in den letzten 5 Jahren um einen Drittel oder um rund 600 Studierende gesteigert. Die Stadt und die ZHW bemühen sich durch die Unterstützung des Vereins SWOWI (Studentischer Wohnraum in Winterthur), Personen in Ausbildung günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Besass der Verein 1996 nur gerade 32 Wohnplätze, so stieg diese Zahl deutlich an und wird sich mit dem Umbau des ehemaligen Sulzer-Bürogebäudes an der Eduard-Steiner-Strasse in ein Studentenwohnhaus auf rund 170 Plätze erhöhen. Ab 2008 fasst der Verein einen Wohnplatzbestand von 285 ins Auge.
Kaum mehr Arbeitsplätze … Und wenn sie nicht mehr in Ausbildung sind, ziehen dann die Leute nach Winterthur, weil sie hier arbeiten? Die Zahlen der Betriebszählung 2005 sind zwar noch nicht zugänglich, gleichwohl lässt sich vermuten, dass trotz eines dynamischen Dienstleistungssektors nicht in erster Linie das Arbeitsplatzwachstum für den Bevölkerungszugang verantwortlich ist. Von 1998 bis 2001 hat zwar die Zahl der in Winterthur Beschäftigten um 3,8 Prozent zugenommen, damit konnten aber die über 6000 Arbeitsplätze, die seit 1991 verloren gegangen sind, bei weitem noch nicht kompensiert werden. Im Jahr 2001 gab es in Winterthur pro zehn Einwohner nur noch knapp sechs Beschäftigte. In Zürich hält sich die Zahl der Beschäftigten mit derjenigen der Einwohner weiterhin die Waage (Grafik 1 ) Ein weiteres Indiz dafür, dass nicht neue Arbeitsplätze für die Zunahme der Bevölkerung verantwortlich sind, ist der Büroflächenmarkt. Um die Jahrtausendwende wurde in Win terthur massiv in die Erstellung von Büroflächen investiert, entsprechend hoch waren die Angebotspreise, als diese neuen Objekte auf den Markt kamen. Doch seit 2002, als das mittlere Angebotspreisniveau der Büroflächen in Winterthur rund 16 Prozent über dem Schweizer Referenzwert lag, haben die Preise nachgegeben. Heute liegt der Mittelwert in Winterthur mit rund 200 Franken pro Quadratmeter im Jahr nur noch 5 Prozent über den 190 Franken pro Quadratmeter und Jahr, die im Schweizer Durchschnitt erreicht werden. Trotz einer geringen Investitionstätigkeit im Bürobereich in den letzten drei Jahren scheint in Winterthur also kein Mangel an Büroflächen zu herrschen. Mit dem markanten Wachstum des Bildungssektors werden vermehrt Büroräume gesucht, die dann als Schulungsräume genutzt werden.
… sondern mehr Wohnraum
Zurück zum Bevölkerungswachstum: Die Zuzüger kommen also weniger wegen einer Arbeitsstelle nach Winterthur, sondern weil sie die Stadt als Wohnort wählen: Sie bietet eine städtische Infrastruktur, vielfältige kulturelle Angebote, diverse Bildungsinstitutionen, eine ausgezeichnete Anbindung sowohl für den motorisierten wie auch den öffentlichen Verkehr, was das Pendeln zur Arbeitsstelle erleichtert. Doch was zum Wichtigsten zählt, wenn erfolgreich um die Gunst von potenziellen Neuzuzügern gebuhlt werden soll: Winterthur verfügt über ein wachsendes Angebot an vielfältigen, neuen Wohnungen. In den letzten zehn Jahren wurden in Winterthur im Durchschnitt pro Jahr rund 500 Wohnungen fertig gestellt. Dies entspricht einer Bautätigkeit von 1,1 Prozent des Bestands, was leicht über dem Schweizer Durchschnitt liegt.
Über die ganze Zeitspanne betrachtet, entfiel die Hälfte dieser neuen Wohnungen auf Eigentumswohnungen. Doch 2003 und 2004, als innert zweier Jahre rund 1800 Wohnungen fertig wurden, betrug der Anteil der Eigentumswohnungen nur ein knappes Drittel, 60 Prozent der Neubauten waren Mietwohnungen, der Rest Einfamilienhäuser. Der Bauboom in Winterthur geht weiter: Im Jahr 2005 wurden wiederum über 1100 Wohneinheiten bewilligt – das Doppelte der bisherigen durchschnittlichen Jahresproduktion. Winterthur scheint erfolgreich am Image einer attraktiven Wohnstadt zu arbeiten, denn trotz grosser Bautätigkeit bewegt sich die Leerstandsquote auf sehr tiefem Niveau. Im Sommer 2005 standen nur 0,3 Prozent aller Wohnungen leer (Grafik 2 ).
Mehr teure Wohnungen
Ein weiterer wichtiger Indikator für die Stärke der Nachfrage neben den Leerständen ist die Entwicklung der Immobilienpreise. Bei den Mietwohnungen war bis 2003 ein Ansteigen der Angebotspreise zu beobachten. Seither haben sich die Preise stabilisiert. Einerseits wurde im Mietbereich stark im günstigen bis mittleren Segment investiert, andererseits besteht eine grosse Angebotskonkurrenz, die auf die Preise drückt. Im Vergleich zu Zürich ist Winterthur für Mieter weiterhin sehr attraktiv. Wurde in Winterthur im letzten Quartal im gehobenen Segment (70-Prozent-Quantil, d.h. 70 Prozent der Wohnungen kosten gleich viel oder weniger, 30 Prozent sind teurer) eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung im Bereich von netto 1680 Franken pro Monat angeboten, würde dieselbe Wohnung an einer vergleichbaren Lage in Zürich für rund 2220 Franken pro Monat ausgeschrieben. Wer die Internetseiten der diversen anstehenden Neubauprojekte besucht, wird sehen, dass diese zum Teil Zürcher Preise erreichen – die Wohnungspolitik der Stadt, die eine wohlhabende Klientel nach Winterthur holen will, scheint von den Investoren beherzigt zu werden. Dies bestätigt auch der Winterthurer Bausekretär im Hinblick auf die Baugesuche des letzten Jahres, in denen mehrheitlich hohe Wohnstandards für die Neubauprojekte vorgesehen sind.
Bei den Eigentumswohnungen, die 14 Prozent des Wohnungsbestands von Winterthur ausmachen, sind die Leerstände noch tiefer als bei den Mietwohnungen, gleichzeitig haben gerade im gehobenen Segment die Angebotspreise 2005 gegenüber dem Vorjahr generell nochmals zugelegt. Wer wohnt wo für wie viel?
Die günstigsten 4- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen wurden 2005 im Stadtkreis ‹Töss› angeboten, die teuersten im Stadt kreis ‹Stadt›. Das 90-Prozent-Quantil (teuerstes Segment) für eine 4- oder 4 ½-Zimmer-Wohnung lag dort bei 2140 Fran ken pro Monat (Grafik 3 ).
In Winterthur sind die Lebensstilgruppen ‹Postmateriel le› und ‹Moderne Performer› sehr stark vertreten. Die ‹Post materiellen› sind kritische Intellektuelle mit einem ausgeprägten Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und vielfältigen kulturellen Interessen. Sie wohnen vor allem in den Kreisen Stadt und Veltheim. ‹Moderne Performer› sind meist junge, erlebnis- und leistungsorientierte Personen, die nach Selbstverwirklichung streben. In Wülflingen, Mattenbach und in der Altstadt sind sie schwach vertreten, ansonsten verteilen sie sich über das gesamte Gemeindegebiet. Die ebenfalls überdurchschnittlich vertretene Gruppe der ‹Konsumorientierten Ar beiter› wohnt
hingegen hauptsächlich in Töss, Wülflingen und Oberwinterthur. Dies ist die Lebensstilgruppe der materialistisch geprägten, modernen Unterschicht. Die in Winterthur eher schwach vertretene Gruppe der ‹Arrivierten› wohnt in erster Linie an den bevorzugten Hanglagen unter anderem am Heiligberg (Kreis Stadt), in Veltheim und in ‹Seen› (Stadtplan Seite 24).
Winterthur verändert sich. Es ist nicht mehr der blühende Industriestandort von einst, doch die Stadt sucht sich aktiv neu zu positionieren. Unter anderem wird sie zur Wohnstadt für eine mobile, urbane Bevölkerung, die die Vorzüge der sechstgrössten Schweizer Stadt zu schätzen und zu nutzen weiss. Doch wenn auch in Winterthur das Motto ‹Gute Wohnungen ziehen qualifizierte Personen an, die neue Arbeitsplätze anziehen› gilt, wird die Stadt auch in Zukunft nicht nur Wohnort, sondern weiterhin für viele auch Ort der Arbeit sein. •
1. Beschäftigte pro Einwohner 1991 und 2001
Dienstleistungssektor
Industriesektor
2. Entwicklung der Leerstandsquote
Winterthur Zürich Kanton ZH Schweiz
Die Anzahl Beschäftigter (inklusive Teilzeit) pro Einwohner ist zwischen 1991 und 2001 in der ganzen Schweiz zurückgegangen, und zwar haupt sächlich als Folge des Rückgangs des Industriesektors. In Winterthur, wo die Industrie einen Aderlass erlebte, ist dieser Rückgang besonders augen fällig. Neu geschaffene Dienstleistungsarbeitsplätze vermochten den Rückgang zu kompensieren. Quelle: Bundes amt für Statistik (BfS), Bearbeitung W üest & Partner
Die Entwicklung der Leerstandsquote auf dem Wohnungsmarkt (Stichtag jeweils 1. Juni) verlief im Kanton Zürich, in der Stadt Zürich und in der Schweiz etwa synchron, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Auch in Winterthur stieg und fiel die Leerstandsquote zur gleichen Zeit wie in den anderen Gebieten, doch fielen die Ausschläge heftiger aus. Markant ist der Rückgang von gut 1,5 Prozent 1998 auf 0,3 Prozent 2005. Quelle: BfS, Bearbeitung Wüest & Partner
3. Angebotspreise 4- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen (1/05 –1/06) billig günstig Mittelwert gehoben teuer
Die Grafik zeigt das Preisspektrum in den Winterthurer Kreisen, in Zürich und der Schweiz für eine 4- bis 4 ½ Zimmer-Wohnung. Lesebeispiel für die gesamte Schweiz: 30 % der Wohnungen kosteten bis zu 1250 Franken, die Hälfte aller Wohnungen war für bis zu 1500 Franken zu haben und 70 % der Wohnungen kosteten maximal 1700 Franken oder weniger. Wohnungen unter dem 10-%-Quantil kosteten weniger als 1000 Franken, jene oberhalb des 90-%-Quantils kosteten mehr als 2200 Franken. Immo-Monitoring Wüest & Partner
Text: Benedikt Loderer
Der Kanton plant die Verdichtung der Stadt und den Ausbau der S-Bahn und Autobahnen. Das Verkehrskonzept schafft die Voraussetzungen: Um den Verkehr zu verringern, soll der Siedlungszuwachs ausserhalb der Stadt gebremst und innerhalb gefördert werden. Für den regionalen Zusammenhalt sind die Umfahrung und die S-Bahn wichtig.
«Der Umfang des heute bereits ausgeschiedenen Siedlungsgebietes reicht grundsätzlich aus, die erwünschte Entwicklung zu ermöglichen.» Der Kanton Zürich postuliert einerseits die «Verdichtung der bereits überbauten Zonen» und plant andererseits den Ausbau der S-Bahn und der Autobahnen. Die Zersiedlung gleichzeitig fördern und sie eindämmen ist das Ziel der offiziellen Verkehrspolitik. Was heisst das für Winterthur? Die Verkehrsplanung in Winterthur ist à jour. Der Schlussbericht des ‹regionalen Gesamtverkehrskonzepts Winterthur und Weinland› (rGVK) ist im November 2005 abgeschlossen worden. Das ist der Winterthurer Beitrag zum Agglomerationsprogramm des Wirtschaftsraums Zürich. Damit ist auch klar: Die Stadt Winterthur ist ein Subzentrum der metropolitanen Agglomeration Zürich. Auch die Planungsregionen Zürich, Glattal und Limmattal gehören dazu und haben ihrerseits ein Konzept erarbeitet, ein weiteres gibt es für die S-Bahn und noch eines für die Autobahnen und Kantonsstrassen. Wer vom Bund Geld will, und das ist der wahre Kern der Agglomerationsprogramme, der muss mit seinen Nachbarn zusammenarbeiten.
Statt 74 zu 26, 68 zu 32 Im regionalen Gesamtverkehrskonzept stellen die Planer dem Trend- ein Zielszenario gegenüber. Der Trend rechnet mit einem Gesamtverkehrswachstum von 21 Prozent bis zum Jahr 2025. Das ehrgeizige Ziel geht vom gleichen Gesamtwachstum aus, will aber den Modalsplit um 6 Prozent zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs verschieben. Im Jahr 2025 sollen 32 Prozent des Verkehrs vom öffentlichen und 68 Prozent vom Individualverkehr bewältigt werden. Heute ist das Verhältnis 74:26. Wie soll das erreicht werden? Zwei Ebenen greifen ineinander: die übergeordneten und die regionalen Massnahmen. Für den öffentlichen Verkehr sind die übergeordneten Massnahmen: — Kapazitätserhöhung der Bahnlinie Zürich-Winterthur. Es stehen zwei Lösungen zur Auswahl: eine unterirdische Neubaustrecke (Brüttnertunnel) oder der Ausbau der bestehenden Strecke. Das ist eine Vorraussetzung für die — Winti-Thur-Bahn oder dritte Teilergänzung der Zürcher S-Bahn, was Durchmesserlinien von Zürich / Glattal nach Wil, nach Frauenfeld und nach Schaffhausen bedeutet. — Beim Individualverkehr ist die Südostumfahrung oder das Schliessen des Autobahnrings um die Stadt das entscheidende Projekt, das vom Kanton Zürich auch als Bestandteil des überregionalen Verkehrskonzepts vorgegeben wurde. Falls allerdings diese Umfahrung nicht ins Nationalstrassennetz aufgenommen wird oder zu spät kommt, muss die bestehende Autobahn A1 auf sechs oder acht Spuren ausgebaut werden.
Die regionalen Massnahmen bauen auf den übergeordne ten auf und ermöglichen den Halbstundentakt der SBahn von Winterthur nach Schaffhausen, Stein am Rhein, Frauen feld, Wil und ins Tösstal und den Viertelstundentakt nach Zürich. Das heute radial aufgebaute städtische Busnetz wird zu Durchmesserlinien umgebaut. Die Busse stehen nicht mehr alle gleichzeitig auf dem Bahnhofplatz (Seite 18) . Der Fahrplan wird dichter und die Busse grösser (Doppelgelenkwagen). Alles zusammen erlaubt einen Verkehrszuwachs von 60 Prozent auf dem städtischen Netz. Wird die Südostumfahrung gebaut, wird dies die städtischen Strassen um rund 10 Prozent entlasten, mit flankierenden Massnahmen könnte die Abnahme auf einzelnen Achsen bis auf 30 Prozent gesteigert werden. Der Stadt-
rat hat beschlossen, auf den geplanten mittleren Ring zu verzichten. Allerdings muss, falls die Südostumfahrung nicht kommt, der Heiligbergtunnel (mit Tieferlegung der Vogelsangstrasse) in Betracht gezogen werden.
Verkehr ja, Siedlung fraglich «Es ist wichtig zu erkennen, dass die Umsetzung eines Gesamtverkehrskonzeptes ohne die Verknüpfung mit siedlungs- und raumplanerischen Massnahmen nur eine sehr beschränkte und kaum dauerhafte Wirkung entfalten kann», steht im Schlussbericht. Darum hat das Amt für Verkehr des Kantons das regionale Verkehrskonzept auf seine Wirkung prüfen lassen. Eines wird erreicht: Der Zuwachs kann vor allem vom Langsam- und vom öffentlichen Verkehr bewältigt werden. Das Verkehrskonzept schafft die Voraussetzungen, dass die angestrebte Verdichtung nach innen überhaupt stattfinden kann. Doch die Umwelt profitiert nur dann, wenn es gelingt, das Siedlungswachstum ausserhalb der Stadt zu bremsen, was den Verkehrszuwachs verringert. Also: Wachstum statt im grünen Thurgau in der Gartenstadt Winterthur. Der Bericht zeigt, dass die ehrgeizigen Ziele zur Verbesserung des Modalsplits realistisch sind. In den ‹Kernthesen Verkehr› ist zu lesen: «Ausbauten der Infrastruktur, die zu einer Zersiedlung führen … sind abzulehnen.» Die Kohärenzanalyse fragt da nach. «Die quantitative Bedeutung der Kernstadt (drei Viertel der Bevöl-
A4 Schaffhausen Stuttgart Schaffhausen
W-Nord

W- Wülflingen



kerung) ist für eine Agglomeration dieser Grösse eher untypisch. (…) Es ist daher erforderlich, dass sich die Infrastrukturmassnahmen auf die Stadt Winterthur konzentrieren. Für den regionalen Zusammenhalt könnte sich dies jedoch ungünstig auswirken.» Man hört die Präsidenten der umliegenden Gemeinden murren: Nur wenn wir unsere Umfahrung kriegen, darf in der Stadt gebaut werden! So überzeugend kohärent ist das Verkehrskonzept also nicht. Die übergeordneten Massnahmen laufen der Zielsetzung zuwider. Die Südostumfahrung und die Winterthur-Thurgau-Bahn «bergen eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die unerwünschte Siedlungsentwicklung», mahnt der Schlussbericht. Das ist zu übersetzen mit: Wenn man auf der Autobahn und mit der S-Bahn schneller im Thurgau und im Zürcher Unterland ist, so wird dort weiter gehäuselt und nicht in Winterthur verdichtet. Dafür sorgen Gemeindeautonomie und Steuerwettbewerb. Da tönt es wie eine selbstbetrügerische Beschwörungsformel, wenn der Schlussbericht festhält: «Die Koppelung von Siedlung und Verkehr ist bei der weiteren Umsetzung zu verdichten, indem auf Stufe Richtplan konkrete vorgaben für die Siedlung gemacht werden.» Der Bund verlangt von den Agglomerationsprogrammen, dass Verkehr und Siedlung aufeinander abgestimmt werden. Der Kanton Zürich versucht, das Geld zu kriegen, ohne die Siedlungspolitik ernst nehmen zu müssen. Wie alle andern Kantone auch. •
W- Ohringen
Stein am Rhein
A1 St. Gallen Frauenfeld



Oberwinterthur
A1 Zürich
Oberwinterthur © Vermessungsamt Stadt Winterthur, bewilligt 10.2.2006; Bearbeitung Hochparterre
St. Gallen
Hauptverkehrslinien

Sennhof Kyburg
Autobahn A1 / A4 bestehend Projekt Südostumfahrung
Projekt Heiligbergtunnel
Projekt Tieferlegung Vogelsangstrasse Bahnlinie mit Station

Städtebau als fachliche Disziplin
«Prägende Industrieareale und die Gartenstadtidee dominierten bis Mitte des 20. Jahrhunderts den Städtebau von Winterthur. Noch heute hat Winterthur mit seinen beispielhaften Siedlungen eine lebendige Quartierstruktur. Aber wie können deren Qualitäten nicht nur bewahrt, sondern entwickelt werden? Wie sieht die Bildungs-, Wohn- und Kulturstadt nach dem Exodus der Industrie aus? Wie definiert sich ihr Zentrum, wie ihre Entwicklungsgebiete?
Welche Bedeutung hat dabei die Gartenstadt und wie bewältigt diese den
nötigen Zuwachs der Infrastruktur? In der Stadtentwicklung hat oft der Fokus auf kurzzeitige finanzielle und politische Erfolge die Entwicklung weit stärker geprägt als städtebauliche Aspekte. Will sich Winterthur als überregionales Zentrum gegen die boomenden Agglomerationsstädte um Zürich behaupten, muss eine kompetente Stelle für Städtebau geschaffen werden, die der Stabstelle für Stadtentwicklung und dem Stadtmarketing zur Seite steht, um Entwicklungsvisionen für Winterthur departementübergreifend
umzusetzen. Bereits hat Winterthur in letzter Zeit vermehrt mit zweckmässigen Planungsverfahren politische Bereitschaft für ein Umdenken angedeutet, so beispielsweise bei der Testplanung für die Stadtmitte Süd, die auf die Initiative des Forums Architektur Winterthur zurückgeht. Wir hoffen, dass Winterthur den bevorstehenden Umbau des Baudepartements nutzt und im Interesse unserer Stadt Städtebau nicht nur als politische, sondern auch als fachliche Disziplin wahrnimmt.» Toni Wirth, Präsident Forum Architektur Winterthur


Stadtentwicklung
«Stadtentwicklung fordert Subtilität und einen würde- beziehungsweise respektvollen Umgang mit den gegebenen Strukturen. Sie setzt grossen Sachverstand voraus. Eine Stadt ist ein Organismus mit Gesetzmässigkeiten. Verletzt man diese, können nachhaltige Probleme entstehen. Ein an Zeit und Quantität zu forciertes Bauen hat nichts Visionäres. Einen neuen Stadtteil mit Park künstlich aus dem Boden zu
Winterthur ohne Verkehrskonzept
«Entsprechend den regierungsrätlichen Vorgaben soll in der Stadt Winterthur der motorisierte Individualverkehr (MIV) von 1998 bis 2025 um 5 Prozent wachsen, der öffentliche Verkehr um 60 Prozent und der Fussgänger- und Veloverkehr um 21 Prozent. 60 Prozent mehr ÖV in Winterthur bedeutet mehr Busse auf den Strassen. Das funktioniert nur, wenn diese vom MIV entlastet werden. Die vom Stadtrat zu diesem Zweck vorgeschlagene Südostumfahrung könnte zwar eine gewisse Entlastung bringen, sie käme aber viel

Zentral ist der politische Wille
«Es war der SIA Winterthur, der 1990 nach der Präsentation von ‹Winti-Nova› (Seite 6, Bild) den Denkprozess Stadtentwicklung in den neu zu nutzen den Arealen in Gang gebracht hatte. Die Stadt nahm den Anstoss auf, publi zier te für das Sulzer-Areal eine Pla nungszone und startete die ‹Werkstadt 90›. Sulzer liess die ursprünglichen Pläne fallen und entwickelte zusammen mit der Stadt die Sulzer-Areale im Zentrum und in Oberwinterthur. Ebenfalls auf Initiative des Sia Winterthur führte die Stadt 1992 die Testplanung Stadtmitte
stampfen, aus der zu Erde gemachten einst bedeutsamsten Industrie Winterthurs, mag verlockend nach dem viel propagierten Aufschwung klingen. Aber ob die Rechnung aufgeht, wird sich erst noch erweisen. Tendenziell fehlt es an der gesunden Durchmischung der Nutzung, Bestehendes wird zu wenig in neue Bauvorhaben integriert. Besser, man hätte einst Mut bewiesen und ‹Megalou› auch ausgeführt, das Projekt, das eindeutig städtebauliche Akzente von grosser Ausstrahlung gesetzt hätte. Doch Winterthur scheint im Mittelmass verhaftet zu sein – daran ändern auch die neuen, wie über Nacht hingeklotzten und ihre Umgebung erdrückenden Mega-Wohnbauten nichts oder die wenigen Ausnahmen, wo geschickt Neues mit Altem kombiniert wurde.» Katharina Henking, Kunstschaffende/Geschäftsleiterin Künstlergruppe Winterthur
zu spät: Frühestens 2035 ist mit dem 1,6 Mrd. Franken teuren Bauwerk zu rechnen. Der ‹Runde Tisch Verkehr› hat deshalb schon früh auf die Vorteile eines Heiligbergtunnels hingewiesen, der zusammen mit der tiefergelegten Vogelsangstrasse das Stadtzentrum massiv vom MIV entlasteten könnte. Die Technikumstrasse zum Beispiel, die von der Südostumfahrung überhaupt nicht entlastet würde, aber eine der wichtigsten Busachsen der Stadt ist, würde vom Heiligbergtunnel um 50 Prozent entlastet. Eine Ende letzten Jahres fertig
gestellte Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass diese Entlastungsachse technisch machbar ist und ca. 200 Mio. Franken kosten würde. 100 Mio. entfallen dabei auf den Tunnel und 100 Mio. auf die sowieso geplante tiefergelegte Vogelsangstrasse. Für rund einen Achtel der Kosten der Südostumfahrung wären so einige der dringendsten innerstädtischen Verkehrsprobleme in kürzerer Zeit lösbar. Dank der Vorteile für alle Verkehrsträger wäre auch eine Mitfinanzierung aus Agglomerationsgeldern wahrscheinlich.» Markus Graf, Vorsitz Runder Tisch Verkeh r
durch. Vom damals entwickelten Leiternkonzept wurden in der Zwischenzeit ein Teil des Bahnhofplatzes, der Bahnmeisterweg und die Wylandbrücke realisiert. Mit dem Ideenwettbewerb Gleisquerung und dem Masterplan Bahnhof (Seite 18) hat die Stadtregierung die Weiterentwicklung an die Hand genommen. Es reicht aber nicht aus, nur die Komplexität des Problems und der Lösungsansätze aufzuzeigen, es muss auch für die Umsetzung gesorgt werden. Es braucht jetzt den politischen Willen der Stadtregierung,
die planerischen und finanziellen Mittel für die Umsetzung dieser wichtigen Verbindungen im Stadtzentrum bereitzustellen. Bei den Quartierentwicklungen Wässerwiesen und Neu Hegi wurden die Behörden vom Tempo des Prozesses überrollt. Sie haben inzwischen erkannt, dass Retortensiedlungen und unkontrollierte Entwicklungen auch viele Probleme schaffen, weshalb Stadtpräsident Ernst Wohlwend die Stadtentwicklung zur Chefsache erklärt und die neue Stelle Stadtentwicklung geschaffen hat.» Michael Küttel, Ingenieur, Präsident SIA Winterthur

