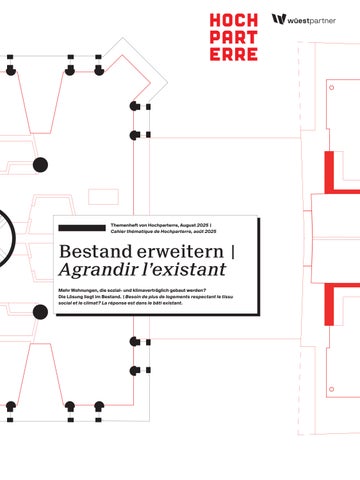Themenheft von Hochparterre, August 2025 | Cahier thématique de Hochparterre, août 2025
Bestand erweitern | Agrandir l’existant
Mehr Wohnungen, die sozial- und klimaverträglich gebaut werden ? Die Lösung liegt im Bestand. | B esoin de plus de logements respectant le tissu social et le climat ? La réponse est dans le bâti existant.
4 Umbauwerk Schweiz | Le chantier Suisse
Eine Analyse zum Um- und Weiterbau der Schweiz. | Une analyse du chantier Suisse.
10 Fallbeispiele 1 – 4 | Exemples de cas 1 – 4
1 Nachverdichtung | Densification Siedlung Hirtenweg, Riehen BS
2 Nachverdichtung | Densification Siedlung Im Grund, Embrach ZH
3 Aufstockung | Surélévation Bockhornstrasse, Zürich
4 Aufstockung | Surélévation Avenue Wendt, Genève
18 « Erst einmal im Wohnzimmer sitzen und zuhören » | « S’asseoir dans le séjour et écouter »
Eine Wohnexpertin, eine Architektin und eine Denkmalpflegerin im Gespräch. | Entretien entre une spécialiste de l’habitat, une architecte et une conservatrice.
22 Fallbeispiele 5 – 8 | Exemples de cas 5 – 8
5 Transformation | Transformation Felix-Platter-Spital, Basel
6 Transformation | Transformation Fabrikgebäude Lindenstrasse, St. Gallen
7 Umnutzung | Reconversion Römerstrasse, Baden AG
8 Umnutzung | Reconversion Avenue Louis-Aubert, Genève
30 Transformation statt Expansion | Transformer plutôt qu’étendre
Zeit für einen Paradigmenwechsel, findet der Direktor des BWO Martin Tschirren. | L’heure est au changement de paradigme pour Martin Tschirren, directeur de l’OFL.

Zwölf Stellschrauben
Was wurde bei den acht Beispielprojekten in diesem Heft besonders gut gelöst?
Was können künftige bestandserweiternde
Projekte von ihnen lernen? Zwölf im Heft eingestreute ‹Stellschrauben› verknüpfen den Einstiegstext ‹Umbauwerk Schweiz› ab Seite 4 und das Gespräch ab Seite 18 mit den acht Beispielen.
Douze vis de réglage
Quels sont les aspects les plus réussis des huit projets présentés dans ce cahier? Quelles leçons en tirer pour les projets d’extension à venir?
Douze ‹vis de réglage› disséminées dans le cahier relient l’entrée en matière
‹Le chantier Suisse› à partir de la page 4, l’entretien à partir de la page 18 et les huit exemples.
Die Schweiz um- und weiterbauen
Wir brauchen mehr Wohnraum. Die Erneuerung und Erweiterung bestehender Bauten steht dabei im Fokus – in der Stadt, aber auch in der Agglomeration. Wichtige Themen wie Kreislaufwirtschaft oder bezahlbare Mieten, Denkmalpflege oder Biodiversität wollen berücksichtigt werden, stehen aber nicht selten in Konkurrenz zueinander. Alle Aspekte müssen sorgfältig ausgehandelt und abgewogen werden, damit sie sich nicht gegenseitig blockieren. Ein Überblick über die relevanten Themen spannt den Rahmen dieses Hefts auf. Weitere Beiträge vertiefen einzelne Gesichtspunkte. Eine Analyse von acht erneuerten und erweiterten Wohnanlagen zeigt und bewertet die angewandten Lösungsansätze. Diese Beispiele zeigen anschaulich, welche Herausforderungen es zu meistern gilt, damit der Wohnungsbau im Bestand gelingt. So möchte das Heft dazu beitragen, dass eine komplexe Bauaufgabe wie die Erweiterung einer Siedlung oder eines Hauses sich nicht selbst blockiert, sondern möglichst viele Ziele vereint. Anlass zu diesem Heft gab das 50-jährige Jubiläum des Bundesamts für Wohnungswesen ( BWO ). Wir gratulieren ! Axel Simon
Transformer la Suisse
Nous avons besoin de plus de logements. La rénovation et l’extension de l’existant, en ville comme en agglomération, sont la priorité. Mais il n’est pas rare que des thèmes essentiels à intégrer comme l’économie circulaire ou l’accessibilité des loyers, la conservation du patrimoine ou la biodiversité, se concurrencent. Tous les aspects doivent être évalués et pesés avec soin afin d’éviter des blocages mutuels. Un tour d’horizon des thèmes prioritaires fixe le cadre de ce cahier, qui inclut également des articles approfondissant certains points de vue. L’analyse de huit ensembles résidentiels rénovés et agrandis expose et évalue les solutions mises en œuvre. Les exemples illustrent les défis à relever pour une construction réussie dans l’existant. Par ce cahier, nous souhaitons contribuer à éviter le blocage d’une tâche aussi complexe que l’extension d’un lotissement ou d’un bâtiment et au contraire viser à concilier un maximum d’objectifs. Il paraît à l’occasion des 50 ans de l’Office fédéral du logement ( OFL ). Joyeux anniversaire ! Axel Simon
Das Bauen im Bestand hat viele Facetten | Bâtir dans l’existant: de multiples facettes
Die acht Projekte im Heft ab Seite 10 und ab Seite 22 haben wir mit Blick auf die folgenden sechs Kriterien und Zielkonflikte beurteilt. Ein Netzdiagramm stellt unsere Bewertung dar und zeigt, in welchem Bereich das Beispiel gut abschneidet und wo es besser sein könnte.
Nous avons évalué les huit projets à partir de la page 10 et de la page 22 en gardant à l’esprit les six critères et conflits d’objectifs ci-dessous. Un diagramme en étoile matérialise notre évaluation et montre dans quel domaine l’exemple excelle et quelles améliorations il pourrait viser.
Erhalt von Bestand
Handelt es sich bei dem Projekt primär um Ersatzneubauten ? Blieb vom Bestand nur noch die Tragstruktur stehen ? Oder bleibt der Bestand völlig erhalten und wird durch Neubauteile ergänzt ?
Ökologische Bauweise
Wurden die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt ? Setzt das Projekt auf eine herkömmliche Bauweise oder ist es möglichst ökologisch und klimaschonend gebaut ?
Construction écologique
Les principes de l’économie circulaire ont-ils été considérés ? Le projet mise-t-il sur un mode de construction conventionnel ou est-il particulièrement écologique et respectueux du climat ?
Soziale Integration
Wurde leergekündigt oder in bewohntem Zustand saniert ? Wurden vorhandene Nutzergruppen eingebunden oder entstand sozial etwas völlig Neues ? Integriert das Projekt gemeinschaftliche Angebote ?
Intégration sociale
Les baux ont-ils été résiliés ou les logements rénovés alors qu’ils étaient habités ? Les groupes d’usagers présents ont-ils été impliqués ou a-t-on créé une nouvelle structure sociale ? Le projet intègre-t-il des offres pour la communauté ?
Freiraum
Geht die Nachverdichtung auf Kosten des Freiraums und der Biodiversität ? Trägt das Projekt zur Klimaresilienz bei ? Gibt es statt Abstandsgrün neue Begegnungsräume ?
Maintien de l’existant
Le projet est-il avant tout une démolitionreconstruction ? La structure porteuse est-elle le seul élément restant ?
Ou l’existant est-il intégralement conservé et complété par de nouveaux éléments ?
Verhältnis
Bestand / Neubau
Stehen Alt und Neu im Dialog, in einer komplementären oder einer symbiotischen Beziehung zueinander ? Oder ist beim Neubau kein Bezug zum Bestand mehr zu erkennen ?
Rapport bâti existant / nouveau
Y a-t-il un dialogue entre l’ancien et le neuf, une relation complémentaire ou symbiotique ou n’est-il plus possible d’identifier le lien avec l’existant dans la nouvelle construction ?
Grad der Nachverdichtung
Schafft das Projekt mehr Wohnraum ? Wie hoch ist der Nachverdichtungsgrad an Bewohnern innerhalb des Projektperimeters ?
Niveau de densification
Le projet crée-t-il plus de logements ? Quel niveau atteint la densification de population dans le périmètre du projet ?
Espace non bâti
La densification affectet-elle les espaces ouverts et la biodiversité ?
Le projet contribue-t-il à la résilience climatique ?
A-t-on remplacé les bandes de gazon par des lieux de rencontre ?
Umbauwerk Schweiz | L e chantier Suisse
Gebäude und Siedlungen sozial- und klimaverträglich erneuern und erweitern, wie geht das ? Ein Blick auf Handlungsspielräume und Zielkonflikte beim Um- und Weiterbau der Schweiz. | Comment rénover et agrandir les bâtiments et lotissements en respectant le tissu social et le climat ? Tour d’horizon des marges de manœuvre et des conflits d’objectifs pour le chantier de transformation de la Suisse.
Bauen bedeutet immer: Bestand erweitern. Denn Bauen ist kontextuell: Jede Intervention verortet sich räumlich, ökologisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich. Bauen ist Umbauen und Weiterbauen. Heute mehr denn je. Wir leben in Zeiten sich überlagernder Krisen und globaler Unsicherheiten, was die Suche nach Vertrautem und Identitätsstiftendem noch verstärkt. Doch es gibt ein Problem: Der Schweizer Wohnungsmarkt ist angespannt, nicht nur in vielen städtischen und touristischen Regionen. Räumliche und materielle Ressourcen werden knapper, gleichzeitig steigen die Bevölkerungszahlen und auch die Wohnansprüche: Einmal an den aktuellen Komfort gewöhnt, will man nicht mehr zurück. All das fordert uns als Branche heraus, ja, es verpflichtet uns. Architekturschaffende, Bauherrschaften und Gesetzgeber müssen sorgsam und verantwortungsvoll mit dem Bestand umgehen, sich bewusst mit ihm auseinandersetzen, ihn qualitätsvoll erweitern. Ihn umbauen.

Bedürfnisse hinterfragen Wer bauliche Standards und Komfortnormen hinterfragt, baut ökologischer. Auch ein günstiges Haus kann architektonisch wertvoll und schön sein.
Questionner les besoins Questionner les standards de construction et de confort, c’est bâtir plus écologique. Même un immeuble peu coûteux peut être beau et avoir une grande valeur architecturale.
Projekte | Projets 1, 4, 7
Bâtir, c’est toujours agrandir l’existant. On ne construit qu’en contexte, en s’ancrant dans l’espace, l’écologie, la culture, la société et l’économie. Bâtir implique de transformer, aujourd’hui plus que jamais. Nous vivons une époque agitée de crises qui se superposent et d’incertitudes mondiales, ce qui renforce la quête d’un cadre familier et vecteur d’identité. L’ombre au tableau, c’est un marché du logement tendu, bien au-delà des zones urbaines et touristiques. Les ressources en terrains et matériaux s’amenuisent, alors que la population croît et les exigences en matière de logement aussi: une fois les habitudes de confort ancrées, difficile de revenir en arrière. Cela met notre branche au défi et nous oblige. Les architectes, les maîtres d’ouvrage et les législateurs doivent considérer et gérer l’existant avec soin et responsabilité, le traiter en connaissance de cause et l’agrandir en privilégiant la qualité. Mission transformation.
Principes de la construction circulaire
Pour remplir ces obligations, nous devons non seulement transformer nos bâtiments, mais aussi notre vie et notre économie. De linéaire, le système doit devenir circulaire. La construction circulaire n’est pas seulement nécessaire pour respecter les limites fixées par la planète, elle nous permet de préserver et de développer des éléments d’identité. Remettons d’abord en question nos besoins ( ‹ refuse › ): évaluons d’un œil critique si un bâtiment existant ne peut pas être rénové et agrandi plutôt que démoli et reconstruit. L’objectif est de densifier et d’utiliser les surfaces avec sobriété. Le second mot d’ordre est ‹ rethink ›, repenser sur le long terme et construire durablement. Les cycles de vie des bâtiments peuvent être prolongés par une grande souplesse d’utilisation, en pensant par strates et en facilitant une déconstruction sélective.
Le troisième principe ‹ r educe › ne s’applique que quand les phases ‹ refuse › et ‹ rethink › ont montré quelles mesures constructives étaient réellement indispensables: dès la phase de projet et de conception, il met l’accent sur la réduction des quantités de matériaux, l’efficacité de l’exploitation future et l’entretien. Alors seulement entrent en jeu les principes de ‹ reuse › et ‹ recycle ›, tout aussi essentiels dans l’économie circulaire, mais moins efficaces
Hierarchie der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen | Hiérarchie des principes de l’économie circulaire dans la construction
Vermeidung von baulichen Massnahmen: Weiternutzung und Erneuerung
Refuse
Kluge ( Um- )Nutzungskonzepte, Entwurf unter Berücksichtigung der Rückbaubarkeit
Minimierung der Materialmenge durch Design, Instandhaltung und Effizienz
Wieder- und Weiterverwendung von Bauteilen und Tragstrukturen
Weiterverwendung von Materialien als Sekundärrohstoffe, Minimierung der Zuführung von Material auf Deponien
So geht zirkuläres Bauen
Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, müssen wir nicht nur unsere Häuser, sondern auch unser Leben und unsere Wirtschaft umbauen. Aus dem linearen System muss ein zirkuläres werden. Zirkuläres Bauen ist nicht nur notwendig, um die planetaren Grenzen einzuhalten, es gibt uns auch die Möglichkeit, identitätsstiftende Elemente zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die erste Maxime ist dabei das Hinterfragen von Bedürfnissen: ‹ Refus e › heisst, kritisch abzuwägen, ob ein bestehendes Gebäude wirklich ersetzt werden muss oder ob es nicht doch saniert und erweitert oder ergänzt werden kann. Das Ziel: Innenverdichtung und suffiziente Flächennutzung. Die zweite Maxime lautet ‹ Rethink ›. Das bedeutet, langfristig zu denken und langlebig zu bauen. Mit einer hohen Nutzungsflexibilität lassen sich Lebenszyklen von Gebäuden verlängern – indem wir etwa in Schichten denken und einen selektiven Rückbau ermöglichen.
Erst wenn ‹ Refus e › und ‹ Rethink › gezeigt haben, welche baulichen Massnahmen tatsächlich nötig sind, kommt als dritte Maxime ‹ Re duce › hinzu: B ei Entwurf und Konstruktion legt sie den Fokus auf die Minimierung der Materialmenge, die Effizienz des künftigen Betriebs und die Instandhaltung. Erst dann folgen ‹ Reus e › und ‹ Re cycle › –die in der Kreislaufwirtschaft zwar ebenfalls wichtig sind, aber viel weniger effektiv als die drei ‹ R › davor: Material und Bauteile bleiben nicht am bisherigen Ort, sondern werden an anderer Stelle wiederverwendet oder wiederverwertet, brauchen also mehr graue Energie.
Éviter les mesures constructives: réutiliser et rénover
Appliquer des concepts de ( ré )affectation astucieux, concevoir en intégrant la déconstruction
Réduire la quantité de matériaux grâce à la conception, l’entretien et l’efficacité
Recycler et réutiliser les éléments de construction et les structures porteuses
Réutiliser les matériaux comme matières premières secondaires, réduire la dépose dans les décharges
Leitfaden zum zirkulären Bauen | Guide de la construction circulaire
que les trois premiers ‹ R ›: les matériaux et les éléments de construction ne restent pas sur place, mais sont réutilisés ou valorisés sur un autre site et consomment donc plus d’énergie grise.
Ces thèmes avant tout stratégiques relèvent de la maîtrise d’ouvrage. L’élaboration en juin 2023 de la Charte pour une construction circulaire a montré que les maîtres d’ouvrage souhaitaient par principe assumer leurs responsabilités. Depuis, environ vingt grands propriétaires et maîtres d’ouvrage suisses ont formulé leurs ambitions communes dans ce document: ils entendent limiter d’ici 2030 l’utilisation de matières premières non renouvelables à 50 % de la masse totale, comptabiliser et réduire fortement les émissions grises de gaz à effet de serre, tout en mesurant et en améliorant nettement la circularité des rénovations et des nouveaux bâtiments. La Confédération soutient les efforts du secteur, en publiant notamment un guide à l’intention des conceptrices et des maîtres d’ouvrage.
Anatomie d’une
pénurie
Le passage à la circularité du secteur de la construction et de l’immobilier est une tâche herculéenne. On attend en outre des politiques et du marché immobilier qu’ils pallient le manque de logements. La pénurie est flagrante si l’on compare l’offre de logements et le nombre d’abonnements aux courriels automatiques qui alertent de la publication d’annonces en adéquation avec leur recherche. La demande en biens est excédentaire presque partout en Suisse et varie fortement selon les régions: dans
Marktanspannung: Anzahl Suchabos pro angebotene
Mietwohnung | Tension du marché: nombre d’abonnements aux alertes par logement à louer
Diese Themen sind primär strategischer Natur und damit Sache der Bauherrschaft. Die Erstellung der Charta für kreislauforientiertes Bauen im Juni 2023 hat gezeigt, dass die Bauherrschaften ihrer grossen Verantwortung grundsätzlich gerecht werden möchten. Mittlerweile haben rund 20 grosse Schweizer Eigentümerinnen und Bauherrschaften ihre gemeinsamen Ambitionen in der Charta formuliert: Bis 2030 wollen sie die Verwendung von nicht erneuerbaren Primärrohstoffen auf 50 Prozent der Gesamtmasse reduzieren, die grauen Treibhausgasemissionen erfassen und deutlich senken sowie die Kreislauffähigkeit von Sanierungen und Neubauten messen und erheblich verbessern. Der Bund unterstützt die Bemühungen der Branche, zuletzt durch die Publikation eines Leitfadens für Planerinnen und Bauherrschaften.
Anatomie des Wohnraummangels
Die Transformation zu einer zirkulären Bau- und Immobilienbranche ist eine gewaltige Aufgabe. Zudem sind Politik und Immobilienmarkt gefordert, die Unterversorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu bekämpfen. Die Unterversorgung wird deutlich, wenn man die Zahl der Suchabos, die ihre Abonnentinnen automatisch auf passende Immobilieninserate aufmerksam machen, dem Wohnungsangebot gegenüberstellt. Fast in der ganzen Schweiz herrscht ein Nachfrageüberhang, wobei dieser regional stark variiert: In den meisten Kantonen kommen auf ein Inserat rund zwei Suchabos, in besonders steuergünstigen Kantonen wie Zug sogar mehr als zehn.
Weil zudem das Angebot rückläufig war, verschärfte sich dieser Zustand in den vergangenen Jahren weiter. Zwischen 2021 und 2024 ging das Angebot an inserierten Mietwohnungen in der Schweiz um rund 40 Pr ozent zu-

Langfristig denken
Nicht immer gleich alles machen, sondern Lebenszyklen durch hohe Nutzungsflexibilität und Systemtrennung verlängern.
Penser à long terme Ne pas se précipiter, mais prolonger les cycles de vie en permettant plusieurs usages et en séparant les systèmes.
Projekt | Projet 4
Nachfrageüberhang | D emande excédentaire: Suchabos pro angebotene Wohnung | abonnements aux alertes par logement à louer m ehr als | plus de 6 5 – 6 3 – 4 0 – 2
Angebotsüberhang | Offre excédentaire: weniger Suchabos als angebotene Wohnungen | moins d’abonnements aux alertes que de logements
Quellen | Sources: Realmatch360, Wüest Partner ; Stand: März 2024 | état en mars 2024
rück. Überdurchschnittlich stark betraf dieser Rückgang Angebote im mittleren und unteren Preissegment – werden bestehende Gebäude abgerissen, sind es oft solche mit bis dahin besonders günstigem Wohnraum. Ein Grund für das geringe Angebot an Wohnungen ist die im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum schwache Bautätigkeit. Äussere Faktoren, die nur beschränkt kontrollierbar sind, etwa der Arbeits- und Kapitalmarkt, die Realwirtschaft, die Demografie, die Haushaltszusammensetzung oder die Baupreise, beeinflussen die Bautätigkeit. Aber auch innere Faktoren wie die Verfügbarkeit von Bauland, Verdichtungsreserven, Baubewilligungsprozesse oder Rechtsunsicherheiten spielen eine Rolle.
Umbauten nehmen zu
Ein Blick auf die Baubewilligungen lässt nun für den Wohnungsmarkt eine wachsende Dynamik erwarten. Die dort veranschlagten Neubauinvestitionen haben vom dritten Quartal 2023 bis zum zweiten Quartal 2024 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 19 Prozent zugelegt, bei den Umbauten sogar um 24 Prozent. Dass das Umbausegment wächst, liegt zum einen an den Eigentümern, die weiterhin bestrebt sind, ihren Bestand energetisch zu sanieren. Zum anderen besteht durch das geltende Raumplanungsgesetz ein Mangel an Bauland und Baureserven, insbesondere an zentralen Lagen. Hinzu kommen Regulierungen und komplexe Baubewilligungsverfahren, die Neubauten erschweren – um die Verdichtung nach innen zu fördern.
Die Agglomerationen wachsen
Neue kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognosemodelle von Wüest Partner zeigen, dass die Bevölkerung in den Agglomerationsgemeinden der grossen Städte am stärksten zunehmen wird. Sowohl die Bevölkerung als auch die Zahl der Haushalte dürfte dort bis 2030 um mehr als ein Prozent pro Jahr wachsen. Diese Gemeinden sind attraktiv, weil sie nahe bei den grossen Wirtschaftszentren liegen, gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind und im Vergleich zu ihren Kernstädten tiefere Wohnkosten aufweisen. Wegen der intensiven Neubautätigkeit können sie mehr neue Haushalte aufnehmen als die bereits dichten Grossstädte.
Erschwingliche Mieten – aber wie ?
Unabhängig von der Lage der Wohnungen steht ihre Erschwinglichkeit immer wieder im Zentrum politischer Debatten. Um dem sinkenden Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen entgegenzuwirken, bietet sich die Erweiterung von Bestandsbauten an. Günstige Wohnungen im Bestand können erhalten und gleichzeitig neuer Wohnraum geschaffen werden. Vergleicht man Massnahmen wie den Abbau von Bauvorschriften, die Einschränkung von Einsprachemöglichkeiten oder die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau miteinander, erzielt das folgende Modell die beste Wirkung: eine Erhöhung der Ausnützungsziffer, verbunden mit der Auflage eines Anteils an Kostenmiete. Dadurch wird das Angebot vergrössert und der Mietzins gedämpft.
Lösungsansätze und Zielkonflikte
Die folgenden Seiten zeigen acht gelungene Beispiele in den vier Kategorien ‹ Nachverdichtung bestehender Siedlungen ›, ‹ Nachverdichtung durch Aufstockung oder ergänzende Bauten ›, ‹ Transformation › und ‹ Umnutzung von Gebäuden, die vorher nicht dem Wohnen dienten ›. Die Ergebnisse der Analyse dieser acht Projekte werden in Netzdiagrammen abgebildet. Sie illustrieren die verschiedenen Lösungsansätze, aber auch inhärente Zielkon-

Bewusst ersetzen
Ersatzneubauten sind nicht grundsätzlich böse. Gezielt eingesetzt, können sie Siedlungen verdichten und Freiräume verbessern.
Remplacer à bon escient
Toute démolition-reconstruction n’est pas à exclure. Bien ciblée, elle permet de densifier un lotissement et d’améliorer les espaces non bâtis.

Unsichtbares weiternutzen
Projekte | Projets 1, 2, 5
Bestehende unterirdische
Bauten oder deren
Gruben lassen sich weiternutzen. Das spart Energie, Zeit und Geld.
Utiliser ce qui n’est pas visible L’utilisation d’ouvrages souterrains existants ou leur excavation est un gain d’énergie, de temps et d’argent.
Projekte | Projets 1, 2, 8
la plupart des cantons, pour une annonce, on constate deux abonnements aux alertes, voire plus de dix dans des cantons à la fiscalité très avantageuse comme Zoug.
La situation s’est encore détériorée ces dernières années en raison aussi de la baisse de l’offre. Entre 2021 et 2024, l’offre d’annonces de locations en Suisse a baissé d’environ 40 %. Ce recul a affecté plus fortement que la moyenne les offres dans les segments de prix moyen et inférieur. Les démolitions de bâtiments concernent souvent des logements particulièrement bon marché. La baisse de l’offre s’explique par l’activité de construction qui reste faible par rapport à l’augmentation de la population. L’activité est soumise à des facteurs extérieurs, difficilement maîtrisables, comme le marché du travail ou des capitaux, l’économie réelle, la démographie, la composition des ménages ou les prix de la construction. Toutefois, des facteurs internes jouent également un rôle: la disponibilité en terrains à bâtir, les réserves de densification, les procédures d’autorisation de construire ou encore les incertitudes juridiques.
Les rénovations augmentent Un coup d’œil sur les permis de construire augure toutefois d’un dynamisme croissant sur le marché immobilier. Du 3 e trimestre 2023 au 2 e trimestre 2024, les investissements estimés ont augmenté de 19 % en gliss ement annuel dans l’immobilier neuf et de 24 % dans les transformations. Si ce dernier segment est en hausse, on le doit aux propriétaires qui tiennent à la rénovation énergétique de leur bien, mais aussi à la loi sur l’aménagement du territoire qui génère un manque de terrains et de réserves de construction, notamment dans les

Vielfältig mischen
Ein guter Wohnungs- und Nutzungsmix erhöht die Vielfalt und senkt die Vermarktungsrisiken eines Gebäudes. Zudem macht er das Quartier lebendiger.
Mélanger les usages
Une bonne mixité de logements et d’activités accroît la diversité et réduit les risques à la commercialisation d’un bâtiment. Elle dynamise aussi le quartier.
Projekte | Projets 1, 2, 4, 5, 8

Grenzen setzen

In Etappen (um)bauen
Wenn der Ersatz oder die Sanierung etappenweise erfolgt, können die Bewohner in ihren Wohnungen bleiben oder dahin zurückkehren. Das kann einen sozialen Mehrwert generieren.
Reglementierungen können Wohnungen preisgünstiger und damit sozialer machen. Und sie können dabei helfen, Häuser zu erhalten, etwa wenn ein Neubau weniger Ausnützung ermöglicht.
Bâtir ou transformer par étapes
Lorsque la démolitionreconstruction ou la rénovation s’effectue par étapes, les habitants peuvent rester ou retourner dans leurs logements. Cela peut être socialement bénéfique.
Projekte | Projets 1, 4
Poser des limites Les réglementations peuvent favoriser des logements plus abordables et plus sociaux, ainsi qu’aider à conserver les bâtiments, par exemple quand une construction nouvelle permettrait une utilisation du sol moindre.
Projekte | Projets 1, 4, 5, 7, 8
lieux centraux. S’ajoutent à cela des réglementations et des procédures complexes de permis de construire qui entravent les constructions neuves, pour favoriser la densification vers l’intérieur.
Les agglomérations grandissent
Les nouveaux modèles de projection des populations et ménages à petite échelle de Wüest Partner prévoient que l’augmentation de population viendra avant tout des agglomérations des grandes villes. La population tout comme le nombre de foyers devraient croître de plus de 1 % par an d’ici 2030. Proches des grands centres économiques, bien desservies par les transports en commun et affichant des coûts de logement inférieurs à ceux des villes-centres, les communes périphériques attirent. Du fait d’une forte activité de construction, elles peuvent accueillir plus de nouveaux ménages que les villes-centres déjà denses.
Des loyers abordables, mais comment ?
Indép endamment de son emplacement, le logement abordable est un thème récurrent dans les débats politiques. Pour endiguer la baisse de l’offre de locations bon marché, il est possible d’agrandir les bâtiments existants. On conserve ainsi un parc immobilier abordable tout en créant de nouveaux logements. Si l’on compare des mesures comme la suppression des prescriptions de construction, la limitation des options de recours ou la promotion de la construction de logements d’utilité publique, le modèle le plus efficace est l’augmentation de l’indice d’utilisation du sol couplée à la fixation d’un quota de logements aux loyers fixés sur la base des coûts. Cette stratégie permet d’augmenter l’offre et de modérer les loyers.
Solutions et conflits d’objectifs
flikte – nicht exakt, aber in der Tendenz. Ein Ersatzneubau erkauft sich seine hohe Ausnützung mit viel grauem CO 2. Seine neuen Wohnungen können mit ihren Typen oder Grössen eine vorhandene Mischung ergänzen oder die Gentrifizierung eines Quartiers befördern. Mit der aufgerüsteten Technik reduziert der Ersatzneubau seine Betriebsenergie fast auf null, was aber die graue Energie seiner Erstellung in die Höhe treibt. Was eine gute Lösung ist und was eine schlechte, lässt sich oft erst nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten sagen. Dazu braucht es Wissen und Daten. Die Abfrage der Projektdaten für dieses Heft hat gezeigt, dass eine Ökobilanzierung noch lange keine Selbstverständlichkeit ist. Das gilt auch für den Erhalt, die Erneuerung und die Erweiterung des Bestands: All das hat in der Praxis noch nicht den gleichen Stellenwert, den es in den Projekten von Architekturwettbewerben oder Hochschulen hat. Aber es beginnt sich zu verändern. ●
Les pages qui suivent présentent huit exemples réussis dans les quatre catégories ‹ D ensification d’ensembles urbains existants ›, ‹ D ensification de bâtiments par surélévation ou extension ›, ‹ Transformation › et ‹ Re conversion de bâtiments qui n’étaient pas à usage d’habitation ›. L’analyse de ces huit projets est exposée dans des diagrammes en étoile. Les résultats illustrent de manière sinon exacte, du moins tendancielle, les différentes solutions et les conflits d’objectifs inhérents. L’intérêt d’une démolitionreconstruction est contrebalancé par la consommation de grandes quantités d’énergie grise. Les nouveaux logements peuvent compléter, par leur typologie ou leur taille, une mixité existante ou favoriser la gentrification d’un quartier. Grâce aux technologies modernes, un immeuble neuf réduit quasi à zéro son énergie de fonctionnement, mais sa construction entraîne une hausse de l’énergie grise consommée.
Bonne ou mauvaise solution ? Souvent, il est impossible de le savoir avant d’avoir soigneusement évalué toutes les options. Pour cela, connaissances et données sont nécessaires. La consultation des données des projets pour ce cahier a montré que la réalisation d’un écobilan était loin d’être une évidence. Le constat vaut aussi pour la conservation, la rénovation et l’extension de l’existant: dans la pratique, ces choix n’ont pas encore la même importance que dans les projets des concours d’architecture ou dans les hautes écoles. Néanmoins, les lignes commencent à bouger. ●
Wohnungsknappheit: Rückgang der inserierten Mietwohnungen, besonders im günstigen Segment | Pénurie de logements: baisse des annonces locatives, notamment dans le segment bon marché
Anzahl inserierte Wohnungen nach Mietpreisklasse | Nombre d’annonces de logements selon la catégorie de loyer: ( Miete in Fr. pro m² und Jahr | loyer en Fr. par m² et par an ) mehr als | plus de 360 3
1
199 weniger als | moins de 160
Quellen | Sources: Realmatch360, Wüest Partner
Investitionen in Mehrfamilienhäuser: Reale Entwicklung | Investissements dans les immeubles d’habitation: évolution réelle
Investitionen zu Baupreisen 2024 ( in Mrd. Fr. ) | Investissements aux prix de la construction 2024 ( en mia. de Fr. ) Neubau | nouvelle construction Umbau | transformation Neubau Schätzung 2023 / 2024 | nouvelle construction estimation 2023 / 2024 Umbau Schätzung 2023 / 2024 | transformation estimation 2023 / 2024 Neubau Prognose | nouvelle construction prévision Umbau Prognose | transformation prévision
Quellen | Sources: Infopro Digital Schweiz, BFS, Wüest Partner
Studie zu wohnungspolitischen Massnahmen | Étude sur les mesures de politique du logement

Die Siedlung aus den 1950er-Jahren in Riehen bei Basel | Le lotissement des années 1950 à Riehen, près de Bâle
Projekt 1: Nachverdichtung | Projet 1: densification Schwedenrot | Rouge suédois
Drei schwedenrote Wohnhäuser gruppieren sich inmitten dunkelgrüner Kiefern um ein etwas kleineres, ebenfalls neues Gebäude. Eine Farbkombination, die passt. Die Nadelbäume sind eine lebendige Erinnerung an die Vorgängerbauten aus den 1950er-Jahren, die durch Holzelementbauten ersetzt wurden. Ein beinah feierlicher Dachabschluss mit geschweiften Lisenen verleiht den Gebäuden eine ganz eigene Erscheinung und erweist sich als gute Alternative zum lieblosen Elementbau-Look. Die Häuser am Hirtenweg in Riehen sind das Resultat eines Gesamtleistungswettbewerbs für preisgünstigen Wohnraum, den Immobilien Basel-Stadt 2018 ausgeschrieben hatte. Damit die angestammte Bewohnerschaft in der Siedlung bleiben konnte, wurde etappenweise gebaut. Zur Reduktion von Kosten und Emissionen sind die drei Ersatzneubauten in die Grube der alten Keller betoniert. Jedes Gebäude ist durch ein Hochparterre etwas von der Umgebung abgehoben und wird von einem offenen Treppenhaus erschlossen. Lauben bieten Platz für gemeinschaftliche Sitz- oder Spielgelegenheiten, vor den Wohnungseingängen gibt es Raum zur individuellen Aneignung. Er ergänzt die suffizienten Grundrisse ( 85 bis 90 Quadratmeter bei 4 ½ Zimmern ) so p assend wie die rote Fassade den Baumbestand. Jenny Keller
Au milieu de pins vert sombre, trois bâtiments rouge suédois sont regroupés autour d’un autre immeuble neuf, plus petit. L’association de couleurs est harmonieuse. Les conifères sont un souvenir vivant des bâtiments des années 1950, désormais remplacés par des constructions en ossature bois. Un acrotère presque solennel et des lésènes incurvés leur confèrent une esthétique très personnelle, une bonne alternative à l’aspect quelconque des constructions modulaires. Les immeubles situés au Hirtenweg à Riehen résultent d’un concours lancé par Immobilien Basel-Stadt en 2018 pour la création de logements abordables. Une réalisation par phases a permis aux habitants de rester sur place durant le chantier. Pour réduire les coûts et les émissions, les trois nouveaux bâtiments ont leur fondation dans l’excavation des anciens sous-sols bétonnés. Légèrement détaché de l’environnement par un rez-de-chaussée surélevé, chaque immeuble est desservi par une cage d’escalier ouverte. Des coursives accueillent des espaces de repos et de jeux, tandis que les résidents peuvent s’approprier les espaces devant les entrées des appartements. Ces espaces complètent les surfaces spacieuses des logements ( 85 à 90 m2 pour 4 ½ piè ces ) comme la façade rouge complète l’espace arboré. Jenny Keller
Durch Etappierung konnte die Bewohnerschaft bleiben. | Grâce à une mise en œuvre par étapes, les habitants ont pu rester sur place. A A
Grundrisse mit Laubengängen | Plans sobres avec coursives

Raumfolgen gehen auch kostengünstig. | L’agencement des espaces a été également peu coûteux.

Wohngebäude am Hirtenweg, 2022 |
Immeubles d’habitation au Hirtenweg, 2022
Hirtenweg 4, Riehen BS Auftragsart | Type de mandat: Wettb ewerb, 2018 | Concours, 2018 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Immobilien
Basel-Stadt
Architektur | Architecture: Studio Gugger, Basel Holzbau | Construction en bois: Erne, Laufenburg
Gebäudetechnikplanung | Planification en technique du bâtiment: Kalt & Halbeisen, Basel
Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Fontana, Basel Geschossfläche | Surface de plancher: 6657 m2
Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) |
Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ):
keine Angaben | n c.
Baukosten ( BKP 2 / m3 ) |
Coûts ( CFC 2 / m3 ): keine Angaben | n c.
THGE Erstellung |
GES réalisation: keine Angaben | n c.
THGE Betrieb |
GES exploitation: keine Angaben | n c.
Stromerzeugung |
Production d’électricité: keine Angaben | n c.
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: Ersatzneubauten, aber bestehende Baugrube benutzt | M aintien de l’existant: bâtiments neufs, mais reprise de l’excavation existante
B Verhältnis Bestand / Neubau: Ausdruck und Konstruktionsart neu ; Gebäudesetzung reagiert auf Bestand | Rapport bâti existant / n ouveau: nouveauté dans l’expression et le type de construction ; les bâtiments sont adaptés à l’existant
C Gr ad der Nachverdichtung: von 12 auf 43 Wohnungen ! | N iveau de densifica-
tion: de 12 à 43 appartements ! D Fre iraum: Viele prägende Bäume konnten stehen bleiben ; weniger Freiraum, dafür besser nutzbar | E space non bâti: de nombreux arbres caractéristiques ont été préservés ; un espace non bâti réduit, mais mieux exploité E S oziale Integration: Durch die etappierte Umsetzung konnte die Bewohnerschaft in der Siedlung wohnen bleiben ; L aubengänge als Kommunikationsraum | Intégration sociale: grâce à la mise en œuvre progressive du
p rojet, les habitants ont pu continuer à vivre sur place ; le s coursives servent d’espaces d’échange
F Ö kologische Bauweise: Standard-Holzbau | C onstruction écologique: construction en bois standard

Die Siedlung aus den 1980er-Jahren in Embrach | Les immeubles des années 1980 à Embrach
Projekt 2: Nachverdichtung | Projet 2: densification Gezielt ergänzt | Ajouts ciblés
Eine Wohnsiedlung in Embrach aus den 1980er-Jahren war sanierungsbedürftig. Anstatt sie abzubrechen, wurde sie mit gezielten und gestalterisch hochwertigen Eingriffen aufgewertet. Zwei neue Atriumgebäude schliessen das Ensemble aus leicht gestaffelten Zeilen ab und ergänzen das bestehende Wohnungsangebot aus grosszügigen 3 ½sowie 4 ½- und 5 ½-Zimmer-Familienwohnungen mit barrierefreien Kleinwohnungen. Der grüne Innenhof liegt auf der verstärkten Decke der Tiefgarage und verfügt über veritable Aussenraumqualität: Die Bewohnerschaft gärtnert in Pflanzbeeten, Bäume und Sträucher spenden Schatten und verbessern die Biodiversität. In den Neubauten sind ein Gemeinschaftsraum sowie Büros und Kleingewerbe im Erdgeschoss auf den Hof hin ausgerichtet. Die offenen Atrien bringen Licht und Luft in die Erschliessungszone der effizient angelegten Kleinwohnungen. Kastenfenster mit Sitzbank in den Küchen der sanierten Wohnungen öffnen die Privatheit ein wenig. Jenny Keller
À Embrach, un lotissement des années 1980 devait être rénové. On préféra le valoriser par des interventions ciblées de qualité que le démolir. Deux nouveaux bâtiments avec atrium ferment la succession d’immeubles légèrement décalés et ajoutent aux logements spacieux de 3 ½, 4 ½ et 5 ½ piè ces destinés aux familles, des appartements plus petits, sans obstacles. La cour intérieure végétalisée recouvre la dalle renforcée du garage souterrain et possède les qualités d’un véritable espace extérieur: les habitants cultivent les plates-bandes, des arbres et des arbustes créent de l’ombre et favorisent la biodiversité. Les nouveaux bâtiments abritent au rez-de-chaussée un espace commun, des bureaux et des petits commerces qui donnent sur la cour. Les atriums ouverts apportent de la lumière et de l’air dans la zone de desserte des petits appartements disposés de manière efficace. Dans les cuisines des logements rénovés, les fenêtres à caisson équipées d’une banquette agrandissent un peu l’espace privé. Jenny Keller
Sanierung und Teilersatz Siedlung Im Grund, 2019 / 2020 | Rénovation et reconstruction partielle du lotissement Im Grund, 2019 / 2020 Im Grund, Embrach ZH Auftragsart | Type de mandat: Machbarkeitsstudien , Direktauftrag, 2016 | Étude s de faisabilité, mandat direct, 2016 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Specogna Immobilien, Kloten Architektur | Architecture: Züst Gübeli Gambetti, Zürich
Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Hager Partner, Zürich Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 10,9 Mio. ( Sanierung | rénovation ), Fr. 16,8 Mio. ( Teilersatz | reconstruction partielle ) Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 479.— ( Sanierung | rénovation ), Fr. 835.— ( Teilersatz | reconstruction partielle ) Geschossfläche | Surface de plancher: 9226 m2 ( Sanierung | rénovation ), 7064 m2 ( Teilersatz | reconstruction partielle ) THGE Erstellung | GES réalisation: ca 8,8 kg CO2-eq / m2a THGE Betrieb | GES exploitation: ca 4 kg CO2-eq / m2a Stromerzeugung | Production d’électricité: keine Angaben | n. c.
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: sieben von neun Häusern erhalten und saniert ; minime Nachverdichtung auf Attika ; zwei von neun Häusern ersetzt | M aintien de l’existant: sept bâtiments sur neuf conservés et rénovés ; densification minimale sur l’attique ; deux bâtiments reconstruits
B Verhältnis Bestand / Neubau: Ausdruck der Altbauten gleicht sich den Neubauten an, nicht umgekehrt ; der Unterschied zwischen den Typologien bleibt sichtbar | Rapport bâti existant / nouveau: l’expression des bâtiments anciens reprend celle des nouvelles constructions, pas l’inverse ; la différence entre les typologies reste visible
C Gr ad der Nachverdichtung: Arealüberbauung, Wohnungsangebot in Neubauten ergänzt das bestehende Angebot mit 35 Wohnungen ( B estand: 58, neu: 93 ) | N iveau de densification: ensemble bâti, 35 appartements dans les nouveaux immeubles complètent l’offre ( 93 contre 58 auparavant )
D Freiraum: Aufwertung der Umgebung ; Gemüsegärten und mehr Bäume | E space non bâti: revalorisation des extérieurs ; potagers et plantation d’arbres
E S oziale Integration: hohe Eingriffstiefe im Bestand, deshalb Leerkündigungen ( z wei Jahre davor angekündigt ) | Int égration sociale: important travail sur l’existant, d’où des résiliations collectives ( annoncées deux ans à l’avance ) F Ö kologische Bauweise: Minergie-P bei Neubauten, Wärmerückgewinnung, Bedarfslüftung ; Umstellung von Öl auf Fernwärme ( ganze Siedlung ) ; hochwertige Materialisierung, massive Bauweise, dadurch viel graue Energie | C onstruction écologique: Minergie-P pour les nouveaux bâtiments, récupération de chaleur, ventilation contrôlée ; passage du fioul au chauffage urbain ( dans tout l’ensemble ) ; matériaux de qualité, construction massive, source d’importante énergie grise

Atrium erschliesst die neuen Wohnungen. | Un atrium dessert les

Pflanzbeete laden zum Gärtnern ein. | Des plates-bandes invitent au jardinage. Fotos | Photos: Roger Frei
Zwei neue Atriumhäuser verdichten die Siedlung. | Deux nouveaux bâtiments avec atrium densifient le complexe.
Querschnitt durch die Altbauten | Coupe transversale des anciens bâtiments
Themenheft von Hochparterre, August 2025 | Cahier thématique de Hochparterre, août 2025 — Bestand erweitern | Agrandir l’existant Fallbeispiele 1 – 4 | Exemples de cas 1 – 4

Die zweigeschossigen Häuser aus den 1950er-Jahren in ZürichAlbisrieden | Les immeubles de deux étages construits dans les années 1950 à Zurich-Albisrieden
Projekt 3: Aufstockung | Projet 3: surélévation Gewachsenes Haus | Extension par le haut
Die Siedlung Albisrieden von 1952 ist eine der ersten Siedlungen der Baugenossenschaft Zurlinden ( BGZ ). Die Genossenschaft hat die vier zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen saniert und zwei davon aufgestockt. Sechs neue Wohnungen kamen hinzu, davon zwei grosse Maisonettes. Leitungen, Küchen und Bäder wurden ersetzt, für die Wärmeerzeugung sorgen nun Wärmepumpen mit Erdsonden, die neue Holzfassade ist hinterlüftet. Gegen Ersatzneubauten sprach die intakte Gebäudesubstanz und die Tatsache, dass nicht wesentlich mehr Wohnraum hätte gewonnen werden können. Photovoltaik auf den Satteldächern ( bei den aufgestockten Häusern integriert ) deckt den Grossteil des eigenen Strombedarfs. Einziger Wermutstropfen: Weil das Untergeschoss bei zweien der Häuser zu mehr als der Hälfte aus dem Erdreich ragt, gilt es baurechtlich als Vollgeschoss, was eine Aufstockung verunmöglichte. Da wünschte man sich seitens der Behörden mehr Flexibilität. Trotzdem verzichtete die BGZ auch dort auf einen Ersatzneubau, beschränkte sich auf die Sanierung und erhielt die alten Dächer. Jenny Keller
Le lotissement Albisrieden de 1952 est l’un des premiers bâtis par la coopérative d’habitation Zurlinden ( BGZ ). La BGZ a rénové les quatre bâtiments de deux étages comptant 16 appartements et en a sur élevé deux, créant six nouveaux appartements, dont deux vastes duplex. Les conduites, les cuisines et les salles de bain ont été remplacées, de nouvelles pompes à chaleur géothermiques assurent la production de chaleur, la nouvelle façade en bois est ventilée. Le bâti existant intact et le faible potentiel de création de nouveaux logements n’ont pas plaidé en faveur du remplacement des bâtiments. Les modules photovoltaïques sur les toits en bâtière ( intégrés sur les surélévations ) couvrent une grande partie des besoins en électricité. Seul bémol: plus de la moitié du sous-sol de deux des bâtiments dépasse du niveau du terrain et est considérée, selon les règles de construction, comme un étage à part entière, empêchant toute surélévation. Faute de souplesse de la part des autorités, la BGZ a là aussi renoncé à reconstruire du neuf, se contentant de rénover et de conserver les toits. Jenny Keller
Aufstockung und Sanierung
Bockhornstrasse, 2025 | Surélévation et rénovation Bockhornstrasse, 2025
Bockhornstrasse 5 – 1 1, Zürich
Auftragsart | Type de mandat: Direktauftrag, 2022 | Mandat direct, 2022
Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Baugenossenschaft Zurlinden, Zürich
Architektur | Architecture: Späh, Zürich
Tragwerksplanung |
Structure porteuse: Henauer Gugler, Zürich
Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 5 Mio.
Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): ca Fr 900.— Geschossfläche | Surface de plancher: 1892 m2 ( Sanierung | rénovation ), 7064 m2 ( Teilersatz | reconstruction partielle ) THGE Erstellung | GES réalisation: 5,1 kg CO2-eq / m2a THGE Betrieb | GES exploitation: 3, 2 kg CO2-eq / m2a
Stromerzeugung |
Production d’électricité:
44,9 MWh / a ( 66 % Eigendeckung | 66 % d’autonomie )
Kennwerte nur von den aufgestockten Häusern | Indicateurs des bâtiments surélevés uniquement
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: Bis auf die Dächer der aufgestockten Häuser blieb der gesamte Bestand erhalten | M aintien de l’existant: L’existant a été entièrement conservé, à l’exception des toits des bâtiments surélevés
B Verhältnis Bestand / Neubau: Die aufgestockten und die lediglich sanierten Häuser sind einheitlich gestaltet ; Rücksprünge seitlich der Fenster sollen an die früheren Fensterläden erinnern | R apport bâti existant / nouveau: les bâtiments surélevés et ceux simplement rénovés sont homogènes ; les renfoncements sur les côtés des fenêtres doivent rappeler les anciens volets
C Gr ad der Nachverdichtung: 75 % mehr Wohnfläche bei den aufgestockten Häusern ; breiterer Wohnungsmix ( Be stand: 16, neu: 22 ) | Ni veau de densification: 75 % de surface habitable en plus dans les bâtiments surélevés ; diversité de logements accrue ( 22 c ontre 16 auparavant )
D Freiraum: neue private Balkone ; Siedlungsraum wurde aufgewertet, z. B. durch Aufenthaltsbereich mit Sandkasten, überdachte Veloabstellplätze | E space non bâti: nouveaux balcons privés ; lotissement revalorisé par une aire de loisirs avec bac à sable et abris de vélos
E S oziale Integration: Leerkündigungen, aber Ersatzwohnungen der Genossenschaft im Quartier | Intégration sociale: résiliations collectives, mais relogement dans le quartier par la coopérative F Ö kologische Bauweise: Aufstockung in Holzelementbauweise und neue Holzfassade, Fenster noch nicht ersetzt | C onstruction écologique: surélévation en éléments en bois et nouvelle façade en bois, fenêtres non remplacées

Zwei der vier Häuser sind nun aufgestockt. | Sur les quatre bâtiments, deux ont été surélevés.

Die Holzkonstruktion der Aufstockung ist sichtbar. | La structure en bois de la surélévation est bien visible. Fotos | Photos: Hanspeter Wagner
1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, Dachgeschoss | 1 er étage, 2 e étage, combles

Das Haus aus den 1950er-Jahren in Genf vor der Aufstockung | L’immeuble des années 1950 à Genève avant la surélévation
Projekt 4: Aufstockung | Projet 4: surélévation Arche als Dach |
Une arche pour toit
Genf ist gebaut. Der Stadtkanton ohne Landreserven kennt das Gebot der Verdichtung nach innen schon länger als der Rest der Schweiz. Eine Reihe von Verordnungen und Reglementierungen sollen das vertretbar machen. Das ‹ Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation › ( LDTR ) zum Beispiel stellt sicher, dass der Mietzins nach einer Renovation während fünf Jahren durch die Behörden festgelegt wird, um übermässige Mietpreissteigerungen zu kontrollieren. Dazu kommen strenge Energieeffizienzvorgaben sowie die strikte Einhaltung hoher baukultureller Standards. All das greift auch bei der Aufstockung an der Avenue Wendt. Auf einem nicht sanierten Gebäude aus den 1950er-Jahren mit 42 Wohnungen setzt das Büro Lacroix Chessex 12 neue. Durch das LDTR sind sie sehr günstig. Die Deckenträger aus Holz prägen das Erscheinungsbild von der Strasse als auch den zeitgemäss gestalteten Innenausbau. Die neuen Geschosse setzen sich klar vom Bestand ab. Dieser blieb unangetastet, weil die Bauherrschaft vorerst auf eine energetische Renovierung der Fassaden verzichten wollte. Immerhin: Das bestehende Vordach ist entwurfsprägend und beschert den beiden neuen Stockwerken rundumlaufende Balkone mit Weitsicht. Jenny Keller
Genève est dense. Cette ville-canton sans réserves foncières a découvert l’impératif de densification vers l’intérieur bien avant le reste de la Suisse. Une série d’ordonnances et de réglementations doit lui donner une assise. La ‹ loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation › ( LDTR ) garantit notamment qu’après une rénovation, le loyer soit fixé par les autorités durant cinq ans afin de contrôler les augmentations excessives. S’y ajoutent des directives d’efficacité énergétique strictes et le plein respect des standards élevés de culture du bâti. Ces exigences ont été imposées à la surélévation de l’avenue Wendt. Le bureau Lacroix Chessex est venu poser 12 nouveaux appartements sur un immeuble de 42 logements non rénové des années 1950. Ils sont très abor dables grâce à la LDTR. Les poutres de plafond en bois modèlent le paysage de la rue tout comme l’aménagement intérieur contemporain. Les nouveaux étages se distinguent clairement de l’existant resté tel quel, le maître d’ouvrage ne souhaitant pas dans un premier temps lancer de rénovation énergétique des façades. Cela étant, l’avanttoit existant a façonné le projet et offre aux deux niveaux ajoutés des balcons périphériques jouissant d’une vue dégagée. Jenny Keller ●

03.57m10.5
Echelle:1:350 1

Aufstockung Avenue Wendt, 2023 |
Surélévation Avenue Wendt, 2023
Avenue Wendt 29 – 33, Genève
Auftragsart | Type de mandat: Konzeptstudie mit drei Büros, 2019 |
Étude de conception avec trois bureaux, 2019
Bauherrschaft | Maître
d’ouvrage: Pensimo, Zürich
Architektur | Architecture: Lacroix Chessex, Genf
Tragwerksplanung |
Structure porteuse: Moser, Genf
Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement
( CFC 1 – 9 ): Fr. 8,05 Mio. Baukosten ( BKP 2 / m3 ) |
Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 1 537.— Geschossfläche | Surface de plancher: 1138 m2
THGE Erstellung |
GES réalisation: keine Angaben | n. c.
THGE Betrieb |
GES exploitation: keine Angaben | n c.
Stromerzeugung |
Production d’électricité: keine Angaben | n. c.
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: 100 % Bestandserhalt | M aintien de l’existant: conservé à 100 %
B Verhältnis Bestand / Ne ubau: Die Aufstockung schafft eine neue Welt auf dem Dach | R apport bâti existant / nouveau: la surélévation crée un nouvel univers sur le toit
C Gr ad der Nachverdichtung: 30 % mehr Wohnraum ( Be stand: 42, neu: 54 ) | Ni veau de densification: 30 % de logements en plus ( 54 c ontre 42 auparavant )
D Freiraum: keine negativen Auswirkungen auf den Freiraum, aber
auch keine Aufwertung ; durchgehende Balkone schaffen ( privaten ) Aussenraum | E space non bâti: pas d’impact négatif, mais pas de revalorisation non plus ; des balcons filants créent un espace extérieur ( p rivé ) E S oziale Integration: Die Bewohnerschaft des Bestands konnte während der Bauzeit in den Wohnungen bleiben ; Regulierung des Mietzinses während fünf Jahren | Intégration sociale: les résidents ont pu rester dans leurs logements durant les travaux ; régulation des loyers pendant cinq ans
F Ö kologische Bauweise: konventioneller
Holzbau, neue Wärmepumpe, Photovoltaikanlage auf dem Dach | C onstruction écologique: construction bois classique, nouvelle pompe à chaleur, installation photovoltaïque en toiture
« Erst einmal im Wohnzimmer sitzen und zuhören » | « S’asseoir dans le séjour et écouter »
Was ist das eigentlich, Bestand ? Eine Wohnexpertin, eine Architektin und eine Denkmalpflegerin sprechen über Häuser, Menschen und den gemeinsamen Weg in die Zukunft. | Qu’est-ce que l’existant au juste ? Une spécialiste de l’habitat, une architecte et une conservatrice discutent de bâtiments, de leurs occupants et d’une feuille de route commune.
Interview | Interview: Jenny Keller

Marie Glaser
Die Sozial- und Kulturwissenschaftlerin leitet seit 2022 den Bereich ‹ Grundlagen Wohnen und Immobilien › des Bundesamts für Wohnungswesen ( BWO ) und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Vorher leitete sie das ETH Wohnforum –ETH CASE am Departement Architektur der ETH Zürich und lehrte als Gastprofessorin an der TU Wien | Chercheuse en sciences sociales et anthropologie culturelle, elle est depuis 2022 cheffe du secteur ‹ Questions fondamentales Logement et Immobilier › de l’OFL et membre de sa direction. Elle a auparavant dirigé l’ETH Wohnforum – ETH CASE au département d’architecture de l’EPF Zurich et enseigné en tant que professeure invitée à l’Université technique de Vienne.

Barbara Buser
Nach ihrem Studium an der ETH Zürich arbeitete die Architektin zehn Jahre in Afrika. Zurück in Basel, gründete sie unter anderem die erste Bauteilbörse, das Baubüro In Situ, den Thinktank für Projektund Stadtentwicklung Denkstatt, das Fachplanungsbüro für das Bauen im Kreislauf Zirkular und den Verein Unterdessen, der sich für die Zwischennutzung von Liegenschaften engagiert. | Après des études à l’EPF Zurich, l’architecte a travaillé en Afrique pendant dix ans. De retour à Bâle, elle a fondé la première bourse d’échange de matériaux de construction, le bureau in situ, le think tank Denkstatt de développement de projets et d’aménagement urbain, le bureau de planification spécialisée pour la construction circulaire Zirkular ainsi que l’association Unterdessen engagée dans l’utilisation transitoire de biens immobiliers.

Konstanze Domhardt
Die Architektin und promovierte Städtebauhistorikerin leitet seit 2018 die Fachstelle Denkmalpflege der Stadt Winterthur. Nach Forschungsaufenthalten in den USA war sie Dozentin an der ETH Zürich, heute lehrt sie an der Universität Zürich sowie an der ZHAW. Sie versteht Denkmalpflege als interdisziplinäres
Projekt. | Architecte titulaire d’un doctorat en histoire de l’urbanisme, elle dirige le service de conservation des monuments historiques de la ville de Winterthour depuis 2018. Après des séjours de recherche aux États-Unis, elle a été chargée de cours à l’EPF Zurich. Elle enseigne aujourd’hui à l’Université de Zurich et à la ZHAW. Elle conçoit la conservation du patrimoine comme un projet interdisciplinaire.
Folgendes Szenario: Eine alte Bewohnerschaft belegt zu viel Wohnraum in einem in die Jahre gekommenen Gebäude. Kennen Sie Beispiele oder haben Sie eigene Projekte, die zeigen, wie solche Häuser zukunftsfähig gemacht werden können ?
Marie Glaser: Das BWO fördert das Projekt MetamorpHouse Mit Erfahrungsberichten, Tipps und Tools aktiviert es das Potenzial von Einfamilienhäusern, um ein Wohnungsangebot zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Bei der Transformation von Einfamilienhausgebieten wird es mittlerweile von vielen kantonalen und kommunalen Partnern oder Stiftungen, vor allem in der Suisse romande, als Modell empfohlen. MetamorpHouse setzt beim Objekt an und entwirft gemeinsam mit der Eigentümerschaft Zukunftsaussichten für das Haus. Die Website zeigt auf, wie sanftes Verdichten geht – und wie dieses den Hausbesitzerinnen ermöglichen kann, bis ins hohe Alter zu Hause zu wohnen. Die Strategien führen zu baulichen Lösungen, wirken aber auch sozial.
Barbara Buser: Der ‹ Wohnwendeökonom › Daniel Fuhrhop zeigt schlüssig auf, dass man der Wohnungsnot begegnen kann, ohne neu zu bauen, indem man « unsichtbare Räume » mit sozialen Programmen aktiviert. Dabei geht es vor allem um eine Beratung meist älterer Eigentümerinnen, die nach dem Auszug ihrer Kinder im zu gross gewordenen Haus wohnen.
Konstanze Domhardt: Mich interessieren dabei vor allem zwei Aspekte: Wie viel Stabilität weist ein solches Einfamilienhausgebiet auf und wie viel Varianz verträgt es ? In der D enkmalpflege beschäftigt uns neben der Erhaltung und der Gestaltung in einer inventarisierten Wohnsiedlung immer auch das Gleichbehandlungsgebot. Was macht eine Transformation mit der ganzen Siedlung ? Es gilt, diese fast systemisch zu denken und sich zu überlegen, wie sich das Lebensumfeld der Menschen verändert, wenn zum Beispiel alle einen Anbau in ihren Garten stellen.
Marie Glaser: Interessant sind auch Ansätze von kommunalen B ehörden, die bei Planungsverfahren mit verschiedenen Eigentümerschaften eines Quartiers zusammenarbeiten, damit nicht jede Parzelle einzeln weiterentwickelt wird. Das bedeutet vielleicht, zwei Objekte abzureissen, um sie anschliessend mit etwas zu ersetzen, was im Quartier noch fehlt, etwa ein Quartierzentrum oder Raum für das Wohnen im Alter. Das Denken in Quartieren statt in Parzellen ist ein zukunftsfähiger Ansatz.
Geht es dann nicht vielmehr um den Freiraum anstatt um die Objekte ?
Konstanze Domhardt: Es sind die Geb äude, die im Zusammenspiel mit den Freiräumen einen Ort mitbestimmen. Sichtachsen oder Wegbezüge können ebenfalls ortsdefinierend und spezifisch sein. Um Stadtraum nach einer Transformation lesbar zu machen, muss man Dinge und Bezüge finden, die Identität stiften und einen Mehrwert generieren, auch wenn sie bisher vielleicht kaum wahrgenommen wurden. Möglicherweise haben zum Beispiel Schulkinder Trampelpfade gebildet.
Marie Glaser: Wenn wir die Suffizienz ernst nehmen, besteht die Chance von Transformationen in der Agglomeration darin, dass bestehende Strukturen so weiterentwickelt werden, dass die Wege kurz sind und ein ressourcenschonendes Wohnen möglich wird. Als zuständige Instanz für Raumplanung und Bauvorschriften kann die Gemeinde Einfluss auf die Entwicklung einer gebauten Umwelt nehmen, die eine suffiziente Lebensweise fördert. Zum Beispiel, indem sie eine angemessene Baudichte vorschreibt und Zonen für Einfamilienhäuser begrenzt. Sie kann eine Stadt der kurzen Wege fördern, indem sie auf öffentlichen Verkehr und autoarme Siedlungen s etzt. Die Ge
Imaginons le scénario suivant: des résidents âgés occupent un logement trop vaste dans un bâtiment vieillissant. Avez-vous en tête des exemples ou des projets personnels qui montrent comment adapter ces constructions pour les rendre viables ?
Marie Glaser: L’OFL soutient MetamorpHouse. Ce projet active le potentiel de maisons individuelles pour développer une offre de logements répondant aux besoins de la population par des reportages, conseils et outils. Un grand nombre de partenaires cantonaux et communaux ainsi que de fondations, notamment en Suisse romande, le conseillent aujourd’hui comme modèle pour la transformation de zones d’habitat individuel. MetamorpHouse part du bien immobilier pour imaginer avec son propriétaire des perspectives. Le site Internet détaille ce processus de densification douce et montre comment elle peut permettre aux propriétaires de rester chez eux jusqu’à un âge avancé. Ces stratégies débouchent sur des solutions constructives, mais ont aussi un impact social.
Barbara Buser: Daniel Fuhrhop, ‹ économiste de la transition dans l’habitat ›, démontre que l’on peut remédier à la pénurie de logements sans construire du neuf, en activant des « espaces invisibles » par des programmes sociaux. Il s’agit avant tout de conseils prodigués à des propriétaires d’un certain âge occupant un logement devenu trop grand depuis le départ de leurs enfants.
Konstanze Domhardt: À ce sujet, deux aspects m’intéressent avant tout: quelle stabilité une zone d’habitat individuel de ce type fournit-elle et quelles variations supporte-telle ? En conservation du patrimoine, outre la préservation et l’aménagement d’un ensemble d’habitations inventorié, nous veillons aussi toujours à un traitement équitable. Quels effets a une transformation dans tout l’ensemble ? Il s’agit d’avoir une pensée systémique et de réfléchir aux changements provoqués dans le cadre de vie si, par exemple, tout le monde ajoute une annexe dans son jardin.
Marie Glaser: L’approche des autorités communales est également intéressante: à la planification, elles collaborent avec les différents propriétaires d’un quartier pour que chaque parcelle ne se développe pas séparément. Ce qui peut signifier démolir deux bâtiments pour les remplacer par quelque chose qui manque encore dans le secteur, comme une maison de quartier ou des logements pour seniors. Penser à l’échelle du quartier plutôt que de la parcelle est une approche porteuse d’avenir. → →

Mehr teilen
Eine aufgewertete Wohnung kommt wenigen zugute, ein aufgewerteter (halb) öffentlicher Freiraum vielen. Weniger privater Wohnraum kann mit mehr gemeinschaftlichen Räumen kompensiert werden.
Partager davantage
Un logement rénové profite à peu de personnes, contrairement à un espace non bâti (semi-)public réaménagé. Une surface privée moins grande peut être compensée par davantage d’espaces collectifs.
Projekte | Projets 1, 2, 5, 7
staltung einer Umgebung kann vielseitig nutzbar sein und dem Langsamverkehr zugutekommen. Kommunale Behörden können privaten Grundeigentümerinnen einen Dichtebonus gewähren als Gegenleistung für eine energieoder flächensparende Ausgestaltung.
Barbara Buser: Wir gehen immer vom Bestand aus, das ist uns wichtig. Dabei umfasst Bestand nicht nur Gebäude, sondern auch das soziale Geflecht und wirtschaftliche Aspekte: Wo befinden sich Läden ? Gibt es weiteres Gewerbe ? Wo ist etwas los ? Welche Probleme bestehen ? Sobald wir das Land gesichert haben – Regel Nummer 1 b ei einer Transformation –, gehen wir auf die Menschen zu. Wir laden Nachbarn, Anwohnerinnen, Schulkinder und die Behörden ein, um ihnen zuzuhören. Was erzählen sie uns über ihren Lebensraum ? Durch das Zuhören merkt man, was an einem Ort nötig und möglich ist. Meist sind das wertvolle Anregungen, die wir dann auch in die Planung aufnehmen. Wenn das Gesagte in der Schublade verschwindet, sind partizipative Veranstaltungen nicht zielführend.

Barrierefrei (um)bauen Zugänglichkeit ist nötig und wichtig. Gezielte Hürden halten aber auch fit.
Bâtir ou transformer sans obstacles L’accessibilité est nécessaire et essentielle, mais des obstacles ciblés permettent de garder la forme.
Projekt | Projet 6
Konstanze Domhardt: Das heisst, ihr macht eine Analys e von allem, was ihr vorfindet, nicht nur vom Gebauten und den Zwischenräumen. Ihr betreibt wirklich Oral History. Das ist interessant – und entspricht auch unserem Vorgehen: erst einmal im Wohnzimmer sitzen und zuhören. Denkmalpflege befasst sich tatsächlich weniger mit Gebäuden als vielmehr mit Menschen und ihren Geschichten – sie ist im eigentlichen Sinne ein Pflegeberuf.
Barbara Buser: Wir zeichnen dann eine Schatzkarte, auf der wir alles festhalten, was wir gefunden haben. Später kann man auch noch einmal darüber diskutieren, ob etwas für die einen ein Schatz und für die anderen ein Schandfleck ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nach einer Tabula rasa 20 bis 30 Jahre braucht, bis ein Gebiet wieder zu leben beginnt. Das Schlimmste ist, wenn der Lebensstrom abbricht. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, sanft und Schritt für Schritt zu sanieren, umzubauen und umzunutzen.
Architektin und Denkmalpflegerin sind sich also einig: Sie wollen nicht abreissen. Aus unterschiedlichen Gründen ?
Konstanze Domhardt: Grundsätzlich geht es uns beiden um eine Wertbeständigkeit über eine lange Zeit. Ein Abbruch unterbricht diese Wert und Wiss ensvermittlung. Es muss nicht alles erhalten werden, aber die Frage ist: Brechen wir das Richtige ab ?
Marie Glaser: Die heutige und die zukünftige Aufgabe liegt im Umbauen und Ergänzen. Der Ersatzneubau allein kann es nicht mehr sein !
Cette approche ne s’intéresse-t-elle pas alors davantage aux espaces non bâtis qu’aux biens ?
Konstanze Domhardt: C’est la synergie entre bâti et non bâti qui définit un lieu. Les perspectives visuelles ou les cheminements peuvent aussi caractériser un lieu et sa spécificité. Pour qu’un espace urbain soit lisible après une transformation, il faut trouver des références qui créent une identité et une valeur ajoutée, même s’ils n’ont peut-être guère été identifiés jusque-là. Dans cet esprit, nous pouvons évoquer par exemple des sentiers créés par les élèves.
Marie Glaser: Si nous prenons au sérieux l’impératif de sobriété, la transformation au sein des agglomérations se fera en développant des structures existantes pour offrir des distances courtes et un habitat respectueux des ressources. La commune, chargée de l’aménagement du territoire et de règlementer les constructions, peut influer sur le développement d’un environnement bâti favorisant un mode de vie sobre. Elle peut par exemple définir une densité de bâti appropriée et limiter les zones d’habitat individuel ou promouvoir une ville des courtes distances en misant sur les transports en commun et des lotissements avec peu de voitures. L’agencement des espaces extérieurs permet de favoriser une diversité d’usages et la mobilité douce. Les autorités communales ont aussi la possibilité d’accorder un bonus de densité aux propriétaires fonciers en échange d’un réaménagement économe en énergie ou en surfaces.
Barbara Buser: Pour nous, il est important de toujours partir de l’existant. Celui-ci n’inclut pas que les bâtiments, mais aussi le tissu social et les aspects économiques: où sont situés les magasins ? Trouve-t-on d’autres commerces ? L e quartier est-il animé ? Y a-t-il des problèmes ? Dès que nous avons sécurisé le terrain – règle numéro un de toute transformation –, nous allons à la rencontre des personnes. Nous invitons les voisins, les riveraines, les enfants et les autorités et nous les écoutons. Que nous disent-ils de leur cadre de vie ? En les écoutant, on saisit les besoins et les possibilités d’un lieu. Le plus souvent, leurs suggestions sont pertinentes et nous les reprenons dans la planification. Les événements participatifs ne servent à rien si les propositions finissent au fond d’un tiroir.
Konstanze Domhardt: Vous faites donc une analyse de tout ce que l’on trouve sur le lieu, pas seulement du bâti et des espaces intermédiaires. Vous faites véritablement de l’histoire orale. C’est intéressant. Cela correspond aussi à notre démarche: commencer par s’asseoir dans le séjour et écouter. La conservation du patrimoine s’occupe en réalité moins des bâtiments que des personnes et de leurs histoires. C’est un métier qui soigne au sens propre du terme.
Barbara Buser: Nous dessinons ensuite une carte aux trésors sur laquelle nous consignons toutes nos trouvailles. Nous en rediscutons plus tard pour décider si tel élément est un trésor pour tous ou, pour certains, une verrue architecturale. Après avoir fait table rase, il faut 20 à 30 ans pour qu’une zone renaisse. Le pire, c’est quand le flux de vie s’interrompt. Pour ne pas en arriver à cette extrémité, il est vital de rénover, transformer et réaffecter doucement et par étapes.
L’architecte et la conservatrice sont donc d’accord: pas de démolition. Pour des raisons différentes ?
Konstanze Domhardt: Au fond, nous tenons toutes les deux à une p érennité des valeurs sur une période longue. Toute démolition brise cette transmission de valeurs et de connaissances. Il ne faut pas tout conserver, mais la question est: démolissons-nous les bons objets ?
Marie Glaser: Notre travail pour aujourd’hui et pour demain consiste à transformer et compléter. Les simples démolitions-reconstructions, c’est fini !

Spuren wertschätzen
Bestehendes stiftet Identität und spendet Charakter. Es schafft keine Zwänge, sondern Möglichkeiten zur intelligenten Aneignung.

Gezielt ergänzen
Neue Bauteile können ein Haus öffnen: zum Licht, zur Gemeinschaft oder zur Aussicht.
Ajouts ciblés De nouveaux éléments de construction peuvent ouvrir un bâtiment: vers la lumière, la communauté ou la vue.
Projekte | Projets
2, 4, 5, 6, 7, 8
Garder les traces du passé L’existant est vecteur d’identité et porteur d’une expression. Loin de former un carcan, il promet une appropriation raisonnée.
Projekte | Projets 4, 5, 6, 7, 8
Barbara Buser: Im Sinne der Stadt der kurzen Wege ist es auch ganz wichtig, dass es im Transformationsgebiet eine gemischte Nutzung gibt.
Marie Glaser: Genau, die Mischung von Wohnen und Arbeiten ist in vielen Fällen möglich und schafft Flexibilität für ein Quartier. Wenn wir die 15Minuten Stadt anstreb en, müssen wir das auch in unseren Vorgaben und in den Planungsgrundlagen abbilden. Oft sind diese Vorgaben überholt. Wie lässt sich trotzdem eine lebendige Stadt planen ?
Konstanze Domhardt: Die Nutzungsplanung ist ein extremer Hebel. Eine zu funktionale Sicht, die bis zu den CIAMKongressen zurückreicht, verhindert Kreativität. Man könnte Stadt anders denken als so – auch wenn das jetzt etwas weit von meinem Fachgebiet entfernt ist. Wie es möglich ist, in den Prozessen Ermessens und Gestaltungsspielräume offen zu halten, beschäftigt mich sehr. Alle Beteiligten müssen ihre Rolle wahrnehmen: Eine Architektin muss dem Eigentümer sagen können, dass es sich vielleicht nicht um das richtige Haus für seine Bedürfnisse handelt. Das darf nicht immer nur Aufgabe der Denkmalpflegerin oder des Bauinspektors sein.
Barbara Buser: Ich glaube, dass die heutige Stadtentwicklung ganz viel mit den ökonomischen Grundlagen zu tun hat, obwohl man diese nicht nennt. Das Problem ist das viele Geld, das Anlagemöglichkeiten sucht.
Marie Glaser: Zuallererst braucht es die Bereitschaft, zwischen Zielkonflikten oder den unterschiedlichen Interessen eine Balance auszuhandeln. Konstanze Domhardt: Unsere Erfahrung ist, dass das möglich ist. Es gilt, von Anfang an alle an einen Tisch zu holen. Wir haben gute Prozesse, aber man muss sie ernst nehmen und sich offen austauschen. Das fällt uns in Winterthur leichter, weil alle Fachstellen in einem Haus sind. Ich gehe ein Stockwerk nach oben zur Energiefachstelle und zur Feuerpolizei oder nach unten zum Tiefbauamt. Natürlich geht das nicht überall so einfach, aber prinzipiell ist es möglich. ●

Baudenkmäler
pflegen Instandhaltung und Pflege verlängern das Leben von Gebäuden, eine Transformation schenkt ihnen ein neues Leben.
Entretenir les monuments Entretenir et soigner les bâtiments, c’est augmenter leur longévité. Les transformer équivaut à les faire renaître.
Projekte | Projets 5, 6, 7, 8
Barbara Buser: Il est aussi trè s important que la zone de transformation offre une mixité d’usages, selon le concept de ville des courtes distances.
Marie Glaser: Tout à fait. Dans de nombreux cas, le mélange entre habitat et activités professionnelles est possible et apporte de la flexibilité à un quartier. Si nous visons la ville du quart d’heure, nous devons l’introduire aussi dans nos directives et dans les bases de planification. Souvent, ces directives sont dépassées. Comment planifier malgré tout une ville vivante ?
Konstanze Domhardt: Le plan d’affectation est un levier puissant. Appliquer une vision trop fonctionnelle, héritée des CIAM, étouffe la créativité. Une autre idée de la ville est possible, même si c’est aujourd’hui un peu éloigné de mon domaine de spécialisation. Comment garder ouvertes les marges d’appréciation et de conception dans les processus ? J’y réfléchis beaucoup. Les parties prenantes doivent assumer leur rôle: une architecte doit pouvoir dire au propriétaire que le bien souhaité ne correspond peut-être pas à ses besoins. Cela ne peut pas toujours incomber à la conservatrice ou à l’inspecteur des bâtiments.
Barbara Buser: Le développement urbain actuel et les fondements économiques sont, selon moi, très imbriqués, même si on ne les évoque pas. Le problème est l’argent en abondance qui cherche des possibilités de placement.
Marie Glaser: Il faut avant tout vouloir trouver un équilibre entre les conflits d’objectifs et les différents intérêts.
Konstanze Domhardt: D’après notre expérience, c’est possible. Il s’agit de réunir dès le début tout le monde autour d’une table. Nous avons des processus de qualité, mais il faut les prendre au sérieux et échanger en toute franchise. À Winterthour, la tâche est plus facile, tous les bureaux sont regroupés sous un seul toit. Je n’ai qu’un étage à monter pour le service de l’énergie et la police du feu ou à descendre pour les travaux publics. Bien sûr, ce n’est pas partout aussi simple, mais sur le principe, c’est possible. ●

Projekt 5: Transformation | Projet 5: transformation Wohnen im Spital | Habiter dans l’hôpital
Der Kanton Basel-Stadt hatte das Felix-Platter-Spital aus dem Inventar entlassen. Als es 2019 in den Neubau nebenan zog, wurden Flächen frei für eine neue Nutzung. Die Genossenschaft Wohnen & mehr erhielt sie im Baurecht und entwickelte das Quartier Westfeld: mit offenem Blockrand, 525 Wohnungen und zahlreichen Einrichtungen für Familien, ältere Menschen und das ganze Quartier. Im 105 Meter langen und 35 Meter hohen Hochhaus, das nun unter Denkmalschutz steht, befinden sich neben 134 Wohnungen in vielen Grössen und Arten auch gemeinschaftliche Nutzungen. Die Architekten bemühten sich, nur so viele Eingriffe wie nötig vorzunehmen. Die Betongitter der Nordfassade blieben ebenso erhalten wie die gefaltete Südfassade, hinter der sich nun Loggien befinden. Als Erschliessung und Begegnungsraum zieht sich eine Rue intérieure mit Kaskadentreppe über alle zehn Geschosse bis hinauf zur gemeinsamen Dachterrasse. Die Öffnung der Decke gab der Eingangshalle im Erdgeschoss ihre noble Höhe. Öffentliche Nutzungen in den flachen Anbauten fördern das Quartierleben. Axel Simon
Le canton de Bâle-Ville avait supprimé de l’inventaire l’hôpital Félix Platter. Après son installation dans le nouveau bâtiment voisin en 2019, il s’agissait de réaffecter les anciens locaux devenus libres. La coopérative d’habitation wohnen & mehr les a obtenus en droit de superficie et a développé le quartier Westfeld, constitué d’une rangée de bâtiments ouverte, de 525 logements et de nombreux équipements destinés aux familles, aux personnes âgées ainsi qu’à l’ensemble du quartier. Désormais classé, cet immeuble long de 105 mètres et haut de 35 mètres accueille 134 appartements de tailles et dispositions diverses ainsi que des équipements collectifs. Les architectes s’efforcèrent de limiter leurs interventions au strict nécessaire. Le quadrillage de béton sur la façade nord fut préservé, tout comme les articulations en plis de la façade sud derrière lesquelles se cachent des loggias. Conçue comme lieu de circulation et de rencontre, l’allée intérieure relie les dix étages par un escalier en cascade qui permet de rejoindre la terrasse collective située sur le toit. Le hall d’entrée profite d’une hauteur généreuse grâce à l’ouverture des plafonds. Les différents espaces ouverts au public dans les ailes basses contribuent à la vitalité du quartier. Axel Simon
Fassadenschnitt


Die Aussenräume des neuen Quartiers sind grün und autofrei. | Les espaces extérieurs du nouveau quartier sont végétalisés et piétonnisés. Fotos | Photos: Ariel
Transformation FelixPlatter-Spital, 2022 | Transformation de l’hôpital Félix Platter, 2022
Im Westfeld 30, Basel Auftragsart | Type de mandat: Studienauftrag im Dialog mit Präqualifikation, 2018 | Mandat d’étude avec procédure de dialogue et préqualification, 2018 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Baugenossenschaft Wohnen & mehr, Basel
Architektur und Baumanagement ( Generalplanung ) | Architecture et gestion des travaux (planification générale): Müller Sigrist, Zürich ; Rapp, Münchenstein
Tragwerksplanung | Structure porteuse: Dr. Lüchinger & Meyer, Zürich
Bauphysik | Physique du bâtiment: Durable, Zürich
HLK-Planung | Conception CVC: Heivi, Basel Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Lorenz Eugster, Zürich
Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) |
Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 78 Mio. Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 7 34.—
Geschossfläche | Surface de plancher: 24 445 m2
THGE Erstellung | GES réalisation: 5,6 kg CO2-eq / m2a
THGE Betrieb | GES exploitation: 2, 25 kg CO2-eq / m2a
Stromerzeugung | Production d’électricité: 108,4 MWh / a ( 99,8 % Eigendeckung | 99,8 % d’autonomie )
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: Die Fassade blieb, das Innere baute man bis auf den Rohbau zurück | M aintien de l’existant: façade préservée, aménagement intérieur entièrement repris à partir du gros œuvre
B Verhältnis Bestand / Neubau: von aussen ein Baudenkmal, innen etwas Neues, das sich gut mit der äusseren Erscheinung verbindet | Rapport bâti existant / nouveau: bâtiment classé à l’extérieur, réaménagement à l’intérieur, mais réalisé en harmonie avec l’aspect extérieur
C Gr ad der Nachverdichtung: völlige Transformation | Niveau de densification: transformation intégrale
D Fr eiraum: Der Erhalt des Hochhauses spielte einen grossen Teil des Areals frei ; Aufwertung der Freiräume der flachen
Nebengebäude | Espace non bâti: le choix de conserver l’immeuble a permis de dégager une grande partie du site ; valorisation des espaces non bâtis et des ailes basses
E S oziale Integration: Mischnutzung und gemeinschaftliche Einrichtungen wie Gäste -
wohnung und -zimmer, Co-Working, Café, Angebote für ältere Menschen | Intégration sociale: utilisation mixte et équipements collectifs tels que logement et chambre d’hôtes, espace de coworking, café, services pour personnes âgées F Ö kologische Bauweise: Erhalt der Bausubstanz, dadurch z. B. Wärmebrücken ; grundsätzlich Öko-Materialien | C onstruction écologique: structure préservée, avec ponts thermiques pour conséquence ; systématiquement, matériaux écologiques

Projekt 6: Transformation | Projet 6: transformation Stöckli in gross | Stöcklis grand format
Eine ehemalige Fahnenfabrik in St. Gallen ist das erste Haus der neuen Genossenschaft SeGeWo. Ältere Menschen sollen hier selbstbestimmt und langfristig günstig wohnen können. Im markanten Kopfbau, in dem sich einst die Verwaltung und die Verkaufsabteilung der Fabrik sowie eine Wohnung befanden, sind nun Gemeinschaftsräume, Gästezimmer und zwei Wohnungen untergebracht. Dem Kopfbau sieht man die Umnutzung von aussen kaum an. Der eingeschossige Fabrikteil dagegen hat sich stark gewandelt. Aussenmauer und Bodenplatte blieben erhalten, der mehr als 50 Meter lange Baukörper wurde stark erweitert: Oben wurde ein Geschoss daraufgesetzt, zur Strasse kam ein Laubengang hinzu. Zehn kurze Treppen führen vom Trottoir auf den Laubengang. Schottenwände teilen das Innere der ehemals offenen Halle in zehn Wohnungen. Die Raumhöhe von fast 4,3 Metern macht aus den 2-Zimmer-Wohnungen im Hochparterre veritable Lofts. Ein zentral angeordnetes Bad teilt die 15 Meter Tiefe in zwei Räume. Die zehn Wohnungen im aufgestockten Geschoss sind nahezu gleich geschnitten. Sie sind nur 2,45 Meter hoch und hab en eine kleine Loggia. Axel Simon
Le premier bâtiment de la nouvelle coopérative SeGeWo est une ancienne fabrique de drapeaux à Saint-Gall. Il doit permettre à des seniors d’y vivre durablement de manière autonome et à des loyers modérés. Édifice de caractère, le bâtiment de tête accueillait jadis les bureaux et le service des ventes de l’usine ainsi qu’un logement ; il abrite désormais les espaces communs, les chambres d’hôtes et deux logements. C’est à peine si la transformation du bâtiment de tête est perceptible de l’extérieur, alors qu’elle a été radicale pour la construction qui abritait l’usine sur un seul niveau. Les murs extérieurs et le dallage ont été conservés, l’édifice de plus de 50 mètres de long a lui fait l’objet d’une vaste extension: un étage a été ajouté et une coursive a vu le jour côté rue. Dix petits escaliers relient la coursive au trottoir. Des murs de refend segmentent l’espace intérieur des anciens ateliers en dix deux-pièces que la hauteur sous plafond de près de 4,3 mètres transforme en véritables lofts au rez supérieur. Placée au centre, la salle de bain vient découper la profondeur de 15 mètres en deux volumes. Les dix appartements de l’étage rajouté ont tous une configuration pratiquement identique. Hauts de seulement 2,45 mètres, ils ont une petite loggia. Axel Simon
Transformation einer Fabrik, 2023 |
Transformation d’une fabrique, 2023
Lindenstrasse 122, St. Gallen
Auftragsart | Type de mandat: Direktauftrag, 2020 | Mandat direct, 2020 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Genossenschaft SeGeWo, St. Gallen
Architektur | Architecture: Markus Alder, St Gallen Tragwerksplanung | Structure porteuse: Nänny + Partner, St. Gallen
HLK-Planung | Conception CVC: IG Energietechnik, St. Gallen
Bauleitung | Conduite des travaux: Bochsler, Bischofszell
Freiraumplanung | Conception des espaces non bâtis: PR, Arbon
Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 8,08 Mio. Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 559.— Geschossfläche | Surface de plancher: 3037 m2 THGE Erstellung | GES réalisation: keine Angaben | n. c. THGE Betrieb | GES exploitation: keine Angaben | n. c. Stromerzeugung |
Production d’électricité: 24,95 MWh / a ( 21,75 % Eigendeckung | 21,75 % d’autonomie )
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: im Kopfbau das meiste erhalten, Innenwände neu ; im F abrikteil Aussenwände, Bodenplatte, Fundamente erhalten | M aintien de l’existant: conservation quasi intégrale du bâtiment de tête, réaménagement des cloisons ; p artie usine: conservation des murs extérieurs, du dallage et des fondations
B Verhältnis Bestand / Neubau: neuer Aus druck für neue Nutzung, wobei das Aussehen des Bestands als Grundlage diente | Rapport bâti existant / nouveau: nouvelle expression pour nouvel usage, avec la visibilité de l’existant comme fil conducteur
C Gr ad der Nachverdichtung: Bestand 1 Wohn ung, neu 22 Woh nungen | N iveau de densification: bâtiment d’origine 1 logement, neuf 22 l ogements
D Freiraum: Ein Dachgarten und Pflanzgärten kamen hinzu | E space non bâti: un jardin en toiture et des potagers ont été créés
E S oziale Integration: selbstbestimmtes und günstiges Wohnen im Alter ; Gemeinschaftseinrichtungen | Intégration sociale: vivre en toute indépendance et à loyer modéré pour les seniors ; équipements collectifs F Ö kologische Bauweise: viel ( Recycling- ) B eton trotz Reduktionsversuchen ; Einsteinmauerwerk und biologische Dämmstoffe ; Photovoltaik und Erdsonden | C onstruction écologique: beaucoup de béton ( r ecyclé ) malgré des efforts de réduction ; murs à simple paroi et isolants biologiques ; photovoltaïque et sondes géothermiques

Die Treppenzugänge erinnern an Arbeiterhäuser. | Les marches d’accès à l’escalier rappellent les maisons ouvrières.

Die Rippendecke spart Material. | Les solives du plafond permettent d’utiliser moins de matériaux.
Erdgeschoss | Rez- de-chaussée

Die drei Bürobauten von 1959 in Baden | Les trois immeubles de bureaux de 1959 à Baden
Projekt 7: Umnutzung | Projet 7: reconversion Eigentum im Büroriegel | D evenir propriétaire dans une barre de bureaux
Die Firma Brown, Boveri & Cie., heute ABB, prägte die Stadt Baden. Wo einst eine Villa der Gründer stand, krönten ab 1959 vier eng stehende Riegel mit Büros die Kante des bewaldeten Hangs zur Limmat – zunächst mit je zwei Obergeschossen über einem offenen Erdgeschoss, dem Parkdeck. Bald kam nahtlos ein weiteres Geschoss obendrauf. Im Studienauftrag 2010 waren zwei Varianten gefordert: Umnutzung des Bestands und Ersatzneubau. Trotz des grossen Aufwands entschied man sich für die Umnutzung. Ausschlag gab der Waldabstand, den ein Neubau hätte einhalten müssen. Eine neue Betonschicht verstärkt die filigranen Betonrippendecken. Die Betonstützen der Fassade blieben ebenso erhalten wie die Raumhöhe von 2,9 Metern. Zwei Treppenhäuser pro Gebäude ersetzen die abgebrochenen Treppentürme im Süden. Neu öffnen sich die Häuser in die nördlichen Baumkronen. Wohnungstrennwände gewährleisten den erhöhten Schallschutz der 78 Eigentumswohnungen. Der öffentliche Aussenraum ist sorgfältig bepflanzt. Er quert die Häuser mittig und verbindet die Eingangsbereiche. Eine Eternitfassade mit textilen Sonnenstoren lässt die Häuser leicht wirken und erinnert an ihre Bauzeit. Axel Simon
Brown, Boveri & Cie., aujourd’hui ABB, a longtemps marqué l’identité de Baden. Là où s’élevait jadis la villa des fondateurs, quatre barres de bureaux rapprochées vinrent trôner dès 1959 sur la colline boisée descendant vers la Limmat – au départ chacune avec deux étages surmontant un rez ouvert, le parking. Rapidement, un nouvel étage fut ajouté. L’étude mise au concours en 2010 demandait deux variantes: reconversion du bâti et construction neuve. En dépit de l’ampleur des moyens requis, la reconversion a été retenue, parce qu’un bâtiment neuf aurait dû observer une distance limite avec la lisière du bois. Une nouvelle dalle renforce les planchers et leurs fines solives en béton. La trame serrée des piliers de béton en façade a été gardée, comme la hauteur sous plafond de 2,9 mètres. Dans chaque bâtiment, deux cages d’escaliers viennent remplacer les tours de circulation au sud. La nouveauté: les bâtiments s’ouvrent au nord sur la cime des arbres. Les cloisons des 78 logements en propriété assur ent un niveau d’isolation résidentielle. L’espace public extérieur, végétalisé avec soin, traverse les bâtiments par leur centre, reliant ainsi les halls d’entrée. La façade en Eternit et les stores textiles allègent l’apparence des immeubles, renvoyant à l’époque de leur construction. Axel Simon
Umnutzung Bürohäuser in Wohnhäuser, 2023 | Reconversion de bureaux en immeubles d’habitation, 2023
Römerstrasse 36 a – h , Baden AG
Auftragsart | Type de mandat: Studienauftrag, 2010 | Mandat d’étude, 2010
Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Schweizerische Gesellschaft für Immobilien, Zürich
Architektur | Architecture:
Michael Meier
Marius Hug, Zürich
Generalplanung | Planification générale: Befair, Zürich
Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Müller Illien, Zürich
Bauingenieure | Ingénierie civile: Construktur, Baden Gebäudekosten ( BKP 2 ) |
Coûts du bâtiment ( CFC 2 ): Fr. 48,7 Mio. Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 7 75.— Geschossfläche | Surface de plancher: 16 557 m2
THGE Erstellung | GES réalisation: keine Angaben | n c.
THGE Betrieb |
GES exploitation: keine Angaben | n c.
Stromerzeugung |
Production d’électricité: 168 MWh / a ( 60 %
Eigendeckung | 60 % d’autonomie )
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: bestehende Betonrippendecken als verlorene Schalung ; Erhalt der eng stehenden Stützen in der Fassade | Maintien de l’existant: plancher et solives de béton existants en coffrage perdu ; maintien de la trame serrée des piliers de béton en façade
B Verhältnis Bestand / Neubau: Der selbstbewusste Ausdruck erinnert an die Bauzeit der 1950er- / 1 960erJahre | Rapport bâti existant / nouveau: expression consciente rappelant l’époque d’origine des années 1950 / 1 960
C Gr ad der Nachverdichtung: früher Büronutzung, heute 78 Wohnungen | N iveau de densification: bureaux transformés en 78 a ppartements
D Fre iraum: von Landschaftsarchitekten sorgfältig gestaltete Aussenräume ; ein Durchgang quert die Häuser im Erdgeschoss und verbindet ihre Eingänge | E space non bâti: espaces extérieurs
aménagés avec soin par des architectes paysagers ; p assage traversant les bâtiments au rez-de-chaussée et reliant les halls d’entrée E S oziale Integration: Eigentum, keine gemeinschaftlichen Einrichtungen | Intégration sociale: propriété, pas d’équipements collectifs F Ö kologische Bauweise: Erhaltung aufwendig ; ke in hoher Standard | C onstruction écologique: préservation complexe, standard peu élevé


Die alten Decken und hohe Räume prägen die Atmosphäre. | Les plafonds d’origine et la hauteur des pièces donnent son identité au lieu. Fotos | Photos: Roman Keller
Regelgeschoss | Étage type
Querschnitt | Coupe transversale
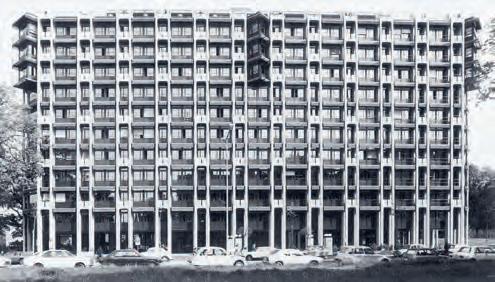
Der ehemalige Westschweizer Hauptsitz einer Versicherung in Genf | L’ancien siège romand d’une compagnie d’assurance à Genève
Projekt 8: Umnutzung | Projet 8: reconversion Plastisch ambitioniert | Ambitions plastiques
Irgendwo zwischen Spät- und Postmoderne steht das Gebäude von Jean-Marc Lamunière im Quartier Champel in Genf. Die Denkmalpflege forderte den Erhalt des einstigen Versicherungssitzes. Für die Umnutzung in 121 Wohnungen sprach die hohe Nachfrage nach Wohnraum und der historische Wert der Immobilie. Ein Studienauftrag suchte nach Lösungen, auch für eine Verdichtung. Der siegreiche Entwurf stellte statt eines Anbaus eine Erweiterung neben den Bestand. Das rhythmische Achsmass der Fassade aus Betonfertigteilen machte die Umnutzung schwierig. Die Lösung: schräg laufende Wände. Sie geben den Räumen ein gutes Mass und holen mit einer tiefen Loggia Licht in die nur einseitig orientierten Wohnungen. Im Innern halten dicke Betonstützen die Erinnerung an das Baudenkmal wach, ebenso die gerundeten Wände der beiden Fluchttreppenhäuser. Nach den heute geltenden Regeln sind diese zu klein, weshalb eine neue Fluchttreppe im Kern integriert ist. Die 60 Wohnungen im später erstellten Erweiterungsbau werden zu einem tieferen, staatlich kontrollierten Mietzins angeboten. Als Passerelle verbindet ein Gemeinschaftsraum Alt- und Neubau. Axel Simon
Ancien siège d’une compagnie d’assurance, entre fin du modernisme et postmodernisme, le bâtiment de JeanMarc Lamunière occupe le quartier de Champel à Genève. L’Office du patrimoine a demandé que cet édifice soit conservé. La forte pression sur le marché locatif ainsi que la portée historique du bâtiment justifiaient de le convertir en 121 logements. Un mandat d’étude a permis d’explorer différente s solutions, dont la densification. Plutôt qu’un agrandissement, le projet lauréat proposait une annexe à côté du bâtiment existant. Le rythme des travées de la façade en béton préfabriqué compliquait les possibilités de transformation. La solution: des murs suivant un tracé trapézoïdal. Tout en donnant aux pièces des proportions agréables, ils créent une loggia dans la profondeur du plan et apportent la lumière dans les appartements orientés sur un seul côté. À l’intérieur, les imposantes piles de béton cultivent la mémoire de l’édifice historique, tout comme les murs arrondis des deux cages d’escaliers de secours. Trop étroites, elles ne répondaient plus aux normes de sécurité en vigueur et un nouvel escalier d’évacuation a donc été intégré au cœur du bâtiment. Les 60 logements de l’extension ultérieure seront proposés à un loyer encadré par l’État. Conçu comme une passerelle, un espace commun relie l’ancien et le nouveau bâtiment. Axel Simon ●
Umbau und Erweiterung eines Bürogebäudes, 2025 / 2027 | Transformation et extension d’un immeuble de bureaux, 2025 / 2027
Avenue Louis-Aubert 20 – 22 , Genève
Auftragsart | Type de mandat: Studienauftrag, 2018 | Mandat d’étude, 2018
Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: AXA Versicherungen, vertreten durch AXA Investment Managers Schweiz, Zürich | AXA Assurances, représentée par AXA Investment Managers Suisse, Zurich
Architektur | Architecture: Brauen Wälchli, Lausanne
Totalunternehmen |
Entreprise totale: HRS Real Estate, Genf Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): keine Angaben | n c
Geschossfläche | Surface de plancher: 17 598 m2 ( Hauptnutzfläche | surface utile principale ), 10 350 m2 ( Umbau | transformation ), 4100 m2 ( Erweiterung | extension )
THGE Erstellung | GES réalisation: keine Angaben | n. c.
THGE Betrieb | GES exploitation: keine Angaben | n. c. Stromerzeugung |
Production d’électricité: keine Angaben | n. c.
Bewertung | Evaluation
A Erhalt von Bestand: vom Rohbau fast alles, von der Fassade rund die Hälfte | M aintien de l’existant: quasi-totalité du gros œuvre, près de la moitié de la façade
B Verhältnis Bestand / Ne ubau: intelligente Raumteilung ; Details und Farben greifen den Geist der 1970er-Jahre auf | Rapport bâti existant / no uveau: répartition intelligente des espaces, différents éléments et couleurs dans l’esprit des années 1970
C Gr ad der Nachverdichtung: vollständige Umnutzung in ein Wohnhaus | Niveau de densification: reconversion intégrale en immeuble résidentiel
D Freiraum: Erweiterungsbau auf alter Tiefgarage ; Anpassung des Aussenraums an heutige Bedürfnisse | E space non bâti: extension sur l’ancien parking souterrain; réaménagement de l’espace extérieur conforme aux besoins actuels
E Soziale Integration: im Erweiterungsbau kontrollierte Miete, im
umgebauten Altbau nicht | Intégration sociale: loyers encadrés dans l’extension, pas dans le bâtiment d’origine F Ö kologische Bauweise: Minergie-Standard ; et was Reuse | C onstruction écologique: Standard Minergie, un peu de réemploi

Von aussen hat sich kaum etwas geändert. | De l’extérieur, les changements sont à peine perceptibles.

Schräge Wände holen die Loggia tief ins Gebäude. | Des murs de biais font entrer la loggia dans la profondeur du bâtiment. Fotos | Photos: Ariel Huber
9. Obergeschoss | 9 e étage
Längsschnitt | Coupe longitudinale

Martin Tschirren
Der Historiker ist seit 2020 Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen ( BWO ). Davor war Martin Tschirren stellvertretender Direktor des Schweizerischen Städteverbands. Weitere berufliche Erfahrungen sammelte er in der Diplomatie und bei einem Wasserkraftwerk im Berner Oberland. | Historien de formation, Martin Tschirren est à la tête de l’Office fédéral du logement ( OFL ) depuis 2020, qu’il a rejoint après avoir occupé la fonction de directeur adjoint auprès de l’Union des villes suisses. Son parcours professionnel l’a également mené dans le domaine de la diplomatie ainsi que dans une société hydroélectrique de l’Oberland bernois.
Wohnforschung des BWO 2024 – 2027: Anpassung des Wohnungsbestands an veränderte Bedürfnisse | Recherche sur le logement de l’OFL 2024 – 2027: adaptation du parc de logements à l’évolution des besoins
Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung, Themenschwerpunkt Bestand | Projets-modèles pour un développement territorial durable, volet thématique Bâti existant
Transformation statt Expansion | Transformer plutôt qu’étendre
Die Zeit der Bauzonenausscheidung ist vorbei. Die Wohnraumentwicklung braucht einen Paradigmenwechsel: vom Neubau zur Weiterentwicklung des Bestands. | Cr éer de nouvelles zones à bâtir, une ère révolue. Le développement de l’habitat a besoin d’un changement de paradigme: délaisser le neuf au profit de la rénovation de l’existant.
Text | Texte:
Martin Tschirren
Die Schweizer Bevölkerung wächst, wird immer älter und vielfältiger. Mit diesem demografischen und gesellschaftlichen Wandel verändert sich auch der Bedarf an Wohnraum – in Grösse, Lage und Qualität. Seit einigen Jahren vermag das Angebot mit der Nachfrage nicht mehr mitzuhalten. Die Bautätigkeit geht zurück, die Leerwohnungsziffer ebenfalls. In den Grossstädten hat sich das ohnehin bereits schmale Wohnungsangebot weiter verknappt. Zunehmend sind auch touristische Berggemeinden, die Agglomerationen und andere Regionen von Wohnungsknappheit betroffen.
Die ausreichende Versorgung mit Wohnraum hat die Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder beschäftigt. 1975 führte der andauernde Wohnungsmangel unter anderem zur Gründung des Bundesamts für Wohnungswesen ( BWO ). S eit der Zustimmung zum neuen Raumplanungsgesetz RPG 1 steht das traditionelle Steuerungsinstrument zur Schaffung von Wohnraum – die Ausscheidung neuer Bauzonen – nicht mehr zur Verfügung. Und das aus gutem Grund: Eine weitere Zersiedelung würde die Landschaft fragmentieren, CO₂-Emissionen steigern und zu einem Ausbau von Infrastrukturen führen. Deshalb rückt die Siedlungsentwicklung nach innen und damit auch die Entwicklung des Bestands in den Fokus. Doch das Bauen im Bestand ist komplexer als Neubauten auf der grünen Wiese. Es erfordert eine exakte Planung, ideenreiche Konzepte, feinfühlige Eingriffe und eine enge Zusammenarbeit zwischen Behörden, Architektinnen, Investoren und der Bevölkerung. Es ist ein Paradigmenwechsel in der Wohnraumentwicklung: von der Expansion zur Transformation. Das Thema Wohnraumversorgung wird auch künftig aktuell bleiben. Mehr noch als in der Vergangenheit muss der Wohnungsbau in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Bestand stattfinden.
La population suisse s’accroît, elle vieillit et ne cesse de gagner en diversité. Sous l’effet de ces évolutions démographiques et sociétales, les besoins changent – qu’il s’agisse de la taille, de l’emplacement ou de la qualité des logements. Depuis quelques années, l’offre ne répond plus à la demande. L’activité de construction est en baisse, tout comme le nombre de logements vacants. Dans les grandes villes, le nombre déjà faible de logements sur le marché a encore chuté. Les communes touristiques de montagne, les agglomérations et d’autres régions sont également de plus en plus touchées par la pénurie de logements.
Ces dernières décennies, l’existence de logements en nombre suffisant a été un thème récurrent en Suisse. En 1975, la saturation persistante du parc résidentiel a même conduit à la création de l’Office fédéral du logement ( OFL ). L’adoption de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire ( LAT1 ) a fait disparaître le dispositif traditionnel de régulation de la production de logements: la création de nouvelles zones à bâtir. Cela, pour de bonnes raisons. En effet, l’étalement urbain ne ferait qu’accentuer le morcellement du paysage, accroître les émissions de CO₂ et nécessiter le développement des infrastructures. C’est pourquoi le développement vers l’intérieur gagne en importance et, avec lui, celui du bâti existant.
Mais construire dans l’existant est plus complexe que de bâtir de rien. Cela nécessite une coordination rigoureuse, des approches créatives, des interventions fines et une collaboration étroite entre les autorités, les architectes, les investisseurs et le public. Le développement de l’habitat fait face à un changement de paradigme: passer de l’expansion à la transformation. La question de l’approvisionnement en logements continuera de nous accompagner au cours des années, voire des décennies à venir. Plus encore que par le passé, la construction résidentielle doit se faire dans le parc existant.
Die folgenden fünf Punkte sind für das Bauen im Bestand wichtig:
Mehr Wohnraum, mehr Dichte
Bereits heute entstehen mehr neue Wohnungen durch Umbauten oder auf bereits überbauten Parzellen als früher. So erfreulich dieser Trend auch ist, so ungenügend ist die Menge dieser Wohnungen. Bauen im Bestand muss zu wesentlich mehr Wohnraum führen, was etwa durch eine höhere Ausnützung oder durch Aufzonungen erleichtert werden könnte. Bauen im Bestand bedeutet mehr Dichte –mehr bauliche Dichte ebenso wie mehr Nutzungsdichte.
Gezielt eingreifen
Nicht überall muss im Bestand gebaut werden. Wird an einem Ort verdichtet und verändert, gilt es andernorts auszusparen. Eine höhere Dichte ist dann verträglich, wenn auch qualitativ hochwertige Frei- und Grünräume zur Verfügung stehen.
Mit Sorgfalt und Respekt transformieren
Mitunter lassen sich durch eine Veränderung und eine Weiterentwicklung des Bestands Situationen verbessern, die nicht mehr überzeugen oder bereits von Anfang an unbefriedigend waren. Bauen im Bestand erfordert Sorgfalt und Respekt, damit vorhandene baukulturelle Werte nicht verloren gehen.
Bestand als Ressource betrachten
Bauen im Bestand bedeutet, Bestehendes ernst zu nehmen und als Ressource zu begreifen. Was bereits vorhanden ist und weiterverwendet werden kann, ist nicht mit klimaschädlichen Emissionen verbunden. Zudem bleibt preisgünstiger Wohnraum eher erhalten, wenn der Fokus statt auf Ersatzneubauten auf dem Bauen im Bestand liegt.
Städtebau im Kleinen
Letztlich geht es um die ganzheitliche Betrachtung eines Areals oder Quartiers. Bauen im Bestand ist Städtebau im Kleinen. Die einzelne Liegenschaft ist Teil eines grösseren Ensembles, und wenn die Bausubstanz auf einer Parzelle verändert oder erweitert wird, hat das auch Auswirkungen auf die Umgebung. Das gilt erst recht für die Agglomerationen, die in Zukunft voraussichtlich einen erheblichen Teil des Bevölkerungswachstums aufnehmen werden und ein grosses Potenzial für die Weiterentwicklung im Bestand aufweisen. ●
Les cinq points majeurs
de la construction dans l’existant:
Plus de logements, plus de densité
On dénombre déjà un plus grand nombre de logements créés à la suite de transformations ou sur des parcelles déjà construites qu’auparavant. Si cette tendance est réjouissante, la quantité de ces logements reste très insuffisante. La construction dans l’existant doit se traduire par une croissance notable des capacités résidentielles, grâce à une augmentation des possibilités de construire. Elle est synonyme de densification – du bâti et de son utilisation.
Intervention ciblée
La construction dans l’existant n’a pas besoin d’être généralisée. Transformer et densifier un lieu implique d’en écarter d’autres. Une densification viable est conditionnée par la présence d’espaces non bâtis et d’espaces verts de qualité.
L’art de transformer avec minutie et respect
Il est tout à fait possible qu’une évolution ou un développement de l’existant contribue à améliorer des situations qui ne répondent plus aux attentes ou qui n’ont jamais été satisfaisantes. Mais pour ne pas compromettre les valeurs du patrimoine bâti, la construction dans l’existant suppose un regard minutieux et respectueux.
Le bâti, une ressource
Construire dans l’existant, c’est percevoir l’existant à sa juste valeur et l’envisager comme une ressource. Réutiliser ce qui est là ne génère pas de nouvelles émissions préjudiciables au climat. De plus, l’habitat bon marché tend à être conservé si la priorité n’est pas de construire du neuf, mais dans l’existant.
Urbanisme à taille réduite
Enfin, il s’agit aussi d’appréhender un site ou un quartier dans sa globalité. Construire dans l’existant, c’est faire de l’urbanisme à taille réduite. Chaque bâtiment fait partie d’un ensemble plus vaste et le fait de changer ou d’étendre le tissu architectural d’une parcelle a un impact sur ce qui l’entoure. Cela est particulièrement vrai pour les agglomérations qui absorberont probablement une part importante de la croissance démographique et qui présentent un fort potentiel pour le développement de l’existant. ●
Dieses Themenheft ist eine journalistische Publikation, entstanden in Zusammenarbeit mit Partnern. Die Hochparterre-Redaktion prüft die Relevanz des Themas, ist zuständig für Recherche, Konzeption, Text und Bild, Gestaltung, Lektorat und Übersetzung. Die Partnerinnen finanzieren die Publikation, genehmigen das Konzept und geben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung. | Ce cahier thématique est une publication journalistique née de la collaboration entre différents partenaires. La rédaction de Hochparterre examine la pertinence du sujet et est responsable de la recherche, de la conception, du texte et des images, de la mise en page, de la relecture et de la traduction. Nos partenaires financent le cahier, valident le concept et donnent leur accord pour publication.
Impressum | Impressum
Verlag | Maison d’édition Hochparterre AG Adressen | Adresses Ausstellungsstrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon +41 44 444 28 88, www.hochparterre.ch, verlag @ hochparterre.ch, redaktion @ hochparterre.ch Geschäftsleitung | Direction Deborah Fehlmann, Roderick Hönig Redaktionsleitung | Direction éditoriale Axel Simon Leitung Themenhefte | Direction cahiers thématiques Roderick Hönig Konzept und Redaktion | Conception et rédaction Axel Simon Art Direction, Gestaltung | Conception graphique, mise en page Antje Reineck Produktion | Production Linda Malzacher Korrektorat Deutsch Lorena Nipkow Übersetzung | Traduction Weiss Traductions Genossenschaft Lithografie | Lithographie Team media, Gurtnellen Druck | Impression Stämpfli AG, Bern Herausgeber | Directeur de la publication Ho chparterre in Zusammenarbeit mit | en collaboration avec Wüest Partner und dem Bundesamt für Wohnungswesen hochparterre.ch / bestand-erweitern Themenheft bestellen ( Fr 15.—, € 12.— ) und als E -Paper lesen | Commander ce cahier thématique ( Fr 15.—, € 12.— ) et lire l’e-paper
Bestand erweitern
Um der zunehmenden Wohnungsknappheit zu begegnen, müssen wir bestehende Bauten erneuern und erweitern. Wichtige Themen wie Kreislaufwirtschaft oder bezahlbare Mieten, Denkmalpflege oder Biodiversität stehen dabei oft in Konkurrenz zueinander. Dieses Heft möchte dazu beitragen, dass sich diese komplexe Bauaufgabe nicht selbst blockiert, sondern viele Ziele vereint.
Agrandir l’existant
Pour pallier la pénurie croissante de logements, nous devons rénover et agrandir l’existant. Des thèmes essentiels comme l’économie circulaire ou l’accessibilité des loyers, la conservation du patrimoine ou la biodiversité entrent alors en concurrence. Avec ce cahier, nous souhaitons contribuer à éviter le blocage d’une tâche aussi complexe et au contraire viser à concilier un maximum d’objectifs.
In Zusammenarbeit mit | En collaboration avec:
Mit freundlicher Unterstützung von | Avec le soutien de:
Sie lesen lieber auf Papier? Dieses Themenheft hier bestellen.
Lust auf mehr Architektur, Planung und Design? Hochparterre abonnieren!