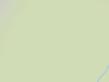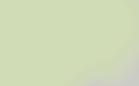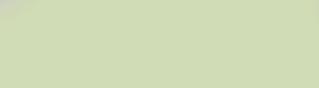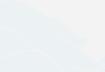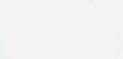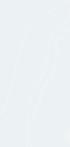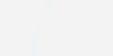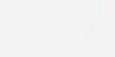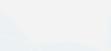Entgegen der Fliehkraft
Dübendorf explodiert an den Rändern und stagniert in der Mitte. Mit neuen Planungsinstrumenten will die Stadt beides in die gewünschten Bahnen lenken. Ein Stadtrundgang entlang der Entwicklungshotspots.
 Text: Deborah Fehlmann
Text: Deborah Fehlmann
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
8
Der Bahnhof Stettbach ist eine regionale Verkehrsdrehscheibe – und eine städtebauliche Schwachstelle. Unterschiedliche Planungskulturen prallen hier sichtbar aufeinander.
entrum iessen-Areal, Campus Empa / wag ochbord nnovationspark
ewahren weiterentwickeln umstrukturieren Zentrum enzentrum Bahnhof stadtraumprägende Strassenachsen Jaune Bleu
Siedlungsgewässer Vert Landschaftsraum eizeitanlagen
Auf der S-Bahn-Fahrt vom Hauptbahnhof Zürich nach Dü bendorf wähnt man sich fast in einer grossstädtischen Metro. Doch wer nach sieben Minuten im Tunnel am Bahn hof Stettbach an die Oberfläche kommt, findet sich an kei ner urbanen Strassenkreuzung wieder, sondern an einer Wiese mit Kühen. Hinter Bäumen versteckt sich der Dü bendorfer Weiler, der dem Bahnhof auf Zürcher Stadtge biet seinen Namen gibt.
An diesem Bahnhofsausgang beginnt Reto Lorenzi gern seine Stadtführungen. Der Leiter der Stadtplanung Dübendorf erzählt von der Park-and-ride-Anlage, die hier hätte entstehen sollen, um den Pendlern aus dem Umland die mühsamen Autokilometer in die Zürcher Innenstadt zu ersparen. « Ein Glück, dass die Anlage inzwischen aus dem regionalen Richtplan verschwunden ist », sagt er, um dann zu erklären, weshalb der gesamte Landschaftsraum am Fuss des Zürichbergs beinahe schon früher abhanden gekommen wäre. Hätte der Bund in den 1970er-Jahren die Umfahrung Dübendorf realisiert, würde heute ein Auto bahnbogen die Ebene zerschneiden. Die Pläne lagen bereit, die Erweiterung des Siedlungsgebiets bis an die Autobahn war vollzogen. Dann verschwand das Projekt in der Schub lade, 1990 erfolgte die grosse Rückzonung. « Seither wächst Dübendorf praktisch nur noch nach innen », sagt L orenzi.
Gegensätzliche Lebenswelten
Wer dieses Wachstum sehen will, muss nur den Kopf wenden. Auf dem Hochbord, einem Rechteck weit grösser als der Dübendorfer Ortskern, lagen vor zehn Jahren noch Felder und Gewächshäuser. Heute stapeln sich hier Ge werbe und Wohnungen in Blockrandbauten und Türmen. Direkt am Bahnhof ist auf gemeindeeigenem Land gera de Stettbach Mitte fertig geworden. Die Überbauung bil det mit fünf Wohngeschossen über einem dreistöckigen
Gewerbesockel das Tor zum neuen Stadtteil, Grossvertei ler, Arztpraxen und Fitnessstudio inklusive. Der Kontrast zur Gartenstadt Schwamendingen, die die Stadt Zürich auf der anderen Seite des Bahnhofs erneuert, könnte kaum grösser sein. Den städtebaulichen Bruch kann man als Am bition Dübendorfs sehen, aus dem Schatten des grossen Nachbarn zu treten und selbst Stadt zu sein – oder als Auf einanderprallen grundverschiedener Planungskulturen.
« Eine komplizierte Grenzsituation, wie es sie am Über gang von der Stadt Zürich zu den Umlandgemeinden oft gibt », sagt Kantonsplaner Wilhelm Natrup. « Fö deralisti sches Schollendenken », nennt es Architekt und Urbanist Stefan Kurath. Womit wir mitten im Thema sind: Die Nähe zu Zürich und zum Flughafen Kloten beschert Dübendorf eine enorme Standortgunst und anhaltendes Wachstum. Mit 30 000 Einwohnern und 20 00 0 Arb eitsplätzen ist sie die viertgrösste Stadt im Kanton und kann dank Entwick lungsgebieten und Verdichtungspotenzial in der Kernstadt noch um einiges weiterwachsen. Bloss: Nicht alle hier wol len Grossstadt sein. Im Ortskern ist Dübendorf ein Dorf mit Festen, Vereinsleben und Grüssen auf der Strasse. Was sich am Stadtrand abspielt, scheint hier weit weg. Um gekehrt liegt das ‹ alte › Dübendorf für viele, die ins Hoch bord-Quartier oder ins Zwicky-Areal gezogen sind, weil sie dort im Gegensatz zur Stadt Zürich eine preiswerte Wohnung gefunden haben, fernab. Mit so gegensätzlichen Stadtteilen und Lebenswelten Stadtplanung zu betreiben, ist eine Herausforderung. Mit dem räumlichen Entwick lungskonzept ( REK ) liegt nun immerhin eine politisch breit abgestützte Absichtserklärung vor, wohin Dübendorf sich als Ganzes entwickeln soll. Darauf basierend revidiert die Stadt nun ihre Planungsinstrumente. Auch im Kleinen fin den die Stadtplanerinnen zunehmend Mittel und Wege, Entwicklungen zu lenken und Qualitäten zu schaffen.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft



















































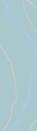





















































































































































































































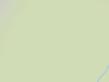


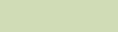





















































































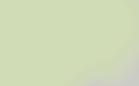
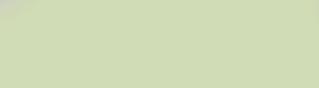










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































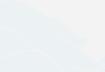


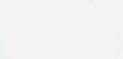



































































































































































































































































































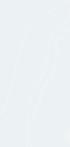

































































































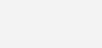















































































































































































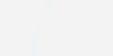






































































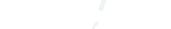








































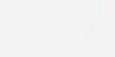















































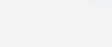
































































































































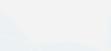






















































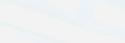































































































































9
Räumliches Entwick lungskonzept ( REK )
→
2
3
1
4

10
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
An der renaturierten Glatt ist es idyllisch. Das explosive Wachstum an den Stadträndern scheint hier weit weg.
Gebaute und geplante Objekte
a S tadthaus
b Stadtoase ( geplant )
c Klimagarten ( geplant )
d G lattquai
e S tadtpark Bettli ( geplant )
Q B ahnhof Dübendorf
21 B irchlenstrasse
22 Sp eicher Obere Mühle 23 H allenbad Oberdorf siehe Stadtplan Seiten 18 / 1 9
Das Stadthaus liegt 20 Gehminuten vom Bahnhof Stett bach entfernt. Hier arbeitet Stadtplaner Reto Loren zi –mitten in der Stadt, aber fernab vom Geschehen. Das Zentrum sei kaum als solches wahrnehmbar, ergab eine Bevölkerungsbefragung bei der Erarbeitung des REK. Das liegt daran, dass sich in früheren Zeiten nie ein richtiges Zentrum gebildet hat, es liegt aber auch an einigen städ tebaulichen Missgriffen im letzten Jahrhundert. Vor dem Stadthaus kreuzen sich zwei Hauptstrassen, der Raum rundherum verliert sich in Vor- und Parkplätzen.
Als Lorenzi vor neun Jahren hier anfing, besetzte er eine von zwei Stellen der Stadtplanung. « Heute haben wir 410 Stellenprozente und eine Stadtbildkommission. » Langweilig wird ihm deshalb noch lange nicht. Die kleine Verwaltung bietet auch Vorteile, zum Beispiel kurze Wege in die anderen Ämter und in die Politik. Das machte es etwa möglich, dass aus der Initiative der städtischen Ju gendbeauftragten für ein Freiraumkonzept für Jugendli che ein Freiraumkonzept für die ganze Stadt wurde – samt zuständiger Kommission. Für Lorenzi ein Bekenntnis zum öffentlichen Raum: « Früher hat man einfach die Sitzbänke entfernt, wenn ein öffentlicher Treffpunkt zu Lärmklagen oder Abfallproblemen führte. Heute erinnert uns das Frei raumkonzept daran, Konflikte zu schlichten, anstatt sie zu verschieben. » Am Bildschirm klickt er durch aktuelle Freiraumprojekte: Klimagarten, Stadtoase und Bettlipark im Zentrum, Giessen-, Ring- und Jabeepark in den Ent wicklungsgebieten. Die Freiräume liegen mal auf öffent lichem Grund, mal auf privatem, manche zahlt die Stadt ganz, andere teilweise, für andere übernimmt sie nur den Unterhalt – Public-private-Partnership in all ihren Schat tierungen. « Dübendorf hat bei den städtischen Freiräumen ein Defizit. Die zunehmende Dichte und der Klimawandel zwingen uns, jetzt vorwärtszumachen », so der Stadtplaner.
Um das Stadtzentrum zu stärken, reichen neue Freiräume allerdings nicht aus. Die Transformation des Flugplatzes zum Innovationspark steht noch bevor und mit ihr der Aus bau des Bahnhofs Dübendorf. Läuft alles nach Plan, wird die Glattalbahn künftig auch ihn bedienen. Spätestens dann werden die Fliehkräfte zu den Polen – Hochbord im Westen und Innovationspark im Osten – in der Kernstadt spürbar. « Die regional b edeutsamen Zentren verschieben sich an den Rand, wo die Verkehrsanbindung und das Flä chenangebot gut sind », sagt Stefan Kurath. « Die historisch gewachsenen Strukturen können nicht mithalten, und es folgen Abwertung und Leerstand. » Ein Mittel, um dem ent gegenzuwirken, wäre laut dem Urbanisten eine starke Ver dichtung des Ortskerns mit Wohnnutzung.
Mit gutem Beispiel voran
Die aktuelle Ortsplanungsrevision soll eine solche Verdichtung ermöglichen. Im Gürtel zwischen Innova tionspark und Hochbord zont die Stadt fast durchwegs auf und setzt damit Anreize, die locker gestreuten Wohn bauten aus den 1950er- bis 1970er-Jahren durch grössere zu ersetzen. Aus dem Industriestreifen parallel zum Hoch bord wird eine Zentrumszone mit Gestaltungsplanpflicht. Hier wird die Stadt neben dem ohnehin fälligen Mehrwert ausgleich einen Mindestanteil an gemeinnützigem Wohn raum vorschreiben. Und quer durch das Ortszentrum soll eine Achse mit hohem Öffentlichkeitsgrad entstehen. Ent lang des ‹ Fil Jaune ›, wie diese Achse im REK heisst, ver pflichten städtebauliche Verträge die Investoren zu öf fentlichen Erdgeschossnutzungen. Auf ihrem eigenen Areal direkt neben dem Stadthaus will die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und sucht derzeit einen Baurechts nehmer für eine Wohnüberbauung mit Gewerbeanteil – am liebsten eine Genossenschaft.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
11
Zentrum →
21
d e a b c Q 22 23

12
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
‹ Am Ring › war Schauplatz eines jahrelangen Planungskrimis. Nun entstehen zwischen Giessen-, Zwicky- und Hochbord-Areal eine Überbauung und ein Stadtpark.
Gebaute und geplante Objekte
f SI S Swiss International School
g Zwicky-Areal, Baufeld F 13 Zwicky-Areal, Baufeld E A m Ring
14 Am Ring ( geplant )
Im Giessen h L ab i M emphispark 15 G iessenhof 16 A m Giessenplatz 17 G iessenturm
Campus Empa / E awag j F orum Chriesbach k F lux
18 N est-Gebäude 19 E mpa-Forschungs campus
20 H ochhaus am Chriesbach
21 B irchlenstrasse siehe Stadtplan Seiten 18 / 1 9
Beim Spaziergang entlang der kleinstädtischen Bahnhof strasse wird deutlich, dass der Weg zur pulsierenden Stadt achse noch lang ist. Schon weit gediehen ist dagegen der ‹ Fil Bleu ›, der den ‹ Fil Jaune › auf halbem Weg zum Bahnhof kreuzt. Der Fuss- und Veloweg entlang der renaturierten Glatt ist Teil eines überkommunalen Projekts, an dem sich auch die Städte Opfikon, Zürich und Wallisellen, der Kan ton und die Planungsgruppe Glattal beteiligen. Am grünen Uferweg werfen Hundebesitzerinnen Stöckchen, drehen Geschäftsleute Joggingrunden, und auch die Enten schei nen sich wohlzufühlen. Kaum beim Stadthaus losspaziert, zeigt sich zwischen den Bäumen bereits der Giessenturm mit seinen 26 Sto ckwerken und weist den Weg zu einem weiteren Stadtteil im Umbruch.
Mehr Wohnraum – und ein Stadtpark
Die planeris che Ausgangslage zur Entwicklung des Gies sen- Are als zwischen Glatt und Ueberlandstrasse schuf die Stadt in den 1980er-Jahren, indem sie aus der Industrie- eine Zentrumszone machte. Auch der Sonder nutzungsplan für die Entwicklung eines Wohn- und Gewer begebiets stammt aus dieser Zeit. Weil der Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan hier seinen Hauptsitz hat te, passierte jedoch lange nichts. Nach dessen teilweisem Wegzug 2016 ging es dafür umso schneller. Auf einem gros sen Teil des Areals baut der Credit-Suisse-Immobilien fonds Siat das Quartier Im Giessen mit 300 Wohnungen, Altersresidenz, Gewerbe und Läden. Das Wohn- und Ge werbehaus Giessen-Lab befindet sich im Bau, der Block randbau Giessenhof, die kleinere Wohnsiedlung Gies senpark und der Hochpunkt Giessenturm stehen bereits. Bemerkenswert ist, dass das Atelier WW, das den Mas terplan für das Quartier entworfen hat, für den Giessen turm einen Direktauftrag erhielt. Für Reto Lorenzi ist die Qualität dennoch gewährleistet: « Wir verlangen b ei Ge staltungsplänen entweder ein Konkurrenzverfahren oder den Weg über die Stadtbildkommission. Hier geschah das
Zweite. Da die Bauherrschaft das Gebäude im Portfolio be hält, war ein hochwertiges Projekt ohnehin in ihrem Inter esse. » Auch rund um das frühere Givaudan-Areal ist vieles in Bewegung. Jenseits der Ueberlandstrasse erweitern die Forschungseinrichtungen Empa und Eawag ihren Cam pus, daneben planen Meier Hug Architekten das Wohn hochhaus am Chriesbach. Östlich des Quartiers Im Gies sen entsteht der Wohn- und Gewerbekomplex Am Ring mit einem 85 Meter hohen Turm. Ursprünglich hätte er noch höher werden sollen, doch den Dübendorfern waren 114 Meter zu viel und 40 Prozent Wohnanteil auf dem Areal zu wenig. Nachdem die Medien 2011 auch noch mehrere laufende Betreibungsverfahren gegen den Eigentümer pu blik gemacht hatten, versenkte das Stimmvolk den vom Parlament bereits abgesegneten Gestaltungsplan an der Urne. Fünf Jahre später trat ein revidierter Gestaltungs plan mit 85 Meter hohem Turm und 50 Prozent Wohnanteil in Kraft. Die anberaumte Zwangsversteigerung konnte der zahlungsunfähige Eigentümer jahrelang hinauszögern. In letzter Minute verkaufte er das auf 64,2 Millionen Franken geschätzte Grundstück 2020 an die Baloise.
Der Planungskrimi mit Bürgerbeteiligung dürfte zum Besten des Areals gewesen sein, nicht nur aufgrund des nun höheren Wohnanteils, sondern auch hinsichtlich der baulichen Qualität. E2A Architekten planen zusammen mit Studio Vulkan eine Überbauung, zu der auch der im Ge staltungsplan festgeschriebene Park am Ring gehört. Mit Pumptrack und Grillstelle soll er vorwiegend junge Men schen ansprechen. Reto Lorenzi freut sich, dass sich der Stadtrat von einer Kostenbeteiligung überzeugen liess: « Mit dem Park erhalten Jugendliche einen dringend b enö tigten Freiraum. Am Schnittpunkt von Zwicky-Areal, Gies sen und Hochbord gelegen, wird er ausserdem ein Herz stück des öffentlichen Lebens. » Noch braucht es Fantasie, sich den Acker neben der Hauptstrasse als Stadtpark vor zustellen. Doch wie schnell ein Acker zu Stadt werden kann, hat Dübendorf auf dem Hochbord bereits vorgeführt.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
13
Giessen-Areal und Umgebung → f i j k g h 14 13
15 18 19 20
17 16 21

14
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
Die Gewächshäuser vor den Three-Point-Hochhäusern gehören zu den letzten Zeugen des einstigen Hochbord-Areals. Auch sie weichen bald einer Wohnüberbauung.
Gebaute und geplante Objekte
l A llmend Stettbach
m F eldmann Park / Ternary
n J abee-Park
o Wohnland
p T hree-Point-Park
q T he Hall
r Helsana Versicherung
P Bahnh of Stettbach
1 S tettbach Mitte
2 S orrento
3 Westhof
4 J abee-Tower
5 Lycée Français de Zurich
6 S onnentalstrasse
7 H ofgarten-Türme
8 E rweiterung Lycée Français de Zurich
9 T hree Point
10 C osmos
11 Younic siehe Stadtplan Seiten 18 / 1 9
Das Hochbord mag sich in den letzten Jahren rasant ent wickelt haben. Doch seine Geschichte zeigt – wie s o vie le Geschichten in Dübendorf –, dass Verzögerungen und Scheitern manchmal auch ihr Gutes haben. Hier war es die Immobilienkrise der 1990er-Jahre, die das Areal vor Schlimmerem bewahrte. « 1990 war das Hochbord bis auf wenige Parzellen entlang der Zürich- und der Ueberland strasse planungsrechtlich nicht erschlossen », erzählt Wil helm Natrup, der damals als Raumplaner bei Ernst Basler und Partner mit der Planung des Hochbords betraut gewe sen war. « Ziel der Investoren war der Bau von grossflächi gen Bürobauten mit maximaler Rendite. Doch sie konnten sich jahrelang auf keinen gemeinsamen Quartierplan zur Erschliessung der Parzellen einigen. »
Mit der Immobilienkrise wurde es ruhig um das Hoch bord, und als die Planung um die Jahrtausendwende wei terging, hatte sich die Ausgangslage grundlegend verän dert: Wohnraum war knapp, und die Preise dafür stiegen, während die viel zu vielen Gewerbeflächen der letzten Jahrzehnte leer standen und an Wert verloren hatten. Zu dem war die Planung der Glattalbahn inzwischen weit fort geschritten und die Frage der Arealerschliessung damit gelöst. Unter der Federführung der Stadt ging es vorwärts mit dem Quartierplan – bis ein Grundeigentümer aufgrund des vorgesehenen Parks rekurrierte. Dass die Eigentümer zugunsten eines öffentlichen Parks anteilmässig Land ab treten müssten, sei im Rahmen eines Quartierplans nicht zulässig, argumentierte er und bekam vor Bundesgericht recht. Die Stadt musste zurückkrebsen und sich auf die Regelung der Erschliessung beschränken.
2012 trat der Quartierplan in Kraft, wenig später fuh ren auf dem Areal die ersten Bagger auf. Aus dem Quar tierkonzept von 2003 erhalten blieb die Hochb ordstrasse als verkehrsfreie Allee in der Mitte, darüber hinaus gab
es keine übergeordneten gestalterischen Grundsätze. Mit der ‹ Leitide e Gestaltung öffentlicher Raum › gab sich die Stadt 2014 Vorgaben, die für Private allerdings unverbind lich blieben. Ein griffiges Instrument zur Sicherung der städtebaulichen und stadträumlichen Qualität gibt es erst seit 2017 mit dem Teilrichtplan ‹ Zentrumszone Ho ch bord ›. « Der Teilrichtplan war aufwendig, aber er hat sich gelohnt », sagt Reto L orenzi. Aus städtebaulichen Überle gungen lässt der Plan entlang bestimmter Baulinien eine höhere Bebauung zu, im Innern des Areals dafür eine offe nere. Zudem legt er einen maximalen Wohnanteil, Alleen, Wegverbindungen und publikumsorientierte Nutzungen fest. « Damit hab en wir ein gutes Instrument, um die Ent wicklung zu steuern und Investoren in die Pflicht zu neh men », so der Stadtplaner. Allerdings waren mehrere um strittene Bauten auf dem Hochbord 2017 bereits bewilligt, etwa der ortsfremd wirkende Jabee-Tower oder die sche matische Wohnüberbauung Feldmann Park, die zum Quar tier hin im Terrain versinkt.
Mehr Rückhalt für die Planung
Die Stadt habe in den letzten Jahren viel dazugelernt, sagt Reto Lorenzi. « Wir nehmen heute mehr Einfluss, for dern mehr von den Investoren und delegieren die Beurtei lung der baulichen Qualität an die Stadtbildkommission. » Auch Wilhelm Natrup, seit 2009 Kantonsplaner, stellt eine zunehmende Professionalisierung der Planung fest, nicht nur in Dübendorf: « Gerade die Agglomerationsgemeinden mit ihren grossen Arealen merken, dass eine semiprofes sionelle Mannschaft nicht ausreicht. » Mehr Mittel und politischer Rückhalt für die Planung – im Hinblick auf die Herausforderungen, die mit Bevölkerungszunahme, Klimawandel und Ressourcenknappheit auf uns zukom men, stimmt das hoffnungsvoll. ●
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Entgegen der Fliehkraft
15
Hochbord
m o n p q r l P 5 8 3 4 7 1 6 9 2 11 10
Vier Stimmen


« Eine höhere Dichte braucht mehr Gestaltungswillen »
Dübendorf hat eine grosse Bedeutung für das ganze Glatt tal. Es ist die bevölkerungsreichste Gemeinde, wachstums stark und verfügt über zentrale Bildungseinrichtungen. Zu dem zeichnet sich die Stadt durch eine hohe Wohnqualität und gute Versorgungsangebote aus. Auch das angestreb te Wachstum könnte Dübendorf durchaus attraktiver ma chen. Das Leitbild der Ortsplanungsrevision zeigt da bei sehr gut die künftigen Hauptstränge der Entwicklung auf. Doch die Gemeinde tut sich immer wieder schwer mit Entscheiden, die sie gegenüber Privaten vertreten sollte. Dübendorf dürfte prägnanter und mutiger auftreten. Eine höhere Dichte braucht mehr Gestaltungswillen.
So fehlt zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Zentrum und dem Bahnhof. Wie die Bahnhofstrasse künftig in Erscheinung treten soll, hat die Stadt bis heute nicht de finiert. Entsprechend gibt es für die in der neuen BZO zuläs sige höhere Dichte keine gestalterischen Vorgaben. Mehr Dichte bedeutet auch mehr Qualität im Aussenraum: Wie sieht der öffentliche Strassenraum aus ? Gibt es eine Al lee ? Was ist mit Parkplätzen ? Wie werden die Erdgeschos se eingebunden ? Auf diese Fragen braucht es Antworten.
Der Innovationspark positioniert Dübendorf neu auf der Schweizer Landkarte. Wir von KEEAS haben im Team mit Hosoya Schaefer Architects, IBV Hüsler und einem breit abgestützten Begleitgremium beim Kanton den kan tonalen Gestaltungsplan ausgearbeitet. Entstehen soll ein Industriegebiet mit einem eigenständigen Charakter und qualitätvollen Räumen für die Bevölkerung. Man kann sich fragen, ob der Flugplatz der richtige Standort dafür ist, weil die Erschliessung nicht optimal ist – ein S-Bahn-An schluss wäre durchaus wünschenswert.
Der kantonale Gestaltungsplan war das richtige Instru ment für diese Entwicklung. Ein Bundesareal und ein Inno vationspark sind für die ganze Schweiz von Bedeutung. Der Kanton hat die Gemeinden schon früh mit einem Gebiets management mittels einer kooperativen Planung unter stützt. Weil der Zeitrahmen für die Erarbeitung des Gestal tungsplans ausserordentlich knapp war, gab es nur wenig Raum für eine breite Mitwirkung. In der weiteren Planung sollte sich die Bevölkerung stärker einbringen können. Auch da sind noch viele Fragen offen: Wie wird der Park bespielt ? Welche Nutzungen braucht es, damit der Inno vationspark keine Insel wird ? Wie funktioniert die Anbin dung an die Stadt ? Wer nutzt die öffentlichen Räume ?
Die Stadt Dübendorf hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie nach Lösungen für die Planungsfehler vergange ner Zeiten sucht. Die Gemeinde ist auf dem richtigen Weg. Im Idealfall wird der Innovationspark zu einem pulsieren den Anker, mit dem sich die Stadt und die ganze Region identifizieren und der neue Impulse für die Glattalstadt setzen kann. Der Park könnte zur neuen Mitte der Glattal gemeinden werden, ein Central Park der Glattalstadt, wie sie die Planungsgruppe Krokodil einst ersonnen hat. Sabine Friedrich ( * 1965 ) ist Stadtplanerin und Co -Geschäftsführerin des Planungsbüros KEEAS in Zürich.
« Dübendorf wird städtischer, leb endiger und durchmischter » Seit einem Jahr arbeite ich in der Stadtbildkommission mit, lerne das heutige Dübendorf kennen und denke über seine Zukunft nach. Dübendorf hat sich in den letzten Jahren stark verändert, ein neuer Massstab ist hinzuge kommen. Die Herausforderung wird sein, dieses neue Dü bendorf mit dem alten Dübendorf zu vernetzen und ein verständliches Stadtgefüge zu schaffen. Im räumlichen Entwicklungskonzept siehe Seite 9 gibt es viele gute Ideen dazu, die nun umgesetzt werden müssen: die bestehenden Achsen stärken, den Glattraum aufwerten und im verdich teten Siedlungsgebiet neue Freiräume schaffen. Wichtig ist, dass die Vernetzung nicht nur auf der räumlichen Ebe ne stattfindet, sondern auch auf der sozialen. Auf dem Hochbord-Areal muss es preisgünstige Wohnungen geben, damit auch Menschen dorthin ziehen können, die bereits in Dübendorf wohnen.
In den vergangenen zehn Jahren ist in Dübendorf mehr passiert als in den 100 Jahren davor. Die Stadt wur de überrannt von dieser rasanten Entwicklung. Das darf aber nicht einfach passieren, sondern muss vom ersten Baustein an begleitet werden. Und Dübendorf muss über die Grenzen schauen und das Gesamte im Blick behalten. Gut, dass es nun das räumliche Entwicklungskonzept gibt. Auch das städtebauliche Modell des Hochbord-Areals hilft. Und beim Innovationspark siehe Seite 30 bietet sich nun die Chance, frühzeitig ganzheitlich zu planen und von Anfang an auf Konkurrenzverfahren zu setzen.
In der Stadtbildkommission beurteilen wir diverse Pro jekte – den kleinen Eingriff in der Kernzone genauso wie das Hochhaus auf dem Hochbord. Wir haben einen klaren Leitfaden, der vom Städtebau über den Freiraum bis zur Materialisierung reicht. Viele Bauherrschaften haben es so eilig, scheint es, dass ihre Projekte mehrmals auf unse rem Tisch landen. Wir müssen dafür sorgen, dass gute Bauten entstehen, und das durchsetzen – auch wenn das Haus dadurch erst ein halbes Jahr später bezugsbereit ist.
Leider wurde die Stadtbildkommission dieses Jahr um ein Mitglied verkleinert, was ich bedaure. Lange hatte die Politik sogar das Gefühl, dass es diese Kommission gar nicht brauche. Aber es ist wichtig, sich für eine gute Quali tät der Projekte einzusetzen. Viele Akteure prägen die Ent wicklung der Stadt mit Herzblut. Die Stadtplanung macht ihre Arbeit sehr gut. Aber ihre Ressourcen sind beschränkt, und sie kann leider nicht jeden Wettbewerb begleiten.
Dübi ist halt Dübi, hiess es oft. Doch die Stadt hat viele Qualitäten, die wir stärken können: den Fluss im Zentrum, das viele Grün rundherum, das Flugfeld als künftigen Inno vationspark. Ich blicke positiv in die Zukunft: Dübendorf wird städtischer, lebendiger und durchmischter werden. Liliane Haltmeier ( * 1984 ) ist Architektin und Mitgründerin de s Büros Haltmeier Kister in Zürich. Seit Herbst 2021 sitzt sie in der Stadtbildkom mission von Dübendorf.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Vier Stimmen
16
« Die Transformation müssen wir so gestalten, bis wir den Wakkerpreis holen » Wir wohnen seit 1986 in Gockhausen siehe ‹ Die Künstlerkolo nie von Gockhausen ›, Seite 8 Der Ort hat eine eigene Identität: nicht mehr Zürich und noch nicht ganz Dübendorf. Seit ei nigen Jahren sitze ich in der Stadtbildkommission von Dü bendorf und rühre dort gehörig im Topf herum, wenn es um städtebauliche und freiräumliche Fragen geht. Ich sage gern: Aus Dübendorf wird Dübenstadt. Diese Transforma tion müssen wir so gestalten, bis wir den Wakkerpreis ho len. Das ist ein Running Gag von mir, dessen Botschaft ich wie ein Mantra wiederhole: qualitativ verdichten, schritt weise und gescheit planen, respektvoll entwickeln.
Die Problematik der Agglo zeigt sich in Dübendorf deutlich. Doch in den letzten Jahren hat sich einiges ge tan. Ich glaube, dass die Stadt die Dinge in eine gute Rich tung bewegen kann. Dübendorf funktioniert etwas hemds ärmelig im Unterschied zum durchprofessionalisierten Zürich. Diese andere Planungskultur eröffnet Möglich keiten, weil man die Themen relativ einfach und unbüro kratisch angehen kann. Das weiss auch die Baulobby. Und das kann dann zu Projekten führen wie dem Jabee-Tower, der uns in der Stadtbildkommission teilweise durch die Lappen ging. Da hat die Stadt gemerkt, dass sie die Dyna mik steuern muss, damit am Ende kein Investorenquartier dabei herauskommt.
Ich habe mich dafür eingesetzt, bei jedem Bauvor haben einen Wettbewerb zu machen und den Freiraum anständig und von Anfang an mitzudenken, statt ihn le diglich als Überbleibsel zu behandeln. Beim Three-PointPark haben wir ein Charrette-Verfahren ausprobiert. Das ist kein SIA-konformer Wettbewerb. Aber es ist immerhin gelungen, Stadt und Investoren an einen Tisch zu brin gen. Seither gab es für fast alle Baufelder Konkurrenz verfahren. Den Investoren ist nun klar: Sie können nicht einfach mit irgendeinem Büro kommen. Man nimmt das ernst, pflegt einen fachlichen Diskurs. Das ist eine tolle Erfahrung. Es macht mich ein bisschen stolz, dass wir ein gewisses Baukulturlevel erreichen konnten.
Je dichter es wird, desto wichtiger wird der Freiraum. Für das Hochbord gab es dafür kein übergeordnetes Kon zept, also muss man für jedes Teilstück das Beste her ausholen. So habe ich Freiraumplanung nicht gelernt an der Hochschule. Aus der Not heraus haben wir situativ re agiert. Ich hab e eine Skizze für das Gebiet gezeichnet, be nannt nach dem Song ‹ Take Five ›: Fünf Parkanlagen sind mit einer Schnur verbunden. Die Skizze dient der Stadt und den Entwicklern nun als visionäre Vorgabe.


Andere Agglomerationsgemeinden können von Düben dorf lernen: Wenn es nicht geht mit einer superseriösen Planung von Anfang an, kann eine Bottom-up-Pfadi-Metho de viel bringen. Die Entwicklung von Dübendorf ist eine verrückte Story. Es könnte sein, dass es am Ende recht gut herauskommt. Obwohl der Weg eigenartig war. Aber ich bin ja bekannterweise ein grenzenloser Optimist. Stefan Rotzler ( * 1953 ) ist Landschaftsarchitekt und Mitglied der Stadtbild kommission von Dübendorf. Er wohnt in Gockhausen.
« Dass jeder für sich wurstelt, ist schon lange vorbei » In meinen 24 Jahren im Stadtrat – zuerst als Hochbauvor steher und danach als Stadtpräsident – hat sich Düben dorf vom Dorf zur Stadt entwickelt. Nachdem 1990 die S-Bahn eröffnet wurde, konnte 2010 die Glattalbahn als Querverbindung zum Flughafen Kloten den Betrieb auf nehmen. Das waren verkehrstechnische Quantensprünge, die einen hohen Siedlungsdruck auslösten. Für die Altein gesessenen war das teilweise ein schwieriger Prozess. Sie verstanden Dübendorf als dörfliche und nicht als Agglo merationsgemeinde. Inzwischen haben sie aber akzep tiert, dass eine dynamische Entwicklung stattfindet.
In der Zürcher Planungsgruppe Glattal haben die Ge meinden im Glattal gemeinsam an der Transformation ge arbeitet und Rahmenbedingungen entwickelt. Dass jeder für sich wurstelt, ist schon lange vorbei. In Workshops wur den Probleme aufgedeckt, Ziele festgelegt und Studien initiiert. Daraus entstand beispielsweise die Planungsvor gabe für ein Band mit Hochhäusern entlang der Glattal bahnlinie. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich war früher nicht sehr eng. Die Limmatstadt gab den Takt vor, als Dübendorfer hatte man nicht viel beizutragen. Durch Projekte wie den Bahnhof Stettbach haben wir gelernt, zu sammenzuarbeiten. In den vergangenen 20 Jahren ist der Austausch intensiver geworden, und man begegnet sich auf Augenhöhe. Das ist auch das Verdienst der Stadt Zü rich, die mit den Gemeinden zusammenarbeiten will.
In den letzten Jahren kam immer mal wieder das The ma einer Fusion der Glattalgemeinden zur Glattalstadt auf. Das ist aber noch nicht trag- und auch nicht mehrheits fähig. Vielleicht in 50 Jahren, wer weiss. Es gibt andere Möglichkeiten, gemeinsam zu planen. Beim Zwicky-Are al zum Beispiel haben wir zusammen mit Wallisellen und der Eigentümerschaft einen Gestaltungsplan über die Ge meindegrenze hinweg erstellt. Da musste politisch und zeitlich alles eng aufeinander abgestimmt sein. Eine sol che Planung gab es bisher wahrscheinlich noch nirgends.
Was ich bedaure, ist die schleppende Entwicklung beim Flugplatz Dübendorf. Gerne hätte ich den Innova tionspark als Stadtpräsident planerisch abgeschlossen. Durch Rekurse haben wir fünf bis zehn Jahre verloren. Aber das Instrument des kantonalen Gestaltungsplans war Neuland. Hätte man damit mehr Erfahrung gehabt, wäre der Kanton womöglich anders vorgegangen. Er hat dann entschieden, neu anzufangen. Planerisch ist das auch eine Chance, weil mehr Beteiligte einbezogen werden.
Ein Blick in die Zukunft: Es ist vorstellbar, dass sich Dübendorf zu einer Stadt mit 40 00 0 Einwohnerinnen und Einwohnern entwickelt. Die planerischen Vorgaben da für sind schon heute mehr oder weniger gegeben. Gesell schaftlich und emotional ist das jedoch noch nicht bewäl tigt. Ich bin überzeugt: Irgendwann wird man Dübendorf wieder als Einheit spüren und leben. Aber das braucht Zeit. Lothar Ziörjen ( * 1955 ) ist Architekt und BDP -Politiker. Von 1994 bis 2006 war er Hochbauvorsteher in Dübendorf, danach bis 2018 Stadtpräsident.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Vier Stimmen
17
Zürich-Schwamendingen
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Stadtplan Dübendorf
18 5 8 3 4 7 1 6 9 2 11 10 17 16 15 14 12 13 20 21 18 19
Wallisellen M K L D E C B P
Wangen-Brüttisellen
Stadtplan Dübendorf
Hochbord
1 Stettbach Mitte
2 Sorrento
3 Westhof
4 Jabee-Tower
5 Lycée Français de Zurich
6 Sonnentalstrasse
7 Hofgarten-Türme
8 E rweiterung Lycée Français de Zurich
9 Three Point 10 Cosmos
11 Younic
Zwicky-Areal
12 Baufeld D 13 Baufeld E
Giessen
14 Am Ring 15 Giessenhof 16 Am Giessenplatz 17 Giessenturm
Empa / Eawag
18 Nest-Gebäude 19 Empa-Forschungscampus
Weitere
20 H ochhaus am Chriesbach
21 Birchlenstrasse
22 S peicher Obere Mühle 23 Hallenbad Oberdorf
24 P avillon Innovationspark
Quartiere
A Zentrum
Volketswil
Schwerzenbach
B Birchlen C Zelgi D Hochbord E Ueberlandstrasse
F Stägenbuck
G Innovationspark / Aviatik
H Flugfeld I Oberdorf J Sonnenberg K Stettbach L Gockhausen M D übelstein N Hermikon O Gfenn
P Bahnhof Stettbach
Q Bahnhof Dübendorf R Flugplatz
Gemeindegrenze
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Stadtplan Dübendorf
19
22 23 Fällanden
Dietlikon
24 Q R N
J I F G H A
O
1
1 Städtischer Auftakt
Die Überbauung Stettbach Mitte wirkt als Tor zum Hochbord-Areal, das direkt am Bahnhof Stett bach liegt. Die beiden Bauten bilden eine urbane Platzfassade und machen aus der Verkehrsplatt form endlich einen veritablen Bahnhofplatz. Da zwischen haben Meier Hug Architekten eine trich terförmige Passage mit Läden gelegt, die in das Quartier hineinführt. Die Gebäude unterscheiden sich klar in Nutzung, Form und Architektur. Das uƒƒ-förmige Langhaus mit seinem ruhigen grünen Hof ist auf Familien ausgerichtet – hier wird vor nehmlich gewohnt. Das Punkthaus am Bahnhof platz ist höher, kommt in Architektur und Mate rialisierung urbaner daher und wird vielfältiger genutzt. 2013 haben Senn und die Anlagestiftung Turidomus den Zuschlag erhalten, das Projekt zu entwickeln und zu realisieren. Die Berechnung des Baurechtszinses basiert auf dem Basler Mo dell. Das bedeutet, dass Dübendorf als Eigentü merin des Grundstücks keine fixe, sondern eine ertragsabhängige Umsatzmiete bekommt. Die Stadt hat den maximalen Wohnanteil auf der Par zelle von 40 auf 50 Prozent erhöht. Die Mischnut zung ist – neben der Architektur – eine wichtige Voraussetzung für Urbanität. Damit der Ort weder Arbeiterstadt noch Schlafquartier wird.
Überbauung Stettbach Mitte, 2022
Zürichstrasse / Am Stadtrand Bauherrschaft: Immobilien-Anlagestiftung Turidomus, Zürich ; Anlagestiftung Pensimo, Zürich Projektentwickler, Totalunternehmer: Senn, St. Gallen Architektur: Meier Hug, Zürich Landschaftsarchitektur: Studio Vulkan, Zürich Auftragsart: Studienauftrag, 2015 Investitionsvolumen: Fr 160 Mio.
2 Hängende Balkone
Das nach der italienischen Stadt Sorrento be nannte Wohnhochhaus steht leicht zurückversetzt in einem Park, der mehrere Parzellen verbindet. Aus dem 20-stöckigen Gebäude blickt man über die Allmend Stettbach im Westen. Prägendes Ele ment des Turms sind die versetzt zueinander an geordneten Balkone. Brisesoleils spenden auch in der Höhe Schatten. Das Hochhaus ist mit silber nen Aluverbundplatten verkleidet, was den abs trakten, skulpturalen Ausdruck unterstützt. Das Erdgeschoss ist von zwei Seiten her zugänglich: von der Quartierstrasse und von der Langsam verkehrsachse entlang der Bahngleise. Neben Fassade und Kern gibt es nur vier innen liegende Stützen, was im Grundriss viele Möglichkeiten of fenlässt: Der Wohnungsspiegel reicht von 1 ½ bis 4 ½ Zimmer, die in verschiedenen Konfigurationen angeordnet sind. Wohn- und Essbereich sind je weils auf den Balkon und zweiseitig ausgerichtet.
Wohnüberbauung Sorrento, 2024
Am Stadtrand 43
Bauherrschaft: Pensionskasse des Bundes Publica, Bern Entwickler: Mettler2Invest, Zürich
Projektmanagement, Bauleitung: Ralbau, St. Gallen Architektur: Stücheli, Zürich Landschaftsarchitektur: Haag, Zürich Auftragsart: Studienauftrag, 2019

3 Alternativ wohnen


Die Überbauung Westhof mischt die Investoren architektur auf dem Hochbord auf – inhaltlich wie formal. Die Genossenschaft selbstverwalte ter Häuser Wogeno und die Palmahus AG haben zusammen ein gemeinschaftliches Wohnhaus gebaut, das preisgünstiges und selbstverwalte tes Wohnen und Arbeiten ermöglicht. Der Woh nungsmix reicht vom Studio über Clusterwohnun gen bis zu Jokerzimmern. Zum Raumprogramm gehören etwa ein Mehrzweckraum, ein Gemein schaftssaal sowie Flex- und Musikzimmer. Die Architektur bezieht sich entfernt auf die Gärt nereivergangenheit auf dem Areal: Die gestreifte Fassade ist mit Welleternit verkleidet, die präg nante Pergola auf der gemeinschaftlichen Dach terrasse erinnert an Gewächshäuser. Die zwei Gebäudeflügel schmiegen sich an den öffentli chen Hof dazwischen. Der grössere Riegel nimmt verschiedene Wohnungsgrundrisse auf. Der klei nere bricht den grossen Massstab, stellt den

20
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
1 3 2
Lärmschutz sicher und bietet Platz für spezielle re Wohntypologien. Der vorderste Hausteil steht leicht abgedreht und wird zum identitätsstiften den Wahrzeichen für die alternative Siedlung.
Wohnüberbauung Westhof, 2023 Zukunftstrasse 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Bauherrschaft: Palmahus, Dietlikon ; Wogeno, Zürich
Entwickler: Topik Partner, Zürich
Architektur: Conen Sigl, Zürich

Bauleitung: W T Partner, Zürich
Landschaftsarchitektur: Kuhn, Zürich
Auftragsart: Wettbewerb, 2017 Gesamtkosten ( BKP 1 9 ): Fr 54,9 Mio.
4 Ho chhaus als Zeichen
Man kann von der Architektur des Jabee-Towers halten, was man will: Das eigenwillig geform te Gebäude dient als Orientierungspunkt auf dem Hochbord-Areal. 100 Meter ragt der Zylin der in die Höhe und ist mit seiner ovalen Form und dem abgeschrägten Dach nicht zu überse hen. Der exotisch klingende Name ist eine Reve renz an Jakob Beerstecher, dessen Familie hier einst Gemüse anbaute. Heute ist auf der privaten Parzelle ein öffentlicher Park angelegt, für des sen Unterhalt die Stadt Dübendorf aufkommt. Im Erdgeschoss des Turms gibt es ein Café und Lä den. Darüber finden auf 27 Etagen 218 Mietwoh nungen von 1 ½ bis 4 ½ Zimmern Platz. Die runde Fassade folgt dem Takt der Fensterbreite wie bei
einem Büroturm. Die Balkonschicht läuft in einem Zug rundherum. Vom orthogonalen Kern aus fä chern sich die Wohnungen zur Fassade und zur Aussicht hin auf. Das Panorama hat seinen Preis: Eine möblierte 2 ½-Zimmer-Wohnung im ersten Obergeschoss kostet 3200 Franken monatlich.

Jabee-Tower, 2021
Am Stadtrand 56
Bauherrschaft: Einfache Gesellschaft Kummer / Beerstecher, Dübendorf
Generalunternehmer: ADT Innova Construction, Altendorf Entwicklung, Architektur: Sattlerpartner, Solothurn Landschaftsarchitektur: W + S, Solothurn
Auftragsart: Direktauftrag Anlagekosten ( BKP 0 9 ): Fr 105,6 Mio.
5 Günstige Schule
Im 1956 als gemeinnützigen Verein gegründeten Lycée Français de Zurich wird nach dem franzö sischen Lehrplan unterrichtet. Rund 1000 Schü lerinnen und Schüler aus fast 40 Nationen ge hen hier zur Schule – vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Entsprechend gross war das Raum programm und das daraus resultierende Volu men: Der Mitteltrakt, in dessen Obergeschossen die Klassenzimmer zweibündig aufgereiht sind, zählt fünf Stockwerke. Daran angebaut sind die Doppelturnhalle und der Kindergarten. Die drei Bauteile umschliessen einen Hof. Die Nutzungen sind so zusammengefügt, dass auf verschiede
nen Niveaus Aussenräume mit unterschiedlichen Qualitäten entstehen. Das bricht auch den gros sen Massstab des Gebäudes. Einzelne farbige Flächen oder bunte Gläser setzen Akzente am hell verputzten Bau. Abstriche und Kompromisse beim Platzbedarf halfen, die Kosten im Vergleich zu Volksschulhäusern tief zu halten.
Lycée Français de Zurich, 2016
Zukunftstrasse 1

Bauherrschaft: Lycée Français de Zurich, Dübendorf Totalunternehmer: Losinger Marazzi, Zürich Architektur: Züst Gübeli Gambetti, Zürich
Landschaftsarchitektur: W + S, Solothurn
Auftragsart: Projektentwicklung mit Totalunternehmer, 2012
6 Pionierblockrand
Noch wirkt der Blockrand etwas fremd. Aber er lässt erahnen, dass die Absicht des Quartierplans, mit Hofrandbebauungen eine städtisch anmu tende Struktur zu erzeugen, funktionieren könnte. Fischer Architekten gewannen den Wettbewerb 2012, und ihre 2017 fertiggestellte Überbauung mit 225 Wohnungen und Gewerberäumen ist eine Pionierin im Quartier. Die meisten Wohnun gen – es gibt 40 verschiedene Grundrisse – sind zweiseitig zur Strasse und zum als Garten gestal teten Hof hin orientiert. Das gleicht die bezüg lich Besonnung und Lärmbelastung unterschied lichen Verhältnisse an den Aussenseiten aus. →
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
21
4 5 6
Grob verputzte Brüstungsbänder strukturieren die strassenseitige Fassade, an der als eigenstän dige Elemente die weit auskragenden Balkone angehängt sind. Die Bänder zwischen den Fens tern sind mit Kunststoffwellplatten gefüllt, die an wehende Vorhänge erinnern. Foto: Roman Weyeneth Wohnüberbauung Sonnentalstrasse, 2017 Hochbordstrasse 29 39 / Sonnentalstrasse 10, 12 / Querstrasse 2 10 Bauherrschaft: Schweizerische Mobiliar Asset Management, Bern Entwickler: Mobimo, Küsnacht Architektur, Generalplanung: Fischer, Zürich Landschaftsarchitektur: ASP, Zürich Auftragsart: Wettbewerb, 2012



7 Gekrönte Türme
Noch gedeihen auf der Parzelle mitten auf dem Hochbord Gemüse und Beeren. Doch schon bald sollen die Gewächshäuser drei Wohntür men Platz machen. Vier- bis fünfgeschossige Riegel definieren die Ränder der Parzelle und fassen einen Hofgarten, der über Durchbrüche mit dem Quartier verbunden ist. Hier sollen Woh nungen für Familien entstehen, die bis ins Erdge schoss reichen. Die meisten dieser Wohnungen sind durchgesteckt und zur Stadt sowie zum Gar ten orientiert. In den Hochhäusern definiert die Aussicht die Grundrisse. Die drei identischen Tür me sind vertikal markant gegliedert, als Material


für die Fassade ist Backstein vorgesehen. Die drei obersten Stockwerke bilden zusammen mit der begrünten Dachterrasse jeweils eine Kro ne, die im Stadtraum ein Zeichen setzt. Insge samt entstehen mehr als 400 Wohnungen, vom 1 ½ -Zimmer-Studio bis zur 5 ½ -Zimmer-Woh nung. Zudem sind 20 Prozent Gewerbenutzung vorgesehen. Nachdem der private Gestaltungs plan genehmigt ist, soll ab 2026 die erste Etappe der Überbauung realisiert werden.

Hofgarten-Türme, 2027 / 2028

Hochbordstrasse / Lagerstrasse Bauherrschaft: Geschwister Beerstecher Entwickler: Romano & Partner, Altendorf Architektur: Caruso St John, Zürich Landschaftsarchitektur: Antón, Zürich Auftragsart: Direktauftrag ( Architektur ), Studienauftrag ( Landschaft )







8 Die gestap elte Schule



Nur wenige Jahre nach der Eröffnung platzt das Lycée Français de Zurich bereits aus allen Näh ten. Züst Gübeli Gambetti Architekten planen deshalb schräg gegenüber einen Neubau. Er soll Zimmer für die Sekundarstufe, einen Mehr zweckraum und eine zusätzliche Turnhalle auf nehmen. Die Parzelle liegt in der Industrie- und Gewerbezone, es gilt eine Gestaltungsplanpflicht. Die Architekten stapeln fünf Geschosse übereinander und lassen die obersten zwei über den
Vorplatz auskragen, was dem Gebäude an der Strasse eine Adresse gibt. Die Spiel- und Pau senflächen befinden sich auf dem Dachgeschoss, das mit Stauden und Sträuchern, Kräutern und Beeren üppig begrünt wird. Wie beim ersten Schulbau des Lycée Français gliedern Bänder die Fassade ; die Metallverkleidung knüpft an indus trielle Themen an . Im Erdgeschoss prägen poly gonale Betonplatten, begrünte Pflanzenflächen und Sitzmöbel aus Beton die Umgebung.
Erweiterung Lycée Français de Zurich, 2025 Lagerstrasse 16 Bauherrschaft: Lycée Français de Zurich, Dübendorf Architektur: Züst Gübeli Gambetti, Zürich Landschaftsarchitektur: Noa, Zürich Auftragsart: Direktauftrag, 2021

9 Dreimal ho ch

Die drei identischen Wohntürme namens ‹ Three Point › scheinen an die Ho chhauseuphorie der 1970er-Jahre anzuknüpfen. Sie sind mehr als 100 Meter hoch und nehmen insgesamt mehr als 400 Miet- und Eigentumswohnungen auf. Prägen des Element der Fassade sind die Balkonbrüstun gen, die schräg versetzt zueinander angeordnet sind. So entsteht « kein unruhiges Sägezahnbild –sondern ein harmonisches Relief », heisst es in der Vermarktungsbroschüre. Ein Architekturwett bewerb ging dem Projekt nicht voraus, obwohl auf
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte

22
→ 7 8
9 9
dem Gebiet eine Gestaltungsplanpflicht gilt. Für den Aussenraum hingegen verlangte die Stadt bildkommission einen Wettbewerb, der in einem Charrette-Verfahren durchgeführt wurde. Das Stu dio Vulkan plant – ausgehend von der Josefswiese in Zürich – in der Mitte eine grosse Wiese, um die herum ein Band mit Bäumen wächst. Einen un gewöhnlichen Weg geht die Stadt auch, um das boomende Hochbord-Quartier mit ausreichend Schulräumen zu versorgen. Sie baut nicht etwa selbst ein Schulhaus, sondern hat die untersten beiden Stockwerke zweier Three-Point-Hochhäu ser erworben. Sechs Primarschulklassen sollen hier ab 2024 unterrichtet werden. Der Investor baut mit den Türmen zudem eine Sporthalle, die er der Stadt schlüsselfertig übergibt. Dübendorf hat den Schulhausbau outgesourct. So spart die Stadt Geld und Zeit, gibt aber ein Stück öffentliche Baukunst aus den Händen.
Hochhäuser Three Point, 2024
Sonnentalstrasse 13 1 7
Bauherrschaft: Einfache Gesellschaft Kummer / B eerste cher, Dübendorf ; Ho chbord Immobilien, Altendorf Entwickler, Generalunternehmer: ADT Innova Construction, Altendorf
Architektur: Arge Wachtl / Maier Hess, Zürich Landschaftsarchitektur: Studio Vulkan, Zürich Auftragsart: Direktauftrag Anlagekosten ( BKP 0 9 ): Fr 425 Mio.

10 Rie gel und Punkte
Das Wohn- und Gewerbeensemble Cosmos vereint Stadt und Natur, Lärm und Ruhe, Dich te und Park. Die Überbauung wird in zwei Etap pen realisiert, die ersten Wohnungen sollen im Herbst 2023 bezugsbereit sein. Ein schmaler Riegel an der Strasse gewährleistet den Lärm schutz. Punktbauten – zwei zum Wohnen und ein Bürogebäude – sorgen für Durchlässigkeit zum angrenzenden Park. Im Erdgeschoss sind stras senseitig Läden vorgesehen. Die 162 Wohnungen haben 1 ½ bis 5 ½ Zimmer. Die 2 ½- und 3 ½-Zim mer-Wohnungen im Riegel sind durchgesteckt, damit alle von der ruhigen Seite profitieren. In den Punkthäusern sind die grösseren Wohnun gen übereck angeordnet. Die Fassaden sind klas sisch in Sockel, Mittelpartie und Dachteil geglie dert. Eine Architektur, die nicht das Experiment sucht, sondern den soliden Wert.
Wohn- und Gewerbeensemble Cosmos, 2023
Sonnentalstrasse 9, 11 / Zürichstrasse 98 / Ringstrasse 26, 28, 30

Bauherrschaft: Credit Suisse Funds, handelnd für Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Zürich Entwickler: Mobimo, Küsnacht
Generalunternehmer: HRS Real Estate, Zürich Architektur: Züst Gübeli Gambetti, Zürich
Landschaftsarchitektur: Noa, Zürich
Auftragsart: Studienauftrag, 2018 Gesamtkosten ( TU-Werkvertrag ): Fr 64,65 Mio.
11 Wohnhöfe statt Büroburg
Seit die Zürcher Kantonalbank 2019 aus dem Ringhof weggezogen ist, wird das Areal grundle gend umgewälzt. Der zweiteilige Bürokomplex mit seiner postmodernen Formenwucht wurde dem Erdboden gleichgemacht. An seiner Stelle entste hen zwei L-förmige Wohnriegel, die mit einem be stehenden und einem neuen Bürogebäude an der Strasse zwei offene Höfe aufspannen. Das Projekt ging aus einem Studienauftrag hervor, den SPPA Architekten gewonnen haben. Die beiden rück wärtigen Bauten nehmen 230 Wohnungen auf. Bänder aus Keramikplatten gliedern die Fassaden horizontal. Die gerundeten Balkone setzen sich markant davon ab. Ihre Geometrie erinnert ent fernt an die Zeit der Postmoderne.

Wohn- und Gewerbeüberbauung Younic, 2025 Ringstrasse 18 / Sonnentalstrasse 6


Bauherrschaft: Mettler 2Invest, St. Gallen Entwickler, Totalunternehmer: Mettler 2Invest, Zürich Architektur: SPPA, Zürich
Landschaftsarchitektur: Fischer, Richterswil Auftragsart: Studienauftrag, 2019
12 Stadt , Land, Fluss


Wie eine Hand öffnet sich die letzte Überbauung auf dem Zwicky-Areal zur Glatt hin. Der Riegel an der Strasse und die vier Finger halten den Lärm von Autobahnauffahrt, Hauptstrasse und Bahn ab. →
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
23
11
12 12
10
Die Bauten nehmen 220 Wohnungen sowie Erdgeschossnutzungen auf. Sie stehen auf einem Tiefgaragensockel, der die halböffentlichen Höfe darüber vom Strassenniveau absetzt. Breite Be tonbänder prägen die aussenseitigen Fassaden. Auf der Innenseite werden sie schmaler und ge hen in Balkone über. Die durchgesteckten Woh nungen sind zweiseitig orientiert. Das Büro Haag Landschaftsarchitektur revitalisierte dieses Jahr den Abschnitt am Fluss, wertete den Uferweg auf und macht die Glatt somit erlebbar.
Zwicky-Areal, Baufeld D, 2020 Riedgarten 2 14
Bauherrschaft: Zwicky & Co., Wallisellen ; Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft, St. Gallen Entwicklung: Zanoni, Zürich
Generalunternehmer: Gross, Wallisellen Architektur: Localarchitecture, Lausanne Landschaftsarchitektur: Haag, Zürich
Auftragsart: Studienauftrag, 2012
13 Dichte Packung
Zwicky Süd ist eine gewagte Mischung: Vier schmale, geknickte Scheiben schützen vor dem Lärm. Zu ihren Füssen verwachsen sie mit sieben tiefen Hallen. Frei dazwischen stehen zwei fet te Blocks. 280 Wohnungen und Gewerbeflächen finden in den Gebäuden Platz. Vom integrierten Reihenhaus und der konventionellen Geschoss wohnung über die studentische Gross-WG bis
zur Clusterwohnung ist alles dabei. Entsprechend vielfältig sind die Bewohnerinnen und Bewohner. Auf den unteren Etagen gibt es ein Restaurant, Gästezimmer, einen Blumenladen, Künstlerate liers und andere Dienstleistungen – eine bunte Mischung wie in der Stadt. Äusserlich spielen die Bauten mit dem rauen Ort. Vor den Rost- und Be tonfassaden stehen orangerote Balkontürme aus Stahl, an denen Kletterpflanzen emporwachsen.
Zwicky-Areal, Baufeld E, 2016 Am Wasser 6 und 15 Bauherrschaft: Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk 1, Zürich ; Anlagestiftungen Adimora und Turidomus, Pensimo Management, Zürich ; Anlagestiftung Swiss Life, Zürich Totalunternehmer: Senn, St. Gallen Architektur: Schneider Studer Primas, Zürich Bauingenieure: Schällibaum, Herisau Landschaftsarchitektur: Lorenz Eugster, Zürich Auftragsart: Projektwettbewerb auf Einladung Gesamtkosten ( BKP 1 9 ): Fr 131 Mio. Baukosten ( BKP 2 ): Fr 105 Mio.
14 O ffenes Raumgitter
Neben der Haltestelle der Glattalbahn errich ten E2A Architekten einen Stadtbaustein mit 469 Wohnungen, Gewerberäumen und Ateliers. Ein Pavillon auf dem zentralen Platz nimmt eine Gastronutzung auf. Daneben kommt der RingTower mit zwei siebengeschossigen Nebenbau ten zu stehen. Gegenüber der Bahnhaltestelle
gibt es drei weitere Häuser, die über einen So ckel verbunden sind. Auf der anderen Seite der Ringstrasse entsteht ein Park mit Grillpavillon, Pumptrack und Spielplatz. Er erstreckt sich lau schig entlang dem Glattufer. Die Architekten ent werfen eine feingliedrige Balkonschicht, deren offenes Raumgitter die ganze Überbauung prägt. Das Projekt kombiniert verschiedene Wohntypen, etwa Hochhaus-Apartments, Mikrowohnungen, Townhäuser oder Atelierwohnungen. Die Hybrid konstruktion verbindet Holz und Beton. Solaran lagen auf den Dächern ernten Strom, die Glatt hilft, die Bauten zu kühlen oder zu heizen.
Wohn- und Gewerbeüberbauung Am Ring, 2026
Ueberland- / Ringstrasse
Bauherrschaft: Basler Leben / Baloise Asset Management, Basel Entwickler: Mettler2Invest, Zürich
Projektmanagement, Bauleitung: MK , Wollerau Architektur: E2A , Zürich




Landschaftsarchitektur: Studio Vulkan, Zürich
Auftragsart: Direktauftrag, 2019
15 Blo ckrand mit Föhrenhof
Der Giessenhof wurde 2018 als erstes Gebäude auf dem Areal fertiggestellt. Ein riesiger Block rand vereint 166 Wohnungen lärmgeschützt um einen Hof, in dem ein kleiner Föhrenwald wächst. Die Fassade folgt einem strengen Raster, der die Hülle in Rahmen und Füllung aufteilt. Auf der
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
24
→ 13
14 15 14
Hofseite, wo die Balkone leicht vor- und zurück knicken, kommt etwas Bewegung in die Geo metrie. Vetschpartner Landschaftsarchitekten haben neben dem bewaldeten Hof auch die übri gen Grünräume auf dem Areal geplant. Auf dem Giessenplatz wechseln harter Asphalt und wei cher Kies sich ab – so vermittelt der Platz zwi schen urbanem Hochhaus und grüner Glatt. Der Raum entlang der Glatt ist baumbestanden und mündet in den Giessenpark, der als Kontrast zum restlichen Areal konzipiert ist und zum Quartier schwerpunkt werden soll. Am Rand steht eine his torische Lagerhalle aus Klinker, die an die Ver gangenheit erinnert. Foto: Hannes Henz
Giessenhof, 2018
Am Giessenpark
Bauherrschaft: CS Real Estate Fund Siat, ein von Credit Suisse Asset Management verwalteter Immobilienfonds Entwickler, Totalunternehmer: Implenia Schweiz, Winterthur / Dietlikon

Architektur: A D P. Walter Ramseier Partner, Zürich Landschaftsarchitektur: Vetschpartner, Zürich
Auftragsart: Studienauftrag, 2014 Gesamtkosten: Fr 65 Mio.
16 Zwei Gesichter
Die beiden Wohnhäuser fassen den Giessenplatz neben dem Giessenturm und nehmen 36 Miet wohnungen auf. Am Platz folgen die Bauten gera den Linien und reagieren mit Klinker und Hochpar
terre auf die urbane Situation. Auf der Flussseite wechseln sie ihren Charakter markant. Eine Bal konschicht knickt vor und zurück, um sie mit dem Grünraum neben der Glatt in Beziehung zu setzen. Das Atelier WW plant am Giessenplatz zudem ein Laborgebäude, das zwischen dem Turm und dem Blockrand daneben zu stehen kommen und den Schlussstein für das Ensemble setzen wird.
Am Giessenplatz, 2021 Giessenplatz 4 6
Bauherrschaft: CS Real Estate Fund Siat, ein von Credit Suisse Asset Management verwalteter Immobilienfonds Entwickler, Generalunternehmer: Implenia Schweiz, Winterthur / Dietlikon
Architektur: Theo Hotz Partner, Zürich Landschaftsarchitektur: Vetschpartner, Zürich


Auftragsart: Studienauftrag, 2017 Gesamtkosten ( BKP 1 9 ): Fr 22 Mio
17 Langer Riegel, hoher Turm
Der Giessenturm steht auf einem langen, flachen Sockelbau an der Strasse. Das 26-stöckige Haus ist Auftakt und Symbol für das Giessen-Areal. Ein Fassadennetz aus Aluminium überspannt Turm und Sockelbau. Im Sockel sind 60 Pflege-Apart ments untergebracht, ausserdem ein Restaura tionsbetrieb sowie Mehrzweck- und Gewerbe räume im Erdgeschoss. Der Turm erweitert das Spektrum um 80 Alterswohnungen und 50 Miet wohnungen mit 2 ½ bis 4 ½ Zimmern. Der Grund
riss besteht aus zwei ineinandergreifenden Qua draten, was vor allem im Plan sofort ins Auge springt. Dadurch hat das Gebäude an jeder Ecke jeweils zwei Ecken, was vielfältige Ausblicke er möglicht und hilft, die Loggien in die Gesamtfigur zu integrieren.
Giessenturm, 2021 Giessenplatz 1 Bauherrschaft: CS Real Estate Fund Siat, ein von Credit Suisse Asset Management verwalteter Immobilienfonds Generalunternehmer: Implenia Schweiz, Winterthur / Dietlikon Architektur: Atelier WW, Zürich Landschaftsarchitektur: Vetschpartner, Zürich Auftragsart: Direktauftrag
18 Gebaute Feldversuche

Das Nest – kurz für ‹ Next Evolution in Sustainable Building Technologies › – ist eine Forschungs plattform der Eidgenössischen Materialprüfungs anstalt Empa, mit der sie an der Zukunft des Bauwesens tüftelt. Hier werden unter realen Be dingungen neue Konstruktionsmetho den getes tet, um die Zeit zwischen Labor und Markt, zwi schen Prototyp und Serienprodukt zu verkürzen. Dazu gehören etwa zentimeterdünne Betonträger, Brettsperrholz aus Buche oder wiederverwendete Bauteile. Sogar Roboter haben im Gebäude schon Wände erstellt. Finanziert haben das Nest die Empa und die Eawag zusammen mit der ETH, →
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
25
16 16 17
18
dem Bundesamt für Energie, dem Kanton Zü rich und privaten Sponsoren. Eine Betonkonst ruktion, deren Geschossplatten rundum auskra gen, bildet das Rückgrat des Hauses. So können die Forschungsmodule unabhängig von der Trag konstruktion wie Schubladen eingesetzt werden. Über eine Tür und eine Schnittstelle, die Wasser, Strom und Netzanbindung liefert, werden die Mo dule an das System angedockt. Nach fünf bis sie ben Jahren werden sie ersetzt. Das Haus ist eine Baustelle, die niemals fertig wird.
Nest-Gebäude, 2016 Ueberlandstrasse 129 Bauherrschaft: Empa, Dübendorf Architektur: Gramazio Kohler, Zürich Auftragsart: Direktauftrag Gesamtkosten ( BKP 1 –9 ): Fr 19,8 Mio. ( ohne Module )


19 Forschungscampus verdichten
Die Eidgenössische Materialprüfungs- und For schungsanstalt Empa und die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag wollen ihr gemein sames Areal schrittweise weiterentwickeln und verdichten. Dafür führte die Empa einen Gesamt leistungswettbewerb durch, den SAM Architek ten mit Andreas Geser Landschaftsarchitekten und Implenia gewannen. Die Umgebung wird um einen Platz und ein grünes Band ergänzt. Auf die
sem wachsen unterschiedliche Baumarten, um die Folgen des Klimawandels zu untersuchen. Auf dem Campusplatz ist ein Roboter geplant, der Kreidezeichnungen auf den Asphalt malt, die der Regen wieder wegwäscht. Zwei Neubauten ein Laborgebäude und ein Multifunktionsbau –fassen den Raum um das Nest-Gebäude. Die ge stalterischen Motive wie Vordächer und Lisenen orientieren sich an den Bestandsbauten. An der Strasse entsteht als Portal ein grosses, mit Holz lamellen verkleidetes Parkhaus.
Empa-Forschungscampus, 2024 Ueberlandstrasse 129
Bauherrschaft: Empa, Dübendorf
Totalunternehmer: Implenia Schweiz, Zürich Architektur: SAM, Zürich
Landschaftsarchitektur: Andreas Geser, Zürich Auftragsart: Gesamtleistungswettbewerb, 2019
20 Kleines Ho chhaus
Mit seinen 13 Geschossen gehört das Wohnhoch haus zu den niedrigeren Türmen in Dübendorf. Doch klein ist bekanntlich fein. Und so zeigt das Projekt: Es lohnt sich, einen Wettbewerb durch zuführen. Das wusste offenbar auch der Bauherr Antonio Cerra, Gründer des Schweizer Mode labels Zebra. Umgeben von einem Grünraum steht der Turm direkt am Chriesbach gegen über vom Zwicky-Areal. Meier Hug Architekten
fächern die Grundform vielfältig auf. An der Fas sade wechseln sich helle und dunkle, mit Klin ker verkleidete Fensterstreifen ab. Ein zweistöcki ger Sockelbau nimmt die Gewerberäume auf, die rund um einen kleinen Innenhof liegen. Im Hoch haus gibt es pro Geschoss vier bis fünf Mietwoh nungen, deren Grundrisse verschiedene Orien tierungen ermöglichen.
Hochhaus am Chriesbach, 2025 Ueberlandstrasse 99
Bauherrschaft: Antonio Cerra / privat Architektur: Meier Hug, Zürich Landschaftsarchitektur: Manoa, Meilen Auftragsart: Wettbewerb, 2018
21 Beidseitige Ausblicke

Der lang gezogene Neubau mit 47 Eigentums wohnungen ersetzt vier kleine Wohnhäuser an der Glatt. Das gestaffelte Volumen reagiert auf die heterogene Umgebung am Übergang vom kleinteiligen Wohnquartier zum Gewerbegebiet und schirmt den Naturraum am Fluss von der Strasse ab. Die Wiese ist öffentlich zugänglich, einzelne Bäume ergänzen den Bestand am Ufer. Die Fassade ist mineralisch geplant, wird sich gegenüber der Darstellung im Wettbewerb aber noch verändern. Die Wohnungen sind beidsei tig zur Strasse und zum Fluss ausgerichtet und haben auf beiden Seiten eine Loggia. Die Rück
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
26
→ 19
20 21
sprünge der Fassade ermöglichen im Grundriss verschiedene Durch- und Aussichten Richtung Stadt oder Natur. Visualisierung: Nightnurse Images
Wohnsiedlung Birchlenstrasse, 2024 Birchlenstrasse 20 26 Bauherrschaft: Projektkontor, Zürich Generalplanung: Fischer, Zürich Architektur: Fischer, Zürich, mit Marco Duarte, Zürich Landschaftsarchitektur: Usus, Zürich Auftragsart: Wettbewerb, 2019
22 Drei Gieb el für die Kultur
Die Obere Mühle ist ein Kultur- und Begegnungs zentrum, das sowohl Künstler wie auch Vereine rege nutzen. Da der Saal für viele Veranstaltun gen zu klein ist, führte die Stadt 2015 einen Wett bewerb für einen Erweiterungsbau durch. Das Siegerprojekt von Bernath + Widmer und Studio De Pedrini umfasst Probe- und Lagerräume, ein Foyer und einen Saal mit 300 Plätzen. Drei re duzierte Giebelfassaden führen den Bestand abstrahiert weiter und sorgen für eine markan te Silhouette. Der Neubau schafft drei Aussen räume: einen grossen Platz beim Eingang, eine lauschige Terrasse am Kanal und Raum für die Anlieferung auf der Rückseite. Die Holzkonstruk tion der Sparrendächer bleibt sichtbar und prägt die Räume, die dank Faltwänden getrennt ge nutzt oder zusammengeschaltet werden können.
So kann der Speicher vielseitig genutzt werden, vom Kleinkunstfestival ‹ Chrüz & Quär › mit meh reren Bühnen bis zum Vereinsanlass.
Speicher Obere Mühle, 2023 Oberdorfstrasse 15 Bauherrschaft: Stadt Dübendorf Architektur: Bernath + Widmer, Zürich ; Studio De Pedrini, Zürich Auftragsart: Wettbewerb mit Präqualifikation, 2015 Baukredit: Fr 8,5 Mio.
23 Baden unter dem Satteldach Aufgrund eines Mangels an Wasserflächen in der Region entschied die Stadt Dübendorf, auf dem Gelände des Freibads Oberdorf an der Glatt ein neues Hallenbad zu bauen. Sie führte dafür einen Wettbewerb durch, den die Arbeitsgemeinschaft Markus Schietsch Architekten und Archobau ge wann. Der längliche Neubau ersetzt ein Gebäude mit Garderoben und einige Parkplätze und grenzt das Freibad zum Siedlungsgebiet ab. Das Sattel dach setzt ein markantes Zeichen und reagiert auf die benachbarten Bauten. Unter dem Dach sind diverse Nutzungen aufgereiht: Schwimmhal le, Garderoben, Cafeteria, Aussenbereich, Werk statt und eine Eingangshalle, die Frei- und Hal lenbad erschliesst. Die Haupträume ragen auf bis zum First. Schlanke Stützen filtern das Licht und die Aussicht zur Freibadanlage.
Hallenbad Oberdorf, 2025 Oberdorfstrasse 23

Bauherrschaft: Stadt Dübendorf Generalplanung: MSA , Zürich
Baumanagement: Archobau, Zürich Architektur: Markus Schietsch, Zürich Landschaftsarchitektur: Lorenz Eugster, Zürich Auftragsart: selektiver Wettbewerb, 2017 Baukosten: Fr 40 Mio.
24 Zeichen für die Zukunft
Seit 2017 steht der Pavillon für die Aufbruchstim mung auf dem Gelände des Flugplatzes Düben dorf. Er markiert das Tor zum Entwicklungsareal. Der Eingang faltet sich auffällig nach oben, das be gehbare Dach wird zur Aussichtsterrasse. Konst ruiert ist das Gebäude aus vorgefertigten Holzmo dulen. Es bietet Raum für Informationen über das Areal und für Besprechungen zu seiner Zukunft. Wenn die Transformation des Flugplatzgeländes beginnt, soll der Pavillon demontiert werden und die Module anderweitig zum Einsatz kommen.

Pavillon Innovationspark, 2017
Wangenstrasse 68

Bauherrschaft: Stiftung Switzerland Innovation Park Zurich, Dübendorf

Totalunternehmer, Holzbau: Blumer-Lehmann, Gossau Architektur: FAT, Munsbach ( LU )
Auftragsart: Wettbewerb
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Bauten und Projekte
27
22 23 23 24

28
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst
Blick von Gockhausen auf das Entwicklungsgebiet Hochbord, in dem in den kommenden Jahren noch einige Hochhäuser hinzukommen.

29
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst
Nationales Netzwerk für Forschung, Entwicklung und Innovation Die Stiftung ‹ Switzerland Innovation Park Zurich › ( Stiftung Innovationspark Zürich ) ist Teil des nationalen Netzwerks ‹ Switzerland Innovation › mit zahlreichen Standorten in der ganzen S chweiz. Ziel des Labels ist es, durch Lobbying und Vernetzung den Forschungs- und Hightechstandort Schweiz zu stärken und durch die Zusammenarbeit von Unter-
nehmen, Start-ups und Hochschulen ge zielt Innova tionen voranzutreiben. Auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf will der Innovationspark Zürich eine neue Plattform für Forschung, Entwicklung und Innovation schaffen. Schwerpunktthemen sind Manufacturing und Materials, Energy und Natural Resources, Computer und Data Science, Robotics, Mobility und Transportation sowie Health und Life Science.

Forschung auf dem Flugfeld
Auf dem Flugplatz Dübendorf wird die Zukunft mit weitreichenden Folgen geplant. Ein Teil des Areals soll in einen Innovationspark transformiert werden. Das gefällt nicht allen.
Text: Gabriela Neuhaus
Die Glattalbahn soll durch den Innovationspark auf dem Flugplatz Dübendorf verlängert werden.
30
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld
Räumliches Zielbild 2050
I nnovationspark Zürich ( Teilgebiete A und B ) F orschungs- und Werkflugplatz ( im Teil gebiet B )
Luftwaffe und Flugsi cherung ( Teilgebiet C ) Flugfeld ( Teilgebiet D )
urbane Entwicklungs achse Freiraumachse P ark interne Groberschlies sung



G lattalbahn hi storischer Flugplatz rand mit Vorfeldern Start- und Landebahn o ffenes Gewässer Veloschnellroute Bahnlinie / B ahnhof D übendorf Autobahn A15 / Au tobahnanschluss S iedlungskern Landschaft / Wald

Die Busfahrt vom Bahnhof Dübendorf zur Haltestelle In novationspark dauert keine fünf Minuten. Von dort sind es nur wenige Schritte an den Hangars vorbei auf das Vor feld des Flugplatzes. Ein Blick über ein unverbautes Ge lände öffnet sich, wie er in der zugebauten Agglo-Schweiz nur noch selten anzutreffen ist. Bis auf das konstante Ver kehrsrauschen von der nahe gelegenen Autobahn ist es ruhig. Keine Flugbewegungen, keine Menschenseele. Der älteste Flugplatz der Schweiz präsentiert sich an diesem Nachmittag – zumindest vordergründig – in einem tie fen Dornröschenschlaf. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt man hinter halb geöffneten Hangartoren High tech labors mit ETH-Logos. Zwei junge Männer tüfteln an einem Kleinstflugzeug. In einer Ecke der historischen Halle 3, die aktuell als Eventhalle dient, stehen Elektro rennautos. Dahinter eine grossformatige Infotafel, die in bunten Farben aufzeigt, wohin sich der Flugplatz Düben dorf in den kommenden Jahrzehnten entwickeln soll.
Noch ist wenig zu spüren von dem pulsierenden For schungszentrum, das hier dereinst entstehen soll. Dabei lobbyieren Interessenvertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft schon seit Jahren für das ehrgeizige Pro jekt: Die erste Machbarkeitsstudie der Stiftung Forschung Schweiz für einen Innovationspark auf dem Areal datiert aus dem Jahr 2007. Nachdem sich der Zürcher Regierungs rat 2012 für einen Hubstandort des Labels ‹ Switzerland Innovation Park › auf dem Flugplatz ausgespro chen hatte, erhielt das Projekt von der nationalen Volkswirtschafts direktorenkonferenz Rückendeckung. 2014 stellte der Bund 70 Hektar Land im nördlichen Teil des Flugplatzes für den Innovationspark zur Verfügung. Gleichzeitig gab er bekannt, das restliche Areal künftig als ziviles Flug feld weiternutzen zu wollen. Die Anstössergemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen begrüss ten den Innovationspark, stellten sich aber vehement gegen die Pläne des Bundes, den einstigen Militärflug platz als zivilen Business-Airport weiterzubetreiben. Als Gegenvorschlag erarbeiteten sie das Konzept ‹ Flugplatz Düben dorf – Historischer Flugplatz mit Werkflügen ›, das 2017 in allen drei Gemeinden von der Stimmbevölkerung deutlich angenommen wurde.
Umstrittener Gestaltungsplan






Während die Zukunft der Fliegerei ungewiss blieb, wollten die Innovationspark-Promotoren vorwärtsmachen. Der Kanton Zürich gründete zusammen mit der ETH und der Zürcher Kantonalbank die Stiftung ‹ Switzerland Inno vation Park Zurich ›, zu deren Stiftungspartnern auch die Städte Zürich und Dübendorf sowie die Universität Zü rich und die Eidgenössische Materialprüfungs- und For schungsanstalt ( Empa ) gehören. Das Raumplanungsamt des Kantons Zürich entwickelte einen kantonalen Ge staltungsplan als Grundlage für die Umsetzung der ers ten, 36 Hektar umfassenden Etappe. Er basiert auf einer städtebaulichen Studie von Hosoya Schaefer Architects von 2014, die in der Folge stark weiterentwickelt werden musste, zum Teil mit redimensionierten Bauvolumen.
In der Folge wurde von einer Einzelperson – stellver tretend für die lokale Gegnerschaft – beim kantonalen Verwaltungsgericht erfolgreich Rekurs gegen den fast 500 Seiten umfassenden Gestaltungsplan eingelegt. Das Zürcher Verwaltungsgericht urteilte, ein Gestaltungsplan sei das falsche Instrument für ein Projekt dieser Dimen sion. Aus genau diesem Grund hatte Cla Semadeni, pen sionierter Kantonsplaner aus Dübendorf und vehementer Kritiker des Innovationspark-Projekts, den Gestaltungs plan angefochten: « Es darf nicht sein, dass in der Schweiz 36 Hektar Land durch eine blosse Verfügung zur Bauzone erklärt werden können, ohne dass die Bevölkerung etwas dazu zu sagen hat. » D er Innovationspark sei ein Prestige projekt, das dessen Unterstützer aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft mit aller Kraft durchzudrücken versuch ten, ohne Rücksicht auf die historische Bedeutung des Areals oder auf seine langfristige Nutzung. « Aus meiner Sicht wäre es das Beste, im Moment nichts zu tun. Statt einer Hauruckaktion sollte man das historische Areal als Ensemble schützen und den Freiraum für die nächste Ge neration erhalten », so S emadeni.
Genau dafür plädierte auch das preisgekrönte Projekt ‹ Ein Moment der Klarheit › der 2011 vom Planer Thom Held und dem Ökonomen Jürg Minsch initiierten Denk-Allmend für den Flugplatz Dübendorf: Ein riesiger Spiegel auf dem stillgelegten Flugfeld holt den Himmel auf den Boden. →
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld

31
A B C D

32
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld
Der Militärflugplatz Dübendorf soll künftig als Forschungs-, Test- und Werkflugplatz genutzt werden.
Mitten in einer der am dichtesten besiedelten Regio nen der Schweiz forderte dieses Projekt Leere ein. Ziel des Wettbewerbs war es, neue Ideen für das frei werdende Flugplatzareal zu generieren, die über bestehende Kon zepte und wirtschaftlich geprägte Nutzungen hinauswei sen. Das Siegerprojekt ‹ Dübenholz › war aus heutiger Sicht besonders visionär: Als Gegenentwurf zum konventionel len Städtebau sollte auf dem Flugfeld ein Wald angelegt werden, der von der Freizeitgestaltung bis zur Holzgewin nung vielseitig genutzt werden könnte.
Keine dieser Visionen hatte je auch nur die geringste Chance, von den Behörden ernst genommen zu werden: Sie passten nicht in das Konzept des Kantons und der Pro motoren des Innovationsparks. Heute will sich Thom Held nicht mehr zur Entwicklung auf dem Flugplatz Dübendorf äussern. Sein Fazit: « Die gro sse Gelegenheit wurde ver passt, verschenkt. Das eigentlich Enttäuschende ist, dass das Absehbare, Naheliegende tatsächlich eintritt. Keine Überraschung. Kein neuer Geist. »
‹
Flight Plan › und Zielbild 2050
Um die Pläne für den Innovationspark zu retten, zog der Regierungsrat das Urteil des Verwaltungsgerichts an das Bundesgericht weiter. Parallel dazu setzte er eine Task force ein, die Ende August 2021 einen Synthesebe richt zu den weiteren Entwicklungsschritten für den Flug platz Dübendorf präsentierte. Interessenvertreter von Bund, Kanton, Gemeinden sowie aus der Wissenschaft er arbeiteten zusammen mit der Stiftung Innovationspark Zü rich und der Arealentwicklungsgesellschaft IPZ Property den ‹ Flight Plan › für die Zukunft des 230 Hektar grossen Areals. Er orientiert sich weitgehend an bestehenden Pla nungen und Beschlüssen und legt etwa die künftige Drei fachnutzung des Areals fest: Neben dem Innovationspark, der als neue Hauptnutzung mit internationaler Ausstrah lung etabliert werden soll, wird das Flugfeld weiterhin als ziviler Werkflugplatz ( ohne Businessflüge ) mit maxi mal 20 000 Flugb ewegungen pro Jahr betrieben werden. Das entspricht weitgehend dem Vorschlag der Anrainer gemeinden für den künftigen Flugbetrieb. Auch der Innova
tionspark unterstützt diese Pläne, da er sich vom Werkflug platz willkommene Synergien erhofft. Als dritten Pfeiler betreibt der Bund auch in Zukunft eine Militärbasis sowie das Flugsicherungszentrum Skyguide auf dem Areal.
Das gemeinsame Zielbild 2050 visualisiert die räum liche Entwicklung. Das Areal ist in vier Gebiete unterteilt. Teilgebiet A entspricht der ersten Ausbauetappe des Inno vationsparks. Sobald alle Hürden überwunden sind, sollen erste Neubauten für Forschung und Hightechunterneh men in den Bereichen Mobilität, Robotik, Aviatik, Raum fahrt und ‹ Advanced Manufacturing and Materials › ge baut werden. Im Teilgebiet B soll sich ein Aviatikcluster ansiedeln, in dem Forschung und Werkflugplatz inein ander übergehen. Teilgebiet C ist als Hochsicherheits bereich für militärische Nutzung und für Skyguide reser viert. Teilgebiet D, das eigentliche Flugfeld, bleibt rund um die Piste eingezäunt und soll ökologisch aufgewertet werden. Mit dem Flugfeldpark entsteht ein rund zehn Hek tar grosser öffentlicher Park. Geplant ist zudem ein Rund weg um das ganze Areal. « Der Synthesebericht war eine grosse Chance und bot die Möglichkeit für eine integrale Gesamtbetrachtung. Das Resultat entspricht weitgehend dem Gestaltungsplan », sagt René Kalt, der langjährige G e schäftsführer der Stiftung Innovationspark Zürich.
Wettbewerb für erste Neubauten
Im November 2021 dann die grosse Erlösung für die Promotoren des Innovationsparks: Das Bundesgericht kippte den Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts, setzte den kantonalen Gestaltungsplan per sofort in Kraft und verwies auf das übergeordnete nationale Interesse. Damit lag der Ball beim Regierungsrat des Kantons Zürich. In der Zwischenzeit hatte der Bund die Pläne für einen zivilen Business Airport ad acta gelegt und gab somit den Weg frei für das Modell eines Forschungs- und Werkflugplatzes. Der Regierungsrat verabschiedete in der Folge drei Vorlagen zuhanden des Kantonsparlaments. Unter Berücksichtigung des Gestaltungsplans beantragt der Regierungsrat mit der Einzonung der für den Innovationspark vorgesehenen Bau felder eine Anpassung des kantonalen Richtplans.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld

33
→ →
Situationsplan des Teilgebiets A mit Start-up-Vorfeld ( A ), Innovation Mall ( B ), Parkway ( C ), Flugfeldpark ( D ) und Säntispark ( E ).
A
Plan: Vogt Landschaftsarchitekten
B C
D
E
Der Flugplatz Dübendorf 1910 2022 Gründung der Genossenschaft Aerodrom Dübendorf.
Die Eidgenossenschaft wählt Dübendorf als Standort für einen Militärflugplatz. Das Gelände wird vorerst gepachtet.
Für 380 000 Franken kauft der Bund das Gelände. Er baut den Flugplatz Dübendorf weiter aus und nutzt ihn nach Ende des Ersten Weltkriegs zunehmend auch für die zivile Luftfahrt.
Der neu gebaute Flughafen ZürichKloten wird in Betrieb genommen. Düben dorf wird zum reinen Militärflugplatz.

Das VBS beschliesst das Ende der Jet fliegerei in Dübendorf. Jahrelange Diskussionen über die künftige Nutzung des Flugplatzes beginnen.
Erste Pläne und erste Machbarkeitsstudie für einen Innovationspark auf dem Areal.
Der Wettbewerb ‹ Denk-Allmend › sucht nach neuen Ideen für die Zukunft des Flugplatzes Dübendorf.
Der Zürcher Regierungsrat will auf dem Areal einen Innovationspark bauen.
Der Bundesrat will auf dem Gelände des Militärflugplatzes Dübendorf eine Dreifachnutzung mit Innovationspark, militärischer Bundesbasis und zivilem Business Airport. Für den Innovationspark stellt der Bund 70 Hektar des Areals zur Verfügung. Die Anrainergemeinden stellen sich dagegen und erarbeiten einen Gegenvorschlag. Der Kanton Zürich gibt eine städtebauliche Studie für den Innovationspark in Auftrag, an der Hosoya Schaefer, AGPS und Vittorio Ma gnago Lampugnani beteiligt sind.
Gründung der Trägerorganisation Stiftung Innovationspark Zürich. Der Kanton Zürich beteiligt sich mit 500 000 Franken Startkapital.
Der Zürcher Regierungsrat legt den kanto nalen Gestaltungsplan ‹ Innovationspark Zürich › fe st, der als Basis für die künftige Überbauung dienen soll. Gegen dieses Vorhaben gehen verschiedene Beschwer den ein, die bis auf eine zurückgezogen oder nicht zugelassen werden.
Das Baurekursgericht schützt den kanto nalen Gestaltungsplan in allen Punkten und weist den Rekurs vollumfänglich ab.
Das Zürcher Verwaltungsgericht heisst eine Beschwerde gegen den Entscheid des Baurekursgerichts gut und beurteilt den kantonalen Gestaltungsplan als unzu lässig. Der Zürcher Regierungsrat legt Be schwerde beim Bundesgericht ein. Gleichzeitig setzt er eine Taskforce ein, die die Weiterführung des Projekts un abhängig vom Bundesgerichtsentscheid sicherstellen soll.
August: Präsentation des Synthese berichts für die Zukunft des Flugplatzes Dübendorf als Basis für die Weiter entwicklung von Innovationspark sowie ziviler und militärischer Fliegerei.
November: Das Bundesgericht kassiert das Urteil des Zürcher Verwaltungs gerichts und setzt den kantonalen Gestal tungsplan per sofort in Kraft.
Den Charakter bewahren
Als Wiege der Schweizer Luftfahrt und langjährigem Haupt flugplatz der Schweiz kommt dem Flugplatz Dübendorf eine hohe historische Bedeutung zu. Entsprechend gross ist die Zahl der in den Inventaren von Bund und Kanton aufgeführten Bauten am Rand des Flugfelds. Sie sind nicht bloss als Einzelobjekte, sondern als Ensemble schützens wert, wie die Eidgenössische Kommission für Denkmal pflege 2015 in einem Gutachten festhielt. « Die Ge samt erscheinung ist sehr wesentlich », bestätigt Roger Strub von der Kantonalen Denkmalpflege Zürich. Aus diesem Grund musste ein erster Entwurf für die Bebauung des ehemaligen Rollfelds noch einmal überarbeitet werden er trug der räumlichen Wirkung des Ensembles zu wenig Rechnung. Das habe sich nun stark verbessert, so Strub. Die Bauherrschaft sehe den Einbezug der historischen At mosphäre mittlerweile als Potenzial und trage die Zielset zungen der Denkmalpflege mit. Dabei gehe es in erster Li nie darum, den Charakter der ursprünglichen Bebauung zu bewahren. « Der Flugplatz Dübendorf ist ein Areal, das sich entwickeln kann und soll – die ursprüngliche Nutzung fällt weg, nun muss etwas Neues entstehen, das sinnvoll ist an diesem Ort », fasst Strub zusammen. So wird etwa in Kauf genommen, dass für die künftige Erschliessung des Areals die denkmalgeschützte Halle 1 an ihrem jetzigen Standort demontiert und an anderer Stelle wieder aufge baut wird. Bei der Umgestaltung der historischen Gebäu de ist die Denkmalpflege involviert, wie eng sie die Neu bauten begleiten wird, ist noch offen.
34
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld
Das Architekturbüro KCAP plant für die ETH Zürich den Umbau eines Hangars auf dem Flugplatz. Visualisierung: Filippo Bolognese Images
1910 1914 1918 1948 2005 2007 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2021
Die nächsten Schritte
Ende 2022 beschliesst der Zürcher Kan tonsrat über drei Vorlagen zur Gebiets entwicklung Flugplatz Dübendorf: die An passung des kantonalen Richtplans an den Synthesebericht, einen Kredit über 97,45 Millionen Franken für die schritt weise Entwicklung de s Innovationsparks und einen Planungskredit von 8,2 Millio nen Franken für einen Forschungs-, Testund Werkflugplatz . Die Kreditvorlagen unterliegen dem fakultativen Referendum. Parallel zum politischen Prozess lanciert die Arealentwicklerin IPZ Property im vierten Quartal 2022 einen Architekturwettbewerb für die ersten Neubauten des Innovationsparks.
Eingeladene Büros:
Aus der Schweiz: Boltshaus er, Zürich ; Christian Kerez, Zürich ; E2A, Zürich ; Herzog & de Meuron, Basel ; Hosoya Schae fer, Zürich ; Nissen Wentzlaff, Basel International: BIG, Kopenhagen ; Bruther, Paris ; Muoto, Paris ; Sou Fujimoto, Tokio ; 3X N, Kopenhagen
Zudem werden drei Büros junger Archi tektinnen und Architekten aus der Schweiz aus gewählt und eingeladen.
→
Hinzu kommen zwei Kreditvorlagen: die Anschub finanzierung für die Entwicklung der Teilgebiete A und B in der Höhe von 97,45 Millionen Franken sowie ein Planungskredit von 8,2 Millionen Franken für den For schungs- und Werkflugplatz siehe ‹ Die nächsten Schritte ›. Der weil arbeiten die Verantwortlichen der Stiftung Innova tionspark Zürich und deren Entwicklungsgesellschaft IPZ Property, deren Aktien aktuell noch zu 90 Prozent HRS Real Estate und zu 10 Pr ozent der Stiftung Innova tionspark Zürich gehören, im Hintergrund mit Volldampf daran, dass der Innovationspark über die Randzonen hin aus zügig weiterentwickelt werden kann, sobald die poli tischen Weichen gestellt sind.
Bereits haben Forschungsteams der ETH in der denk malgeschützten Halle 3, die aufwendig renoviert und für die neue Nutzung angepasst wurde, erste Labors einge richtet. Im ‹ Büro Züri Innovationspark › – dem ehemali gen Feuerwehrgebäude – stellt die Zürcher Kantonalbank ausgewählten Start- up s und Jungunternehmen zeitlich begrenzt kostenlose Räume zur Verfügung. Verschiede ne Firmen, die sich dereinst auf dem Areal ansiedeln wollen, sind zudem übergangsweise bei Maagtechnic in Stettbach eingemietet, bis die Flächen auf dem Areal in Dübendorf bezugsbereit sind. « Für die Transformation des Areals haben Renovation und Umbau der denkmalge schützten Hallen für die ETH und die Universität Zürich oberste Priorität », sagt Andr ea Thöny, Geschäftsführer von IPZ Property und Gesamtprojektleiter aufseiten von HRS Real Estate, dem ausführenden Arealentwickler und Totalunternehmer. Mit einem Wettbewerb, zu dem neben renommierten Büros aus dem In- und Ausland auch drei Nachwuchsteams junger Architektinnen und Architek ten eingeladen werden, soll die Architektur für die ers ten sieben Neubauten im Teilgebiet A bestimmt werden siehe ‹ Die nächsten Schritte ›
« Der Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit und Nut zungsflexibilität », so Thöny. « Die Teams können für die Bearbeitung zwischen verschiedenen, vom Auslober vor gegebenen Gebäudetypologien wählen. Die Siegerprojekte werden anschliessend in einem partizipativen Verfahren weiterentwickelt und in unser städtebauliches Konzept
eingepasst. » Man suche nach einer « robusten Struktur », um den Anforderungen der künftigen Mieterinnen gerecht zu werden. « Die Arealentwicklung bietet die einmalige Ge legenheit, eine Smart City von Grund auf als Ganzes zu planen und unsere hohen Anforderungen an Themen wie Nachhaltigkeit, CO²-Reduktion oder Kreislaufwirtschaft zu erfüllen », sagt der G esamtprojektleiter. In Bezug auf den genauen Zeitplan und Details zum weiteren Vorgehen hält er sich bedeckt. Als letzte Hürde steht nämlich das ordentliche Baubewilligungsverfahren an, dessen Dau er durch allfällige Einsprachen mehr oder weniger in die Länge gezogen werden kann.
Ein lebendiges Quartier – in zehn Jahren
Die Bauherrschaft strebt bei der Entwicklung des Areals generell eine Vielfalt an architektonischen Lösun gen an. Für jedes Bauprojekt soll ein Wettbewerb ausge schrieben werden, obwohl der Gestaltungsplan das nicht verlangt. Es handelt sich überwiegend um mehrgeschossi ge Gebäude, die wegen des instabilen Untergrunds auf Pfählen stehen und über keine Untergeschosse verfügen. Ein Parkway erschliesst die verschiedenen Gebäude als Hauptachse, dazwischen soll viel Platz für öffentliche Nut zungen und ein lebendiges Campusleben geschaffen wer den, so die Promotoren des Innovationsparks.
Parallel zur Aufgleisung der ersten Bauvorhaben im Teilgebiet A wird zurzeit – basierend auf dem Synthese bericht – ein Gestaltungsplan für das Teilgebiet B entwi ckelt. In zehn Jahren, so Andrea Thöny, werde die Trans formation des einstigen Militärflugplatzes in einen zivilen Forschungs-, Test- und Werkflugplatz abgeschlossen sein, was dem Aufbau des geplanten Aviatikclusters Auftrieb geben werde. Bis dahin werde auch die erste Etappe des Innovationsparks fertig gebaut sein und sich mit grossen und kleinen Unternehmen füllen.
Ähnlich sieht das René Kalt, der die Entwicklung des Innovationsparks von Anfang an begleitet hat: « In zehn Jahren haben wir hier ein pulsierendes Quartier mit Fir men und Hochschulen, das sich zu einem neuen Stadtteil von Dübendorf entwickelt hat. » Damit es so kommt, bleibt noch viel Planungsarbeit zu erledigen. ●
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022 Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld




35
Etappe 1: Umbau der Bestandsbauten.
Etappe 3: Die Allee am Bebauungsrand nimmt Form an. Etappe 4: Das Teilgebiet A ist vollständig bebaut.
Etappe 2: Erste Neubauten im Osten und im Süden.
 Die Gemeinde hat eine rasante Entwicklung hinter sich – und noch vor sich. Ein Heft über Wachstum und Wachstumsschmerzen in der viertgrössten Stadt im Kanton Zürich.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022
Die Gemeinde hat eine rasante Entwicklung hinter sich – und noch vor sich. Ein Heft über Wachstum und Wachstumsschmerzen in der viertgrössten Stadt im Kanton Zürich.
Themenheft von Hochparterre, Dezember 2022









 Text: Deborah Fehlmann
Text: Deborah Fehlmann