
16 minute read
als Feinde Europas
Gleichgewichts"46 zu beseitigen versuchte. So begann in der nationalsozialistischen Lesart nicht 1918, sondern erst 1938 - mit dem Münchner Abkommen - der "Neubau eines gesunden Europas",47 der den als "notwendig" erklärten Abschied vom System des Gleichgewichts einleitete. Das deutsche Streben nach einer umfassenden Revision der Versailler Bestimmungen konnte durch diese Argumentation als eine echte, im Interesse des gesamten europäischen Kontinents liegende, unabdingbar notwendige "Neuordnung" des Staatensystems charakterisiert werden, deren Grundzüge sich zunächst über die Abgrenzung von "Feindbildern" herauskristallisierten.
2.1.2. "Britischer liberaler Imperialismus" und "jüdischer Bolschewismus" als Feinde Europas
r - '■ ' ■■■■■■ X . ■ : r . , • : ;.:r * .. . .. . • ■ Die Charakterisierung der "Feindbilder", die die postulierte Notwendigkeit einer "Neuordnung" des europäischen Kontinents untermauern sollten, wurde zunächst als eine primär "weltanschauliche" Frage dargestellt,48 die erst im weiteren Verlauf konkrete politische Schlußfolgerungen zeitigte. Die beschworenen "Gefahren", die Europa insgesamt zu drohen schienen, verstärkten das Bild "unhaltbarer" Zustände im politischen Staatensystem, dem nur durch eine radikale Abkehr von den bisherigen - untauglich gewordenen - Organisationsprinzipien zu begegnen war. Die "Feindprojektionen", die dabei verwendet wurden, griffen erneut auf die differenzierten Einschätzungen der europäischen Zustände zurück und vereinten diese mit ganz konkreten Schlußfolgerungen, die ausschließlich deutsche Interessen bedienten. Die gesamteuropäischen "Befindlichkeiten", die durchaus von diesen angenommenen Gefahren mitgeprägt waren, machten einzelne Aspekte der "Feinbildpropaganda" durchaus akzeptabel. Erst deren prononcierte Wichtung und die Auswahl der angesprochenen Themen ließ sie zu einer äußerst wirkungsvollen Instrument im nationalsozialistischen "Neuordnungs"-Streben werden.
In diesem Verständnis basierten die Feindbilder auf der Gegenüberstellung von nationalsozialistischer bzw. faschistischer "Revolution" und westlicher Demokratie sowie bolschewistischem System. Ausgehend von diesen allgemein angelegten Aspekten wurde die "weltanschauliche" Gegenüberstellung im Verlauf der deutschen Außenpolitik mit den realen Gegnern Deutschlands politisch personalisier und wechselseitig den
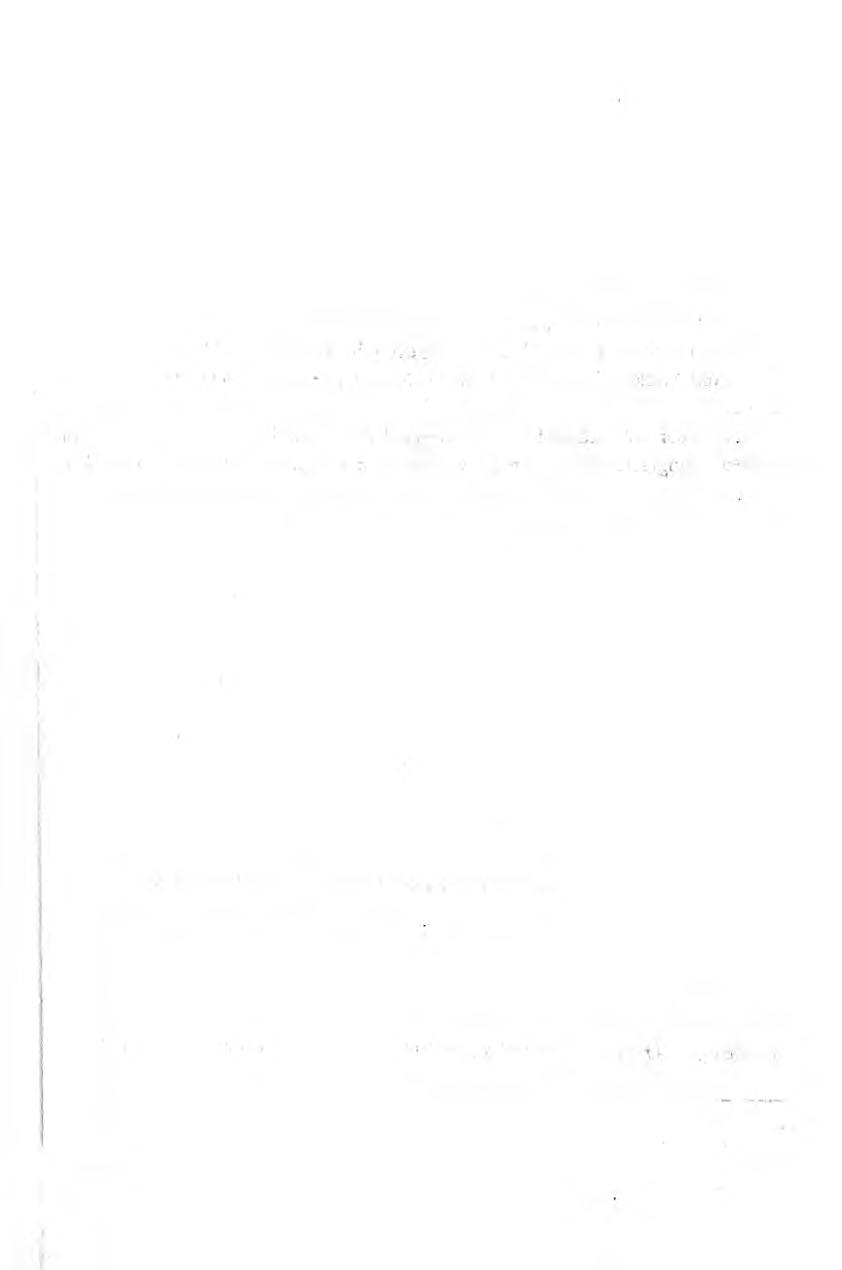
46 Vgl. E. v. Wedel: Der Grundsatz vom europäischen Gleichgewicht, a.a.O., S. 104. 47 Vgl. J. Pfitzner: Die Wiederherstellung der mitteleuropäischen Lebensgemeinschaft, in: Europäische Revue, 1939, S. 333-337, S. 333. 48 Vgl. A. Rosenberg: Krieg der Weltanschauungen, in: Nationalsozialistische Monatshefte, 1940, S. 323-326, S. 323.

politischen Erfordernissen angepaßt: Die "westliche Demokratie" konkretisierte sich zunehmend in Gestalt von Großbritannien und nach dem Kriegseintritt der USA auch in den Vereinigten Staaten, der Bolschewismus wurde zum Synonym für die Sowjetunion und die Kommunistische Internationale, wobei zwischen dem Abschluß des deutsch- sowjetischen Freundschaftsvertrages von 1939 und dem deutschen Überfall auf die
UdSSR politische Rücksichtnahmen überwogen.49 Nach dem Beginn des Krieges im
September 1939 wurden die entworfenen Szenarien umso bedrohlicher und nuancenreicher, in ihrer ständigen Wiederholung aber auch stereotyper, je m ehr sich die deutsche
Situation an der Front verschlechterte, da die deutsche Kriegführung der Unterstützung aus den verbündeten oder besetzten Ländern bedurfte. Die deutschen Gegner wurden in der nationalsozialistischen Darstellung zu "Feinden Europas", die verstärkt nach der
Entstehung der Antihitlerkoalition gemeinsam den Bestand des Kontinents in Gefahr brachten. "Englischer Liberalismus" verband sich mit dem expansiven "jüdischen
Bolschewismus" und der wachsenden "Weltaggression" der USA,50 deren Gesamtpotential europafeindlicher Haltungen nur das nationalsozialistische Deutschland zu bekämpfen vermochte. Gleichsam im Umkehrschluß zeichneten sich - in der typischen propagandistischen Überhöhung und Fehlinformation - über die Feindbilder die alternativen
Vorstellungen einer nationalsozialistischen "Neuordnung" des Kontinents in ersten
Umrissen ab: ns.
Vor allem schienen dabei sowohl der Liberalismus als auch der Sozialismus, die beide mit "jüdischen Elementen" zersetzt wären, "unkonstruktiv" für die europäische Ordnung, ja für jeden Ordnungsgedanken überhaupt zu sein. P a u l H e rre leitete diese
Schlußfolgerungen aus den historischen Entstehungsbedingungen der Ideologien ab und konstatierte, daß der Liberalismus, "das Kind der Aufklärung", zw ar "fest" au f dem "Boden der staatlichen Wirklichkeit" stünde, aber "damit ebensowenig konstruktiv im
Sinne eines europäischen Aufbaus" sei "wie mit seiner Verherrlichung des Freiheitsideals, das kosmopolitischen Ideen und illusionistischen freimaurerischen Bestrebungen Raum" gäbe. Dies gelte umsomehr für die Demokratie, da diese "bei aller Verschleierung" letztlich nur politische und wirtschaftliche "Selbstsucht" hervorriefe, die "das Sonderinteresse über den Gemeinschaftsgeist" erhoben habe. Indem H e rre diese Charakterisierung von Liberalismus und Demokratie vor allem au f den negativen Einfluß des "Judentums" zurückfuhrte, zeigte er bereits eine weitere, "rassisch" bedingte Argum entationslinie auf, die vor allem nach dem Kriegseintritt der USA zu greifen begann. A ber am "wenigsten Ordnung schaffend" wirkte laut H erre der Sozialismus, obwohl er "mit
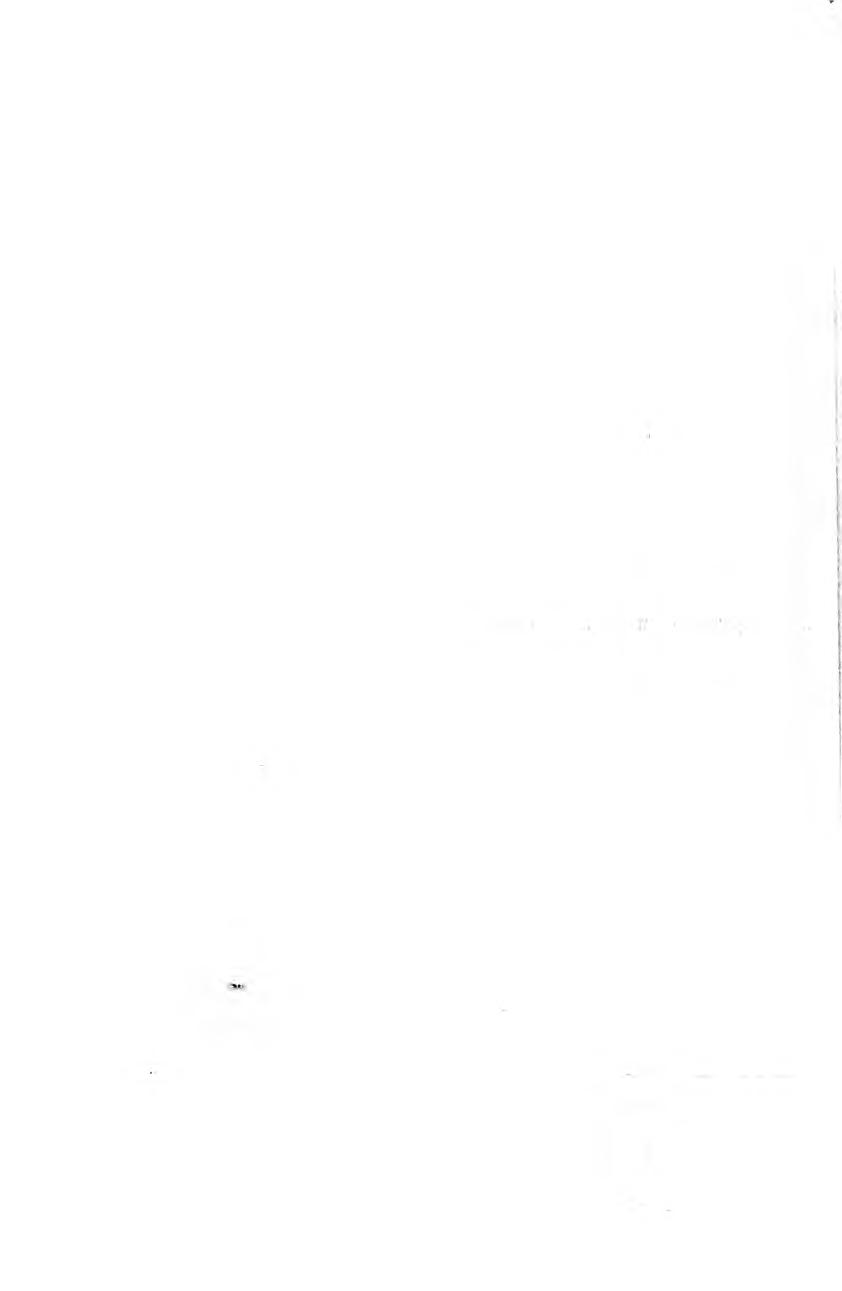
49 Vgl. u.a. A. Ratenieks: Was bringt die Neuordnung Europas den europäischen Völkern?, Berlin 1942, S. 9f. 50 Vgl. F.A. Six: Die Weltpolitik im Jahre 1942, in: Jahrbuch der Weltpolitik, 1943, S. 13-43, S. 13.

seinem Bemühen um die Emporhebung der untersten Schicht und ihre Befreiung vom Druck des Kapitalismus grundsätzlich das geschichtliche Recht auf seiner Seite" habe. Da der Sozialismus allerdings ebenfalls unter den "Einfluß jüdischen Denkens" geraten sei und sich daraufhin dem "Materialismus" und dem "Prinzip des Klassenkampfes" verschrieben habe, so daß er schließlich "auch noch die nationale Idee verneinte und sich einem weitgehenden Internationalismus hingab", hätte er sich letztlich als "trennende Kraft in das eigene Volk wie in das europäische Völkerleben"51 hineingeschoben.
Eine M onographie von Bruno Amann aus dem Jahre 1940 ging dann soweit, den Krieg als eine Auseinandersetzung zweier "Zivilisationen" zu betrachten, wobei er die "erste Zivilisation", die "westliche", an Frankreich, England und Amerika und damit an Kapitalismus, Demokratie und Imperialismus festmachte, die ein Bündnis mit dem "Slawentum" und dem Semitismus eingegangen seien.52 Die "zweite", die "mitteleuropäische Zivilisation" wurde von Deutschland verkörpert, wobei Amann den Gegensatz zwischen den beiden Hauptrepräsentanten England und Deutschland als "unüberbrückbar" einschätzte.53 Mit dem Weltkrieg 1914-1918 sei die "erste Zivilisation" in ihre "letzte Phase" eingetreten: Die "höchste Form des Individualismus", die sie verkörperte, stand endgültig zur Disposition. Das demokratische System, ja die Idee der Demokratie überhaupt galten als "überaltert", den neuen Anforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen.54 Gegen sie an traten mit der "mitteleuropäischen Zivilisation" Tugenden wie "Treue, Disziplin, freiwillige Unterordnung unter ein großes Z iel,... selbstlose Entsagung, schärfste Selbstzucht und ein tiefes Gefühl für echte Gemeinschaft, ein wahrhaft göttliches Empfinden für den Trieb zum Staate"55, die der Nationalsozialismus für sich beanspruchte. In der Gegenüberstellung von westlicher Welt und nationalsozialistischen
Gedanken zeichnete vor allem Alfred Rosenberg die ideologischen Fronten in ihrer ganzen Überzogenheit und ihrer propagandistischen Instrumentalisierung nach: Auf der einen Seite der "unersättliche Imperialismus des Angelsachsen, der unausrottbare Trieb, die Welt als Privatbesitz zu beherrschen, aufgebaut auf den Werten des Erfolges, des
Reichtums und des Glücks", auf der anderen die vorgebliche "Idee des Sozialismus in seiner tiefsten und reifsten Bedeutung, aufgebaut auf dem Willen zur Macht, auf dem
Kampf um das Glück, nicht des einzelnen, sondern der Gesamtheit, auf den Gedanken von Befehl und Gehorsam."56
Auf dieser Basis bildeten dann die britischen Positionen in Europa und der Welt den

51 Vgl. P. Herre: Wesen und Wandel der europäischen Ordnung, a.a.O., S. 138. 52 Vgl. B. Amann: Der Sinn unseres Krieges, Wien/Berlin 1940, S. 8,25. 53 Vgl. ebenda, S. 23. 54 Vgl. A. Rosenberg: Krieg der Weltanschauungen, a.a.O., S. 324. 55 Vgl. ebenda, S. 27. 56 Vgl. ebenda, S. 27.
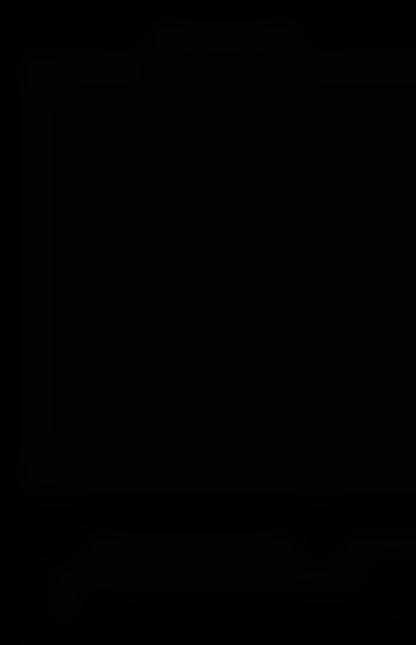
ersten Angriffspunkt der deutschen Feinbildpropaganda: Der postulierte Zustand einer "Dreigliederung der Welt" in eine "pax Britannica", eine "pax Americana" sowie die von der Sowjetunion beherrschte "pax Sarmatica", wie sie Johannes K ü h n vom ahm , schien Deutschland, aber auch Japan keinen Platz zu lassen. Im Gegenteil, so die deutsche Argumentation, die der Ausgangssituation der europäischen Konfrontation entsprach, "britisches Weltmonopol" und "deutsche Großmacht" schlössen sich naturgemäß aus. Damit war die erste Verbindung zwischen deutschen Kriegsgegnern und "Feinden Europas" hergestellt. Der "Sinn des Krieges" entfaltete sich in der Folge im "lebensnotwendigen" Kam pf gegen den britischen Herrschaftsanspruch,37 in welchem deutsche und europäische Interessen nunmehr als Synonym betrachtet winden. D ie Argumenta- tionskette von der liberalen "Europafeindlichkeit", die in der Ablehnung des deutschen Reichsgedankens und der Idee der europäischen Konzentration kulminiere, war geboren. Die liberalen Ideale von Freiheit und Demokratie wurden gleichsam als Antithese zur Idee des Reiches dargestellt, die allein in der Lage sei, die liberal bedingte Zersplitterung der europäischen Verhältnisse durch einen tragfahigen Ordnungsgedanken abzulösen.38 Die deutsch-britische Konfrontation geriet dabei zum stellvertretenden Feindbild, das die Gegenüberstellung von Liberalismus und "totalitärem" nationalsozialistischem Regime am deutlichsten verkörperte. Die gesamte Ideologie des NS-Staates wurde zunehmend als "Negation Englands und des englischen Systems" insgesamt propagiert.39 Schon im Frühjahr 1939, geprägt von den ersten, noch als unzureichend eingeschätzten Erfolgen der deutschen Revisionspolitik, beschrieb ein Beitrag von K a r l R ich ter die "weltpolitische" Situation der beiden Gegenspieler Deutschland und England als "weniger durchsichtig": Während Deutschland "die Initiative zur Veränderung der Lage übernommen" hätte, besäße England den "Schlüssel zu ihr". Deutschland strebe dabei eine Lösung an, die "den Frieden dadurch sichert, daß jedem Volk sein Lebensrecht - Raum und Unterhalt" gegeben werde. England dagegen habe die Wahl: es könne der Welt "den Frieden geben, indem es - den eindeutigen, geopolitischen Entwicklungsgesetzen Rechnung tragend - für eine Verteilung der Landmasse eintritt, die allen Völkern genügend Lebensraum" gebe; oder es würde "dem Streben nach sogenannter Prestige- und Machterhaltung um jeden Preis allein nachgebend -, w eiter den M ann mit den zugeknöpften Taschen spielen und dieser Art Gefahren heraufbeschwören, die im allgemeinen unberechenbar sind, bei geopolitischer Betrachtungsweise aber deutlich 57 58 59
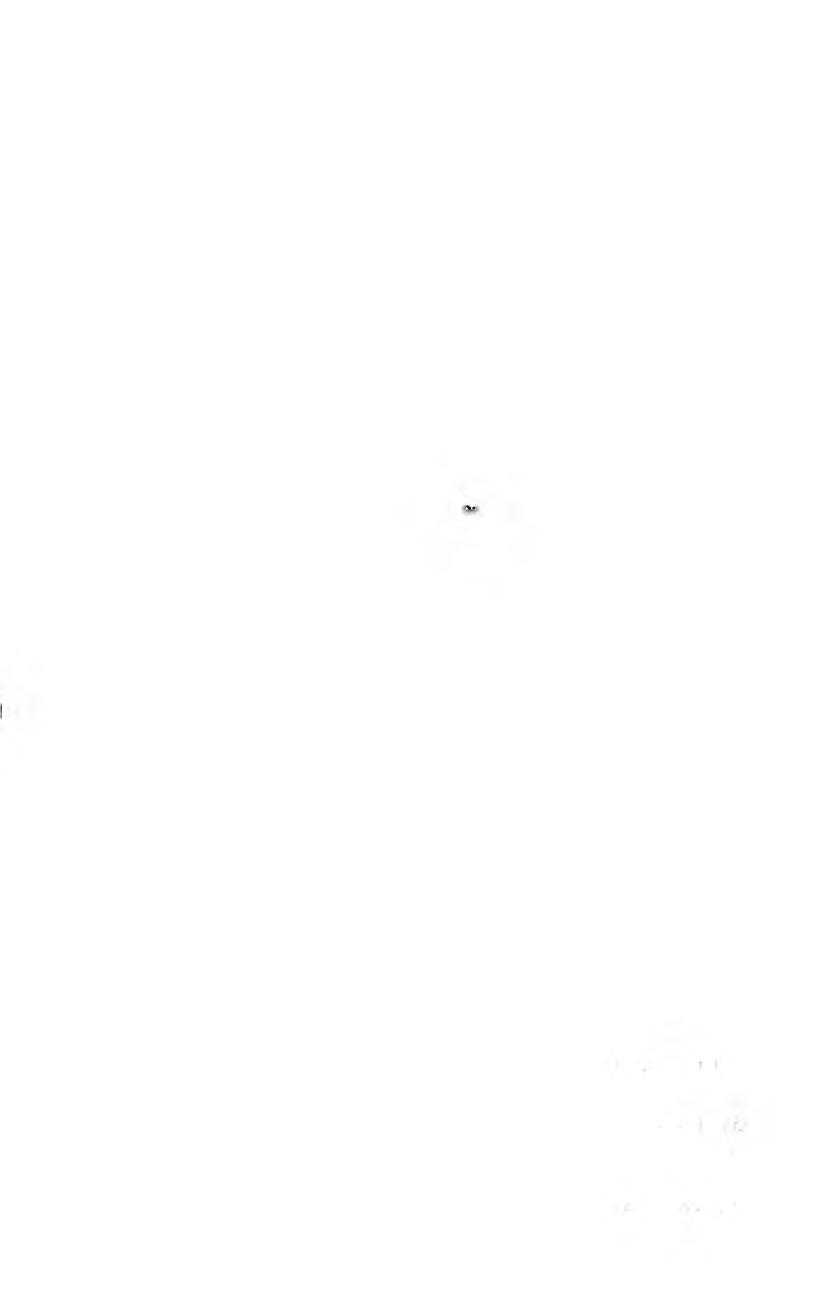
57 Vgl. J. Kühn: Über den Sinn des gegenwärtigen Krieges, Teil 3, in: Zeitschrift für Geopolitik, 1940, S. 156-171, S. 156, 162, 167. 58 Vgl. K. Rüdiger: Die Freiheit Europas wird im Osten erkämpft, a.a.O., S. 646. 59 Vgl. C. Scarfoglio: Europa ohne England?, in: Das neue Europa, Dresden 1941, S. 344-373, S. 369.
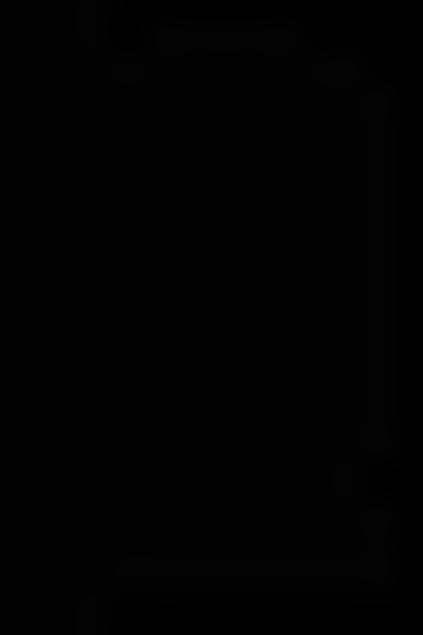
gesehen werden" könnten.60
Nachdem die "unberechenbaren Gefahren" mit dem deutschen Überfall auf Polen Realität geworden waren und England im Gegenzug Deutschland den Krieg erklärt hatte, wandelten sich diese noch sehr gemäßigten Töne radikal. Das nunmehr postulierte "englische Kriegsziel" zeichnete ein Schreckbild englischer Vorherrschaft über den Kontinent, die auf die Uneinigkeit Europas und den alleinigen Zugang Englands zu den Reichtümem der Welt beruhe und von der geographisch "europa-fremden" Lage des Inselreiches unterstützt würde.61 Der eigentliche Krieg zwischen Großbritannien und Deutschland trat mehr und mehr in den Hintergrund, galt doch die englische Kriegserklärung als Ergebnis der überholten Gleichgewichtspolitik, die das politische Schicksal des gesamten Kontinents tangierte.62 Wie es Hans Kaiser formulierte, hätte die englische Politik "vor und seit Beginn des zweiten Weltkrieges nur ein Ziel gekannt: die Vernichtung des Reiches zwecks Niederhaltung Europas und Ausschaltung jedes machtpolitischen und geistigen Widerstandszentrums gegen diejenigen Mächte, denen eine gesunde Aufwärtsentwicklung unseres Kontinents eine Gefährdung ihrer eigenen Zielstellungen bedeutet"63 habe.
Die deutsche Kriegführung gegen England war zur "gesamteuropäischen" Interessenvertretung avanciert. Die vorgeblich "europafeindliche" Politik Großbritanniens zeigte sich dabei - laut der deutschen Interpretation - sowohl in den politischen Ambitionen Englands gegenüber dem Kontinent als auch in seinem liberal geprägten Wirtschaftsverständnis. Analog zu den Einschätzungen der Gleichgewichtspolitik, deren Hauptvertreter England war, galt die englische Haltung als extrem europa-feindlich, da sie die Zerissen- heit des Kontinents im Interesse der eigenen Weltmacht voraussetze.64 Dieser Argumentation folgend betonte ein Beitrag von F. Appel, daß "England, dessen Reich sich über alle Weltteile" ausdehne, "selbstverständlich den ewigen Frieden... in einem internationalen Staatenbunde" wünsche, da ihm dieser Frieden "nicht nur ein Weltreich, sondern auch, dank der ihm in diesem Bunde zu übertragenden Aufgabe der See- und Luftsicherung, jene Freiheit des Handelns" sichere, die "für alle übrigen Mitglieder des Staatenbundes die Opferung der Souveränität zugunsten des polizeigewaltigen Eng-
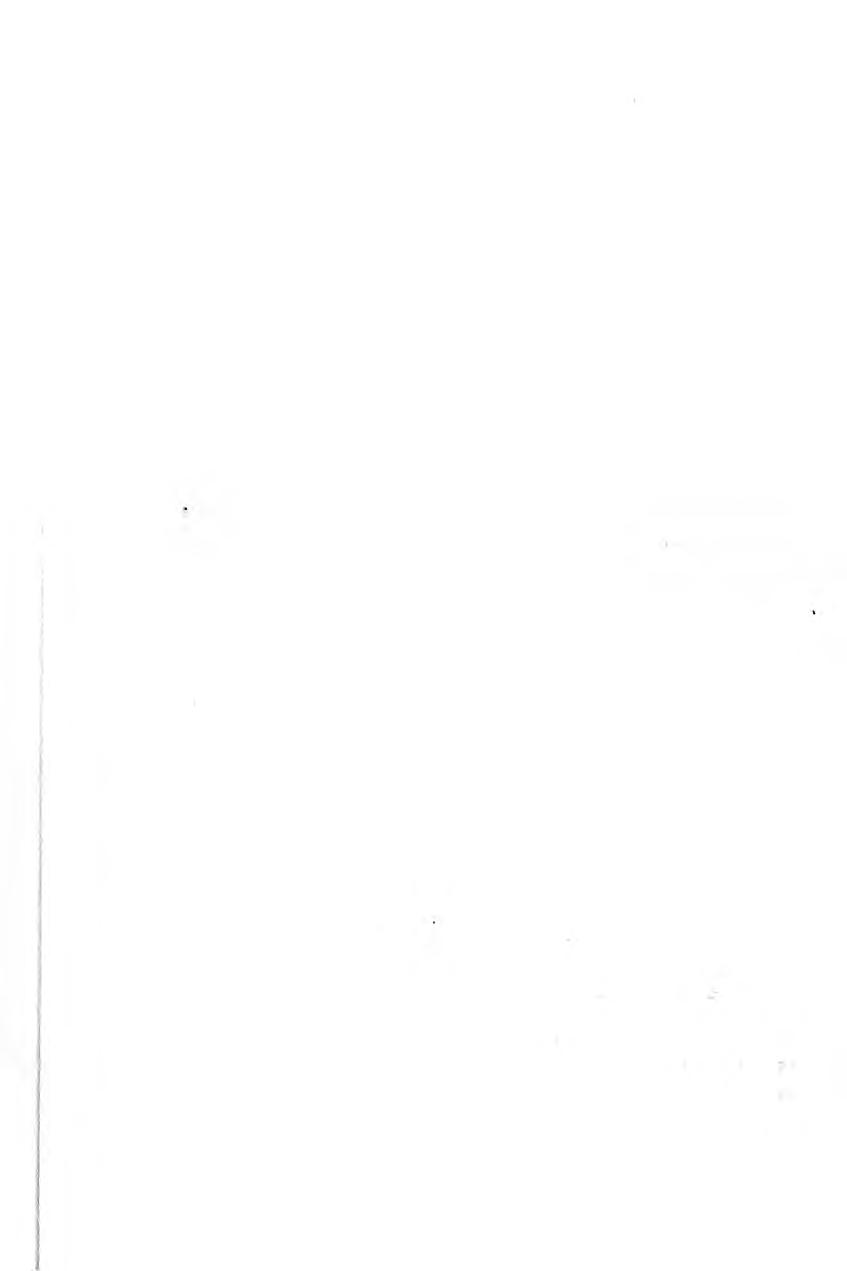
60 Vgl. K. Richter: Die politische Stellung der sieben Großmächte als Folge ihrer völkischen Lage im Raum, a.a.O., S. 265. 61 Vgl. H. Kaiser: Pax Britannica oder Pax Americana, in: Zeitschrift für Politik, 1941, S. 389- 410, S. 394. 62 Vgl. F. Berber: Epochen europäischer Gesamtordnung, a.a.O., S. 923. 63 Vgl. H. Kaiser: Europa als Aufgabe, in: Zeitschrift für Politik, 1943, S. 462-472, S. 466. 64 Vgl. u.a. W. Jantzen: Geopolitisches zur Weltlage, Heidelberg/Berlin/Magdeburg 1941, S. 57; A. v. Gadolin: Entwicklung zum europäischen Bewußtsein, a.a.O., S. 94; W. Ziegler: Der Ordnungsgedanke in der europäischen Geschichte, a.a.O., S. 75; A. Urach: Die Neuordnungsprobleme Japans und Deutschlands, in: Zeitschrift für Politik, 1942, S. 804-823, S. 808.

lands" bedeute. Neben dem damit suggerierten englischen Kriegsziel, der Vernichtung
Deutschlands, bestünde das "Friedensziel" Englands deshalb insgesamt darin, die "nationalen Souveränitäten au f der Welt zugunsten eines unter britischer Vormundschaft und britischem 'Schutz'... stehenden internationalen Staatenbundes"65 zu beschneiden.
Unabhängig von diesem britischen Weltherrschaftsszenario spiegelten eine Reihe von
Beiträgen durchaus wider, daß das Schwergewicht der politischen und wirtschaftlichen
M acht längst von London an Washington übergegangen war.66 Aber diese Feststellung blieb im Interesse der europawirksameren Propaganda weitgehend sekundär, da sich das
Feindbild England als praktikabler erwies. Die Vision eines Kontinents, der zum Objekt englischer Politik degradiert wurde, ermöglichte es, eine notwendige "europäische
Solidarität" im K am pf gegen den "gemeinsamen" Feind zu beschwören,67 die auf dem
W iderstreben der Völker gegen den englischen Führungsanspruch aufbaute.68 Diese
Frontstellung schien sich in der deutschen Interpretation auch in den Prinzipien der englischen Wirtschaftspolitik zu offenbaren. Die dabei am stärksten kritisierten Maximen der englischen Wirtschaftsauffassung lagen in der "Herrschaft des M arktes", der
Überbetonung von "Kapital und Kapitalverflechtung" als "Angelpunkte der Wirtschaft" und der "internationalen Freizügigkeit" als der "Voraussetzung zur besten wirtschaftlichen Leistung". Die Übertragung dieser als rein "englisch" charakterisierten Prinzipien auf die Weltwirtschaft habe die wirtschaftliche Entwicklung der anderen Staaten strikt in "englische Bahnen" gelenkt und sie letztlich nach englischen M arktinteressen ausgerichtet.69 In der Folge dominiere ein "wirtschaftliches Gangstertum im Frack",70 das die anderen Staaten zu "Lieferländern" ausgewählter Spezialprodukte für den englischen
Bedarf degradiere und sie langfristig zu "Monokulturen" mache.71 D ie englische "Europafeindlichkeit" hatte damit eine umfassende "Begründung" erhalten, deren Antithesen bereits die - deutsche - Alternative in Aussicht stellten.
Neben dieser antibritischen, antiliberalen Frontstellung bildete die V ision vom "europafeindlichen Bolschew ism us" den zweiten Schwerpunkt der deutschen Feindbildpropaganda. In ihrer chronologischen Entwicklung wurde der pragm atische A spekt der
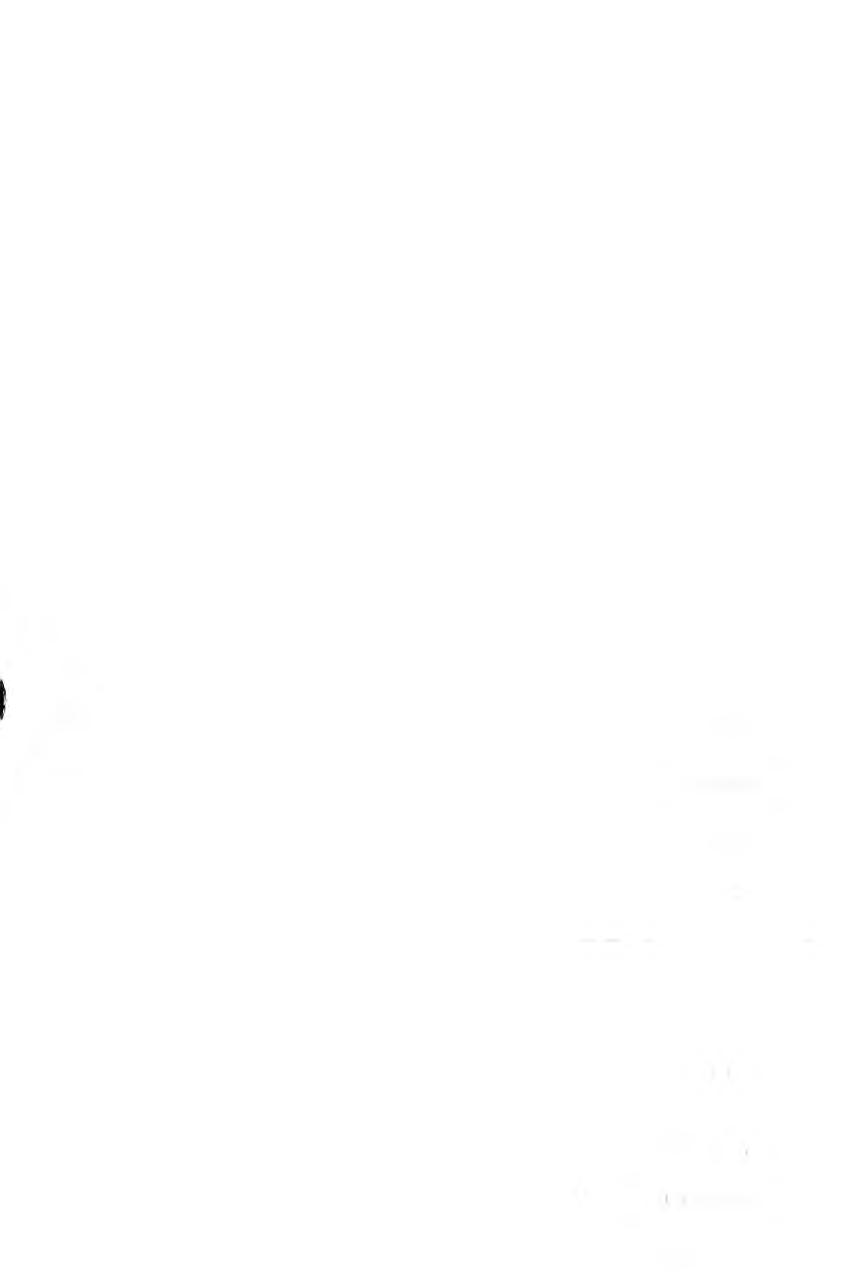
65 Vgl. F. Appel: Der Kampf des 20. Jahrhunderts, a.a.O., S. 14. 66 Vgl. F. Berber: Epochen europäischer Gesamtordnung, a.a.O., S. 923; H. Kaiser: Pax Britanni- ca oder Pax Americana?, a.a.O., S. 389, 406ff. 67 Vgl. H. Kaiser: 'Die Vereinigten Staaten von Europa' und das englische Kriegszielprogramm, in: Auswärtige Politik, 1940, S. 671-685, S. 671. 68 Vgl. K. Rüdiger: England kämpft gegen Europa, a.a.O., S. 960. 69 Vgl. H. Hunke: Volk und Raum in der wirtschaftlichen Neuordnung Europas, in: Zeitschrift für Geopolitik, 1940, S. 571-575, S. 571. 70 Vgl. A. v. Gadolin: Entwicklung zum europäischen Bewußtsein, a.a.O., S. 97. 71 Vgl. W. Hoffmann: Englands Weltwirtschaftspolitik und die Rolle der M onokulturländer, in: Zeitschrift für Politik, 1940, S. 482-505, S. 485ff.

Feindbildthesen besonders deutlich. Obwohl der Bolschewismus in der gesamten Vorstellungswelt des Nationalsozialismus als der Feind schlechthin galt, wurden die entsprechenden Darstellungen in der Zeit zwischen dem Abschluß des deutsch-sowjetischen Freundschaftsvertrages und dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion erheblich relativiert. Erst nach dem Juni 1941 stand die "bolschewistische Gefahr" wieder im Mittelpunkt der Argumentation, ja sie erhielt angesichts der sich abzeichnenden deutschen Niederlage gleichsam beschwörende Züge. Der vorgebliche Hauptangriffspunkt lag dabei im internationalen Charakter der bolschewistischen Ideologie: Wie ein Beitrag von Georg L eibbrandt 1937 betonte, stütze sich die sowjetische Außenpolitik auf "drei Pfeiler": die Kommunistische Internationale, den sowjetischen Staat und die Kommunistische Partei und verfolge auf dieser Basis ihr oberstes Ziel, die "Weltrevolution". Da innerhalb der Kommunistischen Internationale in fast allen europäischen Ländern kommunistische Parteien entstanden waren, verfugte, so Leibbrandt, Stalin damit bereits über ein breites Netz seiner Herrschaft.72 Ein Beitrag aus dem Jahre 1944 ergänzte diese Vision dann durch die sowjetischen Ziele, "europäische Sowjetrepubliken" als Ergebnis des "bolschewistischen Eroberungsdranges" zu schaffen.73 Diese Vorstellung wurde mit der Gegenüberstellung völlig verschiedener Kulturverständnisse und Menschenbilder verbunden, die den drohenden "Untergang des Abendlandes" in Aussicht stellten. Der dabei gezeichnete Typ des "Bolschewisten" bildete in seiner Gesamtheit die Antithese zum "Europäer", den Deutschland favorisierte, und wurde daraufhin mit einer Fülle negativ belegter Charakteristika ausgestattet. Ein Beitrag von Karl Anton P rim Rohan stellte also fest:
"Der Europäer sieht sich als Glied einer Kette, die vom Vater über ihn zu seinem Sohn führt. Der Bolschewist fühlt sich als Vater einer Zukunft, der seinen eigenen Vater verleugnet. Der Europäer bekennt sich zur Geschichte seines Volke ... Der Bolschewist hat sich gegen die Vergangenheit aufgelehnt, verachtet seine eigene nationale Geschichte und glaubt als Begründer einheitlicher Geschichte der Menschheit deren Vorgeschichte in Völkern und Staaten überwunden zu haben. Dem Europäer ist Politik und Geschichte Zusammenspiel geistig-seelischer und wirtschaftlich-sozialer Kräfte... Der Bolschewist ist dem Dogma des historischen Materialismus verfallen... (Ihn) interessiert... der Mensch in erster Linie in seiner wirtschaftlichen Funktion:... also vor allem als Arbeitskraft. Persönlichkeitsentfaltung, menschliche Differenzierung, ja Kultur schlechthin sind im Bolschewismus nur insofern geduldet, ja sogar gefördert, als sie sich arbeitstechnisch als Leistungssteigerung erweisen. Dem Europäer ist demgegenüber der Mensch
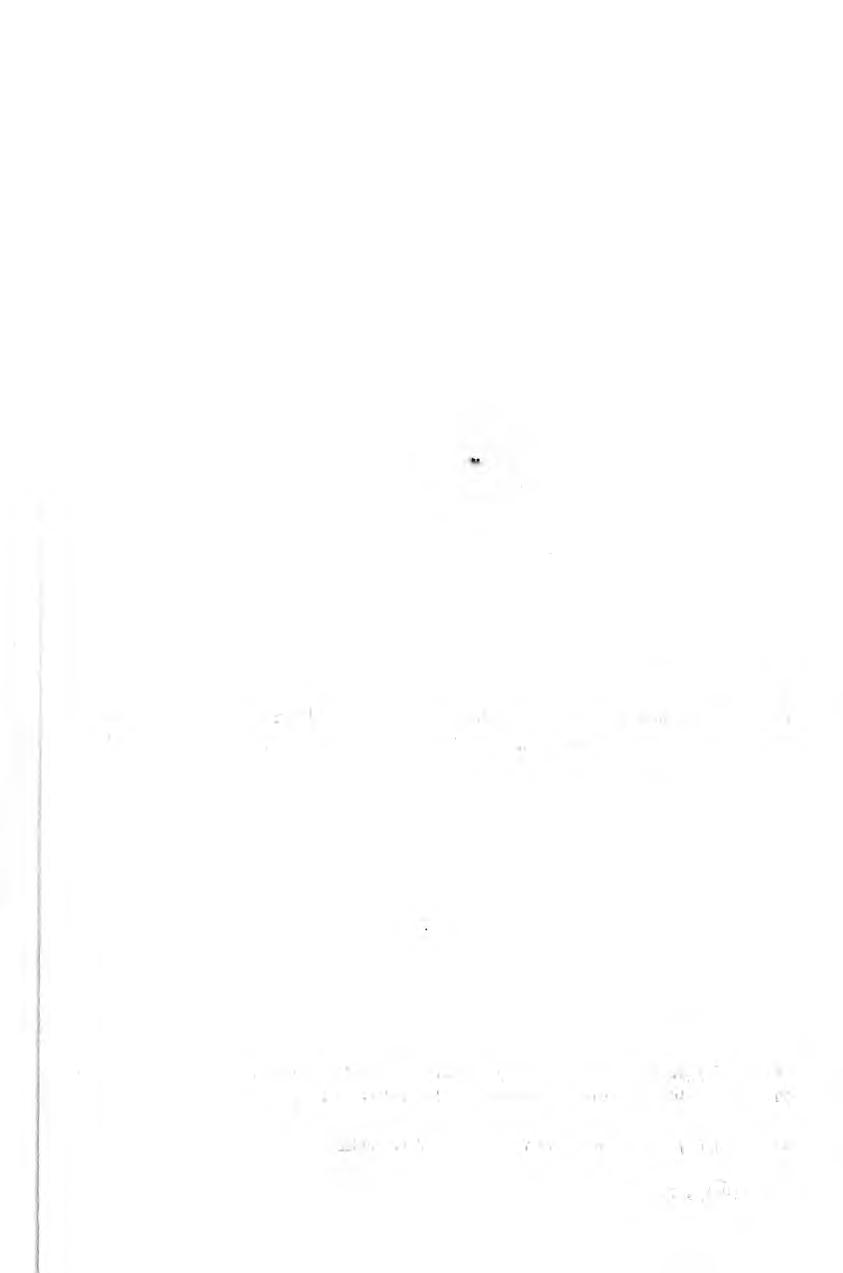
72 Vgl. G. Leibbrandt: Weltrevolution und Sowjetaußenpolitik, in: Auswärtige Politik, 1937, S. 740-753, S. 740, 745. 73 Vgl. K.A. Prinz Rohan: Europa und der Bolschewismus, in: Auswärtige Politik, 1944, S. 216- 224, S. 218.
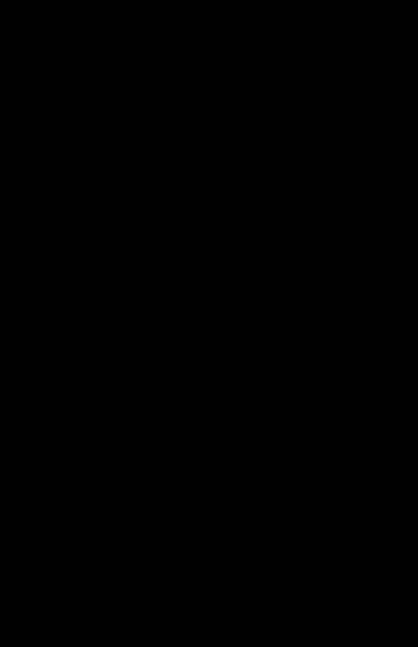
Anfang und Ende, Sinn und Inhalt alles Lebens, aller Wirtschaft, aller Kultur ,.."74
Die Gesamtheit dieser negativen Erscheinungen gipfele dann - so J o s e f Goebbels - in der
Verbindung des Bolschewismus mit dem "Judentum", die den "jüdischen Terror" in den
Dienst der "Weltrevolution" stelle und "das geschichtliche Erbe der abendländischen
Menschheit begraben" würde.75 Der Bolschewismus war zur Gefahr für den Bestand des gesamten europäischen Kontinents westlicher Prägung schlechthin geworden.76 Auch und gerade in dieser Konstellation übernahm das nationalsozialistische Deutschland in der Argumentation - wie schon in der Konfrontation mit dem britischen Liberalismus - die Rolle eines "Schutzwalls" für Europa.77
Die Bedeutung dieser "Aufgabe" kulminierte letztlich durch die Verbindung der "Feinde Europas" in der Antihitlerkoalition, die die "Gefahren" für den Kontinent nach deutscher
Lesart noch potenzierte. Folgerichtig übertrug A lfre d R osenberg die aktuelle Gegnerschaft im Weltkrieg nunmehr auch auf die ideologische Konfrontation: Seine Beschreibung der Frontlage sah auf der "einen Seite... die gesamte M acht der Ideologien von der
Französischen Revolution an bis zur bolschewistischen Revolte", w ährend "auf der anderen Seite... soweit Europa in Frage kommt, die Mächte" stünden, "welche die demokratische und marxistisch-bolschewistische Erkrankung bereits in furchtbarster Weise selber erlebt, durchkämpft" hätten.78 Dabei unterstützte vor allem das englisch-sowjetische Bündnis die deutsche These von der Bedrohung durch ein "Antieuropa",7' da doch
Großbritannien den Kampf gegen die Achse dem K am pf gegen den Bolschewismus vorzuziehen schien.80 Nach der deutschen Interpretation riskiere England im Bestreben, das Gleichgewichtssystems auch weiterhin zu erhalten, die "Bolschewisierung" des Kontinents, der es letztlich im Unterschied zu den Achsenmächten nichts entgegenzusetzen habe.81 Das Bündnis von "Britischem liberalen Imperialismus" und "jüdischem Bolschewismus" schien damit das gesamteuropäische Schicksal zu gefährden - eine Entwicklung, die in deutscher Lesart nur durch die als "unübersehbar notwendig" dargestellte "Neuordnung" des Kontinents aufzuhalten wäre.
In der Umkehrung entstanden gleichsam als Schlußfolgerung aus der beschriebenen
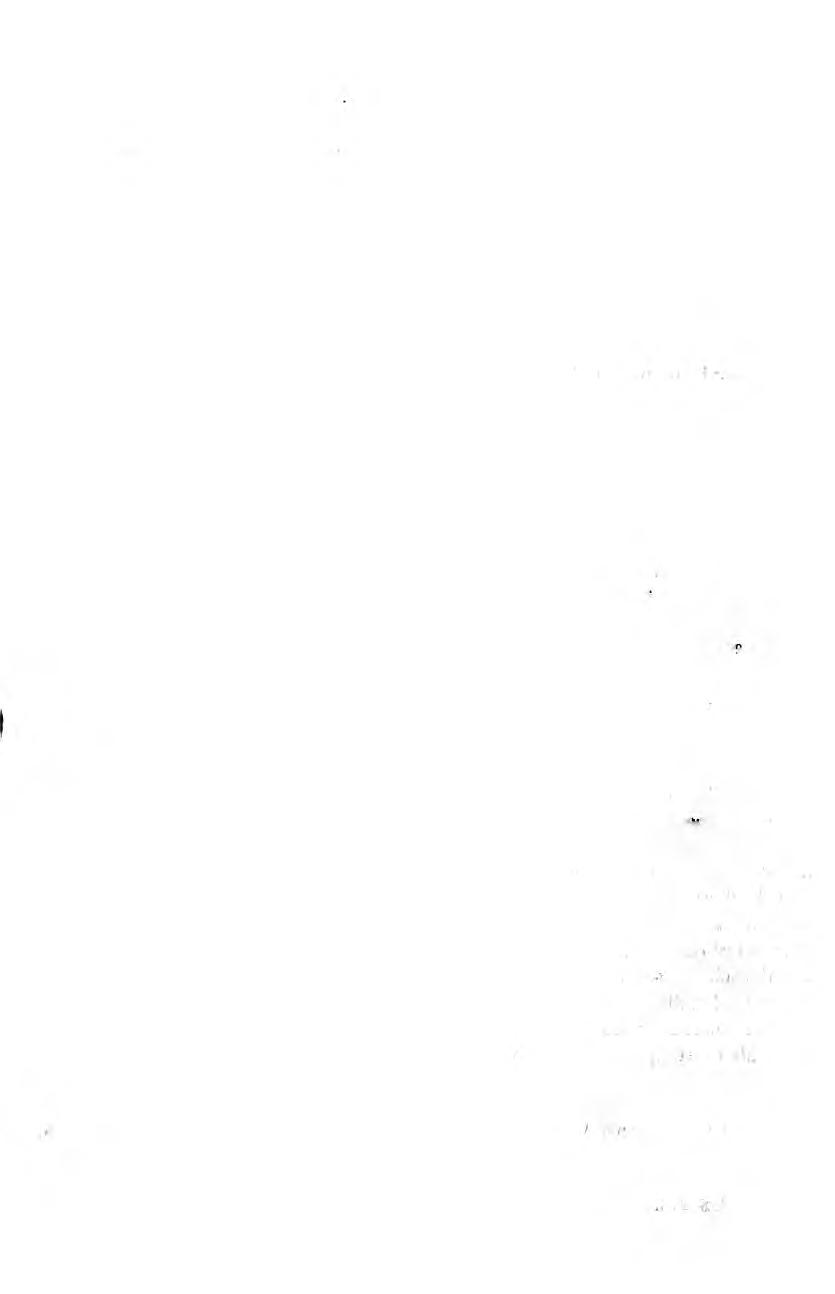
74 Ebenda, S. 220. 75 Vgl. J. Goebbels: An Europa, in: Junges Europa, 1943, S. 8-11, S. 8, 11. 76 Vgl. C. Augustin: Untergang des Abendlandes?, a.a.O., S. 603. 77 Vgl. Europa und der Bolschewismus, a.a.O., S. 8. 78 Vgl. A. Rosenberg: Der Weltkampf und die Weltrevolution unserer Zeit, a.a.O., S. 3. 79 Vgl. A. Blau: Die Beteiligung der europäischen Völker am Kampf gegen den Bolschewismus, in: Europa und die Welt, Berlin 1944, S. 254-272, S. 255. 80 VgJ. R. Kircher: Europäische Vorfragen, in: Volk und Reich, 1941, S. 789-793, S. 789. 81 Vgl. H. Raschhofer: Faktoren und Gegenkräfte europäischer Einheit, in: Volk und Reich, 1941, S. 794-803, S. 803.






