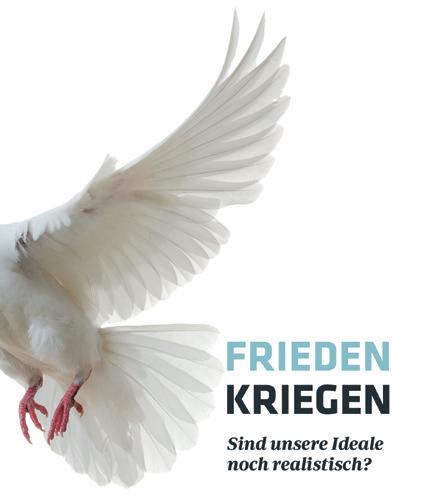
3 minute read
wie war‘s? WARUM WIR NICHT IN FRIEDEN LEBEN KÖNNEN
Sind unsere Ideale noch realistisch? Reflexionen zum Saisonthema FRIEDEN KRIEGEN // von kathrin steger-bordon
In einigen wenigen Wochen, am 24. Februar 2023, jährt sich der Ausbruch des Ukrainekrieges zum ersten Mal. Der Angriffskrieg Russlands ist ein Einschnitt in eine Weltordnung, auf die wir uns in den Jahrzehnten davor nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlassen haben. Wie geht es uns heute mit der veränderten Situation?
Advertisement
Neben den internationalen, den geopolitischen Folgen ist Putins Überfall auch auf persönlicher Ebene für viele eine Zäsur – beispielsweise bei der Einstellung zum Pazifismus. In einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung haben bereits im Juni 2022 42 Prozent der Befragten das Ende der deutschen pazifistischen Haltung konstatiert. Ausgehend von diesen verloren gegangenen Selbstverständlichkeiten stellte die Domberg-Akademie mit dem Saisonthema FRIEDEN KRIEGEN die Frage: Wie sollen wir persönlich und politisch damit umgehen, wenn Ideale fraglich geworden sind und wir in einen Zwiespalt zwischen Idealen und (veränderten) Realitäten geraten?
Wir haben uns dieser Frage in einer mehrteiligen Online-Veranstaltungsreihe genähert. Am 14. November 2022 betrachteten wir das Ideal der transnationalen Solidarität. Professorin Dr. Julia Eckert von der Universität Bern vertrat dabei die These, dass nur das Festhalten am Ideal der transnationalen Solidarität eine Perspektive zur Bewältigung aktueller Problemlagen bereithalte. So arbeitete sie die Wichtigkeit solidarischen Denkens heraus, beispielsweise bei (kriegsbedingten) Migrationsströmen oder auch dem Klimawandel. Sie plädierte dafür, nicht in Nationen, sondern in Verflechtungseinheiten zu denken, zum Beispiel durch international agierende Institutionen. Neben diesen transnationalen Verflechtungseinheiten brauche es eine gut funktionierende lokale Nachbarschaft als politische Verwaltungseinheit. Beides könne in ihrem skizzierten Ideal die übergeordnete Stellung von Nationalstaaten abschwächen oder gar ersetzen.
Professor Dr. Giorgi Maisuradze von der staatlichen Ilia-Universität in Tiflis (Georgien) führte dagegen aus, dass gerade kleine Staaten historische Erfahrungen gemacht haben, in denen transnationale Verflechtungen zur Prekarisierung und Benachteiligung der lokalen Bevölkerung geführt hätten. Zu oft sei man von mächtigeren „Partnern“ überrollt worden.
Eine besondere Herausforderung stellen in Georgien nun die vielen russischen Geflüchteten dar, die mehrheitlich aus der Mittelschicht stammten. Sie sorgen durch ihre Finanzkraft für eine massive Preissteigerung von Wohnraum, die nun viele Georgier:innen trifft. Die Solidarität der einheimischen Bevölkerung, die sich 2008 selbst noch gegen einen russischen Überfall wehren musste, wird damit auf eine harte Probe gestellt.
Das Völkerrecht ist und bleibt eine wichtige Rechtsordnung – auch wenn es zweifellos Schwächen hat. Das ist das eindeutige Statement von Professor Dr. Stefan Kadelbach von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, der am 29. November 2022 zu Gast war. Er stellte sich der provokanten Frage, ob das Völkerrecht denn überhaupt noch einen Sinn habe, wenn es so einfach gebrochen werden kann. Kadelbachs Plädoyer: Man müsse das Völkerrecht in einem größeren Kontext sehen. Die Konsequenzen von Völkerrechtsbrüchen sind zwar nicht so unmittelbar sichtbar wie nach konventionellen Straftaten, aber sie sind dennoch sehr wohl spürbar – aktuell etwa in Form durch das Völkerrecht legitimierter Sanktionen, in der Zukunft voraussichtlich durch Reparationen und Prozesse am internationalen Strafgerichtshof. Sein Beispiel: Auch heute noch werden betagte Männer und Frauen für ihre Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg vor Gericht gestellt – das hätte sich 1945 noch niemand vorstellen können. Wie das Ideal des Völkerrechts eine bindendere Geltung bekommt, bleibt offen, doch die Konsequenzen von Rechtsbrüchen sind heute schon real.
Eine weitere Veranstaltung der Reihe widmete sich am 11. Januar 2023 dem christlichen Ideal der Feindesliebe. Tenor der Diskussion: Auch in einem brutalen Angriffskrieg hat sich dieses Ideal nicht einfach erledigt. Es verbietet uns nicht, uns gegen militärische Aggression zu wehren, fordert aber, auch im Angreifer nicht nur den Feind zu sehen, und Wege zum Frieden zu suchen. Mit Blick auf die Feindesliebe zeigt sich, was generell im Umgang mit herausfordernden Idealen gilt: Es gibt nicht immer moralisch perfekte und „ideale“ Lösungen – wir sind aber dennoch gefordert, die bestmögliche Option zu wählen. Auch ein Ideal, dem wir uns nur annähern können, kann in diesem Sinne Orientierung bieten. •
SAISONTHEMA
VON SEPTEMBER 2022 BIS JANUAR 2023
Gut zu wissen
Wir setzen unser Saisonthema FRIEDEN KRIEGEN mit zwei spannenden Veranstaltungen im Bildungsbereich Persönlichkeit & Pädagogik fort. An zwei Gesprächsabenden beschäftigen wir uns mit „Inneren und äußeren Konflikten“ und gehen der Frage nach: „Wann hören Kriege auf?“ • Seite 27
Haben Sie unsere OnlineReihe zu Solidarität, Völkerrecht und Feindesliebe verpasst, interessieren sich aber für die dort gehaltenen Impulse? Kein Problem.
Für eine Schutzgebühr von 9 Euro geben wir Ihnen einen exklusiven Zugang zu den Videos der Veranstaltungen. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Mail an info@domberg-akademie.de







