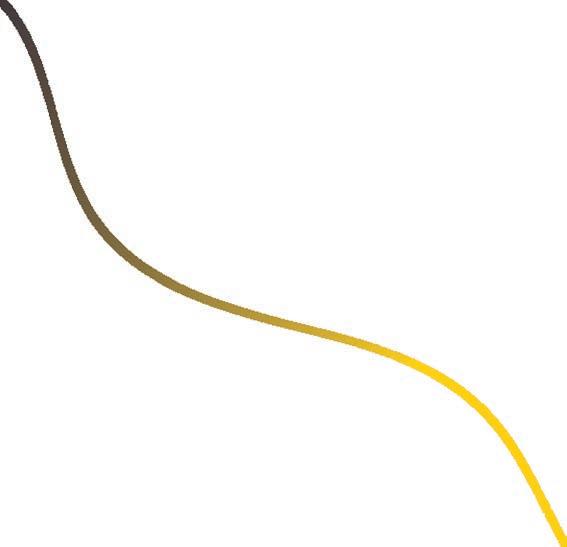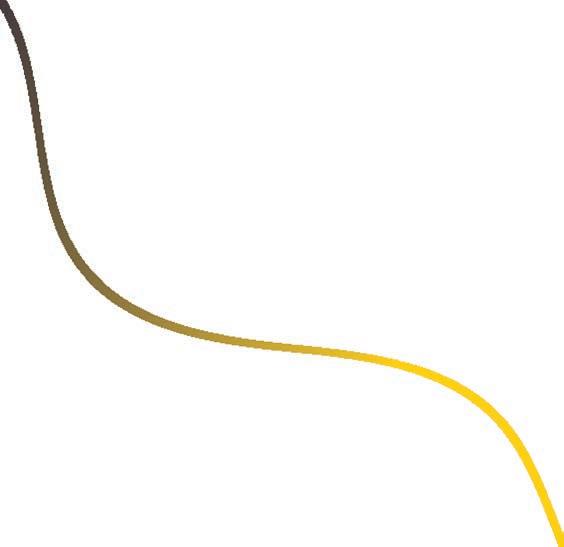Ausgabe 11/202527. Oktober 2025
3

Zusammenarbeit
Rheinland-Pfalz’ Digitalministerin
Dörte Schall über Kooperationen, DMK und Pilotländer.

Souveränität
ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt beschreibt die Pläne für mehr digitale Souveränität. 13

Ausgabe 11/202527. Oktober 2025
3

Zusammenarbeit
Rheinland-Pfalz’ Digitalministerin
Dörte Schall über Kooperationen, DMK und Pilotländer.

Souveränität
ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt beschreibt die Pläne für mehr digitale Souveränität. 13
Wie soll der Deutsch la nd-Stack gesta ltet sein? Das fragten sich viele. Mit dem Start der Konsultation g ibt das BM DS diese Frage nun zurück Dabei geht es zunächst „nur“ um die technischen Standards, da rüber zeich net sich g rößerer Diskussionsbedarf a b.
Eine souveräne, europäisch anschlussfähige und interoperable digitale Infrastruktur für Bund, Länder und Kommunen: das Ziel des Deutschland-Stacks ist hochgesteckt und noch fehlt das große Bild Wie viele unterschiedliche Aspekte und Anforderungen zu berücksichtigen sind, zeigt sich in den Diskussionen, selbst in kleinen, wenig heterogenen Runden, wie kürzlich beim Panel „Wer? Wie? Was? Der Deutschland.Stack in der Diskussion“ auf der Smart Country Convention Allein bei der Frage nach den Erfolgsfaktoren des D-Stacks setzten die Diskutanten ganz unterschiedliche Schwerpunkte: Christine Serrette, Technische Vizedirektorin beim ITZBund ist Einfachheit wichtig Dr

Heike Stach, Referatsleiterin DS I 1 beim Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS), nennt Transparenz, Offenheit und eine sehr gute Kultur der Zusammenarbeit; für Ammar Alkassar, Vorstand bei GovTech Deutschland, zählen vor allem agile Steuerungsmechanismen sowie Schnelligkeit. Der Bund müsse mutig Standards setzen, so Berlins CDO Martina Klement, Vergabe und Kosten seien zu klären Jörg Kr emer , Ab te il un gs le it un g be i FITKO, plädierte für Klarheit, resultierend auf guter Dokumentation, offene Schnittstellen und gute Governance. Es gibt, auf der Haben-Seite, aber nicht nur bestehende Lösungen, die eingesetzt werden sollen, etwa
Ku rz gemeldet
die DVC oder die Deutschland Plattform des GovTech Deutschland, sondern auch Grundlagenarbeit, Referenzarchitekturen und die vermutlich beste Dokumentation zur föderalen IT-Landschaft durch die FITKO und das föderale Architekturboard, wie Jörg Kremer erläuterte Der gewaltigen Aufgabe steht ein Schatz an Erfahrungen, Einsichten und Lösungsansätzen gegenüber – wenn es nur gelingt, sie zusammenzuführen. Wo fängt man an? Mit den technischen Standards, hat das BMDS entschieden: Seit Oktober läuft die öffentliche Konsultation zum Tech-Stack. Dieser definiert die Standards und Technologien zur Realisierung des Deutschland-Stacks, gegliedert in
Bundestag stimmt für den NOOTS -Staatsver trag
Wie kann es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger aussehen, wenn der Staat einfach funktioniert? Zum Beispiel so: Eine junge Familie zieht um. Für Wohnsitz- und Kfz-Ummeldung muss niemand mehr aufs Amt – denn Bund, Länder und Kommunen tauschen im Hintergrund automatisiert die Daten aus. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Markus Reichel beschrieb diese Si tua tion i n seiner Rede vor der Abstimmung über den NOOTS-Staatsvertrag im Deutschen Bundestag. Mit dem Gesetzentwur f der Bundesregier ung „zum Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterent-
wicklung des Nationalen Once-Only Te chnical-Systems (NOOTS)” wird die Grundlage geschaffen für den Aufbau einer gemeinsamen Infrastruktur zum Datenaustausch zwischen öffentlichen Stellen von Bund und Ländern und somit für die Umsetzung des OnceOnly-Prinzips: Bürger sollen Nachweise und Daten, die der Verwaltung bereits vorliegen, nicht mehrfach einreichen müssen.
Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hatte in seiner Beschlussempfehlung die Annahme dieses Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung empfohlen. Die
19


Dr. Markus Richter, Staatssekretär im BMDS
mehrere Schichten. „Die Plattform wird Basiskomponenten wie Cloudund IT-Dienste bereitstellen, die von Bund, Ländern und Kommunen genutzt werden können. Wir laden alle Interessierten ein, ihren Beitrag zur Entwicklung der technischen Standards zu leisten“, so Staatssekretär Dr. Markus Richter. Dazu sind auf der Website eine Technologie-Landkarte, Struktur-Übersicht und ein Reifegradmo de ll be re it ge st el lt , da s di e Kriterien Digitale Souveränität, Interoperabilität, Zukunftsfähigkeit, Marktrelevanz, Vertrauenswürdigkeit und Nachhaltigkeit bewertet. Wie soll es nach der Konsultation weitergehen? „Wir tragen bis zum 30. November 2025 Feedback aus dem Online-Verfahren, aus den
SPEZIAL
Hintergründe und Lösungen zu den Themen E-Akte, Dokumenten- und Outputmanagement.
Rückläufen per E-Mail, aus den fachlichen Workshops und Austa us ch fo rmat en s ow ie a us d en ak tu el le n E nt wi ck lu ng en z um Deutschland-Stack zusammen“, erklärte ein Sprecher des BMDS Anhand der Erkenntnisse solle der bisherige inhaltliche Rahmen bewertet sowie auf der Webseite und „in ergänzender Dokumentation“ kontinuierlich Ziel, Struktur und Vorgehensweise zum DeutschlandStack weiter ausgestaltet werden Ziel sei es, nach dem Konsultationsverfahren bis Ende Januar 2026 eine initiale Version 1 der technischen Standards, Umsetzungsoptionen und Handlungsempfehlunge n für d ie A us ge st al tu ng d es Deutschland-Stacks zu erarbeiten „Zu den Leitthemen der Technologien als Wertschöpfungspotenzial, der Integrationsoptionen in den Stack, den Mechanismen von Kopr od uk ti on u nd Ö ko syst emen sowie der Stärkung von Automati si er un g, B es ch le un ig un g un d Kostenreduktion bei Entwicklung, Beschaffung und Inbetriebnahme wollen wir explizit ein umfassendes Feedback aus Deutschland und Europa nh
Weitere Informationen zum Deutschland-Stack und zur Konsultation: [ deutschland-stack.gov.de ]
Abgeordneten sind dieser Empfehlung gefolgt, mit Ausnahme der Fraktion Die Linke: Am 16. Oktober wurde der NOOTS-Staatsvertrag durch den Bundestag angenommen. Nachdem die in haltlichen, rechtlichen und technischen Grundlagen bereits im Progr am m „G esam ts te ue ru ng Registermodernisierung“ erarbeitet wurden, hatte der ITPlanungsrat bereits Ende Juni die Überführung dieses Programms in eine vorläufige Struktur, wie im § 3 des Staatsvertrages vorgesehen, beauftragt. Betriebsverantwortliche Stelle ist das Bundesverwaltungsamt. Auch die Kosten sind vertraglich geregelt. Für
2025 und 2026 ist die Finanzierung über im Wirtschaftsplan der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) veranschlagten Mittel vorgesehen. Ab 2027 sollen die FITKO 53,4 Prozent und der Bund 46,6 Prozent der Kosten tragen. Laut §10 bedarf der Staatsvertrag der Ratifikation: Der Bund und elf Länder, die mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel abbilden, müssen ihre Ratifikationsurkunden bei dem der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegen, damit der Vertrag in Kraft treten kann. nh
noots.gov.de
3|Digitalministerin Dörte Schall spricht über die Digitalministerkonferenz, über Kooperationen und Rheinland-Pfalz als Pilotland.
4|Die Stadt Friedrichshafen und ihr Umgang mit einem strukturellen Problem deutscher Kommunalfinanzierung.
5|Die Einrichtung des „Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung“ im Bundesrat wird als starkes Signal gewertet.

6|Eine Verwaltung ohne Öffnungszeiten: Prof. Dr. Dr. Niehaves, Hans Christian Klein und Dmitrij Anton erörtern Ideen und Grundvoraussetzungen.
7|Die Studie „EfA im Fokus“ befasst sich mit der Nachnutzung von Online-Leistungen.
10|Unsere Buchtipps: Lesenswertes zu den Themen KI, Krisenkommunikation und Wandel des IT-Planungsrats.

11|Erste Einblicke in die Studie „IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung 2025“ von msg systems offenbaren: Cloud, Registermodernisierung und Cybersicherheit sind zentrale Stellschrauben für eine moderne, effiziente Verwaltung.
Praxis & Innovation
13|Wie geht es mit dem ZenDiS und der digitalen Souveränität Deutschlands weiter? ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt gibt Auskunft.
14|Hürden und Chancen der Abkehr von Hyperscalern: Einblick in eine Studie von A1.
15|Daniel Hoffmann gibt einen Überblick zur Entwicklung der digitalen Baugenehmigung.
15|GovRadar hat eine Vergabe-Software entwickelt –und einen Ansatz, um GovTech-Lösungen schneller in die Fläche zu bringen.
16|Es war wieder Zeit für ein Klassentreffen: Die Smart Country Convention informierte an drei Tagen über Hintergründe, Lösungen, Hürden und Chancen der Verwaltungstransformation.

17|Im November stehen zwei interessante Termine an: Der FIT-Kongress und die „Digital Health Conference“ versprechen spannenden Input in Augsburg beziehungsweise Berlin.
Sonderbeilage
Digitale
Schule
Mediaberatung
eGovernment Vogel IT-Medien GmbH
Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150 redaktion.egov@vogel.de
Handelsregister Augsburg HRB 11943
Redaktionsleitung
Susanne Ehneß / su (CvD, -180, ViSdP für redaktionelle Inhalte)
Stephan Augsten / aus (-145)
Redaktion
Nicola Hauptmann / nh (-260)
Johannes Kapfer / jk (-181)
Serina Sonsalla / se (-184)
Co-Publisher Harald Czelnai (verantwortlich für den Anzeigenteil, -212), harald.czelnai@vogel.de Fax 0821/2177-152
eswarwiedereinmalKlassentreffen. Und zwar eines, auf das sich dieEingeladenentatsächlichfreuen In der Berliner Messe trafen sich zwischen 30. September und 2. Oktober die Gestalterinnen und Gestalter derVerwaltungsmodernisierungzurSmartCountryConvention (SCCON) Die Messe ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen,sodassindiesemJahr gar eine weitere Halle hinzugenommen wurde. Für 2026 erwarte ich eine ähnliche Entwicklung, denn die Messestände – und ja, auch die Essensstände – waren erneut sehr gut besucht. In der neuen Messehalle war unter anderem die Podcast-Area untergebracht.Ineinernahezuschalldichten Box, bestückt mit Aufnahmetechnik, wurden zahlreiche Podcast-Folgen live gesendet und aufgezeichnet. Die Messebesucher konnten per Kopfhörer zwanglos lauschen, ähnlich einer Silent Disco Wir waren selbstverständlich mitUnbürokratischauchdabeiund haben mit Ulrich Ahle und Prof
Dr Dr Björn Niehaves über das digitale Dorf Etteln beziehungsweise den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung gesprochen DieAufzeichnungfinden Sie unter www.egovernment.de/ podcast. Hören Sie einfach mal rein!
Auch in dieser Ausgabe gibt es natürlich einiges von der SCCON. So hat meine Kollegin Serina Sonsalla mit Digitalministerin Dörte Schallgesprochen,ganzentspannt amStandvonRheinland-Pfalz Das Interview finden Sie auf Seite 3 Zudem hat sich mein Kollege Johannes Kapfer zum Thema DaseinsvorsorgemiteinemVertreter der Stadt Friedrichshafen ausgetauscht (Seite 4). Digitale Souveränität war an nahezu allen StändenundVorträgeneinThemaund findet sich natürlich auch wieder: Mit Alexander Pockrandt habe ich über die Rolle und Pläne des ZentrumsDigitaleSouveränität(ZenDiS)gesprochen(Seite13),undauf Seite 14 können Sie sich über eine europäische Cloud-Lösung infor-


Sandra Schüller (-182), Heike Kubitza (-213)
Anzeigendisposition
Mihaela Mikolic (-204)
Grafik & Layout: Vogel Medienservice Kampagnenmanagement
Ursula Gebauer (-217) EBV: Carin Böhm
Anzeigen-Layout: Alexander Preböck
Leserservice: eGovernment.de/hilfe oder eMail an: vertrieb@vogel.de mit Betreff eGovernment“ Gerne mit Angabe Ihrer Kundennummer vom Adressetikett
*CS-1234567*
Geschäftsführer Tobias Teske Günter Schürger
Erscheinungsweise: 12 Ausgaben jährlich
Abonnement Preis des Jahresabonnements: 108,- inkl MwSt und Versand

Susanne Ehneß Redaktionsleitung eGovernment
mieren Und natürlich darf unser obligatorischer Rückblick auf die Messe nicht fehlen. Die SCCONZusammenfassung finden Sie auf Seite 16 WeiteregroßeThemenaufdenFlurenund anden Ständen waren die Modernisierungsagenda derBundesregierung, die zeitgleich zur Messe beschlossen wurde, sowie dieAusgestaltungdesDeutschlandStacks Zu Letzterem wurde mehr gemunkelt statt gesprochen Die Frage „Was ist das überhaupt?“ habeichaufderSCCONmehrmals gehört Die Titelgeschichte meiner Kollegin Nicola Hauptmann dürfte hier für mehr Klarheit sorgen. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre
eGovernment jederzeit & überall: Hintergründe und News rund um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung online lesen.
Bereits freitags vor der Print-Ausgabe online verfügbar: eGovernment.de/digitale_ausgaben

Druck
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstr 5, 97204 Höchberg Gedruckt auf Steinbeis silk Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und dem EU Ecolabel. Mehr Infos unter: www.stp.de Fragen zur Produktsicherheit produktsicherheit@vogel.de Haftung
Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur beim Nachweis grober Fahrlässigkeit. Für Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind ist der jeweilige Autor verantwortlich Redaktionelle Beiträge, die zur Veröffentlichung in eGovernment bestimmt sind, können auch auf allen Websites der Vogel Communications Group verwendet werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Sie können nur zurückgesandt werden, wenn Rückporto beiliegt.
Copyright Vogel IT-Medien GmbH Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion Fotokopieren veröffentlichter Beiträge ist gestattet zu innerbetrieblichen Zwecken, wenn auf jedes Blatt eine Wertmarke der Verwertungsgesellschaft Wort, Abt Wissenschaft, in 80336 München, Goethestraße 49 nach dem jeweils geltenden Tarif aufgeklebt wird. Nachdruck und elektronische Nutzung Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über: www.mycontentfactory.de Tel. 0931/418-2786. Die Artikel dieser Publikation sind in elektronischer Form über das Datenbankangebot der GBI zu beziehen: www.gbi.de eGovernment ist die Zeitung für die Digitalisierung der Verwaltung und Öffentliche
Sicherheit Sie informiert IT-Entscheider in Bund, Land, Kommune und in den Öffentlichen Einrichtungen über alle fachlich relevanten Bereiche der digitalen Informationsverarbeitung im Public Sector Das Onlineportal www.eGovernment.de stellt maßgeschneiderte Services für IT-Entscheider der Öffentlichen Hand dar und bietet ein umfangreiches, exklusives Webangebot mit hohem Nutzwert. Das Stammhaus Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group. Der führende deutsche Fachinformationsanbieter mit rund 100 Fachzeitschriften und 60 Webseiten sowie zahlreichen internationalen Aktivitäten hat seinen Hauptsitz in Würzburg.
Mitgliedschaft eGovernment ist IVW-zertifiziert. Die wichtigsten Angebote des Verlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Healthcare Digital, BigData-Insider, CloudComputingInsider, DataCenter-Insider, IP-Insider, Security-Insider, Storage-Insider.
Digitale Welt – Rheinland-Pfalz

In der kommunalen Daseinsfürsorge Friedrichshafens klafft eine Lücke.

Derzeit bewegt sich Rheinland-Pfalz (RLP) besonders schnell in der digitalen Welt Dabei steht die föderale Zusammenarbeit oft im Fokus, so auch auf dem Bund-Länder-Panel der Smart Country Convention 2025. Dörte Schall, Digitalministerin in RLP, sprach mit uns über die derzeitigen Entwicklungen.
Rheinland-Pfalz ist nun Pilotland Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat sich für eine Kooperation mit Rheinland-Pfalz und den Start eines Modellprojektsentschieden,indem Onlinedienste flächendeckend verfügbar gemacht werden sollen. Wie sieht die Kooperation konkret aus und wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bund?
Schall: Die Bewerbung erfolgte, nachdem der Bundesdigitalminister angekündigt hatte, Pilotkommunen benennen zu wollen. Frau Hölscher hatte in der Podiumsdiskussion auf der Smart Country Convention 2025 bereits erwähnt, dass sich daraufhin alle Bundesländer mit ihren aktuellen Digitalprojekten und Vorhaben beworben haben. Es handelt sich um ein gestuftes Verfahren: Jedes Land ist mit den Projekten eingestiegen, die es bereits umsetzt – daraus wurden dann unterschiedliche Modellprojekte auf Bundesebene entwickelt.
Auf welche inhaltlichen Schwerpunkte haben Sie bei der Bewerbung als Pilotland gesetzt, und welche Ziele und Erwartungen waren damit verbunden?
Schall: Wir unterstützen bei der Finanzierung Und die Finanzierung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) gestalten wir ein bisschen anders als andere Bundesländer, indem wir die Mittel komplett an die Kommunen für bestimmte technische Aufwände, wie beispielsweise Schnittstellen, weitergeben. Wir haben das Thema EfA (Einer-für-alle) vorangestellt und
bereiten das nun auf Landesebene vor, sodass wir eine Fertigungsstrecke einrichten können. Alle Kommunen können diese einheitlich entwickelten Onlinedienste sofort implementieren, egal wie weit sie sind Außerdem ist das verbunden mit einer agilen und ganzheitlichen Arbeitsweise, sodass wir die Zugänge zum OZG wirklich individualisiert für die Kommunen bereitstellen können.
Ein Beispiel: Als Bürgerin oder Bürger ist es mir ja egal, in welchem Landkreis ich wohne Ich möchte auf jeden Fall mein Auto digital anmelden Diese Unterschiede sind es, die etwas ausmachen Es ist schließlich das eine Prozent, das fehlt – und das tut immer weh. Jetzt bieten wir auf Landesebene das Programm an, sodass alle Kommunen einheitliche digitale Antragsprozesse implementieren können.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit 2024 eingerichtete EfA-Rollout-Programm, in dem wir länderübergreifende digitale Dienste an die Behörden anbinden.
Bayern und Hessen arbeiten jeweils mit sechs Kommunen zusammen – ist das in Rheinland-Pfalz ähnlich? Und wenn ja, welche Kommunen sind beteiligt?
Schall: Wir machen das nicht so mit den einzelnen Kommunen. Wir haben auch keinen Abfrageteil vorgesehen. Denn diese Abfrage der Kommunen hätte nicht zuunserem Ansatz und der Art, wie wir arbeiten, gepasst Die Kommunen, die bei uns die Best-PracticeKommunen sind, kennen wir zudem bereits. Wir haben landesweit Praxisgruppen und Ansprech-
personen eingerichtet, die alle kommunalen Gebietskörperschaften bei der Digitalisierung ganzheitlich begleiten Wir sind mit allen kommunalen OZG-Koordinatorinnen und Koordinatoren im Austausch. Wir bewegen uns einfach auf einem anderen Zeitstrang, weil wir schon mehr implementiert haben. Dieses Modell passte also nicht zu Rheinland-Pfalz. Daran sieht man, dass wir föderal sehr unterschiedlich sind.
Welche Vorteile bringt die Zusammenarbeit mit dem Bund?
Schall: Ich glaube, es bringt immer Vorteile, wenn wir Best Practices umsetzen Es ist immer vorteilhaft, zu zeigen, wie es woanders bereits funktioniert. Gerade für die Kommunen ist es wichtig, zu sehen, wie auch andere Kommunen arbeiten Das ist oft hilfreicher als die Vorgaben von Bund und Länder. Die Kommunen wissen bereits, wo ihre Stellschrauben sind, wo man vielleicht mehr Personal, eine andere Software oder mehr Zeit braucht Diese Praxis – aus denKommunen,fürdieKommunen – ist sehr wertvoll.
Was genau soll sich durch die PilotprojekteinRheinland-Pfalz langfristig verändern; welche übergeordneten und strategischen Ziele streben Sie an?
Schall: Wir wollen, dass es schneller und einfacher wird und zwar sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeitenden in der Verwaltung Wir halten immer den Blick darauf, dass in der gesamten öffentlichen Verwaltung in den nächsten zehn Jahren etwa 60 Prozent der Menschen in Rente gehen wird. Wir müssen

also digitales Wissen etablieren und transferieren. Und dort, wo wir automatisieren und Prozesse vereinfachen können, ist das Wissen einfacher zu transferieren als in anderen Bereichen Deswegen sind wir auch Getriebene von der Zeit und von der Demografie.
Die Digitalstrategie in Rheinland-Pfalz ist so aufgebaut, dass Sie diese kontinuierlich verändern und an aktuelle Entwicklungen anpassen können. Welche Entwicklungen könnte es künftig geben?
Schall: Ich bin sehr froh darüber, denn beim Thema KI wären wir vor fünf Jahren noch ganz anders vorgegangen als heute, da die Entwicklungen so wahnsinnig schnell voranschreiten Wenn wir an das Smartphone denken, mit dem wir unser Interview gerade aufnehmen, das gibt es nun seit 18 Jahren. Die Entwicklung ist so rasant geschehen, wie alles, was gerade
Drei Stellschrauben für die laufende IT-Konsolidierung in der Verwaltung.
passiert. Und deswegen müssen wir uns ständig anpassen und ständig aktuell bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Marken erreicht. Wir sind fast so weit, dass wir von unseren gesetzten Meilensteinen über 70 Prozent umgesetzt haben, und die wollen wir bis nächstes Jahr erreichen.
Von den großen Maßnahmen haben wir 20 vollständig umgesetzt, die anderen sind gerade in der Implementierung. Das passen wir stetig an, manchmal auch von unten: Das heißt, wir treffen die Entscheidung, wenn sich eine Maßnahme erledigt hat Zum Beispiel, weil wir eine bessere technische Möglichkeit gefunden haben oder weil die Maßnahme im Zuge der Entwicklungen uninteressant geworden ist. Auch das ist ja ganz spannend, besonders aber die Entwicklung selbst: Wo wir Neues dazunehmen können, wo wir Best Practices von anderen Ländern und Kommunen finden und von ihnen abschreiben bzw. kopieren können. Denn wir müssen nicht alle immer das Rad neu erfinden.
Zum Thema Digitalministerkonferenz: Auf der Smart Country Convention waren wir live beim Panel dabei. Können Siefürunsnochmalzusammenfassen, worin die nächsten Schritte und Entwicklungen bestehen?
Schall: Die Digitalministerkonferenz ist ja aktuell die jüngste aller Ministerkonferenzen. Wir sind jetzt gerade so weit, dass wir uns zusammengefunden haben, dass wir arbeiten und uns positiv abgrenzen gegen andere Gremien Wir sind natürlich super zufrieden, dass es das Bundesdigitalministerium sowie den Bundesratausschuss Digitalisierung gibt Es ist demnach kein Annex-Thema mehr, sondern ein Hauptthema und ein Quantensprung für uns. Im November haben wir die nächste (reguläre) Digitalministerkonferenz. Die Schwerpunktthemen sind digitale Souveränität und Cybersicherheit. Das sind Themen, die uns auch alle umtreiben – ja, auch im täglichen Leben und im täglichen Umgang. Danach übergeben wir turnusgemäß an Hamburg Die haben ebenfalls interessante Schwerpunkte geplant Fortsetzung auf Seite 22

Kommunale Daseinsfürsorge
Die Stadt Friedrichshafen konnte sich in den vergangenen 50 Jahren den Luxus eines kommunalen Krankenhauses leisten Aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten muss der MCB jedoch zeitnah Insolvenz anmelden.
benklinik (OSK) im Landkreis Ravensburg, zu der Kliniken in Ravensburg und Wangen im Allgäu gehören. Die bereits laufenden interkommunalen Gespräche zeigen, dass kommunale Daseinsvorsorge – wenn sie konsequent gedachtwird–zunehmendlandkreisübergreifende Kooperationen erfordert. Zum November 2025 wird Friedrichshafen als Geldgeber des MCB ausscheiden, zum Jahresende endet die Trägerschaft komplett. Stadt und Bodenseekreis konnten sich nicht auf eine gemeinsame Nachfolgelösung verständi-

Die Uferpromenade von Friedrichshafen mit zwei Zeppelinen. Die Konstruktion der Luftschiffe hatte einen entscheidenden Teil zum bisherigen Wohlstand der Stadt beigetragen.
Friedrichshafen – idyllisch am Bodensee gelegen – ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt und seit Jahrzehnten als überdurchschnittlich wohlhabende Kommune bekannt Doch seit dem Abend des 20. Oktober 2025 herrscht Gewissheit, dass es eine einschneidende Veränderung im Bereich der kommunalen Daseinsfürsorge geben wird In seiner Sitzung hatte der Friedrichshafener Gemeinderat einstimmig beschlossen, für den städtischen Medizin Campus Bodensee (MCB) binnen zweier Wochen Insolvenz anzumelden Was nach einem lokalen Verwaltungsakt aussieht, offenbart jedoch bei genauerem Hinsehen ein strukturelles Problem deutscher Kommunalfinanzierung.
Wenn ein Konzern „zu“ systemrelevant ist
Die Zahlen sprechen nämlich eine deutliche Sprache. Und das bereits seit längerer Zeit Nach einem buchhalterischen Minus von 20 Millionen Euro in 2023 rechnet die MCB-Geschäftsführung mit Defiziten von knapp 50 Millionen Euro sowohl für 2024 als auch 2025. Bisher federte die Zeppelin-Stiftung als Trägerorganisation diese Verluste stets ab – finanziert durch Dividenden des Automobilzulieferers ZF, welcher zu knapp 94 Prozent im Stiftungsbesitz steht. Doch ZF steckt selbst in der Krise
Das Unternehmen verbuchte 2024 einen Verlust von einer Milliarde Euro bei einem Umsatzrückgang von elf Prozentpunkten auf 41,4 Milliarden Euro Eine Schuldenlast von zehneinhalb Milliarden Euro sowie jährliche Zinszahlun-
gen von über 600 Millionen Euro zwingen den international agierenden Getriebebauer zu drastischen Sparmaßnahmen. Die Dividenden würden mittlerweile nicht einmal mehr für die laufenden Stiftungskosten ausreichen, heißt es aus stiftungsnahen Kreisen Diese Abhängigkeit von einem einzigen Wirtschaftszweig macht die Vulnerabilität kommunaler Finanzstrukturen schmerzhaft deutlich. Die gesamte Dimension der Krise wird allerdings im Detail sichtbar. Der MCB beschäftigt knapp unter 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt kombiniert über 542 Betten an den beiden Standorten Friedrichshafen und Tettnang. Im letzten Jahr wurden etwa 25.000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Hinzu kommen im Schnitt 3.200 ambulante Operationen sowie knapp unter 1.900 Neugeborene pro Jahr. Diese Versorgungsinfrastruktur steht nun vor dem Kollaps Die an-
gestrebte Planinsolvenz in Eigenverwaltung soll dem Klinikverbund allerdings den nötigen Handlungsspielraum bewahren Gemeinsam mit einem vom Amtsgericht bestellten Sachwalter soll die bestehende Geschäftsführung die Sanierung selbst steuern MCB-Geschäftsführer Dr Jan-Ove Faust verweist gegenüber dem SWR optimistisch auf erfolgreiche Sanierungen anderer Kliniken mit diesem Instrument „Zahlreiche Kliniken haben sich bereits erfolgreich mit einer Planinsolvenz in Eigenverwaltung neu aufgestellt“, betont er Ob das Amtsgericht Ravensburg dem Antrag stattgeben wird, stand zum Redaktionsschluss jedoch noch aus.
Interkommunale Kooperationen als Modell für die Zukunft?
Als Zukunftsperspektive favorisieren die Beteiligten einen Zusammenschluss mit der Oberschwa-

IT-Leistung zusätzlich erschwert wird. Dennoch bieten Kennzahlensysteme und Marketinginstrumente wie beispielsweiseBalancedScorecards Ansätze zur Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen. Zusätzlich kann in das IT-Controlling ein Benefit-Management als ganzheitlicher Lösungsansatz integriert werden, um die Leistung digitaler Systeme mess- und vergleichbar zu machen.
eGovernment als „Frühwarnsystem“
Kommunale eGovernment-Plattformen könnten künftig mehr leisten als nur die reine Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen Integrierte Finanzmonitoring-Systeme würden es Kommunen und Behörden in vergleichbaren Situationen ermöglichen, kritische Abhängigkeiten in Echtzeit zu überwachen Automatisierte Szenario-Analysen könnten aufzeigen, wie sich Veränderungen bei wichtigen Geldgebern auf die kommunale Daseinsvorsorge auswirken.
gen – ein Kommunikationsdefizit, welches in der digitalen Verwaltungsrealität eigentlich vermeidbar gewesen wäre. „Es geht um nicht weniger als das Überleben des MCB“, hatte ein Sprecher des Gemeinderats bereits im Vorfeld der Entscheidung betont Damit verdeutlicht sich, wie schnell sich kommunale Daseinsvorsorge von einer jahrzehntelangen Selbstverständlichkeit zu einem existentiellen Problem wandeln kann.
Präventionsinstrument digitales Risikomanagement
DerFallFriedrichshafenzeigt überdies deutlich, wie unabdingbar transparente Finanzplanung und systematisches Risikomanagement für Kommunen sind Moderne Business-Intelligence-Systeme könnten helfen, Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen und Szenarien durchzuspielen. Gerade bei komplexen Trägerkonstruktionen – wie dem Friedrichshafener Stiftungsmodell – sind digitale Controlling-Instrumente unverzichtbar.
IT-Controlling stellt die öffentliche Verwaltung jedoch auch vor spezifische Herausforderungen Während die Privatwirtschaft leicht messbare Ziele wie Umsatzsteigerung verfolgt, zielt die Öffentliche Verwaltung – nicht zuletz aufgrund ihrer Ewigkeitsgarantie – auf die Verbesserung des Gemeinwohls ab Die oftmals qualitativen Ziele der öffentlichen Verwaltung sind schwer zu in eine Metrik zu pressen, wodurch die Darstellung und Bemessung der
Die technischen Voraussetzungen dafür sind vielerorts vorhanden Sichere Netzwerke, Cloud-Computing-Plattformen und interoperable Systeme stellen bereits heute einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen sicher Was hingegen fehlt, ist die konsequente Anwendung dieser Technologien im Sinne strategischer Planungsaufgaben.
Lehren für die kommunale Praxis
Die Situation am Bodensee zeigt exemplarisch, welche Risiken entstehen, wenn Kommunen ihre Daseinsvorsorge auf wenige Finanzierungssäulen stützen Systematisches Monitoring und rechtzeitige Alternativenentwicklung sind überlebenswichtig – bevor die Insolvenz zum letzten Ausweg wird.
Für andere Kommunen mit ähnlichen Abhängigkeitsstrukturen sollte der Fall Friedrichshafen ein Weckruf sein Die Zeiten, in denen sich Kommunen allein auf die Großzügigkeit lokaler Wirtschaftsunternehmen verlassen konnten, sind definitiv vorbei Auch das „Rechnen“ mit nationalen wie transnationalen Fördermitteln, wie es in vielen Kommunen seit Jahren und Jahrzehnten praktiziert wird, kann beim Ausbleiben ebendieser für böse Überraschungen sorgen.
Der Medizin Campus Bodensee wird überleben Zu welchem Preis und unter welchen Vorzeichen, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen Für die kommunale Verwaltungslandschaft bleibt insgesamt jedoch die Erkenntnis, dass ohne digitales Risikomanagement und strategische Diversifizierung aus der nächsten Wirtschaftskrise schnell eine existentielle Bedrohung für die Daseinsvorsorge erwachsen kann. Vom dadurch schwindenden Vertrauen in den Staat durch die Bürgerinnen und Bürger ganz zu schweigen jk
Länderkammer
Seit Ende September gibt es im Bundesrat einen „Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung“ Für Prof. Dr. Kristina Sinemus und Dr. Benjamin Grimm ist dies ein starkes Signal für mehr Sichtbarkeit und Tempo.
Im Bundesrat gibt es seit Ende September einen ständigen „Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung“ Wie der Name erahnen lässt, soll der Aufgabenbereich des neuen Ausschusses die Zuständigkeiten des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) widerspiegeln. Laut Bundesrat soll sich der Ausschuss mit folgenden inhaltlichen Themen befassen:
W Digitaler Staat
W Digitale Wirtschaft
W Digitale Souveränität
W Digitale Infrastrukturen
W Internationale Digitalpolitik
W Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau
Der Ausschuss berät zugewiesene Vorlagen der Bundesregierung sowie Landesregierungen und ist mit-
beratend tätig, wenn es um Vorlagen geht, die einem der anderen 15 Ausschüsse des Bundesrats zugeteilt sind Wie der Bundesrat erklärt, wird sich der neue Ausschuss neben nationalen Regelungsvorschlägen für Gesetze und Verordnungen außerdem mit Vorhaben der Europäischen Union in den Themenfeldern Digitalpolitik und Staatsmodernisierung befassen. „Mehr Sichtbarkeit, mehr Tempo, mehr Wirkung: Der neue Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung im Bundesrat führt bislang verteilte Zuständigkeiten zusammen und gibt den Modernisierungsthemen auch in der Länderkammer das nötige Gewicht, ohne ein Mehr an Strukturen zu schaffen“, kommentiert Brandenburgs Justiz- und Digitalminister
Dr Benjamin Grimm, der dem Länder-Gremium angehört. Entscheidend sei die konsequente Zusammenarbeit von Bund und Ländern, „damit Reformen schneller greifen, wir Bürokratie abbauen und die digitale Verwaltung für
Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaft spürbar besser werden“. Die Mitglieder des Ausschusses:
W Kai Wegner (Berlin)
W ThomasStrobl (Baden-Württemberg)
W Albert Füracker (Bayern)
W Dr Florian Herrmann (Bayern)
W Dr Fabian Mehring (Bayern)
W Dr Benjamin Grimm (Brandenburg)
W Björn Fecker (Bremen)
W Dr Andreas Dressel (Hamburg)
W Manfred Pentz (Hessen)
W Prof Dr Kristina Sinemus (Hessen)
W Dr Heiko Geue (MecklenburgVorpommern)
W Daniela Behrens (Niedersachsen)
W Nathanael Liminski (NordrheinWestfalen)
W Ina Scharrenbach (NordrheinWestfalen)

W Michael Ebling (RheinlandPfalz)
W Dörte Schall (Rheinland-Pfalz)
W Jürgen Barke (Saarland)
W Dr Andreas Handschuh (Sachsen)
W Dirk Panter (Sachsen)
W Dr Lydia Hüskens (Sachsen-Anhalt)
W Rainer Robra (Sachsen-Anhalt)
W Dr Tamara Zieschang (SachsenAnhalt)
W Dirk Schrödter (Schleswig-Holstein)
W Stefan Gruhner (Thüringen)
W Steffen Schütz (Thüringen)
„Die Einrichtung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung ist ein weiteres starkes Signal, dass wir die digitale Transformation unseres Landes endlich in den Mittelpunkt stellen“, sagt Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus Nach Gründung der Digitalministerkonferenz und des BMDS sei der Ausschuss nun der folgerichtige nächste Schritt. „Jetzt gilt es, den Ausschuss und die damit verbundene Chance klug mit Leben zu füllen. Hier müssen die großen Leitplanken für die digitale Zukunft gebündelt und gesetzt werden, damit Digitalisierung in Deutschland endlich Fahrt aufnimmt und für die Menschen spürbar wird“, erklärt Sinemus Die nächsten Ausschuss-Sitzungen sind für den 5 November und 3 Dezember anberaumt su
Interviewmit PatrickHaupt,GeschäftsführerConvergeGermany
Mitdem ZusammenschlussvonREDNETundderGesellschaft für digitale Bildung (GfdB) istdieConvergeTechnologySolutionsGermanyGmbHentstanden –einneues, starkes SystemhausfürdendeutschenMarkt.Zielist es, öffentlichen Auftraggebern,Schulenund Hochschulenein verlässlicher Partnerbeider Digitalisierungzusein. DasAngebotreichtvon strategischer PlanungüberBeschaffungbishinzuBetriebundnachhaltiger Nutzung digitaler Lösungen. Über Leistungsportfolio,Vorteiledes Zusammenschlussesund strategischePlänehabenwirmitGeschäftsführerPatrick Hauptgesprochen.
Herr Haupt,ConvergeGermany istaus dem Zusammenschluss vonREDNET undderGesellschaft fürdigitale Bildunghervorgegangen. Waserwarten Sievondiesem Zusammenschluss? Durchdie GründungderConverge TechnologySolutionsGermanyGmbH konntendie Stärkenzweier etablierter Unternehmengebündelt werden,um den öffentlichenSektorund Bildungseinrichtungenumfassenderzuunterstützen.REDNET standfür Erfahrung inIT-Beschaffungund Projektmanagement,dieGesellschaftfürdigitale Bildungfürpädagogische Kompetenz unddenpraktischenEinsatzdigitaler Medien. Entscheidendist:Esgibtkeine TrennliniemehrzwischendiesenBereichen. Im Mittelpunkt stehendie Anforderungenunserer Kunden. Ob leistungsfähige Infrastrukturfür Verwaltungen, Konzepte für Schulenoder eine Kombinationbeider Welten –wir liefern Lösungenauseiner Hand. Das schafftVerlässlichkeit,Geschwindigkeit undein Angebot,dasüberdengesamten Digitalisierungsprozessträgt.
WelcheServicesumfasstIhr Leistungsportfolio konkret? WirbegleitendengesamtenLebenszyklusder Digitalisierung. AmAnfang stehenBeratungund Planung –Analyse, Zielbild, Budget- und Förderfragen. Es folgt die BeschaffungundRealisierung: rechtssichereAusschreibungen,Rollouts,Migrationen, Integration. Im Betrieb übernehmenwir Verantwortungmit ManagedServices,klarenService Levels, IT-Sicherheit, Incident-Management, ServiceDesk und modernenCloud Services.ErgänztwirddiesdurchSchulungen,Change-Managementund pädagogischeBegleitung. Kurzgesagt: Wirliefernnichtnur Technik,sondern sorgen dafür, dasssieim Alltagwirkt. Viele öffentliche Auftraggeber kämpfen mitknappen Ressourcen.Wie können Siehierhelfen? Öffentliche Auftraggebermüssenihre Mittel effizienteinsetzen.Genauhier setzenwiran:Wirübernehmen VerantwortungfürdengesamtenProzess–vonStrategiebis Betrieb –undschaffen so EntlastungfürunsereKunden. Mit
standardisierten Abläufen,skalierbaren Modellenund verbindlichenService Levels reduzierenwir Aufwandund Risiken.So könnensichunsereKunden aufihreKernaufgaben konzentrieren:
ConvergeGermanyist Teilder internationaltätigen Pellera Technologies.Mitrund350MitarbeitendenanachtStandorten inDeutschlandbegleitet das Unternehmen öffentliche Auftraggeberund Bildungseinrichtungenbeider Digitalisierung–vonBeratungüber Umsetzung biszuBetrieb,Supportund Fortbildung.
Verwaltung, Bildung, öffentliche Dienstleistungen! Zusätzlich bieten wir Fördermittelkompetenz, die Planungssicherheit schafft. Digitalisierungwirddamit nicht zur Belastung,sondernzumMehrwert-
durch verlässlicheServices,spürbare Entlastung im Alltagund langfristige Zukunftsfähigkeit. Wo sehen SieConvergeGermanyin den kommenden Jahren?
UnserZielistklar:Wir wollenunsere Positionalsführendes Systemhaus inDeutschland weiterausbauen.Der Schlüsseldazu sind unsereMitarbeiter, inderen Zukunftwirinvestieren,und unsereKunden,deren Zufriedenheit unser Maßstab ist. Mit Qualifizierung, Entwicklung und technologischer InnovationschaffenwirdieBasisfür nachhaltigen Erfolg. AlsTeileines internationalen Netzwerksgreifen wiraufBestPracticeszurück, bleibenabernaham Kunden.Diese Kombinationaus lokaler Näheund internationaler Stärke machtunszum verlässlichen Partnerder Digitalisierung.

Warum der Mensch (weiterhin) den Unterschied macht
Ein Terminal ersetzt den Schalter, Dokumente warten im Automaten – Verwaltung ohne Öffnungszeiten wird Realität. Aber Björn Niehaves, Hans Christian Klein und Dmitrij Anton zeigen: Gleiche Technik, unterschiedliche Wirkung Was den Erfolg bestimmt, ist nicht die Technik, sondern die Haltung der Menschen Und manchmal reicht ein Gespräch am Bürgerbüro, um Digitalisierung ins Rollen zu bringen.
Der Amt-O-Mat ist ein kleines Stück Zukunft im Verwaltungsalltag Er vereint zwei Welten: Als Self-Service-Terminal ermöglicht er Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungsleistungen selbstständig zu beantragen. Als Hand-OverStation dient er zugleich der sicheren Übergabe fertiger Dokumente, etwa von Personalausweisen oder Reisepässen.
Der Amt-O-Mat kombiniert analoge Sicherheit mit digitaler Flexibilität. Bürgerinnen undBürgeridentifizieren sich über ihren Ausweis, holen Dokumente kontaktlos und DSGVO-konform aus einem gesicherten Fach ab oder starten direkt am Terminal Anträge, die automatisch an die zuständige Behörde weitergeleitet werden. Die Bedienung ist intuitiv, die Nutzung unabhängig von Öffnungszeiten –frühmorgens, nach Feierabend oder am Wochenende So wird Verwaltung Teil des Alltags und nicht länger dessen Hürde. Verwaltung ohne Öffnungszeiten ist damit Realität, denn in sechs Kommunen des Landkreises Mayen-Koblenz ist der Amt-O-Mat bereits im Einsatz Entwickelt wurde er im Rahmen der Digitalisierungsinitiative „Smarte Region MYK10“, die durch das Modellprojekt Smart Cities gefördert wird Ziel ist es, neue, bürgernahe Zugänge zur Verwaltung zu schaffen und zu erproben, wie digitale Lösungen den Alltag tatsächlich erleichtern können.
Gemischte Reaktion
Ein großartiges Angebot also, aber wird es auch angenommen? Ja und nein In der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projekts zeigt sich ein überraschend differenziertes Bild Der Amt-O-Mat stößt
grundsätzlich auf hohe Zustimmung: 64 Prozent der Befragten geben an, ihn nutzen zu wollen. Doch die tatsächliche Nutzung variiert stark, und das bei technisch völlig identischen Geräten Während an einem Standort knapp 28 Prozent aller Dokumente über den Amt-O-Mat ausgegeben werden, sind es in einer anderen Kommune weniger als ein Prozent Die gleiche Technik, die gleiche Funktion, aber ein völlig anderes Ergebnis Diese Unterschiede lassen sich nicht durch Hard-, Software oder Standort allein erklären. Sie verweisen auf etwas Tieferes: auf das soziale Umfeld, in dem Technologie auf Menschen trifft. Wovon hängt also die Nutzung ab?
Um das zu verstehen, haben wir rund 300 Bürgerinnen und Bürger befragt und mehr als 120 Interviews mit Nutzern, Nicht-Nutzern und Verwaltungsmitarbeitenden geführt Das Ergebnis ist eindeutig: Entscheidend sind nicht Technik, Alter oder Bildung, sondern zwei Faktoren: wahrgenommene Mehrwerte und Empfehlungen
Wer den Amt-O-Mat als echten Gewinn für den eigenen Alltag erlebt, weil er zum Beispiel Zeit spart, flexibel nutzbar ist und den Kontakt zur Verwaltung vereinfacht, zeigt eine deutlich höhere Bereitschaft zur Nutzung So weit, so erwartbar. Aber ebensostarkwirktder„soziale Einfluss“: Wenn Mitarbeitende im Bürgerbüro den Amt-O-Mat aktiv empfehlen oder wenn andere Bürger positive Erfahrungen teilen, steigt die Nutzungswahrscheinlichkeit signifikant. Die Technik schafft Möglichkeiten, aber genutzt wird sie durch Vertrauen. Und Vertrauen entsteht durch Menschen. Empfehlungen sind also entscheidend für die Nutzung Aber wie ent-

Ein Amt-O-Mat ermöglicht 24/7-Service in der Verwaltung.
stehen solche Empfehlungen? Unsere Analysen zeigen: Sie entstehen nicht abstrakt, sondern durch persönliche Erfahrung. Wer den Amt-O-Mat einmal selbst genutzt hat, vertraut ihm und empfiehlt ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter
Die tatsächliche Nutzung ist der stärksteEinflussfaktoraufdieEmpfehlungsbereitschaft, stärker als Vertrauen, Design oder wahrgenommene Einfachheit der Bedienung
Aufwärtsspirale der Nutzung
Mit anderen Worten: Erst die Erfahrung überzeugt. Klassische Merkmale wie Alter, Geschlecht oder technologische Vorerfahrung spielen hingegen keine messbare Rolle Wenn die erste Nutzung gelingt, entsteht aus Neugier Vertrauen, aus Vertrauen Überzeugung und aus Überzeugung eine
Empfehlung Aus Nutzern werden Botschafter, die das Angebot in ihrem Umfeld sichtbar machen und andere motivieren, es selbst auszuprobieren. So entsteht – potenziell – eine Dynamik, die man als Aufwärtsspirale der Nutzung bezeichnen kann. Am Anfang steht die Empfehlung durch Mitarbeitende in den Bürgerbüros: Sie geben den entscheidenden Impuls, das neue Angebot überhaupt auszuprobieren. Gelingt diese erste Nutzung, entsteht Vertrauen, und wer Vertrauen gefasst hat, empfiehlt weiter Jede erfolgreiche Nutzung erzeugt also potenziell neue Empfehlungen, und jede Empfehlung führt zu weiteren Nutzungen Mit der Zeit verstärken sich diese Effekte gegenseitig: Aus einzelnen Impulsen wird eine Bewegung Die Akzeptanz für den Amt-O-Maten wächst dort, wo Menschen überzeugt sind, ihn selbst zu nutzen und anderen davon zu erzählen.
Weiteres zum Thema
Akzeptanz digitaler Selbstbedienungs- und Übergabestationen in Kommunen
In dieser Veranstaltung werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie zum „Amt-O-Mat“ vorgestellt, die von Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves und Prof. Dr. Hans Christian Klein durchgeführt wurde. Die Studie untersucht mit einem Mixed-MethodsAnsatz, wie Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungsmitarbeitende den „Amt-O-Mat“ als digitales Selbstbedienungsangebot für kommunale Leistungen erleben. Im Mittelpunkt stehen Nutzung, Akzeptanz, Hemmnisse, Treiber sowie organisatorische Auswirkungen in den Rathäusern. Die Präsentation bietet zudem Empfehlungen für die zukünftige Skalierung und Verstetigung des Projekts sowie Raum für Austausch und Diskussion.

Wann?
8. Dezember 2025, 10.00 bis 11.30 Uhr
Wo?
virtuell (den Link erhalten Sie nach der Anmeldung)
Anmeldung unter: myk10.de/Studie_Amt-O-Mat

Unterschied: Mensch
Der Amt-O-Mat zeigt eindrücklich: Die gleiche Technik kann ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. An einem Ort wird sie umfassend genutzt, an einem anderen kaum Und der Unterschied liegt nicht in der Hardware, sondern bei den Menschen Entscheidend sind die Mitarbeitenden in den Bürgerbüros. Sie sind es, die das Angebot erklären, Vertrauen schaffen und die ersten Impulse zur Nutzung geben. Ohne ihre Empfehlung bleibt der Amt-O-Mat oft ungenutzt, mit ihrer Unterstützung wird er jedoch Teil des Alltags. Digitalisierung funktioniertalsonichtautomatisch, sondern dort, wo Menschen bereit sind, Neues mitzutragen und weiterzugeben
Diskutieren Sie mit uns! Zur Vorstellung der gesamten Studienergebnisse zum Amt-O-Mat am 8. Dezember 2025 laden wir Sie herzlich ein (siehe Infobox)
Die Autoren
Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves ist Informatikprofessor und Politikwissenschaftler, leitet die Arbeitsgruppe„Digitale Transformation öffentlicher Dienste“ an der Universität Bremen und berichtet in der wissenschaftlichen Kolumne über aktuelle Forschungsergebnisse zur digitalen Verwaltung.
[ linkedin.com/in/niehaves ]
Hans Christian Klein ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der IU Internationalen Hochschule in Düsseldorf. Gemeinsam mit Björn Niehaves leitete er die wissenschaftliche Begleitforschung zum„Amt-O-Mat“ im Rahmen der Digitalisierungsinitiative Smarte Region MYK10.
[ linkedin.com/in/dr-hans-christian-klein ]
Dmitrij Anton ist Projektmanager der„Smarten Region MYK10“ im Landkreis Mayen-Koblenz. Er gestaltet die digitale Transformation auf kommunaler Ebene – mit Fokus auf Datenplattformen, smarte Infrastrukturen und bürgernahe Anwendungen wie den Amt-O-Mat.
[ linkedin.com/in/dmitrij-anton ]
Nachnutzung und Beschaffung
Wer sich für die kommunale Nachnutzung von EfA-Leistungen und den Status quo in den Bundesländern interessiert, wird in einer aktuellen Studie von Fraunhofer FOKUS fündig.
Das Konzept „Einer für alle“ (EfA) beruht auf einem zutiefst humanistischen Gedanken: Eine Person oder Institution entwickelt etwas, das am Ende der gesamten Gemeinschaft zugutekommt Wenn viele diesem Prinzip folgen, entsteht ein vielfältiger Pool an Produkten und Dienstleistungen, von dem alle profitieren können Das EfA-Prinzip im eGovernment-Kosmos entspricht genau diesem Gedanken Verwaltungsleistungen sollen einmal entwickelt und dann von anderen Kommunen oder Ländern nachgenutzt werden können Effizient, ressourcenschonend und im Sinne des Gemeinwohls. Doch ganz so einfach ist es nicht. Efa-Leistungen sind mitunter schwer an die verschiedenen Ländervorgaben anpassbar, zudem kommen rechtliche Rahmenbedingungen, begrenzte Ressourcen und unklare Zuständigkeiten hinzu. Ein gemeinsame Quelle soll die Nachnutzung erleichtern. Im Frühjahr dieses Jahres hat der IT-Planungsrat die Zusammenführung seiner föderalen Marktplätze beschlossen: Der FIT-Store, der Marktplatz für EfA-Leistungen und das Cloud-Service-Portal der Deutschen Verwaltungscloud (DVC) sollen im sogenannten „Marktplatz der Zukunft“ aufgehen Ziel ist, die Beschaffung digitaler Verwaltungsleistungen zu vereinfachen, Prozesse zu beschleunigen und föderale Kooperation zu stärken.
Fraunhofer FOKUS hat das weite Feld der EfA-Nachnutzung und EfA-Marktplätze in einer Studie untersucht Es wurde erfasst, wie die Nachnutzung derzeit organisiert ist – anhand konkreter Praxisbeispiele aus mehreren Bundesländern. Zusätzlich wurden Fallstudien aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen dahingehend betrachtet, wie vergaberechtliche Intermediäre und Bündelungseinrichtungen die kommunale Nachnutzung von EfA-Leistungen vorantreiben können. Die Ergebnisse sollen als Impuls für den „Marktplatz der Zukunft“ dienen, sollen aber auch zur Diskussion zwischen Bund, Ländern, Kommunen und IT-Dienstleistern anregen.
Zentrale Ergebnisse
Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehört, dass finanzielle Planungssicherheit ein kritischer Erfolgsfaktor ist. In den Befragungen wurde deutlich, dass in den Kommunen hinsichtlich Laufzei-
ten und Kostenübernahmen Unsicherheiten vorherrschen. „Planungssicherheit ist die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen EfA-Rollout“, heißt es in der Studie deutlich Sie sei in den Befragungen weitaus häufiger genannt worden als beispielsweise vergaberechtliche Aspekte
Dementsprechend wird eine organisatorische Bündelung in den Ländern als wirkungsvoll erachtet Modelle wie in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, mit „bündelnden Organisationen“ als Intermediäre, erleichtern die Nachnutzung und Kommunikation, sind aber auf klare Strukturen
und Unterstützung angewiesen Laut Studie seien die Bundesländer gefordert, die „Balance zwischen individuellen Anforderungen und der Notwendigkeit zur Standardisierung zu finden, um einen zügigeren EfA-Rollout zu ermöglichen“. Eine umfassende Erweiterung des Funktionsumfangs des EfA-Marktplatzes wird als „derzeit nicht zielführend“ erachtet Im Hinblick auf die geplante Zusammenführung sollte der Fokus eher auf Konsolidierung des bestehenden Umfangs und der zugehörigen Prozesse liegen. Grundsätzlich sei die Meinung der Befragten hinsichtlich einer Zusammenlegung der einzelnen Marktplätze positiv und schaffe „stärkere Anreize zur Nutzung“.
Empfohlen wird allerdings eine größere Transparenz. Für Kommunen, so die Studienautoren, zähle in erster Linie die Tauglichkeit der Dienste. Damit eine EfA-Leistung, die von einer Kommune derzeit als nicht geeignet bewertet werde, dennoch als Option erhalten bleibe, könnten Bereitsteller standardisierte Roadmaps zur Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen transparent zur Verfügung stellen. Diese Informationen könnten dann direkt im Marktplatz integriert werden
Von den Kommunen kam zudem der Wunsch, EfA-Leistungen vor der Implementierung standardmäßig testen zu können, beispielsweise in Test- oder Demo-Umgebungen su





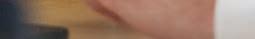














„Konsequente Digitalisierungist im Public Sector einMuss. MitDATEV können wir allesrechtssicherumsetzen.“


















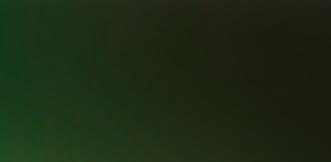
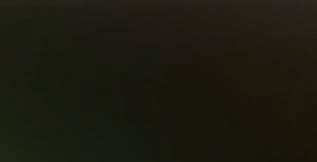

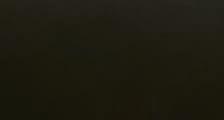
Digitale Prozesse zu initiieren und auszubauen, ist eine der großen Herausforderungen im Public Sector – die leistungsstarkeund rechtssichere Software von DATEV für Finanzwesen, Personalwesen und Verwaltungsprozesse unterstützt Sie zuverlässig bei Ihren Vorhaben Das macht DATEV und die steuerlichen Berater zu den idealen Partnern anIhrer Seite

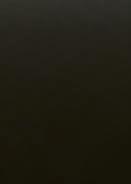


Mehr Informationenunter go.datev.de/public-sector








Praxisbuch Krisenkommunikation
Ist dies noch ein „einfacher“ Notfall oder schon eine echte Krise? Mit derlei Fragen befassen sich die Autoren Marco Cortesi und Stefan Häseli in ihrem „Praxisbuch Krisenkommunikation“, in dem sie Strategien für eine bessere Außenwirkung vorstellen.
Erfolgreiche Cyberangriffe, peinliche Datenschutzverletzungen, gescheiterte Digitalisierungsprojekte: Im öffentlichen Sektor gehören Krisensituationen zum Berufsalltag; nur redet nicht jeder gerne über Fehleinschätzungen. In einer Zeit, in der die Kommunikation derart schnell über das Internet stattfindet und sich jeder noch so kleine Fehler zu einem
Der IT-Planungsrat
Shitstorm oder zu einer strafbewährten Compliance-Verletzung auswachsen kann, ist dies keinesfalls zu empfehlen. Das „Praxisbuch Krisenkommunikation“ von Marco Cortesi und Stefan Häseli bietet deshalb einen strukturierten Ansatz, der weit über klassische PR-Strategien hinausgeht. Die Autoren setzen auf einen systematischen Aufbau, der von den
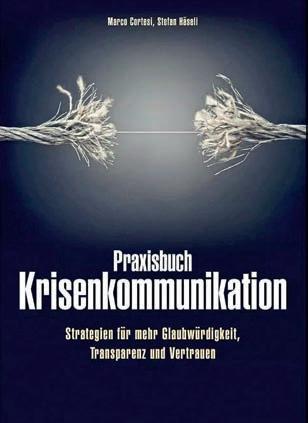
theoretischen Grundlagen der Krisenkommunikation zu konkreten Handlungsempfehlungen führt. Cortesi, der als Pressesprecher der
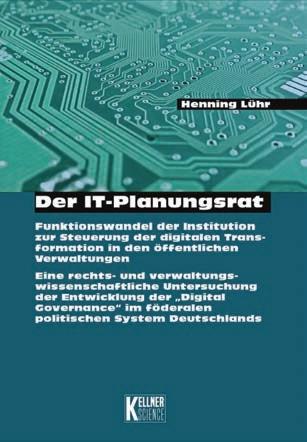
Henning Lührs rechts- und verwaltungswissenschaftliche Untersuchung beleuchtet den Wandel des IT-Planungsrats von einer Koordinationsplattform hin zur zentralen Steuerungsinstanz der digitalen Transformation im föderalen System.
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zeigt mit Blick auf ebenenübergreifende, koordinierte Entscheidungen und Projekte die Grenzen des föderalen Systems auf. Henning Lühr nimmt sich in der 360-seitigen Dissertation dieser
In „Staat 3.0“ stellt Prof. Dr. Heiko Krüger eine provokante Frage: In welchem Ausmaß kann und darf KI in Legislative, Exekutive und Judikative künftig eine Rolle spielen?
Künstliche Intelligenz im Public Sector impliziert in der Regel Chatbots und automatisierte Antragsbearbeitung. In seinem Buch „Staat 3.0“ denkt Prof. Krüger darüber hinaus und entwirft Szenarien der intelligenten Gesetzesanalyse und der algorithmusgestützten Rechtsfindung Einem systematischen Ansatz folgend analysiert er KI-Potenziale entlang der klassischen Gewaltenteilung und entwickelt konkrete Anwendungsfälle.
Direkten Praxisbezug bergen Krügers Fallstudien zu KI-basierten Wirkungsanalysen von Rechtsvorschriften: Intelligente Systeme könnten demnach Gesetzestexte auf Wirksamkeit und ungewollte Nebeneffekte prüfen. Der Autor verbindet dabei juristische, technische und gesellschaftspolitische Perspektiven Rechtliche Rahmenbedingungen behandelt er nicht als Hemmschuh, sondern als Gestaltungsaufgabe. Diese Herange-
Stadtpolizei Zürich umfangreiche Praxiserfahrung sammelte, und Häseli, Experte für glaubwürdige Kommunikation, verstehen es, komplexe Kommunikationsstrategien verständlich zu erläutern.
Ein zentraler Baustein des knapp 320 Seiten langen Buches ist die Bedeutung von Ehrlichkeit und Transparenz in der Krisenkommunikation Anhand zahlreicher Fallbeispiele zeigen die Autoren auf, wie unvollständige oder irreführende Informationen Krisen sogar noch verschärfen können. Dies gilt besonders für den öffentlichen Sektor, der naturgemäß einer hohen gesellschaftlichen Erwartungshaltung unterliegt.
Praxisnahe Tipps und Techniken
Das Buch zeigt auf, wie sich durch klare und vertrauensvolle Botschaften nicht nur akute Krisen entschärfen, sondern langfristig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken lassen. Dabei entwickeln die Autoren konkrete Strategien für verschiedene Kri-
senphasen – von der initialen Reaktion bis hin zum langfristigen Reputationsmanagement. Besonders wertvoll sind die Tipps und Werkzeuge, die sich direkt im Berufsalltag anwenden lassen. Das Werk bietet Checklisten, Kommunikationsmuster und Entscheidungshilfen, die auch unter Zeitdruck funktionieren Die Autoren berücksichtigen dabei die moderne Kommunikationslandschaft mit sozialen Medien und der damit verbundenen Geschwindigkeit der Informationsverbreitung. Fallbeispiele aus verschiedenen Bereichen – von Unternehmens- über Konzernkrisen bis hin zu öffentlichen Skandalen – machen die theoretischen Konzepte greifbar. aus
Weitere Informationen
Autoren: Marco Cortesi und Stefan Häseli
ISBN:
978-3-527-51208-9
Verlag: Wiley-VCH,Weinheim [ voge.ly/krisenkomm-wiley ]
Problematik an und untersucht den Wandel des IT-Planungsrats zur zentralen Institution für digitale Governance. Der Autor zeichnet nach, wie sich der IT-Planungsrat von einer ehemals „artfremden“ Koordinations-

hensweise unterscheidet das Buch von rein technikorientierten Betrachtungen.
plattform zwischen Bund, Ländern undKommunenzurentscheidungsbefugten politischen „Drehscheibe“ gemausert hat. Dabei prägt Lühr den Begriff der „Marble-CakeInstitution“ – als treffende Metapher für ein Gremium, in dem sich die Verantwortlichkeiten verschiedener föderaler Ebenen wie beim Marmorkuchen vermischen. Das Werk deckt schonungslos auf, wie strukturelle, prozessuale und strategische Veränderungen im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung die klassische Bund-Länder-Koordinierung überfordern. Lühr identifiziert digitalpolitische Entwicklungsfelder und reflektiert sowohl erzielte Erfolge als auch administrative Fehlversuche der Verwaltungsdigitalisierung. Seine Diagnose ist klar: Der ITPlanungsrat braucht mehr Entscheidungskompetenz, um den gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Als ehemaligem Vorsitzenden des IT-
Für CIOs und CDOs entstehen so wertvolle Orientierungshilfen Der Autor diskutiert ethikkonforme KIIntegration in bestehende Verwaltungsstrukturen Seine Analyse hilft dabei, strategische Weichenstellungen frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Seine mitunter weitreichenden theoretischen Szenarien treffen auf die Realität der EU-KI-Verordnung vom August 2024, die klare Anforderungen an staatliche KI-Systeme definiert. Vollautomatisierte Entscheidungen bleiben kritisch zu bewerten, menschliche Kontrolle ist regulatorisch vorgeschrieben. Manche der im Buch umrissenen Zukunftsvisionen mögen zunächst überzeichnet erscheinen, helfen aber dabei, die jüngsten Entwicklungen strategisch einzuordnen Die Forschung bestätigt das zunehmende Potenzial KI-gestützter Verwaltungsprozesse – von der Doku-
Planungsrats scheint Lühr sehr daran gelegen, dass das Gremium eine effektive Steuerungsinstanz für die digitale Transformation im föderalen System bleibt. Das 2023 im Kellner Verlag erschienene Werk überzeugt durch seinen gleichermaßen rechts- wie verwaltungswissenschaftlichen Ansatz Lühr gelingt es nicht nur, komplexe Governance-Strukturen verständlich zu erklären, er liefert gleichsam handfeste Reformvorschläge für den Planungsrat als Schlüsselinstitution der deutschen Verwaltungsdigitalisierung im föderalen System aus
Weitere Informationen
Autor: Henning Lühr
ISBN: 978-3-95651-320-6
Verlag: KellnerVerlag [ voge.ly/itplanung-kellner ]
mentenanalyse bis zur Bürgerkommunikation Krüger zeigt mögliche Entwicklungsrichtungen auf. „Staat 3.0“ bietet am Ende aber mehr als theoretische Überlegungen zur digitalen Zukunft. Das Buch liefert IT-Verantwortlichen konkrete Denkanstöße, um sich strategisch besser aufstellen zu können.Krügers systematische Herangehensweise macht komplexe Zusammenhänge greifbar und hilft dabei,die MöglichkeitenundChancen der KI-Integration rechtzeitig zu erkennen. aus
Weitere Informationen
Autor: Prof. Dr. Heiko Krüger
ISBN: 978-3-68932-000-3
Verlag: PlassenVerlag
[ voge.ly/staat30-plassen ]
Digitalisierung
Die Studie „IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung 2025“ von msg systems liefert Informationen zum Status quo, definiert zentrale Stellschrauben und gibt Empfehlungen.
Die mittlerweile sechste Studie von msg zur IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung blickt konkret auf die Transformationsbereiche Betriebs- und Dienstekonsolidierung sowie Registermodernisierung, betrachtet aber auch die NIS-2-Richtlinie und die Nutzung von Cloud-Diensten
Cloud: zwischen Aufbruch und Hürden
Die Studienergebnisse zeigen, dass die Cloud in der öffentlichen Verwaltung angekommen ist, jedoch nicht überall. Während Großstädte bereits zu 56 % Cloud-Services nutzen, sind es bei Ländern 51 % und beim Bund 46 %. Die Vorteile hingegen werden übergreifend erkannt und geschätzt: Über 90 %
Digitalisierung
der befragten Behörden erhoffen sich durch die Cloud einen Innovationsschub sowie eine höhere Verfügbarkeit von IT-Services
Großstädte nutzen die Cloud für eher unkritischere Anwendungen wie Terminvergabe oder Videokonferenzen, die Bundesländer hingegen setzen die Cloud eher pragmatisch und Governance-geführt ein
Gebremst wird die Cloud-Transformation vor allem durch ITSicherheitsbedenken, den Schutzbedarf sensibler Daten sowie die Angst vor einem Vendor Lock-in.
RegMo: Potenzial da, aber kaum bekannt
Die Registermodernisierung (RegMo) darf getrost als Basis der Ver-
waltungsdigitalisierung betrachtet werden Doch die Studie zeigt, dass über 30 % der Befragten gar nicht wissen, ob sie davon betroffen sind – besonders in Großstädten. Länder und kleinere Kommunen sind hingegen laut msg stärker involviert, da sie viele relevante Register und Online-Antragsverfahren verantworten
Die Studie betont, dass der Erfolg der RegMo maßgeblich von der aktiven Einbindung der Kommunen abhängt. Fortschritte gebe es bereits: Mit dem NOOTS-Staatsvertrag sei eine zentrale Infrastruktur geschaffen worden, die Registerdaten effizienter und sicherer bereitstellen solle Dennoch bleibe die Registermodernisierung ein langfristiger Prozess, der gezielte Informationsangebote und flexi-
Die E-Gesetzgebung ist als Open Source zur Nachnutzung für die föderale Ebene verfügbar
Kollaboratives digitales Arbeiten ist heute in vielen Bereichen selbstverständlich Doch gerade im Kern unseres gesellschaftlichen Miteinanders – der Organisation der Gesellschaft durch Gesetze – war es lange nur unzureichend ausgeprägt, obwohl die Gesetzgebung seit jeher auf der Kooperation verschiedener Akteure der Verfassungsorgane beruht.
Die E-Gesetzgebung des Bundes ist vor diesem Hintergrund als zentraler Baustein für die Modernisierung und Digitalisierung des Rechtssetzungskreislaufes zu sehen. Sie integriert alle involvierten Akteure in einen übergreifenden Workflow, um in einem gemeinsamen digitalen Dokumentenraum zu arbeiten. Sie erleichtert die Arbeit aller Beteiligten und ermöglicht mit einem effizienteren und schnelleren Ablauf mehr Fokus auf die inhaltliche Arbeit der Legisten. Das wird unter anderem dank folgender Funktionen und Eigenschaften erreicht:
W Gemeinsame Erstellung und Bearbeitung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen in einem digitalen Dokumentenraum mit konsistenten und versionierten Daten

Die E-Gesetzgebung wird Open-Source-lizensiert bereitgestellt.
W Digitale Unterstützung des gesamten Rechtssetzungskreislaufes von der Initiierung bis zur Verabschiedung, inklusive eines detaillierten Rechte- und Rollenkonzepts.
W Einsatz des legislativen Editors (LEA-Editor) als zentrales Werkzeug für normenkonforme Strukturierung, Bearbeitung und Darstellung von Gesetzestexten
W Unterstützung des Standards LegalDocML.de, wobei der LEA-Editor für eine konsistente

Cloud, RegMo, Security: Teile, die zu einem Ganzen gehören.
ble Governance-Strukturen erfordere.
NIS-2: Pflichtaufgabe
Viele Behörden sind noch unsicher, ob und wie sie von der NIS-2-Richtlinie betroffen sind, das zeigen die Studienergebnisse deutlich. Nur 20 % der Bundesbehörden und 39 % der Länder geben an, die Anforderungen aus der EU-Richtlinie umsetzen zu müssen. Die Mehrheit sieht die Richtlinie als wichtigen Baustein für mehr Sicherheit, warnt aber vor zusätzlicher Bürokratie und Überforde-
rung – vor allem auf kommunaler Ebene.
In der Studie wird empfohlen, die NIS-2-Umsetzung risikobasiert und gestaffelt anzugehen, Synergien durch Kooperationen zu nutzen und das Personal gezielt zu qualifizieren NIS-2 sei kein optionales Programm, sondern verbindlicher Rahmen für die digitale Sicherheit der Verwaltung.
Die Studie macht deutlich: Cloud, Registermodernisierung und Cybersicherheit sind zentrale Stellschrauben für eine moderne, effiziente Verwaltung. Die Digitalisierung der Verwaltung sei ein Marathon, kein Sprint, betont msg. su

Weitere Informationen In der Studie gibt es zahlreiche Praxisbeispiele, Expertenstimmen und konkrete Handlungsempfehlungen. Die vollständigen Ergebnisse werden am 4. November im Rahmen einer Informationsveranstaltung präsentiert. Infoseite und Anmeldeformular finden Sie hier: [ voge.ly/Konsolidierung-Event-2025 ]
Anzeige
Warum die E-Gesetzgebung für die Länder von Interesse ist
Auch auf Landesebene entstehen jährlich zahlreiche Gesetze. Die Verfahren sind jedoch häufig uneinheitlich und von verschiedenen Softwarelösungen geprägt, was Abläufe verlangsamt und Transparenz erschwert In einer Zeit zunehmender Digitalisierung und Komplexität ist ein Paradigmenwechsel hin zu durchgängig elektronischen, interoperablen, barrierefreien und medienbruchfreien Abläufen erforderlich.
Die Vorteile für die Landesgesetzgebung
schritte und ein zentrales Rechte- und Rollenkonzept
W Mehr Partizipation durch bessere Einbindung von Parlamenten, Ministerien und Öffentlichkeit
W KooperationundIntegration durch Interoperabilität zwischen Bund und Ländern
Wie CGI unterstützen kann
CGI verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung, Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen für die öffentliche Verwaltung Als Partner des Bundes bei der E-Gesetzgebung begleiten wir Länder mit:
und interoperable Verarbeitung der Gesetzesentwürfe direkt auf diesem Format aufsetzt.
W Nachvollziehbare und revisionssichere Abstimmung zwischen allen Akteuren– und für eine koordinierte und nachvollziehbare Bearbeitung ohne Versionschaos.
W Einsatz digitaler Assistenten, wie Verfahrens- oder Zeitplanungsassistenten, zur Steigerung von Effizienz und als Unterstützung für gute Gesetzgebung.
Die E-Gesetzgebung ist für die Nachnutzung zum Beispiel auf föderaler Ebene angedacht und wird dafür Open-Source-lizensiert bereitgestellt Damit bietet sie die Möglichkeit, an den Entwicklungsaufwendungen und Evolutionszyklen der zentralen, wiederverwendbaren Komponenten zu partizipieren,diesefürdieVerwendung der E-Gesetzgebung in den Bundesländern zu nutzen und bei Bedarf länderspezifisch anzupassen. Wiederverwendungsmöglichkeiten zu prüfen und zu nutzen, würde den Ländern zahlreiche Vorteile bringen:
W Einfachere, effizientere Prozesse durch digitale Workflows und zentrale Standards
W Schnellere Verfahren dank automatisierter Abstimmungen und definierte Abläufe
W Höhere Transparenz durch nachvollziehbare Bearbeitungs-
W Technischer und fachlicher Expertise im Bereich Gesetzgebungsverfahren
W Erfahrung in Implementierung und Einführung vergleichbarer Lösungen
W Langjähriger Beratungskompetenz für Bund, Länder und Kommunen
Wer jetzt handelt, setzt ein Zeichen: Für moderne digitale Verwaltung, für Effizienz und Transparenz in den Landesparlamenten – und für die Stärkung unserer föderalen Demokratie
Weitere Informationen
Als Entwicklungs- und Umsetzungspartner der E-Gesetzgebung des Bundes unterstützt CGI die Bundesländer bei der Einführung eigener E-Gesetzgebungsverfahren. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
[ public.de@cgi.com ]

Neben Printausgabe, E-Paper und Online-Auftritt ist eGovernment auch auf vielen sozialen Plattformen aktiv. Bei Facebook, Twitter und LinkedIn teilen wir ausgewählte News und Insights.


https://www.facebook.com/ egovernmentde

https://twitter.com/ egovernmentde

https://de.linkedin.com/ showcase/egovernmentde/
Geben Sie uns ein „Like“ und folgen Sie uns!

Zentrum Digitale Souveränität
Geschäftsführer Alexander Pockrandt gibt einen Einblick in die Strategie und Ausgestaltung des ZenDiS und die weiteren Pläne zur digitalen Souveränität Deutschlands.
Das Zentrum Digitale Souveränität (ZenDiS) wurde 2022 durch das Bundesinnenministerium gegründet und treibt unter anderem den Einsatz von Open-Source-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung voran. Und nicht nur das: Ganz aktuell hat die GmbH eine Kooperation mit der Auslands-IT des Auswärtigen Amts bekannt gegeben Gemeinsam soll ein Ökosystem an sicheren Basiskomponenten für die Softwareentwicklung der Verwaltung aufgebaut werden Als mittelfristiges Ziel sollen diese sogenannten Container selbst gehärtet werden können.
„Die Auslands-IT des Auswärtigen Amts braucht gehärtete Lösungen“, erklärt ZenDiS-Geschäftsführer Alexander Pockrandt gegenüber eGovernment. Es gebe zu viele Angriffsmöglichkeiten, zudem wolle man sich nicht in einen Lock-in mit proprietären Herstellern begeben. „Die suchten eine Alternative“, sagt Pockrandt, „und wir sind ja auf dem gleichen Pfad.“
Dieser Pfad namens „Digitale Souveränität“ wird nun gemeinsam beschritten, und es sollen im Laufe der Zeit weitere Partner dazugekommen. Laut Pockrandt gibt es beispielsweise Interessenten aus der Föderalen IT-Kooperation (FITKO). „Die FITKO ist an solchen Innovationen immer interessiert, weil sie sich aus ihrer gesamtheitlichen Sicht Lösungen anschaut, die Bund und Länder voranbringen können.“ Auch mit verschiedenen Bundesbehörden sei man bereits im Gespräch.
Bundesländer als Mitgesellschafter
Die Bundesländer mit ins Boot zu holen, war von Anfang an das erklärte Ziel von Bund und IT-Planungsrat Geplant war, die Länder als Mitgesellschafter zu beteiligen, doch so einfach ist es nicht Das Verbot der Mischverwaltung zwischen Bund und Ländern besagt, dass die Verwaltungszuständigkeiten grundsätzlich getrennt sein müssen, um Kompetenzkonflikte zu vermeiden – außer, es ist im Grundgesetz anders geregelt. „Hier gibt es noch Themen, die wir auflösen müssen“, sagt Pockrandt und meint Formulierungen in der ZenDiS-Satzung und auch Entscheidungen darüber, mit welchen Mehrheiten wie abgestimmt werde Die Diskussion laufe seit Ende vergangenen Jahres, „und da ist unglücklicherweise der Regierungswechsel dazwischen gekommen, sonst wären wir wahrscheinlich
schon weiter“. Nach dem Wechsel und der Gründung des neuen Bundesdigitalministeriums werde das Thema nun wieder aufgenommen. Nach wie vor sei das Ziel, die Länder als Gesellschafter einzubetten, doch das sei laut Pockrandt „verfassungsrechtlich schwieriger als gedacht“ Der juristische Part müsse nun bearbeitet werden, und dann könnten die Bundesländer als Gesellschafter dazukommen. „Wir wollen, dass Bund und Länder im ZenDiS gut zusammenarbeiten, und zwar auch rechtlich stabil“, betont er Das Interesse vieler Länder, sich zu beteiligen, war ab Gründung des ZenDiSbereitssehrgroß,Pockrandt spricht von einer regelrechten „Sogwirkung“ Bei Bundesländern, die weniger Open-Source-affin sind, spiele die Zeit für das ZenDiS. „Im Moment wird für uns gearbeitet“, sagt Pockrandt Die politische Lage spiele dem ZenDiS und dem Thema Souveränität in die Karten, natürlich sei man im Gespräch mit den Ländern „Die Annäherungistda“,sagtPockrandt „Für viele Länder wird digitale Souveränität jetzt ein Thema.“
Mögliche Szenarien
Der Einsatz von ZenDiS-Lösungen in Bund, Ländern und Kommunen kann unterschiedlich aussehen. Pockrandt spricht von „verschiedenen Szenarien“, über die man sprechen könne – beispielsweise openDesk, die Office- und Kolla-
tung wie „Anbieter XY ist böse, wir sind die Guten“ gehe Es müssten stets der Anwendungsfall und der daraus abgeleitete Bedarf an Souveränität betrachtet werden. „Ich kann einem Ministerium oder einem Bundesland ja nicht sagen, welche Lösungen es nutzen soll“, sagt Pockrandt Die Entscheidung für eine bestimmte Lösung eines bestimmten Anbieters sei völlig legitim – „ob sie objektiven Souveränitäts-Kriterien standhält, ist eine andere Frage“, so Pockrandt.
Beschaffung
Die bestehenden Rahmenverträge für Microsoft-Produkte machen es den Verwaltungen bei der Beschaffung derzeit sehr leicht. Für souveräne Lösungen soll es künftig ähnlich einfach werden Dazu öffnet das ZenDiS den Vertrieb für openDesk für öffentliche und auch private IT-Dienstleister – eine Reaktion auf die hohe Nachfrage nach der souveränenArbeitsplatzlösung. Neben dem bisherigen direkten Vertriebsmodell des ZenDiS können Verwaltungseinrichtungen also künftig auch indirekt über Full-Service-Partner Lösungen ordern. Die Nachfrage sei groß, die Unsicherheiten bezüglich der Beschaffung jedoch auch. Für Pockrandt ist daher das neue Vertriebspartnerprogramm ein „Meilenstein“ für die Bezugsfähigkeit und damit auch mehr digitale Souveränität „weit über die Verwaltung hinaus“

borationssuite, im Kompletteinsatz oder als „Fallback neben der bestehenden Infrastruktur“ Diese Notfallebene sei für viele der passende Einstieg. „OpenDesk ist die Anwendungsebene, openCode die Plattformebene“, erläutert Pockrandt, „aber wenn wir von digitaler Souveränität sprechen, reden wir über den ganzen Stack.“ Daher gehe die Überlegung in den Ländern immer einige Schritte weiter – Richtung Server, Infrastruktur. Das ZenDiS sei „ein Teilausschnitt der Betrachtung, aber ein Katalysator der Bewegung“. Dem Geschäftsführer des ZenDiS ist auch wichtig, zu betonen, dass es nicht um eine Bewer-
Eine souveräne Open-Source-Cloud als ganzheitliche Ergänzung zur DVC.

Aus- und Überblick zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.

Alexander Pockrandt, Geschäftsführer des Zentrums für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS).
auf openCode umgesetzt wird, macht vor der Landesgrenze nicht Halt Laut Pockrandt sind Österreich und die Schweiz sehr interessiert, openDesk bei sich einzuführen – im Sinne einer Nachnutzung, die dann auch im Ausland weiterentwickelt und damit für alle stärker wird So, wie es dem Grundgedanken von Open Source entspricht. „OpenDesk ist nicht nur eine Workplace-Kollaborationslösung“, betont Pockrandt, „sondern auch eine Transformationsplattform, in die europaweit reinentwickelt wird.“
Auf dem Digitalgipfel im November sollen voraussichtlich sowohl openDesk als auch das französische Pendant „La Suite“ vorgestellt werden Für Pockrandt ein deutliches Zeichen: „Man muss kein Prophet sein, um sich vorzustellen, dass La Suite und openDesk irgendwann zusammenwachsen, um eine paneuropäische Plattform zu sein.“
Politischer Support
ZenDiS-Haushaltsposition“, erläutert Pockrandt Man brauche hingegen die Projektmittel, die dann direkt in ein Ergebnis mündeten.
Planungen
Bis September 2025 wurden mehr als 80.000 Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung auf openDesk migriert – Tendenz steigend In den vergangenen Monaten hat zudem laut ZenDiS das Interesse aus der Privatwirtschaft stark zugenommen, insbesondere aus regulierten Branchen Die Vermarktungslizenzen für private ITDienstleister werden öffentlich ausgeschrieben, geplant ist der Start der europäischen Ausschreibung für November 2025.
Europäische Lösung
Die Ökosystem-Idee, die durch die Kooperation mit der Auslands-IT
So wichtig die Weiterentwicklung des ZenDiS und seiner Kollaborationslösungen ist, so wichtig ist auch die politische Unterstützung dieses Weges, auch in Form von Geldern. „Durch die Regierungsbildung hatten wir hier ein kleines Vakuum, keine Frage“, sagt Pockrandt. Das ZenDiS sei jedoch nie als Haushaltsposition gedacht gewesen, weil es sonst als Zuwendungsempfänger unter EU-Beihilferecht gefallen und damit nie Inhouse-fähig geworden wäre. „Die Grundidee war immer, dass sich das ZenDiS aus den Projektmitteln des damaligen BMI und anderer Behörden finanziert und darüber Aufträge generiert.“
Deshalb sei das ZenDiS indirekt in den Haushalten abgelegt, beispielsweise im souveränen Arbeitsplatz oder in der Dienstekonsolidierung.
„Da tauchen wir auf, und da brauchen wir den Support der Politik, dass das ZenDiS in diesen Kontexten eine starke Rolle spielt. „Der Weg führt nicht über eine eigene
Die Geschäftszahlen bewertet Pockrandt positiv. Im ersten Jahr habe das ZenDiS rund acht Millionen Euro Umsatz generiert, im aktuell laufenden zweiten Jahr werde diese Zahl verdoppelt „Wir sind als Start-up im Staat auf einem sehr erfolgreichen Pfad“, freut er sich. Auch die Nutzerzahlen können sich sehen lassen, bei openCode seien bislang rund 3.600 Projekte hinterlegt – darunter beispielsweise auch das baden-württembergischeF13 „ÜberopenCode werden auch sichere Software-Lieferketten und gehärtete Container abgebildet“, sagt Pockrandt Die Bedeutung von openCode als Plattform nehme deutlich zu. „Es ist wichtig, eine Workplace-Lösung wie openDesk zu haben“, erklärt er „Aber ein Environment zu haben, in dem sichere Open-SourceProjekte entwickelt, bewertet und zur Nachnutzung bereitgestellt werden können, ist für einen digital souveränen Staat enorm wichtig.“ Auch personell wächst die Bochumer GmbH Bis Ende 2025 sind 40 Personen beschäftigt, perspektivisch seien 70 Mitarbeiter geplant. Die Rolle des ZenDiS war laut Pockrandt von Anfang an klar und wird beibehalten: als Transformator, föderal und europäisch gedacht. „Für den Nutzer bedeutet es Workplace und Kollaboration. Für uns ist es ein Ökosystem“, verdeutlicht er „Wir unterstützen die mittelständische Wirtschaft. Wir sorgen dafür, dass wir aus einer Open-Source-Sicht auf Augenhöhe mit Silicon Valley sind Wir transformieren Gelder aus der öffentlichen Hand in diese Wirtschaft und erhalten Lösungen und Systemlandschaften, die für die öffentliche Hand sicher und nachhaltig nutzbar sind Das ist das ZenDiS“, verdeutlicht er. su
A1-Eurocloud-Studie
Die Diskussion um digitale Souveränität hat sich in den vergangenen Monaten grundlegend gewandelt. Was noch vor wenigen Jahren als theoretisches Konzept in politischen Grundsatzpapieren diskutiert wurde, ist heute zu einer praktischen Notwendigkeit für die Öffentliche Verwaltung geworden.
Die österreichische Telekommunikationsgruppe A1 Digital hat mit ihrer Cloud-Strategie einen Weg eingeschlagen, der sich deutlich von den Ansätzen der großen amerikanischen Hyperscaler unterscheidet. Während Unternehmen wie AWS, Microsoft Azure oder Google primär auf Skalierung und globale Reichweite setzen, fokussieren sich die Österreicher bewusst auf europäische Standards, Datenschutz sowie rechtliche Compliance Diese Positionierung ist nicht zufällig entstanden, sondern resultiert aus einer systematischen Analyse der Bedürfnisse europäischer Organisationen, insbesondere derer, die im Public Sektor verortet sind.
Eine aktuelle A1-Studie zur Sovereign Cloud zeigt, dass bereits mehr als ein Viertel der befragten Organisationen und Behörden souveräne Cloud-Lösungen aktiv nutzen. Weitere 36 Prozent befinden sich in der Planungsphase, während zwei von zehn Befragten die Möglichkeiten einer souveränen Cloudumgebung noch aktiv evaluieren. Dies ist insofern bemerkenswert, als deutlich gemacht wird, dass souveräne Cloud-Lösungen nicht mehr als reine Nischenlösungen betrachtet werden. Vielmehr handele es sich um einen wachsenden Marktbereich, der zunehmend an Relevanz gewinne, betonen die Autoren der Studie. Die Gründe für diese Entwicklung sind hingegen vielschichtig. An erster Stelle stehen zweifelsohne die IT-Sicherheit und der Datenschutz. In der Öffentlichen Verwaltung werden tagtäglich sensible Bürgerdaten – von Einwohnermeldedaten bis hin zu Steuerdaten und allem dazwischen – verarbeitet Diese Informationen auf Servern außerhalb der europäischen Rechtsordnung wirft nicht nur rechtliche Fragen auf, sondern schafft auch potenzielle Sicherheitsrisiken Der zweite wesentliche Treiber ist die gewünschte Unabhängigkeit von Hyperscalern. Die Dominanz weniger großer Anbieter auf dem Cloud-Markt führt zu Abhängigkeiten, die für öffentliche Verwaltungen problematisch sein können.
Diese Konzentration birgt sowohl wirtschaftliche als auch strategische Risiken, da Preisänderungen – man denke hierbei an das Geschäftsgebaren von VMware – oder unvorhersehbare Geschäftsentscheidungen der Anbieter direkte Auswirkungen auf die Öffentliche Verwaltung haben können.
Ein dritter wichtiger Faktor ist die erhöhte Geschäftskontinuität Souveräne Cloud-Lösungen bieten durch ihre europäische Ausrichtung und rechtliche Einbettung eine höhere Planungssicherheit Dies
werden können, ohne dass aufwendige Konvertierungsprozesse oder gar Anpassungen notwendig sind. Diese Flexibilität ist für Behörden und Kommunen von besonders exponierter Bedeutung, da sie
zunehmender Cyberbedrohungen und der Notwendigkeit, kritische IT-Systeme gegen Ausfälle zu schützen
Die Deutsche Verwaltungscloud (DVC), die im März 2025 offiziell gestartet wurde, stellt das zentrale Element der deutschen CloudStrategie dar. Diese von der Bundesregierung initiierte Plattform soll standardisierte Cloud-Services für Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bereitstellen. Das österreichische Produkt positioniert sich dabei nicht als Konkurrenz zur DVC, sondern vielmehr als ergänzende Lösung Besonders für Länder und Kommunen, die spezielle Anforderungen haben oder zusätzliche Kapazitäten benötigen, das eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Hybrid-Cloud-Strategien gewinnen in diesem Kontext an Bedeutung Diese Ansätze ermöglichen

ist besonders für Behörden relevant, die langfristige Digitalisierungsstrategien entwickeln müssen und dabei auf stabile, vorhersagbare Rahmenbedingungen angewiesen sind.
Die Exoscale-Plattform von A1 Digital ist technisch in Wien und anderen europäischen Standorten angesiedelt. Diese geografische Verteilung ist nicht nur aus praktischen Gründen relevant, sondern hat auch rechtliche Implikationen. Alle auf der Plattform verarbeiteten Daten verbleiben innerhalb der europäischen Grenzen und unterliegen ausschließlich europäischem Recht Für deutsche Behörden bedeutet dies, dass sie nicht befürchten müssen, dass ihre Daten aufgrund ausländischer Gesetze wie dem amerikanischen CLOUD-Act zugänglich gemacht werden könnten.
Die technische Architektur der Plattform basiert auf Open-Source-Technologien und offenen Standards. Dies ist ein bewusster Gegenentwurf zu proprietären Lösungen,diezuVendor-lock-in-Effekten führen können. Durch die Verwendung offener Standards werde sichergestellt, dass Daten und Anwendungen bei Bedarf migriert
langfristige Investitionssicherheit und Kostenkontrolle bietet. Als aktives Mitglied der StructuraX-Initiative und des Gaia-XFrameworks haben es sich die Österreicher auf die Fahnen geschrieben, gemeinsame Standards für digitale Souveränität zu entwickeln und auch umzusetzen. Wenn deutsche Behörden mit Partnern in anderen EU-Ländern zusammenarbeiten, sei es im Rahmen von EU-Projekten oder bilateralen Vereinbarungen, benötigen sie Plattformen, die rechtlich neutral sind und dennoch hohe Sicherheitsstandards bieten A1 Digitals Sovereign Cloud kann in solchen Fällen als neutrale Plattform fungieren, die von allen Beteiligten genutzt werden kann, ohne dass eine Seite Kompromisse bei der Datensouveränität eingehen muss. Ein weiterer relevanter Anwendungsbereich ist Disaster Recovery und Business Continuity Die geografische Verteilung der Exoscale-Rechenzentren ermöglicht es deutschenBehörden,robusteBackup-Strategien zu implementieren, die nationale Grenzen überschreiten, ohne dabei die Datensouveränität zu gefährden Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund
Infrastrukturen zu neuen CloudPlattformen erfordere oft erhebliche Investitionen in Hardware, Software und Schulungen. Für öffentliche Verwaltungen, die oft unter Budgetrestriktionen arbeiten, könnten diese Kosten ein erhebliches Hemmnis darstellen. Die zweite benannte Herausforderung ist die Komplexität bei der Migration. Viele Behörden würden über IT-Landschaften verfügen, die über über Jahre oder Jahrzehnte hinweg organisch gewachsen sind Die Integration dieser Systeme in neue Cloud-Umgebungen erfordere sorgfältige Planung und oft auch Anpassungen bisheriger Anwendungen. Dies sei nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern könne auch zu temporären Unterbrechungen im Betrieb führen Die Integration in bestehende IT-Landschaften wurde von den Autorinnen und Autoren als dritte Hürde identifiziert Behörden und Kommunen wären selten dazu in der Lage, von Grund auf neue IT-Systeme einführen, sondern müssten neu beschaffte Lösungen mit bereits operierenden Systemen verbinden Dies erfordere komplexe Schnittstellen und könne teilweise zu Kompatibilitätsproblemen führen.
es Behörden, kritische Arbeitslasten in der nationalen DVC zu belassen, während weniger sensitive Anwendungen oder Entwicklungsumgebungen bei alternativen Anbietern wie A1 Digital gehostet werden. Eine solche Diversifikation erhöhtnichtnurdieAusfallsicherheit, sondern reduziert auch strategische Abhängigkeiten. Die MultiCloud-Strategie bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich Die Integration verschiedener CloudPlattformen erfordert technische Expertise und kann zu erhöhter Komplexität in der IT-Verwaltung führen. Behörden müssen daher sorgfältig abwägen, welche Arbeitslasten auf welcher Plattform am besten aufgehoben sind Hierbei spielen Faktoren wie Datensensitivität, ComplianceAnforderungen, PerformanceBedürfnisse und nicht zuletzt die Kosten eine Rolle.
Trotz der technischen Vorteile souveräner Cloud-Lösungen identifizieren die Autorinnen und Autoren der Eurocloud-Studie von A1 auch typische Implementierungshürden An erster Stelle stehen ihrer Einschätzung nach hohe Einführungskosten zu Buche Der Wechsel von bestehenden IT-
A1 Digital begegnet den erwähnten Herausforderungen mit einem strukturierten Beratungsansatz Der erste Schritt sei eine detaillierte Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur. Hierbei würden nicht nur technische Aspekte, sondern auch organisatorische Prozesse und die zugrundeliegenden rechtliche Anforderungen betrachtet Auf Basis dieser Analyse werde im Anschluss ein maßgeschneiderter Migrationsplan entwickelt, der die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Behörde berücksichtige. Kernidee dieses Ansatzes ist die schrittweise Migration Anstatt komplette IT-Systeme auf einmal zu migrieren, würden zunächst unkritische Systeme in die neue Umgebung übertragen. Dies reduziere das Risiko von Betriebsunterbrechungen und ermögliche es den beteiligten Teams, Erfahrungen mit der neuen Plattform zu sammeln, schreiben die Autoren. Erst nach dem Abschluss dieser ersten Schritte, würden kritischere Systeme migriert. Die wirtschaftlichen Aspekte souveräner Cloud-Lösungen sind vielschichtig. Auf den ersten Blick mögen die Kosten höher erscheinen als bei großen internationalen Anbietern, die aufgrund ihrer Größe oft sehr „kompetitive“ Preise anbieten können. Eine detailliertere Betrachtung zeigt jedoch, dass sich die Investition in souveräne Infrastrukturen langfristig auszahlen kann. jk
Weitere Informationen
Die Eurocloud-Studie von A1 Digital können SIe im Volltext über die offizielle Webseite einsehen.
[ a1.digital/de/eurocloud-studie-2025 ]

Digitale Baugenehmigung
Digitale Bauanträge, die elektronische Beteiligung weiterer Behörden und automatisierte Online-Baulastauskünfte eröffneten den Verfahrensbeteiligten ab Beginn der 2000er-Jahre die Möglichkeit zur medienbruchfreien Kommunikation – lange vor dem OZG.
Bereits Mitte der 1980er Jahre begann in der Stadt Herten eine stille Revolution: Die ersten Computer hielten Einzug in die Stadtverwaltung und veränderten die Abläufe grundlegend Was zuvor ein papierintensiver, analoger Prozess war – geprägt von Checklisten, Wiedervorlagen und Aktenordnern – wurde Schritt für Schritt digital unterstützt. Anfangs diente die neue Technik ausschließlich der Terminverwaltung, doch rasch entwickelte sie sich zu einem zentralen Werkzeug für das gesamte Baugenehmigungsverfahren.
Die Nachricht über die Effizienzgewinne durch elektronische Datenverarbeitung verbreitete sich wieeinLeuchtfeuer:DieEDVkonnte die Prozesse in deutschen Bauaufsichtsbehörden vereinfachen und beschleunigen. Herten wurde zum Vorreiter und zum Impulsgeber für eine neue Ära der Verwaltungsdigitalisierung.
Digitale Kommunikation
– schon lange Realität
Mit dem Beginn der 2000er Jahre nahm die Digitalisierung der Baugenehmigung weiter Fahrt auf.
Digitale Bauanträge, die elektronische Beteiligung weiterer Behörden und automatisierte OnlineBaulastauskünfte eröffneten den Verfahrensbeteiligten erstmals die
Practice

Baugenehmigungen werden durch den Einsatz von BIM, RPA und KI sowie die konsequente Anwendung des Once-OnlyPrinzips weiter vereinfacht.
Möglichkeit zur medienbruchfreien Kommunikation Die digitale Antragstellung war keine Vision mehr – sie wurde lange vor dem XBauStandard gelebte Praxis Diese Entwicklung war nicht etwa eine Folge des Onlinezugangsgesetzes (OZG), sondern ging ihm weit voraus. Die digitale Baugenehmigung ist somit kein neues Phänomen, sondern seit über zwei Jahrzehnten ein etablierter Bestandteil moderner Verwaltungsarbeit Möglich wurde dies durch ein Lösungsportfolio, das frühzeitig auf die Bedürfnisse kommunaler Bauaufsichten reagierte und
digitale Lösungen bereitstellte, die den gesamten Prozess abbilden können und dies auch über den Bescheid hinaus Ein zentraler Erfolgsfaktor in der Entwicklung digitaler Baugenehmigungslösungen ist der konsequente Einbezug aller am Genehmigungsverfahren beteiligten Rollen – von Bauaufsichtsbehörden über Fachplaner bis hin zu Antragstellern. Dieses Vorgehen ermöglichte es, die Nutzerperspektive konsequent in den Mittelpunkt zu stellen und moderne, benutzerfreundliche Lösungen zu entwickeln und sorgt für eine bedarfsgerechte Innovation
Das Start-up GovRadar hat eine Software für die Vergabe entwickelt – und einen Ansatz gefunden, solche GovTech-Lösungen schneller in die Verwaltungen zu bringen.
Letztlich sei es Wissensmanagement, beschreibt Unternehmensgründer und CEO Sascha Soyk die VergabeSoftware von GovRadar. „Wir haben die Ausschreibungen von öffentlichen Plattformen gecrawled – inzwischen sind es etwa sieben Millionen Dokumente – und mit Hilfe von Machine Learning ausgewertet“ Mitarbeitende in den Vergabestellen könnten sich dann von der KI Vorschläge erstellen lassen, anders als etwa bei ChatGPT auchverlässlich mitQuellenhinterlegt Sie können auch nach Krite
rien suchen, etwa in welchen Vergabeverfahren ausgeschrieben wurde oder auf welcher föderalen
Ebene. Beschaffung und Vergabe können so vereinfacht, die Zeiten erheblich reduziert werden – auf 6 Prozent des ursprünglichen Aufwands, wie Sascha Soyk erläutert
Dabei ist aber noch ein anderer Aspekt interessant: Für Startups im GovTechBereich ist der Weg über einzelne Ausschreibungen mühsam und langwierig GovRadar, selbst ein Startup, hat einen anderen Ansatz gewählt: Über zwei
Erfolgsfaktoren zur Umsetzung des digitalen Baugenehmigungsprozesses
Bei allen Digitalisierungsprojekten, die seitens Prosoz in diesem Rahmen erfolgreich umgesetzt worden sind, haben sich die folgenden drei Erfolgsfaktoren als sehr bedeutsam herausgestellt: Zum einen liegt es an der transparenten, professionellen Projektarbeit aller Beteiligten, zum anderen an der Anzahl der Projektpartner, die bewusst klein gehalten wurde und sich dadurch auszeichnet, dass neben der jeweiligen Kommunalverwaltung alles aus einer Hand angeboten und in enger Abstimmung mit der Verwaltung umgesetzt wird. Darüber hinaus spielt der kontinuierliche Wissenstransfer aus früheren Projekten eine wesentliche Rolle. So können Erfahrungen systematisch genutzt und künftige Vorhaben effizienter gestaltet werden.
Once-Only
Ein zentrales Prinzip, das die digitale Baugenehmigung seit jeher prägt, ist „OnceOnly“: Daten, die einmal erhoben wurden, müssen nicht erneutabgefragt werden. Dieses Prinzip ermöglicht eine durchgängige, medienbruchfreie Sachbearbeitung und entlastet sowohl Antragsteller als auch Behörden. Einen wichtigen Beitrag hierzu trägt der verbindlich zu verwendende XBauStandard bei. Von der Übernahme der in der BundID hinterlegten Personendaten in die Antragsassistenten über die direkte Weiterverarbeitung in den Fachverfahren bis hin über die Mitteilung an andere berechtigte Behörden werden diese Daten über den gesamten Prozess sicher und medienbruchfrei transportiert. Die digitale Baugenehmigung ist damit nicht nur ein technischesWerkzeug,sondern einorganisatorisches Konzept, das Effizienz und Bürgerfreundlichkeit vereint
Konsequent weiterdenken
Die Vision für die kommenden Jahre ist klar: Das Baugenehmigungsverfahren wird durch den Einsatz innovativer Technologien wie Building Information Modelling (BIM), RoboticProcessAutomation(RPA),
Künstlicher Intelligenz (KI) und die konsequente Anwendung des OnceOnlyPrinzips weiter vereinfacht und beschleunigt werden. Dabei geht es nicht um Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern um die Schaffung eines intelligenten, vernetzten und nutzerfreundlichen Systems, das den Anforderungen moderner Stadtentwicklung gerecht wird. Die digitale Baugenehmigung ist dabei nicht das Ziel, sondern der Weg – ein Weg, der bereits vor Jahrzehnten begonnen hat und heute aktueller ist denn je Die digitale Baugenehmigung ist kein neues Kapitel, sondern ein fortlaufendes Buch mit vielen bereits geschriebenen Seiten Sie zeigt exemplarisch, wie frühzeitige Investitionen in digitale Infrastruktur langfristige Wirkung entfalten können.
Herten war 1985 ein Pionier – und ist es heute, 40 Jahre später, immer noch Die Geschichte der digitalen Baugenehmigung ist damit auch eine Geschichte von Kontinuität, Innovationskraft und dem Mut, Verwaltung neu zu denken.
Der Autor Daniel Hoffmann, Strategischer Produktmanager im Geschäftsfeld Bauen & Umwelt, PROSOZ Herten GmbH

vorab zentral finanzierte Flatrates können Kommunen und Landesbehörden in NordrheinWestfalen dieAnwendungnutzen,diealsSoftwareasaService(SaaS)angeboten wird Eine noch größere Reichweite ergibt sich aus einem Rahmenvertrag mit der Einkaufsgemeinschaft der kommunalen ITDienstleister ProVitako. Hier können die rund 7.000 durch die ProVitakoMitglieder vertretenen Kommunen ihren Dienstleister beauftragen und die Software ohne Ausschreibung nutzen. Ein Königsweg, auch für an

dere Startups? „Multiplikatoren zu suchen, empfehle ich auf jeden Fall“, sagt Soyk. Allerdings sei das von Land zu Land unterschiedlich: „In NRW hat es sehr gut funktioniert, weil sowohl anfangs dieIT.NRWalszentralerITDienstleister als auch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung unterstützt haben“, es sei auch eine Sache des Mind
sets der Entscheider, erklärt Soyk und hebt den Einsatz von Ministerin Ina Scharrenbach hervor, die die Idee der „gleichen Lösung für alle, zentral orchestriert“ stark gefördert habe Aber wenn es in einem Bundesland funktioniere, zeige das eben auch, dass es möglich sei – ein klares Argument gegenüber anderen Ländern, aber auch dem Bund.
Und natürlich sei die ProVitako mit ihrem Ansatz „Wir beschaffen für viele“ in diesem Fall der passende Partner. Die Genossenschaft, sonst eher auf Hardwarebeschaffung fokussiert, hätte hier Pionierarbeit geleistet und das Vorhaben auch in Hinblick auf Vergaberecht, ITSicherheit und Datenschutz geprüft
Die GovRadarLösung soll künftig auch weiterentwickelt werden, um Innovationen in die Verwaltungen zu bringen – indem die Marktseite mit einbezogen wird Dazu sollte auch die Anbieterseite mit Hilfe von KI analysiert werden, hier seien auch Kooperationen denkbar, so Sascha Soyk. nh
SCCON 2025
Die Smart Country Convention gilt als die wichtigste deutschsprachige Leitmesse für Digitalisierung im Public Sector. In diesem Jahr fand sie zwischen dem 30. September und dem 2 Oktober im Hub27 der Messe Berlin statt.
Erstmalig fand die Smart Country Convention in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des neu geschaffenen Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung statt. Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger hielt zum Ende der Messe am zweiten Oktober eine Keynote, in der er die umfassende digitale Transformation Deutschlands als gesamtgesellschaftlichen Auftrag definierte. „Digitalisierung ist Bewegung, Veränderung, Aufbruch in die Zukunft“, betonte Wildberger und machte deutlich, dass es nicht nur um technische Lösungen gehe, sondern um die Transformation des ganzen Landes Digitalisierung sei ein Mannschaftssport. In seiner Rede konzentrierte er sich weiterhin auf zentrale Säulen des digitalen Wandels. Den Ausbau digitaler Infrastrukturen als Grundlage einer modernen Gesellschaft, die Schaffung einer effizient funktionierenden digitalen Verwaltung, die Innovationskraft neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, umfassende IT-Sicherheit als Vertrauensbasis, sowie gesellschaftliche Teilhabe durch digitale Inklusion Wildberger bezeichnete die Smart Country Convention als „Schaufenster für das, was möglich ist, wenn Verwaltung, Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammenarbeiten“ und unterstrich damit die zentrale Rolle der Veranstaltung als Katalysator für die deutsche Digitalisierungsstrategie.
Begleitet wurde der Minister von seinen Staatssekretären, die an den drei Messetagen in verschiedenen Fachsessions konkrete Impulse für die Modernisierungsagenda der öffentlichen Verwaltung setzten
Mit über 23.000 Teilnehmern konnte die SCCON 2025 ein Besucherplus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen – ein deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung der Digitalisierung im öffentlichen Sektor Um dem gesteigerten Interesse gerecht zu werden, wurde die SCCON in diesem Jahr um eine zusätzliche Halle auf insgesamt drei Hallen mit sieben Bühnen erweitert und bot 500 Ausstellerfirmen, über 800 Speakerinnen und Speakern sowie mehr als 1.000 Sessions den gebotenen Raum
Die Fachmesse konzentrierte sich in diesem Jahr auf die derzeit wichtigsten Digitalisierungsfelder, wobei besonders die Themen digitale Souveränität und künstliche Intelligenz im Fokus standen. In zahlreichen Keynotes und Paneldiskussionen wurde zudem deutlich, dass deutsche Kommunen und Behörden zunehmend auf eigenständige, sichere Lösungen setzen, um ihre digitale Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Der Themenkomplex der KI-gestützten Verwaltungslösungen zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Veranstaltung. Experten aus Wissenschaft und Praxis präsentierten konkrete Anwendungsfälle, von automatisierten Doku-
turen besondere Aufmerksamkeit
Diesbezügliche Diskussionsrunden brachten hervor, dass deutsche Kommunen und Behördenverstärkt auf europäische Alternativen zu globalen Hyperscalern setzen, um einerseits Datenschutz und digitale Souveränität zu gewährleisten und andererseits Anhängigkeiten signifikant zu reduzieren.
Die Smart Country Convention dient traditionell – wie auch von Minister Wildberger beschworen – als Schaufenster für besonders gelungene deutsche wie internati-

mentenverarbeitungen bis hin zu intelligenten Bürgerservices. Dabei wiesen die Aussteller ein um das andere Mal darauf hin, dass der verantwortungsvolle Einsatz von KI in der Öffentlichen Verwaltung nicht nur Effizienzgewinne im zweistelligen Prozentbereich verspreche, sondern auch neue Formen der Bürgerbeteiligung und -kommunikation ermögliche. Ebenfalls bildeten Cloud-Technologien – wie auch schon in den Vorjahren – einen weiteren Schwerpunkt der Messe. In diesem Jahr erhielten – nicht zuletzt aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage – insbesondere hybride Lösungen sowie souveräne Cloud-Infrastruk-

Nutzerinnen und Nutzern digitale Verwaltungsdienstleistungen bietet. Das südschwedische Helsingborg demonstrierte verhaltensbasierte Ansätze zur Förderung nachhaltiger Mobilität, während Graz sein KI-gestütztes Unfallpräventionssystem dem interessierten Fachpublikum demonstrierte. Die SCCON wäre aber nicht die SCCON, wenn es nicht auch einige Award-Verleihungen gegeben hätte
Der Smart City Index Award 2025 würdigte München als führende Smart City vor Hamburg und Stuttgart Die bayerische Landeshauptstadt konnte insbesondere durch ihre ganzheitliche Digitalisierungsstrategie überzeugen, die technische Exzellenz erfolgreich mit Bürgernähe verbindet. Hannover wurde als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet und zeigte damit, dass kontinuierliche Innovationen und strategische Weiterentwicklung in der Smart-City-Landschaft honoriert werden Der „Smart Country Startup Award“ hingegen ging an das Berliner Unternehmen GovIntel für seine KI-gestützten Analysen öffentlicher Daten Diese Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Startups im GovTech-Bereich, die mit agilen Lösungen etablierte Verwaltungsstrukturen modernisieren und neue Wege der Datennutzung aufzeigen.
onale Produkte und Projekte aus der bunten Welt der Digitalisierung Hamburg, Leipzig und München stellten beispielsweise ihr gemeinsames Projekt zur EntwicklungdigitalerZwillingevor,welches durch KI-gestützte Analyseverfahren eine datenbasierte Stadtplanung ermöglicht.
Diese Kooperation zeige exemplarisch, wie interkommunale Zusammenarbeit Synergien schaffen und Ressourcen effizient einsetzen kann, betonte ein Verantwortlicher des Projekts.
Es geht auch mit kleinerem Budget
Aber auch kleinere Kommunen wussten durch innovative Ansätze zu beeindrucken Das Amt von Süderbrarup, einer 5.000-Seelengemeinde aus Schleswig-Holstein, stellte auf der SCCON sein OpenSource-basiertes KI-Chat-System vor. Dadurch würden Bürgerdialoge automatisiert und gleichzeitig die digitale Eigenständigkeit der Verwaltung gestärkt.
Die Stadt Jena hingegen präsentierte ihr partizipatives Smart-City-Konzept, das Bürgerbeteiligung und technische Innovation erfolgreich verbindet. Durch den Einsatz von Sensortechnik zur Luftqualitätsmessung und intelligenten Verkehrssystemen konnte die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger messbar verbessert werden, während gleichzeitig die Bürgerschaft aktiv in Planungsprozesse eingebunden blieb. Internationale Beispiele boten den Fachbesucherinnen und Fachbesuchern den Blick über den deutschen Tellerrand Istanbul etwa stellte seine stadtweite Super-App vor, die über drei Millionen
Ein durchgängiges Thema der SCCON 2025 war weiterhin die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeitmaßnahmen. Zahlreiche Sessions beleuchteten beispielsweise, wie digitale Lösungen zur Erreichung der Klimaziele beitragen können. Von intelligenten Energiemanagementsystemen bis hin zu KI-optimierten Verkehrsflüssen zeigten die Präsentationen konkrete Ansätze auf, wie Technologie dem Umweltschutzdienenkann.Gleichzeitig wurde aber auch die Verantwortung thematisiert, die mit dem Einsatz digitaler Technologien einhergeht. Diskussionen über Algorithmus-Transparenz, Datenschutz und digitale Teilhabe prägten viele Sessions und zeigten, dass erfolgreiche Digitalisierung stets auch ethische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigen muss. Durch die erweiterte Matchmaking-Plattform und zahlreiche Networking-Events bot die diesjährige Convention überdies ideale Voraussetzungen für den fachlichen wie redaktionellen Austausch. Über 90 Prozent der Ausstellerfirmen kündigten – laut Bitkom – bereits ihre erneute Teilnahme für 2026 an und setzten damit ein deutliches Zeichen hinsichtlich der Geschäftsmöglichkeiten, die die Veranstaltung bietet. Apropos. Die nächste Smart Country Convention findet vom 13. bis 15 Oktober 2026 statt Mit der politischen Rückendeckung durch das neue Digitalministerium und dem ungebrochenen Interesse von Kommunen und Wirtschaft, die digitale Transformation voranzutreiben, ist die SCCON auch in Zukunft bestens gerüstet, als zentrale Plattform und Schaufenster für Deutschlands Weg hin zu einem Smart Country zu wirken jk
25. November 2025
Der November bietet für die Gesundheitsbranche einige große und bekannte Veranstaltungen – darunter die Digital Health Conference des Bitkom im Kosmos in Berlin
Die Probleme im deutschen Gesundheitssystem sind längst bekannt: Fachkräftemangel, demografischer Wandel, steigende Kosten und vieles mehr. Nun geht es um Aufbruch, Umsetzung und Tempo. Die Digital Health Conference des Bitkom stellt dieses Jahr eben jene Themen in den Fokus und bietet dafür eine Plattform zum Austauschen, Vernetzen und Teilen konkreter Lösungen. Die sechs Schwerpunkt-Themen sind:
W Digital Patient Journey: Digitale Gesundheitsanwendungen, Telemedizin und innovative Pflegekonzepte.
W Health & Politics: Schaffung richtiger Rahmenbedingungen in der Politik, Finanzierung, Digitalisierung und sichere, nachhaltige Versorgung
W Cybersecurity: Sicherheitsstrategien für sensible Gesundheitsdaten, sowohl in der Versorgung als auch in der medizinischen Forschung.
W KI & Big Data: Von der Forschung bis zur Praxis: Einfluss gesetzlicher Rahmenbedingungen wie des EU AI Acts auf den Einsatz von KI und Datenanalyse – insbesondere bei Diagnose, Behandlung und Prävention von Krankheiten.
27. November 2025

W ePA für alle: Rückblick auf zentrale Entwicklungen rund um die ePA sowie kritische Betrachtung von Nutzen, Risiken und nächsten Schritten.
W Beyond the pill: KI, digitale Therapeutik und personalisierte Medizin – mit Blick auf die Rolle von Startups. Die Eröffnungskeynote wird von Bundesgesundheitsministerin
Nina Warken gehalten Im Verlauf des Tages treten weitere bekannte Speaker auf, wie etwa Prof Dr med. Karl Broich, Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Prof Dr Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit sowieBrenyaAdjei,Geschäftsführerin der gematik GmbH se
Überblick Digital Health Conference 25. November 2025
KOSMOS Karl-Marx-Allee 131A 10243 Berlin
Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr

Veranstalter: Bitkom e.V. und Servicegesellschaft mbH
Eintrittspreise:
500 Euro Abweichender Tarif für Studierende und Start-ups.
[ health-conference.de ]
Die Vogel IT-Akademie veranstaltet ein Event für Frauen in Führungspositionen: In diesem Rahmen werden in Augsburg die IT-Women of the Year gefeiert. Das Highlight am Abend: die Verleihung der Readers' Choice Awards
Beim FIT-Kongress geht es um Austausch von Top-Talenten, Managerinnen, Gründerinnen und Expertinnen. Denn viele Frauen in Führungspositionen setzen Maßstäbe in der IT-Welt Teilnehmende aus den Bereichen Business-IT, eHealth und eGovernment kommen zusammen, um innovative Berufsbilder zu stärken, Netzwerke aufzubauen und als inspirierende Leitfiguren zur Wettbewerbsfähigkeit und Nachwuchsförderung in der IT beizutragen Ziel des Events ist es außerdem, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig im beruflichen Umfeld zu unterstützen. Der FIT-Kongress bietet dazu ein vielfältiges Programm aus Keynotes, Diskussionsrunden und Workshops sowie eine Networking-
Plattform mit Fokus auf Leadership und neuen Karrierechancen.
Die Veranstaltung beginnt mit einem Grußwort der Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg Eva Weber. Im Anschluss folgen diverse Sessions, in denen es beispielsweise um KI, IT-Strategien, Erfolgsfaktoren, Resilienz und Mut als Zukunftskompetenzen sowie um Chancen und Risiken im Business geht.
Am Abend wird schließlich die Gala eröffnet: Neben einem Galadinner werden Tombola-Preise verlost und die Awards verliehen: Denn die „Women's IT Network (WIN)“ und die Vogel IT-Akademie verleihengemeinsamdieReaders'Choice Awards
Die Gewinner, Speaker, Teilnehmer und Veranstalter treffen sich
LIVE | 28. OKTOBER 2025 | 10.00 UHR

DigitaleSouveränität–mitsmarterProjektorganisation

KaterynaPugachova AccountManager MeisterLabsSoftware

Digitale Souveränität ist mehr als ein Schlagwort – sie ist die Grundlage für nachhaltigen Erfolg in Zeiten wachsenderAbhängigkeitvonglobalenCloud-AnbieternundkomplexenCompliance-Anforderungen.GeradefürOrganisationenimöffentlichenSektorbedeutetsie:Kontrolleüber eigene Daten, transparente Prozesse und verlässliche Werkzeuge.
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie ProjektmanagementeinzentralerBausteindigitalerSelbstbestimmungist –undwarumMeisterTaskdieidealeLösungbietet. Sieerfahren:
• Was digitale Souveränität für Ihre Organisation konkret bedeutet.
• Wie Sie mit klaren Workflows und transparenter AufgabenorganisationIhreProjektesouveränsteuern.
• WelcheVorteileMeisterTaskdurcheinfacheBedienung, deutscheServerundvolleDSGVO-Konformitätbietet.
• PraxisnaheBeispieleausderVerwaltung–sosetzenSie moderneInfrastrukturimAlltagerfolgreichum.
Freuen Sie sich auf praxisnahe Einblicke, eine Live-Demo von MeisterTask und konkrete Tipps, wie Sie Ihre digitale UnabhängigkeitSchrittfürSchrittstärken.
danach auch bei einem feierlichen Ausklang auf der Tanzfläche oder an der Bar se
Überblick
FIT-Kongress / Females in IT – Future of IT 27. November 2025
Hotel Maximilian‘s Maximilianstraße 40 86150 Augsburg

Veranstaltungszeit: 8.30 bis 19.30 bzw bis 23 Uhr
Veranstalter / Kontakt: Vogel IT-Akademie Katharina Rimkus: Tel. 0821 2177-124
Eintrittspreise: 250 Euro 159 Euro, jeweils für den Kongress oder die Gala [ fit-kongress.de ]

Jetztanmeldenunter https://voge.ly/webinar/

Johannes Kapfer Redakteur eGovernment

STACKIT bietet souveräne Lösungen für hochregulierte Bereiche mit besonderem
Anspruch an Datenschutz & Sicherheit und ist bezugsfähig über die Mitglieder der govdigital. Das Portfolio umfasst neben klassischen Cloud- & Colocation-Lösungen auch umfassende Beratung & Migrationsunterstützung.
STACKIT GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Gabriel Becker Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm Tel. +49713230484539 gabriel.becker@ stackit.cloud www.stackit.de
DIGITAL SECURITY

genua GmbH
Ansprechpartner: Katrin Pfeil Domagkstraße 7 85551 Kirchheim bei München Tel. +4989991950-902 vertrieb@genua.de www.genua.de
genua schützt IT-Infrastrukturen von Behörden zuverlässig vor Cyber-Risiken – mit IT-Sicherheit „Made in Germany“. Als Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe und enger Kooperationspartner des BSI unterstützen wir von der Konzeption über die Auswahl und Implementierung geeigneter Lösungen – wie PAP-Strukturen und mobile Zugangslösungen für VS-NfD-Kommunikation – bis hin zur Unterstützung bei beschleunigten Zulassungsverfahren.
DMS, WORKFLOW UND ARCHIV
Mit der Lösungsplattform VIS-Suite zählt die PDV GmbH zu den renommiertesten
PDV GmbH Haarbergstraße 73 99097 Erfurt Tel. +493614407100 Fax. +493614407 299 info@pdv.de
E-Akte-Anbietern in Deutschland. Die mit dem E-Akte-Award bereits 7-mal ausgezeichnete Produktfamilie hält Module gemäß dem Organisationskonzept E-Verwaltung bereit und ist in Bundesbehörden, Landesund Kommunalverwaltungen sowie im kirchlichen Umfeld, in der Polizei und in der Justiz erfolgreich im Einsatz. Das standardbasierte System erlaubt eine schnelle und allen voran wirtschaftliche Umsetzung der E-Verwaltung.

xSuite Group GmbH
Ansprechpartner: Daniel Petersen Hamburger Str. 12 22926 Ahrensburg Tel. 0173/7208949 info@xsuite.com www.xsuite.com
Als Softwarehersteller der SAP-zertifizierten xSuite® bieten wir für öffentliche Auftraggeber eine standardisierte, SAP-integrierte Lösung zur Rechnungsverarbeitung. Angesprochen werden die SAP-Module FI, MM, PSM und PSCD sowie der Kommunalmaster Finanzen. Es können alle Rechnungsformate wie Papier, PDF, XRechnung, ZUGFeRD, etc. verarbeitet werden.


OPTIMAL SYSTEMS Hannover ist seit 1997 die treibende Kraft für ein optimales Enterprise Content Management System in Öffentlichen Verwaltungen. In dem ECM enaio® werden Dokumente digital erfasst ausgewertet, verwaltungsweit für alle berechtigten Mitarbeiter*innen bereitgestellt und rechtssicher archiviert. Dank der ausgeprägten Schnittstellenvielfalt zu kommunalen Fachverfahren ist ein reibungsloser Datentransfer möglich.
OPTIMAL SYSTEMSVertriebsgesellschaft mbH Hannover
Ansprechpartner: Björn Wittneben Wöhlerstraße 42 30163 Hannover Tel: +49511123315-0 hannover@optimalsystems.de www.optimalsystems.de/hannover

Fabasoft ist österreichischer IT-Innovations- und Marktführer im Bereich elektronischer Akten im DACH-Raum und sorgt für effizientes Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Fabasoft eGov-Suite ist Teil der Fabasphere und macht dank KI elektronische zu „intelligenten Akten“ für moderne Verwaltungsarbeit.
Fabasoft Deutschland GmbH THE SQUAIRE 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt/Main Tel: +49696435515-0 Fax: +49696435515-99 egov@fabasoft.com www.fabasoft.com

procilon – Technologie für Informationssicherheit und Datenschutz

procilon GmbH
Ansprechpartner: Falk Gärtner Leipziger Straße 110 04425 Taucha Tel. +4934298487831 Fax +4934298487811 anfrage@procilon.de www.procilon.de
Der Name procilon steht seit mehr als 20 Jahren für sichere Softwaretechnologie in der öffentlichen Verwaltung. Heute nutzen mehr als 850 Kommunen, Landes- und Bundesbehörden procilon-Software und strategische Beratungsleistungen für sicheres E-Government



AKDB
Hansastraße 12-16, 80686 München Tel. 089/5903-1533 Fax 089/5903-1845 presse@akdb.de www.akdb.de
Der Marktführer für kommunale Software: Die AKDB bietet Entwicklung, Pflege und Vertrieb qualifizierter Lösungen für alle Bereiche der Kommunalverwaltung. Zur Angebotspalette gehören im BSI-zertifizierten Rechenzentrum gehostete Fachverfahren für das Finanz-, Personal-, Verkehrs- Sozialund Grundstückswesen. Das Bürgerservice-Portal ist die bundesweit modernste und reichweitenstärkste E-Government-Plattform für Online-Verwaltungsdienste.


Governikus KG
Ansprechpartner: Stefan Rauner
Hochschulring 4 28359 Bremen Tel. 0421/20495-0 Fax 0421/20495-11 kontakt@governikus.de www.governikus.de
Die Governikus KG ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen für den gesamten Zyklus elektronischer Kommunikation von der Authentisierung über den sicheren Datentransport bis hin zur Beweissicherung elektronischer Daten. Gesetzeskonformität, Sicherheit und Innovation stehen für das in Deutschland und EU agierende Unternehmen im Vordergrund.

PROSOZ Herten GmbH Ewaldstraße 261 45699 Herten Tel. 02366/188-0 info@prosoz.de www.prosoz.de
Mit innovativen Lösungen, praxisorientierter Qualifizierung und hoher Beratungskompetenz hat sich Prosoz in den zurückliegenden 35 Jahren vom Softwarehersteller für Kommunen zum Komplettlösungsanbieter in den Bereichen Soziales, Jugend sowie Bauen und Umwelt entwickelt. Als Vordenker für die Digitalisierung in den Kommunen stehen wir Ihnen als strategischer Partner zur Seite.


saascom GmbH
Ansprechpartner: Martina Diederich Heidelberger Straße 6 64283 Damstadt Tel. 06151/3600808 vertrieb@saascom.de www.saascom.de www.civento.de
IT-Experte für öffentliche Verwaltungen! saascom versteht die Bedürfnisse der Verwaltungen und unterstützt durch innovative Lösungen bei der digitalen Transformation. Mit civento© bieten wir eine zukunftssichere Low-Code-Digitalisierungsplattform, die vereinfachte und voll digitalisierte Sachbearbeitungsprozesse mit Endezu-Ende-Automatisierung ermöglicht.

SysEleven GmbH
Ansprechpartnerin: Christin Rehbein
Boxhagener Str. 80 10245 Berlin Tel.: +49302332012105 marketing@syseleven.de www.syseleven.de
SysEleven GmbH, eine Tochter der secunet, betreut 500+ Kunden im DACHMarkt und bietet Cloud- und Kubernetes Managed Services, darunter die OpenStack Cloud und „MetaKube“. Als CNCF-Mitglied und zertifizierter Kubernetes Provider legt SysEleven Wert auf Datenschutz und hostet in nachhaltigen Rechenzentren.


Voigtmann GmbH
Ansprechpartner: Jens Bornschein Tel.: 0911 47776542 hallo@voigtmann.de meinvideotermin.de Kieslingstr. 76 90491 Nürnberg
Die Mein Videotermin-Suite ermöglicht sichere und niederschwellige Videoberatung für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende der Verwaltung. Sie stärkt digitale Souveränität, erhöht Servicequalität und Effizienz und gewährleistet höchste Datenschutzstandards. Durch intuitive Bedienung und stabile Technologie wird moderne Behördenkommunikation zuverlässig und zukunftssicher gestaltet.

Open Source
Archivierung
Cloud
Ersetzendes Scannen
Digitale Signatur
Fachverfahren
Schnittstellen
Mobiles Arbeiten
Automatisierung
Standardisierung
Aller Anfang ist schwer: Ein Einblick in die eGPA-Einführung in Justizvollzugsanstalten
Justiz ist prinzipiell Ländersache. Per Gesetz gilt die Einführung der E-Akte bis 2026, nicht aber für den Justizvollzug Allein in Hamburg werden pro Jahr 300.000 Formblätter für Anträge gedruckt Schließlich stellen auch Gefangene aus ihren Zellen Anträge, aber bislang noch auf Papier. In den Justizvollzugsanstalten ist man sich der Notwendigkeit zur schnellen Digitalisierung bewusst, doch aller Anfang ist schwer. Hamburg und NRW gehen die ersten Schritte.
„Die elektronische Akte ist ein Grundpfeiler der digitalen Justiz“, sagte Justizsenatorin Anna Gallina in Hamburg Anfang des Jahres in einer Mitteilung über den Fortschritt zur Digitalisierung in der Justiz Wo sich sonst Akten stapeln, Papier auf Papier, läuft in den Gerichten und Staatsanwaltschaften der Freien und Hansestadt weitgehend alles elektronisch Die bundesweite Einführung der elektronischen Akte in der Justiz ist eigentlich bis zum 1 Januar 2026 vorgesehen – nun auch mit der Opt-Out-Regelung, dass Bund und Länder noch bis Anfang 2027 Zeit zur Überführung haben, um etwaige Digitalisierungslücken zu schließen. Die Herausforderungen sind in vielen Bereichen der Justiz vorhanden, so auch im Justizvollzug Andreas Hildebrandt ist Referatsleiter für IT und Digitalisierung in der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz in Hamburg und erläuterte: „Auch wenn uns für die Umsetzung etwas mehr Zeit bleibt, sind wir dennoch verpflichtet, spätestens ab dem 1.1.2026 am elektronischen Rechtsverkehr (ERV) teilzunehmen Entsprechend besteht für uns die Herausforderung, mit Einführung der EAkte in den Gerichten und Staatsanwaltschaften Medienbrüche in den Anstalten zu minimieren und frühestmöglich eine E-Akten-Lösung für den Vollzug umzusetzen.“
Denn am Ende des Tages würde der Außenangleichungsgrundsatz nicht nur für die Gefangenen, sondern auch für die Organisation gelten, stellte Michael Birx, Referent im Justizministerium in Nordrhein-Westfalen und zuständig für den Aufbau eines landesweiten Controllings und Datenmanagementsystems im Justizvollzug, klar Birx und Hildebrandt laufen sich nicht nur in manchen Gremien über den Weg, sie vertreten auch zwei verschiedene Fachdisziplinen

im Justizbereich: IT und Fachlichkeit Auch daran erkenne man, laut Hildebrandt, dass ein großes Interesse bestehe, bundeseinheitliche Lösungen zu finden. Für ihn steht fest: „Wir wollen die Digitalisierung ein wenig entzerren. Diesen Mammutschritt – vom Analogen ins Digitale – zu gehen, fällt deutlich leichter, wenn bereits ein Teilbereich elektronisch läuft und sich in ein neues System überführen lässt, statt alle Akten auf einen Schlag zu digitalisieren Zudem sind wir mit sechs Justizvollzugsanstalten vergleichsweise klein –im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen mit 36 Einrichtungen.“
Hamburg startet Heureka
Infolge des Bund-Länder-Kommissionsbeschlusses in der Justiz (BLK) 2022 und der Arbeitsgruppe „Sachkommission für Informationstechnik im Justizvollzug“, in dem Nordrhein-Westfalen den Vorsitz hat, wurde ein länderübergreifendes Projekt „Einführung der elektronischen Gefangenenpersonalakte (eGPA)“ eingerichtet

„Hierbei handelt es sich um das derzeit mit Abstand größte und umfassendste IT-Projekt im Justizvollzug“, heißt es im damaligen Finanzierungsentwurf des Justizministeriums in NRW. Hamburg hat dazu bereits im Juli 2023 mit einem Vorprojekt zur eGPA begonnen – parallel zum länderübergreifenden Projekt. Darin wurden zuerst die Anforderungen erhoben und dann konkretisiert, sodass im Folgejahr die Frage im Fokus stand, wie das Antragswesen Ende-zu-Ende digitalisiert werden kann. „Im Oktober 2024 haben wir das Vorhaben in ein ganzheitliches Digitalprogramm namens Heureka gegossen und uns Unterstützung von der Partnerschaft Deutschland (PD – Berater der öffentlichen Hand) geholt, die unsere Projekte begleitet Ich glaube, wir sind mit diesem ganzheitlichen Ansatz sehr gut vorangeschritten in diesem Jahr“, teilte der hamburgische Referatsleiter mit, „und da wollen wir gerne dranbleiben.“ Denn neben den Digitalisierungspotenzialen konnte das Bundesland bereits Lösungen präsentieren.
Birx unterstützte dies: „Wir finden den Gedanken, den Hamburg verfolgt, sehr charmant Deswegen waren wir sehr froh, dass es eine Initiative gab für eine Gesamtstrategie in Deutschland, wo wir uns dranhängen und wo beispielsweise die Hamburger Ergebnisse einfließen und eingebunden werden können. Es ist immer ein Spannungsfeld zwischen zentraler Lösung und dezentraler Aufgabengestaltung, das ist nun mal in einem föderalistischen System so.“ Es müssten allerdings – auch datentechnischer Art – Brücken gebaut werden Ein interessanter Aspekt sei Low-Code, um Zwischenlösungen aufzubauen Low-Code ist eine Entwicklungsplattform, die es ermöglicht, Anwendungen mit minimalem manuellem Programmieraufwand durch visuelle Modellierung und vorgefertigte Bausteine zu erstellen. Birx betonte aber: „Wir müssen in der Organisation selbst noch mehr Erfahrungen in der Digitalisierung sammeln Vollzug können wir, Digitalisierung müssen wir noch ein bisschen lernen.“
Das sei nicht nur aufgrund des Personalmangels schwierig, es fehlten zudem die Kompetenzen „Deswegen ist uns Hamburg ein Vorbild. Und wie in einer guten Schule üblich, wollen wir da ein bisschen abgucken Sie lassen uns auch abschreiben.“ Schließlich habe Hamburg die Digitalisierung mit den Gefangenenanträgen begonnen. „Ich bin da vielleicht ein bisschen zu rheinisch Es muss irgendwann auch mal losgehen. Man kann nicht nur Feste planen, man muss dann mal anfangen zu feiern Und so machen wir das jetzt hier.“
Die praktischen Grenzen liegen besonders in der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in der Anstalt. Doch neben dem Schutzbedarf spielen auch die rechtlichen Verpflichtungen, wie das Hamburgische IT-Souveränitätsgesetz (HmbITSG), eine wichtige Rolle Birx teilte mit: „Die Welt um uns herum ändert sich; sie wird digitaler. Jetzt gehen die Gerichte und Staatsanwaltschaften in die digitale Verarbeitung. Von daher sind wir dazu aufgerufen, diese Entwicklung bestenfalls mitzugestalten, weil es im Vollzug besondere Anforderungen zu Themen wie Sicherheit und Datenschutz gibt.“ In NRW geht man davon aus, dass unstrukturierte digitale Daten noch für eine gewisse Zeit verarbeitet werden können. Gleichzeitig muss weiterhin mit unstrukturierten Informationen gearbeitet werden –wie der elektronische Rechtsverkehr zeigt –, etwa in Form von PDF-Dokumenten, die in die neue Akte integriert werden sollen.
Brücken bauen: Prozesse statt Papier und PDF
In den Justizvollzugsanstalten (JVA) existiert die Gefangenenpersonalakte bislang noch in Papierform Einzelne Auszüge werden in der Akte abgelegt, die vollständige Gesundheitsdokumentation erfolgt jedoch separat Ansonsten wird alles, was den Gefangenen betrifft, in der Akte erfasst Roger Strathausen istbeiderPD– Berater der öffentlichen Hand GmbH verantwortlich für den Bereich der öffentlichen Justiz. Er fokussiert sich besonders auf die Digitalisierungspotenziale und gab deshalb zu verstehen, dass es bei der elektronischen Gefangenenpersonalakte (eGPA) um viel mehr gehe als nur darum, Papierdokumente in PDF zu erstellen: „Wir wollen den Gesamtprozess überdenken, überflüssige Arbeitsschritte einsparen und Dinge neu organisieren.“ Und ein ganz wichtiger Punkt bei der Akte seien die Anträge.
Fortsetzung auf Seite 26
Die nächste Ausgabe der eGovernment erscheint am Montag, den 24. November 2025.
Das SPEZIAL dieser Ausgabe widmet sich dem Thema Datenmanagement & Analysen
Anzeigenschluss ist der 10. November 2025.
Anzeigenhotline: 0821/2177-212
Digitalisierung
Andreas Voglmayr, Business Unit Executive bei Fabasoft, erklärt im Gespräch, warum die E-Akte das Fundament der digitalen Verwaltung ist und welchen Einfluss sie auf die Digitalisierung der Behörden in Deutschland hat. Er erläutert außerdem, wie KI-gestützte, „intelligente Akten“ Behörden helfen, schneller zu entscheiden, Fachkräfte zu entlasten sowie den steigenden Erwartungen von Bürger:innen und Unternehmen gerecht zu werden.
Wie sehen Sie die aktuelle EntwicklungderdigitalenVerwaltung in Deutschland?
Andreas Voglmayr: Deutschland hat in den vergangenen Jahren spürbare Fortschritte bei der digitalen Verwaltung erzielt Besonders positiv ist, dass Bund, Länder und Kommunen stärker zusammenarbeiten und gemeinsame Standards entwickeln, um Abläufe zu vereinheitlichen Gleichzeitig treibt die wachsende Nachfrage nach nutzerfreundlichen Online-Services den Ausbau weiter voran. Insgesamt entwickelt sich die digitale Verwaltung Schritt für Schritt zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Behördenalltags und eröffnet neue Möglichkeiten für effiziente, bürgernahe Services.
Wo liegen aktuell die größten Herausforderungen bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung?
Der demografische Wandel verschärft den Fachkräftemangel und zwingt Verwaltungen, ihre Arbeitsweise grundlegend zu modernisieren und zu digitalisieren. Zudem
beitsplätze zu schaffen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein Verzögerungen blockieren Investitionen und bremsen Wachstum Low-Code-/No-Code-Technologien in Kombination mit künstlicher Intelligenz schaffen genau hier Entlastung: Mitarbeitende gestalten digitale Prozesse ohne tiefgreifendes Programmierwissen und nutzen KI, um Arbeitsschritte zu automatisieren und Entscheidungen zu unterstützen So bleibt trotz knapper Personalressourcen Raum für den Ausbau digitaler Services. Parallel dazu braucht es rechtliche Vorgaben, die es ermöglichen, vollständig digitale Abläufe rechtssicher umzusetzen – eine Voraussetzung für unseren nachhaltigen Fortschritt.
Welche Rolle spielen E-Akten bei der digitalen Transformation von Behörden?
Die E-Akte bildet das Herzstück der digitalen Transformation in Behörden. Sie bündelt den gesamten Wissensschatz der Verwaltung aus den vergangenen Jahrzehnten und macht ihn zugänglich Dieser Da-
wenden bereits die Fabasoft eGov-Suite?
Die Fabasoft eGov-Suite ist in Deutschland auf allen Verwaltungsebenen fest verankert. Mehr als 200 Bundesbehörden arbeiten mit der „E-Akte Bund“. Auf Landesebene setzen unter anderem Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern auf unsere digitale Aktenverwaltung
Auch zahlreiche Kommunen nutzen die Fabasoft eGov-Suite erfolgreich, etwa in München, Frankfurt am Main und Nürnberg Ein besonderes Beispiel stellt das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) dar: Dort betreibt der IT-Dienstleister ein Multimandantensystem für rund 18.000
Anwender:innen, basierend auf der Fabasoft eGov-Suite.
Fabasoft spricht von „intelligentenAkten“.KönnenSiekonkret erklären, was darunter zu verstehen ist?
„Intelligente Akten“ sind digitale Akten, die KI nutzen, um etwa Inhalte zu erkennen, Zusammenhänge zu verstehen und relevante

Dokumente, Metadaten und Vorgänge bilden – wie bereits erwähnt – den zentralen Datenschatz, auf dem automatische Analysen, Prozesssteuerung und KI-gestützte Funktionen aufbauen Die E-Akte liefert somit die Basis für die Digitalisierung und für die intelligente Akte
Wieso sollten Verwaltungen auf die „intelligente Akte“ setzen?
Verwaltungen sollten auf die intelligente Akte setzen, weil Aufgabenmenge, Qualitätsanforderungen und Geschwindigkeit der Abläufe stetig steigen Menschliche Ressourcen allein reichen hier nicht mehr aus, um Prozesse effizient zu bewältigen Die intelligente Akte trägt entscheidend dazu bei, die steigenden Anforderungen aktiv zu bewältigen Besonders bei Verwaltungsleistungen zeigt sich die Bedeutung: Effiziente Abläufe sichern schnelle Entscheidungen, entlasten die Verwaltung und stärken die Wirtschaft.
Wie gestalten intelligente Akten den Arbeitsalltag von Sachbearbeiter:innenundFührungskräften in Verwaltungen effizienter?
Intelligente Akten entlasten Sachbearbeiter:innen von Routinetätigkeiten und schaffen dadurch Raum für die inhaltlich komplexeren Aufgaben Führungskräfte gewinnen einen besseren Überblick und können strategische Entscheidungen gezielter treffen. Außerdem haben Behörden durch moderne Technologien die Chance, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren Eine digital transformierte öffentliche Verwaltung relativiert das oft noch vorherrschende konservative Image und zeigt, dass Behörden zahlreiche fachlich fordernde Jobs anbieten.
Können Sie ein konkretes Beispiel aufzeigen, wie Behörden durch intelligente Akten profitieren? Intelligente Akten verändern den Umgang mit umfangreichen Verwaltungsunterlagen grundlegend Ein Beispiel ist der AI Use Case „Zusammenfassung“. Die Fabasoft eGov-Suite fasst komplexe Sachverhalte etwa von Akten mit mehreren hundert Seiten kompakt zusammen, berücksichtigt dabei Rolle und Blickwinkel des Anwenders und verschafft Mitarbeitenden somit in kürzester Zeit einen klaren Überblick über Sachverhalte, die wichtigsten handelnden Personen und die getroffenen Entscheidungen. Zusammenfassungen werden nach individuellen Anforderungen und Zugriffsrechten erstellt, sodass jede Person genau die Informationen erhält, die für ihre Aufgaben relevant sind. Sachbearbeiter:innen bekommen strukturierte Fakten und Fristen, welche die Bearbeitung deutlich beschleunigen. Die Leitung erhält Kennzahlen, Berichte und Handlungsempfehlungen, während IT-Teams ausschließlich die für ihre Tätigkeiten relevanten Daten einsehen. So bleibt der Informationsfluss stets transparent und effizient, selbst bei umfangreichen Akten mit möglichweiser jahrelanger Histo-
rie. Die künstliche Intelligenz unterstützt damit nicht nur den Überblick, sondern steigert auch die Qualität und Treffsicherheit von Entscheidungen erheblich.
WiekannkünstlicheIntelligenz zukünftig Verwaltungsprozesse weiter verbessern, ohne menschliche Kontrolle zu ersetzen?
Fabasoft setzt auf den Ansatz „Human in the Loop“: Die künstliche Intelligenz unterstützt, aber Menschen treffen weiterhin alle wichtigen Entscheidungen und behalten die Kontrolle, um sicherzustellen, dass alle Vorgangsweisen korrekt sind – juristisch, moralisch und gesellschaftlich So steigert KI die Effizienz von Verwaltungsprozessen, ohne die menschliche Verantwortung zu ersetzen.
Welche Trends im E-GovernmenttreibenausIhrerSichtdie Nutzung von intelligenten Akten voran? Hier sind drei Entwicklungen besonders hervorzuheben. Erstens rückt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt Die entscheidende Frage lautet nicht, ob KI genutzt wird, sondern wie sie in der Verwaltung echten Mehrwert schafft. Zweitens gewinnt digitale Souveränität an Gewicht Mit Cloud-nativen Architekturen betreiben Behörden ihre Anwendungen flexibler und können sie bei Bedarf zwischen verschiedenen Anbietern verschieben. So entsteht eine belastbare Multi-Cloud-Strategie, die Abhängigkeiten reduziert. Die Verwaltung behält die Kontrolle über ihre Daten und stärkt ihre Handlungsfreiheit im digitalen Raum.
Drittens sind auch Low-Code-/NoCode-Funktionalitäten essenziell. Ihr Einsatz ermöglicht Beschäftigten in Behörden, künftig selbstständig, ohne vertiefte Programmierkenntnisse, softwarebasierte Anwendungen auf einfache Art und Weise hinzuzufügen Damit ist die öffentliche Verwaltung in der Lage, mit wenig Aufwand in kürzester Zeit auf neue Anforderungen zu reagieren und einen enormen Nutzen zu erreichen.
Was raten Sie Verwaltungen, die den Schritt zur intelligenten Akte machen möchten? Wichtig ist es, von Beginn an die richtigen Weichen zu stellen: Beim Umstieg zur intelligenten Akte empfiehlt sich die Berücksichtigung der zuvor genannten Faktoren: Das System muss Cloud-nativ arbeiten sowie die Multi-Cloud-Strategie und Low-Code-/No-Code-Technologien unterstützen. Von zentraler Bedeutung ist, künstliche Intelligenz von Beginn an einzuplanen, denn eine spätere Integration ist technisch aufwendig oder meist sogar unmöglich.
Mit der Fabasoft eGov-Suite erfolgt der Wechsel von der elektronischen zurintelligentenAktefließend Kunden müssen nichts anpassen und sich um nichts kümmern Neue AI Use Cases liefern wir regelmäßig mit den Updates mit, sodass Verwaltungen automatisch von Verbesserungen profitieren. Kunden bekommen mit der Fabasoft eGovSuite ein Rundum-sorglos-Paket geliefert.
Bundesärztekammer
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist seit 1. Oktober 2025 gesetzlich verpflichtend Der Bundesärztekammer-Präsident Dr. med. Klaus Reinhardt befürwortet ein lernendes Meldesystem mit direktem Feedback aus der Praxis und warnt vor Abrechnungsausschlüssen bei fehlenden Zulassungen.
Die elektronische Patientenakte wurde mit dem 1. Oktober 2025 verpflichtend für alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen eingeführt Bundesärztekammer-
Präsident Dr Klaus Reinhardt sieht darin Chancen für Patientensicherheit und Behandlungsqualität In der Praxis birgt die Umsetzung jedoch große Herausforderungen.
„Die ePA bietet die große Chance, die Patientensicherheit zu stärken und die Behandlungsqualität weiter zu verbessern“, erklärt Reinhardt. Der Nutzen hänge jedoch

Seit Anfang Oktober Pflicht: die elektronische Patientenakte.
davon ab, dass die Akte vollständig und aktuell gehalten wird. Mit jedem Eintrag steige ihr Wert, da sich Behandlungen besser koordinieren, Risiken schneller erkennen und Doppeluntersuchungen vermeiden ließen. Besonders kritisch sieht die Bundesärztekammer die Situation in den Krankenhäusern. Die Umstellung der komplexen Softwaresysteme sei dort deutlich aufwendiger als in den Praxen. Viele Häuser würden die ePA zum Starttermin voraussichtlich noch nicht einsetzen können. Dies könne die flächendeckende Nutzung erheblich beeinträchtigen. Reinhardt fordert die Entwicklung eines unkomplizierten Meldesystems Ärzte sollen direkt aus ihrem Behandlungsalltag Feedback an die Hersteller von Praxisverwaltungssystemen und Krankenhausinformationssystemen geben können. „Auf diese Weise kann sich die ePA zu einem lernenden System entwickeln, das sich stetig verbessert und an die Bedürfnisse der Praxis anpasst“, so der Präsident. Ein weiteres Problem liegt Ärztinnen und Ärzten zufolge in der lückenhaften Patienteninformation
H offotografen

zur ePA. Der komplizierte Registrierungsprozess verschärft die Situation zusätzlich. Derzeit hat nur jeder 20. Versicherte Zugriff auf seine eigene ePA Die Krankenkassen seien aufgefordert, ihre Versicherten kontinuierlich und zielgruppengerecht zu informieren und zu unterstützen.
Besondere Relevanz entwickelt das Thema der noch ausstehenden Zulassungen, denn ab Januar 2026 dürfen Klkiniken, Arzthäuser und Praxen nur noch ePA-kompatible Systeme nutzen Einige kleine Anbieter konnten einen entsprechenden Nachweis bislang noch nicht erbringen. Reinhardt warnt: „Es wäre völlig absurd, wenn Ärztinnen und Ärzte wegen technischer Versäumnisse ihrer Softwareanbieter ihre Versorgungstätigkeit aufgeben müssten.“
Die Bundesärztekammer fordert daher Übergangsregelungen, die Praxen vor einem Abrechnungsausschluss schützen Ohne diese Regelungen droht ein erheblicher Einschnitt in die Versorgungslandschaft, insbesondere für kleinere Arztpraxen, die auf die Systeme kleinerer Anbieter setzen. aus
Wie schwer ist es, die Bundesländer auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen? Ihre Digitalstrategien unterscheiden sich zum Teil ja deutlich.
Schall: Das stimmt, aber im Digitalen ist es viel einfacher in der Ministerkonferenz als beispielsweise in der Sozialministerkonferenz, in der ich auch vertreten bin Denn da gibt es wirklich Haltungsunterschiede nach den verschiedenen Parteifarben In der Digitalisierung haben wir keine Haltungsunterschiede, denn wir wollen alle gut und schnell digitalisieren und Verwaltungsmodernisierung betreiben. Wir haben natürlich andere Ansätze, aber im Ziel sind wir geeint Und das ist wirklich ein großer Unterschied von den Digitalministern zu den anderen Ministerkonferenzen.
Geht es also weniger darum, in allen Punkten Einigkeit zu erzielen, sondern vielmehr darum, sich grundsätzlich zu
verständigenundeinegemeinsame strategische Richtung zu finden?
Schall: Wir gehen unterschiedliche Wege – die einen links, die anderen rechts, die einen sind schneller, die anderen sind langsamer. Aber das Ziel ist bei uns allen gleich und das eint uns Das ist wirklich ein großer Vorteil.
Welche politischen Entwicklungen begrüßen Sie denn besonders in der digitalen Welt?
Schall: Ich glaube, was jetzt wirklich wichtig ist, dass wir beim Thema Modernisierung noch einmal innehalten, alles zusammenführen und einen Schritt zurückgehen. In den vergangenen Jahren haben wir oft einzelne Systeme implementiert und dabei mit Maßnahmen begonnen, die eigentlich erst der zweite oder dritte Schritt gewesen wären. Jetzt stehen Themen wie die Registermodernisierung, die Vereinheitlichung von Verwaltungsverfahren und aktuell ganz
konkret das Once-Only-Prinzip („NOOTS“) im Fokus Ziel ist es, einheitliche, durchgängige Verfahren zu schaffen, die echte End-toEnd-Digitalisierung überhaupt erst möglich machen.
Bisher war das schlichtweg nicht möglich – unter anderem, weil es unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definitionen gab, auch im juristischen Bereich Jetzt befinden wir uns in einer Art Atempause: Wir gehen bewusst einen Schritt zurück, um danach zwei Schritte nach vorne machen zu können. Und genau diese Pause ist entscheidend, um die Grundlagen für echte, nachhaltige Digitalisierung zu legen.
Sie sind ja bereits seit über einem Jahr im Amt. Was fanden Sie in dieser Zeit eigentlich am spannendsten?
Schall: Ich finde die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Entwicklung sehr gut Gerade in der Anfangszeit – ich komme ja

Dörte Schall (2. v. r. ), Digitalministerin in Rheinland-Pfalz beim Bund-Länder-Panel auf der Smart Country Convention 2025.
selbst aus der Kommunalverwaltung – war es oft so, dass jedes Land eher für sich gearbeitet hat, ohne echte Kooperation. Inzwischen haben wir alle verstanden, dass wir Hand in Hand gehen müssen. Es ist ja auch so mühsam, wenn alle an den gleichen Themen arbeiten Wir müssen diese gemeinsam bearbeiten – das funktioniert inzwischen viel besser. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir das auch weiterhin zielsicher hinbekommen. Das Interview führte Serina Sonsalla
Platin-Award für beste E-Akte 2025
Mit rund 40.000 Anwendern in über 1.400 Kommunen ist regisafe eine der beliebtesten und am häufigsten eingesetzten E-Akten im kommunalen Umfeld. Die Lösung wurde speziell für kommunale Strukturen entwickelt und bietet eine Vielzahl an Modulen, die sich flexibel kombinieren und an lokale Anforderungen anpassen lassen.
Der 360°-Ansatz
regisafe versteht sich längst nicht mehr nur als E-Akte, sondern als Plattform für die gesamte digitale Verwaltung Der sogenannte
360°-Ansatz beschreibt das Zusammenwirken von vier zentralen Komponenten:
1. DMS & Fachverfahren
2. E-Akte
3. Prozessautomation
4. Künstliche Intelligenz (KI) Gemeinsam bilden sie den vollständigen Lebenszyklus eines Dokuments ab – von der Erfassung über die Bearbeitung bis hin zur Ablage und Weiterverarbeitung.
DMS & Fachverfahren –das Fundament
Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) bildet die technische Basis des regisafe-Ansatzes. Es sorgt für strukturierte Ablagen,
einheitliche Versionierung und klare Zuständigkeiten. Dabei werden alle Dokumente zentral gespeichert, nach kommunalen Aktenplänen geordnet und nahtlos mit vorhandenen Fachverfahren verknüpft Durch die revisionssichere Speicherung erfüllt das System die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Integrität und Aufbewahrungspflichten.
E-Akte
Die E-Akte überführt das kommunale Aktenprinzip vollständig in den digitalen Raum Jede Akte enthält alle relevanten Dokumente, Notizen und Vorgangsinformationen in strukturierter Form. Durch klare Rechtekonzepte und Protokollierung bleibt die Bearbeitung jederzeit nachvollziehbar Der Zugriff erfolgt über eine intuitive Oberfläche sowie auch mobil über die regisafe-App.
Prozessautomation: regisafe-Workflow strukturiert Abläufe
Ein zunehmendes Herzstück von regisafe ist die integrierte Workflow-Komponente, die Verwaltungsprozesse automatisiert steuert. Abläufe wie Genehmigungen,
Umläufe oder Fristen können über vordefinierte Prozesse abgebildet oder individuell angepasst werden. Dabei lassen sich Dokumente automatisch zuordnen, Aufgaben verteilen und Fristen überwachen. Für Anwender bedeutet das weniger manuelle Arbeitsschritte, klar definierte Zuständigkeiten und

Mehr als E-Akte
Die Öffentliche Verwaltung steht unter wachsendem Druck: steigende Aufgaben, begrenzte personelle Ressourcen und hohe Erwartungen an Effizienz und digitale Souveränität
Die Einführung der E-Akte war ein wichtiger Schritt – sie ist heute in vielen Behörden Standard Doch die eigentliche Transformation beginnt jetzt: Prozesse müssen automatisiert, Medienbrüche beseitigt und Mitarbeitende gezielt entlastet werden Die digitale Aktenführung ermöglicht ortsunabhängiges Arbeiten, transparente Vorgänge und medienbruchfreie Kommunikation Doch angesichts der strukturellen Herausforderungen reicht das nicht mehr aus Der nächste Schritt ist die intelligente Automatisierung von Verwaltungsprozessen – und genau hier setzt die PDV GmbH mit ihren Lösungen an.
Von der E-Akte zur digitalen Prozessintelligenz
Mit VIS-NoCode bietet PDV eine Lösung, mit der Verwaltungen
eine deutliche Entlastung im Arbeitsalltag - nicht zuletzt auch durch KI-Unterstützung.
KI unterstützt bei Entscheidungen
Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz unterstützt regisafe Verwaltungen dabei, Nachrichten und Informationen schneller zu erfassen und gezielt nutzbar zu machen. Beispielsweise erkennt der Posteingangsassistent eingehende Dokumente, ordnet sie den richtigen Akten zu und schlägt Kategorien oder Zuständigkeiten vor. Die Entscheidung bleibt dabei stets beim Menschen. Die KI liefert Vorschläge, keine verbindlichen Zuordnungen.
Diese Form der intelligenten Unterstützung entlastet Mitarbeitende von Routineaufgaben und trägt dazu bei, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und die Qualität der Abläufe zu erhöhen.
Anwenderzufriedenheit als Maßstab
Der Platin-Award für die beste EAkte 2025 zeigt, dass regisafe in der kommunalen Praxis überzeugt – nicht durch einzelne Funktionen, sondern als starkes Gesamtpaket mit modernsten, praxisnahen Funktionen Die Kombination aus DMS, E-Akte, Workflow und KI bildet ein geschlossenes System, das die Anforderungen moderner Verwaltungen in allen Bereichen abdeckt.
Dokumente werden effizient erfasst, klassifiziert und medienbruchfrei in die E-Akte überführt. In Kombination mit VIS-NoCode lassen sich daraus automatisierte Workflows gestalten – etwa zur Vorgangseröffnung, Weiterleitung oder Archivierung. Diese Verbindung zeigt eindrucksvoll, wie Digitalisierung und Automatisierung Hand in Hand gehen können Ein aktueller Webcast am 12. November 2025 von 11 bis 12 UhrwidmetsichgenaudieserKombination: „VIS-Scan trifft VIS-NoCode“ Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider und Anwender, die ih-

ihre Prozesse eigenständig modellieren und automatisieren können – ganz ohne Programmierkenntnisse Das spart Zeit, reduziert externe Abhängigkeiten und erhöht die Anpassungsfähigkeit
Gerade in föderalen Strukturen ist diese Flexibilität ein entscheidender Vorteil. VIS-Scan ergänzt diesen Ansatz als leistungsstarke Scanlösung für die digitale Eingangsbearbeitung
re E-Akte-Lösung sinnvoll erweitern und echte Effizienzgewinne erzielen möchten Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen finden Sie unter pdv.de/veranstaltungen.
Digitale Verwaltung braucht Erfahrung und Innovation
Seit 35 Jahren ist PDV ein verlässlicher Partner für die digitale Transformation der Verwaltung. Mit der VIS-Suite bietet das Unternehmen eine skalierbare, modulare und rechtssichere Plattform, die sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren lässt – auch für Cloudmigrationen und nicht zuletzt KI-gestützte Assistenzsysteme PDV begleitet öffentliche Einrichtungen ganzheitlich – von der Analyse über die Einführung bis zum Betrieb.
Mit intuitiven Oberflächen, rollenbasierten Benutzerkonzepten und umfassenden Schulungsangeboten sorgt PDV für hohe Nutzerakzeptanz und nachhaltige Projekterfolge. Die PDV-Akademie, E-Learning-Kurse und Arbeitsplatzbetreuung machen Anwender fit für die digitale Zukunft. Die digitale Aktenführung ist in der öffentlichen Verwaltung weitgehend etabliert Um Verwaltungsarbeit effizienter zu gestalten, rückt zunehmend die Automatisierung von Prozessen in den Fokus
VIS-NoCode ermöglicht eine flexible Modellierung solcher Abläufe, VIS-Scan unterstützt als digitaler Eingangskanal. In Kombination lassen sich medienbruchfreie Prozesse realisieren, die Mitarbeitende entlasten und die Bearbeitung effizient beschleunigen.
Dokumentenmanagement-System (DMS)
Die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) ist komplex und erfordert vom Projektteam einen umfassenden Überblick Zudem müssen von Beginn an die Themen Change-Management und Projektkommunikation aufgegriffen werden.

Bei der Einführung einer DMS-Lösung ist auch der gesamte Change-Prozess von allen Projektbeteiligten zu beachten.
Die Einführung einer DMS-Lösung geht an manchen Stellen über die Komplexität anderer IT-Projekte hinaus Das Projekt erfordert ein gutes Verständnis der heutigen und zukünftigen Arbeitsabläufe und Ablagestrukturen bei den Anwendern, den IT-Rahmenbedingungen (Integration in Infrastruktur und Fachverfahren) sowie den regulatorischen Anforderungen.
Ebenso wichtig ist aber auch die Berücksichtigung der Bereitschaft (oder dem Mangel an solcher) der Anwender zur Umstellung ihrer gewohnten Arbeitsweisen, Berechtigungen und Zuständigkeiten (Stichwort: Change-Management) Die Projektleitung bzw das Projektteam muss daher die Fähigkeit besitzen, ein solches Projekt mit unterschiedlichen Teilprojekten und personellen Ressourcen zu managen (klassisches Projektmanagement).
Umkonkreterzuveranschaulichen, welche Aufgaben auf das Projektteam zukommen, nachfolgend einige Bespiele:
W Analyse bestehender Ablagestrukturen (Papier, Gruppenlaufwerk etc.) und Erarbeitung neuer, digitaler Ablage- und Ordnungssysteme für digitale Akten, Vorgänge, Dokumente und deren Meta-Daten. In öffentlichen Verwaltungen ist häufig auch das „Wiederbeleben“ eines Aktenplans mit der Sachakte als Ersatz für die bisher genutzten Papierordner und Gruppenlaufwerke sowie die Ergänzung der Ordnungssysteme in vorhandenen
Fachsystemen üblich. Wichtig:
Ein DMS ist kein Ersatz für das Gruppenlaufwerk. Eine tief gestaffelte Baumstruktur, wie sie oftmalsimGruppenlaufwerkvorzufinden ist, ist in einer DMSLösung praktisch nie notwendig und in der Regel auch nicht zu empfehlen.
W Entwicklung der Berechtigungssteuerung auf Dokumente, Akten und Metadaten unter Berücksichtigung zentraler Rechtesysteme (AD), und der fachlichfunktionalen oder regulatorisch definierten Berechtigungen der verschiedenen Bereiche
W Spezifische regulatorische Anforderungen, insbesondere: Pflichten zur revisionssicheren Aufbewahrung von Unterlagen, Pflichten zur zeitgerechten Datenlöschung gemäß DSGVO, dauerhafte Aufbewahrung oder
Vernichtung von Originalen (Stichwort: ersetzendes oder kopierendes Scannen, Hybridakte).
W Technischer Aufbau des DMS (u a. Client, Server, Office/MailIntegrationen, mobiler Zugriff auf elektronische Akten und Dokumente).
W Aufbau der Entwicklungs- und Testumgebung sowie Einrichtung von Transportsystemen für das Staging Entwicklung -> Test -> Produktion und die für die Entwicklungs- und Testphase notwendigen Werkzeuge wie Testscripte, Ticketsysteme, definierte Abnahmekriterien etc
W Integration der DMS-Lösung in Drittsysteme (in zum Beispiel vorhandene Fachsysteme in den Fachbereichen) für die verschiedenen Integrationsanforderungen.

Abbildung 1: DMS-Komponenten und Aufgaben werden mit den Anforderungen aus der Organisation zusammengefasst.
W Ablösung papierhafter Umlaufmappen durch elektronische Umlaufmappen.
W Arbeitsoptimierung mit elektronischen, regelbasierten Workflows (zum Beispiel elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung etc.).
W Anbindung moderner Dokumenteneingangs- und -ausgangswege für elektronische Unterlagen wie zum Beispiel Portalanwendungen, beBPo etc.
W Berücksichtigung neuer, verpflichtender Formate XRechnung, ZUGFeRD für Erfassung, Bearbeitung/Viewing und Ablage.
W Gestaltung der Übernahmeprozesse von Daten aus Altsystemen oder Dateilaufwerken.
W Beteiligung weiterer Organisationseinheiten (Fachbereiche, Personalrat, Rechtsstelle etc.) am Projekt zur Klärung von Fachfragen.
W Steuerung der Integrationspartner (vor allem DMS-Anbieter und Fachverfahrensanbieter, gegebenenfalls Scan-Dienstleister).
W Projektcontrolling, Projektsteuerung (zum Beispiel Vertragsüberwachung, Projektplanungen, Abstimmungen mit dem DMS-Lieferanten und bei Integrationen in Fachsysteme auch mit dem Fachverfahrensanbieter).
W Mögliche Dokumentationspflichten (Stichwort: GoBD-, TRRESISCAN-Verfahrensdokumentation).
Speziell für die öffentliche Verwaltung kommen hinzu:
W Anforderungen an die Barrierefreiheit,
W Anforderungen an die Post- bzw Scanstelle (in der öffentlichen Verwaltung: zum Beispiel TR03138 / RESISCAN und deren Prüfkriterien für unterschiedliche Schutzklassen),
W Elektronische Signaturen und die Konsequenzen aus der BSI TR-03125 (TR-ESOR zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dateien),
W Anforderungen aus der Nutzung besonderer elektronischer Behördenpostfächer wie beBPo, eBO und weitere,
W Neu-Nutzung standardisierter Austauschformate wie xRechnung, xJustiz, xBau etc.
W Manchmal notwendig: Entwicklung von Akten-/Teilakten-Plänen für Sachakten und deren Abgrenzung zu Fallakten.
Abbildung 1 (siehe unten) fasst die DMS-Komponenten und die Aufgaben zum Verbinden der techni-
schen Komponenten mit den Anforderungen aus der Organisation zusammen.
DMS-Kernteam und Projektleitung
Das DMS-Kernteam ist der Drehund Angelpunkt eines DMS-Projekts und sollte unterschiedliche Talente aufweisen, wie zum Beispiel
W über IT-Know-how verfügen und aufgeschlossen sein gegenüber neuen Technologien.
W Verständnis über jetzige und Konzeptionskompetenz für zukünftige elektronische Prozesse haben.
W neue Ordnungssysteme und Ablagesysteme erarbeiten und den betroffenen Fachbereichen diese auch vermitteln können.
W konzeptionelle Arbeiten übernehmen können (Fachkonzepte erarbeiten, abstimmen, umsetzen etc.).
W „Alte Zöpfe abschneiden“ können, also Entscheidungsbefugnisse besitzen.
Ein Beispiel soll zeigen, wie die typische Organisation eines DMSProjektteams aussehen kann (siehe Abbildung 2).
Tipp Nr. 1: Suchen Sie in Ihrer Organisation diejenige Person für die Projektleitung aus, die in der Lage ist, die oben genannten Aufgaben zu verstehen, zu identifizieren und zu lösen Aufgrund der gegebenenfalls hohen Komplexität, Spezialisierung und gleichzeitig Breite der Aufgabenstellung ist Erfahrung mit vergleichbaren Projekten vorteilhaft; diese kann auch über externe Expertise hinzugezogen werden.
Tipp Nr. 2: Stellen Sie sich als Projektleitung ein entscheidungsbefugtes DMS-Kernteam mit Vertretern aus unterschiedlichen Fachbereichen, IT, Post-/Scanstelle, Personalrat, Rechtsabteilung etc. zusammen. Die IT sollte über den gesamten Projektverlauf im Kernteam vertreten sein. Eine Inhouse-DMS-Lösung sollte von diesen Personen selbst betrieben werden können, um späteren Dienstleistungsaufwand beim DMS-Lieferanten zu minimieren. Identifizieren Sie anhand der Aufgabenliste, über welches Knowhow die am Projekt beteiligten Personen verfügen müssen. Suchen Sie sich die Key-User aus den Fachbereichen, die wissen, wie die Geschäftsprozesse ablaufen, Entscheidungskompetenz besitzen und IT-affin sind.

Abbildung 2 zeigt, wie die typische Organisation eines DMSProjektteams aussehen kann.
Bei der Implementierung einer DMS-Lösung kommen auf die IT besondere Aufgaben zu:
W Installation aller DMS-Module (Server, Client, Scan-Anwendungen, periphere Systeme wie Stapelimporter etc.),
W Integrationen der DMS-Benutzerverwaltung in die zentralen Rechtesysteme (AD u. a.),
W Einrichten der im DMS-Umfeld häufig komplexen, Attribut-basierten Berechtigungssteuerung für Dokumente, Akten und Vorgänge,
W Anbindung spezieller Speichersysteme,
W Integrationen in die Office- und E-Mail-Programme,
W Integrationen in ERP- und Fachsysteme,
W Erstellen bzw. Konfigurieren der neuen Ordnungssysteme (Metadaten für Akten, Dokumente und Vorgänge, inkl Aktenstrukturen, Sachakte/Fallakte etc.),
W Zugänge für gegebenenfalls mobile oder Remote-Arbeitsplätze schaffen,
W Technische Administration und ÜberprüfungdesSystemzustands,
W Performanceoptimierungen,
W Importe von Daten/Dokumentenbeständen,
W Backup und Restore (ggf auch Ausfallszenario simulieren).
Tipp Nr. 3: Vereinbaren Sie zum Projektstart die personellen Zuständigkeiten für die Projektaufgaben gemäß der oben angegebenen Anforderungen und teilen Sie diese Aufgaben den entsprechenden Team-Mitgliedern zu. Auch der DMS-Anbieter und bei Integrationen in Fachsysteme der Fachsystemanbieter sind hierbei zu berücksichtigen.
Tipp Nr 4: Eine DMS-Lösung besteht in der Regel aus einer Vielzahl von technischen Modulen Es ist darauf zu achten, dass auch alle bestellten Module installiert wurden. Fordern Sie daher vom Lieferanten ein Protokoll über alle installierten Module mit deren Versionsnummer, und zwar für alle bestellten Systeminstanzen, also zum Beispiel das Produktions-, Test- und Entwicklungssystem.
Tests
Auch Tests in einem DMS-Projekt sind gegenüber anderen IT-Projekten teilweise anders geartet. Nachfolgend eine nur beispielhafte Liste von DMS-Testaufgaben:
W Bereitstellen von Testdokumenten unterschiedlicher Formate.
W Bei hochvolumigen AnwendungensolltenTestdokumenteinausreichender Menge zur Verfügung stehen Klärung, ob diese Testdokumente anonymisiert werden müssen oder nicht.
W Durchführen von Tests in der Erfassungsstelle bezüglich Auslesen von Daten (zum Beispiel bei der Rechnungserkennung) – „Anlernen“ der Erkennungslösung.
W Überprüfen der Ordnungssysteme/Ablagestrukturen inklusive Metadaten.
W Dokumentenablage und Rechercheszenarien.
W Test der Berechtigungssteuerung für die verschiedenen Rollen und in arbeitsteiligen Workflows.
W Test der neuen elektronischen Prozessabläufe (Workflows), ob sie funktional und technisch fehlerfrei sind und – noch wichtiger – ob End-User damit klarkommen.
W Integrationen in Drittsysteme.
W Speziell im Verwaltungsbereich: selektive Aktenexporte/-importe, Auslagerungsszenarien.
Tipp Nr. 5: Klären Sie frühzeitig:
W Welche Testfälle sind durchzuführen?
W Aus welchen Mitgliedern besteht das Test-Team (interne Mitarbeiter und/oder externe Tester)?
W Woher kommt welches TicketSystem? Wird es intern oder extern bereitgestellt?
W Wer hält die Ordnung im TicketSystem und wer erinnert die Anbieter an die Fristen, damit alles reibungslos läuft?
W Was ist abnahmeverhindernd, was führt zu Verzögerungen bei Zahlungen und was wird akzeptiert, muss aber noch korrigiert werden? Wichtig ist auch, in welcher Frist diese Korrekturen erfolgen sollen.
Schulungen
beinhalten, sondern auch die neuen Arbeitsprozesse Je umfangreicher die „Standard-Lösung“ angepasst wurde, desto weniger sind Standard-Schulungen sinnvoll. Daher sollen diejenigen die Schulung durchführen, die in der Implementierungs- und Testphase mitgearbeitet haben Das können Mitarbeiter des Unternehmens sein oder Personen des Anbieters oder Externe. Bei der Schulung ist die fachliche Perspektive der End-User
Projektdokumentation
Die Dokumentation in einem DMSProjekt ist häufig umfangreich, daher sollten folgende Dokumentationen immer Bestandteil in einem DMS-Umsetzungsprojekt sein, wie zum Beispiel:
W System-Handbücher:Erfassungssoftware, Client-Anwendung, Operating Handbücher (Betriebskonzepte), Administration/Konfiguration (Server, Client), Programmierhandbücher.
W Technische Dokumentation: Systemparameterwerte (Server, Client, Scan-Stationen/Arbeitsplätze), Datenbankkonfiguration.
se, Technologien oder Strukturen, erfolgreich einzuführen und dabei die Mitarbeitenden mitzunehmen Es geht also darum, den Wandel so zu gestalten, dass er reibungslos verläuft und die Organisation sowie die Mitarbeitenden davon profitieren.
Tipp Nr. 9: Binden Sie alle relevanten Stellen frühzeitig in das Projekt ein: Nutzerbereiche, Orga, Recht & Compliance, die IT, die Führungsebene: Ziel ist es, eine gute Zusammenarbeit zu fördern, Konflikte zu vermeiden und die Unterstützung der Stakeholder, also diejenigen, die von den Entscheidungen und Aktivitäten eines Unternehmens betroffen sind oder diese beeinflussen können, für das

Eine DMS-Lösung besteht in der Regel aus einer Vielzahl von technischen Modulen.
Benutzergruppe Schulungsaufgaben (beispielhaft)
End-Anwender
W Bedienung der Standard-Softwarekomponenten
W Bedienung der Anwendung
W Zusammenspiel zwischen DMS, E-Mail und klassischer Dateiverwaltung
W Prozess- und Organisationsänderungen durch DMS-Anwendung
W Erlernen der Abläufe (Scanvorbereitung, -durchführung, Umgang mit gescannten Unterlagen)
Personen in der Scan-/ Erfassungsstelle
Systemverwaltung / Administration
W Bedienung der Scan-Anwendung und der Prüfund Korrekturwerkzeuge
W Technik (Scanner/Einstellungen/ Präventivmaßnahmen)
W Scan-Software Konfiguration
W Getrennte Aufgaben für Fachadmins und Systemadmins
W Pflegen von Auswahllisten, Berechtigungen, Einspielen neuer Transportpakete und Releases
W Überwachung des Systembetriebs
W Definition und Implementierung der First-, Second- und Third-Level-Support-Prozesse
W Behandlung von Fehlermeldungen
W Präventivmaßnahmen
Schulungen sollen sicherstellen, dass alle Nutzer das neue System akzeptieren und für die tägliche Arbeit intuitiv nutzen können.
DMS-Lösungen haben im Vergleich zu anderen IT-Lösungen wie MS Office oder Gruppenlaufwerk eine komplett andere Benutzerführung Die vielleicht vorhandenen Erfahrungen in anderen Bereichen mit dem gleichen DMS hilft nur begrenzt, da Aktenstrukturen, Workflows, etc. häufig bereichsspezifisch gestaltet sind Daher ist bei DMS-Projekten ein entsprechender Schulungsaufwand für unterschiedliche Benutzergruppen zu berücksichtigen (siehe Tabelle).
Tipp Nr 6: Prüfen Sie, ob die Schulungen des DMS-Lösungsanbieters nicht nur die Bedienfunktionen der Anwendungsoberfläche
unverzichtbar, da nicht nur ein Stück Software geschult wird, sondern auch immer neue Abläufe der Arbeitsprozesse Tipp Nr. 7: Bei der Durchführung von Schulungen bietet sich heute eine Palette von Möglichkeiten Klassische Schulungen in einem Schulungsraum können heute gut durch Online-Schulungen ergänzt werden E-Learning Plattformen und natürlich auch Arbeitsanweisungen, die bereits in der Testphase durch das Testteam erstellt werden können, sind weitere Hilfsmittel, um das Schulungsangebot zu ergänzen. Starke Empfehlung: Erstellen Sie How-To-Videos, die von jedem User punktuell abgerufen werden können, statt aufwendige Schulungshandbücher, die niemand liest
W Anwendungsdokumentation: Feinkonzepte, Bedienungshandbücher, Arbeitsanweisungen/ Dienstanweisungen.
Tipp Nr. 8: Überlegen Sie sich, wer im Projektteam Dokumentationsaufgaben übernehmen soll bzw. was bereits Lieferverpflichtung des Anbieters ist Auch ist festzulegen, wer für welche Dokumentationen zuständig ist, zum Beispiel der DMS-Lösungsanbieter, die IT, der Fachbereich für Anwenderdokumentation etc. Greifen Sie auf gegebenenfalls vorhandene Unterlagen bzw. Vorlagen zurück (zum Beispiel über die externe Expertise), um das Rad nicht neu zu erfinden.
Change-Management und Projektkommunikation
Die Einführung einer DMS-Lösung tangiert viele Aspekte, aber auch Ängste bei den Betroffenen, unter anderem:
W Entwertung des bisher personengebundenen Know-hows, W Angst, dass das eigene Know-how ersetzbar wird, W Gefährdung der bisherigen Ressourcenallokation bzw Verlust von Rückgriffen auf altbekannte Informationsquellen, W Gruppenträgheit, Trägheit der Organisation, W Gefährdung vorhandener Hierarchien (Zuständigkeiten, Stellung, Einfluss etc.).
Bei der Einführung einer DMSLösung bezieht sich das ChangeManagement auf die systematische Planung und Umsetzung von Veränderungen innerhalb einer Organisation Ziel ist es, Veränderungen, wie zum Beispiel neue Prozes-
Projekt oder die Organisation zu sichern.
Tipp Nr. 10: Auch eine offene Kommunikation und die Einbindung der Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess sind entscheidend, um Akzeptanz zu schaffen und Widerstände abzubauen. Insbesondere sollte hier auch nach Abschluss eines Projekts mit den Fachbereichen gesprochen, also eine Art Projekt Review bzw. Erfahrungsaustausch durchgeführt werden, um in Folgeprojekten gegebenenfalls Fehler zu vermeiden oder um Dinge während der Projektumsetzung zu optimieren (Lessons Learned).
Bei der Einführung einer DMS-Lösung sind viele technische, funktionale und organisatorische Dinge, aber auch der gesamte ChangeProzess von allen Projektbeteiligten zu beachten. Der Einsatz externer Expertise kann dabei sehr hilfreich sein Sie erhöht die Projektqualität, transferiert PraxisKnow-how aus anderen DMS-Projekten an das Projektteam, unterstützt bei Identifizierung und Durchführung der relevanten Teilaufgaben, steuert externe Dienstleister, sichert die Einhaltung von Terminen und reduziert die Arbeitsbelastung für das interne Projektteam.

Digitale Verwaltungsprozesse
Egal ob Dokumentation, Archivierung oder Kommunikation: Digitalisierung macht das Papier in weiten Teilen obsolet.
Wo digital gearbeitet wird, braucht es weniger Papier. Wie weit die deutschen Unternehmen hierbei sind, hat der Bitkom untersucht. Die Ergebnisse dürften für digita-
lisierungsaffine Menschen ernüchternd sein: 32 Prozent der Firmen nutzen heute „deutlich weniger Papier“ als vor fünf Jahren, 40 Prozent nutzen immerhin „etwas we-
niger Papier“. Und knapp die Hälfte aller Befragten versteht sich selbst als „Nachzügler“ bei der Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen. Ein Pro-

Die Hälfte der Unternehmen bewertet sich hinsichtlich der Digitalisierung als „Nachzügler“.
„Allein in Hamburg werden pro Jahr 300.000 Formblätter für Anträge gedruckt“, so der PD-Berater Jeder Antrag – ob es um Krankheit, Freigang oder Besuch geht –wird in Papierform an einen Vollzugsmitarbeitenden übergeben
„Die Leute laufen den ganzen Tag mit irgendwelchen Papieren durch die Gegend Wenn diese Akte permanent und immer da wäre, dann ist das schon ein ungeheurer Zeitund Effizienzgewinn. Die gewonnene Zeit könnten die Bediensteten für anderen Aufgaben rund um die Gefangenenbetreuung nutzen“, erklärte Strathausen weiter.
Die Aktenführung
In Nordrhein-Westfalen verfolge man in den Anstalten zudem noch ein älteres Ablage- und Ordnungssystem, das Informationen in der GPA in eine „Drei-Nadel-Struktur“ gliedert Die Aktenführung wird in Stammdaten beziehungsweise persönliche Daten, in gerichtliche Unterlagen – dazu zählen Urteile, Strafbefehle, Anklageschriften, usw. – und in vollzugsbezogene Informationen rund um den Gefangenen unterteilt, wie z. B
Disziplinarmaßnahmen, Arbeitseinsätze, Besuchsprotokolle, Anträge und Beschwerden. Birx betonte diesbezüglich, dass an eben jener Struktur noch gearbeitet werden müsse und die eGPA dazu dienen solle, Prozesse zu vereinfachen „Wenn wir natürlich eine elektronischeGefangenenpersonalakte haben, wäre es ja sinnvoll, die Dokumente unmittelbar auffindbar zu machen – zur Sachfrage, Problemlösung oder Strafzeitverlängerung“, ergänzte PD-Berater Strathausen. Denn aktuell sieht der Alltag im Justizvollzug für viele Mitarbeitende noch so aus: „Die Gefangenenpersonalakten lagern in irgendwelchen Räumen. Die Sachbearbeitenden müssen zu einem bestimmten Fall die entsprechende Akte holen. Anschließend müssen sie in allen drei Bereichen nach den Informationen und Dokumenten suchen, die für die Bearbeitung des Falls erforderlich sind – da heißt es zunächst einmal: blättern.“
In Nordrhein-Westfalen, aber auch in Hamburg, stellte man sich deshalb die Frage: „Wie digitalisiert man eigentlich einen Haftraum?“ Für die Beantwortung dieser Frage
zent gibt sogar an, den Anschluss bei der Digitalisierung verpasst zu haben. „Deutsche Unternehmen müssen die Digitalisierung jetzt konsequent vorantreiben, von der Planung in die Umsetzung übergehen und in digitale Kompetenzen und Infrastruktur investieren – nur so sichern sie ihre Zukunftsfähigkeit”, mahnt Dr Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom. Dennoch: Die Zahl der Aktenordner nimmt eher ab Über die Hälfte der Unternehmen hat heute weniger Aktenordner in den Büros stehen als noch vor fünf Jahren, nur vier Prozent der Befragten haben mehr Ordner angeschafft, ein Prozent hat die Anzahl gar erhöht Wo genau stehen die noch vorhandenen Ordner? Bei 94 Prozent in der Personalabteilung, bei 90 Prozent in der Buchhaltung oder im Controlling Bei 82 Prozent stehen in der Geschäftsführung oder dem Management Aktenordner im Schrank. Deutlich weniger – 69 bzw. 65 Prozent – in Kundenservice/Vertrieb und Logistik. Die Vorteile digitaler Prozesse indes sind den Unternehmen wohlbekannt Dies zeigt sich auch in der Umfrage: 94 Prozent möchten nachhaltiger werden, 92 Prozent wollen Kosten sparen, drei Viertel erhoffen sich effizienteres und transparenteres Arbeiten Auch Argumente wie Entlastung, Wettbewerbsfähigkeit oder Attraktivität als Arbeitgeber wurden genannt Ebenso wie der Zwang zum Wechsel: Acht von zehn Unternehmen

aber platzbedürftig.
gaben schlichtweg an, gesetzliche Vorgaben umzusetzen.
Ob die erhofften Potenziale digitalisierter Prozesse denn tatsächlich gehoben werden, steht auf einem anderen Blatt. Nur 58 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, ihr Management verfüge über die nötige Digitalkompetenz, um die Digitalisierung voranzutreiben.
Papier wird auch bei der Kommunikation langsam, aber sicher durch digitale Alternativen ersetzt. 39 Prozent der Unternehmen nutzen sehr häufig oder häufig Briefpost, beim Fax sind es noch 18 Prozent Elektronische Post hat sich durchgesetzt: 100 Prozent nutzen E-Mails. Nicht ganz so eindeutig ist es bei der Telefonie: 94 Prozent kommunizieren per Smartphone, aber nahezu gleichauf mit 93 Prozent auch noch per klassischem Festnetz Mitarbeiter- und Kundenportale werden immer beliebter: 53 Prozent gegenüber 47 Prozent im Jahr 2024 nutzen diese Form des Austauschs. su
schärfte Birx nochmal das Bild dafür, weshalb der Vollzug eigentlich für eine Veränderung ist und auf welche Herausforderungen sie dabei stoßen: „Hier braucht es sehr, sehr viel Prüfung und Erfahrung. Wir gehen hier mit einer Klientel um, da darf man sich keinen Fehler imGrobenerlauben Unddeswegen wird alles auf Herz und Nieren geprüft.“
JVA – kleine eigene Welten
Nicht alles, was in der Gerichtsbarkeit und in der Staatsanwaltschaft
entwickelt wird, sei deshalb eins zu eins auf den Vollzug übertragbar.„DassindkleineeigeneWelten. Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter müssen schnell reagieren können, da bei Ausbruch, Gefährdung, Geiselnahme etc. alles Mögliche passieren kann“, fügte Strathausen hinzu In gewisser Weise müssen sie selbstständig und autonom handeln „Und das hat dazu geführt, dass der Vollzug nicht nur zwischen den Bundesländern unterschiedlich ist, sondern auch in den einzelnen Haftanstalten.“Dazu gehören offener sowie geschlossener Vollzug, Untersuchungshaft, Frauen- und Männergefängnis „Wir wollen jetzt die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Justizvollzugsanstalten in einem Land und anschließend über die Länder herausfinden.“
Doch dafür brauche man Personal und Ressourcen, wandte Birx ein:
„In den letzten Jahren hat man sich

einfach strategisch ein bisschen stärker auf den elektronischen Rechtsverkehr konzentriert Jetzt sind wir dabei, die Dinge aufzubrechen, weil man erkannt hat, dass der Vollzug eben auch einen hohen Bedarf hat.“ Strathausen bestätigte ebenfalls, dass u. a Personalprobleme in den Justizvollzugsanstalten (JVA) dazu geführt haben, dass eine Digitalisierungsoffensive gestartet wurde: „Die Personalsituation ist auch eines der Elemente, die nun Druck erzeugen, und es wird ja mit dem demografischen Wandel nicht besser, sondern schlechter.“ Hildebrandt hat bei der Ende-zuEnde-Digitalisierung in Hamburg das gleiche Problem Hinzu kommen simple bauliche Bedingungen in der Anstalt und wirtschaftliche Faktoren: „Wir müssen Netzwerkinfrastruktur und Haftraummediensysteme etablieren, um im Haftraum mit der Digitalisierung zu beginnen, damit wir am Anfang und am Ende ein digitales Produkt haben, nämlich in der dann hoffentlich existierenden elektronischen Gefangenenpersonalakte“, sagte Hildebrandt.
„Im Moment sind da zu viele Baustellen für Nordrhein-Westfalen, weil das Tempo möglicherweise nicht ausgereicht hat. Diese Baustellen müssen wir trotzdem angehen Und das empfinde ich als Chance“, so Birx Denn man merke eine Veränderung und eine EinigkeitimDigitalisierungswillen.„Von daher glaube ich, dass jetzt ein guter Start ist.“ se
Strategische Investition in unsicheren Zeiten
Ein Reifegrad-Modell gibt der Transformation eine strategische Richtung. Wie das konkret aussieht, erläutert Arthur Mickoleit von Gartner anhand des „Digital Government Maturity Model 3.0“.

Deutschland erlebt 2025 einen digitalen Aufschwung: Zum ersten Mal gibt es ein eigenes Bundesministerium für Digitales – verbunden mit viel Enthusiasmus, aber auch mit hohen Erwartungen und Herausforderungen. Geopolitische Spannungen, Fragen digitaler Souveränität, eine Pensionierungswelle im öffentlichen Sektor, sinkendes Vertrauen in staatliche Institutionen und disruptive Technologien wie KI prägen das Umfeld Gerade jetzt entscheidet digitale Reife darüber, ob Verwaltung handlungsfähig und bürgernah bleibt
Dabei sind digitale Technologien längst kein Fortschrittsversprechen mehr – sie sind zur Voraussetzung für funktionierende Verwaltungen geworden In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Behörden zuerst punktuelle Online-Angebote und später dann strategisch gesteuerte Digitalisierungsinitiativen entwickelt. Der Fokus verschiebt sich: weg von technikgetriebenen Projekten, hin zu einer Verwaltung, die sichtbare Wirkung für Gesellschaft und Staat schafft
Digitalisierung weiter gedacht als Online-Angebote und Prozess-Effizienz
Eine aktuelle Studie von Gartner bezeichnet genau diese Reifeentwicklung als strategisch. Mit dem „Digital Government Maturity Model 3.0 (DGMM 3.0)“ liefert Gartner das Analyseinstrument, das Behörden-Entscheiderinnen jetzt brauchen, um Wirkung zu erzeugen – jenseits von technischer Exzellenz und Tool-Benchmarks.
Verwaltungen müssen digitale
Investitionen neu justieren Weg von Prozesseffizienz, hin zu einem strategischen Beitrag zur Erfüllung der staatlichen Erwartungen und Kernaufgaben Postdigitales Government ist dabei ein Schlüsselwort für Investitionen, deren Erfolg nicht an Ressourcen-Einsatz und Output-Metriken gemessen wird Sondern vielmehr an konkreten Wirkungen – von Bürokratieentlastung über Bürgernähe und -teilhabe bis hin zu Resilienz, Handlungsfähigkeit und digitaler Souveränität
Beispiele aus Europa zeigen, wie dieser Perspektivwechsel gelingen kann: Italien investiert mit IO, pagoPA und SPID seit Jahren in nationale Plattformen, die Bürgern den Zugang zu öffentlichen Leistungen erleichtern (Stichwort: digital public infrastructure) Frankreichs Fokus auf Verfügbarkeit von KI-Ressourcen und Daten für die Verwaltung hat bereits zahlreiche Innovationen hervorgebracht Und die Ukraine zeigt mit der sich ständig weiter entwickelnden Diia-Plattform, wie Technologieeinsatz selbst in Kriegszeiten Verwaltungsleistungen sichern kann.
Diese strategische Denkweise rückt das Wesentliche in den Mittelpunkt: Führungsverantwortung, Bürgernähe, kluge Datennutzung – und das Ziel, mit digitalen Mitteln echte Probleme zu lösen, nicht nur Prozesse zu verwalten.
Das Digital Government Maturity Model 3.0
Das DGMM 3.0 beschreibt fünf Reifegrade digitaler Verwaltungen – jeweils charakterisiert durch den
strategischen Fokus von Digitalisierung, die Führungsstruktur, die Gestaltung von Bürger-Services, die Nutzung von Daten und die Einbindung in digitale Ökosysteme:
Stufe 1:
Traditionelles E-Government „Digitalisierung“ dreht sich hier meistens um Compliance, soll heißen, das oberste Ziel ist die Einhaltung von Vorschriften und Vorgaben. Behörden erweitern ihr Online-Angebot entsprechend spärlich und konzentrieren sich auf interne Prozessverbesserungen. Der Nutzen für Bürgerinnen und Bürger bleibt begrenzt, Transformationswirkung entsteht nicht Führende Verwaltungen habe diese Phase vor 20 Jahren hinter sich gelassen.
Stufe 2:
Effiziente Verwaltung
Schrittweise Verbesserungen steigern die Effizienz einzelner Prozesse und Online-Dienste. Verwaltungsdaten werden zunehmend für Analysezwecke genutzt, aber meist isoliert innerhalb der Abteilung Nutzerperspektiven beim Design von Services werden langsam berücksichtigt – Thema Lebenslagen, ohne aber eine zentrale oder verbindliche Rolle zu spielen.
Stufe 3:
Bürgerorientierte Verwaltung
Hier wandert der Fokus merklich von verwaltungsinternen Abläufen hin zu den Bedürfnissen der Bürger, Unternehmen und anderen Stakeholdern Lebenslagen gewinnen an Bedeutung, und Daten werden proaktiv eingesetzt, um neue Serviceangebote zu gestalten und gesamte Leistungen zu automatisieren Technologie-Einsatz
gische Maßnahmen dient Für CIOs markiert das DGMM 3.0 einen Paradigmenwechsel: von der Infrastruktursteuerung hin zur strategischen Ausrichtung relevanter Akteure und Investitionen Die Rolle der Behörden-CIOs verändert sich und damit auch die Frage, ob Digitalisierung weiterhin Selbstzweck bleibt oder zur wirklichen Schwungmasse wird, zum Beispiel durch synergistische Nutzung von Daten und Plattformen.
Postdigitales Government ist kein technokratischer Endzustand, sondern ein Zielbild mit Governance und Strategie-Anforderungen. Es verlangt Agilität im Umgang mit Unsicherheit, einen konstruktiven Umgang mit Datennutzung und -ethik und eine klare Vorstellung davon, was Wirkung bedeutet und welche Akteure dafür mobilisiert werden müssen.
Gerade in Deutschland zeigt sich 2025, wie stark diese Faktoren wirken:
W Digitale Souveränität wird durch Abhängigkeit von Hyperscalern und Fehlen europäischer Kapazitäten infrage gestellt
W Demografie und Budgetdruck zwingen die Verwaltung dazu, Wissen, Kompetenz und Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern.
führt zu mehr Innovation, aber auch zu gesellschaftlichen Fragen über gewünschte und unerwünschte Auswirkungen.
Stufe 4: Vollständig digitale Verwaltung Daten werden strategisch genutzt für ganzheitliche, vernetzte Serviceangebote über Ressort- und Fachgrenzen hinweg Gemeinsame Plattformen und Synergien zwischen Behörden – aber auch mit Wirtschaft und Gesellschaft (Thema GovTech) – etablieren sich. Datenschutz, digitale Ethik und Resilienz der Verwaltung sind als Zielsetzungen stark in den Vordergrund gerückt.
Stufe 5: Postdigitale Verwaltung Digitalisierung ist voll internalisiert und im Verantwortungsbereich aller Führungsebenen, oft auch der politischen Entscheiderinnen. Initiativen und Investitionen richten sich an höherwertigen Missionszielen aus. Digitalisierung zielt auf messbare, gesellschaftliche Wirkung über Ressort- und Verwaltungsgrenzen hinweg
Die digitale Reife als Führungsaufgabe und -herausforderung
Gerade in großen Behörden kann es unterschiedliche Entwicklungsstände in der digitalen Reife geben – etwa zwischen IT-nahen Querschnittsbereichen und fachlichen Organisationseinheiten mit direktem Bürgerkontakt Umso wichtiger ist ein strukturierter Reifegrad-Check, der solche Unterschiede sichtbar macht und als Grundlage für gezielte strate-
W KI-Disruption verändert Arbeitsweisen rasant – von reifen KITechnologien über GenAI bis hin zu künftigen KI-Agenten erfahren Behörden die Auswirkungen auf Produktivität und Bürgernähe
Fazit: Der richtige Zeitpunkt für Reifebestimmung
Die Empfehlung ist klar: CIOs in deutschen Behörden sollten das Digital Government Maturity Assessment nutzen, um die aktuelle digitale Reife zu bestimmen – und anstehende Investitionen zukunftssicher zu machen
Das Online-Tool bietet dazu Handlungsoptionen, die ergänzt werden können mit Erkenntnissen und Empfehlungen zu:
W Nutzung reifer KI-Technologien für bessere Bürgerdienste Aber auch Erprobung neuerer KITechnologien in gesichertem Umfeld, z. B AI Sandboxes
W Einführung gemeinsamer Daten- und Technologie-Architekturen für Bürger, Verwaltung und Wirtschaft Thema Datenräume und EUDI-Wallets W Gestaltung souveräner Plattformen in Staat und Gesellschaft, so wie der angedachte Deutschland-Stack
Das Reifegrad-Modell gibt der Transformation Richtung und macht sie greifbar Das ist wichtig – denn wer den nächsten Reifeschritt seinen Stakeholdern gegenüber nicht klar beschreibt, wird ihn kaum erfolgreich umsetzen können Und riskiert damit, die Erwartungen an eine moderne, souveräne und bürgernahe Verwaltung zu verfehlen
Unbürokratisch denken. Digital handeln. Das E-PAPER zum Podcast
Wir zeigen erfolgreiche Digitalisierungsprojekte, die Bürokratie abbauen und Mut machen.
Präsentieren Sie Ihr Projekt als Best Practice!

Buchungsschluss: 1. Dezember 2025
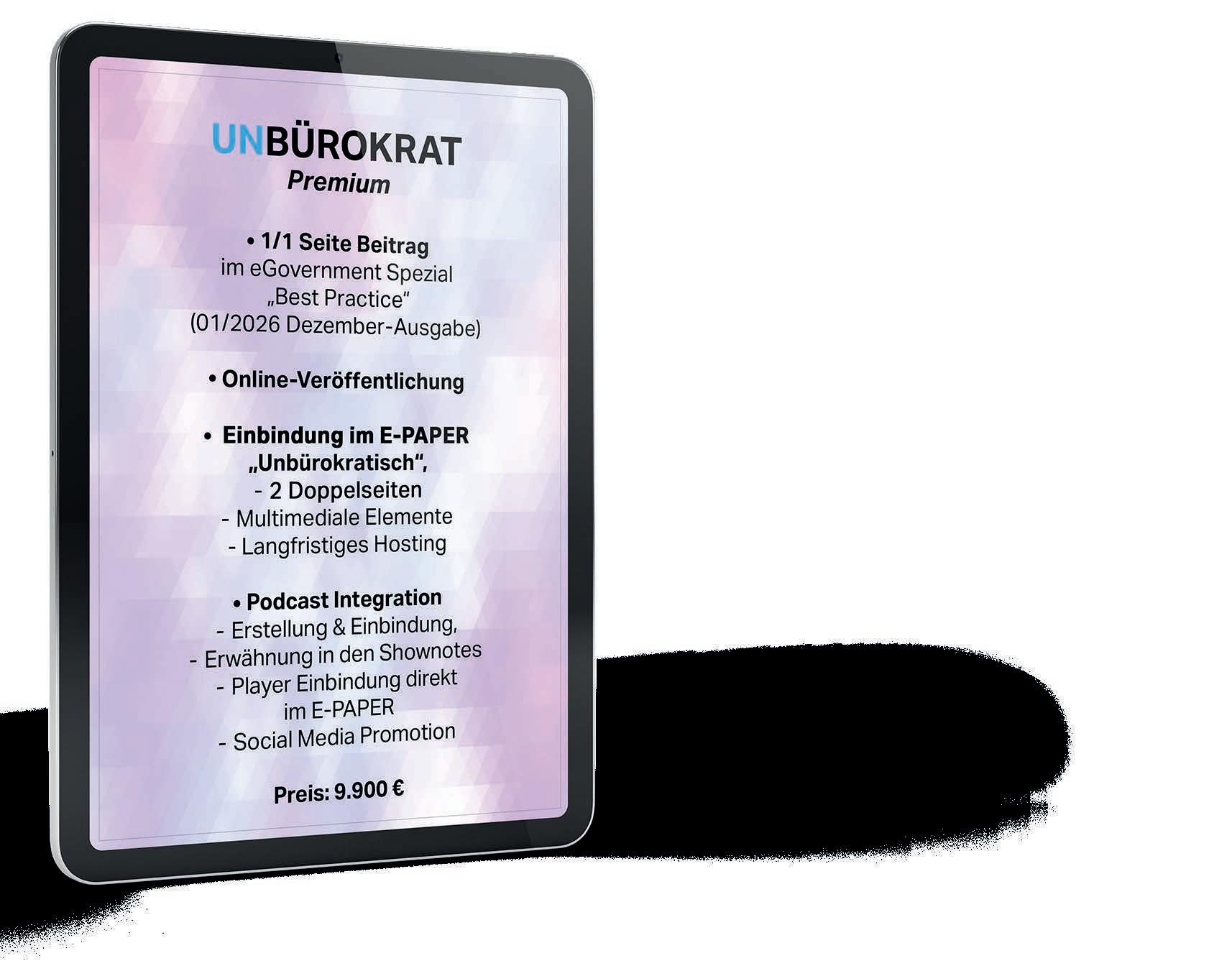
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ubürokrat, Modernisierer oder Mutmacher sein wollen unter:

MARKTÜBERSICHT




























MitelementsuiteundIoT:



Entdecken Sie element suite, die neue IoT-Komplettlösung von ZENNER! Sie verbindet die Fieldservice-Lösung element go zur Digitalisierung von Montageprozessen, die IoT-Plattform element iot – mit der Sie das Geräte-undAsset-Management,denLoRaWAN-Netzbetrieb, die Datenverarbeitung, die Prozessautomation, die Alarmerstellung und vieles mehr realisieren – sowie die neue Anwendung element apps, die Ihnen
www.zenner-iot.com









passende Applikationen bietet und die Möglichkeit, neue Applikationen selbst zu erstellen. Nutzen Sie mit element apps innovative, fertige Out-of-the-box-Applikationen wie ZENNER BuildingLink oder GridLink. Durch die Vernetzung aller Elemente bietet Ihnen element suite einen vollständig digitalen Ende-zu-Ende-Datenfluss von der Inbetriebnahme einzelnerSensorenbiszurfertigenApplikation.

Anbieter &Bezugsquellen
DerMarktplatz für‘sDirektgeschäft!
Anbieter&Bezugsquellen istdas optimale Umfeld für IhrePreis-und Produktanzeigen.
n offensiver Werbeauftritt n direkteAbverkaufssteigerung n hohe,qualifizierteReichweite n attraktiveKonditionen
Nähere Informationengibtunser Media-Team unter 0821/ 2177-212 /-182 /-213 oder dispo@vogel.de






Ausgestattetmit Intel N100 Prozessor (12. Generation,Alder Lake-N)
Dual-Display-Unterstützung: 1×HDMI2.0b, 1× DisplayPort1.4
Gigabit-Ethernet, Wi-Fi-fähig (M.2-Steckplatzmitvorinstallierten Antennen)
4× USB 3.2Gen 2(10 Gbit/s), 2× USB 2.0
Unterstützt bis zu 16 GBDDR4SO-DIMM





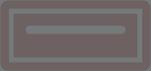
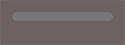




DerShuttleXPC nanoNE10N vereintmoderneRechenleistung auf minimalem Raum. Ausgestattet mit dem effizientenIntel-N100-Prozessorbietetdieseslüfterlose Mini-PC-BarebonedieperfektePlattform fürvielfältige BusinessAnwendungen –vondigitalen Anzeigelösungenbis hin zu Steuerungssystemen imindustriellen Umfeld.Trotz seines kompaktenVolumens vonnur600mlunterstütztderNE10Ndengleichzeitigen Betriebvon zwei UHD-Displays,stellt sechsUSB-Ports(darunter4×USB 3.2Gen 2mit 10 Gbit/s) bereit, bietet Gigabit-LAN sowieErweiterungsmöglichkeitenfür WLANüber einenM.2-Slot.Dankmitgelieferter VESA-Halterunglässtsichdas Systemplatzsparend montiere–idealfür den wartungsarmen24/7-Betrieb.
VielseitigkeitundLeistungentdecken: WWW.SHUTTLE.EU
1× M.2-2280(NVMe/SATA), 1× M.2-2230fürWLAN
Wand-/VESA-Halterungmitgeliefert
TIPP: IhrNE10N‒so individuell wieIhrProjekt!NutzenSieunseren Produktkonfiguratorundpassen SieIhrBareboneperfekt anIhreAnforderungenan. go.shuttle.eu/Dp5fU FANLESS HDMI2.0 NVMESSDOPERATIONUSB3.210GBIT VESAMOUNT
€149,–*

*EmpfohlenerHändlereinkaufspreisinEurobei offiziellenShuttleDistributoren. AbgebildetesZubehör nicht imLieferumfangenthalten.Änderungenvorbehalten.