CARITAS



Seite 6
Bosnien-Herzegowina Hoffnung und Halt für junge Geflüchtete
Seite 11

«Auch in der Schweiz schielt die Politik auf die Beiträge, die eigentlich für den Globalen Süden gedacht sind.»
Die Welt steht vor beispiellosen Herausforderungen. Gleichzeitig sehen wir mit grosser Sorge, wie von vielen Ländern die Budgets für Entwicklungszusammenarbeit gekürzt werden und immer mehr Milliarden in nationale und europäische Interessen fliessen. Diese Entscheidungen stehen im Widerspruch zu den Zielen einer gerechteren und sichereren Welt.
Eine Studie* von Alliance Sud zeigt die verheerenden Folgen der Zerschlagung von USAID, der Behörde der Vereinigten Staaten für Entwicklungszusammenarbeit. Deren weltweite Programme für Gesundheit, Bildung, Friedensförderung und humanitäre Hilfe wurden Anfang 2025 von einem Tag auf den anderen gestoppt. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund dieser Kürzungen bereits jetzt fast 80 Millionen Menschen keinen Zugang mehr zu Hilfsleistungen haben.
Auch in der Schweiz schielt die Politik auf die Beiträge, die eigentlich für den Globalen Süden gedacht sind. Diese Gelder werden betrachtet, als seien sie in einem Sparschwein, das man bei Bedarf zerschlagen kann.
Doch die Stabilität unserer Welt – und damit auch die Sicherheit und der Wohlstand in Europa – hängt auch davon ab, dass wir globale Herausforderungen gemeinsam angehen. Dazu gehört der Klimawandel und seine gravierenden Folgen für die Menschen. Wenn der Zugang zu grundlegenden Ressourcen wie sauberem Wasser und nachhaltiger Landwirtschaft fehlt, wird die Lebensgrundlage vieler Menschen bedroht. Dies führt unweigerlich zu Instabilität, die auch vor unseren Grenzen nicht Halt macht. Kurzfristiges Denken schafft langfristige Probleme.
Auch die Projekte von Caritas Schweiz sind von den massiven Kürzungen für die Entwicklungszusammenarbeit betroffen. Wir setzen alles daran, weiterhin grösstmögliche Hilfe zu leisten. Es führt aber kein Weg daran vorbei, neue Finanzquellen zu erschliessen. Gleichzeitig müssen wir national und international auf die Entscheidungsträger einwirken, die humanitären Errungenschaften nicht zu verspielen. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam für eine gerechtere Welt eintreten, in der Solidarität und Zusammenarbeit über nationalen Interessen stehen.
In diesem Sinne,
Peter Lack
Direktor Caritas Schweiz
* www.alliancesud.ch/de/die-auswirkungen-der-zerschlagung-von-usaid


Seite 6
Im Gorom-Camp im Südsudan leben heute über 10 000 Menschen –geplant wurde das Flüchtlingslager ursprünglich für 2500. Die Lebensbedingungen sind prekär: Es gibt zu wenig zu essen und Wasser, zudem ist es unsicher. Caritas Schweiz setzt sich für bessere Lebensbedingungen ein – etwa für Malik.
Caritas Schweiz unterstützt pflegende Angehörige mit Lohn und fachlicher Hilfe. Das Beispiel von Bernadette und Urs Baumeler zeigt auf, was das konkret bedeutet.
100 Tage nach dem Erdrutsch

Die Unterstützung nach einer so grossen Naturkatastrophe geschieht in verschiedenen Etappen. Ein Überblick über die Hilfsleistungen der Caritas.

Geflüchtete Jugendliche aus verschiedenen Asylunterkünften verbringen zusammen mit jungen Menschen aus der Schweiz ein Sommerlager.
Das Magazin von Caritas Schweiz erscheint sechsmal im Jahr. Herausgeberin ist Caritas Schweiz, Kommunikation und Fundraising, Adligenswilerstr. 15, Postfach, 6002 Luzern, E-Mail: info@caritas.ch, www.caritas.ch, Tel. +41 41 419 22 22
Redaktion: Livia Leykauf (ll); Vérène Morisod (vm); Tamara Bütler (tb); Daria Jenni (dj); Bernhard Leicht (bl); Fabrice Boulé (fb); Niels Jost (nj); Stefan Gribi (sg); Lena Baumann (lb)
Das Abonnement kostet fünf Franken pro Jahr und wird einmalig von Ihrer Spende abgezogen. Grafik: Regula Reufer, Urban Fischer Titelbild: Kenyi Moses Druckerei: Kyburz, Dielsdorf Papier: 100 % Recycling Spendenkonto: IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4 Nachhaltig produziert
Ihre Daten werden bei uns geschützt. Informationen zum Datenschutz der Caritas Schweiz finden Sie unter www.caritas.ch/datenschutz

Beschleunigte Asylverfahren werden oft als Lösung dargestellt, schaffen aber neue Probleme.
Viele vertriebene Menschen erleben auf ihrer Flucht Traumatisches. Darüber zu sprechen, fällt ihnen oft schwer. In der Schweiz steht ihnen ein Asylverfahren bevor, das unter hohem Zeitdruck abgewickelt wird. Dadurch bleibt ihr besonderer
Schutzbedarf, zum Beispiel infolge von sexueller Gewalt oder Folter, oft unerkannt. Asylverfahren dürfen nicht beliebig verkürzt werden – auch wenn die Politik dies oft als Wundermittel anpreist. Dies zeigt die Caritas in einem neuen Positionspapier auf. Der Beschleunigung sind gerade dann klare Grenzen gesetzt, wenn es um den Schutz von besonders verletzlichen Personen geht. Sie zu identifizieren, muss in der Schweiz höhere Priorität haben. In jedem Asylverfahren braucht es eine Vorprüfung auf Vulnerabilität. Zudem soll der heute untersagte Austausch zwischen medizinischem Personal und Rechtsschutz flächendeckend möglich werden. (sg)

Weitere Informationen: caritas.ch/asylverfahren
In Äthiopien dürfen seit letztem Jahr keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor eingeführt werden. «Als wir einen unserer Projektwagen ersetzen mussten, fiel die Wahl daher auf ein Elektrofahrzeug», erklärt Jens Steuernagel, Länderdirektor von Caritas Schweiz in Äthiopien. «Perfekt für eine Stadt, in der weit über drei Millionen Menschen leben, und es genügend Ladesäulen gibt», weiss Jens Steuer nagel. «Zudem ist es ein Beitrag für den Klimaschutz.»
Anders sieht es derzeit noch ausserhalb von Addis Abeba aus, dort, wo Caritas Schweiz verschiedene Projekte durchführt. Es gibt dort für die grossen

Entfernungen zwischen den Orten noch zu wenig Ladestationen. Ausserdem braucht es in der sehr bergigen Region Wagen mit Vierradantrieb. (fb)
SonntagsBlick | Hannes Boos | Israels geheimnisvolle Swiss-Connection | 18. 5. 2025 Die Krise im Gazastreifen spitzt sich zu. Auf Initiative der USA soll nun eine Genfer Stiftung die Verteilung von Hilfsgütern koordinieren –trotz heftiger internationaler Kritik. (…) Auch die Caritas Schweiz – über Partnerorganisationen in Gaza tätig –sieht den Plan der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) (…) äusserst kritisch. Es widerspreche «grundlegenden Prinzipien der humanitären Hilfe wie Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, dass eine involvierte Kriegspartei bestimmt, wer Hilfe leisten darf und wer nicht». Durch eine «Politisierung der Hilfe» fehle die Garantie, dass alle jene Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Zudem befürchtet die Caritas, dass alte oder verletzte Menschen die Sicherheitszentren nicht erreichen können. Notwendig sei deshalb die sofortige Rückkehr zu bewährten Hilfskanälen, fordert das Hilfswerk gegenüber SonntagsBlick.
Luzerner Zeitung | Caritas mit neuem Projekt: Chatbot informiert über Hilfsangebote | 19. 6. 2025 Caritas Zentralschweiz lanciert mit «CaritasGo» einen Chatbot. Dieser zeigt Menschen mit finanziellen Sorgen, auf welche staatlichen Leistungen sie Anspruch haben könnten, und welche Beratungsangebote weiterhelfen. (…) «Viele Menschen fühlen sich überfordert, wenn sie Informationen zu Themen wie Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligung, Betreuungsgutscheinen oder Alimentenbevorschussung suchen», schreibt Caritas. Hier setze der Chatbot an. Bis anhin spreche dieser zehn Sprachen, weitere sollen folgen. (…) Aktuell befindet sich «CaritasGo» in der Beta-Phase und ist auf den Kanton Luzern beschränkt.

Die Lebensbedingungen im Gazastreifen sind höchst prekär.
Der Grossteil des Küstenstreifens liegt in Schutt und Asche. Zehntausende Kinder, Frauen und Männer sind bis heute umgekommen. Den Überlebenden sind Mangelernährung, Kriegstraumata und körperliche wie seelische Verletzungen ins Gesicht geschrieben. Caritas Schweiz und ihre Partner stehen der leidenden Bevölkerung im Gazastreifen zur Seite.
Ist, wenn dieser Artikel erscheint, ein Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas unterzeichnet oder der Krieg weiter eskaliert? Werden endlich wieder mehr Lastwagen in den Gazastreifen gelassen oder kommen noch weniger Hilfs-
Die Antworten von heute können morgen schon überholt sein – das Leid der Bevölkerung aber bleibt.
güter über die Grenze? Wer darf sie verteilen? Und werden die Verletzlichsten berücksichtigt?
Die Antworten von heute können morgen schon überholt sein. Das Leid der Bevölkerung aber wird nicht so schnell
enden. Wer diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die Vertreibung und den Hunger übersteht, ist für sein Leben gezeichnet.
Auch Caritas-Mitarbeitende müssen fliehen
Seit fast zwei Jahren beantwortet das israelische Militär mit aller Härte den Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023. Weit über 80 Prozent der Wohnhäuser, Spitäler, Strassen und die Stromversorgung wurden im Gazastreifen zerstört. Die hygienischen Verhältnisse sind erschütternd, es gibt kaum Trinkwasser, Benzin und Lebensmittel. Fast alle Familien haben Angehörige oder Freunde verloren.
Auch die Mitarbeitenden der Partnerorganisationen von Caritas Schweiz bleiben davon nicht verschont. Mindestens 20 von ihnen leben mit ihren Familien in Zelten, weil ihr Zuhause zerbombt wurde. Einige mussten bereits neunmal einen neuen Ort zum Leben suchen, weil die eigene Wohnung zu einer Ruine wurde oder ein Evakuierungsbefehl für den bisherigen Zufluchtsort erlassen wurde. Eine solche Anordnung zur sofortigen Räumung erhielt im Juli auch Caritas Jerusalem in Gaza Stadt. Grund: geplante Angriffe des israelischen Militärs auf die Region. Die bis dahin weitgehend sichere Nachbarschaft rund um die katholische Kirche und die christliche Schule, wo Hunderte Zuflucht gefunden hatten, war plötzlich Evakuierungszone. Doch wohin sollten die Menschen fliehen? Also blieben sie – mit fatalen Folgen. Am 17. Juli 2025 starben bei einem Angriff auf die Kirche drei Menschen, viele wurden verletzt. Dieser Anschlag auf eine religiöse Einrichtung verstösst gegen das humanitäre Völkerrecht.
Die Bedingungen ändern sich ständig Aufgrund der sich ständig verändernden Bedingungen passen die Caritas und ihre Partnerorganisationen ihre Hilfe regelmässig an. Derzeit ist die Auszahlung von kleineren Bargeldbeträgen das beste Mittel. Damit können die Menschen kaufen, was sie in dieser apokalyptischen Situation am dringendsten brauchen – oder zumindest das, was noch aufzutreiben ist. Die meisten nutzen das Geld für Transportkosten, Miete oder Kommunikationsmittel. Wenn das Telefonnetz funktioniert, ist das Handy oft die einzige Möglichkeit, mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben, die durch die Vertreibungen im ganzen Landstrich verstreut sind. Kleine Lichtblicke in sehr dunklen Zeiten. (ll)
Gorom-Camp, Südsudan
Text: Daria Jenni
Bilder: Kenyi Moses

Der fünfjährige Malik besucht das Kinderzentrum der Caritas im Lager Gorom. Am liebsten verbringt er seine Zeit mit Malen oder Fussballspielen.
«Die Flucht war zermürbend: Wir mussten lange Strecken ohne Pause zurücklegen», erzählt Nura der Caritas-Mitarbeiterin Jenifa Jopute im Gespräch.

Über eine Million Menschen sind vor dem Krieg im Sudan ins Nachbarland Südsudan geflohen – viele ins überfüllte Gorom-Flüchtlingslager. Die Bedingungen dort sind prekär. Doch kinder- und frauengerechte Räume sowie medizinische Hilfe geben Malik und Nura die Chance, anzukommen.
Die Sonne brennt auf das staubige Gelände des Gorom-Flüchtlingslagers. Nura sitzt mit ihrem Sohn Malik auf einem blauen Plastikteppich im Schatten eines improvisierten Bastzelts. Seit über zwei
« Die Inflation treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe. Was wir heute budgetieren, reicht morgen nicht mehr. »
Jahren sind die beiden nun im Südsudan, geflohen aus Al-Fashir im Sudan, nach einer tagelangen Reise durch zerstörte Dörfer und Checkpoints. «Die Flucht war zermürbend: Wir mussten lange Strecken ohne Pause zurücklegen», erzählt Nura.
«Wir brauchten danach eine lange Zeit, um wirklich hier anzukommen. Doch mittlerweile finden wir uns zurecht.»
Malik springt auf und rennt einem selbst gebastelten Fussball nach. Noch vor wenigen Monaten war das undenkbar: Kurz nach der Ankunft im Gorom-Lager litt der heute Fünfjährige an einer schweren Wundinfektion am Fuss. Solche und andere Krankheiten verbreiten sich rasch, denn die Lebensbedingungen im überfüllten Camp sind schlecht, Hygiene und sauberes Wasser rar. Nura suchte mit ihrem Sohn das Gesundheitszentrum im Camp auf. Dort wurde er behandelt und mit Medikamenten versorgt. «Es geht Malik endlich wieder besser, und damit auch mir», sagt Nura und lächelt.
Nothilfe für besonders Verletzliche Caritas Schweiz unterstützt Menschen wie Nura und Malik im Gorom-Flücht -
lingslager zusammen mit Caritas Juba, einer lokalen Partnerorganisation aus dem internationalen Caritas-Netzwerk. Die gemeinsamen Nothilfe-Projekte fokussieren sich auf die Bedürfnisse der besonders verletzlichen Bewohnerinnen und Bewohner: Frauen und Kinder. Zu Beginn leisteten die beiden Organisationen Bargeldhilfe und verteilten Lebensmittel. Heute schaffen sie Zugang zu medizinischer und psychosozialer Versorgung. Die Glückskette unterstützt diese Massnahmen. Im neusten Projekt liegt der Fokus auf dem Schutz von Opfern sexueller Gewalt: Sie erhalten medizinische und psychologische Hilfe. Zudem klären Kampagnen über geschlechterbasierte Gewalt auf – ein gravierendes Problem, das schon lange schwelt.
Eine Region, die nicht zur Ruhe kommt
Seit April 2023 tobt in Südsudans Nachbarland Sudan ein gewaltsamer Konflikt zwischen den sudanesischen Streitkräften und der paramilitärischen Gruppierung «Rapid Support Forces».
Malik und Nura wohnen seit über zwei Jahren in einem schlichten Zelt. Wasser müssen sie an einer öffentlichen Sammelstelle holen.



«Was als Machtkampf begann, hat sich zur grössten humanitären Krise Afrikas entwickelt. Sie verursacht enormes Leid und hat über elf Millionen Menschen zur Flucht gezwungen», erklärt Jenifa Jopute, Mitarbeiterin von Caritas Schweiz im Südsudan. «Mehr als eine Million von ihnen fanden hier Zuflucht.»
Doch das Land zählt selbst zu den ärmsten der Welt und kann den Schutzsuchenden kaum Stabilität bieten: 95 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Bereits vor der Eskalation im Sudan beherbergte der Südsudan Hunderttausende Geflüchtete aus Äthiopien, Uganda, Burundi oder dem Kongo. Jenifa Jopute koordiniert die Zusammenarbeit
oft unerfüllt. Viele lassen sich im GoromCamp nahe der Hauptstadt Juba nieder. Das Lager wurde ursprünglich für 2500 Geflüchtete aus Äthiopien errichtet. Heute leben hier viermal so viele Menschen aus Nachbarstaaten auf engstem Raum.
« Die Versorgungslage hat sich in den letzten zwei Jahren massiv verschärft. »
Die Versorgung ist eine tägliche Herausforderung, die Infrastruktur längst heillos überlastet. Viele Menschen wohnen in überfüllten Zelten oder selbst gebauten Hütten. Als die Mitarbeitenden von Caritas Schweiz und Caritas Juba das Gorom-Lager im Herbst 2023 zum ersten Mal besuchten, waren sie erschüttert: «Wir wussten, dass die Bedingungen schwierig sind. Aber was wir im Camp sahen und hörten, hat uns tief bewegt. Wir haben sofort angepackt – kurz darauf konnten wir erste Lebensmittel verteilen», erinnert sich Jenifa Jopute. Seitdem ist sie regelmässig vor Ort und schaut auch bei Nura und Malik vorbei.
Wenig Planbarkeit, viel Unsicherheit
mit den lokalen Partnern. Die Südsudanesin betont: «Die Kapazitäten der Flüchtlingsunterkünfte sind längst überschritten. Die Versorgungslage hat sich durch die starken Fluchtbewegungen in den letzten zwei Jahren massiv verschärft.» Es herrsche eine weit verbreitete Nahrungsmittelknappheit, auch die Sicherheitslage sei höchst angespannt und volatil.
Leben in einem Lager, das aus allen Nähten platzt
Weil die Camps direkt an der Grenze zum Sudan völlig überfüllt sind, ziehen viele Geflüchtete weiter in den Süden des Südsudans. Doch ihre Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen bleiben auch dort
Doch die Arbeit im Gorom-Lager bleibt schwierig. «Die Inflation treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe. Was wir heute budgetieren, reicht morgen nicht mehr. Planen ist hier kaum möglich», erklärt James Alau, Projektmanager bei Caritas Juba, der mit Jenifa Jopute die gemeinsamen Projekte steuert. Hinzu kommt die angespannte Sicherheitslage. «Das Lager ist so schnell gewachsen, dass es längst in alle Richtungen offen ist. Bewaffnete Gruppen halten sich in der Nähe auf. Die Polizei muss jede Verteilung von Hilfsgütern begleiten», sagt Alau.
Die humanitäre Hilfe folgt einem klaren Prinzip: Wer am dringendsten Hilfe braucht, soll sie erhalten – unabhängig
von Herkunft oder Religion. Doch trotz klarer Auswahlkriterien bei der Hilfe kommt es immer wieder zu Spannungen unter den Geflüchteten. Die Not ist schlicht zu gross.
Schutz und Hoffnung für Frauen und Kinder
Trotz aller Widrigkeiten keimt im Camp auch immer wieder Hoffnung auf. So etwa in den Schutzräumen für Kinder und Frauen. Hier schaffen Caritas Juba und Caritas Schweiz gemeinsam eine sichere Umgebung für die besonders verletzlichen Bewohnerinnen und Bewohner. In den sogenannten «Child Friendly Spaces» finden Kinder Anschluss, können in Ruhe miteinander spielen und Erlebtes gemeinsam mit Fachpersonen verarbeiten. Für die Kleinsten ist das eine wichtige Anlaufstelle, denn viele von ihnen sind durch die Flucht traumatisiert. Frauen und Mädchen finden in einem weiteren Schutzraum Rückzugsmöglichkeiten, Beratung sowie saubere Sanitäranlagen. «Unsere Angebote helfen den Menschen, ein klein wenig Hoffnung zu schöpfen und eine Pause vom sonst so beschwerlichen Alltag im Camp zu erleben», erläutert Jenifa Jopute.

Malik läuft durch das karge Flüchtlingslager zum Kinderzentrum der Caritas. Dort trifft er seine Freunde und vergisst die unwirtliche Umgebung.
Auch Malik besucht regelmässig das Kinderzentrum. «Hier treffe ich meine Freunde zum Fussballspielen, Malen und Rumtoben», sagt er mit leuchtenden Augen. Er sitzt mitten in einer Schar Kinder, sie zeichnen gemeinsam in ein Schulheft. In der friedlichen und sicheren Umgebung wagt sich der Fünfjährige sogar wieder zu träumen: «Ich will einmal Arzt werden –
damit viele weitere Kinder gesund werden können.» Die schnelle medizinische Hilfe nach seiner Infektion hat ihn inspiriert.

Weitere Berichte aus dem Südsudan: caritas.ch/berichte-suedsudan

«Meine grösste Hoffnung ist ein friedlicher und florierender Südsudan, in dem sich alle wohlfühlen», sagt Jenifa Jopute. Der Wunsch, sich für bessere Lebensbedingungen in ihrem Land einzusetzen, treibt die 29-Jährige seit Beginn ihrer Laufbahn an. Sie studierte Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik und arbeitet seit fünf Jahren in gemeinnützigen Organisationen.
Im Oktober 2024 stiess Jenifa Jopute zu Caritas Schweiz. Die gebürtige Südsudanesin unterstützt die lokalen Partner bei der Umsetzung gemeinsamer Projekte. Von den täglichen Hürden lässt sie sich nicht entmutigen: «Unsicherheiten, Stras -
senblockaden, saisonale Überschwemmungen und die rückläufige Finanzierung stellen uns vor Herausforderungen», erklärt Jopute. «Doch meine Motivation liegt im Lächeln der Menschen, die wir unterstützen. Die Begegnungen erinnern mich immer wieder daran, warum ich diese Arbeit mache», betont sie.
Jenifas Ziel: Kinder wie Malik (siehe Haupttext) sollen ihre Traumata überwinden und ihre Träume eines Tages verwirklichen können. Um den Menschen im Südsudan wieder Hoffnung und Würde zu schenken, sind eine kontinuierliche Unterstützung und eine nachhaltige Finanzierung unerlässlich.

Weltweit hungern mehr Menschen als je zuvor. Gleichzeitig kürzen die USA und andere reiche Länder massiv Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit. Was tun? Das internationale Caritas-Netzwerk ruft dazu auf, ärmere Länder von ihren Schulden zu befreien.
Mehr als jede dritte Person auf der Welt lebt in einem Land, das mehr Geld für die Rückzahlung von ausländischen Schulden ausgeben muss, als es für die Grundversorgung wie die Bildung oder den Gesundheitssektor einsetzen kann. Auch für
140 000 Menschen rund um den Globus haben die Petition bereits unterzeichnet.
die Bekämpfung der Armut und für die Anpassung an die fortschreitende Klimaerhitzung fehlt es diesen Staaten an Geld.
Die enorme, stetig wachsende Verschuldung der ärmsten Länder war auch ein zentrales Thema, als sich die UNMitgliedsstaaten Anfang Juli im spanischen Sevilla zur vierten Konferenz zur
Entwicklungsfinanzierung (FfD4) trafen. Die Schulden wären ein Hebel, mit dem sich die reicheren Länder wie die Schweiz stärker für die Interessen der ärmsten Länder einsetzen könnten. Um auf die Dringlichkeit des Problems aufmerksam zu machen, hat das internationale Caritas-Netzwerk die Petition «Turn Debt into Hope» lanciert, die von einem breiten Bündnis anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen mitgetragen wird. Bis anhin wurde die Petition von über 140 000 Menschen rund um den Globus unterzeichnet.
Wie lassen sich künftige Schuldenkrisen verhindern?
Die Forderungen, welche die Caritas auch in Sevilla präsentierte, lauten: Die aktuelle Schuldenkrise muss gestoppt werden durch den Erlass von nicht tragbaren
Schulden. Künftige Schuldenkrisen gilt es zu verhindern, indem das globale Finanzsystem reformiert wird und bessere Regelungen geschaffen werden. Doch in der Schlusserklärung der FfD4-Konferenz finden sich dazu leider nur unverbindliche Absichtserklärungen.
Die Konferenz in Sevilla fand mitten in einer beispiellosen europaweiten Hitzewelle statt. Dies bewirkte jedoch keine besondere Sensibilität für Klimafragen. Dabei sind es gerade die Länder des Globalen Südens, welche am meisten unter der Klimakrise leiden. Dürren und andere extreme Wetterereignisse häufen sich und entziehen den Menschen ihre Lebensgrundlage.
Die Klimakrise erhöht den Finanzbedarf Wer bezahlt dafür, dass sich diese Menschen den neuen Klimarealitäten anpassen können? Die Schweiz hat sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, ihren Beitrag an die sogenannte internationale Klimafinanzierung fair auszugestalten. Davon sind wir heute noch weit entfernt. Das zeigt eine Analyse von Caritas Schweiz in Zusammenarbeit mit Alliance Sud. Der Beitrag zur Klimafinanzierung muss deutlich steigen, er darf nicht einfach wie bis anhin zulasten der Budgets für Armutsbekämpfung gehen. Gleichzeitig muss die Erhöhung des Schweizer Beitrags weiterhin auf Zuschüsse anstatt Kredite setzen, da sonst die Schuldenkrise verschärft werden würde.
Nach der Ernüchterung von Sevilla kommen neue UN-Konferenzen, die sich diesen dringenden Fragen stellen müssen. (sg)

Caritas-Petition «Turn Debt into Hope» caritas.ch/verschuldung
Über 11 Prozent aller Geflüchteten in Bosnien sind unbegleitete Minderjährige – Kinder und Jugendliche, die alleine auf der Flucht sind. Im Caritas-Aufnahmezentrum in Sarajevo erhalten sie Sicherheit und Stabilität, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.
«Unser Fokus liegt darauf, den Kindern körperliche und emotionale Sicherheit zu bieten.»
Im Aufnahmezentrum herrscht eine besondere Atmosphäre. Hier finden unbegleitete Minderjährige einen geschützten Raum, in dem sie zur Ruhe kommen können. «Wir beobachten oft, wie die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Ankunft aufatmen», erzählt Mirela Suman, Projektleiterin des Zentrums. «Viele wissen bereits, dass die Bedingungen hier deutlich bes-
ser sind als in anderen Camps. Sie freuen sich auf ein stabiles Umfeld und endlich in Sicherheit zu sein.»
Mehr als ein Dach über dem Kopf Das Zentrum bietet diesen Minderjährigen mehr als nur eine Unterkunft. Sie erhalten Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und psychosozialer Unterstützung. «Unser Fokus liegt darauf, ihnen körperliche und emotionale Sicherheit zu bieten. Nur so können sie beginnen, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und wieder Kinder sein», erklärt Suman.

Der Alltag im Zentrum ist geprägt von Stabilität und Routine. Die Kinder und Jugendlichen nehmen an Freizeitaktivitäten teil, besuchen Bildungsworkshops und werden rund um die Uhr betreut. «Wichtig ist, dass sie eine stabile Tagesstruktur haben, die ihnen hilft, sich zu öffnen und zu heilen», ergänzt Suman. Dabei werden sie individuell begleitet, um ihre persönlichen Stärken zu fördern und ihnen Mut für die Zukunft zu geben.
Die Arbeit im Zentrum wirkt: «Ein Jugendlicher hatte Schlimmes durchgemacht, als er im Zentrum ankam. Anfangs zeigte er typische Anzeichen von Traumata wie Wut und Rückzug. Er spielte unablässig allein im Hof Fussball. Wir erkannten sein Potenzial und haben ihn an einen lokalen Fussballverein vermittelt. Heute trainiert er regelmässig mit der ersten Mannschaft. Er lernt Bosnisch und hat sogar in Bosnien Asyl beantragt», erzählt Suman begeistert.
Unterstützung, die bleibt
Die meisten Kinder und Jugendlichen bleiben im Zentrum, bis sie sicher weiterreisen können oder wieder mit ihren Familien vereint werden. «Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um Angehörige zu finden und eine sichere Familienzusammenführung zu ermöglichen», erklärt Suman. Selbst wenn die Kinder und Jugendlichen das Zentrum verlassen, endet die Unterstützung nicht abrupt: «Unsere Betreuerinnen und Betreuer bleiben oft mit ihnen in Kontakt, begleiten sie auf ihrem Weg und helfen, wo immer es nötig ist.»
Jede und jeder dieser unbegleiteten Minderjährigen bringt eine eigene Geschichte mit. Geschichten, die geprägt sind von Flucht und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Im Aufnahmezentrum der Caritas werden sie dabei nicht allein gelassen. (tb)
Eine Auswahl von Projekten in Bosnien-Herzegowina: caritas.ch/bosnien-herzegowina


Bernadette Baumeler ist an Multipler Sklerose erkrankt. Im Alltag ist sie auf die Unterstützung ihres Ehemannes Urs angewiesen.
«Die praktischen Tipps helfen mir»
In der Schweiz pflegen über eine halbe Million Menschen ein Familienmitglied. Auch Urs Baumeler kümmert sich jeden Tag um seine Frau Bernadette, die an Multipler Sklerose erkrankt ist. Von der Caritas wird er fachlich betreut – und erhält einen Lohn.
Die Krankheit kam schleichend. Bereits mit 18 Jahren machte sich bei Bernadette Baumeler Multiple Sklerose bemerkbar. Heute ist die 64-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen – und auf die Hilfe ihres Mannes Urs.
glied. Dafür erhalten sie jedoch keinen Lohn und sie sind oft auf sich allein gestellt. Viele pflegende Angehörige reduzieren zudem ihr Arbeitspensum, was Erwerbseinbussen und eine fehlende soziale Absicherung zur Folge haben kann. Dieses Armutsrisiko möchte Caritas Schweiz reduzieren. Sie stellt pflegende «Es gibt immer etwas, bei dem Bernadette Hilfe benötigt.»
Der 63-Jährige unterstützt sie beim Aufstehen, Duschen, Anziehen, bei der Toilette, der Mobilisation und vielem mehr. Rund um die Uhr ist der frühpensionierte IT-Spezialist für seine Frau da. «Eine Selbstverständlichkeit», wie er sagt. «Meine Frau trägt mich ja auch.» Zwar füllt die Pflege nicht den ganzen Tag von Urs Baumeler. «Aber ich habe auch keine längeren Pausen. Es gibt immer etwas, bei dem Bernadette Hilfe benötigt.»
In der Schweiz pflegen und betreuen rund 600 000 Personen ein Familienmit-
Angehörige zu einem Stundenlohn von 35.50 Franken an und zahlt in die Sozialversicherungen ein. Die Finanzierung erfolgt über das Gesundheitswesen, nicht durch Spenden. Urs Baumeler hält dies für ein «wichtiges Zeichen der Anerkennung»; für Bernadette Baumeler wiederum ist es eine mentale Entlastung, zu wissen, dass das Engagement ihres Mannes auch finanziell gewürdigt wird.
Fachliche Begleitung durch Pflegefachfrau
Bei jeder Organisation würde sich Urs Baumeler allerdings nicht anstellen lassen: «Die Caritas habe ich ausgewählt, weil sie eine Non-Profit-Organisation ist und keinen Gewinn erwirtschaftet.»
Neben dem Lohn erhält Urs Baumeler von der Caritas eine professionelle Begleitung durch die Pflegefachfrau Rita Kurmann. Sie macht regelmässige Hausbesuche, beantwortet Fragen und bespricht den Umgang mit belastenden Situationen.
«Die praktischen Tipps helfen mir ungemein», sagt Urs Baumeler. «Übt man jeden Tag dieselben Tätigkeiten aus, merkt man gar nicht, wenn man etwas falsch macht. Ritas fachlicher Blick von aussen ist da sehr hilfreich. Das gibt mir Sicherheit.» (nj)

Ein Video-Porträt von Urs und Bernadette Baumeler finden Sie unter: caritascare.ch
In der Schweiz gibt es immer mehr Organisationen, die pflegende Angehörige anstellen. Auch die Caritas ist in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nid- und Obwalden tätig. Die Regionen Zürich und Aargau folgen bald.
Im Unterschied zu gewinnorientierten Unternehmen ist es das Ziel der Caritas, die Kosten für die Krankenkassen und die öffentliche Hand so tief wie möglich zu halten. Das ist möglich, weil die Caritas keinen Profit erwirtschaftet. Die erzielten Erlöse werden verwendet, um die Löhne der Pflegefachpersonen, den administrativen Aufwand sowie kostenlose Weiterbildungskurse für pflegende Angehörige zu finanzieren.

Der Bergsturz von Blatten Ende Mai hat grosse Teile des Dorfes zerstört und vielen Bewohnerinnen und Bewohnern das Zuhause genommen. Schnell waren Hilfswerke und Behörden zur Stelle und begannen mit der Unterstützung der Betroffenen. Silvano Allenbach von Caritas Schweiz erklärt, wie diese bis heute aussieht.

Herr Allenbach, der Bergsturz ist nun bereits einige Monate her. Wie haben Sie die Betroffenen von Blatten unterstützt?
Bei der Hilfe in Katastrophenfällen ist schnelles Handeln entscheidend – allerdings ist die Bevölkerung auch auf langfristige Massnahmen angewiesen. Unsere Unterstützung erfolgt in einem mehrstufigen Prozess: von den ersten Tagen nach dem Unglück bis zur langfristigen Hilfe,
etwa für den Wiederaufbau. Dank der grossen Solidarität innerhalb der Schweizer Bevölkerung haben wir die Möglichkeit, den Betroffenen für lange Zeit zur Seite zu stehen.
Können Sie das Vorgehen näher erläutern?
In der ersten Phase direkt nach dem Bergsturz steht die Soforthilfe im Zentrum. Bereits Anfang Juni haben wir gemeinsam mit dem Schweizerischen Roten Kreuz
(SRK) und der Glückskette erste Auszahlungen vorgenommen: Die Bewohnerinnen und Bewohner von Blatten erhielten je 2000 Franken. Über das Geld konnten sie frei verfügen und es dort einsetzen, wo der Bedarf am grössten war. Das können Ausgaben für Kleider, Spielzeug oder ein neues Ladegerät sein.
Was folgt auf diese erste Hilfe?
In der zweiten Phase geht es um die Überbrückung: Betroffene haben plötzlich zusätzliche Ausgaben, sei dies für temporäre Unterkünfte, längere Arbeitswege oder neue Möbel. Hier unterstützen wir finanziell, sofern die Versicherungsleistungen nicht alle Mehrkosten decken.
Dann gibt es noch eine dritte Phase. Genau, die Deckung von Restkosten. Hier handelt es sich um mittel- bis langfristige Belastungen. Das kann den Verlust von Hausrat betreffen oder Reparaturen, für die keine Versicherung aufkommt. Wir prüfen dabei jeden Fall sorgfältig und individuell.
Wie gelingt es, dass die Unterstützung geordnet verläuft?
Die enge Zusammenarbeit mit den Behörden, dem SRK, der Glückskette und weiteren Organisationen ist entscheidend. In regelmässigen Sitzungen werden beispielsweise die Gesuche gemeinsam beurteilt. Ergänzend steht die Caritas auch mit Akteuren wie fondssuisse – einer Stiftung, die bei Elementarschäden Unterstützung leistet – im Austausch, um die Hilfsleistungen gut zu koordinieren.
Was passiert mit Spenden, die über den aktuellen Bedarf hinausgehen?
Zuerst fliessen die Spenden in die drei Phasen der Hilfe in Blatten. Falls Mittel übrigbleiben sollten, setzen wir diese im Rahmen unseres zweckgebundenen Katastrophenfonds Schweiz ein. Damit können wir bei zukünftigen, auch kleinen Naturereignissen im Inland ohne grosse Medienresonanz rasch und wirksam helfen. (tb)

Mit einem Testament stellen Sie sicher, dass Ihr Nachlass nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verteilt wird.
Vorsorgen, den Nachlass vorausschauend, rechtzeitig und nach den eigenen Vorstellungen regeln, klare Verhältnisse schaffen – das wünschen sich wohl die meisten Menschen.
Die Vorsorgemappe von Caritas Schweiz enthält Wegweiser für das Verfassen von Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag und Testament. Mittels OnlineHilfen auf unserer Website werden Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung der Dokumente unterstützt. Hier finden Sie auch Antworten auf erbrechtliche Fragen.
Ein Testament ermöglicht, selbstbestimmt und rechtsverbindlich zu entscheiden, wie Ihr Nachlass verteilt werden und wie Ihre Werte und Anliegen weiterleben sollen. Mit einer testamentarischen Berücksichtigung von Caritas Schweiz unterstützen Sie unsere Arbeit und können sicher sein, dass Ihre Spende dort ankommt, wo Sie es wünschen. Haben Sie persönliche Fragen zum Thema Nachlass und Testament? Bernhard Leicht steht Ihnen gerne zur Verfügung per E-Mail an bleicht@caritas.ch oder per Telefon +41 41 419 24 69.

Bernhard Leicht, Verantwortlicher Erbschaften und Legate
Bestellen Sie die CaritasVorsorgemappe unter: caritas.ch/erbschaftund-legat
Der Start in ein neues Schuljahr bedeutet für Familien mit knappem Budget eine finanzielle Belastung. Denn ein neuer Schulrucksack oder ein Etui sind teuer. Aus diesem Grund hat der CaritasMarkt die Aktion «Schulstart» lanciert. In allen 22 Läden wurden während des Sommers eine grosse Auswahl an Schultheken, Turn- und Kindergartentaschen, Etuis, Schreibsets und weitere Artikel angeboten – mit bis zu 80 Prozent Rabatt, ermöglicht durch Unterstützung von Lieferanten und Stiftungen.
Die Nachfrage war enorm: Innert weniger Wochen waren sämtliche Produkte ausverkauft. Rund 5000 Kinder konnten vom Angebot profitieren. Geschäftsleiter Thomas Künzler sagt: «Jedes Kind soll mit Freude und Würde ins neue Schuljahr starten können – genau das konnten wir mit dieser Aktion ermöglichen.» (nj)

Weitere Informationen: caritas-markt.ch
«Frauen stärken –Armut bekämpfen» 18. September 2025, 17–18 Uhr, online
In verschiedenen Projekten setzt sich Caritas Schweiz gezielt für die Stärkung von Frauen und Mädchen ein. Wie dies in der Praxis konkret aussieht, wird am Beispiel der Honigproduzentinnen in Äthiopien deutlich. Erfahrungsberichte und Einblicke zeigen, wie Selbstbestimmung entstehen kann – auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Weitere Informationen und Anmeldung zu dem Infoanlass: caritas.ch/frauenstaerken
Informationsanlass zum Thema Caritas-Familienplatzierung: Montag, 15. September 2025, 19–20 Uhr, online Montag, 3. November 2025, 19–20 Uhr, online Nähere Informationen unter: caritas.ch/pfi
Auskünfte und Anmeldung
E-Mail: event@caritas.ch Telefon: 041 419 21 62 caritas.ch/veranstaltungen




Für viele geflüchtete Jugendliche ist der lange, schulfreie Sommer eine einsame Zeit. Das Ferienlager von youngCaritas stellt für sie eine Abwechslung zum Alltag dar. Dieses Jahr wurden erstmals zwei Lagerwochen durchgeführt.
Wandern, basteln, baden, bräteln, Discoabend: Solche Lagererlebnisse sind unvergesslich – und für viele Kinder und Jugendliche aus der Schweiz Jahr für Jahr fester Bestandteil ihres Sommerprogramms. Genau hier setzt das youngCaritas-Sommer lager an: «Wir wollen junge Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit bieten, gemeinsam eine tolle Woche zu verbringen und neue Kontakte knüpfen zu können», sagt Co-Projektverantwortliche Christine Beeler.
70 Jugendliche und 20 Leitende
Das Interesse am youngCaritas-Sommerlager (Sola) wächst stetig. Deshalb wurden dieses Jahr erstmals zwei Lagerwochen durchgeführt – im Juli in Adel-
boden und im August in Oeschseite (Zweisimmen). Für beide Lager wurde ein Leitungsteam aus jeweils 10 Freiwilligen zusammengestellt. Neben einigen langjährigen Leitenden konnten 13 neue Freiwillige gewonnen werden, welche sich mit grossem Engagement am Sola beteiligten.
Ein Programm voller Höhepunkte Über 70 Teilnehmende aus 14 verschiedenen Ländern, unter anderem geflüchtete Jugendliche aus Afghanistan, Syrien, Somalia und der Ukraine, kamen in den Genuss des abwechslungsreichen Lagerprogramms. Das Steigenlassen der selbstgebastelten Drachen, der Badibesuch, die Jam-Session am Lagerfeuer –das youngCaritas-Sommerlager sorgte für zahlreiche Höhepunkte und unvergessliche Erinnerungen. (lb)
Was das Ferienlager so besonders macht

Laura Meile, freiwillige Leiterin
«Erinnerungen fürs Leben schaffen mit neu gewonnenen Herzensmenschen ist für mich eine Bereicherung, die ich nicht verpassen möchte.»

Mahdi Gholami, ehemaliger Teilnehmer (heute ist er als Freiwilliger bei youngCaritas)
«Das youngCaritas-Sommerlager war für mich eine unvergessliche Erfahrung! Ich habe viele neue Freunde kennengelernt, gelacht, gespielt und so viel Schönes erlebt. Besonders gefallen haben mir der Gruppenzusammenhalt und die gute Stimmung. Alle waren willkommen und wir hatten einfach eine tolle Zeit zusammen. Ich kann es allen empfehlen, die Spass haben wollen und dabei auch etwas Gutes tun möchten!»
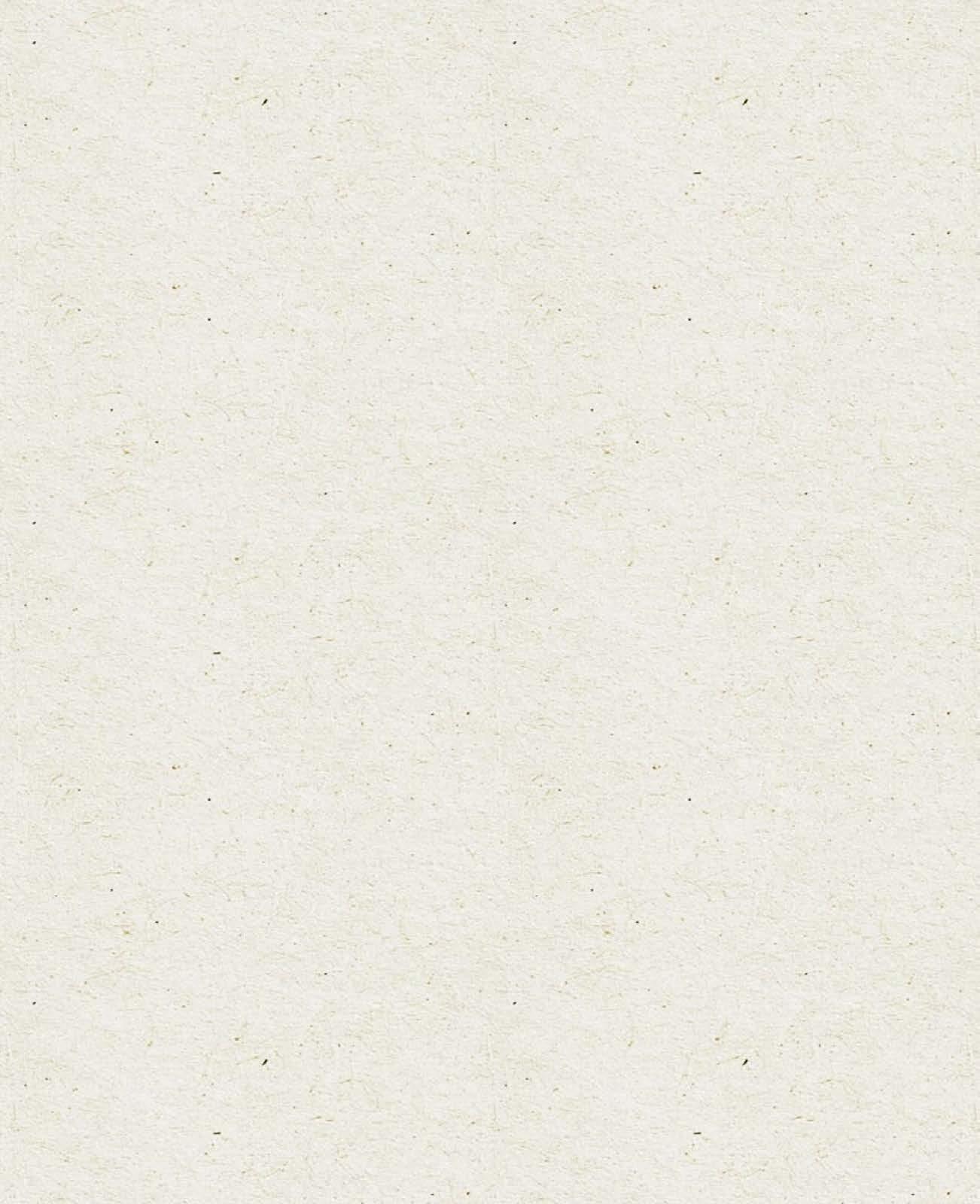
Weitere Informationen: youngcaritas.ch/sola
Unsere Projekte leisten Nothilfe und schaffen nachhaltige Existenzgrundlagen trotz Klimakrise.

caritas.ch/ja