Ratgeber: Einfach mal abschalten, Kosmetik ohne Schadstoffe
Aktuell: Neue BUND-Reisen, Gentechnik in Wildpflanzen


Ratgeber: Einfach mal abschalten, Kosmetik ohne Schadstoffe
Aktuell: Neue BUND-Reisen, Gentechnik in Wildpflanzen

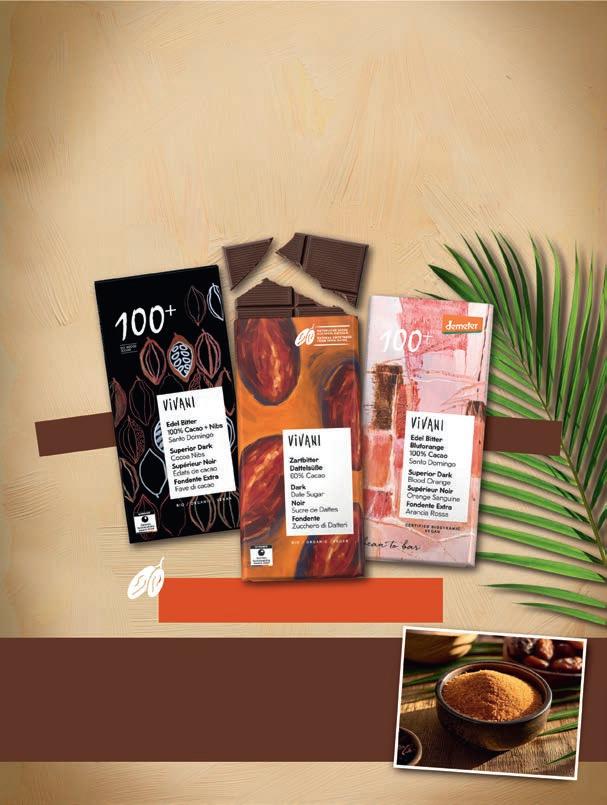
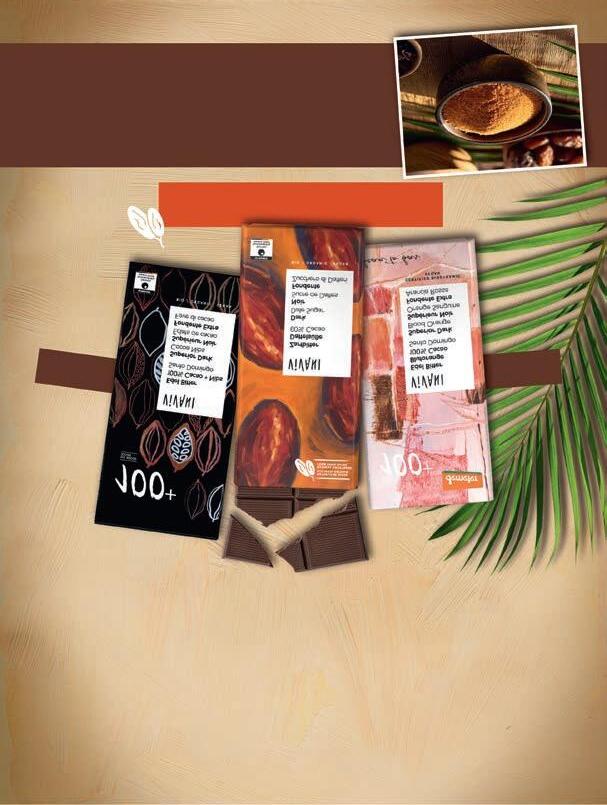

AKTUELLES
4/5 Aktuelle Meldungen
6 Kommentar
7 Gerettete Landschaft
8–13 Aktuelles
TITELTHEMA
14/15 Wasser schützen
16/17 Kostbares Gut
18 Gewässer: Hebel nutzen
19 Puffer schaffen
20 Trinkwasser im Test
21 Grundwasser in Gefahr
22 Wassercent
23 Wasserthemen aus Bayern
NATUR IM PORTRÄT
24 Pflanzenporträt Roter Holunder
25 Neues vom Grünen Band
26/27 Goldschakal
28/29 Stippbachtal bei Herborn
30/31 Bedroht: Nagelrochen
AKTION
32 Ein Jahr Igel-Challenge
33 Allee des Jahres


INTERNATIONALES
34 Gegen die Plastikflut
35 Klimagipfel in Brasilien
URLAUB & FREIZEIT
36 Wanderung Bernrieder Park
37 Reise: Rheinisches Braunkohlerevier
38 BUND-Reisen: Programm 2026
39 Umweltbildung
BN AKTIV + NAH
40 Richard Mergner im Interview
41 Editorial des Vorstands
42 BN Stiftung
43 ÖPNV-Führerschein
44 Serie: BN-Fläche
45 Neuer Landesgeschäftsführer
46–48 Meldungen
49 Umweltbildung
50 Porträt Raimund Schoberer
51–57 Regionalseiten
58/59 Junge Seite
SERVICE
60 Ratgeber
Die Natur+Umwelt ist das Mitgliedermagazin des BUND Naturschutz und die bayerische Ausgabe des BUNDmagazins.
61 Ökotipp
63 Medien und Reisen
66 Kontakte/Impressum


wenn Sie diese Ausgabe der Natur+Umwelt in den Händen halten oder online lesen, findet vielleicht gerade die Neuwahl des BN-Vorstands statt. Am 22. November treffen sich die Delegierten dazu in Fürth. Fest steht schon vorher: Es wird einen Wechsel an der Verbandsspitze geben, denn Richard Mergner stellt sich nicht mehr zur Wahl. Der bisherige Vorsitzende gab im September seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Lesen Sie dazu auch das Interview mit ihm auf Seite 40/41. Wer Richard Mergner nachfolgt, kann sich auf einen im Haupt- und Ehrenamt gut funktionierenden Verband verlassen – und wird dennoch alle Hände voll zu tun haben. Der Schutz von Natur, Umwelt und Klima steht derzeit nicht gerade weit oben auf der politischen Agenda. So gab Ende Oktober die Bayerische Staatsregierung bekannt, dass sie ihr selbstgestecktes Ziel der Klimaneutralität bis 2040 aufgibt. Ein gefährlicher Schritt in die falsche Richtung.
Auch die Maßnahmen zum Schutz des Wassers im Freistaat sind ungenügend. Lesen Sie dazu mehr auf den Seiten 21 bis 23. Jetzt muss die Umweltbewegung einen langen Atem und Durchhaltevermögen zeigen. Der BUND Naturschutz hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass er beides kann.
Luise Frank Redaktion Natur+Umwelt
Severin Zillich Redaktion BUNDmagazin
Fotos: Jörg Farys

Unser Haus nimmt Gestalt an. Bei einem Besuch der Baustelle im September (von links): Projektleiter Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler, Schatzmeister Jens Klocksin, die beratende Architektin Ulrike Lickert, Vorstandsbeauftragter Andreas Faensen-Thiebes und der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt.
Ende November wird der BUND in BerlinNeukölln Richtfest feiern. Der Rohbau der neuen Bundesgeschäftsstelle ist damit fertig. Wie es weitergeht, wissen unsere Experten Andreas Faensen-Thiebes und Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler.
Läuft auf der Baustelle alles nach Plan? Wer mal eine eigene Baustelle hatte, weiß: Probleme gibt es immer. Doch gemeinsam mit den beiden Hochbaufirmen für Holz und Beton sind wir zuversichtlich, den Zeitplan halten zu können. Es ist eine tolle Erfahrung, all das, was wir lange auf dem Papier – oder besser dem Computer – geplant haben, nun dreidimensional entstehen zu sehen.

So hat uns in den letzten Wochen der Bau der Spindeltreppe in Atem gehalten. Sie stellt das kommunikative und verbindende Herzstück des Gebäudes dar, auf die Gestaltung dieses Treppenhauses haben wir großen Wert gelegt. Deswegen, und aus Gründen des Brandschutzes, war der Einbau eine echte Herausforderung.
Welche Schritte stehen als nächstes an? Derzeit beginnen die Dachdeckerarbeiten. Das bedeutet, einerseits das Dach zu schließen und das Gebäude gegen Regen, Schnee, Kälte und Hitze zu isolieren. Und außerdem die Unterlage zu schaffen für unser begrüntes Dach und für die Photovoltaik-Anlage. Sobald das Dach dicht ist

– so um Weihnachten herum –, kann der Innenausbau starten.
Wann wird unsere Geschäftsstelle wohl fertig sein?
Unser Zeitplan sieht vor, das Gebäude in einem knappen Jahr an den Bauherrn, also den BUND, zu übergeben, im Oktober 2026. Wir setzen alles daran, den Termin einzuhalten.
www.bund.net/ bundesgeschaeftsstelle
»Only bad news is good news«
heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.
Doch positive Neuigkeiten aus dem Naturund Umweltschutz tun einfach gut. Einige aus jüngster Zeit haben wir wie immer für Sie ausgewählt.

Goldene Henne gewonnen: Das langjährige BUND-Engagement am Grünen Band ist mit Deutschlands größtem Publikumspreis gewürdigt worden, der »Goldenen Henne«. Zum 35. Jubiläum der deutschen Einheit sei »Europas größte Naturschutzinitiative dank unzähliger Aktiver zu einem Symbol für das Zusammenwachsen von Natur und Menschen geworden«, hieß es in der Laudatio. Bei der festlichen Preisverleihung in Leipzig konnten Myriam Rapior, stellvertretende BUND-Vorsitzende, und Liana Geidezis, BUND-Leiterin Grünes Band, auch einen Spendenscheck über 25000 Euro entgegennehmen, siehe Foto auf Seite 6. Der BUND sagt danke!
26 neue Biosphärenreservate: Ende September erkannte die UNESCO in Afrika, Asien und Europa eine Reihe neuer Modellregionen für Nachhaltigkeit. Sie dienen dem Schutz der biologischen Vielfalt und erproben naturverträgliche Wirtschaftsformen mit Zukunft. Weltweit existieren damit nun fast 800 dieser Regionen –18 davon in Deutschland. Um gleich zwei neue Biosphären reicher sind China, Frankreich, Jordanien, Madagaskar und der Oman. Siehe dazu > www.unesco.de
Erfolgreiche Petition: Im Zentrum der Nordsee liegt deren größte Sandbank, die Doggerbank. Aufgrund ihres Artenreichtums ist sie seit 2017 Meeresschutzgebiet –und wird dennoch weiter von Grundschleppnetzen zerstört. Um diesen Naturfrevel zu beenden, richtete der BUND eine Petition an Fischereiminister Alois Rainer. Bis zur Übergabe Ende Oktober unterschrieben 72500 Menschen. Hoffnung gibt uns, dass die Hälfte des Schutzgebiets bald wirklich geschützt werden soll. Doch keine halben Sachen! Der BUND fordert die Doggerbank vollständig zu schützen. Mehr unter > www.bund.net/meere
Spitzenjahr für die Wiesenweihe:
Seit 2018 setzt sich der BUND in Sachsen-Anhalt für den eleganten Greifvogel ein. Die Wiesenweihe brütet inzwischen fast nur noch in Getreidefeldern. Um ihre Gelege vor Erntemaschinen zu schützen, werden sie in enger Zusammenarbeit mit Landwirten ausfindig gemacht und umzäunt. 2025 hat dies so vielen Vögeln das Leben gerettet wie nie. In 27 entdeckten Nestern wurden mindestens 86 Jungvögel flügge. Die Wiesenweihe gilt bundesweit als vom Aussterben bedroht. Trotzdem ist die Zukunft des Schutzprojektes unsicher, das auch vom EU-Landwirtschaftsfonds ELER gefördert wird.
Wegweisendes Urteil: Am 8. Oktober gab das Bundesverwaltungsgericht einer Klage von BUND und NABU Hamburg gegen die geplante A 26 Ost statt. Der Planfeststellungsbeschluss sei »rechtswidrig und nicht vollziehbar«. Erstmals bei einer Klage gegen eine Autobahn war der Klimaschutz wesentlich. So habe man eine kürzere, klimafreundlichere und günstigere Variante nicht genug gewürdigt. Unser Landesverband: »Dieses Urteil ist ein Triumph für das Klima. Moore speichern Kohlenstoff – wer sie aufreißt, heizt die Erde an. Die A 26 Ost muss politisch beerdigt und durch eine umweltverträgliche Trasse ersetzt werden.«
VERENA GRAICHEN
ist die Bundesgeschäftsführerin für Politik.
KOMMENTAR

Dank mutiger und vorausschauender Menschen vor und nach dem Mauerfall konnte der BUND kürzlich einen besonderen Preis entgegennehmen.
Zum Tag der Deutschen Einheit schrieb mir die Patentante meiner Kinder: Hätten vor 36 Jahren nicht so viele Menschen Mut bewiesen, würde es die kleinen Schätze gar nicht geben –es wäre schade drum. Und das stimmt. Mein Leben wäre ohne die friedliche Revolution anders verlaufen. Aufgewachsen in Bonn, wäre ich nie zum Studium nach Potsdam gezogen, hätte mich nicht dort verliebt und eine Ost-West-Familie gegründet. Deswegen bin ich dankbar, dass 1989 so viele Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen sind und etwas ermöglicht haben, das vorher unvorstellbar war.
Unvorstellbar war ja auch, dass aus dem Todesstreifen der deutsch-deutschen Grenze mal eine Lebenslinie werden könnte.

Wo jahrzehntelang Grenztürme aufragten und Soldaten patrouillierten, hat heute die Natur Raum. Da ist ein Erinnerungsort entstanden, der zeigt, wie eine Teilung überwunden werden kann. Der die Geschichte lebendig hält für jene Generationen, die erst nach der Wiedervereinigung geboren wurden. Das unermüdliche Engagement von Naturschützer*innen auf beiden Seiten der Grenze hat dies erst möglich gemacht.
Am 9. November 1989 wurde die Grenze geöffnet, einen Monat später das Grüne Band geboren: Umweltschützer aus Ost- und Westdeutschland verabschiedeten damals eine erste Resolution für ihre Zukunftsvision eines »Grünen Bandes«. Seitdem haben wir an unzähligen Stellen des einstigen Grenzstreifens Natur vor der Zerstörung bewahrt und vielfältige Lebensräume gerettet und neu geschaffen. Für diesen Einsatz hat der BUND den Ehrenpreis »35 Jahre Deutsche Einheit« der Goldenen Henne gewonnen, im Rahmen der Jubiläumsgala für Deutschlands größten Publikumspreis in Leipzig. Darauf können wir mit Recht stolz sein!
Der demokratische Aufbruch von damals erinnert mich auch daran, was eine engagierte Zivilgesellschaft erreichen kann. Und wie wertvoll die Demokratie als Grundlage und Voraussetzung unserer Arbeit ist. Nur wenn wir gemeinsam um die beste Lösung ringen können und eine Diskussion mit Respekt vor anderen Meinungen möglich ist, lassen sich unsere natürlichen Lebensgrundlagen wirksam schützen.
Wohl uns alle erfüllt mit Sorge, dass die Demokratie weltweit angegriffen wird. Und dass auch in Deutschland manche infrage stellen, ob gemeinnützige Verbände wie der BUND politisch und kritisch sein dürfen. Das dürfen wir nicht nur, das müssen wir. Wir geben Tieren und Pflanzen eine Stimme. Und wir zeigen, wie es besser geht. Mit guten Argumenten und praktisch vor Ort.

Der Caputher See bei Potsdam wird vor allem von Grundwasser gespeist. Wenn es, wie zuletzt häufiger, lange nicht regnet, drohen die angrenzenden Moorböden auszutrocknen. Der BUND Brandenburg suchte gemeinsam mit der Uni Potsdam und zwei lokalen Initiativen nach Lösungen.
So wurde der künstlich verstärkte Abfluss in die nahe Havel reduziert, ehrenamtliche Pegel-Pat*innen kontrollieren seitdem an acht Messstellen den Wasserstand. Die Erlenbruchwälder, in denen unter anderem Biber, Kraniche und Pirole leben, erhalten jetzt wieder ganzjährig genug Wasser.

Der Widerstand gegen die geplante Förderung von Erdgas im Ammerseegebiet verstärkt sich: Im August protestierten rund 450 Menschen vor Ort, Ende September verabschiedete der Kreistag des Landkreises Landsberg am Lech einen Grundsatzbeschluss, in dem die umstrittenen Gasbohrungen abgelehnt werden. In Reichling hat die Genexco Gas GmbH, die sich mittlerweile in »Energieprojekt Lech« umbenannt hat, die Probebohrung abgeschlossen und bereitet Tests des Gasvorkommens vor. Und das, obwohl neue Gasprojekte unvereinbar mit dem Ziel sind, die Erhitzung des Klimas zu be-
grenzen. Das hatte zuletzt auch der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten unterstrichen.
Der BN hatte am 17. August eine Demo organisiert (siehe Bild), zu der rund 450 Menschen kamen, unter ihnen Luisa Neubauer von Fridays for Future. Sie forderten Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf, die auslaufende Konzession für die Gasfirma nicht zu verlängern sowie von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen, die Genehmigung einer möglichen Förderung von Erdgas zu verweigern.
Sollte Genexco Erdgas finden und fördern können, sind bis zu zehn weitere

Der BN ist enttäuscht über das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das Ende Juli die Klage gegen den
Sie möchten sourcen und damit die Umwelt
Ein kleiner der ganz funktioniert:
Sie die Natur+ doch in Zukunft
Das spart Transportwege. einfach eine bund-naturschutz.de mit Ihrem Namen und Ihrer Mitgliedsnummer. Dann erhalten Sie künftig keine Zeitschrift mehr per Post, sondern jeweils eine Mail, sobald die neue Ausgabe online ist.
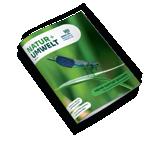
Bohrungen zwischen Lech und Ammersee vorgesehen. Dagegen hat sich Ende September auch der Kreistag des betroffenen Landkreises Landsberg am Lech ausgesprochen. Der Beschluss beinhaltet, dass der Landkreis keine eigenen Grundstücke für Maßnahmen im Zusammenhang mit fossilen Explorations- oder Fördervorhaben zur Verfügung stellt. Der BUND Naturschutz begrüßte diesen Beschluss ausdrücklich.
»Ewigkeitsbeschluss« für die dritte Start- und Landebahn am Flughafen München abgewiesen hat (wir berichteten). Die stellvertretende Landesbeauftragte des BN, Christine Margraf, erklärte: »Wir halten die Urteilsbegründung für fehlerhaft und haben daher eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingereicht. Klar ist aber auch: Unabhängig von der rechtlichen Situation ist mehr denn je die Politik,
das heißt der Hauptgesellschafter Freistaat Bayern gefordert, die Planung endgültig zu beenden. Eine dritte Startbahn ist überflüssig, anachronistisch und für Mensch, Natur und Klima schädlich!« Erschreckend sei, so Margraf, dass die Flughafen München GmH, Luftamt und Gericht das Votum der Bürger*innen Münchens im Bürgerentscheid von 2012 gegen die dritte Startbahn völlig missachte. »Das darf sich die Stadt München nicht gefallen lassen.«
Unter dem Vorwand der »Vereinfachung« und des »Bürokratieabbaus« will die Europäische Kommission wichtige Naturschutzgesetze zurücknehmen. Der BUND Naturschutz und andere Organisationen haben zum Widerspruch aufgerufen. Während Natur und Umwelt überall in Europa unter Druck stehen, plant die Kommission nun ausgerechnet, bewährte Umweltgesetze aufzuweichen. Gerade jene Regelungen, die für die Verbesserung des Zustands von Europas Wäldern, Mooren und Flüssen geschaffen wurden. Mitten in der Sommerpause hatte die EU-Kommission zum »Umwelt-Omnibus« einen »call for evidence« gestartet und Unternehmen, Organisationen und die Bevölkerung dazu aufgefordert, sich zu äußern, ob EU-Umweltgesetze abgeschwächt werden sollten. Offenbar in der Hoffnung, dass nur wenige Bürger*innen davon erfahren.

Hände weg! Der Feldhamster und viele andere Arten sind in Europa vom Aussterben bedroht. Sie brauchen wirksame Naturschutzgesetze.
Doch ein Bündnis aus mehreren Umweltverbänden, unter anderem der BN, rief dazu auf, sich mit einer Stellungnahme für die Natur an der öffentlichen Konsultation zu beteiligen. Die Aktion lief im September zehn Tage und hat in dieser kurzen Zeit fast 188 000 Menschen in Deutschland mobilisiert – ein starkes Signal! Der Aufruf des BUND Naturschutz in den sozialen Medien hat über 13 000 Unterstützer*innen beigetragen. Danke an alle, die mitgemacht haben! Wir bleiben dran.
Schon 2022 demonstrierte der BN gegen den autobahngleichen Ausbau der B 12.

Der geplante Ausbau der B 12 im Allgäu steht weiter im Kreuzfeuer der Kritik: Bei der Regierung von Schwaben scheint immer noch nicht angekommen zu sein, dass Klimaschutz ein Belang mit Verfassungsrang ist, der bei Planungen tatsächlich berücksichtigt werden muss. Obwohl die Regierung von Schwaben ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren zum Klima- und Flächenschutz beim Ausbau der B 12 durchgeführt hat, soll alles beim Alten bleiben: Eine Vollautobahn ohne Tempolimit mit 28 Metern Breite. Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe erklärte dazu: »Eine Güterabwägung zwischen den verkehrlichen Belangen und den Belangen des Klima- und Flä-
chenschutzes findet in keiner Weise statt. Nun müssen die Gerichte entscheiden, ob dieses Vorgehen rechtskonform ist.«
Der BUND Naturschutz hat deshalb eine erneute, 75-seitige Klagebegründung abgegeben. »Dem Gerichtsverfahren zum B 12-Ausbau kommt eine gewisse Präzedenzfallwirkung zu«, erläutert Rechtsanwalt Eric Weiser-Saulin. »Es muss geklärt werden, ob der Klimaschutz ohne tatsächliche Berücksichtigung in der Planung einfach weggewogen werden darf.«
Darüber hinaus ist auch noch eine massive Kostensteigerung prognostiziert: von 265,5 Millionen Euro auf inzwischen 626,9 Millionen Euro.
Erfolg für die direkte Demokratie: Einschnitte in Bürgerbeteiligungen sind –zumindest vorerst – abgewehrt. Weil sie angeblich die Energiewende bremsen, wollte Ministerpräsident Söder Bürgerentscheide in Bayern ausbremsen. Leitlinien dafür sollte ein Runder Tisch erarbeiten, an dem sich neben Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung auch Verbände wie Mehr Demokratie oder der BUND Naturschutz beteiligten. Sie konnten nachweisen, dass Bürgerbeteiligung Fortschritt in den meisten Fällen nicht blockiert, sondern voranbringt und dass erarbeitete Lösungen höhere Aktzeptanz haben. Und sie konnten dieses wichtige Instrument direkter Demokratie schützen: Die erarbeiteten Vorschläge beinhalten manche Verschlankung im Verfahren, aber keine Einschränkung von
Bürgerbeteiligung. Vielmehr schlägt der BN mehr Transparenz und Dialog vor –auch, um Konflikte zu lösen, ohne dass es zu einem Entscheid kommen muss.
Die Ergebnisse sind von Günther Beckstein, der den Runden Tisch leitete, der Staatsregierung vorgelegt worden. Ob sie den Vorschlägen folgen und wie sie eine möglicheÜberarbeitung ausrichten wird, ist offen. Der BN wird sich weiter für die Sicherung dieses wertvollen Elements unserer Demokratie einsetzen.
www.facebook.com/bundnaturschutz
www.instagram.com/bundnaturschutz
bsky.app/profile/bundnaturschutz.bsky.social www.youtube.com/@bundnaturschutz

Die Bayerische SeilbahnFörderrichtlinie legt fest, welche Art von Seilbahnbau gefördert wird und in welchem Umfang. Und sie steht seit vielen Jahren im Kreuzfeuer der Kritik von Umweltverbänden, denn sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Rahmenbedingungen naturzerstörerische Anreize schaffen können. Das Problem: Reine Ersatzinvestitionen werden nicht gefördert. Im Regelfall ist mit dem geförderten Neubau von Seilbahnen eine Kapazitätssteigerung verbunden. Die neuen Seilbahnen bewirken einen Dominoeffekt: Es werden mehr und neue Gebäude und Anlagen errichtet, zum Beispiel Parkplätze, Beschneiungsbecken und vieles mehr. Die Anlagenbetreiber stehen dann vor dem Dilemma, dass der Skibetrieb immer weniger wird, weshalb immer mehr Zusatzangebote und Anlagen für die Sommermonate entstehen wie Rodelbahnen, um die neuen Seilbahnen auszulasten. Die Folge: noch mehr Flächenverbrauch, noch mehr Anfahrtsverkehr, noch mehr Menschen in den sensiblen Naturräumen der Alpen.
Die Bayerische Staatsregierung verschließt die Augen davor, dass die Zeiten des Skifahrens in den bayerischen Alpen aufgrund der Klimakrise zu Ende gehen. So werden Millionensummer fehlinvestiert. Der BUND Naturschutz fordert deshalb, die zum Jahresende anstehende Fortschreibung der Seilbahnförderung endlich an der Umweltverträglichkeit und der Nachhaltigkeit der Projekte auszurichten.

SEILBAHNFÖRDERUNG
Die Förderrichtlinien für Bayerns Seilbahnen laufen Ende des Jahres aus und müssen neu festgelegt werden. Der BN fordert eine umweltfreundliche Ausrichtung.
Obwohl die neuen Seilbahnen und Beschneiungsanlagen am Jenner in den vergangenen Jahren mit rund 11,5 Millionen Euro aus Steuermitteln gefördert wurden, musste sich die Betreibergesellschaft 2023 eingestehen, dass der Skibetrieb nicht mehr wirtschaftlich ist. Dabei gehört das Skigebiet am Jenner mit einer Gipfelstation auf 1800 Metern zu den eher höhergelegenen Skigebieten in Bayern.
Die erst 2018 neu gebaute 6er-Sesselbahn wurde verkauft und soll wieder abgebaut werden. Statt dessen ist eine Rodelbahn geplant: Der Jenner als Erlebnisberg direkt an der Grenze zum Nationalpark Berchtesgaden, an dem »alles geht«. Damit reagiert die Liftgesellschaft »auf die Schneelage der letzten Jahre ebenso wie auf die Nachfrage unserer Gäste« (Berchtesgadener Bergbahn AG 2024). Zurück bleiben erhebliche Eingriffe in die Landschaft wie das 48 000 Kubikmeter große Speicherbecken an der Mittelstation oder der durch die Baustraße zerstörte, große Balzplatz für das Birkwild.
Dass es auch anders und besser geht, zeigt das Beispiel der Hörnlebahn in Bad Kohlgrub. Die 2er-Sesselbahn war in die Jahre gekommen und sollte abgerissen und neu gebaut werden, doch der Gemeinderat entschied sich gegen einen Neubau und damit auch gegen die Kapazitätssteigerung. Die nostalgischen Schwenksessel werden nach der Sanierung nicht schneller an der Gipfelstation sein und auch nicht mehr Personen befördern als bisher. Entschleunigung ist hier die Devise.
Das Hörnle ist auf ganzjährigen Tourismus ausgerichtet. Hier gibt es keinen Skizirkus, der mit aller Macht erhalten werden soll. Weil die explizite Ausrichtung auf den Skisport fehlt, war auch lange Zeit nicht klar, ob die Sanierung der Hörnlebahn von der Seilbahnförderung bezuschusst wird. Letztendlich wurde der Zuschuss von 35 Prozent genehmigt. Bei Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro sind das Peanuts im Vergleich zu riesigen Neu- und Ausbauprojekten. Die Sanierung hat bereits begonnen und soll im Juni 2026 abgeschlossen sein.

BEATE RUTKOWSKI
Stellvertretende BN-Vorsitzende
Ein so genanntes Modernisierungsgesetz nach dem anderen bringt die bayerische Staatsregierung gerade durch den Landtag, aktuell wurde schon das vierte vorgelegt. Doch der Blick auf diese Gesetze zeigt, was das Kabinett unter »Hindernissen« versteht: Es sind immer wieder Umwelt- und Naturschutz sowie Mitspracherechte, die als angebliche Bürokratie abgeschafft werden sollen. Ob massive Erleichterungen für neue Skilifte und Schneekanonen in den Bergen, die Abschaffung von Transparenzberichten wie zu Klimaschutz oder Lobbyismus oder aber das Verbot für die Kommunen, die arten- und klimafeindlichen »Schottergärten« zu untersagen: Diese »Modernisierung« bedeutet vielfach Deregulierung, den Abbau von über viele Jahre erkämpften und bewährten Schutz- und Mitspracherechten.
Damit erschwert sie sogar an vielen Stellen das Leben der Bürger*innen – zumindest derjenigen, die aktiv an der Sicherung und Gestaltung ihres Lebensumfelds teilnehmen wollen. Ausgebaut wird dagegen vor allem das Recht durchsetzungsstarker staatlicher wie privater Akteur*innen, die sich über den Schutz von Lebensgrundlagen und Gemeinwohlinteressen hinwegsetzen wollen.
Ob nun die Klima- oder die Demokratiefrage: Die realen Herausforderungen unserer Gegenwart und Zukunft erfordern es immer dringender, eine schonende Nutzung unserer Lebensgrundlagen zu gestalten und Informations- und Beteiligungsrechte zu erweitern.
Aber weniger Transparenz und mehr Recht des Stärkeren – das ist nicht modern, das ist Steinzeit.
WAS ÄNDERT DAS VIERTE MODERNISIERUNGSGESETZ AN DER LANDESPLANUNG?
• Großprojekte mit bedeutenden Auswirkungen auf Landschaft, Natur
Bayern erlebt gerade einen Modernisierungsschub – sagt die Staatsregierung. Der BN sagt: Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung: ja, aber nicht auf Kosten der Umwelt.
und andere Schutzgüter können leichter landesplanerische Ziele ignorieren (§7/2). Die Verbindlichkeit der Landesplanung insgesamt wird empfindlich ausgehöhlt. Gleichzeitig wird die Beteiligung von Bürger*innen an der Raumplanung beschnitten. Größere Ellbogenfreiheit für Investor*innen zulasten von Natur, Umwelt und Klima.
• Die oberste Landesplanungsbehörde (und damit das Wirtschaftsministerium) legt allein fest, welche Verbände oder Sachverständige in den Landesplanungsbeirat berufen werden. Der Beirat muss an der Erstellung des
Landesentwicklungsprogramms nicht mehr beteiligt werden (§7/7).
Der Beirat verliert Unabhängigkeit und Relevanz, Fachwissen aus der Zivilgesellschaft geht verloren.
• Bisher ist klar definiert, zu welchen Themen Landesentwicklungsprogramm und Regionalpläne grundsätzliche Vorgaben machen dürfen, etwa zu Siedlungsstruktur, Energieversorgung oder Freiraumsicherung. Dieser Katalog wird gestrichen, was die thematische Beschränkung der Pläne erleichtert (§7/8).
Die Befugnisse der Regional- und Landesplanung werden eingeschränkt.

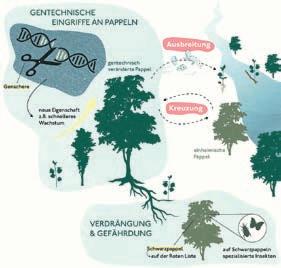

ist Gentechnik-Expertin beim BUND-Bundesverband.
Unter dem Deckmantel der Innovationsförderung sollen Pflanzen, deren DNA gezielt bearbeitet wurde, künftig weit weniger reguliert werden. Pflanzen aus neuer Gentechnik könnten so bald ohne Risikoprüfung und Kennzeichnung auf unseren Äckern, in unseren Wäldern und auf unseren Tellern landen. Für die gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft und uns alle wäre dies ein massiver Verlust an Transparenz und Wahlfreiheit. Für die Umwelt birgt das geplante Gesetz unkalkulierbare Risiken. Denn damit wäre es möglich, auch Wildpflanzen zu manipulieren und freizusetzen. Die Mehrheit der Deutschen will keine Gentechnik im Essen, das bestätigen Umfragen seit Jahren. Dank der Kennzeichnungspflicht dürfen wir selbst entscheiden, was in unserem Einkaufswagen landet. Fällt diese weg, können weder die Höfe noch wir als Konsument*innen nachvollziehen, ob Saatgut, Obst, Gemüse oder verarbeitete Produkte mit Gentechnik
GENTECHNIK
Die EU treibt derzeit ein Gesetz voran, das die Landwirtschaft und unsere Natur tiefgreifend verändern könnte. Der BUND warnt vor den Folgen.
erzeugt wurden. Auch die Koexistenz mit der gentechnikfreien Landwirtschaft wäre massiv erschwert.
Indem die geplante Deregulierung Wildpflanzen mit einbezieht, ignoriert sie das Vorsorgeprinzip, einen Grundpfeiler des europäischen Umwelt- und Gesundheitsrechts. Demnach muss ein potenzielles Risiko im Vorfeld ausgeschlossen werden. Genau das fordert auch die Gesellschaft für Ökologie. Sie kritisiert, der Vorschlag der EU-Kommission lasse fundamentale ökologische Prinzipien außer Acht. Kreuzen sich die gentechnischen Veränderungen in Wildpopulationen aus, wären die Folgen weder vorherzusehen noch zu kontrollieren. Und speziell gentechnisch veränderte Wildpflanzen könnten die biologische Vielfalt ernsthaft bedrohen. Diese Risiken aber spielen in der Debatte auf EU-Ebene bisher keine Rolle.
BEISPIEL PAPPEL
Schon Jahrzehnte wird daran geforscht, Baumarten gentechnisch zu verändern. Aus Umweltsicht ist das besonders heikel. Denn Bäume sind langlebig und spielen in vielen Ökosystemen eine Schlüsselrolle.
Ein anschauliches Beispiel liefert die Pappel. An ihr wird gentechnisch intensiv geforscht. Das Ziel: schnelleres Wachstum und weniger Lignin im Holz, um sie leichter zu Papier oder Biokraftstoff verarbeiten zu können. Noch werden GentechPappeln nicht kommerziell angebaut. Sie befinden sich aber bereits in Feldtests und Freisetzungsversuchen, etwa in Belgien, Schweden und den USA.
DEREGULIERUNG STOPPEN
Geht es nach der EU, sollen derartige Pappeln ohne Risikoprüfung in die Natur gelangen. Das Problem: Ihre Samen würde der Wind kilometerweit verbreiten. Und so könnten mittelfristig heimische Arten wie die gefährdete Schwarzpappel verdrängt werden. Davon wären auch zahlreiche Tierarten betroffen, die an und von Pappeln leben. Zudem zeigen sich negative Folgen oft nicht sofort. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis ein ökologisches Problem offensichtlich wird – nachdem sich die Bäume längst verbreitet haben.
Der BUND fordert diese riskante Deregulierung zu stoppen. Vorsorgeprinzip, Risikoprüfung und Kennzeichnungspflicht müssen für alle gentechnisch veränderten Organismen erhalten bleiben.
Erneuerbare Energien machen uns unabhängig von Öl, Kohle und Gas und schonen damit das Klima. Doch für eine komplett erneuerbare Versorgung auch im Winter braucht Bayern deutlich mehr Windräder.

Sprecher des BN-Arbeitskreises Energie

KASIMIR BUHR
BN-Referent für Energie und Klimaschutz
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat in Bayern zuletzt einige Fortschritte gemacht: 2024 stammten fast 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Doch es bleibt viel zu tun, denn in den Bereichen Wärme und Verkehr dominieren weiterhin Öl und Gas. Für eine vollständige Deckung braucht Bayern vor allem mehr erneuerbaren Strom im Winter.
Der Anteil von Erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch (Strom, Wärme und Verkehr) liegt in Bayern aktuell bei nur 25 Prozent. Um das zu ändern, werden wir – selbst bei ehrgeizigen Einsparmaßnahmen – deutlich mehr grünen Strom benötigen: für Wärmepumpen, Elektroautos und Züge.
Aktuell herrscht ein starkes Ungleichgewicht: Im Juli letzten Jahres stammten

85 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen, im Januar waren es nur 68 Prozent. Zugleich war die aus Öl, Kohle und Gas erzeugte Strommenge im Januar doppelt so hoch wie im Juli. Der Grund dafür: Ein Großteil des grünen Stroms in Bayern stammt aus der Sonnenenergie, die im Juli fast die Hälfte des Stroms liefert. Doch im Winter scheint die Sonne weniger, und Bayern produziert dann zu wenig Erneuerbare Energie. Gerade dann brauchen wir jedoch mehr Strom für Wärmepumpen, um die Wärmewende klimafreundlich voranzutreiben.
Das Problem ist hausgemacht: Jahrelang hat Bayern den Ausbau der Windenergie ausgebremst. Dabei gilt: Windstrom = Winterstrom. Windräder liefern in der kalten (und windigen) Jahreszeit deutlich mehr Strom als im Sommer und sind damit die ideale Ergänzung zu Solaranlagen. Als BUND Naturschutz setzen wir darum auf einen ausgewogenen Mix aus diesen zwei Erneuerbaren Energien. Speicher allein können das Problem nicht lösen: So
große Energiemengen über Monate zu speichern, wäre viel zu teuer und würde enorme Ressourcen verschlingen.
Wie viel Windkraft wir in Bayern brauchen, haben Forscher*innen 2021 für den BN berechnet: Unter der Annahme ehrgeiziger Sparmaßnahmen kamen sie auf einen Bedarf von 32 Gigawatt. Doch Bayern verfügt heute über magere 2,7 Gigawatt. Für eine Versorgung mit Erneuerbaren Energien rund ums Jahr muss die verfügbare Leistung verzwölffacht werden!
Das muss nicht bedeuten, dass auch die Anzahl der Windräder so stark steigen muss. Denn neue Anlagen sind deutlich leistungsstärker als ihre Vorgänger. Damit der Ausbau naturverträglich gelingt, haben wir als BUND Naturschutz strenge Kriterien für die Auswahl möglicher Windgebiete aufgestellt. Denn Klima- und Artenschutz müssen Hand in Hand gehen, nur so kann die Bewahrung unserer Natur gelingen.

Der globale Kreislauf des Wassers ist aus den Fugen geraten. Als Hauptursache gilt die fortschreitende Klimaerwärmung. In Europa steigen die Temperaturen stärker als auf jedem anderen Kontinent. Auch hierzulande macht sich die Wasserkrise immer deutlicher bemerkbar. Mit weitreichenden Folgen.
Häufiger als früher sind wir nun mit zu wenig oder zu viel Wasser konfrontiert. Das Muster der Niederschläge ist unberechenbar geworden. Neben der Menge des Wassers wird auch seine Qualität zum Problem. Vor allem in Trockenzeiten konzentrieren sich Nähr- und Schadstoffe in Flüssen und Seen. Auch das Grundwasser leidet, unsere wichtigste Trinkwasserquelle.
Wie antworten wir auf diese Entwicklung angemessen? Der BUND engagiert sich schon lange für den Schutz der Ressource Wasser und drängt die Politik zum Handeln. Mehr dazu auf den kommenden Seiten.



Die Oberweser zwischen Rühle (vorn) und Pegestorf. Ihre Aue gestaltet der BUND Niedersachsen wieder natürlicher und attraktiver, im Rahmen des Programms »Blaues Band Deutschland«.

HENRY TÜNTE
ist der Sprecher des BUND-Arbeitskreises Wasser.
Es ist die Quelle allen Lebens auf der Erde. Wasser formt die Landschaft, speist die Ökosysteme und ist unverzichtbar für das Überleben von Mensch, Tier und Pflanze. Doch die weltweiten Wasserressourcen stehen zunehmend unter Druck. Klimaextreme und Verschmutzung und ein unkontrollierter Verbrauch bedrohen die Qualität und Verfügbarkeit des kostbaren Guts.
Der BUND tritt dafür ein, das Wasser und die Gewässer umfassend zu schützen. Wir fordern die Bundesregierung auf, sorgsam mit unseren Wasserressourcen umzugehen – sowie den Zustand unserer Gewässer zu verbessern und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, da ringsum das Klima aus dem Lot gerät.
Der Schutz des Wassers ist elementar, um die Biosphäre zu bewahren. Und somit die Lebensgrundlage heutiger und künftiger Generationen.
Damit wir Menschen auch in Zukunft einen gerechten Zugang zu Wasser haben und die Natur ausreichend damit versorgt ist, müssen wir die Ressource Wasser nachhaltig und sparsam nutzen. Um unseren Verbrauch zu verringern, muss ein neues Gesetz klare Ziele setzen.
Das Grundwasser ist nicht allein eine Ressource, sondern auch ein sensibles Biotop. Seine Lebensgemeinschaften reinigen das Grundwasser und reagieren empfindlich auf Temperaturänderungen. Dieser Umstand verdient mehr Aufmerksamkeit. Besonders wenn es zu bewerten gilt, wie der schutzwürdige Lebensraum genutzt und beeinflusst wird.
Wirtschaftszweige wie die Industrie, der Bergbau oder die intensive konven-
tionelle Landwirtschaft schaden unseren Gewässern erheblich. Wer aber Gewässer belastet und verschmutzt, der muss die Folgen tragen und die Sanierung zahlen. Auch brauchen wir deutschlandweit einheitliche Preise für die Wasserentnahme. Sie müssen dem Verursacherprinzip folgen und klare Anreize dafür liefern, Wasser zu sparen.
Die Belastung des Grundwassers und der Gewässer mit Arzneimitteln und mit Kosmetika, mit Reinigungsmitteln und anderen Haushalts- und Industriechemikalien steigt unaufhörlich. Die Bundesländer gehören dazu verpflichtet, solch schädliche Einträge zu minimieren. Zudem fordert der BUND alle Kläranlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe auszustatten.
BESSER SPEICHERN
Nur noch ein Drittel unserer ursprünglichen Flussauen kann bei Hochwasser überschwemmt werden. Heftige Hochwasser treten immer häufiger auf. Darum benötigen unsere Flüsse deutlich mehr Raum.
Unsere Städte sind zunehmend von Hitze und Starkregen betroffen. Das Konzept der Schwammstadt zielt darauf, überschüssiges Wasser zu speichern und erst nach und nach an die Umgebung abzugeben – wie ein Schwamm. Entsprechend müssen die Städte umgestaltet werden, gefördert vom Bund und den Ländern. Auch deshalb fordert der BUND ab 2030 nur noch so viel Boden zu versiegeln, wie gleichzeitig entsiegelt wird (Ziel »netto-null«).
Um Hochwasser wie auch Trockenzeiten zu begegnen, ist es unerlässlich, Wasser naturverträglich und auf großer Fläche in der Landschaft zurückzuhalten. Dafür müssen wir unsere Flüsse und Auen, aber auch Feuchtgebiete, Moore und Wälder verstärkt renaturieren. Die historisch gewachsene Entwässerungslandschaft muss umgebaut werden. Viel zu sehr hat man hierzulande bisher auf bauliche Maßnahmen wie Deiche oder künstliche Rückhaltebecken gesetzt.

Wasser prägt viele unserer Landschaften, hier das Wildnisgebiet Tangersdorf in der Uckermark.
WENIGER SCHADSTOFFE
Mehr als ein Viertel unseres Grundwassers ist in schlechtem chemischen Zustand. Verschmutzt wird es vor allem durch große Mengen von Dünger und Pestiziden aus der Landwirtschaft. Wir müssen unser Grundwasser, unsere Flüsse und Meere vor der Überdüngung schützen. Der aktuelle Nitratbericht der Bundesregierung belegt: Noch immer liegt die Nitratbelastung an jeder vierten Messstelle über dem europaweiten Schwellenwert. Weniger zu düngen bedeutet unter anderem: weniger Tiere zu halten.
Natürliche Uferstreifen schützen Gewässer vor Schadstoffen, helfen Wasser zu speichern und Lebensräume zu verbinden. Daneben muss der Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide stark verringert werden. In Wasserschutzgebieten müssen sie ganz tabu sein.
Der BUND fordert von der Bundesregierung klare Regeln für die Landwirtschaft.
Und eine gezielte Unterstützung derjenigen Bauern und Bäuerinnen, die nachhaltig wirtschaften und somit das Wasser schützen.
(siehe Seite 19)

Einst fast überall ausgerottet, hat sich der Biber in Deutschland wieder ausbreiten können. Unsere Wasserlebensräume haben dadurch viel an Dynamik gewonnen.
Unser ganz persönlicher Wasserverbrauch wird maßgeblich davon bestimmt, wie Alltagsdinge im Inund Ausland hergestellt wurden. Rund 70 Prozent dieses Verbrauchs entfallen auf »virtuelles« Wasser. Es wurde für den Anbau importierter Lebensmittel oder die Produktion importierter Kleidung, Handys etc. beansprucht.
Derzeit gibt es massiven politischen Druck, die EU-Lieferkettenrichtlinie wieder abzuwickeln. Sie sieht vor, große Unternehmen zu verpflichten, für Menschen wichtige Wasserressourcen nicht messbar zu verschmutzen oder übermäßig zu verbrauchen. Unternehmen müssen auch dafür sorgen, dass sich ihre Zulieferer daran halten. Und sie müssen negative Auswirkungen auf Feuchtgebiete in ihrer Lieferkette vermeiden oder minimieren. Der BUND fordert die Bundesregierung auf, diese Richtlinie zu erhalten und vollständig umzusetzen.
Beispielhaft für interessante Wasser-Publikationen auf Landesebene steht ein neues BUND-Werkzeug aus Baden-Württemberg zum Wasserrückhalt im

Um die Trinkwasserversorgung zu sichern, müssen die Wasserschutzgebiete besser geschützt und mehr Reservegebiete eingerichtet werden. Chemikalien wie PFAS, die sich über Jahrtausende hin kaum zersetzen, gefährden unsere Gesundheit und verschmutzen die Umwelt. Je länger sie in Verwendung sind, desto mehr steigt ihre Konzentration in der Umwelt und in unseren Körpern. Sind PFAS erst einmal in die Umwelt und damit ins Wasser gelangt, lassen sie sich praktisch nicht mehr zurückholen. Deshalb muss die Produktion und Anwendung der Ewigkeitschemikalien schnellstmöglich gestoppt werden. Dies betrifft auch chemische Verbindungen, die so ähnlich wie PFAS wirken und unbeabsichtigt bei der industriellen und gewerblichen Produktion entstehen.
Deutschlands Flüsse und Bäche sind vielfach zerstückelt und verbaut. Im Durchschnitt unterbricht sie etwa alle 500 Meter ein Hindernis. Damit Fische und andere Wasserbewohner frei wandern können, müssen unsere Fließgewässer wieder durchgängig werden, von der Quelle bis zu ihrer Mündung.
Natürliche Auen können wie ein Schwamm große Wassermengen zurückhalten und bei Trockenheit wieder abgeben. Doch entlang unserer Flüsse kann Hochwasser nur einen kleinen Teil dieser einstigen Überschwemmungsfläche fluten. Daher müssen wir die Flüsse und Bäche mit ihren Auen vernetzen –damit sie wieder zu den Lebensadern werden, die sie immer waren. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU spielt hierbei eine zentrale Rolle.

> www.bund.net/wasser Den im Januar erschienenen Wasseratlas können Sie unter www.bund.net/wasseratlas herunterladen. Für BUND-Gruppen und Aktive gibt es bund-intern.net ein Aktionspaket zum Thema.
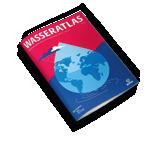

Es ist nicht so, dass es an guten Gesetzen und Programmen fehlte.
Doch zum Schutz des Wassers und der Gewässer muss man sie auch anwenden wollen.

SASCHA MAIER ist der Gewässerspezialist des BUND.
Drei wichtige Instrumente können dabei helfen, mehr Wasser in der Landschaft zu halten, die Wasserqualität zu erhöhen und Feuchtgebiete, Flüsse und Seen zu renaturieren. Ihr Einsatz muss politisch stärker gefördert werden.
MEHR VERNÄSSEN
Feuchtgebiete wie intakte Moore und Auen sind Schlüssellebensräume, um der Klimakrise zu begegnen. Doch speichern sie nur dann viel pflanzlichen Kohlenstoff und damit CO2 aus der Atmosphäre, wenn Moore großflächig nass oder wiedervernässt sind und Auen regelmäßig überflutet werden. Nur so stabilisieren sie auch den Wasserhaushalt der Landschaft. Das nationale »Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz« ist darum ein Hebel, auch für genug Wasser und Grundwasser in einer Region zu sorgen. Im September kündigte das Bundesumweltministerium an, das Programm weiterzuentwickeln. Gut so. Doch für den zentralen Lebensraum der Moore hat es das ursprüngliche Ziel stark heruntergeschraubt. Bis 2030
soll deren Vernässung nur noch 2,5 statt 5 Millionen Tonnen Treibhausgase jährlich einsparen müssen. Der BUND fordert das Förderinstrument am wissenschaftlich Notwendigen auszurichten. Mehr nasse und naturnahe Moore und Auen sind unverzichtbar für den Schutz des Klimas und der Natur.
Dieser Einsicht verdankt sich auch die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (siehe BUNDmagazin 3/2025). Mit ihr gibt es seit 2024 einen neuen Hebel, um den Wasserhaushalt unserer Landschaft zu stärken. Die meisten heimischen vom Wasser geprägten Ökosysteme hat der Mensch bekanntlich stark verändert, degradiert oder ganz zerstört. Feuchtgebiete und Gewässer wieder in einen natürlicheren Zustand zu überführen, hat größte Bedeutung für unsere natürlichen Lebensgrundlagen, Klima inklusive.
Ob und wie die Bundesregierung diesen Hebel zu nutzen gedenkt, ist noch unklar. Das Beteiligungsverfahren hat eben erst
begonnen und die unionsgeführten Agrarministerien drängen darauf, möglichst viele Vorgaben zu streichen. Der BUND setzt sich dafür ein, die neue Verordnung ehrgeizig umzusetzen.
RICHTLINIE ERNST NEHMEN
Bleibt zu hoffen, dass es ihr nicht ergeht wie der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Im Jahr 2000 geschaffen, ist sie das wichtigste Gesetz der EU, um die Ressource Wasser nachhaltig und umweltverträglich zu nutzen. Sie verpflichtet alle Mitgliedstaaten, ihre Gewässer bis spätestens 2027 in einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu versetzen. Eine Verschlechterung ist verboten.
Trotz überaus großzügiger Befristung liegen die Ziele der Richtlinie in weiter Ferne (Nicht mal ein Zehntel der hiesigen Bäche und Flüsse ist in gutem Zustand.) Statt sie zu achten, sorgen die EU-Länder für immer neue Ausnahmen. Erst jüngst vereinbarten sie, dass die Grenzwerte für Schadstoffe wie PFAS oder Pestizide erst 2045 eingehalten werden müssen.
Die EU muss den Schutz des Wassers und der Gewässer über 2027 hinaus verbindlich regeln – und die Versäumnisse der Mitgliedstaaten stärker ahnden. Damit unsere Gewässer einen guten Zustand erreichen, müssen ihre Uferstreifen breit genug sein. Speziell die Flüsse brauchen wieder mehr Raum! Zudem fordert der BUND mehr Geld und Personal, um die Richtlinie endlich umzusetzen.

Wo Gesetze ins Leere laufen, ist Selbsthilfe angezeigt. Aktive des BUND Märkisch-Oderland und der
initiative »Save Oder Die« nutzten den internationalen Tag der Flüsse, um in der Oderaue Müll zu sammeln.
Wie

unser Land bewirtschaftet wird, ist eine entscheidende Größe, wenn es darum geht, den Wasserhaushalt zu schützen. Worauf kommt es dabei an?

DANIELA WANNEMACHER
leitet das Team Landnutzung des BUND.
Weltweit gerät der Wasserkreis lauf aus dem Gleichgewicht. Dies auch, weil Pestizide und Nährstoffe speziell aus der Landwirtschaft in unseren Gewässern immer häufiger die Grenzwerte überschreiten. Die gute Nachricht lautet: Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, um Gewässer zu schützen, Höfe an das sich ändernde Klima anzupassen und den Wasserhaushalt wieder zu stabilisieren.
So gilt: Je mehr Wasser Böden aufnehmen und speichern, besser können sie längere zeiten wie auch starke Niederschläge puffern. Wichtig ist dafür, ihren Humusgehalt zu erhöhen und ihr Bodenleben zu fördern. Stichworte sind hier die organische Düngung und Einarbeitung von Pflanzenresten, die Durchwurzelung und Lockerung der Böden, der Einsatz von Zwischenfrüchten und eine möglichst durchgängige Bodendeckung, die zudem die Verdunstung verringert.
Best Practice: Gewässerreiche Wirtschaftsfläche des Ökohofs Brodowin in Brandenburg.
Mit zunehmender Hitze und längeren Trockenphasen werden sich künftig auch die Kulturen auf den Feldern ändern. Statt auf Bewässerung sollten die Betriebe auf mehr Anbauvielfalt setzen. So können sie ihr Einkommen sichern und Risiken streuen, auch wenn einzelne Kulturen wegen zu viel oder zu wenig Wasser ausfallen. In Brandenburg wird schon der Anbau von Hirse erprobt, und im Rheingraben ist Soja als Kultur etabliert.
Wasser in der Landschaft zu halten, gelingt mit dem, was zwischen den Feldern steht: Hecken und Gehölze schützen vor Erosion und Nährstoffaustrag. Als Inseln mit feucht-kühlem Mikroklima tragen sie zur Resilienz bei und sorgen für einen besseren Wasserhaushalt der Böden.

NEUE KULTUREN
Im Ökolandbau gehört all das zum Standard, auch verzichtet er auf Mineraldünger und Pestizide, welche das Bodenleben schädigen können. Wer ökologisch wirtschaftet, hat deshalb bei den extremen Wetterereignissen der vergangenen Jahre oft stabilere Erträge erzielt.
Auch am Gewässerrand haben Gehölzoder Blühstreifen eine wichtige Pufferfunktion. Aus ökologischer Perspektive müssen sie breit genug sein, um Fließgewässer, Teiche und Seen gegen den Eintrag von Nitrat, Phosphat oder Pestiziden zu schützen.
Wo Trinkwasser gefördert wird, unterstützen Wasserversorger Ökobetriebe, um Grund- und Oberflächenwasser zu entlasten, von »München Wasser« bis zum Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Viele Höfe legen schon Hecken und Blühstreifen an, entscheiden sich für den Ökolandbau und wirtschaften bodenschonend. Doch auch die Politik muss sich für den Schutz des Wassers engagieren. Die neue Bundesregierung aber hat die Gegenrichtung eingeschlagen:
Im Sommer nahm sie die Höfe aus der Pflicht, ihren Nährstoffeinsatz zu bilanzieren. Und jüngst kündigte Agrarminister Alois Rainer an, auch die Strategie zur Verringerung von Pestiziden auszusetzen. Hier fordert der BUND dringend den Kurs zu ändern.
Deutschlandweit nahm der BUND in diesem Sommer
Trinkwasserproben und testete sie auf Schadstoffe wie PFAS.

JANNA KUHLMANN ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Chemikalienpolitik.
Der Großteil unseres Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen. Doch das ist zunehmend belastet.
Auch Schadstoffe tragen dazu bei. Per und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe von über zehntausend ungemein beständigen Chemikalien. Das kleinste und mobilste Molekül dieser Ewigkeitschemikalien ist Trifluoracetat (TFA). Bei einer Stichprobe fand es der BUND 2024 sogar in mehr als jedem zweiten Mineralwasser. Um auf die Gefährdung des Trinkwassers durch PFAS hinzuweisen, trat der BUND jüngst mit politischen Akteuren in Kontakt, speziell aus dem neu zusammengesetzten Bundestag.
PROBEN GENOMMEN

Trinkwassertest in der Erfurter Altstadt mit dem abgeordneten Michael Hose (rechts).
in Klimaanlagen, die Müllverbrennung oder Pestizide. Auch fanden wir einige längst verbotene PFAS. Als Teil von Löschschäumen können sie noch Jahrzehnte nach einem Brand das Grundwasser belasten. Ein bedenkliches Ergebnis.
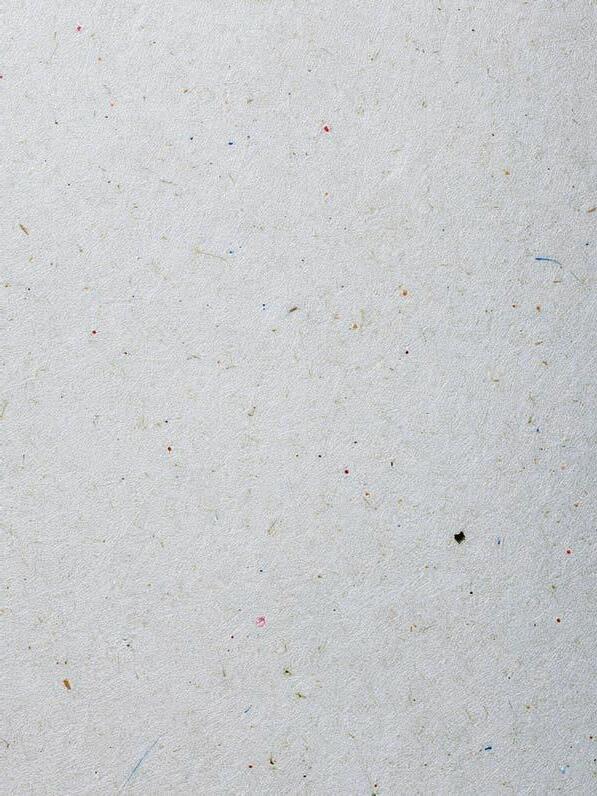
Aktive unserer Landesverbände oder auch Orts- und Kreisgruppen trafen sich über den Sommer mit Abgeordneten. Sie stellten dabei ihre Arbeit vor und nahmen Grund- oder Leitungswasserproben. Die mehr als 60 Proben wurden dann in einem Labor auf Dutzende PFAS- und weitere langlebige Schadstoffe getestet. So zeigte die Ortsgruppe Husum dem wasserpolitischen Sprecher der CDU im Bundestag, Leif Erik Bodin, ihren BUNDGarten und nahm dort mit ihm eine Probe Leitungswasser. Anschließend präsentierten wir ihm im Bundestag die Ergeb-
nisse des Tests und unsere Forderungen. Am Trinkwasserbrunnen auf dem Fischmarkt in Erfurt fand ein Treffen mit dem CDU-Abgeordneten Michael Hose statt. Proben nahmen wir auch mit Annika Klose (SPD) an einer Schwengelpumpe am Berliner Reichstagsufer sowie mit Andrea Lübcke (Grüne) am Rande einer Bürgerveranstaltung zu PFAS im brandenburgischen Zeuthen. Zudem trugen wir unser Anliegen in viele Wahlkreisbüros.
Unsere Auswertung ergab: 42 von den 46 Trinkwasserproben enthielten PFAS. Am häufigsten waren die kurzkettigen Stoffe TFA, Perfluorbutan-, -propan- und -butansulfonsäure. Sie stammen aus Kläranlagen und Industrieabwässern oder gelangten mit der Luft ins Wasser, über Kältemittel
Die gute Nachricht: Ab Januar gelten in Deutschland Grenzwerte für 20 PFAS im Trinkwasser. Nur eine Probe hat sie überschritten; der Wasserversorger vor Ort arbeitet mit Hochdruck an einer besseren Reinigung. Mehrfach über den Grenzwerten lagen unsere Grundwasserproben aus Berliner Schwengelpumpen. Das zunehmend verunreinigte Grundwasser aufzubereiten kostet die Trinkwasserversorger viel Geld. Die Verursacher werden nicht belangt.
Auch hierzulande werden PFAS in großen Mengen hergestellt, so in Leverkusen von Covestro, Bayer und Momentive, in Bad Wimpfen von Solvay, in Frankfurt am Main von Daikin und in Burgkirchen an der Alz von Dyneon, Archroma und W. L. Gore. Solvay immerhin kündigte an, ab 2026 kein TFA mehr herzustellen und in den Neckar zu leiten – ein Erfolg! Unklar bleibt, ob der Konzern nicht nur auf ein anderes PFASMolekül umsteigt. Der BUND fordert die ganze Stoffgruppe EU-weit zu verbieten.
www.bund.net/pfas
GRUNDWASSERSITUATION IN BAYERN
Grundwasser ist eine lebenswichtige Ressource, von der unsere Zukunft abhängt. Und sie wird in Bayern immer knapper!

RENATE GÖTZENBERGER
Stellvertretende Sprecherin des BN-Arbeitskreises Wasser
Die Klimakrise bringt immer häufiger Phasen von Hitze und Trockenheit mit sich. Dann steigt der Wasserverbrauch –nicht zuletzt in der Landwirtschaft. Gleichzeitig führen der Klimawandel und die Änderung der Landnutzung zu einer Abnahme der Grundwasserneubildung. Auch in einem regenreichen Land wie Deutschland drohen damit Wasserknappheit und Verteilungskonflikte. Seit Jahren ist die Grundwasserneubildung rückläufig: Von 2020 bis 2024 war sie in Bayern im Vergleich zu den Jahren 1971 bis 2000 in allen Regierungsbezirken geringer. 80 Prozent aller Grundwas-
sermessstellen in Süddeutschland weisen einen Rückgang der Messwerte auf! Gründe dafür sind die geringere Grundwasserneubildung, die Beschleunigung des Wasserabflusses durch die Landnutzung und anhaltend hoher Wasserverbrauch.
Der BUND Naturschutz fordert deshalb: Die Weichen für eine auch in Zukunft sichere Versorgung mit Trinkwasser müssen jetzt gestellt werden! Und das bedeutet nicht – so wie es derzeit die Bayerische Staatsregierung plant – dass auch die letzten noch nicht erschlossenen großen Trinkwasservorkommen erschlossen werden sollen. Es bedeutet auch nicht, Wasser aus der Bodenseeregion nach Nordbayern zu pumpen.
Schafft unsere Gesellschaft den Wertewandel von »immer mehr« zu »so viel, wie nötig«? Auch beim Wasserverbrauch ist weniger mehr. Wir können alle dazu beiden nötigen Wandel von einer ungezügelten Verbrauchsmentalizu einer Haltung des Maßes und der Rücksicht auf Natur und Umwelt und damit unsere Lebensgrundlagen voranzubringen. Die Zukunft unserer Kinder und Enkel hängt davon ab.
BN-Empfehlungen zum Umgang mit Grundwasser
• Trinkwasser muss sparsam verwendet werden. Wassersparmaßnahmen sind in allen Nutzungsbereichen zu fördern und zu fordern: in Industrie und Gewerbe, in der Landwirtschaft und in den privaten Haushalten. Ein wirksames Mittel zur Steuerung des Wasserverbrauchs ist ein angemessenes Wasserentnahmeentgelt für alle Nutzungen.
• Wasserabhängige Ökosysteme dürfen durch Wasserentnahmen nicht beeinträchtigt werden.
• Alle Wasserentnahmen müssen erfasst werden. Übernutzungen von Grundwasserleitern sind zu verhindern.
• Lokale, dezentrale Wasserversorgungen sind zu fördern. Keine Ausweitung von Fernwasserversorgungen, da deren große punktuelle Wasserentnahmen oft Schäden am Ökosystem hervorrufen.
• Flächendeckender Grundwasserschutz und effektive Maßnahmen zur Sanierung belasteter Grundwasservorkommen.
• Kennzeichnung des virtuellen Wassers in Produkten, damit die Verbraucher*innen gezielt Produkte mit geringem Wasserverbrauch auswählen können.


Wir müssen heute die Weichen stellen, damit auch morgen unsere Brunnen nicht versiegen.
• Natürlicher Wasserrückhalt in den Böden und der Landschaft statt Wasserableitung durch Entwässerung.

PETER HIRMER
Sprecher des BN-Arbeitskreises Wasser
Eine Abgabe auf Wasserentnahmen ist aus zwei Gründen sinnvoll und dringend erforderlich. Für den Gewässerschutz und den Trinkwasserschutz sind bereits jetzt Geldmittel im großem Umfang erforderlich. Durch den Wassercent sollen die Verbaucher*innen verursachergerecht an der Finanzierung des Gewässerschutzes beteiligt werden. Der Wassercent könnte zudem eine wichtige Lenkungswirkung entfalten, wenn er denn entsprechend ausgestaltet wäre. Doch so, wie ihn das neue bayerische Gesetz vorsieht, kann er diese Anforderungen nicht erfüllen, denn: Wesentliche Nutzergruppen wie etwa Industrie, Handwerk und Energiegewinnung sollen beim Wassercent ausgenommen sein. Da pro Nutzer auch noch 5000 Kubikmeter Wasser zum Beispiel bei der landwirtschaftlichen Bewässerung abgabenfrei bleiben sollen, werden überwiegend nur Haushalte, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, über den Wasserpreis den Wassercent zahlen müssen.
Die Bayerische Staatsregierung plant die Einführung eines Wassercents in Bayern. Doch der Gesetzentwurf ist bürokratisch, ungerecht und für den Wasserschutz nicht ausreichend.
Der Bayerische Städtetag teilt diese Einschätzung. In einer Pressemitteilung vom Juli heißt es: »Das Schutzgut Wasser steht infolge des Klimawandels unter Stress, der Nutzungsdruck auf die knappen Wasserressourcen wird in Zeiten mit geringem Wasserdargebot steigen. Dies geht allerdings mit der im Gesetzentwurf nicht enthaltenen Messpflicht für Grundwasserentnahmen in größeren Mengen und den großzügigen Ausnahmeregelungen für Landwirtschaft und Betriebe nicht zusammen.«
Der BUND Naturschutz bewertet den Gesetzentwurf als völlig unzureichend und fordert, dass alle, die Wasser nutzen, auch ihren Beitrag zum Schutz des Wassers leisten. Insbesondere die Nutzung des wertvollen Tiefenwassers muss mit mindestens einem Wassereuro pro Kubikmeter noch wesentlich verteuert werden.
Für die Gewässerbewirtschaftung sind konkrete und zeitnahe Nutzungsdaten erforderlich. Die veränderten Wetterverhältnisse machen es erforderlich, die Wasser-

entnahmen auf einen ökologisch verträglichen Anteil des tatsächlich verfügbaren Wasserangebots zu beschränken. Deshalb braucht es auch manipulationssichere Aufzeichnungsgeräte, die Wassermengen festhalten und digital an die Behörden übermitteln. Bei der Verwendung des Wassercents ist darauf zu achten, dass zusätzliche Maßnahmen für den Gewässerschutz und die Gewässerökologie finanziert werden.
Für den BUND Naturschutz ergibt sich das Fazit: Der Wassercent wäre ein wichtiges Instrument für den Schutz des Wassers. Der Gesetzesentwurf der Bayerischen Staatsregierung ist jedoch für diesen Zweck völlig unzureichend und muss dringend nachgebessert werden.
Mehr Infos: Mit einem eigenen Konzept zum Wassercent zeigt der BN auf, wie eine Lösung aussehen würde:



Wo der »Baumeister Biber« arbeitet, wie hier im Naturschutzgebiet Spessartwiesen, wird mehr Wasser in der Landschaft zurückgehalten.
Der BUND Naturschutz setzt sich für einen guten Landschaftswasserhaushalt ein. Was verbirgt sich hinter dem langen Wort und warum ist er gerade in Zeiten der Klimakrise so wichtig?
Der Landschaftswasserhaushalt beschreibt, wie sich Wasser in der Natur und in unseren Kulturlandschaften verteilt, wie es sich bewegt und gespeichert wird. Gerade Letzteres, also die Fähigkeit zum Wasserrückhalt und zum Wasserspeichern, ist seit vielen Jahren vom Menschen mehr und mehr reduziert worden. Vor allem die massive Begradigung und Kanalisierung von Bächen und Flüssen, aber genauso auch das Trockenlegen von Mooren und Feuchtgebieten, hat dazu beigetragen. In jüngerer Vergangenheit kam die massive Versiegelung von Böden durch Gewerbe-, Wohn- und Straßenbau hinzu.
Die Folge: Es wird zu wenig Niederschlag in der Fläche gespeichert. Das kann zu Trockenheit, zu sinkenden Grundwasserspiegeln und – bei heftigen Niederschlägen – zu Hochwasser führen. Der BN engagiert sich hier, um Abhilfe zu schaffen, unter anderem durch Renaturierung von Fließgewässern, durch die Wiedervernässung von Mooren und den Kampf gegen Bodenversiegelung.
Ein wichtiger Partner in Sachen Wasserhaushalt ist übrigens der Biber. Er hat durch seine Bautätigkeit die einzigartige Fähigkeit, Bäche in ein Mosaik von vielen Lebensräumen zu verwandeln. Davon profitieren nicht nur Fauna und Flora, sondern auch wir Menschen, denn wo der Biber aktiv ist, wird bei Starkregen mehr Wasser in der Fläche zurückgehalten. Weil das aufgestaute Wasser langsam im Boden versickert, bildet sich mehr Grundwasser. Alle diese Maßnahmen kosten keinen Cent! Dort, wo Nutzung und Biberaktivität kollidieren, gibt es Beratung und Hilfe.

Mehr Infos dazu: www.bund-naturschutz.de/biber
Energiewende ja, aber mit guten naturschutzfachlichen Leitplanken – so lässt sich die Position des BN zu Erneuerbaren Energien zusammenfassen. Auch wenn der BUND Naturschutz von der Notwendigkeit von Energiespeichern überzeugt ist, hat der Verband gegen den geplanten Speicher bei Riedl im Landkreis Passau Klage eingereicht. Die Delegiertenversammlung hat mit großer Mehrheit den Klageweg befürwortet. Es gibt gute Gründe dafür: Das Kraftwerk würde in einem europaweit bedeutsamen Flora-Fauna-HabitatSchutzgebiet liegen und das Wasser direkt aus der Donau entnehmen. Ein sonst übliches Unterbecken ist nicht vorgesehen. Diese Nutzung und die damit verbundenen sehr rasch wechselnden Wasserstände, Druckunterschiede und Pumpprozesse würden viele aquatische Arten und Lebensräume bedrohen. Insbesondere die für die gesamte Donau bedeutende Fischfauna wäre durch den Verlust von Jungfisch-Lebensräumen und das Einsaugen stark gefährdet. Denn der Fischschutz an der Entnahmestelle des Wassers in der Donau ist völlig unzureichend. Aus Kostengründen soll ein bisher nicht in diesem Maßstab erprobtes Scheuchsystem eingesetzt werden, und die Rechenabstände sind viel zu groß.
Die Energiewende benötigt verschiedene Speicher. Pumpspeicher können hierzu einen Beitrag leisten. Im Fall des Pumpspeicherwerks Riedl aber sind konkret der falsche Standort in einem Schutzgebiet, die Nutzung eines Flussabschnittes als Unterbecken und der fragwürdige Fischschutz entscheidende Gründe für die Ablehnung des Vorhabens.
Daher hat der BUND Naturschutz Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss eingereicht. Ob das Pumpspeicherkraftwerk jemals gebaut wird, ist jedoch wegen der gravierenden Umweltauswirals zweifelhaft.

Ein Pumpspeicherkraftwerk wie hier Hohen Warte in Thüringen ist immer mit Eingriffen in die Natur verbunden. Deshalb ist die Standortwahl entscheidend.
Im zeitigen Frühjahr mit violettem Blattaustrieb und gelbgrünen Blüten, später mit knallroten Fruchtständen, die im Winter lange am Strauch verbleiben – so ist der Rote Holunder ganzjährig auffallend.

IRMELA FISCHER
Die Autorin arbeitet selbstständig als Naturbegleiterin und Umweltpädagogin. Sie bietet auch für den BUND Naturschutz und das NEZ Allgäu Exkursionen und Kräuterwanderungen an.
Der Rote Holunder (Sambucus racemosa), auch als Traubenholunder bekannt, spielt in Ökosystemen als Erstbesiedler von Kahlflächen eine wichtige Rolle. Er bereitet schnellwüchsig und mit leicht zersetzlichem Laub den Boden nach Windwurf oder Borkenkäferbefall für weitere Pionierarten und fördert die Wiederbewaldung.
Die Früchte dienen Raupen mehrerer Eulenfalter und Spanner, Schwebfliegenund Käferarten sowie über 40 Vogelarten und Kleinsäugern als Nahrung, auch den nicht körnerfressenden kleineren Singvögeln. Samenkerne werden von letzteren nicht zerstört und so verbreitet. Er ist sehr robust, ausschlagkräftig und frosthart, wächst auf sauren Böden und verträgt hohen Verbissdruck durchs Wild, jedoch weder Trockenheit noch Salz.


Rohe Früchte wurden schon in Antike und Mittelalter als Abführ- und Brechmittel, verarbeitet auch bei Erkältungen und Asthma genutzt. Der Tee aus getrockneten Blüten oder Beeren soll krampflösend, harn-, schweißtreibend, fiebersenkend und antioxidativ sein, Wurzeln helfen als Umschlag gegen Entzündungen und Warzen, und die Beerentinktur wird äußerlich bei Rheuma und Gelenkschmerzen eingesetzt.
Beim Verzehr ist Vorsicht geboten! Unsere Holunderarten enthalten das giftige Sambunigrin, das zwar durch Erhitzen unschädlich gemacht wird. Bei den harten Samenkernen des Roten Holunders funktioniert dies jedoch nicht zuverlässig, so dass diese restlos entfernt werden müssen. Abgekocht und ohne Samen ist er als Saft, Sirup und Gelee verwendbar, beson-
ders als Stärkungsmittel in der kalten Jahreszeit.
Die Kerne sind sehr ölhaltig; das Rote Holunderöl setzt sich beim Köcheln ab, kann abgeschöpft werden und wurde in der Volksmedizin vor allem äußerlich als Einreibung bei Hals- und Ohrenschmerzen, gegen Hautkrankheiten und Fieberblasen verwendet.
Ein Hinweis für Gärtner*innen: der schwere, süßliche Geruch vertreibt zuverlässig Wühlmäuse. Unsere Vorfahren haben mit Rotem Holunder ihr Kupfergeschirr geputzt.
Hollerbüsche, ob schwarz oder rot, galten lange als heilig. Als Schutzbaum, Bindeglied zwischen den Welten, gehörten sie an Haus und Hof. Welche Art verwendet wurde, war meist von Vorlieben und der Höhenlage bestimmt.
Moschuskrautgewächse mit Steinfrüchten (keine Beeren), auf stickstoffreichen Böden, auf Waldlichtungen, an Waldrändern und Gebüschen, außer im Tiefland häufig, weltweit mehr als 20 Arten, drei davon in Mitteleuropa:
• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): reich verzweigter Strauch oder bis 10 Meter hoher Baum, weißblütige Schirmrispen ab Mai, schwarz glänzende Früchte ab Ende August
• Roter Holunder (Sambucus racemosa): Trauben-, Berg- oder Hirsch-Holunder, schmale, stark gezähnte
Blätter, Blütenrispen aufrecht und kegelförmig, leuchtend rote Früchte bereits im Juli, wächst in kühleren, höheren Lagen in Mittel- und Süddeutschland bis auf 1800 Meter
• Zwergholunder (Sambucus ebulus): krautig, Stengel unverzweigt, großflächige Bestände, weiße, am Rand rosa Blüten, schwarze Früchte, in allen Pflanzenteilen giftig, im Mittelalter gegen Pferdekrankheiten, deshalb in der Nähe von Ritterburgen gepflanzt und heute noch dort zu finden
Projektabschluss »Quervernetzung Grünes Band« an den Brietzer Teichen bei Salzwedel.

GRÜNES BAND
Lebensräume verknüpfen und Insekten erforschen – zwei Schwerpunkte unseres diesjährigen Einsatzes am Grünen Band.

LIANA GEIDEZIS
leitet das Kompetenzzentrum Grünes Band des BUND.
Nach sechs Jahren haben wir das Projekt »Quervernetzung Grünes Band« erfolgreich abgeschlossen, mit unseren Partnern im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Damit stärken wir Deutschlands größten Biotopverbund entlang des einstigen Eisernen Vorhangs. Das Band wird zum Netz – ein wichtiges Ziel des BUND. Neu geschaffene ökologische Korridore und Trittsteine verbinden das Grüne Band mit der umliegenden Landschaft. Tiere können jetzt wandern und Pflanzen sich
ausbreiten, sei es die Dünen-Pelzbiene, die Waldbirkenmaus oder Arnika und Breitblättriges Knabenkraut. Gegen den bundesweiten Trend erhöhte sich der Bruterfolg von Kiebitz und Braunkehlchen. Wir konnten 110 Hektar wertvolle Biotope dauerhaft sichern und 700 Hektar Grünland für den Schutz von Wiesenvögeln verbessern. Dabei entstanden mehr als 55 Kleingewässer und zehn Kilometer verbindende Achsen zum Grünen Band.
WO LEBT WAS?
Mit der Erfassung der Artenvielfalt entlang der gesamten 1378 Kilometer wollen wir nun mehr über die Biodiversität im Grünen Band erfahren. Von der Ostsee bis
Werden Sie jetzt Patin oder Pate für das Grüne Band! Ab einer Spende von 5 Euro im Monat schützen Sie die Lebenslinie an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Ihr Weg zur Patenschaft: www.bund.net/patenschaften Svenja Klemm | +49 30 27586-429 | svenja.klemm@bund.net
In Deutschland diese Schwebfliege nur sehr selten entdeckt.

ins sächsisch-bayerische Vogtland untersuchen wir in einer breit angelegten Felderhebung die Insektenvielfalt, gefördert vom Bundesamt für Naturschutz.
Erste Ergebnisse zeigen, dass vom Aussterben bedrohte Arten das Grüne Band als wichtigen Rückzugsort nutzen. So konnten wir die Schwebfliege Microdon miki nachweisen. Ihre Larven ernähren sich unter einer Art Tarnkappe von der Brut in Ameisennestern. Da die Schwebfliege vor allem feucht-kühle Habitate besiedelt, könnte das Grüne Band eine wichtige Funktion bei ihrer Verbreitung einnehmen – als Süd-Nord-Korridor in Zeiten des Klimawandels.
Die Erkenntnisse aus der Studie sollen den nötigen Schutz und die Entwicklung der wertvollen Lebensräume im Grünen Band untermauern. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für die Nominierung des Grünen Bandes als UNESCO-Welterbe. Eine bundesweite Umfrage ergab: Fast zwei Drittel der Deutschen unterstützen die Idee einer solchen Welterbestätte.
Der BUND wird sich weiter speziell für einen durchgängigen Schutz des Grünen Bandes einsetzen.


Der Goldschakal lebt bereits seit zehn Jahren im Freistaat –weitgehend unbemerkt, weil er die Begegnung mit Menschen meidet. Nun mehren sich Berichte über das scheue Tier. Zeit, den Zuwanderer besser kennenzulernen.
Die Sommer in Europa werden heißer und die Winter sind weniger streng. Dadurch wandern Tiere bei uns ein, die früher hier keine geeigneten Lebensbedingungen vorfanden. Eines von ihnen ist der Goldschakal. Er breitet sich derzeit von seiner ursprünglichen Heimat in Südasien und Südosteuropa in Richtung Nordeuropa aus. Heute findet man ihn in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Ländern.
In der Bundesrepublik wurde der Goldschakal erstmals 1997 nachgewiesen, in Bayern kam 2015 das erste bestätigte Tier bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Aichach-Friedberg um. Seither hat es insgesamt 22 gesicherte Nachweise des Goldschakals im Freistaat gegeben.
Der erste Fortpflanzungserfolg in Deutschland wurde 2021 in Baden-Württemberg dokumentiert.
ÄHNLICH UND DOCH ANDERS
Der Goldschakal ist mit einer Schulterhöhe von etwa 50 Zentimetern größer als ein Fuchs (circa 40 Zentimeter) und deut-
lich kleiner als ein Wolf (circa 80 Zentimeter). Mit einem Körpergewicht von etwa 15 Kilogramm und einer Körperlänge von circa 105 Zentimetern zählt er zu den mittelgroßen Karnivoren. Oft wird er mit dem Fuchs verwechselt. So handelt es sich bei den allermeisten Goldschakalen, die den Behörden gemeldet werden, letztendlich um Füchse.
Das beste Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Tieren ist der Schwanz. Beim Fuchs ist er buschig und reicht bis auf den Boden. Der Goldschakal hat einen deutlich kürzeren und etwas glatteren Schwanz, dessen Spitze schwarz ist.
Was den Lebensraum anbelangt, ist der Goldschakal anpassungsfähig. Ursprünglich ist er in offenen und halboffenen Landschaften zuhause. Heute findet man ihn in den unterschiedlichsten Gegenden – von reich strukturierten Agrarlandschaften bis hin zu Feuchtgebieten. Bevorzugt werden warme, strukturreiche Lebensräume im Tiefland mit nur geringem Schneefall im Winter. Dichte Wälder be-
Wird häufig mit einem Fuchs oder Wolf verwechselt: der Goldschakal.
siedelt der Goldschakal nicht, ebenso wie intensiv bewirtschaftete Agrarflächen und Gebirge. Als dämmerungs- und nachtaktives Tier braucht er tagsüber ausreichend Deckung und Versteckmöglichkeiten.
Mit drei bis acht Quadratkilometern ist das Territorium eines Goldschakals deutlich kleiner als jenes von Wölfen (200 bis 250 Quadratkilometer). In seinem Revier
Art: Goldschakal (Canis aureus)
Ordnung: Raubtiere (Carnivora)
Familie: Hunde (Canidae)
Gattung: Wolfs- und Schakalartige (Canis)
Schutz: Geschützt laut FFH-Richtlinie Anhang V, besonders geschützt laut Bundesartenschutzverordnung und Bundesnaturschutzgesetz
Gefährdung: Lt. Internationaler Roter Liste ungefährdet
Der Goldschakal ist ein Neuzugang in unserer Fauna. Der BN-Wildtier-Experte Uwe Friedel erklärt, wie das Tier einzuordnen ist.
Natur+Umwelt: Herr Friedel, wird der Goldschakal bald fest zur heimischen Tierwelt in Bayern gehören?
Uwe Friedel: Das tut er bereits. Als heimisch werden ja Arten bezeichnet, die entweder immer schon da waren oder selbstständig einwandern, wie es beim Goldschakal der Fall ist.
Bedeutet das zugewanderte Tier eine Gefahr für unsere Ökosysteme?
Im Moment gibt es noch keine Hinweise, dass der Goldschakal in irgendeiner Weise ein Problem darstellen würde. Wobei man das bei einer Tierart, die noch in so geringer Anzahl vorkommt, auch nicht abschließend beurteilen kann.
Können sich die Reviere von Wolf und Goldschakal überschneiden?
Eigentlich nicht, denn der Wolf ist der wichtigste natürliche Feind des Goldschakals. Wo es ein Wolfrudel gibt, führt das fast immer dazu, dass die Goldschakale abwandern oder getötet werden.
lebt das Tier im Familienverbund und jagt kleine bis mittelgroße Säugetiere, auch kleine Huftiere kann es erbeuten. Außerdem stehen Vögel, Kriechtiere, Insekten, Aas und Früchte auf seinem Speiseplan. In manchen Gegenden ernährt sich der Goldschakal bis zu 40 Prozent vegetarisch.

Wird sich der Goldschakal schneller ausbreiten als der Wolf?
Das wissen wir nicht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Konkurrenz zum Wolf. Es ist auch schwierig, das zu bewerten, denn meiner Meinung nach werden Goldschakale auch oft übersehen, etwa weil sie mit Füchsen verwechselt werden. Bisher ist kein Nachwuchs in Bayern nachgewiesen. Es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis auch bei uns die ersten Welpen gesichtet werden.
Wie steht der BN zur Einwanderung des Goldschakals?
Der Goldschakal ist auf natürliche Weise eingewandert. Er gehört deshalb zu unserer Fauna und muss geschützt werden wie alle anderen heimischen Tierarten. Wir sehen auch wenig Konfliktpotenzial. Es kommt nur in Einzelfällen vor, dass Goldschakale Schafe, insbesondere Lämmer, reißen. Das ist zumindest der aktuelle Kenntnisstand.
Wie ordnen Sie den Angriff eines Goldschakals auf angeblich rund 100 Läm-
Goldschakale leben monogam und jagen einzeln oder auch gemeinsam. Wenn die Jungtiere selbstständig sind und sich eigene Reviere suchen, bleibt meist eines bei den Eltern, um bei der Aufzucht des nächsten Nachwuchses zu helfen.
Text und Interview: Heidi Tiefenthaler
mer auf Sylt ein? Inzwischen wurde ja eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den Abschuss des Goldschakals erteilt.
Der BUND Schleswig-Holstein hat in diesem Fall dem Abschuss zugestimmt, aber auch klargemacht, dass die Ausnahmegenehmigung nicht als Blaupause für einen regelmäßigen Abschuss genutzt werden darf. Im beschriebenen Fall handelt es sich offensichtlich um ein Tier mit sehr untypischem Verhalten. Goldschakale fressen in der Regel sehr viel kleinere Beutetiere. Von ihnen geht deutlich weniger Gefahr für weidende Schafe und Ziegen aus als vom Wolf.
Was sagen Sie zum Vorstoß, den Goldschakal ins Jagdrecht aufzunehmen? Aus meiner Sicht ist das bei den aktuellen Beständen nicht notwendig. Ein Wildtier muss laut EU-Recht in einem günstigen Erhaltungszustand sein, bevor es bejagt werden darf. Davon sind wir beim Goldschakal meilenweit entfernt. Von daher hätte die Aufnahme ins bayerische Jagdrecht momentan überhaupt keine Relevanz.
Zum Weiterlesen

D. Derron-Hilfiker, J. Hatlauf, F. Böcker: Der Goldschakal: Ein Wildtier breitet sich in Europa aus. Haupt Verlag, 2025, 29,90 Euro
Das Sträßchen durchs Stippbachtal trennt die naturnahe Bachaue vom angrenzenden Wald.

Das Stippbachtal bei Herborn ist Teil der Hörre, einem weiten, kaum zerschnittenen Waldgebiet im Westen Hessens. Engagierte BUND-Aktive wollen nicht hinnehmen, dass hier jedes Jahr unzählige Tiere unter die Räder kommen.
Von Sinn im Dilltal begleitet ein schmaler, schon vor Jahrzehnten asphaltierter Weg den Stippbach hinauf in die Hörre. Er verbindet die Gemeinde mit den Dörfern Dreisbach und Kölschhausen. Weil das Sträßchen wenige Minuten Zeitersparnis verspricht, sind hier regelmäßig Autos unterwegs, statt auf der gut ausgebauten Straße östlich um das Waldgebiet herum. Diese Praxis fordert vor allem unter den Amphibien und Reptilien viele Opfer. Worum handelt es sich nun bei diesem einspurigen Weg? Um eine Straße, wie jene behaupten, die den Autos freie Fahrt gewähren wollen? Oder aber um einen Forstweg, der vor allem der Naherholung
dienen und im Sinne des Naturschutzes sein sollte, wie die Parnets meinen? Das ist bis heute ungeklärt.
IDYLLE MIT SCHATTENSEITE
An einem sonnigen Herbsttag wandern wir das idyllische Tal hinauf. Linkerhand steigt das Gelände steil an, bedeckt von einem artenreichen Perlgras-Buchenwald. Rechts begleitet uns der Stippbach, mit Hochstauden wie Wasserdost und Kohldistel, mit Gehölzen, Feuchtwiesen und einzelnen Teichen. Gabriele Parnet und ihr Sohn Martin wohnen im nahen Sinn. Seit Jahrzehnten kennen und lieben sie diesen Weg, genießen die Ruhe abseits

des dicht besiedelten Dilltals. Und freuen sich über die vielfältige Natur, die sie hier erleben können.
Wären bloß die Autos nicht. Zwölfmal in zwei Stunden müssen wir an diesem Vormittag zur Seite weichen, um eines passieren zu lassen. Das ist mindestens lästig, nicht selten auch gefährlich für Fußgänger und Radfahrerinnen. Denn manche der Ortskundigen sind mit hohem Tempo unterwegs. Noch fatalere Folgen hat der Autoverkehr aber für etliche Tierarten in dem geschützten Tal.
Belebt ist der Asphalt vor allem an regnerischen und milden Tagen, weiß Gabriele Parnet: In den vergangenen Wochen haben wir wieder viele überfahrene Kröten gefunden, dazu Salamander, Zauneidechsen, Ringelnattern und Blindschleichen.« Auch wir stoßen an diesem Tag auf die Überreste junger Erdkröten; besonders
Verlauf des Sträßchens (rot) durch das Vogelschutzgebiet »Hörre bei Herborn und Lemptal«.
Richtung Herborn
Vogelschutzgebiet
»Hörre«
Sinn
Stippbach
traurig der Anblick eines noch lebenden Tiers, das seine Augen eingebüßt hatte, wohl durch den Unterdruck, der sich unter schnell fahrenden Autos bildet. Zudem kamen auf dem Sträßchen schon zwei Wildkatzen und ein Rotmilan zu Tode. Auf den sechs Kilometern, die der Weg durchs Stippbachtal verläuft, fallen jedes Jahr Tausende Tiere dem Verkehr zum Opfer. Kein Wunder bei dem Naturreichtum des Tals. So hat Martin Parnet schon bis zu 60 Feuersalamander auf dem Weg gezählt und 240 Larven im Bach. Neben Erdkröten und Grasfröschen sind auch Berg- und Teichmolche hier heimisch. Die Böschung auf der Hangseite ist dagegen voller Zauneidechsen. Martin Parnet vermutet, dass sie zur Eiablage das Sträßchen überqueren, weil unter den Opfern viele trächtige Weibchen sind.
TEILSPERRUNG, ABER …
Wie kann der massenhafte Tod beendet werden? Schon bisher konnte sich der BUND an die Naturschutzbehörde wenden, wenn er mitbekam, dass die Amphibienwanderung ihrem Höhepunkt entgegengeht. (In Zukunft will man auch amtlicherseits darauf achten.) Dann wurde der Weg
Dreisbach
Kölschhausen
für ein paar Wochen gesperrt. Doch mehr als einmal im Jahr mag man dies den Autofahrer*innen nicht zumuten. Wandern Kröten, Frösche und Molche in mehreren Schüben, haben sie Pech gehabt.
Ansonsten gilt, was die Gemeinden Sinn und Ehringshausen (zuständig für Dreisbach und Kölschhausen) im Juli nach jahrelanger Diskussion vereinbart haben: Werktags von 6 bis 20 Uhr darf der Weg mit dem Auto befahren werden, sonst nicht. Freien Zugang haben nur die Land- und Forstwirtschaft. Zweieinhalb Monate dauerte es, bis entsprechende Schilder auf diese Regelung hinwiesen, ärgert sich Gabriele Parnet.
»Weit schlimmer ist jedoch: Die meisten halten sich einfach nicht daran!« Denn kontrolliert wird der Autoverkehr hier nicht, und das ist auch in Zukunft kaum zu erwarten. Wirksam ausschließen könnte ihn nur eine Schranke. Auf Sinner Seite hat man das bereits versucht. Mit dem Resultat, dass die Schranke abgeflext und in einen nahen Teich geworfen wurde. So geht das Sterben im Stippbachtal weiter – gut dokumentiert von Gabriele
Zauneidechsen werden oft überfahren: Männchen an der Straßenböschung.


Häufige Verkehrsopfer: Feuersalamander kommen nur langsam voran. Wenn sie dann noch in die Fänge einer liebestollen Erdkröte geraten
und Martin Parnet. Abfinden will sich die BUND-Ortsgruppe damit nicht. Ihre Forderung bleibt, das für die Naherholung und Natur so wertvolle Tal besser zu schützen. Damit mehr Feuersalamander, Erdkröten und Zauneidechsen überleben und vielleicht der Schwarzstorch zurückkehrt, der hier schon gebrütet hat. Und damit Jung und Alt vom Weg aus ganz entspannt die herrliche Umgebung genießen können. Also werden sie mithilfe ihrer Orts- und Kreisgruppe weiter über die unhaltbare Situation informieren, Politik und Medien aufklären und zu Exkursionen in das Tal einladen. Und sie werden versuchen zu beweisen, dass der Weg nie zur Straße gewidmet wurde, wie Gabriele Parnet vermutet. Das nämlich wäre ein starkes Argument, das Stippbachtal doch noch autofrei zu bekommen.
Severin Zillich
Übrigens wertet der BUND rund um das Stippbachtal in der Hörre gezielt die Lebensräume der Wildkatze auf, im Rahmen seines Projektes »Wildkatzenwälder von morgen«: www.bund.net/wildkatzenwaelder

heißen so, weil ihre hübsch gefleckte Oberseite eine Doppelreihe von Dornen trägt. Die Weibchen werden über einen Meter lang und erst mit acht Jahren geschlechtsreif. Leere Kapseln ihrer Eier finden sich bisweilen auch an der deutschen Nordseeküste.

Noch vor einhundert Jahren kamen Nagelrochen im Wattenmeer sehr häufig vor. In dieser Kinderstube rottete die Fischerei sie schon etwa 1980 aus. Ein wichtiger Lebensraum blieb die Doggerbank im Zentrum der Nordsee. Doch auch hier sind die Rochen heute sehr selten, die meisten sterben als Beifang in Grundschleppnetzen. Der BUND kämpft für ein Verbot dieser Netze zumindest in Schutzgebieten und für ausgedehnte fischereifreie Zonen im Weltnaturerbe Wattenmeer.
Igel gesehen? Schnell ein Foto machen und den stacheligen Gesellen per App melden.


Verantwortlich für BN-Mitmachprojekte
Seit Oktober 2024 läuft die Igel-Challenge von Pro Igel e.V. und dem BUND Naturschutz. Ziel ist es, mehr über die Bestände und das Verhalten der Tiere zu erfahren. Und die Bereitschaft mitzumachen ist groß: Bereits 7097 Meldungen mit 8090 Igeln gingen bis Ende September 2025 ein.
Etwa 13 Prozent der Meldungen betrafen tote Tiere, die meisten davon Verkehrsunfälle. Rund 150 kranke oder verletzte Igel wurden gemeldet. Die Mehrzahl der Beobachtungen stammt aus Gärten – ein Hinweis darauf, wie eng das Leben der Igel mit unseren Siedlungen verbunden ist. Alle Daten fließen zusätzlich in eine internationale Forschungsdatenbank und tragen so weit über Bayern hinaus zum Schutz der Artenvielfalt bei.
Damit Igel durch unsere Siedlungen wandern können, brauchen sie Durchgänge in Zäunen, Laubhaufen zum Verstecken und blühende Gärten mit Insekten. Motorsensen und Mähroboter sind dagegen eine große Gefahr. Schon kleine Ver-
Per App Igel melden und damit dem Artenschutz und der Wissenschaft helfen. Die Igel-Challenge macht das seit einem Jahr möglich – und viele Menschen machen mit.
änderungen im Garten machen einen großen Unterschied. Um sich über solche Maßnahmen auszutauschen, entstand 2024 im Rahmen der Igel-Challenge eine eigene Igel-Community über WhatsApp. Fast 90 engagierte Mitglieder geben sich dort gegenseitig Tipps und Unterstützung. Neue Interessierte sind jederzeit willkommen.
Der Schutz des Igels gehört seit vielen Jahren zu den festen Themen im BN. Mit der Igel-Challenge hat das Anliegen jedoch noch einmal spürbar an Fahrt gewonnen. Ein Beispiel dafür ist die Kreisgruppe Ebersberg: Sie setzt sich mit einer Petition für den Aufbau einer regionalen Igelstation ein, um die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu entlasten, die kranke und verletzte Tiere aufnehmen. Bereits mehr als 5500 Menschen haben die Forderung unterstützt – ein starkes Signal aus der Bevölkerung.
Auch politisch bewegt sich etwas: In mehreren deutschen Städten wurden naturschutzrechtliche Allgemeinverfügungen erlassen, die den nächtlichen Einsatz von Mährobotern verbieten, da diese für Igel eine erhebliche Gefahr darstellen. Ne-
ben Städten wie Köln, Leipzig, Göttingen, Mainz oder Dortmund gibt es mit Bayreuth und Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck auch erste Beispiele aus Bayern. Bayreuth ist damit bislang die einzige größere bayerische Stadt, die beim Schutz der Igel vorangeht – ein Signal, das Mut macht und zeigt, dass Veränderung möglich ist.
Der Igel steht in Bayern auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Lebensraumverlust, Straßenverkehr und Pestizide setzen ihm zu. Die Igel-Challenge zeigt, wie wichtig es ist, Beobachtungen zu sammeln und Lebensräume zu sichern – und wie groß die Bereitschaft der Menschen ist, selbst aktiv zu werden. Jetzt mitmachen und Igel melden!

Hier geht’s zur Igel-Community:

In jedem Herbst weist der BUND auf die Bedeutung unserer heimischen Alleen hin. Zum Tag der Allee am 20. Oktober kürte eine Jury aus 220 eingesendeten Bildern die »Allee des Jahres 2025«. Uwe Fröbel hat sie an einem nebligen Wintertag in Ostfriesland fotografiert: eine charaktervolle, vom vielen Wind geprägte Allee mit Birken, Erlen und Eichen.

3. Platz: Magdalene Kreckel-Fröbel
Dass der Winter nicht immer so mit Farbe geizt, zeigt Lutz Schaffranietz. Mit seinem Bild einer bestens gepflegten Allee junger Eschen bei Sonnenaufgang in Sachsen kam er auf den zweiten Platz. Für ihr Foto einer prächtigen Eschen-Ahorn-Allee in Leybuchtpolder (Niedersachsen) gewann Magdalene Kreckel-Fröbel den dritten Platz. Der BUND gratuliert!
Auch im kommenden Jahr werden wir wieder eine Allee des Jahres prämieren.

Nachdem das Motto dieses Jahr den vier Jahreszeiten gewidmet war, lautet es 2026: Alleen bei Wind und Wetter.
www.allee-des-jahres.de

Seit 25 Jahren erzeugen und liefern wir Ökoenergie höchster Qualität. Und mit jeder Kilowattstunde Ökostrom und Ökogas von naturstrom fließt ein hoher Förderbeitrag in den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland.
Wechseln Sie jetzt zu Energie mit Zukunft und sichern Sie sich 30 € Zukunftsbonus: www.naturstrom.de/energie25
Annabelle, naturstrom-Kundin
„Klimaschutz beginnt bei uns!“
Jetzt wechseln und 30 € Zukunftsbonus sichern!
Otternhagener Moor: Treffen deutscher Projekte des LIFE-Programms »Naturschutz und Biodiversität«.

Im Juli präsentierte die EU-Kommission ihren Vorschlag für den kommenden EUHaushalt. Von 2028 bis 2035 sind ungefähr 1,8 Billionen Euro eingeplant. Im Mittelpunkt stehen künftig Sicherheit und Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und die Möglichkeit, Geld ohne vorherige Zweckbindung einzusetzen.
Dagegen ist der aktuelle Haushalt noch stark vom »Grünen Deal« geprägt. Damit wollte die Kommission den Netto-Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf null senken und Europa (die EU) zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Besonders für den chronisch unterfinanzierten Umwelt-, Klima- und Naturschutz
Am 15. August scheiterten in Genf die UNVerhandlungen über ein weltweites Plastikabkommen – trotz jahrelanger Vorbereitung und der Notwendigkeit, die Plastikflut endlich zu stoppen. Um die anhaltende Bedrohung der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt durch Plastik zu beenden, brauchen wir ein verbindliches Abkommen. Dieses müsste den gesamten Lebenszyklus von Plastik umfassen – mitsamt der Rohstoffgewinnung und Produktion, der Nutzung und Entsorgung. Mit unserem Bündnis »Exit Plastik« drängten wir in Genf darauf, die Plastikproduktion zu begrenzen und gefährliche Chemikalien in Plastik ganz zu verbieten. Vor Ort waren aber auch zahllose Lobbyisten der Öl-, Gas- und Chemieindustrie.
sind EU-Mittel durchaus entscheidend. In Deutschland bilden sie ein Viertel aller öffentlichen Umweltinvestitionen. Fördertöpfe wie LIFE oder ELER (ein Fonds zur Förderung der ländlichen Entwicklung) bewahren das Netzwerk »Natura-2000« der Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiete. Und der EU-Fonds für regionale Entwicklung EFRE stützt zum Beispiel die Renaturierung am Grünen Band in Bayern. Mit dem neuen Entwurf droht jetzt ein krasser Rückschritt. So soll das Umweltprogramm LIFE gestrichen werden, wie auch Budgets für die biologische Vielfalt und Agrarumweltmaßnahmen. Entscheiden werden nun vor allem die Mitgliedstaaten. In der anstehenden Verhandlung im Ministerrat und EU-Parlament wird sich der BUND für verbindliche Mittel für den Klima-, Umwelt- und Naturschutz einsetzen. Sowie dafür, klimaschädliche Subventionen zu stoppen.
Edda Nitschke

Für sie war das Scheitern des Abkommens ein Sieg, auf Kosten von uns allen. Statt einer Eindämmung der Plastikflut dürfte in Zukunft noch mehr Plastik aus Öl und aus Gas hergestellt werden: Bis 2060 ist mit einer Verdreifachung der Produktion zu rechnen – nicht aber mit einer höheren Recyclingquote (die derzeit bei 20 Prozent liegt). Und die Tausenden von problematischen Zusatzstoffen in Plastik werden weiterhin unsere Gesundheit bedrohen.
Während in Genf einige begrenzte Fortschritte erzielt wurden, blieb man bei Schlüsselthemen uneinig. Wie lässt sich die Produktion insgesamt begrenzen, wie die Zahl der Chemikalien? Ölförderländer wie Saudi-Arabien, Iran, Russland oder
In Genf warb der BUND mit seinem Bündnis »Exit Plastik« für ein ehrgeiziges Abkommen.
auch die USA drängten auf einen schwachen Vertrag, der sich auf den Plastikmüll konzentriert. Eine große Koalition aus mehr als einhundert Ländern (darunter Deutschland) warb dagegen für ein Abkommen, das die ganze Wertschöpfungskette einbezieht, notfalls auch gegen den Widerstand einiger Länder. Im Dezember wird Inger Andersen, Direktorin des UNUmweltprogramms, in Nairobi verkünden, wie es nun weitergeht. Janine Korduan

Was erwartet FoE Brazil von der Klimakonferenz in Belém?
Der People’s Summit [ein globaler Dialogprozess der Zivilgesellschaft] im Vorfeld ist eine große Chance für die sozialen Bewegungen, solidarisch für Demokratie und Umweltgerechtigkeit und gegen jede Form von Unterdrückung zu kämpfen. Erstmals findet ein UN-Gipfel am Amazonas statt. Hier verteidigt eine Vielzahl von Völkern ihr Leben in einer Region, die heute im Visier transnationaler Konzerne ist. Sie wehren sich gegen die Agrarindustrie, den Abbau von Roh- und fossilen Brennstoffen, gegen das Militär, rechtsextreme Kräfte und Unternehmen, die mit falschen Klimalösungen Profit erzielen.
Diese Konferenz steht vor der Herausforderung, das Recht der Völker auf ihr Land und auf ihre traditionellen Praktiken gemeinschaftlicher Bewirtschaftung als Element eines echten Klimaschutzes anzuerkennen.
Vor der derzeit laufenden UN-Klimakonferenz sprach Susann Scherbarth vom BUND mit Lucia Ortiz, der Direktorin unseres Partners »Friends of the Earth (FoE) Brazil«.
Was sollten wir über FoE Brazil und Sie selbst wissen?
FoE Brazil ist älter als unser internationales Netzwerk. Wir sind ein Teil der Zivilgesellschaft für Umweltgerechtigkeit und bilden nationale und lateinamerikanische Allianzen im Kampf für Demokratie, die Ernährungssouveränität der Völker und den Schutz der biologischen Vielfalt. Ich bin seit 25 Jahren bei FoE Brazil aktiv. Die Teilnahme an internationalen Treffen wie dem Weltsozialforum, Rio+20 und jetzt dieser Konferenz ist Teil meiner Entwicklung als Sozialaktivistin und gründet auf dem Kernanliegen unseres Netzwerks, der internationalen Solidarität.
Was erwarten Sie für die Zeit nach diesem Klimagipfel?
In Brasilien stehen 2026 Wahlen an. Ich hoffe, dass hier mehr Menschen aktiv werden, um die Demokratie zu verteidigen und die extreme Rechte zu bekämpfen.
Kriege, Unternehmenskriminalität und das Klimachaos sind ein Ausdruck unserer global krisenhaften Zeit. Ich kann lediglich hoffen und Kraft schöpfen aus der Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen, die für nachhaltige Lebensmodelle stehen, für soziale Gerechtigkeit und Frieden.
Möchten Sie uns noch etwas mitgeben? Belém bezeichnet den Ort, zu dem alle Gewässer fließen. Wenn die sich treffen, wachsen sie. Belém bietet eine Gelegenheit, von jenen zu lernen, die hier seit Jahrhunderten leben und widerständig wurden, im Wechsel von Ebbe und Flut. Wie können wir die Folgen der Klimakrise begrenzen? Für die Völker in Amazonien und der Karibik ist Klimagerechtigkeit eine Frage historischer Wiedergutmachung und des Kampfes gegen soziale Ungleichheit und Umweltrassismus. Sie wollen in Belém zeigen, wie wir unser Klima ohne Profitinteresse von Grund auf schützen können.
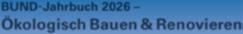
Mit den Themenbereichen: Planung /Grundlagen, Musterhäuser, Grün ums Haus, Gebäudehülle, Haustechnik und Innenraumgestaltung
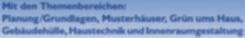
Auf 244 Seiten finden Sie:
■ zahlreiche Beispiele gelungener Bau- und Sanierungsprojekte
■ Öko-Tipps und Anregungen zur persönlichen Energiewende
■ Artikel über den aktuellen Stand der Energie- und Haustechnik
■ Spektrum der Förderprogramme und Dämmstoff-Übersicht
■ weiterführende Literaturhinweise und unzählige Web-Links
ab Dezember für 9,90 Euro am Kiosk, in BUND-Geschäftsstellen und direkt beim Verlag: www.ziel-marketing.de als E-Paper


Ein englischer Landschaftspark drohte
immer intensiverer Landwirtschaft zum Opfer zu fallen – bis der BN protestierte.
Zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert: der Bernrieder Park mit seinen uralten Bäumen
Der Bernrieder Park, südlich des Klosters am Ostufer des Starnberger Sees gelegen und knapp 80 Hektar groß, enthält viele »Methusalembäume«: bis zu 700 Jahre alte Eichen und Buchen mit einen Stammumfang von mehr als vier Metern. Die Baumveteranen beherbergen eine Vielzahl höhlenbrütender Vögel, Säugetiere, Baumpilze und Insekten, darunter Urwaldreliktarten wie den Eremit oder Juchtenkäfer. Nach Auffassung von Fachleuten zählt der Park zu den Top 20 der Altholzflächen in Deutschland. Er steht seit 1959 unter Landschaftsschutz und seit 1992 auf der bayerischen Denkmalliste.
BLICK AUF SEE UND BERGE Angelegt wurde der Bernrieder Park von 1853 bis 1863 durch den Münchner Ober-
• Ausgangspunkt: Bernried, Schifflände oder Bahnhof
• Länge/Gehzeit: nach Belieben ca. 3 – 10 km / 1 – 3 Stunden
• Einkehr: Bernried
• Siehe auch www.bund-naturschutz.de/ natur-und-landschaft/ natura-2000/natura2000-touren

hofgärtner Carl Effner und dessen Sohn Carl-Josef im Stil eines englischen Landschaftsparks. Vorhandene Altbäume wurden integriert; angelegte »Sichtfenster« geben immer wieder den Blick auf den See und die Berge frei. Die damalige Eigentümerin Wilhelmina Busch-Woods brachte den Park in eine Stiftung ein, um ihn »als einzigartiges Naturdenkmal den kommenden Generationen in seiner Eigenart und Schönheit zu erhalten«.
Sie räumte dem Hofgut Bernried aber ein »Grasnutzungsrecht« ein. Unglücklicherweise konnte sie die Intensivierung der Landwirtschaft nicht vorhersehen, die für den Park fatale Folgen hatte: Rinderbeweidung, Gülledüngung und häufiges Mähen verwandelten viele der einstmals artenreichen Wiesen in steriles »EU-Einheitsgrün«. Auch den alten Bäumen setzte die Überdüngung schwer zu.
1984 wurde es den Bernrieder Naturfreunden zu bunt. Der Architekt und Denkmalpfleger Heiko Folkerts richtete gemeinsam mit der entstehenden BN-Ortsgruppe eine Petition an den Bayerischen Landtag mit der Forderung, den Park unter Denkmalschutz zu stellen und ein umfassendes Pflegekonzept festzulegen –mit Erfolg!
ANREISE PER SCHIFF
Sehens- und erlebenswert ist der Bernrieder Park zu jeder Jahreszeit – auch im
Spätherbst und Winter, wo das fehlende Laub die Strukturen der mächtigen Bäume umso transparenter erkennen lässt. Die luxuriöseste Art der Anreise ist die mit dem Schiff, das man in Starnberg, aber auch an anderen Orten rund um den See besteigen kann. Allerdings nur im Sommerhalbjahr, sonst kommt man mit dem Zug nach Bernried.
An der Schifflände halten wir uns südlich und erreichen nach gut 100 Metern, am Naturbad vorbei, den Park. Dort können wir uns nach Lust und Laune den Wegen überlassen, entweder einfach geradeaus den See entlang oder einen der sanften Hügel hinauf, von denen wir einen Überblick über Park, See und Alpenpanorama erlangen. Unbedingt sehenswert ist die frei stehende Wotanseiche in Seenähe: eine riesige Stieleiche mit einem Stammumfang von 6,7 Metern und einer Höhe und einem Kronendurchmesser von 25 Metern. Ihr Alter wird auf 300 Jahre geschätzt wird.
Uli Rohm-Berner, Winfried Berner
Mehr entdecken
Winfried Berner, Ulrike Rohm-Berner: Gerettete Landschaften Wanderführer, Verlag Rother, 14,90 Euro Bestellung: www.bn-onlineshop.de

Wer Yannick Rouault auf seinen Radtouren begleitet, fährt mitten hinein in eine Landschaft, in ihr offenes Herz und ihre besondere Geschichte. Zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach fressen sich die größten Braunkohletagebaue Europas noch immer in die Erde. Zugleich beginnt hier schon das Morgen, das ganz anders sein soll, schöner, grüner, in dem das Leben in leere Dörfer zurückkehrt, und wo dort, wo jetzt die Löcher klaffen, drei große Seen liegen sollen.
Rouault, Fotograf und Dokumentarfilmer, zeigt genau diesen Schwebezustand –zwischen fossiler Vergangenheit und ungewisser Zukunft. Aufgewachsen in Bayern, war er 2012 erstmals zu Besuch. »Das hat mich nicht mehr losgelassen«, sagt er. Seit 2016 fotografiert er das Revier, 2024 zog er nach Köln, um den Strukturwandel aus nächster Nähe zu begleiten. »Wer hier zum ersten Mal an der Abbruchkante steht, ist fassungslos. Ich will diese Wirkung nutzen – und den Blick erweitern.«
Startpunkt der Touren ist Jülich. Von hier geht es mit dem Rad hinaus zu Orten, an denen noch immer die Bagger dröhnen, zu geräumten Dörfern und in erstaunlich liebliche, renaturierte Landschaften.
ZWEI ORTE, EIN SCHICKSAL
Besonders eindrucksvoll ist MorschenichAlt: Fast völlig umgesiedelt – und im letzten Moment doch vor dem nahenden Tagebau Hambach gerettet. Ein Dorf im Dornröschenschlaf. Zeitzeuge Bernd Servos führt durch gespenstisch leere Straßen, erzählt vom letzten Abschließen der Haustür und vom Schlüssel, den er RWE übergab. Am Ortsrand stehen zwei alte Kastanienbäume, gepflanzt in den 1950ern. Einer stirbt, der andere hält sich noch. Nur 500 Meter weiter beginnt die Grube – und der Hambacher Wald, Rest eines einst riesigen Forsts. Hier, am Übergang von Abgrund zu Wald, ist die Spannung greifbar. Auch das Nachbardorf Manheim erzählt von diesem Zwischenzustand: Der Bagger wird sich hier noch bis an die Kirchenmauer graben. Nur noch
An der Abbruchkante wird das gigantische Ausmaß des Kohletagebaus sichtbar.

Zwischen Zerstörung und Hoffnung: Ein neues Angebot von BUND-Reisen führt mit dem Fahrrad durch das rheinische Braunkohlerevier.
zwei Häuser sind bewohnt im einst 1700 Menschen zählenden Dorf. Einige Straßen sind bereits im Tagebau Hambach verschwunden. Einzig die Kirche soll erhalten bleiben. Ihre Zukunft ist dennoch ungewiss.
Die Touren führen an renaturierte Areale des Tagebaus Inden, wo heute wieder Vögel brüten, und zugleich an die Abbruchkante von Hambach. Unterwegs zeigt Rouault Archivfotos und Satellitenbilder – und macht sichtbar, wie diese Wunden jahrzehntelang unsichtbar gehalten wurden. Diese Radreise ist eine Auseinandersetzung mit einer Region im Umbruch. Sie führt durch Landschaften, die tief verletzt und zugleich voller Potenzial sind. Eines Tages, vielleicht 2070, wird hier eine große Wasserfläche glitzern. Doch das Jetzt ist der spannendste Moment, findet Yannick. »Jetzt kann man
noch mit Menschen sprechen, die ihre Dörfer verlassen mussten, und gleichzeitig beobachten, wie Natur und Gesellschaft ihren Platz neu finden müssen«, sagt er. Wer mitfährt, kehrt nicht mit einer Postkartenidylle im Kopf zurück, sondern mit dem Gefühl, einen Ort in seiner Verwandlung erlebt zu haben.
Lucia Vogel
10. – 14. Juni 2026
Infos zu Reisepreis und Anmeldung
BUND-Reisen
ReiseCenter am Stresemannplatz
Stresemannplatz 10, 90489 Nürnberg Tel. 09 11/5 88 88-20
www.bund-reisen.de

Auch 2026 bietet BUND-Reisen wieder viele Wander- und Naturerlebnisreisen an.
Die druckfrische Reisebroschüre inspiriert und lädt zum Entdecken ein.
Wilde Wälder, majestätische Gipfel und zerklüftete Küsten: Europa ist voller faszinierender Landschaften. Viele davon können bequem und emissionsarm mit der Bahn erreicht werden. Das macht sich BUND-Reisen zunutze und verzichtet komplett auf Flüge. So wird schon die Anreise zum Erlebnis und das Klima geschont. Vor Ort begleiten Reiseleitungen mit hervorragender Gebietskenntnis unsere Kleingruppen und geben ihr Wissen mit Begeisterung weiter. Wir begegnen Einheimischen und nächtigen in privat geführten Unterkünften. Das gewährt authentische Einblicke in die Region.
ZWISCHEN BERGEN UND MEER
Das Jahr 2026 startet inmitten glitzernder Bergwelten – mit einem ganz besonderen Jodler. Denn der Veranstalter BUND-Reisen in Nürnberg feiert 15-jähriges Bestehen
und lädt zum Auftakt ins Jubiläumsjahr zum Innehalten, Genießen und Krafttanken ins winterliche Salzburger Saalachtal ein. Weiter geht es mit einer Reise in die historische Region Banat in Rumänien. Wilde Wälder, die schönste Flussenge Europas und ein buntes Kulturprogramm mit kleinen Städten, mit Burgen und Klöstern sind Teil der Reise.
Im Frühsommer locken uns dann blühende Bergwiesen in die italienischen Alpen. Im ursprünglichen Maira-Tal im Piemont und im Nationalpark Stilfserjoch in Südtirol warten nicht nur botanische Highlights und einsame Pfade, sondern auch zwei traditionelle Unterkünfte mit köstlicher regionaler Küche.
In der französischen Normandie dreht sich hingegen alles um die Lebenswelt Wasser. Während unserer Wanderungen wechseln wir zwischen einsamen Buchten,

den Weiten des Watts und malerischen Flusslandschaften. Dabei passieren wir Seefahrerstädte, kleine Fischerhäfen und sagenumwobene Pilgerstätten.
Den Spätsommer mit seinen warmen Farben verbringen wir zwischen Steppe und Meer auf Italiens Stiefelabsatz in Apulien. Hier genießen wir aromatisches Olivenöl und Brot, erkunden Höhlensiedlungen und wandern durch alte Buchenwälder und entlang bizarrer Küsten.
Wer nicht nur gern wandert, sondern auch Rad fährt, für die oder den haben wir zwei spannende neue Reiseziele in Deutschland ausgewählt. Sie könnten kaum verschiedener sein. Im Rheinischen Braunkohlerevier erleben wir ein lebendiges Beispiel ökologischer Transformation und entdecken in der so lange geschundenen Landschaft spannende neue Lebensräume. In der Uckermark bereisen wir eine Region, die mit ihrer dünnen Besiedlung und einem Mosaik aus Seen, Wäldern und Mooren still und nahezu unberührt wirkt. Hier wollen wir dazu beitragen, wertvolle Biotope für die Zukunft zu sichern, indem wir die Mitarbeiter*innen des Naturparks tatkräftig bei ihrer Landschaftspflege unterstützen – im Rahmen unserer Reihe »Naturschutz im Urlaub«.
Harry Karpp
Mehr zum Thema Unser vollständiges Angebot finden Sie unter www.bund-reisen.de, Telefon 09 11/5 88 88-20, info@bund-reisen.de. BUND-Reisen trägt das TOURCERT-Siegel, ist Mitglied im »Forum Anders Reisen« und kooperiert mit www.fahrtziel-natur.de
Aufbruchstimmung herrschte beim Vorstellungstermin für die Neugestaltung der BNE-Auszeichnung Ende September. Das in die Jahre gekommene Qualitätssiegel Umweltbildung firmiert um. Zusammen mit Umweltminister Glauber stellten die Mitglieder des Kernteams die neuen Logos vor. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ab sofort die Klammer für alle ausgezeichneten Umweltstationen sowie die rund 150 Träger dieser Auszeichnung in Bayern. Für den BN bedankte sich Bildungsreferentin Ulli Sacher-Ley für die langjährige kollegiale Zusammenarbeit im Kernteam, mahnte aber ebenso wie Umweltminister Torsten

Vorstellung des neuen Logos durch das Kernteam zusammen mit Umweltminister Torsten Glauber (Mitte)
Glauber an, dass die angekündigten Mittelkürzungen im Staatshaushalt nicht zu Lasten guter Bildungsangebote gehen dürften. 35 000 Veranstaltungen und über 1,5 Millionen Teilnehmende aller Altersgruppen seien es wert, auch in Zukunft unterstützt zu werden.
Alle Infos zum neuen Siegel: www.bnelernen.bayern.de

Der große Infostand auf der Mainfrankenmesse, den die BN-Kreisgruppe und Umweltstation Würzburg betreuten, lockte über 2000 Besucher an. Die attraktiven, lebensgroßen Modelle heimischer Amphibien sowie die zugehörige Amphibien-Ausstellung waren Hingucker und führten nicht nur zu interessierten Nachfragen, sondern auch zu dem ein oder anderen Eintrag in die Liste für Am-

phibienhelfer*innen. Anlässlich der Aktionstage »Bildung für die Zukunft« besuchten auch die Landtagsabgeordeten Björn Jungbauer (CSU, siehe Foto links), Eva Lettenbauer, Kerstin Celina sowie Patrick Friedl (Grüne, siehe Foto rechts) den attraktiven Infostand. Auf jeden Fall ein lohnender Einsatz der ehren- und hauptamtlichen Betreuer*innen!
Mehr Infos auf: wuerzburg.bund-naturschutz.de/ veranstaltungen
Das Klima ändert sich. Was ändert sich im Wald? Der Wiener Erlebnisforscher Gerhard Frank macht sich mit den Teilnehmenden auf den Weg zu neuen Erfahrungsräumen. Eingeladen sind interessierte Menschen aus den Bereichen Wald, Forst, Bildung. Termin: 6. und 7. Februar 2026
Ort: Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil www.wartaweil.bund-naturschutz.de

Die beliebte Online reihe »Artenkenntnis für Einsteiger« des Bildungswerkes geht fünfte Jahr. Die nächs ten Veranstaltungen be fassen sich mit Blättern, Knospen und Nadeln, mit Moosen, Bilchen, heimischen Amphibien und Fledermäusen. Bis Ende März läuft das Angebot im mehrwöchigen Wechsel immer von 18–20 Uhr an einem Dienstag. Informationen und Anmeldung www.bund-naturschutz.de/umweltbildung/artenkenntnis-fuer-einsteiger
Aufsichtspflicht und Gruppendynamik, Spiele und Aktionen draußen, Konfliktlösung und Organisationstalent –das und noch einiges mehr bietet die Ausbildung für die Leitung einer Kinder- oder Jugendgruppe bei der BUNDjugend Bayern. Es sind drei Module zu absolvieren um die JuLeica (Jugendleitercard) zu bekommen und gut gerüstet zu sein für den Start einer eigenen Gruppe. Alle Infos:

Seit 2018 war Richard Mergner Vorsitzender des BUND Naturschutz. Bei den turnusgemäß stattfindenden Neuwahlen am 22. November stellt er sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Wir sprachen mit ihm.
Natur+Umwelt: Richard, was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Richard Mergner: Mir wurde in den letzten Monaten bewusst, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mit 100 Prozent Energie und Tatkraft weitere vier Jahre als Vorsitzender für unseren Verband da sein kann.
So ein Abschiednehmen aus der vordersten Reihe nach Jahrzehnten hauptund ehrenamtlichem Engagement für einen großartigen Verband wie dem BN ist schon sehr einschneidend für mich. Dies fiel mir überaus schwer und mir werden die vielen Begegnungen und der Austausch mit unseren engagierten Mitgliedern sehr fehlen. Doch bin ich mir sicher, dass es für den BN und für mich die richtige Entscheidung ist. Mit so vielen Enga-
gierten im Ehren- und Hauptamt gemeinsam die Natur vor Zerstörung zu retten und an vielen Orten Bayerns Schönheit zu bewahren, war für mich ein großes Geschenk. Ein herzliches Dankeschön an alle im BUND Naturschutz, mit denen ich in all den Jahren zusammenarbeiten durfte.
Ist der BN auf diese Situation vorbereitet?
Da bin ich mir sicher. Auf meinen Vorschlag hin hat der Landesvorstand einstimmig den Landesbeauftragten Martin Geilhufe gebeten, als Vorsitzender zu kandidieren. Ich bin sehr glücklich, dass er sich bewirbt. Zum einen kennt er den BN schon seit seiner ehrenamtlichen Zeit als Jugendvertreter. Zudem bringt er ein profundes, querschnittsorientiertes Fachwissen, Kommunikationsstärke und hohe Motivation und Zuversicht mit – Eigenschaften, die für einen Vorsitzenden enorm wichtig sind. Der Landesvorstand insgesamt, insbesondere meine beiden Stellvertreterinnen Beate Rutkowski und Doris Tropper sowie Landesschatzmeis-
ter Max Walleitner sind ein hervorragendes, sich gut ergänzendes Team. Auch unser Ehrenvorsitzender Hubert Weiger ist noch immer unermüdlich für den Naturschutz bayern- und bundesweit unterwegs.
Was waren wichtige Wegmarken in Deiner Zeit als BNVorsitzender?
Mit einem gut eingespielten Vorstandsteam und unseren hochmotivierten Aktiven in den über 500 Orts- und Kreisgruppen konnte ich den BUND Naturschutz trotz Coronakrise, dem immer noch andauernden Angriffskrieg auf die Ukraine und allgemeinen Preissteigerungen in Deutschland auf Erfolgskurs halten. Wir sind in den sieben Jahren trotz dieser widrigen Umstände um circa 35 000 Mitglieder und Förderer auf rund 270 000 gewachsen, sind breit in der Gesellschaft verankert und haben eine stabile Finanzlage – ohne jedes Wirtschaftssponsoring. Unsere Erfolge im Natur- und Umweltschutz sind immer ein Gemeinschaftswerk, vom Engagement unserer Aktiven
vor Ort über die verschiedenen Ebenen und Gremien unseres Verbandes bis hin zum Landesvorsitzenden. Ich freue mich daher, dass ich in meiner Amtszeit viele Erfolge feiern durfte, für die teilweise schon meine Vorgänger den Grundstein gelegt haben und zu denen ich – sei es als Landesbeauftragter oder Landesvorsitzender – meinen Teil beitragen konnte.
Dazu zählen beispielsweise die Abschaltung des letzten Atomkraftwerks in Bayern und das Vorantreiben der Energiewende, die Weiterentwicklung des Grünen Bandes, die Verhinderung unnötiger Straßenbauplanungen oder die Rettung des Riedberger Horns und des Grünten im Allgäu vor überzogenen Ski-Gebietsplanungen. Auch Waldrodungen für Gewerbegebiete wie im Nürnberger Reichswald, bei Bamberg oder in der Oberpfalz konnten gestoppt werden. Der Ankauf schützenswerter Biotope war weiterhin das Herzstück unserer Arbeit.
Wir haben unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter professionalisiert und erreichen mit neuen Mitmachaktionen neue Zielgruppen. Nach dem erfolgreichsten Volksbegehren aller Zeiten zur Rettung der Artenvielfalt im Jahr 2019 konnten wir neben vielen Verbesserungen auch den Streuobstpakt durchsetzen. Auch unser Einsatz für einen Nationalpark im Steigerwald und ein Biosphärengebiet im Spessart wird weitergehen.
Was wünschst du dem BN für die Zukunft?
Auch in herausfordernden Zeiten, wenn es politischen Gegenwind für eine nachhaltige, ökologische und soziale Entwicklung gibt und politische Kräfte die Demokratie gefährden, muss der BUND Naturschutz standhaft bleiben und ermutigen. Ich bin mir sicher, dass wir dann auch in Zukunft viele Erfolge im Natur- und Klimaschutz erreichen werden. Wir bleiben das überparteiliche und unabhängige, streitbare Umweltgewissen Bayerns.

im Leben kommt oft manches anders, als man es sich vorgestellt hat. Dann müssen viele Gespräche geführt und gut überlegt neue Entscheidungen getroffen werden.
So hat sich unser lieber Vorsitzender Richard Mergner nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, bei der Vorstandswahl im November 2025 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Landesvorsitzender anzutreten. Diese Entscheidung ist ihm sehr schwergefallen, denn seit er 2018 zum Nachfolger von Hubert Weiger gewählt wurde, hat er sich mit Herzblut und in hervorragender Weise für den Verband und für den Natur- und Umweltschutz eingesetzt.
Der Austausch und die Diskursoffenheit haben seine beiden Legislaturen geprägt, viele Gespräche mit politischen und verbandlichen Akteuren wie dem Bayerischen Bauernverband und den Gewerkschaften hat er initiiert, unzählige politische Dialoge geführt und öffentlich auch in manchmal unbequemen Diskussionsrunden klar Standpunkt bezogen.
Die Facharbeit war von Anfang an sein Tätigkeitsfeld im BUND Naturschutz als Referent für das Bessere Müllkonzept, als Regionalreferent und später als Landesbeauftragter. Er hat gemeinsam mit den Gremien BNPositionen weiterentwickelt und neue Projekte auf den Weg gebracht. Mit großem Engagement setzte er sich mit
Landwirten und Bioverbänden für eine ökologische Landwirtschaft ein. Ein besonderes Anliegen war ihm auch der Einsatz für eine Verkehrswende.
Seine Zeit als Vorsitzender war geprägt von schwierigen Rahmenbedingungen für den Naturschutz allgemein. Der russische Angriffskrieg hat die Welt erschüttert und politische Prioritäten verschoben und letztendlich finanzielle Mittel für den Naturschutz infrage gestellt. Trotzdem konnte der BN viele Projekte vorantreiben und ist als Verband weiter gewachsen, was auch der guten Arbeit der Mitglieder an der Basis zu verdanken ist. In der Stärkung der Kreisund Ortsgruppen hat Richard Mergner darum eine zentrale Aufgabe gesehen.
Lieber Richard, wir wünschen Dir für die Zukunft alles Gute, baldige vollständige Genesung und dass Du dann wieder im BN aktiv werden kannst. Denn Dein Herz schlägt für den Naturschutz und einen BN ohne Dich können wir uns nicht vorstellen!
Herzliche Grüße
Beate Rutkowski stv. Vorsitzende
Doris Tropper stv. Vorsitzende
BUND NATURSCHUTZ STIFTUNG

Der Einsatz für die Natur braucht langfristige finanzielle Sicherheit. Deshalb hat der BUND Naturschutz 2007 eine eigene Stiftung gegründet. Ihre Erträge werden ausschließlich in Projekte des BN investiert. Mit einer Beteiligung fördert man nachhaltig den Schutz unserer Umwelt.
Natur+Umwelt: Was ist eigentlich eine Stiftung?
Birgit Quiel: Eine Stiftung ist eine Einrichtung, in der Vermögen sozusagen auf ewig angelegt ist. Die Erträge werden zur Erfüllung eines vorher festgelegten Stiftungszweckes eingesetzt.
Warum hat der BN eine eigene Stiftung?
In der Stiftung des BUND Naturschutz können sich Menschen engagieren, indem sie in die Stiftung einzahlen und damit das Stiftungsvermögen erhöhen. Mit den Erträgen dieses Vermögens werden jedes Jahr BN-Projekte unterstützt. Die Stiftung bietet also für den Verband ein dauerhaft sicheres finanzielles Standbein und für Geldgeber die Möglichkeit, mit ih-
rem Geld nicht nur einmal Gutes zu tun, sondern immer wieder.
Wofür wird der Erlös aus der Stiftung konkret verwendet
Das wird jedes Jahr vom Stiftungsrat neu festgelegt. Es sind immer Projekte, die der BN gerade durchführen oder fördern möchte und bei denen noch Geld fehlt, zum Beispiel Flächenankäufe oder Streuobstwiesen-Projekte.
Zur BNStiftung kann man finanziell beitragen – wie funktioniert das?
Zum einen kann man in die allgemeine Stiftung einzahlen, das wäre eine klassische Zustiftung. Man kann aber auch ab einer gewissen Summe eine eigene Un-
Unsere Beraterin Birgit Quiel, Geschäftsführerin der BN Stiftung, gibt Ihnen gerne im persönlichen Gespräch weitere Informationen. Sie ist zertifizierte Stiftungsmanagerin mit langjähriger Erfahrung. Für Ihre Verdienste im Stiftungswesen wurde sie bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Tel.: 09 41/2 97 20-69
Mail: birgit.quiel@bundnaturschutz-stiftung.de

terstiftung gründen und einen Verwendungszweck für die Erträge festlegen. Dafür entwickle ich eine Stiftungssatzung und kümmere mich um die Anerkennung durch das Finanzamt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die BN-Stiftung im Testament zu bedenken oder testamentarisch eine »Stiftungsgründung von Todes wegen« festzulegen.
In den Gesprächen merke ich immer wieder, dass Interessierte Wert legen auf eine vernünftige Beratung. Wir beraten Sie umfassend – nicht nur am Telefon, sondern vor Ort. Ein gutes Verhältnis zu unseren Stiftern ist uns sehr wichtig.
Was hat Menschen, die schon zur Stiftung beigetragen haben, motiviert?
Man hinterlässt damit wirklich nachhaltig Spuren im Umweltschutz. Manchen Menschen geht es auch darum, dass der eigene Name oder der des verstorbenen Ehepartners als Stiftungsname weiterlebt.
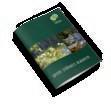
Ausführlichere Informationen finden Sie Stiftungs-Website. Oder fordern unsere Broschüre www.bund-naturschutz-stiftung.de/

NACHHALTIGE MOBILITÄT
Ein neues BN-Projekt, der ÖPNV-Führerschein, bringt Kindern bei, wie man mit Bus und Bahn sein Ziel erreicht.
Unzählige Kinder werden in Deutschland Tag für Tag mit dem Auto herumgefahren. Diese »Elterntaxis« sind nicht nur umweltschädlich, sie verhindern auch, dass Kinder andere Möglichkeiten der Mobilität erlernen. Oft gäbe es die Möglichkeit, die Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Ein neues Projekt macht Schulkinder fit dafür. Wie liest man einen Liniennetzplan? Fährt ein Bus zu meinem Sportverein? Viele Kinder wissen das nicht, weil sie in ihrem ganzen Leben noch kein öffentliches Verkehrsmittel oder nur den Schulbus benutzt haben. Ein neues Umweltbildungsprojekt schafft hier Abhilfe: der ÖPNVFührerschein.
Das Projekt wird vom BUND Naturschutz getragen und von vier Projektpartnern in vier Pilotregionen umgesetzt: BNKreisgruppe München, BN-Naturerlebniszentrum Allgäu, Ökologische Bildungsstätte Oberfranken und Umweltstation BN-Ökohaus Würzburg. Unterstützt wird das Projekt vom bayerischen Kultus-
ministerium. Es richtet sich vor allem an fünfte und sechste Klassen.
Die ersten Schulkinder haben schon gelernt, wie man mit den »Öffis« von A nach B kommt. Elisabeth Kornell, in der BN-Kreisgruppe München zuständig für nachhaltige Mobilität, hat eine Klasse zum ÖPNV-Führerschein geführt. In München ist das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln sehr groß, auf dem Land kann die Situation eine ganz andere sein. »Das Konzept ist aber darauf ausgelegt, überall anwendbar zu sein«, erklärt Elisabeth Kornell. Die ausgebildete Pädagogin hatte viel Freude damit, den Kindern Bus und Bahn näher zu bringen.
Dafür kommt sie in die Schule und erarbeitet mit der Klasse die Grundlagen, anschaulich und kindgerecht mit Videos und Plakaten. Die Kinder bekommen als Aufgabe, eine Strecke auszusuchen, die sie auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen könnten. Dann steht ein Aus-

flug auf dem Programm, zu einem Bahnhof oder einer Haltestelle – idealweise nahe bei der Schule. Auch hier war Elisabeth Kornell dabei und hatte mit den Verkehrsbetrieben abgesprochen, dass die Kinder von der Notfallsäule aus einen Inforuf tätigen dürfen – für die Kinder ein Highlight, erzählt die Pädagogin. Gefragt wurde unter anderem, was man tut, wenn eine Person ins Gleis fällt, oder ein Handy. Danach durften die kleinen Entdecker*innen einen versteckten Schatz suchen, der die »Führerschein«-Plaketten enthielt. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammengefasst. Gemeinsam gestalten die Kinder ein Plakat mit den öffentlich zurückgelegten Strecken, das im Schulhaus aufgehängt wird. Neben der Vermittlung von Alltagskompetenzen dient das Projekt auch dazu, bei den Eltern Bedenken auszuräumen, was die Nutzung des ÖPNV angeht, und in ländlichen Regionen zu zeigen, dass man mit etwas Planung oft auch mit dem Bus zu Freunden oder zum Sportverein kommt –damit das »Elterntaxi« stehen bleiben kann.
Luise Frank
Ansprechpartner Thomas Frey thomas.frey@bundnaturschutz.de
SERIE: BN-FLÄCHEN
Mit dem großen Naturschutzprojekt SandAchse Franken ist es dem BN gemeinsam mit vielen Partnern gelungen, wichtige Sandgebiete im Großraum Nürnberg zu erhalten. Etliche dieser Flächen gehören mittlerweile dem BN und sind damit vor Sandabbau und Bebauungsdruck sicher.
Im Juni konnte der BN Nürnberg mithilfe des Rotary- und des Inner-Wheel-Clubs den geretteten Gebieten einen wichtigen weiteren »Puzzlestein« hinzufügen. Gekauft wurde ein knapp 4000 Quadratmeter großes Grundstück südlich von Kornburg. Es liegt südlich der A 6 in einem landwirtschaftlich geprägten Umfeld und grenzt an eine Fläche, die bereits dem BN gehört. Insgesamt entstand so ein 14 000 Quadratmeter großer, sehr wertvoller Biotopkomplex, der zweitgrößte Einzellebensraum der SandAchse Kornburg. Das Grundstück ist Teil einer kleinen Waldinsel und es gehören Abschnitte eines Feldweges dazu, die schon heute Charakterarten der Sandlebensräume aufweisen, wie die Blauflügelige Ödland-
schrecke oder die Zauneidechse. Bei dem Wäldchen handelt es sich um einen Eichen-Kiefern-Mischwald. Die Kiefer ist jedoch durch etliche Stürme in den vergangenen Jahren bereits deutlich ausgedünnt worden und wird in naher Zukunft wahrscheinlich ganz ausfallen.
Schon jetzt ist die Fläche Heimat gefährdeter Vogelarten. So kann man dort Wachteln, Rebhühner oder Feldlerchen beobachten. Mit der Heidelerche hat sich auf der Fläche sogar eine vom Aussterben bedrohte Vogelart angesiedelt. Der Habicht nutzt den nördlich anschließenden Wald als Rückzugsraum und Ansitz. Neuntöter sowie Feldsperling, die beide auf der Vorwarnliste stehen, kommen ebenfalls auf der Fläche vor. Auch aus dem Insektenreich hat das Projektgebiet Kornburg bereits einiges zu bieten. Es beherbergt Raritäten wie den Rotleibigen Grashüpfer oder den Ampfer-Purpurspanner. Und schließlich kommt die Fläche auch Amphibien zugute: Einige hundert
Meter westlich davon findet sich ein Biotop, das die Kreuzkröte zur Fortpflanzung nutzt. Da diese Art sehr mobil ist, kann sie das neue Grundstück als Sommerlebensraum nutzen.
Die neue Fläche bietet dem BN die einmalige Chance, seine Flächen in der SandAchse sinnvoll zu ergänzen. Die Umgebung rund um Kornburg kann mit dem Neuzugang als Kerngebiet der SandAchse Franken ausgebaut und langfristig für den Naturschutz gesichert werden. Zusammen mit den anderen rund um Kornburg befindlichen BN-Sandbiotopen ergibt sich nun eine Biotopfläche von insgesamt 7,8 Hektar – genug, um auch anspruchsvollen Arten einen Lebensraum zu bieten. Die Stadt Nürnberg hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrere größere Sandmagerrasen auf ehemaligen Äckern angelegt. So ist für eine gute Vernetzung der Biotope gesorgt.
Ein wichtiges Ziel des Biotopmanagements wird in Zukunft der Schutz und die Förderung der verschiedenen Heuschreckenarten durch eine späte Mahd und durch Brachflächen sein. Außerdem soll die auf der Fläche befindliche Hecke als Habitat von Goldammer, Feldsperling, Rebhuhn und Neuntöter gepflegt werden. Strukturen aus Lesesteinen und Altholz werden den Zauneidechsen künftig optimale Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Heidi Tiefenthaler
Kreisgruppe: Nürnberg Stadt
Fläche: knapp 4000 Quadratmeter
Insektenarten: Blauflügelige
Ödlandschrecke, Rotleibiger Grashüpfer, Ampfer-Purpurspanner
Vogelarten: Wachtel, Rebhuhn, Feldlerche, Heidelerche, Neuntöter, Feldsperling

Der BUND Naturschutz hat einen neuen Landesgeschäftsführer. Am 1. September hat Lucas Schäfer das Amt von Peter Rottner übernommen, der es seit 2003 innehatte. Der Landesgeschäftsführer trägt im BN die Gesamtverantwortung für zentrale Funktionen wie Finanzen, Personalwesen, Liegenschaften und Verwaltung. Den BN lernte Lucas Schäfer aus einer ganz besonderen Perspektive kennen, nämlich als Teamleiter in der Mitgliederwerbung. Mit dieser Tätigkeit hat er sein Studium der Volkswirtschaft und Politik in London und Paris finanziert. Gleichzeitig hatte er bei den Gesprächen an der Haustür »das Ohr an den Menschen«, wie er selbst sagt, und das in ganz Bayern. Anschließend war Lucas Schäfer bundesweiter Werbeleiter in der Haustürwerbung des BUND und in den vergangenen vier Jahren, von 2021 bis 2025, Geschäftsführer des BUND Hamburg. Parallel absolvierte der gebürtige Baden-Württemberger einen Executive Master of Science in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation. Für seine neue Aufgabe als Landesgeschäftsführer des größten BUND-
Landesverbandes hat er sich das vorgenommen, was man in der Betriebswirtschaft »beidhändiges Management« nennt: einerseits das bisher Erreichte bewahren und darauf aufbauen, andererseits Neues entwickeln, wo Neuerungen gebraucht werden. Schwerpunkte seiner Arbeit sieht Lucas Schäfer im Bereich Digitalisierung und Verbandsentwicklung. Der bisherige Landesgeschäftsführer bleibt dem BN übrigens als Justiziar erhalten. Seine wertvollen Kenntnisse als Fachanwalt für Verwaltungsrecht werden also auch in künftigen Gerichtsverfahren zur Anwendung kommen. Der BN-Vorsitzende Richard Mergner würdigte Peter Rottner bei dessen Verabschiedung als »Element der Sicherheit im Verband«, der in seiner 22-jährigen Amtszeit große Veränderungen angestoßen und begleitet habe.
Rottner gab seinem Nachfolger Lucas Schäfer mit auf den Weg, als Landesgeschäftsführer sei es seine Aufgabe, »die Herde zusammenzuhalten und auch mal zu bellen«.
Luise Frank

Wie anders? Ganz anders! Alle Sonett-Produkte sind ohne Erdöltenside ohne Gentechnik ohne Enzyme ohne synthetische Duft- und Konservierungsstoffe ohne Nanotechnologie und Mikroplastik gut rhythmisierte balsamische Zusätze gut CO 2 -Engagement 100 % biologisch abbaubar
100 % Seifen aus Bio-Ölen
100 % ätherische Öle aus Bioanbau
100 % Volldeklaration
Zertifiziert durch:
Sonett – so gut. | www.sonett.eu

Das nur meterhohe Dahomey ist eine der kleinsten Rinderrassen der Welt. Auf der wilden Weide der BN-Ortgruppe Waldkraiburg haben sich die putzigen Minirinder seit einem Jahr im Landschaftspflegeeinsatz bewährt.
»Es sind vollwertige Rinder, auch wenn sie nicht größer als meine Schafe sind«, erklärt BN-Ortsvorsitzende Bettina Rolle.
Für den BN-Beweidungsexperten Andreas Zahn sind die Dahomeys eine ideale Alternative zu Schafen bei der Pflege von Freiflächen-PV-Anlagen. »Sie fressen we-

niger selektiv als Schafe, die sich gerne Kräuter und Blüten herauspicken und harte Gräser verschmähen«, erklärt er. Die Gefahr, dass artenarme Graswüsten entstehen, ist deshalb bei Dahomeys gering, auch wenn wenige Tiere lange auf einer PV-Fläche weiden. Und aufgrund ihrer geringen Körpergröße passen sie besser unter PV-Module als »normale« Rinder.
Die Zwergrasse kam übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem afrikanischen Königreich Dahomey nach Europa. Sie sollten eigentlich als Futter für die transportierten Raubtiere dienen.
Vor zehn Jahren veröffentlichte der inzwischen verstorbene Papst Franziskus seine UmweltEnzyklika »Laudato siʼ«. Aus diesem Anlass veranstaltete die Katholische Akademie Bayern am 2. Oktober eine Tagung. Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe sprach über die Auswirkung von Laudato siʼ auf Kirche und Umweltschutzbewegung.
Die Enzyklika war das erste päpstliche Lehrschreiben, das sich explizit ökologischen Themen widmete und erhielt bei der Veröffentlichung viel Aufmerksamkeit auch außerhalb der katholischen Kirche. Viele Kernaussagen des Textes lägen auf einer Wellenlänge mit den Forderungen der Umweltbewegung, betonte Martin Geilhufe, so zum Beispiel die Wachstums- und Systemkritik.
Seit dem Erscheinungsjahr 2015 hätten sich jedoch viele Dinge grundlegend ge-
Ob Artensterben, Klimakrise oder Umweltpolitik – im Podcast »UmweltG’schichten« beleuchtet der BN aktuelle ökologische Themen in Bayern und Deutschland.
Etwa einmal im Monat diskutiert der BNPressesprecher Felix Hälbich, seines Zeichens gelernter Radio-Redakteur, mit spannenden Gästen über umweltpolitische Entwicklungen, Hintergründe und Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft. Bisherige Folgen beschäftigen sich mit Igeln im Herbst, unseren Stadtbäumen in Hitze und Trockenheit, dem bayerischen Skitourismus in Zeiten der Klimakrise, der Wasserbilanz des Sommers 2025 sowie dem Wolf.
Zu finden sind die UmweltG’schichten bei Spotify, Amazon Music und Apple Podcast. Reinhören und mitdenken!

ändert: Die Gesellschaft sei polarisiert wie nie, so Geilhufe, das Thema Umweltund Klimaschutz gerate zunehmend unter Druck. Um der Enzyklika gerecht zu werden, sollten die Kirchen Verantwortung für die Schöpfung übernehmen und ihren Besitz entsprechend einsetzen. Gute Beispiele dafür gebe es bereits. Erste Anzeichen sprechen übrigens dafür, dass Papst Leo XIV. die Ausrichtung der katholischen Kirche an der Bewahrung der Schöpfung fortführen will.
Ins Schwarze getroffen hatte die BNKreisgruppe Mühldorf mit ihrer Idee, das Jubiläum anlässlich ihres 50jährigen Bestehens mit einem Familienfest im BioGasthaus Gallenbach zu feiern. »Frösche über die Straße tragen«, »Fledermauszählung« und viele weitere Spiele hatten zahlreiche junge Familien zum Besuch animiert. Als Renner bei Jung und Alt erwies sich das Bullriding. Dabei handelte es sich selbstverständlich um einen künstlichen Bullen und nicht um ein lebendes Rind aus den zahlreichen Beweidungsprojekten der Kreisgruppe. Als knifflig erwies sich das Quiz über die Geschichte der Kreisgruppe (siehe Bild). Die Gewinner wurden noch während des Festes gezogen.

Am Abend sprachen der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe und Kreisgruppenvorsitzender Andreas Zahn über die Erfolge, aber auch über die aktuell schwierige Lage des Naturschutzes. Landrat

Unter dem Motto »begegnen, bewegen, begeistern« stand das Jubiläumsfest der Kreisgruppe Aichach-Friedberg, das im September im Schloss Blumenthal stattfand.
Das Orga-Team der Kreisgruppe hatte die Tage der offenen Tür im Schloss Blumenthal als Rahmen für die eigene Veranstaltung genutzt. Die letzten schönen Spät-
sommertage lockten Tausende Besucher*innen zum Schloss, so dass auch die Kreisgruppe sich über viel Interesse freuen konnte. Mit einer Ausstellung zur heimischen Tierwelt, Filmen und Musik war für jeden Geschmack etwas geboten.
Der Landesbeauftragte Martin Geilhufe gratulierte dem Vorsitzenden Ernst Haile stellvertretend für die ganze Kreisgruppe
Max Heimerl sowie die Landtagsabgeordneten Sascha Schnürer und Markus Saller würdigten in ihren Grußworten die Rolle des BUND Naturschutz im Landkreis.
Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe gratulierte zum 50-jährigen Bestehen der Kreisgruppe Aichach-Friedberg.
zu 50 Jahren Engagement für die Natur. Mit der Goldenen Ehrennadel des BN wurden bei dieser Gelegenheit zwei verdiente Ehrenamtliche ausgezeichnet: die stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende Doris Gerlach sowie Stephan Kreppold, langjähriger Sprecher des BN-Arbeitskreises Landwirtschaft.
Teilnehmer*innen des Artenkenntnis-Kurses bei der Bestimmung von Molchen

Die Zahl der Artenkenner*innen in Bayern nimmt laufend ab. Sie werden aber dringend gebraucht, etwa um bei Eingriffen in die Natur Artenschutz-Konzepte zu erstellen. Auch beim ehrenamtlichen Engagement sind Fachleute dringend gefragt. Denn ohne tieferes Verständnis für die Ansprüche einer Art schlagen viele Schutzmaßnahmen fehl.
Der BUND Naturschutz will Artenkenntnis fördern. BN-Amphibienexperte Andreas Zahn bildet deshalb in Kooperation mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) seit 2024 im Rahmen
des bundesweiten BANU-Programms Amphibien-Expert*innen auf dem Einsteigerniveau »Bronze« aus.
2025 ist die Stufe »Silber« für Fortgeschrittene hinzugekommen. Am 8. August fand die Abschlussprüfung statt. Erfreulich war, dass über 90 Prozent der Teilnehmer*innen die Prüfung zum »BANU-Zertifikat Feldherpetologie-Amphibien« erfolgreich absolviert haben. Es war die erste deutsche Amphibienprüfung auf Silberniveau. BUND Naturschutz und ANL nehmen hier eine Vorreiterrolle ein.
Warum fallen schlafende Vögel nicht vom Baum? Was machen Schmetterlinge im Winter? Und warum haben Rehkitze eigentlich Tupfen? Manfred Mistkäfer weiß die Antwort.
Sein gleichnamiges Naturmagazin für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren erscheint viermal im Jahr. Darin begeistert der kleine neugierige Käfer die Kinder mit spannenden Forscher*innengeschichten, Rätseln, Beobachtungstipps, Bastelideen und einer Menge Wissenswertem über Pflanzen und Tiere für die heimische Natur.
Jede Ausgabe enthält den Ideenmarkt, das Begleitheft für Erwachsene, mit vielen Anregungen rund um das Thema Kinder und Natur. Herausgegeben wird das Manfred-Mistkäfer-Magazin von der BUNDjugend Baden-Württemberg.
Sie möchten in Sachen Umwelt- und Naturschutz immer auf dem Laufenden sein? Dann ist unser Newsletter genau das Richtige für Sie. Wir informieren über aktuelle Themen, Aktionen und Termine. www.bund-naturschutz.de/newsletter
Hättest du den Baum erkannt? Dann mach mit bei unserem Baum-Quiz.
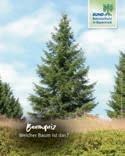
www.instagram.com/ bundnaturschutz

Mitmachmagazin Das

Informationen
Ein Abonnement kostet 20 Euro pro Jahr. Bestellungen und nähere Informationen unter Telefon 0711/6 19 70-24 oder auf www.naturtagebuch.de
Natur+Umwelt-Leser*innen erhalten bei Angabe des Stichworts »Umwelt« die Manfred-Mistkäfer-Winterausgabe und ein Schmetterlingsposter gratis dazu!
















Raimund Schoberer ist seit 2009 Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Regensburg. Als Bauingenieur hat er ein Talent für Struktur und Planung – und genau das bringt er neben seiner Liebe zu artenreichen Flächen in den Umwelt- und Naturschutz ein.
Warum er sich im Naturschutz engagiert, weiß Raimund Schoberer genau: »Nichtstun ist viel frustrierender«, sagt er. »Und bevor ich ein Magengeschwür kriege, packe ich an – im Hier, im Jetzt und vor allem im Team.« Erfolg kommt am ehesten, wenn man ihn gemeinsam sucht. Diese Botschaft ist Raimund Schoberer besonders wichtig.
»Jeder Mensch hat seine Stärken und Fähigkeiten – und genau das kommt in unserer Kreisgruppe zum Tragen«, sagt er. »Bei Käfern und Faltern kenne ich mich beispielsweise nicht so gut aus«, gibt er schmunzelnd zu, »aber bei Bebauungsplänen weiß ich, was verfahrensrelevant ist.« Und das ist entscheidend, wenn es darum geht, Naturschutz zur Not auch juristisch durchzusetzen.
Ein Instrument schätzt er dabei besonders – nicht aus Freude am Konflikt, »sondern um der Natur eine Stimme zu geben«: das Verbandsklagerecht. »Allein die Möglichkeit einer Klage führt dazu, dass die Planungsträger sorgfältiger werden. Vieles wird dadurch nicht gleich gut, aber immerhin besser, als wenn es uns als BN nicht gäbe.« Schoberer und die Kreisgruppe scheuen die Auseinandersetzung also
nicht. So verteidigten sie erfolgreich bis zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Grundstücksgrenze ihrer ökologisch wertvollen Wiesen am Otterbach.
Kernanliegen des Regensburger BN sind die Energiewende, Umweltbildung und die vielen ökologisch kostbaren Flächen, die gepflegt werden – etwa der wildromantische Otterbach mit seiner Aue, die Niedermoorflächen bei Schierling oder die Magerrasen am Hutberg bei Kallmünz. Paradiese der Artenvielfalt. Ein besonderer Erfolg ist die Renaturierung der Donauinsel bei Mariaort: ab 2006 verwandelte die Kreisgruppe dort öde, pestizidbelastete Äcker in ein Mosaik aus extensiven Wiesen, Aussichtspunkten und einer Zone, in der die Natur sich selbst überlassen bleibt. »Zauneidechsen, Ameisenbläuling und Widderchen breiten sich hier wieder aus«, erzählt Schoberer hörbar begeistert. Für ihn ist Mariaort ein Ort, an dem sichtbar wird, was man in der jüngeren Klimabewegung »nature healing« nennt: eine Oase, in der die Lebenskraft der Natur zeigt, was möglich ist – ganz im Sinn des EU-Nature Restoration Law.
Ein Leuchtturmprojekt ist das Naturmobil: ein fahrbares Klassenzimmer, das Schulen und Kindergärten besucht. Rund 75 Einsätze und über 1800 Kinder im Jahr – sie entdecken Pflanzen, Insekten und Wasserlebewesen und lernen, dass Natur nicht Kulisse ist, sondern Lebensgrundlage. Genau dieser Perspektivenwechsel, der auf eine Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein zielt, ist Schoberer wichtig. »Die ökologische Krise hat ihre Wurzel in unserem Lebensstil. Selbst gut informierte und ökologisch denkende Menschen machen hier nur ungern Abstriche. Den meisten fällt es schwer, die eigene Verstrickung in die Krise einzugestehen.« Seine Erfahrung: Kindern gelingt das leichter als Erwachsenen.
Manchmal braucht Naturschutz aber einfach eine pfiffige Idee. So hat die Kreisgruppe im Sommer 2025 in Kooperation mit dem Stadtgartenamt drei Eichhörnchen-Seilbrücken spannen lassen. Seither hangeln sich die kleinen Kletterer gefahrlos über den Autoverkehr. So kann eine gute Tat eben auch aussehen.
Margarete Moulin
Die beiden Jungadler im Horst, aufgenommen von der dort angebrachten Wildtierkamera


KREISGRUPPE WUNSIEDEL
Erstmals flogen im Sommer wieder junge
Fischadler über dem »Breiten Teich« bei Selb aus. Die Jungvögel wurden von ihren Eltern im Horst des BUND Naturschutz aufgezogen.
Eine Spende der Sparkasse hatte es der Kreisgruppe Wunsiedel 2023 ermöglicht, gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten einen Kunsthorst auf einer alten Kiefer am BN-eigenen Gewässer im Staatswald zu errichten.
Den Aufbau mit Stahlring und Weidenkorb hatte damals der erfahrene Baumsteiger Matthias Gibhardt übernommen, der im benachbarten Tirschenreuther Teichgebiet als »Adlervater« bekannt ist. Der Standort am Breiten Teich wurde bewusst gewählt: fernab von Störungen, gewässernah und mit optimaler Struktur für die Ansiedlung des seltenen Greifvogels. Schon im ersten Jahr wurde der Horst von jungen Fischadlern angenommen, welche jedoch noch zu jung für eine Brut waren. 2024 vertrieb ein Seeadler die kleineren Fischadler, das Nest blieb unbe-
setzt. In diesem Frühjahr folgte dann die freudige Überraschung: Ein erwachsenes Fischadlerpaar besetzte den Horst und brütete dort mit Erfolg. Aus den beiden Adlerküken sind inzwischen Jungvögel geworden, die beringt werden konnten, bevor sie sich im Herbst auf den Weg ins Winterquartier südlich der Sahara gemacht haben. »Das ist ein fantastischer Erfolg für den Artenschutz in NordostOberfranken«, betont Heike Schöpe, Vorsitzende der BN-Kreisgruppe. Die Hoffnung auf eine Wiederkehr der Jungvögel im nächsten Frühjahr ist groß, denn Fischadler gelten als standorttreu. Die Kreisgruppe Wunsiedel wird das Projekt weiter betreuen und hofft auf eine neue, erfolgreiche Brutsaison.
Alfred Terporten-Löhner, Jörg Hacker (as)
SAND BRAUCHT SCHUTZ: Nach jahEngagement der BN-Kreisgruppe wurde die Breitenau bei Bamberg als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des Biotopverbunds »SandAchse Franken« am 21. Juni stellte die Bezirksregierung von Oberfranken das Gebiet unter Schutz. Bei der Festveranstaltung würdigte Regierungspräsident Florian Luderschmid die Ausweisung als »verdientes Geburtstagsgeschenk« zur Sicherung der fränkischen Sandlebensräume. Die Breitenau ist eines der ökologisch wertvollsten Sandgebiete Nordbayerns. Ihre offenen Sandrasen, Heiden und lichten Kiefernwälder beherbergen zahlreiche spezialisierte und gefährdete Arten. Für den BN ist das neue Schutzgebiet ein Meilenstein – und Ansporn, den Biotopverbund entlang der SandAchse weiter zu stärken.

KLARE BOTSCHAFT: Bei hochsommerlichen Temperaturen radelte die BNKreisgruppe Bamberg am 29. Juni, gemeinsam mit dem ADFC Bamberg, zum »Nationalparktag« im Garten des Klosterbräu in Ebrach. Lohn der Strampelei: das kühle und schattige Grün der uralten Buchen des Steigerwalds. So wurde hautnah erfahrbar, warum der Schutz alter Wälder ebenso ein Schutz für Menschen ist. Auch 2025 stand der Nationalparktag wieder im Zeichen des Engagements für den Nationalpark Steigerwald.
IHR ANSPRECHPARTNER
Oberfranken: Jörg Hacker Tel. 01 60/7 92 02 67 joerg.hacker@bund-naturschutz.de
BN-Aktive protestierten Anfang Juli auf der Oberndorfer Abbaufläche gegen die Gipsgrube.

Bei Ipsheim im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim will die Firma CA-Tex auf rund 112 Hektar Fläche in großem Stil Gips abbauen. Der BUND Naturschutz kritisiert das Vorhaben massiv.
Geplant ist, den Rohgips sowohl unter als auch über Tage zu fördern — bis zu 140 000 Tonnen jährlich, für bis zu 175 Jahre. Für die Natur nahe dem Ipsheimer Gemeindeteil Oberndorf hätte dies gravierende Folgen.
»Eine Genehmigung für fast zwei Jahrhunderte ist unverantwortlich! Die Zerstörung der Landschaft darf nicht für Generationen festgeschrieben werden«, sagte Karin Eigenthaler, Vorsitzende der örtlichen BN-Kreisgruppe (siehe Foto, ganz rechts), Anfang Juli bei einer Protestaktion vor Ort.
Im Fokus der Kritik stehen die ökologischen Risiken: Das Abbaugebiet liegt im Naturpark Steigerwald, umgeben von Biotopen sowie dem FFH-Schutzgebiet »Külsheimer Gipshügel« mit dem darin gelegenen Naturschutzgebiet. Dessen empfindliche Vegetation würde durch die erhöhte Staubbelastung infolge des Ab-
baus beeinrächtigt. Weiter bleibt trotz Umweltverträglichkeitsprüfung unklar, wie sich die gigantische Gipsgrube langfristig auf Grundwasserstände und Wasserqualität auswirkt.
Der BN fürchtet, dass Quellen versiegen oder sich Grundwasserleiter verschieben könnten. Zudem müsste dafür in großem Stil Humus abgetragen werden, was die Funktion der Böden als CO2-Speicher zerstört – und das in Zeiten der Klimakrise. Angesichts der Vielzahl an Risiken und der unkonkreten Ausgleichsmaßnahmen fordert der BN einen Stopp des Vorhabens. Doch obwohl Gips wiederverwendet werden kann und recycelter Gips verfügbar ist, hält das Unternehmen am Abbau fest und zementiert so die zerstörerische Ausbeutung natürlicher Ressourcen.
Jonas Kaufmann (as)
LETZTE CHANCE: Der BN kämpft weiter gegen den autobahnartigen Ausbau des Frankenschnellwegs. Für das die geplante Verkehrsachse müssten fast 80 000 Quadratmeter dicht bewachsener Fläche gerodet werden darunter über zwei Hektar geschützte Biotope sowie Kleingärten und der Aktivspielplatz Volkmannstraße. Der Verlust an Grün und Bäumen sowie mindestens zwölf Jahre Bauarbeiten dürften Stadtbild und Klima Nürnbergs erheblich beeinträchtigen. Im Herbst wurden leider bereits erste Bäume gefällt, bis zu tausend weitere könnten noch zusätzlich folgen. In einer Protestaktion hatte die BN-Kreisgruppe Nürnberg gemeinsam mit dem Verein »BauLust« und weiteren Mitstreitern am 5. September bedrohte Bäume gekennzeichnet (siehe Bild). BN und Verein haben nun mit dem Bürgerbegehren »Zurück auf Los«, das aktuell im Nürnberger Stadtgebiet läuft, einen letzten Versuch gestartet, das zerstörerische Vorhaben noch zu verhindern. Hier gibt es weitere Infos: www.zurueck-auf-los.de

NEUWAHLEN: In der Kreisgruppe Nürnberger Land votierten die Mitglieder im Juli für Miranda Bellchambers als neue BN-Vorsitzende. Sie folgt auf Herbert Barthel. In der Kreisgruppe Neustadt/AischBad Windsheim wurde Karin Eigenthaler als erste Vorsitzende im Amt bestätigt.
IHR ANSPRECHPARTNER
Mittelfranken: Jonas Kaufmann
Tel. 01 60/7 75 18 31 jonas.kaufmann@bund-naturschutz.de
»Bandi«, das Maskottchen des Grünen Bands, warb auf der Gartenschau für diesen einzigartigen europäischen Natur- und Kulturverbund.

KREISGRUPPE CHAM
Großer Andrang herrschte am »Wochenende des Grünen Bandes« Mitte Juli in Furth im Wald. Auch der BUND und die BN-Kreisgruppe Cham beteiligten sich dort mit einem Stand.
Nur knapp vier Kilometer Luftlinie sind es vom dortigen Gelände der diesjährigen Landesgartenschau bis zur tschechischen Grenze. Grund genug für das Nationale BUND Kompetenzzentrum Grünes Band, gemeinsam mit der Kreisgruppe über das »Grüne Band« zu informieren.
Dazu nutzten die Aktiven den Pavillon des Bayerischen Umweltministeriums, wo eine Tafel die große Artenvielfalt dieses mit 12 500 Kilometern längsten europäischen Naturkorridors entlang des einstigen Grenzverlaufs aufzeigte. Tatkräftig unterstützt von der BN-Kreisgruppe Cham betreute das BUND-Team den Informationsstand, der über die beiden Tage hinweg gut besucht war.
Besonderes Highlight war das Glücksrad: Hier konnten die Besucher*innen in
Quizfragen ihr Wissen über das »Grüne Band Europa« testen. Flyer informierten über die Bedeutung dieses Lebensraumverbunds für den Naturschutz, aber auch über seine historische Bedeutung als »Gedächtnislandschaft«, zur Erinnerung an den »Eisernen Vorhang«, der Ost und West in der Zeit des Kalten Kriegs bis Ende der 1980er Jahre trennte.
Bei einer deutsch-tschechischen Podiumsdiskussion wurde die langjährige grenzübergreifende Kooperation beider Staaten im Rahmen des Grünen Bandes vorgestellt und gewürdigt. Als besonderer Botschafter für die einzigartigen Naturund Kulturlandschaften im bayerischtschechischen Grenzgebiet war zudem das Maskottchen »Bandi« auf dem Gartenschaugelände unterwegs.
Melanie Kreutz, Stefan Entner (rs, as)
MOOR IM FOKUS: Das traditionelle Moorfest der BN-Kreisgruppe Neumarkt lockte Ende Juni wieder zahlreiche Naturinteressierte ins Tal der Schwarzen Laber. Im Mittelpunkt standen eine Foto-Ausstellung und Führungen durch das Deusmaurer Moor. Dort hat sich unter anderem ein Bestand der Blauen Himmelsleiter erhalten, einem Relikt der eiszeitlichen Vegetation. Bei den Führungen für Jugendliche stand der Biber im Mittelpunkt, der das Moor durch seine Dämme feuchthält und so die Biodiversität dieses Naturraums bereichert. Auch für Kinder bot die Kreisgruppe ein umfangreiches Programm mit Beobachtungen am Binokular, Spielen und Rätseln aus der Natur.

MOBILITÄT NEU DENKEN: Unter diesem Motto unterstützt die BN-Kreisgruppe Regensburg ein Bürgerbegehren gegen die Sallerner Regenbrücke, für das seit Juni Unterschriften gesammelt werden. Ein Bündnis aus 23 Organisationen will so einen Bürgerentscheid erreichen, um die geplante Brücke über den Regen beim Stadtteil Sallern noch zu stoppen. Diese bedroht unter anderem die Aue am Westufer des Flusses (siehe Bild). Der vierspurige Brückenbau würde quasi zu einer Stadtautobahn durch Regensburg mit bis zu 28 000 Fahrzeugen pro Tag führen, mit all den negativen Folgen wie Zerschneidung, Versiegelung, Grünverlust, Feinstaub und Lärm.
Info: www.sallerner-regenbruecke.de
IHR ANSPRECHPARTNER
Oberpfalz: Reinhard Scheuerlein Tel. 09 11/8 18 78-13 reinhard.scheuerlein@ bund-naturschutz.de
Die Sandharlander Heide ist ein Sandlebensraum mit hoher Biodiversität.

KREISGRUPPE KELHEIM
Die Sandharlander Heide ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Bayerns. Um sie zu erhalten, wird die Fläche von der Ortsgruppe Abensberg des BUND Naturschutz gepflegt.
Schon früh erkannten Aktive des BN den ökologischen Wert dieser ehemaligen Allmende bei Abensberg: Die frühere Gemeindeweide wurde bereits in den 1960er Jahren vom BN betreut und 1970 unter Naturschutz gestellt. Seit 1984 koordiniert der Kelheimer Landschaftspflegeverband VöF unter Beteiligung der Kreisgruppe die Pflege und Entwicklung des elf Hektar großen Gebiets. Ein Mosaik aus kalkreichen Jura- und sauren Sandböden prägt die Sandharlander Heide, mit Plattenkalk, Binnendünen, Sandkiefernwäldern und Magerrasen. Als die Weidenutzung Ende der 1960er Jahre aufgegeben wurde, drohte sie zu verbuschen und ihre Artenvielfalt zu verlieren. Durch Flächenankauf, Pflege und wiederbelebte Schafbeweidung gelang es dem BN, die Biodiversität des Gebiets mit über
240 Pflanzenarten, darunter Flügelginster und Frühlingsküchenschelle, und typischen Tierarten von Heidelerche bis Wildbiene zu erhalten.
Heute ist der Heidecharakter des Areals vor allem durch die Ausbreitung von Gehölzen bedroht. Besonders die nicht heimischen Robinien im Randbereich machen den Naturschützer*innen Sorgen: Ihre Wurzeln verdrängen die der heidetypischen Pflanzen; zusätzlich schaden sie der Magerrasenflora durch die unerwünschte Anreicherung von Stickstoff im Boden. Um die Heide zu erhalten, organisiert die BN-Ortsgruppe Abensberg daher regelmäßig Arbeitseinsätze und schneidet zugewachsene Flächen frei das nächste Mal im Frühjahr 2026.
Konrad Pöppel, Lena Maly-Wischhof (as)
KUNST-QUELLEN: Auch dieses Jahr veranstaltete die BN-Ortsgruppe Rottenburg im Landkreis Landshut wieder einen Umweltaktionstag anlässlich des Tags der Regionen Ende September. Passend zum BN-Schwerpunkt »Wasser und Boden« zeigte die Ortsgruppe am Michaelimarkt-Sonntag eine Ausstellung im Atelier 13 mit Bildern von Bernd-Jochen Lindner-Haag zum Thema »Quellen unserer Gemeinde«.
STACHLIGE FREUNDE: Im diesjährigen Sommer-Ferienprogramm der BNOrtsgruppe Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn ging es für Schulkinder mit der Ortsgruppenvorsitzenden Daniela Lang zur »Igelhilfe Eggenfelden«. Besonders die Station für verletzte und kranke Tiere stieß auf großes Interesse. Betreiberin Margot Niedl zeigte auf, welchen Gefahren Igel durch ihre Lebensweise ausgesetzt sind, unter anderem durch Mähro-

boter, Hunde oder Rattengift. Die Expertin erklärte den Kindern, was sie im eigenen Garten für Igel tun können: zum Beispiel Katzentrockenfutter ohne Getreide-Anteil anbieten, eine flache Schüssel mit frischem Wasser bereithalten und einen Rückzugsraum mit Laub, Zweigen, Reisig oder Buschwerk im Garten anbieten. Weiter lernten die Ferienkinder, wie man ein Futterhaus für Igel baut.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Niederbayern: Lena Maly-Wischhof Tel. 0 89/54 83 01 12 lena.maly-wischhof@ bund-naturschutz.de
Aktive

KREISGRUPPE NEU-ULM
Im neuen Beweidungsprojekt des BUND
Naturschutz im Landkreis Neu-Ulm pflegen
Dexter-Rinder den Lebensraum von Amphibien, Libellen und anderen Tierarten.
Bei Bubenhausen, einem Ortsteil von Weißenhorn, ist die BN-Kreisgruppe Neu-Ulm eine Partnerschaft mit Landwirt Max Sailer eingegangen, um ein wertvolles Feuchtgebiet zu erhalten — zum Nutzen beider Seiten. Die etwa eineinhalb Hektar große Pachtfläche des BN in der Roth-Aue ist mit Großseggen-Riedgräsern bewachsen, die bisher ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden mussten. Diese Pflegemahd war nötig, um das Gebiet offen und frei von Büschen und Bäumen zu halten und so als Lebensraum zu bewahren.
Künftig übernehmen vierbeinige Helfer diese Arbeit, bodenschonend und ohne fossile Treibstoffe: Seit diesem Sommer pflegen genügsame, robuste und leichtgewichtige Rinder der irischen DexterRasse die Sauergraswiesen und erhalten so auf natürliche Weise die Landschaft.
Die zurzeit siebenköpfige Rindergruppe von Landwirt Seiler ist im Familienverband unterwegs und bleibt ganzjährig draußen auf der Weide.
Zunächst sollen die Tiere die Pachtfläche ein halbes Jahr lang beweiden. Als Wasserstellen haben sie schon die kleinen Tümpel für sich entdeckt, die die Aktiven der Kreisgruppe dort für Amphibien, Libellen und andere Tierarten angelegt haben. Und weil durch die Beweidung der Boden zum Teil freigelegt wird, hofft der BN, dass dadurch schlummernde Samen seltener Wildpflanzenarten »geweckt« werden und so die Artenvielfalt zunimmt. Überprüft wird dies durch ein entsprechendes Monitoring des BN. Das Projekt wird durch das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm gefördert.
Thomas Frey (as)
ABGEWEHRT: Obwohl das Verwaltungsgericht Augsburg nach einer BN-Klage die Abschussverordnung für Biber des Landratsamtes Oberallgäu vom September 2024 aufgehoben hatte, erließ das Landratsamt in diesem Jahr erneut eine gleichlautende Verordnung. Damit hätten die Tiere pauschal entlang überörtlicher Straßen und Bahnlinien abgeschossen werden können; die Genehmigung hätte über 1000 Gewässerabschnitte auf rund 3700 Hektar Fläche betroffen. Im Februar klagte der BN erneut und bekam Anfang August wieder recht. Das Verwaltungsgericht bewertete die Verfügung als rechtswidrig und ordnete aufschiebende Wirkung an, gerade rechtzeitig vor Ende der Biber-Schonzeit ab 1. September.

ERNEUT GERETTET: Noch vor elf Jahren war der Falchengraben bei Erkheim im Unterallgäu eines der Gewässer in Bayern mit den meisten Bachmuscheln (Unio crassus). Doch die Population der streng geschützten Art war durch extreme Verschlammung des Baches stark zurückgegangen. In einem Pilotprojekt sanierten BN und Landschaftspflegeverband im Spätsommer die Bachsohle. Ehrenamtliche der Ortsgruppe siebten aus dem Schlamm in 170 Stunden an die 250 Muscheln und setzten sie nach der Sanierung wieder ein. So haben die seltenen Weichtiere eine Chance, auch längerfristig im Falchengraben zu überleben.
IHR ANSPRECHPARTNER
Schwaben: Thomas Frey Tel. 0 89/54 82 98-64 thomas.frey@bund-naturschutz.de

KREISGRUPPE NEUBURG – SCHROBENHAUSEN
Pünktlich zu Beginn der Sommerferien wurde die Ostumfahrung Neuburg mit zweiter Donaubrücke genehmigt. Der BUND Naturschutz klagt nun dagegen.
Die Regierung von Oberbayern hatte am 1. August den Planfeststellungsbeschluss für das umstrittene Projekt erlassen. Daraufhin reichte der BN Ende September beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Klage gegen den Beschluss ein.
Die geplante Streckenführung würde den Donauauwald durchschneiden ein nach EU-Recht streng geschütztes Natura2000-Gebiet, das mit seinem Alt- und Totholz ein Refugium für Spechte, viele seltene Vogelarten und unzählige Insekten ist. Als Kohlenstoffspeicher sind die Auen zudem wichtig im Kampf gegen die Klimakrise. Auch ein Teil des Englischen Gartens, ein beliebtes Naherholungsgebiet der Stadt, wäre vom Bau betroffen.
Die Trasse würde das geschützte Auengebiet erheblich beeinträchtigen. Nach Europarecht darf in einem solchen Fall
nur gebaut werden, wenn es gleichwertige Ausgleichsmaßnahmen gibt. Nach Ansicht des BN reichen diese aber nicht aus. Zudem liegen die Kosten des überdimensionierten Vorhabens bei rund 85 Millionen Euro; der Eigenanteil der Stadt liegt bei immer noch hohen 13 Millionen Euro. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative »Auwald statt Asphalt« und Bürger*innen der Nachbargemeinde Bergheim stemmt sich die BN-Kreisgruppe weiter gegen die Ostumfahrung.
Zudem bestehen erhebliche Zweifel, ob die genehmigte Trasse die Innenstadt wirklich entlastet oder womöglich sogar zusätzlichen Verkehr anzieht. Angesichts der Klimakrise fordert der BN, endlich in eine echte Verkehrswende zu investieren und den öffentlichen Nahverkehr auszubauen.
Annemarie Räder
(as)
GRATULATION: Gleich doppelte Glückwünsche gehen an Dr. Eberhard Sening von der BN-Ortsgruppe Dießen am Ammersee. Bereits im Dezember 2024 hatte der Biologe seinen 90. Geburtstag gefeiert. Am 13. November dieses Jahres wurde er dann für die 30-jährige Leitung der Ortsgruppe mit der Goldenen Ehrennadel des Landesverbands ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für das langjährige Engagement!

GUT GESCHÜTZT: Ein Jahr lang hat das Amphibienretter-Team in Emmerting im Landkreis Altötting getüftelt nun gibt es dort Gully-Ausstiegshilfen für Frösche und Kröten. Denn viele Amphibien verenden in den Gullys, wenn sie nach Nahrung suchen oder ins Winterquartier wandern und nicht mehr herausfinden. Der Prototyp aus Metallmaschendraht wurde so konstruiert, dass er die Arbeiten des Bauhofs nicht behindert. Rund 30 solcher Kletterhilfen sind bereits verbaut und werden regelmäßig kontrolliert. Dank des großen Einsatzes der Freiwilligen sollen nach und nach weitere Gullys amphibienfreundlich werden.

ANSPRECHPARTNERINNEN
Oberbayern: Annemarie Räder
Tel. 01 70/4 04 27 97
annemarie.raeder@bund-naturschutz.de
Julika Schreiber (Region München) Tel. 01 70/3 58 18 70 julika.schreiber@bund-naturschutz.de
Bei der Preisverleihung (vo.li.): Oberbürgermeister Jürgen Herzing, BN-Kreisvorsitzende Dagmar Förster, ihre Stellvertreterin Ruth Radl und Julia Bauer, Sachgebietsleiterin Klima und Nachhaltigkeit

Für 30 Jahre erfolgreiche Umweltbildung wurde die Kreisgruppe Aschaffenburg des BUND Naturschutz im Juni mit dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt ausgezeichnet. Ein toller Erfolg!
Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird jährlich an Projekte vergeben, die gemäß der lokalen Agenda 21 mindestens zwei der Bereiche Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur vernetzen. Mit ihrem Umweltbildungsprogramm orientiert sich die BN-Kreisgruppe bereits seit 1994 an diesen Kriterien. Schon damals bot der BN in Aschaffenburg ein Umweltprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien. Schul- und Kindergartenkinder konnten so die Lebensräume in Wald, Wiese oder Bach erforschen, ergänzt durch BN-Angebote an den Schulen. Im Rahmen des Projekts »Wildes Klassenzimmer« werden diese seit 2010 auch von der Stadt Aschaffenburg gefördert: Umweltpädagog*innen gestalten für Schulen und Kindergärten einen Projekttag, meist in den Naturräumen vor Ort. Zusätzlich veranstaltet die
Kreisgruppe in Kooperation mit der Stadt »Familiensonntage« mit Aktionen für Eltern und Kinder.
Seit 2006 gibt es weiter ein jährliches Umweltbildungsprojekt des BN für Schulklassen und Kita-Gruppen im gesamten Landkreis, mit Themen wie »Im Reich des Ameisenlöwen« oder »Klimaschurken«. Gefördert werden diese Projekte durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Für ihre Bildungsarbeit erhielt die Kreisgruppe 2019 das Qualitätssiegel »Umweltbildung.Bayern«. 2022 entstand ein neues Umweltbildungsprojekt für Migrant*innen: In Kooperation mit dem Verein »MIZ« bietet der BN praktische Tipps zu gesunder Ernährung, Mülltrennung und -vermeidung und Klima- und Umweltschutz im Alltag an.
Steffen Jodl (as)
ENTDECKT: Mitte Juni machte Sebastian Seibl von der BN-Ortsgruppe Retzbach im Landkreis Main-Spessart eine Entdeckung der besonderen Art – nahe einem geplanten Baugebiet in Himmelstadt spürte er den sehr seltenen und stark gefährdeten Eremit (Osmoderma eremita) auf, auch als Juchtenkäfer bekannt. Der Fund ist so spektakulär, weil der europarechtlich geschützte Käfer im Landkreis bislang nur noch im Naturschutzgebiet Rohrberg im Hochspessart nachgewiesen war. Der Eremit ist auf Mulmhöhlen in alten Bäumen angewiesen und daher ein Beleg für besonders wertvolle Biotope.

GESCHÜTZT: Das ehemalige Militärgelände »Brönnhof« wird als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Damit geht ein Herzenswunsch der BN-Kreisgruppe Schweinfurt in Erfüllung. Mit circa 1450 Hektar Fläche ist es das größte Naturschutzgebiet im Landkreis und leistet einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität in Franken. Das zuvor bereits als FFH- und Natura 2000-Gebiet geschützte Areal besteht aus mageren Flachland-Mähwiesen, Streuobstwiesen und wertvollen Buchenund Eichenwäldern. Weite Flächen werden mit Angus-Rindern und Konik-Wildpferden beweidet. Das Gebiet bietet Lebensraum für rund 550 Pflanzenarten; auch seltene Tierarten wie der Kammmolch, die Bechsteinfledermaus und sogar die Wildkatze sind hier heimisch.
IHR ANSPRECHPARTNER
Unterfranken: Steffen Jodl Tel. 01 60/5 61 13 41 steffen.jodl@bund-naturschutz.de



»Die Selbsterfahrungen sind Anker- und Anknüpfungspunkte, die meinen Aktivismus tragen«, meint Marlo. »Seit meiner Visionssuche fühle ich in meinem Engagement mehr Halt, Gemeinschaft und Ausrichtung «, sagt Tahin. Und Christoph ergänzt: »Dank persönlicher Ermutigung kreiere ich heute inspirierende Projekte, mit denen wir richtig was bewegen.« Hand aufs Herz: Wovon bitte sprechen die? Andrea Schaupp lacht, sie nimmt einem diese Frage nicht übel. »Was wir bei unseren Seminaren machen, klingt erst einmal ziemlich abstrakt und ist nur schwer in Worte zu fassen.« Sie versucht es natürlich trotzdem. »Wir bieten jungen Menschen aus dem BUNDjugend-Umfeld die Möglichkeit, nach innen zu lauschen. Was sind persönliche Haltungen und Herausforderungen? Unsere Angebote unterstützen Aktive dabei, ihre Grenzen anzuerkennen, über sie hinauszuwachsen und Neues zu wagen.«
ZUR RUHE KOMMEN
Viele Jahre lang war Andrea Schaupp als Bildungsreferentin bei der BUNDjugend Nordrhein-Westfalen beschäftigt, bevor

JUNGE SEITE
Ausgebrannt im Aktivismus? Damit es nicht zum Burnout kommt, organisiert die BUNDjugend Seminare und Workshops.
Denn nachhaltig engagieren kann sich nur, wer auch gut für sich selbst sorgt.
sie sich mit LiNTA selbstständig machte.
LiNTA steht für »lernen, integrieren und aktiv sein« und liefert als Bildungsträger diverse Angebote, um bei Auszeiten in der Natur und in Gesprächskreisen zur Ruhe zu kommen und sich selbst besser kennenzulernen. »Es ist wichtig, Herausforderungen anzunehmen, die einem das Leben stellt«, sagt sie. Sich in eine Wohlfühloase zu flüchten, sei keine Lösung: »Wir unterstützen Menschen dabei, mit der Realität umzugehen.«
Was hat das mit der BUNDjugend zu tun? »Ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, ist wohl die größte aller Aufgaben. Damit werden wir sicher ein Lebtag nie fertig«, meint Andrea Schaupp. »Aus der Hoffnung, dass diese Vision Wirklichkeit wird, lässt sich unglaublich viel Kraft ziehen. Aber es ist auch eine riesige Angriffsfläche für Frustration und für das Gefühl, immer wieder zu scheitern.«
VOLLER EINSATZ
Sie hat es selbst erlebt, bei den Klimacamps im rheinischen Braunkohlerevier. Die Energie und die Entschlossenheit der Aktiven hat sie beeindruckt und mitgerissen. »Das war eine intensive und prägende Erfahrung. Doch irgendwann war ich ausgebrannt.« In einer Auszeit nahm sie an einer Visionssuche teil. Das brachte sie auf die Idee, solche Angebote speziell für junge Menschen in der Klima- und Umweltbewegung zu entwickeln.
Seit 2016 findet in Zusammenarbeit mit der BUNDjugend NRW eine Reihe von Veranstaltungen statt. Hier kann man sich in kleinen Gruppen austauschen, damit der Aktivismus nachhaltig bleibt. Da gibt es »KontaktZeit«-Wochenenden, bei denen man seine Geschichten teilt. Eine »WaldZeit« zur Selbstwahrnehmung, Reflexion und Neuausrichtung. Und eine Visions-


suche in Schweden, bei der man vier Tage lang fastend und nur mit dem Nötigsten ausgerüstet allein in der Natur verbringt. Da ist voller Einsatz nötig, das Programm umfasst Einzelgespräche sowie eine umfangreiche Vor- und Nachbereitung.
YOGA ALS VORSORGE
»Unser Einsatz für eine bessere Welt ist anstrengend: Das kostet viele emotionale und körperliche Ressourcen«, so Paulina Mock, Sprecherin der BUNDjugend BadenWürttemberg. Die 26-Jährige weiß um die Herausforderungen für die Aktiven: »Es ist nicht gut, die ganze Zeit nur zu powern, um dann vielleicht in ein Loch zu fallen.« Deshalb spielt die Frage der inneren Resilienz bei vielen BUNDjugend-Seminaren eine Rolle. Im vergangenen Jahr gab es zusätzlich ein Yoga-Wochenende für nachhaltigen Aktivismus. Und das war ratzfatz ausgebucht.
»Wir haben uns Zeit genommen und mit Übungen gelernt, den Blick nach innen zu richten und Kraft zu schöpfen«, sagt Paulina Mock. Ziel war, sich selbst und seine Grenzen besser kennenzulernen. Damit es gar nicht erst zur Überlastung kommt, wurde auch darüber gesprochen, wie das Gelernte in den Alltag integriert werden kann.

KLEINE SCHRITTE WEITER
»Oft hat jemand einen positiveren Blick auf ein Problem, während man selbst in einem Gedankenkarussell feststeckt. Da hilft es, über seine Gefühle zu sprechen. Die Gemeinschaft fängt vieles auf«, meint Paulina Mock. Obwohl die BUNDjugend den Anspruch hat, die Welt zu retten, besteht sie immer noch aus Individuen, die nur einen Fuß vor den anderen setzen können. »Ich muss meinen Mosaikstein finden, den ich ändern und gestalten kann, um angesichts der Probleme nicht zu verzweifeln. Gerade in dieser Zeit multipler Krisen hilft es, am Ende eines Tages innezuhalten und festzustellen: Ich bin jetzt doch wieder einen kleinen Schritt weitergekommen.«
Und wie blickt Andrea Schaupp heute auf sich selbst und ihren Aktivismus? »Mein Leben fühlt sich ganz anders an als früher: Sehr, sehr viel sinnhafter. Ich kann besser damit umgehen, wenn ich einmal scheitere. Schließlich versuche ich wirklich, mein Möglichstes zu tun.« Anstatt ausgebrannt zu sein, ist sie voller Energie: »Ich habe jetzt wieder richtig Bock.«
Helge Bendl
Auf dem Instagram-Channel des BUNDjugend-Projekts KlimaAUSbildung findet ihr kurze Video-Porträts von vier Berufsschulen und ihrem Engagement für den Klimaschutz. Die gezeigten Aktionen waren ein Teil unserer KlimAzubis-Challenge 2024/25. Sie reichen von nachhaltigem und interkulturellem Kochen bis hin zu einem ganzen Nachhaltigkeitstag. Dabei erzählen Auszubildende, Berufsschullehrkräfte und Schulleitungen, was sie erlebt und gelernt haben. Nachmachen ausdrücklich erwünscht! > @klimaausbildung

Aktiv werden
Über Seminare und Workshops informiert die BUNDjugend in den sozialen Medien und unter www.bundjugend.de.
Alle Infos über das Projekt »Visionen für die Zukunft« mit den Veranstaltungen »KontaktZeit« und »Visionssuche« gibt es auf www.bundjugend-nrw.de und bei LiNTA (www.linta.org).
Im vierten Jahr in Folge veranstalten wir als BUNDjugend einen Youth Hub zur Weltklimakonferenz. Ganz egal, wie viel du bisher über das Thema weißt –ob du schon Expert*in für internationale Klimapolitik bist oder dir das alles noch überhaupt nichts sagt: Du bist willkommen und wir freuen uns, wenn du dabei bist! Jetzt anmelden unter www.bundjugend.de/veranstaltungen
instagram.com/bundjugend bundjugend.bsky.social climatejustice.global/@bundjugend


BRIGITTE HEINZ
leitet das Projekt »Nachtretter« des BUND Baden-Württemberg.
Alles Leben auf der Erde hat sich an den TagNachtRhythmus angepasst. Durch ein Übermaß an künstlichem Licht haben wir Menschen die natürlichen Verhältnisse gehörig durcheinandergewirbelt. Die gute Nachricht: Gegen Lichtverschmutzung lässt sich leicht etwas tun. Und nebenbei Geld und Energie sparen. Wussten Sie, dass etwa 60 Prozent aller Tiere nachtaktiv sind? Indem wir Fassaden und Haustüren, Balkone und Terrassen, Wege und Auffahrten beleuchten, rauben wir Nachtfaltern, Fledermäusen und Igeln ihren Lebensraum. Tagaktive Tiere wie die Singvögel verlieren Ruhephasen und Rückzugsorte, Zugvögel die Orientierung. Selbst Bäumen schadet das Kunstlicht.
DIE NACHT RETTEN
Nicht zuletzt uns Menschen ist die Dunkelheit schleichend verlorengegangen. Auf Satellitenfotos leuchtet unser Planet nachts von Jahr zu Jahr mehr. Der Lichtsmog verkleistert den Sternenhimmel. Mit Vorhängen und Rollos verbannen wir das Kunstlicht, um schlafen zu können. Und das in einer Zeit, wo wir dringend
Künstliches Licht kann durchaus schädlich sein. Indem wir nachts auf jede unnötige Beleuchtung verzichten, schützen wir die Natur, unsere Mitmenschen und das Klima.
Energie sparen müssen, um unser Klima zu retten.
Zudem gilt die Lichtverschmutzung als ein Grund für den Rückgang vieler dämmerungs- und nachtaktiver Lebewesen. Das dramatische Insektensterben geht mit auf ihr Konto. Darum hat der BUND in Baden-Württemberg eine Kampagne gestartet. Mit zahlreichen »Nachtrettern« wollen wir die Dunkelheit als ein schutzwürdiges Gut begreifbar machen. Und dazu anregen, künstliches Licht sinnvoll zu dosieren. Unsere Zielgruppe sind Kommunen, Firmen und Kirchengemeinden. Und jede*r einzelne von uns. Denn wir alle können etwas tun.
Verzichten Sie zuallererst auf überflüssiges Dauerlicht. Selbst einzelne Lampen und vermeintlich umweltfreundliche Solarleuchten können zu einer Todesfalle für Insekten werden. Und vergeuden in der Summe immens viel Energie.
Achten Sie an Ihrem Wohnort auf unnötige Lichtquellen – angestrahlte öffentliche Gebäude, noch nach Ladenschluss beleuchtete Parkplätze, überhelle Straßenlaternen etc. Dokumentieren Sie diese am besten mit einem Foto und sprechen Sie die Verantwortlichen an.
Selbstverständlich wollen wir die Beleuchtung nicht missen, wo sie unserem
Sicherheitsempfinden dient. Viele Lampen aber strahlen nutzlos und unsinnig stark in den Himmel, zuweilen mit besonders schädlichem Blaulicht. Und wo nachts niemand unterwegs ist, muss auch nichts beleuchtet werden.
1. Prüfen Sie Ihre Außenbeleuchtung: Ist sie nur an, wenn sie gebraucht wird? Strahlt sie nur so hell wie nötig? Und ist sie gezielt ausgerichtet und streut nicht in die Umgebung?
2. Verzichten Sie auf überflüssige Dekorbeleuchtung wie Lichtkugeln, Lichterketten und Bodenstrahler.
3. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit Freundinnen, Bekannten und Ihrer Nachbarschaft. Nutzen Sie dafür unseren Flyer.
4. Sensibilisieren Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung für dieses Thema. Und weisen Sie auf grobe und unnötige Lichtverschmutzung hin. Damit helfen Sie Ihrer Kommune nicht zuletzt, Geld zu sparen.
Auf www.bund-bawue.de/nachtretter können Sie einen Flyer zur Kampagne herunterladen und bestellen. Als deren Leiterin erreichen Sie unsere Autorin unter bund.heidelberg@bund.net, Tel. 0 62 21/18 26 31.

k/Pixabay
Kosmetika können das Trinkwasser gefährden. Wie meiden Sie schadstoffhaltige Produkte?
Ob Mikroplastik oder andere langlebige Stoffe: In Kosmetika sind zweifelhafte Chemikalien weit verbreitet. Bei der Zulassung ihrer Inhaltsstoffe spielt es keine Rolle, wie sie auf die Umwelt wirken. Mit der ToxFox-App des BUND können Sie umweltschädliche Inhalte beim Einkauf aufspüren und vermeiden. Persistente und mobile Chemikalien bauen sich schlecht in der Natur ab und lösen sich besonders leicht in Gewässern. Einmal in der Umwelt, gelangen sie sehr wahrscheinlich ins Grund- oder Oberflächenwasser. In Kläranlagen werden sie nicht oder kaum zurückgehalten.
Viele Stoffe, die unser Trinkwasser gefährden, kommen auch in der Kosmetik vor. Etwa der UV-Filter »Benzophenone-4« in Sonnencreme oder der blaue Farbstoff CI 42051 in Schaumbädern, Zahnpasta und Co. Deshalb rät die BUND-Expertin Luise Körner: »Wenn Sie das Trinkwasser schützen wollen, schauen
Anzeige
Das Naturmagazin für Kinder von 8 bis 12 Jahren
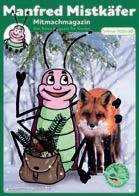
* Ein Abonnement kostet 16 €/Jahr. Ab zehn Bestellungen 14 € bei gleicher Lieferadresse. Das Magazin erscheint vier mal im Jahr. Jede Ausgabe enthält ein Begleitheft für Erwachsene.
Die Geschenkidee!
Ein Abo kostet nur 20 € im Jahr *
Infos und Bestellung unter www.naturtagebuch.de oder Telefon: 0711/619 70-24

Sie sich beim Kauf Ihrer Kosmetika die Inhaltsstoffe genau an oder nutzen Sie unseren ToxFox.«
Achten Sie darum auf zertifizierte Naturkosmetik; sie setzt auf pflanzliche Inhaltsstoffe, die in der Regel gut abbaubar sind. Und nutzen Sie unsere kostenlose ToxFox-App. Neben Mikroplastik, Nano-Stoffen, PFAS und hormonell wirksamen Substanzen spürt sie weitere Schadstoffe auf, die das Trinkwasser bedrohen. Scannen Sie einfach den Barcode der Kosmetik – dann erhalten Sie direkt Aufschluss.
Die ToxFox-App gibt's unter www.bund.net/toxfox (für Android, iOS und auch ohne App Store). Weitere BUND-Ökotipps: www.bund.net/oekotipps

Anzeige











Was muss ich für eine Balkonsolaranlage tun?










Wer ist für den Amphibienschutz an Straßen zuständig?

























































































Was blüht denn da?











Sie haben Fragen zu den Themen Artenschutz, Naturschutz, Erneuerbare Energien, Energie sparen oder brauchen Hilfe bei der Bestimmung einer Art?

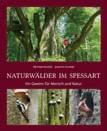
NATURWÄLDER IM SPESSART
Michael Kunkel, Joachim Kunkel
2025, Triga-Verlag, 44 Euro
Schatzkammer der Natur
Nach dem Bildband »Der Spessart« legen die Brüder Joachim und Michael Kunkel nun ein neues Buch über die Wälder ihrer Heimat vor, für die sie sich schon lange engagieren. Atemberaubende Fotos von Michael Kunkel und kenntnisreiche Texte von Joachim Kunkel zeigen den Spessart so, wie ihn nur wenige kennen: als Schatzkammer unberührter Natur.
Der BN-Ehrenvorsitzende Professor Hubert Weiger schreibt in seinem Vorwort: »Dieses Buch ist weit mehr als ein Bildband: Es ist ein Dokument der Hoffnung und des Widerstands, ein Zeugnis für die Schönheit und Kraft unberührter Wälder und ein Aufruf, sie zu schützen und zu mehren.«
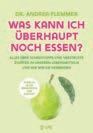
WAS KANN ICH ÜBERHAUPT NOCH ESSEN?
Dr. Andrea Flemming
2024, VAK-Verlag, 20 Euro
Ernährung, aber richtig
Der Titel dieses Buches beschreibt exakt, was sich viele Menschen fragen: Was kann ich überhaupt noch essen?
Dr. Andrea Flemmer, langjähriges BN-Mitglied, hat hier mit großem Rechercheaufwand alles zusammengetragen, was man wissen muss.
Ob Zusatzstoffe oder Pestizidrückstände: Die Autorin erklärt gut verständlich, warum manches, was in unseren Nahrungsmitteln landet, bedenklich ist. Aber auch die Auswirkungen unserer Ernährung auf die Umwelt und auf unsere Nutztiere werden angesprochen. Es bleibt aber nicht bei der Feststellung von Problemen: Das Buch bietet ausführliche Anleitung und Hilfestellung für eine gesündere Ernährung, die auch gut für den Planeten ist.
SCHNEESCHUHWANDERN IM SAALACHTAL
18. – 24. Januar 2026, Österreich
Das Salzburger Saalachtal ist eine von der Natur besonders bedachte Region, mit der wilden Saalach und der umgebenden, imposanten Bergwelt. Im Winter findet sich hier ein wahres Paradies für Naturliebhaber*innen, Aktivurlauber*innen und jene, die einfach die stille Schönheit der kalten Jahreszeit genießen möchten.

WANDERN
30. März – 9. April und 25. Mai – 4. Juni 2026, Rumänien

Diese Kultur-, Natur- und Wanderreise führt nach Rumänien und verbindet Wanderungen in den Karpaten-Nationalparken mit dem Besuch von Timişoara, europäische Kulturhauptstadt 2023, der märchenhaften Burg Hunedoara und weiteren kulturellen Höhepunkten.
KATALONIEN
30. März – 10. April 2026, Spanien
Eine Reise der Kontraste:
Von der pulsierenden Metropole Barcelona mit lebhaften Märkte, verwinkelten Gassen und markanten Gebäuden im Stil des berühmten Architekten Antonio Gaudí geht es in die Weiten

des Naturparks Delta de l’Ebre und in die eindrucksvolle Vulkanlandschaft La Garrotxa.
Weitere Informationen Tel. 09 11/588 88 20· www.bundreisen.de

Bausatz für einen Starenkasten
Nr. 22 204 26,90 €

Vogelschutz-Markierung • Ein hochwirksamer Schutz gegen Vogelschlag: Die reflektierenden Aufkleber-Punkte auf dem Fensterglas werden von Vögeln erkannt. 25 m Lauflänge für ca. 2,5 qm, 50 m Lauflänge für ca. 5 qm Fensterfläche.
Nr. 22 400
Nr. 22 401

Igel-Schnecke • Ganzjahresquartier für Igel aus klimaausgleichender Keramik, in Schneckenform zum Schutz vor Fressfeinden.
Ø 35 cm, H 16 cm, 4,5 kg.
Nr. 66 021 79,90 €

Futterfeder für Meisen knödel • Wildvögel finden guten Halt, und es bleibt kein Netz im Baum zurück. Ohne Knödel.
Nr. 66 075 8,50 €
Bio-Energieknödel (ohne Abb.)
30er-Karton
Nr. 66 063 22,99 €
Bio-Energieknödel (ohne Abb.)
30er-Karton, schalenfrei
Nr. 66 067 25,29 €

Bio-Vogelfutter • Auch Vögel wollen BioKerne! Garantiert ohne Ambrosia-Samen, frei von synthetischen Zusätzen, 1 kg. Nr. 66 060 5,20 €

Wildbienenhaus CeraNatur ® • Für die am häufigsten vorkommenden Solitär-Insekten.
Maße: H 18 x B 11,5 x L 5 cm, 1,8 kg. Nr. 22 292 39,90 €

Bio-Apfelbäume • Alte Obstsorten aus einer hessischen Baumschule (wurzelnackt, 3 bis 4-jährig, Anleitung, Pfahl und Strick inkl.).
Weitere Sorten im Shop.
Gelber Richard
Nr. 29 002 69,90 €

Luchs- und Wildkatzenkalender • Aufgenommen im Wildkatzendorf Hütscheroda. Format: DIN-A4, mineralölfreie Farben, Recyclingpapier. Nr. 39 370 16,90 €


Vogelstimmenuhr • Bei dieser Uhr singt jede Stunde ein anderer Vogel. Ø 34 cm.
Nr. 21 628
89,90 €
Windmühlenmesser • Hergestellt in Solingen aus zertifiziertem Buchenholz.
Küchenmesser Klassiker • Mit verlängertem Griff für größere Hände. Nr. 33 300 19,95 €
Tomatenmesser Rundspitz • Klinge mit Wellenschliff und abgerundeter Spitze. Nr. 33 301 34,50 €

Wolldecke Wetterstein • Verkürzen Sie die Heizperiode mit einer warmen Decke in Übergröße (150 x 210 cm), Bio-Schurwolle aus Deutschland. Weitere Modelle in verschiedenen Größen im Onlineshop.
Nr. 64 011

Teelichtglas (ohne Teelicht) einzeln Nr. 33 201 0,90 € 4 Stück Nr. 33 202 3,20 €

Teelichter aus Bienenwachs 10 Stück Nr. 27 350 9,90 €

33 088

Schneidebrett groß – Streifen Aus heimischen Hölzern: Buche, Ahorn und Rüster. ca. 27 x 40 x 2 cm. Nr. 21 391 31,50 €
Reisehandtuch Aus natürlichen Materialien und gut zu verstauen. 80 % Bio-Baumwolle, 20 % Leinen, hergestellt in Portugal, 70 x 140 cm. Nr. 80 055 35,00 €

€
Guppyfriend Waschbeutel • Verhindert, dass Mikroplastikfasern aus unserer Kleidung in Flüsse und Meere gelangen. Ausführliche Anleitung im Shop. 50 x 74 cm.
Nr. 22 639 29,75 €



Kastenbrotbäcker · Krosse Kruste und saftige Krume wie aus dem Holzbackofen dank der integrierten Wasserrinne. 36,5 x 18,5
029

FRAGEN UND ANREGUNGEN
Tel. 0 91 23/7 02 76 10 frag-den-bn@bund-naturschutz.de Mo.–Do. 10–14.30 Uhr, Di. u. Do. 16–19 Uhr

MITGLIEDSCHAFT/ADRESSÄNDERUNG
Tel. 09 41/2 97 20-65 mitglied@bund-naturschutz.de
SPENDENBESCHEINIGUNGEN
Tel. 09 41/2 97 20-66 spenderservice@bund-naturschutz.de



REDAKTION NATUR+UMWELT
Luise Frank
Tel. 0 89/5 14 69 76 12 natur-umwelt@bund-naturschutz.de
HAUS- UND STRASSENSAMMLUNG
EHRENAMTLICH AKTIV WERDEN
Christine Stefan-Iberl
Tel. 09 41/2 97 20-11 christine.stefan@bund-naturschutz.de
BN-BILDUNGSWERK
Ulli Sacher-Ley
Tel. 09 41/2 97 20-23 ulrike.sacher-ley@bund-naturschutz.de

BERATUNG ZU VERMÄCHTNISSEN, SCHENKUNGEN & STIFTUNGSWESEN
Birgit Quiel
Tel. 09 41/2 97 20-69 birgit.quiel@bund-naturschutz-stiftung.de




Geschirrtuch handgewebt und fair gehandelt, in Deutschland von Hand bedruckt, 7 Varianten, Größe: 50 x 70 cm 14,90 €






Holzbroschen »Tiere« Größe ca. 2 − 3 cm; 9 versch. Motive
IMPRESSUM
Herausgeber: BUND Naturschutz in Bayern e.V. vertreten durch Peter Rottner, Landesgeschäftsführer, Dr.-Johann-Maier-Str. 4, 93049 Regensburg, www.bund-naturschutz.de
Leitende Redakteurin (verantw.): Luise Frank (lf), Tel. 0 89/5 14 69 76 12, natur-umwelt@bund-naturschutz.de
Redaktion: Andrea Siebert (as)
Mitglieder-Service: Tel. 09 41/2 97 20-65
Gestaltung: Janda + Roscher, die WerbeBotschafter, www.janda-roscher.de (Layout: Waltraud Hofbauer)
Titelbild 4/25 (29. Jahrgang): Wasseramsel in ihrem Lebensraum –
Foto: Thomas Hinsche / bia
Redaktion BUND-Magazin: Severin Zillich (verantw.), Kaiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Tel. 0 30/27 58 64-57, Fax -40
Solar-Bausätze »Windrad« und »Radfahrer« mit BN-Logo 17,90 € 13,50 €
Holzohrringe »Fuchs« ø ca. 1 cm; 27,50 € 14,50 €


Plüschtier »Biber« hergestellt in Deutschland aus hochwertigem Plüsch; Höhe ca. 25 cm 19,95 €



Anzeigenverwaltung: Evelyn Alter, Runze & Casper Werbeagentur GmbH, alter@runze-casper.de Es gelten die Mediadaten Nr. 33. Verlag: BN Service GmbH, Eckertstr. 2, Bahnhof Lauf (links), 91207 Lauf an der Pegnitz, Tel. 0 91 23/9 99 57-20, Fax -99, info@service.bund-naturschutz.de
Druckauflage 32025: 150 000
Bezugspreis: Für Mitglieder des BN im Beitrag enthalten, für Nichtmitglieder Versandgebühr, ISSN 0721-6807
BN-Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft München, IBAN DE27 7002 0500 0008 8440 00, BIC: BFSWDE33MUE
Nistkasten »Meise« aus atmungsaktivem Holzbeton Fluglochweite 32 mm 29,50 € Foto: Schwegler GmbH

Wanderführer »Gerettete Landschaften« mit 40 Touren in Bayern 14,90 €
BUND Naturschutz Service GmbH Service-Partner des BUND Naturschutz in Bayern e.V. versand@bn-service.de
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Lieferung solange Vorrat reicht, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten.
unbedingt die Meinung der Redaktion oder des BN wieder. Nachdruck nur mit Genehmigung des BN. Für unverlangt eingesandte Artikel oder Fotos keine Gewähr. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. »Natur+Umwelt« wird auf 100% Recyclingpapier gedruckt.
DEUTSCHLAND
Das schöne Haus auf Usedom Naturnahes Ferienhaus mit schönem Hof und Garten, 3 SZ, 3 Bäder, Sauna, Kamin, Wald, Wiesen, Seen und Meer www.ferienhus.de
Rügen für Naturfreunde! Ferienhaus + FeWos in traumhafter Lage im Biosphärenreservat nahe Putbus + Bodden.
Tel. 03 83 01/8 83 24 www.in-den-goorwiesen.de
Natur pur:
See Suite auf dem Wasser Sanft auf den Wellen schaukelnd, Hausbooturlaub im Schilfgürtel, Panoramablick, Eisvogel, Biber, 100% Sonnenenergie, Süd-Mecklenburg. www.kranichboot.de
Die Perle der Chiemgauer Alpen
Aus der Türe der FeWo zum Wandern und Klettern zur Hochplatte, Kampenwand, Geigelstein + Badesee. Absolut ruhige Alleinlage am Waldrand mit Blick auf den Wilden Kaiser.
Tel. 0 86 49/98 50 82 www.zellerhof.de
Wieder Nordsee?
Nähe St. Peter Ording, FeWo für kurz entschlossene Naturfreunde, ab 45 € pro Tag, NR, Kind und Hund willkommen, Garten und Grill.
Tel. 0 48 62/80 52
EUROPA
URLAUB UNTER SEGELN
Mit dem Segelschiff BANJAARD die prächtige dänische Inselwelt entdecken. Für Familien geeignet. Keine Segelkenntnisse nötig. www.banjaard.net / info@banjaard.net
FRANKREICH
Zwischen Cévennen, Ardèche und Mittelmeer Wunderschöner Natursteinhof, mediterraner Garten. Charmante Ferienhäuschen mit eigenen Terrassen. Bäckerei und Dorfladen mit Metzgerei sowie Bar und Restaurant in den schattigen Gassen. Willkommen im Süden. www.mas-chataigner.com
GRIECHENLAND
Villa Caretta im Süden des Peloponnes Bezauberndes Ferienhaus mit eigenem Pool an einem

flachabfallenden Sandstrand. Natur und Ruhe pur! www.villa-caretta.de
ITALIEN
Italien zwischen Meer und Bergen Region. Marken, Naturpark –Alleinlage – Ruhe – Garten –Panorama – Wandern –Kulinarik, Genuss, nachhaltig Tel. 09 11/9 57 80 87 www.die-marken.de
TOSKANA
Haus mit Traumblick, großem Garten, ruhig, 66/T Tel. 01 76/96 34 91 37 www.casarustica-lampo.de
Ortasee/Norditalien
Genießen, wandern, Dolce Vita Private FeWo für 2–6 P. 480 Euro/Wo. An NR. Hunde willk. Tel. +41 7 92 08 98 02 www.ortasee.info
Toskana familienfreundlich und naturverbunden
Von BUND Mtg. hist. Bauernhaus auf Ausläufer der Küstenberge, Blick auf Insel Elba, 2 FeWo’s für 5 bzw. 7 Pers. viel Platz im und um dem Haus in unberührter Natur. Info: kemmling22@gmail.com
ökologisch - praktisch - gut für draußen & für drinnen, aus Holz, einfach steckbar, wasserdichte Baumwollplanen, Branding info@klipklap.de 033928 239890 www.klipklap.de klipklap :: Infostände & Marktstände


Nächster Anzeigenschluss: 18. Dezember 2025 www.bund-kleinanzeigen.de • Tel. 030/28018-149
Anzeige

erhältlich

Banking für eine sozial und ökologisch gerechte Zukunft. Seit 1974. Sei dabei!