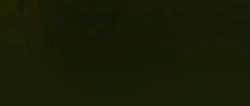03 / 25

Ratgeber: Was tun bei Trockenheit?
Aktuell: PFAS verbieten, Sackgasse Erdgas
MEHR NATUR WAGEN
Das neue EU-Renaturierungsgesetz

03 / 25

Ratgeber: Was tun bei Trockenheit?
Aktuell: PFAS verbieten, Sackgasse Erdgas
Das neue EU-Renaturierungsgesetz

Sich schlängelnde Flüsse, naturnahe Gewässer, Auwälder, nasse Moore. Als Rückhalteräume schützen solche Landschaften vor Hochwasser. Zugleich dienen sie als Wasserspeicher für Trockenzeiten.

Tier- und Pflanzenarten mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen finden hier Nahrung, Unterschlupf und Platz zum Leben. Hier kommen der Schutz von Natur und Menschen zusammen.
Mit Ihrer Hilfe schützen wir unsere Lebensgrundlage Wasser!
Bitte spenden Sie für Flächenankauf
SPENDENKONTO BUND NATURSCHUTZ
IBAN: DE24 7002 0500 9300 0005 00
Renaturierung Aufklärung
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Mitgliedsnummer mit an. Dies hilft uns Verwaltungskosten zu sparen. Bei Spenden über 300 Euro erhalten Sie eine Spendenquittung. Für Zuwendungen bis 300 Euro gilt der Bankbeleg als Nachweis für das Finanzamt.
Oder nutzen Sie unser Onlineformular unter: www.bund-naturschutz.de/spende-gegen-wasserkrise
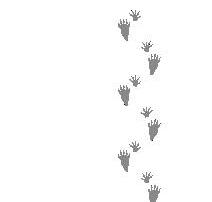


AKTUELLES
4/5 Aktuelle Meldungen
6 Kommentar
7 Gerettete Landschaft
8/9 Aktuelle Meldungen aus Bayern
10 Rappenalpbach
11 Gipsabbau gefährdet Trinkwasser
12 PFAS aktuell
13 Sackgasse Erdgas
TITELTHEMA
14 Mehr Natur wagen
15/16 Ein Meilenstein
17 Wälder + Wildnis
18 Moore
19 Offenland
20/21 BUND aktiv
NATUR IM PORTRÄT
22 Pflanzenporträt Gelber Enzian
23 40 Jahre Hutanger-Projekt
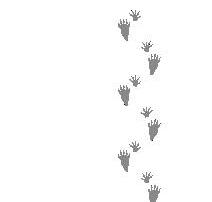
24 Neues Forschungsprojekt am Grünen Band
25 Weidetiere schützen, aber wie?
26 Lieben wir die Alpen zu Tode?
27 Wasser: zu viel oder zu wenig
28/29 Schutz für gefährdete Arten
30/31 Bedroht: Ästiger Stachelbart


AKTION
32 Petition Meeresschutz + Klima-Aktion
MOBILITÄT
33 Die Bahn der Zukunft
34/35 INTERNATIONALES
URLAUB & FREIZEIT
36 Wanderung im Pfreimdtal
37 Reise: Sardinien
BN AKTIV + NAH
38 Serie: BN-Grundstücke
39 Editorial des Vorstands
40/41 Trauer um Hubert Weinzierl
42/43 Delegiertenversammlung 2025
44-46 Meldungen
47 Umweltbildung
48 BUND-Sommerabend
49 Jubiläen
50 Porträt Klaus-Peter Murawski
51-57 Regionalseiten
58/59 Junge Seite
SERVICE
60 Ratgeber
Die Natur+Umwelt ist das Mitgliedermagazin des BUND Naturschutz und die bayerische Ausgabe des BUNDmagazins.
62 Leserbriefe
63 Medien und Reisen
66 Kontakte/Impressum


dieser Sommer hatte sowohl Hitze und Trockenheit als auch starke Regenfälle in petto. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht mit Wehmut an Sommerwochen mit stabilen Hochdruckgebieten und angenehmen Temperaturen.
Doch die Klimakrise macht aus extremen Wetterverhältnissen den neuen »Normal«Zustand. Hitze, lange Trockenperioden und Starkregen sind für Tiere und Pflanzen ebenso gefährlich wie für uns Menschen.
Natürlicher Hochwasserschutz ist deshalb mehr denn je das Gebot der Stunde, denn wenn Niederschläge besser versickern und langsamer ablaufen, landet der Starkregen nicht gleich in den großen Flüssen –und unseren Kellern.
Die Renaturierung von Mooren und Feuchtgebieten leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Solche Maßnahmen sind ein Bestandteil des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur. Lesen Sie dazu mehr in unserem Schwerpunkt ab Seite 14.
Dass dieses Gesetz bei uns Früchte trägt, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Bundesregierung. Unser Bundesverband wird in der laufenden Legislaturperiode immer wieder darauf hinweisen.
Luise Frank
Wie kann ich mich in einer Zeit wachsender Polarisierung und Verunsicherung souverän für Umwelt und Natur einsetzen? Was hilft mir, in kritischen Situationen Haltung zu wahren, handlungsfähig und dialogbereit zu bleiben?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich der BUND im Rahmen des zweijährigen Projektes »Kompetenzen für den Wandel«, gefördert vom Umweltbundesamt. In Kooperation mit dem NABU entsteht eine digitale Kursreihe, die Interessierten und Aktiven helfen soll, mit populistischen Strategien und schwierigen Gesprächssituationen umzugehen.
In alltagsnahen Szenarien können Sie Ihr Wissen erweitern und Handlungsspielräume für die Arbeit vor Ort ausloten –um auch in stürmischen Zeiten weiter Kraft und Motivation für Ihr Engagement zu finden. Schauen Sie am besten regelmäßig vorbei, um keines unserer Angebote zu verpassen!

Vielseitig einsetzbar: die »Smüster Elw« bei der
Seit einem Jahr können die Gäste des BUND-Besucherzentrums Burg Lenzen die Elbe nun vom Wasser aus entdecken. Ein Solarboot bietet einzigartige Naturerlebnisse und lädt zum Austausch ein.
Die kostenfreien Kurse sind als Teil der neuen digitalen Lernwelt der BUNDAkademie ab sofort verfügbar unter: www.bund.net/lernwelt
Fast geräuschlos gleitet die »Smüster Elw« durch die Auenlandschaft des Biosphärenreservates. Gebaut im nahen Havelberg, wird das Boot ausschließlich über Solarpaneele und zwei Elektromotoren betrieben. Das Team von Burg Lenzen hat dafür ein abwechslungsreiches Programm entwickelt. Dazu gehört Naturkundliches wie das »Birdwatching am Grünen Band« mit BUND-Experte Dieter Leupold. Oder Touren mit Martin Bar telt, der die Elbe schon in siebter Generation befischt. Zum Angebot zählen auch musikalisch begleitetes Yoga, Singen mit einem erfahrenen Chorleiter
oder die Krimifahrt »Mord auf der Elbe«, die einigen Nervenkitzel verspricht.
Wofür auch immer Sie sich bei einem Besuch in Lenzen entscheiden: Jede Tour mit dem Solarboot bringt Ihnen die Besonderheiten der Flusslandschaft Elbe näher. »Dieses Boot ist eine echte Bereicherung für unser Zentrum«, so dessen Leiterin Bettina Kühnast. »Ein großer Dank an die Deutsche Postcode Lotterie und die BUNDstiftung, die uns hierbei wesentlich unterstützt haben.«
www.burg-lenzen.de
»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.
Doch positive Neuigkeiten aus dem Naturund Umweltschutz tun einfach gut. Einige aus jüngster Zeit haben wir wie immer für Sie ausgewählt.
Renaissance der Tram: Ob Lüttich, Erlangen, Paris oder Dujiangyan –immer mehr Städte entdecken die Straßenbahn als Transportmittel (wieder). Und das aus gutem Grund. Denn die Tram bietet viele Vorteile: Ihre Klimabilanz ist meist besser als die von Linienbussen, selbst wenn diese elektrisch fahren. Hat sie eine eigene Trasse, ist sie schneller am Ziel als Busse, die zur Stoßzeit oft im Stau stecken. Und der Streckenbau ist zehnfach günstiger als bei der UBahn. Kein öffentliches Verkehrsmittel ist daher geeigneter, um Städte vom Autoverkehr zu entlasten.
Energiewende in Uruguay: In nur wenigen Jahren hat Uruguay seine Stromproduktion fast vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt. Möglich wurde das, weil der südamerikanische Staat und Privatleute von 2010 bis 2020 rund sieben Milliarden US-Dollar in die Erneuerbaren investierten, etwa 15 Prozent des damaligen Bruttoinlandsproduktes. Ausschreibungen, Steueranreize und Einspeisetarife machten den Zubau attraktiv. Zudem unterstützten die Vereinten Nationen und die Weltbank den Wandel. Deutschland gibt derzeit gerade einmal zwei Prozent seines BIP für den Umweltschutz (insgesamt) aus.
otoF : M B r eitfeld

Neue Pflanzenart beschrieben: Ein für den BUND schon Jahrzehnte ehrenamtlich Aktiver hat im Grünen Band eine bis dato gänzlich unbekannte Pflanzenart entdeckt. Der Augentrost »Euphrasia findeisii« ist nach seinem Entdecker benannt: Thomas Findeis arbeitet hauptberuflich an der Unteren Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises. Wie weit das kleine Sommerwurzgewächs außerhalb seines Fundortes im Naturschutzgebiet »Fuchspöhl« verbreitet ist, muss nun die weitere Forschung zeigen.
Wildkatze in Schleswig-Holstein? Erstmals seit Jahrhunderten wurde hier offenbar eine Europäische Wildkatze nachgewiesen. Sie tappte am 22. März im Kreis Herzogtum Lauenburg in eine Wildkamera des Landesamtes für Umwelt. Auf dem Bild ist der typisch buschige, schwarz geringelte Schwanz gut zu erkennen. Noch steht der genetische Nachweis aus. Auch ist unklar, ob das Tier hier (etwas abseits der Verbreitungsgrenze in der Lüneburger Heide) dauerhaft vorkommt oder nur auf Wanderschaft war. Das will der BUND nun mit den bewährten Lockstöcken herausfinden.
Mitglieder
Halbe Million Mitglieder: Pünktlich zu seinem runden Geburtstag hat die Mitgliederzahl des BUND eine neue Höchstmarke erreicht: Mehr als 500 000 Menschen unterstützen uns nun mit ihrer Mitgliedschaft. Ein großes Dankeschön an all jene, die dazu beigetragen haben! Herzlich willkommen, alle neuen Mitglieder! Und ein spezieller Dank an die vielen ehren- und hauptamtlich Aktiven, die daran mitwirken, dass der BUND weiterhin wächst und damit seinen Anliegen noch zusätzliches Gewicht verleihen kann.
www.bund-naturschutz.de/ mitglied
KOMMENTAR
OLAF BANDT
ist der Vorsitzende des BUND.

Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen.
In Schlüsselressorts scheint sie sich mehr der Vergangenheit als der Zukunft zu verschreiben. Was heißt das für uns?
Vor einigen Wochen saß ich erstmals Carsten Schneider gegenüber, dem neuen Bundesumweltminister. Es war ein offenes, konzentriertes Gespräch. Schneider machte deutlich, dass ihm der Naturschutz nicht nur politisch, sondern auch persönlich wichtig ist. Und er sagte einen Satz, der mir im Ohr geblieben ist: »Wir müssen unsere Erfolge auch feiern.« Da stimme ich ihm zu. Denn wir haben viel erreicht, gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit Bündnispartnern und engagierten Menschen überall im Land. Wir haben Auen renaturiert, wertvolle Natur unter Schutz gestellt, gegen klimaschädliche Gesetze geklagt – und nicht selten gewonnen. Veränderung ist also möglich. Das ist ein Fundament für Hoffnung, gerade in Zeiten, in denen so vieles infrage steht.
Gleichzeitig hat Carsten Schneider uns gebeten, Lösungskorridore zu entwickeln, die mehrheitsfähig sind und konkrete Wege für mehr Umwelt-, Natur- und Klimaschutz aufzeigen. Das ist ein wichtiger Impuls. Denn machen wir uns nichts vor: Die politische Großwetterlage ist rau. In der schwarz-roten Bundesregierung gibt es Ministerien, die den Umwelt- und Klimaschutz ganz offen ausbremsen. Und die nicht einmal mehr den Dialog suchen.
Statt die Landwirtschaft endlich naturverträglicher zu gestalten, hat etwa das Agrarministerium gerade den Höfen erlassen, genau zu dokumentieren, wie viel sie gedüngt haben – gegen allen Rat der Wissenschaft. Was uns als Bürokratieabbau verkauft wird, untergräbt in Wahrheit wichtige Umweltstandards. Statt klare Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen, erzählt uns die zuständige Wirtschaftsministerin weiter das Märchen vom Erdgas als einer Brückentechnologie. Und beim
Verkehr? Da wird einmal mehr »Beschleunigung« zum Mantra. Allerdings nicht beim Klimaschutz, sondern beim Asphaltieren. Öffentliche Beteiligung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Klagerechte geraten unter Druck.
Doch wir dürfen das Feld nicht jenen Kräften überlassen, die den Rückwärtsgang einlegen. Der BUND ist nicht dazu da, zuzuschauen. Wir sind dazu da, einzugreifen. Kürzlich haben wir mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft für mehr Natur- und Umweltschutz auf dem Acker protestiert, bei der Agrarministerkonferenz in Berlin. Einmal mehr wollten die Medien hören, was wir zu sagen haben. Ihr Interesse konnten wir bedienen. Unsere Stärke liegt im Zusammenspiel: von Hauptund Ehrenamt, von Bundesverband und Landesverbänden, von Protest und Projektarbeit.
Wir wissen, was getan werden muss. Und wir wissen, wie: durch kluge, fundierte, demokratisch verwurzelte Arbeit. Durch neue und bewährte Allianzen mit der Wissenschaft, der engagierten Zivilgesellschaft. Und durch Projekte, die zeigen, dass eine andere Politik möglich ist. Die großen Naturschutzprojekte des BUND sind solche Leuchttürme.
Wir haben allen Grund, stolz auf unsere Erfolge zu sein. Aber wir haben auch Grund, mehr zu fordern – von der Politik, der Gesellschaft, von uns selbst. Es geht nicht nur um neue Gesetze oder Förderprogramme. Es geht um eine Haltung: Umwelt- und Naturschutz dürfen nicht zur Verhandlungsmasse werden. Nicht jetzt. Nicht in dieser Zeit.

Nördlich von Nürnberg liegt der Tennenloher Forst, das größte Naturschutzgebiet in Mittelfranken. Auf fast zehn Quadratkilometern dehnt sich ein artenreiches Mosaik magerer Kiefernwälder und weiter Sandflächen aus. Das ehemalige Militärgelände beherbergt Silbergrasfluren, Heiden und Borstgrasrasen.
Diese unter Schutz zu stellen, hatte der BUND in Bayern vor 30 Jahren erfolgreich gefordert. Heute halten Ziegen und PrzewalskiPferde die Lebensräume offen. Besonders intensiv kümmert sich die BUND-Kreisgruppe Erlangen um die wertvolle Flugsanddüne Weißensee.
Mit einer Protestaktion machte das Bündnis »Rettet die Berge« auf Missstände im geplanten »Modernisierungsgesetz« aufmerksam.

Das Ende Juli beschlossene »Dritte Modernisierungsgesetz« der Bayerischen Staatsregierung wird als »Bürokratieabbau« verkauft, dabei bedeutet es einen immensen Rückschritt für den Naturschutz und drastische Einschränkung im Mitspracherecht.
Das Bündnis »Rettet die Berge« hat im Juni vor der Bayerischen Staatskanzlei mit einer Protestaktion und noch einmal mit einer Aktion auf dem Münchner Marienplatz im Juli lautstark Stellung bezogen gegen die Pläne der Söder-Regierung. Gerade auf die Alpen würde sich das Gesetz negativ auswirken. So wäre für die meisten Seilbahnen keine Umweltverträg-

München will sich für Olympia bewerben und verspricht nachhaltige Spiele mit wenig Aufwand und Kosten. Der BN erinnert an schlimme Erfahrungen anderer Olympia-Städte und einseitige Verträge zugunsten des IOC.
Olympische Sommerspiele 2036, 2040 oder auch 2044 in München wurden dabei als innovativ, nachhaltig, günstig, Stadt und Umwelt schonend und auch sonst in
lichkeitsprüfung mehr notwendig. Christine Margraf, stellvertretende Landesbeauftragte des BUND Naturschutz, erklärte dazu: »Der Schutz von Natur, Umwelt und Klima ist mehr denn je eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. Die Instrumente dafür – wie etwa Umweltverträglichkeitsprüfungen – sichern unser aller Lebensgrundlagen und gute und zukunftsfähige Planungen auch für die Wirtschaft. Wer meint, dass das unmodern ist, hat die tatsächlichen Herausforderungen unserer Zeit nicht ansatzweise verstanden: Angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Schutz!«
jeder Hinsicht positiv angepriesen. Der BN ist sehr skeptisch und spricht sich gegen eine Olympia-Bewerbung aus, die zu einem extrem teuren Bauprogramm, noch mehr Verkehr und noch mehr Flächenverbrauch führen würde.
»Natürlich können die Landeshauptstadt und der Freistaat vor dem Bürgerentscheid im Herbst wohlklingende Konzepte schreiben«, erläutert Christian Hierneis, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe München. »Aber die interessieren das Internationale Olympische Komitee nicht. Das IOC hat rein profitorientierte Vorstellungen.«
Im Mai beschloss die Bayerische Staatsregierung ein Verbot von Steuern auf Einwegverpackungen für Essen und Getränke »to go«. Der BUND Naturschutz und viele Andere kritisieren das Verbot, so auch der Bayerische Städtetag. Dessen Geschäftsführer Bernd Buckenhofer nennt das Verbot einen Eingriff in die kommunale Finanzhoheit. Er betont: »Es geht den Städten nicht um Bürokratie oder Einnahmenmehrung, sondern darum, einen Anreiz zur Müllvermeidung schaffen zu können. Weggeworfene, schmutzige Pizza-Kartons, Sushi-Verpa-

ckungen und Kaffee-Becher sind ein Ärgernis für die Menschen in unseren Städten und verursachen steigende Kosten für die Kommunen.« Eine Steuer auf To-GoEinwegverpackungen könne Bestandteil eines kommunalen Abfallvermeidungskonzepts sein.
Die Stadt Tübingen in Baden-Württemberg hat mit einer solchen Steuer gute Erfahrungen gemacht. Auch der BUND Naturschutz kritisiert das Verbot als nicht nachhaltig. Es führt zu einer weiter anschwellenden Verpackungsflut. Die Kosten für Straßenreinigung und Entsorgung zahlen letztlich alle Bürger*innen mit ihren Steuergeldern, die Gewinne streichen Fastfood-Unternehmen ein.
www.facebook.com/bundnaturschutz www.instagram.com/bundnaturschutz
bsky.app/profile/bundnaturschutz.bsky.social www.youtube.com/@bundnaturschutz
Bundesländer und Kommunen klagen über knappe Finanzmittel. Doch am falschen Ende zu sparen, wie es derzeit die Bayerische Staatsregierung plant, wird sich langfristig nicht auszahlen.




ben für die LNPR-Gelder hat die Staatsre gierung Zweifel geweckt, ob ihre eigenen Ziele und die vielen daran beteiligten Menschen ihr noch wichtig sind«, so Bea te Rutkowski, stellvertretende BN-Vorsit zende. Viele Naturschutzmaßnahmen konnten nur noch in deutlich geringerem Umfang durchgeführt werden. »Dass das Umweltministerium darüber hinaus Kürzungen für den Doppelhaushalt 2026/27 angekündigt hat, geht in die falsche Richtung. Um das Artensterben zu stoppen, brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Naturschutz«, so Rutkowski.

Auch im Bereich Umweltbildung wurden Fördermaßnahmen zusammengestrichen. Betroffen sind sowohl einzelne Projekte als auch die bayerischen Umweltstationen. Auch hier engagiert sich der













Im Doppelhaushalt 2026/2027 plant die CSU/FW-geführte bayerische Regierung, in mehreren Bereichen den Rotstift anzusetzen. Ein Beispiel: die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie (LNPR). Sie ist eine zentrale Säule der Naturschutzförderung des bayerischen Umweltministeriums. LNPR-Gelder ermöglichen die Durchührung vieler Naturschutzmaßnahmen zum Beispiel von Umweltverbänden wie dem BN, von Landwirt*innen oder den Landschaftspflegeverbänden. »Mit dem völlig überraschenden Ausgabenstopp Anfang des Jahres und neuen SparvorgaWer







BN seit vielen Jahren, um Menschen Wissen über die Natur zu vermitteln. Gerade Ehrenamtliche in den Kreis- und Ortsgruppen sind mit Begeisterung und Herzblut in der Umweltbildung aktiv. Dementsprechend groß ist die Bestürzung.
Der BUND Naturschutz ist deshalb –gemeinsam mit anderen Verbänden und Einrichtungen – mit Politiker*innen im Gespräch und leistet Überzeugungsarbeit.







































































































































UMWELTVERGEHEN
Vor fast drei Jahren deckten BN-Aktive einen Umweltskandal am Rappenalpbach auf. Passiert ist seitdem viel zu wenig. Der BN erwägt nun eine Klage.

Es ist einer der schlimmsten Naturskandale der vergangenen Jahre: Im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen wurde der naturnahe Rappenalpbach durch Bauarbeiten zerstört. Der einstige Wildbach ist einem ausgebaggerten Kanal gewichen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, 2023 und 2024 gab es Gerichtsverfahren. Doch die bisherigen Renaturierungsmaßnahmen sind viel zu gering!
Die Fachleute des BUND Naturschutz trauten ihren Augen kaum, als sie das Ausmaß der Zerstörung sahen: Der Rappenalpbach war im Herbst 2022 auf einer Länge von 1,5 Kilometern ausgebaggert, tiefer gelegt, begradigt und kanalisiert worden. Bei den Arbeiten wurde die Bachsohle aufgerissen, sodass das Wasser anfangs im Erdreich versickerte. Seitlich des Baches wurden meterhohe Kiesdäm-
Juni 2025: Eine BN-Aktive aus der Kreisgruppe Oberallgäu nimmt den traurigen Zustand des Rappenalpbachs drei Jahre nach dem Umweltskandal in Augenschein.
me aufgeschüttet, sodass die Auen vom Gewässer abgeschnitten wurden. Das übrige Steinmaterial wurde links und rechts des Baches auf bis zu zehn Metern Breite einplaniert.
Der BN hatte im November 2022 bei der Regierung von Schwaben und dem Landratsamt Oberallgäu einen Antrag auf Sanierung nach Umweltschadengesetz gestellt. Eine erste Primärsanierung hat im Sommer 2023 stattgefunden. Seitdem geht nichts mehr voran.
Nach Ansicht des BUND Naturschutz ist die Sanierung des Baches bei weitem noch nicht abgeschlossen. Von den rund 9 Hektar des Geländes, die eigentlich zum Lebensraumtyp alpines Fließgewässer
gehören, erfüllen erhebliche Anteile bis heute nicht wieder diese Funktion. Im Gegenteil: Die Dämme sind teils noch vorhanden und wachsen zu, die Situation verfestigt sich. Die Kosten für eine weitere Sanierung müssten sich Landratsamt und Alpgenossenschaft teilen. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs vor dem Verwaltungsgericht Augsburg.
Es bleibt also noch viel zu tun, um im Bachbett wieder in der ehemals vorhandenen Breite die für einen alpinen Wildbach typische Dynamik möglich zu machen. Die noch vorhandenen Deiche müssen beseitigt werden. Geschieht dies nicht, ist zu befürchten, dass der obere Flachbereich mittelfristig zuwächst und eine Weidelandgewinnung stattfindet. Der BN vermutet, dass die Alpgenossenschaft unter dem Deckmantel der Beseitigung von Hochwasserschäden eine solche illegale Vergrößerung der Weidefläche erreichen wollte.
Für die bisher schon entstandenen Umweltschäden wurde noch gar kein Ausgleich durchgeführt, obwohl das Umweltschadensgesetz das explizit vorsieht. Auch das muss noch passieren! Als Bereich dafür bieten sich ehemalige Umlagerungsflächen im nördlichen Teil des Eingriffsgebietes an, die schon vor einigen Jahren durch einen Damm abgeschnitten wurden.
Der BUND Naturschutz wird in Sachen Rappenalpbach nicht locker lassen und gegebenenfalls auch klagen, um die Behörden zum Handeln zu zwingen. Wir bleiben dran!
Mehr Infos www.bund-naturschutz.de/alpen/ rappenalptal
Ein Bergwerk unter dem Trinkwasserreservoir? Der BN lehnt ein solches Risikoprojekt (hier ein Symbolfoto) entschieden ab!

JETZT UNTERSCHREIBEN:
Ein bayernweit bedeutsamer Präzedenzfall droht: Der Baustoff-Hersteller Knauf plant in Franken das größte Gipsbergwerk Deutschlands –direkt im größten Trinkwasser-Einzugsgebiet der Stadt Würzburg.
Die »Zeller Quellen« versorgen rund die Hälfte der Würzburger Bevölkerung mit Trinkwasser. Um dies in der notorisch trockenen Region auch für die Zukunft sicherzustellen, wollen Stadt und Wasserversorger das Wasserschutzgebiet erweitern. Doch genau in der vorgesehenen weiteren Schutzzone will die Firma Knauf ein Bergwerk errichten. Das Vorhaben birgt ein hohes Risiko, denn nur eine dünne Schicht trennt das Gipslager vom Trinkwasser. Hier muss der Trinkwasserschutz Vorrang haben!
Der BUND Naturschutz fordert deshalb Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber nachdrücklich auf, das riskante Vorhaben zu verhindern. Für das Bergwerk soll der Grundwasserleiter durchstoßen und neun Meter darunter jährlich bis zu eine Million Tonnen Gips abgebaut
werden. Hier sieht der BN den Trinkwasserschutz massiv gefährdet und hat deshalb eine Petition aufgelegt.
»Trinkwasser für 80 000 Menschen ist wichtiger als private Profit-Interessen«, erklärt der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. »Untertagebaue sind in Bayerns Wasserschutzgebieten aus gutem Grund untersagt. Die bedrohten Quellen sind gerade im trockenen Unterfranken unersetzbar, das erklärt auch der Wasserversorger.« Wenn das Bergwerk trotzdem genehmigt wird, weckt das Begehrlichkeiten auch an anderen Orten. Der BN befürchtet einen Präzedenzfall und einen DominoEffekt. Der Schutz der »Zeller Quellen« ist deshalb landesweit von Bedeutung.
Der von Knauf beantragte Gipsabbau wäre das größte Bergwerk Bayerns, betroffen wären auch die Wasserschutzgebiete von Waldbrunn und Alltertheim. Im
Juni hatten zwei erfolgreiche Bürgerentscheide die Gemeinde Altertheim dazu verpflichtet, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um das Bergwerk zu verhindern, und keine in ihrem Eigentum befindlichen Grundstücke an Knauf zu veräußern sowie bereits bestehende Vereinbarungen nach Möglichkeit rückgängig zu machen.
Doch die Firma Knauf macht enorm Druck und will das Risikoprojekt unbedingt durchdrücken – noch vor der geplanten Erweiterung des Wasserschutzgebietes »Zeller Quellstollen«, denn in Wasserschutzgebieten ist Bergbau grundsätzlich untersagt. Aus gutem Grund: Schon kleinste Risse in der jetzt noch intakten Bodenschicht können dazu führen, dass laut Trinkwasserversorger der Stadt Würzburg bis zu 20 Prozent des benötigten Wassers verloren gehen.
Die Behörden müssen aus Fehlern der Vergangenheit lernen: Beim Bau des Kramertunnels in Oberbayern ignorierte ein Gutachten der dortigen Straßenplaner ebenfalls das Risiko fürs Grundwasser. Der BUND Naturschutz erkannte die Gefahr und warnte davor, blieb aber ungehört. Die Folge: Durch den Bau traten große Mengen Grundwasser in den Tunnelstollen ein, der Grundwasserspiegel sackte ab. So etwas darf sich an den Zeller Quellstollen in Unterfranken nicht wiederholen!

Unterschriftenliste
Helfen Sie mit, dieses gefährliche Bergwerk zu verhindern und unser Wasser zu schützen! Dieser Natur+Umwelt liegt eine Unterschriftenliste bei, mit der Sie Unterschriften sammeln können. Oder Sie unterschreiben online.

Die EU plant PFAS zu verbieten – gegen den Widerstand von Bayer, BASF und Co. Derweil warnen Wasserwerke, dass die Konzentration dieser gefährlichen Stoffe rasant steigt.
Das geplante EU-Verbot für die extrem langlebigen, gesundheits- und umweltschädlichen PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) gerät ins Wanken. Ihrer fett- und schmutzabweisenden Wirkung wegen setzt die Industrie sie zum Imprägnieren von Kleidung ein, als Skiwachs oder auch in Feuerlöschschäumen und Beschichtungen. Anfang 2023 hatte die Europäische Chemikalienagentur einen Vorschlag Deutschlands und vier weiterer Länder veröffentlicht. Sie forderten die Stoffgruppe wegen ihrer unannehmbaren Risiken stark zu reglementieren. Eine beispiellose Kampagne der Industrie aber gefährdet dieses Vorhaben. Es wird nun überprüft – mit ungewissem Ausgang. Recherchen eines journalistischen Netzwerks belegen den massiven Einfluss der Chemiebranche. Ihr Ziel: kein »pauschales Verbot« aller PFAS, sondern allein ein Verbot in Konsumprodukten. Industrielle Anwendungen sollen nicht darunterfallen.
Ein solches Teilverbot aber würde nur ein Fünftel der PFAS-Emissionen erfassen. Damit würden die mehr als zehntausend PFAS-Stoffe sich weiter in Mensch und Umwelt anreichern. Praktisch alle haben wir sie schon im Blut, jedes fünfte deutsche Kind in bedenklich hoher Menge.
HARMLOS? GEFÄHRLICH!
Gleichzeitig werden fast täglich neue Fälle bekannt, wo PFAS Böden und Grundwasser verschmutzt haben. Das bedroht unsere Trinkwassergewinnung und stellt bereits heute ein unbeherrschbares Risiko dar. Deutlich wird dies am Beispiel von Trifluoracetat (TFA). Es galt bis vor Kurzem als harmlos. Jetzt soll die extrem stabile und mobile Verbindung als Gefahrstoff eingestuft werden, denn sie schädigt die Fortpflanzung. TFA ist ein Abbauprodukt von »F-Gasen«, die etwa in Kühlmitteln eingesetzt werden und rund die Hälfte der PFAS-Emissionen ausmachen.


die Chemikalienpolitik des
Auch PFAS in Pestiziden bauen sich zu TFA ab. Dazu kommen Fabriken wie das Solvay-Werk in Bad Wimpfen bei Heilbronn, das jeden Tag bis zu 24 Kilogramm TFA in den Neckar einleiten darf. Zuletzt wurden bedenklich hohe Konzentrationen in Wein und Getreide nachgewiesen, Tendenz steigend. Die Frage ist nicht, ob wir durch PFAS krank werden, sondern wann ihre Konzentration ein gefährliches Ausmaß erreicht.
Nur eine umfassende Beschränkung der PFAS kann die fatale Entwicklung stoppen und für einen Ersatz durch unschädliche Alternativen sorgen.
Auf die laufende Prüfung der EU wird die Position der neuen Bundesregierung großen Einfluss haben. CDU und CSU haben die Forderungen der Industrie von Anfang an unterstützt. Koalitionspartner SPD hält sich bedeckt und hat das Problem während der Ampelregierung auf die lange Bank geschoben. Unsere von mehr als 56 000 Menschen unterschriebene Petition an den damaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sich für eine PFAS-Beschränkung einzusetzen, blieb unbeantwortet. Im Koalitionsvertrag lehnt die neue Regierung ein »Totalverbot der Stoffgruppe PFAS« ab. Doch längst ist klar: Eine weitere Verschmutzung unserer Umwelt mit PFAS können wir uns mit Blick auf künftige Generationen nicht leisten.
www.bund.net/pfas
Mit ihrer Energiepolitik beschreitet die neue Bundesregierung einen Irrweg. Der Rückgriff auf fossiles Gas ist in mehrfacher Hinsicht unklug.

Foto: Jörg

JULIUS NEU ist BUND-Experte für Energie- und Klimapolitik.
Fossiles Gas ist, besonders wenn es durch Fracking gewonnen wird, fast so klimaschädlich wie Kohle. Dennoch setzt die Bundesregierung auf neue Gaskraftwerke, will weiter Gasheizungen laufen lassen und nach Gas bohren. Das bedroht die deutschen Klimaziele wie auch unsere Versorgungssicherheit – und wird teuer. Dabei existieren längst klimafreundliche und bezahlbare Alternativen. Bis zu 40 neue Gaskraftwerke plant die Regierung zu fördern. Gleichzeitig stellt sie den Ausbau erneuerbarer Energien
infrage. Das ist widersprüchlich. Denn Studien zeigen: Der Ausbau von Windund Solarenergie senkt die Stromkosten. Fossile Kraftwerke sind teuer im Betrieb, erst recht, da die CO2-Preise weiter steigen werden.
Die geplanten Gaskraftwerke sollen bei Dunkelflauten Sicherheit bieten – wenn sich Wind und Sonne über längere Zeit rarmachen. Doch die sind selten, und großflächige Stromausfälle (Blackouts) laut Bundesnetzagentur auf absehbare Zeit nicht zu befürchten.
Der BUND fordert die Erneuerbaren stattdessen konsequent auszubauen, kombiniert mit smarten Lösungen für mehr
Flexibilität: Speicher, die Steuerung des Stromverbrauchs (per Lastmanagement) oder flexible Biogasanlagen.
In den wenigen Stunden, wo das nicht genügt, müssen langfristig flexible Wasserstoffkraftwerke einspringen. Dafür muss jedes neu gebaute Gaskraftwerk, gesetzlich garantiert, schnellstmöglich auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Keine Lösung ist die Abscheidung und Speicherung von CO2, die die Bundesregierung ermöglichen will. Denn die ist im großen Maßstab unerprobt, teuer und ineffizient und passt nicht in ein erneuerbares Energiesystem.
Ein Drittel des deutschen Gasverbrauchs entfällt aufs Heizen. Das macht den Umstieg auf erneuerbare Energien zentral. Die Bundesregierung aber will die gerade eingeführten Vorgaben zum Heizungstausch abschaffen. Dabei ist klar: Wer weiterhin auf fossiles Gas oder Optionen wie Biomethan und Wasserstoff setzt, landet in der Kostenfalle.
Wärmepumpen sind effizient sowie ökologisch und ökonomisch meist die beste Wahl. Auch in Wärmenetzen sind sie der Schlüssel zu erneuerbarem Heizen, kombiniert mit Geo- und Solarthermie oder Abwärme. Statt die Verunsicherung zu schüren, sollte die Bundesregierung die Wärmewende fortsetzen und mit sozialer gestaffelten Förderprogrammen ergänzen.
MEHR EIGENES GAS?
Nur fünf Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases stammen von hier. Doch eine Ausweitung der Förderung, wie die Bundesregierung sie plant, wäre fatal. Die Projekte vor Borkum oder in Bayern bedrohen das Klima und die Umwelt und tragen nicht einmal nennenswert zur Versorgungssicherheit bei. Zumal die bestehenden Flüssiggas-Terminals schon jetzt für Überkapazitäten sorgen.
Sprich: Fossiles Gas führt Deutschland in eine Sackgasse. Umgehen lässt sie sich nur mit einer konsequenten Energieund Wärmewende.

Vor genau einem Jahr trat das »Nature Restoration Law« in Kraft. Mit diesem Renaturierungsgesetz reagierte die Europäische Union auf zwei zentrale Herausforderungen unserer Zeit: den Schwund der biologischen Vielfalt und die sich rasch häufenden Klimaextreme. Aus gutem Grund haben die Vereinten Nationen das laufende Jahrzehnt die »Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen« getauft.
Das Gesetz ist die wichtigste Initiative im europäischen Naturschutz seit mehr als 30 Jahren. Es verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU, Lebensräume wie Flüsse und Auen, Wälder und Felder, Moore und Meere großflächig zu renaturieren. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
Weil konservative und rechtsextreme Parteien im Vorfeld eine heftige Desinformationskampagne gestartet hatten, stand die Verabschiedung des Gesetzes übrigens auf Messers Schneide. Vor allem Österreichs damaliger Umweltministerin Leonore Gewessler ist zu verdanken, dass es nicht völlig verwässert und entkernt wurde. Ein Interview mit ihr finden Sie auf Seite 35.
Mit der bundesweit ersten großen Deichrückverlegung gab der BUND der Elbe bei Lenzen über 400 Hektar ihrer Aue zurück. Dazu wurde der alte, nah am Fluss gelegene Deich an mehreren Stellen abgetragen. Fischotter und Biber, Schwarzstorch und Braunkehlchen sowie zahllose weitere Tiere und Pflanzen haben hier einen neuen Lebensraum gefunden.



leitet das BUND-Team »Lebensräume«.
Ein Sommertag im Langwarder Groden an der Nordseeküste Niedersachsens. Die Sonne spiegelt sich in seichten Prielen, Rotschenkel flöten, zwischen Queller und Strandaster tummeln sich Krebse, Schmetterlinge und Libellen. Die Luft riecht nach Salz und Blüten. Noch vor wenigen Jahren war dieser lebendige Ort eingedeichtes monotones Grünland. Heute ist der Langwarder Groden ein erfolgreiches Beispiel für Renaturierung an der Küste: Salzwiesen, Priele und Übergangszonen wurden wiederhergestellt. Die Natur hat ihren Raum zurück –und bietet gleichzeitig Erholung, Artenvielfalt und natürlichen Küstenschutz. Was hier gelungen ist, soll zukünftig an vielen Orten in Europa geschehen. Denn die Europäische Union hat ein wichtiges Rahmenwerk auf den Weg gebracht: die Wiederherstellungsverordnung, ein Gesetz zur Rettung der Natur.
WAS STECKT DAHINTER?
Diese Verordnung soll nicht nur schützen, was noch übrig ist. Indem sie sämtliche Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet, beschädigte Ökosysteme aktiv wiederherzustellen, geht sie einen Schritt weiter. Sie setzt einen Meilenstein für den Naturschutz in Europa, ganz im Einklang damit, dass sich Deutschland bei Weltnaturkonferenzen regelmäßig zum Übereinkommen der biologischen Vielfalt bekennt.
Das Ziel ist klar. Bis zum Jahre 2030 sollen mindestens 20 Prozent der Landund Meeresfläche in der EU renaturiert werden. Langfristig soll sich die Natur in allen Lebensräumen erholen: im Meer wie an der Küste, in Flüssen und Auen, im Offenland, in Mooren und Wäldern sowie auf städtischem Grün. Die Renaturierung soll helfen, das Artensterben zu stoppen, den Klimawandel zu bremsen und unsere Lebensqualität zu verbessern. Als Grundlage entwickelt die Bundesregierung mit

Wie ein europäisches Gesetz zur Genesung von Lebensräumen beitragen kann. Und was nötig ist, um es zum Erfolg zu führen.

den Ländern bis September 2026 einen »Nationalen Wiederherstellungsplan«.
Europas Natur ist in einem schlechten Zustand. Rund 80 Prozent der Lebensräume in der EU gelten als beeinträchtigt. Viele Arten finden keine Nahrung oder keinen Brutplatz mehr. Gleichzeitig verlieren wir wichtige Leistungen der Natur: sauberes Wasser und saubere Luft, Bestäubung, fruchtbare Böden, Schutz vor Dürren und

Überschwemmungen. Und nicht zuletzt intakte Lebensräume zur Erholung.
Auch Deutschland muss umdenken. Die meisten der heimischen Flüsse sind begradigt, viele Wälder artenarm und fast alle Moore entwässert. Die Verordnung verpflichtet dazu, Biotope in einen guten Zustand zu überführen, Feuchtgebiete wieder zu vernässen, städtisches Grün auszuweiten, Bäume zu pflanzen sowie in Schutzgebieten weniger Pestizide zu versprühen.

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer: Seit einer Öffnung des Sommerdeichs im Jahr 2014 kehrt die Natur in den Langwarder Groden zurück.
Zentrale Partner sind hierbei jene, die Wald und Flur bewirtschaften. Die neue Verordnung verlangt keine radikalen Verbote, sondern setzt auf Kooperation. Da geht es darum, gemeinsam Lösungen zu finden, die der Natur wie uns Menschen nützen. Eigentumsrechte bleiben unangetastet – es gibt keine Pflicht, Privatflächen auch ohne Zustimmung zu renaturieren. Vielmehr wird meist auf öffentlichem Grund oder in freiwilliger Zusammenarbeit gehandelt.
Nachhaltige Konzepte, die Schutz und Nutzung verbinden, sollen unsere gesellschaftlichen Lebensgrundlagen erhalten. Da ist Kooperation gefragt: Bund, Länder, Kommunen, Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutzvereine müssen an einem Strang ziehen.
Hervorragende Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit sind das BUNDProjekt »Stadt trifft Natur« und die Stadtnatur-Ranger*innen in Berlin. Kommunen, Zivilgesellschaft, Fachleute und Ehrenamtliche entwickelten hier gemeinsam Strategien für mehr Vielfalt und engagieren sich für Renaturierung und naturnahe Landschaftspflege.
Verwirklicht wird die Verordnung nicht nur auf politischer Ebene – sie braucht auch Rückhalt in der Gesellschaft. Darum ist es wichtig, dass wir alle gut informiert sind und sie mitgestalten.
Beteiligen Sie sich an Projekten in Ihrer Region! Der BUND bietet vielerorts Mitmachaktionen an. Pflanzen Sie mit uns Bäume oder renaturieren Sie einen Bach. Informieren Sie sich zudem weiter, bilden Sie sich fort und sprechen Sie darüber. Je mehr Menschen die Chancen der neuen Verordnung begreifen, desto größer wird die Unterstützung.
Und: Nutzen Sie Ihre Stimme. Politik braucht Rückhalt. Zeigen Sie, dass Ihnen eine lebenswerte Zukunft mit gesunder Natur am Herzen liegt, etwa durch Briefe an Ihre Abgeordneten.
Das Gesetz zur Rettung der Natur ist keine romantische Idee – es ist eine Notwendigkeit, wissenschaftlich belegt und politisch beschlossen. Es bietet die Chance, dass auch kommende Generationen noch summende Wiesen, lebendige Wälder, klare Flüsse und artenreiche Meere und Küsten erleben können. So, wie am Langwarder Groden. Hier atmen die Salzwiesen
Silberreiher in der Goitzsche-Wildnis der BUNDstiftung. Wo einst Kohle abgebaut wurde, ist die Natur heute sich selbst überlassen.
heute wieder, die Natur kehrt zurück. Und der Mensch ist nicht länger der Gegner, sondern ein Teil des Wandels.
Schon bevor die Wiederherstellungsverordnung in Kraft trat, wehrten sich konservative Parteien und Landnutzungsverbände. Derzeit versuchen die unionsgeführten Agrarministerien der Länder zu verhindern, dass sie konkretisiert, angemessen gefördert und flächenhaft umgesetzt wird. Um die Ziele ehrgeizig, effizient und konfliktarm zu erreichen, ruft der BUND die Bundesländer dazu auf, Renaturierungsräte einzurichten. Sie sollen der Zusammenarbeit dienen, von Verwaltung und Wissenschaft, Landnutzung, Naturschutz und Zivilgesellschaft.



www.bund.net/wvo



WÄLDER


Große Erwartungen weckt die neue EU-Verordnung mit Blick auf unsere Waldökosysteme. Aber welche Wälder sollten renaturiert werden? Und wie ist Wildnis wiederherzustellen?




Der jüngste Zustandsbericht hat gezeigt: Unseren Wäldern geht es unverändert schlecht, nur jeder fünfte Baum ist noch gesund. Damit alle Schritte zur Wiederherstellung unserer Wälder nicht reine Kosmetik bleiben, sei ein Hinweis zu den Prioritäten erlaubt: Für eine Trendwende muss die Bundesregierung vorrangig das Klima schützen und die Erderhitzung begrenzen. Sie muss die Emissionen aus Verkehr, Landwirtschaft und Industrie senken und Wälder bei Bauvorhaben möglichst unangetastet lassen. Ferner muss sie dafür sorgen, dass unser Wald schonender behandelt wird; und schließlich muss sie mehr Wald renaturieren und mehr Naturwälder und Wildnis zulassen.
VOR ALLEM SCHÜTZEN
Die gute Nachricht zuerst: Häufig ist Geduld genau das Richtige, um kranken und naturfernen Wäldern wieder auf die Beine zu helfen. Bevor wir darüber sprechen,
Wald oder Wildnis wiederherzustellen, sollte klar sein: Am besten erhalten wir die Natur, indem wir schützen, was noch da ist. So sollten wir die bestehenden Wälder in Zeiten der Klimakrise so behutsam wie möglich behandeln. Nur wenn das Kronendach geschlossen und es darunter feucht bleibt, hat der Wald eine Chance, immer häufigeren Hitzewellen und Dürreperioden standzuhalten. Zum Schutz vor Austrocknung gehört auch viel Totholz, das wie ein Schwamm wirkt, und ein schonender Umgang mit dem Wasserspeicher Boden.
Ob natürliche und naturnahe oder alte Wälder und Waldwildnis – von alldem hat Deutschland viel zu wenig, um deren biologischen Reichtum zu bewahren. Zahllose Insekten, Spinnentiere, Pilze, Moose und Flechten sind auf alte Bäume angewiesen. Die neue EU-Verordnung ist eine große Chance, mehr Naturwälder auszuweisen (frei von Holznutzung) und in forstlich genutzten Wäldern mehr Natur zuzulassen.
Als Indikatoren benennt sie stehendes und liegendes Totholz, eine vielfältige Altersstruktur, die Waldvernetzung, den
Index häufiger Waldvogelarten, den Vorrat an organischem Kohlenstoff, den Anteil heimischer Baumarten sowie die Vielfalt der Baumarten.
NACHHALTIGER NUTZEN
Über geeignete Vorgaben ringen Bund und Länder derzeit. Der BUND fordert, für alle Wälder und Formen des Waldbesitzes Maßnahmen festzulegen, die die erwähnten Indikatoren tatsächlich verbessern. Am sinnvollsten ist es, den Wald weniger intensiv zu bewirtschaften und häufiger die Natur machen zu lassen. So hat der Wald die Chance, sich selbst zu heilen. In Wildnisgebieten ist das Nichtstun Trumpf, sprich: natürliche Prozesse zu schützen, wie in der Goitzsche-Wildnis des BUND. Wer privat oder als Kommune Wald besitzt und sich besonders für dessen Renaturierung einsetzt, sollte finanziell unterstützt werden. Im Staatswald gilt es, die Vorbildfunktion öffentlicher Wälder voll auszuschöpfen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir brauchen mehr gesunde Wälder, mehr wilde Wälder. Und das auch, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern: sauberes Wasser, frische Luft und ein gemäßigtes Klima.

Die Wiederherstellungsverordnung ist eine Chance für den Klima- und Artenschutz. Und eine Herausforderung für die Politik.

TOBIAS WITTE
ist der BUND-Experte für Moor- und Bodenschutz.
Früher Morgen auf der Bergischen Heideterrasse: Nebelschwaden ziehen über den Moorboden, der Tau liegt noch schwer auf Schnabelrieden und Gagelstrauch. Zwischen leuchtend grünen Torfmoosen streckt eine Arktische Smaragdlibelle ihre Flügel den ersten Sonnenstrahlen entgegen. An Orten wie diesen zeigt sich, was Moore leisten können, wenn wir sie lassen. Sie binden CO2, speichern Wasser und bieten seltenen Arten ein Zuhause. Die EU-Verordnung ist ein Meilenstein im Kampf gegen die Klima- und Biodiversitätskrise. Besonders die Moore spielen hier eine Schlüsselrolle. So beherbergen sie spezialisierte Arten, die auf nasse Standorte angewiesen sind. Und sie speichern Unmengen Kohlenstoff aus abgestorbenen Pflanzenresten im Untergrund. Deutschland ist eines der moorreichsten Länder der EU. Doch mehr als 90 Prozent unserer Moore wurden entwässert, vor allem um sie landwirtschaftlich zu nutzen. Weil in trockenen Moorböden Pflanzenreste weiter zersetzt werden, stoßen diese Böden jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tonnen CO2 aus, ungefähr sieben Prozent der deutschen Treibhausgase. Aufhalten lässt sich das nur, indem wir die Moore konsequent wiedervernässen.
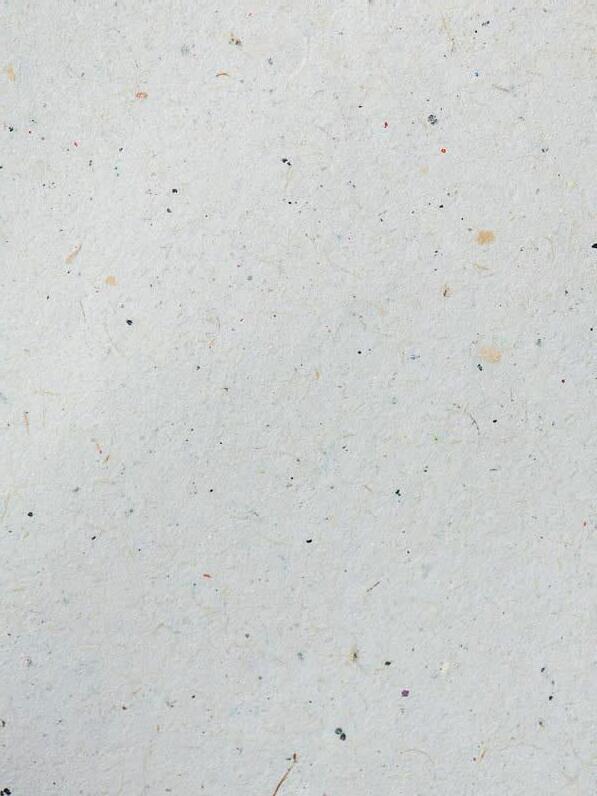
statt 90 Prozent bis 2050). Und nur auf der Hälfte der Böden muss bis zum Jahr 2050 überhaupt mit der Wiederherstellung begonnen worden sein.
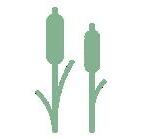
Doch verwässert wurde bisher nur die Gesetzgebung. Die neue EU-Verordnung startete ehrgeizig, geriet dann aber unter starken Lobbydruck von konservativen und rechten Parteien. Besonders bei den Mooren bleibt das Regelwerk jetzt bewusst vage. Die Zielvorgaben sind weich formuliert und erlauben viele Ausnahmen. Messbare Indikatoren oder gar Sanktionen fehlen ganz.
Betrachtet man die Verordnung im Detail, bleibt von den hehren allgemeinen Zielen wenig übrig. So gelten für landwirtschaftlich genutzte Moorböden Minimalziele. Nur 7,5 statt 30 Prozent müssen bis 2030 wirklich wiedervernässt sein (sowie 13,3 statt 60 Prozent bis 2040 und 16,7
Ohne intakte Moore wird Deutschland seine Biodiversitäts- und Klimaziele nicht erreichen. Die Wiederherstellungsverordnung ist ein Anfang und bietet Chancen –so sie denn ambitioniert umgesetzt wird. Dafür braucht es ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen.
Eine besondere Herausforderung liegt im Dialog mit Land- und Forstwirtschaft. Viel Grund ist in privater Hand. Ohne Anreize, die Entwässerung zu stoppen, und ohne gesicherte Perspektiven wird die Bundesregierung scheitern. Der BUND setzt sich für kooperative Modelle ein.
Wie Wiederherstellung praktisch wirkt, zeigen unsere Projekte: So motiviert die BUNDjugend Niedersachsen im Projekt »aMOORe« junge Menschen für die Moorpflege, mit Gummistiefeln, Astschere und Begeisterung für den Naturschutz. Und auf der Bergischen Heideterrasse dringt regelmäßig ein dumpfes Hämmern aus dem Wald: Freiwillige packen mit an, um mit dem BUND NRW alte Entwässerungsgräben zu verschließen und erfolgreich Waldmoore zu renaturieren. So wird aus politischem Fortschritt eine lebenswerte Zukunft.


Im Rahmen des Projekts »Quervernetzung Grünes Band« lässt der BUND bei Neureichenau im Bayerischen Wald Islandpferde weiden – und stellt damit artenreiche Bergwiesen wieder her.
Mithilfe der neuen EU-Verordnung lässt sich unsere Kulturlandschaft wiederbeleben. Davon würde nicht nur ihr natürlicher Reichtum profitieren.


ist die Naturschutzexpertin des BUND in Bayern.
Es summt, zirpt, quakt und zwitschert in den bunten Wiesen. Säume und Hecken umrahmen vielfältige Äcker. Dazwischen schlängeln sich saubere und lebendige Bäche mit breiten Auen. Solch offene Landschaften sind äußerst artenreich, aber selten geworden. Sie wiederherzustellen, ist ein zentrales Ziel der neuen Verordnung.
Von den 93 europaweit geschützten heimischen Lebensräumen zählen etwa drei Viertel zum Offenland. Meeresbiotope, Dünen, Gewässer oder Felsen sind am vielfältigsten, wenn sie unangetastet bleiben. Elf Lebensräume aber sind davon abhängig, dass der Mensch sie nutzt –naturgerecht.
Noch verfehlen die meisten Offenlandbiotope das seit 1992 verpflichtende Ziel des »günstigen Erhaltungszustandes«. Die neue Verordnung bringt nun zeitlich verbindliche Vorgaben, neuen Schwung und spezielle Ziele.


So vielfältig wie das Offenland sind die Wege zu seiner Renaturierung. Bäche und Flüsse müssen von Verbauungen befreit werden. Sie brauchen Platz, um sich dann am besten ungestört und dynamisch zu entwickeln. Wie es gehen kann, erweist sich bisher nur punktuell. Erst acht Prozent der Fließgewässer sind in einem guten ökologischen Zustand, wie ihn die EUWasserrahmenrichtlinie fordert.
Die Wiederherstellungsverordnung nun fordert zusätzlich, die Flüsse in der EU bis 2030 auf mindestens 25 000 Kilometer Länge frei fließen zu lassen, was auch deren Auen einbezieht. Der Staat und die Kommunen sollten hier auf öffentlichem Grund vorangehen. Private brauchen attraktive Anreize, um ihre Flächen am Gewässer anders oder gar nicht mehr zu nutzen. Jede Schädigung etwa durch neue Wasserkraftwerke muss tabu sein.
Der Nutzen wäre enorm. Intakte Auen und Gewässer zählen zu den Hotspots der Artenvielfalt, sie sind zentrale Achsen des Biotopverbunds und tolle Erholungsräume. Und sie verlangsamen und verringern Hochwasser, bilden mehr Grundwasser und speichern mehr Kohlenstoff.
WIESEN UND WEIDEN ... und Magerrasen zu renaturieren, heißt: sie weniger zu mähen und zu düngen, zu entwässern und mit Pestiziden zu behandeln. Die neue Verordnung verlangt eine »zufriedenstellende« Menge von Bestäubern und biologisch reiche AgrarÖkosysteme. Dafür muss die Zahl der Feldvögel und der Wiesenschmetterlinge wieder zunehmen, auch der Humusanteil und Landschaftselemente wie Hecken, Sölle oder Brachen.
Ganz wesentliche Partner sind hier die Agrarbetriebe, ob in BUND-Projekten wie dem Grünen Band oder auf vielen Einzelflächen. Die EU muss ihre Agrarzahlungen und Vorgaben so anpassen, dass sich die Renaturierung rechnet. Dann bietet sie den Landwirt*innen eine Riesenchance: Sie sichert die Bestäubung, fruchtbare Böden und somit auch unsere Ernährung. Humusreichere Böden und vielfältige Feldfluren verbessern den Wasserrückhalt und kommen dem Trinkwasser- und Klimaschutz zugute. Übrigens: Jede und jeder kann zu einer bunteren Landwirtschaft und lebendigen Gewässern beitragen, ob als Flächeneigentümer*in oder beim Einkauf von Lebensmitteln.
Ganz ohne EU-Verordnung bewahren BUND-Aktive schon seit Jahrzehnten tatkräftig die biologische Vielfalt und schützen damit das Klima. Eine kleine Auswahl.

Viele BUND-Aktive haben Moore wiederbelebt. So kümmern sich die Ortsgruppen Hohenpeißenberg und Peiting seit mehr als 30 Jahren um die Renaturierung des Schwarzlaichmoors. Nirgends sonst in Mitteleuropa haben mehr Zwergbirken überlebt. Nicht zuletzt für dieses Eiszeitrelikt hat der BUND große Moorflächen erworben, wiedervernässt und aufgelichtet.
Seit 2022 vernässt die BUND-Gruppe »Ostufer Kummerower See« das Klenzer Quellmoor im Peenetal. Dank einem Nutzungsverzicht der Eigentümer gelang es alte Gräben zu schließen. Die Moorwiesen beherbergen neben Trollblume und Breitblättrigem Knabenkraut auch den Violetten Feuerfalter.

Bergwiesencamp des BUND Dresden bei Oberwiesenthal

Überall in Deutschland sichern BUND-Gruppen wertvolle Natur und sorgen mit Herzblut dafür, dass die Vielfalt überdauert und sich bestmöglich entfalten kann. Zum Beispiel in artenreichen Lebensräumen der Kulturlandschaft. So pflegt der BUND im pfälzischen Weisenheim am Sand Streuobstwiesen sowie trockene Magerwiesen und Ackerbrachen. Neben dem Bergsandglöckchen kommen hier zahllose Wildbienen und Schmetterlinge sowie Steinkauz, Wiedehopf, Heidelerche und Steinschmätzer vor. Das sächsische Fichtelgebirge ist geprägt von Heiden, Mooren und Bergwiesen. Im Zechengrund bei Oberwiesenthal betreut der BUND Dresden seit 2013 mehrere Hangstücke. Per Handmahd bewahrt er den Lebensraum von Rundaugen-Mohrenfalter und Ringdrossel sowie Arnika, Feuer-Lilie und Blauem Tarant. Um wertvolle Berg- und Feuchtwiesen kümmert sich auch der BUND Sonneberg in Thüringen. Am Grünen Band bei Tettau fördert er seit rund 20 Jahren den Biotopverbund entlang kleiner Wiesentälchen: mit Freischneider, Astschere und Sense sowie Schafen, Ziegen und Rindern.
Auf Föhr hat der BUND Schleswig-Holstein intensiv genutztes Grünland in artenreiche Feuchtwiesen verwandelt. Zugunsten von Uferschnepfe, Austernfischer und Moorfrosch wurde der Wasserstand angehoben und Mahdgut übertragen. Gemäht werden die extensiv beweideten Wiesen nur ein bis zwei Mal im Jahr.
Ähnlich ging der BUND Sachsen-Anhalt in der LandgrabenDumme-Niederung vor. Mit den Landwirten vor Ort entwickelte





er Strategien, um diesen Abschnitt des Grünen Bandes teils wiederzuvernässen und für Orchideen und Wollgräser, Libellen und Schmetterlinge, Kiebitze und Fischotter optimal zu nutzen. An den nassesten Stellen kommt eine Mähraupe zum Einsatz.

IN DER STADT
Nicht zu vergessen die urbane (Rest-)Natur. Wie Oasen in der Wüste zieht das städtische Grün Erholungssuchende an. Dazu speichert es Wasser und bietet eine Zuflucht für Wildpflanzen und -tiere. Zudem sorgt jeder Baum für Schatten und Abkühlung. Gerade die Stadtbäume haben es nicht einfach: Winzige Baumscheiben, Schadstoffe und übermäßiger Kronenschnitt setzen ihnen zu. Das lässt ihre Zahl auch in Berlin schrumpfen. Wer dem nicht tatenlos zusehen will, kann sich vom Baumschutzexperten des BUND Berlin beraten lassen.
Besondere Oasen sind die vielen BUND-Gärten in Ballungsräumen. In Bremen gibt es gleich vier: den Nutzgarten auf Hof Bavendamm, einen Insektenschaugarten am Weserwehr, einen Bienengarten im Stadtteil Walle sowie – ganz neu – einen Naturgarten in Vegesack. Helfende Hände sind jederzeit willkommen!


... wiederherzustellen, ist ein weiteres Ziel der EU-Verordnung. Seit dem Jahr 1990 treibt der BUND Baden-Württemberg die Renaturierung der Radolfzeller Aach voran. Er entfernte Barrieren und Uferbefestigungen im Fluss, öffnete und schuf Flussschlingen, wandelte Äcker in Auwiesen um und lässt diese nun schonend beweiden. 2700 Hektar sind damit für Rast- und Brutvögel wie Bekassine und Brachvogel entstanden.
In der Sürther Aue am Rhein rettete der BUND NRW 15 Hektar Naturschutzgebiet vor dem Ausbau eines Hafens. Er entwarf einen Managementplan und erweckte die Fläche aus dem Dornröschenschlaf. Mithilfe einer Eselherde, der Stadt Köln und vieler Ehrenamtlicher stieg die Zahl der gefährdeten Pflanzenarten in nicht einmal drei Jahren von 0 auf 27, die Zahl der Heuschrecken verfünffachte sich sogar.

In Niedersachsen schützt die BUND-Gruppe Grafschaft Bentheim seit Jahrzehnten die Vechte. Nahe der niederländischen Grenze sichert sie den Fluss und sein Tal als Refugium für selten gewordene Vögel, Fische und Amphibien – in einer Hochburg der Massentierhaltung. Der Einsatz der Gruppe mündete in ein länderübergreifendes EU-Projekt. Davon profitieren Tiere wie Kiebitz, Uferschwalbe und Fischotter.
Seit 2012 engagiert sich der BUND Hamburg in dem Projekt »Lebendige Alster«. Viel ist schon passiert, um den zweitgrößten Fluss der Stadt aufzuwerten und seinen Schutz ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Derzeit arbeitet der BUND vor allem daran, die Außenalster zu einem vitalen Gewässer zu entwickeln.
Auf den Lebensraum Wald zielt schließlich das BUND-Projekt »Wildkatzenwälder von morgen«. Gleich zehn Landesverbände renaturieren beispielhaft Flächen, oft gemeinsam mit Forstämtern und Waldbesitzer*innen. Dazu bieten sie praktische Tipps und helfen bei der Umsetzung.
So etwa im europäischen Vogelschutzgebiet »Hörre«. Um das Waldinnere gegen Sturmschäden und Austrocknung zu wappnen, wertet das Forstamt Wetzlar hier Waldränder und Flächen auf, wo Fichten abgestorben sind. Zudem sorgt es dafür, dass der Wald wieder strukturreicher wird. Als Leitarten dienen neben der Wildkatze die Haselmaus und der Mittelspecht. Der BUND mobilisiert dafür viele Freiwillige. sz

Waldränder wie hier in der hessischen Hörre sind ein Ziel des BUND-Projekts »Wildkatzenwälder von morgen«.


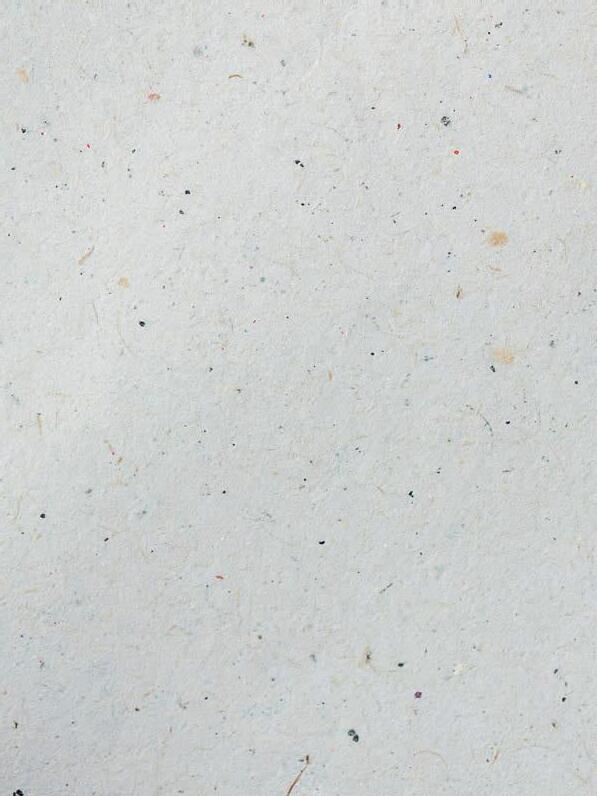



IRMELA FISCHER
Die Autorin arbeitet selbstständig als Naturbegleiterin und Umweltpädagogin. Sie bietet auch für den BUND Naturschutz und das NEZ Allgäu Exkursionen und Kräuterwanderungen an.
Außer den gegenständigen Blättern hat der Gelbe Enzian (Gentiana lutea) wenig gemein mit seinen leuchtend blau blühenden, berühmteren Verwandten. In bis zu sechs Etagen schützen die breiten, graugrünen Blätter die bis zum Grund geteilten Blüten bis zum Aufblühen und bilden dann Zisternen. Der Nektar ist offen erreichbar.
Dadurch ist der Gelbe Enzian Nahrung und Lebensraum für Hummeln, Faltenwespen, Fliegen, Käfer und Schmetterlingsraupen sowie Larvenstube für verschiedene Schwebfliegenarten.
Bekannt ist dieser Enzian eher in flüssiger Form als Verdauungsschnaps, aus der dicken Wurzel gebrannt, die er braucht, um in seiner ganzen Größe zu überleben. Die Wurzel wird in der Natur gesammelt (mit streng reglementierten Sammelrechten) oder in Kulturen angebaut. Sieben Jahre braucht der Gelbe Enzian nach der Ernte, um sich zu regenerieren, mindestens zehn Jahre, bis er überhaupt zum ersten Mal blüht, bei einer Lebensdauer von 40–60 Jahren. Die Pflanze entwickelt bis zu 150 Kapselfrüchte mit 10 000 geflügelten Samen, die vom Wind oder im Fell von Tieren verbreitet werden.
Es ist die stattlichste Pflanze am Berg: bis zu 1,5 Meter hoch, mit strahlend gelben Blüten.
Selbst im Winter steht sie noch aufrecht
und trotzt jedem Sturm.
Wer den Gelben Enzian einmal richtig wahrgenommen hat, wird ihn nie mehr mit dem giftigen Weißen Germer (Veratrum album) verwechseln. Jener hat schmalere, gelbgrüne und vor allem wechselständige Blätter.
Der auffallend andere Habitus zum Rest der Enzianfamilie gilt als Hinweis auf die besondere Heilwirkung des Gelben Enzians: als bitterstes Bittermittel, das die Natur zu bieten hat, eigentlich als Fraßschutz, für uns ideal zur Förderung der Verdauung, insbesondere von tierischem Eiweiß. Das soll ebenso auf die seelische Verdauung zutreffen, denn Gefühle können auch »schwer im Magen liegen«. Er richtet auf, hilft in Phasen der Rekonvaleszenz, bringt Freude und Zuversicht zurück und stärkt im Alter. Bereits in Antike und Mittelalter galt der Gelbe Enzian als Universalheilmittel.
Auch schutzmagische Wirkung wird ihm nachgesagt: gegen Raub und Diebstahl (da schwer zu ernten), ein Wurzelstück in der Geldbörse oder als Pentagramm gepflanzt, verräuchert als Seelentröster, gegen die Pest und als Liebeszauber.

Da der Gelbe Enzian streng geschützt ist, darf er nicht gesammelt werden, Tee und Tinktur gibt es jedoch fertig zu kaufen (auf Gegenanzeigen achten!).
Alle ob der begehrten Wurzel fast ausgerottet, deshalb besonders geschützt. Heute findet fast nur noch der Gelbe Enzian Verwendung.
• Gelber Enzian (Gentiana lutea): strahlend gelbe Blüten in Scheinquirlen, bis 1,5 m hoch, auf Weiden, Magerrasen und Flachmooren, vor allem im Allgäu, sehr selten in Rhön und Bayerischem Wald, Vorwarnliste Bayern
• Tüpfel-Enzian (Gentiana punctata): Blütenkelche hellgelb und dunkel getupft, bis 50 cm hoch, außerhalb des Allgäus selten
• Purpurenzian (Gentiana purpurea): purpurrote Blütenkelche, innen oft gelblich oder weißlich mit purpurroten Punkten, bis 60 cm hoch, im bayerischen Alpenraum, Rote Liste Bayern 2
• Pannonischer Enzian (Gentiana pannonica): rot-violette Blütenkelche und dunkel getupft, bis 60 cm hoch, in den östlichen bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald
Doch wer oder was ist ein Hutanger? Karl Heinlein, Vorsitzender des Naturschutzzentrums Wengleinpark, hat diese Frage schon oft beantwortet. Der gelernte Bankkaufmann muss keine Sekunde überlegen. Mit »Hut« sei nicht die Kopfbedeckung gemeint, sondern das Wort komme von »hüten, behüten«.
Anger kommt aus dem Althochdeutschen. »Angar« bedeutet »ungepflügtes, wildgrünes Grasland«, dieses war Teil der Allmende. Bei den Hutangern handelt es sich um schwer zu bewirtschaftende Flächen – sie sind zu steil, zu steinig, zu feucht oder zu trocken für den Ackerbau. Gemeindehirten haben deshalb Jahrhunderte lang Rinder auf dem Hutanger weiden lassen, bis in die 1960er Jahre. Mit dem Einzug der modernen Landwirtschaft wäre diese Tradition fast ausgestorben und mit ihr die Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere.
Dass es nicht soweit gekommen ist, ist dem »Arbeitskreis Naturschutz Hersbruck« zu verdanken. Die Männer und Frauen haben den ökologischen Wert der Hutanger erkannt und 1977 mit der Kartierung der Flächen begonnen. 1985 wurde mit Unterstützung des Bezirks Mittelfranken das Hutangerprojekt gegründet. Der Bezirk fördert es auch finanziell. Ein weiterer großer Förderer ist der Bayerische Naturschutzfonds. Aus diesem Arbeitskreis ging 1987 die Ortsgruppe Hersbrucker Land des BN hervor.
RINDER ALS NATURSCHUTZHELFER
Nach und nach wurden Flächen angekauft und das zu betreuende Gebiet dadurch immer größer. Die Pflege der mittlerweile 88 Hektar ist deshalb an einen eigens gegründeten Verein ausgelagert worden, an das Naturschutzzentrum Wengleinpark. Hier schließt sich der Kreis: »Langjähriger Projektleiter und Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Hersbrucker Land war mein Bruder Heinz«, sagt Karl Heinlein stolz. Das Herzensprojekt seines Bruders führt er fort. Und damit hat Karl Heinlein alle Hände voll zu tun. Das Naturschutzzentrum
Was für ein Juwel sich in der Hersbrucker Alb versteckt, ahnen viele nicht. Dabei ist dort ein Naturschutzprojekt zu Hause, das seinesgleichen sucht. Das Projekt »Hutanger« kann in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern.

sucht nicht nur geeignete Flächen und kauft diese an. Es hat einen eigenen landwirtschaftlichen Weidebetrieb mit Mutterkuhhaltung, der maßgeblich dazu beiträgt, die Hutanger zu erhalten.
Alexandra Schwarz, die Gebietsbetreuerin Hutanger der Hersbrucker Alb, kümmert sich nicht nur um rund 60 Kühe, Ochsen, Bullen und Kälber des Modellbetriebes, sondern auch um die rund 50 Hutanger im Landkreis Nürnberger Land. Damit hält Schwarz die alte Beweidungstradition lebendig und sorgt für den Erhalt gefährdeter Arten. Ohne diese Beweidung

wären die Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere wie die Küchenschelle, den Gefransten Enzian, Neuntöter, Wendehals oder die Schlingnatter wohl nicht mehr vorhanden. Von den alten Obstbäumen oder den bis zu 500 Jahren alten Eichen ganz zu schweigen.
Nicht nur die Flächen alleine sind kostbar, auch der über 200 Hektar hinweg entstandene Biotopverbund beeindruckt. Da kann man vor den Verantwortlichen des Hutanger-Projekts nur eines tun: den Hut ziehen!
Claudia Rothhammer

Der BUND startete ein großes Forschungsprojekt am Grünen Band, gefördert vom Bundesamt für Naturschutz. Es soll Daten zur Artenvielfalt erheben, die der Nominierung als UNESCO Welterbe dienen.
Entlang der fast 1400 Kilometer des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens, von der Ostsee bis ins sächsisch-bayerische Vogtland, werden erstmalig in einer breit angelegten Felderhebung im Projekt
»Arterfassung am Grünen Band« Insekten erfasst. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erhebung der flugfähigen Insekten, wie seltenen Schecken- und Dukatenfaltern sowie Wildbienen. Die Erkenntnisse aus den erhobenen Daten sollen den notwendigen Schutz und die Entwicklung der wertvollen Lebensräume im Grünen Band untermauern.
Entlang des gesamten Grünen Bandes sind noch bis Ende August sechs Expert*innenteams unterwegs, um Insektenproben an 100 Standorten in ausgewählten Lebensräumen zu sammeln. Diese Proben werden in einem spezialisierten Labor aufgearbeitet und genetisch analysiert, um umfassende Listen zur Arten-

vielfalt und Rückschlüsse über die Funktion des Grünen Bandes als Lebensraum für Insekten zu liefern.
Hubert Weiger, BUND-Ehrenvorsitzender und Beauftragter des BUND für das Grüne Band erklärt: »Es ist ein ambitioniertes Vorhaben, das es bislang so noch nicht gab. Mit dieser Arterfassung legen wir die wissenschaftlich fundierte Basis für den Nachweis des außergewöhnlichen universellen Naturwertes des Grünen Bandes – eine zentrale Voraussetzung für die UNESCO-Nominierung als Welterbe. Dafür notwendig ist auch der durchgängige Schutz des Grünen Bandes als Nationales Naturmonument, für den sich der BUND seit Jahren einsetzt.«
Pflanzaktion, Wanderungen, Bootsexkursion und Radtour am Tag der Deutschen Einheit entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs.
Am 3. Oktober mit dem BUND aktiv werden, seltene Arten, wertvolle Biotope sowie Erinnerungslandschaften entdecken.
www.bund.net/ aktionstag
Was bedeutet die Rückkehr des Wolfs für landwirtschaftliche
Betriebe mit Weidetieren? Wir sprachen mit einer Betroffenen.
Was bedeutet es für einen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn er seine Weidetiere schützen muss? Funktioniert das überhaupt? Rechnet sich das noch mit den Kosten für Zäune und Hunde? Eine, die das aus eigener Erfahrung weiß, ist Steffi Pempe. Die Familie ihres Lebensgefährten bewirtschaftet im bayerischen Alpenraum seit vielen Generationen einen Hof auf 1000 Meter Höhe. Der Betrieb hat zwei Almen mit insgesamt 65 Hektar Grünland. Dort grasen als erstes Mutterkühe mit ihren Kälbern, danach zehn Ponies. Eine der Almen wird nur im Frühjahr und Sommer genutzt, eine auch im Winter. 2023 tauchte in der Region ein Bär auf und riss mehrere Schafe. »Das war Luftlinie nur ein paar hundert Meter von uns entfernt«, erzählt Steffi Pempe. »Wir mussten überlegen: Was machen wir?«
Der Bär starb später bei der Kollision mit einem Zug, aber es war klar: Das Thema Beutegreifer (wie Bär und Wolf) würde aktuell bleiben. Das bayerische Umweltministerium hatte damals finanzielle Unterstützung für den Bau von Zäunen angeboten, also ließ Steffi einen Berater vom Landesamt für Umwelt kommen, der mit ihr die Flächen abging. Noch im selben Jahr fiel die Entscheidung für den Zaunbau, trotz schwierigem Gelände. In Bayern gibt es derzeit noch bis zu 18 Euro Förderung pro Meter Zaun. Steffi

Pempe und ihr Lebensgefährte entschieden sich aber größtenteils für einen robusteren Festzaun aus Metallpfosten, der teurer ist. Nach und nach entstanden so mehrere Kilometer Weidezaun. »Ohne die Hilfe von Freiwilligen, unter anderem von der BUNDjugend, wäre das nicht gegangen«, sagt die Bergbäuerin. Einer der Zäune muss jedes Jahr im Herbst abgebaut werden, weil er in einem Skigebiet liegt.
PROBLEM
FREIZEITNUTZUNG
Um die Sicherheit für die Weidetiere zu erhöhen, wurden auch Herdenschutzhunde angeschafft. Dafür machte Steffi Pempe die notwendige Sachkundeprüfung. Inzwischen bewachen vier Pyrenäen-Berghunde die Weidetiere, und die Tierhalterin zieht die Bilanz: »Herdenschutz bedeutet, dass man seinen Betrieb umstellen muss.« Tiere von anderen Höfen können jetzt zum Beispiel nur dann auf die Alm mitgenommen werden, wenn sie an die Hunde gewöhnt wurden oder aus Betrieben mit eigenen Herdenschutzhunden
kommen. Die Hunde müssen betreut und täglich gefüttert werden.
Probleme macht die Freizeitnutzung. Obwohl ein Wanderweg verlegt wurde, gehen oder radeln Leute durch die eingezäunten Weiden und lassen auch mal das Tor offen. »Wir haben viele Schilder aufgestellt und Absperrband, aber die Leute sind trotzdem durch die Zäune durch«, berichtet Steffi Pempe. »Ich wurde auch schon bedroht.«
Letztendlich sei Herdenschutz viel zusätzliche Arbeit, sagt sie. Was sie nicht nachvollziehen kann: Es gibt Fördermittel vom Bund und der EU für Herdenschutz, die andere Bundesländer wie zum Beispiel Brandenburg abrufen, Bayern aber nicht. Und ohne freiwillige Helfer*innen beim Zaunbau ginge es nicht. »Aber wenn viele Landwirte Herdenschutz machen würden, gäbe es dann noch genügend Freiwillige für den Zaunbau, um unsere Tiere vor Wölfen zu schützen?« Letztendlich, ist Steffi Pempe überzeugt, »werden wir nicht drumrumkommen.«
Luise Frank

Der BR-Journalist Georg Bayerle ruft in seinem neuen Buch »Der Alpen-Appell« dazu auf, unsere Freizeitnutzung des Alpenraums kritisch zu hinterfragen. Wir sprachen mit ihm.
Natur+Umwelt: Herr Bayerle, Ihr Buch ist ein Aufruf, die Natur der Alpen nicht noch weiter zu zerstören. Was war der Anlass?
Georg Bayerle: Das Grundthema der massiven Veränderung der Alpen aufgrund des Klimawandels ist in der öffentlichen Diskussion völlig verloren gegangen. Das muss sich ändern! Ich möchte Debatten anregen. Ich möchte, dass viele Menschen sich dazu Gedanken machen.
Worum geht es konkret?
Das Buch ist wie ein Drama in fünf Kapiteln aufgebaut. Im ersten Kapitel stelle ich die Veränderungen durch den Klimawandel dar. Im zweiten Kapitel geht es um die Frage: Wie reagieren die Menschen darauf? Bisher oft mit technischen Lösungen wie Kunstschnee, aber sie rücken nicht von der Konsumausrichtung ab. Dann geht es um Alternativen. Die gibt es. Man kann Ökologie und Ökonomie gut in Einklang bringen. Kapitel 4 ist der eigentliche Appell: Was müssen wir tun? Die Naturräume der Alpen brauchen Freiraum, um unbeeinflusst vom Menschen existieren zu können. Das letzte Kapitel ist persönlicher. Es geht um sinnliche Erfahrungen, die die besondere Wertigkeit
des Naturraums Alpen für uns Menschen ausmachen.
Warum treibt Sie gerade dieses Thema so um?
Als Kind bin oft bei meinen Großeltern im Tiroler Lechtal gewesen und habe die Wildnis des Tiroler Lechs als Heimat kennengelernt. Deshalb habe ich mich auch in meiner journalistischen Arbeit mit der Natur in den Alpen beschäftigt. Es ist mir außerordentlich wichtig, dass wir diesen Naturraum in einem möglichst guten Zustand an kommende Generationen weitergeben.
Gibt es in der Art und Weise, wie Menschen mit der Natur in den Alpen umgehen, ein besonders massives Problem oder ist es eher die Summe aller Einzelaspekte?
Wir müssen vor allem weg von unserem extrem hohen Konsumanspruch und uns besser der Natur anpassen. Muss man denn Touristen wirklich dieses »Wir bieten hier alles« suggerieren? Brauchen wir wirklich auf 3000 Meter die besten Weine und Scampi? Es geht aber nicht um das grundsätzliche Ob, sondern um das Wie.
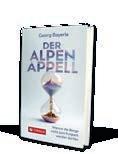
Ich kann mir überlegen, was ich konsumiere. Natürlich brauchen wir auch in den Alpen funktionierende Ökonomien, aber kein endloses Wachstum.
Haben Sie Lösungsvorschläge?
Die Politik muss dringend die Alpenkonvention wieder beleben. Da steht alles drin, zum Beispiel, dass Tourismus möglichst keine Naturräume schädigen soll. Auch gute Organisationen gibt es schon, zum Beispiel das Siegel »Bergsteigerdorf« mit recht strengen Kriterien.
Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch?
Der Verlag hat die Reaktionen »überwältigend« genannt. Auch der DAV-Präsident hat das Buch sehr gewürdigt. Ich hoffe, dass der gute Start, den das Buch hatte, eine Debatte in Gang setzt und wir in einer neuen Zeit in besserer Harmonie mit diesem Naturraum leben.
Interview: Luise Frank
Der BN-Arbeitskreis Alpen empfiehlt:
Georg Bayerle: Der Alpen-Appell
Warum die Berge nicht zum Funpark werden dürfen
Tyrolia Verlag, 160 Seiten, 20,00 Euro

Ein alltäglicher Anblick im ersten Halbjahr 2025: Niedrigwasser in Bayerns Flüssen und Bächen, hier an der Donau in Regensburg
EXTREMWETTER IN BAYERN
Laut dem Potsdamer Institut für Klimaforschung war das erste Halbjahr 2025 das trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1893, gefolgt von viel Regen im Juli.
Extremwetter ist das neue Nomal.
Im Juni hatten laut Bayerischem Landesamt für Umwelt rund 95 Prozent der Fließgewässer-Meldestellen niedrige Wasserstände. »Hitzewellen, Dürren und Starkregen durch die Klimakrise sind das neue Normal in Bayern – und der Freistaat ist nur ungenügend darauf vorbereitet«, so der BN-Vorsitzende Richard Mergner.
Ursachen für die kritische Wassersituation im Freistaat sind: schnelles Ableiten von Wasser, die Versiegelung oder Verdichtung von Böden sowie die Übernutzung vorhandener Grundwasser- und
Oberflächenwasserkörper. Diese fatalen Maßnahmen haben dazu geführt, dass zu wenig Wasser in der Landschaft bleibt und die Grundwasserneubildung gestört ist. Die Klimakrise verschärft die Situation weiter.
Der BN fordert deshalb eine nachhaltige Wasserpolitik. So muss die Speicherfähigkeit der Landschaft wiederhergestellt werden. Das bedeutet: Flüsse und Bäche renaturieren, Drainierung von Wiesen und Äckern rückgängig machen, Mulden, Säume, Hecken und andere abflussbremsende Strukturen in der Landschaft
fördern. Und vor allem: Die Flächenversiegelung endlich drastisch einschränken.
Zudem muss der Ökolandbau gestärkt werden, der bodenschonend wirtschaftet und das Grundwasser nicht durch Pestizide belastet. Mit der wertvollen Ressource Wasser muss sparsam umgegangen werden. Dafür braucht es klare Vorgaben und Anreize für Landwirtschaft, Industrie und Privathaushalte, um den Wasserverbrauch zu verringern. Der Ende Juli beschlossene Wassercent hat dafür eine zu hohe Freigrenze und zu viele Ausnahmeregelungen. Zu guter Letzt muss die Klimakrise bekämpft werden. Die Bayerische Staatsregierung muss alles tun, um die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich zu senken.
Hitzeperioden und extreme Trockenheit wie in diesem Jahr bedrohen aber auch unsere heimische Pflanzen- und Tierwelt. Wälder zeigten heuer Dürreschäden, Bäume warfen vorzeitig ihr Laub ab, und auf Feldern vertrockneten selbst robuste Kulturen. Vögel, Igel, Eichhörnchen, Amphibien und Insekten fanden kaum noch geeignete Wasserstellen. Trockene Wiesen, ausgedörrte Waldränder und ausbleibender Schatten erschwerten das Überleben zahlreicher Wildtiere.
Auch wenn der Regen im Juli die Situation in vielen Gebieten erst einmal entspannte, bedeutet das Extremwetter enormen Stress für die Natur, erklärt die BNArtenschutzexpertin Christine Margraf: »Was wir dieses Jahr beobachten konnten, ist ein ökologischer Notstand. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt derart trockene Wiesen im Juni hatten, die Biotopflächen sind extrem mitgenommen.«
SCHUTZ FÜR GEFÄHRDETE ARTEN

Das Bachneunauge ist wohl nur wenigen Menschen bekannt. Es braucht naturnahe Gewässer zum Leben. Sein Rückgang zeigt an, dass es nicht gut bestellt ist um die bayerischen Fließgewässer.
Mit seinem rund 100 000 Kilometer langen Gewässernetz ist Bayern ein echtes »Wasserland«. Doch seine Fließgewässer sind gestaut, begradigt und verschmutzt. Nur wenige sind noch in einem guten ökologischen Zustand. Dadurch sind die Lebensräume zahlreicher Tierund Pflanzenarten bedroht, darunter auch die des Bachneunauges. Das Bachneunauge ist ein fischähnliches Wirbeltier, das zu den Rundmäulern gehört. Im Unterschied zum Fisch hat es keine Schuppen oder paarige Flossen. Es hat einen etwa 15 Zentimeter langen und bleistiftdicken, aalartigen Körper und ist ein lebendes Fossil, das sich seit Millionen von Jahren kaum verändert hat. Seinen Namen verdankt das Tier sieben Kiemenund einer Nasenöffnung, die an jeder Seite gleich hinter dem Auge liegen. Den größten Teil ihres Lebens verbringen Bachneunaugen im Larvenstadium. Die Larven werden »Querder« genannt und im Oberlauf von Flüssen geboren. Sie verbringen drei bis sieben Jahre als wurmähnliches, augen- und zahnloses Wesen im Boden von Flüssen oder Bächen. Dabei schaut nur der Kopf hervor, sodass sie mit dem Maul Kleinlebewesen
und Pflanzenteile aus dem Wasser filtern können.
Wenn sich die Querder zu erwachsenen Bachneunaugen umbilden, wird kein Darm angelegt. Die Tiere stellen das Fressen komplett ein. Nun ist das einzige Ziel der Bachneunaugen die Fortpflanzung. Um geeignete Laichareale zu finden, führen sie von März bis Juni kurze Wanderungen zu flachen, sandig-kiesigen Stellen durch.
Haben die Tiere eine geeignete Stelle gefunden, schlagen sie mit dem Schwanz Gruben in den Boden und schichten unter Zuhilfenahme ihrer Saugscheiben Steine und Sand zu Nestern auf, in die sie ihre Eier legen. Jedes Weibchen kann bis zu 1500 Eier ablegen. Kurz nach der Eiablage und Besamung sterben die Bachneunaugen.
Das Bachneunauge gilt als Indikator für intakte Gewässerökosysteme mit guter bis sehr guter Wasserqualität und lebt in der Regel in sauerstoffreichen, sommerkühlen Bächen, Flüssen oder Gräben. In Bayern verfehlen jedoch vier von fünf Fließgewässern den gemäß der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie geforderten »guten ökologischen Zustand«. Neben der Verschmutzung durch Stoffeinträge wie etwa Pestizide sind Uferverbau und Querbauwerke wie Wehre und Abstürze ein Problem für das Bachneunauge. Letztere verhindern dessen Wanderung. Fast 57 000 solcher Querbauwerke hat das Landesamt für Umwelt an den bayerischen Bächen und Flüssen gezählt. Das Projekt Fluss.Frei.Raum, an dem der BUND Naturschutz mitwirkt, will durch den Rückbau von Barrieren in Fließgewässern gesunde, frei fließende Gewässer zurückgewinnen. Wer selbst aktiv werden
Familie: Neunaugen (Petromyzontidae)
Gattung: Lampetra
Art: Bachneunauge (Lampetra planeri)
Gefährdung: laut bayerischer Roter Liste von 2021 Vorwarnstufe mit starken Rückgängen. Differenziert für Nordbayern: Vorwarnstufe, für Südbayern: gefährdet
Schutz: geschützt laut FFH-Richtlinie, Anhang II
und Rückbauten anschieben will, ist herzlich eingeladen sich dem Fluss.Frei. Raum-Netzwerk anzuschließen.
Der Ausbau von Fließgewässern wirkt sich negativ auf das Bachneunauge aus, denn in geradlinigen, regulierten Gewässern lagert sich kaum Sediment ab und es fehlen strömungsberuhigte Altarme und flach überschwemmte Auen, in denen sich die Brut des Bachneunauges ungestört entwickeln kann. Außerdem werden beim Unterhalt von Bächen und Flüssen oft Schlick- und Feinsedimentbänke, die das Bachneunauge für seine Entwicklung im Larvenstadium braucht, einfach ausgeräumt.
FLIESSGEWÄSSER VERBESSERN
Zu den neueren Bedrohungen des Bachneunauges gehören die vermehrt auftretenden Dürresommer. Sie zeigen bereits, wie sich der Klimawandel auf unsere wassergebundenen Tiere auswirkt.
Das Bachneunauge braucht einen besseren Schutz der Laichgebiete und mehr Gewässerrenaturierung mit Verbesserungen der Gewässerstruktur und -qualität sowie der Wandermöglichkeiten. Die Umsetzung des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur (siehe Titelthema) ist eine große Aufgabe und Chance, unsere Fließgewässer endlich auf großer Fläche ökologisch zu verbessern, wovon nicht nur das Bachneunauge profitieren wird.
In Bayern ist das Bachneunauge heute vor allem noch im Einzugsgebiet des Mains verbreitet. Seltener kommt es in Ostbayern vor. In Südbayern war es schon früher nur selten zu finden. In den letzten drei Jahrzehnten sind die Bestände bayernweit deutlich zurückgegangen. Das Bachneunauge kommt nur in Europa vor. Bayern hat wegen der verhältnismäßig noch guten Bestände in Nordbayern eine große Verantwortung für die Erhaltung der Art.

maißer
Weitere Infos zum Projekt
Fluss.Frei.Raum: fluss-frei-raum.org/ mitmachen-vor-ort-engagieren
Tobias Windmaißer arbeitet im BN-Projekt »Quervernetzung Grünes Band«. In diesem Rahmen hat er am Spillerbach im niederbayerischen Landkreis FreyungGrafenau den Lebensraum des Bachneunauges verbessert.
Natur + Umwelt: Sie haben am Spillerbach unter anderem die Ufer abgeflacht. Wie profitiert das Bachneunauge davon? Tobias Windmaißer: Die Larven des Bachneunauges brauchen Sedimentablagerungen im Bach. Wenn ein Gewässer kanalisiert und reguliert ist, schwemmt jedes kleinere Hochwasser das Substrat weg. Das verträgt die Art nicht, weil die Larven des Neunauges im Sediment leben. Durch die Abflachung von Ufern nehmen wir den Druck des Hochwassers weg, sodass der Untergrund nicht dauernd weggeschwemmt wird.
Wir nehmen die Abflachungen wechselseitig vor. Dadurch entsteht ein vielfältiges Strömungsbild, durch das sich die besondere Schichtung, die das Sediment für die Entwicklung der Querder aufweisen muss, leichter bildet.
Warum ist sauberes Wasser für das Bachneunauge so wichtig? Das hängt mit dem Larvenstadium zusammen. Im Sediment ist ohnehin weniger Sauerstoff vorhanden als im umgebenden Wasser. Dadurch reagieren die Larven sehr empfindlich, wenn sich durch Nitratbelastung oder organische Verschmutzungen auch noch Faul-

Die Abflachungen am Spillerbach nehmen Hochwasser die Wucht.
schlamm bildet, der Sauerstoffmangel im Substrat verursachen kann.
Welche ökologischen Funktionen erfüllt das Bachneunauge im Ökosystem eines Baches?
Die Larven filtern Schwebteilchen aus dem Wasser. Das heißt, sie tragen zur Reinhaltung eines Gewässers bei. Außerdem sind sie natürlich auch Nahrung für Fische. So ist das Bachneunauge in der Fortpflanzungsphase eine wichtige Nahrungsquelle für den Huchen.
Text und Interview: Heidi Tiefenthaler

morschen Laubbäumen zeugen sie von einer weit fortgeschrittenen Zersetzung des Holzes. Das eigentliche Reich dieses Pilzes sind bei uns alte Buchenwälder. Die oft mehr als 20 Zentimeter großen Wundergebilde wachsen nur auf totem Holz.

und gefährdet. Junge Exemplare sind essbar, sollten aber geschont werden. Damit dieser Pilz und viele weitere Arten wilder Wälder langfristig überleben, müssen mehr Bäume wieder ihr natürliches Lebensalter erreichen dürfen.
Helfen Sie uns, eines der wichtigsten Schutzgebiete der Nordsee vor der Zerstörung durch Grundschleppnetze zu bewahren.
Die Doggerbank ist die größte Sandbank in der Nordsee. Sie beherbergt Arten wie Schweinswal, Minkwal, Weißschnauzendelfin, Seehund oder den Riesenhai. Ihr deutscher Teil wurde 2017 zum Meeresschutzgebiet erklärt. Doch geschützt ist die Sandbank nur auf dem Papier. Bis heute werden hier mittels Grundschleppnetzen große Mengen Fisch gefangen –mit fatalen Folgen. Kaum zu glauben, dass der Gebrauch dieser gefährlichen Netze in Schutzgebieten weiterhin erlaubt ist. Denn sie verwüsten wertvolle Lebensräume und sind eine der größten Gefahren für die marine Artenvielfalt. Als Beifang enden in ihnen jedes

Beim globalen Klimastreik im letzten Herbst gingen auch in Berlin viele Menschen auf die Straße.
Wälder brennen, Hitzewellen rollen, der Grundwasserspiegel sinkt – und was macht die neue Bundesregierung? Statt den Klimaschutz voranzutreiben, stellt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die deutschen Klimaziele in Frage und plant 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke zu errichten. Außerdem soll die höchst umstrittene Technologie der CO2Abscheidung und -Speicherung in großem Stil zum Einsatz kommen – und echten Klimaschutz ersetzen.

Wellhornschnecke und Sandaale auf der Doggerbank.

Jahr unzählige Meerestiere, darunter Seesterne, Haie und Rochen. 2024 konnte der BUND nachweisen, dass fast die gesamte Doggerbank mit Grundschleppnetzen befischt wird.
Die Zeit drängt. Schutzgebiete wie die Doggerbank sind unverzichtbar, um die Vielfalt der Meere zu erhalten und das Artensterben zu stoppen. Schenken wir dieser einmaligen Sandbank endlich den Schutz, den sie so dringend benötigt.
Helfen Sie uns mit Ihrer Unterschrift das Herz der Nordsee zu retten. Zusammen fordern wir Fischereiminister Alois Rainer auf, die Zerstörung der Doggerbank zu beenden.
Unsere Petition www.aktion.bund.net/doggerbank
Demonstrieren Sie am 20. September gegen die rückwärtsgewandte Energiepolitik der schwarz-roten Regierung.
Die Ausbauziele für die erneuerbaren Energien würde die Wirtschaftsministerin dagegen gerne schwächen. Statt in Windund Solarenergie, in Batteriespeicher, in intelligente Stromnetze oder in grünen Wasserstoff zu investieren, soll weit mehr Geld in fossile Energiereserven fließen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, fabulieren Merz, Reiche und Co. unverhohlen vom Bau neuer Atomkraftwerke. Dabei haben wir mit dem Erbe dieser unverantwortlichen Technologie noch eine Ewigkeit zu kämpfen.
Wir hatten beim Klimaschutz Stillstand befürchtet. Jetzt müssen wir uns gegen echte Rückschritte wehren. Gefragt ist ein vielstimmiger Aufschrei, laut und deutlich, überall in Deutschland. Darum gehen wir am Samstag, dem 20. September, auf die Straße, bundesweit und gemeinsam mit Fridays For Future. Schließen Sie sich an!
www.bund.net/klima-demos
Damit der deutsche Verkehr klimaverträglicher wird, muss das Schienennetz erweitert werden. Wie sich das mit dem Naturschutz vereinbaren lässt, ermittelt der BUND in mehreren Workshops.

GABRIEL KAPFINGER ist BUND-Mitarbeiter für Infrastruktur und Verkehr.
Vor fast 200 Jahren begann der Siegeszug der Eisenbahn. 1835 befuhr die erste Dampflok eine sechs Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Fünf Jahre später umfasste das Schienennetz 500, 1850 schon 5700 Kilometer. Heute steht die Schieneninfrastruktur unter ganz anderen Vorzeichen. Viele Gleise und Bahnhöfe wurden zurückgebaut, und was blieb, ist oft sanierungsbedüftig. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit nur 48 Kilometer Schiene neu- oder ausgebaut. Dagegen wuchs das Straßennetz seit 1994 jedes Jahr um durchschnittlich 10000 Kilometer.
KONFLIKTE ENTSCHÄRFEN
Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht und genug Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert, braucht es –neben weiterer Elektrifizierung – mehr Platz auf der Schiene. Bereits heute sind viele Strecken und Knoten (wo Schienenstrecken sich treffen) überlastet und verhindern einen störungsfreien Zugverkehr. Abhilfe schaffen können hier Neu- und Ausbauprojekte, abgeleitet vom Konzept

des Deutschlandtaktes. Doch die führen oft zu Zielkonflikten: Je attraktiver das Schienennetz, desto mehr Personen- und Güterverkehr kann auf die klimafreundliche Schiene verlagert werden. Zugleich beansprucht der Ausbau Fläche, auch in bisher wenig erschlossenen Landschaften. Somit drohen weitere Naturräume zerschnitten und versiegelt zu werden.
Im BUND-Projekt »Umweltverträgliche und gemeinwohlorientierte Schieneninfrastruktur als Rückgrat einer sozial-ökologischen Mobilitätswende« (gefördert vom Umweltbundesamt) möchten wir diese Konflikte entschärfen und Lösungswege zeigen. Essenziell ist dabei der Austausch mit BUND-Aktiven, die an der Planung von Bahnstrecken beteiligt sind. In Workshops sammeln wir deren Erfahrungen und lernen daraus, was sich bewährt hat oder verbessert werden kann.
ZUR DASEINSVORSORGE
Ein wichtiger Anspruch an das Schienennetz ist, dass es sich am Gemeinwohl orientiert. Gleise, Weichen und Co. sind kein Selbstzweck, sondern dienen unserer
Daseinsvorsorge. Für eine gute Anbindung sollten Bahnhöfe flächendeckend verfügbar und problemlos zugänglich sein. Für mehr Kapazität im Netz und somit häufigere Verbindungen können stillgelegte Strecken reaktiviert, bestehende Strecken ausgebaut oder eben Strecken neugebaut werden.
Mit dem Start ihrer Infrastrukturgesellschaft »DB InfraGO AG« Anfang 2024 hat sich die Bahn zum Gemeinwohl verpflichtet. Das muss sie nun mit Leben füllen. Mit eigenen Vorschlägen will der BUND dazu beitragen, dass sich die Bahn in Zukunft mehr an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und gleichzeitig naturverträglich ist.
Aktiv werden
Sind oder waren Sie als Landesverband, Kreis- oder Ortsgruppe an Schienenprojekten beteiligt und wollen über Ihre Erfahrungen berichten? Dann melden Sie sich bei: gabriel.kapfinger@bund.net
Vom 9. bis 13. Juni nahmen in Nizza rund 15 000 Menschen aus 175 Staaten an der dritten UN-Ozeankonferenz teil. Acht BUND-Aktive waren mit dabei, aus dem Meeresschutzbüro, der BUNDjugend und dem Ehrenamt. Sie brachten wichtige Anliegen und Forderungen zum Schutz von Nord- und Ostsee ein. Die Notwendigkeit, die Weltmeere weit konsequenter zu schützen, begleitete die gesamte Konferenz. »Dieses gemeinsame Verständnis stimmt mich hoffnungsvoll. Ich fand das sehr motivierend«, meinte Lena Hohls, die Sprecherin des BUNDArbeitskreises Meer und Küste. So gründete sich in Nizza eine Koalition für leisere

Meere. Sie will neue Wege finden, um den Unterwasserlärm zu senken. Fast hundert Länder forderten zudem ein ehrgeiziges globales Abkommen, das die Plastikverschmutzung beenden und die Produktion von Plastik verringern soll.
Auf dem deutschen Forschungsschiff Meteor stellte der BUND bei einer Veranstaltung den Meeresboden ins Zentrum, als natürliche Kohlenstoffsenke und als wichtigen Verbündeten beim Klimaschutz. »Meeresschutz ist nicht ›nice to have‹. Er ist unsere erste Verteidigungslinie gegen die Klimakrise. Das ist eine von sechs For-

Im Juni fand in Lüttich die Jahresversammlung unsres Dachverbands Friends of the Earth Europe statt. Verbündete aus ganz Europa kamen zusammen, um sich auszutauschen und politische Schwerpunkte für die nächsten zwei Jahre zu setzen.
Ein zentrales Ergebnis: Die Mitgliedsverbände beschlossen entschieden gegen die Deregulierungspläne von EU-Kommission und nationalen Regierungen anzugehen. Immer häufiger werden Umwelt- und Sozialstandards als »Bürokratie« verunglimpft, um wichtige Schutzmechanismen
Einige der BUND-Aktiven in der »Baleine« (dem Wal), einem Treffpunkt für Side-Events, Ausstellungen etc.
derungen, die wir hier in Nizza an Umweltminister Carsten Schneider übergeben haben«, so Alina Reize, BUNDjugend. Die Impulse und Kontakte aus Nizza werden in den kommenden Monaten in das hauptund ehrenamtliche BUND-Engagement einfließen.
Mehr zum Thema ... Meeresschutz unter: www.bund.net/meere
für Klima und Natur, für Demokratie und Menschenrechte zu untergraben. Dabei sind Vorschriften notwendig, um Umwelt und soziale Gerechtigkeit, Gesundheit und Gemeinwohl zu bewahren.
Auch der Vorstand wurde neu gewählt. Dieser setzt sich aus Aktiven aus Frankreich, Ungarn, Malta, Zypern, Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Estland und Tschechien zusammen. Die Estin Marilin Eessalu wurde als Vorsitzende bestätigt. Schließlich verständigte sich die Versammlung auf eine Agenda, um die Arbeit im Netzwerk zu stärken und mehr Wirkung zu erzielen.
Als neue BUND-Geschäftsführerin mit dabei war erstmals auch Verena Graichen, die sich über den regen Austausch im Rahmen des Vernetzungstreffens freute. Susann Scherbarth
Die Highlights 2024 der FoE Europe und ihrer Mitgliedsgruppen finden Sie unter: impact2024.friendsoftheearth.eu
Umweltministerin rettete sie 2024 die Wiederherstellungsverordnung der EU.
Leonore Gewessler war von 2014 bis 2019 Geschäftsführerin des BUND-Partners Global 2000 (Friends of the Earth Austria) und von 2020 bis März 2025 die grüne Umweltministerin Österreichs. Dank ihrer Ja-Stimme im EU-Rat konnte die Wiederherstellungsverordnung (auch: Renaturierungsgesetz) vor einem Jahr in Kraft treten – gegen den Willen ihres Koalitionspartners ÖVP.
Frau Gewessler, warum haben Sie dieser Verordnung zur Mehrheit verholfen?
Beim Renaturierungsgesetz geht es um nichts weniger als um unsere Zukunft. Es ist die historische Chance, den Verlust der

biologischen Vielfalt zu stoppen. Nur so können der Klimaschutz, die Ernährungssicherheit und letztlich der Katastrophenschutz unter einen Hut gebracht werden. Die extremen Hochwasser in Mitteleuropa haben es im vergangenen Herbst erst wieder klar gezeigt: Es muss Schluss sein mit Zubetonieren und Bodenverschleiß.
Im Vorfeld hatten Sie sich juristisch abgesichert. Ihr Ja war also rechtens?
Alle Anzeigen gegen mich wurden von der Staatsanwaltschaft abgewiesen, mangels Anfangsverdacht wurde also nicht mal in der Sache ermittelt. Daher ist ganz klar: Natürlich war das rechtens.
Für Ihren Coup ernteten Sie sehr viel Zuspruch, aber auch einige Anfeindungen. War das den Koalitionskrach wert? Das Renaturierungsgesetz ist das wichtigste Naturschutzgesetz der Europäischen Union. Es legt fest, dass wir unserer Natur Platz zum Leben – eigentlich müsste man sagen: zum Überleben – zurückgeben. Es wurde lange verhandelt und um einen Kompromiss gerungen. Schließlich geht es darum, dass kommende Generationen eine lebenswerte Zukunft haben. Deshalb war die Zeit gekommen, dieses Gesetz anzunehmen. Ich würde jederzeit wieder zustimmen.
sz
Anzeige
DAS MAGAZIN – handlich im Format und munter im Geist –bringt seit 1924 zehn Mal im Jahr einen unerschöpflichen Kosmos aus feinster Unterhaltung und schlauen Reportagen in Ihr Heim. Dazu Porträts, Literatur, Erzählungen, illustrierte Geschichten, Cartoons, internationale Aktfotografie sowie aktuelle Film- und Buchempfehlungen und erfreulich gehobener Mumpitz.
Bestellen Sie sich doch erst einmal ein Abonnement zur Probe, da machen Sie wirklich nichts falsch: 4 Hefte für 14 Euro. Und wenn wir Sie nicht überzeugen konnten, ist das natürlich betrüblich, aber dieses Testabonnement verlängert sich nicht!
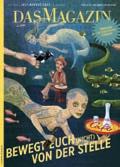
HINTERHER IST MAN IMMER SCHLAUER
Eine Wanderung durch ein stilles, schönes Flusstal führt an den Ort eines Umweltvergehens.
Wenn es ums Geld geht, zeigen manche Betreiber der angeblich so umweltfreundlichen Wasserkraft ihr wahres Gesicht: Wollen sie sich etwa des angesammelten Drecks in ihren verschlammten Stauseen entledigen, dann sind die ganzen ökologischen Bekenntnisse plötzlich keinen Pfifferling mehr wert, und sie spülen den modrigen Schlamm entgegen allen Zielen des Gewässer- und Naturschutzes ungehemmt und ungefiltert in die Flüsse.
So geschehen zum Beispiel an der Pfreimd, einem bezaubernden Wildflüsschen in der mittleren Oberpfalz, einem 76 Kilometer langen östlichen Zubringer der Naab, der kurz hinter der tschechischen
• Ausgangspunkt und Ziel: Tanzmühle unterhalb Tännesberg/Großenschwand
• Länge/Gehzeit: bis zu 20 km, Abkürzungen möglich
• Wegcharakter: Waldwege »über Stock und Stein, hangauf und hangab«
• Höhenunterschied: In Summe ca. 670 Meter
• Einkehr: Trausnitz, Tännesberg

Grenze entspringt. Ihr Tal verläuft so kurvig und krumm, dass es von Straßenbau jahrzehntelang verschont blieb und nur in den 70er und 80er Jahren einmal von einer Autobahn-Überbauung mit mehrfachen Querungen bedroht war.
Doch die dort wandernden Naturfreunde trauten im März 2024 ihren Augen nicht, als das normalerweise glasklare Wasser gelbbraun verdreckt war, mit langgezogenen Schlamminseln und dicken Schlammkrägen an den Ufern. Für Unkundige sieht es so aus, als wäre das kein großes Drama, denn viel von dem Schlamm wird weggespült – oder besser: woanders hin, und nach ein paar Wochen grünt es auf dem nährstoffübersättigten Boden nur umso heftiger, fast wie auf einer Güllewiese. Aber den Fischen, Amphibien und Insekten, die an klares Flusswasser angepasst sind, hilft dies nichts; ihr Nachwuchs erstickt im Schlamm oder verhungert, weil er nicht die richtige Nahrung findet.
Dabei war die Pfreimd eigentlich einer der großen Umwelterfolge der 80er Jahre: Nach einem langen und harten Kampf war es Oberpfälzer Naturschützern gelungen, die geplante Autobahn nach Waidhaus zwar nicht zu verhindern, aber aus dem Pfreimdtal nach Norden an die vorhandene B 14-Trasse hinauszudrängen.
Trotz der Schädigung lohnt das Pfreimdtal unbedingt eine Wanderung.
Eine schöne, stille Flusswanderung führt von der Tanzmühle bei Tännesberg hinunter nach Trausnitz und auf der anderen Seite wieder zurück. Wer einmal ein paar ruhige Stunden ohne Teerstraßen und Motorengeräusche verbringen möchte, hat hier die Gelegenheit – und zwar ausgerechnet in jenem Bereich, der nach der ursprünglichen Planung von der Autobahn überspannt werden sollte.
Kurz nach der Tanzmühle verlassen wir die schmale Straße, die nördlich der Pfreimd diagonal den Hang hinaufgeht, und stoßen erst bei Ödmühl kurz vor Trausnitz wieder auf Asphalt. Dazwischen geht es über Stock und Stein, hangauf und hangab die Pfreimd entlang. Der Weg ist anstrengend, aber unvergesslich. Wem es zu viel wird, der kann einfach umkehren und sich das eng eingeschnittene Kerbtal in Gegenrichtung anschauen, oder kurz nach der Ödmühle über eine Brücke und auf der anderen Flussseite zurückgehen.
Uli RohmBerner, Winfried Berner
Mehr entdecken
Winfried Berner, Ulrike Rohm-Berner: Gerettete Landschaften Wanderführer, Verlag Rother, 14,90 Euro Bestellung: www.bn-onlineshop.de

Im Licht der Morgensonne taucht die Insel auf: Sardinien. Felsen schimmern rosafarben, das Meer glitzert metallisch. Wir legen in Olbia an, das Festland ist vergessen.
Unser erstes Ziel ist die Ogliastra – jene abgeschiedene Region im Osten, in der sich Berge, Meer und Geschichte begegnen. Das Bergdorf Ulassai klebt wie ein Schwalbennest in dieser Landschaft aus Tafelbergen. Am nächsten Morgen führt uns Valentina, unsere lokale Wanderführerin, auf stillen Pfaden durch die »Tacchi« – markante Kalksteinberge. Es duftet nach wilder Minze, Myrte, Lavendel, Rosmarin und Fenchel. Beim Picknick probieren wir Pecorino, Oliven und Brot. Später betreten wir die kühle Welt der Tropfsteinhöhle »Su Marmuri«. In diesem Wunder aus Kalk und Zeit liegen zwei unterirdische Seen und bis zu 70 Meter hohe Hallen. Hier überwintert eine der größten Fledermauskolonien Europas.
In den Folgetagen wandern wir durch die Jahrtausende: zu steinernen Festungsbauten aus der Bronzezeit, hoch über dem Tal gelegen. Am Nachmittag besuchen wir das Weingut »Sa Pruna« und probieren Cannonau, ein rubinroter, kraftvoller Wein.
Am nächsten Tag verlassen wir das Inselinnere und fahren zur Küste, nach Santa Maria Navarrese. Unterwegs besichtigen wir eine Ölmühle und kosten frisch gepresstes Öl. Am Meer dann der erste Sprung ins immer noch warme Wasser. Auf dem Panoramaweg entlang der Küste begleiten uns Esel – ihre gemächlichen Schritte geben das Tempo vor. Der Pfad führt entlang der Steilküste, immer wieder
11. – 22. Oktober 2025
11. – 23. Oktober 2026
Infos zu Reisepreis und Anmeldung
BUND-Reisen
ReiseCenter am Stresemannplatz
Stresemannplatz 10, 90489 Nürnberg
Tel. 09 11/5 88 88-20 www.bund-reisen.de
Eine Wanderreise durch Sardiniens Osten führt zu Fledermäusen, Mandelbäumen –und zurück in die Bronzezeit.
öffnet sich der Blick auf das schimmernde Meer. Unser Ziel: ein Ovile, eine Hirtenhütte aus Stein. Dort erwartet uns ein einfaches, köstliches Essen. Es schmeckt nach Feuer und Weide und erinnert ans Schäferleben von anno dazumal.
Ein freier Tag: Wer mag, wandert, badet oder erkundet Baunei. Unsere Reiseleiterin kennt versteckte Wege und gute Lokale. Wer das Meer liebt, lässt sich mit dem Boot zu versteckten Buchten fahren. Dann besuchen wir die Fischereigenossenschaft von Arbatax. Auf einem Landgut bei Tortolì pflanzen wir Mandel- und Nussbäume.
Bevor wir die Insel verlassen, wartet noch ein fast verlassenes Bergdorf auf
uns, dem wieder neues Leben eingehaucht wurde. Inmitten der alten Häuser lernen wir Culurgionis zu formen – kunstvoll gefaltete Teigtaschen, gefüllt mit Kartoffeln, Käse und Minze. Dann heißt es Abschied nehmen. Die Nachtfähre trägt uns zurück ans Festland.
Die An- und Abreise erfolgt mit je zwei Nachtfahrten per Zug und Fähre. Es ist die klimafreundlichste Möglichkeit, nach Sardinien zu gelangen. Nicht unwichtig vor dem Hintergrund, dass dort seit Jahren mit steigenden Temperaturen und Wasserknappheit umgegangen werden muss. Beteiligen wir uns alle an dem Schutz der herrlichen Mittelmeerregion. Lucia Vogel

Wundervolle Ausblicke aufs Meer von der Ostküste Sardiniens


Es gibt so viele wunderbare Naturschätze in Bayern – doch oft sind sie bedroht: durch Bebauung, durch immer intensivere Landwirtschaft, durch Straßen, die Lebensräume zerschneiden. Der BUND Naturschutz bemüht sich seit vielen Jahren darum, Flächen anzukaufen, um sie zu schützen und zu bewahren, oft mit Erfolg: Derzeit besitzt der BN rund 2750 Hektar Flächen in ganz Bayern. Wir stellen Ihnen in jedem Heft ein solches Naturjuwel vor.
Seachtenberg nennen die BN-Aktiven aus Starnberg ihre neue Fläche. Auf einer Karte wird man sie unter diesem Namen
nicht finden, aber früher gab es angrenzend an die Wiese eine »Seachtn«, wie die Einheimischen sagen, ein großes Toteisloch, das aber schon vor Jahren verfüllt wurde. Die gut einen Hektar große Fläche liegt westlich von Perchting im AmmerLoisach-Hügelland im Landkreis Starnberg. Es handelt sich um eine artenreiche, sehr vielfältige Mähwiese mit einigen Toteislöchern, darunter das tiefste der Umgebung. Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet »Westlicher Teil des Landkreises Starnberg«.
Die Geschichte des Grundstücks ist eigentlich eine sehr traurige: Vor etwa 30
Ortsgruppe: Starnberg
Fläche: 1,1 Hektar
Pflanzen: Aufrechter Ziest, Großer Ehrenpreis, Drahtsegge, Gelbe Sommerwurz
Insekten: Schwalbenschwanz (Raupe), Gespinstblattwespe, Seidiger Fallkäfer, Schwarzfüßige Schnepfenfliege

Gelbe Sommerwurz
Jahren kam bei einem Verkehrsunfall ein Mädchen zu Tode. Die Großmutter kaufte die Fläche, weil man von dort aus den Un-
fallort sehen kann. Sie ließ auf einer Anhöhe eine Bank aufstellen und besuchte den Platz regelmäßig. Der ehemalige Vorsitzende der Ortsgruppe Starnberg, HansJochen Iwan, kannte die trauernde Großmutter. Eines Tages versprach sie ihm, die Wiese dem BUND Naturschutz zu vererben. Als sie starb, erbte ihre Tochter die Fläche. Als diese ebenfalls verstarb, ging das Grundstück auf eine Enkelin über. Diese fand in den Unterlagen der Großmutter einen Hinweis auf das Vorhaben, die Wiese dem BN zu vermachen. Sie entschied sich, dem Wunsch der Großmutter zu entsprechen, und so kam das Grundstück in den Besitz des BN – sehr zur Freude der Ortsgruppe Starnberg.
»DA FREUT MAN SICH EINFACH«
Die Fläche ist mit Feldgehölzen durchsetzt, am Fuße eines Moränenhügels findet sich ein kleiner Weiher. Bei einer ersten Begehung des Grundstücks Mitte Juni waren die BN-Aktiven begeistert. »Da schaut und schaut man und freut sich einfach, was es auf der Wiese alles Schönes gibt«, sagt Irmgard Franken, die Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Starnberg. Auf der artenreichen Fläche fanden die Aktiven auf Anhieb einige seltene Pflanzenarten wie den Aufrechten Ziest oder den Großen Ehrenpreis. Auch aus dem Tierreich hat die Wiese einiges zu bieten. So entdeckten die BN-Leute beispielsweise eine Schwalbenschwanzraupe und eine Gespinstblattwespe.
Das Grundstück wurde durch die Eigentümerfamilie bestens extensiv gepflegt. Ein Landwirt mäht sie einmal pro Jahr über das amtliche Landschaftspflegeprogramm. So konnte sich eine wunderbare Pflanzen- und Tiergemeinschaft halten beziehungsweise entwickeln. Die Ortsgruppe wird daran anknüpfen und weiter nach möglichen Verbesserungen auf der Fläche streben. Unter anderem soll der Weiher, der mittlerweile von Verlandung bedroht ist, ökologisch aufgewertet werden.
Heidi Tiefenthaler

kurz vor der Sommerpause hat der bayerische Landtag mit der Mehrheit von CSU und FW das dritte Modernisierungsgesetz verabschiedet. Was die Bayerische Staatsregierung als »Modernisierung« bezeichnet, nannte die Süddeutsche Zeitung in einem Kommentar ein Bergzerstörungsgesetz. Unter dem Deckmantel von Bürokratieabbau werden damit Umweltschutzstandards abgeschafft. So ist nun für die meisten Seilbahnen in den Alpen keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr notwendig. Damit können einige wenige Liftbetreiber Profit machen auf Kosten der Natur. Eine traurige Entwicklung: Kaum ist das Thema Umweltschutz nicht mehr ganz oben auf der politischen Agenda, drängen Unternehmen auf Genehmigungen von gefährlichen Projekten. So will der Gipshersteller Knauf im Raum Würzburg das größte Gipsbergwerk Deutschlands errichten – direkt unter dem größten Trinkwasser-Einzugsgebiet der Stadt! Dies könnte ein landesweit bedeutsamer Präzedenzfall sein. Bitte helfen Sie mit, dieses Bergwerk zu verhindern, und unterschreiben Sie auf der Unterschriftenliste, die diesem Heft beiliegt. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf Seite 11.
Statt Wasser zu gefährden, müssen wir es besser schützen als jemals zuvor,
denn die Klimakrise führt auch in Bayern zu sinkenden Grundwasserständen und langen Trockenperioden wie in diesem Sommer. Und wenn es regnet, wird dies immer häufiger in Form von Starkregen sein, der Hochwassergefahr mit sich bringt. Die beste Maßnahme dafür ist, den Wasserhaushalt der Natur zu unterstützen, zum Beispiel durch die Wiedervernässung von Mooren oder die Renaturierung von Bächen und Flüssen. Hier leistet das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur der Europäischen Union wertvolle Dienste. Bei vielen solcher Renaturierungsprojekte ist der BUND Naturschutz Akteur oder Partner. Lesen Sie mehr dazu im Titelthema dieser Ausgabe.
Der BN wird sich weiterhin auf politscher Ebene für Klima- und Naturschutz stark machen. Gleichzeitig kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen, der Natur zu helfen, zum Beispiel bei Bioppflege oder der Amphibienrettung, die viele unserer Kreisgruppen anbieten, oder durch das Aufstellen von Vogeltränken in Trockenzeiten. Auf unserer Website finden Sie viele praktische Tipps. Ein kleines Wasserschälchen, aus dem einige Vögel trinken, mag wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, aber wie so oft gilt: Die Summe vieler kleiner Maßnahmen macht einen Unterschied.
Doris Tropper stv. Vorsitzende
Richard Mergner Landesvorsitzender
Beate Rutkowski stv. Vorsitzende

Hubert Weinzierl war ein Wegbereiter des Naturschutzes und hat Natur- und Umweltschutz als Bewegung in der Mitte der Gesellschaft verankert. Ohne ihn wäre der BUND Naturschutz heute als Verband nicht dort, wo er ist. In seiner Amtszeit als Landesvorsitzender des BN von 1969 bis 2002 stieg die Mitgliederzahl von unter 20 000 auf über 175 000. Hubert Weinzierl war 1975 Mitinitiator der Gründung unseres Bundesverbandes Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). »Aus dem staatsnahen, unpolitischen BUND Naturschutz hat Hubert Weinzierl gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen einen unabhängigen, starken und demokratischen Verband gemacht. Bayerns Natur wäre ohne sein Wirken ärmer und unsere Lebensgrundlagen noch bedrohter«, würdigte Richard Mergner, BN-Landesvorsitzender, Weinzierls Wirken.
Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BUND Naturschutz, jahrzehntelanger Wegbegleiter und 2002 Weinzierls Nachfolger als Landesvorsitzender, betonte: »Hubert Weinzierl war ein Wegbereiter des heutigen Naturschutzes, der es geschafft hat, dass der Naturschutz zu einer gesellschaftlichen Kraft wurde. Ohne ihn
NACHRUF
Der BUND Naturschutz trauert um einen großen Naturschützer und seinen langjährigen Vorsitzenden Hubert Weinzierl. Er starb am 16. Juni in Wiesenfelden im Alter von 89 Jahren.
hätte Bayern seine landschaftlichen Naturschutzhöhepunkte nicht bewahrt.«
BUND-Vorsitzender Olaf Bandt erinnert sich: »Als ich 1992 zum BUND kam, war Hubert Weinzierl unser Vorsitzender. Er war ein Mensch, der Vertrauen schenkte. Mit Herz, Klugheit und unermüdlichem Einsatz hat er den BUND geprägt. Er zeigte, dass Naturschutz mehr ist als Facharbeit – nämlich Liebe zur Natur und Verantwortung für kommende Generationen. Ob Naturschutz, Atomausstieg oder Zukunftsfähiges Deutschland – er war vielfältig aktiv und hat Engagement ermöglicht. Sein Wirken begleitet uns bis heute – und fehlt zugleich schmerzlich.«
Hubert Weinzierl wurde 1935 in Ingolstadt geboren und studierte in München Forstwissenschaft. Schon ab 1953 engagierte er sich im Naturschutz. Von 1965 bis 1972 war er ehrenamtlicher Regierungsbeauftragter für Naturschutz in Niederbayern. Über 30 Jahre lang, von 1969 bis 2002, war Weinzierl Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern e.V. und 1975 Mitinitiator der Gründung des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der BN ist seitdem dessen baye-
rischer Landesverband. Hubert Weinzierl hatte zudem von 1983 bis 1998 das Amt des BUND-Vorsitzenden und von 2000 bis 2012 das des DNR-Präsidenten inne.
In Weinzierls langjähriges Wirken als BNVorsitzender fielen große Umweltschutzthemen wie das Waldsterben in den 80er Jahren, der Kampf gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf oder der Super-GAU im Atomkraftwerk Tschernobyl. Zu seinen größten Erfolgen gehört die Einrichtung des Nationalparks Bayerischer Wald, der maßgeblich auf ihn zurückzuführen ist, sowie die Wiedereinbürgerung des Bibers und die Rückkehr von Wildkatze und Luchs nach Bayern. »Für eine ganze Generation von Umweltschutzaktiven war Hubert Weinzierl Vorbild und Integrationsfigur«, würdigt der BN-Vorsitzende Richard Mergner Weinzierls Wirken.
Hubert Weinzierl wurde unter anderem mit der Bayerischen Verdienstmedaille, dem Bayerischen Verdienstorden und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Der BUND Naturschutz wird seinem langjährigen Vorsitzenden Hubert Weinzierl ein ehrendes Andenken bewahren.
Hubert Weinzierl (li.) verteilt 1971 Flyer zum Thema »Saubere Landschaft«

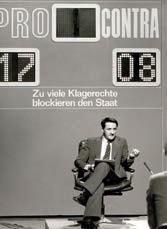
Auch vor der Kamera wie hier in einer Fernsehsendung 1979 trat Hubert Weinzierl mit klugen Argumenten für den Umweltschutz ein.
Hubert Weinzierl bei der 100-Jahr-Feier des BUND Naturschutz 2013
Sie brachten den Naturschutz in Bayern maßgeblich voran (vo.li.): Hubert Weinzierl, der bekannte Tierfilmer Bernhard Grzimek und der frühere BN-Landesgeschäftsführer Helmut Steininger.

1975 war Hubert Weinzierl maßgeblich beteiligt an der Gründung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), hier bei einer der ersten Vorstandssitzungen (3.vo.re.)
Bei einer Demo gegen das




Zusammen mit dem damaligen bayerischen Umweltminister Max Streibl (2. vo. li.) nahm Hubert Weinzierl (li.) 1972 an der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm teil.

Die Delegierten machten mit der Fotoaktion Werbung für mehr Bäume in Städten und Gemeinden.
DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2025
»Natur ist keine
Die Delegiertenversammlung des BN stand ganz im Zeichen der zu erwartenden
Einschnitte beim Umwelt- und Naturschutz durch die neue Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung. Die rund 250 Delegierten, die die fast 269 000 BNMitglieder vertreten, machten sich außerdem für mehr Grün in Bayerns Städten stark.
Das Parlament des BUND Naturschutz appellierte an die Verantwortlichen in der Politik, nicht am falschen Ende zu sparen: Die Delegierten stimmten bei der Versammlung in Fürth dem Leitantrag zu mit dem Titel: »Umwelt-, Natur- und Klimaschutz unter Druck: Unsere Lebensgrundlagen sind keine Nebensache!«
»Dass sich die Bayerische Staatsregierung Anfang des Jahres klammheimlich vom selbst gesteckten Klimaziel verabschiedet hat, ist ein fatales Zeichen an die nachfolgenden Generationen. Der einst Bäume umarmende Ministerpräsident Markus Söder hat dem Umwelt- und Naturschutz leider weitestgehend den Rücken gekehrt. Sein Stellvertreter Hubert Aiwanger bläst mit der geplanten Novelle des bayerischen Jagdgesetzes zum Generalangriff auf geschützte Arten«, erklärte die stellvertretende BN-Vorsitzende Beate Rutkowski.
»Ins Bild passt auch, dass die Bundesregierung, wohl maßgeblich auf Initiative von Markus Söder, das Verbandsklagerecht einschränken will – ein wichtiges
Instrument für Umweltschutzverbände, für den Schutz unserer Natur einzutreten. Aber wir werden uns nicht einschüchtern oder entmutigen lassen und uns weiterhin für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzen. Denn sie sind keine Verhandlungsmasse, keine Bürokratie und keine Nebensache, sondern unverzichtbar und lebensnotwendig!«
WICHTIGE IMPULSE
Der SPD-Oberbürgermeister der Stadt Fürth, Thomas Jung, hob in seinem Grußwort die Wichtigkeit des Klimaschutzes hervor und wies darauf hin, dass die Stadt das Klimaziel mit mehr als 50 Prozent übererfüllt hat. An den BN gerichtet sagte er: »Umwelt- und Klimaschutz ist sehr wichtig, ich bin da überaus dankbar für Ihre Impulse. Vielen Dank für Ihr Engagement in ganz Bayern!«
Der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Fürth-Stadt, Reinhard Scheuerlein, ging in seiner Begrüßung auf die Wichtigkeit von Bäumen in der Stadt ein. »Der Einsatz fürs Stadtgrün ist seit je her ein Schwerpunkt
Volle Konzentration: Die Delegierten bei der Abstimmung

Mit der Naturschutzmedaille wurden in diesem Jahr ausgezeichnet: Waltraud Galaske, Sprecherin Landesarbeitskreis Abfall und Kreislaufwirtschaft und stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Fürth-Stadt, Sabine Lindner, Vorsitzende der Kreisgruppe Fürth-Land, Helmut König, Vorsitzender der Kreisgruppe HöchstadtHerzogenaurach, und Franz Zang, Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kissingen.

unserer Arbeit. Dass die Talauen in Fürth großteils erhalten sind, ist auch ein Verdienst unserer Kreisgruppe, die sich mit aller Kraft gegen Bebauungspläne zur Wehr gesetzt hat.«
Stadtbäume waren auch das Thema des traditionellen Gruppenfotos. Vor der Stadthalle hielten die Delegierten ein Banner hoch mit der Aufschrift: »Der Schatten fällt nicht weit vom Stamm – Ich bin deine Klimaanlage und sorge im Sommer für Abkühlung«. Auch die bayerischen Wälder waren Thema in Fürth. Die Delegierten verabschiedeten eine Resolution zu Infrastruktur-Bauprojekten im Wald. Auf der Delegiertenversammlung wurde außerdem der neue Landesgeschäftsführer Lucas Schäfer vorgestellt, der im September Peter Rottner nachfolgen wird. Schäfer beschwor in seiner Vorstellungsrede die Stärken des Verbandes und dessen Teamgeist: »Wir haben die Antworten, wir sind viele und wir machen das nicht erst seit gestern. Und: Der BN ist mehr als die Summe seiner einzelnen Mitglieder.«
Die Delegierten sprachen dem Vorstand einstimmig das Vertrauen aus und verabschiedeten den Haushaltsplan.
Einnahmen der Umweltbildungseinrichtungen
366 000 Euro
Zuschüsse für Ankäufe, Artenschutz, Projekte
8 295 000 Euro
Erbschaften
3 602 000 Euro
Gesamteinnahmen*
27 Mio.
EINNAHMEN UND AUSGABEN
Felix Hälbich, Luise Frank 2024
Beiträge von Mitgliedern und Förderern
11 510 000 Euro
Verwaltung, Miete und sonstige Ausgaben
3 276 000 Euro
Verbandsorgane, Delegiertenversammlung, Naturschutzveranstaltungen 669 000 Euro
Unterstützung der Jugendarbeit 585 000 Euro
Deutschlandweiter und internationaler Umweltschutz
1 530 000 Euro
Information, Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Internet, Mitgliederund Spendenwerbung
4 412 000 Euro
Mitgliederservice »Natur+Umwelt«
1 105 000 Euro
Gesamtausgaben*
Spenden inkl. Hausund Straßensammlung
2 614 000 Euro
* inkl. Rücklagenzuführung/-entnahme
Investitionen, Baumaßnahmen
761 000 Euro
Arten- und Biotopschutz
4 962 000 Euro
Ankauf ökologisch wertvoller Grundstücke
4 783 000 Euro
Fach- und Lobbyarbeit in Natur- und Umweltschutz 869 000 Euro
Unterstützung der Kreis- und Ortsgruppen
3 451 000 Euro
Bildungsarbeit 947 000 Euro

BN-Landesbeauftragter Martin Geilhufe (li.) und Axel Doering, Vorsitzender der Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen (re.), überreichten die Naturschutzmedaille an Andreas Keller.
Im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen ehrte der BN Andreas Keller für seinen jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Natur. So wurden durch seinen erfolgreichen Widerstand gegen die geplante Autobahntrasse im oberen Loisachtal wertvolle Moore und Föhrenheiden vor der Zerstörung bewahrt. Als promovierter Physiker deckte er Fehlplanungen bei Verkehrsprojekten wie der B2-Umgehung in Farchant und dem Kramertunnel auf. Seine fundierten Analysen trugen dazu bei, dass umweltfreundlichere Alternativen ernst genommen wurden.
Auch das Münchner Wasserprojekt, das eine übermäßige Wasserentnahme aus dem Loisachtal vorsah, hinterfragte er kritisch und wies erhebliche Berechnungsfehler nach. Dank seines Engagements wurden genauere Messungen angeordnet, um langfristige Schäden zu vermeiden. In den 1980er Jahren setzte er sich zudem gegen die Olympiabewerbung Garmisch-Partenkirchens ein. Die Initiative »Bürger fragen Bürger zu Olympia« trug entscheidend dazu bei, dass die Bewerbung scheiterte und somit massive Eingriffe in die Natur verhindert wurden.

Wiesen können Lebensraum für viele Arten bieten. Landwirte, die sich um solche artenreichen Wiesen bemühen, werden alljährlich bei der Wiesenmeisterschaft ausgezeichnet. In diesem Jahr fand sie im östlichen Mittelfranken statt.
Mit dem Wettbewerb wollen die Veranstalter, der BUND Naturschutz und die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), die Leistungen der Landwirt*innen, die artenreiche Wiesen erhalten und in ihrem landwirtschaftlichen Betriebskreislauf nutzen, in der Öffentlichkeit würdigen. Den ersten Platz erzielte Familie Gerstner aus Thalmässing. Die Landwirtsfamilie betreibt Schafhaltung und -zucht im Nebenerwerb und engagiert sich hier besonders für den Erhalt gefährdeter Nutztierrassen. Auf der Siegerwiese fand die Jury über 60 Blütenpflanzen wie Schafgarbe, Wilde Möhre oder Echte Schlüsselblume.
Mit zwei neuen Regionalreferenten in Franken sorgt der BN für kontinuierliche Präsenz in der Region und eine gute Betreuung der Kreisgruppen.
Jonas Kaufmann war bereits beim BN als Regionalreferent für Oberfranken tätig, bevor er in Elternzeit ging. Nun hat er das Regionalreferat Mittelfranken übernommen – als Nachfolger von Tom Konopka, der nach 28 Jahren als BN-Regionalreferent in den wohlverdienten Ruhestand ging. Kaufmann studierte Biogeowissenschaften in Koblenz und Agrarwissenschaften in München, bevor er eine Stelle als Referent im Bayerischen Landtag antrat. Er war mehrere Jahre im Büro des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber tätig.
Das Regionalreferat Oberfranken ist in den bewährten Händen von Kaufmanns Elternzeitvertretung Jörg Hacker. Zusätzlich zur halben Stelle als Regionalreferent hat der 47-Jährige eine halbe Stelle beim Nationalen BUND Kompetenzzentrum Grünes Band. Jörg Hacker studierte Politikwissenschaft und Psychologie und ist aktiv in der Anti-Atombewegung als gewählter zivilgesellschaftlicher Vertreter zur kritischen Begleitung der Suche nach einem tiefengeologischen Lager für hochradioaktiven Müll.

Es war eine Sensation, als auf dem ehemaligen Standortübungsplatz im unterfränkischen Ebern die Essigrosen-Dickfühlerweichwanze nachgewiesen wurde. Die Art galt als ausgestorben. Im Mai wurde mit einem Symposium das fünfjährige Bestehen des Projekts »Rettet Rosi« gefeiert.
Das frühere Militärgelände im Landkreis Haßberge ist ein Hotspot der Artenvielfalt, was nicht zuletzt der BN-Kreisgruppe zu verdanken ist und ihrem Vorsitzenden Klaus Mandery, einem namhaften Artenschutzexperten. Der Fund von »Rosi«, wie das kleine Insekt mit dem langen Namen genannt wird, war der Auslöser für das vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderte Projekt »Rettet Rosi!«.

»Rosi« an ihrer Wirtspflanze, der Essigrose
Dessen erfolgreicher Abschluss und der Nachweis von mittlerweile unglaublichen 15 000 Arten im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet »Ehemaliger Standortübungsplatz Ebern« waren der Anlass für ein farbenfrohes Fest in der ehemaligen Kaserne in Ebern. Hochkarätige Gäste und Artenexperten waren gekommen, so der Landtagsabgeordnete Paul Knobloch, Andreas Krüß vom BfN und natürlich Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann, vom BN der Ehrenvorsitzende Hubert Weiger und Landesvorstandsmitglied Steffen Scharrer. Eine Podiumsdiskussion und Vorträge gaben Einblick in zahlreiche Aspekte der Artenschutzarbeit.

Seit über 50 Jahren lädt der BUND Naturschutz jeden Sommer auf den Schmausenbuck in Nürnberg zum Reichswaldfest ein. Mit einem bunten Programm für Jung und Alt erinnert der BN an die Bedeutung der »grünen Lunge« Nürnbergs. In diesem Jahr war Günter Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Redner auf der Veranstaltung, die im Juni stattfand. Auf den ersten Blick eine überraschende Personalie, haben doch BN und BBV oft sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussieht. Beim Thema Wald sind jedoch die Gemeinsamkeiten groß. Felßner betonte die Bedeu-
tung des Waldumbaus hin zu einem Mischwald, der mit immer häufigeren Hitze- und Trockenperioden besser zurechtkommt als Fichten und Kiefern. Um diese gigantische Aufgabe zu bewältigen, so forderte der BBV-Präsident, bräuchten die Waldbauern staatliche Unterstützung.
Der BN macht in diesem Jahr besonders auf die Bedeutung von Bäumen in Städten und Gemeinden aufmerksam und nutzte dazu auch das Reichswaldfest. Das Waldgebiet ist heute eine wichtige »Klimaanlage« für die Metropole Nürnberg.
Vor zehn Jahren erschien die Enzyklika Laudato si’ des mittlerweile verstorbenen Papstes Franziskus. Das erste päpstliche Lehrschreiben zu Umweltthemen fand weltweit große Beachtung. Eine Tagung am 2. Oktober in München (live und online) wirft einen Blick zurück auf das Werk und geht der Frage nach, welche Bedeutung die Enzyklika für die weltweite ökosoziale Transformation hatte. Das konsequente Zusammendenken ökologischer, sozialer und kultureller Herausforderungen als »Schrei der Schöpfung« und »Schrei der Armen« ist wegweisend – nicht nur aus theologisch-sozialethischer Sicht, sondern ebenso aus der-

jenigen der Forschung, die die Verknüpfung von Klima- und Entwicklungspolitik sowie interkulturelle Dialoge zunehmend als Erfolgsbedingung erkennt. Veranstalter ist die Katholische Akademie Bayern. Der Landesbeauftragte des BUND Naturschutz, Martin Geilhufe, spricht zur Bedeutung von Laudato si’ für die Umweltschutzbewegung.
Informationen und Anmeldung
www.kath-akademie-bayern.de/veranstaltung/franziskus-erbe-fuer-dieschoepfung/
»Wasser marsch!« – Die Jugendfeuerwehren Altdorf und Winkelhaid retteten einen Amphibienteich vor dem Austrocknen.

Mit einer tollen Aktion in letzter Minute rettete die Feuerwehr im mittelfränkischen Winkelhaid Tausenden Amphibien das Leben – auf eine Initiative des BN hin.
Aktive des örtlichen BUND Naturschutz beobachteten im Frühling mit zunehmender Sorge, wie ein Teich im Wald immer mehr austrocknete – eine Folge des ausbleibenden Regens. Irgendwann drängelten sich Tausende Kaulquappen in der verbliebenen Pfütze. Die BN-Aktiven wandten sich in ihrer Verzweiflung an die Freiwillige Feuerwehr. Die Wehren aus Winkelhaid und Altdorf eilten zu Hilfe und machten aus dem Einsatz auch gleich
eine Übung für die Jugendfeuerwehr. Mit Spezialschläuchen, die das Wasser flächig verteilen, wurde der Teich aufgefüllt. 10 000 Liter Wasser waren notwendig. Der BUND Naturschutz sagt im Namen der zahllosen geretteten Tiere und Pflanzen »Dankeschön!«.
So lobenswert diese Aktion war, sie kann leider keine Lösung zur Überwindung der Klimakrise sein. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit mussten die Feuerwehren in der Region kurz danach Wasser sparen, um die kostbare Ressource für mögliche Waldbrände zurückzuhalten.
Online auf einer Karte nach Bio-Angeboten suchen – diese Idee hat die Projektstelle Ökologisch Essen der BN-Kreisgruppe München in die Tat umgesetzt. Was derzeit noch auf die Region um die Landeshauptstadt begrenzt ist, soll bald für ganz Bayern möglich werden. Die Online-Karte biobeidir.de macht Anbieter wie Hofläden, Bio-Restaurants oder Lieferdienste von Bio-Lebensmitteln sichtbar und ist ein praktisches Werkzeug, um nachhaltige Ernährung einfacher zu machen. Durch die Kooperation mit Future Maps sind viele Orte, die auf


Über 60 Gäste aus Politik, Verwaltung und Verbänden haben sich Mitte Mai beim Politischen Frühlingsempfang des BN über Wasserschutz und Hochwasserschutz in der zunehmenden Klimakrise ausgetauscht.
Die jedes Jahr stattfindende kleine, aber feine Veranstaltung ist inzwischen zu einer Tradition geworden, bei der Menschen ins Gespräch kommen, die sonst wenig miteinander reden. Gastreferentin des Abends war Dr. Juliane Thimet, die Wasserexpertin des Bayerischen Gemeindetags.

Thimet, die Wasserexpertin des Bayerischen Gemeindetags.

www.biobeidir.de erscheinen, ab sofort auch in der Future Maps-App zu finden. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern ist die Online-Map nicht kommerziell. Alle BN-Kreisgruppen, die bereits einen Bio-Einkaufsführer erstellt haben oder sich für die digitale Darstellung von BioAngeboten interessieren, sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Gemeinsam machen wir Bio sichtbarer – digital und regional.
Informationen
Hier geht’s zu biobeidir.de: biobeidir.de
Kontakt: bio@bn-muenchen.de
Sie erklärte den Gästen unter anderem, dass es (anders als für »klassisches« Hochwasser durch gesättigte Böden) für sog. »frei abfließendes Oberflächenwasser« nach Starkregen bislang keinen Rechtsrahmen und damit auch keine Verantwortlichkeiten gebe. Und sie machte deutlich, dass der beste Schutz vor solchen Überschwemmungen ein effektiver Klimaschutz ist.
Sie möchten in Sachen Umwelt- und Naturschutz immer auf dem Laufenden sein? Dann ist unser Newsletter genau das Richtige für Sie. Wir informieren über aktuelle Themen, Aktionen und Termine. www.bund-naturschutz.de/newsletter
EXKURSIONEN

Werte wie Kreativität, Selbsterkenntnis, Integrität, kritisches Denken, Optimismus, Wertschätzung und Verbundenheit sind die Antreiber für das, was der BN in Bewegung bringen will.
Ein viertägiger Workshop zu inneren Entwicklungszielen bietet die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, um sich individuell und in einer Gruppe neu auszurichten und eine persönliche Vision zu finden.
Die Teilnehmenden erfahren, wie sie ihr Engagement und das ihrer Gruppe unter-
stützen, indem sie die inneren Ressourcen aktivieren. Hier geht es darum, Vorhandenes weiterzuentwickeln und an die eigene Biografie und die eigenen Ressourcen und Visionen anzuknüpfen.
Informationen innerdevelopmentgoals.org 28.–30. Oktober 2025, Wartaweil Anmeldung bis 26. September Weitere Infos auf: www.wartaweil.bund-naturschutz.de

Strahlende Gesichter bei der Auszeichnung durch Umweltminister Thorsten Glauber (re.)
Nach der Anerkennung als Umweltstation kann sich die Umweltstation Ingolstadt nun auch über die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel »Umweltbildung. Bayern« freuen. Einer der drei Träger ist die BN-Kreisgruppe. Bürgermeisterin Petra Kleine freute sich: »Ich gratuliere unserer Umweltstation Ingolstadt zu dieser tollen Würdigung ihrer Arbeit. 2024 konnten über 6000 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene an den Angeboten der Umweltstation teilnehmen. Mit der Auszeichnung wurde nun die hohe Qualität der Arbeit bestätigt.«
In Bayern können sich Einrichtungen und Akteure mit hochwertigen Bildungsangeboten im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) um das Qualitätssiegel »Umweltbildung.Bayern« bewerben. Die Umweltstation Ingolstadt ist nun Teil dieses Netzwerkes aus rund 150 Einrichtungen und Akteuren, zu denen auch die BN-Umweltstationen, sowie das Bildungswerk und engagierte Kreisgruppen zählen.
Für Kurzentschlossene: Vom 31. August bis zum 7. September startet die zweite Runde der »Outdoor Heroes« in der Umweltstation Mitwitz. Zielgruppe: Studie rende aus Deutschland und aller Welt. Das englischsprachige Camp bietet Wanderungen am Grünen Band Deutschland sowie Besuche in Kronach und Weimar. Nebenbei wird mit angepackt, zum Beispiel beim Einrichten von Biotopen. Dazwischen gibt es Infos über Naturschutzpionier*innen wie Rachel Carson oder Alexander von Humboldt. Anmeldung: info@oebo-natur.de

Kontakt
Kontakt: Umweltstation Ingolstadt Mensch.Natur.Stadt. www.sjr-in.de www.umweltstation-ingolstadt.de

Waldameisen nehmen eine Schlüsselrolle im Ökosystem Wald ein. Zwei Fachleute berichten bei einem Waldspaziergang am 13. September in Waldbrunn Spannendes über die Welt dieser besonders geschützten Tierart. Hier kann man die Ameisen bei ihrer täglichen Arbeit beobachten und mehr über ihr Sozialverhalten und das Leben dieser faszinierenden Waldbewohner erfahren.
Anmeldung: info@bn-wuerzburg.de
Am 15. November findet der Blühbotschafterkongress in Lindau statt. Es gibt viele spannende Impulse, um das Anliegen der blühende Landschaften voranzubringen, gute Beispiele aus der Praxis, Workshops und Zeit fürs Netzwerken. Die BN-Umweltstation NEZ-Allgäu ist einer der drei Projektpartner. Infos: www.nez-allgaeu.de
Am 3. Juni feierte der BUND in Berlin seinen runden Geburtstag – mit politischer Prominenz, vielen Wegbegleiter*innen und verdienten Aktiven.
Es war ein Abend wie gemalt. Pünktlich zum Beginn des Sommers und unserer Veranstaltung zeigte sich das Hauptstadtwetter von seiner schönsten Seite. So konnten sich die zahlreichen Gäste nicht nur im Festsaal der Stadtmission begegnen und austauschen, sondern auch im Hof davor. Und das bis in die laue Nacht hinein.
Vorausgegangen war dem eine Podiumsdiskussion zum Thema »Umweltpolitik in herausfordernden Zeiten«. Wie können wir in einer Zeit der Spaltungsnarrative und
Krisen als Zivilgesellschaft wirksam zusammenarbeiten?

Dabei wurde nicht zuletzt deutlich: Der BUND hat in seiner Geschichte schon viel Gegenwind und schweres Fahrwasser erlebt. Unsere Aktiven aber ließen sich nie davon abbringen, für eine vielfältige Natur und gesunde Umwelt einzutreten.
GLÜCKWÜNSCHE
Kurz vor dem Beginn des Sommerabends hatten sich alle Landesverbände des BUND um eine junge Linde versammelt.
Starthilfe für die junge BUND-Linde
Der Baum wird im kommenden Jahr die neue Bundesgeschäftsstelle in BerlinNeukölln schmücken. Bis dahin soll er wachsen und gedeihen und, wie der BUND auch, aus den Regionen Stärkung erfahren. Jeder Landesverband hatte deshalb eine Handvoll Erde mit nach Berlin gebracht. Die Gäste konnten zudem auf papiernen Lindenblättern Glückwünsche und andere Botschaften platzieren und in die Zweige hängen.

Annabelle, naturstrom-Kundin
Seit 25 Jahren erzeugen und liefern wir Ökoenergie höchster Qualität. Und mit jeder Kilowattstunde Ökostrom und Ökogas von naturstrom fließt ein hoher Förderbeitrag in den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland.
Wechseln Sie jetzt zu Energie mit Zukunft und sichern Sie sich 30 € Zukunftsbonus: www.naturstrom.de/energie25 Jetzt wechseln und 30 € Zukunftsbonus sichern!
„Klimaschutz beginnt bei uns!“

In den 70er Jahren wurden viele BN-Kreisgruppen gegründet. Deshalb haben in diesen Jahren viele Kreisgruppen Grund, dieses schöne Jubiläum zu feiern (wir berichteten). Hier weitere Feste aus ganz Bayern.

Landrat Anton Speer und Bürgermeisterin Elisabeth Koch dankten bei der Jubiläumsfeier der Kreisgruppe GarmischPartenkirchen für die wertvolle Arbeit, die der BN seit 50 Jahren leistet – manchmal unbequem, aber immer konstruktiv. Auch der Bürgermeister von Mittenwald, Ernesto Corongiu, würdigte die Arbeit des BN. Hubert Endthardt überbrachte die Glückwünsche des Fördervereins Nationalpark Ammergebirge. Kreisgruppenvorsitzender Axel Doering und Landesbeauftragter Martin Geilhufe ließen in ihren Reden 50 Jahre Naturschutzarbeit im Landkreis Revue passieren.
Die Kreisgruppe Rhön-Grabfeld feierte im Mai auf dem Hof des Schäfers Josef Kolb, denn es konnte auch das Jubiläum 40 Jahre Rhönschafe gefeiert werden (siehe Regionalseite Unterfranken). Viele Projekte hob die Kreisgruppe schon aus der Taufe und arbeitete dabei auch mit weiteren Akteuren wie dem Bauernverband oder Agrokraft zusammen, so beim BiogasBlühfelder Projekt, das den 1. Preis beim Bundeswettbewerb »Insektenfreundliche Landwirtschaft« erhielt. Ehrenvorsitzender Hubert Weiger (li.) übereichte einen Präsentkorb an den KreisgruppenVorsitzenden Helmut Bär.


Zu einer Exkursion zur Flachmoorwiese der Ortsgruppe Floß bei Hildweinsreuth lud die Kreisgruppe Neustadt a.d. Waldnaab – Weiden ein. Danach blickte Kreisvorsitzender Hans Babl (2. vo. re.) auf die BN-Aktivitäten der zehn Jahre seit dem letzten Jubiläum zurück. Grußworte sprachen Thomas Meiler, Bürgermeister von Flossenbürg, die Landtagsabgeordnete Laura Weber und Hans-Jürgen Gmeiner, der als Stadtrat den Oberbürgermeister von Weiden vertrat. Der BN-Ehrenvorsitzende Hubert Weiger hielt den Festvortrag zur aktuellen Situation des Natur- und Umweltschutzes in Bayern und Deutschland.

Bei der Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Coburg war sogar ein Gründungsmitglied dabei: Robert Reiter feierte mit über 90 Jahren mit. Viele Gäste würdigten die Umweltbildungsarbeit der Gruppe, die Rettung und Pflege der Muggenbacher Tongrube sowie den erfolgreichen Widerstand gegen den geplanten Verkehrslandeplatz bei Wiesenfeld/Neida. Landrat Sebastian Straubel lobte die Aktiven als »grünes Rückgrat unserer Region«, und BN-Landesvorsitzender Richard Mergner und Ehrenvorsitzender Hubert Weiger freuten sich über die große Akzeptanz für die Arbeit des BN.
Fotos: Steffen Jodl, Gabi Fraunholz, Armagan Akinci, Jörg Hacker
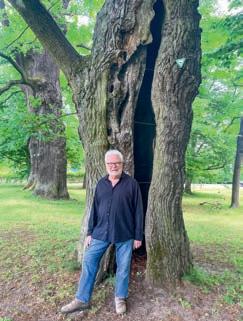
Foto:
Ein heißer Sommertag in Nürnberg. Asphalt, Steine und Mauern sind unangenehm aufgeheizt. Doch oben am Platnersberg, einer Parkanlage im Stadtteil Erlenstegen, ist es angenehm kühl. Alte Eichen breiten ihre Kronen aus, die Sonne wirft goldene Kringel durchs Blätterdach. Ein Lüftchen geht.
Klaus-Peter Murawski steht in der Parkanlage, hält die Hände in den Windhauch und sagt: »Spüren Sie das?« Der Platnersberg sei eine wichtige Kaltluftschneise für die Stadt. »Und die möchte ich erhalten.« Doch das Sozialreferat plant hier ein mehrstöckiges Erweiterungsgebäude für das bestehende Seniorenheim. Murawski und die BN-Kreisgruppe Nürnberg-Stadt wenden sich gegen das Vorhaben und schlagen einen ökologisch sinnvolleren Standort gegenüber dem Platnersberg vor. Denn für das Projekt müssten mindestens 19 alte Eichen gefällt werden.
Murawski geht ein Stück die alte Allee entlang, die einst aus der Stadt hinausführte. Dort stehen sechs mächtige Bäreneichen, rund 300 Jahre alt. »Bei den
In Nürnberg macht sich mit Klaus-Peter Murawski ein ehemaliger Staatsminister für den BN als Kreisgruppenvorsitzender und Baumretter stark.
jetzigen Plänen müssten schwere Baufahrzeuge direkt an diesen Naturdenkmälern vorbei – das würden sie nicht unbeschadet überstehen.«
Nach seinem Rückzug aus der Politik widmete sich Klaus-Peter Murawski dem Naturschutz. Seit 2021 ist er Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Nürnberg-Stadt – ehrenamtlich, engagiert, streitbar. Einst gestaltete er als Chef der Staatskanzlei Baden-Württembergs und als engster politische Vertrauter von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Landespolitik mit, heute ist er Teil der Zivilgesellschaft. Er unterstützt Pflegeaktionen im Stadtgrün, fördert Baumpatenschaften und engagiert sich in Bürgerbegehren. »Mein Altersprojekt«, nennt der 75-Jährige das. Und das hat es in sich: Ob Ausbau des Frankenschnellwegs, geplante Rodungen am Campus oder drohender Verlust von Bannwald: Sein Ziel ist eine klimaresiliente, lebenswerte Stadt.
»Der Klimawandel stellt Städte weltweit vor große Herausforderungen – aber besonders Nürnberg«, sagt er. »Diese Stadt
ist eine der meist versiegelten in Deutschland.« Es brauche daher kluge Anpassungsstrategien. »Der Erhalt alter Bäume ist dabei absolut notwendig.« Sie spenden Schatten und kühlen dadurch, speichern Wasser und bieten Tausenden Arten Lebensraum. Die Idee, alte Bäume durch Jungpflanzen zu ersetzen, hält er für Augenwischerei: »Wenn wir hier erst Temperaturen wie in Sevilla haben, kriegen wir Jungbäume gar nicht mehr hoch.«
Die Bedeutung von Bürgerbeteiligung und Freiheit hat sich früh in Murawskis Leben eingeschrieben. Er wurde 1950 in Erfurt geboren, damals Teil der DDR. Als er zehn Jahre alt war, floh seine Familie in die Bundesrepublik und ließ sich in Franken nieder. Das Engagement fürs Gemeinwohl war ihm stets Richtschnur. Ab 1996 war der Jurist in Stuttgart der erste grüne Bürgermeister. Heute setzt er seinen politischen Weitblick lokal ein – mit kühlem Kopf, im Schatten alter Eichen.
Margarete Moulin

KREISGRUPPE MÜNCHEN
Für den 13. September ruft die Kreisgruppe München des BUND Naturschutz zur Fahrraddemonstration gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) auf.
Im September kommt wieder die vom Verband der Automobilindustrie ausgerichtete Messe nach München, mit glänzenden Karossen, leeren Versprechen und einer Zukunft im Stau. Dagegen wollen die BN-Aktiven anradeln.
Während sich IAA-Aussteller und Fachpublikum auf dem Messegelände treffen, sind gleichzeitig als »Open Space« Veranstaltungen für private Besucher*innen in der Innenstadt zwischen Königsplatz, Marienplatz und Universität geplant. Damit blockiert die IAA zentrale Flächen der Stadt für ein Werbeevent der Autoindustrie, während nachhaltige Mobilität und Klimaschutz auf der Strecke bleiben.
Mit der Demonstration will der BN, wie schon bei der Messe 2023, auf den eklatanten Widerspruch zwischen Worten und Taten seitens Autoindustrie und Politik hinweisen: Während die Klimakrise eskaliert, bleibt eine echte Mobilitätswende aus. Auch wenn sich die Autoindustrie
mit Schlagworten wie »e-Mobilität« ein grünes Mäntelchen übergeworfen hat, ändert dies nichts an der Dominanz des Autos.
Dagegen setzt sich der BN für eine zukunftsfähige Mobilität ein, die auf mehr Verkehr zu Fuß, per Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln setzt. Dabei dürfen auch Menschen auf dem Land, mit kleinem Geldbeutel oder eingeschränkter Mobilität nicht zu kurz kommen.
Die Kreisgruppe ruft daher alle Münchner*innen zur großen Raddemo am Samstagnachmittag, 13. September, auf. Anschließend sind weitere Protestaktionen in der Stadt geplant.
Julika Schreiber (as)
Aktiv werden
Für die Demonstration werden noch Ordner*innen gesucht. Bewerbung an: info@bn-muenchen.de
GESUCHT: Die jährliche Mahd und Pflege der Enzianwiese am Gritschen bei Samerberg findet dieses Jahr am 27. September statt. Dafür sucht die BN-Kreisgruppe Rosenheim noch tatkräftige Helfer*innen. Die magere Streuwiese auf einem Hangquellmoor ist seit den 1970er Jahren im Besitz des BN und wird von diesem gepflegt. Um ihre Vegetation mit stängellosem Enzian (siehe Bild) als Lebensraum für seltene Arten zu erhalten, muss das gemähte Gras zusammengerecht und mit Planen und Schubkarren entfernt werden.
Info: www.rosenheim.bund-naturschutz. de/aktiv-werden

GENUSSVOLL: Am 12. Oktober findet auf dem Traunsteiner Stadtplatz wieder der Apfelmarkt statt, den die BN-Kreisgruppe Traunstein gemeinsam mit der Stadt und dem Landschaftspflegeverband ausrichtet. Heimische Streuobsterzeuger können sich hier präsentieren und ihre regionalen Produkte vermarkten. Am BN-Stand kann man selbst Saft pressen und sich über Streuobstwiesen als Kulturlandschaft und Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten informieren. Info: traunstein.bund-naturschutz.de/ veranstaltungen
Oberbayern: Annemarie Räder
Tel. 01 70/4 04 27 97
annemarie.raeder@bund-naturschutz.de
Julika Schreiber (Region
Tel. 01 70/3 58 18 70
julika.schreiber@bund-naturschutz.de

KREISGRUPPE RHÖN-GRABFELD
Mit dem Rhönschaf hat der BUND Naturschutz eine fast ausgestorbene Rasse gerettet und einen Sympathieträger für das Biosphärenreservat geschaffen.
Dass diese alte Schafrasse erhalten blieb, ist eines der großen Erfolgsprojekte des BN – auch für die artenreichen Wiesen der Rhön, die den Tieren ideale Weiden bieten. Im Mai wurde das 40-jährige Bestehen des Projekts auf dem Biohof Kolb gefeiert.
Initiator war der Zoologe und Naturschützer Professor Gerhard Kneitz, Gründer der Kreisgruppe Würzburg. Er erkannte, dass sich die bedrohte Rasse mit dem schwarzen Kopf und den weißen Beinen sehr gut für die Landschaftspflege in der rauen Rhön eignet.
1985 kaufte der BN 38 Rhönschafe und einen Zuchtbock. Damit startete in den 1980er Jahren das bundesweit erste Naturschutzprojekt durch Beweidung.
Ihren ersten Einsatz hatten die Tiere auf den gerade vom Verband angekauften Gassenwiesen, einer 32 Hektar großen Fläche in der Langen Rhön bei Ginolfs.
Für die Betreuung der Herde konnte der dortige Landwirtschaftsmeister Josef Kolb gewonnen werden – ein Glücksfall für den BN. Heute zählt der von Naturland zertifizierte Biohof der Familie Kolb stolze 500 Mutterschafe, lädt Schulklassen zu Führungen ein und trägt durch die Beweidung vieler Wiesen zum Erhalt der Rhön als »Land der offenen Ferne« bei.
Das Rhönschafprojekt verbindet Tradition und Zukunft und ist ein Werbeträger für das Biosphärenreservat. Ohne diese Schafrasse wäre das Schutzgebiet undenkbar. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BN, war daher beim Jubiläumsfest auf dem Biohof Kolb voll des Lobes: »Das Rhönschafprojekt zeigt, dass scheinbar Unmögliches möglich gemacht werden kann. Aus Kleinem kann Großes werden.«
Steffen Jodl (as)
TOLLE KOOPERATION: Seit fast 30 Jahren sammeln Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Bad Königshofen Spenden für den BN, doch heuer erzielten sie mit fast 7000 Euro ein Rekordergebnis. Die Schule engagiert sich auch seit langem im Amphibienschutzprojekt der Kreisgruppe Rhön-Grabfeld und ist seit 2023 Partnerschule des BN. Im vergangenen Jahr legten die Kinder gemeinsam mit BN-Aktiven eine Blühwiese auf dem Schulgelände an. Aktuell entsteht im Schulgarten gerade ein Sandarium mit Nisthügel (siehe Bild). In dieser künstlich angelegten Sandfläche können bodennistende Insekten, insbesondere Wildbienen und solitäre Wespen, ungestört ihre Nistgänge graben. Weiter ist im Rahmen der Zertifizierung des Gymnasiums als Klimaschule ein Workshop zum Bau von Nisthilfen für Wildbienen geplant, die neben dem Sandarium installiert werden.

AUSSICHTSREICH: In Altertheim im Landkreis Würzburg wurden am 1. Juni zwei Bürgerentscheide gegen das von der Firma Knauf geplante Gipsbergwerk gewonnen. Die Gemeinde muss nun Maßnahmen einleiten, um den Gipsabbau in den Trinkwasserschutzgebieten der Stadt Würzburg und der Gemeinden Waldbrunn und Altertheim zu verhindern. Auch der BN setzt sich intensiv für das Trinkwasser ein und engagiert sich gegen den Abbau in diesem Gebiet (siehe Seite 11).
IHR ANSPRECHPARTNER
Unterfranken: Steffen Jodl Tel. 01 60/5 61 13 41 steffen.jodl@bund-naturschutz.de

KREISGRUPPE ROTTAL-INN
Zwei Wochen lag eine riesige »Kippe« vor dem Veranstaltungszentrum Artrium in Bad Birnbach. Abgelegt hatte sie die dortige Ortsgruppe des BUND Naturschutz.
Mit der Kampagne »Bad Birnbach kippenfrei« im April machten die Naturschützer*innen auf die Gefahren weggeworfener Zigarettenstummel aufmerksam. Die Installation hatten sie sich von der Stadt Burghausen ausgeliehen. Von den rund 5,6 Billionen (!) Filterzigaretten, die jährlich weltweit geraucht werden, landen Schätzungen zufolge etwa zwei Drittel achtlos auf dem Boden. Damit gehören Zigarettenkippen zu den häufigsten Müllarten. Außer Tabakresten und Nikotin enthalten sie eine Vielzahl weiterer Giftstoffe wie Blei, Arsen und Cadmium, Teer und Formaldehyd. Eine einzige Kippe kann bis zu 40 Liter Grundwasser mit diesen Substanzen verunreinigen. In städtischen Gebieten gelangen die Gifte über die Kanalisation in die Gewässer. Die Schadstoffe wirken toxisch auf Mikroorganismen, Pflanzen und Wassertiere.
Der Filter besteht aus dem schwer abbaubaren Kunststoff Celluloseacetat, dessen vollständige Zersetzung in der Umwelt bis zu 15 Jahre dauert und den Boden mit Mikroplastik belastet. Wind und Regen verfrachten die Kippen über große Distanzen auch in sensible Ökosysteme. Viele Tiere verwechseln Zigarettenstummel mit Nahrung und fressen sie, was zu inneren Verletzungen, Vergiftungen oder sogar zum Tod führen kann. Auch Kleinkinder sind gefährdet, wenn sie Kippen in den Mund nehmen.
Um das unterschätzte Kippenproblem in den Griff zu bekommen, wünschen sich die BN-Aktiven mehr Aufklärung und Maßnahmen seitens der Kommunen, fordern aber auch von den Raucher*innen verantworliches Handeln. Denn jede weggeworfene Kippe ist eine zuviel. Horst Blein (as)
AUFGEBLÜHT: Auch in diesem Jahr hat die BN-Ortsgruppe Vilshofen mit einer einfallsreichen Aktion für »Bienenfutter« gesorgt. Im März stellten die BN-Aktiven, wie schon 2024, zwei umgebaute Kaugummi-Automaten im Stadtgebiet auf. Gegen eine 50-Cent-Münze spuckten die knallgelben Kästen eine Kapsel mit Wildblumensamen aus (siehe Bild), ausreichend für etwa einen Quadratmeter, auszusäen im heimischen Garten. Bis zu 40 einjährige Blumenarten waren in der Mischung enthal ten, die von April bis Ende Mai ausge bracht werden muss te, damit die Pflanzen rechtzeitig für die Bie nen blühen konnten. 150 Kapseln wurden verkauft, ein Viertel weniger als im Vorjahr. Helgard Gillitzer, Vorsitzende der Ortsgruppe, führt dies auf die mutwillige Zerstörung eines der beiden Automaten im April zurück und hofft, dass diese im nächsten Jahr verschont bleiben.

GELUNGENER NEUSTART: Nach Jahren der kommissarischen Leitung hat die BN-Ortsgruppe Ergoldsbach-NeufahrnBayerbach im Landkreis Landshut seit April wieder einen gewählten Vorstand. Zur ersten Vorsitzenden wurde die Agraringenieurin Lena Käsbauer bestimmt; ihr Stellvertreter ist Stefan Haschke. Zuvor war die Ortsgruppe kommissarisch von Gerhard Friedrich geleitet worden. Unter dem neuen Führungsteam beteiligte sie sich im Mai am Energietag Neufahrn und beim Rogatemarkt in Ergoldsbach.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Niederbayern: Lena Maly-Wischhof Tel. 0 89/54 83 01 12 lena.maly-wischhof@ bund-naturschutz.de
Von der Erdnuss über Getreide und Gemüse bis zu Baumwolle für Kleidung: Auf den 2000 Quadratmetern wächst, wovon der Mensch lebt.

KREISGRUPPE BAMBERG
Wie viel Ackerfläche steht jedem Menschen auf der Welt zur Verfügung? Der »Weltacker« in der Bamberger Südflur zeigt es: 2000 Quadratmeter – für alles, wovon wir leben.
Ende Juni wurde das Feld als neuer Bildungsort der Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz eröffnet, mit Jasper Jordan von der internationalen Weltackerbewegung, vielen weiteren Gästen und großem Engagement aus der Region. Der Bamberger Weltacker macht globale Zusammenhänge sicht- und erfahrbar: Über 40 weltweit wichtige Ackerkulturen wachsen hier nebeneinander, entsprechend ihrem Anteil an der global genutzten Ackerfläche. Davon gibt es rund 1,6 Milliarden Hektar, die sich die Erdbevölkerung von derzeit acht Milliarden Menschen teilen muss.
Das würde für alle reichen, sofern die Flächen gerecht verteilt und nachhaltig genutzt werden. Hier setzt das Projekt der Kreisgruppe an: Als außerschulischer Lernort bietet es Bildungsangebote für alle Altersgruppen und lädt ein, sich mit Umwelt – und Ernährungsgerechtigkeit auseinanderzusetzen. Wer mag, kann
sich auch praktisch beim Gärtnern betätigen; immer dienstags am späten Nachmittag nach Feierabend.
»Was den Acker ausmacht, sind die Menschen, die ihn mit Leben füllen«, sagt Christine Hertrich, die das Projekt für den BN koordiniert. So haben Kinder beim Weltacker-Camp der Kunstschule Bamberg in den Pfingstferien bunte Schilder, eine Wimpelkette und zwei große Holzstelen für den neuen Lernort des BN entworfen und gestaltet.
Der Bamberger Weltacker ist Teil des weltweiten Weltacker-Netzwerk – ein wachsendes Bündnis von Projekten, das lokale Bildung, nachhaltige Landnutzung und globale Gerechtigkeit auf einem Feld zusammenbringen will.
Jörg Hacker (as)
Mehr Info: www.bamberg. bund-naturschutz.de/weltacker
EIN HERZ FÜR HÖRNCHEN: Wo Weiher verlandet und Amphibien fast verschwunden waren, hat die BN-Ortsgruppe Neunkirchen am Brand neue Vielfalt geschaffen. Unter Leitung von Günter Schulze Vowinkel-Schwedler entstand mit Unterstützung der Gemeinde und des Landratsamtes ein 7500 Quadratmeter großes Biotop. Beim Infotag Mitte Mai wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt. Teiche, Wiesen und Gehölze bieten nun Lebensraum für Libellen, Schmetterlinge – und Eichhörnchen: In einer Voliere werden verwaiste Jungtiere betreut (siehe Bild) und auf die Auswilderung vorbereitet.

AB INS MUSEUM: Das Windrad bei Selbitz, 1995 unter maßgeblicher Initiative der BN-Kreisgruppe Hof errichtet, war das erste und älteste Bürgerwindrad Bayerns. Nun hat das 30 Jahre alte Pioniermodell ausgedient und wurde Ende Mai abgebaut. Es wandert ins Deutsche Museum in München, wo Teile davon ab 2028 in der Dauerausstellung »Energie – Strom« zu sehen sein werden. In Hof gibt es heute mit 113 Windkraftanlagen mehr als in anderen Landkreisen Bayerns. Das Windrad war damals von Ehrenamtlichen um Wolfgang Degelmann, Geschäftsführer der Kreisgruppe, gegen viele Widerstände durchgesetzt worden und ist auch heute noch ein Vorbild für Klimaschutz mit Bürgerbeteiligung.
IHR ANSPRECHPARTNER
Oberfranken: Jörg Hacker Tel. 01 60/7 92 02 67 joerg.hacker@bund-naturschutz.de
Zu viel Gülle aus industrieller Viehhaltung belastet das Grundwasser mit gesundheitsschädlichem Nitrat.

Mit 125 000 Rindern hat der Landkreis Unterallgäu eine der höchsten Viehdichten Bayerns.
Das sorgt für bedenkliche Nitratwerte im Grundwasser.
Nun schlägt der BUND Naturschutz
Alarm: Zahlen des Wasserwirtschaftsamtes Kempten von 2024 zeigen, dass die Nitratbelastung seit Jahren kontinuierlich ansteigt. Immer mehr Messstellen überschreiten den kritischen Grenzwert von 30 Milligramm Nitrat pro Liter. Hauptverursacher sind die vielen industriellen Rinderbetriebe, die ihre Gülle auf die wasserdurchlässigen Böden südlich von Memmingen ausbringen. So befindet sich bei Bad Grönenbach einer der größten Milchviehbetriebe Bayerns; zugleich wird dort Trinkwasser für über 80 000 Menschen gewonnen. »Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, werden wir in Zukunft ernsthafte Probleme mit dem Trinkwasser bekommen«, fürchtet Konrad Lichtenauer, Vorsitzender der dortigen BN-Ortsgruppe.
Zu viel Nitrat im Trinkwasser ist für Säuglinge gesundheitsgefährdend. Auch
bei Erwachsenen können dadurch krebserregende Verbindungen im Körper entstehen. Besorgt blicken die BN-Aktiven daher auf die europäische Agrarpolitik: Bislang müssen landwirtschaftliche Förderprogramme zur Einhaltung der Nitratrichtline beitragen. Dies soll nun abgeschafft werden – schon für die laufende Förderperiode. »Die Folgen für unser Trinkwasser wären dramatisch«, so BNAgrarreferentin Rita Rott.
Der BN fordert, die Tierhaltung zu extensivieren und die EU-Düngemittelverordnung so zu verändern, dass sie die tatsächlichen Nitratquellen, wie eine regional zu hohe Viehdichte, berücksichtigt. Weiter sollten Düngeverfahren optimiert, mehr Grünland gefördert und das Wasserschutzgebiet um die Trinkwasserbrunnen im Unterallgäu erweitert werden.
Thomas Frey (as)
BEKLAGENSWERT: Der Kampf gegen den autobahngleichen Ausbau der Bundesstraße 12 zwischen Buchloe und Kempten geht weiter. Nachdem der BN 2022 gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt hatte, weil Klima- und Flächenschutz nicht berücksichtigt waren, führte die Regierung von Schwaben ab 2024 ein ergänzendes Verfahren durch, das im Juni abgeschlossen wurde. Ergebnis: Das Projekt wirkt sich zwar negativ auf Klima und Flächenverbrauch aus, wird aber nicht geändert. Der BN will weiter auf juristischem Weg den geplanten Maximalausbau der B 12 verhindern, zugunsten des Klima- und Flächenschutzes.

VERBESSERT: Im vergangenen Winter haben 20 Aktive der BN-Kreisgruppe Dillingen in zwei Aktionen rund 650 Schwarzerlen angepflanzt – Restbestände einer Baumschule, die sie dem BN für den Naturschutz gespendet hatte. Die Bäumchen stehen nun an drei Bächen in der Gemeinde Bissingen, wo sie die Gewässerstruktur verbessern sollen. Bisher waren die Bachkanten nur gemulcht worden. Dagegen sorgen die Erlen für Struktur im Uferbereich und kühlenden Schatten –wichtig in Zeiten der Klimakrise. Von Verschattung und Strukturreichtum profitieren nicht nur Fische, sondern auch streng geschützte Steinkrebse und Bachmuscheln.
IHR ANSPRECHPARTNER
Schwaben: Thomas Frey Tel. 0 89/54 82 98-64 thomas.frey@bund-naturschutz.de
Die vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) bedroht nährstoffarme Biotope wie hier am Schlossberg bei Kemnath.

Die vielblättrige Lupine mit ihren blauen Blüten ist vielerorts in der nördlichen Oberpfalz zu sehen. Doch die Pflanze ist invasiv und verdrängt seltene und bedrohte Arten.
Um die Ausbreitung der aus Nordamerika stammenden Art einzudämmen, waren Aktive der Kreisgruppe Tirschenreuth des BUND Naturschutz Anfang Juni in einem wichtigen Biotop bei Kemnath im Einsatz. Die Leguminosenart bindet Stickstoff aus der Luft und reichert so den Boden mit Nährstoffen an. In der Landwirtschaft ist diese Düngung erwünscht, sie wirkt sich aber negativ aus auf Biotope, die mageren Boden brauchen. So auch auf der Basaltkuppe des Waldecker Schlossbergs bei Kemnath mit ihren geschützten, artenreichen Flachland-Mähwiesen: Deren Pflanzenarten, darunter Ackerwitwenblume, Frauenmantel und Knabenkraut, gedeihen am besten auf nährstoffarmen Standorten.
Um die Biotope zu erhalten, entfernten Ehrenamtliche der Kreisgruppe gemein-
sam mit Aktiven des Naturparks Steinwald die invasiven Lupinen. Unterstützt wurden sie von Freiwilligen der Firma Siemens Healthineers aus Kemnath. »Wichtig ist, die Pflanze vor der Samenreife zu entfernen, damit sie sich nicht weiter vermehren kann«, so Uli Roth und Erwin Möhrlein vom BN Tirschenreuth.
Den Naturschützer*innen ist bewusst, dass sie die Verbreitung der auch Staudenlupine genannten Art durch ihre Arbeit allein nicht aufhalten. Daher konzentrieren sie sich auf wertvolle und für bedrohte Arten wichtige Biotope wie die Wiesen am Waldecker Schlossberg. Mit Erfolg: Auf Flächen, die schon in früheren Aktionen von der Lupine befreit worden waren, gelang es, die ursprüngliche Artenvielfalt zu erhalten.
Reinhard Scheuerlein (as)
SITZUNG IM GRÜNEN: Statt in den Sitzungssaal ging es Ende Mai raus in die Natur für den Vorstand der BN-Kreisgruppe Amberg-Sulzbach. Die Mitglieder besuchten BN-Grundstücke, die Hotspots der Artenvielfalt sind, planten vor Ort deren Pflege und tauschten sich über neue Projekte aus.
WEITERBETRIEB: Mit alten FotovoltaikAnlagen befasste sich im Mai eine Veranstaltung der BN-Kreisgruppe Neustadt a.d. Waldnaab-Weiden und des EnergieTechnologischen Zentrums (etz) Nordoberpfalz. Über 50 Interessierte erfuhren, wie sich vorhandene Module am besten weiter betreiben lassen, was bei Leistungsverlust zu tun ist und wie die Umstellung auf eine Eigenverbrauchsanlage gelingt. Info: www.etz-nordoberpfalz.de
NACHRUF: Im Alter von 91 Jahren ist Pfarrer Leo Feichtmeier Ende Mai in Nittenau gestorben. Als Gegner der geplanten atomaren Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf war der Seelsorger in den 1980er Jahren weit über die Grenzen des Landkreises Schwandorf bekannt. Unvergessen sind die Andachten, die er am Franziskus-Marterl im Taxöldener Forst organisierte. Von dort aus starteten die Protestmärsche gegen die geplante Anlage. Dieses Bauprojekt zu verhindern, wurde für Leo Feichtmeier zur – letztlich erfolgreichen – Lebensaufgabe. Der BUND Naturschutz wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

IHR ANSPRECHPARTNER
Oberpfalz: Reinhard Scheuerlein Tel. 09 11/8 18 78-13 reinhard.scheuerlein@ bund-naturschutz.de
Der Aischgrund mit dem Naturschutzgebiet Ziegenanger ist Heimat für den bedrohten Kiebitz.



KREISGRUPPE HÖCHSTADT-HERZOGENAURACH
Mitten im Aischgrund soll bei Neuhaus ein Wellness-Hotel entstehen. Dabei liegt hier das zweitgrößte Kiebitz-Brutgebiet Nordbayerns.
Beim Ratsbegehren Ende Juni stimmte eine Mehrheit der Bürger*innen für die Fortführung des umstrittenen Bauprojekts der Gastronomenfamilie Wirth. Trotz alternativer Flächen will diese das Hotel ausgerechnet am kritischsten Standort errichten. Der BUND Naturschutz prüft nun rechtliche Schritte. Es droht ein massiver Eingriff in den sensiblen Naturraum des Aischgrunds um den Adelsdorfer Ortsteil Neuhaus: Das Projekt betrifft das Naturschutzgebiet Ziegenanger, dessen umliegende Pufferflächen und angrenzende europäische Schutzgebiete – letzte Lebensräume für viele seltene und gefährdete Arten und unverzichtbar für den Erhalt der Biodiversität.
»Nicht der Abstand zum Schutzgebiet ist entscheidend, sondern der zusätzliche Stördruck durch wechselnde Gäste und mehr Verkehr«, warnt Helmut König, bis
vor wenigen Wochen Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach. »Mit dem Hotel droht der Verlust eines der letzten Wiesenbrütergebiete Nordbayerns und weiterer wertvoller Lebensräume.«
Auch die Naturschutzbehörden im Landratsamt und bei der Regierung von Mittelfranken stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber. Zudem besteht die Gefahr, dass der Hotelbau einen Präzedenzfall für weitere Zersiedelung im Außenbereich schafft – entgegen den Zielen des Landesentwicklungsplans, den Flächenverbrauch zu begrenzen. Der BN wird sich weiterhin mit aller Kraft für den Schutz des Aischgrunds einsetzen. Der Verband will nun alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um das Hotel dort zu verhindern, zumal es ortsnahe Standorte gibt, die weit weniger problematisch für die Natur sind. Jonas Kaufmann (as)
NEUWAHLEN: In den BN-Kreisgruppen Weißenburg-Gunzenhausen und Höchstadt-Herzogenaurach wurde dieses Jahr bei den Jahreshauptversammlungen im Mai jeweils der Vorstand neu gewählt. Marlies Liepelt ist neue Erste Vorsitzende und Christoph Recher neuer Zweiter Vorsitzender in Höchstadt-Herzogenaurach. Liepelt folgt auf Helmut König, der nicht mehr kandidiert hatte. In WeißenburgGunzenhausen fiel die Wahl auf Stefan Ballak als Ersten Vorsitzenden und Utz Löffler als Stellvertreter (Bild – li. u. re.).
Die ehemalige Vorsitzende Brigitte Löffler war nicht mehr angetreten (Bild – Mitte).

NEUPLANUNG: In die Debatte um die neue Stromtrasse als Ersatz der bisherigen Juraleitung (siehe N+U 4/24) ist Bewegung gekommen: Die Regierung von Mittelfranken forderte im Mai den Netzbetreiber Tennet auf, neben der vom BN abgelehnten »Vorzugstrasse« durch den Nürnberger Süden auch Alternativen, etwa südlich von Schwabach, detailliert zu prüfen. Positiv ist, dass damit die Trassenführung wieder offen ist. Allerdings müssen die dadurch entstehenden großräumigen Umplanungen aus Sicht des Naturschutzes bewertet werden. Sobald die neuen Planunterlagen Ende dieses Jahres öffentlich verfügbar sind, wird der BN mögliche Einwendungen prüfen. Erörterungstermine sind für Sommer 2026 geplant.
IHR ANSPRECHPARTNER
Mittelfranken: Jonas Kaufmann Tel. 01 60/7 75 18 31 jonas.kaufmann@bund-naturschutz.de

JUNGE SEITE
dafür sorgen, dass an ihrer Schule bald der Müll getrennt wird. Jonte (17) organisiert Workshops, um Kondomautomaten in Spender von Wildblumensamen zu verwandeln. Und in Ludwigshafen bauen Kinder hinter einem Jugendzentrum Biogemüse an, wo einst Betonplatten lagen. Nur drei von rund 150 Projekten, die im vergangenen Jahr unterstützt werden konnten. Nun seid ihr am Zug!
Gemeinsam lässt sich mehr bewegen: Mit BUNDjugend, Naturfreundejugend und NAJU ziehen drei große Jugendumweltverbände an einem Strang. Kern von Handeln JETZT! ist der »Young Impact Fund«. Der stellt jungen Menschen mit etwas Glück unkompliziert 300 Euro bereit.
UNBÜROKRATISCH
Wie das funktioniert? Ein Team aus mindestens zwei Personen unter 27 Jahren –ein paar Freund*innen, aber auch AGs, Jugendclubs oder Schulklassen – bewirbt sich online mit einer Idee. »Im Fokus steht der Schutz der biologischen Vielfalt. Doch der kann auch über eine Klima-Aktion oder sonst ein Umweltvorhaben verwirklicht
Ihr habt eine Aktionsidee, braucht aber Geld, um sie umzusetzen? Mit dem Projekt
»Handeln JETZT!« unterstützt euch die BUNDjugend – ganz unkompliziert.
werden«, erklärt Anne Nemack, Referentin der BUNDjugend. Per Chat, Videocall oder Telefonat werden offene Fragen beseitigt. Regionale Jurys aus Ehrenamtlichen wählen im Anschluss die geförderten Projekte aus. Zur Dokumentation sind dann keine Belege nötig, dafür reichen Fotos oder Videos und ein kurzer Projektbericht. »Also alles ganz unbürokratisch«, so Anne Nemack, »es soll eine Initialzündung sein, damit sich junge Leute ohne Riesenaufwand engagieren können.« Der Erfolg gibt ihr Recht: Im ersten Jahr wurden fast 150 Ideen gefördert. Die Auswahl fiel dem Team nicht leicht, es gab drei Mal mehr Einsendungen, als das Budget hergab. Das Besondere: In zwölf deutschen Regionen gibt es Ansprechpersonen für das Projekt. Pro Region können mehrere Ideen gefördert werden. Und das noch bis zum Jahr 2029.

BUDDYS HELFEN
Einen veganen Kochabend mit geflüchteten Jugendlichen veranstalten? Im Dorf einen Lehmhügel für Wildbienen bauen? Den Dreck anderer Leute wegräumen und aus einem Waldstück den Müll sammeln? Oder als Alternative zu Fast Fashion eine Kleidertauschparty mit Disco organisieren? All das wurde schon umgesetzt. Wer will, bekommt dabei Unterstützung von Projektbuddys. Das sind 18- bis 27-Jährige, die sich schon länger für den Natur- und Klimaschutz engagieren und ihre Erfahrung weitergeben wollen. Als Buddy kann man projektfinanziert an bis zu


drei Seminarwochenenden teilnehmen. Zudem gibt es für sechs Monate ein Deutschlandticket: So lassen sich die Projektgruppen bei Bedarf besuchen und vor Ort begleiten.
Die bisherige Bilanz kann sich wirklich sehen lassen. So hat ein gutes Dutzend Kieler Schüler*innen eine Umwelt-AG gebildet. Für ein selbst entwickeltes OnlineMagazin recherchieren sie Themen wie Abfall und Artenvielfalt, Geschichte und Politik – und führen Interviews mit Prominenten. Die AG hat zudem erreicht, dass alle von der Stadt betreuten internetfähigen Geräte statt Google die nachhaltigere Suchmaschine Ecosia nutzen.
In Schleswig-Holstein möchte Koumba Kamano, dass an ihrer Schule der Müll getrennt wird. »Im Moment steht in jedem Klassenzimmer nur ein Mülleimer, in dem alles landet«, erzählt die 16-Jährige. An ihrer Gemeinschaftsschule Kronshagen sollen Plastik, Papier und Restmüll bald in separate Behälter kommen, um ein Recycling zu ermöglichen. In jeder Klasse hat sie ihren Plan schon präsentiert und Hinweisschilder verteilt. Mal sehen, ob alle Beteiligten im neuen Schuljahr mitziehen.


Anderswo sprießt nun frisches Grün. Hinter dem Ludwigshafener Ernst-Kern-Haus, einem Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, wurde ein Gemüsegarten angelegt. »Gummistiefel, Gartengeräte, Material für das Hochbeet, Anzuchtboxen, Saatgut: Dank der Förderung konnten wir das Projekt anschieben«, freut sich Betreuerin Katharina Ceesay.
Hier können auch Kinder mitmachen, die sonst wenige Möglichkeiten haben. »Am engagiertesten sind die Förderschüler. Die schnappen sich den Spaten, haben Spaß und sind nicht zimperlich, wenn ihre Klamotten dreckig werden.«
Auch in Bönen im Landkreis Unna wird inzwischen geerntet, von der Garten-AG der Humboldt-Realschule. »Die Kinder sind total begeistert: Hier sehen viele zum ersten Mal, wie schnell Gemüse wächst«, sagt Lehrerin Dörte Plewka. Der Garten wird auch für den Unterricht genutzt, etwa um zu erklären, warum Bio-Tomaten aus der Region besser für die biologische Vielfalt und das Klima sind. Und: Hier darf immer genascht werden.
Damit alles, was blüht, auch bestäubt wird, organisiert der 17-jährige HobbyImker Jonte Mai aus Bremen bundesweit Workshops. In Berlin ließ er – gefördert von Handeln JETZT! – einen Kondomautomaten zum Samenspender (!) umbauen. Der gibt nun an einer Grundschule Samen von bis zu 60 heimischen Wildblumen aus. Blühen die erst einmal, ist das nicht nur schön bunt, sondern bietet Hummeln & Co auch reichlich Nektar und Pollen.
Helge Bendl
Aktiv werden
Was ist euer Projekt? Nächster Einsendeschluss für Ideen ist der 30. November. Die Förderung beträgt 300 €. Mitmachen können Gruppen ab zwei Menschen unter 27 Jahren. Den Antrag stellt ihr online, das Geld gibt es nach der Entscheidung der Jury schnell und ohne Papierkram. Alle Infos: www.handeln-jetzt.org Handeln JETZT! wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz und Bundesumweltministerium.


Alina aus dem Bundesvorstand der BUNDjugend ist nach Nizza gereist, um mit Regierungsvertreter*innen, NGOs und Journalist*innen aus aller Welt zu diskutieren – über Hochseeabkommen, Tiefseebergbau oder die biologische Vielfalt »beyond national Jurisdiction«. Als Jugenddelegierte Zugang zu solchen Veranstaltungen zu erhalten, ist wichtig. Denn wir machen klar: Klimaschutz ist Meeresschutz!

Auch im Bundesamt für Naturschutz haben wir in diesem Sommer unsere Perspektive eingebracht. Karola und Robert vom Bundesvorstand führten Gespräche über Jugendbeteiligung, Angriffe von rechts und Gesetze für eine nachhaltige Landwirtschaft.
Sei mit dabei vom 19. bis 21. September im sächsischen Bielatal. Triff dich hier mit Aktiven der BUNDjugend aus ganz Deutschland. Das Programm wird genauso toll wie die Teilnehmenden! Mehr unter www.bundjugend.de/ veranstaltungen/bundesweitesaktiventreffen
instagram.com/bundjugend bundjugend.bsky.social facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband
Immer häufiger kommt es in unseren Breiten zu langen Trockenphasen. Das bedeutet Stress für die Natur. Wie können wir gegensteuern, im Garten und in der Kommune?

CORINNA HÖLZEL ist die Gartenexpertin des BUND.
Bleibt der Regen aus, fehlt es Pflanzen wie Tieren an Wasser. Etwas Abhilfe für Insekten, Frösche, Vögel oder Säugetiere kann dann ein Gartenteich schaffen. Oder schon eine Wasserschale, die Sie am besten jeden Tag reinigen. Wie aber lässt sich ein Garten als Ganzes oder eine Gemeinde an die vermehrte Trockenheit anpassen?
Pflanzen Sie erstens traditionelle und widerstandsfähige Stauden. Mannstreu, Glockenblumen, Astern oder Natternkopf sind pflegeleicht, müssen nicht bewässert werden und bieten Pollen und Nektar für Wildbienen und Schmetterlinge.
Bedecken Sie den Boden, indem Sie ihn bepflanzen oder mulchen. Das senkt die Verdunstung und schützt die Struktur des Bodens. Laub- und Komposthaufen oder ein dichtes Gebüsch verhelfen Tieren zu Feuchtigkeit und Schatten.
Begrünen können Sie auch Dächer und Fassaden. So schaffen Sie neue Lebensräume und sorgen für Verdunstungskühle. Und denken Sie darüber nach, Innenhöfe, Parkplätze oder die Einfahrt auf Ihrem Grundstück zu entsiegeln und dann zu begrünen.

Baumscheiben am Straßenrand können Sie ebenfalls bepflanzen, um ihren Boden feucht zu halten. Die hierfür oft nötige Erlaubnis des Grünflächenamts ist meist nur eine Formalie.
RICHTIG GIE SS EN
Regnet es über Tage oder gar Wochen zu wenig, sollten Sie gießen – nicht nur Ihre Beete, sondern auch junge Bäume (bis etwa zehn Jahre nach der Pflanzung) und Straßenbäume. Besser als Leitungswasser eignet sich dafür Regenwasser. Sammeln Sie dieses in Tonnen oder Zisternen.
Gießen Sie möglichst am frühen Morgen, dann verdunstet weniger Wasser als in der Mittagshitze. Abendliches Gießen lockt dagegen Schnecken an. Bewässern Sie gezielt den Wurzelbereich, Gießmulden oder Gießringe sind hier hilfreich.
Und gießen Sie eher selten, aber dann reichlich. Das gilt in langen Trockenphasen besonders für Bäume – ob im Garten oder an der Straße.
Die Grundregel: Spenden Sie vor allem frisch gepflanzten Bäumen alle paar Tage etwa 80 bis 100 Liter auf einmal (also 8 bis 10 Gießkannen). So dringt das Wasser bis in die Wurzeln und fördert ihr Tiefenwachstum. Gießringe sind sinnvoller als ein Gießsack, der das Wasser nur langsam abgibt (und dennoch besser ist als gar nichts). Und vermeiden Sie Hochbeete
oder Erdaufschüttungen um den Stamm, weil dem Baum sonst Fäulnis droht.
Mit dem Leitbild der Schwammstadt reagieren Kommunen auf die Folgen der Klimakrise. Im Hinblick auf häufigere Dürrezeiten, aber auch Starkregen zielen sie darauf, mehr Wasser zu speichern und lokal versickern zu lassen. Dazu gehört ein gutes Management des Regenwassers. Es sollte möglichst dezentral verdunsten oder versickern, gespeichert und genutzt werden. Das entlastet die Kanalisation und schützt Gewässer davor, bei starkem Regen durch Schmutzwasser verunreinigt zu werden.
Eine Schwammstadt bietet mehr Platz für Bäume. Deren Wurzelraum sollte so groß wie möglich sein, damit sie gut wachsen und Trockenphasen überstehen. Und: je mehr Bäume, desto besser! Was im Garten hilft, gilt auch im großen Maßstab: Indem wir urbane Räume entsiegeln und begrünen, verbessern wir das Mikroklima, speichern das Wasser und schaffen neuen Lebensraum. Und wappnen uns so gegen künftige Dürrezeiten.
www.bund.net/garten
www.bund.net/stadtnatur

















BJV WILL »JAGD VOR WALD«
Zum Beitrag »Defizite bei Jagd« in N+U 2/2025
Im vergangenen Herbst brachten die bayernweit durchgeführten »Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung« erneut zu Tage, dass die Bestände von Reh-, Rot- und Gamswild auf der Hälfte (!) der bayerischen Wälder so hoch sind, dass ein gesunder Mischwald nicht, wie vom Jagdgesetz gefordert, »im Wesentlichen ohne Schutz aufwachsen« kann. Aber anstatt Besserung zu geloben, will der Bayerische Jagdverband (BJV) die Gesetzesgrundlagen zum Schutz unserer Wälder und der Waldbesitzer so ändern, dass das jahrzehntelange jagdliche Versagen nicht mehr publik wird. Denn obwohl es die Vegetationsgutachten seit 1986 gibt, stagniert nach anfänglich guten Fortschritten die Verbissbelastung vielerorts auf einem untragbar hohen Niveau. Der Schaden dieses jagdlichen Totalversagens ist enorm: So kann kein zukunftsfähiger Mischwald, den wir gerade im Klimawandel dringender denn je brauchen, heranwachsen!
Die Zeche zahlen die Waldbesitzer und Steuerzahler, die statt der möglichen kostenlosen Naturverjüngung teure Pflanzungen und Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss zwischen 10 000 und 30 000 Euro pro Hektar finanzieren müssen – ein Vielfaches der jährlichen Jagdpachteinnahmen von drei bis fünf Euro/Hektar. Was unterschlagen wird: Nicht nur im Art. 14 GG ist der Schutz des Eigentums garantiert, speziell im Artikel 1 des Bayerischen Jagdgesetzes heißt es , dass dieses Gesetz (unter anderem) dazu dienen soll, »Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild möglichst zu vermeiden, insbesondere soll die Bejagung die natürliche Verjüngung der standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen«.
»Wald vor Wild« heißt nichts anderes, als die Verwirklichung dieser Grundsätze! Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, hier ein gesunder Wald, muss vor den jagdlichen Interessen stehen! Dazu muss man wissen, dass zum Beispiel von den überall in Bayern vorkommenden Rehen jährlich mehr als
Wir freuen uns auf Ihre Meinung
BN-Magazin »Natur+Umwelt«, Pettenkoferstr. 10a, 80336 München oder an natur-umwelt@bund-naturschutz.de Leserbriefe können gekürzt werden. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
Das Blattwerk rauscht, wenn der Wind weht, doch fest die Eiche im Sturm steht. Sie ist jetzt 100 Jahre alt und ist der schönste Baum am Wald. Massiv der Stamm, die Äste krumm, und ist es windstill, ist er stumm, der Baum, Symbol der Festigkeit in unsrer doch bewegten Zeit.

Drum zieht’s mich gerne zu ihm hin, denn immer, wenn ich bei ihm bin, gibt er mir Ruhe, Schutz und Sinn, weil ich ein schwacher Mensch doch bin.
Von unserem Mitglied Joachim Kokula
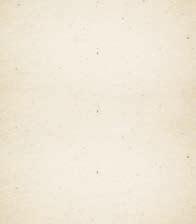
360 000 Stück (!) erlegt werden. Diese Tierart ist genauso wenig wie Rot- und Gamswild gefährdet, Tanne, Eiche und Edellaubbäume aber schon. Diese Tatsachen sollen aber nach dem Willen des BJV unter den Teppich gekehrt werden. Dem BJV geht es weder um Tierschutz noch um die Eigenverantwortung der Waldbesitzer, sondern im Sinne eines neofeudalistischen Jagdverständnisses um »Jagd vor Wald«!
Alfons Leitenbacher, Nußdorf
ERNÄHRUNGSWENDE
SELBER MACHEN
Zum Titelthema
Bundestagswahl in N+U 1/2025 Insekten und deren Nahrungspflanzen werden durch den Einsatz von giftigen Spritzmitteln wie Glyphosat beeinträch tigt bzw. vernichtet, auch unser Grundwasser wird dadurch belastet. Die Herstellung von Kunstdünger verursacht erhebliche CO2-Emissionen. Das gilt auch für die Verfütterung von Soja (Urwaldrodung, Transport) und nicht zuletzt für den Verzehr von Fleisch, Wurst und Käse. Beim Verzehr von Biolebensmitteln verringern sich die Umweltschäden erheblich, die Artenvielfalt bleibt weitgehend erhalten. Erfahrungsgemäß werden regional erzeugte Lebensmittel oft mit Bio-Lebensmitteln verwechselt. Zu Unrecht, denn nur bio-zertifizierte Lebensmittel haben einen ökologischen und qualitativen Vorteil. Insbesondere schützt der Begriff »regional erzeugt« nicht vor der Behandlung mit Pestiziden.

Franz Amann, Hirschaid : stock adobe.com – M
Da die Bundesregierung hier keine grundlegenden Maßnahmen geplant hat, bitte ich Sie, alles zu tun, damit durch Ihren gesünderen, ökologischen Nahrungsverzehr weiteres Artensterben verhindert wird. Ihre Ernährungswende schont Tiere, Natur und Umwelt und gibt Ihnen persönlich ein gutes Gefühl.

BRENNENDE ERDE
Eine Geschichte der letzten 500 Jahre Sunil Amrith
2025, 505 Seiten, 34 Euro, Verlag C. H. Beck
Aufrüttelnd
»Brennende Erde« ist eine fesselnde Globalgeschichte der letzten 500 Jahre. Sunil Amrith beleuchtet darin das komplexe Verhältnis von Mensch und Umwelt. Meisterhaft verwebt der Historiker die Geschichte von Imperien, technologischem Fortschritt und menschlichem Freiheitsstreben mit den ökologischen Konsequenzen. Sein Buch zeigt, wie die Jagd nach Profit und Ressourcen den Planeten tiefgreifend veränderte und Ökosysteme an den Rand des Kollapses brachte.
Aufrüttelnd erzählt er über Genozide und Ökozide und das langsame Erwachen eines Umweltbewusstseins. Amrith argumentiert überzeugend, dass wir unsere Geschichte neu bewerten müssen, um die Erde zu retten. Sein brillant geschriebenes Werk regt dazu an, unser Verhältnis zur Natur zu überdenken – und ist unverzichtbar, um die Wurzeln unserer heutigen Umweltkrisen zu verstehen.

WILDGEHÖLZE
Heimische Gehölze für Gärten und andere Freiflächen
Reinhard Witt, Katrin Kaltofen
2025, 624 Seiten, 1143 Fotos, 69,95 Euro, Naturgarten-Verlag
Für naturnahe Gärten
In diesem Buch stecken nicht nur jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit heimischen Pflanzen, sondern auch Faszination und Liebe zur Natur. Reinhard Witt und Katrin Kaltofen gehen der Frage nach, was »heimisch« eigentlich bedeutet und wie aus exotischen Pflanzen für den Garten invasive Arten werden können.
Ein großer Praxisteil beantwortet Fragen rund um die Anlage und Pflege von Gehölzen im Garten: Soll man den Heckenschnitt kleinhäckseln oder liegen lassen? Welche Pflanzgröße ist die beste? Viele, viele Artenporträts bieten für jeden Garten, jeden Standort und jeden Geschmack das passende Gehölz.
Eine fundierte Entscheidungshilfe für alle, die ihren Garten naturnah gestalten wollen. Zahllose Wildbienen, Schmetterlinge, Vögel und andere Arten werden davon profitieren.
5. – 11. Oktober 2025, Österreich
Das Salzburger Saalachtal vereint wilde Natur mit sanfter Schönheit – rauschende Klammen, die Loferer Steinberge und blühende Almwiesen prägen das Landschaftsbild. Im Herbst fasziniert die goldene Laubfärbung vor vielleicht schon schneebedeckten Gipfeln. Abgerundet wird die Reise durch spannende Einblicke in die Almwirtschaft und Pinzgauer Spezialitäten.

5. – 11. Oktober 2025, Italien

6. – 16. Oktober 2025, Spanien
Von der märchenhaft gelegenen Lyfi-Alm aus erkunden die Reisenden mit einem ehemaligen Förster und Nationalparkranger den Nationalpark Stilfserjoch. Es warten Wasserfälle, Blicke auf die umliegenden Dreitausender und vielleicht auch Bartgeier. Zudem können die Wanderer das einzigartige Naturschauspiel der Hirschbrunft beobachten.

In den Picos de Europa warten Felswände, Gletscherseen und hohe Gipfel auf die Reisenden. Weiter geht es ins Naturreservat Muniellos, den »Amazonas« Asturiens, mit seinem Mischwald und einer artenreichen Tierwelt. An der Costa Verde entdecken die Reisenden Dinosaurierspuren und beobachten die »bufones«, aus denen das Meerwasser fontänenartig aufsteigt.
Weitere Informationen Tel. 09 11/588 88 20· www.bund-reisen.de
Ab Oktober in unserem Shop erhältlich

Sonnenglas • H 18 cm.
Nr. 33 088 39,99 €
Sonnenglas mini • H 10,5 cm. Nr. 33 170 34,99 €
Futterfeder für Meisenknödel • Einfach zu befüllen, Wildvögel finden guten Halt, und es bleibt kein Netz im Baum zurück. Ohne Knödel. Nr. 66 075 8,50 €


Vogelstimmenuhr • Bei dieser Uhr singt jede Stunde ein anderer Vogel. Ø 34 cm. Nr. 21 628 89,90 €

Wildbienenhaus CeraNatur ® • Für die am häufigsten vorkommenden Solitär-Insekten.
H 18 x B 11,5 x L 5 cm, 1,8 kg. Nr. 22 292 39,90 €

Futterhaus Granicium® • Ideal zur Vogelbeobachtung durch die transparente Konstruktion. Die Vögel haben einen freien Blick auf mögliche Feinde. Ø 37 cm, H 15 cm, 4,7 kg. Nr. 84 073 139,90 €

BIO Energie-Knödel
30er-Karton
Nr. 66 063 22,99 €
30er-Karton, schalenfrei
Nr. 66 067 25,29 €

Apfelstiege Nr. 23 527 32,90 € Deckel Nr. 23 528 16,90 €
Lenkrollenstiege Nr. 23 529 46,90 €
Komplettpaket (4 Stiegen) Nr. 23 544 148,50 €

Schmelzfeuer Indoor CeraNatur ® Nr. 22 126 69,90 € Deckel Indoor CeraNatur ® (ohne Abb.)
Nr. 22 127 21,90 €

Igel-Schnecke • Ganzjahresquartier für Igel aus klimaausgleichender Keramik, in Schneckenform zum Schutz vor Fressfeinden. Ø 35 cm, H 16 cm, 4,5 kg. Nr. 66 021

Bio-Apfelbäume • Alte Obstsorten werden von den meisten Allergiker*innen gut vertragen: ihre Polyphenole schalten das Apfelallergen aus. Drei Jahre alte Apfelbäume aus einer hessischen Baumschule (wurzelnackt, 3 bis 4-jährig, Anleitung, Pfahl und Strick inkl.).
Alter Gravensteiner Nr. 29 007
Gelber Richard Nr. 29 002
Signe Tillisch Nr. 29 005
Holsteiner Cox Nr. 86 006
Berner Rosenapfel Nr. 86 014 je 69,90 €
Bienenbeutel • Krokusse, Traubenhyazinthen und Tulpen blühen bereits sehr früh im Jahr – recht zeitig für die ersten Bienen auf Nahrungssuche. 40 Stück.
Nr. 10 489 17,95 €
Wieder im Sortiment: Blumenzwiebeln aus ökologischem Anbau. Lieferung ab Mitte September.


Tulpenmischung
Nr. 10 490
€ Krokusmischung (ohne Abb.)
Nr. 10 491
€

Stapelstiegen • Optimale Lagerung von Obst und Gemüse – stapeln Sie mehrere Kisten zu einem Regal. Regionales Fichtenholz. ca. B 48 x H 29 x T 33 cm, inkl. Griff. Nr. 33 194 32,90 €

Gartenbank Cansa 3-Sitzer Aus robustem FSC ® -Robinienholz, Metallteile rostfrei. Einfach setzen und genießen.
Nr. 83 038 699,00 €
2-Sitzer (ohne Abb.)
Nr. 83 074 579,00 €

Guppyfriend Waschbeutel • Verhindert, dass Mikroplastikfasern aus unserer Kleidung in Flüsse und Meere gelangen. Ausführliche Anleitung im Shop. 50 x 74 cm. Nr. 22 639 29,75 €

Klimahandtuch • Zeigt die Jahresdurchschnittstemperaturen von 1850 bis heute. Ein Teil der Erlöse kommt Klimaschutz-Projekten zugute. Aus 100 %-zertifizierter GOTS Bio-Baumwolle, hergestellt in Portugal. 180 x 100 cm. Nr. 80 053 55,00 €

Vogelschutz-Markierung • Ein hochwirksamer Schutz gegen Vogelschlag: Die reflektierenden Aufkleber-Punkte auf dem Fensterglas werden von Vögeln erkannt. 25 m Lauflänge für ca. 2,5 qm, 50 m Lauflänge für ca. 5 qm Fensterfläche.
25 Meter Nr. 22 400 54,00 €

Lunchbox Yogi 800 ml • Optimale Box für die Kita oder Schule, BPA-frei und auslaufsicher in kompakter Größe.
B 16 x T 12 x H 6 cm.
Nr. 33 177
29,95 €


Reisehandtuch • Nicht aus Plastik und trotzdem gut zu verstauen. Hergestellt in Portugal, aus 80 % Bio-Baumwolle, 20 % Leinen. 70 x 140 cm Nr. 80 055 35,00 €

Gießspitze aus Ton – 4 Stück • Fahren Sie beruhigt in die Ferien – eine gefüllte Flasche in der Gießspitze hält die Erde feucht.

Brotschneidebrett mit Krümelunterlage • Die Brösel fallen durch das herausnehmbare Gitter in die Auffangschale. Aus massiver und geölter Buche handgefertigt, stabil vernutet.
B 23,3 x T 40 x H 3,5 cm.
Nr. 21 358
Trinkhalme aus Edelstahl • Vier lebensmittelechte Strohhalme aus Edelstahl mit Reinigungsbürste Nr. 33 159 9,95 €
32,90 €

Wohndecke Punkte • Das hohe Stoffgewicht von 320 g/m² macht die kuschelige Decke sehr strapazierfähig. Bio-Baumwolle, GOTS-zertifiziert. 140 x 200 cm.
Nr. 64 009
49,95 €

• Nisthilfe für Wildbienen im Holzkasten zum Aufhängen
FRAGEN UND ANREGUNGEN
Tel. 0 91 23/7 02 76 10 frag-den-bn@bund-naturschutz.de Mo.–Do. 10–14.30 Uhr, Di. u. Do. 16–19 Uhr

MITGLIEDSCHAFT/ADRESSÄNDERUNG
Tel. 09 41/2 97 20-65 mitglied@bund-naturschutz.de
SPENDENBESCHEINIGUNGEN
Tel. 09 41/2 97 20-66 spenderservice@bund-naturschutz.de



REDAKTION NATUR+UMWELT
Luise Frank
Tel. 0 89/5 14 69 76 12 natur-umwelt@bund-naturschutz.de
HAUS- UND STRASSENSAMMLUNG
EHRENAMTLICH AKTIV WERDEN
Christine Stefan-Iberl
Tel. 09 41/2 97 20-11 christine.stefan@bund-naturschutz.de
BN-BILDUNGSWERK
Ulli Sacher-Ley
Tel. 09 41/2 97 20-23 ulrike.sacher-ley@bund-naturschutz.de

BERATUNG ZU VERMÄCHTNISSEN, SCHENKUNGEN & STIFTUNGSWESEN
Birgit Quiel
Tel. 09 41/2 97 20-69 birgit.quiel@bund-naturschutz-stiftung.de


Anzeige
IMPRESSUM
Herausgeber: BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN), vertreten durch Peter Rottner, Landesgeschäftsführer, Dr.-Johann-Maier-Str. 4, 93049 Regensburg, www.bund-naturschutz.de Leitende Redakteurin (verantw.): Luise Frank (lf), Tel. 0 89/5 14 69 76 12, natur-umwelt@bund-naturschutz.de
Redaktion: Andrea Siebert (as)
Mitglieder-Service: Tel. 09 41/2 97 20-65
Gestaltung: Janda + Roscher, die WerbeBotschafter, www.janda-roscher.de (Layout: Waltraud Hofbauer) Titelbild 3/25 (29. Jahrgang): Gebänderte Prachtlibelle im Wildnisgebiet Tangersdorf (Uckermark) – Foto: Dr. Tilo Geisel, Die Wildnisstiftung Redaktion BUND-Magazin: Severin Zillich (verantw.), Kaiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Tel. 0 30/27 58 64-57, Fax -40

Heftumschläge plastikfrei DIN A4 und DIN A5, mit und ohne Muster 1,35 – 1,45 €
alter Preis: 1,55 - 1,65 €


FÜR DEN SCHULANFANG: Stifte, Hausaufgaben-Heft, Lineal, Radierer, Spitzer, USB-Stick u.v.m.
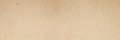
11,95 € 24,95 €

Memo-Spiel »Wer fliegt wo?« 72 Karten aus stabilem Karton

Anzeigenverwaltung: Evelyn Alter, Runze & Casper Werbeagentur GmbH, alter@runze-casper.de
Es gelten die Mediadaten Nr. 33. Verlag: BN Service GmbH, Eckertstr. 2, Bahnhof Lauf (links), 91207 Lauf an der Pegnitz, Tel. 0 91 23/9 99 57-20, Fax -99, info@service.bund-naturschutz.de
Druckauflage 2-2025: 150 000
Bezugspreis: Für Mitglieder des BN im Beitrag enthalten, für Nichtmitglieder Versandgebühr, ISSN 0721-6807
BN-Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft München, IBAN DE27 7002 0500 0008 8440 00, BIC: BFSWDE33MUE

BUND Naturschutz Service GmbH Service-Partner des BUND Naturschutz in Bayern e.V. versand@bn-service.de
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Lieferung solange Vorrat reicht, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten.
Mit Namen gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des BN wieder. Nachdruck nur mit Genehmigung des BN. Für unverlangt eingesandte Artikel oder Fotos keine Gewähr. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. »Natur+Umwelt« wird auf 100% Recyclingpapier gedruckt.
DEUTSCHLAND
HISTOR. BACKHAUS
als Ferienhaus im Hunsrück, Moselnähe, behagliche Einrichtung, idyllische Lage, Bach, Wiesen, Wald, Tel. 0 65 43/97 55 www.bleesmuehle.de
Das schöne Haus auf Usedom Naturnahes Ferienhaus mit schönem Hof und Garten, 3 SZ, 3 Bäder, Sauna, Kamin, Wald, Wiesen, Seen und Meer www.ferienhus.de
Rügen für Naturfreunde!
Ferienhaus + FeWos in traumhafter Lage im Biosphärenreservat nahe Putbus + Bodden.
Tel. 03 83 01/8 83 24 www.in-den-goorwiesen.de
Die Perle der Chiemgauer Alpen
Aus der Türe der FeWo zum Wandern und Klettern zur Hochplatte, Kampenwand, Geigelstein + Badesee. Absolut ruhige Alleinlage am Waldrand mit Blick auf den Wilden Kaiser.
Tel. 0 86 49/98 50 82 www.zellerhof.de
Anzeige
Hochgras-Mäher
Kreismäher + Mulchmäher für Streuobstwiesen, Biotop- u. Landschaftspflege Viele Modelle ab 1.145,- €

Qualität seit 1959 Tel.: 0421-633025 E-Mail: info@vielitz.de

Wieder Nordsee?
Nähe St. Peter Ording, FeWo für kurz entschlossene Naturfreunde, ab 45 € pro Tag, NR, Kind und Hund willkommen, Garten und Grill.
Tel. 0 48 62/80 52
Bodensee
Gemütliche FeWo für 2 Personen in Friedrichshafen, 300 m zum See, ruhige Lage, Nähe Naturschutzgebiet.
Tel. 01 76/41 25 48 78 www.seefreudebodensee.de
FRANKREICH
Natur pur –französische Pyrenäen Idyllisches Häuschen mit großer Terrasse. Geringe Besiedlung, viel Natur mit Fluss. 1 Stunde zum Strand. 2 bis 6 Personen.
Beatrice.allwein@gmx.de
Südfrankreich nahe Cévennen-Berge
Stilvolles Ferienhaus mit Garten in malerischem Dorf für zwei Personen, 70 Euro pro Nacht.
Tel. 00 33/07 83 33 72 64 ostermann.ole@gmail.com
Anzeige

Anzeige
klipklap :: Infostände & Marktstände
ökologisch - praktisch - gut für draußen & für drinnen, aus Holz, einfach steckbar, wasserdichte Baumwollplanen, Branding info@klipklap.de 033928 239890 www.klipklap.de

Nah dran. Natur erleben und verstehen. In Kleingruppen naturverbunden und nachhaltig in den schönsten Ecken Deutschlands und Europas unterwegs.

Anzeige

Kostenlos Katalog anfordern unter: info@bund-reisen.de oder 0911 5888820.

Nächster Anzeigenschluss: 30. September 2025 www.bund-kleinanzeigen.de • Tel. 030/28018-149
Anzeige

Artgerecht & 15 Jahre Garantie
09563-513320 1 www.denk-keramik.de Im BUNDladen erhältlich











Sprechen Sie mich gern an, wenn Sie Fragen zum Thema Stiften oder Interesse an unserer Broschüre haben.






Birgit Quiel 0941 297 20 69 birgit.quiel@bund-naturschutz.de







BUND Naturschutz Stiftung Dr.-Johann-Maier-Str. 4 93049 Regensburg




Weitere Informationen unter: www.bund-naturschutz-stiftung.de