






AKTUELL
Hummel-Challenge IG Metall im Interview

GUTER RAT
PFAS vermeiden
Blumen ohne Gift








AKTUELL
Hummel-Challenge IG Metall im Interview

GUTER RAT
PFAS vermeiden
Blumen ohne Gift

Seit 2006 l wendet Gleichklang psychologische Methoden an, um Menschen in glücklichen zusammen zu bringen.




AKTUELLES
4/5 Aktuelle Meldungen
6 Kommentar
7 Gerettete Landschaft
8/9 Aktuelles aus Bayern
10/11 Jahresschwerpunkt Wasser
TITELTHEMA
12/13 Zur Europawahl
14 /15 Europa entscheidet
16 Wer hat wie gestimmt?
17 So funktionier t die EU
18 Was wir fordern
19 BUND-Partner im Interview
20 Rolle rückwärts?
21 Ergebnisse sehen
AKTION
22/23 Hummel-Challenge
24 Weniger Parkplätze, mehr Lebensqualität
NATUR IM PORTRÄT
25 Artenvielfalt in Kommunen
26 Pflanzenporträt: Fieberklee
27 Licht aus für die Fledermaus
28/29 Schutz für gefährdete Arten
30/31 Bedroht: Feldhase
Die Natur+Umwelt ist das Mitgliedermagazin des BUND Naturschutz und die bayerische Ausgabe des BUNDmagazins.



32/33 Wolf und Weidetiere
34/35 EU-Schutzgebiet
SOZIAL-ÖKOLOGISCHE
TRANSFORMATION
36 Gebäudesanierung
37 Interview mit Christiane Benner, IG Metall
INTERNATIONALES
38 Fukushima-Jahrestag
39 Klimaklage gegen Großbank
URLAUB & FREIZEIT
40 Reise: Donaudelta
41 Wanderung
BN NAH + AKTIV
42 Neue Serie: BN-Grundstücke
43 Editorial des Vorstands
44–46 Meldungen
47 Bildung
48 Porträt
50 Jubiläen
51–57 Regionalseiten
58/59 Junge Seite
SERVICE
60 Ratgeber
61 Ökotipps
62 Leserbriefe
63 Medien und Reisen
66 Ihre Ansprechpartner*innen/ Impressum


die meisten Menschen, die im BUND Naturschutz ehrenamtlich aktiv sind, betätigen sich im Arten- und Biotopschutz. Damit tragen sie unentgeltlich und in ihrer Freizeit dazu bei, überall in Bayern Schatzkästchen der Natur zu erhalten. Oder sie sorgen dafür, dass solche Naturjuwelen wieder entstehen können – wie im Landkreis Dingolfing-Landau, wo die Kreisgruppe eigens angekaufte Flächen wiedervernässt, damit sich dort Kiebitz und Großer Brachvogel wohlfühlen. Insgesamt besitzt der BN rund 2750 Hektar Flächen, in denen Ehrenamtliche mit viel Engagement und Herzblut schaufeln, mähen, anpflanzen, brütende Vögel zählen und vieles mehr. Ein Beispiel für diese Flächen zeigen wir Ihnen ab sofort in jeder Ausgabe der Natur+Umwelt, in diesem Heft auf den Seiten 42 und 43. Optimistisch stimmende Nachrichten wie diese tun gut in einer Zeit, in der Krisen in Dauerschleife die Nachrichten beherrschen. Doch statt zu verzagen, sollten wir überall da, wo es möglich ist, unseren Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten. Bei der Wahl des Europaparlaments am 9.Juni ist das mit sehr wenig Aufwand möglich. Unser Schwerpunktthema ab Seite 12 bietet mehr Informationen dazu.
Luise Frank
Severin Zillich
BUNDmagazin

Foto: SMAQ
Der BUND zeigt an seinem Neubau der Bundesgeschäftsstelle, wie nachhaltiges Bauen gelingt. Nicht auf der grünen Wiese, sondern mitten in Berlin-Neukölln entsteht ein energieeffizienter Bürobau, der Platz für den BUND und für befreundete Organisationen bietet.
Anfang April gab der Gesamtrat grünes Licht für die Vergabe der Hauptgewerke. Dabei verzichtet der BUND, wo immer es geht, auf Beton und verwendet im Untergeschoss weit überwiegend Recyclingbeton und CO2-reduzierten Zement.
Erneut kürt der BUND eine »Allee des Jahres« – aus den besten Bildern, die Sie uns zuschicken. Wir freuen uns über Ihre Fotos, ob vor der Haustür oder im Urlaub entstanden. Das diesjährige Motto des Wettbewerbs lautet »Alleen in unseren Städten und Dörfern«. Denn nichts kühlt bei den steigenden Temperaturen wirksamer als große Bäume.
Bitte senden Sie uns bis 16. September maximal vier (digitale) Bilder, die
nicht älter als ein Jahr sind. Notieren Sie dazu bitte den Ort, die Länge der Allee und die prägende Baumart. Auch wüssten wir gerne, was Sie mit Ihrer Allee verbindet.
Im Herbst wird eine Jury die Allee des Jahres 2024 küren und öffentlich präsentieren. Für den ersten Platz gibt es neben der Auszeichnung eine Übernachtung auf Burg Lenzen für zwei Personen. Auch den Zweit- und Drittplatzierten winken schöne Preise.
Foto: K. Dujesiefken
So soll die neue Bundesgeschäftsstelle des BUND im Berliner Rollbergkiez einmal aussehen.
Der eigentliche Holzbau darüber erfüllt hohe Anforderungen an die Wärmedämmung und schließt mit einem Gründach ab. Dieses dient als Biotop, Niederschlagspuffer und zur Verbesserung des Mikroklimas. Das Energiekonzept nutzt alle Potenziale der erneuerbaren Energien –von Photovoltaik über eine GeothermieWärmepumpe für Wärme und Kühlung bis hin zu einer Verdunstungsanlage für zusätzliche Kühlung. Damit wird sich unsere Geschäftsstelle zu 80 Prozent selbst mit Energie versorgen, der Grundstein für ein echtes Zukunftshaus des BUND.

Lindenallee in Bad Doberan.
Mehr zum Thema www.allee-des-jahres.de; Ihre Fotos senden Sie bitte an: katharina.dujesiefken@bund-mv.de
»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.
Doch positive Neuigkeiten aus dem Naturund Umweltschutz tun einfach gut. Einige aus jüngster Zeit haben wir wie immer für Sie ausgewählt.

Hummeln gezählt: Mit einer dreiwöchigen »Hummel-Challenge« über die GratisApp »ObsIdentify« rief erstmals auch der BUND Naturschutz im März/April dazu auf, möglichst viele Hummeln zu finden. Wer schafft es, die meisten Arten zu fotografieren und damit zum Schutz ihrer Lebensräume beizutragen? An die dreitausend Hummelfans meldeten etwa zehntausend Beobachtungen. Neben den am häufigsten gesichteten Erd-, Ackerund Wiesenhummeln wurden auch seltene Arten wie die Bunte, die Veränderliche und die Bergwald-Hummel entdeckt. Am 20. Juni startet die nächste Challenge. Siehe auch Seite 22/23.
Mehr Infos: www.bund-naturschutz.de/ hummelchallenge

Rundumblicke im Grünen Band: Der BUND regt zur Spurensuche an der einstigen innerdeutschen Grenze an. Neue interaktive 360°-Touren führen zu verschwundenen Orten und geschützten Arten, mit Berichten von Zeitzeugen, mit Filmen, Audios und historischen Dokumenten. Wie war es, im Sperrgebiet zu leben? Warum haben seltene Tiere und Pflanzen und ihre vielfältigen Lebensräume gerade hier überlebt? Bereisen Sie online die Rhön, das Werrabergland sowie die Altmark: www.360-grad. bund.net/gruenes-band
Atomausstieg bekräftigt: Ein Jahr nach der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke zog der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt im April eine rundum positive Bilanz: »Die Lichter sind nicht ausgegangen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist auf einem Rekordhoch und hat die Leistung der abgeschalteten Reaktoren längst ausgeglichen. Gleichzeitig ging die Nutzung von Kohlestrom deutlich zurück.« Entgegen allen Unkenrufen ist Deutschlands Energieversorgung gesichert. Der BUND ist überzeugt: Die unwirtschaftliche, hochriskante Atomkraft wird zum globalen Auslaufmodell.
Jahrzehntelang verschollen: Bayerische Kurzohrmaus wiederentdeckt. Es passiert nicht alle Tage, dass ein in Deutschland lange vermisstes Säugetier wiedergefunden wird. 1962 wurde »Microtus bavaricus« in Oberbayern erstmalig als neue Art beschrieben. Danach blieb die graubraune Wühlmaus trotz mehrfacher Suche über Jahrzehnte verschollen, nur in Tirol fanden sich einige weitere Exemplare. Ende 2023 gelang es jetzt bei Mittenwald, die Bayerische Kurzohrmaus in einer Lebendfalle zu fangen und mittels DNA-Analyse eindeutig nachzuweisen. Bayerns Landesamt für Umwelt freute sich über den »Sensationsfund«.
Recht auf Reparatur: Rund 35 Millionen Tonnen Elektroschrott häufen wir EU-weit jedes Jahr an, weil Dinge nicht repariert werden können oder ihre Reparatur zu teuer ist im Vergleich zu einem Neukauf. Ende April beschloss das EU-Parlament einen Rechtsanspruch auf Reparatur. Bestimmte Haushaltsgeräte wie Kühlschrank und Geschirrspüler, Smartphone, Tablet oder Fahrrad müssen nun auch nach der zweijährigen Mindestgewährleistung zu reparieren sein – um unseren Geldbeutel, das Klima und die irdischen Ressourcen zu entlasten. Die EU-Staaten haben bis 2026 Zeit, dieses Gesetz in ihr nationales Recht zu übertragen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dem BUND einen neuen Weg eröffnet, das Klima zu schützen.
Die Schweizer KlimaSeniorinnen haben einen sensationellen Erfolg erstritten. Der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bestätigte ihr Grundrecht darauf, vom Staat vor den Folgen des Klimawandels geschützt zu werden. Richtig so! Die Klimapolitik muss gerade die gesundheitlich besonders Betroffenen schützen. Ich verneige mich vor diesen starken Frauen, die nicht lockergelassen haben. Auch uns haben sie damit die Möglichkeit neuer Klagen im Namen von Betroffenen eröffnet.
Am 10. April wurden eine gute und eine schlechte Nachricht öffentlich. Die schlechte: Zehn Monate in Folge war es nun heißer als je im gleichen Monat zuvor. Damit ist die 1,5 Grad-Grenze im Durchschnitt der letzten zwölf Monate schon überschritten. Hoffnung machte, was den Schweizer KlimaSeniorinnen am Vortag gelungen war. Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte verpflichtete die Schweiz, ihre Bürgerinnen und Bürger vor der fortschreitenden Klimaerwärmung zu schützen.
Denn dafür tut die Schweiz zu wenig – und verletzt somit das Menschenrecht der klagenden Frauen. Die steigenden Temperaturen schaden ihrer Gesundheit, ihrem Wohlbefinden und ihrer Lebensqualität. Ältere Menschen, aber auch Kleinkinder, (chronisch) Kranke und Schwangere sind bei Hitzewellen besonders gefährdet. Die Schweiz muss jetzt Ziele und Zeitpläne vorlegen, wie sie die Treibhausgase schnell und wirksam verringern wird.
Dafür hatten sich die Klägerinnen seit 2018 durch alle Instanzen geklagt. Rechtsbegehren, Klagen und Beschwerden blieben erfolglos, das Verfahren in Straßburg zog sich über drei Jahre hin. Als Klima-Omas belächelt, ließen sie sich nicht beirren. Sie streikten und demonstrierten, formulierten Schriftsätze und warben für ihre Sache. Ihre Beharrlichkeit und geschickte juristische Argumentation wurden zu Recht belohnt.
ist die stellvertretende Vorsitzende des BUND.
Das Urteil bindet zunächst die Schweiz, reicht aber viel weiter. Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention, also weit über die EU hinaus. Das Gericht erkannte den Klimaschutz als Menschenrecht an und erklärte die Klage eines Vereins im Namen der Betroffenen erstmalig für zulässig. Damit hat der Gerichtshof eine menschenrechtliche Verbandsklage erfunden. Sie eröffnet uns Umweltverbänden neue Möglichkeiten, den Klimaschutz voranzubringen.
Ich bin froh, mit unserer Arbeit auf den Schultern solcher Riesinnen stehen zu können. Umweltschutz braucht alle Generationen –und Verbündete in vielen Ländern und Organisationen. Aktive des BUND haben weit vor meiner Generation viel dafür getan, dass Verbände Natur und Umwelt schützen können. Sie haben umfassende Rechte erstritten, um Vorhaben auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen und – im Namen der Natur – gegen Fehlentscheidungen der Verwaltung zu klagen.
Umso wichtiger, dass wir nun gegen die Aushebelung der Rechte im Naturschutz kämpfen. Mit ihrem LNG-Beschleunigungsgesetz (zum schnellen Bau von Flüssiggas-Terminals) hat die Bundesregierung einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Auf Kosten der Qualität trieb sie deren Genehmigung mit der Brechstange voran, auch in Naturschutzgebieten.
Bislang sorgten Eingaben von Umweltverbänden und Bürger*innen oft dafür, dass Pläne verbessert und die Umweltbelastung gemindert wurde. Dies ist im Schweinsgalopp kaum möglich. Im Entwurf des Wasserstoff-Beschleunigungsgesetzes sehen wir teils wortgleiche Formulierungen. Dem müssen und werden wir uns mit aller Kraft entgegenstellen.
VERENA GRAICHEN
Fast 40 Jahre drohte die Vorderheide am Fuße des Taunus bebaut zu werden. Dabei zählen die 11,3 Hektar im Norden der Stadt Hofheim mit den angrenzenden Bauerlöcher Wiesen zu den wertvollsten Streuobstgebieten im MainTaunus-Kreis. Gutachter stellten hier ungewöhnlich viele Raritäten fest, darunter den Gartenschläfer, zwölf Fledermaus-Arten und den Steinkauz. Der BUND Hessen kämpfte deshalb bis zur letzten Instanz für den Schutz des Biotops. Mit Erfolg: Laut Oberverwaltungsgericht Kassel ist die Vorderheide mit den Bauerlöcher Wiesen ein faktisches Vogelschutzgebiet. Der BUND-Ortsverband Hofheim bemüht sich vor Ort darum, das prächtige Streuobstgelände zu erhalten.

Bei dieser Photovoltaik-Anlage im Landkreis Freising verstehen sich Artenschutz und Energieerzeugung bestens.
Der schnelle Ausbau von FreiflächenPhotovoltaik weckt bei manchen Sorgen. Mit guter Planung lassen sich Konflikte mit Artenschutz und Landwirtschaft entschärfen.

KASIMIR BUHR
BN-Energie- und Klimaschutzreferent
Freiflächen-Photovoltaik – hinter diesem sperrigen Begriff verstecken sich Solarkraftwerke auf Agrar- und Brachflächen. Photovoltaik (PV), also Strom aus Sonnenenergie, ist in Bayern inzwischen die wichtigste Quelle für erneuerbaren Strom und wird weiter ausgebaut: So wurden 2023 rund 3600 Megawatt Leistung angeschlossen, das entspricht dreieinhalb Atomkraftwerken. Mehr als die Hälfte davon entfiel zuletzt auf die Freiflächen-PV, Tendenz weiter steigend.
Manche werden sich angesichts der neuen Anlagen fragen: Muss das sein? Geht das nicht auch auf Dächern? Solarmodule auf dem Hausdach bieten erneuerbaren Strom ganz ohne Flächenkonflikte. Doch es gibt gute Gründe, warum die Module
auf dem Dach alleine nicht reichen: Um Bayern komplett erneuerbar zu versorgen, muss neben einem kräftigen Ausbau der Windkraft die Leistung der Photovoltaik um das Dreifache erhöht werden. Und auch das reicht nur dann, wenn es wie vom BN gefordert gelingt, die Hälfte der aktuell verbrauchten Energie einzusparen!
IDEAL: KOMBINUTZUNG
Dabei muss es schnell gehen: Um die Klimakrise auf ein für Mensch und Natur verkraftbares Maß zu begrenzen, fordert der BUND Naturschutz, dass Bayern bis 2035 klimaneutral wird. In den nächsten zehn Jahren ist also viel zu tun.
Freiflächen-Anlagen spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie lassen sich vergleichsweise schnell und günstig bauen. Mit einem Projekt wird hier eine Leistung erreicht, für die viele Dachanlagen notwendig wären. Und im Vergleich zu Biomasse braucht es dafür deutlich weniger Fläche: Für Biogas aus Mais wäre zum Beispiel das bis zu 50-fache an Fläche nötig.
Damit die Energiewende nicht zulasten von Artenschutz und Landwirtschaft geht, müssen die Flächen aber gut ausgesucht und möglichst mehrfach genutzt werden. So sollten die Anlagen vor allem auf Flächen gebaut werden, die für andere Nutzungen weniger geeignet sind. Darum sieht man übrigens auch so viele Solaranlagen, wenn man durch Bayern fährt: diese werden bevorzugt entlang von Autobahnen und Eisenbahnstrecken aufgestellt.
In Zukunft sollten Flächen außerdem auch gleichzeitig für Stromerzeugung und Landwirtschaft genutzt werden (»AgriPV«). Die Module können dafür zum Beispiel als Schutzdach von Obstplantagen dienen oder aufrecht zwischen Ackerstreifen stehen. Damit es bei solchen Projekten nicht bei leeren Versprechen der Investor*innen bleibt, werden die Fachleute des BUND Naturschutz vor Ort genau hinzuschauen. Dabei helfen die vom BN aufgestellten Kriterien.
Mehr zum Thema www.bund-naturschutz.de/energiewende/ erneuerbare-energien
Die von ALDI Nord aufgekaufte Mineralwasserfirma Altmühltaler plant, zwei neue Förderbrunnen bei Treuchtlingen zu bohren. Das Wasser soll aus einer fossilen Tiefengrundwasserschicht entnommen werden. Der BUND Naturschutz lehnt die Pläne, wertvolles Tiefengrundwasser durch einen privaten Konzern ausbeuten zu lassen, ab.
Bei einem Termin vor Ort im Februar machte sich auch Martin Geilhufe, der BN-Landesbeauftragte, für den Schutz des Tiefenwassers stark: »Wir lehnen in ganz Bayern eine dauerhafte Tiefengrundwasserförderung durch private Wasserabfüller ab.« Es könne nicht sein, so Geilhufe, dass sich privatwirtschaftliche Unternehmen an einem allgemeinen Gut wie Wasser bereichern, zumal die Verteilungskämpfe um das Wasser auch in Bayern bereits begonnen hätten. In Zeiten zunehmender Trockenheit müsse dieses Wasser der öffentlichen Versorgung als Notreserve vorbehalten bleiben.
Altmühltaler durfte jahrelang Tiefengrundwasser aus dem überdeckten Sandsteinkeuper entnehmen. »Wir sind dankbar, dass das Wasserwirtschaftsamt diesen Raubbau beenden will«, sagte Brigitte Löffler, Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Weißen-

Ausgedampft: Das AKW Isar 2 bei Landshut ist inzwischen stillgelegt, die Genehmigung für den Abbruch liegt vor.
Am 15. April 2023 sind die letzten drei Atomreaktoren in Deutschland, darunter Isar 2 bei Landshut, vom Netz gegangen. Inzwischen ist klar: Die Panikmache der bayerischen Staatsregierung war völlig unbegründet.
»Ein Riesenerfolg für die Umweltbewegung, die ein halbes Jahrhundert lang gegen diese Hochrisikotechnologie gekämpft hat«, freut sich Richard Mergner. Der BN-Vorsitzende konstatiert: »Weder sind bei uns die Lichter ausgegangen, noch ist die Kohleverstromung nach oben geschnellt. Im Gegenteil, wir haben so wenig Kohlestrom wie noch nie. Stattdessen konnten die Erneuerbaren durch den Atomausstieg den Turbo zünden und sind mit 63 Prozent der Gesamtstrommenge auf einem neuen Rekordhoch.«
Auf den Strompreis hatte der Atomausstieg kaum Einfluss. »Die Schreckgespenster, die die bayerische Staatsregierung vor dem Ausstieg an die Wand gemalt hat, sind allesamt nicht eingetreten«, bilanziert Mergner und betonte, dass die Falschbehauptung, Deutschland wäre auf französischen Atomstrom angewiesen, »nicht richtiger wird, wenn man sie ständig wiederholt«.

des BN und der Bürgerinitiative auf den besseren Schutz des Tiefengrundwassers an.
burg-Gunzenhausen. »Allerdings halten wir nichts davon, nun ein anderes Tiefengrundwasser für den Discounter ALDI Nord freizumachen. Altmühltaler will aus den neuen Brunnen 80 Prozent seines Bedarfs decken. Der Rest soll immer noch aus dem überdeckten Sandsteinkeuper kommen. Dabei müssen sogar die kommunalen Wasserversorger schon sparen«, so Löffler.

 Anzeige
Mit Trinkwasser aus dem Wasserhahn stießen Aktive
Foto:
BN
Anzeige
Mit Trinkwasser aus dem Wasserhahn stießen Aktive
Foto:
BN
BN-JAHRESSCHWERPUNKT WASSER

Unsere Wälder spielen eine zentrale Rolle im Wasserkreislauf. Höchste Zeit, dass wir diese Erkenntnis beim Umgang mit dem Wald mehr als bisher berücksichtigen!

HRALF STRAUSSBERGER
BN-Waldreferent
ätten Sie gewusst, dass die Wälder in Europa für die Hälfte unserer Niederschläge verantwortlich sind? Bäume pumpen mit ihren tiefen Wurzeln Wasser aus dem Boden hinauf zu den Blättern, die es an die Atmosphäre abgeben. Die Wälder in Europa verdunsten eine Wassermenge, die etwa der Hälfte unserer Niederschläge entspricht. Sie wirken dadurch wie eine Kühlanlage, die besonders an Hitzetagen aufgeheizte Städte abkühlt. Wälder mindern durch ihre große Blattoberfläche die Erosionswirkung des Regens auf den Waldboden. Sie halten Niederschläge zurück wie ein großer Schwamm und bieten dadurch Schutz vor Überschwemmungen, Erosion und Erdrutschen. Waldböden filtern und reinigen die Niederschläge, die im Boden versickern und sind ein wichtiger Trinkwasserspeicher. Wie wir unsere Wälder
bewirtschaften, kann dem Wald helfen, all diese Wasser schützenden Ökosystemleistungen zu erfüllen. Ideal ist dafür ein »Dauerwald«, reich strukturiert aus heimischen Baumarten.
Um diese stufig aufgebauten Wälder zu bekommen und sie vital und klimaresilient zu erhalten, ist eine Waldverjüngung zwingend notwendig, vor allem in den in Bayern verbreiteten Nadelwäldern. Bislang scheitert dies daran, dass oft zu viele Rehe, Hirsche und im Gebirge auch Gemsen die Naturverjüngungen auffressen. Die Folge ist, dass gerade klimaresiliente Baumarten wie Eichen, Buchen, Tannen oder Ahornarten nicht aufwachsen können, sondern ausfallen. Dies gefährdet mittelfristig die Erfüllung der vielen wichtigen Funktionen, die Wälder in unserem Ökosystem haben, langfristig gefährdet es den Fortbestand unserer Wälder an sich. Wie die letzte Verbissinventur Bayerns zeigt, ist in mindestens der Hälfte der Wälder der Verbisszustand der Verjüngung kritisch. Aktuell läuft eine neue Bestandsaufnahme der Verjüngung in
So sieht der Wald der Zukunft aus: stufig aufgebauter Mischwald

Wie ein Drainagekanal: Tiefe Furchen von Forstmaschinen tragen zur Entwässerung der Wälder bei.
Bayerns Wäldern. Der BUND Naturschutz fordert seit Jahren eine stärkere Bejagung der vielerorts überhöhten Reh- und Hirschbestände.
In der Bewirtschaftung von Wäldern muss künftig auf Kahlschläge oder starke Auflichtungen verzichtet werden, weil sie den Wasserabfluss und die Erosionsgefahr erhöhen und die Trinkwasserqualität verschlechtern.
Die Erschließung mit Wegen in Wäldern hat großen Einfluss auf den Wasserabfluss. Rückegassen, auf denen Forstmaschinen fahren, durchziehen oft im Abstand von 20 bis 30 Metern die Wälder. Die Befahrung führt dort zur Bodenverdichtung und auch zu eingetieften Fahrrinnen, so dass Regenwasser darin schnell abfließt. Von dort wird das Wasser dann in Gräben entlang der Forststraßen schnell aus dem Wald geleitet. Der BN fordert, das Wasser stärker im Wald zurückzuhalten. Dazu braucht es weitere Abstände der Wege, einen Rückbau der Entwässerungsgräben und eine Versickerung des Wassers aus den Wegseitengräben in die Waldfläche.

WAGENWASSER
Am Wagenwasser, einem Bach in der Gemeinde Philippsreuth, hat der BN in den vergangenen zehn Jahren mehrere Flächen gekauft und so einen Teil der Feuchtund Moorflächen gesichert. Darunter auch eine langgezogene Fläche direkt an der Grenze zu Tschechien, dort, wo der Bach die Grenze passiert.
Der dichte Fichtenwald wurde ausgelichtet, um lichtbedürftigen Arten mehr Lebensraum zu geben und eine Wanderachse entstehen zu lassen. Dies schafft für seltene Schmetterlinge wie den Hochmoor-Gelbling einen Wanderkorridor. Gleichzeitig werden die Moorfunktionen sowie der Wasserrückhalt in der Landschaft und die Lebensraumqualität für Moorarten gestärkt.
Life for MIRES ist ein tschechisch-deutsches Projekt am Grünen Band Europa, bei dem grenzübergreifend Moore und Feuchtgebiete erhalten und renaturiert werden. Hier bringen Wasser, Moore und Naturschutz international Menschen zusammen.
RESCHBACHTAL
Im Bayerischen Wald konnte der BN 2,7 Hektar im Reschbachtal erwerben. Durch das frühere Niedermoor fließt ein kleines Bächlein, aber leider hat die Fläche durch Entwässerung ihren Moorcharakter immer mehr verloren. Bei Renaturierungsarbeiten (siehe Bild) wurden die Ufer des kleinen Baches abgeflacht und Erlen zur Stabilisierung gepflanzt. Der Entwässerungsgraben hatte sich immer weiter eingetieft, teils fast mannshoch. Hier wurde Material aufgeschüttet und ebenfalls die Ufer abge-
BIOTOPE BEWAHREN
Gerade am Grünen Band, wo einst der Eiserne Vorhang Europa teilte, gibt es viele Biotope im und am Wasser. Der BN besitzt hier Flächen und kümmert sich um diese Naturjuwelen.

flacht. So kann bei starken Regenfällen das Wasser über die Ufer treten und im Boden versickern, statt abzufließen.
Die Auenwiesen bei Fischern sind ein Biotop, das von der BN-Kreisgruppe Wunsiedel betreut wird. Die Feuchtwiesen liegen direkt an der Grenze zu Tschechien, wo die Flüsse Röslau und Eger zusammenfließen. Das Biotop bietet einer Vielzahl von Pflanzen ein Zuhause, vom Flutsüßgras bis zum Wiesenknöterich.
Die Auenwiesen waren einer der ersten Flächenkäufe des BUND Naturschutz am



Grünen Band. 2005 wurden Mulden ge graben, in denen nach Starkregen und Über schwemmungen Wasser stehen bleiben kann, und Tümpel angelegt. Dadurch wurden wichtige Feucht- und Nassbereiche für auentypische Tier- und Pflanzenarten geschaffen. Tiere wie die Bekassine (Bild) und der Flussuferläufer, die vom Aussterben bedroht sind, finden hier einen Lebensraum.
Anzeige
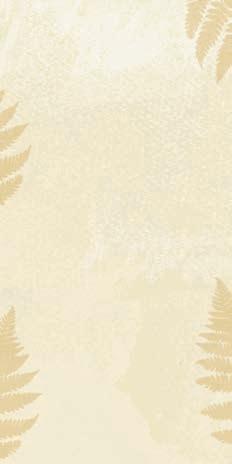
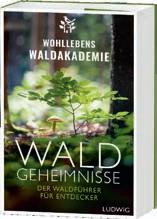
Dieser reich bebilderte Führer der von Peter Wohlleben gegründeten Waldakademie nimmt uns mit auf eine Ent deckungsreise durch den Wald, bei der man aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt.



Vor noch nicht allzu langer Zeit teilte der Eiserne Vorhang Europa. Wo die Kalte Moldau heute kaum sichtbar die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien markiert (siehe Foto), standen sich Ost und West bis 1989 feindlich gegenüber. Im ehemaligen Sperrgebiet pflegt der BUND nun seit vielen Jahren wertvolle Moorwiesen. Diese Flächen bilden einen Teil des Grünen Bandes, das an die Stelle des Eisernen Vorhangs getreten ist.

Über 12 500 Kilometer lang durchquert es unseren Kontinent als europäisches Natur- und Kulturerbe, vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer. Für den BUND ist das Grüne Band ein Symbol der Hoffnung. Mehr denn je glauben wir an die einende Kraft Europas –in einer Zeit, die uns vor neue und besondere Herausforderungen stellt. Am 9. Juni wird das Europäische Parlament neu gewählt. Geben auch Sie Ihre Stimme ab, für die Natur und Umwelt und die Demokratie! Mehr zu dieser so wichtigen Wahl erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



Unterstützen Sie im Vorfeld der Europawahl die Demokratie! Gehen Sie mit dem BUND und vielen Verbündeten auf die Straße. Vom 23. Mai bis 8. Juni demonstriert das Bündnis »Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen« in Erfurt, Köln, Cottbus, Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main, Leipzig, München und Stuttgart sowie flächendeckend auch in kleineren Städten: www.bund.net/demokratie-verteidigen




Am Grünen Band bei Eisenach reichen sich Teilnehmer*innen einer paneuropäischen »Green Belt Conference« die Hände.



Die Kalte Moldau bei Haidmühle im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau.



 Foto: Melanie Kreutz
Foto: Melanie Kreutz
EUROPAWAHL
Am 9. Juni stimmen wir darüber ab, wie das EUParlament künftig zusammengesetzt sein wird. Und damit auch über die Demokratie und den Schutz der Natur und Umwelt in Europa.

DOLAF BANDT
ist der Vorsitzende des BUND.
ie Natur kennt keine Grenzen. Zudem sind viele Umweltprobleme nur auf internationaler Ebene zu lösen. Darum verwundert es kaum, dass mehr als 80 Prozent des deutschen Umweltrechts seinen Ursprung in Brüssel hat. Viele Richtlinien und Gesetze der EU waren wegweisend: sei es das Netz der Natura2000-Gebiete, die Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz unserer Gewässer oder die Richtlinie zur Luftreinhaltung, welche die Luftverschmutzung in unseren Städten maßgeblich verringert hat. Vor der vergangenen Europawahl im Jahr 2019 hatte die Umweltbewegung mobilisiert wie noch nie. Das führte europaweit zu entsprechenden Wahlergebnissen. Unter diesem Eindruck hoben die Staats-


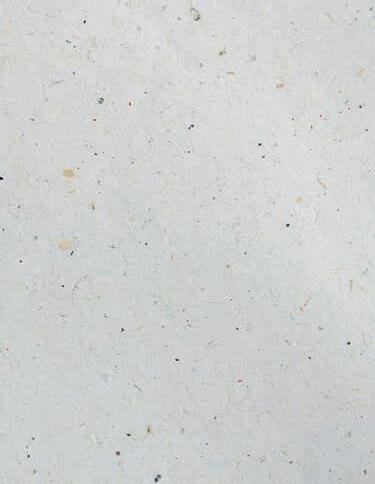
und Regierungschefs der EU, Kommission und Parlament den »European Green Deal« aus der Taufe.
Einige Erfolge können sich durchaus sehen lassen, so das erste europäische Klimagesetz. Oder das geplante Aus für den Verbrennermotor, das in Deutschland mit seiner politischen Gemengelage wohl niemals möglich gewesen wäre.
PAUSE BEIM UMWELTSCHUTZ?
Doch seitdem hat sich die Welt massiv verändert. Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die gestiegenen Kosten der Lebenshaltung sind ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Auch wenn die öffentliche Unterstützung für Umweltthemen hoch bleibt, ruft mancher in der Politik nach einer Pause beim Klima- und Naturschutz. Derweil schreiten der Schwund der natürlichen Vielfalt und die Erderhitzung weiter voran.
Die gescheiterte EU-Pestizidverordnung und das Tauziehen um das »Gesetz zur Wiederherstellung der Natur« sind Beispiele dafür, dass ökologische Anliegen nun von vielen blockiert werden. Dabei kann uns die Lösung der ökologischen Krisen helfen, zugleich auch soziale und geopolitische Probleme anzugehen. So werden wir dank erneuerbarer Energien unabhängig von der – durch fossile Brennstoffe angefachten – Inflation. Der Schutz von Ökosystemen macht unsere Gesellschaft widerstandsfähiger. Kommt die Landwirtschaft mit weniger Kunstdünger und Pestiziden aus, ist sie den Preissprüngen bei diesen Stoffen weniger ausgeliefert. Und der Klimaschutz erfordert unseren Energiebedarf zu senken, sei es in Wohnräumen oder bei der Mobilität. Das schont den Geldbeutel und mindert unsere Abhängigkeit weiter.
RICHTUNGSENTSCHEIDUNG
Am 9. Juni liegt es jetzt an uns, ob der sozial-ökologische Wandel eine Chance behält. In gleich mehreren Bereichen stehen direkt nach der Wahl Richtungsentscheidungen an. So muss die EU bald über ihren Klimafahrplan bis 2040 beschließen. Dies ist der letzte große Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Hier später nachzuschärfen ist schwierig, der Plan muss also sitzen.
Die EU-Kommission schlug kürzlich vor, den CO2-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent zu verringern, zumindest auf dem Papier. Der Plan sieht jedoch vor, auch danach noch Gas und Öl zu verfeuern. Um auf das Reduktionsziel zu kommen, soll das klimaschädliche CO2 mit der höchst problematischen CCS-Technik aufgefangen und unterirdisch verpresst werden.
Nach der Wahl muss die EU sich entscheiden, ob sie auf Scheinlösungen wie diese setzt oder das Aus für Kohle, Öl und Gas endlich auf den Weg bringt. Zugleich drängt die Frage, wie wichtige Umweltgesetze (etwa zum Heizungsumbau) so umgesetzt werden können, dass geringe Einkommen nicht zu sehr belastet werden. Rückschritte, wie manche Parteien sie etwa beim Verbrenner-Aus planen, können wir uns angesichts der rapide wachsenden Umweltprobleme nicht leisten.
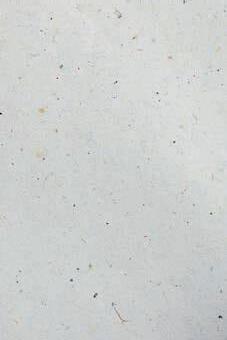
Bald nach der Wahl steht auch eine Neuverteilung der EU-Milliarden für die Landwirtschaft an. Die bisherige Förderpolitik ist gescheitert, das haben die Bauernproteste verdeutlicht. Wir vom BUND fordern den Protest zum Anlass zu nehmen, ökologische Aufgaben und ländliche Zukunftsperspektiven in der EU-Förderpolitik zusammen zu gestalten. Andere wollen sich nun der letzten grünen Standards in der Landwirtschaft entledigen. Damit stünde der Schutz der biologischen Vielfalt in Europa zur Disposition.
Tatsächlich greifen konservative Politiker*innen an die Basis des europäischen Naturschutzes. In ihrem Wahlprogramm fordert die Europäische Volkspartei (mit CDU und CSU) die Natura-2000-Gesetze zu »öffnen«, sprich zu schwächen. Dazu passen auch Bemühungen wie die, den Schutzstatus des Wolfs zu lockern.
Das EU-Renaturierungsgesetz schaffte es im Parlament nur ganz knapp über die Ziellinie. Für das so wichtige Vorhaben, bis 2030 auf einem Fünftel der EU-Fläche Ökosysteme zu renaturieren, gab das Ja eines halben Dutzends Abgeordneter den Ausschlag. Allerdings ist das Gesetz noch nicht gesichert – der Umweltministerrat versagt vorläufig seine Zustimmung, die als bloße Formsache galt.






Auch andere Fortschritte im Europäischen Parlament kamen zuletzt nur denkbar knapp zustande. Nach dem 9. Juni dürften Mehrheiten für Umweltanliegen noch schwieriger zu finden sein.
Besorgniserregend ist das Erstarken demokratieverachtender Kräfte in Europa und Deutschland. Sie könnten die zentrale Bedeutung des EU-Parlaments als europäische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger schwächen. Der Höhenflug der AFD ist zahlenmäßig einer der größten Treiber dieser Entwicklung. Wer in Deutschland zu Wahl geht, trägt damit eine kontinentale Verantwortung.
In den vergangenen fünf Jahren hat die AFD gegen jeden Fortschritt im Umweltschutz gestimmt, die absolute Ausnahme unter den größeren Parteien. Sie möchte das EU-Parlament, die einzige direkt gewählte Institution der EU, abschaffen –und die EU gleich mit. Für alle, denen die Demokratie und der Klima- und Naturschutz am Herzen liegen, kann diese Partei darum keine Alternative sein.
Meine Bitte lautet deshalb: Nutzen Sie am 9. Juni Ihre Stimme, um ein Zeichen zu setzen: für ein demokratisches Europa, das unsere Lebensgrundlagen sichert.
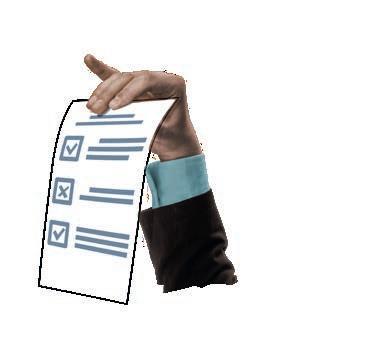
Wie haben die deutschen Parteien in den vergangenen fünf Jahren votiert, wenn es um den Schutz von Natur und Umwelt ging? Eine Analyse ergab deutliche Unterschiede.
Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Dieser Spottspruch der 70er Jahre trifft schon lange nicht mehr zu. Denn es macht einen Unterschied, wer im Europäischen Parlament sitzt und mit darüber entscheidet, ob es beim Schutz unserer Lebensgrundlagen vorangeht oder nicht.
In den letzten fünf Jahren gab es dort eine ganze Reihe wichtiger Abstimmungen. So entschied das Parlament, dass Verbrennungsmotoren bald der Vergangenheit angehören und die EU-Staaten bis 2030 auf 20 Prozent ihrer Fläche die Natur wiederherstellen müssen. Es verhinderte eine Verordnung, die den Einsatz von Pestiziden halbiert und für pestizidfreie Zonen in Siedlungen und Schutzgebieten gesorgt hätte. Zugleich schärfte es Vorgaben zur Luftqualität und beschloss immerhin ansatzweise, die Berge von Verpackungsmüll abzutragen.
PARTEIEN BEWERTET
14 Parteien sitzen für Deutschland im EUParlament (unter den 96 Abgeordneten sind auch drei parteilose), wegen der fehlenden 5-Prozent-Hürde oft mit nur ein bis zwei Abgeordneten. So vielfältig wie die
Parteienlandschaft erweist sich auch deren Abstimmungsverhalten.
Welche Positionen haben unsere Abgeordneten in Brüssel und Straßburg in den vergangenen fünf Jahren vertreten? Dafür hat der BUND mit einem europaweiten Verbändebündnis rund 30 Abstimmungen im Plenum des EU-Parlaments analysiert. Das Verhalten der einzelnen Abgeordneten bestimmt für jede Partei einen Wert von 0 bis 100 als bestmögliches Ergebnis.
Im Einzelfall hängen Sieg oder Niederlage für die Natur an wenigen Stimmen. Zwei Beispiele zeigen, was hinter den
Volt (1)
ÖDP (1)
Grüne (21)
Piraten (1)
Die Linke (5)
SPD (16)
DIE PARTEI (1)
Familien-Partei (1)
Freie Wähler (2)
CDU (23)
CSU (6)
FDP (5)
Bündnis D (1)
AfD (9)
ANDRÉ PRESCHERSPIRIDON
ist der BUND-Experte in
Zahlen steht. Anders als im Bundestag gibt es im EU-Parlament keine klassischen Regierungskoalitionen und keinen Fraktionszwang. Mehrheiten schwanken
Die Verordnung zur »Wiederherstellung der Natur« soll die Renaturierung von Ökosystemen in der EU vorantreiben. Im Parlament gab es massiven Widerstand. Am Ende stimmten die 705 Abgeordneten mit hauchdünner Mehrheit dafür. Deutschlands Abgeordnete votierten knapp dagegen. Dafür waren Grüne 20, SPD 16, Linke 5 sowie ÖDP, Die Partei, Piraten und Volt (je 1); dagegen stimmten CDU 23, CSU 6, AfD 9, FDP 5, Freie Wähler 2, FamilienPartei und Bündnis D (je 1).
Die »Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln« sollte den Einsatz von Pestiziden in der EU bis 2030 halbieren und besonders gefährliche Stoffe aus Städten, Gemeinden und Schutzgebieten verbannen. Am Ende scheiterte sie knapp, auch an deutschen Abgeordneten. Dafür waren Grüne 16, SPD 11, Linke 3 und ÖDP, Die Partei, Piraten und Volt (je 1). Dagegen stimmten CDU 17, CSU 6, AfD 7, FDP 5, Freie Wähler 5, SPD 2 und Familien-Partei 1.
So oft gaben die EUAbgeordneten deutscher Parteien (Anzahl in Klammern) von 2019 bis 2024 der




WER MACHT WAS?
Wer sich für den Schutz von Natur und Umwelt einsetzt, weiß in der Regel, was sie oder er der EU zu verdanken hat. Zur Wahl am 9. Juni sollten das alle wissen. Doch wer macht eigentlich was in Brüssel und in Straßburg?

Oist Sprecher des BUNDArbeitskreises Internationale Umweltpolitik.


b die Rettung des Wolfs vor dem Abschuss, saubere Luft in den Innenstädten, der Zustand unserer Gewässer oder die Chemikalienpolitik: Politische Fortschritte im Natur- und Umweltschutz verdanken wir heute vielfach Initiativen der Europäischen Union. Die EU beeinflusst nahezu all unsere Lebensbereiche. Darum lohnt ein genauer Blick auf ihre Struktur und Funktionsweise. Es gibt zwei Arten europäischer Gesetzgebung: Verordnungen und Richtlinien. Verordnungen setzen Regeln, die direkt in den Mitgliedstaaten der EU gelten. Richtlinien geben dagegen ein Ziel vor. Der Weg dahin und die Maßnahmen bleiben den Mitgliedstaaten überlassen.
Beide können jedoch keine neuen Gesetzentwürfe vorschlagen. Das ist bisher die Aufgabe der Europäischen Kommission. Der BUND fordert, dass künftig auch das Parlament Gesetze auf den Weg bringen kann.
Das EU-Parlament kann Gesetzesentwürfe annehmen, ändern oder ablehnen. Auch der EU-Haushalt gehört zu diesen Gesetzen. Das Parlament hat zudem die Mitglieder der Kommission und ihre Präsidentin gewählt. Und es überwacht deren Arbeit – etwa durch Untersuchungsausschüsse – und kann die Kommission durch ein Misstrauensvotum ablösen.
DIREKT GEWÄHLT
Einzig das Parlament wird als Institution direkt von den EU-Bürger*innen gewählt –das nächste Mal bei der Europawahl. Die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl prägen die politische Agenda der neuen EU-Kommission. Im Parlament ist Deutschland mit 96 von insgesamt 720 Abgeordneten am stärksten vertreten.
ÜBER GRENZEN HINWEG

PARLAMENT STÄRKEN
Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in der EU ein Zweikammersystem zur Gesetzgebung. Das Europäische Parlament und der Ministerrat teilen sich die Verantwortung als Gesetzgeber gleichberechtigt, analog dem Bundestag und Bundesrat.
Die EU-Kommission setzt sich aus einem Vertreter jedes Mitgliedslands zusammen. Das Vorschlagsrecht liegt bei den jeweiligen Regierungen. Der Rat ist je nach Fragestellung unterschiedlich besetzt, etwa mit den verantwortlichen Minister*innen der EU-Länder zum Thema Verkehr oder Landwirtschaft.
In den EU-Verträgen ist der Schutz des Klimas, der Gesundheit, der Ressourcen und der Umwelt festgeschrieben. Dieser Schutz muss konsequent verfolgt und ausreichend finanziert werden. Da Umwelt- und Klimaschäden keine nationalen Grenzen kennen, ist die EU hier die richtige Akteurin. Denn sie wirkt über die Mitgliedstaaten hinweg. So erlauben die FaunaFlora-Habitat- und Vogelschutz-Richtlinie, Europas wertvolle Natur grenzüberschreitend zu bewahren.
Ob die Europäische Union dieser Verantwortung auch in Zukunft gerecht wird, entscheidet nicht zuletzt das Ergebnis der Wahl am 9. Juni.
Das Europäische Parlament ist in Straßburg angesiedelt.


Zur Europawahl drängt der BUND darauf, die Demokratie zu verteidigen und den Green Deal zu vertiefen.
Die Europäische Union kann viel dazu beitragen, innerhalb der planetaren Grenzen ein gutes Leben für alle Menschen zu sichern. Der BUND fordert zur Europawahl deshalb einen Green Deal 2.0. Er soll den Rahmen bilden für eine ökologisch und sozial gerechte Politik und damit den bisherigen Green Deal der EU vertiefen.
Dazu muss Europa erstens seine Naturschätze an Land und zur See gemeinsam schützen. Intakte Ökosysteme sind auch unsere Lebensversicherung und Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Um die Natur besser schützen zu können, muss europäisches Recht besser durchgesetzt werden. Nötig ist vor allem eine bessere Finanzierung.
Zweitens fordern wir eine faire und nachhaltige Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Europa muss die Weichen für eine Landwirtschaft stellen, die mehr Vielfalt erlaubt und weniger Pestizide verwendet. Diesen Wandel müssen die Höfe von der EU gefördert bekommen.
Um die bäuerliche Landwirtschaft zu stärken und Investitionen in landwirtschaftliche Böden zu steuern, sollte ein europäisches Agrarstrukturgesetz verabschiedet werden. Es soll dazu dienen, das Landgrabbing und die Konzentration von Land in wenigen Händen zu verhindern.
Ferner fordert der BUND eine europäische Klimapolitik, die für einen schnellen und konsequenten Ausstieg aus fossilen Energien sorgt, den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringt und dabei niemanden in der Gesellschaft zurücklässt.
Viertens muss die EU eine giftfreie Umwelt sicherstellen und den Ressourcenverbrauch drastisch reduzieren, speziell im globalen Süden. Konkret fordern wir zum Beispiel ein europäisches Gesetz zum Schutz der Ressourcen, mit verbindlichen Reduktionszielen für kritische Ressourcen wie Wasser oder etwa Kalk. Gibt es hier klare Grenzen, wird auch der Druck auf die Natur abnehmen.
Nötiger denn je ist auch, dass wir klima-, umwelt-, gesundheits- und sozialverträglich mobil sein können. Wenn die Bahn öfter fährt und Europa besser verbindet, können mehr Menschen klimafreundlich unterwegs sein. Das schließt zum Beispiel mehr Verbindungen für Nachtzüge ein.
Schließlich muss die EU dafür sorgen, dass ihre Wirtschaft und
Mehr zum Thema Alle Forderungen des BUND zur Europawahl finden Sie hier: www.bund.net/europawahl

die Strategieabteilung des
Industrie sozial-ökologisch ausgerichtet werden. Europa ist nicht allein auf der Erde. Unsere Art zu wirtschaften beeinflusst das Leben von Milliarden Menschen und die Natur und Umwelt in anderen Weltregionen. Das erfordert zum Beispiel, für unseren Konsum weniger Fläche im Ausland zu beanspruchen oder die Ausfuhr von Stoffen (wie Pestiziden) zu verbieten, die aufgrund ihrer Schädlichkeit für Mensch und Umwelt in der EU längst verboten sind.
Umweltpolitik kann nur erfolgreich sein, wenn eine Reihe von Rahmenbedingungen erfüllt ist. Dazu gehört das Vertrauen und eine aktive Teilhabe der Gesellschaft an Entscheidungsprozessen. Darum ist es so wichtig, am 9. Juni wählen zu gehen und einer Partei die Stimme zu geben, die sich für ein demokratisches Europa einsetzt.

 LIA POLOTZEK
leitet
BUND.
LIA POLOTZEK
leitet
BUND.

Am 21. März entschieden die EU-Staats- und Regierungschefs, Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina aufzunehmen. Dazu ein Gespräch mit Tihomir Dakić vom BUND-Partner »Centar za životnu sredinu« (Zentrum für Umwelt).
Tihomir, was sind die Schwerpunkte eurer Arbeit?
Wir versuchen die Politik fachlich zu beeinflussen, die Öffentlichkeit für Umweltfragen zu sensibilisieren und mit anderen Verbänden, Netzwerken und Institutionen auch international zusammenzuarbeiten.
Unsere Kernthemen sind Energiepolitik und Klimawandel, biologische Vielfalt und Schutzgebiete, urbane Mobilität, Stadtplanung und Abfall. Und unser AarhusCenter, das den zivilgesellschaftlichen Umweltdialog fördert. Unsere Vision ist eine gerechte Gesellschaft im Einklang mit der Natur.
Womit seid ihr derzeit ganz besonders konfrontiert?
Umweltschutz in Bosnien und Herzegowina ist eigen und sehr herausfordernd. Das Land ist in zwei Entitäten, einen Distrikt und zehn Kantone unterteilt. Es gibt eine riesige Verwaltung, die meist nicht richtig funktioniert. Als Protektorat ist die Souveränität unseres Landes eingeschränkt. Einen Teil der Staatsgewalt übt der Hohe Repräsentant aus, der Deutsche Christian Schmidt vertritt hier die internationale

Gemeinschaft. Diese politische und finanzielle Einmischung hemmt die gesellschaftliche Entwicklung erheblich.
Wie beurteilst du die nun konkrete Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft eures Landes?
Diese Perspektive ist für die allermeisten unserer Bürger seit Langem wichtig. Ob unser Land Teil der EU wird, ist vor allem eine geopolitische Entscheidung. Es beunruhigt uns, dass der Beitrittsprozess so lange dauern wird. Viele Menschen haben das Land schon verlassen, um woanders zu leben und zu arbeiten.
Außerdem sind ausländische Investoren stark an unseren Rohstoffen interessiert. Bis strenge EU-Vorschriften wie Natura 2000 bei uns gelten, können 15 und mehr Jahre vergehen. Wir fürchten, dass unser Land bis dahin weiter an Einwohnern und natürlichem Reichtum verliert.
Kürzlich wurde im Nordosten des Landes ein großes Lithiumvorkommen entdeckt. Ihr seht den Abbau kritisch. Warum? Mehrere Konzerne haben Bosnien und Herzegowina nach Lagerstätten kritischer

»Bosnien-Herzegowina ist keine Bergbau-Kolonie« steht auf dem Banner unserer Verbündeten.


Rohstoffe erkundet. Das britische Unternehmen Adriatic Metals dürfte bald als erstes mit dem Abbau beginnen. Die EU braucht diese Rohstoffe für die Energiewende. Warum aber sollen wir die negativen Folgen des Abbaus tragen, wenn in Deutschland oder Österreich weit mehr Lithium in besserer Qualität vorkommt? Soll Bosnien und Herzegowina zu einer Kolonie der westlichen Volkswirtschaften werden oder zu einem gleichberechtigten Partner? Für uns eine der drängendsten Fragen rund um den EU-Beitritt.
Europa steht vor großen Veränderungen. Was erwartest du nach der Europawahl? Leider oder zum Glück verbindet die EU Länder mit eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Jedes Land sollte daran arbeiten, die Korruption bei sich zu beseitigen, dabei denke ich auch an all das Geld dubioser Investoren vom Westbalkan. Die Energiewende in der EU kann nur gelingen, wenn der Verbrauch gesenkt wird. Eine große politische Herausforderung wird es sein, die Bürger dazu zu bringen, insgesamt weniger zu konsumieren. Was auch heißt, weniger weite Reisen zu fördern oder dafür zu sorgen, dass wir Geräte wie früher selbst reparieren können.
Mit Tihomir Dakić sprach Celia Zoe Wicher.
Tihomir Dakić ist seit 2021 Präsident von »Centar za životnu sredinu«.



LANDWIRTSCHAFT UND GENTECHNIK
Aktuell erlebt die EU zahlreiche Änderungen in der Agrarpolitik. Vom Ausgang der Wahl hängt auch die Nachhaltigkeit unserer Landwirtschaft ab.
Die Landwirtschaft ist mit Abstand der größte Posten im EU-Haushalt. Die Verwendung dieser Gelder muss aus Sicht des Umweltschutzes nachhaltiges Wirtschaften fördern statt kurzfristigen Profit. Leider geschieht im Moment genau das Gegenteil.
Im April hat das EU-Parlament Umweltleistungen wie die nichtproduktiven Flächen für mehr Biodiversität, eine verbindliche Winterbegrünung und eine obligatorische vielfältige Fruchtfolge ausgesetzt. Dies ist ein Schlag ins Gesicht zukünftiger Generationen. Bodenerosion, Rückgang der Biodiversität und Mindererträge in der Zukunft sind nur einige Folgen, die in Kauf genommen werden für die Aussicht auf kurzfristige Wahlerfolge und die Interessen der Agrarindustrie.
PRAKTIKERRAT
Welche politischen Signale kommen aus Bayern? Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat den sogenannten »Praktikerrat« einberufen. In diesem Gremium haben Landwirtschafts-

verbände und neben dem BN weitere Verbände aus dem Natur- und Umweltschutz mitgearbeitet. Unter der Frage wie eine Gemeinsame Europäischen Agrarpolitik (GAP) aussehen muss um bayerische Familienbetriebe zu erhalten wurde kontrovers diskutiert. Bei Redaktionsschluss lag das Ergebnis noch nicht vor. Allerdings liegen für die Landwirtschaft aus der Zukunftskommission Landwirtschaft und der Borchert-Kommission zur Tierhaltung gute Vorschläge zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft vor. Es mangelt also nicht an guten Vorschlägen, sondern an deren Umsetzung auf bayerischer wie auch auf Bundesebene. Was Europa braucht, ist eine Strategie, die den Erhalt von kleinen und mittleren bäuerlichen Betrieben sichert. Für diese Betriebe muss auf europäischer Ebene endlich auch die Marktordnung angefasst werden, um die Bedingungen strukturell zu verbessern.
Wird die Gentechnik auf europäischer Eben dereguliert? Die Gesetzesvorlage
Eine immer noch industriellere Landwirtschaft darf nicht das Ziel europäischer Agrarpolitik sein.

BN-Agrarreferent
der EU-Kommission dazu wurde im EUParlament angenommen. Dank erfolgreicher Änderungsanträge ist aber für die sogenannten neuen Gentechniken nun eine Kennzeichnung vorgesehen, und die Rückverfolgbarkeit soll gewährleistet werden.
Das Verhalten der Abgeordneten von CSU und Freien Wählern zeugte dabei von Mutlosigkeit gegenüber den Interessen Bayerns. Obwohl sich der Freistaat 2014 zur gentechnikfreien Region erklärt und die Gentechnikfreiheit im Naturschutzgesetz verankert hat, glänzten die Abgeordneten durch Abwesenheit oder enthielten sich der Stimme. Hätten die Abgeordneten aus den Parteien der bayerischen Staatsregierung dagegen gestimmt, hätte die Chance bestanden, dass Gesetz im EUParlament zu stoppen und Bayern damit auch in Zukunft gentechnikfrei zu erhalten. Nun wird die Gesetzesvorlage mit in die neue Legislaturperiode der EU genommen – die Unsicherheit bleibt.
HARALD ULMER




Von geschützten Naturräumen bis hin zu grenzüberschreitenden Naturschutzprojekten: Die EU macht’s möglich! Eine gemeinsame Exkursion der deutschen Alpin- und Umweltorganisationen zeigte eindrucksvoll die Bedeutung der EU-Gesetzgebung und der Zusammenarbeit für den Erhalt unserer einzigartigen alpinen Landschaft. Eingeladen waren die Kandidat*innen für das EUParlament, um ihnen ein Bewusstsein für die Errungenschaften und die offenen Baustellen der EU mit auf ihren Weg nach Strassburg zu geben. Mehrere Umweltorganisationen hatten sich zum Ziel gesetzt, den (vielleicht) künftigen Abgeordneten die beeindruckenden Errungenschaften des Naturschutzes in den bayerischen Alpen näherzubringen. In Graswang hießen Vertreter*innen von CIPRA, BUND Naturschutz, den NaturFreunden, dem Deutschen Alpenverein und anderen Verbänden die Gäste willkommen. Gemeinsam machte sich die Gruppe auf den Weg entlang des Betts der Linder in Richtung Bergwald und lernte die Bedeutung von Bergwäldern als Schutzgebiete kennen.

Am Flussbett der Linder entlang führte die Exkursion durch das Ammergebirge.
Umweltorganisationen zeigten Kandidat*innen für das EU-Parlament die Errungenschaften des Naturschutzes in den bayerischen Alpen.
Während der Wanderung wurden in Naturschutzgebieten verschiedene Ökosysteme mit hoher Biodiversität auf kleinstem Raum erkundet, vor allem in Natura 2000 und INTERREG-Projekten. Diese haben im bayerischen Alpenraum maßgeblich zur Erhaltung der Landschaft beigetragen und eine Vielfalt von Lebensräumen erhalten, so etwa Bergwald, Feuchtgebiete und Moore. Viele gefährdete Arten finden hier noch ein Zuhause, zum Beispiel Orchideenarten, Heuschrecken oder Rauhfußhühner.
FORTSCHRITTE
Ein Besuch des Ettaler Weidemooses bot Gelegenheit, die Rolle von Mooren als CO2-Senken zu verstehen und über die grenzüberschreitende Vernetzung mit Tirol zu diskutieren. Höhepunkt der Veran-
staltung war ein Gespräch in Ettal, bei dem die Teilnehmer*innen über Themen wie das geplante Restoration Law der EU, die Bedeutung Erneuerbarer Energien im Einklang mit dem Naturschutz und die Herausforderungen des Klimaschutzes in den Alpen diskutierten.
»Diese Exkursion war eine einzigartige Gelegenheit für uns als Umweltorganisationen, den Kandidat*innen die konkreten Auswirkungen der EU-Gesetzgebung auf den Naturschutz vor Ort zu zeigen«, sagte Axel Doering, Präsident von CIPRA Deutschland und Vorsitzender der BNKreisgruppe Garmisch-Partenkirchen.
»Wir hoffen, dass wir ihnen die bedeutenden Fortschritte im Naturschutz in den bayerischen Alpen demonstrieren konnten, die europäische Gesetzgebung möglich gemacht hat.«
Foto: Michael Schödl


Im Frühjahr 2024 startete der BN erstmals die Hummel-Challenge – ein spielerischer Wettbewerb für alle Naturbegeisterten.
Ziel der Aktion ist es, in einer bestimmten Zeit so viele verschiedene Hummelarten wie möglich zu finden. Wer die meisten Arten fotografiert, gewinnt. Melden kann man die Tiere über die Smartphone-App ObsIdentify oder über die Webseite Observation.org. Hört sich einfach an? Ist es auch. Hinter diesem Mitmachangebot steckt ein großangelegtes, mehrjähriges CitizenScience-Projekt des BUND Naturschutz, des Thünen-Institut in Braunschweig und Observation.org. Gemeinsam wollen die Partner mehr über die Verbreitungsgebiete und die Vielfalt der Hummelarten in Bayern und ganz Deutschland herausfinden, denn eine repräsentative Datengrundlage gibt es nicht. Das soll sich nun ändern.
Zukünftig werden jedes Jahr im Frühling (20. März – 9. April) und im Sommer (20. Juni – 3. Juli) immer im gleichen Zeitraum Hummelerfassungen in Form von Challenges stattfinden. Der Fokus der Datenerfassung im Frühjahr liegt auf den Hummelköniginnen, im Sommer zusätzlich auf den Drohnen und Kuckuckshummeln. Die über Observation.org gesam-
melten Funde sollen die Daten des Wildbienen-Monitorings des Thünen Instituts ergänzen und eine Datengrundlage für die Forschung liefern, denn anhand der Geodaten ist nachvollziehbar, wo welche Hummelarten gesichtet wurden. Auch die Blüte, auf der eine Hummel fotografiert wurde, kann für eine spätere Auswertung wichtig sein.
Alle hochgeladenen Hummel-Sichtungen im Projektzeitraum zählen automatisch zur Challenge dazu. Den persönlichen Ranglistenpatz findet man in der App, wenn man diese Einstellung in seinem Benutzeraccount aktiviert hat. Außerhalb des Projektzeitraums sind Hummeldaten ebenfalls willkommen und werden auf der Naturmeldeplattform Observation.org gespeichert. Diese Daten stehen für die Erstellung Roter Listen, Atlasprojekte oder auch für die Naturschutzarbeit vor Ort zur Verfügung. Sie fließen außerdem in internationale Auswertungen ein.
Für eine Teilnahme an dem CitizenScience-Projekt ist keine Artenkenntnis notwendig, da die automatische Bilderkennung durch KI in der App und auf der
Sie möchten mitmachen? So funktionierts:
1. Registrieren Sie sich bei observation.org.
2. Laden Sie sich die kostenlose App ObsIdentify herunter.
3. Gehen Sie raus in die Natur und versuchen Sie so viele verschiedene Hummelarten wie möglich zu finden.
4. Machen Sie mit dem Mobiltelefon ein Foto von der Hummel. Die App bestimmt die Hummelart.
5. Laden Sie Ihre Beobachtung über ObsIdentify in Ihr Konto hoch. Fertig!
Naturmeldeplattform bei der Bestimmung hilft. Außerdem werden alle Datensätze noch einmal von Expertinnen und Experten überprüft und möglicherweise korrigiert, falls die KI einen Fehler gemacht hat. Es kann auch vorkommen, dass auf dem Foto nicht alle relevanten Merkmale zur Bestimmung erkennbar sind. Ist das der Fall, wird die Hummel als »unbestimmte Hummel« (Bombus spec.) gewertet und erscheint nicht als erkannte »Art« in der Ergebnisliste. Auch Hummelarten, die sich stark ähneln und oft nur unter dem Mikroskop sicher bestimmt werden können, werden in einem Art-Komplex zusammengefasst.
Am besten jetzt schon vormerken: Die Hummel-Challenge im Sommer findet von 20. Juni bis 3. Juli statt. Martina Gehret
Mehr Infos
über Hummeln und die Challenge finden Sie unter: hummel-challenge

Die neue Bestimmungshilfe für Hummeln können Sie hier bestellen: www.bn-onlineshop.de
Deutschlandweit haben rund 3000 Hummelbegeisterte bei der Challenge mitgemacht und rund 10 000 Beobachtungen auf Observation.org hochgeladen. Dabei wurden 18 verschiedenen Arten entdeckt. Besonders gefreut hat uns dabei der einmalige Fund der Bergwaldhummel im Ammergebirge.
Die Erdhummel wurde am häufigsten fotografiert, was typisch ist für das zeitige Frühjahr. Auf manchen Fotos konnten sich ähnelnde Hummeln nicht ausreichend identifiziert werden und wurden deshalb sogenannten Sammelgruppen zugeordnet. Rund 350 Hummeln konnten aufgrund schlechter Fotoqualität nicht bestimmt werden. Die Rangliste der


Die Kreuzotter ist faszinierend –und gefährdet. Sie ist das Reptil des Jahres 2024. Da die Zahl der Tiere vielerorts stark zurückgegangen ist, begegnen wir ihnen nur noch selten. In vielen Landkreisen Bayerns wissen wir nicht, wie es der Art heute geht. Auch andere Reptilienarten wie Schlingnatter und Waldeidechse haben stark abgenommen. Die eingeschleppte Mauereidechse breitet sich hingegen in Siedlungen und an Bahnlinien aus. Der BUND Naturschutz will mehr über die Situation von Kreuzottern und Co. erfahren – mit Ihrer Unterstützung. Falls Sie eine Schlange

Hummel-Challenge nach Arten sortiert sieht demnach so aus:
Rang- Top Ten der Hummel-Arten, liste die in Bayern entdeckt wurden
1 Erdhummel-Sammelgruppe
2 Wiesenhummel
3 Ackerhummel
4 Steinhummel
5 Baumhummel
6 Gartenhummel
7 Gartenhummel-Sammelgruppe (Bombus hortorum/ruderatus/ argillaceus)
8 Ackerhummel-Sammelgruppe (Bombus pascuorum/humilis/ muscorum)
9 Bunthummel
10 Keusche Kuckuckshummel/ Böhmische Kuckuckshummel
KREUZOTTER & CO.
oder Eidechse entdecken, melden Sie bitte das Tier über die App ObsIdentify oder Observation.org.
Wichtiger Hinweis: In den Benutzereinstellungen der Plattform oder in der Meldung direkt können Sie die Fundorte sensibler Tierarten verstecken. Die Kreuzotter ist eine solche sensible Tierart. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Verbergen einer Tierart auf der Plattform haben, melden Sie sich unter artenschutz@bund-naturschutz.de. Gerne helfen wir Ihnen weiter. Viele Reptilien leben in störungsempfindlichen Lebensräumen. Bitte fotografieren sie die Tiere daher nur vom Weg aus und berücksichtigen Sie zeitliche Betretungseinschränkungen, zum Beispiel aus Gründen des Vogelschutzes.



Es ist möglich, in der Verpachtung von Äckern und Wiesen einen nachhaltigen Weg zu gehen. Vom Wunsch bis zur Umsetzung unterstützen wir Sie kostenfrei – damit landwirtschaftliche Flächen nicht nur eine Zahl in der Steuererklärung sind, sondern Boden, für den man Verantwortung übernimmt.
WENIGER PARKPLÄTZE
Autos belasten unsere Städte auch, während sie den Großteil des Tages nur herumstehen. Sie beanspruchen viel öffentlichen Raum, der anders weit besser genutzt werden kann.

EJOSEPHINE MICHALKE ist die Sprecherin des BUND-Arbeitskreises Mobilität.
s könnte so schön sein: mehr Bäume an den Straßen, mehr Sitzmöglichkeiten, Spielplätze oder Fahrradbügel. Stattdessen aber Unmengen von Blech. Parkende Autos gehören in deutschen Ballungszentren zum Stadtbild. Wieviel Raum sie in Anspruch nehmen, fällt erst so richtig auf, wenn ein zeitweiliges Parkverbot die Autos verbannt. Autos belegen im Durchschnitt 23 Stunden am Tag ungenutzt den öffentlichen Raum. Dabei sind öffentliche Flächen in deutschen Städten knapp und wertvoll. Für den Bau und Unterhalt eines öffentlichen Parkplatzes kommen alle auf, die Steuern zahlen. Angeboten wird der Parkraum dann noch immer meist kostenlos
oder zu niedrigen Gebühren. Die Suche nach einem freien Parkplatz sorgt zudem für grassierenden Verkehr. Satte 30 bis 40 Prozent des innerstädtischen Verkehrs entfallen auf die Parkplatzsuche.
Wie lässt sich öffentlicher Raum, den bisher der »ruhende Verkehr« belegt, besser nutzen? Dies ist ein zentrales Thema der Mobilitätswende. Die Straße gehört allen, auch jenen, die zu Fuß, mit Rad und Roller oder Bus und Bahn unterwegs sind. Der öffentliche Raum dient uns zum Flanieren und Entspannen, Einkaufen, Spielen, Kaffee trinken und anderem sozialen Miteinander. Gleichzeitig benötigen unsere Städte ganz dringend mehr Grün. Bäume und Grünflächen verbessern das Stadtklima und bieten Nischen für mehr natürliche Vielfalt.

Eine Schulstraße in Paris nach der Umgestaltung.

Gründe für die Umnutzung gibt es also viele. Der BUND fordert die Parkplätze zu verringern und gleichzeitig Alternativen zum Auto zu stärken. Dazu gehört, verbleibende Parkplätze zu verlagern und zu verteuern. Die Parkplatzgebühren sollten zumindest die öffentlichen Kosten decken, Städte wie Tübingen machen es vor.
Die Mehreinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung sollten in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und in bessere Wege für den Fuß- und Radverkehr fließen. Das verbreitete Falschparken auf Geh- wegen oder Radstreifen muss zudem entschiedener geahndet werden.
Einige europäische Städte haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht, den Parkraum zu verringern und umzunutzen. Deutschland aber hat Nachholbedarf.
Der BUND setzt sich in vielen Städten und auf verschiedenen Ebenen dafür ein, den öffentlichen Raum neu zu verteilen. Unser Bundesarbeitskreis Mobilität hat hierzu eine Broschüre erarbeitet, die Sie in Kürze unter www.bund.net/publikationen downloaden können. Ihr Titel: »Stadtraum fair teilen! Mehr Lebensqualität durch weniger parkende Autos: Wie wir den Parkraum in unseren Städten umnutzen können«.
Unsere Broschüre bietet politische Handlungsmöglichkeiten, zählt gute Beispiele aus der Praxis auf und stellt viele Aktionsideen für BUND-Gruppen vor.

PROJEKT FÜR KOMMUNEN
Artenvielfalt in Städte und Gemeinden bringen – leichter gesagt als getan. Das Projekt »KomBi« hilft jetzt dabei. Der BN ist einer der Projektträger.
Eigene Flächen, direkter Kontakt in die Bürgerschaft und enge Verbindung zu wichtigen Partnern – Kommunen haben viel Potenzial, die biologische Vielfalt zu schützen. Doch oft fehlt es an Fachwissen oder Erfahrung. Da hilft jetzt das Projekt »KomBi«, das vom BUND Naturschutz, vom LBV und von der Stadt Lohr a.Main getragen wird. Manche Gemeinden, Märkte und Städte in Bayern zeigen schon seit Jahrzehnten, was auf kommunaler Ebene alles möglich ist. »KomBi« bündelt diese Erfahrungen und begleitet interessierte Kommunen, die ihr Engagement für die Biodiversität verstärken möchten.
Der Werkzeugkasten dafür ist gut gefüllt. So können Kommunen ihre öffentlichen Grünflächen extensiv pflegen oder kommunale Wälder ökologisch bewirtschaften. Oder die Kommunen vergeben ihre Pachtflächen unter Berücksichtigung des Biodiversitätsschutzes. Eine einfach umsetzbare Maßnahme ist die Reduzierung nächtlicher Lichtverschmutzung.
Ein bereits laufendes Projekt ist die »Allianz für die Biodiversität«. Hier arbeiten der BN und elf Kommunen in den Landkreisen Bamberg, Haßberge und Coburg beim Biodiversitätsschutz eng zusammen. Aktuell sind die Gemeinden dabei, die Streuobstbestände in dem 360 Quad-
Im Projekt »Eine Allianz für die Biodiversität« arbeiten der BN und Kommunen zusammen. Aktuell werden Streuobstbestände kartiert.
ratkilometer umfassenden Gebiet systematisch zu kartieren. Danach wollen die Projektgemeinden die Streuobstwiesen wieder »auf Vordermann bringen«, zum Beispiel mit Pflegemaßnahmen und Nachpflanzungen. Ein anderer Schwerpunkt in diesem Projekt ist der Biotopverbund in den Auen kleinerer Gewässer.
Über konkrete Maßnahmen hinaus hat »KomBi« auch zum Ziel, Gemeinden in Sachen biologische Vielfalt langfristig zu ertüchtigen. Dafür werden gemeindespezifische Biodiversitätsstrategien mit umfassenden Maßnahmenkatalogen erstellt. So können Kommunen den Schutz der biologischen Vielfalt als kommunales Entwicklungsziel verankern und sich selbst mittel- bis langfristige Ziele setzen. Dabei legt »KomBi« besonderen Wert auf den Praxisbezug. Und damit das Ziel nicht an klammen Kassen scheitert, stehen Fördergelder zur Verfügung.
Um das Projekt mit Leben zu füllen, sind die Orts- und Kreisgruppen des BUND Naturschutz wichtige Partner. Über ihre politische Arbeit können sie Initiativen anregen. Bei Planungen und Umsetzungen sind dann die Gebiets- und Artenkenntnisse sowie das praktische Knowhow zur Biotoppflege und im Artenschutz von großem Wert.
Durch eine Förderung des Bayerischen Naturschutzfonds ist bis 2028 sichergestellt, dass »KomBi« als Anlaufstelle für kommunalen Biodiversitätsschutz zur Verfügung steht. Die Projektleistungen sind kostenfrei, und es muss kein Antrag gestellt werden.

Mehr zum Thema Weitere Informationen unter www.kommunale-biodiversitaet.de Kontakt: Projektmanagement
Florian Lang, Mobil: 0151/70591313, E-Mail: flang@lohr.de

 IRMELA FISCHER
IRMELA FISCHER


Mit leuchtend weißen, beim Aufblühen rosa überlaufenden, fransig behaarten Blütensternen aus dem Grün einer Feuchtwiese oder sich vor dunklem Wasser abhebend: so faszinierend präsentiert sich der Fieberklee zwischen April und Juni.
EDie Autorin arbeitet selbstständig als Naturbegleiterin und Umweltpädagogin. Sie bietet auch für den BUND Naturschutz und das NEZ Allgäu Exkursionen und Kräuterwanderungen an.
r ist eigentlich auf der ganzen Nordhalbkugel der Erde zu Hause, doch die Pflanze ist selten geworden, da ihr Lebensraum durch Entwässerung und intensive Landwirtschaft bedroht ist. Die Wiedervernässung von Feuchtwiesen und Mooren sorgt hoffentlich dafür, dass der Fieberklee (Menyanthes trifoliata) künftig wieder häufiger zu entdecken ist. Auffällig ist er auch nach der Blüte mit seinen dreizähligen Blättern und den Rispen mit rundlich-grünen Kapselfrüchten,

deren Samen vom Wind zerstreut, im Wasser und von Vögeln verbreitet werden. Mit seinen hohlen Stängeln und Blattstielen, die dem Auftrieb und der Durchlüftung am sauerstoffarmen Sumpfstandort dienen und einem hohen Gerbstoffgehalt gegen Fäulnisbildung ist der Fieberklee perfekt an feuchte oder nasse Standorte angepasst. Aufgrund seiner Filterwirkung der Wurzeln und seiner Forsthärte ist er auch ideal für den Gartenteich.
Nektar und Pollen locken Hummeln, Bienen, Wespen, Wollschweber und Schwebfliegen an. Die Fransen der Kronblätter erhöhen die Schauwirkung und dienen als Sperrhaare, um kleinere Insekten abzuhalten, die jedoch die Blätter als Versteck nutzen. Der Fieberklee ist eine beliebte Futterpflanze für Nachtfalterarten wie Nesselbär und SumpflabkrautBlattspanner – also ein Förderer der Artenvielfalt. Zudem ist er eine Pionierpflanze, die in Flachwasser vordringt, Verlandung fördert und so Lebensräume für nachfolgende Arten erschließt.
Seit der Renaissance ist Fieberklee als Heilmittel bekannt. In Lappland wurde er als Wurzelpulver zum Brotbacken verwendet, in England als Hopfenersatz zum Bierbrauen. Er ist schwach giftig in allen Teilen, aber durch Bitterstoffe sind die Blätter appetitanregend und die Magensaftproduktion fördernd (»Bitterklee«), auch bei Gallen- und Leberleiden sowie
bei Kopfschmerzen und Fieber verwendbar. Letzteres ist nicht nachgewiesen, Fieberklee hilft aber bei Nässe und Kälte, wirkt kühlend und entzündungshemmend. Überprüfen können dies alle, die Fieberklee im Garten haben, die Wildsammlung ist verboten!
Wasser- oder Sumpfpflanzen, weltweit über 60 Arten
In Mitteleuropa sind nur zwei Arten vertreten:
Dreiblättriger Fieberklee (Menyanthes trifoliata): Sumpf- und Wasserpflanze, terrestrisch in Feuchtgebieten bis halb untergetaucht in Flachwasserzonen, Rote Liste Bayern 3, gefährdet
Europäische Seekanne (Nymphoides peltata): Wasserpflanze, Blätter ähnlich wie kleine Seerosen, aber gelbe Blüten, Rote Liste Bayern 1, vom Aussterben bedroht
Beide Arten besonders geschützt durch Bundesartenschutzverordnung Als Heilmittel vorsichtig dosieren. Nicht geeignet bei Durchfall, Magenoder Darmgeschwüren sowie während Schwangerschaft und Stillzeit!


AKTIV FÜR DEN ARTENSCHUTZ
Fledermäuse brauchen Dunkelheit. Der BUND Naturschutz setzt sich dafür ein, dass die kleinen, nachtaktiven Flieger nicht durch übertriebene Beleuchtung vergrault werden.

ANDREAS ZAHN
BN-Artenschutzexperte
Kirchendachstühle sind wichtige Sommerquartiere für viele Fledermäuse. Hier fühlen sich zum Beispiel das Große Mausohr, die Wimperfledermaus, die Kleine Hufeisennase sowie das Graue und das Braune Langohr wohl. Werden Kirchen aber nachts angestrahlt, kann dies die dort lebenden Fledermäuse beeinträchtigen, wenn das Licht auf ihre Ausflugsöffnungen fällt. Entweder geben die Tiere die Quartiere auf oder sie fliegen später aus und finden dann weniger Nahrung. Dadurch verringert sich der Fortpflanzungserfolg.
Im Sommer 2023 haben deshalb 32 Kreisgruppen des BUND Naturschutz bei 361 Kirchen in ganz Bayern die Beleuchtungssituation überprüft, wobei der Schwer-

punkt auf bekannten Fledermauskolonien lag. Die Aktion wurde vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale gefördert. Eine erste Bilanz fällt positiv aus: Nur 42 Kirchen werden angestrahlt. Lediglich in sechs Fällen musste ein Verstoß gegen die gesetzlich vorgeschriebene Abschaltung um 23 Uhr – ein Erfolg des »Bienen-Volksbegehrens« –festgestellt werden. In diesen Fällen setzt sich der BN bei den Kirchengemeinden für einen Verzicht auf die nächtliche Beleuchtung ein, auch im Hinblick auf die dadurch mögliche Energieeinsparung. Wie BN-Aktive berichteten, haben einige Kirchengemeinden bereits aus eigener Initiative jüngst die Beleuchtung reduziert oder abgestellt, was der BN sehr begrüßt. Leider stellten die Kreisgruppen aber immer wieder fest, dass Straßenlaternen die Kirchenumgebung sehr aufhellen. Dadurch werden Flugwege lichtsensibler Fledermausarten unterbrochen. Eine Neubesiedlung von Kirchendachböden
durch Fledermäuse ist sehr erschwert. Das betrifft Arten wie die Kleine Hufeisennase, deren Bestände sich nach starkem Rückgang im vergangen Jahrhundert mittlerweile gut erholen. Doch die Art ist bei der Wiederausbreitung in Bayern auf Quartiere angewiesen, die sich über dunkle Flugwege erreichen lassen.
Der BN wird sich deshalb verstärkt für Erhalt und Neuschaffung dunkler Korridore in unseren Siedlungen einsetzen. Für einen nachhaltigen Fledermausschutz bittet der BN alle Mitglieder, auch in Zukunft auf nächtliche Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und die verpflichtende Abschaltung um 23 Uhr zu achten. Entsprechende Fälle sollen der Kreisgruppe, der Naturschutzbehörde am jeweiligen Landratsamt oder der Stadtverwaltung kreisfreier Städte mitgeteilt werden.
SCHUTZ FÜR GEFÄHRDETE ARTEN
Die Waldbirkenmaus galt in Deutschland lange als ausgestorben. Doch nach einem Fund 2018 gelangen im Bayerischen Wald gleich mehrere Nachweise – 2023 auch dank Fotofallen. BN-Aktive helfen bei der Suche.
Gerade einmal 5 bis 11 Gramm bringt das winzige Tierchen auf die Waage. Ohne den langen Mäuseschwanz ist es etwa 5 bis 7 Zentimeter lang. Und kaum jemand hat es bisher in Deutschland zu Gesicht bekommen. Dennoch wissen wir: Im Bayerischen Wald hat die extrem seltene Waldbirkenmaus ein Zuhause gefunden.
Durch einen Aufruf des Bayerischen Landesamtes für Umwelt wurde die Art erstmals seit Jahrzehnten im Bayerischen Wald wiederentdeckt. Seit 2018 sind Ehrenamtliche des BUND Naturschutz und
des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) auf der Suche nach dem Kleinsäuger. Auf mehreren Flächen im Landkreis FreyungGrafenau wurden Fotofallen aufgestellt, die von Aktiven vor Ort regelmäßig überprüft werden. Angeleitet vom BirkenmausExperten David Stille, konnten sie die Art mehrfach auf BN-Flächen im Inneren Bayerischen Wald, direkt am Grünen Band, nachweisen. Ohne diese neue Technik wären die Nachweise wohl kaum möglich gewesen, denn die Waldbirkenmaus (Sicista betulina) bekommt kaum jemand zu Gesicht.

Gut zu erkennen ist der Winzling in natura und auf Bildern durch einen dunklen Aalstrich auf dem Rücken. Die Maus ernährt sich vorwiegend von Insekten, aber auch Früchten und Beeren sowie Grassamen. Diese findet sie in einem kleinräumigen Mosaik feuchter Lebensräume und insektenreicher Wiesen und Gebüsche. Die Waldbirkenmaus hält einen langen Winterschaf: oft vom September bis in den Mai hinein.
Neun Vorkommen wurden bisher nachgewiesen. 2023 weiteten die Aktiven nun ihre Suche aus: Auf sieben Grundstücken von BN und LBV wurden 17 Fotofallen aufgestellt. Und tatsächlich: Die Auswertung der Fotofallen erbrachte neue Nachweise! Damit erhöht sich die Zahl der Flächen mit bekannten Waldbirkenmausvorkommen im Bayerischen Wald auf insgesamt 20 Flächen. So erfreulich diese Entwicklung auch ist – die Bestände bleiben bedroht. Denn die Fundstellen sind isoliert und nicht miteinander verbunden, so dass eine genetische Verarmung droht.
Die Ehrenamtlichen werten aber nicht nur Bilder aus, sondern sind auch mit Rechen, Spaten und Säge für den Winzling im Einsatz: Sie optimieren die Lebensräume der Waldbirkenmaus und gestalten ein Mosaik aus gemähten und ungemähten Streuwiesen, Moorflächen und Hochstaudenfluren. Magerrasen, die der Maus als Nahrungsraum dienen, werden erhalten und gepflegt, indem die Ehrenamtlichen aufwachsende Fichten entfernen. So entstehen neue Wanderkorridore für die Maus. Diese sind besonders wichtig,
Das Projekt »Quervernetzung Grünes Band« wird gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie durch den Bayerischen Naturschutzfonds.


Sicista betulina
Unterklasse: Höhere Säugetiere (Eutheria)
Ordnung: Nagetiere (Rodentia)
Gattung: Birkenmäuse (Sicista)
Status: deutschlandweit stark gefährdet
Schutz: europaweit geschützt laut FFH-Richtlinie
damit die bisher vereinzelten Populationen sich finden und durchmischen können. Auch »Trittsteine«, so das Resümee der Auswertung von 2023, können der Maus bei der Weiterverbreitung helfen. Dazu gehören zum Beispiel Totholzhaufen, Gehölzgruppen oder hohes Gras. Hier findet die Art Deckung und damit Schutz vor Fressfeinden.
Viele der Aktivitäten im Landkreis Freyung-Grafenau finden inzwischen im Rahmen des Quervernetzungsprojekts am Grünen Band statt. Betreut wird es von Tobias Windmaißer vom Grünes-BandBüro. Er berichtet, dass es in ganz Deutschland nur drei kleine Vorkommen der Waldbirkenmaus gibt: im Bayerischen Wald, im Allgäu und in Schleswig-Holstein. Heimisch ist das kleine Tierchen vor allem in nördlicheren Regionen. »Bei uns ist sie eigentlich ein Eiszeit-Relikt«, so Tobias Windmaißer. So klein die Maus ist, so groß sind jedoch ihre Ansprüche an die Vielfalt ihres Lebensraumes: Im Sommer sucht sie gern Feuchtgebiete auf, wo sie Nahrung findet. In Hochstauden sucht sie Deckung. Für den Winterschlaf benötigt sie jedoch einen Hohlraum, der frostsicher und trocken ist – also einen anderen Biotoptyp. Eine solche Vielfalt gibt es heute nur noch selten. (lf)

Seit fast einem halben Jahrhundert ist Karel Kleijn in der Vorstandschaft der BN-Kreisgruppe FreyungGrafenau. Seit vielen Jahren betreut der Biologe auch BN-Flächen.
Natur+Umwelt: Karel, was macht eigentlich ein ehrenamtlicher Flächenbetreuer – abgesehen von der Auswertung der Fotofallen?
Karel Kleijn: Wir überlegen, meistens gemeinsam mit Tobias Windmaißer vom Projekt Quervernetzung Grünes Band: Was ist hier zu tun? Soll die Fläche gemäht werden? Soll sie beweidet werden? Steht eine Entbuschung an? Welche Maßnahme muss jährlich gemacht werden, welche öfters?
Was bringen die Flächenankäufe?
Wir können hier echt was erreichen! Auf den BN-Flächen haben wir schon mehrere Arten entdeckt, die in Deutschland als ausgestorben galten, zum Beispiel bei Spinnen oder Tagfaltern. Der Ankauf ermöglicht uns die Gestaltung von Lebensraumelementen oder optimalen Nahrungsflächen. Am Wagenwasser gibt es jetzt auf zwei Flächen Steinhaufen und -riegel als Überwinterungsraum und ein besseres Angebot an Hochstaudenfluren.
Wie kam es, dass du an der Suche nach der Waldbirkenmaus beteiligt bist? Ich war von Anfang an dabei und habe
Vorschläge gemacht, wo wir Fotofallen platzieren können. Damit hatte ich eine hohe Trefferquote.
Außer der Waldbirkenmaus sind auch eine ganze Reihe anderer Tiere von den Fotofallen abgelichtet worden … (lacht) Ja, das stimmt. Die »Beifänge« sind bei den Fotofallen eigentlich fast das Beste! Es wurden andere Mausarten wie Haselmäuse fotografiert, aber auch Ringelnattern, Blaukehlchen, Neuntöter und Waldeidechsen.
Wie geht es weiter in Sachen Waldbirkenmaus?
Wir brauchen mehr Kenntnisse, denn vieles an dieser Art ist rätselhaft. Zum Beispiel hat die Waldbirkenmaus einen enormen Aktionsradius für ihre Größe! Wir wissen nicht, wie sie das energetisch hinbringt, so weit zu laufen. Weitere Forschung ist auch notwendig im Hinblick auf ihre Nahrung und die Vegetation, die sie braucht. Wir wissen so wenig, weil früher das wissenschaftliche Interesse an Kleinsäugern gering war.
Interview: Luise Frank

Er schlägt Haken, springt bis zu drei Meter weit und erreicht 80 km/h. Doch das tut der Feldhase nur, wenn seine Tarnung aufgeflogen ist und er sich vor Habicht, Fuchs, freilaufenden Hunden oder Jäger*innen retten muss.
Ansonsten verlässt er die Mulde, in der er ruht, erst abends, um Kräuter und Gräser, Wurzeln oder junge Baumrinde zu fressen. Nur zur Paarungszeit im Frühling sind Hasen tagsüber aktiv.
Ursprünglich ein Steppenbewohner, profitierte der Feldhase jahrhundertelang von der Landwirtschaft. Äcker, Wiesen und Weiden boten reichlich Nahrung und Deckung. Doch weil der Mensch seine Lebensräume immer stärker zerschneidet und intensiver nutzt, gilt der Feldhase heute als gefährdet. Der BN kämpft für sein dauerhaftes Bleiberecht in einer vielfältigen Kulturlandschaft.



DBEATE RUTKOWSKI
Stellvertretende BN-Vorsitzende
UWE FRIEDEL
BN-Wolfsexperte
er BUND Naturschutz hat ein neues Positionspapier erarbeitet, das vorschlägt, Tierart und Alter der Weidetiere bei Überlegungen zu Wolfsentnahmen zu berücksichtigen. Ausgleichzahlungen nach Rinderrissen sollen auch ohne Herdenschutz gewährt werden.
Der Herdenschutz auf den Almen und Alpen ist oft schwierig und manchmal einfach nicht machbar. Gleichzeitig legen Erfahrungen aus anderen Ländern nahe, dass es auch ohne Herdenschutzmaßnahmen wenig Risse an über einjährigen Rindern geben wird. Auf dieser Basis hat der BN seine Haltung zu Wolfsentnahmen im Alpenraum angepasst.
»Mit dem neuen Papier wollen wir einen Schritt auf die Alm- und Alpbauern und -bäuerinnen zugehen«, erklärt der BN-Vorsitzende Richard Mergner. »Dies bedeutet auch, dass wir unsere bisherige Position ein Stück weit öffnen. Nach sorgfältiger, fachlicher Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass in bestimmten Fällen Wölfe leichter entnommen werden sollten. Klar ist aber auch: Am generellen Schutzstatus des Wolfes wird nicht gerüttelt!«
Acht Wolfsrudel haben sich 2023 in Bayern niedergelassen. Dazu streifen immer mehr Durchzügler durchs Land, so dass eine Wolfsbegegnung fast überall möglich ist. Die meisten dieser Begegnungen bemerken Menschen überhaupt nicht. Seit über 20 Jahren gibt es Wölfe in Deutschland, mittlerweile Hunderte von Rudeln. Es gab bisher keine Verletzung eines Menschen durch einen Wolf. Die Angst vor dem Wolf, genährt von vielen Lügengeschichten, die Jahrhunderte lang erzählt wurden, ist immer noch tief ver-

WOLF UND WEIDETIERE
Es war ein großer Aufreger in der Presse:
BN rückt von bisheriger Position zum Wolf ab! Wie so oft ist die ganze Wahrheit komplizierter.
wurzelt. Angriffe von Wölfen auf Menschen sind aber extrem selten und werden durch die deutsche Regelung, auffällige Wölfe frühzeitig zu schießen, wahrscheinlich sogar ganz vermieden werden.
Weidetiere dagegen sind ohne Schutz nicht mehr sicher. Dies gilt insbesondere für Schafe und Ziegen, die in Deutschland 90 Prozent der Nutztierrisse ausmachen. Während viele Menschen sich über die Rückkehr einer einst ausgerotteten Tierart freuen und den Wolf als Bereicherung unserer Natur empfinden, stehen Weidetierhaltende vor der Aufgabe, ihre Tiere
vor dem Wolf zu schützen. Zu den zahlreichen Herausforderungen, denen die Weidetierhaltung gegenübersteht, kommt nun die Sorge vor dem Wolf hinzu.
Und hier kommt die Politik der bayerischen Regierung ins Spiel. Im dauerhaften Wahlkampfmodus hat sie den Wolf ins Fadenkreuz genommen und fordert, eine Bejagung einzuführen. Bringt das den Tierhaltenden wirklich die versprochene Entlastung? Zunächst einmal: Abschüsse von problematischen Wölfen gehören zu einem funktionierenden Wolfsmanagement dazu. Sie sind unter anderem dann notwendig, wenn Wölfe gelernt haben, Herdenschutzzäune zu übersprin-

gen oder, was viel öfter der Fall ist, sich unter dem Zaun durchzugraben. Der Abschuss bleibt als letzte Lösung, wenn der Herdenschutz nicht mehr wirkt und Gefahr besteht, dass andere Wölfe sich das erlernte Verhalten abschauen. Der Großteil von Wolfsrissen an Nutztieren in Deutschland geschieht allerdings an völlig ungeschützten Weidetieren.
WOLFSVERORDNUNG
Ganz anders als diese gezielten Einzelabschüsse ist eine Bejagung der Wolfsbestände zu beurteilen. Behauptungen, dass die Wolfsbestände ohne Bejagung »ins Unendliche« wachsen würden, sind Unsinn. Fakt ist: Wolfsbestände regulieren sich selbst. Wolfsreviere, die in Deutschland aufgrund der enorm hohen Rehdichte »nur« 200 bis 250 Quadratkilometer groß sind, werden vom sesshaften Wolfspaar gegen eindringende Wölfe bis aufs Blut verteidigt. Auch ist nicht ganz Bayern als Lebensraum geeignet. In Gebieten mit wenig Waldanteil ist nach derzeitigem Wissensstand mit sesshaften Wölfen nicht zu rechnen. Es gibt also natürliche Obergrenzen für den bayerischen Wolfsbestand. Außerdem heißt es, Wölfe müssten durch flächendeckende Abschüsse »scheu« gehalten werden. Doch auch hier ist den Weidetieren nicht geholfen, denn durch Bejagung kann es nicht gelingen, den Wölfen unerwünschtes Ver-
halten – den Riss von Weidetieren – zu verleiden. Der schmerzhafte Stromschlag durch den wolfsabweisenden Zaun oder die Herdenschutzhunde dagegen schon. Die einfache Rechnung »Weniger Wölfe = weniger Risse« ist ein Trugschluss. In den bestehenden Wolfsgebieten Europas zeigt sich klar, dass die Anzahl der Nutztierrisse nicht von der Wolfsdichte abhängt, sondern von der Anzahl ungeschützter Nutztiere. Ob in einem Wolfsrevier nun zwei oder sechs Wölfe auf der Jagd sind – ungeschützte Schafe werden früher oder später attackiert. Es sei denn, die Abschussquote wäre so hoch, dass weite Bereiche Bayerns von sesshaften Tieren frei gehalten werden. Solche »wolfsfreien Zonen« sind das Ziel einiger Interessengruppen. In die Tat umgesetzt werden soll dies durch die völlig überzogene Definition von »nicht zumutbar schützbaren Weidegebieten« in der bayerischen Wolfsverordnung. Die Klage des BN dagegen befindet sich im laufenden Verfahren. Doch wolfsfreie Zonen sind rechtlich nicht möglich – und werden es auch nicht nach einer möglichen Absenkung des Schutzstatus auf europäischer Ebene sein. Wölfe wandern bis zu 80 Kilometern in einer Nacht, deshalb könnten jederzeit Wölfe von außerhalb der Zonen einwandern und Nutztiere reißen.
Im Übrigen bergen unspezifische Abschüsse auch die Gefahr, Nutztierrisse sogar zu erhöhen. Zum Beispiel wenn ein
Wolfspaar, das gelernt hat, herdengeschützte Tiere zu respektieren, dezimiert wird und der nachwandernde Wolf, der die Lücke schließt, sich erneut an Weidetieren probiert und sich nicht so leicht abschrecken lässt. Zudem kann sich bei Tötung eines Elterntieres das Jagdverhalten des verbliebenen Elterntiers vom Schalenwild zu Nutztieren verschieben. Nicht von ungefähr gibt es von Schäfern aus Wolfsgebieten Aussagen wie: »Schießt mir bloß nicht in mein Rudel.«
Noch absurder ist die Ansicht, dass Bejagung eine Alternative zu Herdenschutzmaßnahmen sein könne. Der vergleichende Blick auf Norwegen oder Schweden zeigt: In Norwegen – wo kein Herdenschutz praktiziert wird – reißt ein Wolf 40 Mal so viele Schafe als in Schweden, wo die Tiere überwiegend durch Zäune geschützt sind.
Der BN ruft die Staatsregierung dazu auf, bei der Diskussion um Wolfsabschüsse das einfache wildbiologische ABC zu berücksichtigen und ihre Hausaufgaben zu machen: Weder Herdenschutz- noch die Rissbegutachtung sind in Bayern so aufgestellt, dass notwendige Einzelabschüsse rasch und rechtlich verlässlich durchgeführt werden können.
Der BN ist durchaus bereit, über Bejagung von Wölfen zu diskutieren. Die Frage darf dann aber nicht lauten, Bejagung ja oder nein, sondern: »Können Wölfe so bejagt werden, dass zusätzlich zu den Herdenschutzmaßnahmen Nutztierrisse in bedeutendem Umfang reduziert werden?«. Grundsätzlich gilt für den BN: Die Tötung von Wölfen muss gut be gründet und alternativlos sein. Wölfe haben, wie alle heimischen Tiere, ein Lebensrecht in Bayern.

Mehr Fakten und Hintergründe zum Thema gibt es im neuen »BN aktuell« Download unter: www.bund-naturschutz.de/publikationen
WESTLICHE OSTSEE
Miesmuscheln und Seegras in der westlichen Ostsee. Solche Lebensräume sind bis heute fast überall von Grundschleppnetzen bedroht.

Die Ostsee ist überdüngt, überfischt und generell übernutzt, auch vor SchleswigHolsteins Küste. Ein Nationalpark hätte vieles zum Guten wenden können. Doch lauter Protest ließ den Plan scheitern.
Auf dem Papier wirken die Küstengewässer zwischen Flensburg und Lübeck ganz ordentlich gesichert. Etwas lückenhaft reihen sich hier europäische FFH- und Vogelschutzgebiete aneinander. Die aber sind, politisch gewollt, beinahe wirkungslos – ein Schicksal, das sie mit den meisten deutschen Meeresschutzgebieten teilen. Auch deshalb ist die westliche Ostsee seit geraumer Zeit in desolater Verfassung. Höchste Zeit, hier aktiv zu werden, da ist sich der BUND Schleswig-Holstein mit allen Umweltverbänden und Meereskundigen einig. Selbst Kiels schwarz-grüne Landesregierung beteuert das »kranke Meer vor unserer Haustüre« (Umweltminister Goldschmidt) besser schützen zu wollen.

Vor dem Bülker Leuchtturm an der Kieler Förde: Meeresschutzexpertin Stefanie Sudhaus mit Olaf Bandt (Mitte), dem Landesvorsitzenden Dietmar Ulbrich (rechts) und dessen Stellvertretern Julian Retzlaff und Jürgen Leicher (links).
Um die Chancen eines Nationalparks in der schleswig-holsteinischen Ostsee auszuloten, richtete sie von Sommer bis Herbst 2023 einen Konsultationsprozess aus. Meeresschutzexpertin Stefanie Sudhaus vom BUND-Landesverband nahm an den Workshops teil. Ihr Fazit fiel ernüchternd aus: »Eine vernünftige Diskussion war hier leider kaum möglich. Die Gegner des Nationalparks streuten Falschinformationen und schrien die Abgesandten des Umweltministeriums förmlich nieder. Speziell viele Wassersportler und Landwirte verweigerten jede Mitarbeit.«
GEMEINWOHL GEFÄHRDET
Es ist kein Gütesiegel für die Demokratie, wenn lautstarke Minderheiten erfolgreich
ihre Einzelinteressen gegen fachlichen Rat und gegen das Gemeinwohl verteidigen. Doch die Landesregierung kündigte am 19. März an, die Idee eines Nationalparks nicht weiterzuverfolgen.
Dabei sind die Befürworter*innen deutlich in der Überzahl. 54 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein bewerteten in einer repräsentativen Umfrage den Nationalpark als sinnvoll oder eher sinnvoll, nur 28 Prozent als »(eher) nicht sinnvoll«.
Bei einem Ortstermin an der Kieler Förde bekräftigte der BUND-Landesvorsitzende Dietmar Ulbrich: »Ein umfassender Schutz der Lebensräume und Arten in und an der Ostsee ist seit Jahrzehnten überfällig. Am besten könnte dies ein Nationalpark leisten.«
Foto: Dietmar Reimer Foto: Sina CloriusInfo von Herrn Zillich für Grafikerstelllung: (Vorlage liegt bei; bitte in der Karte die Städte Flensburg, Eckernförde + Kiel und die Insel Fehmarn kennzeichnen)
FEHMARN ECKERNFÖRDE
KIEL
Natura-2000-Gebiete
Naturschutzgebiete
Potenzialkulisse
Blau schraffiert die Umrisse eines Nationalparks Ostsee, wie ihn das Umweltministerium skizziert hatte.
Seit vielen Jahren sinkt vor der Küste Schleswig-Holsteins die Zahl der Fische, Schweinswale und überwinternden Enten. Am Meeresgrund breiten sich sauerstoffarme Zonen aus. Es muss also dringend etwas passieren.
SCHWACHER ERSATZ
Als Ausgleich für den verworfenen Nationalpark kündigte die Landesregierung an, acht Prozent der schleswig-holsteinischen Ostsee neu als Naturschutzgebiet auszuweisen und 4,5 Prozent der Natura-2000Flächen künftig strenger zu schützen. Hier sollen zur Vogelrast im Winter weder der Wassersport (bis auf drei Kite-Spots) noch das ganze Jahr über die Fischerei erlaubt sein. Zudem will sie bei der EU ein Verbot industrieller Fischerei in all ihren Küstengewässern beantragen.
Stellnetzfischerei an den Küsten bleibt aber generell erlaubt. Und dem Grundübel, der Überdüngung aus der Landwirtschaft, will die Regierung mit laschen freiwilligen Vereinbarungen weit unterhalb der europäischen Anforderungen begegnen.
Stefanie Sudhaus ist das zu wenig. Sie sagt aber auch: »Mit welchem Label die Ostsee geschützt wird, ist letztlich zweitrangig. Das Land muss nur endlich loslegen.« Womit sich der Blick auf die schon erwähnten FFH- und Vogelschutzgebiete richtet. Auf ihnen basiert der ursprünglich geplante Nationalpark (siehe Karte) und die nun angekündigten Schutzgebiete. Warum verfehlen sie so offenkundig ihren Zweck?
Der Meeresschützerin ist klar, warum: »Ihre Maßnahmenpläne verweisen nur vage auf europäische Richtlinien, ohne je ins Detail zu gehen. Und von einer regelmäßigen Überwachung der Gebiete, wie die EU sie fordert, kann keine Rede sein.« Sprich: Die Meeresschutzgebiete gibt es vor allem auf dem Papier.
Olaf Bandt, der sich als Vorsitzender des BUND vor Ort ein Bild machte, fasste zusammen: »Wir fordern 30 Prozent der schleswig-holsteinischen Ostsee von jeg-


Im Stellnetz ertrunkene Eisente. Jedes Jahr verenden auf der Ostsee überwinternde Eisenten und Samtenten zu Abertausenden in deutschen Fischernetzen. Als Brutvogel in Deutschland vom Aussterben bedroht: Sandregenpfeifer brauchen ungestörte Strandabschnitte, um sich fortzupflanzen.
licher Nutzung zu befreien, dazu das wertvollste Zehntel der Strände. Die Fischerei mit Stellnetzen, in denen unzählige Tauchenten und Schweinswale ertrinken, muss verboten werden. Und die Ostsee muss per Gesetz besser vor eingeschwemmten Nährstoffen aus der Landwirtschaft geschützt werden.«
Mit der Absage an den Nationalpark hat die Landesregierung eine große Chance vertan, findet Stefanie Sudhaus. Nationalparks beleben erfahrungsgemäß die regionale Wirtschaft. Sie helfen Fördermittel zu gewinnen, für die Wertschöpfung vor Ort oder die Forschung. Und sie bieten Bereiche für eine nachhaltige Nutzung, für Naturerlebnisse und Umweltbildung. Die Hoffnung, dass der Nationalpark einmal kommen wird, mag sie deshalb noch nicht aufgeben.
Severin Zillich
iMehr zum Thema Alle Argumente für einen Nationalpark in der Ostsee finden Sie hier: www.bund-sh.de/ meere/fuer-einen-nationalpark-ostsee
BUND + MIETERBUND
Sanierte Gebäude schützen das Klima und die Menschen, die darin wohnen. Die energetische Modernisierung muss sozial gerecht gelingen.
Gebäude verschulden einen großen Teil der deutschen Treibhausgase. Jeder dritte Mieterhaushalt ist durch die Wohnkosten überlastet, hohe Energiepreise verschärfen die Situation. Damit Deutschland auf Klimakurs kommt und die erneuerbaren Energien ressourcenschonend ausgebaut werden, müssen Gebäude energetisch modernisiert werden. Mieter*innen profitieren davon durch dauerhaft geringe Heizkosten und ein gesundes Wohnklima. Doch bisher tragen sie einen zu hohen Anteil der Investitionskosten.
Obwohl eine Modernisierung den Energieverbrauch senkt, erhöht sie häufig die Warmmiete. Denn wer vermietet, kann pro Jahr acht Prozent seiner Investitionskosten über die Modernisierungsumlage

dauerhaft auf die Miete umlegen. Damit steigt die Kaltmiete oft stärker, als die Heizkosten sinken.
Die Höhe dieser Umlage hängt von verschiedenen Faktoren ab. Förderung und Instandhaltung müssen zur Berechnung von den Gesamtkosten der Sanierung abgezogen werden. Das ist kompliziert und die Berechnung anfällig für Fehler.
Oft wird überhaupt keine Förderung in Anspruch genommen, was die Mieter*innen zu spüren bekommen. So kann eine nicht genutzte Förderung die Warmmiete für eine 70-Quadratmeter-Wohnung um 160 Euro in die Höhe treiben. Noch mehr wirkt sich aus, wie viel für die Instandhaltung abgezogen wird.
Für Vermieter*innen gibt es wenig Anreiz zu sanieren. Sie zahlen die Heizkosten ja nicht selbst. Die staatliche Förderung für Effizienzmaßnahmen ist aktuell gering und muss zudem komplett an die Mieter*innen weitergereicht werden. Zudem zahlt es sich nicht genug aus, gründlich statt nur oberflächlich zu sanieren.
SOZIALER KLIMASCHUTZ
Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Damit die energetische Modernisierung von Mietwohnungen sozialverträglich und im Einklang mit den Klimazielen gelingt, müssen die nötigen Investitionen besser zwischen öffentlicher Hand, Vermieterinnen und Mietern verteilt werden.

ist die Bundesgeschäftsführerin des BUND.

MELANIE WEBER-MORITZ ist die Bundesdirektorin des deutschen Mieterbunds.
Wie das geht, zeigt eine neue Studie des ifeu-Instituts, die BUND und Mieterbund gemeinsam beauftragt haben. Demnach soll die Modernisierungsumlage von jetzt acht auf drei Prozent gesenkt werden. Wer mietet, zahlt dann nicht mehr, als er an Energiekosten einspart. Im Gegenzug werden besonders wirksame Maßnahmen gefördert: Die Vermieter*innen erhalten die Fördermittel unmittelbar, ohne sie von den umlagefähigen Kosten abziehen zu müssen. So profitieren sie direkt von den staatlichen Anreizen, und ihre Kosten sind leichter zu berechnen.
Für Mieter*innen ist die Umlage nicht länger abhängig davon, ob zur Sanierung eine Förderung in Anspruch genommen wurde. Da die Modernisierungsumlage deutlich niedriger ausfällt, wirkt sich die Frage, ob ein großer oder kleiner Teil der Kosten für die Instandhaltung abgezogen wird, viel weniger auf die Mieterhöhung aus. Klimaschutz in Mietwohnungen wird damit wirksamer und gerechter – ein Gewinn für alle!
www.bund.net/sozialerklimaschutz-mietwohnungen
ANTJE VON BROOCK
Christiane Benner steht seit Oktober als erste Frau an der Spitze der IG Metall. Mit ihr sprach Ruth Krohn, unsere Expertin für Industriepolitik, über den sozial-ökologischen Wandel und ihre Verbindung zum BUND.
Frau Benner, Sie sind seit Oktober die erste Vorsitzende der IG Metall. Was hat Sie bewogen, dieses Amt zu übernehmen?
Vor allem ehrt es mich, einer so großen und vielfältigen Organisation vorzustehen. Und ich freue mich, an der Spitze der IG Metall die anstehenden Veränderungen zu gestalten, den technologischen Umbau zu mehr Klimaschutz. Die Umbrüche in unserer Industrie sind gravierend, bergen aber auch viele Chancen. Ich möchte gute Arbeit in unseren Betrieben sichern, die Demokratie stärken und als Gewerkschaft einen Beitrag zur nötigen Klimaneutralität leisten.
Was bedeutet die sozial-ökologische Transformation für Sie?
Uns ist es wichtig, ökologischen Wandel und soziale Aspekte zusammenzudenken. Die Beschäftigten in den Unternehmen erleben viele Veränderungen, neue Produkte und Produktionsverfahren. Wir wollen ihnen mittels starker Mitbestimmung, Weiterbildung und vieler Gespräche und Beteiligungsmöglichkeiten die Chance geben, ein Verständnis für die Umbrüche zu gewinnen und diesen Prozess motiviert mitzugestalten.
Auch angesichts der steigenden Energiekosten fordern wir zudem eine starke Industriepolitik, damit unsere Stahl- oder
Automobilkonzerne in diesem Umbruch wettbewerbsfähig bleiben. Gibt es eine faire Chance für alle Beschäftigten auf dem Weg ins dekarbonisierte Zeitalter? Das ist eine Riesenherausforderung. Ich bitte um Verständnis, wenn der nötige Wandel auch mal Schritt für Schritt erfolgt, damit wir die Menschen überzeugen und beteiligen und unsere industriellen Strukturen erhalten können.
Was verbindet den BUND und die IG Metall aus Ihrer Sicht?
Wir sind ja schon häufiger gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten, etwa mit dem Hashtag #FairWandel. Wie hängt all das zusammen, eine umweltverträgliche, die Gesundheit erhaltende Industrie, Wohlstand und Demokratie? Sehr eng!
Ich finde es toll, dass unsere Organisationen Ökologie und Soziales zusammendenken, da ist der BUND einfach ein wichtiger Bündnispartner. Wir können von euch zum Beispiel etwas über die Bedeutung der Recycling- oder Kreislaufwirtschaft lernen und hierzu technische Lösungen anbieten. Das sind ja Geschäftsmodelle für die Zukunft.
Zuletzt haben die IG Metall und der BUND u.a. Szenarien für eine Mobilitätswende erarbeitet und gemeinsame Forderungen
mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen veröffentlicht. Wo könnten wir noch zusammenarbeiten?
Ich will das Verständnis unserer jeweiligen Perspektiven für beide Seiten gewinnbringend weiterentwickeln. Gerne würde ich zur nächsten Bundestagswahl wieder gemeinsame Forderungen formulieren. Und wir sollten unser Bündnis in den Regionen vorantreiben, denn dort findet die Transformation konkret statt.
Sollte der Wandel bis 2050 geschafft sein, wie sähe unser Leben wohl aus?
Wir haben unsere industriellen Kompetenzen genutzt, um den ökologischen Umbau zu gestalten – bei der Wind- und Solarenergie, bei Speichertechnologien oder intelligenten Netzen. Starke Gewerkschaften haben diesen Wandel aktiv begleitet. Wir wirtschaften klimaneutral und exportieren ökologische Produkte. Die Mobilitätswende ist gelungen, wir können in den Städten gesünder atmen und haben es ruhiger und grüner dort. Trotz häufiger Wetterextreme ist unser Leben erträglich geblieben. Und wir sind als Gesellschaft nicht auseinandergefallen und haben eine stabile Demokratie – das gehört für mich zu einem solch positiven Szenario.
Im April traf sich der BUND-Arbeitskreis Internationale Umweltpolitik auf Rügen. Der Ort war nicht zufällig gewählt – auf der Insel entsteht derzeit eines von zwölf deutschen Terminals für Flüssiggas (LNG). Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und einen befürchteten Gasmangel hat die Bundesregierung diese neue Infrastruktur 2022 auf den Weg gebracht.
Der BUND kritisiert, dass die Anzahl der geplanten Terminals den eigentlichen Bedarf bei Weitem übersteigt. Damit zögert die Regierung ein Ende der Nutzung von fossilem Gas ohne Not hinaus. Auf Rügen traf sich der Arbeitskreis mit einer Bürger-

initiative, die sich gegen die Inbetriebnahme des Terminals wehrt.
Der Ausbau der hiesigen LNG-Infrastruktur schadet auch andernorts. So kommt das meiste Flüssiggas derzeit aus den USA, wo es oft durch umweltschädliches Fracking gewonnen wird. Schwache Umweltgesetze führen dazu, dass dort viel Methan aus Lecks entweicht. Unsere BUND-Aktiven haben sich daher auch mit

Zum 13. Jahrestag des AKW-Unglücks von Fukushima reiste eine BUNDDelegation nach Japan. Ziel der Reise war es, Solidarität mit den japanischen Anti-Atomkraft-Aktivist*innen zu zeigen und außerdem Fakten über den deutschen Atomausstieg und gegen die Propaganda der japanischen Atomlobby zu liefern.
Gruppenbild des Arbeitskreises auf Rügen
Umweltschützer*innen aus Louisiana ausgetauscht, um mehr über die Lage vor Ort zu erfahren.
Unser Partner »Friends of the Earth US« setzt sich zusammen mit lokalen Gemeinschaften dafür ein, das Fracking zu stoppen. Doch vorläufig heizt Deutschlands Energiepolitik die Nachfrage nach dem Flüssiggas kräftig an.
Celia Zoe WicherUnser Ehrenvorsitzender Hubert Weiger, der bayerische Vorsitzende Richard Mergner sowie Martin Geilhufe, Sprecher des Arbeitskreises Internationales, trafen sich mit Akiko Yoshida und weiteren Aktiven von Friends of the Earth Japan. Akiko engagiert sich seit dem Super-Gau unermüdlich gegen die Atomkraft und war schon mehrfach in Deutschland auf Vortragsreise.
»Die Propaganda der Atomlobby hat uns schockiert«, so Martin Geilhufe. In der Präfektur Fukushima wurden große Infozentren gebaut, die ein positives Bild der Atomenergie zeichnen und besonders
für Schulklassen errichtet wurden. Seit dem Gau sind Japans Reaktoren mehrheitlich nicht mehr am Netz, weil sie bei damals anberaumten Sicherheitstests durchgefallen sind. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist sichtbar, geht aber viel zu langsam voran.
Die BUND-Vertreter nahmen an Gedenkveranstaltungen am zerstörten AKW teil, hielten Vorträge und führten Gespräche mit Abgeordneten, um der Propaganda mit Fakten zu begegnen und einen Atomausstieg argumentativ zu unterstützen. Eine Veranstaltung in Hiroshima schloss die fünftägige Reise ab. lf
FUKUSHIMABAHNBRECHEND
Mit seiner erfolgreichen Klage gegen den Ölgiganten Shell schrieb unser niederländischer Schwesterverband »Milieu Defensie« 2021 Geschichte. Jetzt zieht er wieder vor Gericht – gegen die größte Bank der Niederlande. Milieu Defensie hat die ING-Bank wegen ihrer Klimapolitik verklagt. Das hat es in unserem Nachbarland noch nie gegeben. Der bahnbrechende Prozess könnte dazu beitragen, die Unterstützung des globalen Bankensektors für fossile Unternehmen und deren Geschäftspolitik zu verändern.
AUSSTOSS HALBIEREN
Nach eigenen Angaben war ING im Jahr 2022 für 61 Megatonnen klimaschädliche
Anzeige
Nah dran. Natur erleben und verstehen.

Mit BUND-Reisen können Sie aktiven Naturschutz mit Urlaub verbinden. Neben den Naturschutz-Einsätzen kommen auch kulturelle Entdeckungstouren nicht zu kurz. Erleben Sie in Kleingruppen sinnstiftendes gemeinsames Schaffen mit Hand und Herz! Unterstützen Sie Fachleute durch Tätigkeiten, die Ihren Urlaub besonders machen:
- Streuobstbestände pflegen
- Solitäreichen nachpflanzen
- Kopfweiden beschneiden
- den Auwald von morgen pflanzen
Unser Reiseangebot für 2024 finden Sie hier: www.bund-reisen.de
BUND-Reisen +49 (0)911- 58 888 20 info@bund-reisen.de Instagram: @bund.reisen • Facebook: @BUND-Reisen
Emissionen verantwortlich – mehr als beispielsweise ganz Schweden ausstößt. Im selben Jahr war die niederländische Bank der weltweit viertgrößte Finanzier von Flüssigerdgas und stellte dem Sektor mehr als 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Von allen Banken des Landes hat ING mit 15 Milliarden Euro das meiste Geld in Öl und Gas investiert. Anstatt eine sozialökologische Energiewende zu fördern, unterstützt die Bank weiter Unternehmen, die die Klimakrise verschärfen.
Laut Milieu Defensie gefährdet die größte Geschäftsbank der Niederlande damit unser aller Zukunft. Unser Partner fordert die Bank auf, ihre Emissionen (von 2019) bis 2030 zu halbieren und all ihre

Die ING-Bank investiert das ihr anvertraute Geld besonders klimaschädlich – trotz Wildtier im Logo.
Verbindungen zu Konzernen zu kappen, die keinen guten Klimaplan aufgestellt haben. Das betrifft etwa Öl- und Gasunternehmen, die weiterhin fossile Brennstoffe fördern und nicht gezielt auf einen Ausstieg hinarbeiten.
Susann Scherbarth
en.milieudefensie.nl/ climate-case-ing
Gemeinsam mit dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen produziert der BUND den englischsprachigen Podcast »[insert solutions here]. Climate meets Democracy«.
Insgesamt acht Folgen sollen zeigen, wie wir die Klimakrise angehen und gleichzeitig demokratische Prinzipien

27.–30. Juni 2024 Jetzt Tickets sichern!
fördern können. Zudem beleuchten wir die Wirksamkeit diverser Beteiligungs- und Aktivismusformate. Gäste aus Wissenschaft und Praxis teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in verschiedenen Weltregionen. Vier Episoden des Podcasts sind bereits auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.ufu.de abrufbar.
Anzeige
Sei dabei und wirke aktiv an der Gestaltung der Zukunft mit!
#Nachhaltigkeit #Community #Transformation #Wandelbewegung #Netzwerk #Vision #Coaching
U. a. mit: Gülcan Nitsch, Amandus Samsøe Sattler, Arndt Pechstein
https://wemaco.eu/create-convention/


Die Kreuzwertheimer haben es gut. Nördlich ihrer Marktgemeinde, nur durch eine Straßenunterführung abgetrennt, liegt ein Kleinod der Artenvielfalt: die Erlichsgärten.
Das Streuobstwiesenareal mit Kleingärten, Hütten, blühenden Wiesen, kleinen und großen Tieren sowie fast 3000 Obstbäumen preist der Markt Kreuzwertheim als »Paradies vor der Haustüre und europäisches Naturerbe« auf Infotafeln an. Mit Recht: So etwas hat nicht jeder.
Zu dem heutigen Streuobstareal entwickelte sich die Fläche mit der kleinteiligen Struktur und den schmalen Parzellen freilich erst, nachdem in den 60er Jahren die meisten Eigentümer die Bewirtschaftung ihrer Parzellen aufgaben. Auf den ersten Blick sieht das 45 Hektar große Areal etwas »unordentlich« aus, aber gerade das führt zu besonderer Vielfalt: Weil jede Teilfläche etwas anders bewirtschaftet wird, kommen die unterschiedlichsten Bedürfnisse zum Tragen. Wenn beispielsweise irgendwo gemäht wird, dann weichen Insekten und Vögel auf das Nachbargrundstück aus. Wenn der eine seine Bäume im zeitigen Frühjahr schneidet, die andere im Sommer nach der Ernte und
der dritte gar nicht, entsteht eine Vielfalt, die mit einem einheitlichen Pflegekonzept niemals zu erzielen wäre.
ÜBERBAUUNG
Um ein Haar wäre es Anfang der 90er Jahre mit den Erlichsgärten vorbei gewesen: Der Marktgemeinderat hatte beschlossen, das Areal in ein Bau- und Gewerbegebiet umzuwandeln. Der frischgebackene BN-Ortsgruppenvorsitzende Georg Wolpert ermutigte die Bürger, ihre Ablehnung des Vorhabens schriftlich einzureichen und zu der Bürgerversammlung gehen, die die damalige Bürgermeisterin angesichts der vielen Einwände einberufen musste. Dort bekamen sie und ihre Gemeinderäte heftigen Gegenwind. Darauf wurde der Plan erst einmal zurückgestellt. Auch zwei weitere Anläufe scheiterten. Im Laufe der Zeit schlossen sich auch andere Organisationen dem Kampf um die Rettung der Erlichsgärten an. 1995 wurden die Pläne endgültig ad acta gelegt. Fair ist, dass die Marktge-

• Ausgangspunkt: Kreuzwertheim, »In den Herrnwiesen« bzw. nach der Straßenunterführung
• Länge/Dauer: nach Belieben (Rundweg: eine knappe Stunde)
• Höhenunterschiede: gering
• Einkehr: Kreuzwertheim, Wertheim
meinde in ihren neuen Infotafeln ausdrücklich die Rolle der Bürgerschaft und des BN bei der Bewahrung der Erlichsgärten hervorhebt.
Von Kreuzwertheim aus kommt man in die Erlichsgärten über die Straße »In den Herrnwiesen« am nördlichen Ortsrand. Nach der Unterführung steht man vor dem Areal und kann entweder geradeaus gehen oder – was wir empfehlen würden – dem Weg nach rechts folgen und dann in den oberen Weg nach links einschwenken. Verlaufen kann man sich in den Erlichsgärten kaum: So groß sind sie nicht. Man kann auf den Wegen bis zum Waldrand wandern und wenn man möchte, auch weiter. Ratsam ist, sich Zeit zu lassen und einen Blick für die Vielfalt zu entwickeln, die dieses Gebiet auszeichnet. Uli RohmBerner, Winfried Berner
Mehr entdecken
Winfried Berner, Ulrike Rohm-Berner: Gerettete Landschaften

Wanderführer, Verlag Rother, 14,90 Euro Bestellung: www.bn-onlineshop.de
Blühende Pracht: Frühlingserwachen in den Erlichsgärten
Foto: HarUMWELTFREUNDLICH REISEN
Leise tuckert unser Boot in die Morgendämmerung hinaus. Wir gleiten in das Labyrinth aus Schilf, Kanälen und Seitenarmen der Donaumündung. Schließlich stoppt das Boot auf einer Lagune. Nebelschwaden liegen über dem Wasser. Im fahlen Licht erkennen wir Nacht-, Silber- und Seidenreiher, Schilfrohrsänger und Bartmeisen. Eine Schar Rosapelikane scheucht einen Fischschwarm vor sich her – ihr Frühstück. Je höher die Sonne steigt, desto lauter erwacht diese Wasservogelwelt zum Leben. Das Biosphärenreservat Donaudelta in Rumänien ist ein über 5000 Quadratkilometer großes, urwüchsiges LandWasser-Dreieck. Es bietet über 300 Vogelarten Lebensraum. In diesem größten zusammenhängenden Schilfrohrgebiet der Erde sind unsere wichtigsten Verkehrsmittel ein Hausboot (»floating hotel«) sowie Schlepp- und Ausflugsboote.
REISETERMIN
30. August – 9. Sept. 2024
Infos zu Reisepreis und Anmeldung
BUND-Reisen
ReiseCenter am Stresemannplatz
Stresemannplatz 10, 90489 Nürnberg
Tel. 09 11/5 88 88-20
www.bund-reisen.de

Ein beliebter Reiseklassiker führt auf verschlungenen Wasserwegen durch das Donaudelta und in die Steppenlandschaft der Dobrogea.
Vier Tage sind für das Erleben des Donaudeltas vorgesehen. Abends ankern wir an schönen Plätzchen, den großartigen Sternenhimmel über uns. Schließlich erreichen wir die Mündung der Donau. Wie breit und majestätisch der Strom ist, bevor er sich im Schwarzen Meer verliert! In den Seitenarmen liegen schwimmende, sich ständig verändernde Schilfrohrinseln, die Plauri. Nach einer Wanderung im Küstenbereich zieht es uns auf die Hartbodeninsel Letea.
In der pontisch-sarmatischen Waldsteppe der Dobrogea liegt der Nationalpark Munţii Măcinului. Eine kantige Landschaft empfängt uns: submediterrane Trockenwälder und grasige Berghänge, schroffe Felsen. Landschildkröten, Erdmännchen und Smaragdeidechsen haben hier ihr Zuhause ebenso wie Adonisröschen, wilde Pfingstrosen und Orchideen. Neben dem Ornithologen und Landeskenner begleiten uns immer wieder hervorragende Botaniker, ihre Kenntnisse machen unsere Rumänienreise so besonders. Wir
besuchen die einstige Handelsstadt Histria, die griechische Seefahrer im 7. Jahrhundert v. Chr. gründeten. Heute wiegt sich Steppengras zwischen den Ruinen. Aber noch immer beeindrucken die Überreste der Wohnhäuser, der Tempel, der Therme und der Basilika.
Unsere Reise führt uns Richtung Karpaten und Siebenbürgen. Hinter Buzău machen wir Halt in einer einzigartigen Kraterlandschaft, um die kalten, aber aktiven Schlammvulkane zu betrachten. Im Strâmba-Tal, seit 2017 UNESCO-Weltnaturerbe, wartet noch ein Highlight auf uns: Wir wandern durch den Buchen-TannenUrwald und steigen in einen hüttenartigen Beobachtungsposten. Unsere Chancen, Braunbären zu beobachten, stehen gut.
Allmählich neigt sich die Reise dem Ende zu. Wir besuchen Braşov, zu Deutsch Kronstadt, ein Zentrum der Siebenbürger Sachsen. Die historische Altstadt umfängt uns mit spätmittelalterlichen Bürgerhäusern und stilvollen Bauten des 19. Jahrhunderts. Dann heißt es Abschied nehmen von einem vielfältigen Land und freundlichen Menschen. Lucia Vogel
Ein Eldorado für Vogelbeobachtung: das Donaudelta in Rumänien Foto: Daniel Petrescu

Es gibt so viele wunderbare Naturschätze in Bayern – doch oft sind sie bedroht: durch Bebauung, durch immer intensivere Landwirtschaft, durch Straßen, die Lebensräume zerschneiden. Der BUND Naturschutz bemüht sich seit vielen Jahren darum, Flächen anzukaufen, um sie zu schützen und zu bewahren, oft mit Erfolg: Derzeit besitzt der BN rund 2750 Hektar Flächen. Ab jetzt stellen wir Ihnen in jedem Heft ein solches Naturjuwel vor. Niederbayern hat ein Problem: den erschreckend hohen Flächenverbrauch. Jede Fläche, die hier der Betonlawine von Gewerbeansiedlungen und überzogenen Straßenbauprojekten entrissen werden kann, ist deshalb besonders wertvoll für die Natur. Die Kreisgruppe Dingolfing-Lan-
dau gehört mittlerweile zu den Spitzenreitern, was den Flächenbesitz im BN angeht: Über 100 Hektar sind es bereits! Solche Ausgaben stemmt auch ein großer Verband wie der BN nicht aus eigener Kraft: Gefördert werden die Ankäufe vom Bayerischen Naturschutzfonds, vom Freistaat Bayern und der EU. Teile des Flächenerwerbs im Landkreis DingolfingLandau wurden durch eine größere Erbschaft ermöglicht.
Rund 45 Hektar der BN-Flächen, meist Wiesen, liegen im Wallersdorfer Moos. Für Laien sind sie auf den ersten Blick unspektakulär. Doch gerade dieser Biotoptyp ist in Bayern eine Seltenheit geworden: feuchte Wiesen, die nur wenig gemäht werden. Viele Arten, die sich auf die-
Kreisgruppe: Dingolfing-Landau
Fläche: rund 100 Hektar; Wiesen, frühere Feuchtgebiete und Niedermoore
Arten: Wiesenbrüter wie Kiebitz und Großer Brachvogel, Laubfrosch, Libellenarten, Sibirische Schwertlilie, Gottesgnadenkraut, Lungenenzian
sen Lebensraum spezialisiert haben, stehen heute auf der Roten Liste. Franz Meindl, ehrenamtlich Aktiver aus der Kreisgruppe, zählt Pflanzen auf, die hier noch wachsen, während sie im übrigen Bayern sehr selten geworden sind: Sibirische Schwertlilie, Gottesgnadenkraut oder Lungenenzian.
 Foto: Franz Meindl
Laubfrosch und Kiebitz (oben) finden im Wallersdorfer Moos ein Zuhause.
Foto: Franz Meindl
Laubfrosch und Kiebitz (oben) finden im Wallersdorfer Moos ein Zuhause.
Bei den Tieren stehen die Wiesenbrüter im Fokus, vor allem der Kiebitz und der große Brachvogel. »Im Landkreis Dingolfing-Landau, mit Schwerpunkt Wallersdorfer Moos, brüten die meisten Kiebitze in ganz Bayern«, freut sich Franz Meindl und fügt hinzu: »Die BN-Flächen haben da einen entscheidenden Anteil geleistet!« Er und andere Ehrenamtliche bemühen sich seit Jahren mit viel Engagement und Herzblut um die Wiesenbrüter-Art. Auf den BN Flächen brüten jährlich rund 25 Kiebitzpaare, außerdem Brachvogelpaare, Flussregenpfeifer und Feldlerchen.
Damit der Vogelnachwuchs eine Chance hat, dürfen die Wiesen während der Brutzeit nicht gemäht werden. Die Landwirte, an die die Flächen verpachtet sind, erhalten für die ausgefallene Mahd eine Entschädigung. Auch hier fließen Fördergelder aus dem Bayerischen Naturschutzfonds.
Über Jahrhunderte haben Menschen die Landschaft entwässert, um sie nutzbar zu machen. Doch wenn eine Feuchtwiese nur noch eine Wiese ist, verschwinden die spezialisierten Arten. Deshalb wird dieser Prozess auf den BN-Flächen so weit wie möglich rückgängig gemacht, im Fachjargon Wiedervernässung genannt, zum Beispiel, indem Vertiefungen angelegt werden, in denen sich das Wasser staut. Ein wichtiger Partner der Kreisgruppe bei diesen Maßnahmen ist der Landschaftspflegeveband im Landkreis. Von der Vernässung der Flächen im Wallersdorfer Moos haben nicht nur der Kiebitz, sondern auch andere Arten profitiert. Die LaubfroschPopulation sei regelrecht explodiert, erzählt Franz Meindl. Aber auch Libellenarten fühlen sich hier wohl.
Der Prozess der Wiedervernässung ist umso einfacher, je größer und zusammenhängender die Fläche ist. Weil die BN-Grundstücke aktuell noch ein »Flickerlteppich« sind, wie Franz Meindl erklärt, geht die Suche nach Flächen, die gekauft oder auch getauscht werden können, weiter.
Luise Frank
fast wehmütig erinnert man sich dieser Tage an die Zeiten, als der schlimmste Vorwurf an die EU war, dass sie sich mit der Krümmung von Bananen beschäftigt. Im derzeitigen Wahlkampfmodus machen einige Verantwortliche in der Politik die Europäische Union für so ziemlich alles verantwortlich, was in Deutschland schief läuft. Hauptsache, man kann mit dem Finger nach Brüssel zeigen. Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes ist beileibe nicht alles gut, was auf EU-Ebene beschlossen wird. Bei aller berechtigten Kritik darf jedoch eines nicht vergessen werden: Der Europäischen Union und ihrer Gesetzgebung verdankt die Natur in den Mitgliedsländern sehr viel! Wo stünden unsere Naturschutzbemühungen heute ohne NATURA 2000, ohne die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder europäische Vogelschutzgebiete? Auch Impulse für den Klimaschutz kamen von der EU. Und der Verbraucherschutz in Europa profitiert von der Chemikalienrichtlinie REACH. Damit gilt seit 2007 bei der Markteinführung von Chemikalien das Vorsorgeprinzip – anders als zum Beispiel in den USA. Natürlich ist immer Luft nach oben. Auch bei der europäischen Umweltpolitik ließe sich noch vieles verbessern. So darf das Restoration Law zur Wiederherstellung der Natur nicht verwässert werden, sondern muss so umfassend wie möglich umgesetzt werden. Der finanziell dickste »Brocken« der EU ist gleichzeitig ein Dauerbrenner mit riesigem Reformbedarf: die sogenannte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Hier müssen endlich
Gelder sinnvoller verteilt werden, damit die bäuerlichen Betriebe für Leistungen honoriert werden, die der Umwelt zugutekommen statt für bloßen Flächenbesitz! Auch der schnelle Umstieg auf Erneuerbare Energien muss mehr als bisher von der EU vorangetrieben werden.
Der BUND Naturschutz ist dank seines internationalen Netzwerks Friends of the Earth auch in Brüssel präsent und bringt Anliegen des Umweltschutzes in die politische Debatte ein. Mit 268 000 Mitglie-

dern und Förderern ist der BN eine wachsende Gemeinschaft und eine gewichtige Stimme in dieser europäischen Familie. Am 9. Juni sind wir alle aufgerufen, ein neues EU-Parlament zu wählen. Es droht eine Stimmenmehrheit von Parteien, die EU-skeptisch sind oder die Europäische Union und ihre Errungenschaften offen ablehnen. Von einer sinnvollen Weiterführung europäischer Umweltgesetzgebung oder einer Reform der GAP kann dann keine Rede mehr sein. Deshalb appellieren wir an Sie: Informieren Sie sich insbesondere über die Natur- und Umweltschutzthemen in den Wahlprogrammen der Parteien. Geben Sie der Natur und der Demokratie Europas Ihre Stimme – es steht viel auf dem Spiel!
Doris Tropper stv. Vorsitzende Richard Mergner Landesvorsitzender Beate Rutkowski stv. VorsitzendeIn der Nürnberger Straße in Erlangen wird die StUB auf der Straße fahren, so dass die alten Eichen erhalten bleiben.

Am Tag der Europawahl wird es in Erlangen einen Ratsentscheid über den Bau der Stadt-Umland-Bahn (StUB) geben. Für den Bau der StUB wirbt die BN-Kreisgruppe Erlangen im breiten Bündnis der Initiative »Wir pro StUB«.
Die Stadt-Umlandbahn ist ein Projekt des BN; die ersten Ideen stammen vom Verband, der ab 1987 eine Machbarkeitsanalyse erstellen ließ. Mit diesem bundesweit größten Straßenbahn-Neubauprojekt mit 26 Kilometer Strecke kommt man künftig
Es ist ein Rückschlag für Klimaschutz und Mobilitätswende: Die Klage des BUND Naturschutz gegen den geplanten kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg wurde Anfang April vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abgewiesen. Eine Revision wurde nicht zugelassen.
»Für uns ist diese Planung ein Paradebeispiel dafür, welch untergeordnete Rolle der Klimaschutz vor allem im Verkehrssektor spielt«, so BN-Vorsitzender Richard Mergner. »Dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nun die Planung genehmigt, ist bitter. Ich appelliere eindringlich an Ministerpräsident Markus Söder und die Nürnberger Stadtpolitik, sich von dieser Dinosaurierplanung zu verabschieden! Wir brauchen einen kostengünstigeren Ausbau mit effektivem Lärmschutz.«
ohne Umsteigen vom Plärrer in Nürnberg bis in die Erlanger Innenstadt und weiter nach Herzogenaurach.
Die StUB ist die Alternative zum Straßenbau. Der über 30-jährige Kampf des BN gegen die Südumfahrung BuckenhofUttenreuth-Weiher durch den Reichswald war letztlich erfolgreich. Auch, weil es immer die StUB als Alternative gab. Die geplante Umfahrung Niederndorf-Neuses wude kürzlich in einem Bürgerentscheid zum zweiten Mal abgelehnt. Sie wäre das direkte Konkurrenzprojekt zur StUB und hätte sie kannibalisiert, da sie das Autofahren nach Herzogenaurach einfacher und schneller gemacht hätte. Seit vielen Jahren agiert der BN gegen die flächenfressenden Umfahrungen von Neunkichen am Brand und Dormitz. Bislang erfolgreich! Als Alternative steht auch hier die StUB zur Verfügung.
Deshalb hofft der BUND Naturschutz auf ein klares Votum der Bürger*innen für die Stadtumlandbahn!

Sehr enttäuscht war auch Klaus-Peter Murawski, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Nürnberg-Stadt: »Wir werden die schriftliche Begründung abwarten und dann entscheiden, ob wir das Bundesverwaltungsgericht anrufen. Es kann nicht sein, dass 2024 bei einem riesigen Bauprojekt der Klimaschutz nicht betrachtet werden muss. Leider haben wir heute erlebt, dass die Kräfte, die immer weiter machen wollen wie bisher, die Oberhand behalten haben.«
Inzwischen wurde bei einer Stadtratssitzung in Nürnberg bekannt, dass die Kosten des Gigaprojekts weiter explodieren – mittlerweile auf über 1 Milliarde Euro!
Mit Bestürzung und Trauer hat der BUND Naturschutz auf den Tod des ehemaligen Landtagspräsidenten und CSU-Politikers Alois Glück reagiert. »Diese Nachricht kam plötzlich und unerwartet für uns. Es ist erst ein Jahr her, dass wir Alois Glück die Naturschutzmedaille verliehen haben, er war über 50 Jahre lang Mitglied beim BN«, erklärte der BN-Vorsitzende Richard Mergner.
Glück hat sich in herausragender Weise für den Natur- und Umweltschutz in Bayern verdient gemacht und beeinflusste seit den 1970er Jahren stark die Umweltpolitik der Bayerischen Staatsregierung. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren Artenvielfalt war er als Leiter des runden Tisches maßgeblich daran beteiligt, dass Konflikte überwunden werden konnten.
Alois Glück hat den sogenannten Bergwaldbeschluss herbeigeführt, wonach es keine Rodungen mehr in Bergwäldern für Freizeiteinrichtungen geben soll. Eine weitsichtige und kluge Entscheidung, ohne die die Situation im Alpenraum heute noch dramatischer wäre, als sie jetzt ist. Er war auch der erste bayerische Landespolitiker, der nicht nur konsequent die Schaffung eines eigenen Ausschusses für Landesentwicklung und Umweltfragen mit anschob, sondern 1974 bis 1988 der erste Vorsitzende dieses Gremiums wurde.
Foto: Michael Lucan
Der Landesvorstand des BUND Naturschutz bereist regelmäßig die bayerischen Regierungsbezirke, um sich vor Ort ein Bild über Erfolge des BN, aber auch über Konfliktthemen zu machen. Im März war der Vorstand in Schwaben unterwegs. Auf dem Programm standen die
Bereiche Naturschutz, Wasserkraft und Verkehr.
In den Landkreisen Ostallgäu, Landsberg/ Lech und der Stadt Kaufbeuren informierten sich die Mitglieder des Landesvorstands über Schwerpunkte und Konfliktfälle, Projekte und Erfolge der beteiligten
Kreisgruppen. In Buchloe gab es eine Protestaktion begleitend zur Klage des BN gegen den Ausbau der B 12. In Dornstetten stand die Frage im Mittelpunkt: Wie geht es am Lech weiter nach dem Auslaufen der Kraftwerkskonzessionen?
In Kaufbeuren besuchte der Vorstand eine der größten Amphibienwanderstrecken Bayerns am Kaufbeurer Kaiserweiher. 50 Ehrenamtliche tragen hier jährlich zwischen 5000 und 8000 Frösche, Kröten und Molche über die Straße und sichern so eines der größten Amphibienvorkommen Bayerns. Doch durch die Klimakrise kommen die Amphibien auch hier immer mehr unter Druck.
In Füssen war der Alpentransit am Fernpass ein Thema. Hier setzt sich der BN für eine Stärkung des Schienenverkehrs ein. Einen wahrhaft königlichen Grundstücksankauf besichtigten die Vorstandsmitglieder schließlich unterhalb der Pöllatschlucht bei Schloss Neuschwanstein.
Nach der Landtagswahl im vergangenen Herbst setzten CSU und Freie Wähler ihre Koalition fort. Vertreter*innen des BUND Naturschutz kamen im Rahmen mehrerer Antrittsbesuche ins Gespräch mit neuen und bisherigen Verantwortlichen in der Politik.
Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (links) äußerten der BN-Vorsitzende Richard Mergner und seine Stellvertreterin Beate Rutkowski erneut die große Sorge des BN über den

veränderten Ressortzuschnitt der Ministerien. Aiwanger hatte durchgesetzt, dass die Verantwortung für den Bereich Jagd sowie die Verantwortung für die Bayerischen Staatsforsten vom Landwirtschafts- und Forstministerium an sein Wirtschaftsministerium übergeht.
Beim alten und neuen Umweltminister Thorsten Glauber (Mitte) brachten Richard Mergner, Beate Rutkowski und der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe die im Naturschutz drängenden Themen wie Erhalt der Artenvielfalt, Gewässer-

und Moorschutz und Reduzierung des Flächenverbrauchs zur Sprache. Bei Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (rechts) war ebenfalls eine BN-Delegation zu Gast. Herrmann ist der oberste Dienstherr der bayerischen Verwaltung, die für den Umweltschutz vor Ort häufig eine wichtige Rolle spielt.
Auch mit den neuen Fraktionsvorsitzenden von CSU und Freien Wählern, Klaus Holetschek und Florian Streibl, kamen die Vorstände des BN ins Gespräch.

Denn Plastik wird heute fast überall eingesetzt: in der Verpackungsindustrie, dem Bausektor, der Elektrotechnik sowie im medizinischen Bereich oder der Textilbranche. Ein Alltag ohne Kunststoffe ist nicht mehr vorstellbar. Leider landet Plastik oft in der Natur. Man findet Plas-

AUSZEICHNUNG
FÜR KREISGRUPPE GÜNZBURG
Seit 2021 engagiert sich die BN-Kreisgruppe Günzburg im Bildungsbereich. Das Spektrum reicht von einem Angebot für Vorschulkinder über den Recyclingführerschein für die Sekundarstufe bis hin zu einer gemeinsamen Aktion zur Quartiersbepflanzung. Dabei beteiligten sich Schulklassen ebenso wie die Anwohner und der städtische Bauhof. Die Kreisgruppe Günzburg ist in der Region inzwischen ein angesehener Ansprechpartner für Angebote im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da war es nur logisch, sich für das Qualitätssiegel Umweltbildung.Bayern zu bewerben. Für das langjährige Engagement sowie die Vielfalt der Themen und Methoden
tikpartikel inzwischen überall auf der Welt, mittlerweile auch auf unseren Tellern.
Aufgrund dieser Fakten hat das BN-Bildungswerk eine Ausstellung zum Thema Plastik konzipiert, die von Kreisgruppen ausgeliehen werden kann. Sie besteht aus drei zusammensteckbaren Elementen. Die Ausstellungstürme sind nur für Innenräume geeignet. Sie eignen sich für alle öffentlichen Räume wie Stadtbüchereien, Schulen oder Volkshochschulen. Gefördert wurde die Ausstellung »Planet Plastik« vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.
Weitere Infos unter www.bund-naturschutz.de/umweltbildung/ ausstellungen/planet-plastik

wurde die Kreisgruppe mit dem Qualitätssiegel Umweltbildung.Bayern ausgezeichnet. Bei einer Feierstunde im Umweltministerium nahmen Jutta Reiter und Vanessa Lochbrunner die Urkunde aus der Hand von Ulli Sacher-Ley und Umweltminister Glauber entgegen.
Infos unter www.guenzburg.bund.naturschutz.de
Wie können Bildungsprogramme für Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, Herkunftsländern und Lebensphasen entwickelt werden? Dieser Frage geht die Umweltstation Wartaweil nach. Interessenten an einer Kooperation können sich gerne noch melden. Am 13. Juni findet ein Online-Workshop zu den Themen: »BNE inklusiv: Gestaltungskompetenz in Zeiten des Wandels – für alle!« statt. Auch zum Nachhaltigkeitsfest zum Thema »Reduzieren, Wiederverwenden und Aufbereiten« am 29. Juni sind alle herzlich eingeladen! Kontakt: axel.schreiner@bund-naturschutz.de; Infos: www.wartaweil.bundnaturschutz.de

Ernährung ist eine der großen Stellschrauben beim Einsparen von CO2. Und dazu noch ein Handlungsfeld, bei dem Kreativität und Genuss so einfach zu kombinieren sind. Machen Sie mit und widmen Sie sich sommerlichen Salaten und Gemüsen. Der SommerKochworkshop findet am 20. Juni statt. Kontakt: melanie.hahn@bundnaturschutz.de; Infos: www.bundnaturschutz.de/umweltbildung
Für das BANU-Zertifikat Feldbotanik oder als Einstieg zur Bestimmung heimischer Pflanzen bietet das Naturerlebniszentrum Allgäu im Juni zwei Kurse an, bestehend aus Theorie und Praxis. Anmeldung erforderlich. Kontakt: info@NEZ-Allgaeu.de Infos: www.nez-allgaeu.de/veranstaltungen/fortbildungen
Foto: Melan
Vor sieben Jahren wurde Martin Simon, heute Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu, in den Strudel der Ereignisse um das Riedberger Horn gezogen und an die Spitze einer Bürgerbewegung katapultiert.
Martin Simon ist vom Typ her keiner, der sich nach vorne drängen muss. Er erzählt ruhig, und auf die Sache bezogen. Dass er einmal an prominenter Stelle für den Erhalt von Natur kämpfen würde, hatte der 38-Jährige nicht geplant.
An diesem Märztag 2024 stapft Simon am Rand einer dick verschneiten Skipiste oberhalb von Grasgehren bergan. Jetzt bleibt er vor einer Informationstafel stehen. Auf ihr sind die Routen für Tourengänger eingezeichnet und in Gelb eine Wildtierschutzzone, die zu bestimmten Zeiten nicht betreten werden soll. Dort lebt das Birkhuhn, eine äußerst störungsempfindliche Vogelart. Martin Simon weist mit der Hand auf einen Geländerücken, der sich im Nebel abzeichnet.
»Diese Zone gehört nach dem Alpenplan zur höchsten Schutzkategorie C«, erklärt er. »Trotzdem wäre das beinahe Skipiste geworden.«
Ein Rückblick ins Jahr 2017: Die Gemeinden Obermaiselstein und Balderschwang bewerben eine alte Idee neu. Sie wollen ihre beiden Skigebiete verbinden.
Die dafür nötige Fläche soll jene Schutzzone liefern. Sie hätte gerodet, planiert und mit Liftpfeilern bebaut werden sollen. Ein Speicherbecken wäre gegraben worden. Der übliche Skirummel wäre gefolgt.
ALPENPLAN IN GEFAHR
Damals hatte Simon gerade begonnen, sich gemeinsam mit seiner Frau im BN zu engagieren, mit Aktivitäten wie Amphibienrettung. Dann stand dieses Projekt im Raum und erhitzte die Gemüter, denn es stand pars pro toto für eine große Gefahr: die Aufweichung des Alpenplans. Dagegen will Simon aufstehen. Für die Bürgerinitiative »Freundeskreis Riedberger Horn« stellt er sich als Sprecher zur Verfügung. Damals holte sich Martin Simon das Rüstzeug, das er heute als Kreisgruppen-Vorsitzender gut gebrauchen kann. »Wir hatten gar keine KampagnenErfahrung«, berichtet Simon und lacht bei der Erinnerung.
Doch er und sein Team lernen schnell, wie man Leute mobilisiert, Expertise einholt, mediales Interesse weckt, Demons-
trationen organisiert – und mit einem bayerischen Ministerpräsidenten spricht. In diesem Tauziehen, das sich teils in die Gerichtssäle verlagert, weil der BN klagt, ist der »Freundeskreis Riedberger Horn« ein entscheidender Player. Es gelingt ihm, 5000 Menschen hinter sich zu versammeln. Am Ende kippt die Politik das Projekt. »Wir kamen damals aus dem Nichts und haben das geschafft!« sagt Martin Simon immer noch staunend.
Seit 2023 ist Martin Simon Vorsitzender der Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu. Die ist schon wieder mit einem brisanten Thema befasst: den Folgen der illegalen Ausbaggerung des Rappenalpbachs. Was ist Simons Antrieb? Als Antwort macht er eine ausholende Bewegung. Ein Sonnenstrahl hat inzwischen die Wolkendecke durchbrochen, bringt die verschneite Bergwelt zum Leuchten. »Ich habe zwei Kinder«, sagt er. »Sie werden voraussichtlich das Jahr 2100 erleben. Ihnen möchte ich eine lebenswerte Welt hinterlassen.«
MargareteMoulin











Mit einem Festakt im Landratsamt feierte im März die Kreisgruppe Ebersberg ihr 50-jähriges Bestehen. Nicht nur BN-Mitglieder, auch viele Vertreter*innen von Ämtern und Behörden waren gekommen – und natürlich der Hausherr, Landrat Norbert Niedergesäß. Kreisgruppenvorsitzender Sepp Biesenberger, Landesvorsitzender Richard Mergner und Aktive der Kreisgruppe zeigten das vielfältige Engagement des BN im Landkreis auf.
In den 70er-Jahren wurden viele BN-Kreisgruppen gegründet. Viel Zuwachs gab es 1973 und 1974. Deshalb hatten und haben derzeit viele Kreisgruppen Grund, dieses schöne Jubiläum zu feiern (wir berichteten). Hier weitere Feste aus ganz Bayern.

Eine Chronik über ein halbes Jahrhundert Naturschutz-Engagement brachte die Kreisgruppe Main-Spessart anlässlich ihres Jubiläums heraus (im Bild präsentiert von Kreisgruppenvorsitzendem Erwin Scheiner). Bei der Feier zum runden Geburtstag zeigte Alfred Dill in einem Bildervortrag die BN-Geschichte im Landkreis. 1974 sollte die Natur noch die scheinbar unbegrenzten Reserven für wirtschaftlichen Aufschwung liefern.

Die Kreisgruppe Berchtesgadener Land feierte ihr 50-jähriges Bestehen im Haus der Berge und hatte dazu ihre Mitglieder und befreundete Verbände eingeladen. Über den runden Geburtstag freuten sich (vo.li.) BN-Vorsitzender Richard Mergner, KreisgruppenVorsitzende Rita Poser und BN-Ehrenvorsitzender Hubert Weiger. Der BN-Ehrenvorsitzende betonte, wie wichig die Arbeit der Umweltverbände für die Natur in Bayerns Städten und Gemeinden ist.

Die Kreisgruppe Tirschenreuth hatte zum Jubiläum gleich zu zwei Veranstaltungen eingeladen: Bei einer Exkursion erfuhren die Gäste mehr über das BN-Engagement für den Teichelberg (siehe Bild). Hier konnte die Erweiterung eines Steinbruchs verhindert und ein Naturwaldreservat erhalten werden. Beim Festakt in Konnersreuth wurde auf ein halbes Jahrhundert NaturschutzArbeit in der nördlichen Oberpfalz zurückgeblickt.


NATURNOTIZEN AUS DER OBERPFALZ
BN-Aktive brachten 2023 im Landkreis Regensburg über 7000 Kröten, Frösche und Molche sicher zu ihren Laichgewässern.
KREISGRUPPE REGENSBURG
Bei Aktionen zur Amphibienrettung zeigen sich oft rückläufige Bestandszahlen – ein Alarmzeichen. In Wenzenbach ermöglicht die BN-Ortsgruppe den Tieren seit 35 Jahren ein Überleben.
Ab Ende Februar waren die Wenzenbacher BN-Aktiven wieder unterwegs, um Kröten, Fröschen und Molchen über die Straßen zu helfen. Beim Ortstermin Mitte März zeigten sich aber auch die Probleme durch zerschnittene Lebensräume und den Klimawandel. Steigende Temperaturen und leichter Regen locken Amphibien aus dem Winterquartier. Sie machen sich dann auf zu dem Gewässer, in dem sie sich selbst aus der Kaulquappe in Frosch, Molch oder Kröte verwandelt haben. Wenn sie auf dieser Wanderung eine Straße queren müssen, endet es für die Tiere oft tödlich. Beim Abbachhof in der Gemeinde Wenzenbach errichten die BN-Aktiven deshalb seit 2013 mit Hilfe des städtischen Bauhofs jedes Jahr einen 200 Meter langen Schutzzaun. Die Tiere fallen in dahinter
eingegrabene Eimer und werden von Helfer*innen gefahrlos über die Straße zu ihrem Gewässer gebracht. Wie wichtig der Zaun ist, zeigen die Zahlen: 2023 wurden dort 1400 der insgesamt 1600 im Gemeindegebiet gezählten Amphibien erfasst.
Für die BN-Artenschutzreferentin Dr. Christine Margraf sind Krötenzäune dennoch nur eine Notmaßnahme: »Wenn wir Grasfrosch und Co. erhalten wollen, brauchen wir mehr intakte Feuchtgebiete, Flussauen und Gewässervielfalt – und weniger Entwässerung, Flächenverbrauch und Straßenbau«, sagte sie bei ihrem Besuch vor Ort. Die jährliche Amphibienrettung ist die größte Artenschutzaktion Bayerns, bei der Tausende von Menschen im Einsatz sind, die meisten von ihnen Aktive des BUND Naturschutz.
Reinhard Scheuerlein (as)
AUFBRUCH: 39 Umweltinteressierte aus dem südlichen Landkreis Schwandorf fanden sich im Februar in Münchshofen zur Gründungsversammlung der neuen BN-Ortsgruppe im Städtedreieck Burglengenfeld, Maxhütte und Teublitz ein. Klaus Pöhler, Vorsitzender der Kreisgruppe Schwandorf, freute sich besonders, dass etliche Mitglieder Interesse hatten, in der neuen Vorstandschaft aktiv mitzuwirken. Zum Vorsitzenden der Ortsgruppe wurde Harald Söll gewählt, als seine Stellvertreterin Jannika Nübler, beide aus Teublitz (s. Bild). Sie wollen sich zunächst um die Themen Flächenversiegelung, Wasserverbrauch, Baumfällungen und das geplante Gewerbegebiet an der Autobahn A 93 kümmern.

ABSCHIED: Der BN trauert um Othmar Kipfer, der am 29. Februar im Alter von 88 Jahren verstarb. Nach Gründung der Kreisgruppe Neumarkt im Jahr 1974 war er ihr erster Vorsitzender und leitete sie zehn Jahre lang. Als passionierter Förster setzte er sich für naturnahe Wälder ein. Über Jahrzehnte war Kipfer Mitglied der Arbeitskreise Wald auf Landes- und Bundesebene. Er engagierte sich auch für den Erhalt des Deusmaurer Moors im Tal der Schwarzen Laaber, das unter einem künstlichen Badesee verschwinden sollte, und gegen eine Autorennstrecke am Möninger Berg. Sein beharrliches Engagement ist für alle BN-Aktiven Vorbild und Ansporn.

IHR ANSPRECHPARTNER
Oberpfalz: Reinhard Scheuerlein Tel. 09 11/8 18 78-13 reinhard.scheuerlein@ bund-naturschutz.de

KREISGRUPPE ROSENHEIM
Aktive der BN-Kreisgruppe Rosenheim und des Landesvorstands protestierten Anfang April gegen die Ausbaupläne für die A 8 in ihrem Landkreis.
36 Tausend Tonnen mehr Kohlendioxid pro Jahr: Dafür würde der geplante Ausbau der A 8 zwischen München und Salzburg sorgen, hat das Bundesverkehrsministerium selbst berechnet.
Der BUND Naturschutz klagt gegen den Ausbau. Mit ihrer drastisch negativen Klimabilanz ist die geplante Erweiterung auf sechs, teils sogar acht Fahrstreifen das bayernweit klimaschädlichste Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan.
Es steht damit in krassem Gegensatz zum Ziel Deutschlands, den verkehrsbedingten CO2-Ausstoß bis 2030 zu halbieren. Nachdem die Regierung von Oberbayern Ende Februar die Planfeststellung für den ersten Bauabschnitt zwischen Achenmühle und Bernauer Berg beschlossen hatte, hat sich der BUND Naturschutz entschlossen, gerichtlich gegen das klimaschädliche Projekt vorzugehen. Die Bürgerinitiative »Bürger setzen Grenzen« unterstützt die Klage.
Der Ausbau ist eigentlich eine völlige Neutrassierung, da neben der bestehenden Autobahn eine neue, etwa gleich brei-
te Straße gebaut werden soll. Hinzu kämen Streckenbegradigungen sowie massive Aufschüttungen und Abtragungen des Geländes, welche auch wertvolle landwirtschaftliche Flächen betreffen würden. Allein 1,2 Milliarden Euro Kosten werden für den Bauabschnitt Inntal bis zur Bundesgrenze veranschlagt. Der wirtschaftliche Nutzen ist fraglich. Das Geld wäre sinnvoller für Sanierungsmaßnahmen und einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs angelegt.
Der Bund Naturschutz fordert, die alternative Ausbauvariante »4+2« zu prüfen, die in Verbindung mit einem Tempolimit von 120 Stundenkilometern den Zustand der A 8 bereits ausreichend verbessern dürfte, aber deutlich geringer in Natur und Landschaft eingreift und weniger klimaschädlich ist.
Annemarie Räder (as)
KUNST TRIFFT NATUR: In Seefeld im Landkreis Starnberg gestalteten junge Künstler*innen unter Anleitung des Graffitikünstlers Lando die Wände der Fußgängerunterführung unter der Eichenallee mit Graffiti-Kunstwerken. Die Streetart-Aktion hatte Constanze Gentz von der BN-Ortsgruppe initiiert (siehe Bild). In Kooperation mit dem Jugendhaus Seefeld und gefördert durch die LAG Ammerfeld entstanden zwischen November und Februar bunte Wandbilder mit Bezug zum Thema Naturschutz: Alle Motive zeigen bedrohte Arten aus dem Gemeindegebiet – vom Laubfrosch über die Mehlprimel bis hin zur Krabbenspinne.

NACHRUF: Am 5. März verstarb mit Georg Eberle aus Kaufering ein Naturschützer der ersten Stunde. Von 1980 bis 1989 war er Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Landsberg. Er half, die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage bei Friedheim zu verhindern, die Ansiedlung des USPharmakonzerns Eli Lilly abzuwenden und Naturjuwele wie die Hurlacher Heide und das Tannenfilz bei Issing zu bewahren. Der BN verliert mit Georg Eberle einen Naturschützer mit Herz und Kompetenz.
Oberbayern: Annemarie Räder Tel. 01 70/4 04 27 97 annemarie.raeder@bund-naturschutz.de Julika Schreiber (Region München) Tel. 01 70/3 58 18 70 julika.schreiber@bund-naturschutz.de
Foto: Julika SchreiberJürgen Wolf und seine Anwältin Sylvia Meyerhuber hoffen auf juristischen Erfolg der PFAS-Klage.


Weil sein Grundstück in Obereichenbach mit PFAS-Chemikalien kontaminiert ist, hat Jürgen Wolf die Bundesrepublik auf Schadensersatz verklagt.
NACHRUF: Am 24. Januar starb Bruno Täufer im Alter von 86 Jahren in Bad Windsheim. Als langjähriger Vorsitzender der Ortsgruppe und Mitglied im Vorstand der Kreisgruppe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim war er das Gesicht des BN im Arten- und Biotopschutz, besonders im Landesarbeitskreis Artenschutz. Über Jahrzehnte engagierte er sich für den Schutz von Rotmilan, Biber, Bachmuschel und Fledermaus. Das Natur schutzgebiet »Sieben Buckel« und das BN-Biotop »Kiliansleite« lagen ihm besonders am Herzen. Der BN wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Filmreife Szenen gab es Ende Januar im Weißenburger Stadtwald, als Waldfreund*innen Arbeiter beim Fällen von Bäumen am dortigen Kalksteinbruch überraschten. Die Stein- und Schotterwerke Weißenburg wollen diesen um 35 Hektar erweitern (siehe N+U 1/2022), wogegen seit 2022 eine Klage des BN läuft. Das Landratsamt hatte den sofortigen Vollzug der Rodung genehmigt. Durch einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Ansbach und permanente Überwachung durch Ehrenamtliche (siehe Bild) konnte die BN-Kreisgruppe WeißenburgGunzenhausen die Abholzung zwar stoppen, doch zwei Hektar Wald fielen der Aktion zum Opfer. Im Februar protestierten 150 Naturschützer*innen vor Ort. KREISGRUPPE ANSBACH
ahe des Grundstücks liegt die Katterbach-Kaserne der US-Armee. Auf dem dortigen Militärflugplatz wurde jahrelang mit PFAS-haltigem Löschschaum geübt. Die Giftstoffe versickerten und gelangten über den Katterbach ins Grundwasser und die Umgebung. Diesen Zusammenhang stellte 2020 ein von der US-Armee beauftragtes Gutachten fest. Eine Sanierung des Flugfelds ist jedoch nicht geplant; lediglich kontaminiertes Grundwasser wird zurückgehalten. Dabei ist die Verseuchung seit 2014 bekannt. Bereits 2019 wurden in Wolfs Hausbrunnen so hohe PFAS-Werte gemessen, dass er ihn stilllegen musste. Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS, sind eine Gruppe von über 4700 wasser-, fett- und schmutzabweisenden Chemikalien, die in unzähligen Produkten stecken, von Outdoorkleidung über Teflonpfannen bis zu Feuerlöschschaum.
Die extrem langlebigen »Ewigkeitsgifte« reichern sich in der Nahrungskette an
und bergen eine Vielzahl großer gesundheitlicher Risiken. Vor dem Oberlandesgericht Nürnberg fordert Jürgen Wolf Schadensersatz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Eigentümerin des Kasernengeländes. Unterstützt wird er vom Ansbacher Stadtrat, einer Bürgerinitiative und dem BN. Die Klage könnte zu einem Präzedenzfall für Ansprüche aus Umwelthaftung werden.
Um rechtssicher nachzuweisen, dass die PFAS aus der Kaserne stammen, ist nun ein Gutachten nötig, das einige zehntausend Euro kosten wird. Der BN Ansbach unterstützt einen entsprechenden Spendenaufruf und hofft auf große Resonanz.
ChristinaBeckler, Tom Konopka (as)
Spenden können auf folgendes Treuhandkonto überwiesen werden: IBAN: DE31 7655 0000 0009 5258 17, BIC: BYLADEM1ANS, Inhaber: Kanzlei Meyerhuber Rechtsanwälte (www. meyerhuber.de/pfc-verfahren)

IHR ANSPRECHPARTNER
Mittelfranken: Tom Konopka Tel. 09 11/8 18 78-24 tom.konopka@bund-naturschutz.de
Foto: Kreisgruppe AnsbachFoto: Isolde

Durch das neue Teilstück des BN-eigenen Naturwaldreservats sind die urtümlichen Wälder der Rohrachschlucht besser vernetzt und geschützt.
KREISGRUPPE LINDAU
Das BN-Naturwaldreservat Rohrachschlucht wurde um fünf Hektar erweitert. Es schließt nun an den Vorarlberger Naturwald an. So entsteht ein grenzüberschreitender Waldverbund.
Das Schutzgebiet besteht seit 2018 auf Flächen im Eigentum des BUND Naturschutz in der Rohrachschlucht. Es umfasste zunächst knapp elf Hektar. Durch einen weiteren Ankauf fügte der BN nun 5,2 Hektar hinzu, die am 10. April eingeweiht wurden.
Die neuen BN-Flächen grenzen teils an das bestehende Reservat und teils an die österreichischen Naturwaldflächen an. Insgesamt erstrecken sich nun über 60 Hektar geschützter Naturwald beidseits der Grenze. »Damit sind ein länderübergreifender Waldnaturschutz und grenzüberschreitende Forschungskooperationen möglich. Naturwälder werden nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt und bleiben sich selbst überlassen«, freute sich der Kreisgruppenvorsitzende Maximilian Schuff.
Das Naturwaldreservat ist eingebettet in das 177 Hektar große und landesweit bedeutsame Naturschutz- und Flora-
Fauna-Habitat-Gebiet »Rohrachschlucht«.
Seine naturnahen Schluchtwälder weisen eine hohe Vielfalt an Tier-, Pilz- und Pflanzenarten auf. Unter den Baumarten dominieren Tannen, Buchen und Fichten. Allein sieben Spechtarten sind in dem Gebiet anzutreffen, darunter der Weißrückenspecht und der Dreizehenspecht.
Eine Erfassung holzbewohnender Käferarten in den Allgäuer Tobelwäldern erbrachte für das Naturschutzgebiet Rohrachschlucht die meisten Individuen, Arten und gefährdete Arten. Insgesamt wurden 111 Käferarten nachgewiesen, darunter zwei vom Aussterben bedrohte Urwaldreliktarten und eine bisher unbeschriebene Art der Gattung Rindenkäfer.
Der BN ist Träger der Gebietsbetreuung und wird in den nächsten Jahren – grenzüberschreitend mit Vorarlberg – weitere Artengruppen erforschen.
Thomas Frey (as)
ERFOLGREICH: Zehn Jahre lang hatten das staatliche Bauamt Kempten und die Stadt Memmingen eine Umgehungsstraße für den verkehrsgeplagten Stadtteil Steinheim geplant. Vorgesehen war eine neue Trasse quer durch den Grüngürtel. Dabei ließe sich eine Ortsumgehung, mit kleinen Ergänzungen, auch durch die Neuordnung des vorhandenen Straßennetzes verwirklichen. Diese Argumentation der BN-Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu und einer Bürgerinitiative hatte schließlich Erfolg: Stadt und Bauamt gaben letztes Jahr ihre Neubaupläne auf und entwickelten, auf Basis einer intensiven Bürgerbeteiligung, eine Variante, die auf dem Straßenbestand aufbaut. Im September 2023 beschloss der Memminger Stadtrat einstimmig den finalen Verlauf. Der BN freut sich, dass diese Lösung nicht nur Steinheim vom Durchgangsverkehr entlastet, sondern auch ein Naherholungsgebiet erhält, wertvolle landwirtschaftliche Böden bewahrt und Ressourcen schont.

GUT VERBUNDEN: Auf Ackerflächen in Oberndorf legte die BN-Kreisgruppe Donau-Ries eine 330 Meter lange Hecke an. Eigentümerin Marianne Kränzler hatte zwei ihrer Felder zur Verfügung gestellt. Mitte März pflanzten 25 Freiwillige 500 heimische Sträucher und Wildobstgehölze. Die Hecke bietet Tieren der Feldflur Lebensraum und verbindet bestehende Biotope zwischen Auwald und freier Landschaft.
IHR ANSPRECHPARTNER
Schwaben: Thomas Frey Tel. 0 89/54 82 98-64 thomas.frey@bund-naturschutz.de


KREISGRUPPEN SCHWEINFURT, MAIN-SPESSART, WÜRZBURG UND KITZINGEN
Zwischen den Autobahnkreuzen Schweinfurt/ Werneck und Biebelried soll die Autobahn A 7 auf sechs Fahrstreifen erweitert werden – auf Kosten des Feldhamsters und anderer Arten.
Mit dem geplanten Ausbau der A 7 gehen weitere Lebensräume für vom Aussterben bedrohte Tierarten verloren. Wälder, Hecken, Trockenstandorte und auch wertvollstes Ackerland sind betroffen.
Allein in den drei aktuellen Planungsabschnitten würden weit über 40 Hektar Land durch die Baumaßnahme netto neu versiegelt werden. Lebensräume für zahlreiche seltene Arten wie Feldhamster, Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter, Feldlerche, Schwarzspecht und Bechsteinfledermaus würden der Trasse zum Opfer fallen.
Besonders für den bereits vom Aussterben bedrohten Feldhamster wäre ein weiterer Verlust an Lebensraum, verbunden mit Vergrämung und unsicheren Ausgleichsmaßnahmen, ein weiterer Sargna-
gel. Der BUND Naturschutz (BN) hatte schon vor vier Jahren bei der Europäischen Kommission Beschwerde eingelegt wegen unzureichender Schutzmaßnahmen für diese europarechtlich geschützte Art.
Die Tiere haben in Bayern nur noch zwischen Schweinfurt, Würzburg und Kitzingen ein Refugium. Doch auch dieser Lebensraum schwindet zunehmend – und große Straßenbaumaßnahmen wie der Ausbau der A 7 tragen dazu bei. Zudem verstärken sie die Barrieren zwischen Teilpopulationen weiter. Der BN wird sich daher nicht nur im Planfeststellungsverfahren entsprechend positionieren, sondern sich auch erneut an die EU wenden, um umfassende Schutzmaßnahmen für den Feldhamster einzufordern.
Steffen Jodl (as)
VIELSTROMLAND: Unterfranken ist bayernweit am stärksten vom dem Bau neuer Stromtrassen von Nord nach Süd betroffen; dabei ist ein Bedarf in dieser Größenordnung nicht nachgewiesen. Nach dem SüdLink und der Fulda-MainLeitung sollen nun mit dem SüdWestund dem NordWestLink sowie der P540Leitung aus Thüringen und möglicher Querverbindungen weitere Trassen hinzukommen. Dass Unterfranken damit zum Stromtrassenland mutiert, ist auch ein Ergebnis der Politik der Bayerischen Staatsregierung, die eine dezentrale Energiewende, insbesondere in Südbayern, eher verhindert, anstatt sie voranzubringen.
SCHUTZ VERSANDET? Die Gewinnung von Rohstoffen am Main setzt sich ungebremst fort. Aktuell kämpft der BN unter anderem gegen den Abbau von Quarzsand in einem Landschaftsschutzgebiet, auf 14 Hektar wertvoller Sandflächen bei Sommerach und Schwarzach im Landkreis Kitzingen (siehe Bild). Entstehen soll die riesige neue Sandgrube in der Mainschleife, die bereits durch den massiven Abbau von Kiessand beeinträchtigt ist. Der geplante Sandabbau wäre nicht nur ein schmerzhafter Eingriff in das Landschaftsbild, auch wertvolle Lebensräume für Bodenbrüter und Zauneidechsen wären betroffen.

IHR ANSPRECHPARTNER
Unterfranken: Steffen Jodl Tel. 01 60/5 61 13 41 steffen.jodl@bund-naturschutz.de
Foto: Steffen Jodl Wird die A 7 wie geplant ausgebaut (Symbolbild), kommen auf den Feldhamster harte Zeiten zu. Foto: Sonja Kreil
KREISGRUPPE FORCHHEIM
Dass sich Verkehrsprobleme nicht durch den Bau neuer Straßen lösen lassen, sollte heute bekannt sein. Doch im Landkreis Forchheim scheint dieses Credo weiterhin zu gelten.
Dort liegen gleich zwei große Straßenbauprojekte auf dem Tisch: Für die Westumfahrung von Neunkirchen gibt es ein neues Planfeststellungsverfahren, und die Planung der Ostspange vor den Toren Forchheims ist noch immer aktuell.
Der BUND Naturschutz hält beide Projekte für nicht mehr zeitgemäß: Die Trasse der Ostspange für die Bundesstraße B 470 würde quer durch das Wiesenttal führen. Dabei wurde die traditionelle Bewässerung der dortigen Wiesen erst 2023 zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Die Bedeutung des Tals für das lokale Klima und die Naherholung hat der Planungsverband Oberfranken West ebenfalls im vergangenen Jahr selbst bestätigt.
Bei der Westumfahrung von Neunkirchen durch das Ebersbacher Tal verbes-
sert die neue Planfeststellung aus Sicht des Naturschutzes wenig. Bemerkenswert: Im 2023 eingestellten Verfahren hatte der Planungsverband das Tal noch als Grünzug mit Bedeutung für das örtliche Klima und die Naherholung eingestuft. Dieser Status wurde im neuen Verfahren nun ohne nachvollziehbare Gründe ersatzlos gestrichen. Weiter steht zu befürchten, dass sich die Trasse negativ auf die Trinkwasserbrunnen auswirkt.
»Die Politik muss andere Lösungen vorantreiben«, fordert der Vorsitzende der Kreisgruppe, Dr. Ulrich Buchholz. Konkret hieße das, anstelle der Ostspange die Wiesenttal-Bahn zu stärken und sich im Fall Neunkirchen ernsthaft mit einer »Nullvariante« auf Basis bestehender Straßen und Alternativen wie der Stadt-UmlandBahn zu befassen.
Jonas Kaufmann (as)
SCHLÄFERKOBEL: Entlang der Fränkischen Linie, von Kronach bis Bad Berneck, finden die stark bedrohten Gartenschläfer nun 50 neue Nistkästen. Zum Auftakt Anfang März brachten NaturparkRangerin Ines Gareis und Alwin Geyer von der BN-Ortsgruppe Stadtsteinach den ersten Kobel an (siehe Bild), auf einer Fläche der Kreisgruppe Kulmbach nördlich von Stadtsteinach. Fünf Kästen wurden in unmittelbarer Nähe zueinander montiert, da Gartenschläfer mehrere Nester nutzen, um ihre Fressfeinde zu verwirren. Die Aktion ist Teil des sechsjährigen Projekts »Spurensuche Gartenschläfer«.

NEUWAHLEN: Heike Schöpe aus Marktredwitz ist die neue Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Wunsiedel. Sie folgt auf Alfred Terporten-Löhner, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Zu ihrem Stellvertreter wurde Matthias Henneberger gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung im März in Arzberg wurden der ehemalige Vorsitzende vom BN-Ehrenvorsitzenden Hubert Weiger verabschiedet und die neue Vorsitzende gebührend eingeführt.

IHR ANSPRECHPARTNER
Oberfranken: Jonas Kaufmann
Tel. 09 11/8 18 78-24 jonas.kaufmann@bund-naturschutz.de
Foto: Jonas KaufmannMit ihrem umweltpolitischen Aschermittwoch setzten die Veranstalter auch ein Zeichen gegen Populismus und für demokratische Verständigung.

KREISGRUPPE DEGGENDORF
Zum politischen Schlagabtausch in Niederbayern versammeln sich nicht nur Parteien: Auch BN, LBV und der Fischereiverband luden wieder zum Umweltpolitischen Aschermittwoch ein.
Dabei ging es im voll besetzten Kolpingsaal in Deggendorf am 22. Februar nicht um Stammtischparolen, sondern im Gegenteil um nachhaltige, demokratische und friedliche Zukunft. So reichten die Redebeiträge von Klimaschutz und Energiewende ohne Kohleund Atomstrom über den Schutz der Landschaft vor Flächenfraß und Zersiedelung bis hin zum Arten- und Naturschutz. Michael Kreiner, Präsident des Fischereiverbands Niederbayern, forderte von der Politik einen nachhaltigen und wirksamen Wasser- und Gewässerschutz. Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), mahnte: »Intakte Ökosysteme sind für uns Menschen lebensnotwendig.«
In seinem Grußwort schlug Peter Aigner von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft vor, Einnahmen aus der wegfallenden Dieselrückvergütung
für Kulturlandschaftsprogramme und Maßnahmen zum Tierwohl zu verwenden.
Ins Zentrum seiner Rede stellte der BNLandesvorsitzende Richard Mergner eine eindringliche Warnung vor Populismus: »Dem BUND Naturschutz ist es ein besonderes Anliegen, die Demokratie vor ihren rechtsextremen Feinden und Populisten zu schützen, denn die demokratischen Instrumente sind die Grundlage, um Natur und Umwelt und damit unsere Lebensgrundlagen vor der Zerstörung zu bewahren.«
Die Veranstaltung wurde umrahmt von bayerisch-böhmischer Blasmusik – und feinen Fischgerichten: Verbandspräsident Kreiner hatte dazu elf Kilo selbst gefangenen und von seiner Frau fachgerecht filetierten Waller spendiert.
Rita Rott (as)
SELTENE SCHÖNHEIT: Die Schellenblume oder Becherglocke (Adenophora liliifolia) ist eine vom Aussterben bedrohte botanische Rarität. In Deutschland gibt es sie nur an zwei Standorten an der unteren Isar. Einer davon liegt im Laubwald bei Erlau zwischen Landau und Wallersdorf. Dort hat die BN-Kreisgruppe DingolfingLandau mehrere Grundstücke angekauft, um die seltene Waldsteppenpflanze wieder zu vermehren. Auf einer der Flächen waren die Baumkronen Anfang des Jahres durch Sturmschäden so stark ausgelichtet, dass wilde Brombeeren alles zu überwuchern drohten. Ende Februar mähten Aktive der BN-Ortsgruppe Landau die Flächen und entfernten Äste und Zweige. Nun können sich die bis zu eineinhalb Meter hohen Pflanzen wieder ungestört entwickeln.

BAHN FREI: Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter will die Waldbahn von Gotteszell nach Viechtach nun doch in den Dauerbetrieb überführen, voraussichtlich Ende 2025. Die Bahnstrecke soll für 6 Millionen Euro instandgesetzt werden. Damit hatte der jahrelange Einsatz der BN-Kreisgruppe Regen zusammen mit dem Förderverein Go-Vit endlich Erfolg. Die 25 Kilometer lange und landschaftlich reizvolle Strecke befindet sich seit 2016 im Probebetrieb. Für einen Dauerbetrieb wäre eigentlich der Nachweis von mindestens 1000 Fahrgästen pro Tag nötig. Durch den Vorstoß des Ministers ist die Waldbahn davon nun befreit.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Niederbayern: Rita Rott Tel. 0 89/54 83 01 12 rita.rott@bund-naturschutz.de

Sie fliegen so elegant wie Adler. Oder wat scheln wie eine Gruppe tapsiger Pinguine. Die aller letzten Meter dann schleichen die Kinder wie scheue Jäger auf der Pirsch. Die Wanderung von der Bushaltestelle ist für die Mädchen und Jungen viel spannender als der normale Schulweg. Am Waldrand angekommen, wird erst gebuddelt, dann gepflanzt. Die Kids bauen der Wildkatze ein Zuhause!
Schulkinder in Niedersachsen pflanzen Sträucher für die Wildkatze, angeleitet von Teamerinnen der BUNDjugend. Die kümmern sich im Projekt »Wildkatzenwälder von morgen« um die Umweltbildung.

Rund um Sprakensehl im nordöstlichen Niedersachsen leben nur wenige Kinder. Dritt- und Viertklässler haben hier gemeinsam Unterricht. 13 Mädchen und Jungen tragen heute ihr Schmuddelzeug und haben ein extragroßes Pausenbrot dabei. Denn statt im Klassenzimmer zu sitzen, verbringen sie den ganzen Vormittag draußen in der Natur. Organisiert haben den Einsatz Teamerinnen der BUNDjugend.
GUTE DECKUNG
Auf der Wiese steht ein Aufsteller aus Pappe. Zu sehen ist ein Tier mit buschigem Schwanz und verwaschenem Fell. Mina gibt sich wenig beeindruckt: »Ich würde so gern mal eine Wildkatze sehen, also in echt«, sagt die Neunjährige. Sie hat mitbekommen, dass sich die scheuen Tiere wieder in ihrer Heimat ausbreiten. Oder es zumindest versuchen.
Letztes Jahr wurde an der Bundesstraße ein totes Tier gefunden. Nicht nur der Autoverkehr ist ein Problem. Wildkatzen

brauchen abwechslungsreiche Lebensräume, wo sie viele Mäuse fangen und sich gut verstecken können.
Mina und ihre Mitschüler*innen probieren es selbst aus und verwandeln sich bei einem Spiel in einen Wurf junger Wildkatzen. Jemand aus der Gruppe muss sie mit dem Fernglas (in Wahrheit der Karton einer Küchenrolle) entdecken. »Das ist unfair: Auf der offenen Wiese sieht man ja alles«, beschwert sich Maxi schon nach der ersten Runde. Um die Ecke am Waldrand, unter Büschen und umgestürzten Baumstämmen, ist es für die Kinder viel leichter in Deckung zu gehen.
Ihre Klassenlehrerin ist beim Katz-undMaus-Spiel dabei, hält sich aber im Hintergrund. Regie führen die Teamerinnen Annbrit Langer und Jana Fenske aus Göt-
Das Projekt »Wildkatzenwälder von morgen« wird bis 2028 gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums. Projekte gibt es in zehn Ländern. Die BUNDjugend organisiert Angebote zur Umweltbildung in Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

tingen. Bei einer Wochenendschulung der BUNDjugend haben die Studentinnen der Biodiversität mehr über die Wildkatze erfahren – und darüber, wie man Kinder für Naturschutz begeistern kann. Weil sie ganz auf Augenhöhe mit den Kindern agieren, haben alle viel Spaß.
Damit die Wildkatzen einfacher von A nach B kommen, pflanzen viele Dutzend Freiwillige des BUND an diesem Tag eine Streuobstwiese. Für die Sträucher am Saum sind die Kinder zuständig. Also schnell die Handschuhe mit dem Marienkäfermuster angezogen! Mit ihren Spaten graben sie Löcher für Besenginster und für Traubenkirsche, Hundsrose und Holunder,
Fotos: Helge Bendl (5)
Schwarz- und Weißdorn, Vogelbeere und Haselnuss. Was hier heranwächst, soll vielfältig und klimarobust sein.
Zum Schluss sind Mina, Maxi und die anderen ausgepowert, aber happy. Sie nehmen sich vor, ihren Eltern die Pflanzung zu zeigen und zu verfolgen, wie sie sich entwickelt. Mit sehr viel Glück zeigt sich ihnen hier mal eine Wildkatze – und bestimmt das ein oder andere Tier, das von dem neuen Lebensraum profitiert.
ANGEBOTE IN FÜNF BUNDESLÄNDERN
»Wildkatzenwälder von morgen« ist ein Großprojekt des BUND: Wälder, Waldränder und angrenzende Wiesen sollen wildkatzengerecht umgestaltet werden. In fünf Bundesländern ist auch die BUNDjugend mit am Start und entwickelt Angebote für Acht- bis Zwölfjährige.
Wie in Sprakensehl: Kira Nadler von der BUNDjugend Niedersachsen hat den Kontakt zur Schule hergestellt, das Programm für den Tag entworfen und das Freiwilligenteam unterstützt. »Es ist wirklich cool, die Themen Artenschutz und Klimawandel verbinden zu können. Zudem sind Schulklassen ein Spiegel unserer Gesellschaft: Wir erreichen hier alle Kinder, nicht nur bestimmte.«


An manchen Orten, so die Hoffnung, könnte das Projekt auch zur Gründung von Kindergruppen führen. Für die BUNDjugend ist das Projekt eine Chance, neue Aktive zu begeistern. Es scheint zu klappen: Zur ersten von Kira Nadler organisierten Wildkatzen-Schulung kamen neben alten Hasen einige Neulinge. Sie stehen nun bereit, um Exkursionen und Projekttage zu organisieren. Andere Aktive wollen sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Es gibt auch die Idee, Kindergeburtstage mit dem Motto Wildkatze anzubieten.
Weil das Projekt über mehrere Jahre läuft, wird es in Niedersachsen und in vier weiteren Bundesländern zusätzliche Schulungen für Teamer*innen geben. »Kinder für Wildkatzen zu begeistern, ist richtig erfüllend«, meint Kira Nadler. »Und natürlich wäre es total schön, selbst mal eine in freier Wildbahn zu sehen.«
Helge Bendl
Aktiv werden
Teamer*innen gesucht! Hast du Lust, mehr über die Wildkatze zu lernen? Und möchtest du in deiner Region Kindergeburtstage, Projekttage und Freizeiten organisieren? Mehr dazu: www.bundjugend.de
Nach vielen Monaten der intensiven Zusammenarbeit des Bundesverbands mit Landesverbänden und Webagentur sowie dem kreativen Einsatz von Ehrenamtlichen freuen wir uns auf den Launch unserer neuen Webseite im Sommer! Social Media-Plattformen werden immer mehr zu Orten der Polarisierung, der Simplifizierung und Desinformation. Darum ist es uns besonders wichtig, zeitgemäß ansprechend und selbstorganisiert online präsent zu sein. Besuche uns: www.bundjugend.de

Laura und Enrico sind die neuen Sprecher*innen unseres Bundesjugendrats. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! Der BuJuRat ist das Gremium, das für den Austausch zwischen der Landes- und Bundesebene zuständig ist, für die Beratung des Bundesvorstands, für Anliegen und Probleme der Landesverbände, für die Vernetzung zwischen allen Gremien und natürlich: ganz viel Flausch!
Hast du den Dachboden oder die Festplatte voller Bilder aus den vergangenen 40 Jahren BUNDjugend? Dann sende sie uns anlässlich unseres Jubiläums 2024 an vierzigjahre@bundjugend.de! instagram.com/bundjugend twitter.com/BUNDjugend facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband
Sie sind unsichtbar, reichern sich in der Umwelt und unserem Blut an und werden mit Krankheiten in Verbindung gebracht.
Wie vermeiden Sie den Kontakt mit den Ewigkeits-Chemikalien PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen)?
 JANNA KUHLMANN
JANNA KUHLMANN
betreut die Chemikalienpolitik des BUND.
In Kleidern oder in Möbeln finden sich die unterschiedlichsten Chemikalien: Weichmacher im Plastik, Beschichtungen und Lacke oder Imprägnierungen. Einigen sollte man besser aus dem Wege gehen. Weil Firmen die Inhaltsstoffe ihrer Produkte nicht ausweisen müssen, tappen wir Verbraucher*innen im Dunkeln. Was können wir trotzdem tun?
Schon heute nehmen die meisten Menschen regelmäßig PFAS-Chemikalien auf – über Lebensmittel, die Luft und den Kontakt mit Dingen, die diese Stoffe enthalten. Mit Folgen für unsere Gesundheit: Jene PFAS, die bereits näher untersucht wurden, stehen im Verdacht, Krebs und Unfruchtbarkeit zu fördern und unser Immunsystem zu schwächen. Einmal in der Umwelt, verbleiben sie dort über Jahrhunderte, belasten Gewässer und Böden und gelangen so auch in Mensch und Tier.
WORAUF ACHTEN?
Gern werden PFAS eingesetzt, wo Dinge Wasser, Fett und Schmutz abweisen oder besonders gleitfähig sein sollen. Schauen Sie also bei Bratpfannen, Regenkleidung

und -schirmen, Schuhimprägnierung und Skiwachs, schmutzabweisenden Möbeln oder Teppichen besser zweimal hin. Mehr und mehr Firmen kennzeichnen ihre Produkte als PFAS-, PFC- und fluorcarbonfrei. (PFOA-frei dagegen zielt auf nur einen dieser Stoffe, andere PFAS können enthalten sein.) Fehlt ein solcher Hinweis, lohnt es beim Hersteller nachzufragen.
VON FISCH BIS FAHRRAD
Besonders viele PFAS nehmen wir über die Nahrung auf. Vor allem Fisch und Fleisch können diese Stoffe enthalten. Auch über Verpackungen wie Popcorntüten und Pizzakartons gelangen sie in unseren Körper. Wer sich überwiegend pflanzlich ernährt und fettabweisend verpacktes Fastfood meidet, geht hier auf Nummer sicher.
Die umweltschädlichen Stoffe können zudem in Zahnseide und Kosmetika oder Outdoorjacken und Kletterseilen stecken. Per Marktrecherche und Labortests nahm der BUND diese vier Produktgruppen unter die Lupe – und wurde in jedem Fall fündig. Auch Fahrradkettenöl kann PFAS als Schmiermittel enthalten. Hier werben einige Anbieter bereits ausdrücklich für biologisch abbaubare Alternativen.
Wärmepumpen können PFAS als Kältemittel enthalten. »Natürliche« Ersatzstoffe sind aber weit verbreitet und werden
staatlich extra gefördert. Achten Sie hier auf das Siegel »Blauer Engel«.
Schadstoffe werden auf europäischer Ebene reguliert. Das Ergebnis der Europawahl im Juni wird entscheiden, ob endlich alle PFAS-Chemikalien in Alltagsprodukten verboten werden. Ganz untätig war die EU bisher nicht. So wird der Einsatz von PFAS in Essensverpackungen – jenseits leichter Verunreinigungen aus Recyclingpapier –ab Mitte 2026 untersagt sein.
Bis dahin können Sie die ToxFox-App des BUND nutzen. Um Schadstoffe aufzuspüren, brauchen Sie nur den Barcode eines Produktes zu scannen. Bei Kosmetika bekommen Sie direkt Antwort, ob PFAS oder andere Stoffe enthalten sind.
Bei Textilien, Möbeln und Spielzeug können Sie über die App eine Anfrage an den Hersteller senden. Der ist zur Auskunft über besonders schädliche Stoffe verpflichtet, wozu auch einige PFASChemikalien zählen. Nebeneffekt: Jede Anfrage zeigt den Firmen, dass wir uns Produkte ohne Gift wünschen!
Mehr zum Thema www.bund.net/chemie/pfas www.bund.net/toxfox

adobe com – Gh
Deutschland importiert jedes Jahr allein 1,3 Milliarden Rosen. Nicht nur im Winter kommen diese und andere Blumen oft per Flugzeug aus fernen Regionen wie Ostafrika oder Südamerika. Viele enthalten einen Cocktail problematischer Pestizide. Greifen Sie darum zu heimischer Bio-Ware und achten Sie beim Kauf auf bestimmte Siegel.
Dazu BUND-Expertin Corinna Hölzel: »In der Blumenproduktion im globalen Süden werden zahlreiche zum Teil gefährliche Gifte gespritzt, darunter Insektizide und Fungizide, die in der EU verboten sind. Diese umweltschädlichen Stoffe bedrohen die Gesundheit derer, die im Anbau und im Blumenhandel arbeiten.«
Wer sich oder anderen mit Blumen eine Freude machen will, sollte auf deren Herkunft achten. Die beste Wahl sind Bio-Blumen oder BioTopfpflanzen, möglichst aus der Region. Denn diese werden ohne chemischsynthetische Pestizide und ohne Mineraldünger angebaut. Auch chemische Hemmstoffe, die die Pflanzen kleinhalten, sind tabu, ebenso wie Gentechnik.
GANZJÄHRIG IM ANGEBOT
Das Siegel »Fairtrade« garantiert, dass die Blumen nach guten sozialen und ökologischen Standards produziert wurden, die Beschäftigten werden fair entlohnt. Das Gütezeichen »Slowflower« setzt auf Regionalität und auf Nachhaltigkeit und vermeidet damit lange Transportwege. Bio-Pflanzen gibt es das ganze Jahr über: Auf Ranunkeln, Anemonen, Narzis-
sen oder Tulpen folgt eine große Palette von Sommerblühern wie Rosen, Lilien oder Sonnenblumen. Im Herbst sind Dahlien, Astern, Chrysanthemen und Gräser im Angebot, im Winter gibt es Christrosen und Weihnachtssterne.
Corinna Hölzel: »Gerade jetzt im Frühjahr ist es leicht, einen Blumengruß so zu gestalten, dass die Umwelt und alle, die mit den Blumen vorher in Kontakt kamen, vor gefährlichen Giften geschützt sind.«
Im Übrigen fordert der BUND den Einsatz von Pestiziden deutlich zu verringern und besonders schädliche Pestizide in Europa und weltweit zu verbieten. Gefährliche Pestizide dürfen nicht länger hierzulande hergestellt und dann in den globalen Süden verkauft werden, wie das derzeit noch der Fall ist.
www.bund.net/pestizide

Seit 25 Jahren erzeugen und liefern wir Ökoenergie höchster Qualität. Und mit jeder Kilowattstunde Ökostrom und Ökogas von naturstrom fließt ein hoher Förderbeitrag in den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland.
Wechseln Sie jetzt zu Energie mit Zukunft und sichern Sie sich 30 € Zukunftsbonus: www.naturstrom.de/energie24
„Klimaschutz beginnt bei uns!“
Annabelle, naturstrom-Kundin
Zum Editorial der Redaktion in N+U 4/2023
Luise Frank und Severin Zillich schreiben auf Seite 3, dass Krisen und Konflikte die Welt in Atem halten und für entsetzliches Leid sorgen. Aber jammern und sich beklagen über die bewaffneten Auseinandersetzungen ist meiner Meinung nach zu wenig. Durch immer neue Waffenlieferungen ist noch nie ein Krieg beendet worden. Im Gegenteil: Der Krieg eskaliert immer mehr. Viele Milliarden Euro werden sinnlos verschwendet.
In der Ukraine haben beispielsweise sich die Frontlinien seit einem halben Jahr kaum verändert, aber jeden Tag sterben hunderte Soldaten auf beiden Seiten oder den Soldaten werden Gliedmaßen amputiert oder sie werden schwer verwundet.
Der niederländische Klimaforscher Lennard de Klerk errechnete, dass der Ukraine-Krieg allein im ersten Jahr etwa so viele klimaschädliche Emissionen verursachte wie ein Land der Größe Belgiens. Als Umwelt- und Naturschutzorganisation sollte sich der BUND eindeutig für den Frieden aussprechen.
Alfons Trautner, Gräfenberg

»ZORRO« ENTDECKT
Zum Beitrag über den Gartenschläfer in N+U 1/2024
Dank dem Bericht in Heft 01/24 kann ich Ihnen heute die erfreuliche Mitteilung machen, dass sich der »Zorro« bei mir eingenistet hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut!
Monika Dimpel, Burgthann

BLÜHENDE PRACHT IM GARTEN
Zum Pflanzenporträt Schneeheide in N+U 1/2024
In meinem Garten wächst seit 13 Jahren die Schneeheide. Ich habe die Sorten Rubinteppich, Kramers Rote und White Perfection »Isabell«. Sie gedeiht prächtig und ist ein wahrer Bienen-, Hummel- und Schmetterlingsmagnet – das sognannte »erste Brot«.
Die Erde habe ich mit Rhododendronerde etwas verändert; sozusagen etwas saurer Erdanteil, wobei ich darauf geachtet habe, woher diese Erde kommt (Schutz der Torfmoore).
Zudem habe ich noch die Besenheide/Sommerheide, die in Bezug auf die Erdqualität etwas empfindlicher ist als die Winterheide (Sand-Mulchgemisch sauer). Wächst bei mir auch etwas langsamer, aber sie blüht sehr hübsch bis in den Herbst. Wichtig ist der Rückschnitt nach der Blüte. Das hält die Pflanze vital und gesund.
Dazwischen das Highlight Frühlingszwiebeln in Form von Narzissen in unterschiedlichster Form und Farbe. Das rundet auch das Büffet für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge ab.
Wirklich eine wahre Pracht – im Garten summt und brummt es! Christa Stark, Gars am Inn
Wir freuen uns auf Ihre Meinung
BN-Magazin »Natur+Umwelt«, Pettenkoferstr. 10a, 80336 München oder an nu@bund-naturschutz.de
Leserbriefe können gekürzt werden.
Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

LORENZ
Ilona Jerger
Piper Verlag 2023, 24 Euro
Bewegter Lebenslauf
Konrad Lorenz – der Verhaltensforscher, dem die Gänse hinterherlaufen. Dieses Bild haben viele vor Augen. Weniger im Gedächtnis ist seine Rolle für den Naturund Umweltschutz. In der exzellent geschriebenen RomanBiografie »Lorenz« begibt sich Ilona Jerger, langjährige Chefredakteurin der Zeitschrift natur, auf seine Spuren. Sie vermittelt sowohl den großen historischen Rahmen von Lorenz’ Lebenszeit als auch die Details. Sie macht weder Halt vor der Sympathie, die der Verhaltensforscher für die NS-Ideologie hatte, noch davor, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft Insekten aß, um zu überleben. So entsteht ein lebendiges Bild von Konrad Lorenz, seiner Forschung und seinen Erkenntnissen – und den kontroversen Diskussionen, für die diese gesorgt haben. Völlig zurecht ein Beststeller!

EINE LEBENDIGE LANDSCHAFT
Strukturvielfalt ist biologische Vielfalt Uwe Klindworth
Isensee Verlag 2024, 14,90 Euro
Wann ist Landschaft lebendig?
Warum sind Feuchtwiesen, Moore und Heidelandschaften wichtig für die Artenvielfalt? Wie kann man im eigenen Garten ein Zuhause für Tiere und Pflanzen schaffen? Dieses Buch voller schöner, farbenfroher Zeichnungen erklärt größeren Kindern, aber auch Erwachsenen anschaulich, warum wir vielfältige Strukturen in Feld, Wald und Wiese brauchen. Es zeigt, wie verschiedene Lebensräume »funktionieren« und welche Arten im Wald, im Teich oder in Hecken leben. So lernt man den Moorfrosch und den Taumelkäfer kennen, aber auch vermeintliche »Allerweltsarten«, die viele Kinder noch nie gesehen haben, wie den Weißdorn oder das Rebhuhn.
Das komplexe Thema Biodiversität wird hier anschaulich vermittelt.
BAYERISCHER WALD
1. – 7. Juli 2024, Deutschland, Tschechien

Wo einst der Eiserne Vorhang Europa teilte, bilden heute Bayerischer Wald und Böhmerwald eine einmalige Naturlandschaft. Auwälder, Moore und nahezu unberührte Wiesenflächen bieten Wolf, Luchs und Biber einen schützenden Lebensraum. Die Reisenden wandern durch wild-schöne Landschaften und erleben eine DonauSchifffahrt rund um die »Dreiflüssestadt« Passau.
NATIONALPARK EIFEL
8. – 13. September 2024, Deutschland
Im Nationalpark Eifel sollen bis 2034 mindestens dreiviertel der Fläche sich selbst

RILA-GEBIRGE
14. – 26. September 2024, Bulgarien
Vor den Toren von Bulgariens Hauptstadt Sofia erstreckt sich ein Naturparadies mit besonderer Anziehungskraft: das Rila-Gebirge. Mit seinen über 2000 Meter hohen Gipfeln gilt es als das größte Gebirge der Balkanhalbinsel. Die Reisenden wandern durch ge-
Weitere Informationen
überlassen sein und die Natur wieder ihren ureigenen Gesetzen unterliegen. Rauschende Bäche, duftende Blumenwiesen und tiefe Wälder zeugen aber schon heute davon, dass sich die Region bereits auf bestem Weg zurück in die Wildnis befindet. Geplant sind Wanderungen rund um den »Wildnis-Trail« und eine Fahrt auf dem idyllischen Rursee.

schützte Wälder mit über 100 Jahre alten Bäumen, über Wiesen mit vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten und hinauf auf den Musala, den höchsten Berg des Rila-Gebirges.
Tel. 09 11/588 88 20· www.bundreisen.de
Foto: V. Hartwig Foto: U. CallGar tenbank Nr 84 064 639,– 7

Sonnenglas
H 18 cm Nr 33 088 39,99 7
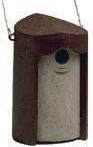
Sonnenglas mini H 10,5 cm Nr 33 170 34,99 7
Nisthöhle 1B – 32 mm
Rotkehlchen, Grauschnäpper, Hausrotschwanz und viele andere, die gerne in Nischen ihre Nester bauen, fühlen sich hier wohl Nr 21 136 34,90 7

Wildbienenhaus CeraNatur® · Aus dauerhaf ter, wärmeausgleichender Keramik, spechtsichere Niströhren mit unterschiedlichem
Durchmesser
Maße: H 18 x B 11,5 x L 5 cm, 1,8 kg Nr 22 292 39,90 7

Hummelburg · Der bemalte Eingang lockt nützlichen Wildbienen an Aus Keramik, mit Nistwolle und Anleitung
Maße: Ø 27 cm, H 16 cm, 5,5 kg Nr 22 117 89,90 7
Gartenmöbel Sassa
Die Serie Sassa ist eine gelungene Kombination aus st abiler Qualit ät und klarem Design Gar tensessel bis zu 4-fach st apelbar Aus FSC®zer tifizier tem Robinienholz, hergestellt in Europa
Forest Steward-ship Council® (FSC®)
Achten Sie auf unsere FSCzer tifizier ten Produkte aus verantwor tungsvoller Waldwir tschaf t


Nisthöhle 2M – 26 mm
Aufgrund des verengten Einflugloches geeignet für kleine Meisen wie Blau-, Sumpf-, Tannenund Haubenmeise Nr 22 139 36,90 7

3er-Set Ohrwurmhäuser
Ohr würmer ernähren sich von Blattläusen und Spinnmilben und sind nacht aktiv Keine Reinigung nötig Maße: Ø 3 cm, H 12 cm Nr. 66 046 19,90 7

Brummblock Nisthilfe für Wildbienen Nr 66 058 26,90 7 im Holzkasten zum Aufhängen (o Abb ) Nr 66 059 36,90 7
Tisch Nr 84 067 829,– 7

Apfelstiege Nr 23 527 29,90 7

Stapelstiegen
Optimale Lagerung von Obst und Gemüse Regionales Fichtenholz
Maße: ca B 48 x H 29 x T 33 cm, inkl Grif f Nr. 33 194 32,90 7

Gießspitze aus Ton – 4 Stück · Fahren Sie beruhigt in die Ferien – eine gefüllte Flasche in der Gießspitze hält die Erde feucht groß Nr 22 653 14,95 7 klein Nr 22 654 13,95 7

Beerensträucher aus ökologischem Anbau – je 3 Stück


Gartenbank Cansa Aus robustem FSC®Robinienholz, Met allteile rostfrei Einfach setzen und genießen
Maße: B 131 x H 90 x T 62 cm
2-Sitzer (ohne Abb ) Nr 83 074 579,– 7
3-Sitzer Nr 83 038 699,– 7

Klimahandtuch · Zeigt die Jahresdurchschnittstemperaturen von 1850 bis heute Ein Teil der Erlöse kommt KlimaschutzProjekten zugute Maße: 180 x 100 cm, aus 100 %zer tifizier ter GOTS-Bio-Baumwolle, hergestellt in Por tugal Nr 80 053 55,– 7
Bestelltelefon (0 30) 2 75 86-480



Schmelzfeuer Outdoor CeraNatur® · Vorab gefüllt mit Wachs für ca 36 Stunden Dauerbrand Aus Keramik
Maße: Ø 20 cm, H 14,5 cm, 4,5 kg Schale Nr 22 119 99,90 7
Ständer Edelstahl Nr 22 287 89,90 7

Wolldecke Mosel · Weiche Decke aus 100 % Schur wolle aus kontrollier t biologischer Tierhaltung in Deutschland Maße: 130 x 180 cm, verschiedene Farbvarianten Nr. 64 014 169,90 7

Solarlampe
Eco Ice Cuber · Eiswür fel mit einem Ruck, wie früher! Auf den Tisch in schicker rostfreier Edelst ahlschale, für 12 Wür fel Maße: 28 x 12 x 5 cm Nr 33 158 4
Die Little Sun ver wandelt fünf Stunden Sonnenlicht in vier Stunden helles oder zehn Stunden gedämpf tes Licht Ø 2,9 cm Nr. 33 087 28,90 7
Bokashi Komposter Sensei Küchenabfälle hygienisch und geruchsneutral sammeln und gleichzeitig Flüssigdünger herstellen Für den Ferment ationsprozess Granulat zugeben Nutzinhalt : ca 11 Liter, Maße: Ø 27 cm, H 57 cm
Nr 27 386 79,90 7
Aktivkohlefilter – 2 Stück
Nr 27 388 11,90 7
Bokashi Komposter Granulat (o Abb ) Nr 27 387 17,90 7
Wasser- und Energiespar-Rechner

Wassersparset Dusche mit Brauseschlauch (Abb.) · Handbrause mit 3 Stufen, mit integrier tem Wassersparer (9 l ⁄ min), Messtüte Passt an alle gängigen Anschlüsse Brauseschlauch PVC-frei, recycelbar, maschinenwaschbar Eine spezielle Befestigung verhinder t das lästige Verdrehen des Brauseschlauchs L 1,8 m Nr 27 419 45,90 7 Wasserspar-Set Dusche (ohne Brauseschlauch) Nr 27 418 29,90 7


Krauterseitling
Pilzbeet-Sets
Pilze im eigenen Gar ten anbauen Mit gepressten Substratblöcken aus Buchenspänen, 1 Packung Dübel (20 St ), Anbauanleitung
Braunkappe Nr 10 502
Kräuterseitling Nr 10 509
Austernpilz Nr 10 510
Limonenpilz Nr 10 511 je 24,90 7

Vogelstimmenuhr
Bei dieser Uhr singt jede Stunde ein anderer Vogel Zu hören bekommen Sie einheimische Vögel, die Sie auch in der Natur entdecken und kennenlernen werden
Nr 21 628 89,90 7
Anzeige
Tel. 09 41/2 97 20-65
(Fragen zur Mitgliedschaft, Adressänderung) mitglied@bund-naturschutz.de MITGLIEDERSERVICE
SPENDENBESCHEINIGUNGEN
Tel. 09 41/2 97 20-66, spenderservice@bund-naturschutz.de





IMPRESSUM

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Luise Frank, Redaktion Natur+Umwelt
Tel. 0 89/5 14 69 76 12 natur-umwelt@bund-naturschutz.de
HAUS- UND STRASSENSAMMLUNG
EHRENAMTLICH AKTIV WERDEN
Christine Stefan-Iberl
Tel. 09 41/2 97 20-11 christine.stefan@bund-naturschutz.de
BN-BILDUNGSWERK
Ulli Sacher-Ley
Tel. 09 41/2 97 20-23 ulrike.sacher-ley@bund-naturschutz.de
BN-STIFTUNG
Christian Hierneis
Tel. 09 41/2 97 20-35 christian.hierneis@bund-naturschutz.de
BERATUNG ZU VERMÄCHTNISSEN, SCHENKUNGEN & STIFTUNGSWESEN
Birgit Quiel
Tel. 09 41/2 97 20-69 birgit.quiel@bund-naturschutz-stiftung.de



Herausgeber: BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN), vertreten durch Peter Rottner, Landesgeschäfts Dr.-Johann-Maier-Str. 4, 93049 Regensburg, www.bund-naturschutz.de Leitende Redakteurin (verantw.): Luise Frank (lf), Tel. 0 89/5 14 69 76 12, natur-umwelt@bund-naturschutz.de
Redaktion: Andrea Siebert (as)
Mitglieder-Service: Tel. 09 41/2 97 20-65
Gestaltung: Janda + Roscher, die WerbeBotschafter, www.janda-roscher.de (Layout: Waltraud Hofbauer) Titelbild 2/24 (28. Jahrgang): Gestaltung J+R Redaktion BUND-Magazin: Severin Zillich (verantw.), Kaiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Tel. 0 30/27 58 64-57, Fax -40
Druck und Versand: Fr. Ant Niedermayr GmbH & Co. KG, Regensburg

27,50 €
Holzohrringe »Fuchs« ø ca. 1 cm

Regionales Saatgut für Bayern (Menge frei wählbar) ab 0,30 €/g

20,00 €
BLV Tier- & Pflanzenführer für unterwegs mit 900 Tier- & Pflanzenarten


Holz-Schlüsselanhänger 4 cm x 4 cm x 0,5 cm; 7 versch. Motive 2,95 € 14,50 €

Holzbroschen »Tiere« ø Köpfe ca. 2 - 2,5 cm; Höhe Fuchs sitzend: 3 cm; 7 versch. Motive

€
»Ökologisch Bauen & Renovieren« BUND-Jahrbuch 2024

Tel. 0 30/2 80 18-149, Fax -400, alter@runze-casper.de. Es gelten die Mediadaten Nr. 32.
Verlag: BN Service GmbH, Eckertstr. 2, Bahnhof Lauf (links), 91207 Lauf an der Pegnitz, Tel. 0 91 23/9 99 57-20, Fax -99, info@service.bund-naturschutz.de
Druckauflage 12024: 152 000
Bezugspreis: Für Mitglieder des BN im Beitrag enthalten, für Nichtmitglieder Versandgebühr, ISSN 0721-6807 BN-Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft München, IBAN DE27 7002 0500 0008 8440 00, BIC: BFSWDE33MUE

www.bn-onlineshop.de
12,50 €

16,50 €
Solar-Bausätze »Windrad« und »Radfahrer« mit BN-Logo
BUND Naturschutz Service GmbH Service-Partner des BUND Naturschutz in Bayern e.V. versand@bn-service.de
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Lieferung solange Vorrat reicht, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten.
Mit Namen gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung Nachdruck nur mit Genehmigung des BN. Für unverlangt eingesandte Artikel oder Fotos keine Gewähr. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. »Natur+Umwelt« wird auf 100% Recyclingpapier gedruckt.
Biosphärenreservat Elbtalaue/Wendland
Individuelle Ferienwohnungen. Naturgarten, Vogelschutzgebiet, gutes Radwegenetz. 2 km zur Elbe. www.hof-elsbusch.de
Zell an der Mosel Fewo im ehemaligen Kloster zwischen Mosel-Weinbergen, für 2 Pers., Balkon, Garten, Allergikerfreundlich. www.kloster-merl.de 0152 53 98 25 01
Stille hören in MV
Sterne gucken, Naturschutzgebiet mit Beobachtungskanzel am See, 2 mod. Fewos, Alleinlage, NR, Allergiker, alter Gutspark, Nähe BarlachStadt Güstrow Tel. 01 60/8 06 27 81 www.stille-hoeren.de
Rügen für Naturfreunde!
Ferienhaus + FeWos in traumhafter Lage im Biosphärenreservat nahe Putbus + Bodden.
Tel. 03 83 01/8 83 24 www.in-den-goorwiesen.de
Die Perle der Chiemgauer Alpen
Aus der Türe der FeWo zum Wandern und Klettern zur Hochplatte, Kampenwand, Geigelstein + Badesee. Absolut ruhige Alleinlage am Waldrand mit Blick auf den Wilden Kaiser.
Tel. 0 86 49/98 50 82 www.zellerhof.de
Wendland
Biosphärenreservat Elbtalaue u. Nehmitzer Heide, gemütliches Holzhaus für 4 Personen in Gartow am See, wo die Zugvögel rasten, der Kranich brütet, der Biber zu Hause ist.
Tel. 0 58 46/3 03 31 85 e.topeters@gmx.de
Wieder Nordsee?
Nähe St. Peter Ording, FeWo für kurz entschlossene Naturfreunde, ab 45 € pro Tag, NR, Kind und Hund willkommen, Garten und Grill.
Tel. 0 48 62/80 52
Bodensee
Gemütliche FeWo für 2 Personen in Friedrichshafen, 300 m zum See, ruhige Lage, Nähe Naturschutzgebiet
Tel. 01 76/41 25 48 78 www.haus-seefreude. jimdosite.com
EUROPA
500 Fastenwanderungen Europaweit, ganzjährig. Woche ab 350 €. Täglich 10–20 km. Auch Intervallund Basenfasten.
Tel. 06 31/4 74 72 www.fastenzentrale.de
Villa Caretta
An einem einsamen Strand bietet das Ferienhaus ideale Möglichkeiten für einen naturnahen Urlaub für bis zu 8 Personen. www.villa-caretta.de / info@villa-caretta.de
ITALIEN
TOSCANA
Haus mit Traumblick, gr. Garten, ruhig, 66/T Tel. 01 76/96 34 91 37 www.casarustica-lampo.de
www.elysana.de
Naturseife ohne Duft, ohne Farbstoffe, ohne Plastik 10 % Code: BUND24 Solange Vorrat reicht.
Hochgras-Mäher
Kreismäher + Mulchmäher für Streuobstwiesen, Biotop- u. Landschaftspflege Viele Modelle ab 1.145,- €

inkl. MwSt. www.vielitz.de Qualität seit 1959
Tel.: 0421-633025 E-Mail: info@vielitz.de


ökologisch - praktisch - gut für draußen & für drinnen, aus Holz, einfach steckbar, wasserdichte Baumwollplanen, Branding info@klipklap.de 033928 239890 www.klipklap.de klipklap :: Infostände & Marktstände

Nächster Anzeigenschluss: 4. Juli 2024 www.bund-kleinanzeigen.de • Tel. 030/28018-149



Ihre Spende hilft bei: Flächenankäufen Wiedervernässung und Pflege Aufklärung
SPENDENKONTO BUND NATURSCHUTZ

Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Mitgliedsnummer mit an. Dies hilft uns Verwaltungskosten zu sparen. Bei Spenden über 300 Euro erhalten Sie eine Spendenquittung. Für Zuwendungen bis 300 Euro gilt der Bankbeleg für das Finanzamt.
Oder nutzen Sie unser Onlineformular unter: www.bund-naturschutz.de/bayerns-moore-retten