
Hauseigentümerverband Aargau
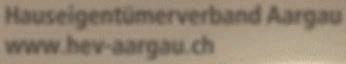

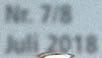


Hauseigentümerverband Aargau
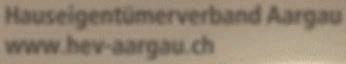

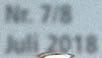


Gebäudeabstand



Küchen – Jetzt von einmaligen Frühlingsangeboten profitieren!
Aktionen gültig für Bestellungen bis 15. Juli 2018

Nur Fr. 16’800.–Vorher: Fr. 19’600.–Sie sparen: Fr. 2’800.–CESANA
Inklusive Markengeräte von



Preisgleich lieferbar in 3 verschiedenen Frontfarben.

P 40’000fach praxisbewährt
P Grosse Modellvielfalt in Form, Grösse und Ausstattung
P Hoher Liegekomfort
P Patentiertes Tür- und Verriegelungssystem
P Wahlweise und auf Wunsch mit Sprudeldüsen oder Hebesitz ausrüstbar
Ausstellungsküchen zum ½ Preis!
Gratis Besteckund Geschirrset
Ihr Geschenk zur Küchenofferte ab Fr. 7500.–


Jetzt zum ½ Preis!
Geschirrset 30-teilig







Besteckset 24-teilig
Jetzt Bon in Ihrem Küchenund Bad-Studio abholen.
Jetzt zum ½ Preis!


TWINLINE 1







Aktion: Fr. 500.– Rabatt bei Bestellung einer Twinline bis 15.7.2018



TWINLINE 2
Ausschliesslich gültig für Besucher einer FUST Küchen- und Badaus stellung bis 15. Juli 2018. Eine spätere Anrechnung ist aus organisatorischen Gründen aus geschlossen.
Solange Vorrat.
Mehr dazu unter www.fust.ch/aktionen
Gratis Handtuchset
Ihr Geschenk zur Bad offerte ab Fr. 4500.–


Handtuchset 12-teilig
Heimberatung –Kostenlos und unverbindlich.
Wir kommen zu Ihnen nach Hause und planen Ihr Bad dort, wo es später auch stehen soll. So können Sie sicher sein, dass auch alles genau passt.
Jetzt Heimberatung anfordern: Tel. 0848 844 100 oder Mail an: kuechen-baeder@fust.ch
Spreitenbach, Shoppi Tivoli, 056 418 14 20 • Suhr, im Möbel Pfister, Bernstrasse Ost 49, 062 855 05 40 • Wohlen, Zentralstrasse 52a, 056 619 14 70 • Füllinsdorf, Schneckelerstrasse 1, 061 906 95 10 • Egerkingen, Gäu-Park,Hausimollstrasse 1, 062 389 00 66 Zug, im COOP City: 2. OG, Bundesplatz 11, 041 726 70 35 • Zürich, im FUST-Center Eschenmoser, Birmensdorferstrasse 20, 044 296 66 90

Nach Ausführungen zu Holzbrücken im Kanton Aargau startet in dieser Ausgabe eine neue Serie, die Aussichtspunkte zum Thema macht. Der erste Beitrag führt nach Baden zum Wasserturm Baldegg. Wer bereit ist, 151 Stufen zu überwinden, wird mit einem fantastischen Panorama belohnt. Dazu gehört der Blick auf die höchsten Gipfel der Berner Alpen.
NATÜRLICHE MATERIALIEN

Im aargauischen Oberhofen wird der schweizweit einzigartige Schilfsandstein abgebaut. Er eignet sich innen für Bodenbeläge und Ofenanlagen und aussen für die Gestaltung von Garten und Umgebung. Für Böden aus Holz und Bettwäsche aus Leinen werden ebenfalls natürliche Materialien verwendet, die aufgrund ihrer Behaglichkeit beliebt sind.

Früher hiess es, die Axt im Haus erspare den Zimmermann. Heute erspart Uber das Taxi, Airbnb das Hotel und Moneypark die Bank. Die Welt ist in Bewegung. Im Hypothekarmarkt Schweiz sind die Banken nach wie vor die grössten Kreditgeber. Doch neue Anbieter drängen auf den Markt und machen den Etablierten Anteile streitig. Allen voran Versicherungen und Pensionskassen, neu auch der Darlehensvermittler Moneypark, der mehrheitlich der Helvetia-Gruppe gehört. Wie der letzten Mai-Ausgabe der NZZ am Sonntag zu entnehmen ist, will Moneypark neue Märkte erschliessen und über attraktive Angebote für Kundensegmente nachdenken, die derzeit Mühe haben, günstige Kredite von Banken zu erhalten. Dazu gehören ältere Leute und junge Familien.
Etwas mehr Wettbewerb im Hypothekargeschäft schadet auf den ersten Blick nicht. Allerdings gibt es handfeste Gründe, weshalb Ältere und junge Familien in zahlreichen Fällen Schwierigkeiten haben, Darlehen für Hauskauf, Bauvorhaben oder Renovationen zu erhalten. Menschen in Pension verfügen normalerweise über weniger Einkommen als zum Zeitpunkt, als sie noch im Arbeitsprozess standen. Es ist deshalb angemessen, dass Banken die Bonität von Pensionierten anders beurteilen als von jenen, die mitten im Erwerbsleben sind.
Es ist richtig, dass es kaufkraftbereinigt heute oft teurer ist, Eigentum zu erwerben, als dies für frühere Generationen der Fall war. Allerdings ist beizufügen, dass die Konsumgewohnheiten heutiger Generationen üblicherweise aufwendiger sind als die vorheriger. Ursachen für die zögerliche Verbreitung von Wohneigentum unter Jüngeren sind nicht nur in die Höhe geschnellte Immobilienpreise, sondern auch verändertes Konsumverhalten und erweiterte Ansprüche. Deshalb ist es nicht unerheblich, dass auch neue Anbieter im Hypothekarmarkt Tragbarkeits- und Finanzierungsregeln Beachtung schenken. Wenn durch die Aktivitäten neuer Kreditanbieter, die weniger strengen Regulierungen unterliegen als Banken, die Verschuldung in neue Höhen geschraubt würde, wäre das volkswirtschaftlich wenig sinnvoll.
Heizöl • Diesel • Benzin Tankrevisionen/-sanierungen




Als Mitglied des Hauseigentümerverbandes profitieren Sie von Vergünstigungen beim Kauf von Heizöl bei Voegtlin-Meyer AG.
So profitieren Sie bei Voegtlin-Meyer AG Sie bestellen telefonisch bei Voegtlin-Meyer AG. Bei der Bestellung geben Sie Ihre Mitgliedernummer beim Hauseigentümerverband an. Voegtlin-Meyer AG gewährt Ihnen Rabatt auf den aktuellen Tagespreis. Die Aktion ist zeitlich nicht beschränkt (gültig bis auf Widerruf).
Preisnachlass bei Voegtlin-Meyer AG
Menge in LiterRabatt in Rp. pro 100 Liter
500 –1499 120
1500 –2499110
2500 –3499100
3500 –599990
6000 –899980
9000 –1399970
14000 –1999960
20000 –2500040
Wechseln Sie jetzt zu Öko-Heizöl!
Der Umwelt zuliebe empfehlen wir Ihnen Öko-Heizöl 50 ppm.
Gerne beraten wir Sie über den Produktewechsel, wo wir Öko-Heizöl 50 ppm liefern, den Tank sauber reinigen und das alte Heizöl extra-leicht gegen Gutschrift zurücknehmen. Diese Arbeiten erfolgen alle in einem Arbeitsgang durch unser geschultes und eigenes Personal.
Wir beraten Sie gerne. Bestellungen beim Team der Voegtlin-Meyer AG unter:
Tel. 056 460 05 05
5210 Windisch www.voegtlin-meyer.ch







Reiheneckhaus Strengelbach
4½ Zimmer, 145 m2 Wohnfläche
346 m2 Grundstück, sehr gepflegt
BJ. 1998, ruhige Lage, Pergola Weitsicht, Dachraum ausbaubar Garage, Besucherparkplätze Verkaufspreis CHF 650’000.–
Terrassenwohnung Nussbaumen
3½ Zimmer, 84.5 m2 Wohnfläche BJ. 2016, Erstbezug, eigene Waschküche sonnig, ruhig, 42.5 m2 Terrasse Nähe ÖV, Schulen und Läden inklusive zwei Tiefgaragen-Parkplätze Verkaufspreis CHF 834’000.–
Wohn- und Gewerbehaus
Waltenschwil
262 m2 Wohnen, 557.7 m2 Gewerbe
Stilvolles, sehr gepflegtes Wohnhaus Grosser Umschwung mit Teichanlage Vielfältig nutzbare Gewerbefläche Garage, Abstellplätze Verkaufspreis CHF 2’300’000.–
Eigentumswohnung Unterentfelden
6½ Zimmer, 173.4 m2 Wohnfläche zzgl. 46 m2 Sonnenterrasse Hobbyraum, Tramhaltestelle in der Nähe im Grünen und dennoch zentral inklusive Tiefgaragen-Parkplatz Verkaufspreis CHF 780’000.–
Eigentumswohnung Unterentfelden
5½ Zimmer, ca. 140.9 m² Wohnfläche grosszügig, hochwertig ausgebaut zwei Nasszellen, eigener Waschturm grosser Balkon, Nähe Aarau inklusive zwei Tiefgaragen-Parkplätze Verkaufspreis CHF 750’000.–
Eigentumswohnung Buchs AG
4½ Zimmer, 137 m² Wohnfläche modern, hoher Ausbaustandard bevorzugte, familienfreundliche Lage teilweise überdeckter Balkon inklusive zwei Tiefgaragen-Parkplätze Verkaufspreis CHF 860’000.–
Eigentumswohnung Bad Zurzach
4½ Zimmer, 140.5 m² Wohnfläche grosse Sonnenterrasse, Migrosmarkt und Restaurant im Haus, ÖV vor der Tür inklusive Kellerabteil, Reduit und Tiefgaragen-Parkplatz Verkaufspreis CHF 680’000.–







Einfamilienhaus Neuenhof
4½ Zimmer, 85.8 m2 Wohnfläche 339 m2 Grundstück, gepflegt, ruhig nahe Waldrand und Kindergarten gute Verkehrs- und ÖV-Anbindung Gartenschopf, Aussenparkplatz Verkaufspreis CHF 690’000.–
Maisonettewohnung Spreitenbach
4 Zimmer, 110 m2 Wohnfläche zwei Balkone, schöne Aussicht sehr gut unterhaltene Liegenschaft grosse Galeriefläche inklusive eigene Garagenbox Verkaufspreis CHF 730’000.–
Maisonettewohnung Ehrendingen
3½ Zimmer, 87.9 m2 Wohnfläche sonnige und ruhige Lage, zwei Balkone Nähe ÖV und Schulen inklusive Hobbyraum und Tiefgaragen-Parkplatz Verkaufspreis CHF 495’000.–
Einfamilienhaus Kölliken
4½ Zimmer, 127 m² Wohnfläche 900 m² Grundstück, helle Räume BJ. 1961, nähe ÖV, ruhige Lage grosser Garten, Garage Verkaufspreis CHF 685’000.–
Einfamilienhaus Niederlenz
4 Zimmer, 88 m² Wohnfläche 589 m² Grundstück, grosser Garten BJ. 1955, verkehrsberuhigte Lage Dachraum ausbaubar, Garage Verkaufspreis CHF 625’000.–
Einfamilienhaus Bözberg
7½ Zimmer, 249 m² Wohnfläche 869 m² Grundstück, Wintergarten Garten mit Teichanlage, Kachelofen Möglichkeit für Einliegerwohnung hochwertige Bauweise, Doppelgarage Verkaufspreis CHF 1’300’000.–
Einfamilienhaus Birr
5½ Zimmer, 159 m2 Wohnfläche 580 m2 Grundstück, sonnig, grosszügig Cheminée, Steinbrunnen im Garten Bastelraum, Doppelgarage 3 Aussenparkplätze Verkaufspreis CHF 1’080’000.–









Hansjörg Knecht
Nationalrat, Leibstadt, Präsident
Hauseigentümerverband Aargau
Jedes zeitgemässe Staatswesen braucht Steuern, um ihm anvertraute Aufgaben wahrnehmen zu können. Dies sollte nach dem Äquivalenzprinzip geschehen: Die Höhe der Abgaben richtet sich nach dem Empfang staatlicher Leistungen durch die Bürgerinnen und Bürger.
In der Praxis wird dieses Prinzip oft verletzt. Erhöhungen bei Steuern und Abgaben dienen häufig fiskalischen und anderen Ansprüchen. Davon ist auch das Wohneigentum betroffen. Das zeigt sich beispielsweise bei der Debatte um die Eigenmietwertbesteuerung. So stellen sich Vertreter öffentlicher Aufgaben gegen die Abschaffung, weil sie Steuerausfälle befürchten. Es ist aber nicht Aufgabe von Wohneigentümern, fiskalische Bedürfnisse der öffentlichen Hand zu befriedigen, sondern angemessene Abgaben für einen Teil ihres Vermögens, das Wohneigentum, zu leisten. Die Eigenmietwertbesteuerung ist systemfremd. Sie besteuert Einnahmen, die es nicht gibt – fiktive Mieteinnahmen. Die Eigenmietwertbesteuerung rüttelt am Prinzip der steuerlichen Belastung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.
Wohnen benachteiligt Nicht nur der Fiskus, auch die Klimapolitik hat das Wohneigentum entdeckt. Der Regierungsrat will das geltende Energiegesetz verschärfen. Bisher durfte das bestehende System einer Heizungsanlage bei einer Ersatzbeschaffung durch eine gleichartige Anlage ersetzt werden. Neu
sollen Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen nur noch dann zulässig sein, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine energieeffizientere Heizungsanlage mit geringerem CO2-Ausstoss zur Verfügung steht, die für die geplante Anwendung genügt und wirtschaftlich tragbar ist. Beabsichtigt ist auch, dass bestehende zentrale Wassererwärmer, die ausschliesslich direkt beheizt werden, innert 15 Jahren durch ein anderes System ersetzt werden. Grund: Dieser Typ von Wassererwärmer verbrauche zu viel Strom. Das mag stimmen. Aber jemand, der sein Velo durch ein E-Bike ersetzt und dadurch mehr Strom konsumiert, wird von den Behörden nicht behelligt. Und jemand, der eine Reise bucht, muss keinen Nachweis erbringen, dass ihm das Reisebüro eine energieeffizientere Reise mit geringerem CO2-Ausstoss, sprich ein Angebot mit kürzerer Flugstrecke als die ausgewählte, empfohlen hat.
Fazit: Ich stelle eine Ungleichbehandlung von «Mobilität» und «Wohnen» fest, obwohl es der Gebäudebereich ist, der die Vorgaben des von der Schweiz mitunterzeichneten Kyoto-Protokolls nahezu erfüllt hat, während im Bereich Mobilität die Lücke zwischen Verpflichtungen und Zielerreichung viel grösser ist. Das ist kein Plädoyer für neue Verkehrsabgaben, sondern
bloss ein Aufzeigen der Ungleichbehandlung von Verkehr und Wohnen.
Vorschriftenflut – Wohnungsnot Es gibt weitere Beispiele dafür, wie Vorschriften das Bauen und Wohnen unnötig einschränken. Mit dem Raumplanungsgesetz soll die Zersiedelung der Schweiz gestoppt und die Verdichtung nach innen gefördert werden. Doch wie sieht die Realität aus? Wenn Eigentümer in städtischen Gebieten Wohngebäude erweitern wollen, sind sie mit einer Vielzahl von Vorschriften konfrontiert, namentlich in Bereichen wie Denkmalschutz oder Lärm, was investitionshemmend wirkt. Die Schaffung von neuem Wohnraum wird behördlich verhindert. Eine Abwärtsspirale setzt ein: Vorschriften schrecken Investoren von Bauvorhaben ab, das Wohnungsangebot hält nicht Schritt mit der Nachfrage, Wohnen wird teurer. Dies wiederum bildet den Nährboden für populistisch anmutende Forderungen wie die Schaffung von staatlich verbilligtem Wohnraum für einige, was neue Ungleichheiten nach sich zieht und die öffentliche Verschuldung weiter verschärft. Die Wohnungskrise in Frankreich ist ein Lehrbeispiel für diese Abwärtsspirale. Um ihr entgegenzuwirken, braucht es Gradlinigkeit in der Eigentumspolitik, private Initiative und behördliche Zurückhaltung.

Besser jetzt als zu spät! 056 438 05 35 (24h) oder 044 746 66 66 (24h) www.kanaltotal.ch
total Hächler-Reutlinger
Von den bisher vorgestellten Tälern des Kantons Aargau, wo denkmalgeschützte Brücken die Ufer der grössten Schweizer Flüsse verbinden, ändert die folgende Beitragsreihe den Blickwinkel, schaut in schwindelerregende Höhen und stellt spektakuläre Aussichtspunkte in unserer schönen Gegend ins Zentrum.

Der Restaurantturm wirkt vergleichsweise unscheinbar.

Salomé Edelmann, HEV Aargau
Naherholungsgebiete erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Ihr Vorhandensein steigert oft die Attraktivität eines Wohnorts. Ebenso verhält es sich mit der Aussicht bei Immobilien. Sie bestimmt den Wert einer Liegenschaft wesentlich mit. Leider sieht aber längst nicht jeder Eigentümer in die weite Ferne. Die neue Beitragsreihe möchte mit auserlesenen Ausflugszielen, an denen bei klarem Wetter eine schöne Sicht garantiert ist, inspirieren.
Inmitten prächtiger Wälder Besonders eindrucksvoll präsentieren sich Naturräume aus der Vogelperspektive. Für den Menschen sind öffentlich zugängliche Türme zur Betrachtung der Landschaft sehr willkommen. So kann beispielsweise Baden mit dem Turmreservoir auf dem Hausberg Baldegg auftrumpfen. Nahe der Geschäftsstelle des HEV Aargau beim Bahnhof West fährt die Buslinie Nummer 5 direkt bis zum Restaurant Baldegg – einem nahen Ausgangspunkt für die Besteigung des Wasserturms. Die Überwindung der 151 Stufen lohnt sich allemal. Dem Betrachter präsentiert sich ein fantastischer Fernblick vom Schwarzwald über das Mittelland bis hin zum Säntis und zur Jungfrau. Alpenzeiger auf der Aussichtskanzel erleichtern den Besuchern die genaue Orientierung.
Reservoir im Hochbehälter Nebst dem viel kleineren, unzugänglichen Wasserturm in Baldingen ist das Turmreservoir auf dem Hundsbuck der Gemeinde Baden das einzige dieser Art im Kanton Aargau. Der alte Wasserturm wurde im Jahre 1905 mit 12 Metern Höhe gebaut. 1985 ersetzte ihn die Regionalwerke AG Baden (RWB) durch den 34 Meter hohen Betonbau in der Nähe des Restaurants Baldegg.

Das Aargauische Versicherungsamt setzte sich zuvor für eine Löschwasserreserve ein. Der neue Turm steht auf vier Pfeilern, die zirka 18 Meter hoch sind. Darüber befinden sich aufsteigend die Schieber-, die Brauchwasser- und die Löschwasserkammer. Letztere muss jederzeit einen Löschwasseranteil von 100 Kubikmetern gewährleisten können. Die darunterliegende Seitenkammer umfasst 100 Kubikmeter Trinkwasser. In beiden Hochbehältern wird das Wasser fortlaufend ausgewechselt. Dieses Zweikammersystem ermöglicht es im Wartungsfall, dass die Anlage ununterbrochen funktioniert. 2004 wurde der Turm aufgrund der Stationierung von Mobilfunk-Sendeanlagen nochmals um vier Meter erhöht.
Licht einschalten
Zur Aussichtsplattform hoch führt eine Wendeltreppe. Zuerst im Freien, dann im Inneren des Turms. Zwar beleuchten Lampen das Turminnere, allerdings mittels Zeitautomatik. Da lediglich ein Lichtschalter an jedem Ende der Treppe angebracht ist, empfiehlt es sich, den Schalter zu drücken, bevor der Aufstieg beginnt, ansonsten
kann es passieren, dass der letzte Teil im Dunkeln überwunden werden muss.
Gut informiert
Während der nebelverhangenen Wintermonate im Limmattal scheint nicht selten auf dem Wasserturm auf 601 Meter über Meer die Sonne. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Webcam zu werfen (s. nachfolgend unter Links). Im September 2017 wurde die Kamera auf der Spitze des Turms
installiert und überträgt nun das ganze Jahr Live-Bilder. Die Daten können auch im Nachhinein jeden Tag und jede Minute zurückverfolgt werden.
Links:
https://baden.roundshot.com/turm-baldegg www.baldegg.ch
www.liegehalle-beizli.ch
www.baden.ch/public/upload/assets/18145/ Pub_Running_Walking_Trail.pdf
Aufzüge als Transportmittel erleichtern in Wohngebäuden das mühelose Erreichen von Geschossen. Besonders bei körperlicher Beeinträchtigung gewinnen diese Anlagen an Bedeutung.

Aufzüge nden in verschiedensten Gebäudetypen Verwendung.
Aufzüge erleichtern das Überwinden von Höhendifferenzen als komfortables, zeitsparendes und nützliches Hilfsmittel. Grundsätzlich macht ein Aufzug in einem Mehrfamilienhaus bereits ab zwei Geschossen Sinn, da sich Wohnkomfort und Wert des Gebäudes erhöhen. Mieter mit Gehbehinderung, Eltern mit Kinderwagen oder Personen mit schwerem Gepäck sind zudem auf einen Lift angewiesen.
Nutzlast und Anzahl Personen
Die Installation eines Aufzugs greift erheblich in die Gebäudekonstruktion ein und ist bereits in einer frühen Phase der Planung zu berücksichtigen. Besonders Schallschutzanforderungen verhindern eine Be-
Treppenlifte
Foto: AS Aufzüge
einträchtigung der Bewohnenden. Neuere Anlagen mit integriertem Schallschutz reduzieren deshalb die Geräuschkulisse in und ausserhalb der Kabine. Die Nutzlast und damit die Anzahl der zu befördernden Personen bestimmen grundsätzlich die Grösse von Aufzügen. Die technischen Komponenten und der damit verbundene effektive Platzbedarf können zwischen den verschiedenen Herstellern variieren.
Wohngebäude mit Aufzügen
«Hydraulisch betriebene Aufzüge sind in Wohnhäusern mittlerweile weniger gebräuchlich», sagt Kurt Kaufmann, Geschäftsführer der AS Aufzüge AG. Üblich sind heutzutage hingegen maschinenraumlose Aufzüge mit Tragmitteln und dem Antrieb im Schachtkopf. Besonders empfeh-
Sie sollen nur innerhalb einer Wohnung eingeplant werden, wenn weder Raum für einen Lift noch für eine Hebebühne vorhanden ist. Um einen Treppenlift nachträglich einbauen zu können, braucht es genügend breite Treppen und gefällefreie Podeste beim An- und Austritt. Werden diese schon vorgängig eingeplant, erlaubt dies ein Anpassen an veränderte Bedürfnisse. Der Einbau erfolgt unter Einhaltung der Norm SN EN 81-40. Die Fahrrohre müssen höher als 65 cm montiert sein, damit das Geländer seine Schutzfunktion weiterhin erfüllt. Sonst könnten diese von Kindern als Aufstiegs- und Kletterhilfe genutzt werden.
Quelle: bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
lenswert sind Systeme ohne einen zusätzlichen Dachaufbau. Für Kaufmann liegen die Vorteile auf der Hand: «Ein Lift ohne Dachaufbau mindert Schwachstellen in der Dachkonstruktion und senkt die Kosten damit massgeblich.
Wartungen erhalten zudem die Funktionalität von Aufzügen. Die Bewohnenden können oftmals nur schwer einschätzen, ob ein Umbau oder gar ein Austausch Sinn macht. Womöglich ist auch eine präventive Reparatur die passende Lösung», weiss Kaufmann und empfiehlt daher, den zuständigen Servicetechniker beizuziehen.
Regelmässig warten
Die Wartungsintensität richtet sich nach Alter der Anlage, Nutzerfrequenz und Umgebungseinflüssen, die regelmässige Wartung stellt die übliche Lebenserwartung eines Lifts von 20 bis 30 Jahren sicher. Als nützliche «Faustregel» gelten die Vorgaben vom Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (VSA):
• 6 Wartungen: bei weniger als 2000 Fahrten pro Woche oder bis 4 Haltestellen
• 9 Wartungen: bei 2000 bis 5000 Fahrten pro Woche oder 5 bis 8 Haltestellen
• 12 Wartungen: bei über 5000 Fahrten pro Woche oder mehr als 9 Haltestellen
• 12 Wartungen: werden generell an Aufzügen durchgeführt, die vor 1979 installiert wurden
Modernisierungsmassnahmen in drei Varianten und in Abhängigkeit des Alters der Aufzüge greifen bei unzureichendem technischen Standard:
• Modernisierung von Einzelkomponenten
• Modernisierung von Kernkomponenten
• Komplettaustausch des Aufzugs
Normen massgebend
Die Normen SN EN 81-20 und SN EN 81-50 geben seit 2017 Auskunft über Auf- und Ein-
bau von Aufzügen sowie Prüfungen und Berechnungen. Alle in Betrieb genommenen Aufzüge müssen diesen entsprechen, um die Sicherheit für Nutzende und Servicetechniker zu gewährleisten. So vermeiden beispielsweise Lichtvorhänge Verletzungen an Personen durch schliessende Türen. Bei den Materialien für Kabinenböden, -wände und -decken müssen zudem besondere Brandschutzanforderungen beachtet werden.
Hindernisfrei umgesetzt
Behindertengerechte Aufzüge sind grösser als herkömmliche und verfügen beispielsweise über Haltegriffe sowie gut erreichba-
Modernisierungskonzept
re Bedienelemente. Das BehiG formuliert in Art. 3 die Gebäudekategorien, in denen ein behindertengerechter Zugang zu Gebäude und Wohneinheit gesetzlich vorgeschrieben sind. In Wohngebäuden mit mehr als acht Wohneinheiten sind Aufzüge notwendig, in einigen Kantonen bereits ab vier Wohneinheiten erforderlich. Auch die SIA 500 «Hindernisfreies Bauen – Richtlinie für behinderten- und altersgerechten Wohnbau der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen» nennt Informationen zur behindertengerechten Ausführung gemäss der jeweiligen Gebäudenutzung.
Art der ModernisierungEinzelkomponenten
Empfohlen, wenn der Aufzug… – ein geräuschvolles Türsystem hat – mit einer veralteten und unpraktischen
Signalisation ausgestattet ist
– älter als 10 Jahre ist

















Kernkomponenten
Wartungsvereinbarungen
Für die regelmässige Wartung kann ein Servicevertrag abgeschlossen werden. Dieser leistet einen Beitrag zur Sicherheit der Nutzenden und zum Werterhalt des Lifts. Grundsätzlich können Kunden zwischen einem Teilservicevertrag mit oder ohne Störungsbehebung wählen. Ein Vollservicevertrag beinhaltet den kompletten Umfang von der regelmässigen Wartung über den präventiven Austausch von Bauteilen bis hin zur raschen Störungsbehebung.
– sehr viel Strom verbraucht – auf den Zieletagen nicht eben anhält
– über eine unpraktische oder veraltete Innenausstattung verfügt
– zwischen 15 und 20 Jahre alt ist








Komplettaustausch
– über eine kleine und beengte Kabine verfügt
– viel Zeit für die Fahrt von einer Etage zur nächsten benötigt
– häufig ausser Betrieb ist – älter als 25 Jahre ist























DER OFFENEN TÜR IM KURATLE SHOWROOM: SAMSTAG, 30. JUNI 2018
Gerne beraten wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.
Ab 1. Juli 2018 sind wir in Spreitenbach an der Willestrasse 3 mit dem neuen grossflächigen KURATLE SHOWROOM und einer grossen Auswahl an PARKETT, FASSADEN, TERRASSEN und TÜREN vertreten.
Das KURATLE & JAECKER Team freut sich auf Ihren Besuch! kuratlejaecker.ch
Am Abend des 27. Juli wird ein ganz besonderes Ereignis am Himmel zu sehen sein. Mit einer Totalitätsdauer von einer Stunde und 43 Minuten kann die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts beobachtet werden.

Während der totalen Ver nsterung erhält der Mond seine charakteristische rötliche Farbe.
Andreas Walker, Wissenschaftsjournalist, Hallwil
Sonnen- und Mondfinsternisse wurden in der antiken Mythologie häufig mit Kämpfen von Gut und Böse verbunden. Dies ist leicht nachzuvollziehen, drängt sich doch in einem dualen Weltbild die Verknüpfung mit Licht und Schatten geradezu auf. Man betrachtete eine Finsternis auch als Folge von Ohnmacht, Krankheit oder Tod des verfinsterten Himmelskörpers und man nahm an, dass Sonne oder Mond ihren gewohnten Platz am Himmel verlassen hätten.
Heute wissen wir, dass eine Mondfinsternis durch ein kosmisches Schattenspiel verursacht wird und können daher dieses Phänomen fasziniert betrachten. Bei einer Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond exakt in einer Linie. Dabei durch-
quert der Vollmond den Erdschatten, was zu einer totalen Verfinsterung unseres Erdtrabanten führt. Die Mondbahn verläuft nicht ganz genau in der gleichen Ebene wie die Erdbahn, sie ist um fünf Grad zur Erdbahn geneigt. Wäre dies nicht der Fall, gäbe es bei jedem Vollmond eine Mondfinsternis und bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis. Während der Totalität wird der Mond in der Kernschattenzone der Erde nicht gänzlich verfinstert. Die Erdatmosphäre lässt aufgrund ihrer Streuwirkung nur noch rotes Licht in den Kernschattenbereich passieren, was dem Mond seine charakteristische rötliche Farbe während der totalen Verfinsterung verleiht.
Farbe immer wieder anders Jede Mondfinsternis sieht ein bisschen anders aus, da die Farbe während der To-
talität durch den Zustand der Erdatmosphäre bestimmt wird. Einerseits spielt der Verschmutzungsgrad der Erdatmosphäre eine wichtige Rolle, denn Vulkanausbrüche oder auch vom Menschen produzierte Luftverschmutzung trüben die Luft und führen dazu, dass die wenigen Lichtstrahlen, die durch die Erdatmosphäre auf die Mondoberfläche fallen, röter werden, ähnlich wie die untergehende Sonne sich immer röter verfärbt. Auch die momentane Bewölkung in der Erdatmosphäre hat einen wichtigen Einfluss. Befinden sich zur Zeit der Totalität viele Wolken in der Erdatmosphäre, wird mehr weisses Licht auf die Mondoberfläche gestreut, als ohne Wolken – die Mondoberfläche erscheint dadurch ein bisschen heller. Zudem spielt die Passage des Mondes durch den Erdschatten noch eine wichti-
ge Rolle. Je zentraler der Mond durch den Erdschatten läuft, desto dunkler wird die Finsternis.
Temperatursturz auf dem Mond Da sich der Mond pro Erdumlauf genau einmal um seine eigene Achse dreht, dauern Mondtag und Mondnacht jeweils rund 15 Erdentage. Weil der Mond ausserdem keine Atmosphäre besitzt, kann auch kein Temperaturausgleich zwischen Tag- und Nachtseite stattfinden. Dies führt zu extremen Oberflächentemperaturen. So herrscht auf der Tagseite des Mondes eine Temperatur von etwa 120 °C am «Mittag», während sie auf der Nachtseite bis auf –130 °C fällt. Wegen der fehlenden Atmosphäre kommt es ausserdem zu krassen Temperaturstürzen. Besonders rasche Temperaturveränderungen wurden bei Mondfinsternissen gemessen. Sobald der
Mond in den Erdschatten eintaucht, breitet sich eine arktische Kälte aus.
Für diese Mondfinsternis sind Jahreszeit, Tageszeit und Wochentag absolut optimal. Am Freitagabend geht der Mond um 20.56 Uhr auf, zehn Minuten nachdem er in den Kernschatten der Erde getreten ist. Bereits dieser Anblick dürfte an einem lauen Sommerabend in der Dämmerung sehr spektakulär sein. Von 21.30 Uhr bis 23.13 Uhr wird der Mond gänzlich verfinstert sein und vor allem in verschiedenen Rottönen erscheinen. Da er zentral durch den Erdschatten läuft, dauert die Finsternis extrem lange und dürfte in der Mitte der Totalität sehr dunkel werden, was sehr selten ist. Schliesslich ist die Finsternis um 00.19 Uhr (28.7.) mit dem Austritt des Mondes aus dem Kernschatten zu Ende.


Möchten Sie eine Entkalkungsanlage ausprobieren?
WEICHES WASSER 1
–DANACH ENTSCHEIDEN: Mit dem flexiblen KalkMaster-Probeabo können Sie die Enthärtungsanlage weiter mieten, kaufen oder wieder zurückgeben!


Wichtigste Bedingung zur Beobachtung der Mondfinsternis ist schönes Wetter. Bei lockerer Bewölkung hat man die Chance, den Mond hin und wieder klar zu sehen. Die Mondfinsternis ist von blossem Auge gut sichtbar. Ein Feldstecher leistet bereits gute Dienste für nähere Beobachtungen. Der Beginn der Finsternis beginnt bereits am Horizont, denn beim Mondaufgang hat die Finsternis schon begonnen. Im Sommer ist die Vollmondbahn tief, deshalb wird der Mond bis zum Ende der Mondfinsternis eine Höhe von nur etwa 20 Grad erreicht haben. Wer freie Sicht bis zum Ende der Totalität haben will, muss also darauf achten, dass der östliche und der südliche Horizont tief liegen und der Mond nicht durch Berge oder Hügel verdeckt wird. Sollte das Wetter mitspielen, dürfte dieses Schauspiel in einer lauen JuliNacht ziemlich eindrücklich werden.

Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um Strom geht. Die regional organisierten Spezialisten der Certum Sicherheit AG prüfen Elektroinstallationen und stellen die erforderlichen Sicherheitsnachweise aus.

In Entscheiden von Behörden und Gerichten kommt der Gebäudeabstand selten vor, obwohl er im Einzelfall entscheidend für die Bewilligungsfähigkeit eines Bauprojekts sein kann. Eine Auseinandersetzung mit dieser häufig stiefmütterlich behandelten Bestimmung lohnt sich dennoch.
Rechtsgrundlage
Gemäss § 47 Abs. 1 BauG schreiben die Gemeinden Grenz- und Gebäudeabstände vor. Fehlen in der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Vorschriften über den Gebäudeabstand, kommt die kantonale Regelung gemäss § 47 Abs. 1 und 2 BauG zur Anwendung. Diese entfällt nur dann, wenn die BNO bestimmt, dass kein Gebäudeabstand einzuhalten ist.
Enthält die BNO einer Gemeinde keine spezifischen Bestimmungen zum Gebäudeabstand, entspricht dieser der Summe der vorgeschriebenen Grenzabstände (§ 27 Abs. 1 BauV/§ 20 Abs. 2 ABauV). Sofern ein Gestaltungsplan Baufelder bestimmt, gehen diese dem Gebäudeabstand vor. Das gilt auch dann, wenn eine Baulinie eingetragen ist.
Zwischen Gebäuden
Der Gebäudeabstand gilt zwischen Gebäuden; er gilt also nicht für alle Bauten und Anlagen. Gebäude sind gemäss Ziff. 2.1 IVHB ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Überdachung und in der Regel weitere Abschlüsse aufweisen. Zum Beispiel Wohnhäuser, Industriegebäude, Scheunen, Lagerhäuser etc. Nicht unter den Gebäudebegriff fallen beispielsweise Swimmingpools, Einfriedungen oder Strassen. Gegenüber solchen Bauten und Anlagen muss kein Gebäudeabstand eingehalten werden. Da die Definition des Gebäudeabstands an das Vorliegen von Fassaden anknüpft, ist der Gebäudeabstand sodann nur für oberirdische Gebäude relevant.
Der Gebäudeabstand muss grundsätzlich zwischen allen Gebäuden eingehalten werden, unabhängig davon, ob zwischen ihnen eine Grundstücksgrenze verläuft. Der Gebäudeabstand kann aber reduziert oder
gar aufgehoben werden. Dies aber nur, wenn die architektonischen, gesundheitsund feuerpolizeilichen Anforderungen gewahrt bleiben (siehe § 27 Abs. 2 BauV), die BNO dies nicht verbietet (z. B. für Mehrfamilienhäuser) oder einschränkt (siehe § 47 Abs. 2 BauG) und die konkret anwendbaren Einordnungsvorschriften erfüllt werden (siehe z. B. § 42 BauG).
Bei Gebäuden auf verschiedenen Grundstücken setzt eine Unterschreitung des Gebäudeabstands zum Schutz der nachbarlichen Interessen ausserdem einen Dienstbarkeitsvertrag voraus, der im Grundbuch eingetragen werden muss (§ 47 Abs. 3 BauG). Achtung: Öffentliche Interessen können einer Abstandsverkürzung entgegenstehen (beispielsweise feuerpolizeiliche Anforderungen, Ortsbild). Bestehen solche öffentlichen Interessen, führt auch der Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags, in dem der Gebäudeabstand reduziert wird, nicht zur Bewilligungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
Messweise
In Gemeinden, welche die IVHB bereits umgesetzt haben, ist der Gebäudeabstand die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Gebäude (BauV Anhang 1, Ziff. 7.2 IVHB). Die Fassadenlinie wird – vereinfacht dargestellt – durch die äussersten Punkte eines Baukörpers gebil-
● Küchen – Bad – Böden
● Haushaltgeräte-Austausch
● 300m 2 Ausstellung


Gebr. Fritz + Ueli Wirz AG Schreinerei – Küchenbau
5504 Othmarsingen Tel. 062 896 20 20 www.wirz-kuechen.ch
Küchenexpress
Ihr Partner für Apparateaustausch und Reparaturen in Küche und Waschraum
Basel Tel. 061 337 35 00 Rothrist Tel. 062 287 77 87

det, wobei vorspringende und unbedeutend rückspringende Gebäudeteile nicht berücksichtigt werden. In Gemeinden, die ihren Nutzungsplanung noch nicht an die IVHB angepasst haben, entspricht der Gebäudeabstand der kürzesten Entfernung zwischen zwei Fassaden (§ 20 Abs. 1 ABauV).
Abstand und Mehrlängenzuschlag
Da der Gebäudeabstand der Summe der vorgeschriebenen Grenzabstände entspricht, führt ein allfälliger Mehrlängenzuschlag auch zu einem grösseren Gebäudeabstand. Beträgt der von der BNO vorgeschriebene Mehrlängenzuschlag beim einen Gebäude z. B. 80 cm und der ordentliche Grenzabstand 4 m, beträgt der einzuhaltende Gebäudeabstand mindestens 8,8 m.
Grosser Grenzabstand
Schreibt die Gemeinde die Einhaltung eines grossen Grenzabstands vor, führt dieser zu einem grösseren Gebäudeabstand. Dies gilt selbstverständlich nur dann, wenn der
grosse Grenzabstand in Richtung des zweiten Gebäudes eingehalten werden muss (Hauptwohnseite). Legt eine Gemeinde einen kleinen Grenzabstand von 4 m und einen grossen Grenzabstand von 8 m fest, muss der Gebäudeabstand mindestens 12 m betragen.
Abstand zu bestehenden Gebäuden
Unterschreitet ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück den Grenzabstand (zum Beispiel wegen Parzellierungen, Änderungen des Grenzabstands, tolerierten rechtswidrigen Bauten oder Bauten, die vor der Einführung von Grenzabständen erstellt wurden), muss das neue, projektierte Gebäude dennoch den Gebäudeabstand wahren.
Verfügt ein bestehendes Gebäude auf einem Grundstück somit lediglich über einen Grenzabstand von 2 m anstelle von 4 m, muss eine projektierte Baute auf dem Nachbargrundstück einen Grenzabstand
von 6 m einhalten, damit der Gebäudeabstand von 8 m eingehalten ist.
Diese Regelung führt nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts nicht zu übertriebenen Härten, kann doch bei ausserordentlichen Verhältnissen immer noch eine Ausnahmebewilligung nach § 67 BauG erteilt werden. Das Verwaltungsgericht erachtete es auch nicht als rechtsmissbräuchlich, wenn der Eigentümer der bestehenden Baute auf der Einhaltung des Gebäudeabstands beharrt (AGVE 2010 S. 181).
Die Gemeinden sind jedoch befugt, eine abweichende Vorschrift in ihre BNO aufzunehmen. Nur wenn die BNO die Unterschreitung des Gebäudeabstands erlaubt, muss das neue, projektierte Gebäude den gesetzlichen Gebäudeabstand nicht einhalten. Eine solche Befreiung kann auch dann vorliegen, wenn eine Gemeinde die geschlossene Bauweise erlaubt (z. B. in Kernoder Altstadtzonen).





















Frage:
Darf ich in meinem Garten ein Trampolin aufstellen?
Antwort:
Bei dieser Frage gibt es mehrere Punkte zu prüfen: die Verantwortlichkeit, der Lärm und die rechtliche Zulässigkeit der Beanspruchung der Rasenfläche.
Wer ein Freizeittrampolin aufstellt, ist dafür verantwortlich, dass es korrekt aufgestellt, gewartet und unterhalten wird.
Es muss insbesondere auch verhindert werden, dass «fremde» Kinder verunfallen können. Bei der bfu – Beratungsstelle für Unfälle – sind weitere Informationen erhältlich.
Wenn Kinder spielen, ist es meistens laut. Kinderlärm im Freien gilt jedoch nicht als übermässige Immission im Sinne des ZGB. Nachbarn müssen den Lärm somit dulden, können Sie und die Kinder jedoch zur Einhaltung der Nachtruhezeiten sowie der Hausordnung und zur gegenseitigen Toleranz und Rücksichtnahme ermahnen.
Bei der Frage, ob bzw. wo das Trampolin aufgestellt werden darf, ist zu berücksichtigen, wie Ihre Wohnsituation ist. Am unproblematischsten ist es für den Einfamilienhausbesitzer: Dieser kann in seinem Garten ohne weitere Erlaubnis und Bewilligung ein Trampolin aufstellen. Mieter und auch Stockwerkeigentümer von Parterrewohnungen müssen beim
Vermieter bzw. bei der Stockwerkeigentümergemeinschaft eine Erlaubnis einholen. Gartenfläche, die nicht zur alleinigen und ausschliesslichen Benutzung für Sie ausgeschieden ist, kann für das Aufstellen eines privaten Trampolins nicht benutzt werden. Ein Stockwerkeigentümer kann auf seinem eigenen Gartenanteil ein Trampolin aufstellen, sofern dadurch nicht gestalterisch in die Substanz des Gartenanteils eingegriffen wird, da der Grund und Boden nach wie vor der Eigentümergemeinschaft gehört. Das monatelange Stehenlassen eines grossen Trampolins wäre daher nicht zulässig. Das qualifizierte Mehr der Stockwerkeigentümergemeinschaft reicht in der Regel als Zustimmung.
Die Rechtsberaterinnen des HEV Aargau beantworten telefonische Rechtsfragen werktags von 9 bis 11.30 Uhr, Tel. 056 200 50 70.



Jeannine Stierli, HEV Aargau
Malvengewächse (malvaceae) gehören einer sehr grossen Pflanzenfamilie an. Sie sind in Unterfamilien mit zahlreichen Gattungen und vielen verschieden Arten gegliedert. Die Linde und der Eibisch, sogar Baumwolle und Kakao gehören zur Familie der Malvengewächse. Bei den Malvengewächsen findet man Stauden, Gehölze, ein- und zweijährige Pflanzen, hohe und niedrige Gewächse. Manche Gattungen sehen sich sehr ähnlich. Einige der bedeutendsten Malvenarten in der einheimischen Gartenwelt sind: Buschmalve, Moschusmalve, Rosenmalve, wilde Malve und die Stockrose.
Die wilde Malve gehört zu den ältesten Nutzpflanzen. Seit Jahrhunderten wird sie für ihre Heilkräfte hochgeschätzt. Die Malve wird bei verschiedenen Leiden äusserlich wie auch innerlich angewendet. Der Schleim der Malve ist ein gutes Mittel gegen Husten. Heutzutage findet man verschiedene Produkte wie Malventee und -salben in Drogerien.
Bei uns kennt man die wilde Malve auch unter den Namen Chäslichrut oder Käsepappel. Vermutlich kommt der Name von den Früchten, die sich nach der Bestäubung




der Blüten bilden und wie kleine Käselaibe aussehen. Früher kochte man Malvenblätter als Gemüse, Brei oder Suppe. Die unreifen Samenkapseln und die Blüten kann man Salaten beigeben. Von der Malve können Blüten, Blätter und Wurzeln verwendet werden. Unter den Malvengewächsen findet
man auch wahre Hingucker wie zum Beispiel die Stockrosen, auch Bauernrosen genannt, da sie in vielen Bauerngärten anzutreffen sind. Stockrosen können zwei bis drei Meter hoch werden und scheinen unermüdlich von Juni bis Oktober zu blühen. Kaum öffnen sich die ersten wunderschönen, trichterförmigen Blüten, da summt und brummt es auch schon. Die grossen Blüten sind ein wahres Paradies für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge.












Die Malven sind auch wertvolle Raupenfutterpflanzen für eine Reihe von Schmetterlingen. Sie sind ein idealer Schlaf- und Verpuppungsplatz. Auch für verschiedene Käferarten sind Malven eine wichtige Nahrungsquelle. Bei den Stockrosen gibt es eine vielfältige Palette an Farben. Stockrosen sät man am besten an einer Hauswand oder an einem etwas geschützten Platz, damit die hohen Stengel bei starkem Wind nicht umknicken. Oder man stützt sie mit einem Pflanzenstab.

Luzia Dubler, Yvonne Lacoseliac, Gertrud Tännler und Andreas Senn, Präsident HEV Baden/Brugg/Zurzach (v.l.n.r.).
Auf dem Bild fehlen Brigitte Schüepp und Evenline Landolt.
(zc) Anlässlich der Messe «Bauen+Wohnen» im April 2018 in Wettingen durfte der HEV Baden/Brugg/Zurzach wiederum viele Interessierte an seinem Stand begrüssen. 1346 Besucherinnen und Besucher haben am diesjährigen Wettbewerb teilgenommen. Es gingen viele richtige Antworten ein, so dass wieder das Los entscheiden musste.
Die glücklichen Gewinner heissen:
1. Preis: Gertrud Tännler aus Kleindöttingen
Wellness-Weekend für 2 Personen im Wert von Fr. 700.–Parkhotel in Bad Zurzach
2. Preis: Yvonne Lacoseliac aus Aarau
Gutschein für Restaurantbesuch für 2 Personen im Wert von Fr. 250.–Schloss Schartenfels in Wettingen
3. Preis: Luzia Dubler aus Dottikon
Gutschein für Restaurantbesuch für 2 Personen im Wert von Fr. 200.–Schloss Böttstein in Böttstein
4. Preis: Brigitte Schüepp aus Sulz (AG) Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 150.–Gartencenter Blueme Kari in Frick
5. Preis: Eveline Landolt aus Dietikon Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 100.–Gartencenter Toni Suter AG in Baden-Dättwil
Die Gewinner wurden zur Preisübergabe in die Geschäftsstelle in Baden eingeladen.
(mm) Fragen zur Energie bildeten den Schwerpunkt der diesjährigen Generalversammlung des HEV Lenzburg-Seetal. Das Thema Energie und kommende Regulierungen auf diesem Gebiet würden die Hauseigentümer in den nächsten Jahren erheblich beschäftigen, sagte Hans Stoller, Präsident HEV Lenzburg-Seetal. Er zweifelt daran, dass Energie mittels Gesetzen sinnvoll eingespart werde. Im Kanton Aargau sei der Heizölverbrauch in den letzten 35 Jahren um 53 Prozent gesunken, dies trotz Bevölkerungszunahme und gewachsenem Gebäudebestand. Die Einsparung sei freiwillig erfolgt. Dies zeige, dass Hauseigentümer durchaus vernünftig handelten. Die nun vom Aargauer Regierungsrat vorgeschlagene Vorlage zur Teilrevision des Energiegesetzes sei das Gegenteil davon. Der Entwurf folge der Überzeugung, dass es mehr Vorschriften brauche, um beim Energiesparen vorwärts zu machen. Doch es gebe zwei Arten, Energiesparziele zu verfolgen – intelligente und solche, die auf mehr Vorschriften, mehr Kontrolle und dem Ausbau der Bürokratie basierten, sagte Stoller. Die jetzige Vorlage gehöre der zweitgenannten Kategorie an. Sie sei nicht zielführend. Anstatt Energiesparziele festzulegen, würden Massnahmen vorgeschlagen.
Referendum nicht ausgeschlossen
Der Fokus des Regierungsrats auf die Solarenergie sei zwar grundsätzlich richtig. Solarstrom werde aber vor allem im Sommer produziert, der Hauptbedarf für Strom falle jedoch im Winter an. Speichermöglichkeiten, die Produktion und Nachfrage besser in Einklang bringen, fehlten noch. Anstatt mehr in die Forschung zu investieren, werde qualifiziertes Personal durch die Energiebürokratie absorbiert. Ingenieure schafften Formulare und kontrollierten bürokratische Eingaben. Das sei der falsche
Weg, denn Energieprobleme würden nicht auf Verwaltungsebene gelöst.
Viel hänge von der Eigenverantwortung ab. Wer im Winter in seiner Wohnung die Raumtemperatur von 24 °C auf 20 °C absenke, spare einen Drittel Wärmeenergie. Während man Bürgern zumute, ihre politischen Vertreter in Gemeinden, Kanton und auf Bundesebene frei zu wählen, traue man demselben Bürger nicht zu, in Energiefragen, die sein eigenes Haus betreffen, freie Entscheide zu fällen. Mit der Vorlage zum Energiegesetz würden Hauseigentümer entmündigt. Deshalb sei die Vorlage abzulehnen. Es sei nicht auszuschliessen, dass der HEV Aargau dereinst das Referendum gegen die Teilrevision ergreifen werde.
Jeanine Glarner neu im Vorstand In Lenzburg kam es zudem zu einer Ersatzwahl in den Vorstand HEV Lenzburg-Seetal. Vom Vorstand vorgeschlagen und von den Anwesenden einstimmig gewählt wurde Jeanine Glarner, Historikerin, Kommunikationsspezialistin sowie FDP-Grossrätin und Gemeinderätin von Möriken-Wildegg.
Über Schäden und Schadenprävention für Hauseigentümer sprach Urs Graf, Vorsitzender der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV). Die Leistungen der AGV basierten auf den Säulen Prävention, Intervention und Versicherung. Das schweizerische Versicherungswesen im Bereich Elementarschäden zeichne sich durch eine Dualität aus. In den einen Kantonen, wie dem Kanton Aargau, gebe es ein Versicherungsmonopol, in den anderen ein Versicherungskartell, bestehend aus mehreren Leistungsanbietern. In diesen Kantonen herrsche zwar eine relative Wahlfreiheit, aber im Kanton Aargau seien die Prämien nur halb so hoch wie in
den «Kartellkantonen». Und die Versicherungsleistungen seien erst noch besser, sagte Graf. Die AGV sei nicht gewinnorientiert, allfällige Überschüsse würden den Versicherten zurückerstattet bzw. für Prämiensenkungen verwendet. Finanzerträge der AGV dienten der Subventionierung der Prämien.
Prävention nicht besteuern Im Bereich Feuer sei seit Jahren ein Rückgang der Schadenfälle zu beobachten. Das sei unter anderem auf guten Brandschutz bzw. vernünftige Vorschriften sowie auf eine sehr gut ausgebildete und effizient arbeitende Feuerwehr zurückzuführen. Im Bereich Elementarschäden sei der Schadenverlauf erratisch, Schadenereignisse treffen zufällig ein.
Die Basis des Hochwasserschutzes bildeten behördenverbindliche Gefahrenkarten, auf deren Grundlage Baubewilligungen erteilt würden. Die Gefahrenkarten seien sehr verlässlich, sagte Graf. Bei bestehenden Gebäuden, die gewissen ElementarschadenRisiken ausgesetzt seien, biete die AGV auch Beratungsdienstleistungen gegenüber Hauseigentümern an. Dabei werde dem Prinzip der Verhältnismässigkeit (Kosten der baulichen Massnahme, Wahrscheinlichkeit des Schadeneintreffens) Rechnung getragen. Oft reiche es aus, Lichtschächte leicht zu erhöhen oder bestehende Mauern zu ergänzen. In zahlreichen Fällen beteilige sich die AGV an den Kosten der baulichen Massnahmen. Die AGV setze sich dafür ein, dass solche Vorkehrungen von den Steuerbehörden nicht als wertvermehrend, sondern als werterhaltend betrachtet würden, wie das heute bereits im Kanton Graubünden der Fall sei. Ziel sei es, Kosten für solche Baumassnahmen steuerlich in Abzug bringen zu können. Dafür verwende sich der AGV auf Bundesebene, sagte Graf.
Hauseigentümerverband Aargau, Stadtturmstrasse 19/Tagblatthaus, 5400 Baden Tel. 056 200 50 50; Fax 056 222 90 18; www.hev-aargau.ch; E-Mail: info@hev-aargau.ch
Hauswart; Unterhalt
Geschäftsräume (Garnitur 3fach, 2 Seiten) (2016)
(1 Zusatzblatt, Garnitur 4fach) (2009)
30011
Stockwerkeigentum/Nachbarrecht; Baurecht; Erbrecht; Steuerrecht
(360 Seiten) (2007/SHEV)
(398 Seiten) (2016/SHEV)
(2016/SHEV)
20 Prozent Mengenrabatt bei Bestellungen von über 100 Exemplaren des gleichen Artikels. Kein Drucksachenversand unter Fr. 5.– (zuzüglich Versandspesen).
Alle Preisangaben ohne Versandspesen. Preisänderungen vorbehalten. Keine Warenretouren. Versand ins Ausland nur gegen Vorauszahlung.
Mitglied-Nr.:
(*Mitgliederpreis nur möglich bei Angabe der Mitglied-Nummer)
Name: Vorname:
Adresse: PLZ/Ort:
Datum: Unterschrift:








Wir sorgen dafür, dass Sie keine kalten Füsse kriegen.




Ob jung oder alt, gross oder klein, von sicheren Handläufen an Innen- und Aussentreppen profitieren alle Menschen. Günstige Komplettpreise inkl. Montage.
Heizteam Savaris AG info@heizteam.ch www.heizteam.ch
Heizteam Savaris AG info@heizteam.ch www.heizteam.ch
Hauptsitz Brugg
Hauptsitz Brugg
Tel. 056 441 60 84
Tel. 056 441 60 84
Wir sorgen dafür, dass Sie keine kalten Füsse kriegen.
Filiale Neuenhof
Filiale Neuenhof
Als zuverlässiger Partner für behagliche Wärme realisieren wir Heizungssysteme aller Art. Wir kennen uns mit Öl, Gas, Luft und Wasser genau so gut aus wie mit thermischen Solaranlagen oder Photovoltaik. An den Standorten Brugg und Neuenhof projektieren und planen wir massgeschneiderte Lösungen für höchste Ansprüche. Die Ansprechpartner für Ihre Inserate
Tel. 056 426 37 23
Tel. 056 426 37 23
Heizteam Savaris AG info@heizteam.ch www.heizteam.ch
Hauptsitz Brugg
Tel. 056 441 60 84
Filiale Neuenhof
Tel. 056 426 37 23

Wohlerstrasse 15 5620 Bremgarten Tel. +41 56 641 90 80
Schilfsandstein aus Oberhofen ist einmalig in Struktur und Farbe. Er eignet sich innen hervorragend für Bodenbeläge sowie den Ofenbau und aussen für die Gestaltung von Garten und Umgebung sowie für Tür- und Fenstereinfassungen.

Oberhofen ist eine kleine Ortschaft im Fricktal. Dort betreibt die Familie Obrist einen Steinbruch, in dem ein ganz spezieller Stein vorkommt: der Oberhöfner Schilfsandstein. Die Gebäulichkeiten der Firma Obrist Natursteine und das Steinsägewerk befinden sich mitten im Dorf. Der Steinbruch liegt etwas ausserhalb des Dorfes im Mettauertal. Er befindet sich bereits seit vier Generationen, also mehr als Hundert Jahre, im Besitz der Familie Obrist.
Uraltes Zeugnis der Erdgeschichte
Die aus Schilfsandstein bestehende Gesteinsschicht verläuft zwischen den Ortschaften Gansingen sowie Oberhofen und ist in der Schweiz einzigartig. Der Schilf-
sandstein ist jedoch nicht ein x-beliebiger Naturstein, bei weitem nicht. Er besteht aus Farn, Schachtelhalm, Glimmerplättchen sowie Kalk, der als Bindemittel funktioniert. Schilf kommt darin allerdings nicht vor. Es ist wahrscheinlich, dass die Schachtelhalme bei der Namensgebung mit Schilf verwechselt wurden. Deshalb ist der Name etwas irreführend. Das Gestein ist rund 250 Millionen Jahre alt und stammt aus der Keuper-Zeit. Dieser Fricktaler Sandstein erzählt also weit vergangene Erdgeschichte(n).
Das Steinsägewerk
In der Werkhalle sind Büroräume und das Steinsägewerk untergebracht. Neben einem grossen Schneidewerk lagern hier Platten in verschiedenen Grössen, Dicken und
Farben. Die Vielfalt ist erstaunlich. André Obrist zeigt auf einen Stapel grossformatiger Platten mit dunkel-weinroter Färbung: «Wenn diese Platten jemandem gefallen und sie in einem Haus verbaut werden sollen, muss mit einer Wartezeit von 15 Jahren gerechnet werden, denn diese hier sind bereits verkauft.» Mein Gesicht muss ein einziges Fragezeichen gewesen sein. Er lacht und erklärt: «Diese Platten stammen vom Fuss des Abbruchs im Steinbruch. Zuerst müssen wir rund zehn Meter Humus und andere Erdschichten entfernen, bis wir auf die Schicht mit dem Schilfsandstein treffen. Zuoberst ist der Stein lehmig-braun, ockerfarben mit dunkelroten Sprenkeln. Zuunterst hat er eine Farbe wie alter Rotwein mit wenigen lehmfarbenen Sprenkeln, wenn überhaupt. Es sind im Grossen
und Ganzen etwa vier verschiedene Farbschattierungen im Steinbruch zu finden.»
Nun ist Obrist im Steinbruch also mit dem Abbau am Fusse des Abbruchs beschäftigt, bald wird als nächste Lage wieder die von oben in Angriff genommen.
Der Abbau braucht Fingerspitzengefühl
Der Steinbruch von Obrist ist rund 1,8 Hektare gross. Früher arbeiteten etwa zehn Männer im Steinbruch und schlugen mit reiner Muskelkraft Steine aus dem Fels. Anschliessend wurden diese zur weiteren Verarbeitung mit Pferdefuhrwerken in die Fabrikhalle gebracht. Heute baut André Obrist mit seinem Mitarbeiter zwischen April und November rund 200 Tonnen Stein ab. Sie arbeiten mit Bagger und Luftdruckgeräten. «Die Arbeit ist nicht ganz ungefährlich. Nicht immer kann man die Reaktion eines Felsbrockens richtig einschätzen», erklärt er. «Die Arbeit im Steinbruch ist zwar Knochenarbeit, dennoch braucht es dafür viel Fingerspitzengefühl. Die Felsbrocken sind mit feinen Bruchlinien durchzogen. Dafür muss man ein Gespür entwickeln. Witterung und Temperaturen spielen beim Abbau ebenfalls eine Rolle», fährt Obrist fort. Der Abbau des Steins ist anstrengend und geht weder an Mensch noch Maschine spurlos vorbei. André Obrist ist sehr froh darüber, dass es in seinem Steinbruch in den letzten 60 Jahren keinen Unfall mehr gegeben hat.
Vom Mechaniker zum Steinmetz Als junger Bursche wollte André Obrist eigentlich eine Steinmetzlehre machen, aber keiner der Betriebe in der Region wollte ihn ausbilden. So entschied er sich für eine Lehre als Mechaniker. Nachdem er diese mit Erfolg abgeschlossen hatte, lernte er das Handwerk der Steinbearbeitung von seinem Vater. Dieser Werdegang erweist sich heute als echter Glücksfall, denn er kann fast alle Reparaturen an Maschinen und Fahrzeugen selber ausführen.
André Obrist kennt sich mit den Eigenschaften des Oberhöfner Schilfstandsteins bestens aus. Der Abbau des Schilfsand-
Fortsetzung Seite 25




Treppenhandläufe
M. Kaufmann
5742 Kölliken

Für jede Treppe die richtige Lösung. Handläufe in jeder Form und jede Ecke durchgehend angepasst. Top-Preise. Offerten unter Telefon 062 842 45 63 www.treppenhandlaeufe.ch

Büchi+Fischer AG Malerei
5400 Baden,Tel. 056 222 53 83 5442 Fislisbach,Tel. 056 493 3564
Tankrevisionen Hauswartungen Entfeuchtungen
5616 Meisterschwanden
www.schoop.com





Fenster und Läden aus Kunststoff, Holz, Aluminium

















steins sei auf jeden Fall bis Mitte des 18. Jahrhunderts zurückzuverfolgen. Schilfsandstein eignet sich hervorragend sowohl für den Innenausbau als auch für den Aussenbereich. In vielen Häusern des Mettauertales findet man Stubenöfen und Fensterumrandungen aus diesem besonderen Stein. Auch in hiesigen Gärten kam und kommt der Schilfsandstein zum Einsatz, denn er ist sehr witterungsresistent.
Gestalterisches Element
Die individuelle Musterung des Schilfsandsteins aus Oberhofen macht ihn zu einem Gestaltungselement im Innenbereich. Er eignet sich bestens für Speicheröfen im Wohnbereich, denn er hat, ähnlich wie Speckstein, eine exzellente Speicherfähigkeit. Schilfsandstein gibt die gespeicherte Wärme kontinuierlich und langsam an die Umgebung ab. Deshalb kann man einen Ofen aus diesem Sandstein selbst bei voller Heizleistung noch anfassen, ohne sich die Hände zu verbrennen. Bei Speckstein ist das anders. Durch die Einwirkung von Hitze wird der Schilfsandstein noch etwas härter und beständiger, als er anfangs ist. Zudem ist er gesundheitlich völlig unbedenklich. Es besteht keine Gefahr von Asbesteinschlüssen, wie das bei anderen Natursteinen der Fall sein kann.
Den individuellen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Bei einem Ofen aus Schilfsandstein stimmt das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis des Materials. Jeder Stein sieht anders aus, verleiht einem Ofen dadurch ein einzigartiges Aussehen. Ein Stubenofen aus Oberhöfner Schilfsandstein ist also genau das Richtige für Individualisten, die den Komfort einer Wohnraumfeuerung geniessen wollen. Öfen aus diesem einzigartigen Gestein gibt es in der ganzen Schweiz. Vor allem aber im Baselbiet, in den Kantonen Bern sowie Luzern und natürlich im Aargau sind Stubenöfen aus Oberhöfner Schilfsandstein zu finden.
Vielseitig verwendbar
Platten aus Schilfsandstein eignen sich hervorragend als Gestaltungselemente im Innenausbau und im Aussenbereich. Ob als Kräuterschnecke, Trockenmauer oder Plattenbelag, der Oberhöfner macht immer eine gute Figur. Traditionell werden sie zudem für Tür- und Fenstereinfassungen verwendet. Manchmal verlangen Kunden spezielle Reliefverzierungen, die André Obrist in den Stein fräst. Einmal wünschte ein Kunde für die Umrandung seines Kamins eine eingemeisselte französische Königslilie. Der Oberhöfner Schilfsandstein ist also nicht nur in der Schweiz bekannt. André Obrist liefert den Oberhöfner auch nach Deutschland, vor allem in den Schwarzwald, manchmal sogar nach München und Hamburg.
Wunderbare Wärme
Ich streiche mit meiner Hand über eine der hochkant gestellten Steinplatten. Der

André Obrist leitet den Betrieb «Obrist Natursteine und Steinsägewerk» in Oberhofen. Er ist gelernter Mechaniker und führt das Familienunternehmen seit 2006 in der vierten Generation.
Obrist Natursteine + Steinsägewerk, Langmättli 124 5273 Oberhofen im Mettauertal Tel. 062 875 23 36 info@obrist-natursteineoberhofen.ch www.obrist-natursteineoberhofen.ch
Schilfsandstein fühlt sich wunderbar an, etwas rau vielleicht, aber für einen Stein erstaunlich warm. Und das, obwohl in der Werkhalle nicht geheizt wird. Ich spüre die Erhabenheit des Alters, die diesem Stein innewohnt. Es ist die Geschichte von Hunderttausenden von Jahren unserer Erde. Es lohnt sich, die einzigartigen Eigenschaften dieses einheimischen Natursteins wiederzuentdecken, den Stein vermehrt einzusetzen und dessen Stärken für sich zu nutzen.
Schützen Sie, was Ihnen lieb ist. Insektenschutzgitter nach Mass.
Sie haben die freie Wahl. Und wir die passende Lösung.



Bodenbeläge aus Holz erleben eine Renaissance. Sie sind heute ebenso pflegeleicht wie Plattenböden. Für Akzente und Abwechslung in Zimmern und Stuben sorgen eine Vielfalt an einheimischen Hölzern sowie die unterschiedlichen Arten von Verlegemustern.
Ruth Bürgler, Redaktorin
Parkettböden bestehen in der Regel aus Stabparkett. Diese Parkettstäbe sind entweder aus Massivholz oder aus zwei verleimten Holzschichten zusammengesetzt. Hier werden die klassischen Parkettverbände vorgestellt. Natürlich gibt es zusätzliche individuelle und seltene Verlegemuster, die einen Raum zu schmücken vermögen. Kunstvolle Parkettarbeiten gehören auf alle Fälle in die Hände von Fachleuten.
Schiffboden
Beim Schiffsboden oder auch Schiffboden genannten Muster werden die Parkettstäbe stets in einzelnen Reihen verlegt. In jeder Reihe sind die Stäbe ein wenig versetzt verlegt. Wie weit die Querspalten voneinander versetzt sind, ist beliebig. Die Breite der Parkettstäbe kann ebenfalls von Reihe zu Reihe variieren. Die einzelnen Stäbe werden immer willkürlich verlegt. Diese Verlegeart heisst deshalb auch «wilder Verband». Bei dieser Technik trägt die Erfahrung des Parkettlegers wesentlich dazu bei, wie gefällig der fertige Parkettboden schlussendlich wirkt. Im Unterschied zum Schiffboden-Fertigparkett sind die Parkettstäbe beim echten Schiffbodenparkett alle gleich lang und die nebeneinanderliegenden Stäbe enden nie auf gleicher Höhe.
Englischer Verband
Ähnlich wie beim Schiffboden werden die Stäbe in einzelnen Reihen verlegt, jedoch immer um die Hälfte der Länge des Parkettstabes. Dadurch wirkt der englische Verband ruhiger als der Schiffboden.
Altdeutscher Verband
Beim altdeutschen Verband werden die Parkettstäbe wie im englischen Verband angeordnet. Jede Reihe ist gegenüber der vorhergehenden Reihe um genau die Hälf-

Das Fischgrätmuster eignet sich besonders gut für grosse Räume.
te versetzt. Im Unterschied zum englischen Verband sind immer zwei Stäbe doppelt nebeneinander angeordnet. Zwischen jedem Stabpaar wird ein verkürzter Stab eingesetzt, der um 90 Grad gedreht ist. Das entstehende Muster erinnert an das Flechtmuster eines einfachen Weidenkorbes. Der altdeutsche Verband wirkt sehr dekorativ und ornamenthaft. Durch die Quer- und Längsmusterung heben sich die Richtungswechsel gegenseitig auf. Es entsteht ein ruhig wirkender Holzboden. Schade, dass dieses schöne Parkettmuster etwas aus der Mode gekommen ist.
Der Würfelverband wird auch als Schachbrettmuster bezeichnet. Fachleute sprechen jedoch vom Tafelmuster. Die einzelnen Parkettstäbe sind zu Quadraten
angeordnet, deren Ausrichtung sich bei jedem Quadrat um 90 Grad dreht. Je nach Breite und Länge der einzelnen Parkettstäbe variiert die Anzahl der Stäbe, die zu Quadraten geordnet wird. Auch der Würfelverband ist ein Muster, das keine Richtung vorgibt und dem Raum dadurch
Altdeutscher Verband.
Ruhe verleiht. Das Tafelmuster wirkt im Unterschied zum altdeutschen Verband jedoch schlichter und nüchterner.
Parallelverband
Beim Parallelverband werden die Parkettstäbe in Reihen verlegt, die im Unterschied zum Schiffboden und zum englischen Verband nicht versetzt sind. Deshalb wirkt der Parallelverband sehr geometrisch und geordnet. Meist kommt diese Verlegevariation für Industrieparkett zur Anwendung. Beim Industrieparkett sind die einzelnen Holzelemente etwa 10 cm lang, 1 bis 2 cm breit und etwa 1 cm dick.
Leiterverband
Der Leiterverband gleicht dem Parallelverband. Der Unterschied besteht darin, dass jede Reihe parallel nebeneinander liegender Stäbe mit einer quer dazu verlaufenden Einzelreihe abgewechselt wird. Der Leiterverband wirkt wie der Parallelverband sehr geometrisch und geordnet.
Fischgrätverband
Diese Verlegeart bildet ein klassisches Muster. Immer zwei Parkettstäbe werden im rechten Winkel zueinander versetzt. Es entstehen übereinander liegende Zickzacklinien. Das Fischgrätmuster eignet sich eher für grosse Räume, weil es vor allem in der Grossflächigkeit dekorativ wirkt. Das Muster sorgt zudem für wechselnde Lichtspiele.
Geölte Holzböden richtig reinigen Holzböden, die nicht versiegelt, sondern geölt sind, verdienen bei der Reinigung eine schonende Behandlung. Holzfussböden behalten ihre Schönheit ohne viel Ar-
beit, wenn man weiss, wie man am besten vorgeht: Zur einfachen Reinigung genügt es, das Parkett mit einer nichtkratzenden Bürste abzusaugen. Die Staubsaugerbürste darf auf der Unterseite keine scharfen Kanten, keine überstehenden Metallränder oder gebrochene Plastikteile aufweisen. Verschiedene Staubsaugerhersteller bieten spezielle Parkettbürsten an, die mit weichen Naturborsten ausgestattet sind. Sie sind zudem breiter als die normalen Bodendüsen und sehr gelenkig. Damit geht das Saugen schnell und leicht.
Nebelfeucht wischen
Bei Bedarf kann man den Boden nach dem Saugen nebelfeucht aufwischen. Den Wischlappen muss man gut auswringen, so dass kein Wasser heruntertropft. Dem Wischwasser darf man niemals normales Reinigungsmittel oder Spülmittel hinzufügen, denn dieses entfernt das Öl vom Holz. Für geölte Holzböden gibt es spezielle Pflegemittel, die einen dünnen Ölfilm auf dem Holz hinterlassen.
Zudem ist darauf zu achten, dass keine Mikrofasertücher zum Einsatz kommen. Mikrofasern sind sehr hart, zerkratzen den Boden und wischen das Öl ab. Am besten verwendet man einen weichen Baumwolllappen
oder kauft für den Wischmopp einen Überzug aus Baumwolle. Niemals sollte man Wasser auf den Holzboden giessen, da es sonst zwischen die Fugen des Parketts eindringt und unter den Holzboden gelangt. Dort kann es nicht verdunsten, vielmehr wird es vom Holz aufgesaugt. Der Parkett quillt auf und löst sich durch die Spannungen vom Untergrund oder beginnt, sich nach oben zu wölben.
Wasser ausgeleert
Wegen sehr kleiner Mengen Wasser, wenn man beispielsweise ein Wasserglas umstösst, braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn in kurzer Zeit kann nur wenig Flüssigkeit in die Fugen eindringen. Somit sollte man das Wasser einfach sofort mit einem saugfähigen Baumwolllappen aufwischen. Ein häufiger, unbeabsichtigter Fehler besteht darin, ausgeleerte Flüssigkeit, heruntergefallene Lebensmittel und dergleichen mit dem Spülschwamm oder dem Küchentuch aufzuwischen, mit dem sonst das Geschirr gespült wird. Man sollte daran denken, dass in diesen meist Spülmittelreste enthalten sind oder sie aus Mikrofasern bestehen. Beides entfernt die schützende Ölschicht vom Holz. Es ist besser, für solche Fälle ein geeignetes Reinigungstuch zur Hand zu haben, das nur für den Boden zum Einsatz kommt.

Würfelverband mit eher kleinen Quadraten.
Braucht die Fassade einen neuen Anstrich? Oder wird ein Hausumbau in Hinblick aufs Alter notwendig? Irgendwann sehen sich Hauseigentümer konfrontiert mit Erneuerungen oder Renovationen, die viel Geld kosten. Es lohnt sich deshalb, grössere Investitionen gut vorauszuplanen.

Brigitte Müller, Redaktorin
Als Wohneigentümer muss man früher oder später mit einem Umbau oder einer Renovation rechnen. Zum Beispiel muss eine Fassade nach 20 bis 30 Jahren neu gestrichen oder nach 30 bis 40 Jahren frisch verputzt werden. Die Küche möchte man modernisieren und die Heizung gemäss den neuesten energetischen Anforderungen sanieren. Oft lösen veränderte Lebensumstände Renovationen und Umbauten aus, sei es, weil Eltern und Kinder andere Bedürfnisse ans Wohnen stellen, sei es, weil das Alter ein barrierefreies Wohnen erfordert. Kleinere Renovationen und Unterhaltsarbeiten wie beispielsweise Wände neu streichen sollte man mit Geld aus den privaten Ersparnissen bezahlen können. Um grössere Renovationen zu finanzieren, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Welche Mittel sind vorhanden? Zuallererst empfiehlt es sich, genau zu klären, warum man eine Renovation plant. Weiss man, welche Renovationen anstehen, dann gilt es, die richtigen Fachleute zu finden und neben einer kompetenten Beratung entsprechende Offerten bei mehre-
ren Handwerkern einzuholen. Vielleicht benötigt man zusätzlich das Fachwissen von Architekten oder anderen Spezialisten? Hat man einen Kostenvoranschlag in den Händen, ist man mit Fragen der Finanzierung konfrontiert: Sind genügend Eigenmittel vorhanden? Können Beiträge der Pensionskasse oder der Säule 3a bezogen werden? Hat man bei einer energetischen Sanierung Anspruch auf staatliche Fördergelder? Sind die Eigenmittel zu knapp, so dass man eine Hypothek erhöhen oder einen Baukredit beantragen muss?
Werterhaltend oder -vermehrend?
Banken wollen genau wissen, ob es sich bei einer Renovation um eine Werterhaltung oder um eine Wertvermehrung handelt. Tatsache ist, dass bei einem Umbau oder einer Sanierung immer Arbeiten ausgeführt werden, die den Wert der Liegenschaft nicht steigern. Eine neue Küche ist sicher schöner, praktischer und wahrscheinlich auch luxuriöser. Trotzdem wird ein Teil dieser Modernisierung als werterhaltend eingestuft, weil die Immobilie schon vorher über eine Küche verfügte. Werden alte Küchengeräte durch gleichwertige ersetzt, bleibt der Verkehrswert unverändert. Hin-
gegen ist beispielsweise ein neuer Wintergarten eine wertvermehrende Massnahme, die einen positiven Effekt auf den Verkehrswert der Liegenschaft hat. Dies ist wichtig zu wissen, denn Banken finanzieren nur wertvermehrende Massnahmen und höchstens 80 Prozent der Kosten. Für den Rest muss der Hausbesitzer selber aufkommen. Um böse Überraschungen zu vermeiden, ist es ratsam, frühzeitig zu klären, wie stark die geplanten Investitionen den Wert der Liegenschaft tatsächlich steigern werden und in welcher Höhe sich die Bank an den Renovationskosten beteiligen wird. Es wird auch empfohlen, eine Reserve von etwa zehn Prozent der Umbaukosten einzuplanen. Solch eine Reserve erspart es einem, nachträglich um einen zusätzlichen Kredit bitten zu müssen.
Ist der geplante Umbau wertvermehrend und man möchte diesen mit einer Aufstockung der bestehenden oder einer neuen Hypothek finanzieren, prüfen die Banken oft die Einkommensverhältnisse und lassen sogar das Haus oder die Wohnung neu schätzen. Verdient man weniger oder steht kurz vor der Pensionierung, kann die Finanzierung durch eine Bank schwierig werden.
Wenn die Immobilie an Wert verloren hat, kann es auch sein, dass die Bank die Kreditsumme nach unten korrigiert. Dies hat zur Folge, dass man zuerst der Bank Geld zurückzahlen muss, statt neues zu erhalten.
Vorsorgegelder beziehen
Eine Renovation oder einen Hausumbau können Eigenheimbesitzer mit Geldern aus der Vorsorge finanzieren. Im Prinzip können alle fünf Jahre Vorsorgegelder für die Finanzierung von Umbauten, Renovationen oder Sanierungen bezogen werden: In den fünf Jahren vor der ordentlichen Pensionierung kann die Säule 3a sogar jederzeit aufgelöst werden. Zu Bedenken gilt: Geld aus der Säule 3a muss beim Bezug zu einem reduzierten Satz versteuert werden. Auch bei Vorsorgegeldern gilt die Regel: Pensionskassengelder und Guthaben der dritten Säule werden nur für wertvermehrende Arbeiten ausbezahlt. Will man sein Vorsorgeguthaben gar verpfänden, braucht es das Einverständnis der Bank.
Oft ist es die günstigste Variante, wenn man die Kosten für eine Erneuerung oder einen Umbau aus privaten Ersparnissen bezahlt. Clevere Hauseigentümer bilden zu diesem Zweck jedes Jahr Rückstellungen in Höhe von etwa 0,5 Prozent des Immobilienwerts.
Fördergelder beantragen
Für energetische Sanierungen gibt es staatliche Programme zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energie. Klimafreundliche Umbauten werden von Bund, Kanton, Städten und Gemeinden sowie von regionalen Elektrizitäts- und Fördergelder
Erdgasversorgern finanziell unterstützt. Wichtig ist, sich frühzeitig – noch in der Planungsphase – zu informieren und rechtzeitig Förderbeiträge zu beantragen. Hat die Sanierung schon begonnen, kann es zu spät sein, um in ein Förderprogramm aufgenommen zu werden. Während der Planung können zudem Anpassungen vorgenommen werden, die die Vorschriften der Förderung erfüllen. Wird eine Immobilie nach dem Minergie-Standard umgebaut und erhält dann die Zertifizierung, kann bei vielen Banken eine zinsvergünstige Minergie-Hypothek beantragt werden.
Und die Steuern?
In den meisten Kantonen kann man jedes Jahr entscheiden, ob man die effektiven Unterhaltskosten abziehen oder den Pauschalabzug geltend machen will. In der Regel können werterhaltende Ausgaben in der Steuererklärung als Unterhaltskosten vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Deshalb sollten kleinere Unterhaltsinvestitionen nach Möglichkeit im selben Kalenderjahr ausgeführt werden, damit man in den anderen Jahren vom Pauschalabzug profitiert. Treuhänder empfehlen bei umfangreicheren Renovationen die Kosten auf mehrere Steuerperioden zu verteilen. Dies kann zur Folge haben, dass man einige Jahre lang eine tiefere Progressionsstufe erreicht und entsprechend Steuern spart.
Nicht vergessen: Die Rechnungen für wertvermehrende Investitionen in die Liegenschaft muss man sorgfältig aufbewahren, denn die Kosten für diese Arbeiten können beim Verkauf vom steuerbaren Grundstückgewinn abgezogen werden.
Wer sein Haus oder seine Wohnung klimafreundlich umbauen will, findet im Internet viele Informationen über die Bedingungen für den Erhalt von Fördergeldern und vergünstigte Hypotheken.
• www.energiefranken.ch – Gibt man die Postleitzahl des Gebäudestandorts im entsprechenden Suchfenster ein, erhält man eine Auflistung aller Energie-Förderprogramme der Schweiz. Die Suche umfasst Förderprogramme der Kantone, der Städte und der Gemeinden sowie Kampagnen von regionalen Energieversorgungsunternehmen.
• www.dasgebaeudeprogramm.ch – Informationen, für welche Massnahmen Fördergelder bezahlt werden und wie ein Gesuch gestellt werden muss. Links zu jedem Kanton.

energieberatungAARGAU


Es lohnt sich!
Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um das Thema Gebäude und Energie, zum Beispiel zu: – Gebäudeerneuerungen – Fensterersatz – Heizungs- und Boilerersatz – Solaranlagen – elektrischen Verbrauchern und Beleuchtung – Neubauten – Förderprogrammen


energieberatungAARGAU eine Dienstleistung des Kantons Aargau
Kostenlose Beratungen: telefonisch: 062 835 45 40 per E-Mail: energieberatung@ag.ch


Weitere Informationen
finden Sie unter www.ag.ch /energie > Bauen & Energie > energieberatungAARGAU










Damit der Hauskauf auch wirklich Freude bereitet, kann man sich wie beim Kauf eines Occasionsautos mit einer Versicherung gegen Folgeschäden schützen und bösen Überraschungen vorbeugen.
Brigitte Müller, Redaktorin
Jährlich wechseln in der Schweiz rund 40’000 Häuser bzw. Wohnungen den Besitzer. Rund die Hälfte dieser Immobilien ist über zehn Jahre alt. Zudem wird ein zunehmender Sanierungsstau in der Schweiz festgestellt: Fällige Renovationen werden bei über 30 Prozent der Gebäude vertagt. Diese Feststellungen haben zur Folge, dass Käufer einer Altbauimmobilie vorsichtig sein sollten, denn oft werden Folgeschäden einer ausstehenden Sanierung erst Jahre später entdeckt. Ebenso werden Käufer nach dem Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung häufig mit Schäden konfrontiert, die zum Kaufzeitpunkt noch nicht absehbar waren.
Hinter die Fassade schauen Liebe macht blind – auch beim Hauskauf. Hinter die Fassade zu schauen, ist deshalb ein Muss. Bei der Fassade sollte man also auf Risse, Abplatzungen und feuchte Stellen achten. Ebenso ist es notwendig, den Zustand des Daches und der Dachhaut sowie alle Fugen des Gebäudes auf ihre Dichtheit zu überprüfen. Bei Holzfenstern muss man kontrollieren, ob die Holzprofile verfault sind. Auch Heizungen bergen ein grosses Schadenspotenzial, die bei Reparaturen hohe Kosten verursachen. Das Gleiche gilt für Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. Dies ist eine kleine unvollständige Aufzählung von versteckten Mängeln, die man vor und nicht nach dem Hauskauf erkennen sollte.
Mängel erkennen
Tatsache ist, dass der Verkäufer nicht für Mängel haftet, die bei der Besichtigung leicht erkennbar waren. Ansonsten besteht grundsätzlich eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. Innerhalb dieser Frist kann der Käufer entdeckte Schäden bemängeln und eine Preisreduktion verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Wenn der Verkäufer Mängel arglistig verschweigt,

Eine Immobiliengarantie – damit der Hauskauf wirklich Freude macht.
kann er ab dem Kaufdatum dafür noch zehn Jahre lang haftbar gemacht werden und die finanzielle Übernahme der Kosten liegt theoretisch bei ihm. Allerdings muss man nachweisen, dass der Verkäufer tatsächlich von den Mängeln gewusst hat. Das ist oft schwierig, aufwendig und kostspielig.
In notariellen Verträgen für Hausverkäufe finden sich oft Klauseln, laut derer der Verkäufer nicht für versteckte Mängel haftet. Wird ein solcher Vertrag vom Käufer unterzeichnet, gibt es keine rechtliche Grundlage mehr, um ihn im Nachhinein zur Verantwortung zu ziehen. Es ist deshalb ratsam, gebrauchte Immobilien vor dem Kauf durch einen Gutachter prüfen zu lassen. Die Erstellung eines umfassenden Gutachtens ist meistens günstiger als die Bau- und Sanierungskosten für zu spät entdeckte Schäden.
Immobiliengarantie Für Neubauten gibt es im Schadensfall umfassende Garantien. Beim Kauf einer Liegenschaft aus «zweiter Hand» haftet der Verkäufer hingegen in der Regel nicht für Mängel. Um böse Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt sich eine Immobiliengarantie. Diese versichert während zweier Jah-
re nach dem Kauf die Funktionsfähigkeit sämtlicher wichtiger Bauteile im und am Einfamilienhaus bzw. in der Eigentumswohnung. Innerhalb dieser Zeit übernimmt die Versicherung bei aufgedeckten Schäden die Reparaturkosten oder sorgt für einen Ersatz zum Neuwert. Zu den versicherten Bauteilen zählen zum Beispiel das Dach, die Heizung, die Lüftung, die Waschmaschine oder der Backofen, ebenso der Whirlpool oder der Wintergarten. Doch Achtung: Es werden Alterslimits definiert. So sind etwa Bauteile zur Wärmeerzeugung wie zum Beispiel Ölheizungen und Wärmepumpen nur mitversichert, sofern sie bei Vertragsabschluss maximal 25 Jahre alt sind. Dächer dürfen maximal 40 Jahre alt sein. Eine Ausnahme sind Kunststofffoliendächer, die maximal
Die Zurich-Immobiliengarantie ist in verschiedenen Varianten mit einer Versicherungssumme von 20’000 bis 150’000 Franken erhältlich. Die Prämien liegen zwischen 1950 bis 5000 Franken. Der Selbstbehalt beträgt, unabhängig von der Art des Versicherungspakets, 500 Franken pro Schadensfall.
20 Jahre sein dürfen. Eingebaute Haushaltgeräte wie etwa Waschmaschine, Backofen oder Geschirrspüler dürfen maximal zehn Jahre alt sein, damit sie mitversichert sind.
Vorteile ebenfalls für den Verkäufer Auch Verkäufern bietet eine Immobiliengarantie Vorteile, denn damit kann die Immobilie mit einer zusätzlichen Sicherheit beworben werden, was die Verkaufschancen auf dem Markt verbessert. Ausserdem wird der Verkäufer vor unangenehmen Auseinandersetzungen mit dem Käufer bewahrt, sollten unerwartet Schäden auftreten. Eine Immobiliengarantie erspart zudem administrativen Aufwand bei allfälligen Schäden, denn der Käufer kann sich im Schadensfall direkt an die Versicherung wenden.
Versichertes Bauteil
Wärmeerzeugung
Gebäudeinstallationen/Haustechnik
Enthärtungsanlagen/Schmutzwasserpumpen
Kunststofffoliendächer
Jahre
Fassade/Fenster/Sonnenschutz 30 Jahre
Wintergärten
Eingebaute Haushaltgeräte
ZIMMERLIDACHLUKARNEN ZIMMERLIDACHLUKARNEN als Fertigelement

Mehr Raum und Licht in einem Tag. Mehr Raum und Licht in einem Tag.
Lassen Sie Ihr Dachgeschoss leerstehen, weil Sie den Einbau einer Dachlukarne scheuen? Dann kennen Sie die Zimmerli Dachlukarne nicht! Zimmerli Dachlukarnen werden nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen geplant, im eigenen Werk als Fertigelement und in bester Schweizer Qualität hergestellt und in einem Tag montiert. Profitieren Sie von unser langjährigen Erfahrung.
Tel.062 822 37 23 • www.zdl.ch

Unterdorf 19 5420 Ehrendingen
Bauaustrocknung
Isolationstrocknung
Bauheizung
Bauthermographie Wäschetrockner
Tel.056 221 62 15 Fax056 221 62 68

Internet:http://www.buba.ch
12, 5103 Wildegg
Fast drei Viertel aller Personen, die eine Immobilie kaufen, sind Paare mit Kindern oder ohne. In der neuesten Immobilienmarkt-Studie der Credit Suisse wird ersichtlich, dass beim Erwerb von Wohneigentum eine traditionell anmutende Rollenverteilung vorherrscht: Sie sucht das Haus aus, er kümmert sich um die Hypothek.

Der Erwerb von Wohneigentum gehört zu den wichtigsten Entscheiden eines Haushalts. Üblicherweise wird schrittweise entschieden: vom Erkennen des Bedürfnisses über die Suche nach einem Objekt bzw. nach Alternativen bis hin zum definitiven Kaufentscheid. Eine Umfrage bei Maklern und Finanzierungsspezialisten, durchgeführt von der Credit Suisse, hat ergeben, dass Wohneigentum meistens gemeinsam gekauft und bewohnt wird. Beinahe drei Viertel aller Käufer sind Paarhaushalte mit oder ohne Kinder. Dies bestätigen auch Daten über Wohneigentümer des Bundesamts für Statistik. Interessant ist allerdings, dass alleinstehende Männer etwas häufiger Eigentum erwerben als Frauen.
Klare Rollenverteilung
Die befragten Immobilienmakler erkennen bei Paaren eindeutig – zu 97 Prozent (!) –
geschlechterspezifische Unterschiede beim Erwerb von Wohneigentum. Mit einer Zustimmungsrate von 67 Prozent fällt diese Aussage bei Finanzierungsspezialisten jedoch tiefer aus. Ein ähnliches Bild zeichnen internationale Studien. So äussert bei jüngeren Familien mit Kindern häufig die Frau den Wunsch nach Eigentum. Die Gründe liegen in den grösseren Platzansprüchen, der innerfamiliären Rollenverteilung sowie der finanziellen Sicherheit, die das eigene Heim bietet. Sind hingegen keine Kinder vorhanden, wird der Prozess von beiden gleichermassen angestossen. Männer sind vor allem in einer späteren Lebensphase Treiber für den Wunsch nach Eigentum.
Bei der Suche nach dem Wunschobjekt nehmen gerne die Frauen das Zepter in die Hand: In 53 Prozent der Fälle stellt die Frau den Erstkontakt mit dem Makler her. Der Mann ist dagegen nur für 41 Prozent der
Erstkontakte verantwortlich. Die dominierende Rolle der Frau manifestiert sich auch bei der Erstbesichtigung und beim Entscheid für oder gegen ein Objekt. Aufgrund der klaren Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern erstaunt es letztlich nicht, dass Frauen in 56 Prozent der Fälle verantwortlich sind für den Entscheid für oder gegen ein Wohnobjekt, Männer hingegen nur in 23 Prozent.
Welche Kriterien sind entscheidend?
Der Mann ist für die Technik und den Garagenplatz zuständig, die Frau hingegen für die Küche und das Bad. Wiederum werden die gängigen Klischees bestätigt. Interessant ist, wie deutlich diese Muster zutage treten. Für Frauen sind jedoch auch die Nachbarschaft, das soziale Umfeld und die Kinderfreundlichkeit von grosser Bedeutung, insbesondere wie gut Kindergarten oder Schulen erreichbar sind. Und ob sie ein Objekt emotional anspricht. Diesen
Entscheid fällen Frauen schnell: Überzeugt ein Objekt nicht bei der ersten Besichtigung, dann ist es meistens gleich aus dem Rennen. Bei Männer stehen in erster Linie finanzielle Aspekte im Vordergrund: der Preis und der mögliche Verhandlungsspielraum. Beim Objekt selber ist vielen Männern neben dem Parkplatz und der Garage die Technik wichtig: von der Heizung über die Elektroanschlüsse bis hin zu den Internetanbindungen. Männer hinterfragen auch eher die Bauqualität sowie die Bausubstanz und bei Bestandsliegenschaften den Sanierungsbedarf. Sie interessieren sich weniger für Küche und Bad. Themen wie das soziale Umfeld und die Nachbarschaft werden von ihnen nur selten angeschnitten.
Der Mann übernimmt die Finanzierung Eine klare Rollenverteilung zeigt sich ebenfalls bei den Preisverhandlungen für das gewünschte Objekt und bei der Finanzierung. In beinahe zwei Dritteln der Fälle übernimmt der Mann die Führung in den Preisverhandlungen, im Gegensatz zu 20 Prozent bei den Frauen. Bei Finanzierungsfragen wie der Wahl des Hypothekarproduktes, gewünschten Laufzeiten oder der Art der Amortisation ist der Mann in 41 Pro-
Zins
Hypothekarprodukte
Lage/Infrastruktur
Kaufpreis
Kosten
Sicherheit finanziell
Tragbarkeit
Ablauf der Finanzierung
Konditionen
Unsicherheit in Bezug auf Tragbarkeit
Amortisation
Eigenmittel/Belehnung
Verkauf/Wiederverkauf
zent der Fälle in der Führungsrolle, die Frau nur in 28 Prozent. Frauen hingegen ist die finanzielle Sicherheit besonders wichtig. Sie sorgen sich um die Tagbarkeit der Liegenschaft und die Amortisation der Hypothek.
Die grossen Unterschiede in Bezug auf die Bedeutung der verschiedenen Themenbereiche führen dazu, dass sich Paare sehr gut gegenseitig ergänzen und gemeinsam die relevanten Aspekte bei einem Kauf von Wohneigentum abdecken. Ob ein Objekt gekauft wird, beschliessen Paare meistens gemeinsam. Entscheidet nur einer der beiden Partner, so ist es in 35 Prozent der Fälle die Frau und in nur 24 Prozent der Fälle der Mann. Frauen haben beim Hauskauf also häufiger das letzte Wort. Wenn die Frau letztlich für den Kaufentscheid verantwortlich ist, bedeutet dies für die Verkäuferin oder den Makler, dass die Frau vom Objekt überzeugt sein muss. Für ein Paar wiederum bedeutet diese Umfrage, dass die Frau nicht zu früh zu erkennen geben soll, dass ihr ein Objekt gefällt. Denn wenn einmal klar ist, dass sie Ja sagt, hat der Mann weniger Spielraum bei den Preisverhandlungen.
Frauen Männer
Budget/Finanzplanung weniger wichtig sehr wichtig
Finanzierungsspezialisten erkennen teilweise eine eindeutige Rollenverteilung bei der Finanzierung.

Betten & Möbel massiv, Betten metallfrei nur mit Bio-Öl und Bienenwachs behandelt
So geschmeidig kann sich Holz anfühlen!







Top-Beratung und Service
• Eigene Produktion: Matratzen, Decken, Kissen
• Lattenroste, Bettgestelle
• Bettwäsche
• Bettfedernreinigung
• Hüsler Nest

Der Familienbetrieb im Herzen von Villmergen
Unterdorfstrasse 3 • 5612 Villmergen Tel. 056 621 82 42
www.betten-kueng.ch




Öffnungszeiten: Montag geschlossen
Dienstag-Freitag: 9-12 • 14-18.30 Uhr Samstag 9-16 Uhr




ERA Kuhlmann Immobilien
Kuhlmann Immobilien AG



• Kompetent und erfahren
• 100 % Erfolg – alles verkauft!
• Kostenlose Immobilien-Bewertung
• Bester ERA-Verkäufer in der Schweiz 2016 und 2017
Das ERA Kuhlmann Team Ihres Bezirkes freut sich auf Sie
Telefon 056 450 22 22 www.era-kuhlmann.ch



Telefon 056 6 49 99 65 ww w immovendo ch |


EMPFEHLUNG: Haustiere wirken bei einer Besichtigung störend. » Mehr Informationen unter www.brivioimmobilien.ch
Brivio Immobilien GmbH Suhrgasse 2 5037 Muhen T 062 723 03 03
































Wir finden einen Käufer für Ihre Liegenschaft.


Vermittlung... ... auf reiner Erfolgsbasis ... ohne Werbekosten für Sie ... zu fairen Konditionen

Unsere Kernkompetenz: Immobilien-Verkauf

DER IMMOBILIENPARTNER IN IHRER REGION
Verkaufen Sie keine Immobilien ohne Offerte von uns. Wir bieten mehr –auf allen Ebenen.

UTA IMMOBILIEN AG 5400 Baden verkauf@uta.ch 5314 Kleindöttingen verkauf-kld@uta.ch www.uta-immobilien.ch
beraten. verkaufen. verwalten.
Aarauerstrasse 52CH-5200 Brugg Tel. 056 461 70 80Fax 056 461 70 81 info@immostoeckli.chwww.immostoeckli.ch
Kleines Feld, 58 x 22 mm, 4-farbig pro Erscheinung CHF 168.–Informationen Tel. 056 641 90 80
Rustikal und doch elegant, kühlend und behaglich: Leinen in hellen Pastelltönen oder schönen Erdtönen ist im Trend. Im Schlafzimmer strahlt Leinenbettwäsche Natürlichkeit und Ruhe aus.
Brigitte Müller, Redaktorin
Besonders abends beim Zubettgehen wünscht man sich Ruhe und ein Schlafzimmer, das ein gemütliches, vertrautes Zuhausegefühl weckt. Leinenbettwäsche erfüllt diese Sehnsucht, sei es in einer eher natürlichen, ländlichen Einrichtung oder im modernen, puristischen Interieur eines Neubaus. Im Gegensatz zu früher, als Leinen hauptsächlich weiss und gestärkt verwendet wurde, schätzt man heute den lässigen Knitter-Look in sanften Farbtönen.
Umweltschonender Anbau
Leinengewebe gehört zu den ältesten Stoffen der Menschheit: Bereits die ersten Hochkulturen bauten Flachs an, der zu Leinen verarbeitet wurde. Zeugnisse dieser frühen Nutzung sind in Leinen gehüllte Mumien, die Archäologen in den ägyptischen Grabkammern fanden. Flachs kann umweltschonend angebaut werden, benötigt er doch fünf Mal weniger Dünger und Pestizide als beispielsweise der Anbau von Baumwolle. Zudem braucht Flachs keine zusätzliche Bewässerung, ihm reichen die natürlichen Regenfälle. Ein Hektar Flachs speichert übrigens jedes Jahr 3,7 Tonnen CO2. Als Brachpflanze produziert Flachs auf natürlich Weise eine optimale Bodenqualität und erhöht dadurch die Erträge der folgenden Kulturen.
Wundersame Eigenschaften
Leinen eignet sich hervorragend für Bettwäsche, denn es ist eine sehr stabile, enorm reissfeste Faser, die sowohl antiallergische als auch antibakterielle Eigenschaften besitzt. Da die Leinenfaser sehr dünn gesponnen wird, ist der Leinenstoff glatt und schliesst nur wenig Luft ein. Auf dieser glatten Faserstruktur finden Staub sowie Milben keinen Halt und können sich nicht auf der Oberfläche ansammeln. Beliebt ist Leinen auch, weil das Gewebe Temperaturen regulieren

kann: Im Winter wirken die Fasern isolierend gegen Kälte und im Sommer bleibt der Stoff kühl und atmungsaktiv. Zudem kann Leinen Feuchtigkeit bis zu 20 Prozent seines Gewichts aufnehmen und diese wieder an die Luft abgeben – ein wichtiger Grund, weshalb das Gewebe seinen kühlen und trockenen Griff behält. Das Garn selbst verfügt über einen natürlichen Schimmer. Leinen kennt keine statische Aufladung, bleibt fusselfrei und ist schmutzabweisend.
Wegen der geringen Elastizität von Leinen ist der Stoff knitteranfällig. Je öfter Leinen gewaschen wird, desto weicher und glatter wird der Stoff. Leinenbettwäsche sollte mit 60 Grad gewaschen werden – mit einem Bunt- oder Feinwaschmittel ohne optischen Aufheller. Vorher sollte man die Bettwäsche wenden und den Reissverschluss schliessen. Nachher kann sie im Tumbler getrocknet werden, jedoch nicht übertrocken. Bügeln lässt sich Leinen am besten in leicht feuchtem Zustand. Experten empfehlen zudem, Leinenstoff nicht immer an derselben Stelle zu falten, da die Fasern sonst brechen können.
Schöne Bettwäsche – aus reinem Leinen oder gemischt mit anderen, Materialien – wird beispielsweise von den Schweizer Unterneh-
men Schlossberg und Christian Fischbacher, beide bekannt für edle und qualitätsvolle Bettwäsche, in Möbel- und Warenhäusern verkauft. Auch der Bettwarenspezialist Betten Küng in Villmergen bietet eine breite Palette an Bettwäsche zu unterschiedlichen Preisen an.
Der Familienbetrieb Betten Küng im aargauischen Villmergen bietet alles rund ums Bett an: ausgewählte Produkte, die mit ihrer langlebigen Qualität überzeugen. Die angebotenen Matratzen werden in einer Schweizer Matratzenfabrik exklusiv für Betten Küng hergestellt. Auch beim Lattenrost arbeitet das Bettwarengeschäft mit Lieferanten zusammen, die eine wertbeständige Fabrikation garantieren. Ausserdem werden Matratzenauflagen, Kissen, Bettdecken und Bettwäsche verkauft. Den Service einer Bettfederreinigung nehmen Kunden gerne in Anspruch, wird durch die fachmännische Daunenreinigung der Gebrauch eines Kissens oder einer Bettdecke doch um Jahre verlängert. Besonderen Wert legt das BettenKüng-Team auf eine ganzheitliche Beratung. Betten Küng
Unterdorfstrasse 3, 5612 Villmergen Tel. 056 621 82 42, www.betten-kueng.ch
Saudi-Arabien und Russland provozieren mit Erhöhung der Ölförderung
Ende Mai schlugen Russland und Saudi-Arabien vor, die Kürzungen bei der Ölförderung zu lockern und die Förderung um etwa eine Million Barrel pro Tag zu erhöhen. Dieser Vorstoss kam nicht bei allen gut an.
Einige andere ölproduzierende Länder relativierten diese Aussagen und wollten damit den Eindruck vermeiden, dass die vereinbarten Kürzungen nun schnell aufgehoben werden. Algeriens Ölminister beispielsweise wies kurz nach dieser Provokation von Russland und Saudi-Arabien darauf hin, dass der Fokus beim Meeting am 22. Juni noch immer darauf liege, den Markt auszugleichen und nicht etwa darin, die Obergrenzen der Produktion zu lockern.
Vor allem Länder, die keine Möglichkeit haben, die Ölförderung schnell zu steigern, wollen tendenziell am bestehenden Abkommen festhalten. Sollte dieses aufgeweicht werden, profitieren nur diejenigen davon, die auch freie Produktionskapazitäten besitzen. Durch eine höhere Menge Öl auf dem Markt würde der Ölpreis fallen, so dass Länder, die keine zusätzlichen Exportmengen anbieten können, grössere Einnahmeausfälle hinnehmen müssten. Deshalb stehen sie dem Vorhaben nicht unbedingt positiv gegenüber.
Alles noch offen
Die Spekulation, dass die Ölförderung nach dem 22. Juni signifikant steigt, ist deshalb noch längst nicht in trockenen Tüchern. Vor allem
Der Ölpreis hängt davon ab, ob sich die ölproduzierenden Länder einigen können.
nachdem die Ölpreise bereits nach der Ankündigung stark fielen, dürften einige Marktteilnehmer wachgerüttelt worden sein. Sinken die Preise zu stark, wird die Opec ihren Anreiz verlieren, die Produktion anzuheben.
UTA Immobilien AG: wertvolle Tipps von den Verkaufsprofis
Der Begriff Mediation, nicht zu verwechseln mit Meditation, stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «Vermittlung». Die Mediationsperson versucht, die Konfliktparteien zu einer konstruktiven Lösung zu führen. Dieses Verfahren kann auch beim Verkauf einer Immobilie nötig sein.
Die Parteien beharren auf ihren Positionen, die Nerven sind angespannt, ein sachliches Gespräch ist kaum möglich. Bei jedem Verkaufsprozess kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Maklerinnen und Makler, die das Verfahren der Mediation kennen, können in solchen Situationen ihre Vermittlungsdienste anbieten.
Allparteilichkeit
Eine Mediationsperson verhält sich allparteilich, das heisst, sie bevorzugt keine Partei und bleibt stets sachlich.
Kommt es zu einem erfolgreichen Abschluss der Mediation, erspart dies viel Zeit und hohe Anwaltskosten.
Mediation unter Verkäufern
Immer öfter ist ein Mediationsverfahren auch unter Verkäufern nötig. So sind Scheidungen und Trennungen mittlerweile der zweithäufigste Verkaufsgrund bei Einfamilienhäusern. Für viele Paare sind solche Lebenssituationen sehr belastend. Auch hier können Makler und Maklerinnen die Vermittlung übernehmen.
Kostenlose Beratung
Wenden Sie sich für ein unverbindliches Beratungsgespräch an uns. Wir zeigen Ihnen die besten Verkaufsmöglichkeiten auf. Unsere Beratung ist kostenlos und beinhaltet die Einschätzung der Verkäuflichkeit und des Marktwerts des Objekts. Zudem erhalten Sie



Voegtlin-Meyer AG
Aumattstrasse 2 5210 Windisch Tel. 056 460 05 05 info@voegtlin-meyer.ch
www.voegtlin-meyer.ch



Informationen über Vorbereitung, Ablauf und Vorgehen beim Verkauf. Wir freuen uns auf Sie!
Online-Bewertung
Die UTA Immobilien AG bietet auf ihrer Website eine kostenlose Selbstbewertung der Immobilie an. Einfach unter dem Link www.kurzbewertung.ch die Daten eingeben und in nur wenigen Minuten liegt eine grobe Einschätzung vor. Alle Daten werden vertraulich behandelt.

UTA Immobilien AG
5400 Baden
Tel. 056 203 00 70
5314 Kleindöttingen
Tel. 056 268 66 68
www.uta-immobilien.ch
Das solide Glasdach von Frego

Mit einem geeigneten Sonnenund Wetterschutz wird das Verweilen auf dem Aussensitzplatz noch beliebter.
Die Firma Frego mit Sitz in Ottenbach fertigt Glasdächer für Sitzplätze nach Mass. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo sich Kundinnen und Kunden einen ganzjährigen Wetterschutz wünschen. Die
filigranen Glasdächer sind in Stahl oder Aluminium erhältlich und sie zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung aus.
Höchste Sicherheitsstandards
In der Regel verwendet Frego für die Konstruktionen Verbundsicherheitsgläser (VSG-TVG). Diese bestehen aus zwei gehärteten Gläsern (2 x 5 mm), die mit einer klaren oder
matten Folie (0,76 mm) verklebt sind. Die Firma garantiert für alle Teile der feingliedrigen Dachkonstruktionen eine lange Lebensdauer.
Die Frego-Glasdächer lassen sich seitlich mit edlen Festverglasungen sowie mit Schiebe- oder Faltwänden kombinieren. So ist der Schutz vor Wind und Wetter von allen Seiten her möglich.
Wohlfühlklima
Die Fachleute von Frego kennen sich mit den Tücken von Wind und Wetter bestens aus. Besondere Aufmerksamkeit schenken sie deshalb den passenden Beschattungsvarianten, die für ein behagliches Klima unter dem Glasdach sorgen. Ob eine Überglas-Beschattung oder Unterglas-, Roll- oder Faltstoren zum Einsatz kommen – Frego bietet der
BWT setzt bei der Wasseraufbereitung auf digitale Vernetzung
Die digitale Vernetzung ermöglicht es, Serviceangebote in völlig neuen Dimensionen anzubieten. Diese neuen Möglichkeiten nutzt BWT aktiv und schafft damit bei den Kunden Vertrauen.
Der Service des Wasserenthärters BWT Perla seta basiert auf digitaler Vernetzung. Die neu entwickelte Servicestruktur funktioniert über eine firmeneigene Daten-Cloud. Hier werden die Informationen der Geräte direkt aus dem Betriebsalltag empfangen und die Daten entsprechend verwaltet. So kann BWT rasch auf etwaige Störungen reagieren und Geräte optimieren.
Die Service-Zukunft
Die laufend eingehenden Daten bilden das Fundament für ein neues Niveau der Kundenbetreuung und

Das Enthärtungsgerät lässt sich einfach über ein Tablet kontrollieren und steuern.
des Services. Nicht der Betreiber meldet auftretende Fehler, vielmehr informiert BWT als Hersteller den Betreiber, sobald ein Gerät Meldungen anzeigt und es nötig ist, einzugreifen, damit der einwandfreie Betrieb weiter gewährleistet bleibt. «Vorausblickende Wartung» nennt sich das neue Prinzip, mit dem BWT Neuland in Sachen Kundenzufriedenheit betritt. Die Bedie-
nung des Geräts ist einfach und verständlich aufgebaut. Gesteuert wird der Wasserenthärter BWT Perla seta über einen Touchscreen.
Perlwasser tut einfach gut Eine kontinuierliche Versorgung mit weichem Wasser ist rund um die Uhr garantiert. Der Enthärter regeneriert zu einem Zeitpunkt, in dem im Haushalt erfahrungsgemäss
Kundschaft eine individuell angepasste Lösungsvariante an. Zusätzlich lassen sich seitlich angebrachte textile Wind- und Sonnenschutzelemente raffiniert in jede Konstruktion von Frego integrieren.
Ein offenes Ohr für Wünsche
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Frego nehmen sich gerne Zeit für ihre Kundinnen und Kunden, sei dies für ein persönliches Gespräch in der grossen Ausstellung in Ottenbach oder beim Kunden vor Ort.

Frego AG
8913 Ottenbach ZH
Tel. 044 763 70 50
3123 Belp BE
Tel. 044 763 53 33 info@frego.ch
www.frego.swiss
Foto: zvg
kein Wasser benutzt wird. Wählen die Kunden den Online-Modus, können sie über eine App die Leistungsfähigkeit der Anlage selbst überprüfen. Sie werden über notwendige Wartungsschritte informiert, beispielsweise ob Salz nachgefüllt werden muss. Um den Status zu überprüfen, braucht man nicht in den Keller oder Abstellraum zu gehen, wo die Anlage ausser Sichtweite arbeitet. Die Direktbedienung funktioniert mittels Smartphone oder Tablet über die responsefähige Website.

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192 4147 Aesch (BL)
Tel. 061 755 88 99 info@bwt-aqua.ch
www.bwt-aqua.ch
Das richtige Verständnis für die WC-Anlage reduziert die Kosten und verlängert die Lebensdauer.
Wir alle benützen das WC mehrere Male am Tag und haben uns noch nie Gedanken über die Funktion und Komplexität der WC-Spülung gemacht.
Damit unser Auto, die Heizung oder die Wohnungslüftung immer reibungslos funktionieren, lassen wir regelmässig durch einen Profi einen Service machen. Das ist für uns so selbstverständlich wie die Dentalhygiene, die uns vor teuren und schmerzhaften Zahnbehandlungen schützt.
Das WC wird unterschätzt
Die Hersteller von WC-Anlagen haben Spülkasten, WC-Keramik und Ablaufrohre so aufeinander abgestimmt, dass diese bei jedem Spül-
vorgang einwandfrei ab- und ausgespült werden. Dieses Zusammenspiel von Wassermenge, Ausspüldruck und Abwasserleitungen hat einen direkten Einfluss auf den Pflegeaufwand sowie die Unterhaltskosten von Ablaufleitungen und WC-Anlagen.
Mit einem durchschnittlichen Spülvolumen von neun Litern erreicht die WC-Spülung einen Ausspüldruck wie kein anderes Gerät unseres Haushalts. Wenn wir duschen oder die Badewanne ablassen, fliessen nur 0,1 bis 0,4 Liter Wasser pro Sekunde durch unsere Ablaufleitungen. Dies reicht nicht aus, um die Ablaufrohre sauber zu halten.
Funktioniert die WC-Spülung optimal, entleert sich der Spülkasten
– ein wichtiger
Auf dem Immobilienmarkt gibt es eine grosse Auswahl an Häusern und Wohnungen zu kaufen. Auf Plattformen oder in der Tagespresse kann man sich einen guten Eindruck davon verschaffen. Hat man eine passende Immobilie gefunden, ist es ratsam, weitere Informationen anzufordern.
Der solide Immobilienvermarkter erstellt für jedes seiner Objekte eine ausführliche Dokumentation. Überzeugt die Liegenschaft auch nach dem Studium dieser Dokumentation, so kann eine Besichtigung vereinbart werden. Grundsätzlich verlässt man sich dabei am besten auf sein Bauchgefühl, es gibt jedoch einige Punkte, welche dabei zusätzlich beachtet werden sollten.
Nehmen Sie sich genügend Zeit für die erste Besichtigung. Lassen Sie sich von
innerhalb von vier Sekunden. Nach einiger Zeit verkalken aber die Wasserverlaufskanäle der Keramik und die Funktionsteile im Spülkasten.
Spült das WC noch richtig?
Mit dem Betätigen der grossen Spültaste sollten bis zur kompletten Entleerung des Spülkastens nicht mehr als vier Sekunden vergehen. Hat der Spülvorgang länger als vier Sekunden gedauert? Dann wäre eine fachliche Abklärung durch Restclean (restclean.com/diagnose) angezeigt.
Schonend und natürlich Restclean reinigt und entkalkt alle wasserführenden Kanäle von Toiletten. Beginnend mit dem Spühlkasten, über das Spülrohr und die Keramik bis hin zum Siphon.

jemandem begleiten – vier Augen sehen bekanntlich mehr. Sie können aber auf einen Fachmann verzichten, es geht primär darum, wie das Haus wirkt. Können Sie sich vorstellen, darin zu wohnen? Entspricht das Objekt dem, was Sie wollen?
Mikrolage – Nachbarschaft
Denken Sie immer daran, wenn Sie eine Immobilie für sich selber kaufen, werden Sie eine sehr lange Zeit, vielleicht sogar den Rest Ihres Lebens in diesem
Haus verbringen. Tauschen Sie sich bei Gelegenheit mit den Nachbarn aus. Diese kennen sich in der Regel gut, oftmals können bereits zu einem frühen Zeitpunkt gute Bekanntschaften entstehen.
Guter Rat ist nicht teuer, aber wertvoll. Wer kein Baufachmann ist, sollte externen Rat einholen. Wichtig dabei ist die Kontrolle der Bausubstanz, vom Keller bis zum Dachboden. Kritische Punkte sind auch: das Bad und die Küche, die Fenster (Tipp: In der Alulitze des Fens-






RESTCLEAN AG
Toilettenkultur


Schmidtenbaumgarten 10 8917 Oberlunkhofen
Gratis-Telefon 0800 30 89 30 info@restclean.com
www.restclean.com
terrahmens ist jeweils das Baujahr eingeprägt), die Innen- und Aussenwände, die Heizung sowie die Haustechnik. Halten Sie im Kaufvertrag fest, welche Mängel Sie entdeckt haben und wer sie beheben beziehungsweise die Kosten dafür übernehmen wird.
Achtet man auf die obenerwähnten Punkte, steht einer erfolgreichen Besichtigung nichts im Weg. Fragen, die erst danach zu Hause auftauchen, lassen sich per Telefon oder optimal bei einer weiteren Besichtigung beantworten.
5000 Aarau, Tel. 062 822 24 34
5400 Baden, Tel. 056 441 90 30
5722 Gränichen, Tel. 062 822 24 30 info@immoservice.ch www.immoservice.ch
Nr. 390 Juli 45. Jahrgang
Auflage WEMF beglaubigt 37’927 Ex. Basis 2016/2017
Anzahl Mitglieder: 38’193 (1. Juni 2018)
Offizielles Organ des Hauseigentümerverbandes Aargau, erscheint 10 Mal jährlich Einzelexemplar Fr. 3.–Für Verbandsmitglieder ist das Abonnement im Jahresbeitrag inbegriffen.
HERAUSGEBER
Hauseigentümerverband Aargau
Sekretariat, Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden Tel. 056 200 50 50, Fax 056 222 90 18 info@hev-aargau.ch, www.hev-aargau.ch Postcheck 50-9730-2
REDAKTION
Martin Meili (mm), Chefredaktor Redaktion Themen:
Ruth Bürgler, Redaktionsbüro, 4632 Trimbach ruthbuergler@bluewin.ch
Brigitte Müller, Müllertext, 4500 Solothurn www.muellertext.ch
ADRESSÄNDERUNGEN
HEV Aargau, Tel. 056 200 50 50, Fax 056 222 90 18
INSERATE
DapaMedia GmbH, Davide Paolozzi
Wohlerstrasse 15, 5620 Bremgarten Tel. 056 641 90 80 info@dapamedia.ch www.dapamedia.ch
HERSTELLUNG UND VERTRIEB
Media2finish
Täfernstrasse 14 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 470 40 60 www.media2finish.com
Titelbild: Adobe Stock
Der Nachdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet. Über nicht bestellte Manuskripte kann keine Korrespondenz geführt werden. Der Inhalt der Rubrik «Firmen und Produkte» liegt in der Verantwortung der Absender und muss nicht mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen. Der Inserateteil und die Publireportagen dienen lediglich der Information der Mitglieder und Leser über Produkte und Dienstleistungen.
Hauseigentümerverband Aargau (Kantonalverband)
Stadtturmstr. 19, 5401 Baden, Tagblatthaus, 11. OG Schalteröffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–12.00 sowie 13.15–17.00 Uhr www.hev-aargau.ch, info@hev-aargau.ch Telefonzentrale inkl. Bestellung Drucksachen:
Tel. 056 200 50 50; Fax 056 222 90 18 Mo–Fr 8.30–12.00 sowie 13.30–16.30 Uhr
Telefonische Beratung:
Tel. 056 200 50 70, Mo–Fr 9.00–11.30 Uhr Persönliche Beratungen: nach tel. Vereinbarung
Hauseigentümerverband Bezirke Aarau und Kulm Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau www.hev-aarau-kulm.ch
Tel. 062 822 06 14; Fax 062 832 77 43
Telefonische Beratung:
Mo 13.30–18.00, Mi 13.30–16.30, Fr 7.30–12.00 Uhr
Persönliche Beratungen: nach tel. Vereinbarung
Hauseigentümerverband Baden/Brugg/Zurzach (Bezirke Baden, Brugg, Zurzach) siehe oben Hauseigentümerverband Aargau
Hauseigentümerverband Lenzburg-Seetal (Bezirk Lenzburg) c/o lic. iur. Hans Stoller, Baurecht + Baumanagement Niederlenzerstrasse 10, 5600 Lenzburg
Tel. 062 888 25 38; Fax 062 888 25 26 www.hev-lenzburg.ch, info@hev-lenzburg.ch
Telefonische Beratung:
Tel. 056 200 50 70, Mo–Fr 9.00–11.30 Uhr
Persönliche Beratungen: nach Vereinbarung, Tel. 062 888 25 28
Hauseigentümerverband Fricktal (Bezirke Rheinfelden, Laufenburg)
Postfach 176, 5070 Frick
Tel. 0840 438 438 kontakt@hev-fricktal.ch
Telefonische Beratung: Tel. 0844 438 438
Do–Fr 8.30–11.30, 14.00–17.00 Uhr
Persönliche Beratungen: nach tel. Vereinbarung
Hauseigentümerverband Freiamt (Bezirke Bremgarten, Muri)
Geschäftsstelle: c/o Fricker, Seiler Rechtsanwälte
Kirchenfeldstrasse 8, 5630 Muri
Tel. 056 664 37 37; Fax 056 664 55 66 www.hev-freiamt.ch, info@hev-freiamt.ch
Rechtsberatung:
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr sowie 13.30–17.00 Uhr: MLaw Corinne-Moser-Burkard, lic. iur. Matthias Fricker, lic. iur. Roger Seiler, a) Sorenbühlweg 13, 5610 Wohlen, Tel. 056 611 91 00; Fax 056 611 91 01 oder
b) Kirchenfeldstrasse 8, 5630 Muri, Tel. 056 664 37 37; Fax 056 664 55 66
Hauseigentümerverband Zofingen (Bezirk Zofingen)
Untere Brühlstrasse 21, Postfach, 4800 Zofingen
Tel. 062 745 50 25; Fax 062 745 50 26 www.hev-zofingen.ch, hevz@hev-zofingen.ch
Telefonische Beratung:
Tel. 056 200 50 70, Mo–Fr 9.00–11.30 Uhr
Persönliche Beratungen: nach tel. Vereinbarung






