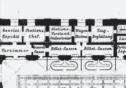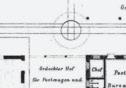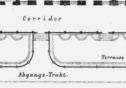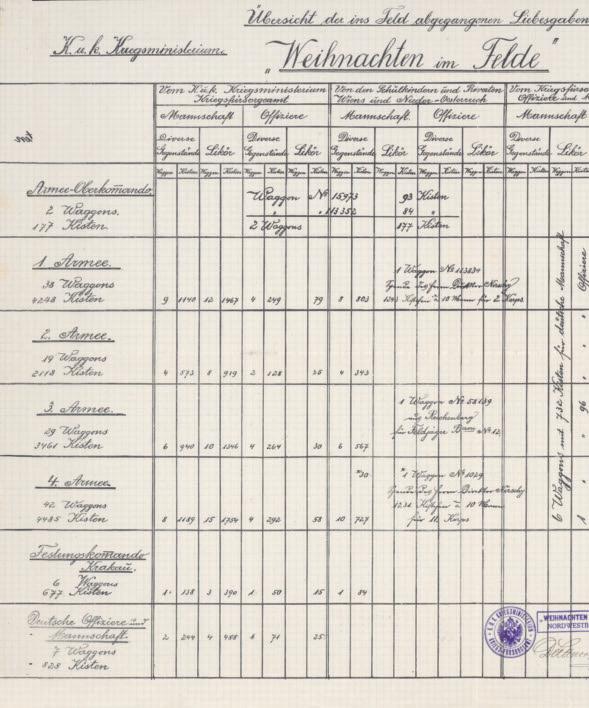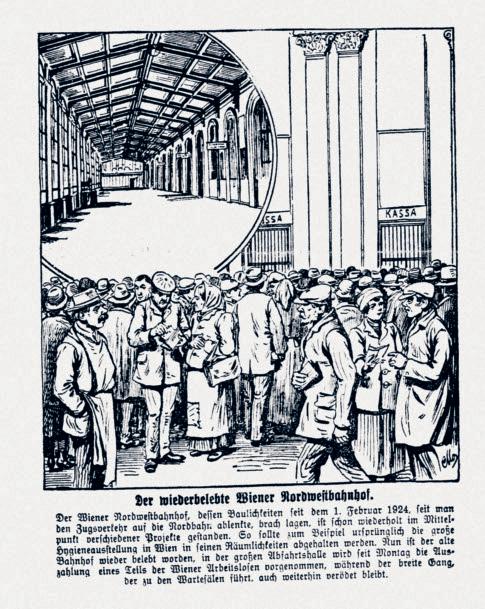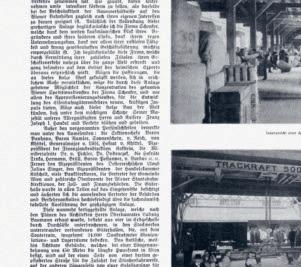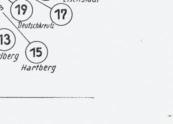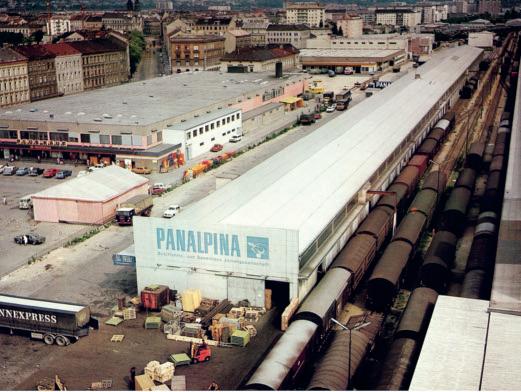Biogra e eines innenstadtnahen Bahnhofsareals


Der Wiener Nordwestbahnhof wurde 1872 als letzter der großen Kop ahnhöfe in Wien errichtet, um die nordböhmischen Industrieregionen mit Wien und in der Folge Wien mit Berlin und den Nordseehäfen zu verbinden.

Im Gegensatz zu anderen Wiener Bahnhöfen konnte der Nordwestbahnhof seine Funktion als innenstadtnaher Umschlagplatz für den transnationalen Güterverkehr bis zuletzt erhalten. Trotz seiner Größe und Bedeutung scheint dieser Bahnhof jedoch völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Ausgerechnet 2022, im Jubiläumsjahr seines 150-jährigen Bestehens, erfuhr er seine endgültige Stilllegung und wird in naher Zukunft einem neuen Stadtteil für etwa 15.000 Menschen weichen müssen.
Dieses Buch legt unterschiedliche verdrängte Schichten, bauliche Transformationen und soziale Überformungen frei, beginnend bei den Fischpopulationen, die in den 1860er-Jahren den Aufschüttungen der Industrialisierung zum Opfer elen. Von den Nutzungen der Zwischenkriegszeit, darunter die NS-Propagandaausstellung „Der ewige Jude“, führt der Weg zu Raub, Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die sowjetische Besatzung, die Boom-Jahre während des Kalten Krieges und der sukzessive Rückbau bis zum Abriss. www.falter.at
9 783854 397168
Blinder Fleck Nordwestbahnhof Hachleitner Hieslmair Zinganel Blinder Fleck Nordwestbahnhof 1872–1918 1918–1938 1938–1945 1945–2022 221031_NWBH-Buch_Konzept_Cover_RZ.indd 1-5 31.10.22 22:32
221031_NWBH-Buch_Konzept_Cover_RZ.indd 6-10 31.10.22 22:32
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 3 04.11.22 11:16
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 4 04.11.22 11:16
Blinder Fleck
Nordwestbahnhof Biografie eines innenstadt nahen Bahnhofsareals
Verlag 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 5 04.11.22 11:16
Hachleitner Hieslmair Zinganel Falter
1872 1873 1874
1880 1881 1882 1883 1884
1890 1891 1892 1893 1894
1900 1901 1902 1903 1904
1910 1911 1912 1913 1914
1920 1921 1922 1923 1924
1930 1931 1932 1933 1934
1940 1941 1942 1943 1944
1950 1951 1952 1953 1954
1960 1961 1962 1963 1964
1970 1971 1972 1973 1974
1980 1981 1982 1983 1984
1990 1991 1992 1993 1994
2020
2012 2022
2013 2014 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 6 04.11.22 11:16
2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021
1875 1876 1877 1878 1879
1885 1886 1887 1888 1889
1895 1896 1897 1898 1899
1905 1906 1907 1908 1909
1915 1916 1917 1918 1919
1925 1926 1927 1928 1929
1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979
1985 1986 1987 1988 1989
1995 1996 1997 1998 1999
2005 2006 2007 2008 2009
2015 2016 2017 2018 2019
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 7 04.11.22 11:16










8 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 8 04.11.22 11:16










9
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 9 04.11.22 11:17
Karl Karger, Ankunft eines Zuges am Nordwestbahnhof in Wien, Öl auf Leinwand, 91 x 171 cm, 1875; Kunsthistorisches Museum Wien
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 10 04.11.22 11:17
Infrastruktur und Stadt Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1872–1918: Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation .............................................. 52
1918–1938: Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr . . . . . 68
„Der ewige Jude“ - Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung .............................................. 98
1938–1945: Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg . . . . . 112
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co. 138
1945–2022: Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende . . . . . . 156
Excavations of Lost Memories. Künstlerische Ausgrabungsarbeiten am Wiener Nordwestbahnhof 188
Firmenindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Personenindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Unterstützer*innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
11 Inhalt
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 11 04.11.22 11:17
1 Überdeckte Kutschenvorfahrt vor dem prunkvollen Kassensaal 2 Laubengang zu den nach drei Klassen getrennten Wartezonen
Gastgarten des Restaurants
Hofsalon für die ankommende Aristokratie




















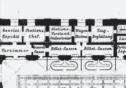







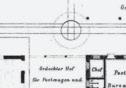
Empfangshalle und Gepäckabholung





Standplatz für Kutschen

12
Abfahrtsseite / Ankunftsseite
5
7
1
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 12 04.11.22 11:17
3
4
6
Verwaltungstrakt
4
Das Personenabfertigungsgebäude des Nordwestbahnhofs, Grundriss Erdgeschoß; Zeichnung: Wilhelm S Bäumer, 1873; ÖNB Bildarchiv Austria

























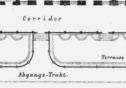









13 2 3
5 6 7
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 13 04.11.22 11:17












14 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 14 04.11.22 11:17












15
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 15 04.11.22 11:17
Ausfahrt aus der beschädigten Bahnhofshalle um 1950; Roland Peter Herold (Hg .), Die Österreichische Nordwestbahn, Erfurt 2009
Infrastruktur und Stadt Verdrängte Geschichte (n) eines
Bahnhofs 16 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 16 04.11.22 11:17
1
Der Wiener Nordwestbahnhof wurde am 1 . Juni 1872 als letzter der großen Kopfbahnhöfe in Wien errichtet, ursprünglich, um die nordböhmischen Industrieregionen mit Wien und in der Folge auch Wien mit Berlin und den Nordseehäfen zu verbinden . Zwar wurde der Personenverkehr bereits im Jahr 1959 endgültig eingestellt, im Gegensatz zu anderen Wiener Bahnhöfen konnte der Nordwestbahnhof seine Funktion als innenstadtnaher Umschlagplatz für den nationalen und transnationalen Güterverkehr aber bis zuletzt erhalten: Noch bis zum Jahresende 2016 wurden hier Überseecontainer umgeschlagen . Trotz seiner Funktion und Größe scheint der Bahnhof bei den Wiener*innen jedoch völlig in Vergessenheit geraten zu sein . Parallel zur jahrzehntelangen Abschottung als Güterbahnhof wurden sowohl Innovationen im Speditionswesen als auch bedeutende historische Ereignisse am Areal in den Hintergrund gedrängt . Erst in den allerletzten Jahren des Umbruchs, mit dem Herannahen des Ablaufdatums, öffnete sich das Areal langsam seiner Nachbar schaft . Das Wissen über seine Geschichte(n) blieb – bis auf die Initiative des Museums Nordwestbahnhof – aber weiterhin weitgehend verborgen . Insgesamt stand der Nordwestbahnhof auch im Schatten des nahegelegenen, größeren und im Stadtbild präsenteren Nord bahnhofs, bisweilen wird er auch mit diesem verwechselt . Ausgerechnet 2022, im Jubiläumsjahr seines 150-jährigen Bestandes, hat der Nordwestbahnhof seine endgültige Stilllegung erfahren und wird in naher Zukunft einem neuen Stadtentwick lungsgebiet mit rund 15 .000 neuen Bewohner*innen und etwa 5 .000 Arbeitsplätzen weichen müssen .
Aus den Augen – aus dem Sinn
Die für den Metabolismus der Stadt essenzielle Ver- und Entsorgungsinfrastruktur scheint von einer generellen Amnesie betroffen zu sein: Kraftwerke, Wasser- und Kläranlagen, Logistikzentren und Verkehrsinfrastrukturen, die nicht dem Personenverkehr dienen, sind weitgehend verdrängte Orte, die isoliert von der Gesellschaft, die sie versorgen, erscheinen . Die großen, prächtigen Bahnhofshallen des 19 . Jahrhunderts wurden in stadtgeschichtlichen Aufzeichnungen als „Kathedralen des Fortschritts, Tore zur Stadt und zur Welt […], Orte der Ankunft und der Abfahrt“ gefeiert . 1 Dagegen fanden die
.2006−25 .2 .
17
Infrastruktur und Stadt. Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 17 04.11.22 11:17
Wolfgang Kos, Wien Museum (Hg ), Großer Bahnhof. Wien und die weite Welt (Ausstellungskatalog, Wien Museum, 28 .9
2007), Wien: Czernin Verlag, 2007 . Mit diesen Worten wurde die Presseaussendung für Ausstellung und Katalog eröffnet, die den Güterverkehr weitgehend ausgeblendet hatte
vielen Bahngleise, Laderampen und standardisierten Lagerhallen für den Umschlag von Gütern in deren unmittelbarer Nachbarschaft überraschend wenig Aufmerksamkeit – trotz des in der Regel viel größeren Flächenverbrauchs an Stadtraum und des enormen Umfanges an Rohstoffen und Waren, die in den rasant anwachsenden Städten so dringend benötigt oder die in den Industrie- und Gewerbebetrieben der Städte produziert und über die Güterbahnhöfe ausgeliefert wurden . 2 Ähnlich frappant ist die Diskrepanz bezüglich der Faszination für das Gewimmel an illustren Passagier*innen in den Bahnhofshallen und dem Desinteresse für die Arbeitsbedingungen der unzähligen Eisenbahn- und Lagerarbeiter*innen oder Fuhr werker, die unter beschämenden Bedingungen ihr Brot verdienten . Dieses Missverhältnis ist auch heute nicht anders – und trifft insbesondere auch auf den Wiener Nordwestbahnhof zu . Angesichts des blinden Flecks, den das Areal des Bahnhofs in der Stadtwahrneh mung darstellte, sind auch die Ereignisse auf seinem Areal während des Nationalsozialismus – Propagandaveranstaltungen, „Arisierun gen“ und Zwangsarbeit – in den Hintergrund getreten . 3
Als sich die Städte weiter ausdehnten, wurden auch die an der Peripherie errichteten Bahnhofsareale sukzessive vom neuen Stadtgewebe eingeschlossen und die potenzielle Erweiterung der Logistikareale eingeschränkt . Viele vormalige Logistikareale wurden zu Büro- oder Wohnflächen oder Mixed-Use-Developments umgewidmet, restrukturiert und gentrifiziert, während neue große Logistikknoten weit außerhalb der Städte nahe der Kreuzungen der wichtigsten Verkehrskorridore errichtet wurden, die heute zwischen den traditionellen metropolitanen Regionen ein eigenes Netzwerk aus „post-urbanen“ Logistik-Archipelen bilden . 4
Der Wiener Nordwestbahnhof war einer dieser letzten innen stadtnahen Logistikknoten . Seit seiner Errichtung wurde der Standort des Bahnhofs – unmittelbar neben dem größeren Nordbahnhof – mehrmals infrage gestellt . In Stadtentwicklungskonzepten taucht er meist als Störfaktor auf, der eine gedeihliche Entwicklung des 20 . Bezirks erschwerte . Tatsächlich entwickelte sich um den Bahnhof ein Ökosystem von Betrieben, die vom Schienenanschluss profitierten oder dem Bahnbetrieb zuarbeiteten . Der Lebensqualität
2 Eine Ausnahme bilden Festschriften im Eigenverlag von Bahngesellschaften und Logistikunternehmen: Öster reichische Bundesbahnen (Hg ), 125 Jahre Bahnhof Wien Nordwest, Wien 1997; Schenker & Co AG (Hg ), 125 Jahre Schenker. 1872–1997, Wien 1997
3 Vgl . Traude Kogoj (Hg .), Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938–1945 (Ausstellungs katalog, Wien, 11 6 −31 10 2012, kuratiert von Mimi Segal), Wien: ÖBB, 2012
4 Regina Bittner, Wilfried Hackenbroich, Kai Vöckle (Hg ), Transiträume = Transit Spaces (Edition Bauhaus, Bd 19), Berlin: Jovis Verlag, 2006; Susanne Hauser, „Die Ästhetik der Agglomeration“, in: MAP Markus Ambach Projekte et al . (Hg .), B1A40: The Beauty of the Grand Road, Berlin: Jovis Verlag, 2010, S . 202–213 .
18 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 18 04.11.22 11:17
der Bewohner*innen der umliegenden Gebiete waren die Barrierewirkung der Bahnanlagen, Lärm und Luftverschmutzung – zuerst durch Dampflokomotiven, später vor allem durch Lkw – allerdings nicht zuträglich . Trotzdem: Entgegen den urbanistischen, ökonomischen und verkehrsplanerischen Trends der jeweiligen Epochen zeigte der Nordwestbahnhof eine hartnäckige Resilienz . Immer, wenn er für gänzlich obsolet erklärt wurde oder der Stadtentwicklung im Wege stand, sollte ihn ein „Zufall“ am Leben erhalten . Das mag darin begründet sein, dass der Güterverkehr auf der Schiene von staatlichen Monopolunternehmen kontrolliert wurde, die lange wenig Interesse für die Verwertung der eigenen Grundstücke aufbrachten . Zudem sorgten die bis zur Ostöffnung bestehende Randlage Wiens und das damit verbundene Schrumpfen der Stadt für einen niedrigen Verwertungsdruck . Zur Widerständigkeit trägt die große Menge des in Eisenbahn- und Umschlaglogistik investierten „gebundenen Kapitals“ ebenso bei wie die gut eingespielten –für Bewohner*innen der unmittelbaren Umgebung aber störenden –Anschlüsse an Netzwerke anderer Verkehrsmodi (wie dem LkwVerkehr) . Deshalb ist kaum einer der großen innerstädtischen Güterterminals abrupt geschlossen worden . Stattdessen wurden das urbane Umfeld, die technische Infrastruktur, die Strukturen der vor Ort tätigen Unternehmen und der Arbeitsalltag der hier tätigen Akteur*innen einem mehrstufigen Wandel unterzogen . Für diese Menschengruppe – die „soziale Infrastruktur“ 5 zur Versorgung der Stadt – stellt der Nordwestbahnhof keineswegs einen geschichtslosen, unpersönlichen Nicht-Ort, wie ihn Marc Augé definiert hat,6 dar: Für hier zuliefernde Lkw-Fahrer*innen, parkende Busfahrer*innen, Lagerangestellte und Unternehmer*innen ist der Bahnhof durchaus mit Geschichte und Geschichten, Bedeutung und Erinnerungen aufgeladen .
Resilienter Ort der Güterlogistik mit Nischennutzungen
Auch wenn die Logistikinfrastrukturen seit vielen Jahrzehnten weltweit standardisiert scheinen, sieht die Anthropologin Anna Tsing den aktuellen globalen „Supply-Chain-Kapitalismus“ nicht allein als Werkzeug der Homogenisierung, sondern vielmehr als Modell für
5
6
19
Infrastruktur und Stadt. Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs
AbdouMaliq Simone, „People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg“, in: Public Culture, Bd 16, Nr . 3, 2004, S 407–429 .
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 19 04.11.22 11:17
Vgl . Marc Augé, Nicht-Orte, München: C . H . Beck, 2019
das Verständnis der konstitutiven Vielfalt von Differenz (unter schiedliche Staatsformen, Wirtschaftssysteme, Märkte, Einkommensverhältnisse), durch die diese Mobilisierung von Kapital, Arbeit und Ressourcen im Netzwerk transnationaler Lieferketten erst vorangetrieben wird . 7 Durch Auslagerung von Tätigkeiten aus großen Unternehmen entsteht zudem auch ein Nischenkapitalismus an den unteren Rändern der Gesellschaft . Ein solcher kann sich aber auch von diesen unteren Ebenen ausgehend („Bottom-up“) entwickeln, insbesondere, wenn etablierte Systeme oder Netzwerke Störungen erfahren (wie beim Nordwestbahnhof beispielsweise während und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs) . Parallel zu den Logistiknetzwerken der großen mächtigen Global Player wuchert daher auch das Myzel (schein-)selbstständiger Unternehmer*innen, die das hohe Ausmaß an Selbstausbeutung durch den Stolz auf ihre vermeintliche unternehmerische Freiheit kompensieren . 8
Freilegung historischer Nutzungen
Gerade beim Nordwestbahnhof zeigt sich, dass der Bahnbetrieb und die mit ihm verbundene Güterlogistik – vor allem in Krisensituatio nen – auch zusätzliche andere Nutzungen zulässt . Frei werdende Flächen ermöglichen die angesprochenen Nutzungen durch ein Kleinunternehmer*innen-Prekariat . Es zeigen sich über die 150 Jahre unterschiedliche Formen und Rhythmen der Raumaneignung oder Raumproduktion, um mit Henri Lefebvre zu sprechen . 9
Die historische Analyse dieser sich teilweise wie ein Palimpsest überlagernden Schichten hat sich dieses Buch zur Aufgabe ge stellt . Raum steht dabei immer im Zusammenhang mit den jeweiligen ökonomischen Strukturen, politischen Rahmenbedingungen und den Menschen, die die gebaute Umwelt des Bahnhofs nutzen und dabei auch verändern . Das betrifft 150 Jahre Güterverkehr und 68 Jahre Personenverkehr, ergänzt von wechselnden Zwischen- und Neben nutzungen . Das Buch versteht sich demnach als Erinnerungsarbeit zum Wiener Nordwestbahnhof und seinen wesentlichen Bedeutungen: Einerseits als Knotenpunkt eines übergeordneten TransportNetzwerkes10 und dessen Wechselwirkungen mit der Stadt – und
7 Anna Tsing, „Supply Chains and the Human Condition“, in: Rethinking Marxism, Bd 21, Nr 2, April 2009, S 148–176
8 Anna Tsing, Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus, Berlin: Matthes & Seitz 2018
9 Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris: Editions Anthropos, 1974 [deutsch: Die Produktion des Raums, Leipzig: Spectormag, 2020]; ders , Rhythmanalysis: Space, Time, and Everyday Life, London: Bloomsbury, 2013
10 Zur Route der Bahnlinie siehe: Werner Prokop, Kreativwerkstatt HLW Hollabrunn (Hg ), 150 Jahre Nordwest bahn, Wien: Railway-Media-Group, 2022 .
20 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 20 04.11.22 11:17
Infrastruktur und Stadt. Verdrängte Geschichte(n) eines Bahnhofs
andererseits als Mikrokosmos sich wandelnder Arbeits- und Lebens räume für eine Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Herkunft .
In vier chronologischen Kapiteln und vier thematischen Essays werden unterschiedliche verdrängte Schichten, bauliche Transformationen und soziale Überformungen „freigelegt“: Von den Fischpopulationen, die in den 1860er-Jahren während der Aufschüttungen der Donauregulierung und des Bahnhofsbaus dem Industrialisierungsschub und der Spekulation zum Opfer fielen, über die Zwischennutzungen der Zwischenkriegszeit, zu denen auch die NS-Propagandaausstellung „Der ewige Jude“ von 1938 zählt, führt der Bogen zu „Arisierungen“, Kriegsmaschinerie und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, zu sowjetischer Besatzung und Wiederauf bau, den Boom-Jahren während des Kalten Krieges bis hin zum aktuellen schrittweisen Rückbau . Das Buch schließt mit dem Museum Nordwestbahnhof, unserem eigenen Engagement, das auch als Legitimation und Ausgangspunkt einer leisen, mittelfristig angelegten Raumaneignung dient, die im Idealfall über die Abbruch- und Bau phase hinaus Bestand hat .
21
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 21 04.11.22 11:17
22 70m 22m 1500m 740m 380m 150m 100m 2020 Nach Stilllegung des Containerverkehrs 1924 Nach Einstellung des Personenverkehrs 1924 Nach Einstellung des Personenverkehrs 1 Halle Personenbahnhof 2 Bahnhofspost 3 Lokschuppen und Werkstätten 4 Lagerstätten für Kohle 5 Wasserturm 6 Umschlaghalle Schenker & Co . 7 Hallen mit offener Umladebühne 8 Nordsee und Bananenhalle Stromstraße Hellwagstraße Taborstraße Nordwestbahnstraße 4 1 2 3 4 5 6 7 8
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 22 04.11.22 11:17
Schwarzpläne der Bauten am Nordwestbahnhof im Wandel der Zeit; Zeichnung: Michael Hieslmair und Michael Zinganel
23 70m 22m 1500m 410m 740m 440m 380m 150m 100m 2020 Nach Stilllegung des Containerverkehrs Personenverkehrs 2020 Nach Stilllegung des Containerverkehrs 1 Wohnhochhäuser der BWS 2 Ehemaliger Konsumgroßmarkt (KGM) 3 Ehemaliges Postgebäude 4 Museum Nordwestbahnhof, ÖBB-Infoausstellung, MA 21 Stadtraum II 5 Leitstelle Kraftwagendienst ÖBB (stillgelegt) 6 Lagerhallen DB-Schenker 7 Stückguthalle der ÖBB EC-Logistik GmbH Stromstraße Hellwagstraße Taborstraße Nordwestbahnstraße 1 2 3 4 5 6 7 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 23 04.11.22 11:17
2020 1880 1881 1882 1883 1884 1890 1891 1892 1893 1894 1900 1901 1902 1903 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1920 1921 1922 1923 1924 1930 1931 1932 1933 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1950 1951 1952 1953 1954 1960 1961 1962 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021 2012 2022 2013 2014 1872 1873 1874 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 24 04.11.22 11:17
1885 1886 1887 1888 1889 1895 1896 1897 1898 1899 1905 1906 1907 1908 1909 1915 1916 1917 1918 1919 1925 1926 1927 1928 1929 1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 1875 1876 1877 1878 1879 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 25 04.11.22 11:17
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
1872–1918:
26 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 26 04.11.22 11:17
Das Personenabfertigungsgebäude des Nordwestbahnhofs an der Ecke Taborstraße und Nordwestbahnstraße; oben: Gesamtansicht über Eck, ganz links die polygonale Unterfahrt für Kutschen vor dem Vestibül und der Kassenhalle; unten: Schnitt mit Blick auf den Leopoldsberg; Zeichnung: Wilhelm S Bäumer, 1873, ÖNB Bildarchiv Austria


27
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 27 04.11.22 11:17
„Wenn man durch die prachtvolle östliche Kastanienallee des k. k. Augartens dem Ausgange zuschreitet, so erblickt man schon von ferne eine mit Giebel statuen geschmückte, im halben Zehneck angelegte hochragende Säulenhalle, und beim Heraustreten aus dem Garten selbst zeigt sich dem überraschten Be schauer ein im Renaissancestil gehaltener Bau – der Wiener Nordwestbahn hof. Da wo vor nicht allzu langer Zeit eine Ablagerungsstätte für Schutt und Dünger die Umgebung mit mephitischen Dünsten verpestete, erhebt sich jetzt in erhabener Größe die Riesenhalle.“
Über Land und Meer, 1874 1
Das Bahnhofsgebäude
Als Letzter der großen Kopfbahnhöfe Wiens errichtet, bildete der Nord westbahnhof den repräsentativen Abschluss des Streckennetzes der Öster reichischen Nordwestbahn (ÖNWB) in Wien . An die Personenhalle war zum Tabor hin das Verwaltungsgebäude mit dem Sitz der Generaldirektion dieser Bahngesellschaft angeschlossen . Die Bahnlinie wurde unter der Lei tung von Baudirektor Wilhelm Hellwag gebaut, der aus Schleswig-Holstein stammte und sich zuvor in der Schweiz und im westösterreichischen Raum als Eisenbahningenieur einen guten Ruf erworben hatte . Für die Planung des prestigeträchtigen Kopfbahnhofsgebäudes ließ die Direktion der Nord westbahn von der hauseigenen Baudirektion ein Programm ausarbeiten . Auf dieser Basis beauftragte sie im Sommer 1869 den Stuttgarter Architek turprofessor Wilhelm S Bäumer, „ein Projekt für den Bau eines Personen bahnhofes für die Nordwestbahn in Wien zu verfassen“ . 2 Die Bauleitung hatte – wie schon bei anderen Bauten der Nordwestbahn – Wilhelm Reuter inne . Bäumers Entwurf für das Gebäude des Personenbahnhofs orientierte sich stilistisch an italienischen Renaissance-Palazzi . Die Erschließung für die Passagier*innen sollte jedoch nicht über das mächtige Portalgebäude an der Taborstraße erfolgen, das auf mehreren Geschoßen die Verwaltung, inklusive Generaldirektion, beherbergte, sondern über die langen Seiten schiffe parallel zur Halle . Abfahrende Passagier*innen betraten den Bahnhof von der Nord westbahnstraße genau gegenüber dem Zugang zum Augarten . Hier wurden
1 „Der Nordwestbahnhof in Wien“, in: Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung, Nr 36, 1874, S 712
2 W Bäumer, „Der Nordwestbahnhof in Wien“, in: Allgemeine Bauzeitung, 38 Jg , 1873, S 8–32, hier 8 . Bäumer liefert hier eine detaillierte Beschreibung des Gebäudes inkl . Planmaterial .
28 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 28 04.11.22 11:17
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
die Reisenden von einer großräumigen, halbrunden, von Säulen gerahmten Vorhalle empfangen, in der Kutschen witterungsgeschützt entladen werden konnten . Am Gesims dieser Halle war eine Reihe allegorischer Figuren pos tiert, die jene Städte repräsentierten, die die Nordwestbahn nun mit Wien verband: Dresden, Leipzig, Breslau, Berlin, Hamburg und Bremen . Dahin ter schloss sich ein prunkvoller Kassensaal an, von dem eine Art verglaster Laubengang zu den streng nach den drei Klassen getrennten Wartezonen führte . Zwischen den Warteräumen befand sich auch ein Restaurant mit einem bepflanzten Gastgarten an der Nordwestbahnstraße, das von einer Großküche im Keller beliefert wurde . Das Gebäude war innen durch kas settierte Decken, Wandmalereien, Tapeten und Pilaster, die Ansichten der Städte entlang der Nordwestbahn zum Gegenstand hatten, sowie durch exquisite Beleuchtungskörper elegant ausgestattet, insbesondere der War tesalon der 1 . Klasse und der Hofsalon auf der Ankunftsseite .
Güterverkehr als Motor
Das repräsentative Personengebäude gegenüber dem Augarten bestimmte zwar das öffentliche Bild des Nordwestbahnhofs, der weitaus größere Teil der Fläche des zwischen Augarten und Donau liegenden Bahnhofsgelän des diente allerdings dem Güterverkehr, der zudem umsatzstärker als der Personenverkehr war . Wie bei den meisten anderen größeren Bahnlinien bildete auch bei der Nordwestbahn der Gütertransport die grundlegende Motivation für ihren Bau . Der Ursprung der Nordwestbahn ist auch nicht in Wien zu finden, sondern in Böhmen . Hier entstand mit der 1856 ge gründeten Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn (SNDVB) die Keimzel le der späteren ÖNWB An der Spitze des SNDVB-Konsortiums stand der Textilunternehmer Johann Liebieg . 3 Das Streckennetz der SNDVB diente vor allem der Erschließung des „industriereichen Gebiets um Reichenberg [Liberec] und Josefstadt [Josefov], vor allem der Kohlengruben von Schwa dowitz [Malé Svatoňovice]“ . 4 Denn für die Industrie- und Kohlengruben in Nordost- und Mittelböhmen war die großräumige Anbindung nicht zufrie denstellend gelöst, trotz Kaiser-Franz-Josefs-Bahn (KFJB) und Staatseisen bahn-Gesellschaft (StEG) wurde für den Transport nach Wien häufig noch die alte Reichsstraße genutzt . Die Fuhrwerke benötigten nicht wesentlich mehr Zeit als die Züge, denn ein jahrelanger Tarifstreit zwischen den bei den großen Bahnunternehmen bremste den Gütertransport erheblich . Das
3 Radio Prague International, „Textilbarone aus Reichenberg – die Unternehmerfamilie Liebieg“, https://deutsch radio cz/textilbarone-aus-reichenberg-die-unternehmerfamilie-liebieg-8697297 (23 8 2022)
4 Alfred Horn, Die Österreichische Nordwestbahn, Wien/Heidelberg:
Verlag, 1967, S . 4 .
29
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 29 04.11.22 11:17
Bohmann
sollte sich durch eine neue Bahnlinie ändern: „Besonders die großen Zu ckerfabriken in der Gegend von Caslau [Čáslav], Dobrowitz [Dobrovice], Jungbunzlau [Mladá Boleslav] und Jičín erwarteten sich durch die Bahn eine billige Transportmöglichkeit für die großen Kohlenmengen, die sie für ihre Tätigkeit brauchten . Andererseits hofften auch die Betreiber der Koh lengruben auf die Erschließung neuer Absatzmärkte bis ins Wiener Indust riegebiet, wurde durch die neue Bahn doch der nächste Weg zu den reichhal tigen Lagerstätten in Niederschlesien (Waldenburg [Wałbrzych]), Schatzlar [Žacléř], Lampersdorf [Grodziszcze] und Schwadowitz [Svatoňice], aber auch zu Lagerstätten im Kladnoer und Aussiger [Ústí nad Labem] Bereich hergestellt “ 5 Da Kohle in diesem Zeitraum zum wichtigsten Energieträger wurde, erlebte der Bergbau einen gewaltigen Aufschwung . Als weitere Ab nehmer *innen waren die Zucker- und Glasindustrie sowie die Eisenwer ke, die nun praktisch keine Holzkohle mehr verwendeten, von Bedeutung . 6
Spekulativer Liberalismus mit Staatsgarantie
Die Initiative zum Bau der Nordwestbahn ging also von ehrgeizigen Ak teur*innen an der Peripherie des Reiches aus, in diesem Fall von einem Konsortium an Unternehmen, die in Nordböhmen investierten und nun über die neue Bahnlinie eine Verbindung zur Hauptstadt des Kaiserrei ches suchten, um Wien als zusätzlichen Absatzmarkt für ihre Güter zu erschließen . Die Entwicklung der Nordwestbahn und des Nordwestbahnhofs kann nicht losgelöst von den sich radikal verändernden wirtschaftspoliti schen Rahmenbedingungen, den Konzentrationsprozessen des Kohlezeit alters und den parallel zu ihrer Errichtung entstehenden Großprojekten gesehen werden Die 1870er-Jahre waren auch in Österreich eine Phase des Liberalismus, dem erst die gescheiterten militärischen Abenteuer des Kaiserhauses zu seinem verspäteten Durchbruch verhalfen: Die Nieder lagen gegen Sardinien (1859, Solferino) und Preußen (1866, Königgrätz) brachten das Kaiserhaus in so schwere ökonomische und politische Be drängnis, dass es 1859 die Aufhebung der Zünfte und die vollständige Frei gabe aller Gewerbe zulassen und in der neuen Verfassung von 1867 die Gleichheit aller Staatsbürger*innen vor dem Gesetz und die Gleichberech tigung „aller Volksstämme“ garantieren musste . Darüber hinaus konnten nun jede Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger „an jedem Orte des Staats gebietes seinen Aufenthalt und Wohnbesitz nehmen, Liegenschaften jeder Art erwerben und über dieselben frei verfügen, und unter den gesetzlichen
5 Horn, Nordwestbahn, S 6
6
„Bergbau
30 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 30 04.11.22 11:17
Vgl Karl M Brousek, Gustav Otruba,
und Industrie Böhmens im Zeitalter des Neoabsolu tismus und Liberalismus 1848−1875“ (1 . Teil), in: Bohemia, Bd . 23, H 1, 1982, S . 51–91 .
Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben“,7 eine wichtige Veränderung für die wirtschaftliche Entwicklung . Wirtschaftlich gesehen waren die Jahre von 1867 bis 1873 − die sogenannten Gründerjahre − eine Zeit hektischer Entwicklung auf einer nicht immer soliden Grundlage . Charakteristisch für diese Epoche sind die zahlreichen, oft auf Aktienbasis vorgenommenen Neugründungen, wobei die erhöhte Finanzkraft der beteiligten Banken einen verstärkten Einsatz von Dampfmaschinen und modernen Technologien gestattete . Die Vergrö ßerung der Betriebe und deren Ausstattung mit kostspieligen technischen Einrichtungen führten zu einem Konzentrationsprozess, bei dem kleine Betriebe nicht mithalten konnten Die Eisenbahnen standen im Zentrum dieses Geflechts von technischem Fortschritt, durch Kohle gestillten Ener giehunger und spekulativem Kapitalismus gepaart mit staatlicher Patro nage . Denn der Staat gewährte ab 1866 für den Ausbau bestimmter Rou ten Zinsgarantien – wie auch für das Stammnetz der Nordwestbahn . Fiel der Ertrag der Bahngesellschaft geringer aus als der den Aktionär*innen „garantierte Zinsfuß“, übernahm der Staat die Differenz . 8 Bei der Nord westbahn spielte, wie erwähnt, die böhmische Zuckerindustrie, die hinter dem Konsortium der SNDVB stand, eine zentrale Rolle, für die Verlänge rung der Strecke nach Wien waren allerdings Kooperationspartner*innen notwendig . Am 8 . September 1868 erhielt das um Hugo Fürst Thurn und Taxis, Franz Altgraf zu Salm-Reifferscheidt, Louis Haber von Linsberg und Friedrich Schwarz erweiterte Konsortium der SNDVB die Konzession für den Bau und Betrieb der Hauptstrecke Wien–Znaim–Iglau–Deutschbrod–Kolin–Jungbunzlau und mehrere Flügelbahnen . 9 Dass Vertreter großer Adelshäuser hier prominent vertreten waren, ist kein Zufall, ebenso we nig wie die Rolle Johann Adolf Fürst zu Schwarzenbergs bei der KaiserFranz-Josefs-Bahn . Die durch die Auflösung der Grundherrschaft 1848 in die Hände des Adels gelangten Ablösesummen führten in erhöhtem Maße zur anonymen Geldanlage − zur Neugründung großer Bankinstitute und auch von Aktiengesellschaften . Bei der Nordwestbahn nahmen die Thurn und Taxis eine besondere Rolle ein: Mit einem Teil der Abfindung für die 1867 zu Ende gehenden Postprivilegien investierte das Adelshaus in Nord böhmen, insbesondere in Zuckerfabriken, und wurde zum Hauptaktionär der Nordwestbahn . 10 In deren Firmenimperium und diversen industriellen Interessenvertretungen nahm Friedrich Schwarz eine führende Position ein . Salm-Reifferscheidt hatte ebenfalls in die Zuckerindustrie und andere
7 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1867, LXI . Stück, Ausgegeben und versendet am 22 December 1867: Staatsgrundgesetz vom 21 December 1867, S 395
8 Vgl Horn, Nordwestbahn, S 3
9 Vgl ebd , S 7
10 Vgl Franz Fiedler, Postzwang und Postpflicht, München/Berlin: Oldenburg, 1907, S . 16 .
31
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 31 04.11.22 11:17
Nordwestbahn Nordbahn
Kolberg Bremerhaven (Nordenham)
Berlin
Görlitz Tetschen Dresden
Jungblunzau
Prag
Krakau Iglau
Diagramm des Liniennetzes der Nordwestbahn und ihrer Vorläufergesellschaft mit aktuellem Grenzverlauf; Zeichnung: Michael Hieslmair und Michael Zinganel
Köslin Kiel Hamburg 0 250 km 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 32 04.11.22 11:17
32
Reichenau Brünn Wien
Industriezweige in Nordböhmen investiert, ebenso wie der aus Karlsruhe stammende jüdische Industrielle und Bankier Louis Haber von Linsberg, der den „Centralverein für Rübenzucker-Industrie in der Österreichisch-Unga rischen Monarchie“ mitbegründete . Investitionen in eine Bahnlinie waren besonders attraktiv: Sie verbesserten die Versorgungs- und Absatzsituation der eigenen Betriebe und brachten zusätzliche Einnahmen aus dem Trans port . Neben der SNDVB und mit ihren vereinigten Konzessionswerbern strebte die StEG, die bereits ein umfangreiches Netz in Österreich-Ungarn betrieb, die Konzession an . Ihr Hauptbahnhof in Wien war der Ostbahnhof, auch Staatsbahnhof genannt . Trotz ihres Namens handelte es sich bei der StEG um eine private Gesellschaft mit französischer Aktienmehrheit Um eine Dominanz dieser „französischen“ Gesellschaft zu vermeiden, beschloss der Reichsrat 1868, den Bau einer Bahn von Wien nach Znaim – parallel zur bestehenden StEG-Strecke – und einen eigenen Endbahnhof in Wien zu for dern . 11 Damit verlor das Projekt für die StEG an wirtschaftlicher Sinnhaf tigkeit, weil sie ihre eigene Strecke und den Ostbahnhof für die neue Linie mitverwenden hätte wollen . Der Nordwestbahnhof verdankt seine Entste hung also einer Mischung aus Liberalismus (Konzessionen an Bahnlinien wurden an private Konsortien vergeben) und regionalpolitisch-nationalen Überlegungen und Machtverhältnissen . Statt der „französischen“ StEG kam das „deutsche“, erweiterte SNDVB-Konsortium zum Zug . Dadurch entstand auch ein von der StEG unabhängiger Anschluss an die Linien der Südbahn und den Handelskai, womit Anschlüsse an Süd- und Osteuropa und durch den Hafen von Triest auch darüber hinaus geschaffen wurden .
Am 27 . Oktober 1868 erfolgte die „auf zwei Tage anberaumte Subscription auf die Aktien der österr . Nordwestbahn“, ein Unternehmen, „für welches die Creditanstalt die Capitalbeschaffung übernommen hat“,12 schrieb die Wiener Geschäftszeitung, die rosige Zeiten für Aktionär*innen ankündigte: Der Emissionskurs sei „in Anbetracht der sicheren und rentab len Capitalsanlage, welche die neuen Aktien bieten, ein so niedriger, daß die Beteiligung des Publikums voraussichtlich eine sehr bedeutende sein wird“ . 13 Die Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, von Anselm Roth schild mit den böhmischen Adeligen Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg, Vincenz Karl Fürst von Auersperg, Max Egon Fürst zu Fürstenberg und Otto Graf von Chotek und weiteren Partnern gegründet, spielte auch bei der von Schwarzenberg initiierten Kaiser-Franz-Josefs-Bahn und der von Rothschild gegründeten Nordbahn eine zentrale Rolle . 11 Vgl Horn, Nordwestbahn, S 7 12 „Notizen“, in: Wiener Geschäftszeitung, 26 10 1868, [S 1] 13 Ebd .
33
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 33 04.11.22 11:17
Beim Bau der Nordwestbahnstrecke, der am 26 . November 1869 begann, waren bis zu 40 .000 Arbeiter*innen beschäftigt . Das hügelige Ge lände machte eine kurvenreiche Streckenführung notwendig, die nur gerin ge Fahrgeschwindigkeiten zuließ . Am 1 . November 1871 wurde die Strecke zwischen Znaim und Jedlesee eröffnet (der bereits bestehende Abschnitt von Stockerau bis Jedlesee wurde von der Nordbahn erworben), damit fehl te nur mehr die Donauquerung . Für den Bau der Brücke mussten noch die Donauregulierungsarbeiten14 abgewartet und ein beschädigter Brücken pfeiler neu errichtet werden . Somit konnte die Eröffnung der Strecke über die Donau erst am 1 . Juni 1872 erfolgen, obwohl das Bahnhofsgebäude, bis auf Arbeiten an den Dekorationen, schon am 1 Jänner 1872 nach nur 16-monatiger Bauzeit fertiggestellt worden war .
Im Fremden-Blatt war – wie in anderen Zeitungen – anlässlich der Eröffnung nur eine kleine Notiz zu finden: „(Oesterreichische Nordwest bahn .) Da mit der heute stattfindenden Eröffnung des Wiener Bahnhofes dieser Transportunternehmung auch gleichzeitig der Verkehr der Eilzüge nach Dresden und Berlin beginnt, so dürfte es in weiteren Kreisen interes siren, das Resultat der am 29 . Mai stattgehabten technisch-polizeilichen Prüfung des Bahnhofes und der Strecke Wien-Jedlersee [sic] kennen zu lernen . Dasselbe ist ein derartiges, daß man der Benützung der erwähnten Bahnlinie mit vollster Beruhigung entgegensehen kann, denn der Bericht der Kommission hebt es besonders hervor, daß die äußerst solide und zweckentsprechende Ausführung der fraglichen Bahnstrecke in jeder Beziehung die vollste Anerkennung verdiene, und daß insbesondere der Wiener Bahn hof und die Donaubrücke in Bezug auf Anordnung und Ausführung als be sonders gelungene und allen Anforderungen entsprechende Bauobjekte be zeichnet werden müssen “ 15 Damit öffnete sich die Nahverkehrsverbindung nach Stockerau, aber auch der prestigeträchtigere Fernverkehr nahm den Betrieb auf . Täglich fuhr ein „Courierzug zwischen Wien und Berlin über Kolin-Reichenberg ohne Wagenwechsel“ . 16 Die Fahrzeit betrug 19 Stunden . Der Güterverkehr wurde einen Monat später aufgenommen . Gut drei Monate später, am 12 . September 1872, war der Bahnhof jedenfalls festlich geschmückt, Kaiser Franz Joseph kehrte aus Berlin vom Drei-Kaiser-Treffen mit dem deutschen Kaiser Wilhelm I . und dem russi schen Zar Alexander II . aus Berlin zurück . Bei der Weltausstellung von 1873 diente der Nordwestbahnhof auch als Ankunftsort für den prestigeträchti gen Besuch des deutschen Kaisers und seine Entourage .
14 Siehe: dieses Kapitel, S 53–56
15 „Österreichische Nordwestbahn“, in: Fremden-Blatt, 1 6 1872, S 10
16 Inserat der Österreichischen Nordwestbahn, in: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 4 6 .1872, [S . 9] .
34 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 34 04.11.22 11:17
Der Nordwestbahnhof und die (verzögerte) Entwicklung der „Donaustadt“
Die Errichtung des Nordwestbahnhofs lässt sich als Teil eines weitreichen den Stadtentwicklungsprojektes im Zuge der Donauregulierung lesen: Wei te Teile des 2 . und 20 . Bezirks wurden bei der Donauregulierung zwischen 1870 und 1875 durch massive Aufschüttungen trockengelegt, um aus einer mäandernden Flusslandschaft sicheres Bauland zu schaffen: für den Nord westbahnhof, den wesentlich erweiterten Nordbahnhof und einen neuen Stadtteil – die „Donaustadt“ . Zudem sollte die Donauregulierung zukünf tige Überschwemmungen verhindern und ein tiefes mit Dampfschiffen be fahrbares Flussbett und eine solide Uferbefestigung für neue Hafenanla gen schaffen . „Wesentlich ausgedehnter als die etwa zeitgleich entstandene Ringstraße, ja selbst als das barocke Achsensystem von Schönbrunn, stellt die ‚Donaustadt‘ bis heute das größte einheitlich konzipierte Stadtentwick lungsgebiet Wiens dar“, beschreiben Gertrud Haidvogl und Friedrich Hauer die Dimensionen . 17 Auf dem Gebiet des späteren Nordwestbahnhofs be gannen die Vorarbeiten 1868 mit der Trockenlegung des hier verlaufenden Donauarmes und einer Aufschüttung des Geländes um bis zu vier Meter, um die Bahnanlagen vor Hochwasser zu schützen . „Das erforderte rund 1,5 Millionen Raummeter Erde, welche von einer Berglehne bei Heiligen stadt auf einer eigenen Materialbahn mit Brücke über den Donaukanal, durch die Spittelau und Wolfsau, 30 Monate hindurch von 4 Lokomotiven und 100 Waggons herangeschafft wurde .“ 18
Eine im Auftrag des Bürgermeisters Cajetan Felder 1871 erstellte Karte zeigt eine Wunschvorstellung, wie sie 1874 dem Gemeinderat vor gelegt wurde: eine Überlagerung der vormaligen Donauarme mit dem neu gewonnenen Bauland, den wichtigen Verkehrsinfrastrukturprojekten und dem Weltausstellungsgelände . Die rot markierten Parzellen zeigen das neue Bauland, das sich entlang der Donau von der Stadlauer Brücke bis zur Nord westbahnbrücke zieht . Im Bereich von Nord- und Nordwestbahnhof reicht die neue Fläche bis zu den Bahnanlagen . Mit dem Verkauf dieser Grundstü cke sollten die Kosten der Regulierung gedeckt werden . Eine Annahme, die sich aus mehreren Gründen als zu optimistisch erwies . Die zwei Bahnhofs projekte wurden zwar wie geplant fertiggestellt und die Weltausstellung 1873 eröffnet, wenn auch einige Teile des Geländes noch einer Baustelle glichen . Die Ausstellung stand allerdings unter keinem guten Stern: Am
17 Gertrud Haidvogl, Friedrich Hauer, „Die wachsende Stadtinsel“, in: Zentrum für Umweltgeschichte, Universität für Bodenkultur, Technische Universität Wien (Hg ), Wasser Stadt Wien. Eine Umwelt geschichte, Wien 2019, S 340
18 Horn, Nordwestbahn, S . 9−10 .
35
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 35 04.11.22 11:17

36 1 1 . Bezirk 2 Nordwestbahnhof 3 Nordbahnhof 4 Gelände Weltausstellung 1 2 3 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 36 04.11.22 11:17
In Rot markiert sind die durch die Donauregulierung gewonnenen neuen Parzellen zwischen den Verkehrsbauten, die mit Gewinn verkauft werden und damit den Großteil der Investitionskosten ehestmöglich einspielen sollten Quelle: Cajetan Felder, Die Gemeinde-Verwaltung der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in den Jahren 1871 bis 1873. Bericht des Bürgermeisters Cajetan Felder vorgelegt dem Gemeinderathe im November 1874, Wien: Verl . des Gemeinderathes, 1874, Abschnitt XIII , o . S . 4

37
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 37 04.11.22 11:17

















38 1872–1918
Aufgeschüttetes Bahngelände um 1872, Aufnahme von der Höhe des Hallendaches in Richtung Kahlenberg und Leopoldsberg; rechts im Bild der Donauarm „Kaiserwasser“; ÖNB Bildarchiv Austria
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 38 04.11.22 11:17
Weitgehend noch unbebautes nordwestliches Ende der Brigittenau, der „Brigittenauer Spitz“, mit Nordwestbahnbrücke (links) und Nordbahnbrücke (rechts), Luftaufnahme um 1920; WStLA, media wien, Historisches Fotoarchiv, Sign . FB 5814
9 . Mai 1873, wenige Tage nach der Eröffnung, platzte mit dem „Schwarzen Freitag“ der Wiener Börse die – auch durch die Weltausstellung und den Immobilienboom beförderte – Spekulationsblase der Gründerzeit . In den folgenden Wochen erreichte die Krise weltweite Ausmaße . Es folgte eine bis zum Ende des Jahrzehnts dauernde wirtschaftliche Stagnation . Der Ka pitalverlust und die stark anziehenden Kreditzinsen trafen die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung schwer: Die mit Aktienkapital ausgebauten Bahnlinien und Industriebetriebe, die die Bahnlinien für den Transport von Rohstoffen oder Fertigwaren nutzen sollten, aber auch die Aktionär*innen der Bahnen selbst . Daher entsprach auch das Wachstum des Güterverkehrs vorerst bei Weitem nicht den Erwartungen Für die Weltausstellung kam Anfang Juni der nächste Rückschlag: In Wien grassierte die Cholera, deren erste erfasste Fälle ausgerechnet im Weltausstellungshotel „Donau“ in der Nordbahnstraße auftraten . In der Folge verließen viele Besucher*innen fluchtartig die Stadt oder stornierten die Buchungen . Erst gegen Ende der Weltausstellung normalisierte sich die Buchungslage einigermaßen . Die anhaltende, allgemeine Wirtschaftskrise bildete einen zentralen Grund für die verzögerte Bebauung der Umgebung des Nordwestbahnhofs . Dass die Regulierungsgründe im „Wettbewerb mit anderen Stadterweite rungsgebieten außerhalb des Wirkungsbereichs der strengen städtischen Bauvorschriften und der hohen Verzehrungssteuer“ 19 standen, trug eben falls dazu bei . Als exklusives Wohnquartier funktionierte das Gebiet aus anderen Gründen nicht, so Haidvogl und Hauer: „Trotz gegenteiliger Archi tektenvisionen kam die Donaustadt als teures Wohngebiet oder für eine re präsentative ‚Waterfront‘ aufgrund der Kaianlagen nicht infrage .“ 20 Dazu kamen Auswirkungen der Bahnhöfe auf ihre Umgebung: Lärm und vor al lem der Ruß der Dampflokomotiven machten sie als Wohngebiet nur be dingt attraktiv, vor allem aber bildeten das Bahnhofsgelände und die Gleis anlagen eine massive Barriere in Richtung Stadt . Der Verkehrsplaner Anton Waldvogel sprach schon 1892 davon, den „ganz überflüssigen Nordwest bahnhof, der im Niveau der Straßen der Leopoldstadt liegt, eine enorme Länge und Ausdehnung besitzt und eine förmliche Absperrung der künf tigen Donaustadt gegen die Leopoldstadtseite zu bildet, vollständig aufzu lassen“ . 21 Es sei kein Problem, den Verkehr (auch den Güterverkehr) auf den Nordbahnhof und den Franz-Josefs-Bahnhof überzuleiten, wenn die Fläche intensiv genutzt werde, wie etwa das Beispiel des Londoner Bahnhofskom plexes Kings Cross zeigen würde . „Dem gegenüber besitzt der Nordwest
19 Haidvogel, Hauer, „Die wachsende Stadtinsel“, S . 342 .
20 Ebd
21 Anton Waldvogel, „Projects-Entwurf für die Ausgestaltung der Verkehrsanlagen im gesamten Gemeindegebiet von Wien“, in: Beilage zur Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, Nr 21, 1892, S . 1–18, hier 6 .
39
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 39 04.11.22 11:17
bahnhof einen Flächeninhalt von 500 .000 m2 und wird heute nach mehr als 20jährigem Bestand noch nicht einmal bis zur Hälfte für Eisenbahn zwecke benützt; ein großer Theil ist nur Weideplatz . Das kommt in einem Stadtterrain vor, wo die Quadratklafter im Mittel schon 60–70 fl kostet . Solche Verhältnisse sind nicht mehr zeitgemäß, umsomehr als der Bahnhof an einer Stelle steht, welche in der abträglichsten Weise die Entwicklung und den Anschluss der Donaustadt hindert . Die seinerzeitige Anlage dieses Bahnhofes im Niveau der Leopoldstadt ist ein längst erkannter Fehler .“ 22
Das Ökosystem Güterbahnhof
Um die Wende vom 19 . zum 20 . Jahrhundert wurden um den Augarten Wohnbauten errichtet, die zumindest auf der südwestlichen Seite den Bahn hof an den Stadtrand anschlossen . Die Nordostseite blieb trotz gewisser Im pulse durch die verbesserte Konjunktur noch länger zu einem großen Teil unbebaut . Bis auf vereinzelte Industriebauten, informelle Armenquartiere und Krankenanstalten tat sich wenig, selbst zum Ende der Monarchie war erst die Hälfte der Gründe verkauft . 23 Während der Nordwestbahnhof auf die Wohnbautätigkeit in sei ner Umgebung vorerst einen eher bremsenden Einfluss hatte, wirkte er sich in anderer Hinsicht belebend auf seine Umgebung aus: Kaffeehäuser, Ho tels, Ladengeschäfte und diverse Dienstleister wurden von den Reisenden frequentiert, besonders von den Fernreisenden . Beim Nordwestbahnhof betraf das vor allem den Bereich um das Personengebäude und die Tabor straße, die zur Innenstadt führt . Größer sind die Effekte des Güterverkehrs auf die Umgebung des Bahnhofs, der im Zentrum eines umfangreichen Ökosystems steht: Auf dem Areal des Bahnhofs und in seiner Umgebung siedeln sich Speditionen und andere Firmen – etwa aus dem Bereich der Metallverarbeitung und des Maschinenbaus – an, die einen direkten Bahn anschluss benötigen oder zumindest davon profitieren . Dazu kommen Zu liefer- und Servicebetriebe für den Bahnbetrieb . Einen Wachstumsschub für die Speditionsbranche brachten in den ersten Jahrzehnten des Nordwest bahnhofs auch die aufkommenden Groß-Kunstausstellungen und beson ders die Weltausstellungen: So konnte sich die noch junge auf Möbel- und Kunsttransporte spezialisierte Spedition E . Bäuml den riesigen und pres tigeträchtigen Auftrag sichern, für die Pariser Weltausstellung 1878 alle
22 Anton Waldvogel, „‚Ueber die Ausgestaltung der Verkehrsanlagen und die Schaffung von DonauHäfen für Wien‘, Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am 22 April 1893 von Ober-Ingenieur Anton Waldvogel“, in: Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, XLV Jg , Nr 12, 9 6 1893, S 325–334, hier 334
23 Vgl . Haidvogl, Hauer, „Die wachsende Stadtinsel“, S . 342 .
40 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 40 04.11.22 11:17
Güter der österreichischen Aussteller*innen zu transportieren . 24 E . Bäuml betrieb damals das Lager in der Dresdner Straße, in unmittelbarer Nähe des Nordwestbahnhofs (und nach 1918 das Lager III im Bahnhofsgelände) . Schenker & Co ., 1872 in Wien gegründet, profilierte sich mit dem Transport der deutschen Weltausstellungsgüter und wurde bald zu einer der größten Speditionen Europas . 25 Am Nordwestbahnhof hatte die Firma ihre Haupt magazine, die sie mehrmals erweiterte . Sie war auch in der Reederei-Bran che vertreten und konnte damit geschlossene Transportketten anbieten – auch für eine exotische Frucht: die Banane . Die Versorgung der Stadt lief über den Nordwestbahnhof . „Westindische Bananen enthalten alle Be standteile, die der Mensch zum Leben gebraucht“ und seien „eine Zierde jeder Tafel“ . 26 En gros erhältlich waren sie im Schenker-Magazin am Nord westbahnhof, wo 1912 ein eigenes Bananenlager eingerichtet wurde . Hier zeigt sich eine ganz wesentliche Funktion des Nordwestbahnhofs: Er war der Wiener Anschluss zu den deutschen Seehäfen Hamburg und Bremer haven . Dort wurden exotische Früchte, Kolonialwaren aller Art, darunter auch Kunstwerke indigener Kulturen, die von den Seehäfen mit der Bahn nach Wien verbracht wurden und in Wiener Sammlungen landeten, verla den Umgekehrt nutzten auch Auswandernde, die etwa aus dem Burgenland über Bremerhaven oder Hamburg nach Amerika emigrierten, den Nord westbahnhof als Tor zum Hafen .
Ein anderes Beispiel für eine am Ökosystem Güterbahnhof partizipierende Firma ist der Bahnsignalhersteller Götz & Söhne in der Nord westbahnstraße, aus dem sich der Nutzfahrzeughersteller Fross-Büssing entwickelte, der auch direkt auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs ein gemietet war . 27 Weitere metallverarbeitende Unternehmen und Maschi nenbaubetriebe siedelten sich in der Nachbarschaft des Bahnhofs an Fass binder und Sackmacher lieferten die benötigten Transportverpackungen . Kohle spielte am Nordwestbahnhof weniger eine Rolle als am Nordbahn hof, aber auch hier nahmen Kohlerutschen und Kohlelagerplätze einen be trächtlichen Teil des Bahnhofsareals ein . In deren Nachbarschaft siedelten sich Kohlehändler an, manche verkauften zusätzlich auch Holz als Brenn material . Über die Milchrampe wurden naheliegende Molkereibetriebe, wie die Brigittenauer Molkerei (Brigittaplatz) und die Niederösterreichische Molkerei (Höchstädtplatz), mit ihrem „Rohstoff“ versorgt .
24 Vgl Kunsttrans Holding GmbH, Die Kunsttrans. 150 Jahre Kunst und Transport – Geschichte eines Unternehmens, o . O ., o . J , S . 7
25 Siehe: „Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co “, S 138
26 Inserat „Westindische Bananen […]“, in: Neues Wiener Tagblatt, 28 12 1912, S 26
27 Virtuelles Kraftfahrzeug Museum Austria, A Fross-Büssing, www voz co at/VKMA/Fro_Bue/fro_ bue .html (24 .8 .2022) .
41
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 41 04.11.22 11:17

42 1 Halle Personenbahnhof 2 Bahnhofspost 3 Lokschuppen und Werkstätten 4 Lagerstätten für Kohle 5 Wasserturm 6 Freiladerampe 7 Umschlaghalle Schenker & Co . 8 Hallen mit offener Umladebühne 9 Nordsee und Bananenhalle 1 2 6 7 8 9 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 42 04.11.22 11:17
4
5 4

43
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
Ökosystem Bahnhof: Der Plan des gesamten Geländes des Nordwestbahnhofs zwischen 1911 und 1924 zeigt die Vielzahl der hier angesiedelten Firmen . Plan aus 1911 mit Einträgen zur Bahnhofssperre 1924; OeStA 3 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 43 04.11.22 11:17
Vor der Einführung von Europalette, Gabelstapler und Container beschäftigten die Betriebe am Bahnhof unzählige ungelernte männliche Arbeitskräfte als Lagerarbeiter und Fuhrwerker, die das Milieu der Nach barschaft prägten, das von Ausbeutung und Elend gekennzeichnet war, von katastrophalen Wohnverhältnissen, Prostitution und Branntweinschen ken . Viele dieser Arbeiter kamen mit der Nordwestbahn aus Böhmen nach Wien, wie auch Köchinnen und Hausmädchen . Die Nordwestbahn selbst beschäftigte kaum tschechische Mitarbeiter*innen, ihre Belegschaft setz te sich zum überwiegenden Teil aus Deutschböhmen zusammen, sie ver stand sich als „deutsches“ Unternehmen . Bei den Frächtern und Speditionen am Nordwestbahnhof fanden wiederum viele tschechische Zugewanderte Arbeit, die Brigittenau gehörte zu den Bezirken mit hohem tschechischen Bevölkerungsanteil .
Die
Verstaatlichung der „deutschen“
Nordwestbahn
Wie erwähnt, spielten schon bei der Konzessionsvergabe nationale Erwä gungen eine Rolle, es ging um „deutsch“ vs . „französisch“ . Die Entscheidung gegen das französisch dominierte StEG-Konsortium kann auch staatspoli tisch (im Sinne des multi- oder übernationalen Habsburgerreiches) gelesen werden, aber auch als Versuch, den Wettbewerb zwischen Bahngesellschaf ten zu fördern . In den folgenden Jahrzehnten konnte „deutsch“ auch als „nichtjüdisch“ verstanden und verwendet werden, in dieser Hinsicht war die Nordwestbahn ein Kontrapunkt zur „jüdischen“, von Rothschild domi nierten Nordbahn . In der antisemitischen Agitation verschwimmt dieser Unterschied (einer zumindest nicht mehrheitlich jüdischen Aktionärsstruk tur der Nordwestbahn) allerdings bisweilen und es war nicht nur von den „Nordbahnjuden“, sondern auch von den „Nordwestbahnjuden“ die Rede, auch Rothschild wurde mit der Nordwestbahn in Verbindung gebracht . Ve hement wurden die antisemitischen Untergriffe im Zusammenhang mit der Verstaatlichung der Nordwestbahn, für die es ab Mitte der 1890er-Jahre konkrete Pläne gab, die aber erst 1908/1909 vollständig umgesetzt wurde . Von der in Aussicht stehenden, „für die Steuerträger sehr theuren, für ei nige Juden aber höchst kostbaren Verstaatlichung der Nordwestbahn“ war im Hans Jörgel vom 29 . August 1896 zu lesen . 28 Das war die allgemeine Stoßrichtung der Antisemiten: Bei den Verstaatlichungen der Bahngesell schaften würden die Aktionär*innen (sprich: Jüdinnen und Juden) auf Kos ten der Steuerzahler*innen zu gut aussteigen . Eine Regierungsvorlage war deshalb im Reichsrat abgelehnt worden, wohl nicht nur, aber ganz wesent
28 „Im Reich der Unwahrscheinlichkeiten“, in: Hans Jörgel von Gumpoldskirchen, 29 8 1896, S 1–2, hier 1 .
44 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 44 04.11.22 11:17
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
lich aufgrund antisemitischer Agitation . Eine Zielscheibe bildete Theodor (Ritter) von Taussig . Der Bankfachmann war ab 1873 für die Allgemeine Bodencreditanstalt tätig und Mitglied im Verwaltungsrat der Nordwest bahn . Er spielte eine zentrale Rolle bei der Verstaatlichung der Gesellschaft . Der Antisemit Karl Lueger nutzte Taussigs Judentum für seinen Angriff: „Wer ist der Mächtige, der diese Vorlage bei der Regierung durchgesetzt hat? Man sagt der Taussig! Ja ist der Taussig wirklich eine solche mächti ge Persönlichkeit? Er ist ja doch nur ein einfacher Jude, – wenn er aber so mächtig ist, dann sollten sich unsere Minister vom Taussig zum Minister machen lassen, sich aber nicht Minister Sr . Majestät nennen .“ 29 Inhaltlich lehnten die Parlamentarier vor allem die unterschiedlichen Einlösefristen für die drei Netze der Nordwestbahn ab, weil diese dem Staat erhebliche Mehrkosten verursachen würden . Die Debatten zogen sich über Jahre, die Bahngesellschaft investierte kaum mehr in die Strecke, weil das dem künf tigen Eigentümer zugutekommen würde . 30 Die nationalen Befindlichkeiten manifestierten sich auch an den Stationsschildern: Sollten sie nur deutsch, deutsch-tschechisch oder tschechisch-deutsch sein? 31
Die aus deutschnationaler Sicht essenzielle Funktion der Nordwest bahn für die deutschsprachigen Gebiete an ihrer Strecke tauchte im Natio nalsozialismus nach der deutschen Besetzung der Tschechoslowakei noch einmal auf . In einem Brief forderte der Iglauer Kreisleiter den zweigleisigen Ausbau der Strecke und unterfütterte seine Forderung mit der NS-Erzählung über die angebliche Benachteiligung der Deutschen in der Tschecho slowakei: „Iglau und die Sprachinsel ist in den vergangenen Jahren bewusst von jeder wirtschaftlichen Aufstiegsmöglichkeit ausgeschaltet worden .“ 32 Die Reichsbahndirektion Wien sah das Ganze pragmatischer und verwies in ihrer Antwort auf die schwierige Topografie der Strecke und die zwischen Wien und Stockerau bereits bestehende Zweigleisigkeit .
Personenverkehr: meist bis Stockerau, manchmal bis Berlin oder an die See
Dass die Strecke nur bis Stockerau zweigleisig verlief, spiegelte sich schon in der Monarchie auch in der Frequenz des Personenverkehrs wider: Zwar
29 „Parlamentarisches Abgeordnetenhaus (Sitzung am 14 . April 1896)“, in: Reichspost, 15 4 .1896, S 6–7, hier 7
30 Vgl Horn, Nordwestbahn, S 155
31 Z B „Justiz- und Sprachenfragen“, in: Die Zeit, 28 3 1908, S 1–2, hier 2
32 Österreichisches Staatsarchiv (OeStA)/AdR Vk ÖBB 1Rep Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/ Mappe 3/Der Kreisleiter [Iglau] An die Gauleitung Niederdonau, zur Weiterleitung an die Parteiverbindungsstellen beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Iglau, den 19 November 1940 Betrifft: Ausbau der zweigeleisige [sic] Bahnstrecke DeutschbrodIglau-Wien, Abschrift .
45
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 45 04.11.22 11:17
waren die Fernzüge nach Berlin die prestigeträchtigeren, die Verbindung zu den deutschen Seehäfen öffnete sogar den Weg nach Übersee . Prominente Passagier*innen waren Sigmund Freuds Schwester Anna Freud-Bernays und ihr Ehemann Eli Bernays . Als sie nach Amerika emigrierten, wurden sie von Sigmund Freud und dessen Vater zum Nordwestbahnhof gebracht . Ihren – später als PR- und Propagandapionier berühmt-berüchtigten – Sohn Edward nahmen Anna und Eli mit, die Töchter blieben in Wien: Judith bei den Großeltern, Lucy bei Martha und Sigmund Freud . 33 Vom Nordwestbahnhof fuhren auch „Vergnügungszüge“ in „Ostseeund Nordseebäder“, allerdings in bescheidener Anzahl: 1911 waren es drei Züge mit 1 051 Personen, 1912 ebenfalls drei Züge mit 986 Personen (16 in der 1 . Klasse, 221 in der 2 . Klasse und 749 in der 3 . Klasse) . 34 Auch Kuror te in Böhmen – wenngleich nicht die berühmten Bäder, die lagen am Netz der Franz-Josefs-Bahn – konnten vom Nordwestbahnhof erreicht werden, beispielsweise Tecin, Belohrad oder Geltschbad (Lázně Jeleč) in der Nähe von Leitmeritz (Litoměřice) .
Den Großteil der Passagierfrequenz brachte jedoch der Nahverkehr, der die Region nördlich von Wien viel stärker an die Stadt gebunden und dadurch ihren Aufschwung beschleunigt hat, ein Beispiel dafür ist Stocke rau . Der Nordwestbahnhof hatte in der Monarchie eine höhere Passagier frequenz als der prominentere Nordbahnhof: Im Jahr 1913 fuhren auf der Nordwestbahn 1 .514 Schnellzüge, 2 .351 Personenzüge, 7 .422 Lokalzüge (bis Stockerau) und 365 gemischte Züge, auf der Nordbahn waren es knapp doppelt so viele Schnellzüge (3 .041), mehr als doppelt so viele Personen züge (5 .404), dreimal so viele gemischte Züge und keine Lokalzüge . Insge samt waren es auf der Nordwestbahn 11 .652, bei der Nordbahn 9 .352 . Der Nordbahnhof war also der weitaus wichtigere Fernbahnhof, beim Nord westbahnhof hatte der Lokalverkehr großes Gewicht . 35 Zum Vergleich: Vom Südbahnhof fuhren 2 .611 Schnellzüge, 2 .450 Personenzüge und 22 .711 Lo kalzüge . Am Nordwestbahnhof wurden 1 .149 .981 Fahrkarten verkauft, am Nordbahnhof 1 .369 .582 . 36
Die Nordwestbahn nutzte auch der prominente sozialdemokrati sche Reichsratsabgeordnete Franz Schuhmeier, um am 11 . Februar 1913 zu einer Wahlkundgebung nach Stockerau zu fahren . Bei der Rückkehr wurde er von Paul Kunschak, dem geistig verwirrten Bruder des christlichsozialen
33 Lisa Appignanesi, John Forrester, Die Frauen Sigmund Freuds, aus dem Englischen von Brigitte Rapp und Uta Szyszkowitz, München u a : List Verlag, 1994, S 20 [im engl Original: dies , Freud’s Women, New York, NY: Basic Books, 1992]
34 Magistrat der Stadt Wien (Hg .), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1912, Wien: Ver lag des Wiener Magistrates, 1914, S 803
35 Magistrat der Stadt Wien (Hg ), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1913, Wien: Ver lag des Wiener Magistrates, 1916, S 788
36 Ebd , S . 789 .
46 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 46 04.11.22 11:17
Die Bahnhofshalle (rechts) an der Kreuzung Taborstraße und Nordwestbahnstraße, Foto um 1900; Historisches Archiv der Wiener Linien, www .bildstrecke .at

47
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 47 04.11.22 11:17
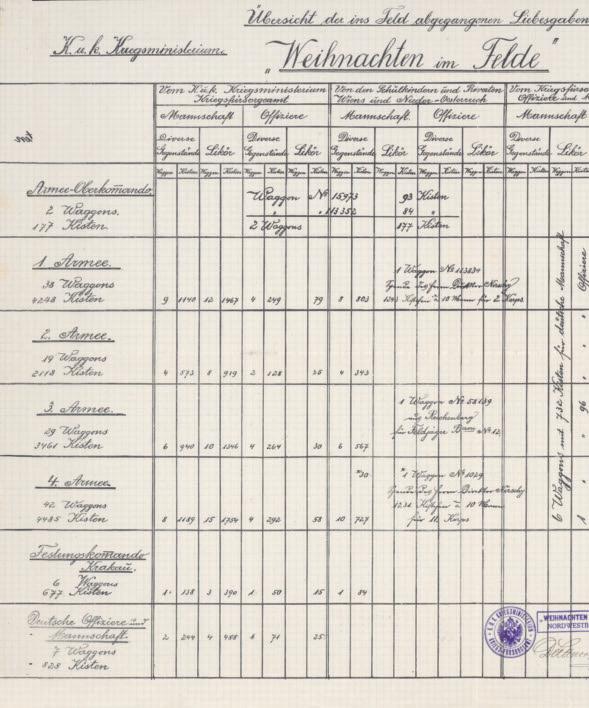
48 1872–1918 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 48 04.11.22 11:17

49
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 49 04.11.22 11:17
Aufzeichnungen zu den Weihnachtsgeschenken, die vom Nordwestbahnhof am 17 Dezember 1914 den Soldaten an den Fronten des Ersten Weltkrieges gesendet wurden ÖNB Bildarchiv Austria
Politikers Leopold Kunschak, ermordet . Schuhmeiers Begräbnis wurde zu einer der größten politischen Kundgebungen der späten Monarchie . Eineinhalb Jahre später begann der Erste Weltkrieg . Größere Trup pentransporte wurden über den Nordwestbahnhof nicht abgewickelt, un beeinflusst vom Kriegsgeschehen blieb er dennoch nicht, wie ein paar Bei spiele zeigen: So empfing am 24 . November 1914 Erzherzog Franz Salvator den „Krankenzug Nr . 15“ und „nahm mit lebhafter Befriedigung die ausge zeichnete Verfassung der Verwundeten und die glänzenden Einrichtungen, die für sie getroffen wurden, wahr“ . 37 Wenig später wickelte Schenker die Verschickung von Hunderttausenden Geschenken für die Soldaten an den Fronten über den Bahnhof ab In den Stimmungsberichten der Polizeidirek tion während des Krieges kommt der Nordwestbahnhof nur im Zusammen hang mit Handwagenzustelldienst und mit jugendlichen Arbeiter*innen, die ihre Arbeitsstellen schnell wechseln, vor . 38 Reichlich zynisch ist der Bericht des Wiener Bürgermeisters Richard Weiskirchner an den Gemeinderat aus dem Jahr 1914, der auf die Rolle des Nordwestbahnhofs für die Lebens mittelversorgung der Stadt verweist: „Die Hausfrauen Wiens, die ahnen es gar nicht, wie groß die Sorge ist, die aufgewendet werden muß, um ihren Ansprüchen in Bezug auf Lebensmittel zu entsprechen Sie wollten nur ein mal hinausziehen, um sich bei den Überladestellen in Stammersdorf und auf dem Nordwestbahnhof zu überzeugen, wie väterlich Wiens Bürgermeister hier für seine Wiener gesorgt hat .“ 39
37 „Das Rote Kreuz Der Krankenzug Nr 15“, in: Neues Wiener Tagblatt, 25 11 1914, S 9
38 Vgl k k Polizeidirektion Wien, Zentralinspektorat der k k Sicherheitswache, Stimmungsberichte aus der Kriegszeit, Wien 1914–1917
39 Richard Weiskirchner, Die Gemeinde Wien während der ersten Kriegswochen. 1. August bis 22. Sep tember 1914. Nach dem vom Bürgermeister Dr. Richard Weiskirchner dem Wiener Gemeinderate erstatteten Bericht zusammengestellt vom Sekretariate der Wiener christlichsozialen Parteileitung, Wien: Verlag des Sekretariats der christlichsozialen Parteileitung, 1914, S 24
50 1872–1918
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 50 04.11.22 11:17

51
Gelenkter Liberalismus, böhmische Industrie und das Tor nach Preußen
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 51 04.11.22 11:17
Die Ermordung des populären sozialdemokratischen Abgeordneten Franz Schuhmeier am Nordwestbahnhof; Illustrierte Kronen-Zeitung, 13 2 1913, S 1
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation
























Der Hausen nach Ferdinando Luigi Marsigli, 1726; Edit Király, Olivia Spiridon (Hg.), Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art, Salzburg 2018, S. 40–44

52 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 52 04.11.22 11:17
Die Donau vor der Regulierung
Zwischen dem heutigen Stift Klosterneuburg und der Enge von Hainburg entfaltete sich einst die weiträumigste Auenlandschaft entlang der Donau. Der Fluss teilte sich in viele schmale und relativ seichte Arme, die es ermöglichten, die Donau hier vergleichsweise sicher zu überqueren. Schon die Römer hatten, um diesen Übergang über den Fluss, der die Grenze ihres Imperiums bildete, kontrollieren zu können, hier das Legionärslager Vindobona gegründet. An genau demselben Standort im Schutze des Wienerberges, wo sich bedeutende Han delsrouten kreuzten, wuchs später eine florierende Stadt heran. Über Jahrhunderte bildete der stadtnächste Donauarm, der heute als Donaukanal bekannt ist, die wichtigste Verkehrsinfrastruktur zur Versorgung der Stadt, bis die Eisenbahn dem Schiffsverkehr Konkurrenz zu machen begann.
Dort, wo der Nordwestbahnhof errichtet werden sollte, im Bereich des späteren Schienenstrangs und der Halle zur Abfertigung des Personenverkehrs, befand sich das sogenannte Fahnenstangenwasser, ein Donauarm, über den bevorzugt Holz angeliefert und abgeladen wurde. Von der Taborlinie, der Grenze für die Verzehrsteuer am inneren Tabor (heute Ecke Taborstraße und Nordwestbahnstraße), führ te ein Weg mit zwei Brücken über zwei Donauarme zum äußeren Tabor und von dort über die größte Brücke über einen dritten Donauarm nach Floridsdorf. Die Insellandschaft dazwischen, bezeichnenderweise Zwischenbrücken genannt, beheimatete von 1843 bis 1870 das beliebte Vergnügungsetablissement Universum, das dem Neubau des Bahnhofs weichen musste. Auch das Linienamt wurde 1875 aufgelassen. „Einst war die Taborlinie eine Berühmtheit Wiens; nicht allein deshalb, weil, wie der Wiener mit gutmüthigen Scherze zu sagen pflegte, ‚alle Böhm‘ bei der Taborlinie hereinkommen und weil im Frühjahr die Lehrlinge dort ‚hereingetrieben‘ wurden, sondern weil überhaupt alles, was an Reisenden oder Waren aus dem Norden kam – und dessen war viel –die Taborlinie passieren musste.“1 Die Donauregulierung und „mehr noch die Eisenbahnen (in diesem Falle die Nord- und Nordwestbahn), deren Bahnhöfe innerhalb der Linien liegen, haben dazu beigetragen, dem ‚Tabor‘ seine Berühmtheit zu nehmen.“2
Die vielen Arme der Donau bei Wien – der Donaukanal ausgenom men – verliefen noch bis zum Jahr 1870 völlig unreguliert. Das war gut für die Fische und andere tierische wie pflanzliche Bewohner*innen dieser Naturlandschaft. Für die wachsende Stadt Wien brachte es aber Probleme mit sich: Zum einen kam der Schiffsverkehr durch Niederwasser wiederholt zum Erliegen oder aber die Stadt – insbesondere die Brigittenau und Zwischenbrücken – wurden von schweren Hochwässern
1 „Die Taborlinie“, in: Neuigkeits-Welt-Blatt, 11.1.1888, [S. 9].
2 Ebd.
53
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 53 04.11.22 11:17

54 1 Nordwestbahnhof 2 Nordbahnhof 3 Am Tabor 4 Praterstern
Lasallestraße Taborstraße Nordwestbahnstraße 1 2 3 4 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 54 04.11.22 11:17
Überlagerung der Bahnhöfe und Bahnlinien mit einer Karte von Zwischenbrücken aus dem Jahr 1821; Raimund Hinkel, Wien XXI, Floridsdorf. Das Heimat-Buch, Wien 1994
heimgesucht. Während der Überschwemmungen suchten sich die Flussarme ihr neues Flussbett selbst, wodurch die reale Gefahr bestand, dass sich der Verlauf der Donauarme – dem geringsten Widerstand folgend –sukzessive weiter nach Norden und damit weg von der Stadt verlagern könnte. Stadtnahe schiffbare Wasserwege wurden mit der zunehmenden Industrialisierung jedoch immer bedeutender – die Regulierung der Donauarme zur Sicherung der Stadt und des Schiffverkehrs umso dring licher. Erst nach fast 20 Jahren andauernder Debatten über die möglichen Varianten wurde schließlich 1870 bis 1875 die großräumige Umgestaltung als geradliniger Durchstich umgesetzt. Parallel dazu waren die Arbeiten am Nordwestbahnhof schon im Gange; auf den ältesten Fotos sind neben dem Bahnhofsgelände noch die Reste des Heustadel wassers zu sehen.
Fischreichtum, Fischsterben und Fischimport
Wien war über Jahrhunderte eine amphibische Stadt, die sich am Fluss und deren Läufen orientierte. Brücken mussten oft jährlich erneuert werden und organische Veränderungen prägten das Stadtbild. Die Verlandung der Auen führte zu einer Veränderung dieses einzigartigen Ökosystems, das heute nur noch in Restbeständen im Nationalpark Donau-Auen fortbesteht und immer mehr zu verlanden droht.3 Diese bis zur Regulierung bestehende, ausgedehnte Aulandschaft vor Wien mit den vielen mäandernden Seitenarmen der Donau und deren vergleichsweise niedrige Fließgeschwindigkeit und natürliche Uferbepflanzung bot nicht nur Lebensräume für eine Vielfalt von Fischen, sondern ebenso ideale Laichgründe – auch für jene Fischarten, die jährlich weite Wanderbewegungen über die Donau zurücklegten, mitunter von und bis ins Donaudelta am Schwarzen Meer. Der Fischreichtum in der Donau und das große Angebot auf dem Wiener Fischmarkt wurden vielfach gelobt und gepriesen.4
Die Aufschüttungen der Aulandschaft für die Baulandgewin nung, die Donauregulierung − die eine erhöhte Fließgeschwindigkeit nach sich zog, mit ihrem befestigten Flussbett die Uferbepflanzung reduzierte und den Zugang zu den Seitengewässern abschnitt – sowie in der Folge auch Staustufen und Schleusen verschlechterten die Laich- und Lebensbedingungen. Die ersten offiziellen Berichte darüber lieferten nicht wie heute üblich Ökolog*innen, sondern sie kamen vom Berufsstand der Donaufischer. Diese minutiösen Beobachter des Flusses
3 Für die hydrobiologische Expertise danken wir Christina Gruber, siehe: Christina Gruber, Historical fish market data and fish ecological changes in the Austrian Danube from 1860 to 1914, Masterarbeit, Univ. f. Bodenkultur Wien, 2015.
4 Siehe z.B.: Wolfgang Schmeltzl, Ein Lobspruch der Hochlöblichen weit berümbten Küniglichen Stat Wienn in Österreich, Wien 1547; Ferdinando Luigi Marsigli, „Über die Donaufische“ [Original aus 1726 aus dem Lateinischen übersetzt], in: Edit Király, Olivia Spiridon (Hg.), Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art, Salzburg/Wien: Jung und Jung, 2018, S. 40–44.
55
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 55 04.11.22 11:17
mussten mitansehen, wie ihre üblichen Fangplätze verschwanden und durch das Abkappen der Seitenarme ganze Fischgenerationen zugrunde gingen. Viele typische Donaufischarten, wie Karausche, Nase und Zope, nutzten die Nebenarme und Augewässer als Kinderstube, Nahrungsquelle und Winterquartier.5
Zur gleichen Zeit kam mit den großen Baumaschinen, die unmittelbar vor der Donauregulierung beim Bau des 1869 eröffneten Suezkanals eingesetzt worden waren, die Wandermuschel (Dreissena polymorpha) als „blinder Passagier“ auf den riesigen Baggerschaufeln von Ägypten mit nach Wien. Der berühmteste und größte aller Donaufische, der Hausen, eine uralte Untergattung des Störs, hat die Modernisierung nicht überlebt, nachdem seine 2.000 Kilometer langen Wanderrouten unterbrochen wurden. Seiner urtümlichen Gestalt, in Form von knöchrigen Schuppenreihen, und seinem bevorzugten Lebensraum am Flussboden verdankte er es, dass er 250 Millionen Jahre lang die Erde bewohnte. Mit zunehmender Regulierung der Donau gingen die Bestände jedoch drastisch zurück, da die gewohnten Strecken blockiert und Rückzugsorte abgeschnitten wurden. Der größte Feind dieser lebenden Fossilien ist aktuell der Mensch und dessen Eingriffe in das Fluss ökosystem.6 Heute wird eine Gattung in der österreichischen Donau ge zielt gezüchtet und ausgesetzt.7
Kaum war der Lebens- und Reproduktionsraum der Wiener Fische nachhaltig ge- oder zerstört, setzte eine verstärkte Nachfrage nach Fisch als Nahrungsmittel ein: Mit dem durch die Eisenbahnen mit angetriebenen Bevölkerungswachstum Ende des 19. Jahrhunderts und dem schlechten Gesundheitszustand der unteren sozialen Klassen erfasste der Hygiene-Diskurs die Stadtplanung und das Interesse an der Volksgesundheit wurde virulent: Auch die Wiener Märkte wurden reformiert, gesunde und eiweißhaltige Nahrungsmittel sollten zu erschwinglichen Preisen angeboten werden: Fisch! Im Vergleich zu anderen Großstädten wurde in Wien allerdings wenig Fisch gegessen. Die Versorgung mit Meeresfischen von der Adria funktionierte nicht zuver lässig, lange Transportzeiten und unterbrochene Kühlketten standen dagegen. Die angestammten Händler der Binnenfische – Adel und Klerus − konnten als Inhaber der Fischereirechte und Fischereiteiche auf dem Boden der Monarchie den Markt kontrollieren und die Preise diktieren. Das und der Ärger über die Hygiene- und Qualitätsmängel in Handel und Verkauf veranlassten den Wiener Marktamtsleiter Karl Kainz,
5 Vgl. dazu Österreichischer Fischereiverein, 1880–1904, Mitteilungen des öster reichischen Fischereiverbandes, Offizielles Organ der niederösterreichischen Fischereiausschüsse, Wien, zit. nach: Gruber, Historical fish market data and fish ecological changes.
6 Ebd.
7 Das „LIFE Sterlet“ Projekt zielt darauf ab, die Wildbestände der letzten noch in der oberen Donau vorkommenden Art der Störe, des Sterlets, zu stärken: LIFE Sterlet, BOKU, Institut für Gewässermanagement und Hydrobiologie, https://life-sterlet.boku.ac.at/ (21.8.2022).
56 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 56 04.11.22 11:18
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation
Inserat der „Deutschen Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee“, die über den Nordwestbahnhof die Stadt Wien mit frischem Fisch versorgte; Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich (Nordsee) – 1899−1999, Klosterneuburg: Mayer & Comp., 1999, S. 18






Marktstand am alten Naschmarkt, Architekten Franz Krauß und Josef Tölk, 1909; Foto: Wien Museum

57
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 57 04.11.22 11:18







58 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 58 04.11.22 11:18
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation



Einreichplan zur Neuerrichtung des Betriebsgebäudes der Nordsee GmbH, 1923; OeStA









59
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 59 04.11.22 11:18
die Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft „Nordsee“ anzufragen, die Wiener Märkte mit Fischen aus der Nordsee zu versorgen und mittels des erhöhten Wettbewerbs die Preise zu senken.8
Frischer Fisch per Bahn
1896 in Bremen von einer Gruppe Bremer Kaufleute und Reeder gegründet, setzte Nordsee schon ein Jahr später 23 Dampfschiffe ein, mit denen sie riesige Gebiete befischten. In Nordenham errichteten sie einen speziellen Fischerei-Hafen mit Kühllagern und direktem Eisenbahnanschluss, sodass sie die Fische gekühlt in speziellen Fisch-Waggons weit in das Hinterland transportieren konnten.9 1897 verfügte Nordsee über 12 speziell angefertigte Eisenbahnwaggons, die von Nordenham die Route über Bremen, Hannover, Magdeburg, Dresden und Tetschen in Richtung Nordwestbahnhof nahmen. Die zum Transport der toten Fischware verwendeten Waggons konnten jeweils 30 Tonnen Fisch lagern und waren mit hölzernen Doppelwänden, Wänden mit Filzlagen und Rinnen zur Abfuhr des Schmelzwassers versehen. Zwischen den Doppelwänden befand sich ein 12 Zentimeter großer Spalt, durch den kalte Fahrtluft in die Lagerräume geführt und somit die Ware auf relativ primitive Weise kühl gehalten wurde.10 Bereits ab 1899 betrieb die Deutsche Dampffischerei-Gesell schaft „Nordsee“ ihre Wiener Zentrale am Nordwestbahnhof. Noch detaillierter als den Eisenbahnwaggon beschrieb Anton Krisch das „als General-Depot, Comptoir, Raucher- und Bratküche zugleich dienende ebenerdige Gebäude“, ein überraschend kleiner, einfacher Holzbau, der aber mit speziellen, der Kühlung dienenden Baudetails ausgestat tet war: Gegen die natürliche Bodenwärme wurde das Erdreich auf eine Tiefe von vier Metern ausgehoben und mit Kies, Lehm und Kohlenschlacke ausgefüllt, bevor ein Betonboden eingezogen wurde. Hatten die normalen Räume 28 Zentimeter starke, mit Torfmull ausgefüllte Doppelwände und das Dach eine 30 Zentimeter hohe Torfschichtdämmung, so wurden die Kühlräume mit 65 Zentimeter starken, gedämmten Doppelwänden und das Dach mit 60 Zentimeter Torf gedämmt. Sie verfügten über einen elektrisch betriebenen Ventilator und mit Eismischung ge füllte Blechkästen.11 Das Eis dafür wurde von einer nahe dem Bahnhof gelegenen Eisfabrik bezogen.
8 Magdalena Kröll, „Die Versorgung der Stadt Wien mit Fischen um 1900. Der neue Wie ner Zentralfischmarkt“, in: Martin Scheutz, Herwig Weigl (Hg.), Verwaltetes Wasser im Österreich des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Forschungen zur Landes kunde von Niederösterreich, Bd. 37), St. Pölten: Verein für Landeskunde von Nieder österreich, 2016, S. 107–133.
9 Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich (Nordsee) – 1899–1999, Klosterneu burg: Mayer & Comp., 1999.
10 Anton Krisch, Der Wiener Fischmarkt. Volkswirtschaftliche, den Hausfrauen der ös terreichischen Haupt- und Residenzstadt gewidmete Studie, Wien: Carl Gerolds Sohn, 1900.
11 Ebd., S. 22.
60 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 60 04.11.22 11:18
Nordsee eröffnete Verkaufsstellen auf den Märkten der Stadt.12
In einem Inserat anlässlich der Eröffnung war zu lesen: „Von dem Bestreben geleitet, Seefische zu einer beliebten Volksnahrung zu machen, wozu sie sich in Folge ihres Wohlgeschmackes, hohen Nährwerthes (Eiweiß und Stickstoffgehalt) und Billigkeit wie kaum ein anderes Nahrungsmittel eignen, werden wir allzeit nur beste frischeste Qualitäten zum Verkauf bringen, und zwar zu Küstenpreisen zuzüglich Fracht und hiesige Kosten. Durch speciell getroffene Einrichtungen erhalten wir die Fische bereits circa 40 Stunden nach Eintreffen aus See in unseren Häfen in eigens construierten Kühlwaggons in täglichen Sendungen nach hier und sind dadurch in der Lage, Seefische in einer Qualität zum Verkauf zu bringen, wie sie sonst nur den Bewohnern der Küstenstriche zugänglich sind.“13
1899 wurde die erste Filiale noch als einfacher Holzstand am Karmelitermarkt im 2. Bezirk errichtet, in dessen Umgebung viele strenggläubige jüdische Familien lebten, die zu erschwinglichen Preisen mit Fischprodukten, die nicht gegen ihre Ernährungsvorschriften verstießen, versorgt werden konnten.14 Die zweite Filiale ent stand am Neubaugürtel in einem Arbeiterbezirk. 1909 wurde dann an der prominentesten Stelle des alten Naschmarktes, in der Verlängerung der Wiedner Hauptstraße, ein prächtiger Jugendstil-Stand eröffnet, mit dessen Gestaltung die prominenten Architekten Franz Krauß und Josef Tölk beauftragt wurden.15 1911 eröffnete Nordsee einen Stand in der Großmarkthalle im 3. Bezirk, heute Wien Mitte.16 Die Firma Nordsee war bald nicht nur auf jedem der Wiener Märkte präsent, ihr Stand befand sich jeweils auch immer in der besten Lage am Markt. Selbst am zentralen Fischmarkt am Donaukanal, der 1907 im Zuge des Stadtbahnbaus von Otto Wagner neu errichtet wurde und wo vorrangig Lebendfisch angeboten wurde, war Nordsee an Ort und Stelle.
Die Initiative des Marktamtsleiters Kainz war erfolgreich: Denn obwohl die Verzehrsteuer nicht gesenkt wurde, gelang es durch „die erhöhte und qualitativ verbesserte Zufuhr an Seewasserfischen aus der Nordsee und der Adria“, hochwertigen Fisch zu vergleichsweise geringen Preisen zu verkaufen – wie das abgebildete Plakat mit den Preisen beweist. Auch die Qualität der Waren verbesserte sich: Die Zahl der konfiszierten Fische ging in Wien zwischen 1895 und 1907 leicht zurück, während der Fischkonsum um etwa 50 Prozent zunahm.17 Nachdem
12 Magistrat der Stadt Wien (Hg.), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1899, Verlag des Magistrates, 1901, S. 608.
13 „Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft ‚Nordsee‘“, in: Neue Freie Presse, 31.10.1899, S. 15.
14 Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich, S. 37–38.
15 Der Stand wurde 1917 abgebrochen und in anderer Form am Standort des neuen Nasch marktes, der durch die Überbauung des Wienflusses verlagert wurde, wiedererrichtet. Siehe: Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich, S. 41–45.
16 Ebd., S. 51f.
17 Kröll, „Die Versorgung der Stadt Wien mit Fischen um 1900“, S. 127.
61
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 61 04.11.22 11:18
die Einfuhr von Seefischen aus der Nordsee jene aus der Adria bei Weitem übertraf, ist ein maßgeblicher Teil der Steigerung den Importen durch die Firma Nordsee zuzuschreiben, die über den Wiener Nordwestbahnhof umgeschlagen wurden.
Um den Bedarf abzudecken, wurde 1923 eine neue größere Fisch fabrik in der sogenannten Nordseestraße am Areal des Nordwestbahnhofs errichtet, in der bis zu 350 Arbeiter*innen im Schichtdienst arbeiteten ab 1969 fast ausschließlich extra dafür angeworbene Gastarbeiter*innen aus dem ehemaligen Jugoslawien und später auch aus der Türkei. Ältere Bewohner*innen können sich noch an den mitunter strengen Geruch erinnern, wenn die Fischreste entsorgt wurden oder Arbeiter*innen direkt von der Arbeit nach Fisch riechend in die Straßenbahn zustiegen. Der Standort am Nordwestbahnhof wurde 1981 geschlossen, weil an dessen Stelle Platz für den Ausbau des Containerterminals geschaffen werden musste, und in ein auf Kühlwaren spezialisiertes Logistikzentrum nahe des alten Schlachthofs St. Marx übersiedelt.
62 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 62 04.11.22 11:18

63
Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 63 04.11.22 11:18
„Weihnachtsfische“: Plakat mit einem Vergleich der Fischpreise aus heimischen Gewässern mit jenen aus der Nordsee, Druck: Paul Gerin, Wien 1935; ÖNB Bild archiv Austria
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 64 04.11.22 11:18
2020 1880 1881 1882 1883 1884 1890 1891 1892 1893 1894 1900 1901 1902 1903 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1920 1921 1922 1923 1924 1930 1931 1932 1933 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1950 1951 1952 1953 1954 1960 1961 1962 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021 2012 2022 2013 2014 1872 1873 1874
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 65 04.11.22 11:18
1885 1886 1887 1888 1889 1895 1896 1897 1898 1899 1905 1906 1907 1908 1909 1915 1916 1917 1918 1919 1925 1926 1927 1928 1929 1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 1875 1876 1877 1878 1879
1918–1938
Ökosystem Bahnhof
Um den Bahnbetrieb, vor allem um den Güterverkehr, entwickelte sich ein Konglomerat von Firmen, die auf dem Areal Niederlassungen hatten. Dazu kamen vom Bahnbetrieb unabhängige Institutionen, die als Zwischennutzer*innen leerer Flächen und Gebäude auftraten.
Drazka, Richter u . Dicker, Fritz und Maschke, „Kohlenfritz“, Kohlehändler, Lagerplatz E
Erben & Gerstenberger, Spedition Erich Bäuml, Spedition F Frank „Frideko“, Kohlengroßhandlung G
A
A . Fross-Büssing KG, Gleiswaren (Nachbarschaft), Eisenbahnsignalanlagenbau, Lastkraftwagen und Omnibusse
A . Simiesek, Lagerplatz
Adolf Blum & Popper, Spediteure Wien, Internationale Transporte WienHamburg-Tetschen-Fiume Anna Cigale, Kohlen Anna Guha, Verkaufshütte Arbeitsschutzhütte Ilse B
Bananen-Import Bruno Jellinek Böhm, Petroleum Raffinerie Brasch & Rothenstein, Spedition Brasch, Milchverladungen Braun, Kohle
Brennstoffhandels Ges .m .b . H . C
Caro & Jellinek, Übersiedelungs- und Möbel-Transport-Unternehmung, Wien-Budapest-Lemberg
D
Deutsche Bricketts, Verkaufsstelle
Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft „Nordsee“, Verladestelle, Fischfabrik
Deutsche Reichsbahn
Dr . B . Horowitz, Kohlen
Gebr Böhler & Co , Auslieferungshalle für Stahlprodukte Gemeinde Wien, Kohlenplatz, Kohlenrutschen, Verkaufshaus Gemeinde Wien, Städtischer Straßenbau, Holzschneidehütte Gerich, Kohle Gewerkschaft Ernstbrunn, Kalkschuppen Giesskann, Schupfen Glashüttenwerke Leopold Stiassny Gotthilf Götz & Söhne, Metallbau, Hersteller mechanischer Stellwerke, Magazin, Lagerplatz, Schleppgleis Gutfreund & Schmeer, Lager H
H Schulz & Sohn, Kohle H . Wolfert, Pferdestall Harry W . Hamacher, Spedition, Büro und Lager Hausner & Co ., Büro und Lager Hörmann L ., Fuhrwerksunternehmer Hugo Janko, Chemikalien I
I . Gaugusch, Mehllager Ignaz Jellinek, Kohlen Ing . L . Katzner Konserven
Internationale Transporte Karl Kubicek (später Kubicargo Speditions GmbH), Büro, Magazin
Internationale Transport-Ges . A .G, Spedition J
J . Ginskey, Magazin J . Weinmann, Kohle Jacques Hauvette, Autoreifenhandlung Josef Deutsch, Landesprodukte Josef J . Leinkauf, Speditionsfirma, Kanzlei, Schuppen, Bananenhalle
66
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 66 04.11.22 11:18
K . K . Post
Kirchner & Co ., Spedition
Kosmos, Internationale Transporte Wien „Köb“, Kraftwagen-Betrieb der Österr . BBahnen, Ges .m .b . H .
Kraftwagendienst der ÖBB (KWD), Verwaltungsgebäude, Busgaragen, Werkstätten Künstler & Co ., Mineralhandels Ges .m .b . H . L
Leopoldine Blüml, Säcke „Lobeg“, Autobusunternehmen (Bundesbahnen) M
Marie Weis, Verkaufsstube
Markls & Kaiser, Fassdepot und Fasswäscherei Mattoni-Ungar, Mineralwassergroßhandel Mauthner, Getreidesilos, Lager Maximilian Tins, Spedition Michael Berger, Landesprodukte N Neumann Josef, Säcke O
O . Czerwenka, Säcke
ÖBB Österreichische Bundesbahnen k .k . privilegierte Österreichische Nordwestbahn (ÖNWB, 1872−1908), k .k . Staatsbahnen (1909−1918), Österreichische Bundesbahnen (BBÖ, 1918−1938), Deutsche Reichs bahn (DR, 1938−1945)
Oitmar Omni Petrol, Tankstelle Österreichische Keramik Gesellschaft P
Pacher
Peter, Kanzlei, Depot, Kohlenrutschen Petter Johann, Speditionsgewerbe Pintsch J ., A .G . Maschinen
Popper Cilli, Kohlen Post- und Telegraphenamt Prager Kohlenverein Ges .m .b . H . Q R
R . Ditmann, Lager
R . Wolfert, Kantine Radebeule
Reiner, Stech & Co ., Bau- und Brennstoff handelsges .m .b . H .
Rosenbaum & Schiller, Technische Öle, Wien und Prag Roth E . & Co ., Eisen Rudolf Dittmars Erben, Auslieferungslager von Waren der Sanitär-Steingutfabrik aus Znaim S
Schattauer Tonwarenfabrik, Auslieferungs lager für Produkte aus Porzellan, Keramik und Ton aus Südböhmen Schenker & Co , Internationale Spedition, Lager und Verwaltung Schlein u . Reiner Schrecker Th ., Eisen Simicsek Spiegel J ., Lebensmittel Spiegler & Popper FaßhandelsgesmbH . Spitzer, Schupfen Stadlauer Mühle, Singer & Co Städtische Stellwag . Untern . Steingut-Union Lichtenstern & Co . Stern u . Popper Stiaßny R ., Fahrräder Stroh J ., Weine Sulke L . F . & Sohn, Kohlen T
Telegraphendirektion Theresia Jäger, Verkaufshütte U
Ungar und Schicht, Magazin Uniroyal, Reifenhandel, Lager V
Vulkan L ., Holzhdlg . W W . Mohne Weiss Gebr ., vorm . Schubert & Vöth . Spedit . Wiehart, Pferderampe, Schupfen „Wigös“, Großeinkaufsges . öst . Säckehdl . in Wien, r . G .m .b . H . X Y Z
Quellen: Lehmann Häuserverzeichnis 1938, Plan des Nordwestbahnhofs 1911/1924 (OeStA, Bahnhofssperre 1924)
67 K
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 67 04.11.22 11:18
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
Speditions bahnhof und Zwischennutzung statt Personen-
1918–1938:
68 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 68 04.11.22 11:18
verkehr

69
Zwischennutzung: Die leer stehende, zum „Schneepalast“ adaptierte Nordwestbahnhalle, 1927; ÖNB Bildarchiv Austria
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 69 04.11.22 11:18
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
1 Nordwestbahnhof (1872)
2 Franz-Josefs-Bahnhof (1872)
3 Nordbahnhof (1838/1852/1864/1898)
4 Handelskai, Donauhafen 5 Donauregulierung (1870–1875)
Nordwestbahn Franz-Josefs-Bahn
Nordbahn
Unregulierte Donauarme
Überlagerung der vormaligen Donauauen mit dem durch Aufschüttungen neu gewonnenen Bauland für den Ausbau des Nordbahnhofs, des Nordwestbahnhofs und des Hafens entlang des Handelskais; Zeichnung: Michael Hieslmair und Michael Zinganel
70
Augarten
D
Stadtzentrum Praterstern
5 4 2 1 3 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 70 04.11.22 11:18
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
Mit dem Ersten Weltkrieg endete auch die Habsburgermonarchie . Die ehe maligen Kronländer Böhmen und Mähren bildeten nun die Tschechoslowa kei, die Staatsgrenze verlief bei Streckenkilometer 87 der Nordwestbahn . Drei Bahnhöfe mit nach Norden bzw . Nordosten ausgerichteten Strecken netzen waren zu viel für die neue Situation und sie bildeten einen beträcht lichen Kostenfaktor für die Österreichischen Bundesbahnen . Auf der Su che nach Einsparungen verglich deren Direktion den Personenverkehr von Nordbahnhof, Nordwestbahnhof, Franz-Josefs-Bahnhof und Ostbahnhof vor und nach dem Ersten Weltkrieg . Während beim Nordbahnhof die Kenn zahl für die Auslastung der Hallengleise von Sommer 1914 auf Sommer 1923 bzw Winter 1923/24 sogar leicht stieg (von 9,2 auf 9,8 bzw 10,0), ebenso beim Franz-Josefs-Bahnhof, fiel sie beim Ostbahnhof etwa um ein Viertel von 9,1 auf 6,6 und beim Nordwestbahnhof von 9,1 auf 3,5 bzw . 2,8 . 1 An dere Bahnhöfe kamen dagegen auf Werte von 12 und mehr . Was heißt das in anschaulicheren Zahlen? Im Jahr 1913 waren von Franz-Josefs-Bahnhof, Nordwestbahnhof, Nordbahnhof und Ostbahnhof zusammen 146 Fernzüge abgefahren, 1923 waren es nur mehr 68, der Rück gang an Passagier*innen war noch größer . Allerdings sei „durch die große Wohnungsnot […] eine erhebliche Steigerung des Nahverkehres eingetre ten“, trotzdem habe der Nordwestbahnhof fast zwei Drittel seines früheren Personenverkehrs verloren . In mehreren Schritten erfolgte seine Stilllegung: Zunächst wurde ein Teil des Nordwestbahnverkehrs über Floridsdorf zum Nordbahnhof umgeleitet, im Herbst 1923 eine Nachtsperre des Bahnhofs durchgeführt und weiterer Verkehr umgeleitet . 2 Am 1 . Februar 1924 um 19 .24 Uhr verließ der (vorerst) letzte Personenzug den Bahnhof . Wehmü tig kommentierte der Pester Lloyd: „Und es war gleichsam, als sei eines der letzten Bänder zerrissen worden, das noch aus den Tagen der Monarchie länderverbindend zu uns hinüberreichte . Denn: Der Nordwestbahnhof war gewissermaßen das zentrale Einfallstor der Länder der böhmischen Krone nach Wien, seine der Hauptsache nach in der Tschecho-Slowakei liegende Verkehrsstrecke benützte die uralte nord-südliche Reichsstraße, und er war die Domäne der deutschböhmischen Eisenbahner, aus deren Reihen sich hundertprozentig das Personal rekrutierte . Die historische alte Taborlinie stirbt mit dem Bahnhof …“ 3
Mit der Einstellung des Personenverkehrs verschwand der Bahnhof ein Stück weit aus dem Alltagsleben der Stadt, die „Halle des ehemaligen Nordwest-Bahnhofs, die jetzt nicht mehr in Benützung für den Personen
1
2 „Die
3 „Ein Opfer des Weltkrieges“, in: Pester Lloyd, 2 .2 .1924, S . 13 .
71
OeStA/AdR Vk ÖBB 1Rep Dion W NO/1924/Abt V/Kt 72/Auflösung der Bahnhöfe Wien Nord westbahnhof u Jedlesee AZ 50 0026/24/Technischer Bericht
Schließung des Nordwestbahnhofes“, in: Neues Wiener Tagblatt, 1 2 1924, S 11
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 71 04.11.22 11:18
Arbeitslosenauszahlung in der Kassenhalle des Nordwestbahnhofs, Bildausschnitt; Neuigkeits-Welt-Blatt, 29 3 1925, S 1
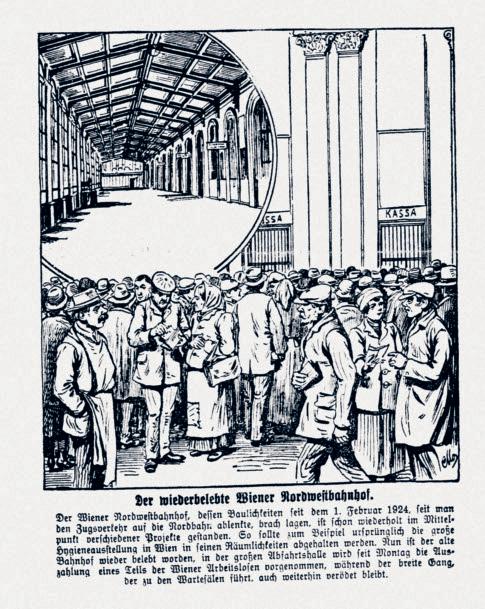
72 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 72 04.11.22 11:18
verkehr stand“, wurde, wie Heimito von Doderer in Die Dämonen schreibt, „ein blind gewordenes, verschlossenes Fenster der Ferne, groß und grau und tot . . . “ . 4
Die Stadt Wien, namentlich der Stadtsenat und der zuständige Ge meinderatsausschuss, protestierte gegen die Schließung des Bahnhofs, da sie „eine schwere Schädigung der Interessen Wiens als Großstadt und Ver kehrsknotenpunkt“ 5 darstelle . Zudem sei zumindest im Sommer der FranzJosefs-Bahnhof bereits überlastet und auch der Nordbahnhof weise bereits eine Frequenzsteigerung gegenüber der Vorkriegszeit auf . Zwar sei derzeit der Fernverkehr reduziert, doch das könne sich wieder ändern . „Es unter liegt keinem Zweifel, daß die beste Verbindung nach Dresden, Berlin und Hamburg von Wien über die Nordwestbahnstrecke führt .“ Der Nordbahn hof sei zwar äußerlich schön, aber veraltet . „Anstatt […] neue Bahnhöfe zu schaffen, wird der Versuch der Ausschaltung eines Wiener Bahnhofs ge macht, und zwar gerade eines jener Bahnhöfe, die der lästigen, eine rasche Verkehrsabwicklung hindernden Stiegenanlagen entbehren .“ 6
Die meisten Zugverbindungen wurden auf den Nordbahnhof ver legt, die Schnellzüge nach Prag fuhren ab 1 . Februar 1924 vom Ostbahn hof ab, jene nach Berlin vom Westbahnhof Es ging Wien aber nicht in ers ter Linie um die komfortable Abwicklung des Bahnverkehrs: „Der um den Nordwestbahnhof liegende Bezirksteil des 20 . Bezirkes mit seiner ganzen Geschäftswelt steht in einem ursächlichen Zusammenhange mit diesem Bahnhofe, lebt und fällt mit ihm .“ 7 Hier kollidierten die betriebswirtschaft lichen Überlegungen der Bundesbahnen mit den Interessen der Stadt, die den Bahnhof vor allem als Standortfaktor für dessen Umgebung betrach tete . Gewerbetreibende und Kaufleute hielten eine Protestversammlung ab; der Leopoldstädter Bezirksvorsteher „erklärte, daß die Erregung nicht nur die Gewerbetreibenden und Kaufleute ergriffen habe, sondern auch weite Schichten von Angestellten und Arbeitern, vor allem die Gepäckträ ger, die Chauffeure, die Hotel- und Kaffeehausangestellten, deren Existenz vernichtet ist, wenn der Nordwestbahnhof nicht bald wieder geöffnet und Schnellzüge wieder auf den Nordbahnhof geleitet werden“ . 8
Später intervenierte auch der Wiener Bürgermeister Karl Seitz bei den Bundesbahnen, die Schließung des Nordwestbahnhofs für den Per sonenverkehr blieb aufrecht . Vier Jahre später versuchte es die Bezirksvorstehung der Leopoldstadt erneut, mit Verweis auf das bevorstehende
4 Heimito von Doderer, Die Dämonen. Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff, München: dtv, 1985, S . 140
5 Amtsblatt der Stadt Wien, Nr 21, 12 3 1924, S 270 6 Ebd
7 „Der Nordwestbahnhof“, in: Arbeiter-Zeitung, 27 2 1924, S 7 8 Ebd .
73
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 73 04.11.22 11:18
Sängerbundesfest und die Bedeutung des Bahnhofs für den Tourismus, ebenfalls erfolglos . Auch die von Heinrich Nübel in der Zeitung Der öster reichische Volkswirt formulierten Überlegungen blieben ohne praktische Folgen: Ausgehend von den Wiener Donaubrücken analysierte er die Wiener Verkehrssituation . Während eine dritte Straßenbrücke fehle, sei eine Eisen bahnbrücke überzählig . „Es wäre denkbar, diese Brücke zur Errichtung einer Schnellbahnverbindung [vom Nordwestbahnhof] mit dem linken Ufer“ 9 zu verwenden; oder man könne die Stadlauer Staatseisenbahnbrücke für den Straßen- und Schnellbahnverkehr verwenden und den Bahnverkehr „auf die Nordbahnbrücke und Nordwestbahnbrücke [zu] verteilen . Hiebei könnte der heute brachliegende Nordwestbahnhof wieder Verwendung finden “ 10
Der „Hauptspeditionsbahnhof“
und seine Umgebung
Wie groß die Auswirkungen auf die Umgebung des Bahnhofs tatsächlich waren, lässt sich schwer sagen, vermutlich bedeutete der Februar 1924 aber nicht den ganz großen Einschnitt, außer für das an das Bahnhofsgelände Richtung Innenstadt anschließende Gebiet Für die Hotels war der Bahn hof ohne Fernverkehr schon vorher kein besonderer Faktor gewesen, am ehesten ließen sich negative Auswirkungen auf das Geschäftsleben in der Einkaufsstraße Taborstraße vermuten . Die jüdische Zeitung Der Morgen schreibt im Dezember 1932 allerdings, es habe sich gar nicht so viel geän dert, die Kund*innen aus den umliegenden Regionen würden nun mit dem Autobus kommen . 11 Die im Zuge der Donauregulierung fehlgeschlagene Spe kulationsverwertung der Fläche zwischen Bahnhof und Donau erwies sich für die Stadtverwaltung des Roten Wien als Vorteil Die große, weitgehend unverbaute Fläche wurde für die Errichtung einiger großer Gemeindebau ten genutzt: den Winarskyhof, die Wohnhausanlage am Friedrich-EngelsPlatz oder den Janecek-Hof . Entlang des Handelskais und des Bahnhofs hatten sich bereits im 19 . Jahrhundert Industrie- und Gewerbebetriebe angesiedelt, sie waren Teil des Ökosystems „Güterbahnhof“, das ja nach 1924 nicht verschwand: Die Heizanlagen für die Lokomotiven blieben bis 1930, es arbeiteten weiterhin Hunderte Menschen auf dem Bahnhofsgelände . Die umliegenden Firmen mussten ihre Güter nun bei einer Spedition aufgeben oder zum – nicht weit entfernten – Nordbahnhof transportieren . Es blieben aber auch die
9 Dr Heinrich Nübel, „Die Wiener Brückenfrage“, in: Der österreichische Volkswirt, 1 9 1928, S 1 362–1 364, hier 1 364
10 Ebd
11 „Das Haus Nummer 48“, in: Der Morgen, 12 12 .1932, S . 12 .
74 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 74 04.11.22 11:18
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
Auch 50 Jahre nach dem Bahnhofsneubau und der Donauregulierung bestanden entlang der Nordwestbahn noch viele freie Bauflächen, einige wenige wurden im Roten Wien für Gemeindebauten verwendet „Plan des 20 Bezirkes Brigittenau der Bundeshauptstadt Wien“, 1925–1930; WStLA

75
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 75 04.11.22 11:18
Der Nordwestbahnhof als Drehort für die Deportationsszene im Film „Stadt ohne Juden“ (1924), gedreht nach einer Romanvorlage von Hugo Bettauer; Blick der Kamera auf das bis heute erhaltene Postgebäude; Filmarchiv Austria

76 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 76 04.11.22 11:18
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
negativen Auswirkungen bestehen: Die Barrierewirkung der Bahnanlagen bestand nach wie vor vollständig, Lärm und Luftverschmutzung durch die Dampflokomotiven in reduziertem Ausmaß . Schon vorher hatte die Direkt verladung bei Speditionen und anderen am Bahnhof angesiedelten Firmen einen wichtigen Teil des Betriebs ausgemacht, wie eine Reportage im Neuen Wiener Journal anschaulich beschreibt:
„Hauptspeditionsbahnhof Wiens ist der Nordwestbahnhof . Hier befinden sich die Riesenmagazine von Schenker & Co, Caro & Jellinek, Ginzkey, Leinkauf usw . Regstes geschäftiges Leben bewegt sich täglich die anderthalb Kilometer lange Bahnhofsfront entlang . Und endlos lange Züge rollen Tag und Nacht, gespenstisch beleuchtet von den hochmastigen Bogenlampen, ab und zu . Gegenwärtig wird Schnee geschaufelt, vor den Magazinen, im langgestreckten Hofe und vor den Bureauhäusern . Meist ziemlich unnütz, denn schon einige Stunden später breiten sich wieder dichte Schneedecken über das Pflaster, das aber trotzdem immerhin noch wenigstens wegsam bleibt .“ 12
Zwar schrieb Die Stunde über nun wertlos gewordene Magazine; auf Ersuchen der Speditionsfirma Leinkauf folgte die Klarstellung, „daß der Nordwestbahnhof für den allgemeinen Güterverkehr gesperrt worden ist, hingegen der Waggonladungsverkehr jener Firmen, die auf dem Territo rium des Nordwestbahnhofs Lagerhäuser oder Magazine betreiben, keiner lei Beschränkung erfahren hat“ . 13 Davon profitierten nicht nur die Firmen, die direkt auf dem Bahnhofsareal angesiedelt waren, sondern auch jene mit Betriebsstätten in Bahnhofsnähe, die also zum erweiterten Ökosystem des Güterbahnhofs gehörten: Speditionen, Zulieferer für den Bahn- und Spedi tionsbetrieb (beispielsweise Hersteller von Säcken und anderen Transport verpackungen) und Holzhändler, Eisen verarbeitende Firmen – kurz gesagt, Industrie- und Gewerbebetriebe, die auf Schienentransport angewiesen wa ren . Dazu kamen Kantinen, Gasthäuser und Branntweinschenken, die von den Arbeitern frequentiert wurden . Neben den vom Neuen Wiener Journal genannten Firmen befanden sich weitere Transportunternehmen auf dem Areal, etwa die auf Kunsttransporte spezialisierte Spedition E . Bäuml oder Brasch & Rothenstein .
Es gab zwischen 1924 und 1938 zwar eine gewisse Fluktuation, manche Firmen nutzten die von der Bahn freigegebenen Flächen und Hal len, um ihre Anlagen auszuweiten, es kamen neue Firmen hinzu, andere stellten ihren Betrieb ein . Insgesamt zeigte sich aber auf dem Areal des Bahnhofs und in seiner Umgebung eine starke Kontinuität . Die bestehende
12 Edmund Eichler, „Besuch am Frachtenbahnhof Im Reiche der Kohlenrutschen“, in: Neues Wiener Journal, 7 1 1924, S 3–4
13 „Der Nordwestbahnhof ohne Verkehr“, in: Die Stunde, 9 .2 .1924, S . 4 .
77
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 77 04.11.22 11:18
Logistikinfrastruktur erfuhr zwar teilweise eine krisenbedingte Umnut zung, sie blieb aber bestehen und erfüllte auch durch die Weltwirtschafts krise hindurch ihre Funktion, der Nordwestbahnhof blieb für manche Bran chen ein attraktiver Standort . Die schiere Masse im physikalischen wie im ökonomischen Sinn bewirkte Resilienz . „Jedenfalls kann man sagen, daß der ‚tote‘ Nordwestbahnhof heute bis auf den letzten Quadratmeter und besser ausgenützt ist denn je .“ 14 Reibungslos dürfte der Betrieb – zumin dest in der ersten Phase der Umstrukturierung – aber nicht abgelaufen sein . In einer Versammlung beklagten Gewerbetreibende, dass ein Waggon vom Nordwestbahnhof über Jedlesee zum Nordbahnhof neun Tage unterwegs gewesen sei Einen gewissen Aufschwung im Güterfernverkehr ließ die Einführung von Verbandstarifen mit der Tschechoslowakei ab 1 . Septem ber 1924 erwarten . 15
Das beförderte Gütervolumen war jedenfalls schon vor 1924 stark zurückgegangen: Waren es im Jahr 1913 mehr als 500 .000 Tonnen gewe sen, lag dieser Wert 1928 nur mehr bei knapp über 200 .000 Tonnen . Dar an änderte sich bis 1938 nichts Grundlegendes, allerdings war der Umfang des Warenumschlages konjunkturbedingten Schwankungen unterworfen, er stieg bis 1929 an, sank ein wenig bis 1931, fiel bis 1934 stark, um 1935 wieder leicht zu steigen . Beim Nordbahnhof fiel der Rückgang verhältnis mäßig geringer als beim Nordbahnhof aus; interessant ist die Entwicklung ab 1938: Hier erreichte der Nordwestbahnhof einen Wert, der etwa 25 Prozent über jenem von 1935 lag, während der Nordbahnhof um etwa 15 Pro zent unter seinem Vergleichswert von 1935 blieb .
14 „Der tote Bahnhof lebt“, in: Kleine Volks-Zeitung, 25 1 1930, S 3–4 15 „Der Volkswirt Ein Wort an die Völkerbunddelegierten“, in: Neues Wiener Tagblatt, 27 8 1924, S 9
78 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 78 04.11.22 11:18
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
Güterumschlag im Vergleich an Nordwest- und Nordbahnhof Nordwestbahnhof Nordbahnhof
1913 an: 365 .729 ab: 148 .087 Gesamt: 513 .816 1928 172 764 845 421 39 .180 80 .054 211 .944 925 .475 1929 174 .936 999 .480 38 .172 310 .488 213 .108 1 .309 .968 1930 167 .724 858 .720 1931 167 .688 813 .710 1932 146 .753 791 .684 1933 136 .605 711 .898 1934 112 .670 688 .093 1935 118 .019 800 .404 1938 110 .962 559 .769 48 190 114 025 159 .152 673 .794
Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für die Jahre 1913, 1929, 1930–1935 (1 und 2 Jg ), 1938, Angaben in Tonnen; zwischen 1913 und 1928 ist das Statistische Jahrbuch der Stadt Wien nicht erschienen . Die Werte von an- und abtransportierten Gütern sind nur in manchen Jahren aufgeschlüsselt
79
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 79 04.11.22 11:18
Zwischennutzungen von 1924 bis 1939 Skihalle, Arbeitslosenauszahlung und viel Unverwirklichtes
Die Einstellung des Personenverkehrs und der Güterabfertigung bedeute te aber nicht den völligen Rückzug der Bundesbahnen vom Bahnhof: „Die Kanzleien dienen der Generaldirektion als Bureaus und haben so den Zweck ihrer Bestimmung nicht viel geändert . In den Souterrainräumen sind die Verrechnungsabteilungen der Fahrkartenausgabe aller Wiener Bahnhöfe untergebracht . Eine Anzahl komplizierter Zählmaschinen sind hier ein gestellt und arbeiten das ungeheure täglich einlaufende Material auf . Ein großer Wartesaal ist an eine russische Orthodoxengemeinde verpachtet, die nach eingehender Renovierung und Veränderung hier eine Kirche in stallierte . Die verschiedenen übrigbleibenden Räume haben als Wohnun gen für Angestellte der Oesterreichischen Bundesbahnen Verwendung ge funden .“ 16 Als Wohnungen wurden Räume im Hauptgebäude genutzt, aber auch das Frachtenaufgabe-Gebäude, das Postgebäude, die Signalwerkstät te, die Wagenhalle oder das Verkehrsbüro . 17 Die Heizhauswerkstätten blie ben bis 1930 in Betrieb . „Nunmehr wird aber doch eine Zusammenziehung mit den Floridsdorfer Werkstätten Platz greifen und die Rentabilität der Arbeit vergrößern, wenngleich an Abbau der Angestellten augenblicklich nicht gedacht ist . Die Arbeiter werden in das Floridsdorfer Unternehmen übernommen werden .“ 18
Die riesige Bahnhofshalle, die Güterabfertigung und weitere An lagen standen allerdings leer, dieser Umstand weckte Begehrlichkeiten, di verse Ideen und Pläne wurden präsentiert . Bald begann eine Reihe von Zwi schennutzungen auf unbestimmte Zeit, allerdings mit einer wesentlichen Einschränkung: Auch wenn kaum jemand realistische Chancen auf eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs sah, wollten sich die Bundesbah nen diese Option doch offenhalten . Die Nutzungen sollten ohne größere bauliche Veränderungen stattfinden, die Option auf Wiederaufnahme des Bahnbetriebs sollte bestehen bleiben .
Eine der ersten prominenten Zwischennutzungen des Bahnhofs areals im Jahr 1924 stellten die Dreharbeiten für den Film „Die Stadt ohne Juden“ unter der Regie von Hans Karl Breslauer nach einem Roman von Hugo Bettauer dar, der als erstes filmkünstlerisches Statement gegen den Antisemitismus gilt . Der Plot spielt in einer nahen Zukunft und zeigt einen Staat, in dem die jüdische Bevölkerung für alle Missstände verantwortlich gemacht und daher des Landes verwiesen wird .
16 „Der tote Bahnhof lebt“, S 3
17 Wiener Adressbuch. Adolph Lehmann’s allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Wien, Bd 2, 1938, S 35
18 „Der tote Bahnhof lebt“, S . 3–4 .
80 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 80 04.11.22 11:18
Zwischen den in und vor der stillgelegten Bahnhofshalle abgestell ten Zuggarnituren wurden Szenen des Abschieds vor der fiktiven Deporta tion der Wiener Jüdinnen und Juden gedreht, die am Ende des Films, weil weite Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ohne sie völ lig zusammengebrochen waren, wieder unversehrt zurückgeholt wurden . Im Gegensatz zum fiktiven Ende des Films, in dem die jüdische Bevölkerung wieder zurückkehren darf, sollte sich die tatsächliche Geschichte drama tischer entwickeln . Selbst der Film hat von Anbeginn an unzählige anti semitische Störversuche nach sich gezogen – der Autor des Romans, Hugo Bettauer, wurde 1925 von Nationalsozialisten ermordet . Einzelne Szenen für diesen Film wurden am Nordwestbahnhof gedreht – insbesondere die Deportation der Jüdinnen und Juden . Die Filmeinstellung zu dieser Szene zeigt im Hintergrund das alte (Bahn-)Postamt in der Nordwestbahnstraße, das von den ÖBB dem jüdischen Lauder Chabad Campus übertragen wurde . 19 Knapp ein Jahr nach der Einstellung des Bahnbetriebs schrieb das Neuigkeits-Welt-Blatt: „Nun ist der alte Bahnhof wieder belebt worden, in der großen Abfahrtshalle wird seit Montag die Auszahlung eines Teils der Wiener Arbeitslosen vorgenommen .“ 20 Noch im selben Jahr war zu lesen: „Der aufgelassene Nordwestbahnhof – ein Tennisstadion“ 21 Daraus wurde nichts, und die für den Nordwestbahnhof angekündigte Hygieneausstellung fand im Messepalast statt; umgesetzt wurde dagegen im Winter 1927/28 ein exotisches Projekt: der „Schneepalast“ des norwegischen Skispringers und Unternehmers Dagfinn Carlsen . Er ließ eine Holzrampe mit Skipiste, Rodelbahn und Sprungschanze in die Halle bauen . Statt auf Schnee fuh ren die Wintersportler*innen auf einer Mischung aus Soda und verschie denen Chemikalien zu Tal . 150 Tonnen wurden von einer Chemiefabrik in Moosbierbaum (Niederösterreich) mit Zügen zum Nordwestbahnhof ge bracht – praktischerweise hatte die Skihalle Bahnanschluss . 22 Schlagzeilen machte die Eröffnung am 26 . November 1927 allerdings nicht wegen der ungewöhnlichen und aufwendigen Installation, sondern weil ein Pistolen attentat auf den Wiener Bürgermeister Karl Seitz verübt wurde . 23 Seitz blieb unverletzt, weil der erste Schuss nicht traf und er sich daraufhin im Fond seines Wagens duckte . Dem Schneepalast war trotz diverser sportlicher
19 Eine Originalversion des Films wurde 2014 gefunden und 2018 in restaurierter Fassung wieder gezeigt, diese bildet auch den Kern der aktuellen Ausstellung „Die Stadt ohne“ im Metrokino Siehe: Filmarchiv Austria, „Die Stadt ohne“, Digitorial, www .filmarchiv at/digitorial/die-stadt-ohne/ (28 8 2022)
20 „Der wiederbelebte Wiener Nordwestbahnhof“, in: Neuigkeits-Welt-Blatt, 29 3 1925, S 1
21 „Der aufgelassene Nordwestbahnhof – ein Tennisstadion“, in: Der Tag, 22 7 1925, S 5
22 Vgl Petra Mayrhofer, Agnes Meisinger, „Wintersport in Österreichs ‚alpiner Peripherie‘ am Beispiel des ‚Schneepalasts‘ in der Wiener Nordwestbahnhalle“, in: Matthias Marschik, Agnes Meisinger, Rudolf Müllner, Johann Skocek, Georg Spitaler (Hg ): Images des Sports in Österreich. Innensichten und Außenwahrnehmungen, Wien: Vienna University Press, 2018, S 147–160
23 Vgl z . B . „Revolverattentat auf Bürgermeister Seitz“, in: Der Tag, 27 .11 .1927, S . 1 .
81
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 81 04.11.22 11:18
und gesellschaftlicher Veranstaltungen, der Einbindung von Organisatio nen, wie den Arbeiterturnern, und großem Medienecho in den ersten Wo chen des Betriebs kein kommerzieller Erfolg beschieden . Am 10 . März 1928 meldete Carlsen ein Ausgleichsverfahren an .
Ein Jahr später war zu lesen: „Der Nordwestbahnhof – Zentralauto busbahnhof . Sympathische Zukunftsmusik“ . 24 Es blieb bei der Idee, tatsäch lich genutzt wurde die Abfahrtshalle nach dem Ende des Skivergnügens für Güterlogistik . Die Halle „bietet jetzt einen recht eigentümlichen Anblick . Da, auf dem Bahnsteig, liegen riesige Holzmassen – angeblich russische Qualitätsware zur Klaviererzeugung – dort, wo früher Züge aus- und ein fuhren, türmen sich quer über die Gleise große Holzkisten, Warenballen und Koffer auf . In gewisser Hinsicht ist also die Verbindung mit einst noch erhalten, aber diese Dinge sind nicht wie einst für kurze Zeit bloß hier aus geladen worden, sondern sie sollen ziemlich lange hierbleiben . Denn die Halle ist kein Ausladeplatz der Bundesbahnen, sondern ein Magazin der Speditionsfirma Schenker“ . 25 Als 1933 der Vertrag mit Schenker für die Nutzung der Bahnhofshalle endete, überlegten die Bundesbahnen, sie „als Remise für außer Gebrauch gesetzte oder reservierte Lokomotiven […], die im Freien allzu sehr den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind“,26 zu ver wenden . Parallel wurden wieder verstärkt Ideen für andere Nutzungsformen ventiliert: „Zum Projekt der Umwandlung des Bahnhofes in eine Sporthalle ist auch noch nicht offiziell Stellung genommen worden, weil diesbezüglich noch kein offizielles, wirklich ernst zu nehmendes Anbot vorliegt .“ 27 An fang 1934 tauchte das Projekt des Autobusbahnhofs wieder auf,28 eineinhalb Jahre später sogar erweitert um einen „Flugzeug-Landeplatz“ . 29 Es blieb bei der Idee, genauso wie ein „Zentralobst- und Gemüsemarkt auf dem Nord westbahnhof“ 30 nicht verwirklicht wurde Angesichts des Fehlens einer größeren Sporthalle in Wien überrascht es nicht, dass mehrmals derartige Pläne entwickelt wurden: Von dem „schöne[n] Projekt des Ausbaues der Nordwestbahnhalle zu einem Velodrom und einer Sporthalle großen Stils“ 31 oder einer „Sechstage-Rennbahn in der Nordwestbahnhalle“ 32 war die Rede . Probleme bei der Finanzierung und die Planungsunsicherheit – weil sich 24 „Der Nordwestbahnhof – Zentralautobusbahnhof Sympathische Zukunftsmusik“, in: Die Stunde, 24 3 1929, S 6 25 „Der tote Bahnhof lebt“, S 3–4 26 „Das Projekt der Sporthalle im Nordwestbahnhof“, in: Wiener Allgemeine Zeitung, 1 .12 .1933, S . 7 27 Ebd 28 Vgl „Die Nordwestbahnhalle als Autobusbahnhof“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 10 1 1934, S 11 29 „Bemerkenswerter Vorschlag zum ‚Problem Nordwestbahnhof‘“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 10 .8 .1935, S . 9 . 30 „Zentralobst- und Gemüsemarkt auf dem Nordwestbahnhof“, in: Neues Wiener Journal, 8 6 1934, S 10; „Schaffung eines Obstexportgesetzes“, in: Der Tag, 21 6 1934, S 10 31 „Das Projekt der Sporthalle im Nordwestbahnhof“, 1 12 1933, S 7 32 „Sechstage-Rennbahn der Nordwestbahnhalle“, in: Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, 5 .3 .1934, S . 8 .
82 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 82 04.11.22 11:18

83
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 83 04.11.22 11:18
Antrag der NSDAP zur Nutzung der Nordwestbahnhalle für Propagandaveranstaltungen, 1933; WStLA
die Bundesbahnen nach wie vor die Option einer Wiederinbetriebnahme offenhalten wollten – ließen alle diese Projekte scheitern . Einer Automesse im Nordwestbahnhof war von vornherein geringes Realisierungspotenzial zugeschrieben worden;33 eine geplante weihnachtliche „Verkaufsausstel lung“ stieß auf Widerstand der lokalen Kaufmannschaft . 34
Von Dollfuß zu Hitler: Politische Massenveranstaltungen
Während die diversen kommerziellen Ideen also unverwirklicht blieben, weckte die leer stehende Halle mit Platz für 20 000 Personen, in Gehdistanz vom Stadtzentrum, zudem mit guter Verkehrsanbindung, Begehrlichkeiten politischer Parteien und ihrer Vorfeldorganisationen . Massenveranstaltun gen und Inszenierungen, Rituale der Zurschaustellung von Stärke und der Selbstvergewisserung gehörten zum Repertoire aller Lager . Die Lage im Arbeiterbezirk Brigittenau an der Grenze zur Leopoldstadt – den Stadt teilen mit dem höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil – verlieh manchen Inszenierungen eine zusätzliche Bedrohlichkeit .
Die ersten Veranstaltungen fanden bereits statt, als Schenker & Co die Halle noch gemietet hatte: Am 25 . November 1932 verkündete Bun deskanzler Engelbert Dollfuß beim Bauernbundtag unter großem Beifall ein allgemeines Versammlungsverbot ab 1 . Dezember, damit die „Adventund Weihnachtszeit nicht durch unnötiges Versammlungsgetöse gestört“ werde . 35 Gestört wurde allerdings diese Veranstaltung . „Eine dumm-feige Demonstration von Nationalsozialisten“, schrieb Der Bauernbündler. „Zu Beginn der Tagung im Nordwestbahnhofe erschienen an den Fenstern, die in die Halle führen, einige Hakenkreuzler Es wohnen im Nordwestbahnhof derzeit auch einige Privatpersonen . Die Fenster dieser Wohnungen münden zum Teil in die Halle . Die Hakenkreuzler waren jedoch keine Personen, die im Hause wohnen, sondern Fremde, die sich anscheinend angeschlichen hat ten . Sie warfen vom Klosett (bezeichnend!) Papierhakenkreuze und Flug zettel in die Halle hinunter . Einige Kriminalbeamte und Ordner griffen ein und machten dem Unfug ein Ende . Der Zwischenfall wurde nur von einem kleinen Teile der Versammlungsteilnehmer bemerkt .“ 36 Am 2 . Februar 1934 folgte eine weitere Bauernbunddemonstration mit Schlusskundgebung am Nordwestbahnhof, wenige Tage vor dem österreichischen Bürgerkrieg .
33 Vgl „Die Wiener Automesse 1938“, in: Automobil- und Motorrad-Zeitung. Der Motorradfahrer, 12 .11 .1937, S . 2
34 „Die geplante Weihnachtsausstellung im Nordwestbahnhof“, in: Neues Wiener Tagblatt, 8 11 1932, S 4
35 „Der Wiener Bauerntag“, in: Kleine Volks-Zeitung, 26 11 1932, S 2
36 „Eine dumm-feige Demonstration von Nationalsozialisten“, in: Der Bauernbündler, 3 .12 1932, S . 3 .
84 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 84 04.11.22 11:18



















































































85
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 85 04.11.22 11:18
Die „Wiederbelebung“ des Nordwestbahnhofs durch die NS-Propaganda aus der Sicht des Bundesbahndirektors Rudolf Jary; Verkehrswirtschaftliche Rundschau, 1938, S . 13–15; ÖBB Archiv, Wien

86 1918–1938 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 86 04.11.22 11:18

87
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 87 04.11.22 11:19
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
Zwischen diesen beiden Bauernbundveranstaltungen bejubelten die österreichischen Nationalsozialisten den Regierungsantritt ihrer Ge sinnungsgenossen im Deutschen Reich . Der Tag schrieb von einer „Nazi siegesfeier in der Nordwestbahnhalle – Frauenfeld droht mit dem Bürger krieg“ . 37 Bei der Anmeldung dieser Veranstaltung bat die Wiener NSDAP um Kollaudierung, da sie wiederholt Veranstaltungen abhalten wolle . 38 „Es kam zu dem bekannten Uniform- und Versammlungsverbot, und schließlich nach der Großkundgebung in der Nordwestbahnhalle zur Auf lösung der NSDAP“,39 schrieb Kreisleiter Josef Grießler sechs Jahre später, ein Jahr nach dem „Anschluss“ . Tatsächlich hatte das Verbot der NSDAP wenig mit dieser Kundgebung zu tun Dollfuß führte nach seinem Staats streich noch Geheimverhandlungen mit der NSDAP, erst nach einer massi ven NS-Terrorwelle im Juni 1933 wurde die Partei verboten . Beim Katho likentag im Jahr 1933 nutzte Dollfuß den Trabrennplatz, um seine Vision eines christlichen, deutschen, autoritären Österreichs zu präsentieren, im Praterstadion wurde ein mittelalterliches Historienspektakel als Massen festspiel inszeniert, die Nordwestbahnhofshalle fungierte als Nebenschau platz, in ihr fand ein Generalapell der Ostmärkischen Sturmscharen mit etwa 5 000 Teilnehmer*innen statt 40 Nach der Umsetzung der autoritä ren Visionen im Austrofaschismus wies die Halle für etwa ein Jahr eine beträchtliche Veranstaltungsfrequenz auf: Am 9 . April 1934 wurde eine Kundgebung der „Wiener städtischen Angestellten und Lehrer“ 41 für den der Stadt aufgezwungenen Bürgermeister Richard Schmitz inszeniert . Am 30 . August 1934 fand ein Appell des Wiener Heimatschutzes statt,42 am 9 . Dezember 1934 eine Weihnachtstombola des österreichischen Kriegs opferverbandes . 43 Der Bezirksappell der Vaterländischen Front Leopoldau und Brigittenau mit Kanzler Kurt Schuschnigg am 25 März 1935 war auch der „Wochenschau“ einen Beitrag wert . 44 Mitte 1935 fanden die Politinsze nierungen ein Ende:
„78 Lokomotiven warten jetzt in der Nordwestbahnhalle, um end lich das zu werden, was sie eigentlich schon längst sind: altes Eisen . Die älteste Maschine stammt aus dem Jahr 1891, bis vor kurzer Zeit pustete sie 37 „Nazisiegesfeier in der Nordwestbahnhalle“, in: Der Tag, 7 3 1933, S 3 38 WStLA, M Abt 104, A8/28/Feuer- und Sicherheitspolizei: Theater, Lokale: 33 – Nordwestbahnhof halle, Veranstaltungsanmeldung der NSDAP, März 1938 39 Josef Grießler, „Die Leopoldstadt im Kampf um die Freiheit“, in: Neues Wiener Tagblatt, 12 3 1939, S 6 40 „Jugendtagung im Stadion“, in: Öffentliche Sicherheit, 1933, 13 Jg , Nr 10, S 13 41 Siehe: Kurzmeldungen (2 Spalte), in: Grazer Tagblatt, 10 4 1934, S 10; vgl auch „Kundgebung für Bürgermeister Schmitz“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 10 4 .1934, S . 7 42 „Apell des Wiener Heimatschutzes“, in: Kleine Volks-Zeitung, 31 8 1934, S 3 43 „Österreichischer Kriegsopferverband“, in: Kleine Volks-Zeitung, 2 12 1934, S 5 44 „Waffenkundgebung in der Nordwestbahnhalle“, in: Kleine Volks-Zeitung, 26 3 1935, S 2; „Wochen schau . Österreich in Bild und Ton Ausgabe 13/35 A“, in: Der gute Film, H . 121, 1935, S . 6 .
88 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 88 04.11.22 11:19
jedoch noch als Verschublokomotive durchs Leben . Die meisten anderen Maschinen stammen aus den letzten Vorkriegsjahren . […]
Die tote Halle mit den vielen toten Maschinen bietet einen trauri gen Anblick . Das einzige lebendige in ihr ist ein Schwalbenpaar, das sich den längst ausgekühlten Rauchfang einer alten Lokomotive zum Nestbau auserkoren hat .“ 45 Zwischendurch wurden die Lokomotiven aus der Halle gefahren: Im Jänner 1936 drehte der – als Jude aus Deutschland vertrie bene – Walter Reisch Bahnhofsszenen für die Verwechslungs- und Eifer suchtskomödie „Silhouetten“ mit Luli von Hohenberg in der Hauptrolle der Ballettmeisterin Lydia Samina . 46 Noch war es für einen jüdischen Re gisseur möglich, in Österreich zu arbeiten, in Deutschland wurde der Film allerdings nicht gezeigt . 47 Zwei Jahre später hatte der Nationalsozialismus auch Österreich unter Kontrolle . Für die Nordwestbahnhalle begann wenige Tage nach dem „Anschluss“ mit der Rede von Hermann Göring am 26 . März 1938 ein neuer Nutzungszyklus . Dazu wurde die Halle leer geräumt, die Prellböcke ent fernt, die Schienen mit Schotter bedeckt und die Einfahrtsseite der Halle geschlossen . 48 Eine Woche später folgte Joseph Goebbels; die Rede war, weil des Reichspropagandaministers „Stimme überanstrengt ist [und] we gen der rauhen Witterung“,49 vom Heldenplatz in die Nordwestbahnhalle verlegt worden . Sie unterbrach die Arbeiten an der Dekoration für den Auf tritt Adolf Hitlers am 9 . April 1938, einen Tag vor der „Volksabstimmung“ . „Der künstlerische Entwurf wurde von Professor Popp, dem kommissari schen Leiter der Akademie der bildenden Künste gemacht, dem Architekt Ubl zur Seite stand .“ 50 Mit dem Behrens-Schüler Alexander Popp, seit 1935 NSDAP-Mitglied, stand ein Architekt übergangslos dem neuen Regime zur Verfügung, der vor allem mit der Linzer Tabakfabrik Bekanntheit erlangt hatte . 51 Die Gestaltung betraf nicht nur die Halle selbst, sondern bezog die Umgebung mit ein: Vor dem Bahnhof wurden zwei Pylonen mit Haken kreuzen an der Spitze errichtet . Die dekorierte Halle konnte bis zum Be ginn der Aufbauarbeiten für die Propagandaausstellung „Der ewige Jude“ besichtigt werden .
45 „Lokomotivfriedhof Nordwestbahnhalle“, in: Illustrierte Kronen-Zeitung, 26 6 1935, S 7
46 „Theater, Film und anderes“, in: Das interessante Blatt, Nr 3, 16 1 1936, S 12; Filmarchiv Austria, „Silhouetten“, 1936, www filmarchiv at/program/film/silhouetten/ (30 7 2022)
47 Christian Maryška, „Eine Mikrogeschichte Wiener Plakate um 1935“, in: Austrian Posters, Beiträge zur Geschichte der visuellen Kommunikation, 20 2 2021, www austrianposters at/2021/02/20/einemikrogeschichte-wiener-plakate-um-1935/ (30 7 2022)
48 Rudolf Jary, „Vergangenheit und Gegenwart des Wiener Nordwestbahnhofs“, in: Verkehrswirt schaftliche Rundschau, 1938, S . 13 .
49 „Der Wiener Besuch Dr Goebbels“, in: Das kleine Volksblatt, 29 3 1938, S 2
50 Jary, „Vergangenheit und Gegenwart“, 1938, S 13
51 Az W: Architektenlexikon Wien 1770–1945, „Alexander Popp“, www architektenlexikon at (30 .7 .2022)
89
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 89 04.11.22 11:19
Der Nordwestbahnhof in Konzepten der Stadt- und Verkehrsplanung
Mit dem „Anschluss“ hatten Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzepte für Wien Hochkonjunktur . Beim Bahnverkehr war die Problemstellung keine neue, die Unzufriedenheit mit den Wiener Kopfbahnhöfen und die dar an anknüpfenden Überlegungen, den Personenverkehr an einem Zentraloder an zwei bis drei Gruppenbahnhöfen zu bündeln, sind fast so alt wie die Bahnhöfe selbst . Schon der irische Eisenbahningenieur Joseph Fogerty hatte sie 1881 im Zusammenhang mit dem Nahverkehrskonzept „Wiener Gürtelbahn“ formuliert 52 In einer Schrift aus dem Jahr 1923 schlug der Elektrotechniker Carl Hochenegg, damals bereits pensionierter Professor der Technischen Hochschule, vor, in Heiligenstadt einen Gruppenbahnhof für die Franz-Josefs-, die Nord- und Nordwestbahn zu errichten . Mit den anderen Bahnhöfen und Stadtteilen sollte er mittels U-Bahn und Stadtbahn verbunden werden . 53 Realistische Chancen auf Umsetzung hatte dieses Pro jekt angesichts der Wirtschaftslage und der Prioritäten von Bund und Stadt Wien nicht . Es zeigt aber ein Bewusstsein dafür, dass die Infrastruktur des Schienenverkehrs den Anforderungen einer Zwei-Millionen-Stadt nicht ent sprach . Die Verbindung zwischen den Kopfbahnhöfen war mangelhaft, die Bahnhöfe selbst veraltet – und angesichts der längst abgeschlossenen Ver staatlichung aller großen Bahnlinien und der nunmehrigen Randlage Wiens schien eine Reduktion der Bahnhöfe naheliegend . Die Schließung des Nord westbahnhofs bildete eine Minimallösung, die Ideallösung aus der Sicht vie ler Verkehrsplaner*innen hieß Zentralbahnhof, im größeren Zusammenhang zeigen sich dabei unterschiedliche, bisweilen widersprüchliche Konzep te für den Nordwestbahnhof, die von Aufwertung bis Schleifung reichen Eher kurios mutet die in einem Leserbrief formulierte Idee zur Re aktivierung des Nordwestbahnhofs für den Personenverkehr an: Erweckung könne die U-Bahn bringen, die mit französischem Kapital demnächst gebaut würde, allerdings nur bis zum Donaukanal, das sei zu wenig, so der ehema lige Eisenbahner: „Eine nicht sehr kostspielige, aber für den Verkehr sehr günstige Fortsetzung würde sie erhalten, wenn sie unter dem Donaukanal und unter einem Teil der Taborstraße bis zum Augarten geführt würde . Im Augarten kann sie an das Tageslicht steigen, im Augarten selbst, und zwar am Rande desselben, parallel zur Taborstraße weitergeführt werden [und] beim Nordwestbahnhof […] Anschluß an die tote Nordwestbahnstrecke finden . […] Große Städte, Floridsdorf, Korneuburg, Stockerau, und die auf
52 Vgl Roman Hans Gröger, Die unvollendeten Stadtbahnen. Wiener Schnellverkehrsprojekte aus den Akten des Österreichischen Staatsarchivs, Innsbruck/Wien u a : StudienVerlag, 2010, S 54–57
53 Vgl . ebd ., S . 118–121 .
90 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 90 04.11.22 11:19
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
strebenden Orte, beziehungsweise Sommerfrischen Lang-Enzersdorf und Bisamberg liegen an dieser Strecke . Die Untergrundbahn wäre lebensfähig und rentabel, und der Nordwestbahnhof würde plötzlich zu kräftigem Le ben erwachen .“ 54 Diese Verkehrsprognose klingt fast so realistisch wie die Hoffnung auf „französisches Kapital“ . Neu war die Idee der Anbindung an das U-Bahn-Netz nicht, bereits der Vorschlag der „Kommission für Ver kehrsfragen“ aus dem Jahr 1911 sah sie vor, im darauf aufbauenden Plan aus dem Jahr 1914 endete sie allerdings am Praterstern . Im Entwurf der Städtischen Straßenbahnen von 1928 bindet einer der beiden die Donau querenden Stränge der U2 den Nordwestbahnhof ein . 55 Ausgehend von den nach 1918 und – nach einem Aufschwung in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre – als Folge der Weltwirtschaftskrise neuerlich stark gesunkenen Verkehrszahlen entwickelte Erich Kuschel 1934 in seiner Dissertation an der Technischen Hochschule Wien den Plan eines Zentralbahnhofs an der Stelle des Ostbahnhofs . 56 Bemerkenswert ist die direkte Anbindung an einen Stadtflughafen auf dem Gelände des Arsenals . Die bisherigen Bahnhöfe sollten weiter für den Nahverkehr genutzt wer den, der Güterverkehr würde verteilt abgewickelt, den Nordwestbahnhof sah Kuschel für den Sammelladungsverkehr durch Speditionen vor 57 Im Jahr 1935 veröffentlichte Erwin Ilz, Professor an der Techni schen Hochschule Wien, seine Studie Wiener Verkehrsfragen – Zentralbahn hof und Nahverkehr. Er verwendet die Metapher des Stadtorganismus und postuliert die Notwendigkeit einer zentralen Planung . „Ein solcher Or ganismus […], muß von e i n e m [Hervorhebung im Original] beherrscht sein, der jedem Glied – sei es ein Verkehrsband, eine Freifläche oder ein Baugebiet – Raum und Wirkungskreis vorschreibt .“ 58 Innerhalb der Stadt planung ergebe sich wiederum eine „Spitzenstellung der Verkehrsfragen“ und „obenan […] im Gerüst der städtischen Verkehrsfragen [stehen] somit die Fernbahnen […] . Das Herzstück des Fernbahnnetzes eines Landes ist der hauptstädtische Zentralbahnhof“ . 59 Er solle ausschließlich dem Fern verkehr dienen, Nahverkehr sei eine grundlegend andere Verkehrsaufgabe, die Trennung eine Notwendigkeit, um Höchstleistungen zu erzielen . Ein leistungsfähiger Nahverkehr sei wiederum notwendig, um eine Auflocke
54 „Anregungen und Beschwerden“, in: Kleine Volks-Zeitung, 24 2 1930, S 10
55 Johann Hödl, Das Wiener U-Bahn-Netz: 200 Jahre Planungs- und Verkehrsgeschichte. Dieses Buch erschien anlässlich des Jubiläums „40 Jahre U-Bahn-Bau in Wien“ (3 November 1969 – 3 Novem ber 2009), hg von Wiener Linien GmbH & Co KG, Wien: Wiener Linien, 2009, S 210–213
56 Erich Kuschel, Zentralfernbahnhof Wien, Diss , TH Wien, 1934
57 Vgl Andreas Suttner, Das schwarze Wien. Bautätigkeit im Ständestaat 1934–1938, Wien u . a : Böhlau Verlag, 2017, S 63–67; Kuschel, Zentralfernbahnhof, S 56
58 Erwin Ilz, Wiener Verkehrsfragen. Zentralbahnhof und Nahverkehr, Wien/Leipzig: C Gerolds Sohn, 1935, S 6
59 Ebd .
91
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 91 04.11.22 11:19
rung der Besiedlung möglich zu machen . Aus gesundheitlichen Gründen schon länger propagiert, sprächen derzeit drei Gründe dafür: „Siedlungs bewegung, Altstadtsanierung und Luftschutz“ . 60 Ilz schlug eine Übersied lung von 500 .000 Menschen in Mietskasernen der Vorkriegszeit an der Peripherie vor .
Als wichtigste bisherige Impulse betrachtete er die Nahverkehrs konzepte Hocheneggs, auch wenn er dessen Idee von Gruppenbahnhöfen für den Fernverkehr verwarf, weil der Fernverkehr nach Norden und Nord osten weit schwächer sei als in der Monarchie . Für den innerstädtischen Ver kehr sah Ilz ein U-Bahn-Netz vor . Die Umsetzung eines derartigen Konzepts würde Jahrzehnte dauern, es sei aber wichtig, die ersten Schritte bald zu setzen: „Am wünschenswertesten erscheint wohl die Beseitigung der teils schon aufgelassenen, teils noch in Verwendung stehenden Bahnhofsruinen, nämlich Nordwestbahnhof, Franz-Josefs-Bahnhof und Westbahnhof .“ 61 Verkehrsplanung sei nicht Selbstzweck, sondern zentrales Instrument der Raumplanung: „Unser Ziel soll sein, die Umsiedelung der Stadtbevölkerung und diese Umsiedelung soll wieder den Weg öffnen zu einer durchgreifen den Neugestaltung der Stadt im Hinblick auf die Erfordernisse der Wirt schaft und der Gesundheit sowie der Sicherheit im Kriegsfall “ 62 Damit führt ein direkter Link zu nationalsozialistischen Städtebaukonzepten, etwa der nicht zuletzt aus Gründen des Luftschutzes im Kriegsfall propagierten Reduktion der Siedlungsdichte – und dem Bau eines Zentralbahnhofs . Ilz argumentierte ihn zwar mit der Entflechtung von Nah- und Fernverkehr, ohne Wien als Knotenpunkt eines Verkehrsnetzes mit relevanten Fernver kehrsströmen auch aus Norden und Nordosten zu denken, ergibt er wenig Sinn . Im September 1938, knapp ein halbes Jahr nach dem „Anschluss“, veröffentlichte Ilz eine überarbeitete und erweiterte Version seiner Über legungen . Die Pläne zum Schienenverkehr blieben weitgehend unverändert, dem Fernverkehr kam eine größere Bedeutung als 1935 zu . Vor allem aber konkretisierte Ilz seine Umsiedelungspläne durch Gebietszuweisungen, und der Autoverkehr erhielt nun eine wichtige Rolle . Eine Leerstelle blieb: „Über die großen Anlagen der Donauhäfen, Flugplätze, Kasernen und Trup penübungsplätze, der Industriestätten und sonstigen Güterverkehrsanlagen zu sprechen, ist hier nicht der Platz .“ 63 Klar wird aus seinen Ausführungen hingegen, dass der Nordwestbahnhof auch als Güterbahnhof verschwinden müsse . In Erweiterung des Augartens sollte das Areal Teil eines Grünkeils durch den 2 . und 20 . Bezirk werden .
60 Ilz, Verkehrsfragen, S 10
61 Ebd , S . 25–26 .
62 Ebd , S 25
63 Erwin Ilz, „Der Gau Wien im Rahmen der Landes- und Stadtplanung“, in: Raumforschung und Raumordnung, 2 Jg , H 9, 1938, S 430–439, hier 439
92 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 92 04.11.22 11:19
Mit seinen Konzepten von Siedlungsauflockerung lag Ilz im raum planerischen Mainstream des Nationalsozialismus, die schon 1935 formu lierte Dimension seiner Umsiedelungspläne passt zu dessen Gigantomanie . Theoretisch hätte der autoritäre Zentralismus des Nationalsozialismus auch die Voraussetzungen für eine Planungshierarchie im Ilz’schen Sinn gebo ten . In der Praxis zeigte sich, gerade am Beispiel Wien, ein Kompetenzge wirr mit neben- oder gegeneinander laufenden Planungen von städtischen, Partei- und staatlichen Stellen, verschärft durch Konkurrenzkämpfe und Willkür . Dazu kamen auf inhaltlicher Ebene bisweilen Widersprüche zwi schen den funktionalen Ansprüchen einer Verkehrsinfrastrukturplanung und den Konzepten monumentaler Repräsentation von Staat und Partei 64
Die erste von einer offiziellen Stelle unterstützte Planung stammt von dem Berliner Architekten Franz Pöcher, der schon vor dem „Anschluss“ Überlegungen für Wien angestellt hatte und den Wiener Gauleiter Odilo Globocnik dafür begeistern konnte . Pöcher, der im Büro von Albert Speer arbeitete, entwarf eine großflächige axiale Anbindung Wiens an die Donau, ohne Rücksicht auf die vorhandene Bausubstanz und deren Bewohner*in nen, die „jüdische“ Leopoldstadt sollte verschwinden, aus Sicht der NS-Ideo logie mehr als nur ein wünschenswerter Nebeneffekt Auch für die wenig repräsentativen Frachtenbahnhöfe Nordbahnhof und Nordwestbahnhof war kein Platz mehr . 65 Als Reaktion auf Pöchers Planungen wurde das Stadtbauamt aktiv und entwickelte die „1 . Wiener Lösung“, die aber mangels Monumentali tät den nationalsozialistischen Vorstellungen nicht entsprach . Anders die „2 . Wiener Lösung“: „Ohne Rücksicht auf den historischen Baubestand schlagen die Planer geradlinig geführte Aufmarschstraßen quer durch be bautes Wohngebiet “ 66 Die Aufmarschstraßen führen zu einem Aufmarsch platz auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs, ergänzt von der „Ostmark halle“ im Nordwesten . Bürgermeister Hermann Neubacher beauftragte sechs Experten mit der Begutachtung dieses Entwurfs, das Ergebnis waren die „Professo renvorschläge“, die im Herbst 1938 vorlagen . Bemerkenswert ist der unter schiedliche Umgang mit dem Areal des Nordwestbahnhofs: In keinem die ser Vorschläge wird es zum Aufmarschplatz . Beim schon erwähnten Plan von Erwin Ilz (verfasst mit Robert Örley) wird es Teil eines Grünkeils, bei
64 Vgl Siegfried Mattl, „Nationalsozialistische Planungsinstitutionen“, in: ders , Gottfried Pirhofer, Franz J Gangelmayer, Wien in der nationalsozialistischen Ordnung des Raums. Lücken in der WienErzählung (VWI Studienreihe, Bd . 3), Wien: new academic press, 2018, S . 17–128 .
65 Vgl zu Pöchers Planungen: Ingrid Holzschuh, Wiener Stadtplanung im Nationalsozialismus von 1938 bis 1942: Das Neugestaltungsprojekt von Architekt Hanns Dustmann, Wien: Böhlau Verlag, 2011, S 24–30
66 Ebd ., S . 34, Abb . S 35, 36 und 37 .
93
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 93 04.11.22 11:19
Achsenplanung zur Überbauung der Leopoldstadt einschließlich der Bahnhöfe; Hanns Dustmann, „Führervorlage“, Wien, städtebauliche Studie, 1941; Archiv Klaus Steiner, Architekturzentrum Wien, Sammlung

94 1918–1938
N 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 94 04.11.22 11:19

95
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 95 04.11.22 11:19
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
Franz Schuster bleibt der Bahnhof bestehen, ebenso bei Hermann Stroebel (mit Karl Köster) und Roman Heiligenthal . „Die Professorenvorschläge sind als Konsensfindung zwischen staatlicher und kommunaler Planungsbehör de zu verstehen, die hierdurch das Gebiet für die Neugestaltung der Stadt endgültig festlegen konnte .“ 67
Das bedeutete aber nicht das Ende weiterer Planungen: Der Kunst historiker Josef Strzygowski skizzierte 1939 ein neues Stadtzentrum in der Leopoldstadt, in der die Ringstraße ihre Fortsetzung finden sollte, ein Forum an der bzw . über die Donau würde den krönenden Abschluss bilden . Er befasste sich aber auch mit der Verkehrssituation, ging dabei auf die un befriedigende Situation mit den sieben Kopfbahnhöfen ein, von denen noch dazu die meisten aus den 1870er-Jahren stammten, also veraltet wären . Der Nordwestbahnhof sollte nach seinen Plänen die Rolle des innerdeutschen Fernverkehrsbahnhofs übernehmen, der Südbahnhof den Fernverkehr ins Ausland nach Süden und Osten abdecken . „Diese Zweiteilung entspricht den gegebenen Verhältnissen besser als ein einziger Zentralbahnhof . Dem innerdeutschen Verkehr nach Norden und Westen steht der Auslandsver kehr gegen Süden und Osten gegenüber . […] Beide Bahnhöfe müssen in radialer Richtung angeordnet und unterirdisch verbunden sein […] Der neue ‚Nordwestbahnhof‘ wäre im Raum des alten, heute unbenützten, zu errichten . Eine Kopffront wäre gegen das Forum gekehrt . Zwischen dem Bahnhof und der Donau, zwischen Innstraße und Forum könnte ein neues Hotelviertel entstehen . Ebenso wie die Stationen der Untergrundbahnen könnten die Hotels mit dem Bahnhof unterirdisch verbunden sein . In die sem Empfangsbahnhof von Wien würden alle Fernzüge von Westen und Norden einlaufen, zum Teil über die neu gestaltete Nordwestbahnbrücke . “ 68
Der Frachtenverkehr würde im inneren Stadtgebiet auf die beiden Haupt bahnhöfe beschränkt bleiben, auch wegen ihrer guten Anbindung zur Do nau, dazu kämen ein Frachtenbahnhof links der Donau und „die Erbauung eines großen Verschiebe- und Frachtenbahnhofs zwischen Himberg und Gramatneusiedl“ . 69
Im Herbst 1940 wurde der Berliner Architekt Hanns Dustmann zum Baureferenten bestellt . Damit wurde im „Ringen der kommunalen In stanzen mit der Reichsebene um die Vormachtstellung in der Stadtplanung […] die zentralistische Kontrolle durchgesetzt“,70 schreibt Ingrid Holzschuh . Dustmann verantwortete in der Folge umfassende Neugestaltungsprojek te, in denen der Nordbahnhof als Hauptbahnhof und ein Gauforum im 67 Holzschuh, Wiener Stadtplanung, S 43, Abb . S . 41 .
68 Josef Strzygowski, „Wiens Stadtkern, die Innere Stadt, bis an die Donau verlängert“, in: Nachrich tenblatt des Vereines für Geschichte der Stadt Wien, 56 Jg , Nr 3, 1939, S 37–64, hier 52–53
69 Ebd , S 55
70 Holzschuh, Wiener Stadtplanung, S 9, Abb . der Modellfotos S . 11–15 .
96 1918–1938
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 96 04.11.22 11:19
Bereich des Augartens eine zentrale Rolle spielen . Den Hauptbahnhof sah er „als nördlichen Abschluss eines repräsentativen, neuen Stadtviertels an der Donau“ vor, wie Gottfried Pirhofer schreibt . „Das jüdische Wien in der Leopoldstadt sollte dafür ausgelöscht werden . Das neue Viertel erforderte (aus ästhetischer und urbanistischer Sicht der Planer) die Beseitigung der bestehenden Kopfbahnhöfe . An ihre Stelle sollte ein Bahnhof mit neuer Funktion treten: ein Wiener Zentralbahnhof, den es als ‚Eintrittstor zur Stadt‘ zur Inszenierung des NS-Staates und der Partei zu entwerfen galt .“ 71 Von Dustmanns Überlegungen sind keine Pläne, allerdings Modellfotos er halten . Der Nordwestbahnhof bildet in diesem Modell eine Leerfläche, an der Front der Taborstraße ist allerdings eine Blockverbauung vorgesehen Es ging der NS-Planung auf dieser Ebene weniger um Verkehrsplanung, schon gar nicht um Güterlogistik, sondern um architektonische und stadt planerische Monumentalität, kombiniert mit der nationalsozialistischen Ideologie und Praxis der Judenverfolgung .
Die Bahnhofsareale, auch der Nordwestbahnhof, standen also wei ter zur Disposition – zumindest in der Theorie, so auch im Grünflächenplan von Roland Rainer aus dem Jahr 1941: „Die ‚Kopfbahnhöfe mit umfangrei chen, tief in das Baugebiet einschneidenden Gleisanlagen‘ sollten im Zuge der Planungen der Donauhäfen und des Zentralbahnhofs beseitigt werden . [ . . .] Die Areale des Nord- und Nordwestbahnhofs würden nach Fertigstel lung der neuen Donauhäfen der Aufgabe als Kohlenbahnhöfe ‚enthoben‘ sein, und ihre Umwandlung in Grünflachen ermögliche ‚eine fast lückenlose Verbindung des Augartens mit den Praterauen und damit die Wiederherstel lung eines Teiles jener natürlichen Grünflachen, die durch die Donauregulierung verloren gegangen sind‘ [ . . .] .“ 72 1941 wurden die Planungen für einen Hauptbahnhof im Norden oder Nordosten eingestellt Zumindest auf dem Papier hatte sich die Reichsbahn mit ihren Vorstellungen eines Hauptbahn hofs im Bereich von Süd- und Ostbahnhof durchgesetzt, das Projekt durfte als „kriegswichtig“ weiterverfolgt werden . Gebaut wurde davon allerdings nichts . Der Nordwestbahnhof wurde – wie andere Bahnhöfe auch – zum Ort von „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Kriegslogistik .
71 Gottfried Pirhofer, „Die Widersprüche der Bahnnetzplanung“, in: Mattl, Pirhofer, Gangelmayer, Wien, 2018, S 159–165, hier 160
72 Ebd ., S . 56 .
97
Speditionsbahnhof und Zwischennutzung statt Personenverkehr
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 97 04.11.22 11:19
„Der ewige Jude“ Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung





















Portalgebäude der Nordwestbahnhalle an der Taborstraße mit dem großen Plakat zur Ausstellung, 1938; ÖNB Bildarchiv Austria

98 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 98 04.11.22 11:19
Am 2. August 1938 wurde in der stillgelegten Halle des Nordwestbahn hofs die große antisemitische Hass-Ausstellung „Der ewige Jude“ eröffnet, die auch in der nunmehrigen „Ostmark“ die Legitimation für die barbarischen Judenverfolgungen liefern sollte.1 Als Wanderausstellung konzipiert, wurde „Der ewige Jude“ zuerst ab 8. November 1937 in München gezeigt. Die Ausstellung und die drastische Berichterstattung sollten den Beginn einer seit Längerem vorbereiteten mas siven „Arisierungswelle“ im Deutschen Reich begleiten und legiti mieren. In 20 Sälen auf insgesamt 3.500 Quadratmetern wurde – wie der Historiker Wolfgang Benz argumentiert – „mit denunziatorischen Gesten, dem Appell an stereotype Feindbilder und der Wiederholung diffamierender Behauptungen die schlichte Weltsicht eines Rassenantisemitismus propagiert, der im 19. Jahrhundert entstanden war, sich aber erst nach dem Ersten Weltkrieg als programmatisches Element rechtsextremistischer, ultrakonservativer und deutschnationaler Agitation voll entfalten konnte“.2 Die Ausstellung bemühte dabei auf den ersten Blick sachliche und scheinwissenschaftliche Statistiken, Diagramme und Darstellungstechniken in musealem Ambiente. Unterbrochen wurden sie von überzeichneten Karikaturen oder Fratzen bis hin zu regelrechten Gruselkabinetten, in denen mit dramatischen Beleuchtungseffekten, wandfüllenden Fotomontagen sowie dem Einziehen niedriger Decken und schräger Wände eine physisch bedrückende Desorientierung erzielt wurde. Völlig enthemmt wurde dabei Judentum mit Bolschewismus, Freimauerei, Wucher und kulturellem Verfall gleichgesetzt, wurde die „jüdische Unterwanderung“ oder Dominanz ganzer Berufsgruppen beklagt und konkrete lebende Persönlichkeiten diffamiert. Dabei werde – wie es Reichspropagandaminister Joseph Goebbels in seiner Eröffnungsrede zynisch formulierte – authentisches Material objektiv vorgeführt, das „hieb- und stichfest in jeder Richtung“ sei und das sich gleichzeitig als „so grauenvoll, dass es mit Worten gar nicht mehr geschildert werden kann“, darstelle.3
In der Ausstellung wurde auch das Medium Film prominent eingesetzt: In einem 200 Personen fassenden Kino in der Mitte der Ausstellung zeigte ein 20-minütiger Zusammenschnitt unter dem Titel „Juden ohne Maske“ Szenen jüdischen Filmschaffens vor 1933, der dokumentieren sollte, „welchen Schmutzkübel dieses über Deutschland
1 Wolfgang Benz, „Der ewige Jude“: Metaphern und Methoden nationalsozialistischer Propaganda (Reihe Dokumente, Texte, Materialien, Zentrum für Antisemitismusfor schung der TU Berlin, Bd. 75), Berlin: Metropol, 2010.
2 Ebd., S. 66–68.
3 „Dr. Goebbels eröffnet Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Münchner neueste Nach richten, 9.11.1937, Titelseite, zit. nach Rosemarie Burgstaller, „Verhöhnung als inszeniertes Spektakel im Nationalsozialismus. Die Propaganda-Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Lucile Dreidemy, Richard Hufschmied, Florian Wenninger u.a. (Hg.), Bananen, Cola, Zeitgeschichte. Oliver Rathkolb und das lange 20. Jahrhun dert, 2 Bde., Bd. 1, Wien u.a.: Böhlau Verlag, 2015, S. 346–356, hier 349.
99
„Der ewige Jude“ – Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 99 04.11.22 11:19
ausgeschüttet hat“.4 Dabei wurde bewusst Fiktion als Fakt kommuniziert: „So war der Jude nicht nur im Film, so war er in Wirklichkeit!“ So wie der jüdische Schauspieler Peter Lorre, der im Film „M Eine Stadt sucht einen Mörder“ einen Kindermörder spielt, sich in einer Szene selbst der Taten bezichtigt und um Erlösung bettelt, so wird in der Propaganda das Judentum generell bezichtigt und zu dessen eigener Erlösung für vogelfrei erklärt: „Nur ein Jude konnte solche Verbrecher mit solcher Leibhaftigkeit darstellen, daß Rolle und Spieler eins geworden zu sein scheinen! Wen packt da nicht das Grauen, wenn dieser Jude, den Verbrecher aus innerstem Antrieb spielend, unschuldige Opfer an sich lockt, plötzlich gefasst wird und dann winselnd und hysterisch fast wie ein Wahnsinniger dem Gericht demonstriert, dass er doch morden m u s s [im Original gesperrt], weil er sich nicht gegen sein Inneres wehren kann [...] Es konnten nur Juden sein, die solche Szenen drehten.“5 Darüber, wie mit Jüdinnen und Juden umgegangen werden sollte, ließ die Ausstellung in München keinerlei Zweifel: Schon im ersten kreisrunden Raum wurden die von der NS-Rassenideologie behaupteten „biologischen“ Grundlagen des Judentums gezeigt, illustriert unter anderem mit extrem vergrößerten Darstellungen physiognomischer Wachsmoulagen von Nasen, Ohren und Augen, die an Jüdinnen und Juden in Konzentrationslagern abgenommen wurden, als wäre dadurch die „Authentizität“ der scheinwissenschaftlichen Forschung bewiesen. In weiteren Räumen wurden Konzentrationslager zynisch als ideale Aufenthaltsorte für Jüdinnen und Juden dargestellt. Und im letzten Raum wurden als Abschluss die Nürnberger Rassengesetze als Werkzeug zur Erlösung des deutschen Volkes vom Judentum propagiert.
Das Neue Wiener Tagblatt hatte die Münchner Ausstellung im November 1937 auf ihrer Titelseite noch schockiert als „eine einzige Aufforderung zum Pogrom“ kritisiert.6 Anlässlich der Vorankündigung und Berichterstattung über die Eröffnung in Wien am 2. August 1938 übte sie sich hingegen genau so wie die anderen mittlerweile politisch gleichgeschalteten Zeitungen nur mehr in Superlativen: Wien wurde nun unisono als „Stammstadt des Antisemitismus“ gerühmt, hätten doch „dessen Vorkämpfer Schönerer und Lueger hier gewirkt“.7 Wien habe ja in besonderem Maße unter jüdischer Überfremdung gelitten,8 die sich insbesondere am Standort der Ausstellung, an der Grenze des 20. und 2. Bezirks, jener Wiener Bezirke mit den höchsten
4 Dieselben Filmsequenzen und dieselbe Argumentation bildeten auch die Basis für den Propaganda-Film „Der ewige Jude“ von Fritz Heppler, der im November 1940 in Berlin Premiere haben sollte.
5 „Juden ohne Maske. Film in der Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Magdeburger-Gene ral-Anzeiger, 24.5.1939, zit. nach Benz, „Der ewige Jude“, S. 135–136.
6 „Der ewige Jude“, in: Neues Wiener Tagblatt, 12.11.1937, Titelseite.
7 „Vorschau auf die Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Neues Wiener Tagblatt, 30.7.1938, S. 5.
8 „Der ewige Jude“, in: Wiener Zeitung, 30.7.1938, S. 3.
100 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 100 04.11.22 11:19
ewige Jude“ Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung
Werbeplakat und Sonderpostkarte zur Ausstellung „Der ewige Jude“, publiziert unter der Verwendung des Pseudonyms „Horst Schlüter“, 1938; ÖNB Bildarchiv Austria

101
„Der
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 101 04.11.22 11:19


102
Fleck Nordwestbahnhof
Blinder
Zeitachse mit Darstellungen der von der NS-Propaganda behaupteten Vergehen der Jüdinnen und Juden, vom Ur-Judentum bis zur Gegenwart, fotografiert beim Aufbau der Wiener Ausstellung „Der ewige Jude“,1938; Foto: Bildstelle Gau Wien, ÖNB Bildarchiv Austria
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 102 04.11.22 11:19
Pseudowissenschaftliche Darstellung der jüdischen Rasse im ersten Raum der antisemitischen Wanderausstellung „Der ewige Jude“, fotografiert im Deutschen Museum München,1937; BArch Berlin
Anteilen jüdischer Bevölkerung, so offenkundig darstelle. Daher wurde hervorgehoben, wie wichtig diese Ausstellung für Wien und wie großartig die Wiener Erweiterung um sechs zusätzliche Räume für das Verständnis oder die Überzeugungskraft des Gesamtprojektes sei, sodass die Ausstellung erst in Wien „ihre Krönung“ erfahren habe, „in der Stadt der antisemitischen Tradition“.9
„Nirgends im Gebiet des Deutschtums war die Judenfrage so brennend, wie hier in Wien, nirgends war auch der Einfluss des Judentums so entsetzlich übermächtig wie bei uns.“10 „Hat man hier doch sicher auch nicht ohne Grund die Ausstellung gerade in der Nordwestbahnhalle untergebracht, auf daß sie sich hier mitten in der Leopoldstadt wie eine Trutzburg des Deutschtums erhebe.“11 Denn gerade über die Taborlinie seien die Ostjuden eingewandert, um sich in der Leopoldstadt und in der Brigittenau einzunisten. Besucher*innen, die sich die Ausstellung ansehen wollten oder dazu gezwungen wurden (wie z.B. 350.000 Wiener Schüler*innen), reisten mit den Straßenbahnlinien 2 oder 5 durch die beiden Stadtteile an und nach der verhetzenden Wirkung der Ausstellung wieder durch dieselben Stadtteile ab mit einem durch die Ausstellung geprägten Blick auf deren jüdische Bevölkerungsgruppe. „Es ist daher mehr als nur ein Symbol, wenn das Bild des ewigen Juden am Eingang der Nordwestbahnhalle diese beiden Bezirke beherrscht.“12
Erfolgte der Zugang zur Bahnhofshalle während des Personenverkehrsbetriebes bis 1924 über die Längsseite an der Nordwestbahnstraße, so wurde der Eingang zur Ausstellung nun genau in die Mitte der Stirnseite des Portalgebäudes an die Taborstraße verlegt. Hier konnte das riesige Plakat, das auf gelbem Grund das Zerrbild eines bärtigen Juden zeigte, eine offene Hand mit Münzen nach vorne gereckt, in der anderen Hand eine Geißel und unter dem Arm eine Weltkarte des Bolschewismus geklemmt, im Einklang mit der Architektur eine monumentalere Wirkung entfalten und schon von Ferne zur Geltung kommen.
In der dahinterliegenden großen Halle wurde durch Errichten einer Trennwand, künstliche Säulen und Abhängen einer niedrigen Decke ein 800 Quadratmeter großer feierlicher Vorraum in Form einer Säulenhalle geschaffen, dessen einziges Exponat, eine Ehrentafel mit Inschrift einem Hitler-Zitat aus Mein Kampf der Wiener Ausstellung das Motto voranstellte: „Ich war (in Wien) vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden.“ Diese Tafel bildete den Hintergrund für die Eröffnungsreden des Reichsstatthalters,
9
10
11
„Vorschau auf die Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, S. 5.
„Juden sehen Dich an! Die große politische Schau: Der ewige Jude“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 30.7.1938, S. 5.
„Der ewige Jude“, 30.7.1938, S. 3.
12 Peter Payer, „Jüdisches Leben in der Brigittenau. Ein Rundgang zu den stummen Zeu gen der Vergangenheit“, in: Gerhard Blöschl, Brigittenau. gestern, heute, morgen, Wien: Verein Bezirksmuseum Brigittenau, 1999, S. 111–121.
103
„Der ewige Jude“ Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 103 04.11.22 11:19
1 Nur für Wien: Vorhalle mit Zitat des „Führers“ aus Mein Kampf
2 Die „biologischen Grundlagen des Judentums“































































3 Eine 45 Meter lange Zeitachse mit angeblichen Vergehen des Judentums
4 Collage aus Filmszenen in einem Kino für 200 Personen
5 Denunziationen nach „unterwanderten Berufsgruppen“ geordnet
6 Die Nürnberger Gesetze bildeten in der Münchner Ausstellung den Abschluss .
7 Erweiterung der Fläche um ein Drittel für die Wiener Ausstellung
8 Die Wiener Apotheose: Der „Führer“ fährt als „Befreier“ in Wien ein .
104 3
6
3
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 104 04.11.22 11:19
6 7 8
„Der ewige Jude“ – Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung



















































Einreichplan der Ausstellungseinbauten in der Nordwestbahnhalle, 1938; WStLA












105
5
2 4 5 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 105 04.11.22 11:19
1
Arthur Seyß-Inquart, und des Gauleiters, Odilo Globocnik, die über Wochenschauen in die Kinos getragen und in fast allen Zeitungen nach gedruckt wurden.
Durch einen vergleichsweise kleinen Eingang neben diesem Leitspruch erreichten die Besucher*innen die eigentliche Ausstellung, die eine Fläche von 100 x 38 Metern umfasste. Der erste Teil, der hier zwei Drittel der Grundfläche umfasste, wurde 1:1 aus München übernommen, samt allen technischen Geräten in die Bahnhofshalle transportiert und wiederaufgebaut.
Die Ausstellung führte auch in Wien von den „biologischen“ Grundlagen zu einer durchlaufenden 45 Meter langen und gekurvten Wand, die in chronologischer Abfolge vom Ursprung der jüdischen Religion bis zur Gegenwart einen Überblick über „die zersetzende Arbeit des Weltjudentums auf[ge]zeigt“.13 Die Münchner Ausstellung endete mit einer prominenten Präsentation der Nürnberger Gesetze, in Wien wurden hingegen noch sechs weitere Räume mit insgesamt 1.220 Quadratmetern hinzugefügt. Diese Erweiterung um ein Drittel erschien auf den ersten Blick architektonisch und visuell geordneter und durch Statistiken „wissenschaftlich“ untermauert. Sie schob jedoch ebenso perfid nun mit dem Schwerpunkt auf Wien den Jüdinnen und Juden als „Drückeberger“ die Schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu oder diffamierte sie als geheime Machthaber*innen der Ersten Republik und des Austrofaschismus, die nun zur „Sommerfrische“ in das KZ Dachau geschickt wurden. Schlussendlich wurde in einer strahlenden Apotheose die Befreiung vom Judentum gefeiert:14 Am Ende der dunkel gehaltenen Raumfolge hinter einer von Hakenkreuzfahnen gesäumten Allee zeigte das speziell erleuchtete Schlussbild den umjubelten Einzug Hitlers in seinem Prunkwagen vor dem Hintergrund des Wiener Burgtheaters, während seitlich davon in schmalen Streifen die Wiener Jüdinnen und Juden, als Karikaturen dargestellt und nach Berufsgruppen geordnet, bei ihrer eiligen Flucht vor dem „Führer“ zu sehen waren. In einzelnen Fällen, wenn berühmte Vertreter*innen bestimmter Berufsgruppen das Land bereits verlassen hatten, wurden Fotos ihrer Gesichter über die Zeichnungen geklebt und die realen Namen hinzugefügt.
Kontinuitäten in der Gestaltung
Rosemarie Burgstaller schlägt vor, die Entwicklung der rassistischen, propagandistischen Argumente und visuellen Gestaltungsprinzipien in der Ausstellung „Der ewige Jude“ als Teil einer ganzen Reihe von Ausstellungen zur antisemitischen und antibolschewistischen
13 „Eröffnung der Großausstellung ‚Der ewige Jude‘“; in: Völkischer Beobachter, Wiener Ausgabe, 3.8.1938, S. 2, zit. nach Benz, „Der ewige Jude“, S. 117.
14 „Die Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Neues Wiener Tagblatt, 3.8.1938, S. 5.
106 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 106 04.11.22 11:19
Das Schlussbild der Wiener Ausstellung als „Apotheose“: Während








in einem Triumphzug in Wien einfährt, werden

107
„Der
ewige Jude“ Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung
der „Führer“
die Jüdinnen und Juden in die Flucht geschlagen, 1938; Foto: akg-images
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 107 04.11.22 11:20
Reichsstatthalter Arthur Seyß-Inquart bei seiner Eröffnungsrede der Ausstellung vor einem Hitler-Zitat in der Eingangshalle des Nordwestbahnhofs, 2.8.1938; Foto: Weltbild, ÖNB Bildarchiv Austria
Feindbild-Inszenierung zu lesen. Den Anfang setzte – im Rahmen des „Propaganda-Winterfeldzuges der NSDAP“ ab 1936 – die Ausstellung „Der Bolschewismus – Große antibolschewistische Schau“ in München, die in Wien nach „Der ewige Jude“ von Dezember 1938 bis Februar 1939 ebenfalls in der Nordwestbahnhalle gezeigt und mit der Ausstellung „Entartete Kunst“ fortgeführt wurde. Die in der von den Nationalsozialisten kritisierten progressiven Moderne entwickelten Gestal tungsmittel wurden zunehmend in den Dienst der visuellen Diffamierung einer Feindgruppe gestellt, bezüglich deren inhaltlicher und gestalterischer Bandbreite der „Der ewige Jude“ neue Maßstäbe gesetzt hat.15
Für den Wiener Kontext ist noch eine andere Kontinuität von Interesse, nämlich der politische Opportunismus jener Akteure, die den neu hinzugekommenen Wien-Teil maßgeblich gestaltet haben: Inhaltlich verantwortlich waren Robert Körber und Gustav Zettl. Die visuelle Gestaltung leiteten Otto Jahn und Alois Fischer vom Österreichischen Institut für Bildstatistik, das aus dem Gesell schafts- und Wirtschaftsmuseum hervorgegangen ist. Diese vom austromarxistischen Soziologen und Ökonomen Otto Neurath 1924 gegründete Institution versuchte, im Sinne sozialdemokratischer Volksbildung, sozialpolitische und volkswirtschaftliche Sachverhalte einer breiten Bevölkerung zu vermitteln und gleichzeitig auch die Reform politik des Roten Wien zu legitimieren. Hier entwickelte Otto Neurath mit dem Grafiker Gerd Arntz und der Illustratorin Marie Reidemeister die „Wiener Methode der Bildstatistik“, die sie als zentrales Instrument der interkulturellen Verständigung und Demokratisie rung des Wissens verstanden und die unter dem Namen „Isotype“ (International System of Typographic Picture Education) zu einer um fassenden Bildpädagogik erweitert wurde.16
Mit Beginn des Austrofaschismus 1934 wurden Neurath, als einer der prominentesten Denker des Roten Wien, Arntz und Reidemeister in die Emigration in die Niederlande (und später nach England) gezwungen. Ein großer Teil der Belegschaft blieb während des Austrofaschismus im neu gegründeten Österreichischen Institut für Bild statistik und arbeitete auch im Nationalsozialismus an einschlägigen Propagandaaufträgen – nun unter dem Namen „Institut für Ausstellungstechnik und Bildstatistik“. Die Erweiterung der antisemitischen Hass-Ausstellung „Der ewige Jude“ war eines der ersten Großprojekte dieser Einrichtung unter dem NS-Regime.17 Auch hier wurde auf
15 Burgstaller, „Verhöhnung als inszeniertes Spektakel“, S. 346–356.
16 Günther Sandner, „Demokratisierung durch Bildpädagogik – Otto Neurath und Isoty pe“, in: SWS-Rundschau, Jg. 48, H. 4, 2008, S. 463–484.
17 Vgl. Günther Sandner, „Bilder trennen und Bilder verbinden. Wege der Wiener Bild statistik (1934–1945)“, in: Andreas Kranebitter, Christoph Reinprecht (Hg.), Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich, Bielefeld: transcript-Ver lag, 2019, S. 286–287.
108 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 108 04.11.22 11:20
Stilmittel der verfemten Moderne zugegriffen. Unmittelbar nach dem Kriegsende waren manche dieser Mitarbeiter*innen auch an der ersten antifaschistischen und antirassistischen Ausstellung „Niemals vergessen!“ im Künstlerhaus (1946) beteiligt. Hier setzten sie dieselben architektonischen, typografischen und visuellen Gestaltungselemente, die vorher zur Diffamierung der Jüdinnen und Juden eingesetzt wurden, als Kampfmittel gegen den Nationalsozialismus ein.
109
„Der ewige Jude“ – Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 109 04.11.22 11:20
1872 1873 1874
1880 1881 1882 1883 1884 1890 1891 1892 1893 1894 1900 1901 1902 1903 1904
2020
2012 2022
2013 2014 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 110 04.11.22 11:20
1910 1911 1912 1913 1914 1920 1921 1922 1923 1924 1930 1931 1932 1933 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1950 1951 1952 1953 1954 1960 1961 1962 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021
1875 1876 1877 1878 1879
1885 1886 1887 1888 1889
1895 1896 1897 1898 1899
1905 1906 1907 1908 1909
1915 1916 1917 1918 1919
1925 1926 1927 1928 1929 1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 111 04.11.22 11:20
1938–1945: Reaktivierung
für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
112 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 112 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg

Ansuchen um eine Ausfuhrgenehmigung für die Besitztümer von Sigmund Freud durch die Spedition E . Bäuml, 1938/39; Sigmund Freud Museum, Wien 113 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 113 04.11.22 11:20
Zwangsarbeiter*innen-Lager 1 Nordwestbahnhof 2 Nordbahnhof 3 Schleppgleis vom Nordwestbahnhof in den Augarten 4 Flakturm
Donau
Verortung von NS-Zwangsarbeiter*innen-Lagern am und um den Nordwestbahnhof sowie der Schleppgleise in den Augarten zur Anlieferung von Baumaterial für die Errichtung der Flaktürme; Zeichnung: Michael Hieslmair und Michael Zinganel, basierend auf: Wien Geschichte Wiki, „Zwangsarbeiterlager“, www .geschichtewiki .wien .gv .at/Zwangsarbeiterlager
114
Augarten Donaukanal
2 4 4 3 1 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 114 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
Während die Halle des Nordwestbahnhofs in den ersten Monaten nach dem „Anschluss“ für NS-Propaganda genutzt wurde, begann auf dem Bahnhofs gelände und in seiner Umgebung die nationalsozialistische Praxis der Ju denverfolgung . Innerhalb weniger Tage wurden mit dem Ausschluss von Jü dinnen und Juden aus dem Arbeitsleben und dem Raub jüdischen Eigentums begonnen . Speditionen und Reichsbahn spielten dabei eine zentrale Rolle .
„1938 war ein gutes Jahr für die Wiener Möbelpacker. Nach der Annexion Österreichs durch Deutschland flohen Zehntausende aus der Stadt; die Nazis bemächtigten sich ihrer Betriebe, verlangten von ihnen Strafzahlungen, wenn sie ausreisen wollten, verboten ihnen, das Geld, das ihnen geblieben war, in Devisen umzutauschen, und raubten viele ihrer Kunstgegenstände. Üblicher weise konnten die Flüchtlinge jedoch ihre restlichen Haushaltsgegenstände mitnehmen […]. Und so waren Spediteure in einer Stadt höchst gefragt, in der man üblicherweise ein Leben lang seine Mietwohnung behielt. […] Vor dem „Anschluss“ im März war in jeder Ausgabe der Presse höchstens eine kleine Annonce eines Möbelpackers, meist aber überhaupt keine zu sehen gewesen; binnen vierzehn Tagen danach erschienen drei Anzeigen von Speditionen, die den neuen Markt möglichst rasch nutzen wollten. Ende April brachte es die Zeitung schon bis zu sieben Inserate, Ende Mai waren es elf.“ 1
Anschaulich beschreibt der australische Historiker Tim Bonyhady, dessen Eltern vor der NS-Judenverfolgung nach Australien geflüchtet waren, den Boom der Wiener Speditionsbrache und dessen räuberische Grundlage . Wobei hier eine Präzisierung notwendig ist: Profitieren konnten die Inha ber*innen der Speditionen klarerweise nur, wenn sie „Arier“ waren . Den jüdischen Besitzer*innen wurden die Firmen bzw Anteile auf dem Wege der „Arisierung“ geraubt, die „Ariseure“ profitierten doppelt von diesem Raubzug: Durch günstig erworbene Firmen und von einer hervorragen den Auftragslage, indem sie die Güter von Jüdinnen und Juden, die zur Flucht gezwungen wurden, transportierten . Das gilt auch für die am und um den Nordwestbahnhof angesiedelten Speditionen . In der umfangrei chen Forschungsliteratur zu diesem Thema kommt der Nordwestbahnhof kaum vor, die einzelnen Speditionen dagegen schon – wenn auch häufig unter der Büroadresse (die oft in der Innenstadt war) und nicht unter der des Lagerhauses am Bahnhof . In Sophie Lillies enzyklopädischem Was ein mal war. Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens 2 finden sich
1 Tim Bonyhady, Wohllebengasse. Die Geschichte meiner Wiener Familie, übersetzt von Brigitte Hilzensauer, Wien: Zsolnay, 2013, S 9
2 Sophie Lillie, Was einmal war. Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens, Wien: Czernin, 2003 .
115
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 115 04.11.22 11:20
beispielsweise mehrere Hinweise auf die am Nordwestbahnhof tätigen Spe ditionen E . Bäuml, Schenker & Co . und Kosmos . Schenker war die größte Spedition am Nordwestbahnhof, zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ fungierte das Wiener Stammhaus bereits als Tochter der deutschen Gesellschaft . 3 „Ein Besuch bei Schenker & Co . ver mittelt einen Einblick in den großen Aufschwung, den das Speditionsge werbe seit dem Anschluß genommen hat“, schrieb der Völkische Beobachter am 12 . März 1939 . Der Sammelladungsverkehr habe sich fast verfünffacht . Der Boom habe neben dem Raubzug am jüdischen Besitz noch weitere Gründe: „Seit dem Anschluss des Sudetenlandes zeigt sich, daß alle alten, vor dem Krieg bestandenen Verkehrsrelationen wieder aufleben; der Güter austausch zwischen Wien, Nordböhmen und Nordmähren beginnt langsam wieder den seinerzeitigen beträchtlichen Umfang anzunehmen .“ 4 Auch die Exporte würden zunehmen und sie gingen „heute weitgehend über die deutschen Seehäfen“ . 5
Die auf Kunsttransporte spezialisierte Spedition E . Bäuml hatte ihr Hauptlager in der Dresdner Straße in unmittelbarer Nähe des Nord westbahnhofs und sich zudem dort in das Magazin III der Bundesbahnen eingemietet 6 Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ führte Erich Bäuml die Firma, sein Vater Rudolf war 1937 verstorben, er hatte die Firma wiederum vom Firmengründer Eliazim übernommen . Als Jude musste Erich Bäuml sein Vermögen anmelden, im Juni 1938 wurde Max Müller zum „kommissarischen Verwalter“ bestellt . Im Bericht der „Deutschen Wirtschaftsprü fungs- und Treuhandgesellschaft über die Firma E . Bäuml“ wird auf den Geschäftsaufschwung durch die Vertreibung der Jüdinnen und Juden hin gewiesen: „Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zeigte während der letzten Monate eine außerordentlich günstige Entwicklung, besonders in der Möbeltransportabteilung . Diese wurde hervorgerufen durch die zahl reichen Abwanderungen von Emigranten nach dem Ausland, speziell nach Übersee . Besonders in den Monaten Juni und Juli 1938 häufte sich die An zahl dieser Geschäfte . Da von den Emigranten die Umzugskosten im Voraus bar zu erledigen sind, hat sich die Liquidität des Unternehmens seit dem 10 . Juni 1938 bis zur Zeit unserer Prüfung erheblich verbessert .“ 7
Zu den Vertriebenen, die den „Ariseuren“ erzwungenermaßen gute Geschäfte bescherten, gehörten auch Erich Bäuml selbst, seine Mutter
3 Siehe: „Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co “, S 138 4 „Großer Aufschwung im Speditionsgewerbe“, in: Völkischer Beobachter, 12 3 1939, S 13
5 Ebd
6 OeStA/AdR Bundesbahn Dion NO Bat II Sig 1924 (38 028-38 722), Staatsfernsprechanschluss der Fa E Bäuml Magazin III Wien Nordwestbhf 38497, 31 7 1924
7 Kunsttrans Holding GmbH, Die Kunsttrans. 150 Jahre Kunst und Transport – Geschichte eines Unter nehmens, o . O ., o . J ., S . 18 .
116 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 116 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
Inserat der Spedition Brasch und Rothenstein; Eisenbahn & Industrie, H 1, Jänner 1925, S . 14

Inserat der Spedition Brasch und Rothenstein nach ihrer „Arisierung“ durch Harry W Hamacher; Wiener Zeitung, 11 12 1938, S 14

117
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 117 04.11.22 11:20

118 1938–1945 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 118 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg

119
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 119 04.11.22 11:20
Inserate (um 1910, 1938) von Fross-Büssing, Nordwestbahnstraße 53, Hersteller von Nutzfahrzeugen; im Zweiten Weltkrieg auch Rüstungsproduktion unter Beschäftigung von Zwangsarbeiter*innen; ÖBB Archiv, Wien
Selma und seine Geschwister . Die Firma E . Bäuml wurde von langjährigen Geschäftspartnern „arisiert“, dem Aachener Kaufmann Alfons Bartz und der Continental Agentur für Transporte . Wie meist in solchen Fällen, kam der Kaufpreis nicht beim jüdischen Besitzer an, er wurde als „Reichsflucht steuer“ und „Ausreisespesen“ einbehalten . Die „nichtarischen“ Angestellten wurden entlassen . In dieser Phase brachte die Firma zunächst Möbel und Kunstsammlungen vor der NS-Verfolgung geflohener Jüdinnen und Ju den ins Ausland . Die Ausfuhrkartei des Bundesdenkmalamtes aus dem Jahr 1938 enthält mehrere hundert auf E . Bäuml lautende Aufträge, darunter ein besonders prominenter: E . Bäuml brachte den gesamten Besitz Sigmund Freuds, darunter auch dessen wertvolle Antikensammlung, nach London Andere Ausfuhren scheiterten an Einsprüchen des Bundesdenkmalamtes oder wurden (vor allem nach Kriegsbeginn) mit anderen Begründungen be schlagnahmt und so ihren Besitzer*innen geraubt, in Wien, teilweise auch in den Seehäfen, spielten die Speditionen häufig eine wenig rühmliche Rol le . 1949 gelang es Erich Bäuml, die Firma rückgestellt zu erhalten, er hatte aber kein Interesse mehr, sie selbst zu führen und verkaufte den größten Teil an eine Londoner Spedition . Nach mehreren Besitzerwechseln ist die Spedition heute als „Kunsttrans“ tätig 8 Auch das Berliner Speditionsunternehmen Brasch & Rothenstein hatte eine Zweigstelle in Wien mit einem Büro am Fleischmarkt im 1 . Be zirk und warb in den 1920er-Jahren in Inseraten mit dem Lagerhaus am Nordwestbahnhof . „Im Mai 1936 wurde die Firma von dem Einzelkaufmann Harry W . Hamacher in Besitz genommen . Bis 1940 führte er die Spediti on noch unter ihrem Traditionsnamen mit dem Zusatz ‚Inhaber Harry W . Hamacher‘ fort . Ab März 1940 wurde das Unternehmen dann als ‚Spedition Harry W Hamacher‘ im Berliner Handelsregister eingetragen “ 9 Durch Um wandlung der Wiener Filiale in ein eigenständiges Unternehmen konnte es einige Zeit vor dem Zugriff geschützt werden – allerdings nur bis zum „An schluss“ . Formal noch eine eigene Firma war Brasch & Rothenstein Wien im Juli bereits an die neue Situation angepasst: „Umzüge nach dem Ausland und Uebersee besorgen verläßlich Brasch & Rothenstein .“ 10 Diese relativ langsamen Umbenennungen zeigen einen weiteren Aspekt: Die Namen der jüdischen Besitzer*innen waren gut eingeführte Marken, auf deren Wert die „Ariseure“ oft ungern verzichten wollten, gleichzeitig sollten diese Na men aus ideologischen Gründen verschwinden, teilweise wurde das mit dem Zusatz „vormals“ umgangen oder für eine Übergangsphase der Name des
8 Kunsttrans Holding GmbH, Kunsttrans, o S
9 Christine Fischer-Defoy, Kaspar Nürnberg, „Zu treuen Händen . Eine Skizze über die Beteiligung von Berliner Speditionen am Kunstraub der Nationalsozialisten“, in: Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V., Mitgliederrundbrief, Nr 65, Juli 2011, S 7–12, hier 8
10 Inserat von Brasch & Rothenstein, in: Neue Freie Presse, 3 7 1938, S 34
120 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 120 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
„Ariseurs“ dem ursprünglichen Firmennamen beigestellt . Auch die „Ari seure“ von E . Bäuml gingen so vor, sie stellten mehrfach Anträge, „vor mals Bäuml“ weiterführen zu dürfen . Bei der Internationalen TransportGes . A . G . erfolgte im Mai 1938 die Löschung von Hermann Oppenheim und weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats aus dem Handelsregister . 11 Zu den weiteren Speditionen, die im Jahr 1938 auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs tätig waren, zählten Caro & Jellinek, Erben & Gerstenberger, Johann Petter, Maximilian Tins und die Gebrüder Weiss Spedition . Weitere Speditionen befanden sich in der unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs, genauso wie mehrere Fuhrwerksunternehmen .
Requirierung des Raubgutes –die Kooperation zwischen Spediteuren und der Vugesta
Für die Umverteilung des geraubten Privateigentums jüdischer Österrei cher*innen gründete die Gestapo ein eigenes Unternehmen, die „Verwal tungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo“ (Vugesta) . Jüdinnen und Juden, die geflüchtet waren oder ihre Flucht vorbereiteten, mussten ihre Umzugsgüter bei Speditionen einlagern, verpackt als sogenannte Umzugs lifts . Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs blieben die noch nicht verschiff ten Lifts in den Überseehäfen liegen, manche waren sogar noch in Wien in den Magazinen der Speditionen . Die Speditionen meldeten Umzugslifts „rassisch“ verdächtiger Besitzer*innen bei der Vugesta . Die Güter wurden beschlagnahmt und sollten ursprünglich vom Dorotheum versteigert wer den . Wegen der großen Menge richtete die Vugesta im Messegelände ein Verkaufslager ein . Bedürftige „Volksgenossen“ konnten dort günstige Mö bel und ähnliche Gegenstände kaufen Die Verbindung zu den Speditionen war eng: Karl Herber, Leiter der „Reichsgruppe Spedition und Lagerei Ost mark“ war Leiter der Vugesta, die auf Initiative von Karl Ebner, dem Leiter des Referats II B der Gestapo Wien eingerichtet worden war . 12 Am Raub be reicherten sich einige Mitarbeiter*innen der Vugesta, vor allem die Schätz meister*innen . Es profitierten auch die Speditionen, weil sie die Lagerkos ten der liegen gebliebenen Lifts erhielten; teilweise wurden Umzugsgüter nicht oder nur verzögert weitertransportiert, meist mit devisenrechtlichen Begründungen – ob echt oder vorgeschoben . Gegen Harry W . Hamacher, der auch die am Nordwestbahnhof tätige Firma Brasch & Rothenstein „arisiert“ hatte, wurde in einem Volksgerichtsprozess der Vorwurf der Mitwirkung
11 WStLA, Handelsregister, B 20/168, 2 3 .3 .B77 .20 .168, Internationale Transport-Gesellschaft A . G .
12 Vgl z B : Sabine Loitfellner, „Die Rolle der ‚Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Geheimen Staatspolizei‘ (Vugesta) im NS-Kunstraub“, in: Gabriele Anderl, Alexandra Caruso (Hg ), NS-Kunstraub in Österreich und die Folgen, Innsbruck: StudienVerlag 2005, S 110–120
121
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 121 04.11.22 11:20
Die 1940 gegründete „Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo“ (Vugestap, später Vugesta) spielte eine zentrale Rolle bei der Umverteilung des geraubten Eigentums von Jüdinnen und Juden an „Volksgenossen“ . Merkblatt, 1940; DÖW, Wien





122 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 122 04.11.22 11:20
Legitimationskarte der Vugesta, die eine Voraussetzung war, um im dortigen Lager einkaufen zu können Die Karten wurden an „Volksgenossen“ mit geringem Einkommen vergeben Wikimedia Commons

123
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 123 04.11.22 11:20
am Entzug jüdischer Umzugsgüter erhoben . 13 Außerdem sollten lokale In teressen befriedigt werden, auch gegen Widerstände aus dem „Altreich“ . Im Bericht der österreichischen Historikerkommission ist zu lesen: „Her ber und Ebner vereinbarten, auch alle jüdischen Umzugsgüter, die bereits außerhalb Wiens, aber noch innerhalb des Deutschen Reiches – insbeson dere in den Seehäfen Bremen und Hamburg – lagerten, zu beschlagnahmen und zu verwerten .“ 14 Dazu sollten die geraubten Umzugsgüter nach Wien zurückgebracht werden . Dabei offenbarten sich Interessenkonflikte zwi schen reichsdeutschen und Wiener Stellen, es war ein „regelrechter ‚Kampf um die Beute‘ ausgebrochen“ . 15 Das Reichsverkehrsministerium verweigerte die Bereitstellung von Eisenbahnwaggons, „Herber veranlasste schließlich durch ein Abkommen mit der böhmischen Elbschifffahrt die Verschiffung des Guts nach Prag und von dort mit der Eisenbahn weiter nach Wien“, mög licherweise also über die Nordwestbahnstrecke . Dass diese Güter dann in Wien am Nordwestbahnhof ankamen, ist eher unwahrscheinlich – außer die Magazine der dort ansässigen Speditionen wurden als Zwischenlager genutzt . Wahrscheinlicher ist aber eine Entladung am Nordbahnhof, einer seits weil dort die Reichsbahn Güterumschlag betrieb – und wegen der Nähe zum Vugesta-Verkaufslager im Prater
„Arisierungen“ von Firmen auf dem Nordwestbahnhof
Nicht nur einige der Speditionen, auch andere Firmen auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs hatten jüdische Besitzer*innen, Anteilseigner*in nen, Geschäftsführer*innen und Mitarbeiter*innen, die nach dem „An schluss“ ihren Besitz bzw Arbeitsplatz verloren: Bei Bárány & Co wurde am 24 . März 1938 ein Abwickler bestellt und am 18 . Oktober 1940 die Firma aus dem Handelsregister gestrichen . 16 Oder: „1938 wird Leopold Stiassny von den Nazis seines gesamten Besitzes beraubt . Nach dem Krieg wird der Betrieb restituiert . Die Erben verkaufen das Unternehmen, Haus und Be trieb werden getrennt .“ 17
Bei Mattoni-Ungar, einem Mineralwassergroßhandel, wurde mit 14 . Juni 1938 ein kommissarischer Verwalter bestellt, die Firma in der Folge „arisiert“ . Auf den guten Namen wollte der „Ariseur“ nicht verzichten und
13 Vgl . Gabriele Anderl, Edith Blaschitz, Sabine Loitfellner u a ., „Arisierung“ von Mobilien und die Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut (Veröffentlichungen der Österreichischen Historiker kommission, Bd 15), Wien/München: Oldenbourg, 2004, S 161–163
14 Ebd , S 121
15 Ebd
16 WStLA, Handelsregister, A 53/22a, 2 3 3 B76 53 22a, Barany & Co, Einträge 24 3 und 18 10 1938
17 Glas & Co Glastechnik, Firmengeschichte, www glas-co at/ueber-uns/firmengeschichte/index html (7 8 2022)
124 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 124 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
er warb mit „Vorm . Mattoni-Ungar . Godetz, Geist & Co . Mineralwassergroß handlung“ . 18 Ebenfalls ihren jüdischen Eigentümer*innen entzogen wur den: Eisen Schrecker; Stadlauer Mühle Singer & Co; Spiegler & Popper FaßhandelsgesmbH .; Rosenbaum & Schiller, Techn . Öle; Roth E . & Co ., Eisen . 19 Diese Liste stellt bei Weitem keine vollständige Aufzählung der „Arisierungen“ auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs dar, schon des halb, weil bei den vielen kleinen, nicht ins Handelsregister eingetragenen Firmen die Rekonstruktion schwierig ist . Gut dokumentiert ist dagegen das Schicksal einer Firma (und ihres Besitzers), die am Nordwestbahnhof über Jahrzehnte eine große Rolle spielte und sich mit der „Bananenhalle“ in die Topografie des Geländes eingeschrieben hat: das Unternehmen des Bananen-Großimporteurs Bruno Jellinek . Die Bananenimportfirma unter hielt am Nordwestbahnhof nicht nur ein Lager, sondern hatte dort ihren Firmensitz . Jellinek betrieb das Unternehmen gemeinsam mit dem Dänen Niels Mörch . Unmittelbar nach dem „Anschluss“ flüchtete Jellinek in die Tschechoslowakei, deren Staatsbürgerschaft er innehatte . Seinen Firmen anteil wollte er Mörch übertragen, am 15 . April 1938 erfolgte im Handels register die Umschreibung des Firmennamens auf „Bananen-Import Niels Mörch“ Mörch verstarb allerdings bereits im Mai 1938 Wegen Nicht-An meldung seines Vermögens (die für den 26 . April 1938 vorgeschrieben war, als Baustein der „Legalisierung“ des Raubzugs am jüdischen Vermögen), wurde Strafanzeige gegen Jellinek gestellt . 20 Jellinek besaß eine umfangreiche Kunstsammlung, Sophie Lillie re konstruierte die Vorgangsweise der NS-Behörden und listet insgesamt 218 Objekte aus dem Besitz Jellineks auf, darunter einen Friedrich Waldmüller . Dieser wurde mit weiteren besonders wertvollen Bildern auf Antrag „der Zentralstelle für Denkmalschutz vom Wiener Magistrat […] ‚sichergestellt‘ und in das Zentraldepot der neuen Burg überstellt . Acht weitere Bilder, die sich beim Spediteur Caro & Jellinek befanden, wurden ebenfalls für die Ausfuhr gesperrt, vorerst jedoch im Speditionsmagazin belassen“ . 21 Hier zeigt sich exemplarisch, wie Jüdinnen und Juden daran gehindert wur den, wertvolle Teile ihres Besitzes in ihr Fluchtland mitzunehmen . „Alles übrige wurde im Februar 1939 von der Zentralstelle für Denkmalschutz für die Ausfuhr freigegeben, jedoch von der Spedition nicht abgefertigt . 1941 wurde die Einziehung von Teppichen, Silber, Kunstgegenständen und Miniaturen im Wert von insgesamt über 17 .000 Reichsmark sowie des Erlöses der Firmendissolution in der Höhe von rund 124 .000 Reichsmark
18 Inserat von Godetz, Geist & Co, in: Pharmaceutische Post, 30 12 1939, S 17
19 Hinweise dazu im Handelsregister im Wiener Stadt- und Landesarchiv, in den Vermögensanmel dungen und Restitutionsakten im Österreichischen Staatsarchiv
20 Lillie, Was einmal war, S 529
21 Ebd
125
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 125 04.11.22 11:20
vom Landesgericht zugunsten des Staatsschatzes des Deutschen Reiches ver fügt . Begründung: ‚Der Beschuldigte ist Jude‘ .“ 22 Zu holen gab es bei diesem staatlichen Raubzug genug: „Insgesamt 16 Möbelwagen und 33 Collis Um zugsgut wurden schließlich von der GESTAPO beschlagnahmt und unter VUGESTA Konsignations-Nr . 375 teils im Freihandverkauf, teils über das Dorotheum einer Verwertung zugeführt . Einige Stücke wurden auf diesem Wege vom ‚Sonderauftrag Linz‘ für die Zwecke des geplanten ‚Führermuse ums‘ erworben .“ 23 Jellinek gelang mit seinem Bruder und seiner Frau Mellie die Flucht aus Europa: Aus der spanischen Stadt Vigo kommend, erreichten sie an Bord der Marqués de Comillas im Jänner 1941 New York, 24 wo Bruno Jellinek 1943 starb Die Dimension von Jellineks Umzugsgütern, insbe sondere seiner Kunstsammlung, lässt Rückschlüsse auf sein Vermögen und damit auch auf die beträchtliche Größe seines Bananenimports über den Nordwestbahnhof zu .
Wie Jellinek war auch Leopold Vulkan, der auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs einen Handel mit Holz und Brennmaterialien betrieb, tschechoslowakischer Staatsbürger . Bis zum deutschen Einmarsch in der Tschechoslowakei im März 1939 bot die Staatsbürgerschaft einen gewissen persönlichen Schutz, sie half aber nicht gegen die „Arisierung“ seines Un ternehmens und die Raubzüge der SA: Unmittelbar nach dem „Anschluss“ und bei den Novemberpogromen wurden dabei unter anderem Schmuck und ein Auto geraubt . Auch deshalb konnte Vulkan die „Reichsfluchtsteuer“ nicht aufbringen und wurde am 26 . Februar 1941 in das Ghetto Opole de portiert . Wie auch seine Frau Mathilde fiel Leopold Vulkan der Shoah zum Opfer, ihre Töchter Gertrude und Edith überlebten . 25
1939: Wiederaufnahme des Güterbetriebs durch die Reichsbahn
Wie erwähnt sorgten Raub, Vertreibung und die engere wirtschaftliche Verflechtung der „Ostmark“ mit dem „Altreich“ nach dem „Anschluss“ für zunehmenden Güterverkehr, der die Wiener Bahnhöfe bald an ihre Kapazi tätsgrenzen brachte; deshalb wurde der Nordwestbahnhof von der Reichs bahn als Güterbahnhof mit Abfertigung reaktiviert . Von September 1938
22 Lillie, Was einmal war, S . 529 . 23 Ebd
24 National Archives and Records Administration New York (NARA), microfilm publication T715 (Washington, D C, n d , New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925–1957, zit nach: https:// familysearch .org/ark:/61903/3:1:33S7-95J9-9F4R?cc=1923888&wc=MFKW-VWL%3A1030111301 (26 8 2022)
25 OeStA/AdR E-uReang VVSt VA Buchstabe V 33074 (1938–1945); vgl Ilana Fritz Offenberger, The Jews of Nazi Vienna, 1938–1945. Rescue and Destruction (Palgrave Studies in the History of Geno cide), Cham: Palgrave Macmillan, 2017, S . 151, 160, 168, 178, 181, 183, 200, 202, 214 und 217 .
126 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 126 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
bis Ende 1939 wurden 200 Arbeiter*innen eingesetzt, um die stillgelegten Gütergleise wieder befahrbar zu machen . 26 Der Völkische Beobachter und andere Zeitungen begleiteten die Wiederinbetriebnahme des Güterverkehrs propagandistisch . Am 7 . März 1939, eine Woche vor dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in der Tschechoslowakei, war zu lesen: „Nordwest bahnhof wieder in Betrieb . Wien erhält seinen ersten großen Zentralgüter bahnhof“ . Und: „Ein Denkmal der Unfähigkeit verschwindet .“ 27 Im August habe die Reichsbahn den Sammelladeverkehr eingeführt und er habe seit her um 200 Prozent zugenommen . „Er mußte bisher auf dem Nord-, Ost-, Süd- und zum Teil auch auf dem Westbahnhof abgefertigt werden, was wegen der dadurch unvermeidlichen Zersplitterung der Reichsbahn viel Kopfzerbrechen bereitete .“ 28 Deshalb solle der Ladungsverkehr langfristig auf den Nordwestbahnhof konzentriert werden . „Eine eigene Planungs stelle befaßt sich mit den notwendigen Maßnahmen, die bei den Anlagen des Nordwestbahnhofs durchgeführt werden müssen, um auf eine Tages ladung von 1 .000 Tonnen zu kommen . […] So ist eine Schienenverbindung zum Nordbahnhof mit Überbrückung der Dresdnerstraße in Aussicht genommen, die alleine viele Millionen Reichsmark kosten wird .“ 29 Tatsächlich umgesetzt wurde von diesen Plänen wenig: Am 1 Oktober 1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, verfügte das Reichsverkehrsministerium, dass zur Verbesserung der Verladesituation am Nordwestbahnhof „unter Heranziehung eines bestehenden Güterschuppens eine Umladebühne zu schaffen sei . Mitte 1941 begann der als kriegswichtig anerkannte Bau und wurde 1942 abgeschlossen“ . 30 Abgeschlossen heißt in diesem Fall aber nicht fertiggestellt, sondern beendet . Aus Besprechungsprotokollen zur Verkehrs situation geht hervor, dass die bereits 1939 angedachte Zentralisierung des Stückgutverkehrs am Nordwestbahnhof, um die anderen Güterbahnhöfe für andere Aufgaben zu entlasten, zumindest bis zum Frühjahr 1943 nicht um gesetzt wurde: „Bisher seien alle Maßnahmen zur Schaffung der wichtigsten Voraussetzung für einen geregelten Stückgutverkehr, nämlich eines großen Zentral-Stückgutbahnhofs am Nordwestbahnhof, an den unzureichenden Baumitteln gescheitert . Die Reichsbahndirektion (RBD) Wien hoffe, den Zentral-Stückgutbahnhof in diesem Sommer fertigstellen zu können, wenn ihr die nötigen Kontingente, besonders an Eisen und Holz, zur Verfügung
26 Alfred Horn (Hg ), Eisenbahn Handbuch Sonderausgabe 2015. Die Bautätigkeit der DRB in Österreich 1938–1945, Wien: Holzhausen, 2015, S 87
27 „Nordwestbahnhof wieder in Betrieb!“, in: Wiener Beobachter. Tägliches Beiblatt zum Völkischen Beobachter, 9 3 1939, S 10
28 Ebd
29 Ebd
30 Horn, Eisenbahn Handbuch, S . 87 .
127
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 127 04.11.22 11:20
stehen .“ 31 Dass es diese Kontingente jemals gegeben hat, scheint angesichts des immer massiveren Ressourcenmangels sehr unwahrscheinlich, in den Listen der wichtigsten Bahnprojekte taucht das Projekt nicht auf . Auskunft über die Funktion des Bahnhofs im Kriegsbetrieb geben vor allem die Dokumente zur Wiederaufnahme des Personenverkehrs: Die Planungen begannen mit einer Bestandsaufnahme des Betriebs im Oktober 1942, der sich auf Übergabe- und Lokzüge beschränkte . „Aufgelöst werden täglich 6–8 Übergabezüge, gebildet werden täglich 5–9 Übergabezüge . Die Zahl der Lokfahrten beträgt 8–13 . Das Verkehrsaufkommen des Bfs . [Bahn hofs] beträgt ungefähr je 4 .500 Wg . [Waggons]/Monat im Ein- und Aus gang Das ergibt ein Tagesaufkommen von 150 Wg […] Hiervon entfallen etwa 60 % auf den Verkehr mit Jedlersdorf und 40 % auf den Verkehr mit Brigittenau .“ 32
31 OeStA/AdR Vk ÖBB RB Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/Mappe 15b/Tagesordnung für die Besprechung von Verkehrsfragen am 2 .3 und 3 .3 1943 im Gauhaus, S . 5 .
32 OeStA/AdR Vk ÖBB RB Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/Mappe 16d/Vorerhebungen über die erforderlichen Herstellungen, Umgestaltungen und Maßnahmen bei Rückverlegung des Nordwestbahnreiseverkehrs auf den Bahnhof Wien Nordwestbahnhof der Reichsbahndirektion Wien vom 26 .11 1942 .
128 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 128 04.11.22 11:20
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
Bahnverkehr am Nordwestbahnhof im Oktober 1942
Waggons pro Monat Tagesdurch schnitt Schwankungen zwischen
Schenker 783 26 8–40
Bestandsnehmer 806 27 9–41 Verpflegungsmagazin 861 29 9–63
Kohlenrutschen 164 6 0–13
Ziegelgleis 241 8 1–26 Straßengleis 159 5 0–20 Bunzl & Biach33 44 2 0–4
Ölgas 40 1 0–3 Fross-Büssing 23 1 0–7 Post 209 7 3–12 Bm 35 1 0–7 RAW 117 4 0–14 Schadwagen 1063 36 3–64
Quelle: OeStA/AdR Vk ÖBB RB Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/ Mappe 16d/Vorerhebungen über die erforderlichen Herstellungen, Umgestaltungen und Maßnahmen bei Rückverlegung des Nordwestbahnreiseverkehrs auf den Bahnhof Wien Nordwestbahnhof der Reichs bahndirektion Wien, 26 11 1942
Der Personenbahnhof war zum größten Teil an Wehrmacht und Reichspost vermietet worden: Im Empfangsgebäude und den Nebengebäuden nutz te die Wehrmacht für das Verpflegungsmagazin die Bahnsteig- und Gleisanlagen innerhalb der Halle, auf der Abfahrtsseite die Eintrittshalle, die ehemalige Fernschreibstube, Fahrdienstleitung, Garderobe, die Büroräume samt Vorraum, die Räume der Fahrkartenausgabe, den Raum für die Kom mandierung und die Toilettenanlage; auf der Ankunftsseite den ehemali gen Hofwartesaal, das Sanitätszimmer, den Warteraum für Erwartende, die Toilettenanlage, die Ausgangs- und Zollrevisionsanlage, die Zollabfertigung, Gepäckabgabe, Nachzahlungskassa, den Raum für die Bahnsteigschaffner
33 Die in der Papierindustrie tätige Firma Bunzl & Biach war zu diesem Zeitpunkt „arisiert“ und in „Kontinentale Rohstoffe und Papierindustrie Aktiengesellschaft Wien“ umbenannt Vgl . Peter Melichar, „Arisierungen und Liquidierungen im Papier- und Holzsektor“, in: Ulrike Felber u a , Ökonomie der Arisierung, Teil 2, Wirtschaftssektoren, Branchen, Falldarstellungen (Veröffentlichun gen der Österreichischen Historikerkommission, Bd 10/2), Wien/München: Oldenbourg, 2004, S . 279–741, hier 311–335 .
129
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 129 04.11.22 11:20
und Telegrafenmeister sowie drei Räume der Gastwirtschaft; auf der Stirn seite der Empfangshalle drei Büroräume .
Die Gepäckabgaberäume, der Eilgutaufgabeschuppen, ein Lager platz (Kabellager) zwischen den Gleisen 4 und 5, ein Lagerplatz vor den ehe maligen Gepäck- und Eilgutabfertigungsräumen, ein Lagerplatz zwischen Eilgutmagazin und Postgebäude und ein Lagerplatz zwischen Postgebäude und Fross-Büssing-Remise wurden von der Reichspost benutzt .
Die Lochkartenstelle der Reichsbahn verwendete den ehemaligen Warteraum samt Gastwirtschaft 3 . Klasse, die Gastwirtschaft 2 . Klasse samt Nebenräumen und den Wartesaal 2 . Klasse als Maschinenräume; ferner 12 Räume auf der Stirnseite des Empfangsgebäudes als Kanzleien Der ehe malige Wartesaal 1 . Klasse diente als Speiseraum der Gefolgschaft .
Die ehemaligen Polizeiinspektionsräume auf der Ankunftsseite waren an die Bahnhofwache und Brennstoffversorgung vergeben . Als Woh nungen und an Privatfirmen waren vermietet: In den ehemaligen Eilgut kassen- und Abfertigungsräumen auf der Abfahrtsseite befanden sich drei Wohnungen, auf der Ankunftsseite dienten drei Räume als Friseurladen und Wohnung . Das ehemalige Eilgutabfertigungsmagazin war an die Spe ditionsfirma Tins vermietet In der Lampisterie befanden sich die Tischle rei W . Kryzan und zwei Wohnungen . 34 Die außerhalb der Halle liegenden Bahnsteiggleise dienten als Zuführungs- und Beistellgleise zum Verpfle gungsmagazin und zu den Kabellagerplätzen . Das ehemalige Eilgutgleis 9 fungierte als Beistellgleis für Post und Kabellager . Der größte Teil der bei den ehemaligen Abstellanlagen wurde vom Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) benützt, was den hohen Anteil an „Schadwagen“ am Verkehrsauf kommen erklärt .
Diese Beschreibung illustriert einerseits die Funktion des Nord westbahnhofs für den Güterverkehr und zeigt, wie intensiv der stillgelegte Personenbahnhof genutzt wurde . Zusammenfassend lässt sich sagen: Für die Versorgung Wiens mit Kohle spielte der Nordwestbahnhof auch während des Zweiten Weltkriegs eine geringe Rolle, diese lief fast zur Gänze über die Nordbahn, die dadurch, aber auch durch den Transitverkehr von Kohle nach Italien, überlastet war . Als Standort des Verpflegungsmagazins der Wehrmacht hatte er eine gewisse Funktion bei der Versorgung der Front –immerhin 861 Waggons fuhren zu diesem Zweck im Oktober 1942 in den Nordwestbahnhof . Im übrigen Bahnhofsbetrieb zeigt sich die Dominanz von Schenker; welche Güter wohin und woher transportiert wurden, geht aus
130 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 130 04.11.22 11:20
34 Vgl OeStA/AdR Vk ÖBB RB Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/ Mappe 16d/Vorerhebungen über die erforderlichen Herstellungen, Umgestaltungen und Maßnah men bei Rückverlegung des Nordwestbahnreiseverkehrs auf den Bahnhof Wien Nordwestbahnhof der Reichsbahndirektion Wien, 26 .11 .1942 .
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
den vorliegenden Unterlagen nicht hervor . Die Frachtpapiere von Schenker sind bei der Zerstörung der Hallen am Nordwestbahnhof zu Kriegsende vernichtet worden . 35 Fross-Büssing nutzte ehemalige Remisengleise und Wagenreinigungsschuppen, vermutlich als Erweiterung ihrer Produktions halle in der Nordwestbahnstraße .
Wiederaufnahme des Personenverkehrs
Zur Überraschung der Reichsbahn akzeptierte die Wehrmacht problem los die Kündigung der von ihr genutzten Bereiche des Bahnhofs . Als Er satz dienten Lagerhallen mit Gleisanschluss in der Umgebung Wiens Auch von der Reichspost kam kein Widerstand . Damit war ein Teil der erwarte ten Probleme rasch erledigt, wie in einer Besprechung bei der Reichsbahndirektion Wien am 12 . Dezember 1942 festgestellt wurde . 36 Auch wenn seit der Einstellung des Personenverkehrs im Jahr 1924 keine größeren Rück- oder Umbauten vorgenommen worden waren, erfor derte die Wiederinbetriebnahme doch einigen Aufwand . Die Kosten wur den durch ein Sonderbudget aus Berlin gedeckt . In der Halle waren zum Teil die Gleise ausgebaut worden, von der Sicherungsanlage waren zwar noch Leitungen und Kabel vorhanden, die ortsfesten Signale waren aber abgetragen, die Fernschreib- und Fernsprechanlagen ausgebaut worden . Das Heizhaus wurde vom RAW genutzt, die Bekohlungsanlage war nicht mehr vorhanden . Alfred Horn fasst zusammen: „Der Pbf [Personenbahn hof] war seit 1924 aufgelassen und die Halle vermietet . Dafür wurden die Gleise mit Sand überschüttet und mit Bohlen überdeckt . […] Am 9 .3 .1943 wurde nach Berlin gemeldet, dass in Wien der Nordwestbahnhof zur Entlas tung des Nordbahnhofs wieder in Betrieb genommen werden sollte Bereits am 11 .5 .1943 erfolgte die Zustimmung zur Wiedereröffnung . Am 15 .5 .1943 wurden die Heizhausanlagen für Verschublokomotiven wieder in Betrieb genommen und am 1 .11 .1943 der Personenverkehr wieder aufgenommen .“ 37 Dementsprechend kündigte das Neue Wiener Tagblatt am 24 . November 1943 an: „Vom 1 . November an verkehren alle Züge der Strecke WienStockerau-Znaim-Schönwald/Frain, die bisher von und nach Wien-Nord bahnhof geführt wurden, von und nach Wien-Nordwestbahnhof, ausge nommen die Züge P 1001, P 1777, P 1756 und P 1024 .“ 38 Die Reise in das
35 Mündliche Auskunft des Schenker-Archivars Erhalten sind nur Unterlagen, die im Firmenbüro am Hohen Markt aufbewahrt worden waren
36 OeStA/AdR Vk ÖBB RB Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt 7/ Mappe 16d/Deutsche Reichsbahn Reichsbahndirektion Wien 30–30H2Ban20, Vermerk über die Besprechung bei der RBD Wien am 12 12 1942, Betrifft: Wiedereröffnung des Nordwestbfs für den Reiseverkehr
37 Horn, Eisenbahn Handbuch, S 87
38 „Ab 1 . November neuer Fahrplan“, in: Neues Wiener Tagblatt, 24 .10 .1943, S . 5 .
131
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 131 04.11.22 11:20
„Protektorat Böhmen und Mähren“ war nur Personen gestattet, die neben den üblichen Reisedokumenten auch einen „Durchlaßschein“ vorweisen konnten . Für Durchreisende von und nach Berlin wurden einzelnen Zü gen, sogenannten Sperrwagenzügen, Waggons beigestellt, die während der Zwischenstopps nicht verlassen werden durften, dafür aber ohne „Durch laßschein“ benutzt werden konnten . 39
Für Deportationen von Jüdinnen und Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager vom Nordwestbahnhof sind bisher keine Belege bekannt . Ein konkreter Hinweis basiert fast sicher auf einer Verwechslung von Nord westbahnhof und Nordbahnhof . Die Ärztin Ella Lingens, die wegen ihrer Hilfe für Jüdinnen und Juden am 16 Februar 1943 in das KZ Auschwitz deportiert wurde, nennt in ihren Erinnerungen den Nordwestbahnhof als Ausgangspunkt ihrer Deportation, in späteren Veröffentlichungen ist diese Angabe auf „Nordbahnhof“ geändert . 40
Flakturmbau und Zwangsarbeit
In den Akten der Reichsbahn zur Logistik für den Wiener Raum taucht der Nordwestbahnhof neben der ihm zugedachten Funktion als Stückgut bahnhof und der Wiederaufnahme des Personenverkehrs noch in einem dritten Zusammenhang auf: Der „Engpaß Nußdorf – Heiligenstadt– Bahn hof Brigittenauer Lände – Donauuferbahn – Nordwestbahnhof erschwert die Heranbringung von Baustoffen in das Gebiet des Nordwestbahnhofs (Schottertransporte Augarten)“ . 41 Es ging dabei um den Bau der Flaktür me im Augarten . Für den Bau dieser Flaktürme wurde ab 1942 ein An schlussgleis zur Baustelle errichtet, das beim Gaußplatz in die Straßen bahnline mündete 700 Meter der insgesamt 1,3 Kilometer langen Strecke wurden elektrifiziert, damit konnte sie nicht nur von Zügen der Reichs bahn, sondern auch von der Straßenbahn befahren werden . Anfang 1943 begann die Teilnutzung, am 15 . November 1943 befand sich die Gleisanlage in Vollbetrieb . 42 Zu jedem der beiden Türme (Gefechtsturm und Leitturm) führte eine Gleisschleife . Nach der Fertigstellung der Flaktürme wurde die Anschlussbahn zum Munitionstransport in die Türme genutzt . Beim Bau der Flaktürme kamen Zwangsarbeiter*innen aus mehreren Ländern zum
39 Deutsche Reichsbahn, Amtlicher Taschenfahrplan der Reichsbahndirektion Wien, Jahresfahrplan 1944/45, S . 70 .
40 Ella Lingens, Eine Frau im Konzentrationslager. Monographien zur Zeitgeschichte, Wien [u a ]: Europa-Verlag, 1966; dies , Gefangene der Angst. Ein Leben im Zeichen des Widerstandes. BvT 152, Berlin: Berliner Taschenbuch-Verlag, 2005
41 OeStA/AdR Vk ÖBB RB Dion W Varia Reichsbahndirektion Wien/Varia, 1938–1945/Kt . 7/ Mappe 15b/Tagesordnung für die Besprechung von Verkehrsfragen am 2 und 3 3 1943 im Gauhaus, Anlage 2, S 6
42 Horn, Eisenbahn Handbuch, S 87
132 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 132 04.11.22 11:20
Einsatz . Zwangsarbeit war im Nationalsozialismus weit verbreitet, vor al lem – aber nicht nur – in als „kriegswichtig“ eingestuften Betrieben . Die Herkunft der Zwangsarbeiter*innen und die Begründungen für deren zwangsweise Arbeitsverpflichtung deckten ein breites Spektrum ab, auch die Arbeits- und Lebensbedingungen variierten stark . Untergebracht wur den sie in Lagern, die häufig direkt von den Firmen, bei denen sie arbei teten, betrieben wurden, und sich nicht selten auf Firmengeländen befan den, oder in Sammellagern mit Arbeiter*innen mehrerer Firmen . Hermann Rafetseder hat auf Basis der Akten des Versöhnungsfonds – bei dem ehe malige Zwangsarbeiter*innen Entschädigungsanträge stellen konnten – ein umfassendes Bild des NS-Zwangsarbeitssystem in Österreich erstellt Die meisten der beim Flakturmbau im Augarten eingesetzten Arbeiter*innen waren im Zwangsarbeiter-Sammellager „Sportplatz“ an der Brigittenauer Lände untergebracht . Betrieben wurde dieses Lager von der Firma Gottlieb Tesch, einer der beiden mit dem Bau der Wiener Flaktürme beauftragten Baufirmen . 43
Der Einsatz von Zwangsarbeiter*innen auf dem Gelände des Nord westbahnhofs und seiner Umgebung beschränkte sich nicht auf den Bau der Flaktürme Klarerweise zog auch die Reichsbahn als integraler Bestandteil der NS-Kriegsmaschinerie diese zur Arbeit heran, im August 1944 waren 19 . 235 ausländische Arbeitskräfte bei der Reichsbahn gemeldet, auf de ren Gelände sich 381 Arbeitslager befanden . 44 Eines für polnische, jugoslawische und italienische Zwangsarbeiter*innen befand sich auf dem Areal des Nordwestbahnhofs im Bereich der Güterabfertigung . 45 Auch bei FrossBüssing und bei Schenker lässt sich der Einsatz von Zwangsarbeiter*in nen nachweisen . 46 Schenker war als Teil der Reichsbahn in die Kriegs- und Raublogistik eingebunden, der Nutzfahrzeughersteller Fross-Büssing be lieferte in der Ersten Republik u . a . die Stadt Wien mit Bussen und Müll abfuhrwägen . Während des Zweiten Weltkriegs produzierte Fross-Büssing Lastkraftwagen und Panzerteile für die Wehrmacht, die Firma nutzte dafür neben dem Firmengelände in der Nordwestbahnstraße 53 auch Teile des Nordwestbahnhofs . Hermann Rafetseder nennt mehrere Tschechen, die bei Fross-Büssing Zwangsarbeit verrichten mussten: „Der 1921 geborene
43 Hermann Rafetseder, NS-Zwangsarbeits-Schicksale. Erkenntnisse zu Erscheinungsformen der Oppression und zum NS-Lagersystem aus der Arbeit des Österreichischen Versöhnungsfonds. Eine Dokumentation, Bremen: Wiener Verlag für Sozialforschung, 2014, S 364–365
44 Vgl Florian Freund, Bertrand Perz, Mark Spoerer, Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen auf dem Gebiet der Republik Österreich 1939–1945, 1 Teil, Zwangsarbeit auf dem Gebiet der Republik Österreich (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission, Bd . 26/1), Wien/Mün chen: Oldenbourg, 2004, S 111
45 Wien Geschichte Wiki, „Zwangsarbeiterlager Nordwestbahnhof“, www geschichtewiki wien gv at (9 8 2022)
46 Archiv DB Schenker, Wien, Wochenberichte
133
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 133 04.11.22 11:20

134
1938–1945 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 134 04.11.22 11:20
Flakturm im Augarten mit den Schienensträngen zur Materialanlieferung für dessen Errichtung und Versorgung; Foto: Franz Freund, 1945, ÖNB Bildarchiv Austria
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
Vaclav F . […] arbeitete von Februar 1942 bis März 1945 bei Fross-Büssing in Wien“, sein 1923 geborener Landsmann Josef S . „von Oktober 1942 an geblich bis Juni 1945“ . 47 In einem weiteren Lager in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, in der Nordwestbahnstraße 93, waren russische Zwangs arbeiter*innen untergebracht . 48 Als kriegswichtige Einrichtung war der Nordwestbahnhof nicht nur Ort von Zwangsarbeit, sondern auch ein Ziel alliierter Bombenangriffe . Der Bevölkerung der Umgebung war das auch bewusst, wie ein Anrainer erzählt: „Wir haben den ganzen Krieg eigentlich gerechnet, nachdem vor unserem Haus, vor der Stiege, der Nordbahnhof war […] und hinter der Stiege zwei der Nordwestbahnhof, haben wir immer damit gerechnet, wir werden die Ersten sein, oder zu den ersten gehören, die von den Bomben getroffen werden . Das war aber gottseidank nicht der Fall .“ 49 Tatsächlich wurden der Bahnhof und seine Umgebung bei mehreren Bombenangriffen von Juni 1944 bis März 1945 getroffen . 50 Der Gütertransport war in dieser Phase nur mehr eingeschränkt möglich . An die Wiener Gelatinewaren In dustrie K . G ., die Trockenkapseln nach Dänemark und Schweden schicken wollte, schrieb Schenker: „Die angeführten Sendungen lagern in unserer Zentralanlage Wien-Nordwestbahnhof, nachdem die Weiterleitung infolge Verkehrssperre unmöglich ist . Der Weiterversand erfolgt nach Verkehrs wiederaufnahme, insofern Sie nicht anderweitig verfügen .“ 51 Die damit verbundenen Probleme reichte die Spedition an ihre Kundin weiter: „Das Gut liegt auf Ihre Rechnung und Gefahr durch uns nicht versichert und erbitten wir uns gegeben Falles Lagerversicherungsauftrag gegen Feuer und Einbruch mit Wertangabe .“ 52 In der Notzeit der letzten Kriegsphase zogen die gelagerten Güter Begehrlichkeiten auf sich . Am 6 . bzw . 7 . April 1945, also eine Woche vor Kriegsende in Wien, tötete Rudolf Wondrak drei „Plünderer“ . Er hatte „als Ausbildner der ‚Werkschaft‘, einem bewaffneten und militärisch organisierten Verband, dem die Sicherung der Bahnanla gen und der dort lagernden Güter oblag, am 6 .4 .1945 die Abriegelung des Nordwestbahnhofs übernommen, weil es auf demselben zu Plünderungen gekommen war“ . In einem Volksgerichtsurteil vom 26 . Juni 1946 wurde
47 E-Mail von Hermann Rafetseder, 3 9 2021
48 Wien Geschichte Wiki, „Zwangsarbeiterlager Nordwestbahnstraße 93“, www geschichtewiki wien gv at (9 8 2022)
49 Herr P., in: Evelyn Klein, Gustav Glaser, Peripherie in der Stadt. Das Wiener Nordbahnviertel. Einblicke, Erkundungen, Analysen, Innsbruck u a : StudienVerlag, 2006, S 9
50 Wien Geschichte Wiki, „Luftkrieg“, www geschichtewiki wien gv at (9 8 2022); Stadt Wien, „Wien Kulturgut: Kriegssachschädenplan, um 1946“, www wien gv at/kultur/kulturgut/plaene/kriegs sachschaden .html (9 .8 .2022) .
51 Archiv DB Schenker, Wien, Schenker & Co , Ges m b H , Zweigniederlassung Wien an Wiener Gelatinewaren Industrie K G , „Betr : ECG 2335 – 1 Kiste Trockenkapseln 100 - kg / WGJ 2354 – ! Pkt ‚45 -‘ f Stockholm bezw Göteborg Ihre Verfg 9 1 30 1 1945 “
52 Ebd .
135
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 135 04.11.22 11:20




136 1938–1945
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 136 04.11.22 11:20
Zerstörte Speditionslager am Nordwestbahnhof, 1945; Foto: Archiv DB Schenker, Wien
Reaktivierung für „Arisierung“, Raub, Zwangsarbeit und Krieg
Wondrak – der außerdem noch einen Ostarbeiter am Bahnhof Sigmunds herberg getötet hatte – wegen Mordes zum Tode verurteilt . 53
Bei Kriegsende war die Bahnhofshalle schwer beschädigt, die Ma gazine von Schenker und vieler anderer Firmen zerstört oder desolat – aber nicht unbedingt leer, wie ein Anrainer, der diese Zeit als Jugendlicher erlebt hat, erzählt: „Am Bahnhof gab es da noch Etliches, zum Beispiel hinter uns am Nordwestbahnhofsgelände war eine Halle voll mit Marketenderware . Ich bin dann dort auch einmal drinnen gewesen, und da gab es wirklich von Tischtennisbällen über Feuersteine und Feuerzeuge und Zigarettenhülsen und weiß der Kuckuck was, bis zu Präservativen, die ich natürlich mit Inte resse damals mir angeschaut hab, weil ich ja zu sowas keinen Zugang g’habt hab . – Es war dort alles drinnen und da wurde drauflos geplündert .“ 54
53 Akt: LG Wien Vg 1i Vr 1725/45, in: Zentrale Österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien, RG-17 003M, Wiener Prozesse wegen NS-Verbrechen: Viennese post-war trials of Nazi war crimes Inventory Part 1 Microfilm reels 1000-1217, https://portal ehri-project eu/units/us-005578-irn521945 (16 8 2022)
54 Herr P., in: Klein, Glaser, Peripherie in der Stadt, S . 9 .
137
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 137 04.11.22 11:20
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
Zentralgüterhalle der Firma Schenker & Co auf dem Nordwestbahnhof, 1911; Zeitungsausschnitt, Archiv DB Schenker, Wien

138 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 138 04.11.22 11:20
Pionier der modernen Güterlogistik
1872, im Jahr der Eröffnung des Nordwestbahnhofs, gründete der Schweizer Gottfried Schenker (1842–1901) mit seinen jüdischen Part nern Moritz Karpeles (1834–1903) und Moriz Hirsch (1839–1906) in Wien das Unternehmen Schenker & Co., dem seitdem eine tragende Rolle am Nordwestbahnhof zukommt. Schon 1873 transportierte Schenker & Co. exklusiv die deutschen Exponate für die Weltausstellung über den Nordwestbahnhof nach Wien. Hier zeigte sich bereits, was Schenker über viele Jahrzehnte auszeichnen sollte: Die Bewältigung komplexer transnationaler Logistikaufgaben, die auch eine Nähe zu den jeweiligen Machthabern in unterschiedlichen politischen und ideologischen Systemen voraussetzte, in Monarchien und Republiken, in Demokratien und Diktaturen, zu den Regimes des Nationalsozialismus, aber auch in der Sowjetunion und in China.
Gottfried Schenker hatte in Wien eine bedeutende Innovation der Güterlogistik entwickelt, nämlich den Sammelgutverkehr per Bahn. Lieferten die Bahngesellschaften Güter nur von Bahnhof zu Bahnhof, so konnte Schenker die komplette Lieferkette einschließlich der Abho lung und Zustellung von Haus zu Haus zu fixen Gesamtpreisen und Terminen garantieren. Diese Geschäftsidee setzte eine sehr zeitaufwendige Vorarbeit und ein hohes Verhandlungsgeschick zum Aufbau internatio naler Netzwerke voraus. Schenker gelang es damit in kurzer Zeit, zu einer der größten Speditionen am europäischen Kontinent aufzusteigen. 1891 kaufte Schenker & Co. 60 Güterwaggons und war damit in der Lage, als zu diesem Zeitpunkt einzige europäische Speditionsfirma mit durchgehend kalkulierten und verbindlich geltenden Tarifen Eisenbahnfrachten von London bis Konstantinopel anbieten zu können.1 Als Gottfried Schenker 1901 starb, übernahmen seine Adoptivsöhne August Schenker-Angerer und Emil Karpeles-Schenker ein Firmenimperium mit 32 Niederlassungen in 13 europäischen Ländern mit rund 1.000 Mitarbeiter*innen.
Zehn Jahre später schloss Schenker & Co. mit den Staatseisenbahnen eine für den Nordwestbahnhof richtungsweisende Vereinbarung. Gegen Abtretung der Magazine auf anderen Wiener Bahnhöfen erhielt Schenker am Nordwestbahnhof ein Grundstück „zur Erbauung einer Zentralgüterhallenanlage mietweise und gegen Heimfall“.2 Der technisch auf neuestem Stand ausgestattete 450 Meter lange, mehrgeschoßige Komplex aus Lagerhallen und Rampen zwischen Bahngleisen und Zufahrtsstraße wurde 1911 von hochrangigen Vertreter*innen
1 Herbert Matis, Dieter Stiefel, Das Haus Schenker. Die Geschichte der internationalen Spedition 1872–1931, Frankfurt am Main/Wien: Ueberreuter Verlag, 1995, S. 60f.
2 „Die neuen Zentralgüterhallen der Firma Schenker & Co. auf dem Nordwestbahnhof“, in: Das interessante Blatt, 13.7.1911, S. 2.
139
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 139 04.11.22 11:20
aus Politik und Wirtschaft feierlich eröffnet.3 Der Nordwestbahnhof wurde so zum zentralen Güterumschlagplatz von Schenker & Co. in Österreich. Er sollte zwei Weltkriege und unzählige Krisen überdauern und erst 1996 in seiner Bedeutung von einem anderen moderneren Standort an der Peripherie von Wien abgelöst werden.
Im Ersten Weltkrieg zeigte sich Schenker als patriotisches Unternehmen. Es organisierte über den Nordwestbahnhof die Verteilung von Weihnachtsgeschenken an Frontsoldaten, die „ein Paket Lebkuchen, ein Fläschchen Liqueur, ein Luntenfeuerzeug, ein Stück Seife, ferner je fünfzehn Zigaretten und ein Spitzel aus Weichselholz oder eine Pfeife, ein Päckchen Zigarettentabak“ und „zuoberst jeder Spende […] eine Ansichtskarte mit dem Bilde des Kaisers“ erhielten.4 Folgt man Zeitungsmeldungen aus dem Jahr 1925, hatte Schenker auch geholfen, Waffen aus der neutralen Schweiz nach Österreich zu bringen, indem diese als Durchzugsgut deklariert wurden.5
Mit dem Ende der Monarchie und dem Verlust der Kronländer sank das Frachtenvolumen in Österreich drastisch. Im Jahr 1924 stellte die Bahn den Personenverkehr und die Güterabfertigung am Nordwest bahnhof ein. Es verblieben Lagerhäuser mit Gleisanschluss, die nun von privaten Speditionen bewirtschaftet wurden. Schenker, das weitaus größte Unternehmen, baute – weil es für seine Kund*innen die Aufgabe der Bahngüterabfertigung übernahm – seine Stellung vor Ort aus. (Schenker musste die Waggons aber zu den anderen Bahnhöfen schleppen lassen, um sie dort an die Züge der Staatsbahn anzudocken.) Zeitweise mietete das Unternehmen sogar die stillgelegte Personenhalle und verwendete sie als Magazin für russisches Holz.6
Für die Entwicklung des Gesamtunternehmens bedeutender wurde aber eine andere Reaktion auf die Marginalisierung Österreichs als Speditionsmarkt: Die Geschäftsinteressen wurden zunehmend auf Deutschland ausgeweitet. Der Geschäftsführer von Schenker in Deutschland, Marcell Holzer, setzte dort auf eine rasante Expansion und baute mit hohem finanziellen Risiko ein Speditions-Netzwerk auf, ohne die Wiener Eigentümer im Detail darüber zu informieren. Dafür ging er eine Partnerschaft mit der staatlichen Deutschen Reichsbahn ein. Weil aber mit der Weltwirtschaftskrise 1929 das Speditionsgeschäft einbrach und die Kredite nicht mehr bedient werden konn ten, war Holzer gezwungen, das gesamte Unternehmen an die Deutsche Reichsbahn zu verkaufen, sodass Schenker Österreich von der
3 Baumeister war Oberbaurat Karl Stigler, der einige der bedeutendsten öffentlichen Bauten in den letzten Jahren der Monarchie in Wien errichtet hat. Siehe: „Die neuen Zentral-Güterhallen am Wiener Nordwestbahnhof“, in: Österreichische Illustrierte Zeitung, 16.7.2011, S. 1.033.
4 „Kriegsfürsorge“, in: Arbeiter-Zeitung, 22.11.1914, S. 9.
5 „Hat die Schweiz im Kriege die Neutralität verletzt?“, in: Die Stunde, 19.5.1925, S. 5; „Schweizer Waffenlieferungen an Österreich“, in: Innsbrucker Nachrichten, 9.6.1925, S. 9.
6 Vgl. „Der tote Bahnhof lebt“, in: Kleine Volks-Zeitung, 25.1.1930, S. 3–4.
140 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 140 04.11.22 11:20
Die neuen Zentralgüterhallen auf dem Nordwestbahnhof, 1911; Österreichische Illustrierte Zeitung, H. 42, 16.7.1911, S. 1.033



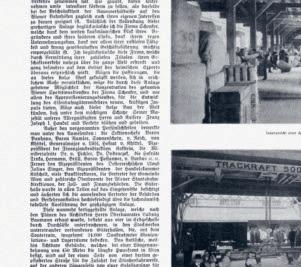

141
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 141 04.11.22 11:20
Muttergesellschaft zu deren Tochter wurde.7 Anders betrachtet hatte Holzer durch die enge Verflechtung die Deutsche Reichsbahn mit Erfolg dazu gezwungen, den angeschlagenen Betrieb zu übernehmen –zu einem weit überhöhten Preis, wie sich später zeigen sollte.
Das Interesse der Deutschen Reichsbahn war aber auch strate gisch begründet: Mit Schenker als „bahntreuem“ Unternehmen, das sich im Sammelgutverkehr von Haus zu Haus etabliert hatte, wollte man sich einen starken Partner gegen die zunehmende Konkurrenz der Lkw-Frächter ins Boot holen. Der vorerst geheim gehaltene Vertrag sicherte Schenker eine Monopolstellung in Deutschland, die heftig kritisiert wurde8 – insbesondere auch von den Nationalsozialisten, deren Agitation sich vor allem gegen den Juden Marcell Holzer richtete, der 1933 unter einem Vorwand verhaftet, interniert und schließlich gezwungen wurde, alle Funktionen zurückzulegen.9
Die Wien-Tochter wurde ab 1932 als eigene Aktiengesellschaft neu gegründet, die sich im Alleinbesitz der Berliner Schenker und Co. befand, gegenüber Geschäftspartnern, vor allem in Südost-Europa, jedoch Eigenständigkeit suggerieren sollte. Bereits ab 1933 startete die Berliner Zentrale ein „internes Arisierungsprogramm“.10 Mit der „Arisierung“ der Außenstellen in Südosteuropa, die von Wien aus betreut wurden, zeigte sich die Berliner Zentrale unzufrieden, zum einen, weil sich kaum „Arier“ finden ließen, die bereit waren, dort zu arbeiten, zum anderen, weil der Wiener Betrieb gefährdete Mitarbei ter*innen an die Peripherie versetzte, um sie so lange wie möglich im Unternehmen halten zu können. Den guten Verbindungen zu den Bundesbahnen im austrofaschistischen Österreich schadete diese Nähe zum NS-Regime offenbar nicht. So kritisierte Der österreichische Volkswirt die Tarifpolitik der Bahn, die Schenker auf manchen Strecken de facto ein Monopol zulasten der Speditionskund*innen, der kleineren Konkurrenzunternehmen und der Steuerzahler*innen einräumte.11
Nach dem „Anschluss“ 1938 wurden auch bei der Wiener Tochter die Nachfahren der jüdischen Mitbegründer von Schenker & Co., die Familie Karpeles-Schenker, zur Auswanderung gezwungen und Opfer der
7 Siehe: Herbert Matis, Dieter Stiefel, Grenzenlos. Die Geschichte der internationa len Spedition Schenker von 1931 bis 1991, Frankfurt am Main/Wien: Ueberreuter Ver lag, 2002, S. 19f.
8 Die Geheimhaltung bis 1937/38 sollte auch verdecken, dass die Deutsche Reichsbahn bereits so weit konsolidiert war, dass sie ausstehende Reparationsansprüche Frankreichs durchaus hätte bedienen können. Susanne Kill, „Geheimsache Schenker/ Wie das Unternehmen in den Besitz der Reichsbahn kam“, in: Verkehrsgeschichtliche Blätter, 47. Jg., Nr. 2, März/April 2020, S. 51–52.
9 Marcell Holzer emigrierte 1935 in die USA und strengte von dort eine Klage gegen seine Kündigung als Geschäftsführer an, die er auch gewann. Mit der Entschädigung gründete er eine eigene Spedition in den USA. Siehe: „Marcel [sic] M. Holzer, Plaintiff, v. Deutsche Reichsbahn Gesellschaft and … Supreme Court, Special Term, New York County, Jun 22, 1936“; in: Casetext Inc., https://casetext.com/case/ holzer-v-deutsche-reichsbahn-gesellschaft-2 (13.8.2022).
10 Siehe: Matis, Stiefel, Grenzenlos, S. 43f., 45.
11 „Zum Wettbewerb Eisenbahn – Kraftwagen“, in: Der österreichische Volkswirt, 28.11.1936, S. 6.
142 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 142 04.11.22 11:20
„Arisierung“ ihres Besitzes und des Raubes ihrer Kunstsammlung.12
Die Nicht-Juden Gottfried und August Schenker-Angerer führten das Unternehmen bis 1939, bis zur Übertragung der Firmenanteile nach Berlin und der Löschung der Wiener Gesellschaft, weiter.13 Gottfried verkehrte privat mit dem Gauleiter und NS-Kriegsverbrecher Odilo Globocnik, wie die Notiz auf einem Meldezettel zeigt.14
Das „arisierte“ Unternehmen profitierte vom Aufschwung des Speditionsgewerbes.15 „Die Firma Schenker wurde als die größte und im Eigentum der Deutschen Reichsbahn stehende deutsche Speditionsund Transportunternehmung mit nahezu ihrer gesamten Kapazität in den Dienst der deutschen Kriegswirtschaft gestellt“, schreiben die Historiker Herbert Matis und Dieter Stiefel.16 „Die enge Kooperation mit Wehrmachtstellen führte dazu, dass Schenker nahezu der gesamte Transport des in Frankreich, Holland und Belgien erbeuteten Kriegs materials ins Deutsche Reich übertragen wurde.“17 Schenker fungierte als Speditionsabteilung namhafter Rüstungsfirmen, organisierte über die Wiener „Geschäftsleitung Ostmark“ u.a. auch Erdöl- und Benzintransporte aus rumänischen und ungarischen Vorkommen, Tabakimporte vom Balkan und Munitionstransporte in die entgegengesetzte Richtung. In Wien spielte Schenker auch eine große Rolle bei der Einlagerung und dem Transport jüdischer „Umzugsgüter“, die über den Nordwestbahnhof in die Seehäfen von Bremerhaven und Hamburg transportiert wurden (die aber vielfach nicht mehr zugestellt, sondern geraubt wurden, wie Aktivist*innen dem Unternehmen vorgeworfen hatten).18
Die „österreichische Lösung“
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Schenker Österreich (wie beispielsweise auch Siemens Österreich) zunächst als eigenständiges „österreichisches“ Unternehmen neu gegründet. Bereits im Februar 1946 bemühte sich Schenker um Wiederherstellung des Status vor 1931. Das Vorhaben war nicht unumstritten: Das Unternehmen wurde bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse erst einmal unter kommis sarische Leitung gestellt. De jure galt Schenker Österreich ab 1931 als Zweigniederlassung der Berliner Mutter, stellte sich selbst
12 Sophie Lillie, Was einmal war – Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens, Wien: Czernin, 2003.
13 Siehe: Eintragung im Handelsregister am 20.10.1939.
14 WStLA, BPD Wien, 2.5.1.4.K11, Globocnik Odilo, 21.4.1904, Bericht des Bezirkspoli zeikommissariats Wieden, 8.4.1947.
15 „Großer Aufschwung im Speditionsgewerbe“, in: Völkischer Beobachter, 12.3.1939, S. 13.
16 Matis, Stiefel, Grenzenlos, S. 54.
17 Ebd., S. 56.
18 Siehe dazu: „Die Schenker-Verbrechen“, in: Zug der Erinnerung, 27.1.2021, www. zug-der-erinnerung.eu/aktuell20210123.html (13.8.2922). Zur Rolle der Speditionen am Nordwestbahnhof beim Raub an Gütern von Jüdinnen und Juden; siehe auch: Kapitel „1938–1945. Reaktivierung für ‚Arisierung‘, Raub, Zwangsarbeit und Krieg“, S. 112.
143
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 143 04.11.22 11:20
Geschäftigkeit in der Arbeitswelt „Schenkerstraße“, 1960er-Jahre; Archiv DB Schenker, Wien


144
Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 144 04.11.22 11:20


145
vernetzter
Co. 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 145 04.11.22 11:20
Gut
Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker &
nun aber als Opfer der „Vergewaltigung“ und des „Raubes“ durch die Nationalsozialisten dar.19 Wie schon einmal in der Geschichte des Unternehmens versuchte es trickreich, einem potenziellen Konkurs und den drohenden Reparationsansprüchen seitens der Siegermächte wegen seiner Verstrickungen mit dem NS-Regime zu entgehen. Um sich dem Zugriff der französischen Besatzungsmacht zu entziehen, verlegte das Unternehmen 1953 sogar seinen Firmensitz aus dem 1. Bezirk in die sowjetische Besatzungszone, wo es unter dem Schutz der Besatzungs macht die Filialverbindungen in die Sowjetunion, nach Osteuropa und in den Orient wieder aufzubauen versuchte.20
Mit dem Abzug der Alliierten 1955 wurde die staatliche Verwal tung von Schenker aufgehoben und das nun selbstständige österreichische Unternehmen konnte sich zu einer der treibenden Kräfte und zum Profiteur des Wirtschaftswunders entwickeln. 1974 wurde das Unternehmen nach einem nicht genauer spezifizierten Fehlverhalten eines seiner Vorstandsmitglieder wieder an den Rand des Ruins gedrängt und in der Folge vom deutschen Unternehmen DB Schenker übernommen. Schenker Österreich wurde so zum zweiten Mal zur Tochter der Deutschen Bahn, bevor diese 1989 selbst privatisiert wurde. Als älteste Tochter nahm Schenker Österreich jedoch stets eine besondere Stellung im Konzern ein. Sie war die bei Weitem größte Auslandsgesellschaft, entwickelte zahlreiche Eigeninitiativen und war für die Geschäftstätigkeit in anderen Ländern verantwortlich. Schenker Österreich kam und kommt auch eine wichtige Rolle für den Wiederaufbau und die Direktbeteiligungen der Schenker-Organisationen in Osteuropa, insbesondere während der Osterweiterung, zu.21
Das Zentralmagazin am Nordwestbahnhofsgelände war am 9. April 1945 von der Waffen-SS gesprengt und in Brand gesteckt worden.22 Der Nordwestbahnhof fiel in die sowjetische Besatzungszone. Der Speditionsbetrieb konnte 1946 vorerst nur provisorisch auf Ersatzflächen der ÖBB und am Schlachthof St. Marx aufgenommen werden. Trotzdem fun gierte Schenker bereits im Oktober 1946 als offizieller Spediteur der Wiener Messe. Erst 1948 bis 1949 wurde das zerstörte Magazin 1 mit 6.615 Quadratmetern wiederhergestellt.23
Von 1963 bis 1964 wurde an der gegenüberliegenden Seite der Ladestraße – entlang der ehemaligen Milchverladerampe – eine völlig neue Magazinzeile errichtet. So entstand am Nordwestbahnhof die
19 Matis, Stiefel, Grenzenlos, S. 92.
20 Ebd., S. 96.
21 Ebd., S. 157, 159.
22 Ebd., S. 92.
23 Dieter Stiefel, Zur Geschichte der Spedition Schenker in Österreich, Wien: Holzhausen, 2007, S. 35.
146 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
Wiederaufbau und Ausbau am Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 146 04.11.22 11:20
damals größte zusammenhängende Speditionsanlage in Österreich mit insgesamt 40.000 Quadratmetern (33.306 Quadratmeter Magazinfläche und 6.567 Quadratmeter Freifläche). Die Ladestraße zwischen den Magazinen 1 und 2 und dem Zentralmagazin war teilweise unterkellert und durch Tunnel verbunden.24
Nach Auskunft ehemaliger Mitarbeiter*innen wurden hier „Kauf mannsgüter aller Art“ umgeschlagen, welche genau, sei in diesem diskreten Gewerbe nicht relevant, solange sie keine besondere Trans port-Behandlung oder -Verpackung erfordern würden. Durch das hohe Auftragsvolumen war Schenker jedenfalls einer der wichtigsten Nutzer des Containerterminals am Bahnhof. In der Chronik des Nordwestbahnhofs finden sich wiederholt Berichte über Containerzüge, mit denen Messen in Osteuropa, der Sowjetunion und in China beschickt wurden. Die guten Kontakte zur Sowjetunion werden auch aus Erzählungen über besondere Ereignisse am Areal deutlich: Ernst Brückler, aufgewachsen unmittelbar gegenüber der Haupteinfahrt zum Güterbahnhof als Sohn eines Lkw-Fahrers, der für Schenker bis in den Iran gefahren ist, absolvierte von 1969 bis 1973 seine Lehre bei Schenker. Er berichtet von der Androhung der Schließung, amourösen Abenteuern am Areal, Schmuggelgütern, die wie Trophäen gehandelt wurden, und Begegnungen mit jüdischen Auswandernden aus der Sowjetunion, die ihre am Nord westbahnhof zwischengelagerten Güter kontrollieren wollten: Denn während der großen Auswanderungswelle von 1973 wurde ausgerechnet Schenker, die Firma, die in der NS-Zeit als Teil der Deutschen Reichsbahn Beutezüge mit Raubgut organisiert hatte, mit dem Transport des Übersiedlungsguts und Hausrats über Wien nach Israel beauftragt.25
Auch russische Lkw-Fahrer haben bleibende Erinnerungen hinterlassen: So musste in einem kalten Winter ein Lkw der Marke KAMAZ das Wochenende in der Schenker-Ladestraße verbringen. „Am Montag war der Motorblock eingefroren. Die Fahrer haben unter dem Motor ein Feuer gemacht, bis der Motorblock aufgetaut und der Motor warm war. Das hat natürlich hellste Aufregung ausgelöst. Heute würde das einen Großeinsatz der Feuerwehr auslösen. Für russische Verhältnisse war das aber ganz normal, und hat auch funktioniert.“26
Mit 200 bis 250 Mitarbeiter*innen blieb der Nordwestbahnhof bis Mitte der 1990er-Jahre der wichtigste Standort des Unternehmens in Wien. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs begann Schenker von Wien aus seine Partner*innen aus Zeiten des Kalten Krieges in Osteuropa aufzukaufen – und baute sein Netzwerk zu einem der ganz großen Player in Zentraleuropa aus. Spätestens dann wäre es dringend notwendig geworden, die an den Bahngleisen orientierte lineare Bebauung der
24 Stiefel, Zur Geschichte, S. 102.
25 Ernst Brückler, Pensionist, ehem. Speditionskaufmann bei Schenker, danach in der Pharmabranche tätig, Interview mit den Autoren, Wien, 30.1.2019.
26 Alexander Schaffer, Berater, ehem. Lkw-Fahrer bei Panalpina, Speditionskaufmann u.a. bei Schenker und Q-Logistics, Interview mit den Autoren, Wien, 19.3.2019.
147
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 147 04.11.22 11:20

148 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 148 04.11.22 11:20
Schaubild der Planungen für den Ausbau des Schenker-Zentralmagazins im Jahr 1963 zur damals größten zusammenhängenden Speditionsanlage in Österreich; Archiv DB Schenker, Wien

149
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 149 04.11.22 11:20

150 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 150 04.11.22 11:20
Kopfgebäude mit Laderampe; Archiv DB Schenker, Wien
Hallen mit den engen Gassen für den Warenumschlag mit Lkw-Zügen und Sattelschleppern aus- und umzubauen. Schenker sei „ohnehin viel zu lange Bahn-affin gewesen“, obwohl der Bahnverkehr längst nicht mehr rentabel war, der Standort für Sattelschlepper nicht geeignet und über keine direkte Zufahrt zum Handelskai verfügte. Wegen der man gelnden Planungssicherheit – Schenker verfügte nur über das Baurecht auf fremdem Grund, während der Lkw-Verkehr bei der Stadt Wien generell auf zunehmendem Widerstand stieß – verzichtete Schenker auf riskante Investitionen vor Ort.27 Stattdessen entschloss sich das Unternehmen, 1996 am Alberner Hafen einen neuen Logistikterminal zu errichten: mit Donauhafen und Bahnanschluss, nahe der Autobahn, dem Flughafen und dem Containerterminal der Wien Holding.28 Erst da durch verlor der Standort am Nordwestbahnhof an Bedeutung. Innen stadtnahe Lagerflächen sind jedoch immer noch von Wert. Schenker sitzt daher sein Nutzungsrecht am Nordwestbahnhof aus und setzt die Grundstückseigentümerin ÖBB in Zugzwang, ein Angebot zu machen. Bis zum Abbruch nutzt Schenker die Hallen weiterhin als (Langzeit-) Lager, in denen unter anderem der Weihnachtsschmuck der Josefstädter Straße und der Rotenturmstraße untergebracht ist.
27 Elmar Wieland, Pensionist, ehem. Vorstandsvorsitzender von Schenker Österreich, Interview mit den Autoren, Wien, 19.2.2019.
28 Stiefel, Zur Geschichte, S. 105.
151
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 151 04.11.22 11:20
Mitte: Die nach dem Krieg wiederaufgebaute Schenker-Halle bildet mit einer neu errichteten Halle die Schenker-Straße. Links: Anstelle des ehemaligen Personenverkehrsgeländes wird von Rohner + Gehrig (später Panalpina) eine weitere Halle errichtet. Archiv DB Schenker, Wien

152 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 152 04.11.22 11:20

153
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 153 04.11.22 11:20
Gut vernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co.
2020 1880 1881 1882 1883 1884 1890 1891 1892 1893 1894 1900 1901 1902 1903 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1920 1921 1922 1923 1924 1930 1931 1932 1933 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1950 1951 1952 1953 1954 1960 1961 1962 1963 1964 1970 1971 1972 1973 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2021 2012 2022 2013 2014 1872 1873 1874 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 154 04.11.22 11:20
1885 1886 1887 1888 1889 1895 1896 1897 1898 1899 1905 1906 1907 1908 1909 1915 1916 1917 1918 1919 1925 1926 1927 1928 1929 1935 1936 1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1955 1956 1957 1958 1959 1965 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1979 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 1875 1876 1877 1878 1879 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 155 04.11.22 11:20
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg
1945–2022:
lange
156 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 156 04.11.22 11:21
und das
Ende
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Die Reste der abgetragenen Bahnhofshalle des Nordwestbahnhofs, der in der sowjetischen Besatzungszone als zentraler Nachschubbahnhof diente, 1953; Foto: United States Information Service, ÖNB Bildarchiv Austria

157
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 157 04.11.22 11:21


158 1945–2022
Die „Russenschleife“ verband die Nord- und Nordwestbahn Sie war notwendig, weil nach dem Zweiten Weltkrieg vorerst nur die Nordwestbahnbrücke wiederaufgebaut wurde Foto um 1950, Archiv Alfred Luft
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 158 04.11.22 11:21
Personenverkehr in der Ruine des teils abgebrochenen Kopfbahnhofsgebäudes, um 1950; Archiv Alfred Luft
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Besatzungszeit,
Ersatzbahnhof
und Wiederaufbau
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges fielen der 2 . und 20 . Bezirk, und damit auch der Nordwestbahnhof, in die Besatzungszone der Sowjetunion, die von hier aus den Nachschub, die Truppenbewegungen und den Abtrans port von Beutegut aus Österreich organisierte . 1 Die Deutsche Wehrmacht hatte in den letzten Kriegstagen während ihres Rückzugs vor den anrü ckenden Sowjettruppen sämtliche Brücken über den Donaukanal und die Donau (mit Ausnahme der Reichsbrücke) gesprengt . Die Nordwestbahn brücke wurde sofort nach Kriegsende von den Pionieren der Sowjetarmee wiedererrichtet 2 Die Nordbahnbrücke hingegen war völlig zerstört Da durch waren der Nordbahnhof und die Verbindungsbahn zum Südbahnhof vom nordöstlichen Donauufer zur Gänze abgeschnitten . Um diese wichtige Streckenführung aufrechtzuerhalten, errichteten Pioniere der Roten Armee eine provisorische Verbindung vom Nordwestbahnhof auf Straßenniveau quer über die Kreuzung Taborstraße und Nordbahnstraße zur Nordbahn, die sogenannte Russenschleife . Von 1945 bis zum Wiederaufbau der Nord bahnbrücke im Jahr 1957 führten daher der gesamte Bahnverkehr, der Per sonennahverkehr, der Fernverkehr und die Gütertransporte von und nach Norden über die Nordwestbahnbrücke und den Nordwestbahnhof . Die prächtige, im Krieg beschädigte Personenabfertigungshalle des Nordwestbahnhofs wurde im Sommer 1952 von der Besatzungsmacht abgetragen, der Personenverkehr aber weiterhin auf offenen Bahnsteigen zwischen den Grundmauern und Bauwerksfragmenten abgewickelt . Mit der Fertigstellung des Bahnhofs Praterstern im Jahr 1959 wurde der Per sonenverkehr am Nordwestbahnhof ein zweites Mal – dieses Mal für im mer – eingestellt Gleichzeitig begann die notdürftige Instandsetzung der Infrastruk tur für den Güterverkehr: Wegen akutem Mangel an Baumaterial und Kapi tal wurden ab 1946 die im Bereich des alten ÖBB-Frachtenbahnhofs noch erhaltenen unterkellerten Backsteinlagerhallen aus dem 19 . Jahrhundert restauriert und adaptiert oder – falls zerstört – wiederaufgebaut . 1949 bis 1950 folgte die große Umladebühne für den Stückgutverkehr, die um neue Kopfbauten erweitert und – vorerst nur im südlichen Abschnitt – mitsamt den Schienensträngen überdacht wurde . Von den privaten Unternehmen war die Fischhandels AG 1949 das erste, gefolgt von Schenker (1951 und
1 Ein Erbe der sowjetischen Besatzungszeit war das 1956 eröffnete Globus Druckerei- und Verlagsge bäude der kommunistischen Partei Österreichs, das nicht nur Österreich, sondern viele sozialisti sche Länder hinter dem Eisernen Vorhang mit Druckwerken versorgen sollte 2 1962 wurde die ehemalige Eisenbahnbrücke umgebaut und für den Autoverkehr zugelassen: Sie dient unter dem Namen Nordbrücke als Schnellstraßenverbindung zwischen Gürtel, Prager Straße und Donauufer Autobahn .
159
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 159 04.11.22 11:21
Diagramm der Schienenstränge des Nordwestbahnhofs mit der „Russenschleife“, der Verbindung zur Nordbahn, um 1950; ÖBB Archiv, Wien








160 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 160 04.11.22 11:21
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
1956) sowie Südland und Intercontinentale, die auf alten Fundamenten neue Magazine errichteten . Erst in den 1960er-Jahren entstanden zur Gänze neue Hallen, wie die riesigen Stahlbetongebäude von Schenker3 und Panalpina im südwestlichen Teil der Anlage oder die nördliche Überdachung der großen Umladebühne . 4
Das zuvor für den Personenzugsverkehr und die Wartung von des sen Fuhrpark genutzte Areal entlang der Nordwestbahnstraße wurde über die gesamte Länge – von der Taborstraße bis zur Hellwagstraße – für andere Nutzungen freigegeben . Die Erschließung des Geländes erfolgte nun auch direkt von der Straßenseite: Anstelle der ehemaligen Personenbahnhofs halle und den Schienensträngen für den Personenverkehr mit den dazuge hörenden Servicegebäuden, wie Ringlokschuppen, Werkstatt und Wasser turm, entstanden am Tabor drei trostlose, elfgeschoßige Wohntürme für Eisenbahner*innen; unmittelbar anschließend Richtung Norden eine Tank stelle, ein Konsumgroßmarkt (KGM) mit riesigem Parkplatz, ein Lager des Textilhändlers Schöps und die Auslieferungshalle des vormals staatlichen Stahlbetriebes Böhler . Alle waren – pro forma – an einen eingleisigen Bahn anschluss angebunden, der bis 1959 dem Personenverkehr gedient hatte . Genutzt wurde er kaum, er spielte aber in den Mietverträgen eine Rolle Die zunehmende Verlagerung der Transportkapazitäten von der Bahn auf Lkw und Busse spiegelte sich in der wachsenden Bedeutung des Kraftwa gendienstes der Österreichischen Bundesbahnen (KWD) wider: Nahe der Hellwagstraße wurden 38 .000 Quadratmeter Grundfläche vom Eisenbahn gelände abgetrennt, um 1971/72 nach zehnjähriger Planungs- und Bauzeit die neue Kraftwagenbetriebsleitung Wien zu eröffnen . Ausgestattet war sie mit einer Verladestelle auf Züge, Parkplätzen, Garagen, Werkstätten mit Gruben und Kranbahnen, einer technischen Prüfstelle und einer eigenen Tankstelle für 360 Fahrzeuge . Für die bis zu 408 Mitarbeiter*innen, die im Güterverkehr im Großraum Wien und im Personenverkehr (Schüler*innen und Arbeitspendler*innen) zwischen Niederösterreich, dem Burgenland, der Oststeiermark und Wien eingesetzt wurden, gab es neben ihren Arbeits plätzen Sozial- und Ruheräume für die Fahrbereitschaft . 5
3 Siehe: Kapitel „Gutvernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co“, S . 138 .
4 Günter Kettler, „Von der Personenstation zum Containerterminal Der Nordbahnhof in Wien, 2 Teil“, in: Schienenverkehr aktuell (Österreich), H 12, 1997, S 9
5 „Die Kraftwagenbetriebsleitung Wien hat ein neues Domizil“, in: Die ÖBB in Wort und Bild. Nachrichtenblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Nr 11/ 1971, S . 17–21
161
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 161 04.11.22 11:21
Resilienz eines todgeweihten Güterumschlagplatzes
Nach Meinung von Stadtplanungsexpert*innen wäre nach der Wiederer richtung der Nordbahnbrücke und dem Bau des neuen Bahnhofs Praterstern im Jahr 1959 das Schicksal des Nordwestbahnhofs nicht nur als Personen-, sondern auch als Güterbahnhof endgültig besiegelt gewesen . Vorerst provi sorisch reaktiviert, sollte der Nordwestbahnhof jedoch – entgegen der Ex pertisen – als innenstadtnaher Logistikknoten noch viel länger überleben als die anderen Wiener Bahnhöfe: Schon im Dezember 1946 hatte beispiels weise der Wiener Baustadtrat Franz Novy die aus Monarchie und Erster Re publik bekannte Forderung nach einer Fusion der benachbarten Bahnhöfe wiederholt: „Die Verhältnisse beim Nordbahnhof und Nordwestbahnhof führen zu dem Gedanken, dass hier ein Bahnhof zu viel ist .“ 6 1951 schrieb Hugo Rainer im Aufbau: „Es steht aber schon fest, dass der Nordwestbahn hof für den Personenverkehr aufgelassen werden kann .“ 7 Auch noch im Stadtentwicklungsplan für Wien 1984 (STEP 84) wurde der Nordwest bahnhof vorrangig als Störfaktor für die Stadtentwicklung in der Brigitte nau diskutiert: „Der durch den Nordwestbahnhof bedingte hohe Schwer verkehrsanteil ist durch geeignete Maßnahmen in seinen Auswirkungen zu mildern“, forderten die Stadtplaner . 8 Im Bezirksentwicklungsplan Brigitte nau von 1991 ist sogar von den „in jeder Hinsicht negativen Auswirkungen des Nordwestbahnhofes“ die Rede . 9 Deshalb wurde im Leitbild der Bezirks entwicklung „nach Maßgabe der Kapazitäten im Güterumschlag im Rau me Wien […] eine Realisierung einer höherwertigen Nutzung um das Jahr 2010 angestrebt“ . 10 Allerdings hatten die ÖBB erst in den 1980er-Jahren in eine neue Containerkrananlage investiert Der Nordwestbahnhof blieb da her aus Sicht der Güterlogistik ein für die ÖBB längerfristig unverzichtba rer Knotenpunkt . Als nach der Ostöffnung und durch den EU-Beitritt die Stadt Wien wieder zu wachsen begann und die Begehrlichkeit nach innen stadtnahem Bauland wuchs, verschärfte sich der „Konflikt zwischen der ÖBB und den Bestrebungen der Stadt Wien zur mittel- und langfristigen Auflassung dieses Bahnhofs“ . 11
6 Franz Novy, „Die Zukunft Wiens“, in: Der Aufbau, Dez 1946, S 228
7 Hugo Rainer, „Der Wettbewerb für den neuen Süd-Ostbahnhof in Wien“, in: Der Aufbau, Juli 1951, S . 266 .
8 Magistrat der Stadt Wien, MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hg ), Stadtentwicklungs plan Wien. STEP Wien, Wien 1985, S 89
9 Magistrat der Stadt Wien, MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hg ), Bezirksentwicklungs plan Brigittenau, Wien 1991, S 11–12 .
10 Ebd , Leitbild (Plan)
11 Magistrat der Stadt Wien, MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hg ), Stadtentwicklungs plan für Wien. STEP 1994 (Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd . 53), Wien 1994, S . 175 .
162 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 162 04.11.22 11:21
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende

Diagramm Stückgutschnellverkehr mit Entfernungen und Beförderungszeiten im österreichischen Schienennetz, 1951; Was weißt Du von der Eisenbahn?, Düsseldorf 1971, ÖBB Archiv, Wien








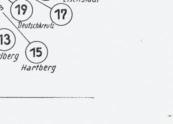


163
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 163 04.11.22 11:21
Am ehemaligen Personenverkehrsgelände wurde von Panalpina eine große Halle neu errichtet und entlang der Nordwestbahnstraße wurden ein Konsumgroßmarkt sowie Auslieferungslager der Textilkette Schöps und des Stahlherstellers Wagner-Biro angesiedelt . 25 Jahre Panalpina Österreich, Festschrift, Wien 1973, Archiv der Wirtschaftskammer Österreich
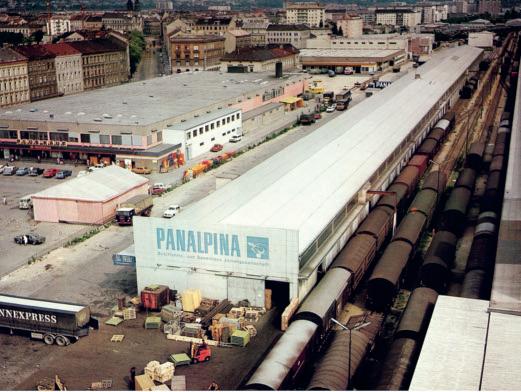
164 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 164 04.11.22 11:21
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Statt jedoch den Nordwestbahnhof zu schleifen, wurde zuerst das Areal des Franz-Josefs-Bahnhofs zwischen dem Julius-Tandler-Platz und der S-Bahn-Station Spittelau überplattet und bebaut . Dieses zwischen 1974 und 1989 durchgeführte Projekt verschlechterte die Bedingungen für den Güterumschlag so stark, dass einige der dort angesiedelten Speditionen ihre Tätigkeit sogar vom Franz-Josefs-Bahnhof auf den Nordwestbahnhof ver lagerten . Als nächstes wurde das viel größere Güterareal am Nordbahnhof sukzessive für eine Überbauung freigegeben: Die ersten Ideen dazu entstan den Ende der 1980er-Jahre im Rahmen der Entwicklung des städtebauli chen Leitbildes für die EXPO 95, die Wien und Budapest gemeinsam aus richten wollten: „Die städtebauliche Gestaltung des Nordbahnhof-Geländes und der Achse Lasallestraße – Wagramerstraße in Zusammenhang mit der Weltausstellung werden Meilensteine in der Entwicklung Wiens bedeuten . Wien an die Donau zu bringen, ein neues Zentrum, oder genauer, eine neue Peripherie dieser Stadt zu schaffen, wird durch die Weltausstellung 1995 beschleunigt und gefördert“, argumentierte Gerhard Feltl, Gründungsvor stand der Expo-Vienna AG . 12 Tatsächlich begann parallel mit der offiziel len Vergabe der Weltausstellung an Wien und Budapest im Jahr 1989 die Planung des ersten Großprojektes zur Überbauung des Güterbahnhofs an der Lasallestraße: Die Verwaltungsbauten für IBM und die Bank Austria nach Entwürfen des Architekten Wilhelm Holzbauer, die 1994/95 fertig gestellt wurden . Der Anlass der Umgestaltung, die Weltausstellung, sollte hingegen nie stattfinden .
Aufbau eines multimodalen Logistikknotens
Der Nordwestbahnhof hingegen entwickelte sich für eine kurze Zeit zu ei nem „Labor“ für Innovationen in der Güterlogistik: Bereits in den 1920erJahren waren in den USA motorisierte Gabel- oder Hubstapler entwickelt worden, die schwere Lasten auf speziell dafür angefertigten Paletten an heben und befördern konnten . Doch erst die Notwendigkeit im Zweiten Weltkrieg sowie im Koreakrieg, die immensen Nachschublieferungen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, mit Flugzeugen, Schiffen und Lkw, über Kontinente hinweg zu den US-Truppen und ihren Alliierten zu ver einfachen und zu beschleunigen, führte zu intensiveren Investitionen in die Standardisierung . Diese mündeten 1945 in ein Patent für die erste be züglich Größe und Bauart standardisierte Palette . 1952 folgten die stabilen CONEX-Boxen aus Stahlrahmen und Wellblechverkleidung, die Vorläufer
12 Der Projektverlauf und dessen Scheitern ist hier aus dem Blickwinkel des Initiators hervorragend dokumentiert: Gerhard Feltl, Projekte, Expo ’95, www .feltl .at/Projekte .Expo95 (14 .8 .2022) .
165
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 165 04.11.22 11:21


166 1945–2022
Verladung von Maschinenteilen – Destination Bagdad; 25 Jahre Panalpina Österreich, Festschrift, Wien 1973, Archiv der Wirtschaftskammer Österreich
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 166 04.11.22 11:21
Erste Wechselaufbauten-Verladung, 1980; Wiener Bezirksmuseum Leopoldstadt, Sammlung Haas
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
des viel größeren und modernen ISO-Containers, der seinen Durchbruch im Vietnamkrieg fand . Nach Europa kamen die ersten ISO-Container im Jahr 1966, wenig später auch nach Österreich .
Im März 1968 wurden auf dem Nordwestbahnhof in Anwesenheit von Prominenz aus Politik und Wirtschaft mit einem vorerst nur proviso risch adaptierten Kran die ersten Überseecontainer umgeladen . 13 1970 folg te der erste „echte“ Containerkran mit einer 210 Meter langen Kranbahn . 1972 wurde dieser für die Aufnahme von Wechselaufbauten adaptiert . Zehn Jahre später war auch die Leistungsfähigkeit dieser Anlage an ihre Gren zen gestoßen: Auf dem Bahnhofsgelände wurde zwischen der überdach ten Umladebühne und der Rebhanngasse sämtlichen Bestandsnehmern ge kündigt und ihre Bauten wurden in diesem Bereich geschleift . Das betraf Kubicek, Ölschlägel, Schmidl, die Gebrüder Weiss und Schenker, später auch die Nordsee Fischfabrik in der damals nach dem Unternehmen benannten Nordseestraße (1982) und die Bananenhalle (1986) . 1984 wurden zwei neue moderne Portalkräne von Künz und SGP mit 40 Tonnen Tragkraft und mit einer 400 Meter langen Kranbahn aufgestellt – mit einer beträchtlich größe ren Spannweite, die drei Gleisanlagen, eine Lkw- und drei Lagerspuren über spannte – und ein neues Abfertigungsgebäude für den kombinierten Verkehr errichtet . 14 1982 hatten sich die großen Speditionen am Areal – Schenker, Panalpina, Intercontinentale, Kirchner und Gebrüder Weiss – zur Confracht zusammengeschlossen, einem Gemeinschaftsunternehmen, das die Containervorläufe und -nachläufe über die Häfen organisierte . Vom Nordwestbahn hof fuhren nun Containerzüge zu den großen Häfen in Hamburg, Bremen, Rotterdam oder Triest . 15 Parallel zur Entwicklung des Containerumschlages präsentierte die neu gegründete Hucketrans im Mai 1972 erstmals den sogenannten Kombi verkehr, der ab sofort zwischen dem Nordwestbahnhof und Nürnberg und weiteren Bahnhöfen in Deutschland angeboten werden sollte: Neben Con tainern konnten nun auch Sattelaufleger und Wechselbrücken vom Kran auf dafür zugerichtete Lastenwaggons gehoben werden . 1978 bis 1980 folgte eine eigene Verladerampe, über die Lkw selbst auf die miteinander gekoppel ten Waggons auffahren konnten . Für den Betrieb der rollenden Landstraße
13 Zum ersten Containerkran siehe: Dr Bruno Kepnik, „Perspektiven des Containerverkehrs in Öster reich,“ in: ÖBB Nachrichtenblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Jg . 1968, 3 Stück, Wien, 20 3 1968, S 67–70
14 Günter Kettler, „Der Neubau des Terminals Wien (1981 bis 1985) Der Nordwestbahnhof in Wien, 3 Teil“, in: Schienenverkehr aktuell (Österreich), H 1, 1998, S 6
15 15 Jahre später war die Auftragslage der einzelnen Speditionen so gut, dass sie sich aus der Koope ration zurückzogen 2001 wurde die Confracht vom Mitbewerber Roland übernommen Quelle: Elmar Wieland, Pensionist, ehem Vorstandsvorsitzender von Schenker Österreich, Interview mit den Autoren, Wien, 19 .2 .2019; Leopold Schafhauser, Pensionist, ehem . Leiter des Containertermi nals am Nordwestbahnhof, Interview mit den Autoren, Wien, 28 9 2018 .
167
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 167 04.11.22 11:21
wurde die Ökombi GmbH gegründet, eine Kooperation von Frächtern, Spe ditionen und den ÖBB . 16 1987 kam es zur Neuorganisation des Stückgutverkehrs „Bahn-Ex press“ (BEX): Die ÖBB boten nun auch Haus-zu-Haus-Transporte auf dem gesamten Bundesgebiet der Republik Österreich an: Die Abholung vom Kunden mit Lkw, das Zuführen zum nächsten von 20 Bahnlogistikknoten in ganz Österreich, den Nachtsprung mit der Bahn sowie die frühmorgend liche Verteilung mit Lkw zur Endkundschaft, wobei der Nordwestbahnhof für den Großraum Wien den wichtigsten Knoten darstellte . Aus dem Blick winkel des Umweltschutzes ist es zu würdigen, dass sich die ÖBB als letzte Bahn Europas einen flächendeckenden – wenn auch nicht kostendeckenden – Stückgutverkehr leistete .
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und parallel zur EU-Oster weiterung begann die Bahn aber auch in den internationalen Sammelver kehr zu expandieren (den Gottfried Schenker 1872 in Wien erfunden hatte) . 2001 übernahm die ÖBB-Tochter Rail Cargo Austria (RCA) zudem die Spe dition Schier, Otten & Co ., die vor allem im Osteuropageschäft gut etabliert war . 17 Dadurch entwickelten sich die ÖBB sukzessive von der jahrzehnte langen Partnerin zu einer harten Konkurrenz der privaten Speditionen Was beide Seiten nicht davon abhielt, zeitweilig so intensiv zu kooperieren, dass mehrmals Strafen wegen Kartellbildung verhängt wurden . 18
Speditionsalltag in der Boom-Phase
Die besten Jahre – nach Angaben vor Ort arbeitender Logistik-Expert*in nen – hat der Güterterminal von den 1970er-Jahren bis in die frühen 1990er-Jahre erfahren, als Österreich von den verspäteten Modernisie rungsschüben im Osten Europas, im Nahen und Mittleren Osten besonders profitierte . 19 Die Grenzen des Eisernen Vorhangs galten für den Güterver kehr und auf der Bahn nicht, oder nur bedingt . Die Unternehmen aus dem „neutralen“ Österreich hatten Exklusivverträge mit staatlichen Speditionen aus den kommunistischen Ländern . 20 Das größte war das bulgarische
16 Die Ökombi GmbH gehört seit 2005 der Rail Cargo Austria AG .
17 „Schier, Otten & Co . (SOC) feiert 80-jähriges Bestehen“, in: APA-OTS, www .ots .at/presseaussen dung/OTS_20041011_OTS0171, 11 10 2004
18 Die Anzeigen bezogen sich auf Preisabsprachen zwischen 1994 und 2010 Vgl dazu z B „17,5 Millionen Euro Kartellstrafe für Spediteure“, in: OÖ Nachrichten, 23 .1 .2015, www .nachrichten at (19 8 2022); „Österreich: Speditionskartell muss Millionenstrafe zahlen“, in: Verkehrsrundschau, 9 6 2016, www verkehrsrundschau de/nachrichten/transport-logistik/oesterreich-speditions kartell-muss-millionenstrafe-zahlen-2992159 (19 8 2022)
19 Bernhard Böhm, Lagerleiter Quehenberger bzw . Q-Logistics GmbH, davor Mitarbeiter bei Panalpina Austria, Interview mit den Autoren, Wien, 17 5 2017
20 Elmar Wieland, Interview, 19 2 2019; Alfred Czerny, Pensionist, ehem Schulungsbeamter bei der ÖBB, davor Bahnhofsvorstand, Interview mit den Autoren, Wien, 4 3 2019
168 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 168 04.11.22 11:21
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende






















Zeitungsartikel über den ersten Huckepackverkehr; eine Seite aus der handschriftlich geführten Bahnhofschronik vom 16 . Mai 1972; ÖBB Archiv, Wien


















169
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 169 04.11.22 11:21
Unternehmen SOMAT, das mehr als 50 Prozent des gesamten Transitver kehrs zwischen Europa und dem Mittleren Osten kontrollierte . 21 Für deren Lkw-Fahrer war Wien die erste Stadt jenseits des Eisernen Vorhangs – im ehemaligen Westen – Handelskai, Mexikoplatz und Nordwestbahnhof wa ren ihnen allen geläufig . 22
Ein wichtiger Teil der Arbeit der Speditionen vor Ort war das Ab wickeln der Zollformalitäten für den Import und Export von Waren . Da bei ging es nicht nur um die Kenntnis der komplexen Vorschriften und die Kompetenz im korrekten Ausfüllen von Formularen, sondern auch um in formelle zwischenmenschliche Aspekte . Die Kontrolle der Ladungen durch die Zöllner*innen wurde jeweils frühmorgens und am späten Nachmittag durchgeführt – sie lief ritualisiert ab wie ein Theaterstück . Akteur*innen waren die Speditionsmitarbeiter*innen und die Zöllner*innen, die in den frühen 1970er-Jahren sogar noch in Uniform auftraten, wie der damalige Schenker-Mitarbeiter Ernst Brückler erzählt . 23 Wichtig war es, die Zöll ner*innen – von deren mitunter recht willkürlichen Entscheidungen der Durchlauf der Waren abhing – gewogen zu stimmen . Einladungen zu alko holischen Getränken in den umliegenden Gaststätten spielten dabei eine nicht unwesentliche Rolle
Die größten privaten, international operierenden Speditionen am Standort waren – neben DB Schenker – die Panalpina, Schier, Otten & Co ., Intercontinentale, Kirchner und die Gebrüder Weiss . Die Panalpina, vormals Rohner + Gehrig, die ab 1968 mit dem Kauf der Südland-Gruppe mit bis zu 1 .700 Mitarbeiter*innen zu einer der größten Speditionen Österreichs aufstieg, organisierte vom Nordwestbahnhof aus beispielsweise die Trans porte in den Iran und Irak . Am Schienenstrang neben der von 1969 bis 1971 neu errichteten Halle wurde in den 1980er-Jahren jeden Tag ein ganzer Zug be- und entladen . Panalpina war auch berühmt für ihre Expertise und Vormachtstellung für den Transport und die Auslieferung von Weißwa re (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen usf .) – und somit auch für die Modernisierung der österreichischen Haushalte . Panalpina verteilte aber auch von hier aus eine in den Wirtschafswunderjahren identitätsstiftende Süßigkeit: die Schwedenbomben von Niemetz . 24 Aus Japan kamen Mazda-
21 Helmuth Trischler, „Geteilte Welt? Verkehr in Europa im Zeichen des Kalten Krieges“, in: Ralf Roth, Karl Schlögel (Hg .), Neue Wege in ein neues Europa. Geschichte und Verkehr im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2009, S 168–169
22 Georgi Dimitrov, Werkstättenleiter bei SOMAT in Wien, heute bei Balkanstar, der Mercedes-Ver tragswerkstätte in Sofia, Interview mit den Autoren, Sofia, 14 4 2016; siehe auch: Michael Hieslmair, Michael Zinganel (Hg .), Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition, Berlin: Sternberg Press, 2019, S 75
23 Ernst Brückler, Pensionist, ehem Speditionskaufmann bei Schenker, Interview mit den Autoren, Wien, 30 1 2019
24 Böhm, Interview, 26 .2 .2022 .
170 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 170 04.11.22 11:21
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Autoersatzteile, Messewaren wurden nach China transportiert . Prinzipiell spielte die Art der Waren für eine breitere Öffentlichkeit keine Rolle, sie tauchten nur im Zusammenhang mit Skandalen auf (etwa eine Lieferung von Rohren nach Russland, die im Verdacht illegaler Kartellbildung stand) oder wenn sie besonders spektakulär waren, wie ein gebrauchter Skilift, der aus Österreich in ein russisches Skigebiet verfrachtet wurde . Milch wurde aus Niederösterreich mit der Bahn angeliefert . Zur direkten Anbindung der damals größten Molkereianlage Österreichs, der NÖM am nahe gelegenen Höchstädtplatz, wurden 1983 eine Weiche und ein Schleppgleis errichtet . Fritz Mauthner betrieb von den 1950er-Jahren bis 1990 in der Ladestraße 3 ein Lagerhaus für den Umschlag von Getreide, Saatgut und Lebensmitteln . 1980 eröffnete das Handelsunternehmen Spar eine Frischdienstumschlaganlage, in der Gemüse vom Marchfeld und von Wiener Gartenbaubetrieben in Kühlwagen verladen und mit Nachtsprung zügen in Regionallager verbracht wurde . 25 Ehemalige Mitarbeiter*innen schätzen, dass in den 1980er-Jahren am Areal bis zu 500 Arbeiter*innen allein bei den ÖBB tätig waren – in Summe auf dem Bahnhofsgelände sicher über 1 .200!26
Bis auf die Abwicklung des Containerverkehrs war die Eisenbahn jedoch nicht mehr das primäre Verkehrsmittel am Bahnhof . Die Zuwächse betrafen in erster Linie den Lkw-Verkehr . Noch in den 1990er-Jahren waren am Nordwestbahnhof auch Frächter aus dem Iran, Irak und vor allem aus der Türkei stark vertreten (die mitunter auch die Wochenenden am Areal verbringen mussten) . Die Lkw stauten sich nicht nur in den engen Lade straßen und an den Tankstellen, sondern auch in den Zufahrtsstraßen bis zum Handelskai . Die Betriebskantinen am Areal, die umliegenden Gasthäu ser und Branntweiner waren voll Auch das Prostitutionsgewerbe florierte Die mit dem Boom einhergehende Verkehrsbelastung und die Subkulturen der transnationalen Kraftwagenfahrer und Lagerarbeiter trugen gleich zeitig auch maßgeblich zur sinkenden Reputation des Bahnhofsumfelds als Wohnbezirk bei . Wer sozialen Aufstieg signalisieren wollte, zog weg . 27
Nach dem EU-Beitritt Österreichs 1995 veränderte sich das Spe ditionsgeschäft dramatisch . Mit den Grenzöffnungen und der sukzessiven EU-Erweiterung, auch in Richtung Osten, wurden die Grenzkontrollen ab gebaut und – zum Leidwesen der Speditionen – ihre lukrativ vermarktbare
25 Kettler, „Von der Personenstation zum Containerterminal“, S 11 Spar nutzte den Nordwestbahnhof für den Frischdienst bis zur Absiedelung im September 2001 Siehe: Bahnhofschronik des Nord westbahnhofs, ÖBB Archiv, Wien .
26 Alexander Schaffer, Berater, ehem Lkw-Fahrer bei Panalpina, Speditionskaufmann u a bei Schen ker und Q-Logistics, Interview mit den Autoren, Wien, 19 3 2019
27 Bernhard Odehnal, Journalist und Anwohner, Sohn einer Anwohnerfamilie, die von hier in ein Neubaugebiet am Stadtrand weggezogen war, Interview mit den Autoren, Wien, 12 .9 .2017
171
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 171 04.11.22 11:21

172 1945–2022 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 172 04.11.22 11:21
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
1983 wurden zwei moderne Containerkräne mit je 40 Tonnen Tragkraft errichtet . Plan: Künz Maschinenfabrik GmbH

173
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 173 04.11.22 11:21
Luftbild des südöstlichen Bahnhofsareals in Richtung Augarten, 2018; Foto: ÖBB, Christian Fürthner

174 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 174 04.11.22 11:22
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Expertise bezüglich Zollabwicklungen großteils obsolet . 28 Gleichzeitig erfolgte eine Auslagerung von Produktion und Warenumschlag in die neu en Billiglohngebiete Osteuropas: Es drangen nicht nur immer mehr Fräch ter aus Osteuropa in den westeuropäischen Markt, die den Preis drückten, sondern die großen westeuropäischen Unternehmen gründeten selbst Be triebsstätten, Lager und Logistik-Hubs im ehemaligen Osten und meldeten Lkw und Fahrer*innen bei ihren neuen Tochterunternehmen an . 29 Dieser kurzen „wilden“ Phase folgte eine Marktkonzentration auf wenige große Player, die kleinere Frächter und Speditionen übernahmen . Aber auch die großen wie Schenker verzichteten angesichts des zunehmenden Widerstan des der Stadt Wien und der Rechtsunsicherheit, auf fremdem Eigentum so intensiv in diesen Standort zu investieren, um in diesem vom Lkw-Verkehr dominierten Markt wieder wettbewerbsfähig zu werden . 30 Die Bedeutung des Standortes als Umschlagplatz nahm ab . Der Niedergang des Knotens Nordwestbahnhof begann .
Ab 2014/15 – zweite Phase der Zwischennutzung
Von der Nordwestbahnstraße aus, wo das Gelände über die gesamte Länge am besten einsehbar ist, bietet sich auf den ersten Blick ein desolater Zu stand: Das Einkaufszentrum steht seit Jahren leer, die nach dem Konkurs des Konsums folgenden Billigmärkte wie Magnet und zuletzt T-Preis blieben Episoden, nur der riesige Parkplatz wird von einem privaten Unter nehmen bewirtschaftet . Die Tankstelle hinter den Wohntürmen und die Böhler-Auslieferungshalle wurden 2015 abgebrochen . Das Schöps-Auslie ferungslager wurde durch einen Hofer-Markt und einen Getränkegroß markt ersetzt, in dem aktuell ein Theater als Zwischennutzung Platz ge funden hat . Das alte Bahnhofspostamt, das bis 2012 als Bezirkspostamt 1200 diente, wurde 2022 bis auf drei der vier Außenwände entkernt und wird für die Erweiterung des Bildungscampus der jüdischen Lauder Cha bad Stiftung umgebaut . Das Verwaltungsgebäude des KWD wurde 2015 an gesichts des Flüchtlingszustroms von der Caritas in eine betreute Massen unterkunft verwandelt . Die vielen Betriebskantinen am Areal sind schon lange verschwunden . Nur mehr die ÖBB betrieben bis 2017 – exklusiv für die wenigen verbliebenen Mitarbeiter*innen – eine kleine Kantine . Eben so wurden die meisten der Gaststätten in der Nachbarschaft aufgegeben und selbst die Sexarbeit scheint am Ende, seit moderne Ladetechniken die
28 Böhm, Interview, 17 5 2017; Wieland, Interview, 19 2 2019
29 Thomas Mader, Disponent bei Q-Logistics, vorher EC-Logistics (Tochter der ÖBB Holding), Inter view mit den Autoren, Wien, 24 5 2017
30 Siehe: Kapitel „Gutvernetzter Großlogistiker am Nordwestbahnhof: Schenker & Co“, S .138 .
175
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 175 04.11.22 11:22
Die große Stückguthalle, eine nach dem Krieg überdachte Umlagebühne, blieb bis 2022 in Betrieb Foto: Peter Hollos, 2018

176 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 176 04.11.22 11:22
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Lagerarbeiter*innen auf Abruf obsolet gemacht haben, die Arbeitszeiten reguliert wurden und die Lkw-Fahrer*innen rund um die Uhr via GPS kontrolliert werden . Nur das Wirtshaus Am Nordpol 3 hat sich gehalten . Es läuft tatsächlich hervorragend, allerdings nur abends, denn in der Nachbar schaft existiert schlichtweg keine Kundschaft mehr, mit der sich der Gast stätten-Betrieb tagsüber rentieren würde .
Der trostlose Eindruck täuschte jedoch lange Zeit . Denn in den Ladestraßen herrschte bis zur endgültigen Stilllegung 2022 durchaus noch Betriebsamkeit: Zwar hatten die großen privaten Unternehmen ihre Haupt quartiere längst in größere multimodale Logistikknoten an die Peripherien der Stadt verlegt, sie sind jedoch nicht zur Gänze ausgezogen, weil dafür der innerstädtische Standort viel zu wertvoll ist . Sie warten ab und ver mieten währenddessen ihre Lager weiter . Nur die Schweizer Panalpina ist 2014 ausgezogen, weil sie sich von Bahn- und Straßenverkehr zur Gänze zurückgezogen hat . 31 DB Schenker nutzte nach wie vor die größten Volu men am Areal als Dauerlager . Die ÖBB-Tochter EC-Logistics betrieb weiter den Stückgutterminal, ab 2017 in Kooperation mit dem privaten Logistik dienstleister Quehenberger, der allerdings mit Jahreswechsel 2018/19 aus dem Joint Venture wieder ausstieg Mit dem Jahreswechsel 2016/17 haben die zwei großen Contai nerkräne ihre Arbeit beendet, nachdem der Ersatzterminal in Inzersdorf fertiggestellt wurde . 32 Im September 2017 wurden die beiden Kräne von einem serbischen Unternehmer zum Schrottpreis gekauft, abgebaut und mit zwei Frachtschiffen auf der Donau an ihren neuen Arbeitsort in Sme derevo gebracht, einer Hafenstadt auf halbem Weg zwischen Belgrad und der Grenze zu Rumänien . 33 Stattdessen haben sich wieder Zwischennutzer*innen aller Art am Areal angesiedelt . Viele der kleinen spezialisierten Unternehmen werden von Geschäftsleuten mit Migrationserfahrung aus Süd- und Osteuropa ge führt, die gemäß ihrer Netzwerke altbewährte Routen neu bespielen: In der ehemaligen Panalpina-Halle leitet eine Immigrantin aus Russland das Unternehmen Autoteile Express GmbH, ein Onlineportal für Ersatzteile . 34
31 Wieland, Interview, 19 2 2019
32 Die Auslastung des neuen Terminals ist jedoch noch bescheiden . Mittlerweile hat sich der Contai nerterminal im Wiener Hafen Freudenau zum wichtigsten Umschlagplatz von der Straße auf die Schiene entwickelt – aber auch zu einem der wichtigsten Logistik-Hubs in Wien Hier zeigt sich die Resilienz dieser gewachsenen Infrastrukturanlagen, deren ursprüngliche Nutzung als Hafen heute nur mehr ein Nebengewerbe darstellt .
33 Miroljub Beočanin, Miteigentümer des Unternehmens Tomi Trade d o o in Smederevo, Serbien, neuer Besitzer der beiden Containerkräne am Nordwestbahnhof, Interview mit den Autoren, Wien, 29 9 2017
34 Irina Trey, Autoteile Express GmbH, Interview mit den Autoren, Wien, 24 .5 .2017 .
177
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 177 04.11.22 11:22
Nachdem ein ehemaliger Lkw-Fahrer, dem das Areal auch von sei nem vorherigen Job vertraut war, in die Dienste eines großen privaten Bus unternehmers trat, begann er nachts hier den ihm zugewiesenen Autobus abzustellen, um nicht jeden Morgen und Abend im Stau in die Firmenzen trale an der Wiener Peripherie fahren zu müssen . Bald folgten befreunde te Kolleg*innen seinem Beispiel, bis es eine ganze Busflotte wurde, die vor der Panalpina-Halle abgestellt war, es waren so viele Busse, dass sogar ein Sozialraum für die Fahrer*innen eingerichtet werden musste . 35 Die Fah rer*innen, die hier penibel ihre Busse reinigten, bevor sie vorrangig Do naukreuzfahrttourist*innen durch Wien fuhren, waren fast alle in Serbien geboren oder Kinder serbischer Familien
Am Ende der Halle war selbst der Freiraum in kleine Parzellen aufgeteilt, die mit Zäunen voneinander und von der der Ladestraße abge grenzt waren: Hier hatte beispielsweise ein mazedonischer Unternehmer mehrere teils ramponierte 7,5-Tonnen-Lkw abgestellt, mit denen er Wa ren von der Stückguthalle zwei Straßen weiter im Raum Wien auslieferte . Gleichzeitig wurde hier sein alter Autobus gewartet, mit dem er eine Bus linie vom Stadion Center in Wien nach Mazedonien betrieb . Wie bei den meisten der Kleinstunternehmer*innen diente auch hier ein alter Contai ner als Sammelgefäß für Waren aller Art . Diese wurden im Bedarfsfall in einen alten Mercedes-Benz Sprinter gepackt und in Richtung Südosteuropa transportiert – dabei wurde meist ein Autoanhänger mitgezogen, auf dem zusätzlich noch ein Gebrauchtwagen exportiert wurde . Eine multikultu relle Fahrschule nutzte das weitläufige Areal für Übungsfahrten und prak tische Fahrprüfungen mit Pkw, Lkw und Autobussen . Die Fahrschule war und ist insbesondere bei Migrant*innen populär, weil sie Fahrlehrer*innen mit unterschiedlichen kulturellen Kompetenzen anbieten kann, die den je weils gleichen ethnischen und religiösen Hintergrund aufweisen wie ihre Fahrschüler*innen . Hier trafen sich Grüppchen von verschleierten Frauen getrennt von jungen Machos, die vor der Fahrprüfung zitterten, weil diese mitunter ihre bisher einzige Ausbildung darstellte .
Von 2005 bis 2020 nutzte der Filmausstatter props .co eine der alten Backsteinhallen aus dem 19 . Jahrhundert als Lager für seine äußerst dichte Sammlung . 36 Das Erdgeschoß, das ausgebaute Dachgeschoß und der Keller stellten eine Art großartiges Ready-Made-Museum dar, voll mit Artefakten aller Art, die nach ihrer Nutzung im Alltag auch noch für Filmausstattun gen Verwendung finden konnten und daher ein enormes Imaginationsar senal freisetzten . Im Zwischenraum zur unmittelbar benachbarten Lager
35
36
7 .2017 .
178 1945–2022
Goran Miladinovic, Autobusfahrer bei Blaguss, Interview mit den Autoren, Wien, 8 9 2017
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 178 04.11.22 11:22
Predrag Jankovic, Lagerarbeiter bei props co, Verein Film Theater, Interview mit den Autoren, Wien, 24
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende

179
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 179 04.11.22 11:22
Der Anfang vom Ende: der Abtransport der Containerkräne, 2017; Foto: Michael Hieslmair und Michael Zinganel
halle hatte die betagte Seniorchefin eines auf teure Küchen spezialisierten Elektrounternehmens einen privaten Kleingarten im Stil der 1950er-Jahre angelegt – mit Blick auf die Schienenstränge, die sukzessive einer Renatu ralisierung unterzogen wurden .
Im Jahr 2018 füllte sich ein Drittel der zuvor leeren Schienen stränge nach und nach mit brandneuen U-Bahn-Garnituren, die im Wiener Siemens Werk hergestellt und mangels Parkmöglichkeit hier endgefertigt wurden und auf ihre Auslieferung und Verschiffung nach Riad in Saudi-Ara bien warteten . Im Februar 2019 sind sie über Nacht verschwunden . Mona telang zeugten nur mehr die riesigen Videoüberwachungssysteme, die sie vor Angriffen von Graffiti-Künstler*innen hätten schützen sollen, davon, dass sich hier etwas von Bedeutung abgespielt haben muss . Nach einem Konflikt zwischen der Rail Cargo und ihrem Partner Quehenberger wurden 2019 die ehemalige Panalpina-Halle in der Lade straße 1 geräumt sowie die Straße und der Schienenstrang endgültig für den Güterverkehr gesperrt . Während sich die Zwischennutzer*innen neue Standorte suchen mussten, verwandelte sich plötzlich das abgetrennte Areal des ehemaligen KWD in einen Cluster aus Fahrschulen, halblegalen Auto werkstätten mit eigener Teststrecke (eine Art „Safe Space“ für Fans des Verbrennungsmotors) während die Info-Ausstellungen der MA 21 Stadtteil planung und Flächenwidmung der Stadt Wien und des ÖBB-Immobilien managements hier über die Zukunft des Areals informierten . 2022 wurde der Stückgutverkehr mit Verspätung abgesiedelt, 150 Jahre nach seiner Er öffnung war der Bahnhof Geschichte .
Das aktuelle Stadtentwicklungskonzept
Parallel zu den genannten illustren Zwischennutzungen hat bereits 2005 auf Initiative der MA 21 und des ÖBB-Immobilienmanagements der Pla nungsprozess eingesetzt: Auf Basis von Vorstudien mit Bürgerbeteiligungs verfahren wurde 2008 ein geladener städtebaulicher Wettbewerb abgehal ten, mit dem Ziel, ein Leitbild für die Neubebauung des 44 Hektar großen Bahnhofsareals zu erhalten . Am Wiener Nordwestbahnhof soll ein kom plett neues Stadtquartier entstehen: Hier werden nicht nur 15 .500 Wie ner*innen ein neues Zuhause finden, sondern auch 4 .750 Wiener*innen einen Arbeitsplatz . Zur Vollversorgung werden auch ein „Bildungscampus plus“, bestehend aus Volksschulklassen und Kindergartengruppen mit Ganz tagsbetreuung, dienen sowie eine weitere Volksschule und Mittelschule, deren Sportanlagen auch den Bewohner*innen des Stadtteils offenstehen sollen . Der Beginn des Abbruchs der Bahnanlagen und Bestandsbauten wur de ursprünglich für 2017 avisiert, die Fertigstellung des Gesamtprojektes
180 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 180 04.11.22 11:22
für 2025 . Aus dem Wettbewerb ging das Züricher Architekturbüro Ernst Niklaus Fausch Partner AG als Sieger hervor, das um eine großzügige Grünzone sehr große geschlossene Hofanlagen in Blockrandbebauung vorschlug . 37 Die geringe Anzahl an Baufeldern, die wohl der Schweizer Stadtentwicklungskultur geschuldet ist, in der wenige Bauträger riesige Gebiete alleine entwickeln, wurde in einem weiteren Überarbeitungspro zess in kleinteiligere Felder filetiert, die der Vielfalt der gemeinnützigen Genossenschaften und privaten Bauträger besser entspricht, die an der Um setzung beteiligt sein werden . Kernstück des Entwurfes ist die „Grüne Mitte“ des Quartiers, die frei von Kfz-Durchzugsverkehr bleiben wird, die erforderlichen Stellplätze werden in Tiefgaragen untergebracht und nur über Stichstraßen erschlos sen . An der Oberfläche soll ein dichtes Fuß- und Radwegenetz mit hoher Aufenthaltsqualität und Durchlässigkeit angeboten werden . Die Esplanade in der „Grünen Mitte“ dient als wichtigste Längsverbindung für Fußgän ger*innen und Radfahrer*innen . Temporär steht sie für die Anlieferung der Erdgeschoßnutzungen sowie für den Einsatzverkehr offen . Nach Vorbild des Parks „The High Line“ in Manhattan soll diese Esplanade als Grünkorri dor und Fahrradweg über die Zulaufstrecke der Nordwestbahn in Richtung Nussdorf und der Donauuferbahn weitergeführt werden . Die Durchquerung des Areals wird fußläufig – auch durch die größeren Baublöcke hindurch –möglich sein, um der Nachbarschaft den Zugang zur zentralen Grünfläche zu ermöglichen . Hier laden die klare urbane Gestaltung der Esplanade im Nordosten und der naturnahe organisch wuchernde Hain im Südwesten mit den verschiedenen Pflanzenarten zu tageszeitlich unterschiedlichen Nutzungen ein . Dazwischen entstehen nutzungsoffene Bereiche und an den Kreuzungen der wichtigsten Durchquerungen auch urbane Platzsitua tionen: Z . B . im nördlichen Teil ein als Markt tauglicher Platz, in der Mitte der „Traisenplatz“ als Akzentuierung der Achse zwischen Wallensteinstraße und Traisengasse, die von einer neuen Straßenbahnlinie durchquert wird, und im Süden als Abschluss der „Grünen Mitte“ platzartige Bereiche, die sowohl die Verbindung zum Grünraum des Augartens als auch zum Nord bahnviertel herstellen . 38
Der Wettbewerbsbeitrag des Bregenzer Büros Dietrich Untertri faller Architekten bot eine völlig gegensätzliche, jedoch interessante Alter native dazu: Hier wurde vorgeschlagen, die Neubebauung auf einen extrem dichten und hohen Streifen an der Nordwestbahnstraße einzuschränken
37 Detailliert beschrieben in: Magistratsabteilung 21 A, Stadtteilplanung und Flächennutzung InnenWest (Hg ), Stadt muss leben. Städtebauliches Leitbild Nordwestbahnhof, Wien 2008
38 Über den aktuellen Planungsstand informieren die Ausstellungen „Stadtraum 2“ der MA 21 und das Info-Center der ÖBB in der ehemaligen Leitstelle des KWD in der Nordwestbahnstraße 16a .
181
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 181 04.11.22 11:22
182 Jahreszahl
Nord-Marktplatz Grüne Mitte Erdgeschoßzone Mitte-Einkaufsstraße Esplanade Kosmos Halle Süd-Parkgarage Bezirksmuseum
Leitbild Nordwestbahnhof, hg . von der MA 21 A Stadtteilplanung und Flächennutzung, 2008; aufbereitet durch Michael Hieslmair und Michael Zinganel, Zeichnung: Aline Eriksson, 2020 Schule
FH
zu 80 m
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 182 04.11.22 11:22
Highline
Städtebauliches
Kindergarten (öffentlich) Kindergarten (privat) Universität,
Sportplatz Spielplatz Erdgeschoßzone Verbindung Einkaufsstraße Hochpunkt Gebäude (35 m) Hochhaus bis
Bestand, Industriedenkmal Bildung Wohnen Gemischte Nutzung (Wohnen, Büro, Handeln)
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende und stattdessen die Schienenstränge und Bahnhofsgebäude als teilnaturalisierte Brache, Industrie-Landschaftspark und Beherbergung von Wohnfolgeeinrichtungen, wie Bildung, Kultur, Sport, Konsum und Arbeitsplätze aller Art, bestehen zu lassen . In diesem Projekt hätten im Sinne einer „produktiven Stadt“ auch Gewerbebetriebe und ein lokaler Verteilerknoten für die Güterverteilung im Bezirk Platz gefunden, die sogar mit der Bahn beliefert hätten werden können .39
183
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 183 04.11.22 11:22
39 Dietrich | Untertrifaller Architekten, Wettbewerbe, Nordwestbahnhof Wien, www .dietrich .untertrifaller .com (14 .8 .2022)
Ökosystem Bahnhof
Nach dem Zweiten Weltkrieg am Nordwestbahnhof tätige Unternehmen (Auszug)
Del Fabro Kolarik GmbH, Getränkegroß handel, Büro und Lager E EC-Logistics GmbH (ÖBB), Büro und Stückgut-Halle F
Fahrschule WIENWEST – Arton Asani, Die multikulturelle Fahrschule, Übungs gelände, Parkplatz Faulmann & Faulmann GmbH, Handel mit Küchen, Büro und Lager Folia Tech, Autofolierungen, Werkstätte G
Gschwindl Urlaub- u . Reisen GmbH, Busparkplätze und -garage H
A
A . F .T . Plus Promotion Sales, Lager und Parkplatz
Ankapack – Dereza Gastro Service GmbH, Lager
ARA Trans GmbH, Parkplatz
Auto – Stahl Reparatur- und VertriebsGmbH, Abstellplatz Autoteile Express GmbH, weltweiter Onlinehandel für Autoersatzteile, Büro B
Berkmann Transporte und Logistik GmbH, Büro und Lager
Berufsfeuerwehr der Stadt Wien, Garage und Werkstätte
Blaguss Reisen GmbH, Busparkplätze und Sozialraum für Fahrer*innen brut Koproduktionshaus Wien GmbH, Theater und Performances C
Caritas der Erzdiözese Wien, Flüchtlings unterkunft
D
DaneTrans Logistic GmbH, Büro und Parkplatz
Danubius Transporte GmbH, Parkplatz DB Schenker (SCHENKER & CO AG), Büro und Lager DBS Cargo GmbH, Büro und Parkplatz
Hadi Travel, Mazedonisches Busunternehmen, Büro und Parkplatz Hannes Busreisen, A+H Zajsek OG, Parkplatz Harry W . Hamacher, Spedition Herber Hausner Süd-Ost Speditionsgesell schaft m .b . H Hofer KG, Lebensmittelmarkt I
Internationale Transporte Karl Kubicek, (später Kubicargo Speditions GmbH) IVI Getränkehandel KG, Büro und Lager J Jeong GmbH, Japanische Lebensmittel, Lager K Konsumgroßmarkt (KGM) L
LTS Transport und Logistik GmbH, Büro und Lager Lugmair Handels- und Transport GmbH, Parkplatz M
Marcic Int . Transporte, Büro und Parkplatz Mepix Handels KG, Medizinisches Mobiliar, Büro und Lager Museum Nordwestbahnhof, Ausstellungen N
Norbert Schaller GmbH, Büro und Lager O
ÖBB Info-Center Nordwestbahnhof, Büro und Ausstellung ÖBB-Infrastruktur AG, Büro und Bereichslager Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
184 1945–2022
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 184 04.11.22 11:22
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
P
Panalpina Welttransport AG, Lager und Verwaltung props .co, Verein Film Theater, Filmausstattungen, Büro und Lager
Q
Q Logistics GmbH, Logistik-Center Wien Nordwest, Büro und Stückguthalle Quehenberger Logistics GmbH, Büro und Lager R
Rail Cargo Austria AG (ÖBB) – Geschäfts feld Terminal Service Austria (TSA), Büro und Containerterminal
Richard Schöps & Co . AG, Textilgroßhandel Rohner + Gehrig Lagerhaus und Immobilien GmbH, Büro und Lager S
Schachinger Logistik Holding GmbH, Parkplatz, Lager Schier, Otten & Co . GmbH, Internationale Spedition, Lager und Verwaltung SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Büro und Lager T
TAC Carwash
Tatschl & Söhne Speditions- und Transport GmbH, Parkplatz, Lager TM Wraps, Autofolierungen, Werkstätte Trans Pak Österreich GmbH, Büro und Lager U V
VIENNACARGO GmbH, Büro und Lager W
Wirtschaftsagentur Wien . Ein Fonds der Stadt Wien, Lager X Y Z
Quellen: Firmenbeschilderung bei Begehung des Areals und Verzeichnis der Untermieter*innen/Bestandsnehmer*innen der ÖBB Infrastruktur
185
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 185 04.11.22 11:22

186 1945–2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C D E F 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 186 04.11.22 11:22
Wiederaufbau, der Boom im Kalten Krieg und das lange Ende
Luftaufnahme Areal Stand 2020
A Halle Personenbahnhof
B Bahnhofspost
C Lokschuppen
D Wasserturm
E Nordsee Kühlhaus mit Fischverarbeitungshalle
F Bananenhalle
1 Schüttgutverladestelle für den Material umschlag von der Bahn auf tiefer gelegenes Straßenbahnniveau; seit 1945 Kleingarten verein ÖBB Wien-Nordwest
2 ÖBB Betriebsgebäude, Fahrdienstleitung Wien Nordwest mit Sozialraum und Unterkunft für das Verschubpersonal
3 Seit 1971 Leitstelle des Kraftwagen dienstes der ÖBB mit Garagen und Werk stätten; von Februar 2016 bis Juni 2017 Flüchtlingsunterkunft – „Caritas Notquar tier NordWestBahn“; seit 2020 Museum Nordwestbahnhof, ÖBB Info-Center Nord westbahnhof, MA 21 Stadtraum II
4 Ehemalige Spedition Schier, Otten & Co . (2001 von den ÖBB erworben, als Subfirma geführt und 2009 in die ÖBB Rail Cargo Austria integriert); heute ÖBB-Infrastruktur AG, Signalwerkstätte, Bauhof, Lager
7 Auslieferungshalle Böhlerstahl Vertriebs GmbH, abgebrochen 2014/15; Halle der Textilhandelskette Schöps; später Del Fabro Kolarik GmbH, Getränkegroßhandel; seit 2020 brut nordwest
8 Seit 1911 Umschlaghallen von Schenker & Co ., später DB Schenker, in den 1960erJahren neu erbaut und um eine ganze Zeile erweitert
9 Ehemaliges Hauptpostamt der Brigitte nau, nur die Außenmauern bleiben erhalten, in Zukunft Teil des Lauder Chabad Campus .
10 Ehemaliger Konsumgroßmarkt (KGM), Gebäude nach der Insolvenz 1995 von meh reren Diskontern − wie Magnet und zuletzt T-Preis − genutzt; steht seit Jahren leer
11 Ehemalige Panalpina-Halle, danach Quehenberger Logistics GmbH, von 2015 bis 2019 provisorischer Autobusparkplatz der Firma Blaguss Reisen GmbH
12 1964 fertiggestellte zwölfgeschoßige Wohnhochhäuser der BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und Siedlungsgenos senschaft am Standort der abgebrochenen Personenabfertigungshalle
13 Magazine in Backsteinbauweise, weit gehend im Originalzustand erhalten, genutzt u . a . vom Filmausstatter props .co, Verein Film Theater; Asia-Lebensmittel
Lager- und Auslieferungshalle, betrieben von Tatschl & Söhne Speditions- und Transport GmbH für Gipskartonprodukte der Firma Knauf GmbH
5
6 Fahrschulübungsplatz und seit 2002 Parkplatz für Container, Busse, Sattelzüge, Klein-Lkw von Kleinstunternehmer*innen mit Migrationshintergrund
14 Hallen mit offener Umladebühne, später Stückguthalle der ÖBB EC-Logistics GmbH, entstanden 1950 aus der Überdachung zweier alter Magazinreihen
15 Containerterminal mit zwei Kränen, 1985 errichtet von der Firma Künz GmbH, 2016 stillgelegt, 2017 demontiert und nach Serbien abtransportiert
Luftbild: ViennaGIS – Geografisches Informationssystem der Stadt Wien, 2015; grafische Bearbeitung: Tracing Spaces, 2020
187
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 187 04.11.22 11:22
Excavations of Lost Memories. Künstlerische Ausgrabungsarbeiten am Wiener Nordwestbahnhof














Improvisierte Disziplinierungsmaßnahme beim Zugang zur Laderampe zwischen den alten Backsteinhallen; Foto: Peter Hollos, 2018

188 Blinder
Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 188 04.11.22 11:22
Excavations of Lost Memories.
Ein Museum als Quelle künstlerischer Interventionen am Logistikareal
Seit 2015 betreiben wir unter dem Label „Tracing Spaces“ einen Projektraum am Wiener Nordwestbahnhof – ursprünglich als Arbeitsraum mit Logistikbezug für unsere Forschungen zu einem weiteren mobili tätsbezogenen Thema.1 Inmitten eines Güterumschlagplatzes, dessen Ende bereits mehrmals angekündigt wurde, wurde schnell klar, dass wir uns in ein potenziell ergiebiges Forschungsfeld bewegt hatten, dessen Wissensträger*innen bald nicht mehr hier arbeiten würden: Videointerviews mit den unmittelbaren Nachbar*innen, d. h. mit gerade noch vor Ort Tätigen oder pensionierten Akteur*innen, geben Einblick in verschiedene Tätigkeitsfelder und Hierarchiestufen in großen und kleinen Betrieben, in die Transformation von Arbeits- und Lebenswelten. Parallel dazu entstand eine Sammlung aus Artefakten, Geschenken oder Dauerleihgaben, die von uns mit historischem Dokumentationsmaterial ergänzt wurde. Publikum wurde durch niederschwellige Führungen über das Areal, die in der Regel mit Grillfesten endeten, generiert.
Der Erfolg dieser Veranstaltungen führte jedoch auch zu Problemen mit der Grundstückseigentümerin ÖBB, weil unsere Besucher*innen auf der Suche nach unserem Raum durch absichtliche und unabsichtliche Wanderungen über das Logistikareal, auf dem zu diesem Zeitpunkt noch Güterzüge und Lkw verkehrten, sich und andere gefährdeten. Die unlösbare Haftungsfrage und ein im Jahr 2020 von den ÖBB angebotener, von der Straße zugänglicher Raum veranlassten uns zum Umzug und zur symbolischen „Institutionalisierung“ und Aufwertung zum „Museum Nordwestbahnhof“. Dieses eröffnete in weiterer Folge Außenstellen am Areal und bespielte diese mit künstlerischen Interventionen, aus deren Erfahrungen wiederum der Bestand des Museums inhaltlich ange reichert wurde.
„Nordwestpassage“: Ein Stationentheater
Zum Zeitpunkt der Aufführungen von „Nordwestpassage“ im Sommer 2019 wurden am Nordwestbahnhof mit seinen scheinbar verödenden Hallen und Rampen und den sich bereits der Renaturierung unterwerfenden Eisenbahn- und Industriebrachen immer noch Güter per Bahn und Lkw umgeschlagen. Der Rückgang des Warenumsatzes und der Rückzug einiger großer Unternehmen bot Raum für eine parasitäre Nutzung: Unter dem
1 Michael Hieslmair, Michael Zinganel (Hg.), Stop and Go – Nodes of Transformation and Transition (Schriftenreihe der Akademie der bildenden Künste Wien, Bd. 23), Berlin: sternberg press, 2019; dies., Road*Registers. Aufzeichnungen mobiler Lebenswelten (Ausstellungskatalog, Akademie der bildenden Künste Wien, 30.9.−6.11.2016), Wien: Tracing Spaces, 2017; Tracing Spaces, Road Registers, https://tracingspaces.net/road-registers/ (27.8.2022).
189
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 189 04.11.22 11:22





190
Blinder Fleck Nordwestbahnhof
Museum Nordwestbahnhof, Innenraum; vorne: Modell der Nordwestbahnhalle, rechts: aktuelles Luftbild und Interviews mit vor Ort Beschäftigten; Foto: Wolfgang Thaler, 2021
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 190 04.11.22 11:22
Museum Nordwestbahnhof, der Eingang gestaltet als Schiffsdeck eines fiktiven Forschungsschiffes, darüber ein Graffiti von RUIN; Foto: Michael Hieslmair und Michael Zinganel, 2021
Motto „Das Leben ist eine Zwischennutzung“ konzipierten wir in Kooperation mit dem Theater im Bahnhof ein mobiles Stationentheater, das sich entlang bereits stillgelegter Gleise über die gesamte Länge des weitläufigen Areals erstreckte. Auf Basis eines Castings wurden mit ehemaligen und derzeit noch am Areal Beschäftigten, mit Bewohner*innen aus der unmittelbaren Umgebung sowie mit zu Bahn arealen Forschenden einzelne Szenen und Bilder erarbeitet, die sowohl unsere eigenen Recherchen als auch die jeweiligen Berufserfahrungen der Schauspieler*innen als Expert*innen ihres mitunter prekären Berufsalltags reflektierten.
Zur Markierung einzelner Szenen bauten wir unterschiedliche überdimensionale Objekte, und zur Fortbewegung des Publikums von Szene zu Szene bedienten wir uns verschiedener Fahrzeuge, wie auf Schubkarren montierte Stuhlreihen, Klein-Lkw und selbstgebaute Draisinen, die in der Schlussszene ins Abendrot fuhren, während JeanLuc Nancys Reflektionen über das Unendliche „Immer schon […] gemeinsam“ rezitiert wurden.2 Hauptattraktion war das zwei Kilometer lange Areal, das vom Publikum – Passagier*innen und Stückgut zugleich –durch mehrmaliges Umsteigen und Umgeladen-Werden zwischen technischen und sozialen Infrastrukturen er- und befahren werden durfte.3
Fischgeschichten
Die Recherchen zur Vorgeschichte des Standortes als Auenlandschaft, Wasserweg und Lebensraum der Wiener Fische, geborener wie ungebore ner, die der Industrialisierung und Immobilienspekulation zum Opfer gefallen sind, animierten uns 2020, den wahren „Ureinwohner*innen“ des Bezirks einen thematischen Schwerpunkt in unserem Museum zu setzen: Zuerst sammelten wir auf Basis eines offenen Calls Fischgeschichten aller Art, Erzählungen und Artefakte für die Ausstattung unseres Museums. Dazu zählt neben der Dokumentation der weiträumigen Auen landschaft und der nachhaltigen Zerstörung dieses Reproduktions- und Lebensraums der Fische auch die Geschichte der deutschen Firma Nordsee, die Wien über den Nordwestbahnhof mit Fischen versorgt hatte.4 Zudem adaptierten wir den Eingang unseres Museums mit einfachen Mitteln ähnlich dem Schiffsdeck eines Forschungsschiffs, mit dem wir – wenngleich nur virtuell oder symbolisch – über das Areal schipperten, um nach Geschichten zu fischen. Neben einer Betriebstankstelle hinter dem Museum findet sich eine informelle
2 Siehe dazu: Tracing Spaces, Nordwestpassage, https://tracingspaces.net/nordwest passage/ (27.8.2022).
3 Vgl.: Rimini Protokoll, Cargo Sofia-X. A Bulgarian truck-ride through European cities, Konzept und Regie: Stefan Kaegi, Produktion: Goethe-Institut Sofia, Hebbel am Ufer Berlin, 2006, www.rimini-protokoll.de/website/en/project/cargo-sofia-x (30.8.2022).
4 Siehe: „Vorgeschichte, Fischgeschichte, Donauregulierung und Spekulation“, S. 60, Anm. 9: Nordsee GesmbH (Hg.), 100 Jahre in Österreich.
191
Excavations of Lost Memories.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 191 04.11.22 11:22
Aussichtsplattform, die einen weiten Blick über das Areal bietet: Auf den stillgelegten Bahngleisen des Frachtenbahnhofs, genau dort, wo sich früher das Fahnenstangenwasser, ein bedeutender Seitenarm der Donau, befand, wurden zu dessen Markierung Fische „ausgesetzt“. Hier beschränkten wir uns auf nur eine ikonenhaft vereinfachte „universelle“ Typologie, wie sie Otto Neurath und Gerd Arntz in den 1920er-Jahren für ihre bildhaften statistischen Diagramme entwickelt hatten. 100 identische zweidimensionale Fischtafeln zeigen so eine mögliche Lesart mit ihren Nasen jeweils schräg nach unten, in Richtung des Wasserspiegels des einstigen Donauarmes, als wollte der Fischschwarm in sein ehemaliges Habitat zurückkehren. Die immer gleichen, weißen, abstrahierten Fischabbilder könnten aber auch in Analogie zu Soldatenfriedhöfen als „Grabsteine“ für die unzähligen unbekannten Donaufische interpretiert werden, die hier für die Industrialisierung der Stadt ihr Leben lassen mussten.
Der Sachverhalt, dass der Fischbestand einst durch eine Viel falt unterschiedlicher Gattungen und Arten gekennzeichnet war und die meisten von ihnen Migrant*innen oder transnationale Pendler*innen waren, die zyklisch weite Wege über die damalige „Balkanroute“, die Donau flussauf- und flussabwärts, zurücklegten, spiegelt sich heute noch in den migrantisch geprägten Milieus unterschiedlichster Herkunft in den hier ansässigen Speditionsunternehmen und Reparaturwerkstätten wider.
Im ehemaligen Pförtnerhäuschen neben der Einfahrt ins Areal begegnen wir Hinweisen auf die mythologisch und kunsthistorisch sich wiederholende Rollenzuschreibung der Fische als Mischwesen und Monster aus der Urzeit, der Unterwelt oder als dem Rande der Zivilisation nahestehende Lebewesen, wie sie beispielsweise auch in den Grafiken von Pieter Bruegel dem Älteren und den Gemälden von Hieronymus Bosch zu finden sind. Diese haben uns ermutigt, dem Ort eine lokale Mythengeschichte anzudichten: Der Wiener Hausen, der wegen seiner enormen Größe und Hässlichkeit meist beschriebene und besungene Donaufisch,5 eine gepanzerte Urform des Störs, mit dem schon immer Kinder verängstigt wurden, schien prädestiniert für diese Rolle als ortsspezifische Identifikationsfigur. Den kleinen, allseitig einsichtigen Raum des Pförtnerhäuschens verwandelten wir in ein Hybrid aus Aquarium und Vitrine bzw. Operationssaal und Anatomietheater, in dem ein raumfüllendes, fischartiges Wesen aufgebahrt ist mit geöffneter Bauchdecke und an intensivmedizinische Notversorgungsgeräte angeschlossen. Dieses Tier hatte so unsere Behauptung die Aufschüttungen von 1860 in einem Hohlraum unter dem Areal überlebt und wurde nun bei Probebohrungen schwer verletzt an die Oberfläche und in unsere sorgenden Hände gespült, noch unklar, ob es ein gutes
5 Siehe: ebd., S. 54, Anm. 4: Schmeltzl, Ein Lobspruch der Hochlöblichen, S. 40−44.
192 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 192 04.11.22 11:22
Excavations of Lost Memories.
Proben zu „Nordwestpassage“, einem mobilen Stationentheater, das sich wie eine Prozession über die gesamte Länge des Nordwestbahnhofs zog. Foto: Stefan Beer, 2019


193
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 193 04.11.22 11:22
Ein „Fischfriedhof“ für die unbekannten Wiener Fische oder ein „Fischschwarm“ auf der Rückkehr in sein angestammtes Habitat auf den stillgelegten Bahngleisen des Frachtenbahnhofs hinter dem Museum Nordwestbahnhof; Installation: Michael Hieslmair und Michael Zinganel, Foto: Wolfgang Thaler, 2021


194
Nordwestbahnhof
Blinder Fleck
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 194 04.11.22 11:22
„Fischkiosk“ im ehemaligen Pförtnerhäuschen der Bahn- und Postbusgaragen, ein Hybrid aus Aquarium und Vitrine bzw. Operationssaal und Anatomietheater für die Behandlung eines unbekannten fischartigen Wesens; Foto: Wolfgang Thaler, 2021
Excavations of Lost Memories.
oder böses Monster ist, das wir hier sicherheitshalber vor militärischen, medizinischen und musealen Institutionen und dem Stadtmarketing zu schützen versuchen.
Excavations: Baustelle einer forensischen Rekonstruktionsarbeit
Der Nordwestbahnhof war aber auch Ort politisch brisanterer Zwischennutzungen: Hier an der Grenze zwischen den beiden Bezirken mit dem höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil Wiens wurde deren Schicksal durch zwei kulturelle Produktionen markiert: 1924 diente der Nordwestbahnhof als Drehort für die Szene der Deportation der Wiener Jüdinnen und Juden im Film „Stadt ohne Juden“6 und 1938 als Ausstellungsort der antisemitischen Propagandaausstellung „Der ewige Jude“.7 Um diese beiden Ereignisse in räumlich und zeitlich verdichteter Form vor Ort zusammenzuführen, überlagerten wir den Grundrissplan der Einbauten für die Ausstellung, der 1938 zur Genehmigung der Veranstaltung bei der Stadt Wien eingereicht wurde, mit den Umrisslinien der 1952 abgebrochenen Bahnhofshalle. Diese Überlagerung zeichneten wir im Maßstab 1:1 am Boden des Originalstandortes nach. Um die Wirkung der Markierung zu verstärken und die Höhenentwicklung anzudeuten, errichteten wir ein niedriges Gerüst, das an Fundamentschalungen oder Baustellenabgrenzungen für Ausgrabungsarbeiten erinnert. Gleichzeitig stellten wir die abstrahierten Umrisse eines Zugwaggons genau an der Stelle nach, wo dieser während der Deportationsszene im Film zu sehen war. War diese fiktive Handlung im Film von 1924 noch vorübergehend, so zeigte die verhetzende Wirkung der Ausstellung 1938 ihre fatale Wirkung im Realen: in Pogromen, Deportationen und Massenvernichtung.
Einer in den Kulturwissenschaften des 20. Jahrhunderts etablierten Interpretation gemäß ließen sich diese „Ausgrabungen“ auf Sigmund Freuds Analogie von Archäologe und Psychoanalyse zurückführen, der zufolge sowohl die Arbeit der Archäolog*innen als auch die der Psychoanalytiker*innen anhand kleiner Details Schicht für Schicht verdrängte Aspekte des Unterbewussten eines Individuums oder der Stadtgeschichte (des Unterbewussten einer Stadt) freilegen kann.8 Freuds These wurde besonders wirkmächtig, weil sie unzählige Künstler*innen, die zu Stadtthemen arbeiteten, wie beispielsweise
6 Andreas Brunner, Barbara Staudinger, Hannes Sulzenbacher (Hg.), Die Stadt ohne. Juden, Muslime, Flüchtlinge, Ausländer (Ausstellungskatalog, Metro Kulturhaus Wien, 2.3.−30.12.2018), Wien: Verlag Filmarchiv Austria, 2018; Filmarchiv Austria, „Die Stadt ohne“, Digitorial, www.filmarchiv.at/digitorial/die-stadt-ohne/ (28.8.2022).
7 Siehe: „‚Der ewige Jude‘ – Eine Ausstellung als Aufruf zur Vernichtung“, S. 99, Anm. 1: Benz, „Der ewige Jude“; Anm. 3: Burgstaller, „Verhöhnung als inszeniertes Spektakel“, S. 346–356.
8 Z.B. wieder aufgenommen in: Freud’s Archaeology, Symposium, The Warbug Institute (Birbeck College, London), 4.−5.6.2019.
195
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 195 04.11.22 11:22
Überlagerung einer Schrägluftaufnahme des Nordwestbahnhofs aus dem Jahr 2015 mit dem Einreichplan der Einbauten für die NS-Propagandaausstellung „Der ewige Jude“ (1938) im Bestand des später zerstörten Bahnhofsgebäudes (schraf fiert) an der Ecke Taborstraße und Nordwestbahnstraße; Luftaufnahme: ÖBB, Collage: Alexander Gruber, Michael Hieslmair, Michael Zinganel, 2021

196 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 196 04.11.22 11:22
Excavations of Lost Memories.
die Surrealist*innen oder Walter Benjamin in seinem Passagenwerk, Drehbuchautor*innen und Regisseur*innen, maßgeblich beeinflusste. Sie prägte aber auch Robert Ezra Parks Denken, der in den 1920er-Jahren die Chicago School of Sociology, die Geburtsstätte moderner Stadt forschung, mitbegründete, oder den Architekturtheoretiker Peter Eisenman, der stadtarchäologische und mentale „Excavations“ zur architektonischen Entwurfsgrundlage erhob.9 Nach einem aktuelleren Verständnis folgt diese Praxis den Prinzipien der Forensic Architecture, die anhand von Indizien politisch motivierte Verbrechen aus der Geschichte und Gegenwart in unterschiedlichen architekturnahen Darstellungstechniken fragmentarisch rekonstruiert: Der Begriff wurde von Eyal Weizman geprägt, lässt sich aber auf die Arbeit des Architekturhistorikers Robert Jan van Pelt zurückführen, der im Jahr 2000 als Gutachter im Prozess gegen den Holocaustleugner David Irvin auftrat und anhand von Plänen des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und Spuren des Bestandes die Tötungsabsicht und -praxis nachweisen konnte.10 Im Fall von „Tracing Spaces“ passiert diese öffentliche Beweisführung jedoch nicht im Gerichtssaal (oder in großen Architekturausstellungen), sondern direkt am Ort der Ereignisse und Recherche.
Den Nordwestbahnhof verstehen auch wir demnach als Tatort. Hier wurde kein organisierter Massenmord verübt. Hier wurden jedoch –nach unserem heutigen Rechtsverständnis – offenkundig rassistische Verhetzung betrieben, Verbrechen legitimiert, zu Verbrechen ermutigt und direkt dazu aufgerufen.
Auch dieses Erinnerungsmal diente nicht allein als „Skulptur“, sondern vorrangig als Ausgangspunkt und Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zur Rolle jüdischer Akteur*innen im Speditionswesen, deren Unternehmensstandorten am oder im Umfeld des Bahnhofs, zu „Arisierung“, erzwungener Emigration und Raub ihres Hab und Guts am Nordwestbahnhof während der NS-Zeit, auch der Film „Stadt ohne Juden“ wurde wiederaufgeführt.11
Stille Taktiken der Verstetigung
„15 vor statt 5 nach 12“: Im Gegensatz zu den lautstarken Forderungen nach Räumen für permanente kulturelle Nutzungen, die bei so gut wie jedem neuen Stadtentwicklungsgebiet in der Regel erst dann
9 Jean-François Bédard et al. (Hg.), Cities of Artificial Excavation: The Work of Peter Eisenman, 1978−1988, New York: Rizzoli International, 1994.
10 Robert Jan van Pelt, The case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, Bloomington, IN, u.a.: Indiana Univ. Press, 2002; Eyal Weizman, Forensic Architecture. Notes from Fields and Forums = Forensische Architektur (Documenta 13, Kassel, 9.6.−16.9.2012), Ortsfildern: Hatje Cantz, 2012.
11 Siehe dazu: Tracing Spaces, Veranstaltungen/Führungen, Excavations from the dar kest past, https://tracingspaces.net/excavations/veranstaltungen-fuehrungen/ (28.8.2022).
197
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 197 04.11.22 11:22
eingebracht werden, wenn die Bautätigkeit längst begonnen hat oder der neue Stadtteil kurz vor der Fertigstellung steht, verstehen wir dieses Projekt als eine frühzeitig einsetzende, mittelfristig angelegte Taktik zur stillen Verstetigung unserer Anliegen. Zu diesem Zweck konnten wir uns ein Netz von Verbündeten in Stadtverwaltung und den ÖBB aufbauen, die unsere Tätigkeit über die Jahre beobachtet haben und wertschätzen.12 Im Rahmen der anstehenden Transformation in ein Wohngebiet wird der aktuelle Museumsstandort mit Sicherheit erst als eines der letzten Gebäude am Areal abgebrochen und in den kommenden Jahren auch von den ÖBB und der Stadtplanung als Informationszentrum für die Neugestaltung genutzt werden. Sollte wie angekündigt eine der alten Lagerhallen aus dem 19. Jahrhundert für kulturelle Nutzungen gewidmet werden, könnten wir unsere „Sammlung“ einbringen, ebenso wie unsere Stammkundschaft, die wir in der Nachbarschaft gewonnen haben. Noch interessanter wäre es allerdings, wenn Spuren unserer Erinnerungsarbeit in die Freiraumgestaltung des Areals integriert werden könnten, indem die Stadt sich ermächtigt, die Widmung mit inhaltlichen Auflagen zu verbinden, bevor die Grundstücke vergeben werden und die Planung durch Bauträger beginnt.
12 Wir haben gelernt, die Toleranzschwellen der Verwalter*innen der Grundstückseigentümer*innen vor Ort auszuloten. Andernfalls wären die o. a. Aktivitäten nicht realisierbar gewesen.
198 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 198 04.11.22 11:22

































199
Excavations of Lost Memories.
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 199 04.11.22 11:23
1:1-Nachzeichnung der Umrisse des Bahnhofsgebäudes mit einer zitathaften Rekonstruktion der Einbauten für die Ausstellung „Der ewige Jude“ (1938) am Ort des historischen Ereignisses; Installation: Michael Hieslmair und Michael Zinganel, Foto: Wolfgang Thaler, 2021
Anhang
200 Blinder Fleck Nordwestbahnhof 221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 200 04.11.22 11:23
A
Allgemeine Bodencreditanstalt 45
Am Nordpol 3, Gasthaus 177
Autoteile Express GmbH 177
B
Bank Austria AG 165
Bárány & Co, Großhandlung mit Ölen und Fetten 124
Böhlerstahl Vertriebs GmbH (Gebr . Böhler & Co .) 161, 175
Brasch & Rothenstein, Spedition 77, 120, 121
Brigittenauer Molkerei 41
Bruno Jellinek (Bananen-Großimporteur) 125, 126
C
Caritas der Erzdiözese Wien 175
Caro & Jellinek, Spedition 77, 121, 125
Centralverein für Rübenzucker-Industrie in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 33
Confracht 167
Continental Agentur für Transporte 120
Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe 33
D
Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft „Nordsee“ 60, 61, 62, 167, 191
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH 181
E
E . Bäuml, Spedition 40, 41, 77, 116, 120, 121
EC-Logistics GmbH (ÖBB) 177
Eisen Schrecker 125
Erben & Gerstenberger, Spedition 121 Ernst Niklaus Fausch Partner AG 180, 181 Expo-Vienna AG 165 F
Fischhandels AG 159
Fross-Büssing (A Fross-Büssing KG) 41, 130, 131, 133, 135 G
Gebrüder Weiss GmbH 121, 167, 170
Gelatinewaren Industrie K . G . 135
Godetz, Geist & Co . Mineralwassergroß handlung 125
Gottlieb Tesch, Baufirma 133 Götz & Söhne, Metallbau 41 H
Hofer KG 175
Hucketrans (Huckepack-Transportgesellschaft m .b . H .) 167 I
IBM Österreich Internationale Büromaschinen G .m .b . H . 165
Institut für Ausstellungstechnik und Bildstatistik 108
Intercontinentale GmbH, Spedition 161, 167, 170
Internationale Transport-Ges . A . G . 121 J
Johann Petter, Spedition 121 K
Kaiser-Franz-Josefs-Bahn (KFJB) 29, 31, 33, 46, 90
Kirchner und Partner GmbH, Spedition 167, 170
Konsumgroßmarkt (KGM) 161, 175
Kosmos, Internationale Transporte, Spedition 116
Kraftwagendienst der ÖBB (KWD) 161, 175, 180
Kubicek (Internationale Transporte Karl Kubicek, später Kubicargo Speditions GmbH) 167
Kunsttrans 120 L
Leinkauf (Josef J . Leinkauf, Spedition) 77
201 Firmenindex Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 201 04.11.22 11:23
Blinder Fleck Nordwestbahnhof
Leopold Vulkan, Holz und Brennmaterialien 126 M
MA 21 Stadtteilplanung und Flächenwidmung 180 Magnet 175
Mattoni-Ungar, Mineralwassergroßhandel 124, 125
Maximilian Tins, Spedition 121, 130 Museum Nordwestbahnhof 17, 21, 189, 191 N
Niederösterreichische Molkerei (NÖM) 41, 171
Niels Mörch, Bananen-Import 125
Niemetz (Walter Niemetz Süßwarenfabrik) 170
O
ÖBB Immobilienmanagement GmbH 180
Ökombi GmbH 168
Ölschlägel 167
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB-Holding AG) 71, 73, 80–82, 84, 116, 142, 146, 151, 159, 162, 168, 171, 175, 177, 189, 198
Österreichische Nordwestbahn (ÖNWB) 28-31, 33, 34, 44–46, 53, 71, 90, 181
Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 108
Österreichisches Institut für Bildstatistik 108 P
Panalpina Welttransport AG 161, 167, 170, 177, 178, 180
props .co, Verein Film Theater 178
Q
Quehenberger Logistics GmbH 177, 180
R
Rail Cargo Austria AG (RCA, ÖBB) 168, 180
Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) der Deutschen Reichsbahn 130, 131
Rohner + Gehrig Lagerhaus und Immobilien GmbH 170
Rosenbaum & Schiller, Technische Öle 125
Roth E . & Co ., Eisen 125 S
Schenker (Schenker & Co ., DB Schenker, SCHENKER & CO AG) 41, 50, 77, 82, 84, 116, 130, 131, 133, 135, 136, 138-153, 159, 161, 167, 168, 170, 175, 177
202
Schier, Otten & Co . GmbH, Internationale Spedition 168, 170 Schmidl 167 Schöps (Richard Schöps & Co . AG) 161, 175 Siemens AG Österreich 143, 180 SOMAT AD, Spedition 170 SPAR Österreichische Warenhandels-AG 171 Spiegler & Popper FaßhandelsgesmbH . 125 Staatseisenbahn-Gesellschaft (StEG) 29, 33, 44
Stadlauer Mühle, Singer & Co 125 Südland, Internationale Transporte 161, 170 Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn (SNDVB) 29, 31, 33 T T-Preis 175 U V W W . Kryzan, Tischlerei 130 X Y Z
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 202 04.11.22 11:23
A
Arntz, Gerd 108, 192
Auersperg, Vincenz Karl Fürst von 33
B
Bartz, Alfons 120 Bäumer, Wilhelm S . 28 Bäuml, Eliazim 116 Bäuml, Erich 116, 120 Bäuml, Rudolf 116 Bäuml, Selma 120 Benz, Wolfgang 99 Bernays, Edward 46 Bernays, Eli 46 Bernays, Judith 46 Bernays, Lucy 46 Bettauer, Hugo 80, 81 Bonyhady, Tim 115 Bosch, Hieronymus 192 Breslauer, Hans Karl 80 Brückler, Ernst 147, 170 Bruegel der Ältere, Pieter 192 Burgstaller, Rosemarie 106
C
Carlsen, Dagfinn 81, 82 Chotek, Otto Graf von 33 D
Doderer, Heimito von 73 Dollfuß, Engelbert 84, 88 Dustmann, Hanns 96, 97
E
Ebner, Karl 121, 124 Eisenman, Peter 197 F
Felder, Cajetan 35 Feltl, Gerhard 165 Fischer, Alois 108 Fogerty, Joseph 90 Freud, Martha, geb . Bernays 46 Freud, Sigmund 46, 120, 195 Freud-Bernays, Anna 46 Fürstenberg, Max Egon Fürst zu 33 G
Globocnik, Odilo 93, 106, 143 Goebbels, Joseph 89, 99 Göring, Hermann 89 Grießler, Josef 88 H
Haidvogl, Gertrud 35, 39 Hamacher, Harry W . 120, 121 Hauer, Friedrich 35, 39 Heiligenthal, Roman 96 Hellwag, Wilhelm 28 Herber, Karl 121, 124 Hirsch, Moriz 139 Hitler, Adolf 89, 106 Hochenegg, Carl 90, 92 Hohenberg, Luli von 89 Holzbauer, Wilhelm 165 Holzer, Marcell 140, 142 Holzschuh, Ingrid 96 Horn, Alfred 131 I
Ilz, Erwin 91, 92, 93 Irvin, David 197 J
Jahn, Otto 108 Jellinek, Bruno 125, 126 Jellinek, Mellie 126 K
Kainz, Karl 56, 61 Kaiser Franz Joseph 34 Kaiser Wilhelm I . 34 Karpeles, Moritz 139 Karpeles-Schenker, Emil 139, 142 Körber, Robert 108 Köster, Karl 96 Krauß, Franz 61 Krisch, Anton 60
203
Personenindex Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 203 04.11.22 11:23
Kunschak, Leopold 50
Kunschak, Paul 46
Kuschel, Erich 91 L
Liebieg, Johann 29
Lingens, Ella 132
Linsberg, Louis Haber von 31, 33 Lorre, Peter 100
Lueger, Karl 45, 100 M
Matis, Herbert 143
Mauthner, Fritz 171 Mörch, Niels 125 N
Nancy, Jean-Luc 191
Neubacher, Hermann 93
Neurath, Otto 108, 192 Novy, Franz 162 Nübel, Heinrich 74 O
Oppenheim, Hermann 121 Örley, Robert 93 P
Park, Robert Ezra 197
Pelt, Robert Jan van 197 Pirhofer, Gottfried 97 Pöcher, Franz 93 Popp, Alexander 89 Q R
Rafetseder, Hermann 133 Rainer, Hugo 162 Rainer, Roland 97
Reidemeister, Marie 108 Rothschild, Anselm 33, 44 S
Salm-Reifferscheidt, Franz Altgraf zu 31 Salvator, Erzherzog Franz 50
Schenker, Gottfried 139, 143, 168
Schenker-Angerer, August 139, 143 Schuhmeier, Franz 46, 50 Schuster, Franz 96 Schwarz, Friedrich 31
Schwarzenberg, Johann Adolf Fürst zu 31, 33
Seitz, Karl 73, 81 Seyß-Inquart, Arthur 106 Speer, Albert 93 Stiefel, Dieter 143
Stroebel, Hermann 96 Strzygowski, Josef 96 T
Taussig, Theodor (Ritter) von 45 Thurn und Taxis, Hugo Fürst 31 Tölk, Josef 61 U V
Vulkan, Leopold 126 Vulkan, Mathilde 126 W
Wagner, Otto 61 Waldvogel, Anton 39 Weiskirchner, Richard 50 Weizman, Eyal 97 Wondrak, Rudolf 135, 136 X Y Z
Zar Alexander II . 34 Zettl, Gustav 108
204 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 204 04.11.22 11:23
Literatur
Anderl, Gabriele/Blaschitz, Edith/Loitfellner, Sabine u a (2004): „Arisierung“ von Mobilien und die Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommis sion, Bd 15) Wien/München: Oldenbourg, S 161–163 .
Appignanesi, Lisa/Forrester, John (1994 [1992]): Die Frauen Sigmund Freuds, aus dem Englischen von Brigitte Rapp und Uta Szyszkowitz, München u a : List Verlag [im engl Original: dies , Freud’s Women, New York, NY: Basic Books]
Augé, Marc (2019): Nicht-Orte. München: C H Beck
Bédard, Jean-François et al . (1994, Hg ): Cities of Artificial Excavation: The Work of Peter Eisenman, 1978−1988, New York: Rizzoli International
Benz, Wolfgang (2010): „Der ewige Jude“: Metaphern und Methoden nationalsozia listischer Propaganda (Reihe Dokumente, Texte, Materialien, Zentrum für Antise mitismusforschung der TU Berlin, Bd 75) Berlin: Metropol
Bittner, Regina/Hackenbroich, Wilfried/ Vöckle, Kai (2006, Hg ): Transiträume = Transit Spaces (Edition Bauhaus, Bd 19) Berlin: Jovis Verlag
Bonyhady, Tim (2013): Wohllebengasse. Die Geschichte meiner Wiener Familie, übersetzt von Brigitte Hilzensauer Wien: Zsolnay
Brousek Karl M (1982): Gustav Otruba, „Bergbau und Industrie Böhmens im Zeit alter des Neoabsolutismus und Liberalismus 1848−1875“ (1 Teil), in: Bohemia, Bd 23, H 1, S 51–91
Brunner, Andreas/Staudinger, Barbara/ Sulzenbacher, Hannes (2018, Hg .): Die Stadt ohne. Juden, Muslime, Flüchtlinge, Ausländer (Ausstellungskatalog, Metro Kulturhaus Wien, 2 3 −30 12 2018) Wien: Verlag Filmarchiv Austria .
Burgstaller, Rosemarie (2015): „Verhöh nung als inszeniertes Spektakel im Natio nalsozialismus . Die Propaganda-Ausstel lung ‚Der ewige Jude‘“, in: Lucile Dreidemy, Richard Hufschmied, Florian Wenninger u a (Hg ), Bananen, Cola, Zeitgeschichte. Oliver Rathkolb und das lange 20. Jahrhun dert, 2 Bde , Bd 1 Wien u a : Böhlau Ver lag, S 346–356
Fischer-Defoy, Christine/Nürnberg, Kaspar (Juli 2011): „Zu treuen Händen Eine Skizze über die Beteiligung von Berliner Spedi tionen am Kunstraub der Nationalsozialisten“, in: Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V. Mitgliederrund brief, Nr 65, S 7–12
Freund, Florian/Perz, Bertrand/Spoerer, Mark (2004): Zwangsarbeiter und Zwangs arbeiterinnen auf dem Gebiet der Republik Österreich 1939–1945, 1 Teil, Zwangsar beit auf dem Gebiet der Republik Österreich (Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission, Bd 26/1) Wien/ München: Oldenbourg
Gröger, Roman Hans (2010): Die unvoll endeten Stadtbahnen. Wiener Schnellver kehrsprojekte aus den Akten des Österreichi schen Staatsarchivs. Innsbruck/Wien u . a .: StudienVerlag, S 54–57
Gruber, Christina (2015): Historical fish market data and fish ecological changes in the Austrian Danube from 1860 to 1914, Masterarbeit, Univ f Bodenkultur Wien
Haidvogl, Gertrud/Hauer, Friedrich (2019): „Die wachsende Stadtinsel“, in: Zentrum für Umweltgeschichte, Universität für Bo denkultur, Technische Universität Wien (Hg .), Wasser Stadt Wien. Eine Umweltge schichte. Wien
Hauser, Susanne (2010): „Die Ästhetik der Agglomeration“, in: MAP Markus Ambach Projekte et al (Hg ), B1A40: The Beauty of the Grand Road. Berlin: Jovis Verlag, S 202–213
Hieslmair, Michael/Zinganel, Michael (2016): „Stop and Go Nodes of Trans formation and Transition“, in: Günther Friesinger, Judith Schoßböck, Thomas Ballhausen, Ges Bildender Künstlerinnen und Künstler Öst (Hg ): Digital migra tion. Konstruktionen – Strategien – Bewe gungen, Wien: edition mono/monochrom, S 167−184
Hieslmair, Michael/Zinganel, Michael (2017): Road*Registers. Aufzeichnungen mobiler Lebenswelten (Ausstellungskata log, Akademie der bildenden Künste Wien, 30 9 −6 11 2016), Wien: Tracing Spaces
Hieslmair, Michael/Zinganel, Michael (2019, Hg ): Stop and Go – Nodes of Trans formation and Transition (Schriftenreihe der Akademie der bildenden Künste Wien, Bd 23) Berlin: sternberg press
Hödl, Johann (2009): Das Wiener U-BahnNetz: 200 Jahre Planungs- und Verkehrsge schichte. Dieses Buch erschien anlässlich des Jubiläums „40 Jahre U-Bahn-Bau in Wien“ (3. November 1969 – 3. November 2009), hg von Wiener Linien GmbH & Co KG . Wien: Wiener Linien
Holzschuh, Ingrid (2011): Wiener Stadtplanung im Nationalsozialismus von 1938 bis 1942: Das Neugestaltungsprojekt von Architekt Hanns Dustmann. Wien: Böhlau Verlag
Horn, Alfred (1967): Die Österreichische Nordwestbahn. Wien/Heidelberg: Boh mann Verlag .
Horn, Alfred (2015, Hg .): Eisenbahn Hand buch Sonderausgabe 2015. Die Bautätigkeit der DRB in Österreich 1938–1945. Wien: Holzhausen
Kill, Susanne (2020): „Geheimsache Schen ker/Wie das Unternehmen in den Besitz der Reichsbahn kam“, in: Verkehrsgeschicht liche Blätter, 47 . Jg ., Nr . 2, März/April, S 51–52
Klein, Evelyn/Glaser, Gustav (2006): Peri pherie in der Stadt. Das Wiener Nordbahn viertel. Einblicke, Erkundungen, Analysen. Innsbruck u a : StudienVerlag
Kogoj, Traude (2012, Hg .): Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938–1945 (Ausstellungskata log, Wien, 11 6 −31 10 2012, kuratiert von Mimi Segal) . Wien: ÖBB .
Kos, Wolfgang/Wien Museum (2007, Hg ): Großer Bahnhof. Wien und die weite Welt (Ausstellungskatalog, Wien Museum, 28 9 2006−25 2 2007) Wien: Czernin Verlag
Krisch, Anton (1900): Der Wiener Fisch markt. Volkswirtschaftliche, den Haus frauen der österreichischen Haupt- und Residenzstadt gewidmete Studie. Wien: Carl Gerolds Sohn .
Kröll, Magdalena (2016): „Die Versorgung der Stadt Wien mit Fischen um 1900 Der neue Wiener Zentralfischmarkt“, in: Martin Scheutz, Herwig Weigl (Hg ), Verwaltetes Wasser im Österreich des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich, Bd . 37) St Pölten: Verein für Landeskunde von Niederösterreich, S 107–133
Kunsttrans Holding GmbH (o . J ): Die Kunsttrans. 150 Jahre Kunst und Trans port – Geschichte eines Unternehmens. o O Lefebvre, Henri (1974 [2020]): La Produc tion de l’espace, Paris: Editions Anthropos [deutsch: Die Produktion des Raums, Leipzig: Spectormag]
Lefebvre, Henri (2013): Rhythmanalysis: Space, Time, and Everyday Life. London: Bloomsbury
Lillie, Sophie (2003): Was einmal war: Handbuch der enteigneten Kunstsammlun gen Wiens. Wien: Czernin, S 529
Lingens, Ella (1966): Eine Frau im Kon zentrationslager. Monographien zur Zeit geschichte. Wien [u a ]: Europa-Verlag
Lingens, Ella (2005): Gefangene der Angst. Ein Leben im Zeichen des Widerstandes. BvT 152. Berlin: Berliner Taschenbuch-Verlag
Loitfellner, Sabine (2005): „Die Rolle der ‚Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugs gut der Geheimen Staatspolizei‘ (Vugesta) im NS-Kunstraub“, in: Gabriele Anderl,
205 Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 205 04.11.22 11:23
Alexandra Caruso (Hg .), NS-Kunstraub in Österreich und die Folgen. Innsbruck: StudienVerlag, S 110–120
Marsigli, Ferdinando Luigi (2018): „Über die Donaufische“ [Original aus 1726 aus dem Lateinischen übersetzt], in: Edit Király, Olivia Spiridon (Hg ), Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art. Salzburg/Wien: Jung und Jung, S 40–44
Matis, Herbert/Stiefel, Dieter (1995): Das Haus Schenker. Die Geschichte der interna tionalen Spedition 1872–1931, Frankfurt am Main/Wien: Ueberreuter Verlag
Matis, Herbert/Stiefel, Dieter (2002): Grenzenlos. Die Geschichte der interna tionalen Spedition Schenker von 1931 bis 1991, Frankfurt am Main/Wien: Ueber reuter Verlag .
Mattl, Siegfried (2018): „Nationalsozia listische Planungsinstitutionen“, in: ders , Gottfried Pirhofer, Franz J . Gangelmayer, Wien in der nationalsozialistischen Ord nung des Raums. Lücken in der Wien-Er zählung (VWI Studienreihe, Bd 3) Wien: new academic press, S . 17–128 .
Mattl, Siegfried / Pirhofer, Gottfried / Gangel mayer, Franz J (2018): Wien in der nationalsozialistischen Ordnung des Raums. Lücken in der Wien-Erzählung (VWI Studienreihe, Bd 3), Wien: new academic press
Mayrhofer, Petra/Meisinger, Agnes (2018): „Wintersport in Österreichs ‚alpiner Peri pherie‘ am Beispiel des ‚Schneepalasts‘ in der Wiener Nordwestbahnhalle“, in: Matthias Marschik, Agnes Meisinger, Rudolf Müllner, Johann Skocek, Georg Spitaler (Hg ): Images des Sports in Öster reich. Innensichten und Außenwahrneh mungen. Wien: Vienna University Press, S 147–160
Melichar, Peter (2004): „Arisierungen und Liquidierungen im Papier- und Holz sektor“, in: Ulrike Felber u a , Ökonomie der Arisierung, Teil 2, Wirtschaftssektoren, Branchen, Falldarstellungen (Veröffentli chungen der Österreichischen Historiker kommission, Bd 10/2) Wien/München: Oldenbourg, S 279–741
Nordsee GesmbH (1999, Hg ): 100 Jahre in Österreich (Nordsee) – 1899–1999, Kloster neuburg: Mayer & Comp
Offenberger, Ilana Fritz (2017): The Jews of Nazi Vienna, 1938–1945. Rescue and De struction (Palgrave Studies in the History of Genocide) . Cham: Palgrave Macmillan . Österreichische Bundesbahnen (1997, Hg ): 125 Jahre Bahnhof Wien Nordwest. Wien
Payer, Peter (1999): „Jüdisches Leben in der Brigittenau Ein Rundgang zu den stummen Zeugen der Vergangenheit“, in: Gerhard Blöschl, Brigittenau. gestern, heute,
morgen, Wien: Verein Bezirksmuseum Brigittenau, S 111–121
Pelt, Robert Jan van (2002): The case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, Bloomington, IN, u a : Indiana Univ Press
Pirhofer, Gottfried (2018): „Die Wider sprüche der Bahnnetzplanung“, in: ders ., Siegfried Mattl, Franz J Gangelmayer, Wien in der nationalsozialistischen Ord nung des Raums. Lücken in der Wien-Er zählung (VWI Studienreihe, Bd . 3) . Wien: new academic press, S 159–165
Prokop, Werner/Kreativwerkstatt HLW Hollabrunn (2022, Hg .): 150 Jahre Nord westbahn. Wien: Railway-Media-Group
Rafetseder, Hermann (2014): NS-Zwangs arbeits-Schicksale. Erkenntnisse zu Er scheinungsformen der Oppression und zum NS-Lagersystem aus der Arbeit des Österrei chischen Versöhnungsfonds. Eine Dokumen tation. Bremen: Wiener Verlag für Sozial forschung, S 364–365
Sandner, Günther (2019): „Bilder trennen und Bilder verbinden . Wege der Wiener Bildstatistik (1934–1945)“, in: Andreas Kranebitter, Christoph Reinprecht (Hg ), Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich, Bielefeld: transcript-Verlag, S 286–287
Schenker & Co AG (1997, Hg ): 125 Jahre Schenker. 1872–1997, Wien .
Simone, AbdouMaliq (2004): „People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg“, in: Public Culture, Bd . 16, Nr 3, S 407–429
Stiefel, Dieter (2007): Zur Geschichte der Spedition Schenker in Österreich, Wien: Holzhausen, S 35
Suttner, Andreas (2017): Das schwarze Wien. Bautätigkeit im Ständestaat 1934–1938. Wien u a : Böhlau Verlag, S 63–67
Trischler, Helmuth (2009): „Geteilte Welt? Verkehr in Europa im Zeichen des Kalten Krieges“, in: Ralf Roth, Karl Schlögel (Hg ), Neue Wege in ein neues Europa. Geschichte und Verkehr im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Campus Verlag, S . 168–169 .
Tsing, Anna (2009): „Supply Chains and the Human Condition“, in: Rethinking Mar xism, Bd . 21, Nr . 2, April, S . 148–176 .
Tsing, Anna (2018): Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Ka pitalismus. Berlin: Matthes & Seitz .
Weizman, Eyal (2012): Forensic Archi tecture Notes from Fields and Forums = Forensische Architektur (Documenta 13, Kassel, 9 6 -16 9 2012) Ortsfildern: Hatje Cantz
„Ab 1 November neuer Fahrplan“, in: Neues Wiener Tagblatt, 24 10 1943, S 5
„Anregungen und Beschwerden“, in: Kleine Volks-Zeitung, 24 2 1930, S 10
„Apell des Wiener Heimatschutzes“, in: Kleine Volks-Zeitung, 31 8 1934, S 3
„Bemerkenswerter Vorschlag zum ‚Problem Nordwestbahnhof‘“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 10 8 1935, S 9
„Das Haus Nummer 48“, in: Der Morgen, 12 12 .1932, S . 12 .
„Das Projekt der Sporthalle im Nordwest bahnhof“, in: Wiener Allgemeine Zeitung, 1 .12 .1933, S . 7
„Das Rote Kreuz Der Krankenzug Nr 15“, in: Neues Wiener Tagblatt, 25 11 1914, S 9
„Der aufgelassene Nordwestbahnhof – ein Tennisstadion“, in: Der Tag, 22 7 1925, S 5
„Der ewige Jude“, in: Neues Wiener Tag blatt, 12 11 1937, Titelseite
„Der ewige Jude“, in: Wiener Zeitung, 30 .7 1938, S . 3 .
„Der Nordwestbahnhof – Zentralautobus bahnhof Sympathische Zukunftsmusik“, in: Die Stunde, 24 .3 .1929, S . 6
„Der Nordwestbahnhof in Wien“, in: Ueber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zei tung, Nr . 36, 1874, S . 712 .
„Der Nordwestbahnhof ohne Verkehr“, in: Die Stunde, 9 2 1924, S 4
„Der Nordwestbahnhof“, in: Arbeiter-Zei tung, 27 2 1924, S 7
„Der tote Bahnhof lebt“, in: Kleine VolksZeitung, 25 1 1930, S 3–4
„Der Volkswirt Ein Wort an die Völker bunddelegierten“, in: Neues Wiener Tag blatt, 27 8 1924, S 9
„Der wiederbelebte Wiener Nordwestbahn hof“, in: Neuigkeits-Welt-Blatt, 29 .3 .1925, S 1
„Der Wiener Bauerntag“, in: Kleine VolksZeitung, 26 .11 .1932, S . 2 .
„Der Wiener Besuch Dr Goebbels“, in: Das kleine Volksblatt, 29 3 1938, S 2
„Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft ‚Nordsee‘“, in: Neue Freie Presse, 31 10 1899, S 15
„Die Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Neues Wiener Tagblatt, 3 8 1938, S 5
206 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 206 04.11.22 11:23
Gedruckte Quellen
„Die geplante Weihnachtsausstellung im Nordwestbahnhof“, in: Neues Wiener Tag blatt, 8 11 1932, S 4
„Die Kraftwagenbetriebsleitung Wien hat ein neues Domizil“, in: Die ÖBB in Wort und Bild. Nachrichtenblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Nr 11/ 1971, S . 17–21 .
„Die neuen Zentral-Güterhallen am Wiener Nordwestbahnhof“, in: Österreichische Illus trierte Zeitung, 16 .7 .1911, S . 1 .033 .
„Die neuen Zentralgüterhallen der Firma Schenker & Co auf dem Nordwestbahnhof“, in: Das interessante Blatt, 13 .7 .1911, S . 2 .
„Die Nordwestbahnhalle als Autobus bahnhof“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 10 .1 .1934, S . 11 .
„Die Schließung des Nordwestbahnhofes“, in: Neues Wiener Tagblatt, 1 2 1924, S 11
„Die Taborlinie“, in: Neuigkeits-Welt-Blatt, 11 1 1888, [S 9]
„Die Wiener Automesse 1938“, in: Auto mobil- und Motorrad-Zeitung. Der Motor radfahrer, 12 11 1937, S 2
„Ein Opfer des Weltkrieges“, in: Pester Lloyd, 2 2 1924, S 13
„Eine dumm-feige Demonstration von Na tionalsozialisten“, in: Der Bauernbündler, 3 12 1932, S 3
„Großer Aufschwung im Speditionsgewer be“, in: Völkischer Beobachter, 12 .3 .1939, S 13
„Hat die Schweiz im Kriege die Neutralität verletzt?“, in: Die Stunde, 19 .5 .1925, S 5 .
„Im Reich der Unwahrscheinlichkeiten“, in: Hans Jörgel von Gumpoldskirchen, 29 .8 .1896, S . 1–2 .
„Juden sehen Dich an! Die große politische Schau: Der ewige Jude“, in: Illustrierte Kro nen Zeitung, 30 .7 .1938, S 5 .
„Jugendtagung im Stadion“, in: Öffentliche Sicherheit, 1933, 13 Jg , Nr 10, S 13
„Justiz- und Sprachenfragen“, in: Die Zeit, 28 3 1908, S 1–2
„Kundgebung für Bürgermeister Schmitz“, in: Illustrierte Kronen Zeitung, 10 4 1934, S 7
„Kriegsfürsorge“, in: Arbeiter-Zeitung, 22 11 1914, S 9
„Lokomotivfriedhof Nordwestbahnhalle“, in: Illustrierte Kronen-Zeitung, 26 .6 .1935, S 7
„Nazisiegesfeier in der Nordwestbahnhal le“, in: Der Tag, 7 .3 .1933, S . 3 .
„Nordwestbahnhof wieder in Betrieb!“, in: Wiener Beobachter. Tägliches Beiblatt zum Völkischen Beobachter, 9 3 1939, S 10
„Notizen“, in: Wiener Geschäftszeitung, 26 10 1868, [S 1]
„Österreichische Nordwestbahn“, in: Frem den-Blatt, 1 .6 .1872, S 10
„Österreichischer Kriegsopferverband“, in: Kleine Volks-Zeitung, 2 12 1934, S 5
„Parlamentarisches Abgeordnetenhaus (Sit zung am 14 April 1896)“, in: Reichspost, 15 4 1896, S 6–7
„Revolverattentat auf Bürgermeister Seitz“, in: Der Tag, 27 11 1927, S 1
„Schaffung eines Obstexportgesetzes“, in: Der Tag, 21 6 1934, S 10
Schmeltzl, Wolfgang (1547): Ein Lobspruch der Hochlöblichen weit berümbten Künigli chen Stat Wienn in Österreich. Wien
„Schweizer Waffenlieferungen an Ös terreich“, in: Innsbrucker Nachrichten, 9 6 1925, S 9
„Sechstage-Rennbahn der Nordwestbahn halle“, in: Wiener Sonn- und Montags-Zei tung, 5 3 1934, S 8
„Theater, Film und anderes“, in: Das interes sante Blatt, Nr . 3, 16 .1 1936, S . 12 .
„Vorschau auf die Ausstellung ‚Der ewige Jude‘“, in: Neues Wiener Tagblatt, 30 7 1938, S . 5 .
„Waffenkundgebung in der Nordwestbahn halle“, in: Kleine Volks-Zeitung, 26 3 1935, S . 2 .
„Wochenschau Österreich in Bild und Ton Ausgabe 13/35 A“, in: Der gute Film, H 121, 1935, S . 6 .
„Zentralobst- und Gemüsemarkt auf dem Nordwestbahnhof“, in: Neues Wiener Jour nal, 8 .6 .1934, S . 10 .
„Zum Wettbewerb Eisenbahn – Kraft wagen“, in: Der österreichische Volkswirt, 28 .11 .1936, S . 6 .
Amtsblatt der Stadt Wien, Nr 21, 12 3 1924, S 270
Bäumer, W (1873): „Der Nordwestbahn hof in Wien“, in: Allgemeine Bauzeitung, 38 Jg , S 8–32
Deutsche Reichsbahn (1944/45): Amtlicher Taschenfahrplan der Reichsbahndirektion Wien, Jahresfahrplan
Doderer, Heimito von (1985): Die Dämo nen. Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff. München: dtv .
Eichler, Edmund (7 .1 1924): „Besuch am Frachtenbahnhof Im Reiche der Kohlen rutschen“, in: Neues Wiener Journal, S 3–4
Fiedler, Franz (1907): Postzwang und Post pflicht, München/Berlin: Oldenburg
Grießler, Josef (12 3 1939): „Die Leopold stadt im Kampf um die Freiheit“, in: Neues Wiener Tagblatt, S 6
Ilz, Erwin (1935): Wiener Verkehrsfragen. Zentralbahnhof und Nahverkehr, Wien/ Leipzig: C Gerolds Sohn
Ilz, Erwin (1938): „Der Gau Wien im Rah men der Landes- und Stadtplanung“, in: Raumforschung und Raumordnung, 2 Jg , H 9, S 430–439
Inserat „Westindische Bananen […]“, in: Neues Wiener Tagblatt, 28 12 1912, S 26
Inserat der Österreichischen Nordwest bahn, in: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 4 6 1872 [S 9]
Inserat von Brasch & Rothenstein, in: Neue Freie Presse, 3 .7 .1938, S 34 .
Inserat von Godetz, Geist & Co, in: Phar maceutische Post, 30 12 1939, S 17
Jary, Rudolf (1938): „Vergangenheit und Gegenwart des Wiener Nordwestbahn hofs“, in: Verkehrswirtschaftliche Rund schau, S . 13
Kepnik, Dr Bruno (20 3 1968): „Perspekti ven des Containerverkehrs in Österreich,“ in: ÖBB Nachrichtenblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, Jg 1968, 3 Stück, Wien, S 67–70
Kettler, Günter (1986): „Der Neubau des Terminals Wien (1981 bis 1985) Der Nordwestbahnhof in Wien, 3 Teil“, in: Schie nenverkehr aktuell (Österreich), H 1, S 6
Kettler, Günter (1997): „Von der Personen station zum Containerterminal Der Nord bahnhof in Wien, 2 Teil“, in: Schienenver kehr aktuell (Österreich), H 12, S . 9 .
K k Polizeidirektion Wien, Zentralins pektorat der k k Sicherheitswache, Stim mungsberichte aus der Kriegszeit, Wien 1914–1917
Kurzmeldungen (2 Spalte), in: Grazer Tag blatt, 10 .4 .1934, S . 10 .
Kuschel, Erich (1934): Zentralfernbahnhof Wien, Diss , TH Wien
Magistrat der Stadt Wien (Hg , 1901): Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1899. Wien: Verl des Wiener Magistrates
Magistrat der Stadt Wien, MA 18, Stadt entwicklung und Stadtplanung (1985, Hg ): Stadtentwicklungsplan Wien. STEP Wien, Wien .
207 Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 207 04.11.22 11:23
Magistrat der Stadt Wien, MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hg , 1991): Be zirksentwicklungsplan Brigittenau, Wien
Magistrat der Stadt Wien, MA 18, Stadt entwicklung und Stadtplanung (1994, Hg ): Stadtentwicklungsplan für Wien. STEP 1994 (Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 53), Wien
Magistrat der Stadt Wien (1914, Hg ): Sta tistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1912, Wien: Verlag des Wiener Ma gistrats
Magistrat der Stadt Wien (1916, Hg .): Sta tistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1913, Wien: Verlag des Wiener Ma gistrates
Magistratsabteilung 21 A, Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West (2008, Hg ): Stadt muss leben. Städtebauliches Leitbild Nordwestbahnhof. Wien
Novy, Franz (1946): „Die Zukunft Wiens“, in: Der Aufbau, Dez , S 228
Nübel, Dr Heinrich (1 9 1928): „Die Wie ner Brückenfrage“, in: Der österreichische Volkswirt, S 1 362–1 364
Rainer, Hugo (1951): „Der Wettbewerb für den neuen Süd-Ostbahnhof in Wien“, in: Der Aufbau, Juli, S 266
Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1867, LXI Stück, Ausgegeben und versendet am 22 December 1867: Staatsgrundgesetz vom 21 . December 1867, S 395
Sandner, Günther (2008): „Demokratisie rung durch Bildpädagogik – Otto Neurath und Isotype“, in: SWS-Rundschau, Jg 48, H 4, S 463–484
Strzygowski, Josef (1939): „Wiens Stadt kern, die Innere Stadt, bis an die Donau verlängert“, in: Nachrichtenblatt des Verei nes für Geschichte der Stadt Wien, 56 Jg , Nr . 3, S . 37–64 .
Waldvogel, Anton (1892): „Projects-Ent wurf für die Ausgestaltung der Verkehrs anlagen im gesamten Gemeindegebiet von Wien“, in: Beilage zur Zeitschrift des ös terreichischen Ingenieur-Vereines, Nr 21, S 1–18
Waldvogel, Anton (9 6 1893): „‚Ueber die Ausgestaltung der Verkehrsanlagen und die Schaffung von Donau-Häfen für Wien‘, Vor trag, gehalten in der Vollversammlung am 22 April 1893 von Ober-Ingenieur Anton Waldvogel“, in: Zeitschrift des österreichi schen Ingenieur-Vereines, XLV Jg , Nr 12, S . 325–334 .
Weiskirchner, Richard (1914): Die Gemein de Wien während der ersten Kriegswochen. 1. August bis 22. September 1914. Nach dem
vom Bürgermeister Dr. Richard Weiskirch ner dem Wiener Gemeinderate erstatteten Bericht zusammengestellt vom Sekretariate der Wiener christlichsozialen Parteileitung. Wien: Verlag des Sekretariats der christ lichsozialen Parteileitung
Wiener Adressbuch. Adolph Lehmann’s all gemeiner Wohnungs-Anzeiger für Wien, Bd 2, 1938
Internetquellen
„17,5 Millionen Euro Kartellstrafe für Spe diteure“, in: OÖ Nachrichten, 23 1 2015, www .nachrichten .at (19 .8 .2022) .
„Die Schenker-Verbrechen“, in: Zug der Erinnerung, 27 1 2021, www zug-dererinnerung .eu/aktuell20210123 . html (13 8 2922)
„Marcel [sic] M Holzer, Plaintiff, v Deutsche Reichsbahn Gesellschaft and … Supreme Court, Special Term, New York County, Jun 22, 1936“; in: Casetext Inc., https://casetext com/case/holzer-v-deutsche-reichsbahngesellschaft-2 (13 .8 .2022) .
„Österreich: Speditionskartell muss Millio nenstrafe zahlen“, in: Verkehrsrundschau, 9 .6 . 2016, www verkehrsrundschau .de/ nachrichten/transport-logistik/oester reich-speditionskartell-muss-millionen strafe-zahlen-2992159 (19 8 2022)
„Schier, Otten & Co (SOC) feiert 80-jäh riges Bestehen“, in: APA-OTS, www ots at/presseaussendung/OTS_20041011_ OTS0171, 11 .10 .2004 .
Az W: Architektenlexikon Wien 1770–1945, Alexander Popp, www architekten lexikon .at (30 .7 2022) .
Dietrich Untertrifaller, Wettbewerbe, Nordwestbahnhof Wien, www dietrich untertrifaller .com (14 .8 .2022) .
EHRI-Portal, Archivmaterial zum Holo caust, https://portal ehri-project eu/units/ us-005578-irn521945 (16 .8 .2022) .
Family Search, https://familysearch org/ar k:/61903/3:1:33S7-95J9-9F4R?cc=192 3888&wc=MFKW-VWL%3A1030111301 (26 8 2022)
Feltl, Gerhard, Projekte, Expo ’95, www feltl .at/Projekte Expo95 (14 .8 2022) .
Filmarchiv Austria, „Die Stadt ohne“, Digitorial, www filmarchiv at/digitorial/diestadt-ohne/ (28 8 .2022) .
Filmarchiv Austria, „Silhouetten“, 1936, www filmarchiv at/program/film/silhou etten/ (30 .7 .2022) .
Glas & Co Glastechnik, Firmengeschichte, www .glas-co .at/ueber-uns/firmengeschich te/index .html (7 .8 .2022) .
LIFE Sterlet, BOKU, Institut für Gewässer management und Hydrobiologie, https:// life-sterlet boku ac at/ (21 8 2022)
Maryška, Christian (20 2 2021): „Eine Mi krogeschichte Wiener Plakate um 1935“, in: Austrian Posters, Beiträge zur Geschichte der visuellen Kommunikation, www austrianposters .at/2021/02/20/eine-mikrogesch ichte-wiener-plakate-um-1935/ (30 7 2022)
Radio Prague International, „Textilbarone aus Reichenberg – die Unternehmerfami lie Liebieg“, https://deutsch radio cz/textil barone-aus-reichenberg-die-unternehmer familie-liebieg-8697297 (23 8 2022)
Rimini Protokoll, „Cargo Sofia-X A Bulga rian truck-ride through European cities“, Konzept und Regie: Stefan Kaegi, Pro duktion: Goethe-Institut Sofia, Hebbel am Ufer Berlin, 2006, www rimini-proto koll de/website/en/project/cargo-sofia-x (30 8 2022)
Stadt Wien, „Wien Kulturgut: Kriegssach schädenplan, um 1946“, www wien gv at/ kultur/kulturgut/plaene/kriegssachscha den .html (9 .8 2022) .
Tracing Spaces, Nordwestpassage, https:// tracingspaces net/nordwestpassage/ (27 .8 .2022) .
Tracing Spaces, Road Registers, https://tra cingspaces net/road-registers/ (27 8 2022)
Tracing Spaces, Veranstaltungen/Führun gen, Excavations from the darkest past, https://tracingspaces net/excavations/ veranstaltungen-fuehrungen/ (28 .8 2022) .
Virtuelles Kraftfahrzeug Museum Austria, A Fross-Büssing, www voz co at/VKMA/ Fro_Bue/fro_bue .html (24 .8 .2022) .
Wien Geschichte Wiki, „Luftkrieg“, www geschichtewiki wien gv at (9 8 2022)
Wien Geschichte Wiki, „Zwangsarbeiter lager Nordwestbahnhof“, www geschichte wiki wien gv at (9 8 2022)
Wien Geschichte Wiki, „Zwangsarbeiter lager Nordwestbahnstraße 93“, www ge schichtewiki wien gv at (9 8 2022)
Interviews
Beočanin, Miroljub, Miteigentümer des Unternehmens Tomi Trade d o o in Smederevo, Serbien, neuer Besitzer der beiden Containerkräne am Nordwestbahn hof, Wien, 29 .9 .2017 .
Böhm, Bernhard, Lagerleiter Quehenberger bzw Q-Logistics, davor Mitarbeiter bei Panalpina Austria, Wien, 17 5 2017 .
Brückler, Ernst, Pensionist, ehem Spedi tionskaufmann bei Schenker, danach in der Pharmabranche tätig, Wien, 30 .1 .2019 .
208 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 208 04.11.22 11:23
Czerny, Alfred, Pensionist, ehem . Schu lungsbeamter bei der ÖBB, davor Bahn hofsvorstand, Wien, 4 3 2019
Dimitrov, Georgi, Werkstättenleiter bei SOMAT in Wien, heute bei Balkanstar, der Mercedes-Vertragswerkstätte in Sofia, Sofia, 14 4 2016
Jankovic, Predrag, Lagerarbeiter bei props co, Verein Film Theater, Wien, 24 7 2017
Mader, Thomas, Disponent bei Q-Logistics, vorher EC-Logistics (Tochter der ÖBB Hol ding), Wien, 24 5 2017
Miladinovic, Goran, Autobusbusfahrer bei Blaguss, Wien, 8 9 2017
Odehnal, Bernhard, Journalist und Anwoh ner, Sohn einer Anwohnerfamilie, Wien, 12 9 2017
Schaffer, Alexander, Berater, ehem LkwFahrer bei Panalpina, Speditionskaufmann u a bei Schenker und Q-Logistics, Wien, 19 3 2019
Schafhauser, Leopold, Pensionist, ehem . Leiter des Containerterminals am Nord westbahnhof, Wien, 28 9 2018
Trey, Irina, Autoteile Express, Wien, 24 5 2017
Wieland, Elmar, Pensionist, ehem Vor standsvorsitzender von Schenker Öster reich, Wien, 19 2 2019
Archive
Architekturzentrum Wien, Sammlung Archiv Alfred Luft Archiv DB Schenker, Wien Archiv der Wirtschaftskammer Österreich, Wien Bundesarchiv, Berlin Dokumentationsarchiv des österreichi schen Widerstandes, Wien Filmarchiv Austria, Wien
Historisches Archiv der Wiener Linien Museum Nordwestbahnhof, Wien National Archives and Records Administration, New York ÖBB Archiv, Wien
Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Austria, Wien Österreichisches Staatsarchiv, Wien Sigmund Freud Museum, Wien Virtuelles Kraftfahrzeug Museum Austria Wien Museum
Wiener Bezirksmuseum Leopoldstadt, Sammlung Haas Wiener Stadt- und Landesarchiv
Abkürzungen
Az W Architekturzentrum Wien BArch Berlin Bundesarchiv, Berlin BEX Bahn-Express BOKU Universität für Bodenkultur Wien BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft DÖW Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien DRB Deutsche Reichsbahn EU Europäische Union Gestapo Geheime Staatspolizei IHG Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement Isotype International System of Typographic Picture Education KFJB Kaiser-Franz-Josefs-Bahn KGM Konsumgroßmarkt KWD Kraftwagendienst der Österreichischen Bundesbahnen KZ Konzentrationslager MA Magistratsabteilung der Stadt Wien NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ÖBB Österreichische Bundesbahnen OeStA Österreichisches Staatsarchiv 1Rep 1 Republik AdR Archiv der Republik E-uReang Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten NO Nordost RB Dion Reichsbahndirektion VA Vermögensanmeldungen Vk Verkehr
VVSt Vermögensverkehrsstelle W Wien ÖNB Österreichische Nationalbibliothek ÖNWB Österreichische Nordwestbahn
RAW Reichsbahnausbesserungswerk RBD Reichsbahndirektion
RCA Rail Cargo Austria SA Sturmabteilung SNDVB Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn StEG Staatseisenbahn-Gesellschaft STEP Stadtentwicklungsplan
TH Wien Technische Hochschule Wien Vugesta(p) Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo WStLA Wiener Stadt- und Landesarchiv, Wien
209 Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 209 04.11.22 11:23
Biografien
Tracing Spaces, 2012 von Michael Hieslmair und Michael Zinganel gegrün det, produziert recherchebasierte Kunst- und Forschungsprojekte, Publika tionen und Vermittlungsformate zu Urbanismus, Mobilität und Migration . www.tracingspaces.net
Michael Hieslmair studierte Architektur an der Technischen Universi tät Graz und an der Technischen Universität Delft . Er war Stipendiat des Künstlerhauses Büchsenhausen Innsbruck und Architect in Residence am MAK Center for Art and Architecture Los Angeles, lehrte an verschiede nen Universitäten, u . a . an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, den Universitäten Innsbruck und Graz und der Technischen Universität Wien . Er arbeitete u . a . am Forschungsprojekt „Crossing Munich, Places, Representations and Debates on Migration in Munich“ (mit Sabine Hess) .
Michael Zinganel studierte Architektur an der Technischen Universität Graz, Kunst an der Jan van Eyck Academie in Maastricht und promovierte in Zeitgeschichte an der Universität Wien Er war Kurator des Forum Stadt park in Graz, Research Fellow am IFK (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften) Wien und lehrte an verschiedenen Universitäten und Akademien, z . B . an der TU Graz, Kunstuniversität Linz, Universität Klagenfurt, an der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau und der Tech nischen Universität Wien . Er konzipierte und produzierte die Wanderaus stellung und Publikation Holidays after the Fall. Seaside Architecture and Urbanism in Bulgaria and Croatia (mit Elke Beyer und Anke Hagemann), Berlin: jovis, 2013
2014 bis 2016 leiteten sie gemeinsam das Projekt „Stop and Go: Nodes of Transformation and Transition“ über die Produktion und Aneignung von Räumen entlang paneuropäischer Verkehrskorridore zwischen Ost- und Westeuropa . Seit 2015 betreiben sie einen Projektraum am Nordwestbahn hof, seit 2020 unter dem Namen „Museum Nordwestbahnhof“, wo − ein gebettet in dem sozialen Milieu der Logistiklandschaft − sukzessive eine mehrschichtige, multimediale Kartografie der Geschichte dieses Areals ent stand .
210 Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 210 04.11.22 11:23
Bernhard Hachleitner studierte Geschichte und Germanistik an der Uni versität Wien, Dissertation: Das Wiener Praterstadion/Ernst-Happel-Sta dion. Bedeutungen, Politik, Architektur und urbanistische Relevanz, 2010 . Historiker und Kurator, Mitarbeit an Projekten, u . a . in der Wienbibliothek im Rathaus, im Wien Museum, im Haus der Geschichte Österreich, der Uni versität Wien und der Universität für angewandte Kunst Wien . Zahlreiche Veröffentlichungen und Ausstellungen zu Themen aus den Bereichen Popu lärkultur, Stadt- und Zeitgeschichte . www.hachleitner.at
211 Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 211 04.11.22 11:23
Impressum
Blinder Fleck Nordwestbahnhof Biografie eines innenstadtnahen Bahnhofsareals
Bernhard Hachleitner, Michael Hieslmair und Michael Zinganel
Lektorat Brigitte Ott Gestaltung seite zwei (Christoph Schörkhuber, Stefan Mayer)
Druck Holzhausen Gerin GesmbH
Vertrieb Falter Verlagsgesellschaft mbH Marc-Aurel-Straße 9, 1011 Wien T +43/1/536 60 – 928 F +43/1/536 60 – 935 E service@falter .at W faltershop .at © 2022, bei den Autor*innen, Wien Auflage 1 .500 ISBN 978-3-85439-716-8 Gefördert von Zukunfts- und Nationalfonds der Republik Österreich
212
Blinder Fleck Nordwestbahnhof
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 212 04.11.22 11:23
Unterstützer*innen

Bezirk Brigittenau

213 Anhang
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 213 04.11.22 11:23
221104_NWBH-Buch_Kern_Layout_RZ.indd 214 04.11.22 11:23