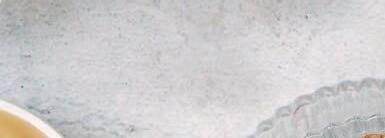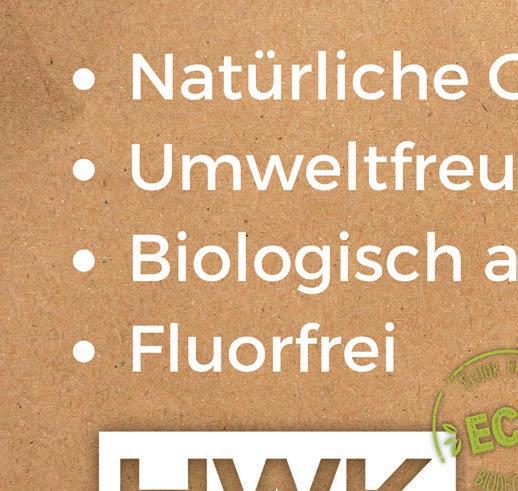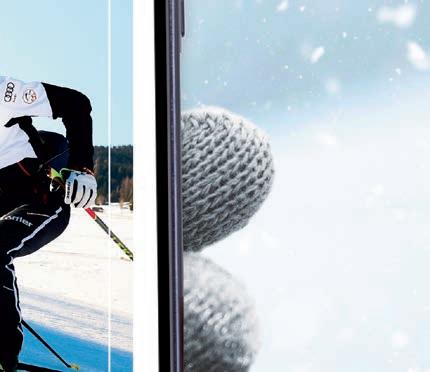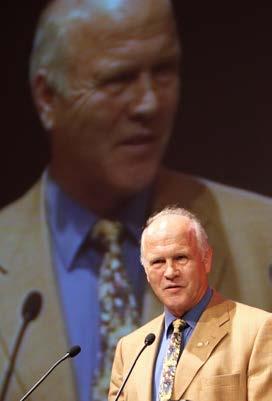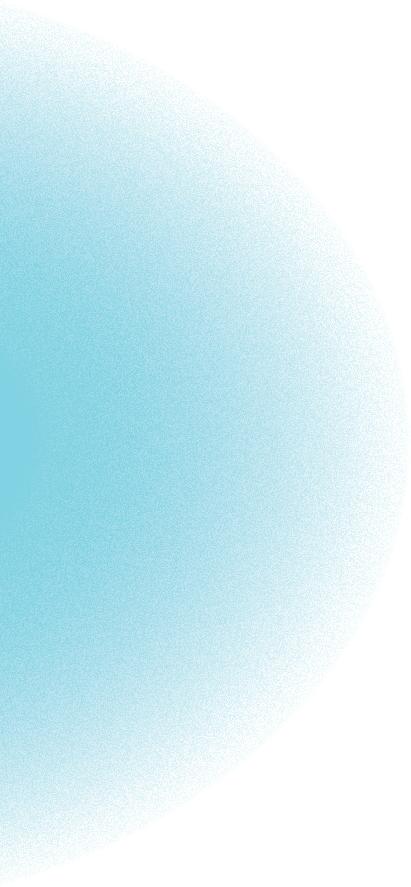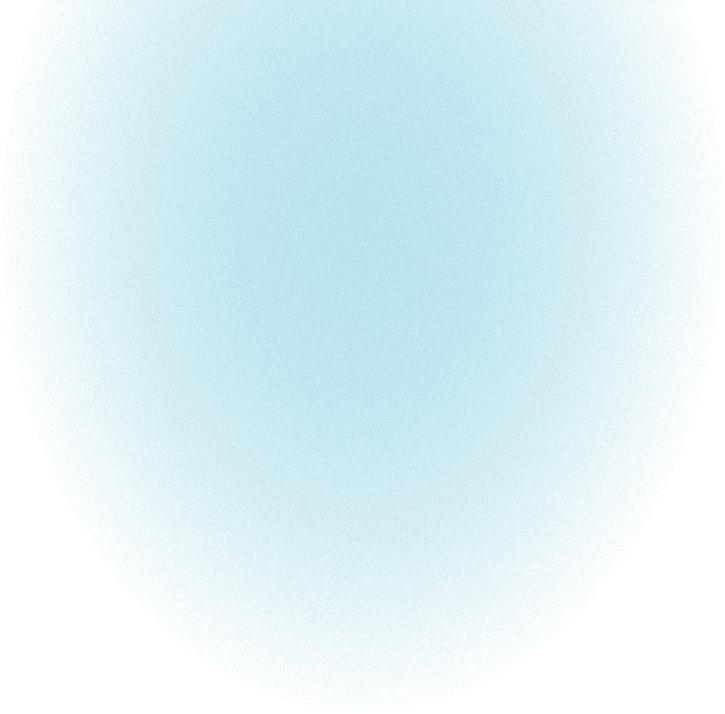In dieser Sonderausgabe beleuchtet Ski Austria wichtige Zukunftsthemen des Wintersports.

















FOR FUTURE
Horizont erweitert –um bis zu 600 km.






















































Die neuen, rein elektrischen Audi Q8 e-tron Modelle.


Future is an attitude







































Mehr erfahren auf
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 19,7 – 25,6 (WLTP); CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Symbolfoto. Stand 02/2023.
audi.at
EDITORIAL


Die Zukunft hat begonnen
Stillstand bedeutet Rückschri , daher machen wir mit dieser neuen „Ski Austria for Future“-Ausgabe einen Schri voraus – um neben den Inhalten unserer sechs regulären Magazine einmal im Jahr auch Themen zu beleuchten, die für die Zukun des Wintersports von großer Bedeutung sind.
Als Österreichischer Skiverband tragen wir eine Mitverantwortung, den Skisport ökologischer zu machen. Dabei wahren wir die Vergangenheit, richten aber auch den Blick in die Zukun , um den Aufgaben eines modernen Verbandes gerecht zu werden.

Im Mi elpunkt unseres Handelns stehen stets die Liebe und Begeisterung für den Wintersport. Themen wie Klimawandel oder Digitalisierung sind riesige Herausforderungen, erö nen uns aber auch große Chancen, weil wir mit Innovationen und nachhaltiger Entwicklung unsere Zukun erfolgreich und verantwortungsbewusst mitgestalten können.
Wir sehen es als unsere gesellscha liche Aufgabe, heute so zu handeln, dass auch kommende Generationen den Wintersport in all seinen Face en (er)leben können. Gerade weil wir den Sport in der Natur ausüben, wollen wir unseren Beitrag leisten, um diese zu schützen. Gleichzeitig setzen wir uns als Verband, Unternehmen und Marke hohe Ziele, um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben.
Viele Artikel dieser Sonderausgabe behandeln Themen, die den gesamten Wintersport beschä igen – gehen aber teilweise über die Gegenwart hinaus und zeigen, in welch positive Richtung sich viele Dinge verändern. So zeigen wir Ihnen, mit welch innovativen Projekten der Wintertourismus auf klimafreundliche Lösungen abzielt, um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur aufrechtzuerhalten, und wie ein Winterspor ag der Zukun ausschauen könnte.


Mit herausragenden Leistungen begeistern wir seit Jahrzehnten die Skisportfamilie in Österreich. Auch in Zukun wollen wir die Athletinnen und
Athleten bestmöglich beim Streben nach sportlichen Erfolgen auf der Piste, Schanze und Loipe unterstützen. Dazu zählt auch, ihnen mit innovativen Lösungen zur Seite zu stehen. Mit welchen Technologien und smarten Tools innerhalb des ÖSV bereits gearbeitet wird, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

Mit der Durchführung der alpinen Heim-WM 2025 in Saalbach als Sportfest und gleichermaßen nachhaltige Veranstaltung haben wir die Chance, in puncto Transparenz und Verantwortung neue Maßstäbe zu setzen. In dieser Ausgabe verraten wir Ihnen, auf was dabei zu achten ist und mit welchem Konzept das gelingen soll.
Auch das Thema Nachwuchsarbeit liegt uns sehr am Herzen. Wir gehen in diesem He mit einigen Experten der Frage nach, ob die Jugend im Leistungssport zu früh unter Druck gerät. Da ss nichts unmöglich ist, zeigt eine Geschichte über die Wiener Stadtadler, denen es dank Engagement und Leidenscha seit Jahren gelingt, im urbanen Raum den Traum vom Fliegen zu leben.



Zudem berichten wir darüber, warum Livesport im Fernsehen die Menschen begeistert und wie wir diesen dank neuester Technologien in Zukun erleben können. Abgerundet wird die Sonderausgabe mit einer Reportage über Pionierin Eva Ganster, die den Weg für die heutige Generation junger Skispringerinnen geebnet hat und ein Sinnbild dafür ist, dass alle Hürden im Leben überwindbar sind, auch wenn sie im ersten Moment zu hoch erscheinen. Ich wünsche Ihnen viele Anregungen zum Nachdenken.
erscheinen. Ich wünsche Ihnen viele Anregungen zum Nachdenken.






Herzlichst



© ERICH SPIESS
Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin)
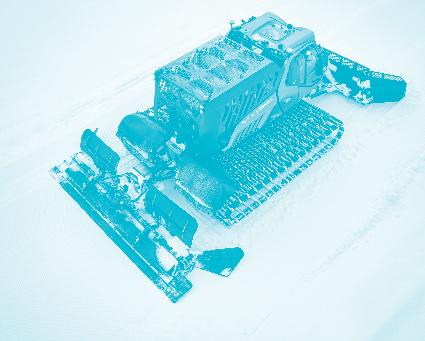









4 SKI FOR Innovative Projekte 76 SkisprungPionierin 38 Wie plant man Erfolg? 46 Kinofilm Stams 20 Nachhaltige Events INHALT 14 Stadtadler Wien 26 6 Wintersporttag der Zukunft © ILLUSTRATION: MONIKA CICHO Ń PRINOTH, WIENER STADTADLER, GEPA, WEREK PRESSEBILDAGENTUR, PANAMAFILM, SAALBACH.COM/CHRISTIAN WÖCKINGER, EXPA, SHUTTERSTOCK.COM, GEPA, KOI ALM SALZBURG, QUS
AUSTRIA FUTURE
Das Leben nach der Sportkarriere
IMPRESSUM:




Offizielles Organ des Österreichischen Skiverbandes • Medieninhaber und Verleger: Austria Ski Team Handelsges.m.b.H., 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10 • Chefredakteur und für den Inhalt verantwortlich: Mag. Bernhard Foidl, 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10, Tel. 0512/33 501 • Redaktion ÖSV: Nils Vettori, MA • Redaktion TARGET GROUP: Matthias Krapf, MA (Ltg.), Anna Kirchgatterer, Barbara Kluibenschädl, Mag. Haris Kovacevic, Denis Pscheidl, Michael Rathmayr, Eva Schwienbacher • Adressenstelle für den Zeitschriftenversand: ÖSV, 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10, Tel. 0512/33 501-27, E-Mail: mitglieder@oesv.at • Jahresabonnement: Inland 19 €, Ausland 25 € • Zeitungsbezug für ÖSV-ErwachsenenInlandsmitglieder im Vereinsbeitrag 2022/23 • Freiwilliger Zeitungsbezug für 7 Hefte: Schüler bis Jahrgang 2008 10 €, Auslandsmitglieder 13 € Anzeigen: Austria Ski Team Handels ges.m.b.H., 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10, Michael Rangger, E-Mail: rangger@ oesv.at • Layout & Produktion: TARGET GROUP Publishing GmbH, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck • Marco Lösch, BA (Ltg.), Thomas Bucher, Lisa Untermarzoner • www.target-group.at • Druck: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn • Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder.




Genderhinweis:



Im Sinne der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei personenbezogenen Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, zumeist nur die im Deutschen übliche männliche Form. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



5 50
68 Sport mit Controller 60 Live is Live 54
Innovationen im Wintersport 30
Geht es im Kindersport zu ernst zu?
Ein Blick in








6 Wintersporttag der Zukunft
die Zukunft








7
Megatrend Nachhaltigkeit
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sind nicht mehr nur etwas für Hippies und Grün-Wähler. Ökologie ist einer der Megatrends unserer Gesellschaft. In Zukunft wird sich Nachhaltigkeit aber nicht nur auf einzelne Lebensbereiche wie Ernährung oder Mobilität beschränken, sondern ein gesamtheitliches System sein, das sich durch unseren kompletten Alltag zieht. Nur so können die Ziele des Pariser Klimaabkommens, Netto-Null-Emissionen bis 2050 und die Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad, erreicht werden.
Unternehmen und Tourismusbetriebe erkennen immer mehr, dass sie, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, nicht nur von Nachhaltigkeit sprechen dürfen, sondern auch nach dieser Maxime handeln müssen.
Text: Denis Pscheidl, Illustration: Monika Cichoń




7.30 Uhr: Der Wecker klingelt
Mit einer Berührung des Displays neben unserem Bett schalten wir den Wecker aus und wechseln zum Lawinenlagebericht. Auf einer in die Wand eingelassenen Glasscheibe erscheint eine Auswahl an Skigebieten. Wir wählen unser Ziel Saalbach aus und sehen eine Karte des Skigebiets, auf der die einzelnen Varianten mit einer detaillierten Lawinenrisikobewertung versehen sind. Der Neuschnee von vorgestern hat sich gut mit den darunterliegenden Schichten verbunden – allgemein gilt Warnstufe 2. Außerdem sind neun Stunden Sonne und kalte minus acht Grad angesagt. Ein perfekter Tag zum Skifahren.


fen können. Nach dem Kauf einer Tageskarte schauen wir uns die App noch etwas genauer an und stellen fest, dass man darüber auch Leihausrüstung reservieren könnte. Das machen wir aber lieber am Berg, um das Zukunftsmaterial vorher genau unter die Lupe nehmen zu können. Außerdem sind auf der App viele andere nützliche Informationen, wie der Lawinenlagebericht, den wir uns bereits im Hotel angesehen haben, zu finden. Es ist definitiv praktisch, alles gesammelt an einem Ort zu haben.
Uns fällt auf, dass kaum jemand eigene Ski dabeihat. Schon in den 2020erJahren ging der Trend zum Leihski. Während 2016 noch rund die Hälfte der verkauften Ski an Skiverleihe ging, waren es 2019 bereits 60 Prozent. Dieser Trend hat sich anscheinend fortgesetzt.
8.20 Uhr: Abfahrt mit dem Skibus
Still und leise fährt der Bus vor. Auf seiner Seite ist ein von Blitzen umrahmtes Stromkabel zu sehen. Er fährt elektrisch, denn in 20 Jahren verläuft die Anreise zum Skigebiet CO2-neutral. An den Sitzen vor uns hängen QR-Codes, die zu einer App führen, auf der wir uns die Liftkarte kau-
8.54 Uhr: Ankunft am Berg
An der Talstation angekommen, machen wir uns schnurstracks auf den Weg zur Seilbahn. Und siehe da: Bei den Ticketschaltern steht kaum jemand an. Die meisten haben wie wir ihre Tickets online
Um herauszufinden, was der Skisport in Zukunft für uns bereithält, haben wir eine Zeitmaschine konstruieren lassen und sind in das Jahr 2043 gereist. Nach einer Nacht in einem Hotel in Zell am See sind wir ins Skigebiet Saalbach-Hinterglemm gefahren.
8
Die Asitzkogelbahn ist ein Qualitätsgewinn
Top-modern und nachhaltig, so präsentiert sich der neue 8er Sessellift in Leogang. Mit einer Förderleistung von 3.700 Personen pro Stunde übernimmt die komfortable D-Line Anlage mit Bubble seit der Wintersaison 2022/23 eine wichtige Wiederholfunktion und entspannt zugleich den Transfer vom Leoganger in den Saalbacher Skiraum. Parallel zum Neubau mit dynamischer Sitzheizung und Photovoltaik-Dach, dürfen sich Skifahrer auf eine Verbreiterung der Pisten im Bereich der Talstation Asitzkogel und Muldenbahn freuen. Im Sommerbetrieb ermöglicht die Asitzkogelbahn Wanderern und Mountainbikern einen bequemen Aufstieg auf den Berg.
doppelmayr.com

Die Zukunft des Skibaus
Denis Dietrich, Global PR Manager von Atomic, weiß, dass sowohl Atomic als auch andere Skihersteller versuchen werden, immer umweltfreundlicher zu bauen. Das bedeutet zum einen, dass die Materialien für die Ski aus nachhaltiger Produktion stammen und zum anderen wird daran geforscht, wie Ski besser recycelt werden können, denn bisher ist es sehr schwierig, einen Ski wieder in seine Einzelteile zu zerlegen. Ziel ist eine Kreislaufwirtschaft die Emissionen bestmöglich reduziert. Selbstverständlich beschäftigt man sich auch mit neuen Technologien, die die Performance der Skier verbessern. Immer leichtere Ski sind dabei kein endloser Trend, da darunter die Abfahrtseigenschaften leiden.

Ob Skier immer noch tailliert sein werden, kann er zwar nicht beantworten, geht aber davon aus. Das Produktportfolio wird gerade bei Freerideski größer werden, da diese den regionalen Gegebenheiten mit den richtigen Breiten und Fahreigenschaften angepasst werden müssen. Der größte Trend ist laut ihm aber mit Sicherheit, dass nicht nur Skihersteller, sondern alle Interessengruppen den Skisport zukunftsfähig machen müssen



gekauft. Am Lift erkennt die Schranke automatisch, dass wir bereits ein Ticket am Handy haben, und lässt uns durch. Was vor 20 Jahren noch eine Revolution darstellte, ist 2043 in allen Skigebieten Standard. In der Gondel fragen wir einen anderen Skifahrer, was man macht, falls das Handy keinen Akku mehr haben sollte. In diesem Fall könne man sich einfach eine Ersatzkarte an der Kassa holen, da alle Daten hinterlegt seien, meint er.
Auf dem Weg nach oben fällt einem als Erstes auf, dass alle Südhänge mit Photovoltaikanlagen versehen sind, die den Strom für das Skigebiet direkt vor Ort produzieren. Bei diesem Anblick kann man die Sitzheizung mit gutem Gewissen genießen.
9.30 Uhr: Ausrüstung leihen
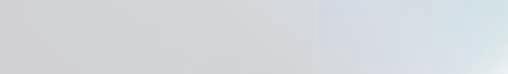



Im Skiverleih an der Bergstation stehen an einer Wand die Ski derjenigen, die sie online reserviert haben, bereit. Wir gehen zu einem der Mitarbeiter und lassen uns die Modelle der Zukunft er-
klären. Er präsentiert uns eine breite Auswahl. In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Skibauer eine Vielzahl von neuen Technologien einfallen lassen, um die Bretter noch laufruhiger und kontrollierbarer zu machen. Aber tailliert sind sie immer noch. Auf einer Liste an der Wand finden wir den exakten CO2-Fußabdruck jedes Skis. Außerdem befindet sich auf fast jedem Ski ein Recyclingcode. Wir entscheiden uns dazu, am Vormittag Powder-Ski auszuleihen und Varianten fahren zu gehen und am Nachmittag auf Rennlatten zu wechseln.
Danach schauen wir uns die restliche Ausrüstung an. In der Zukunft ist es anscheinend auch üblich, Skijacken und -hosen auszuleihen. Wir nutzen die Chance, die neuen Textilien zu testen, und lassen uns einkleiden. Die Jacken verfügen über eingebaute Sensoren und verständigen im Falle eines Unfalls direkt die Pistenrettung. Auch unter einer Lawine kann das Notsignal vom Bergrettungsdienst und Ersthelfern mit LVSGeräten geortet werden, erklärt uns der Verkäufer. Die Airbagrucksäcke funktionieren mittlerweile fast alle elektrisch und wiegen nur noch rund die Hälfte von denen, die wir gewöhnt sind. Selbst bei den Skibrillen gibt es Neuheiten. Auf Knopfdruck erscheint ein Hologramm auf dem Glas, das die Geschwindigkeit des Fahrers anzeigt.

Wintersporttag der Zukunft
10
© PRINOTH
Die Schneehöhenmessung von Prinoth verbessert das Schneemanagement – von der Produktion über die Verteilung bis hin zur Präparierung. Das spart Zeit, Kosten und Ressourcen.


10 Uhr: Ab in den Powder

Mit allen Sicherheitsgadgets ausgerüstet, kann es endlich losgehen. Die Sessellifte der Zukunft sehen moderner aus als unsere heutigen Bahnen. Das beginnt bei der Architektur der Liftstation, auf deren Dach ein Windrad angebracht ist, und endet bei den schnittig designten Sitzen, die selbstverständlich alle mit Sitzheizung ausgestattet sind. Den Atem verschlägt es uns, als wir den Windschutz runterklappen. Vor unseren Augen erscheint eine interaktive Karte des Skigebiets. Per Fingerdruck können wir zwischen den einzelnen Pisten und Variantenabfahrten wählen und uns so einen Überblick verschaffen.
Unterschied zu früheren Powderlatten merken wir allerdings auf der Piste, denn auch dort sind die Skier problemlos mit einem kleinen Radius zu fahren.
Oben angekommen, ist das ganze Ausmaß der Photovoltaikanlagen und Windräder im Skigebiet zu erkennen. Überall, wo die Sonne hinscheint, sehen wir schwarze Bänder aus Photovoltaikmodulen und jede Liftstation ist mit einem Windrad versehen.
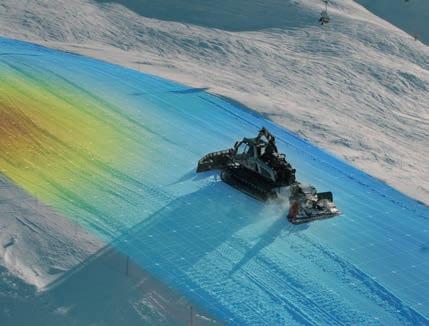
Wir verlassen den gesicherten Skiraum und sind direkt begeistert von den wendigen Freerideski der Zukunft.
Mühelos ziehen wir unsere Schwünge durch den Tiefschnee und finden großen Gefallen an den gewichtsreduzierten Lawinenrucksäcken, die unsere Fahrt kaum behindern. Den größten
12.30 Uhr: Mittagspause

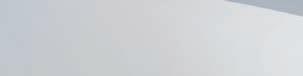






Nach zweieinhalb Stunden brennen unsere Oberschenkel und wir freuen uns, das kulinarische Angebot im Jahr 2043 testen zu können. Am Platz finden wir wieder den aus dem Bus bekannten QR-Code. Nach dem Scannen die Tischnummer eingeben, das gewünschte Essen wählen und es wird einem zum Tisch gebracht.
Der Fokus liegt ganz klar auf vegetarischen und veganen Speisen. Wir finden nur noch wenige fleischhaltige
Die Zukunft der Skigebiete

Manuel Hirner, Geschäftsführer der Bergbahnen SaalbachHinterglemm, glaubt, dass bereits installierte Systeme wie die GPS-Schneehöhenmessung in Pistengeräten noch exakter und die technische Beschneiung noch effizienter im Wasserund Energieverbrauch werden. Außerdem werden herkömmliche Antriebstechnologien nachhaltigen Konzepten wie Wasserstoff- und Elektroantrieb weichen. Darüber hinaus können biologisch abbaubare Kraftstoffe wie HVO seiner Meinung nach eine echte Alternative zu fossilen Energiequellen sein.
Auch die Bergbahnen SaalbachHinterglemm befindet sich bereits massiv im Ausbau erneuerbarer Energien durch Wasserkraft und Photovoltaik So ist gerade ein Wasserkraftwerk im Bau, das nächstes Jahr in Betrieb geht, und die PV-Anlagen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn werden ständig erweitert. Außerdem werden Windkraftanlagen projektiert und intensiv an nachhaltigen Systemen wie kleinen Windrädern auf Liftstützen geforscht Hirner glaubt, dass die optimale Nutzung bereits bestehender Infrastruktur hinsichtlich nachhaltiger Energiegewinnung immer mehr an Bedeutung gewinnt: keine zusätzliche Flächenversiegelung, sondern das Nutzen des Bestehenden.
Trotz Künstlicher Intelligenz wird der Beruf des „Liftlers“ nicht aussterben, da der persönliche Kontakt nicht durch eine Maschine zu ersetzen ist.
11
Die Zukunft der Seilbahnen
Als Infrastruktur, die zu 100 Prozent mit Strom betrieben wird, nimmt die Seilbahn eine wichtige Funktion beim emissionsfreien Transport der Gäste am Berg ein. Beispielsweise verbraucht der von Leitner entwickelte Direktantrieb im Vergleich zu einem herkömmlichen Antrieb mit Getriebe um fünf Prozent weniger Energie. Hier gehen die Entwicklungen aber intensiv weiter. Die Integration von PVElementen in Stationsgebäuden und Kabinen wird aktuell nur vereinzelt von Kunden angefragt. Dies wird aber kurz- bis mittelfristig zu einem Trend werden.
Damit der Transport mittels Seilbahnen zukünftig noch komfortabler ermöglicht werden kann, entwickelt Leitner derzeit ein hybrides System, bei dem die Kabine in der Station an ein autonomes Fahrzeug übergeben wird, das anschließend auf einer Trasse weiter zu seinem Ziel fährt. Damit lassen sich zum einen topografische oder bauliche Hürden überwinden. Zum anderen wäre es zukünftig möglich, ohne Umsteigen zur Unterkunft oder Haltestelle zu gelangen.

Auch die in letzter Zeit viel beachtete Künstliche Intelligenz (KI) hat ihren Weg in die Seilbahnbranche gefunden. So präsentiert Leitner mit dem Leitner Eco Drive bereits ein System, das das Tempo der Seilbahnanlage auf Basis eines Kamerasystems, das die Anzahl der Gäste bei der Station erfasst, reguliert. Damit kann bis zu 20 Prozent Energie gespart werden, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Außerdem trägt KI bei der Regulierung der Sitzheizung zur Einsparung von Energie und so zur Nachhaltigkeit bei.

Gerichte und wenn, dann stammen sie aus nachhaltiger regionaler Haltung. Sogar der Name des Hofs steht dabei. Nach der Stärkung tauschen wir unsere Skier und begeben uns auf die Piste.
13.30 Uhr: Die neuen Rennski ausprobieren

gewährleisten. Das gab es zwar auch 2023 schon, wurde zwei Jahrzehnte später aber perfektioniert. Auch die Skier selbst sind ein absoluter Traum. Der Verleihmitarbeiter hat nicht zu viel versprochen. Wie auf Schienen carven wir die Piste hinunter.

16 Uhr: Resümee
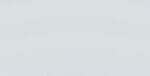

Unten angekommen, lassen wir den Tag noch einmal Revue passieren.
Sie ist pickelhart und trotzdem schön griffig. Die neuen CO2-neutralen Pistenraupen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb leisten wirklich gute Arbeit.
Das wird unter anderem durch ein komplett vernetztes Skigebiet ermöglicht. Wetterstationen sammeln Daten über Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die Aufschluss über den perfekten Zeitpunkt zum Beschneien geben. Außerdem wurden die Hänge im Sommer via GPS vermessen, sodass die Pistenraupen im Winter genau wissen, wie viel Schnee an welcher Stelle liegt. So lässt sich ein optimales Schneemanagement
Besonders freut uns, dass es der Skisport geschafft hat, seine Nachhaltigkeitsvisionen in die Tat umzusetzen, und so seinen Teil zu einer CO2-neutralen Welt beiträgt. Im Sommer werden die Skigebiete sogar zu Energielieferanten und versorgen die Bergdörfer mit grünem Strom. Allgemein lässt sich positiv festhalten, dass Skifahren durch die Digitalisierung Unannehmlichkeiten wie Schlangestehen hinter sich lassen konnte, neue Gadgets uns das Leben erleichtern und der Skisport so noch mehr an Attraktivität gewonnen hat.





Zufrieden werfen wir unsere Zeitmaschine an und reisen zurück ins Jahr 2023, um Ihnen von unseren Erfahrungen zu berichten, sodass auch Sie sich auf einen Skitag in der Zukunft freuen können.

Wintersporttag der Zukunft
12
© LEITNER
In Zukunft geht es mit der Gondel direkt zur Unterkunft oder Haltestelle.
Für die Besten

KRAFTVOLL UND SAUBER
Kompromisslose Leistung, unerreichte Effizienz und unschlagbare Performance machen den LEITWOLF zum unbestrittenen Meister der Piste. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Stage-V-Motor ist er zudem sauber wie noch nie. Betankt mit alternativen Treibstoffen wie HVO oder GTL, leistet der LEITWOLF einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion in Skigebieten. prinoth.com

Motor MTU 6R 1300, Euromot Stage V, 390 kW/530 PS @ 1.600 UpM, Drehmoment 2.600 Nm @ 1.300 UpM, 4,5 t Zugkraft
WINTERTOURISMUS ZUKUNFTSFIT MACHEN
Hinter urigen Berghütten und ohrwurmspielenden Après-Ski-Bars sind
Österreichs Skigebiete alles andere als von gestern. Der Wintertourismus geht mit den verschiedensten Innovationen in die Zukunft.


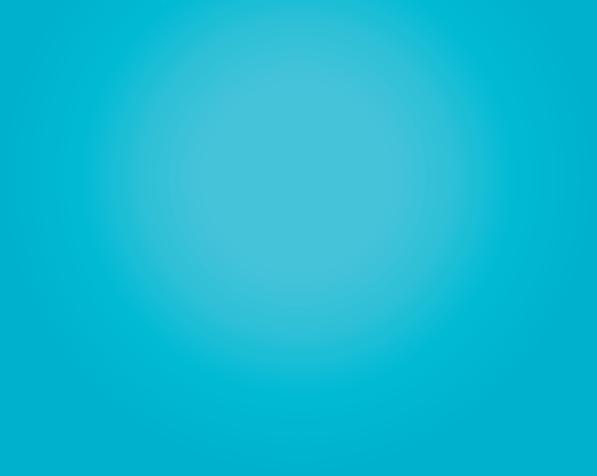
14 Innovative Projekte
Text: Anna Kirchgatterer




15 © SHUTTERSTOCK.COM
Skigebiete sind immer wieder Kritik ausgesetzt: Wälder müssen weichen für Pisten und die Beschneiung sei zu energieintensiv – das sind oft gehörte Einwände gegen den Wintersport. Aber immer mehr Regionen reagieren auf Anforderungen von Mensch und Natur und setzen punktuell oder ganzheitlich auf klimafreundliche Lösungen.

Hier ein paar Vorbilder:
Pistenpräparierung Next Level
Mit dem LEITWOLF h2MOTION arbeitet das Unternehmen Prinoth an klimaschonenden Alternativen für den Pistenraupen-Markt. Gelingen soll die CO2-freie Pistenpräparation durch Wasserstoffantriebe – je nach Modell mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder einem Wasserstoff-Verbrennungsmotor. Nach der Präsentation letzten September wird Letzterer jetzt auf den Pisten getestet. Unter anderem war die Pistenraupe beim Weltcup in der Flachau Anfang Jänner im Einsatz. 2025 soll der LEITWOLF h2MOTION mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor dann in Serie produziert werden.
Wasserstoffantrieb

16 Innovative Projekte
1
©
PRINOTH,
JULIA BRUNNER, PEAKMEDIA/DOMINIK ZWERGER, MOON LOUNGE SILVRETTA PARK MONTAFON
Sonnenkraft am Gletscher
Ein Drittel des Energiebedarfs könne man während des Winterbetriebs mit der Photovoltaikanlage direkt am Gletscher decken, erklärt Bernhard Füruter von den Pitztaler Gletscherbahnen in Tirol. Die Anlage auf einer luftigen Höhe von 2.840 Metern sei sogar effektiver als jene im Tal, rund ein Drittel mehr Sonnenenergie kann so produziert werden. Das liegt am höheren UV-Anteil und an der Abstrahlung durch die großen weißen Schneeflächen rundherum. Rund 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt die Photovoltaikanlage im Jahr. Die Kraft der Sonne nutzen mittlerweile einige Skigebiete, so zum Beispiel die Zillertal Arena (Tirol) oder das Skigebiet Zell am See Kaprun (Salzburg).

Auto anstecken und ab auf die Piste
Das geht im Skigebiet Silvretta-Montafon. Seit Dezember 2021 gibt es die Moon-Lounge, in der das Elektroauto bequem während des Skitags aufgeladen werden kann. Das Vorarlberger Skigebiet setzt so auf eine umweltfreundlichere Anreise. Denn wie man zur Skipiste kommt, ist einer der wichtigsten Teile des CO2-Fußabdrucks beim Skifahren – weshalb man im Silvretta-Montafon versuche, darauf Einfluss zu nehmen. Ausgestattet ist die Moon-Lounge mit 35 Ladeplätzen in der Parkgarage und 15 öffentlich zugänglichen Ladestationen. Im Endausbau könnte man in der Parkgarage sogar alle Stellplätze mit Ladepunkten ausrüsten. Voll ausgelastet sind die Ladeplätze aber noch nicht, heißt es aus dem Skigebiet.

Umweltfreundlichere Anreise

17
2 3
Sonnenenergie
Autofreie Zonen
Snow Space Salzburg
Das Skigebiet Snow Space Salzburg setzt sich zum Ziel, bereits in der Wintersaison 2025/26 klimaneutral zu sein. Dafür fokussiert man sich auf unterschiedliche Bereiche. Unter anderem wird der Energieverbrauch aller Abteilungen und Tätigkeiten analysiert, um Einsparungspotenziale festmachen zu können. 15 Prozent vom eigenen Fuhrpark sind bereits auf Elektroantrieb umgerüstet. Am meisten CO2 verursachen aber die Pistengeräte. Aktuell testet das Skigebiet, ob diese mit HVO-Kraftstoff betankt werden können. Längerfristig hofft man im Snow Space Salzburg auf Pistenraupen, die mit Wasserstoff betrieben werden.


Das eigene Auto stehen lassen
Anreisen mit Bus oder Bahn – das forciert der Skiort Hinterstoder seit mittlerweile 15 Jahren. Erreichen will man dieses Ziel mit unterschiedlichen Maßnahmen: Zum einen wurde der öffentliche Verkehr besser auf die Bedürfnisse von Bewohnern und Gästen abgestimmt, zum anderen hat man im Ort autofreie Zonen geschaffen. Serviceeinrichtungen – wie E-Tankstellen – und Partnerbetriebe – etwa ein E-Bike-Verleih – ergänzen das Angebot. „Alle Maßnahmen werden von den Gästen sehr gerne angenommen und genutzt“, meint Bürgermeister Klaus Aitzetmüller. Denn schleppen müssen Urlauber deswegen nicht: Wer mit den Öffis kommt, kann die Ski während des Urlaubs ganz einfach bei der Talstation deponieren. Damit ist das Projekt aber nicht abgeschlossen: In Zukunft will man auch für Tagesgäste aus den umliegenden Ballungszentren das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern.
Elektroantrieb

Innovative Projekte 18
4 5
© GEMEINDE HINTERSTODER, CHRISTOPH
v. l.: Klaus Thonhäuser (Prinoth AG), Peter Braunhofer (Prinoth AG), Roswitha Stadlober (Präsidentin ÖSV)
HUBER, SNOW SPACE SALZBURG
WHITE PEARL MOUTAIN DAYS






Die White Pearl Mountain Days im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn presented by Visa stehen für einen einzigartigen „Alpine Lifestyle“. Man nehme eine große Portion Home of Lässig und mixe sie mit einem vielfältigen Active Lifestyle-Rahmenprogramm wie Mountain Yoga oder Outdoor Bootcamp. Für den perfekten Sound sorgen internationale Top-DJs aus House, Jazz & Soul sowie mitreißende Live-Performances. Garniert wird das Event-Highlight mit traditionellen österreichischen Spezialitäten und internationalen Highlights.










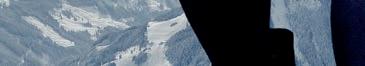










MORE INFO
Saalbach 2025
Kurze Wege, große Wirkung
Die Heim-Ski-WM 2025 ist nicht die erste Großveranstaltung, bei der der ÖSV Nachhaltigkeitsmaßnahmen umsetzt. Doch das Event in Saalbach soll ein Sportfest mit Leuchtturmcharakter werden.

Roswitha Stadlober ist seit Oktober 2021 Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes. Das Thema Nachhaltigkeit ist ihr eine Herzensangelegenheit und soll im Verband weiter forciert werden.

Manuel Hirner ist Geschäftsführer der Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Ges.m.b.H., ehemaliger Langlaufprofi im ÖSV (2001–2012) und seit 2015 bei den Weltcups in Saalbach involviert.

20 Nachhaltiges Veranstalten
Text: Eva Schwienbacher
© SAALBACH.COM/DANIEL ROOS, SAALBACH.COM, FRANZ OSS, SAALBACH.COM/FOTO JANK
Ein Berg – alle Bewerbe“, so lautet das Motto der FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften, die im Februar 2025 in Saalbach stattfinden werden. Und der Name ist Programm: So sollen sämtliche Rennen in allen Disziplinen an einem Berg, dem Zwölferkogel, ausgetragen, die Koordination zwischen Publikum und Sport erleichtert und bestehende Infrastruktur genutzt werden.
Die geografische Anordnung ist laut Manuel Hirner, Geschäftsführer der Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm, der herausragendste Aspekt der Location: „Fußläufigkeit ist hier kein reißerisches Schlagwort. Die Besucher benötigen im Zeitraum der WM und auch sonst kein Auto, höchstens zur Anreise.“ Kurze Wege zählen zu den umfassenden Maßnahmen, die gesetzt werden, damit die nächste Ski-Heim-WM eine zukunftsträchtige wird.
Hohe Priorität
Die Bestrebung, als Organisator verantwortungsbewusst und ressourcenschonend zu handeln, gilt laut ÖSV für sämtliche seiner Veranstaltungen. „Gerade weil wir den Sport in der Natur ausüben, leisten wir unseren Beitrag, um sie zu schützen“, sagt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, die das Thema Nachhaltigkeit im Verband weiter forciert, da es für sie als Präsidentin und das ganze Team eine hohe Priorität hat.
beispielsweise sukzessive auf Hybrid- und E-Autos umgestellt.
Bestandsaufnahme
Seit 1933 hat der ÖSV 37 Weltmeisterschaften durchgeführt. Darunter seien einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, bei denen Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchgeführt wurden. Auch bei den Weltcupbewerben in Österreich setze man klare Zeichen für den Umweltschutz. Gemeinsam mit den Organisationskomitees aller Weltcupbewerbe in Österreich habe man bei einer Bestandsaufnahme im Herbst erhoben, was gut laufe und wo noch Luft nach oben sei. „Da passiert schon sehr viel, von ganz kleinen bis hin zu ganz großen Maßnahmen“, sagt Stadlober.
Gute Bedingungen: Die Ski-WM 1991 in Saalbach blieb aufgrund des schönen Wetters als SonnenWM in Erinnerung.

Eigenverantwortung
Im Wissen, dass die Reisen der Athleten und Betreuer zu den Trainings- und Wettkampforten in Sachen CO2-Emissionen besonders problematisch (siehe Interview Seite 80), aber alternativlos sind, bemühe man sich etwa durch gute Reiseplanung und Fahrgemeinschaften um eine Reduktion. Der Fuhrpark der Ski Austria Gruppe selbst werde
Kleine und große Maßnahmen erarbeiten, evaluieren und umsetzen steht in den nächsten Monaten auch in Saalbach auf dem Plan. Dabei gilt es auch, die Grenzen des Machbaren auszuloten. „Wir müssen uns an den Möglichkeiten orientieren. Wir können den öffentlichen Verkehr beispielsweise fördern, in einem Ort wie Hinterglemm ohne Bahnhof wird es aber Busse brauchen, um Fans vom Bahnhof Maishofen/Zell am See bis nach Hinterglemm zu befördern“, räumt die ÖSV-Präsidentin ein. Außerdem sei man abhängig von Lieferanten und Sponsoren.
Die Ski-WM biete jedoch die Chance, darin sind sich Hirner und Stadlober einig, das Bewusstsein sämtlicher Beteiligter für Klimaschutz zu stärken. Als nachhaltiger Event könnte Saalbach 2025 künftigen Veranstaltungen als Vorbild dienen.
21
„Gerade weil wir den Sport in der Natur ausüben, leisten wir unseren Beitrag, um sie zu schützen.“
Roswitha Stadlober
SAALBACH
Beispiele
Infrastruktur: Verwendung bestehender Infrastruktur, Berücksichtigung der neuesten Energiestandards für Strom und Heizung bei temporären Eventbauten
Mobilität: kostenlose Anreise mit dem Veranstaltungsticket für öffentliche Verkehrsmittel, Shuttle für Teams, Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes
Verpflegung: regionale und saisonale Produkte, veganes und vegetarisches Angebot, Food-Waste-Konzept, Einsatz von Mehrweg- und recycelbarem Geschirr
Abfall: Mülltrennungskonzept mit regionalen Entsorgungsunternehmen, Bewusstseinsbildung zur richtigen Mülltrennung, keine Einweg-Giveaways
Energieverbrauch: Nutzung von Wasserkraft sowie Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Seilbahngebäuden zur Gewinnung zusätzlich benötigter Energie
Barrierefreiheit: Barrierefreiheit der WM-Website, Angebot an Behindertenparkplätzen und -transporten
1. Das Konzept
Das Nachhaltigkeitskonzept von Saalbach 2025 sieht Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Mobilität, Verpflegung, Abfall, Energieverbrauch und Barrierefreiheit vor. Neben dem ökologischen Aspekt, sagt Manuel Hirner, gebe es noch die soziale und ökonomische Seite. „Eine solche Skisportveranstaltung kann regionale Unternehmen zu Investitionen motivieren und zu Verbesserungen der Infrastruktur führen. Die aktive Partizipation der Bevölkerung an der Veranstaltung, beispielsweise beim örtlichen Skiclub, verbindet und fördert das Wir-Gefühl.“
2. Die Besonderheiten
Sämtliche Rennen finden am Zwölferkogel A statt, weshalb Saalbach 2025 auch die WM der kurzen Wege werden soll. Darüber hinaus soll der Publikumsskilauf während der Veranstaltungen durchgehend möglich sein. „Mit dem Skiticket gelangt der Gast bis zu den Sicherheitszäunen der Rennstrecken und genießt während eines Skitages eine WM-Abfahrt in der ersten Reihe fußfrei“, erklärt der Pinzgauer. Damit sei die Veranstaltung ein absoluter Mehrwert für Besucher sowie ein Anreiz, länger zu bleiben, und in Folge eine Reduktion des Verkehrsaufkommens möglich.
Ein Zuckerl für Sportliche: Das WM-Stadion soll über das großflächige und regionsübergreifende Skigebiet auf Skiern oder Snowboards erreichbar sein.
3. Die Herausforderungen
„Eine Challenge wird das Umsetzen der Maßnahmen in der Gastronomie bei winterlichen Temperaturen sein. Das beginnt beim Ausschank bei Minusgraden bis hin zu den Heizungen“, weiß Hirner. Prinzipiell sei die Integration von Nachhaltigkeitsbestrebungen bereits in der frühen Planungsphase des Events wichtig, nur so könnten die Umsetzungen fruchten und ökonomisch umgesetzt werden.
4. Der finanzielle Mehraufwand
Die Frage nach den Mehrkosten stelle sich laut dem ehemaligen Langlaufprofi nicht, da man nur mit und nicht gegen die Natur arbeiten könne. „Als ehemaliger Spitzensportler sehe ich den Gigantismus mancher Veranstaltungen sehr kritisch und freue mich, den Fokus wieder mehr auf den Sport und deren Akteure lenken zu können.“ Außerdem seien die finanziellen Subventionen mit einer nachhaltigen Event-Umsetzung verknüpft.
5. Vorteile für Sport und Region
„Der Skisport und der Wintertourismus sind das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft“, sagt Hirner. „Wir haben sicherlich eines der modernsten Skigebiete weltweit und müssen keine neuen Pisten schaffen. Die Athleten kommen in einen echten Wintersportort mit Tradition.“ Eine Ski-WM könnte dieses Bekenntnis weiter verstärken, den Nachwuchs fürs Skifahren begeistern und somit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des Sports und der Region leisten.

22
Kernpunkte der Heim-Ski-WM
in Saalbach (04.–16.02.2025), die als nachhaltiger Event Vorbildwirkung erzielen soll.
Nachhaltiges Veranstalten Fünf
2025
„Als ehemaliger Spitzensportler sehe ich den Gigantismus mancher Veranstaltungen sehr kritisch.“
Manuel Hirner
© SAALBACH.COM/CHRISTIAN WÖCKINGER A


























































saalbach2025.com WE LTCUP FINALE März 2024 FIS ALP INE S KI W E LTMEISTERSCHAFTEN 4.–16. Februar 2025
„Sport ist nicht das Problem“
Was ist ein Green Event? Kann ein Wintersportevent überhaupt nachhaltig sein? Welche Maßnahmen sind dafür notwendig? Ein Gespräch mit Freizeitwirtschaft- und Klimawandelforscherin Ulrike Pröbstl-Haider von der BOKU in Wien.
Von der Fußball-WM in Katar bis zu kleinen Vereinsfesten – Sportevents auf internationaler und lokaler Ebene bezeichnen sich als grün. Was sind Green Events?
ULRIKE PRÖBSTL-HAIDER: Green Events sind Veranstaltungen, die sich an klare Kriterien der Nachhaltigkeit halten, die umfassend sind und alle Bereiche des Events betreffen – von der Website über die Verpflegung und Mobilität bis hin zu den Publikationen.
Auch bei Wintersportevents sind Organisatoren um mehr Nachhaltigkeit bemüht. Was ist das Problematische an diesen Events?
In Sachen Umweltbelastung fallen einerseits die vielen kleinen Events ins Gewicht, die auf lokaler Ebene regelmäßig stattfinden und ob der Schneeverhältnisse immer weiter von den Vereinsstützpunkten entfernt abgehalten werden. Ihre CO2-Belastung ist aufgrund der längeren, zumeist individuellen Anreise der Begleitpersonen problematisch. Auf der anderen Seite sind die Großevents zu nennen. Hinsichtlich der CO2-Emissionen sind die großen Strecken, die die Sportlerinnen und Sportler inklusive Begleittross zurücklegen, die größte CO2-Belastung.
Inwiefern?
Ein Blick auf den Rennkalender im Ski Alpin zeigt, wie groß die Distanzen und wie kurz die Pausen zwischen den Rennen sind. Hier wäre es nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch der mentalen Gesundheit der Athletinnen und Athleten, den Rennkalender zu überdenken. Das Thema ist natürlich ein „heißes Eisen“, da jedes Land sein traditionelles Rennen hat, das mit viel Herzblut verteidigt wird. Aber man muss heutzutage in diese Richtung denken dürfen. Hinzu kommt das Begleitprogramm bei Großereignissen. Mit dem Verkehr, Abfall, der Verpflegung und Schaffung temporärer Infrastruktur für Konzerte und Live-Veranstaltungen ist die Beeinträchtigung der Umwelt und Natur erheblich.
24 Green Event
Das Interview führte Eva Schwienbacher.
„Der Sport kann Vorreiter und Vorbild werden.“
Ulrike Pröbstl-Haider
EXPERTENINTERVIEW Ulrike
Pröbstl-Haider
Ist es überhaupt möglich, ein Wintersportevent nachhaltig zu gestalten?
Man kann nicht alle Sportarten über einen Kamm scheren. Beim Skispringen zum Beispiel hält sich der Energieaufwand durch Schneeproduktion in Grenzen. Steht in Skigebieten eine Rennstrecke vor und nach dem Wettkampf dem Publikum zur Verfügung, sehe ich die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen auch weniger problematisch. Grundsätzlich ist nicht der Sport das Problem. Vielmehr sind es die vielen Side Events. Man sollte sich fragen, ob man in Zukunft nicht den Sport mehr in den Mittelpunkt rücken will. Auch zu seinem Schutz. Warum sollten ganze Berge und Täler beschallt werden, ohne dass ein Leistungssportler überhaupt fährt?
Sind da die Veranstalter gefordert?
Die Veranstalter, aber auch die öffentliche Diskussion. Inwieweit braucht es die Party? Reicht nicht der Sport? Vielleicht sollte man über die Verhältnismäßigkeit nachdenken.
Es gibt viele Labels und Zertifizierungen für Events. Was bringen sie?
Für mich ist entscheidend, wie transparent und nachvollziehbar die Kriterien für die Zertifizierung sind, wie sie kontrolliert werden und ob die Prüfeinrichtung anerkannt ist.
Kann ein Event auch ohne Zertifizierung „grün“ sein?
Ich würde nicht ausschließen, dass das geht. Auch außerhalb der Zertifizierung kann man sinnvolle Maßnahmen setzen. Allerdings fehlt eine objektive Kontrollinstanz. Eigene Kriterien bedeuten auch eine eigene Begründung und Transparenz, und die muss man erst einmal herstellen, ansonsten bleibt es beim: Wir sind gut, weil wir uns gut finden.
Ulrike Pröbstl-Haider ist Professorin für Landschaftsentwicklung, Erholung und Tourismus an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Pröbstl-Haider forscht u. a. im Bereich Freizeitund Tourismuswirtschaft und Klimawandel.


Welchen Nutzen bringt Nachhaltigkeit den Organisatoren?
Ob es sich ökonomisch rechnet, lässt sich nicht pauschal sagen, manche Maßnahmen sind kostendämpfend, andere nicht. Aber ich denke, es geht um gesellschaftliche Akzeptanz. Die Spitze der Negativdiskussion war Katar – so viele Menschen, die eigentlich Fußball mögen, haben die WM boykottiert. Der Leistungssport bekam ein negatives Image, weil die negativen sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen überwogen haben. Aber in den Sportverbänden ist ein Umdenken zu erkennen. Der Sport kann Vorreiter und Vorbild werden.
Wie schaut für Sie die ideale Wintersportveranstaltung von morgen aus?
Sie sollte zentral in den Alpen stattfinden, damit sie für möglichst viele teilnehmende Personen gut zu erreichen ist. In sämtlichen Bereichen sollten Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchgeführt sein, die objektiven, nachvollziehbaren Kriterien folgen. Für das Publikum sollte eine längere Verweildauer attraktiv sein. Es wäre auch interessant, standortrelevante Daten etwa zur Schneesicherheit in bestimmten Lagen und zu Zeitpunkten des Winters bei der Erstellung des Rennkalenders zu berücksichtigen. Damit Bilder von weißen Strichen in der Landschaft der Vergangenheit angehören.
Vielen Dank für das Gespräch.
25 © PRIVAT
„Man sollte sich fragen, ob man in Zukunft nicht den Sport mehr in den Mittelpunkt rücken will.“
URBANES ADLERNEST
wegen Exoten: Der Skisprungverein


Von
Wiener Stadtadler räumt bei Nachwuchsbewerben kräftig ab. Hoher
Einsatz von Jungadlern, Trainerstab und Helfern, Teamgeist und öffentlichkeitswirksame
Auftritte zählen zum Erfolgsrezept.
© WIENER STADTADLER Wiener Stadtadler 26
Text: Michael Rathmayr
Der Traum vom Fliegen wird überall geträumt, auch mitten in der Großstadt. Und dort gibt es, rein mathematisch, deutlich mehr potenzielle Überflieger als in weniger dicht verbauten Gebieten –wenn sie denn nur Gelegenheit bekämen, sich im Skispringen zu versuchen.
So weit die einfache Rechnung, die wohl eine wesentliche Rolle gespielt hat, als Toni Innauer und Ernst Vettori dem Kärntner Wahlwiener und Team-Bronzemedaillengewinner von 1994 in Lillehammer, Christian Moser, vor zwei Dekaden einen Floh ins Ohr setzten: Man könne das springerische Potenzial der Wiener Bevölkerung nicht länger ins Leere laufen lassen, es brauche eine Anlaufstelle in der Hauptstadt. Moser fackelte nicht allzu lange, 2004 gründete er die Wiener Stadtadler, Ostösterreichs ersten und bis heute einzigen Skisprungclub.

Detail am Rande: Eine Skisprunganlage gibt es weder in Wien noch im Burgenland oder Niederösterreich. Aber wo ein Wille, wo Freiwillige und –vor allem – begeisterte Nachwuchsadler, da findet sich auch ein Weg. Und der führt Wochenende für Wochenende per Teambussen zu den Sprungtrainings nach Mürzzuschlag oder nach Eisenerz, manchmal auch bis nach Villach.
Schnuppern im Prater
An zwei Wochenenden im Jänner fanden im Wiener Ernst-Happel-Stadion Schnupperkurse im Skispringen statt. Die Stadtadler luden ein, 300 Kinder kamen (und Hunderte weitere landeten auf der Warteliste). Auf der K1, der kleinsten Schanze des ÖSV, und auf dem Simulator wurde geschnuppert – eine Gaudi für die teilnehmenden Mädchen und Buben.

Die Trainer, fast alle selbst ehemalige Stadtadler-Kinder, hatten dabei ausgiebig Gelegenheit zum Scouten und dazu, die besten Kids direkt zu ersten Vereinstrainings einzuladen. Schwerpunkt der Adler ist die Nachwuchsarbeit: die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 14 Jahren auch darauf vorzubereiten, die Aufnahme in eines der Ski-Oberstufengymnasien in Stams, Saalfelden oder Eisenerz zu schaffen.
Jungadler mit Biss
Auch der elfjährige Nico Greilhuber aus Wien Währing kam vor drei Jahren über ein Schnuppertraining zu den Stadtadlern. In einer Zeitung hatte er zufällig eine Ankündigung entdeckt – damals wurde noch auf der Hohe Wand Wiese geschnuppert, nicht im Prater. Der Sprungsport hatte Nico schon lange fasziniert. Wenn er Stefan Kraft, Michi Hayböck und Konsorten im TV zusah, wollte er am liebsten mit ihnen abheben: „Die Luftzeit, der V-Stil – das taugt mir einfach, immer schon.“ Mittlerweile springt Nico auf 60bis 70-Meter-Schanzen. In Bischofshofen hat er im Rahmen der Kindervierschanzentournee schon zweimal gewonnen. „Angst hab ich keine, aber Respekt schon“, sagt der im Umgang mit Medien bereits ziemlich versierte Nachwuchssportler.
Skisprungclub Wiener Stadtadler
2004 gegründet, betreut der (noch) schanzenlose Skisprungverein den sechs- bis 14-jährigen Nachwuchs, stets mit Blick auf die angestrebte Aufnahme in die SkisprungLeistungszentren in Stams, Saalfelden und Eisenerz.
Rund 30 Kinder sind in drei Gruppen fast jedes Wochenende zu den Sprungtrainings in Mürzzuschlag und Eisenerz oder zu Bewerben in ganz Österreich unterwegs. Mit den regelmäßigen Erfolgen in Austria- und Alpencups dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die ersten Stadtadler auch im Weltcup abheben.
27
„Die Luftzeit, der V-Stil –das taugt mir einfach, immer schon.“
Nico Greilhuber, Nachwuchsathlet
Sigrid Katzböck, Nicos Mama, lobt das Klima bei den Stadtadlern: „Hier wird Leistungssport gemacht. Aber das Ganze bleibt ein Riesenspaß für die Kinder. Trainer und Betreuer, alle hier pflegen einen extrem netten Umgang mit dem Nachwuchs.“ Und die Verletzungsgefahr? „Das Trainerteam kann sehr gut einschätzen, auf welcher Schanzengröße die Kids gerade sicher zu Hause sind“, meint Vereinsvorstand Florian Danner. „Verletzungen passieren am ehesten, wenn wir in den Pausen miteinander Fußball spielen.“
Nico hat sich für seine erste Saison im Austria Cup jedenfalls noch einiges vorgenommen. Und wenn er nicht springt (oder in der Schule sitzt), dann singt der vielseitig talentierte Jungadler im Kinderchor der Wiener Volksoper.



Teamgeist on the road
Den Teamgeist hebt Florian Danner hervor, im Brotberuf TV-Moderator bei Puls4. Der Zusammenhalt sei schon ein anderer, wenn die rund 30 Kinder jedes Wochenende gemeinsam aus Wien zu den Trainings und Wettkämpfen starten, manchmal auch über Nacht bleiben. Unter der Woche werden in Turnhallen oder im Donaupark in Wien Koordination und Kraft trainiert. Die Kinder sprechen zwölf ver-
schiedene Sprachen, vom ukrainischen Flüchtlingsmädchen bis zur Familie aus Simmering reicht das Spektrum. „Wir sind so bunt wie die Stadt, bei den Bewerben erkennt man uns relativ schnell“, so Danner, dessen älterer Sohn Theo ebenfalls ein Jungadler ist.
Ein gewisses Exotentum ist den Stadtadlern gewissermaßen in die Wiege gelegt. Aber mit den Erfolgen ändert sich der Blick auf den Großstadtclub schnell –und davon gibt es nicht wenige: Louis Obersteiner, 18 Jahre, aus Wien Donaustadt, gewann bereits zweimal im Alpencup, holte Silber und Gold bei den Europäischen Jugendspielen 2022 und krönte sich heuer in Whistler (CAN) gemeinsam mit seinen Teamkollegen zum Juniorenweltmeister. Bei den zunehmend im Fokus stehenden Mädchen sind Meghan Wadsak und Sara Pokorny Garantinnen für regelmäßige Podestplätze. Und bei den jüngsten Stadtadlern kehrte man vom Landescup Ende Jänner in Villach mit einer beachtlichen Bilanz zurück nach Wien. Vierfachsieg in der Klasse der neunund zehnjährigen Buben, Dreifachsieg in der offenen Klasse auf der K15-Schanze und Doppelsieg in der Klasse der elf- und zwölfjährigen Athleten: ziemlich gut für eine Exotentruppe.
Schanzenlos?
Mit dem vorhandenen Budget zu arbeiten, sei sicher die größte Herausforderung für die Stadtadler, meint Vereinsvorstand Florian Danner.
Ohne die Sponsoren und das große Engagement vieler Freiwilliger wäre die Vereinsarbeit samt öffentlichkeitswirksamer Auftritte wie den Schnupperkursen kaum machbar.
Erklärtes Ziel der urbanen Greifvögel ist eine eigene, nachwuchstaugliche Schanzenanlage in Wien – im Mattenbetrieb, versteht sich. Auch der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker war im Jänner beim Schnupperkurs im Stadion zu Besuch. Er überlegt bereits laut, die Vision der Stadtadler zum Vorhaben zu erklären.
28 Wiener Stadtadler
„Wir sind so bunt wie die Stadt, bei den Bewerben erkennt man uns relativ schnell.“
Florian Danner, Vereinsvorstand Wiener Stadtadler
© WIENER STADTADLER, WIENSKI
Louis Obersteiner gewann in seiner Karriere bereits EYOF- und Junioren-WM-Medaillen.
„Ungeheures Potenzial“
Roland König, Präsident des Wiener Skiverbandes, über Skisport in Wien, den Erfolg der Stadtadler und Herausforderungen der nächsten Jahre

Leistungssportliches Potenzial der Großstädter versus naturgemäß fehlende Sportstätten: Worin liegen die speziellen Anforderungen an den Wiener Skiverband?
Grundsätzlich ist es möglich, Skisport auch auf einem Spitzenniveau zu betreiben, wenn man in einer Großstadt aufwächst. In einer Stadt wie Wien schlummert ein ungeheures Potenzial an talentierten Wintersportlern. Es gibt bei Kindern sehr viel Begeisterung und Neugier für den Skisport. Der Wiener Skiverband hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Schaffung von neuer Trainingsinfrastruktur mehr Kindern die Ausübung des Skisports möglich zu machen.
Es existiert eine beachtliche Menge an Skiclubs in der Hauptstadt – Vereinsarbeit als eine der Säulen für WienSki?
Die Skivereine sind das Herzstück des Skisports in Wien. Ohne die vielen engagierten, ehrenamtlichen Funktionäre und Trainer in den Vereinen würde es in Wien keine Skifamilie geben. Der Wiener Skiverband versucht, die Vereine bestmöglich bei der Organisation von Trainings und der Begleitung ihrer Athleten zu unterstützen. Mit unseren beiden neuen sportlichen Leitern Felix Ortner und Moritz Schellmann haben wir im Alpinbereich in der heurigen Saison ein professionelles Umfeld geschaffen, das in den nächsten Jahren die entsprechenden Früchte tragen wird.
Die Wiener Stadtadler: Worauf führen Sie deren Erfolgsgeschichte zurück?
Zunächst war es in der Vergangenheit eine unglaublich schlaue Idee, den Skisprungsport nach Wien zu bringen und einen Skisprungverein auch mit den entsprechenden Ressourcen zu unterstützen. Gleichzeitig arbeiten die Stadtadler schon seit vielen Jahren hervorragend, sowohl im sportlichen Bereich als auch in wirtschaftlichen Belangen. Sie haben durch ihre Erfolge auch das Interesse der Stadt Wien geweckt – ich bin zuversichtlich, dass wir dadurch dem
Traum von Nachwuchsschanzen in Wien deutlich näher gekommen sind. Das wäre ein Meilenstein für den Skisport in Wien!
Demografischer Wandel, Klimakrise – die großen Herausforderungen der nächsten Jahre?
Unsere wichtigste Aufgabe als Wiener Skiverband besteht darin, wieder mehr Kindern in Wien den Zugang zum Skifahren zu ermöglichen. Der ÖSV, der Tourismus, die Politik: Wir alle müssen uns bemühen und das Erlernen des Skifahrens wieder zur Selbstverständlichkeit machen. Gelingt uns das nicht, werden das Verständnis und die Akzeptanz für den Skisport in Großstädten in den nächsten Jahren dramatisch abnehmen. Durch die Klimakrise gerät das Skifahren zusätzlich unter Druck, so bedarf es für Wiener Skivereine zusätzlicher Anstrengungen, den Trainingsbetrieb aufrechterhalten zu können. Hier braucht es zukünftig auch vermehrt die Unterstützung des ÖSV. Gleichzeitig hat der Skisport aber auch die Chance, in der Klimakrise eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Wir sind als Skifamilie aufgerufen, Vorbilder zu sein und zu zeigen, dass man reagieren und Skisport auch nachhaltig betreiben kann. Natürlich werden wir Gewohnheiten ändern und viele Dinge in unserem Sport ein wenig anders machen müssen, aber wir können durch gescheite und innovative Lösungen wieder sehr viel mehr Akzeptanz gewinnen.
Vielen Dank für das Gespräch.
INTERVIEW
29
Die Zukunft ist und schnell digital


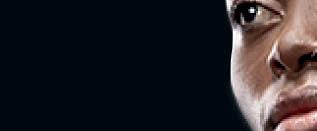































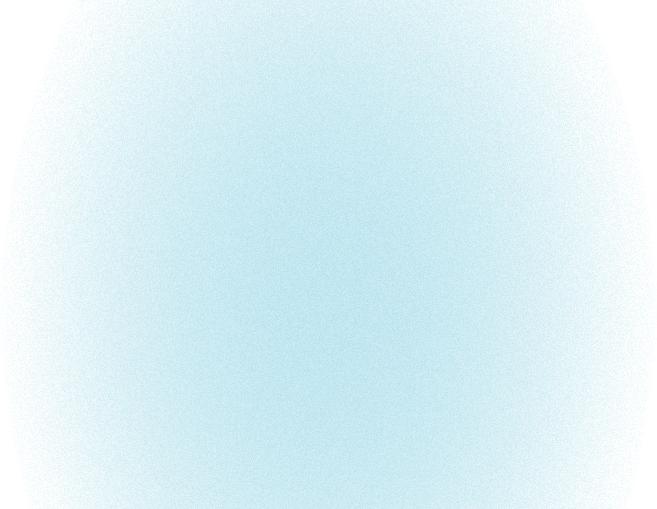
Technologie
30
Text: Barbara Kluibenschädl
ein Hauptziel sei es, so Michael Gufler, Bereichsleiter Technologie im ÖSV, das System Sportler und Sportequipment innerhalb der vorherrschenden Umweltbedingungen zu perfektionieren. Laufend arbeitet sein sechsköpfiges Team an der Findung und Umsetzung neuer Sporttechnologien.



Smarte Tools




„Wir stellen den Teams als Dienstleistung spezielle Tools zur Verfügung, wie Kameras für Spezialaufnahmen, um zum Beispiel Superzeitlupen zu machen.“ Technologien aus der Biomechanik und Bewegungsanalyse kommen zum Einsatz, wie etwa Druckverteilungsanalysen im Skischuh oder Gegenhang-Kameras, die Aufnahmen für eine Fahrlinienbewertung generieren. Der Trainer hat so die Möglichkeit, die Athleten head to head zu vergleichen.




Daraus könne man, so Gufler, mit speziellen Software-Tools Overlay-Analysen generieren. Das Abfahrtsvideo eines Athleten wird mit einem zweitem überblendet, um Fahrlinien zu vergleichen.







„Das kommt zum Einsatz, wenn spezielle Fragestellungen existieren“, erklärt Michael Gufler.
Auch bei der Kleidung ist „smart“ schon angekommen. Der ÖSV nutzt Tanktops und Shirts von QUS, einer Steirer Firma, die smarte Sensorik


Michael Gufler

Alter: 31


Studium: MSc. Sports Equipment Technology
Freizeit: Zeit mit Familie und Freunden
31
© FRANZ OSS, SKI AUSTRIA, MICHAEL GUFLER, QUS
Die Kombination aus innovativster Hard- und Software garantiert den Spitzensportlern des Österreichischen Skiverbandes vielversprechende Jahre.
Die im Textil integrierten Sensoren messen die Vitaldaten der Sportler.
Alter: 53
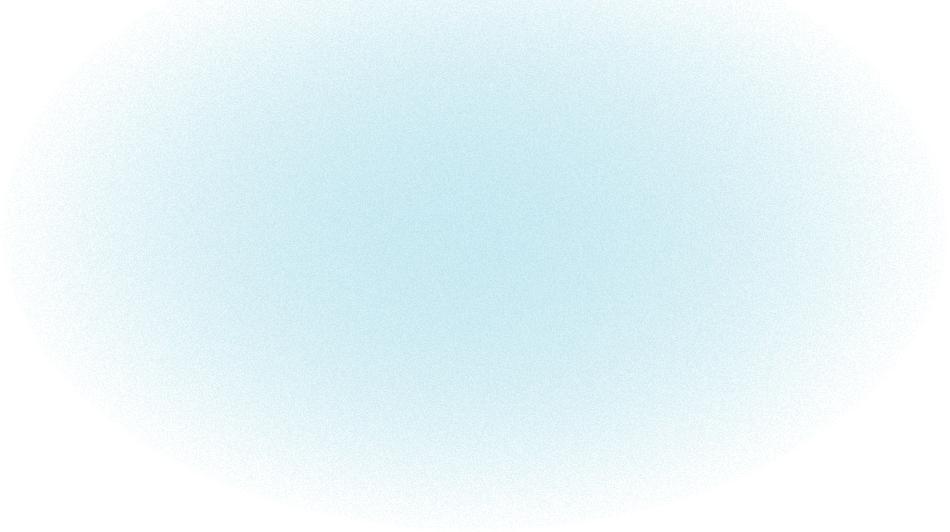
Studium: Experimentalphysik, MSc. Wirtschaftsingenieurswesen
Freizeit: Zeit mit der Familie
im Textil mit einer On-board-Unit, einem kleinen, schwarzen Kästchen zur Datenübertragung, verknüpft. Diese Vital- und Bewegungsdaten können in Zukunft dem Trainer eine Entscheidungsgrundlage für eine optimale Trainingssteuerung und Verletzungsprophylaxe geben.



„In weiterer Folge gilt es passende sportartspezifische AuswertungsAlgorithmen zu entwickeln, um objektive Aussagen treffen zu können.“
Wachsende Digitalisierung mit IoT
Vielversprechend für die Datensammlung und -auswertung ist, so Michael Gufler, der IoT-Sektor. IoT steht für die englischen
Wörter „Internet of things“ oder für das deutsche Äquivalent „Internet der Dinge“.





Michael Gufler erklärt: „Die größte Herausforderung ist bislang die Datensammlung im Feld gewesen. Verschiedene Teams sind zeitgleich auf der ganzen Welt unterwegs. Mithilfe neuer dezentraler Hardware-Tools können Daten nun via Internet gesammelt werden.“
Gerade läuft ein Projekt zur Implementierung einer smarten, cloudbasierten Wetterstation mit dem niederösterreichischen Start-up Lympik. Diese misst während des Wettkampfs laufend Umweltdaten, wie Luftdruck, Lufttemperatur und Feuchtigkeitsgehalt. Die gewonnenen Daten helfen den Serviceleuten, die Skier und Boards optimal anzupassen und zu präparieren.
Künstliche Intelligenz ist Zukunftsmusik
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird Einzug halten. „Wir haben bei unserem Partner am Forschungszentrum Schnee Ski und Alpinsport der Universität
32
„Hauptziel ist, das System Sportler und Sportequipment innerhalb der vorherrschenden Umweltbedingungen zu perfektionieren.“
Michael Gufler, Bereichsleiter Technologie im ÖSV.
© FRANZ OSS, QUS
Michael Hasler
Technologie
Seit 25 Jahren stolzer Partner des ÖSV.



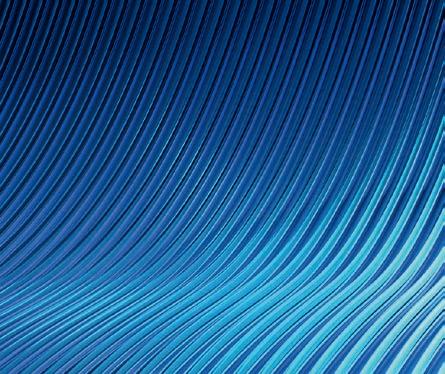

Unser gemeinsames Ziel:
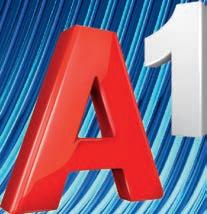



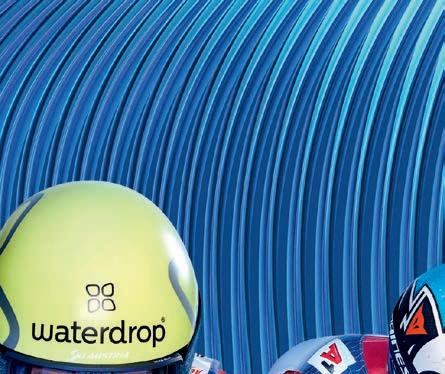


Jetzt Du. Im A1 Giganetz.
Was ist dieses Internet der Dinge?
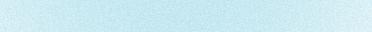


Es bezeichnet ein System, das in Echtzeit Daten misst, auswertet und austauscht.
Ein IoT-System besteht aus drei Komponenten. Zum einen aus einem intelligenten Gerät, das Daten aus seiner Umgebung sammelt
Dieses sendet die gewonnenen Informationen via Internet an eine cloudbasierte IoT-Anwendung, die in der Lage ist, die Daten zu integrieren, zu analysieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Diese Ergebnisse werden wieder zurück an das Sendergerät geschickt, das darauf mit einer Funktionsanpassung reagiert.
Zur Verwaltung und Visualisierung der Auswertung braucht das System eine dritte Komponente, nämlich eine Benutzeroberfläche. Meist in Form einer App, Website oder eines integrierten Bildschirms am Gerät.

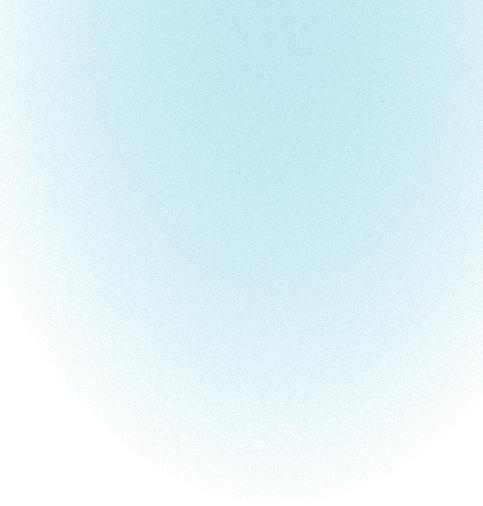
Innsbruck die Möglichkeit, über Computervision, KI-basiert, aus 2D-Videos eine 3D-Bewegungsanalyse generieren zu können. Das ist aktuell in einem Entwicklungsstadium“, berichtet Gufler.
„Das größte Problem in der Analyse des Skifahrens“, ergänzt Projektkoordinator am Forschungszentrum Schnee Ski und Alpinsport Michael Hasler, „ist die objektive und numerische Darstellung.“ Da alpiner Wintersport eine Freiluftsportart ist, ist die Datengenerierung sehr aufwendig. „Unter Laborbedingungen“, erklärt Hasler, „können Biomechaniker diese Daten schnell via Markertracking und multiplen Kameras ermitteln.“ Im Feld sind das Sammeln und die Auswertung aber noch ein monatelanger Prozess.

Zwischen Technologie und Einsatz
Nur weil Technologien unter Laborbedingungen funktionieren, können sie nicht immer in der Praxis eingesetzt werden. Schlechte Videoqualitäten, die Notwendigkeit schnellerer Abläufe und das Fehlen von Experten, die derartig komplexe
Systeme betreuen und interpretieren können, sind Hürden für den Einsatz von smarten oder KI-basierten Tools, weiß auch ÖSV-Bereichsleiter Michael Gufler.
„Ziel ist, dass man hinter allen Daten auch die entsprechende Data Science und statistischen Auswertungsmodelle stehen hat und so wirklich Erkenntnisse und sinnvolle Analysen daraus ziehen kann“, erklärt Gufler. Der nächste Schritt besteht darin, eine derartige Infrastruktur sukzessive aufzubauen. Athleten und Trainer sollten Erkenntnisse in Echtzeit erhalten und direkt beim Wettkampf nutzen können.
Nach der Saison
Wie in jedem Frühjahr wird sich Michael Gufler mit seinem Team, den sportlichen Leitungen, Trainern und Athleten zusammensetzen, laufende Projekte auswerten und neue Vorhaben besprechen. „Wir saugen die Inputs auf und werden die nächsten Entwicklungsziele definieren“, erklärt Gufler. Das große Ziel, berichtet er, ist Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.
„Ziel ist, dass man hinter allen Daten auch die entsprechende Data Science hat und so wirkliche Erkenntnisse daraus ziehen kann.“
34
Michael Gufler, Bereichsleiter ÖSV
Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird Einzug halten. © FRANZ OSS, MICHAEL
Technologie
GUFLER
Auftragsforschung für mehr Geschwindigkeit
Das Team am Forschungszentrum Schnee, Ski und Alpinsport der Universität Innsbruck unterstützt den ÖSV mit der Erforschung und Testung der Gleitreibung von Skiern und Boards – ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Athleten.
Mit dem Mikroskop werden Schliff und Wachsschicht untersucht.

Versteckt in einem unscheinbaren, flachen Gebäude aus Wellblech am Campus für Sportwissenschaften in Innsbruck befindet sich das weltweit größte Tribometer seiner Art. Mithilfe dessen ist es möglich, den Gleitwiderstand bzw. Wechselwirkung zwischen Schnee und Ski zu messen.
Je nach Beschaffenheit des Untergrunds ändert sich das Anforderungsprofil an den Untersatz. Der Ski oder das Snowboard müssen auf die Verhältnisse optimal abgestimmt werden.
Die Anlage besteht aus einer 24 Meter langen, orangefarbenen Metallwanne, befüllt mit einer Lage hausintern produziertem Schnee. Darüber werden mit verschiedener Geschwindigkeit einge-

spannte Ski „geschossen“. Computer und Programme erfassen die Daten, die im weiteren Verlauf ausgewertet werden können.
30 Jahre Kooperation
Michael Hasler, der Koordinator des Forschungsteams, erklärt, dass dieses Tribometer aus der intensiven langjährigen Kooperation mit dem ÖSV entstanden ist. Zum Bau kam es aufgrund teils frustrierender Feldtests der Vergangenheit. Die unterschiedlichen Umweltbedingungen haben das Extrahieren von nützlichen Ergebnissen manchmal unmöglich gemacht. Mit dem Tribometer können viele Schneebe-
35
dingungen nachgestellt werden. Limitierungen gäbe es, so Hasler, bei der Luftfeuchtigkeit, die durch das künstliche Runterkühlen auf bis zu minus 20 Grad Celsius immer relativ niedrig bleibt.
Verstehen, wie es funktioniert
Neben den Arbeiten für den ÖSV macht die Forschungsgruppe aber auch Grundlagenforschung. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie die Reibung zwischen Ski und Schnee genau funktioniert oder wieso Wachs den Ski schneller macht. „Wir möchten es verstehen“, so Michael Hasler.
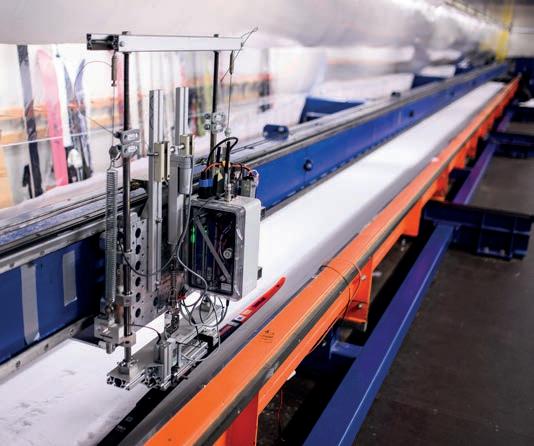

Den einen richtigen Schliff oder die perfekte Wachsschicht kann man nicht ermitteln. Was optimal ist, bestimmt die Umgebung, also die Wetterbedingungen und die Schneequalität.

So vergleicht das Forschungsteam dasselbe Skimodell mit verschiedenen Wachsen oder Schliffen. Die Testungen sind sehr zeitaufwendig. Die Temperaturanpassung im Messungsraum dauert bis zu zwölf Stunden. „Wir können nicht alle Wachse bei allen Temperaturen messen, das geht sich nicht aus“,
erklärt Hasler. So wird ein Ski bei drei bis vier Temperaturpunkten getestet, um aussagekräftige Daten zu bekommen.
Neues Wachs
Zurzeit liegt ein Forschungsschwerpunkt für den ÖSV auf der Austestung fluorfreier Wachse. „Im EU-Raum wurden gewisse Fluorverbindungen, die biologisch nicht abbaubar und für den Menschen gefährlich und fortpflanzungsschädlich sind, verboten“, erklärt der Forschungsleiter. Die internationalen Weltverbände FIS und IBU möchten noch einen Schritt weitergehen und die Anwendung aller fluorbasierten Wachse in Zukunft verbieten. Vorausschauend betrachtet, mache es Sinn, sich jetzt schon mit der Thematik auseinanderzusetzen, so Hasler.

36
Michael Hasler: „Nach der Testfahrt wird die Struktur des befahrenen Schnees mithilfe eines Computertomografen dargestellt.“
„Wir möchten verstehen, wie das funktioniert.“
© FRANZ OSS Technologie
Michael Hasler über die Notwendigkeit der Grundlagenforschung













myeisbaer.com FOR A NATURAL EXPERIENCE STRIVE
Wintermärchen mit Open End


























Wie plant man Erfolg?
38
ie Buckelpiste war zwar 1992 als erste FreestyleDisziplin olympisch, trotzdem führt sie in Mitteleuropa ein Schattendasein. Die Skination Österreich ist da keine Ausnahme. Die Buckelpiste ist hierzulande zwar Teil der staatlichen Skilehrerausbildung und gilt ob des hohen technischen Anspruchs als Königsdisziplin, doch für die meisten ist sie eher Pflicht als Vergnügen.
Aktive Athleten gibt es nur wenige und auch in den Skigebieten dominieren bügelglatte, bestens präparierte Pisten. „Das ist das, was der Gast bei uns sucht“, sagt Roman Kuss, Bereichsleiter Verbandsentwicklung und Sportkoordination und sportlicher Leiter Freeski im ÖSV. In der Vergangenheit genoss die Sportart auch innerhalb des Verbandes nicht die beste Unterstützung, so Kuss, obwohl man bereits sehr erfolgreiche Sportler in den ÖSV-Strukturen betreute.






Verband für alle



International wurde der Buckelpiste ebenso bereits das Ende vorhergesagt. Dann entschied das Olympische Komitee im Sommer 2021, Dual Moguls, also das Parallelrennen in der Buckelpiste, ins olympische Programm aufzunehmen. „Das hat gezeigt, dass es doch in eine andere Richtung geht und man das Ganze weiter forcieren will“, sagt der Kärntner. Auch der ÖSV will auf den Zug aufspringen. Anlass dafür seien laut Kuss zum einen eine generelle Öffnung des Verbandes für andere Dis-

39 © GEPA PICTURES/DAVID RODRIGUEZ
Wie man eine Sportart erfolgreich aufbaut, dafür gibt es kein Patentrezept. Was es aber braucht, sind Herzblut, Ausdauer und vielleicht eine coole Athletin mit Talent und einer Geschichte, wie das Beispiel Buckelpiste in Österreich zeigt.
Text: Eva Schwienbacher
Kuss arbeitet seit 2015 im Österreichischen Skiverband, wo er als sportlicher Leiter für Freeski die Sparte erfolgreich aufgebaut hat. Seit 2022 leitet er den neu geschaffenen Bereich Verbandsentwicklung und Sportkoordination im ÖSV.

Die Salzburgerin
Melanie Meilinger ist eine ehemalige Buckelpistenfahrerin, die ihren Weg zum Freestyle über Ski Alpin fand. Sie finanzierte den Großteil ihrer sportlichen Karriere privat. Heute ist sie unter anderem Mitarbeiterin im Bereich Verbandsentwicklung und Sportkoordination und koordiniert den Bereich Freestyle im Hinblick auf die Heim-WM 2027.


Eine echte Kennerin
plan,



ziplinen, zum anderen die Freestyle, Freeski und Snowboard WM 2027 im Montafon, die man als Leuchtturmprojekt nutzen wolle. Was außerdem für die Buckelpiste spreche: „Wir sind mittlerweile bemüht, alle Disziplinen zu bespielen, um für die breite Masse als DER Fachverband und die Stimme des Wintersports wahrgenommen zu werden.“

Mit Melanie Meilinger, die zehn Jahre lang auf eigene Faust im Weltcup unterwegs war, hat sich der Verband eine echte Expertin geholt, die nicht nur Insiderwissen mitbringt, sondern auch die notwendige Leidenschaft für die Buckelpiste. Denn „um eine Sportart erfolgreich aufzubauen, braucht es in erster Linie viel Willen,
Motivation und Herzblut“, so Kuss.


Als ehemalige Buckelpistenfahrerin habe die Salzburgerin nicht nur erlebt, wie schwierig es ist, Ergebnisse einzufahren, erzählt sie, sondern auch, wie hart die Gesamtsituation in Österreich sei.
„Doch das hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen.“ Die Disziplin, bei der es um skifahrerisches Können und Akrobatik gehe, sei wahnsinnig faszinierend und mache Spaß. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, das Bewusstsein dafür in Österreich zu schärfen und Kindern und Jugendlichen diese Art des Skifahrens nahezubringen.


Vorbild mit Geschichte



Was es braucht, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen Sport zu lenken,


40 Wie plant man Erfolg?
„Es gibt keinen Master-
um eine Sportart erfolgreich aufzubauen.“
Roman Kuss
Roman
© EXPA, PRIVAT, MATEUSZ KIELPINSKI FIS
In den Top Five: Die Neo-Österreicherin Avital Carroll, hier beim Weltcup im französischen Alp d’Huez im Dezember 2022, gehört zur Weltspitze.
Das geniale Frühstück





einfachgesagt:
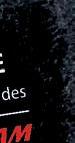









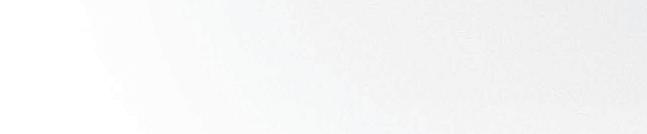
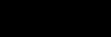
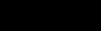
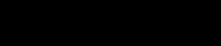
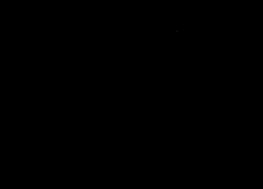
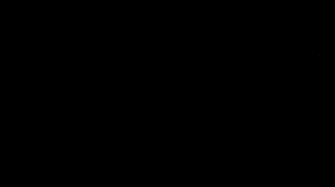

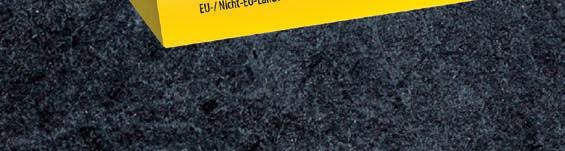






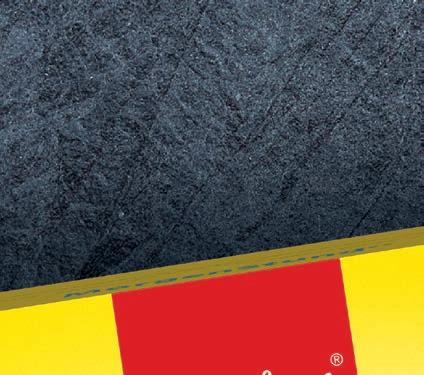


basisch vegan Kohlenhydrate ohne Zuckerzusatz Eiweiß glutenfrei Ballaststoffe laktosefrei p-jentschura.com/ska18 Kostenlose Probe anfordern: dessert brot Brei smoothie gebäck vielseitig · gesund · lecker 2021
Wie wird bewertet?
60 % Technik
20 % Sprünge



20 % Geschwindigkeit



Avital Carroll, geboren und aufgewachsen in New York, wohnhaft in Utah, ist eine österreichisch-amerikanische FreestyleSkifahrerin.
Ihren ersten internationalen Erfolg in Moguls erlangte sie als Amerikanerin mit Platz drei bei der Ski Freestyle Junioren-WM 2015. Ihr Weltcupdebüt feierte sie 2018. Seit 2022 startet Carroll für Österreich.


Buckelpiste oder Moguls
Die Buckelpiste, auch Moguls genannt, ist eine FreestyleDisziplin. Es wird zwischen zwei Bewerben unterschieden.


Bei Moguls müssen die Athleten einen rund 250 Meter langen und zwischen 28 bis 32 Grad steilen, mit Buckeln präparierten Hang möglichst schnell und technisch sauber abfahren und dabei zwei Sprünge bewältigen. In der Bewertung zählen die Technik (60 Prozent) sowie die Sprünge und Geschwindigkeit (jeweils 20 Prozent). Bei Dual Moguls treten Athleten Kopf an Kopf gegeneinander an.
sind mitunter erfolgreiche heimische Athleten, Vorbilder. Eine, die eine solche Rolle künftig einnehmen könnte, ist die gebürtige New Yorkerin Avital Carroll. Carroll ist Enkelin einer in Wien geborenen Jüdin, die als Jugendliche im Nationalsozialismus nach Amerika geflohen ist. Dank eines relativ neuen Gesetzes, das Nachkommen von NS-Opfern den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft erleichtert, ist sie seit 2021 Österreicherin. „Meine Großeltern haben mir von den schlimmen Dingen erzählt, die sie erlebt haben“, sagt Carroll. „Ich möchte als amerikanische Österreicherin und Jüdin den Sport als Plattform nutzen, um die Erinnerung an das Grauen während des Nazi-Regimes wachzuhalten, und einen Beitrag für eine bessere Welt leisten.“
Carroll, die von 2018 bis 2022 für das US-Team im Weltcup fuhr, lebt seit einigen Jahren in Utah, wo sie perfekte
Trainingsbedingungen vorfindet. Ihre Teamkollegen reagierten im ersten Moment verwirrt und geschockt, als sie von Carrolls Nationenwechsel hörten, „aber als sie von meinen Gründen erfuhren, waren sie sehr unterstützend. Auch meine Trainer“, meint Carroll. In Österreich sei sie indes mit offenen Armen begrüßt worden.
Chance für beide Seiten
Avital sei aktiv auf sie zugekommen, erzählt Roman Kuss, „wir kaufen keine Athleten von außen ein“. Vielmehr sei es als Win-win-Situation zu sehen. Avital, die in den Top Fünf im Weltcup und damit auf einem Level wie niemand sonst in Österreich fahre, könne ein Zugpferd werden. Ihre Geschichte berühre, außerdem sprechen ihre Ergebnisse für sich. Für sie gel-
42 Wie plant man Erfolg?
© ALES SPAN, MATEUSZ KIELPINSKI FIS
Königsdisziplin Buckelpiste: Die Sportart verlangt perfekte Skifahrtechnik und akrobatisches Können.
ten die gleichen Spielregeln wie für alle anderen Athleten, die für Österreich starten, betont Kuss: Bei bestimmten Leistungen gibt es eine finanzielle Unterstützung. Mehr nicht. Zumindest noch nicht. Denn ob der Support in Zukunft mehr wird, hänge von der Entwicklung des Sports ab.
„Es gibt keinen Masterplan, um eine Sportart erfolgreich aufzubauen“, weiß Kuss. Was es aber definitiv braucht, sei Zeit. Schätzungsweise acht Jahre. So lange hätte er für den Aufbau der Sparte Freeski im ÖSV gebraucht, für die er verantwortlich war und ist. Von dieser Erfahrung könne man nun profitieren. „Wir haben keine ausgebildeten Trainer, keine Infrastruktur und wir sind weit davon entfernt, einen internationalen Bewerb auf nationalem Boden durchführen zu können“, gibt Roman Kuss ehrlich zu. „Wir haben aber eine Melanie Meilinger und eine Avital Carroll sowie die Rückendeckung vom Verband.“
Sowohl Kuss als auch Meilinger haben die Vision, bis 2027 junge Menschen für die Sportart begeistern zu können, sodass Österreich mit einem jungen Team bei der WM in Vorarlberg vertreten und später auch international vorne dabei ist – so wie es heute schon die NeoÖsterreicherin Avital Carroll macht.
FRAGEN AN


Was ist das Faszinierende an der Buckelpiste?
Avital Carroll: Ich mag den Nervenkitzel und den Adrenalinkick dabei. Ich liebe es, so schnell die Piste runterzufahren. Das ist gleichzeitig auch beängstigend, aber danach fühle ich mich vollkommen. Das Buckelpistenfahren ist so vielseitig – die Kombination aus skifahrerischem und akrobatischem Können macht den Sport so speziell. Ein kleinster Fehler kann einen in der Bewertung weit zurückwerfen.
Was bedeutet es dir, für Österreich zu starten?


Es ist für mich eine Ehre und einmalige Gelegenheit, für die ich sehr dankbar bin. Österreich ist DIE Skination und beheimatet viele der besten Fahrer der Welt. Gleichzeitig möchte ich damit die Chance ergreifen, auf die Geschichte meiner jüdischen Familie aufmerksam zu machen. Ich möchte, dass die Welt davon erfährt, was im Nationalsozialismus passiert ist, und ein stückweit dazu beitragen, dass die Zukunft besser wird.
3 3 Avital Carroll
Was hast du dir in sportlicher Hinsicht vorgenommen?
Heuer möchte ich im Weltcup unbedingt aufs Podium. Längerfristig möchte ich dann eine Olympiamedaille für Österreich holen und auch bei der Freestyle-, Freeski- und Snowboard-WM 2027 unter die Top-3 fahren.

43
„Ich mag den Nervenkitzel und den Adrenalinkick.“
Avital Carroll
SCHWEIZ
Wie haben das die Schweizer geschafft?
Die Schweiz gilt als DIE Freestyle-Nation. Bereits Mitte der 1990er-Jahre wurden die klassischen Freestyle-Disziplinen, die damals in einem eigenen Verband vertreten waren, in den Schweizer Skiverband integriert. Wir haben bei Christoph Perreten, Chef Freestyle, Freeski und Snowboard Freestyle von Swiss-Ski, nachgefragt, was ausschlaggebend für den erfolgreichen Aufbau der Freestyle-Sparte war.
Blick über den Tellerrand

Spezialisten in Schlüsselpositionen: Es sei wichtig, interessante Leute aus der Szene bei Aufbau und Entwicklung der Verbandsstrukturen miteinzubinden und ihnen Gestaltungsfreiheiten zu lassen. Mit diesen Opinion Leadern, die Sport und Community kennen, werde auch der Verband glaubwürdiger.

gestellt, um die Athleten in ihren Ausgaben zu entlasten. So möchte man sicherstellen, Talente nicht aus finanziellen Gründen zu verlieren.

Vorbilder, auch auf regionaler Ebene: Local Heroes können einen Sogeffekt in der Nachwuchsarbeit bewirken. Es sei entscheidend, jungen Leuten Perspektiven und Karrieremöglichkeiten zu zeigen. In der Schweiz gebe es regional große Unterschiede, so sei zum Beispiel die Buckelpiste vor allem in der italienischen Schweiz beliebt und verbreitet, dank erfolgreicher Athleten.
Ganzjahresangebote: Unverzichtbar in der Nachwuchsförderung seien Ganzjahresangebote in der Sportart, um Kinder überhaupt dafür begeistern und halten zu können.
Herzblut: Ausschlaggebend sei auch, viel Herzblut in die Sportart zu stecken. Die Spezialisten aus dem Sport bräuchten nicht nur das Know-how, sondern auch die Bereitschaft, einen langen Weg mit den Athleten zu gehen.
Finanzielle Unterstützung: Allen Sportarten, die Swiss-Ski fördert, werden Mittel zur Verfügung
Kooperation: Letztendlich helfe es auch, mit anderen Verbänden zu kooperieren. Vom Austausch könnten beide Seiten profitieren.
44 Wie plant man Erfolg?
DIE ZUKUNFT BRAUCHT EIN STARKES WIR.




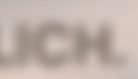

WIR MACHT’S MÖGLICH.


Ein starkes Wir kann mehr bewegen als ein Du oder Ich alleine. Es ist die Kraft der Gemeinschaft, die uns den Mut gibt, neue Wege zu gehen, die uns beflügelt und die uns hilft, Berge zu versetzen. Daran glauben wir seit mehr als 160 Jahren und das ist, was wir meinen, wenn wir sagen: WIR macht’s möglich.





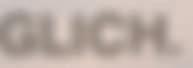


















raiffeisen.at



























Hintergrund Die Dreharbeiten zu „Stams“ fanden von April 2019 bis Juli 2021 statt. Eine Grundvoraussetzung der Regie und Produktion war es, den Dokumentarfilm in völliger Unabhängigkeit von jeglichem Einfluss der Schulleitung herzustellen, was dem Team auf ganzer Linie erfüllt wurde.
Ein Ort voller Hoffnungen und Rückschläge
Am 16. Februar feierte „Stams“ –Österreichs Kaderschmiede“ bei der Berlinale seine Weltpremiere. Ganz nah und mit großer Empathie folgt dieser Film, der ab 3. März in den heimischen Kinos läuft, den Jugendlichen durch die Höhen und Tiefen eines Schuljahres und zeigt, was es bedeutet, sich in jungen Jahren für eine Sportkarriere zu entscheiden.

Text: Bernhard Foidl & Presseheft Panama Film KG
Ich wollte keinen klassischen Sportfilm machen, nicht das klassische Helden-Narrativ bedienen, sondern mit einem genauen und empathischen Blick den Alltag der heranwachsenden Jugendlichen beschreiben.“ Diese Aussage von Regisseur Bernhard Braunstein
(siehe auch Interview nächste Seite) bringt auf den Punkt, was mit dem Film erreicht werden soll: ein authentischer Blick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Skiinternate der Welt.
Das Schigymnasium Stams gilt als DIE Wintersport-Kaderschmiede des Alpenraums – bis heute. Allein der aktuelle alpine Nationalkader des ÖSV besteht zu rund einem Drittel aus Stams-Schülern. Beim Blick auf die Ehrentafel könnte so mancher Neuankömmling in Ehrfurcht erstarren. 48 Olympiamedaillen gehen auf das Konto von Stams-Absolventen. Benjamin Raich, Stephan Eberharter, Marlies Schild, Toni Innauer, Gregor Schlierenzauer, Johannes Lamparter oder Sara Marita Kramer – das ist nur ein kleiner Auszug aus einer Namensliste von Ausnahmesportlern, die hier einst die Schulbank drückten.

Aber, wie gesagt, es geht in diesem Film nicht darum, die Historie von Stams zu huldigen.
„Uns war der Zugang eines sportaffinen Künstlers wichtig, der unsere Schülerinnen und Schüler im Alltag erlebt und mit all ihren Freuden und Nöten wahrnimmt“, so Direktor Arno Staudacher. Ob er mit dem Ergebnis zufrieden sei? „Ja, auch wenn mir manche Sequenzen nicht gefallen haben“, bezieht sich der Schulleiter vor allem auf jene Bildausschnit-
„Uns war es wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler mit all ihren Freuden und Nöten im Alltag zu zeigen.“
Arno Staudacher, Direktor

Kinofilm „Stams“ 46
© PANAMAFILM, SCHIGYMNASIUM STAMS
STIMMEN
Gewinnspiel
Wir verlosen
10 x 2 Kinokarten
(in Kinos der jeweiligen Landeshauptstädte)
der Protagonisten:
„Ich glaube, dass ich ohne Skisport nicht ich selbst wäre.“
Sophia Waldauf, Skifahrerin

„Es ist immer schwer, abzuwägen. Ist es wichtiger, dass ich den Schwung besser fahre oder dass ich gesund bleibe.“
Lisa-Marie Fuchs, Skifahrerin
„Ich werde nach sechs Fahrten nicht in den Beinen müde, sondern im Kopf.“
Pascal Mair, Skifahrer
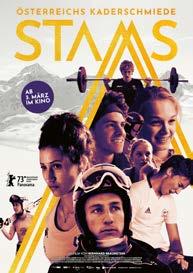
„Letztendlich, am Schulende, ist es wichtig für mich, dass ihr in den Spiegel schauen könnt und sagt: ‚Ich habe alles probiert.‘“
Ein Trainer

te von jungen Athleten auf Krücken. Und fügt hinzu: „Aber wir wollten einen kritischen Blick von außen – und beim Thema Verletzungen hat der alpine Skirennsport ein großes Problem, das ist die Realität.“
Träume verwirklichen
Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms steht die unverfälschte Betrachtung des penibel getakteten Alltags aus Training, Unterricht, Freizeit und Internatsleben. Mit enormer Disziplin und eisernem Willen bringen sich die Jugendlichen immer wieder an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Wer hier herkommt, tut dies nicht aus bloßer Liebe zum Sport – sondern um zu den Besten zu gehören, um seine Träume zu verwirklichen, mit dem Bewusstsein, dass es am Ende nur ein bis zwei Prozent aller Schüler schaffen, sich im Spitzensport durchzusetzen.
Trotz der sportlichen Konkurrenz verbinden die jungen Sportler enge Freundschaften, die sie zu einer Art Schicksalsgemeinschaft werden lassen.
Bitte einfach den QR-Code scannen, für den Ski-Austria-Newsletter anmelden sowie deinen Namen, E-Mail-Adresse und die gewünschte Landeshauptstadt angeben. Alle Gewinner werden per E-Mail verständigt.
In den gemeinsamen Momenten zwischen Training, Schule und Wettkampf motivieren sie sich gegenseitig, spenden einander Trost und lachen über Erlebtes. Das Innenleben der jungen Athleten wird durch einen klaren Fokus auf die Körper und durch eine genaue Beobachtung von Gesichtern und Mimik sichtbar gemacht. „Bin ich mein Körper oder habe ich einen Körper, kann man Geist und Körper trennen?“ Diese Frage des Philosophielehrers in einer Unterrichtsstunde zieht sich als einer der vielen Fäden durch den 97 Minuten langen, bildgewaltigen Film. Prädikat: sehenswert!

Über das Schigymnasium Stams
Im Jahre 1967 gegründet, zählt das Schigymnasium Stams (Tirol) weltweit zu den ältesten und erfolgreichsten Internatsschulen für Wintersport. Die Ausbildung erfolgt in den Sparten Ski Alpin, Sprunglauf, Langlauf/Biathlon, Nordische Kombination und Snowboard. Das Schigymnasium sieht ein duales Ausbildungskonzept vor, um schulische Leistungen mit der sportlichen Entwicklung zu verbinden. Die Ausbildungsdauer beträgt, aufgrund der zeitintensiven sportlichen Ausbildung, in der Regel fünf Jahre und wird mit einer Reifeprüfung abgeschlossen.
47
Über das Ausloten von Grenzen
Braunstein, Regisseur des Films


Auszüge aus einem Interview mit Karin Schiefer (Dezember 2022)
Was hat Ihr persönliches Interesse für diese Schule erweckt?

Ich war als Kind ein leidenschaftlicher Skifahrer und wir haben in der Familie immer die Skirennen im Fernsehen verfolgt. Ich fand es sehr reizvoll, dorthin zu schauen, wo junge Menschen versuchen, den Traum von einer erfolgreichen Skisportkarriere zu leben.

Lässt sich eine „Kaderschmiede“ gerne über die Schulter blicken?
Man ist uns seitens des Schigymnasiums Stams mit erstaunlicher Offenheit entgegengekommen, uns tiefe Einblicke zu gewähren. Ich habe von Beginn an klargestellt, dass ich keinen Werbefilm machen würde, sondern so unvoreingenommen wie möglich beobachte, um zu zeigen mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben und welche Freuden sie erleben. Es ging mir um die Licht- und Schattenseiten dieser speziellen Schullaufbahn.
Welche Idee steht hinter dem starken Fokus auf den Gesichtern und Individualitäten?
Der Ansatz, mit Zeit und Ruhe sehr genau auf Gesichter, Mimik und Körpersprache zu schauen, steht für die Absicht, Innenleben sichtbar zu machen. Im Idealfall erkennt man im Gesicht und in der Körpersprache, wie es dem Menschen im Moment, in dem er oder sie gefilmt wird, geht. Ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob mir jemand erzählt, wie es ihm oder ihr in einer bestimmten Situation ergangen ist, oder ob ich es unmittelbar beobachten kann und somit direkt erlebe. Ich bin überzeugt, dass die Wirkung des Films dadurch intensiver ist.

Die Schule bietet einen sehr ambivalenten Rahmen, nämlich den, in einem Miteinander zu einem Jeder-für-sich und letztlich auch zu einem Gegeneinander heranzubilden. Das Spannungsfeld Individuum/Gemeinschaft, die Tatsache, dass man in einer Gruppe, einer Schicksalsgemeinschaft lebt und gleichzeitig in Konkurrenz zueinander steht, hat mich als Thema sehr interessiert. Ich habe in meinen Beobachtungen bemerkt, dass es relativ viel Solidarität und gar nicht so viel Konkurrenz gibt, wie man es an so einer Schule erwarten würde.
Das Thema Verletzung scheint sehr präsent. Wie haben Sie den Umgang mit der Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper wahrgenommen?

Für mich war es schockierend zu erleben, wie schwer und mit welcher Häufigkeit sich diese jungen Menschen verletzen. So ist die ein wesentliches Thema meiner Erzählung geworden. Die Selbstverständlichkeit, mit der der Umstand Verletzung hingenommen wird, hat mich sehr irritiert.
Hat Ihnen die Arbeit an „Stams“ auch überraschende Erkenntnisse gebracht?
Die Kameradschaft und Solidarität hat mich überrascht, auch die Sensibilität, Klugheit und Fähigkeit zur Selbstreflexion vieler Athletinnen und Athleten. Das Klischee der engstirnigen Hochleistungssportler kann der Film bestimmt widerlegen. „Stams“ wirft eine sehr allgemeine Frage nach dem Prinzip Leistung und den vielfältigen Konsequenzen auf. Eine Frage, die mich auch abseits des Leistungssports interessiert.
48 © MARTIN HASENÖHRL
„Stams – Österreichs Kaderschmiede“, über tiefe Einblicke, die Bedeutung von Mimik und Körpersprache sowie die vielfältigen Konsequenzen des Leistungsprinzips.
Bernhard Braunstein INTERVIEW
Kinofilm „Stams“
Vorbilder sind die besten Wegweiser.




















































gemeinsam besser leben uniqa.at Werbung
UNDER PRESSURE
Profisportler stehen unter enormem Erfolgsdruck. Den bekommt schon die Jugend zu spüren. Ob das für den Sport und die (angehenden) Athleten gut ist und ob es der beste Weg zum Erfolg ist, darüber haben wir mit vier Experten gesprochen.
Die Experten
Rainer Stöphasius
Sportlicher Leiter und Koordinator am Skigymnasium Saalfelden. Der Sport- und Französischlehrer ist in seiner Position Schnittstelle zwischen Lehrern, Verwaltung, Trainern und Schülern.
Joseph Jenewein
Seit 24 Jahren
Referent und Trainer für Sprunglauf und Nordische Kombination beim Kitzbüheler Ski Club, war auch zehn Jahre beim Tiroler Skiverband als Trainer tätig.


Alex Stöckl
Ehemaliger Trainer des Schigymnasium Stams und seit 2011
Cheftrainer der norwegischen SkisprungNationalmannschaft.
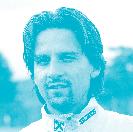

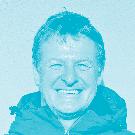
Patrick Bernatzky
Fachbereich Sportund Bewegungswissenschaft Universität Salzburg und Geschäftsführer des Österreichischen Bundesnetzwerks Sportpsychologie (ÖBS).
50
© XXXXX
Text: Haris Kovacevic
© SCHIGYMNASIUM SAALFELDEN, GEPA Geht es im Kindersport zu ernst zu?
60-Stunden-Wochen
In den Schulwochen im Herbst erleben Schüler an Skischwerpunktschulen einen Peak an Anstrengung: Unterricht steht jeden Tag einschließlich Samstag auf dem Programm, nachmittags Trainings und abends Lernzeiten. „Da kommen dann um die 60 Wochenstunden an Belastung zusammen“, erklärt Rainer Stöphasius, sportlicher Leiter am Schigymnasium Saalfelden.
Bernatzky:
„Es gibt da unterschiedliche Philosophien im Sport. Eine besagt, dass Sport im Jugendalter immer nur Spaß machen soll, die andere, dass Kinder auch lernen müssen, den Wettbewerb zu schätzen. Meiner Meinung nach ist eine Portion Wettkampffreude notwendig, damit die Motivation aufrechterhalten bleibt.“
Stöphasius:
Stöckl:
„Von zentraler Bedeutung ist meiner Meinung nach die Vielseitigkeit – es wird in Österreich massiv unterschätzt, wie wichtig es ist, in verschiedenen Sportarten tätig zu sein, damit man in jener, die man professionell betreiben möchte, auch wirklich gut wird.“
„Talent fördert man am besten, indem man den Druck aus der Sache nimmt. Neben den Wettbewerben haben Kinder noch unzählige andere Sachen um die Ohren. Oft ist es so, dass sich nur Schüler, die wenig oder keinen schulischen Druck verspüren, auf den Sport und die Wettkämpfe konzentrieren können. Wettbewerb gehört dazu, eine altersgerechte Entwicklung braucht aber Zeit und Geduld – das wird oft vergessen.“
Behauptung eins:
Materialschlacht
Schon ein U14-Skialpinist, der bei Bezirks- und Landesrennen teilnimmt, braucht
Minimum vier Paar Ski und ein Paar Super-G-Ski – die Kosten dafür werden immer größer. Ist man in einem Kader, bekommt man Hilfe von Sponsoren oder günstigeres Material. Aus privater Hand ist es aber immer schwerer finanzierbar.
Talent fördert man am besten durch Wettbewerb!
Jenewein:
„Meiner Meinung nach ist dieser Weg nicht mehr zeitgemäß. Bei Kindern und Schülern muss der Drang, in der Sportart besser werden zu wollen, im Vordergrund stehen, weil sie vom Fliegen oder Carven begeistert sind, nicht weil ihr Pokalschrank wächst. Wettbewerbe sind wichtig, ja, aber erst ab einem Alter von etwa 14.“
51
»
Geht es im Kindersport zu ernst zu?
Ernst im Hintergrund Wer glaubt, dass es in Seppi Jeneweins Schulung nur spaßig zugeht, täuscht sich: Wöchentliche SymmetrienChecks mit Videokameras, Function-MovementScreens, die in der NFL üblich sind, Messplattentraining, um den richtigen Schwerpunkt von Anfang an zu erlernen, und vieles mehr. „Wir versuchen unsere Kinder, wo und wie es nur geht, zu fördern, aber nicht um Schülerweltmeister zu werden, sondern wir geben ihnen eine Topgrundausbildung auf ihrem Weg mit –und nehmen das sehr ernst. Den Spaß dürfen sie dabei aber nie verlieren.“
Stöckl:
„Druck muss natürlich schon dabei sein und einigen tut der gut. Anderen würde es vielleicht helfen, länger abzuwarten mit den Wettkämpfen.“
Behauptung zwei: Druck
ist
Jenewein:
„Dass sie ihr Hobby zum Beruf machen, will ich ja. Erhöht man den Druck aber zu früh, lässt sie voreilig von zu großen Schanzen springen oder reizt das Material für den kurzfristigen Erfolg aus, ruiniert man eine potenziell glanzvolle Karriere.
Der Druck bedingt nicht späteren Erfolg, er verhindert ihn eher.“
zwar da, aber dafür machen sie ihr Hobby zum Beruf!
Bernatzky:
„Man muss den Druck nicht vom Spaß trennen und nicht das eine gegen das andere ausspielen. Gefallen an Herausforderungen lässt sich dann finden, wenn es mit unserem Grundbestreben im Einklang steht.“
Stöphasius:
„Der Druck ist bereits massiv, noch bevor sie das Hobby zum Beruf machen. Wenn man sich überlegt, wie viele Arbeitsstunden die 14- bis 18-Jährigen in der Woche haben, wie viele Ansprüche an das Material gestellt werden, ist das schon enorm.“
52
Stöphasius:
„Dabei sollte man Erfolg an sich definieren. Bei aller Liebe zum Gewinnen und bei allem Verständnis für den Druck darf der Mensch nicht in den Hintergrund geraten.“
Nor-Way
Sport ist ein zentraler Bestandteil des norwegischen Schulund Erziehungssystems. Wichtig dabei sind: viel(seitige)
Bewegung, kostengünstige Angebote, bis zum etwa 13. Lebensjahr kein Wettbewerbsdruck. Bei 5,6 Millionen Einwohnern kann Norwegens Sportwelt mit beeindruckenden Leistungen in Fußball, Nordischer Kombination, Handball, Biathlon, Leichtathletik und Schach aufwarten.
Ernst der Lage
Einige Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, mussten sich in der Vergangenheit Kritik gefallen lassen, da Depressionen oder psychische Belastungen bei Spielern verschwiegen oder nicht ernst genommen wurden. Der Mentalcoach Patrick Bernatzky erklärt: „Das ist nicht nur ein Thema des Spitzensports, sondern allgemein. Psychische Gesundheit ist ein wichtiger Faktor im Spitzensport sowohl für den Athleten als auch für den Menschen selbst.“
Behauptung drei:
Nur der Erfolg zählt – auf den kommt es an, er ist der Gradmesser.
Stöckl:
Bernatzky:
„Der Erfolg ist natürlich zentral. Den erreicht man, wenn man gut trainiert ist, aber auch nur dann, wenn man sich in einem gewissen emotionalen Gleichgewicht befindet.“
„Erfolg ist ein guter und wichtiger Gradmesser im Sport. Das heißt aber nicht, dass ihm alles unterstellt werden sollte. Er ist nur ein Teil der ganzheitlichen persönlichen Entwicklung, die man als Trainer verantwortungsbewusst verwalten sollte.“
Jenewein:
„Was ist Erfolg? Für mich ist es mittlerweile kein Erfolg mehr, die Vereinswertung zu gewinnen oder noch einen Schülermeister mehr zu haben. Erfolg ist für mich ein 15-Jähriger, der sich für eine Karriere im Spitzensport entscheidet und den Weg von sich aus begeistert geht und dann seine Leidenschaft zum Beruf machen kann.“
53
ERFOLGREICH
AUCHIMZWEITENLEBEN
Reinfried Herbst hatte schon früh Pläne für seine Karriere nach dem Profisport. Der Salzburger ist ausgebildeter Polizist und leidenschaftlicher Koi-KarpfenZüchter.

54 Zweite Karriere
©
GEPA/Jasmin Walter, Event Corner
ass er ein zweites Standbein braucht, das sei Reinfried Herbst von Anfang an klar gewesen. Der Skirennläufer hat 2016 seine Karriere im Profisport beendet, was er danach machen wollte, wusste er aber schon viel früher. „Schon am Beginn der Karriere können schwere Verletzungen auftreten, da kann von einem Tag auf den anderen alles anders ausschauen“, erklärt er seine Überlegungen. „Ich hatte immer Augen für andere Tätigkeiten, nicht nur den Tunnelblick: Sport, Sport, Sport. Es ist zwar schön, wenn es aufgeht, aber das ist oft ein naives Denken von Sportlern.“
Training und Ausbildung vereinen
Herbst hat daher direkt nach dem Bundesheer eine Ausbildung beim Zoll begonnen. Da fuhr er noch im Europacup. Zweimal saß er je für ein paar Monate in Kursen in Wien. Mit dem Training ließ sich das nur schwer vereinbaren. „Das war anstrengend, ich habe das aber, wie sonst auch das Training, knallhart durchgezogen. Ich wollte unbedingt einen Plan B“, so Herbst. Später hat er dann noch eine Ausbildung zum Polizisten absolviert.
Um die schwierige Vereinbarkeit von Training und Ausbildung weiß auch Nik Berger, der ehemalige Volleyballprofi ist Geschäftsführer des Vereins KADA - Sport mit Perspektive. „Nach der aktiven Zeit als Sportler zu schauen, was man machen will, ist ein bisschen spät. Wir setzen hier schon viel früher an“, erklärt Berger.
Reinfried Herbst gewann bei den Olympischen Winterspielen 2006 die Silbermedaille und in der Saison 2009/10 den Slalomweltcup. Nach neun Einzelweltcupsiegen und 18 Podestplätzen im Skiweltcup beendete der ausgebildete Zollwachbeamte und Polizist 2016 seine aktive Karriere als Sportler.

55
Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Disziplin – Profisportler können nach ihrer aktiven Zeit von vielen ihrer Fähigkeiten profitieren. Trotzdem kann der Start in die zweite Karriere gerade ohne Vorbereitungen holprig werden. Damit das nicht passiert, gibt es mittlerweile einige Angebote.
Text: Anna Kirchgatterer
„Ich hatte immer Augen für andere Tätigkeiten, nicht nur den Tunnelblick: Sport, Sport, Sport.“
Reinfried Herbst, Ex-Skirennläufer
Teilnehmer hat das SparTrainee-Programm für ÖSV-Athleten.
„Jeder Athlet nimmt Zielstrebigkeit mit:
Ich habe ein Ziel und weiß, dass ich dafür arbeiten muss; da kann ich nicht Solitaire spielen, wenn der Chef nicht hinschaut.“
Nik Berger, Verein KADA

Denn viele österreichische Athleten haben nach ihrer Zeit im Spitzensport mangels Ausbildung Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Nur die wenigsten haben finanziell ausgesorgt. Gleichzeitig steigen viele Talente schon nach der Schulzeit aus dem Leistungssport aus, weil sie dort keine Erwerbsmöglichkeiten sehen. Beides will KADA verhindern. Berger schildert, wie: „Wir klären bereits die Schüler in den Nachwuchskompetenzzentren und Spezialschulen zu Bildungsmöglichkeiten auf, die sich mit Leistungssport vereinbaren lassen, und fragen: Wisst ihr schon, was ihr machen wollt? Wenn nicht, kommt zu uns.“ Auch mit Leistungssportlern beim Bundesheer tritt der Verein, im Rahmen der Grundwehrdienstausbildung, in Kontakt. Durch die Berufsförderung im Bundesheer könne man diverse Bildungswege aufzeigen.

Gewinn für die Firmen
ÖSV-Athleten betreut der Verein KADA derzeit.
Eine dieser Möglichkeiten speziell für ÖSV-Athleten ist ein Trainee-Programm bei Spar. Elf Plätze gibt es alle zwei Jahre für motivierte Sportler. Sie können so Einblicke in verschiedenste Bereiche des Handels sammeln. Dabei sind Präsenz- und Trainingsphasen aufeinander abgestimmt. Viele Kurse sind online und können absolviert werden, wann es am besten passt. „Im Winter sind die Athleten im Training und nehmen an Wettkämpfen teil. Im Frühling, nach der Rennsaison, finden unsere Präsenzwochen statt“, erklärt Beatrix Marvan, Head of Employer Branding bei Spar. Absolventen beenden das Traineeprogramm als Fachverkäufer. Im Anschluss kann ein Aufbaulehrgang absolviert werden. Dabei spezialisieren sich die Sportler und können ihr Wissen in bestimmten Bereichen noch weiter vertiefen.
Mit dem Programm wolle man jungen Athleten eine Chance geben, Praxiserfahrung in der Arbeitswelt zu sammeln. Zudem seien Spitzensportler für Unternehmen sehr interessant, so Marvan. „Das sind Menschen, die engagiert sind, die ehrgeizig sind,
Die großen Förderer des Sports Nicht nur die Polizei (BMI) unterstützt junge Spitzensportler beim Aufbau einer zweiten Karriere. Auch das Österreichische Bundesheer und das Bundesministerium für Finanzen (BMF) gelten als große Förderer des heimischen Leistungssports – so können Heeresleistungssportler und Zollsportler professionell trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, während ihnen parallel dazu eine wertvolle Berufsausbildung in der Zollverwaltung bzw. beim Bundesheer ermöglicht wird.
Seit vielen Jahrzehnten legen Bundesheer, Polizei und BMF mit ihrer großartigen Unterstützung die soziale sowie finanzielle Basis für sportliche und berufliche Karrieren von ÖSV-Kaderathleten.
die eine Power haben, die etwas mitbringen aus dem Sport, das für Unternehmen spannend sein kann.“
Das sieht Berger ähnlich. Man lerne im Sport, sich zu organisieren und Ergebnisse zu liefern, Sportler hätten eine hohe Konzentrationsfähigkeit, Teamgeist und Sitzfleisch, führt der KADA-Geschäftsführer aus: „Jeder Athlet nimmt Zielstrebigkeit mit: Ich habe ein
56 Zweite Karriere
56 11
©
SARA BUBNA photography, GEPA, Thomas Kaserer, Shutterstock.com/vipfl ash, Shutterstock.com/Sharomka, JvM SPORTS
Der Verein KADA









begleitet Leistungssportler dabei, sich eine berufliche Perspektive außerhalb des Spitzensports aufzubauen. Laufbahnberater helfen bei der Wahl einer passenden Ausbildung und unterstützen die Abstimmung von Trainings-, Wettkampf- und Ausbildungsplänen. Außerdem bietet der Verein eigene Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung und ist gerade dabei, einen Pool von Unternehmen aufzubauen, die bereit sind, auf die Bedürfnisse von Spitzensportlern einzugehen. Aktuell werden rund 500 Talente aus allen möglichen Sportarten betreut, 56 davon












Im zweiten Leben erfolgreich
Viele Spitzensportler sind auch nach ihrer Karriere auf Piste oder Sportplatz weiterhin sehr aktiv. Manche gründen Unternehmen, andere gehen in die Politik.

Hier ein paar Beispiele:


Armin Assinger –das in Österreich wohl berühmteste Beispiel für eine erfolgreiche Karriere nach dem Sport. Der Ex-Skirennläufer und nunmehrige Millionenshow-Moderator hat übrigens auch eine Ausbildung bei der Gendarmerie hinter sich.


Bud Spencer – alias Carlo Pedersoli – der beliebte Actionschauspieler („Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“, „Vier Fäuste für ein Halleluja“) war im ersten Leben Profischwimmer und zweimal bei den Olympischen Spielen dabei, nämlich 1952 und 1956.

Katja Kraus – die ehemalige deutsche Fußballerin ist Geschäftsführerin der Sportmarketingagentur Jung von Matt SPORTS und Autorin mehrerer Sachbücher.
DEIN BIO-TEE, DEIN TAG!






























Jung, frech und so köstlich – das sind unsere Bio-Tees TEEKANNE ORGANICS ® . Alle Zutaten stammen ausschließlich aus Anbauten, an denen die Tees, Früchte und Kräuter auf ganz natürliche Weise wachsen und gedeihen – und das schmeckt man! Was hinter dem schicken Design auf der Faltschachtel steckt, ist FSC-Papier, das getreu des Forest Stewardship Councils ® umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt wurde. Bei unseren Tees stimmen sowohl die inneren als auch die äußeren Werte.


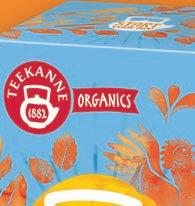



Die Teekanne macht den Tee. Nachhaltig.
 Vitali Klitschko –Bürgermeister von Kiew.
Vitali Klitschko –Bürgermeister von Kiew.
teekanne.at
3 Fragen an …
ANNA JUPPE
Die Biathletin und Olympiateilnehmerin (Peking 2022) studiert neben ihrer Sportkarriere Ingenieurswissenschaften. Gerade schreibt Juppe, die ihre sportliche Karriere als Langläuferin gestartet hat, an ihrer Bachelorarbeit.
Ski Austria:
Wieso hast du dich dafür entschieden, neben der Sportkarriere ein Studium anzufangen?
Ich wollte eigentlich immer schon studieren und neben dem Spitzensport noch einen Ausgleich haben. Es geht bei mir ja den ganzen Tag um den Sport, das Studium ist da ein bisschen eine Ablenkung für den Kopf und ein schönes Hobby.
Studium und Biathlon – wie bekommt man das unter einen Hut?

Ich habe direkt nach der Matura zu studieren begonnen. Da war ich noch im Langlauf und hatte mehr Zeit, da ja das Schießtraining nicht absolviert werden muss. Grundsätzlich habe ich mir das Studium immer so eingeteilt, dass nie viel zu tun war. Maximal einmal in der Woche geht es für mich an die Uni. Und Corona hat mir da noch mal in die Karten gespielt, weil viele Kurse online waren, da ist dann alles noch ein bisschen flexibler.
Jetzt hast du bald den Bachelorabschluss in der Tasche, willst du dann weiter studieren?
Jetzt ist mal das Wichtigste, dass ich mit dem Bachelor fertig werde. Ich hätte echt nie damit gerechnet, dass ich das während meiner Sportkarriere schaffe. Und dann mache ich mal eine Pause. Aber ich schätze, dass mir spätestens nach zwei Monaten schon wieder so langweilig ist, dass ich einen Master auch noch machen werde. Der Spitzensport hat dennoch immer oberste Priorität.
Ziel und weiß, dass ich dafür arbeiten muss; da kann ich nicht Solitaire spielen, wenn der Chef nicht hinschaut.“
Neue Ziele
Diese Zielstrebigkeit bringe einen auch bei der Polizei weiter, so Herbst. Für den Sportler war die Umstellung vom Profiskirennläufer zum „normalen“ Beruf unproblematisch. „Ich bin nicht in dieses berühmte Loch gefallen, ich hatte zwei Kinder, eine Familie, da sieht man schon etwas anderes als nur den Sport“, sagt Herbst. „Ich bin so lange gefahren, wie es mir Spaß gemacht hat, und in dem Moment, als ich aufgehört habe, habe ich mir neue Ziele gesucht.“
„Ich bin so lange gefahren, wie es mir Spaß gemacht hat, und in dem Moment, als ich aufgehört habe, habe ich mir neue Ziele gesucht.“
Reinfried Herbst, Ex-Skirennläufer
Mittlerweile hat der ausgebildete Polizist drei Standbeine: Als Koordinator im Innenministerium betreut er derzeit circa 80 Sportler, die bei der Polizei arbeiten. Gemeinsam mit ExTeamkollegen Manfred Pranger veranstaltet Herbst Motivations- und Bewegungsworkshops, und außerdem handelt er mit KoiKarpfen. Manchmal sei zwar alles ein bisschen stressig, aber insgesamt sei das für den Ex-Skirennläufer der richtige Weg: „Momentan bin ich absolut happy. Es ist immer schön, wenn man Dinge machen kann, die man gern macht und wo eine Leidenschaft dabei ist.“
58
© GEPA
Zweite Karriere













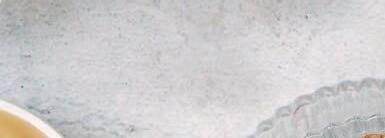





Schwungvoll zum kulinarischen Hochgenuss. Das Beste für Gastronomie & Business. Mehr auf transgourmet.at
Genussmomente voller Glück.
Nicht nur Cornelia Hütter hatte bei ihrer Fahrt zu Abfahrtsbronze in Meribel den Durchblick. Drohnenkameras lieferten spektakuläre Bilder in die Wohnzimmer der TV-Zuseher.

60
© EXPA
LIVE LIVE IS

61
Sportübertragungen locken Millionen Österreicher und Österreicherinnen vor die TV-Geräte. Warum das so ist und wie wir Livesport in Zukunft erleben könnten, erklären Experten aus TV, Wissenschaft und Sport.

Text: Denis Pscheidl
Als es dem japanischen Professor Kenjiro Takayanagi am 17. Feber 1931 gelang, ein Baseballspiel auf dem Campus der Waseda Universität in Echtzeit zu übertragen, begann der Siegeszug der Live-Sportübertragungen. Fünf Jahre später konnten Menschen zum ersten Mal Olympische Spiele an den Bildschirmen daheim verfolgen und 1960 wurden die ersten TV-Rechte an Winterspielen vermarktet.
Seitdem hat die Fernsehwelt Quantensprünge hinter sich. Doch was erwartet uns in der Zukunft? Wie werden wir in zehn Jahren Olympische

Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und natürlich alpine Skiwettbewerbe verfolgen? Und warum ist es überhaupt so faszinierend, Sportübertragungen im Fernsehen beizuwohnen?
Die Gretchenfrage
Zuerst soll jedoch beantwortet werden, ob wir in Zukunft überhaupt noch Livesport im Fernsehen bewundern werden. Laut Martin Szerencsi, Sportrechtechef beim ORF, sind die TV-Quoten für Sportübertragungen im Free-TV in den letzten Jahren „zwar leicht zurückgegangen, aber immer noch auf einem hohen Niveau“. Die Marktanteile hingegen seien immer noch stabil. Das liege zum einen am Vormarsch der digitalen Nutzung ebenso wie sportlichen Durststrecken und begleitenden Umständen. So seien die gesunkenen Zuschauerzahlen bei Skirennen nach dem Sieg von Vincent Kriechmayr auf den verschneiten Hängen der Streif wieder deutlich über eine Million
62
„Es drängen jede Menge Anbieter von Onlineplattformen und TV-Sendern – zumeist mit Bezahlabo-Systemen –in den Markt.“
Martin Szerencsi
Live ist live © SHUTTERSTOCK.COM, ROMAN ZACH-KIESLING
geklettert. „Letztlich muss man also festhalten, dass es Live-Sportübertragungen immer noch schaffen, ein sehr großes Publikum aus allen Bevölkerungsschichten zu erreichen“, sagt Szerencsi.
Claudia Stura, Professorin für Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement an der FH Kufstein rechnet auch in Zukunft nicht mit einem Untergang der Live-Sportübertragungen. „Ich glaube, dass Sport eines der Formate ist, das langfristig bleiben wird. Sport hat immer noch eine Faszination des Echtzeiterlebnisses. Deswegen ist es auch in Zukunft nicht zu ersetzen.“

Auch Andreas Eichwalder, Koordinator Medienrechte & Videoproduktionen beim ÖSV, glaubt, dass nur die Spannung einer Liveübertragung Emotionen auslösen könne. Das Ergebnis eines Fußballspiels im Nachhinein auf Social Media zu lesen, erzeuge kein Gänsehautgefühl, auch nicht beim größten Fan.
Faszination Livesport
In diesen Emotionen liegt laut den amerikanischen Medienforschern Donald Horton und Richard Wohl der Grund für den lang anhaltenden Erfolg des medialen Sports. Durch die emotionale Teilnahme am Schicksal von Menschen werden intensive Glücksgefühle wahrgenommen, die sich kaum von den Emo-
Leichter Tourenhandschuh mit Silikonprint

Stellen Sie sich einen Handschuh vor, der sich fürs Tourengehen, Langlaufen, Radfahren, Nordic Walking und Laufen bestens eignet. Der „Touring-Grip“ aus dem Hause ESKA macht’s möglich!
Superleichtes
Softshell-Material auf der Oberhand
Mit dem Silikonprint hat man Stöcke fest im Griff.

Schon beim ersten Hineinschlüpfen wird klar, dass dieses außergewöhnliche Modell zum treuen Begleiter im Freiluftsport wird. Das winddichte Softshell-Material auf der Oberhand ist nicht nur superleicht, es sieht auch cool aus.

ALLES FEST IM GRIFF

Für besten Grip am Stock sorgt der edle Silikonprint in der Amara-Innenhand. Weil ESKA mit der Zeit geht und ihr immer wieder voraus ist, haben die Österreicher am Daumen und Zeigefinger des „Touring-Grip“ ein Touchprint angebracht. Somit können Displays bequem und zuverlässig mit angezogenem Handschuh bedient werden. Ist doch lässig, oder? Besonderes Augenmerk hat ESKA auf den Pulsbereich gelegt, der von einem enganliegenden Strickbund angenehm gewärmt wird.
DAS MULTITALENT AM MARKT
Ein Hit ist die Schlaufe am Mittelfinger, mit der die Handschuhe via Karabiner am Rucksack befestigt werden können. Zu den Features des „Touring-Grip“ zählen ebenso der abnehmbare Fangriemen und die praktische Anziehhilfe. Das Multitalent ist um 39,90 € im ausgewählten Fachhandel und im ESKAOnline-Shop erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Mehr auf www.eskagloves.com
© ESKA Entgeltliche Einschaltungen
„Ich glaube, dass Sport eines der Formate ist, das langfristig bleiben wird.“
Claudia Stura
tionen unterscheiden, die in direktem persönlichen Kontakt erlebt werden.
Stura begründet die Faszination Livesport folgendermaßen: „Bei Sportereignissen sehen wir Helden und Triumphe, Verlierer und Dramen in einem eigenen emotionalen Erlebnisrahmen.“ Für Fans einer Sportart sei es aber noch viel mehr. „Sie besitzen eine tiefe Bindung zu den Athleten oder bestimmten Teams.“ Forschungen haben laut Stura außerdem gezeigt, dass beim passiven Konsum von Sport ähnlich wie bei aktivem Sport ein Flow-Erlebnis – ein beglückendes Gefühl durch einen mentalen Zustand völliger Vertiefung – zu beobachten ist. Im Stadion komme noch eine weitere Komponente hinzu, das Gemeinschaftsgefühl. „Im Fußballstadion liegen sich wildfremde Menschen in den Armen. In der U-Bahn passiert so etwas nicht“, diese Stimmung könne man nur im Stadion erleben, so Stura.
Involvierte Zuschauer
Kamerafahrer der TV-Stationen ermöglichen den Zusehern dank HelmKameras einen Blick aus Läufer-Perspektive.
länger gibt es speziell auf die Nutzung eines zweiten Bildschirms während des laufenden Fernsehprogramms zugeschnittene Angebote. Solche Secondscreen genannten Anwendungen haben vor allem den Sinn und Zweck, den Zuschauer noch tiefer ins Geschehen zu involvieren. „Beim eSport können Fans sich in Chats über das Spielgeschehen austauschen oder sogar mit den Athleten kommunizieren“, so Stura. Sie glaubt, dass sich solche Angebote in Zukunft auf andere Sportarten ausweiten werden.
„Das Ergebnis eines Fußballspiels im Nachhinein auf Social Media zu lesen, erzeugt kein Gänsehautgefühl, auch nicht beim größten Fan.“
Andreas Eichwalder


Wenn es darum geht, Live-Sportübertragungen in Zukunft noch attraktiver zu machen, wird der Fokus darauf liegen, diese Emotionen zu intensivieren. Schon
Auch weil sich der Second-Screen perfekt dazu eignet, Sportübertragungen zu personalisieren. Bereits jetzt sammeln Fachleute und -verbände während Sportwettkämpfen Daten zur Leistung der Athleten. Diese werden häufig in die Livesendungen integriert. Zum Beispiel Geschwindigkeit beim Skifahren oder Pass- und Torschussstatistiken beim Fußball. In Zukunft sollen diese Daten laut Stura deutlich umfangreicher zur Verfügung stehen. „Athleten können in einem großen Umfang mit Sensoren, die alle möglichen Bewegungsdaten aufzeichnen, ausgestattet werden“, so die Professorin. Diese Daten sollen von jedem individuell und personalisiert zusammengestellt abrufbar sein. Zum Beispiel über neue Technologien wie Kontaktlinsen, die die aktuellsten Statistiken sichtbar machen.

64
„In Zukunft werden technologische Neuerungen noch viel mehr in die TVÜbertragungen involviert werden und sie somit authentischer machen.“
Martin Szerencsi
Seilkameras – die Vorgänger der Drohnen –bringen den Zuschauer schon ein ganzes Stück näher ans Geschehen als fest montierte Kameras.
© EXPA, GEPA, PRIVAT
Urlaub neu gedacht: nachhaltiger Tourismus in Ferienparks
Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle im Tourismus und ist bei EuroParcs eines der Fokusthemen in den kommenden Jahren.
Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich der Ferienparkbetreiber
EuroParcs mit zukunftsfähigen Tourismusformen. Gepresste Erde, Altpapier, Pfirsiche und Aprikosen sind dabei wichtige Elemente, die jetzt schon eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit von Ferienparks spielen. Zusätzlich wird die Verwendung von Smart Home Appliances und erneuerbarer Energie wesentlich dazu beitragen, wie Gäste bei EuroParcs in Zukunft ihren nachhaltigen Urlaub verbringen. Ziel ist ein nachhaltiger Urlaub bei mindestens gleichbleibendem Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Angeboten.
Die beiden EuroParcs-Ferienhäuser der Zukunft „Rebel House“ und „Just


Nature“ geben einen Eindruck davon, wie die neue Erholung aussehen könnte. In den Beinen des von Star Wars inspirierten „Rebel House“ sind eine Wärmepumpe und Batterien eingebaut, welche die von den Sonnenkollektoren auf dem Dach erzeugte Energie speichern. Außerdem besteht die Glasur der Keramikfliesen im Außenbereich aus feinem Luftstaub und die Fliesen im Badezimmer aus gepresster Erde, die mit Naturharz verstärkt wurde. Im Falle des Ferienhauses „Just Nature“ wird der Nachhaltigkeitsgedanke unter anderem durch die modulare Bauweise ausgelebt. Diese ermöglicht es, das Bad ganz einfach durch die Außenwand aus dem Haus zu schieben und bei Bedarf tauschen zu können.



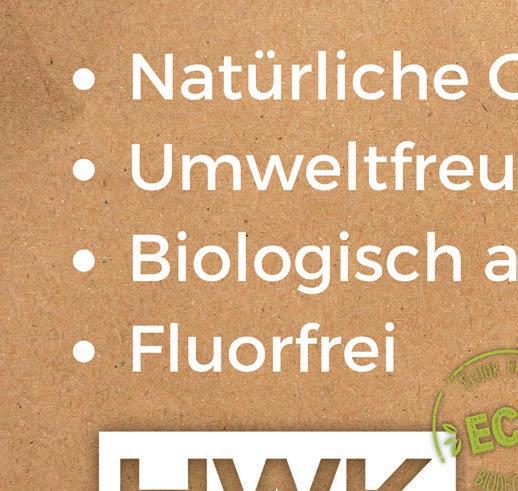
EuroParcs

Feriendorf 1, 9181 Feistritz im Rosental info@europarcs.at www.europarcs.at/ski-austria

© EUROPARKS Entgeltliche Einschaltungen
Das „Rebel House“ von EuroParcs vereint nachhaltige Materialien mit innovativer Technik.
Mittendrin statt nur dabei
Das Zauberwort in der Zukunft der Sportübertragungen allerdings lautet Immersion, also das Eintauchen des Zuschauers in das Sportereignis. Verschiedene Sportarten experimentieren bereits mit unterschiedlichen Elementen, um die Fans näher ans Geschehen zu bringen. Bei der Formel 1 gibt es zum Beispiel den Boxenfunk, und der ORF setzte zuletzt beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel Drohnenkameras ein, die den Fahrern die Streif hinab verfolgten und einen eindrucksvollen Blick auf die Fahrt ermöglichten.
„In Zukunft werden technologische Neuerungen noch viel mehr in die TV-Übertragungen involviert werden und sie somit authentischer machen“,
sagt Szerencsi. Augmented Reality wie die von Stura erwähnten Kontaktlinsen und Virtual Reality werden die Art, wie Sport konsumiert wird, verändern. „Irgendwann werden wir in der Lage sein, Sportereignisse über eine VR-Brille aus der Perspektive der Athleten verfolgen zu können“, glaubt Stura.

Ganz konkrete Vorstellungen hat Eichwalder: Aus Sicherheitsgründen könne man im Alpinbereich zwar nicht jedem Athleten eine Go-Pro auf den Helm schnallen, „aber wenn es eine Kamera gäbe, die den Fans in den Wohnzimmern die wirkliche Steilheit eines Weltcuphanges nach Hause vermitteln könnte, würde das vieles verändern.“ Das sei aber leider noch nicht möglich, so der ÖSV-Experte.

Alle wollen ein Stück vom Kuchen
Ein Problem sieht Szerencsi allerdings in den immer teurer werdenden Lizenzen. Insbesondere in den Sportarten Fußball, Ski und Formel 1. „Es drängen jede Menge Anbieter von Onlineplattformen und TVSendern – zumeist mit Bezahlabo-Systemen – in den Markt, um die Interessen der dahinterstehenden Investoren zu befriedigen und rein kommerzielle Geschäftsmodelle umzusetzen“, erklärt Szerencsi.
Für Eichwalder gilt es, dies im Skisport zu vermeiden, um ihn weiterhin einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Stura hofft auf den Einfluss der Sponsoren: „Die sollten ein Interesse daran haben, dass nicht nur ein ausgewählter Kreis Zugang zu Sportereignissen hat, weil sie ja ihre Message kommunizieren wollen.“ Außerdem müssen die hohen Summen, die für Übertragungsrechte bezahlt werden, auch vor den Zuschauern gerechtfertigt werden.
66 Live is live
„Irgendwann werden wir in der Lage sein, Sportereignisse über eine VR-Brille aus der Perspektive der Athleten verfolgen zu können.“
Claudia Stura
© EXPA, SHUTTERSTOCK.COM
Ein Drohnenpilot mit futuristischem Headset. Irgendwann können Sportereignisse via VR-Brille auch aus der Perspektive des Athleten verfolgt werden.
SERVUS WINTERSPORT







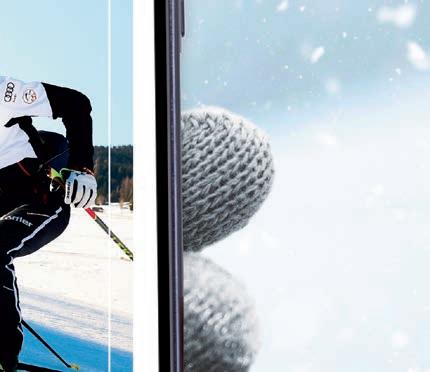







© Red Bull Content Pool
ERSTER WINTERSPORT-KANAL
ÖSTERREICHS
LOS GEHT‘S
ATHL


eSport
Sport oder nicht Sport –Emotionen sind jedenfalls im Spiel.
ATHLETEN
MIT TASTEN
eSport erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Ob es sich dabei wirklich um Sport handelt oder nicht, spielt keine Rolle.
Georg bewies früh, dass er richtig flott ist. Als Scharfschütze, oder Sniper, wie sich die Rolle unter Counter-Strike-Spielern nennt, musste er das auch sein. Und als 8-Jährigen machte es ihn natürlich stolz, dass die Freunde seines großen Bruders irgendwann bei den Spieleabenden alle in seinem Team spielen wollten – weil er relativ bald der beste Spieler unter ihnen wurde.
Heute ist Georg 26. Er spielt weiterhin jeden Tag Counter Strike, und zwar mehrere Stunden – immer noch als Scharfschütze –, ist beim Wiener Verein Sissi State Punks unter Vertrag und vertrat Österreich kürzlich bei der eSport-Weltmeisterschaft auf Bali. „In Österreich ist eSport in der breiten Be-
völkerung nicht so angesehen wie in Dänemark, Polen oder Brasilien“, sagt der Niederösterreicher, „dort hat eSport das Standing von Fußball.“ Vorurteile hätten aber meistens nur Leute, die noch nie selbst gespielt haben.
Sport mit zweierlei Maß
Bei Counter Strike treten zwei 5er-Teams gegeneinander an. Eine Gruppe versucht eine Zeitbombe zu legen, die andere eine Explosion derselben zu verhindern. Ob es sich dabei um Sport handelt oder nicht, darüber scheiden sich die Geister. Damit sich
69
Text: Haris Kovacevic
© ÖFBL/Max
Bruckner, shutterstock.com
eine Tätigkeit so nennen darf, muss sie laut der Definition des Deutschen Sportbunds drei Kriterien erfüllen: Neben ethischen Werten, die sie vertreten solle, braucht es Vereinsstrukturen, damit der Zugang zur Sportart ermöglicht ist, und die Ausübung müsse mit physischer Bewegung zu tun haben. Nur das letzte Kriterium trifft laut vielen eSportlern beim eSport nicht zur Gänze zu – bei anderen anerkannten Sportarten aber eben auch nicht.
„Bei der Beurteilung wird oft mit zweierlei Maß gemessen“, stört sich Stefan Baloh, Vorsitzender des österreichischen eSport-Verbandes an dieser und an ähnlichen Definitionen: „Bei Tischfußball, Schach, Luftgewehrschießen, aber auch bei Angeln und Billard sagt keiner was“, so Baloh, „aber bei eSport fühlen sie sich nicht ganz wohl, es als Sport zu bezeichnen.“

Dabei seien die Anforderungen in Sachen Hand-Auge-Koordination, beim räumlichen Denkvermögen, bei Feinmotorik sowie Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit an eSportler sogar höher als das bei vielen klassischen Sportarten der Fall sei.
So wie Spitzensportler Höchstleistungen erbringen, machen das auch Spitzen-eSportler – und das Interesse daran sei weltweit auch nicht geringer als an herkömmlichen Sportarten.


















Voll im Trend




























Asien ist der Hotspot beim Thema eSport. Professionelle eSportler sind dort mit Rockstars und Profifußballern in Europa vergleichbar – nicht nur was die Gagen und Preisgelder anbelangt, sondern auch den Bekanntheitsgrad. Die größten Events können in China nur noch in Stadien ausgetragen werden. Für Karten fürs Finale von League of Legends 2020 hatten sich 3,2 Millionen Menschen registriert. Vor den Bildschirmen verfolgten durchschnittlich 23 Millionen das Event, zum Höhepunkt waren sogar doppelt so viele zugeschaltet. „Vor allem bei 16- bis 19-Jährigen ist eSports sehr beliebt, sowohl als Zeitvertreib wie auch als Chance, aus dem Hobby einen Beruf zu machen“, so Baloh.

chen“, so Baloh.





Neue Wege, neue Möglichkeiten
Beim Grazer Philipp Gutmann hat alles mit Fifa 17 angefangen. Damals wurde die eBundesliga gegründet und beim Kräftemessen online fiel sein Talent rasch auf. Heute verdient er seinen Lebensunterhalt als Content-Creator auf Twitch und Youtube, spielte die letzten vier Jahre für die eSport-Vereine von Sturm und Wacker und ist mittlerweile auch als Coach tätig. „Ohne das Engagement der Bundesliga wäre die eBundesliga nie zustande gekommen und ich hätte vermutlich kaum Profi werden können“, erzählt Phil-

70 eSport
„Für mich ist eSport eSport und Sport Sport. Ich mache mein Ding und freue mich, wenn ich andere Leute damit begeistern und inspirieren kann.“
Philipp Gutmann, Fifa-Profi
© A1 eSport, esvoe
eSport-Turniere sind Massenevents, ziehen Hunderte Spieler und Tausende Zuschauer an.
ipp. Haben Vereine ein Problem, an neue Mitglieder zu kommen, sollten sie seiner Meinung nach unter anderem auf eSport setzen. So erhalten ganz junge Menschen einen sehr niederschwelligen Zugang zu einer Sportart – und diese profitiere dann davon.

„Leute, die ein Game spielen, fangen oft auch an, sich für die analoge Variante zu interessieren“, so Stefan Baloh. Das habe man beim Segeln gut beobachten können, wo der Segelverband ein Spiel entwickeln ließ, das sehr beliebt wurde, und daraufhin auch mehr Menschen anfingen, sich bei Segelvereinen anzumelden. Außerdem können sich auch


neue Trainingsmöglichkeiten entwickeln wie im Motorsport. „Der absolute Großteil des Trainings wird da heutzutage digital abgewickelt“, erklärt Baloh. Andere Sportarten wie Skifahren hätten dahingehend auch großes Potenzial, das bisher wenig genutzt wurde. Philipp Gutmanns Weg zum Fifa-Profi begann beispielsweise bei der ORF Skichallenge, einem österreichischen Computerspiel, bei dem virtuell eine Strecke schnellstmöglich zu bewältigen war – und das vor kurzem von Greentube wiederbelebt wurde und dabei Rückenwind von namhaften Partnern wie SwissSki, dem ÖSV und dem Deutschen Skiverband erhält.
Von Natur aus gut
Für unser naturbelassenes Siegl-Paracelsus Bio-Zwickl verwenden wir nur die besten Zutaten. Deshalb wird diese herrliche Bierspezialität ausschließlich mit heimischen Rohstoffen in höchster Bio-Qualität für ausgezeichneten Biergenuss gebraut.



„Leute, die eine Game spielen, fangen oft auch an, sich für die analoge Variante zu interessieren.“
Stefan Baloh, Vorsitzender des österreichischen eSport-Verbandes
eZAHLEN Fast jeder zweite
unter 25-Jährige interessiert sich für Gaming.
Bei den eSportKonsumenten ist nur ein Viertel weiblich
Mehr als die Hälfte aller 14- bis 55-Jährigen in Österreich spielen mindestens einmal pro Woche
75 % aller Gamer greifen fürs Spielen zum Handy
Computerspiele –13 Prozent sehen sich regelmäßig eSport-Events an.

44 % der Gamer sind weiblich, 56 % männlich.
Am PC zocken 55 %. Eine Konsole kommt bei 45 % zum Einsatz.
Die wichtigsten Gründe für eSport-Konsum sind:
Spannende Wettbewerbe/ Wettkämpfe
42 %
Ich bewundere die Fähigkeiten der Spieler
38 %
Es macht Freude zu sehen, wie die Spiele, die ich selbst gerne spiele, in Perfektion gespielt werden
36 %
In 68 % der Fälle ist es der Entertainment- und Spaßfaktor, der die Leute motiviert zu spielen.
54 % sagt, dass es zu Entspannung führt und ebenso oft ist es Ablenkung vom Alltagsstress.
Das beliebteste Spiel ist
Fifa gefolgt von Call of Duty auf Platz 2 und Minecraft auf dem dritten Platz.
72 eSport
Quelle: Nielsen Sports/A1 –eSports Marktanalyse Österreich, September 2021
Ski Challenge 2.0
Das legendäre Spiel, an dem sich früher viele erprobt haben, ist seit letztem Jahr zurückgekehrt – die Ski Challenge mit neuen Features und Überraschungen gibt es als App zum Download und erlaubt allen Ski-Fans, den Spirit und die Aufregung eines echten Weltklasse-Skirennens zu erleben.


www.ski-challenge.com
Übung macht den Meister









eTeam-Austria bei der eSport-WM in Bali

Sein Dasein als Profi-eSportler sieht er als Privileg. „Es ist mein Traumberuf, aber es ist auch wirklich stressig.“ Wochenenden und Feiertage gebe es in dem Sinne nicht und Urlaub nur, wenn man die Disziplin hat, sich diese Freiheit auch wirklich zu nehmen. Ihm ist auch bewusst – und da sieht er eine klare Parallele zu herkömmlichen Sportlern –, dass alles recht schnell vorbei sein kann. Deswegen sei es gut, immer etwas in der Hinterhand zu haben – eine abgeschlossene Ausbildung zum Beispiel: „Vor allem, wenn man bedenkt, dass Spieler immer jünger werden und nicht mehr, wie bei mir, mit 22 in die Profikarriere gestartet wird, sondern bereits mit 13 oder 14.“
Sein Alltag steht dem eines Profisportlers in kaum etwas nach: „Jeder Spieler hat seinen eigenen Rhythmus und seine besonderen Trainingsgewohnheiten.“ Es hänge viel davon ab, wie sehr man es für nötig erachte, gerade zu trainieren, und wie viel Zeit man habe. Wenn im Herbst das neue Fifa rauskommt, spiele er mehr, im Sommer dann so gut wie gar nicht. Mit seinen Jobs als Coach und Content Creator sei sein Arbeitstag gut gefüllt: „Und für Training nehme ich mir jeden Tag mehrere Stunden Zeit.“
Unbeantwortete Fragen

Bei Georg Bauer gestaltet sich dieser Part seines Jobs etwas komplizierter, da er als Counter Striker auch von seinem Team abhängig ist: „Man kann zwar auch alleine üben und trainieren, doch ist es bei Counter Strike enorm wichtig, seine Teammates gut zu kennen.“ Mit seinem Team spielt er in der höchsten Liga des deutschsprachigen Raums. Neben den fünf Spielern gehören ein Coach, ein Analyst, ein Manager sowie ein Mental Coach dazu – jeder mit einer eigenen Aufgabe. Denn nicht nur auf die Schnelligkeit und die

eigenen Fähigkeiten kommt es an: „Das Teamgefüge ist enorm wichtig, ein guter Schlafrhythmus, die richtige Ernährung, aber auch sportlicher Ausgleich“, erklärt der Niederösterreicher.
Ob es sich bei eSport nun um Sport handelt oder nicht, bleibt beantwortet – und eine endgültige Antwort darauf gibt es wohl nicht, auch nicht unter den eSportlern selbst: „Ich persönlich denke darüber zum Beispiel nicht nach“, erklärt der FifaProfi Philipp Gutmann, „für mich ist eSport eSport und Sport Sport. Ich mache mein Ding und freue mich, wenn ich andere Leute damit begeistern und inspirieren kann.“
73
© Moritz Scheer, ÖFBL/Max Bruckner
„In Österreich ist eSport in der breiten Bevölkerung nicht so angesehen wie in Dänemark, Polen oder Brasilien, dort hat eSport das Standing von Fußball.“
Georg Bauer, Counter-Strike-Profi
Schö el Teamwear
INDIVIDUELLE & HOCHPROFESSIONELLE VEREINSBEKLEIDUNG
Entwickelt & getestet von den Besten
Seit 13 Jahren verbindet den ÖSV mit Schö el eine Ausstattungspartnerschaft, die unseren AthletInnen und BetreuerInnen Skibekleidung und Rennanzüge in Top-Qualität garantiert. Es freut uns sehr, dass diese erfolgreiche Partnerschaft auch den ÖSV-Vereinen zugute kommt und dass die Vorteile des Spitzensports allen ÖSV-Vereinsmitgliedern zugänglich sind. Roswitha Stadlober, ÖSV-Präsidentin


Für deine Vereinsbestellung wende dich an:

ORDER DEADLINE
15.03.2023


ÖSV MITGLIEDER AUFGEPASST!!
Wir haben ein ganz besonderes Zuckerl für euch:
Ab der Wintersaison 2022/23 erhältlich:















• Original Rennanzug der ÖSV-AthletInnen (nur für Kinder bis zur Größe 164)
• Rennanzug für Erwachsene (Design angelehnt an Original ÖSV Rennanzug)
• Original ÖSV Race Shorts für Erwachsene und Kinder
ÖSV SONDERPREIS: 40 % RABATT
Bernhard Steiner +43 512 27 93 33-63 +43 664 38 07 49 0
+43
b.steiner@schoe el.com Herbert Kern +43 512 27 93 33-39
664 88 73 91 00 h.kern@schoe el.com
Nur in Kombination mit einer Vereinsbestellung für den Winter 2023 zu erwerben! Die Auslieferung erfolgt im Herbst 2023 über euren Teamwear Händler vor Ort
FÜR ÖSV-MITGLIEDER
Melde dich beim Ski Austria Newsletter an und gewinne sensationelle Preise.

Die Gewinnfrage lautet:
Wie heißt die rot-weiß-rote Skisprunglegende, die 1996 am Kulm Skiflug-Weltmeister wurde und am 29. November 2022 seinen 50. Geburtstag feierte?


UNTER ALLEN RICHTIGEN EINSENDUNGEN VERLOSEN WIR:
3 Übernachtungen
für 2 Personen im Doppelzimmer mit HP in der Ski Austria Academy St. Christoph inklusive Skipass
Also: Mitspielen und gewinnen!
Mit etwas Glück darfst du dich über drei unvergessliche Skitage freuen oder unvergessliche Momente in unvergleichlicher Atmosphäre bei den WM-VeranstaltungsHighlights des Österreichischen Skiverbandes erleben.
2 VIP-Tickets
für einen Tag bei den FIS Skiflug-Weltmeisterschaften 2024 Kulm/Bad Mitterndorf

2 VIP-Tickets
für einen Tag bei den FIS Alpinen SkiWeltmeisterschaften 2025 Saalbach-Hinterglemm
So funktioniert es:
Schritt 1: Scanne den QR-Code

Schritt 2: Melde dich für den Ski Austria Newsletter mit deiner ÖSV-Mitgliedsnummer an.

Schritt 3: Gib das richtige Lösungswort ein und drücke auf „Absenden“.
win.myskiaustria.info
© MALLAUN, EXPA
TOLLE PREISE GEWINNEN!
EXKLUSIVES
GEWINNSPIEL
Eva Ganster


„Ich wollte nur meine Träume verwirklichen.“
76
Skisprung-Pionierin
Text: Bernhard Foidl
Für die aktuelle Generation ist Damen-Skispringen von der Großschanze Normalität. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass es in diesem Sport keine Wettkämpfe für das weibliche Geschlecht gab. So etwa Anfang der 90er Jahre. Und hier kommt Eva Ganster ins Spiel. Ein Mädchen aus Tirol, dass gut Skifahren konnte und im Kader des Kitzbüheler Skiclub trainierte. In der vierten Klasse Volkschule nahm Eva an einem Schülerrennen teil, wo sie ihre Altersklasse bei den Mädchen gewann. Als verlautbart wurde, dass alle Sieger nebenan auf der 15-MeterSchanze vorspringen dürfen, wollte sie auch. Für Mädchen geht das nicht, weil das viel zu gefährlich sei, hieß es plötzlich. „Aber stur war ich schon damals“, erzählt Eva mit einem spitzbübischen Lächeln. Sie blieb hartnäckig, durfte springen, wurde Zweite und entdeckte ihre wahre Passion. Von da an war sie regelmäßig auf der Schanze unweit ihres Elternhauses zu sehen. „Am Anfang haben sie gedacht: ‚Wenn sie einmal auf die Nase fällt, wird sie schon wieder aufhören‘“, kann sie sich lebhaft zurückerinnern. Tat sie aber nicht. Stattdessen kamen mit dem Training die ersten Erfolge. Schon im Jahr darauf gewann sie den Tiroler Landescup, 1991 folgte der Sieg bei den österreichischen Schülermeisterschaften –bei den Burschen wohlgemerkt. „Da habe ich schon mitgekriegt, dass die Jungs oft von deren Trainern gehänselt wurden. So nach dem Motto: ‚Ihr könnt euch doch nicht von einem Dirndl schlagen lassen.‘“
Eva hingegen war es „völlig wurscht“, dass sie das
Eva Ganster
einzige Mädchen in einer männlichen Domäne war. „Das Wegspringen, das Gefühl beim Abheben und das durch die Luft segeln – das hat mich einfach fasziniert“, so Ganster, die dank der Unterstützung von Prof. Paul Ganzenhuber (siehe Interview) im Jahr 1992 als erste Skispringerin in das Schigymnasium Stams wechseln durfte. „Er hat es mir ermöglicht meinen Traum weiterzuleben und den Weg als Skispringerin einzuschlagen“, ist Eva heute noch dankbar. Trotz des anfänglichen Heimwehs schien der damals 14-Jährigen die Welt offen zu stehen. In ihrem Zimmer hing ein Poster der deutschen Skisprunglegende Jens Weißflog, ihre Ziele standen fest: „Ich wollte Olympiasieger werden“. Warum sie bei dieser Aussage die männliche Form benutzt? Eva will das bei den Männern schaffen. „Es gab ja nur Jungs – und mich. Das war für mich das Normalste der Welt.“ Dass körperlich die Schere biologisch bedingt auseinandergehen würde, wurde Eva in ihrer herzerfrischenden, kindlichen Unbefangenheit erst kurze Zeit später bewusst. „Ab 16 konnte ich mit den Burschen nicht mehr mithalten. Das war schon ernüchternd. Da habe ich erst realisiert, dass es meinen Sport noch gar nicht gibt.“
Vorspringerin bei den Olympischen Spielen
Im selben Jahr dieser schmerzlichen Erkenntnis setzt Eva ein erstes internationales Ausrufezeichen. Paul Ganzenhuber, Sportlicher Leiter in Stams, konnte durchsetzen, dass die 16-Jährige bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer als Vorspringerin an den Start gehen darf. „Ich habe sichere
Nach der Matura studierte Eva Ganster (44) in Innsbruck Gesundheitssport und Bewegungswissenschaften und schloss 2005 als Magistra ab. Dazu absolvierte sie eine Zusatzausbildung im Bereich der Myoreflex-Therapie. Heute arbeitet sie im Burg Vital Resort, einem 5 Sterne Superior Hotel in Oberlech, als Therapeutin und liebt nach wie vor die Bewegung in der freien Natur. Zu ihren Hobbies zählen Skitouren, Wandern, Laufen und Radfahren.
77 © WEREK PRESSEBILDAGENTUR, MARTINA DI LORENZO
Mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen hat Eva Ganster dem Damen-Skispringen zum Durchbruch verholfen. Die Geschichte einer Tirolerin, die ihrer Kindheitstraum gelebt hat und dabei ihrer Zeit weit voraus war.
und gute Sprünge gezeigt“, erinnert sich Eva, die mit 113,5 Metern ihren eigenen Damen-Weltrekord (112 Meter in Bischofshofen), verbesserte. In Erinnerung bleibt ihr weniger die Rekordweite als vielmehr die unglaubliche Stimmung an der Schanze. „40.000 Zuschauer waren da. Dieses Gefühl war einmalig.“
In der Folgesaison gab es vereinzelt Damen-Skisprungveranstaltungen, die Entwicklung verläuft jedoch schleppend. Erst in der Saison 1999 genehmigt die FIS eine Damen-Wettkampfserie. Zwei Jahre nachdem der frühere FIS-Präsident Gian-Franco Kasper mit zweifelhaften Anatomiekenntnissen aufhorchen ließ und mit seiner Aussage, „dass es bei der Landung den Skispringerinnen die Gebärmutter zerreißen könnte“, verbal einfädelte. Im selben Jahr machte Eva Ganster in der Skisprungwelt weiter Schlagzeilen. 1997 versucht sie sich am legendären Kulm als erste Frau im Skifliegen.
„Dieses Projekt hat schon ein halbes Jahr vorher begonnen. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich ‚Ja‘ gesagt, denn ich wollte mir diese einmalige Chance nicht entgehen lassen. Da ging es auch um mein Ego. Franz Leiner und Paul Ganzenhuber, denen ich blind vertraute, haben mich gezielt auf das Skifliegen vorbereitet, denn das ist nochmal eine andere Naturgewalt. Wir sind zu dieser Zeit ja größten-
WEITENREKORD-ENTWICKLUNG im Damen-Skispringen (Auszug):

teils nur auf K70- oder K90-Schanzen gesprungen. Da war schon die Anfahrtsgeschwindigkeit eine völlig andere.“
Die Tage am Kulm gehören dann zu jenen unvergesslichen Momenten, die Eva nie missen möchte. „Als ich das erste Mal am Kulm oben saß, da hatte ich schon echt Muffensausen – das war Adrenalin pur.“ Nach dem ersten Flug („Ich dachte mir: Nicht so schlimm, ich hab’s überlebt“) fand sie Gefallen am Fliegen. Schließlich stellte sie mit 169 Metern einen neuen Weltrekord auf, der ihr einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bescherte und sechs
78
© WEREK PRESSEBILDAGENTUR
1897 Ragna Pettersen (NOR) 1911 Paula von Lamberg (AUT) 1931 Johanna Kolstad (NOR) 1972 Anita Wold (NOR) 1981 Tiina Lehtola (FIN) 1994 Eva Ganster (AUT) 1997 Eva Ganster (AUT) 2003 Daniela Iraschko (AUT) 12 22 40 80 110 113,5 167 200 Meter
Skisprung-Pionierin
Als Vorspringern bei den Olympischen Winterspielen 1994 sorgte Eva Ganster für internationales Aufsehen.
Jahre Bestand haben sollte. 2003 knackte schließlich Teamkollegin Daniela Iraschko als erste Frau die 200er-Marke – in einer Zeit, in der diese Sportart langsam Fahrt aufnahm. Immer mehr Mädchen begeisterten sich für das Skispringen. Dann ging es Schlag auf Schlag: 2009 sprangen die Damen erstmals um WM-Medaillen, im Dezember 2011 folgte der erste Weltcupbewerb – drei Jahre bevor der Sport sogar olympisch wird. Eva Ganster war die Möglichkeit auf einen Olympiasieg nicht mehr vergönnt, denn 2005 beendete sie mit 27 ihre Karriere. Wehmut hört man bei der heute 44-Jährigen dennoch keine heraus: „Im Nachhinein betrachtet war alles gut so, wie es war. Für die Entwicklung der Sportart war es wichtig, dass es step by step geht. Auch wenn ich mir das damals anders gewünscht habe.“
Wegbereiterin für die heutige Generation



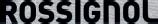

Heute ist der Name Eva Ganster untrennbar mit den Anfängen dieser Sportart verbunden. Auch ihr Vater






Edgar, der sich anfangs vorrangig für die Tochter und später intensiv für den Damen-Skisprungsport engagierte, kann man getrost als Wegbereiter bezeichnen. Ob sie sich heute selbst als eine solche sieht? „Mir ging es nicht darum, als Pionierin in die Geschichte einzugehen. Ich wollte nur Skispringen und meine Träume verwirklichen. Klar war die Familie Ganster ein Wegbereiter, aber hätten wir es nicht gemacht, dann eben ein paar Jahre später jemand anderer. Man muss auch dazu sagen, dass es dafür viel Rückhalt gebraucht hat. Von der Familie, über den Skiclub und Landesverband bis hin zum ÖSV. Harald Haim (Sportlicher Leiter Stams, Anm.) hat einmal zu mir gesagt: ‚Eva, du weißt gar nicht, was du da in Bewegung gesetzt hast.‘ Damit hatte er wohl Recht.“


ANMELDUNG & INFOS auf www.sport -hun.at TESTE DIE NEUESTEN MODELLE DER SAISON 2023/24
SCAN ME
„Für die Entwicklung der Sportart war es wichtig, dass es step by step geht.“
Eva Ganster
Prof. Paul Ganzenhuber
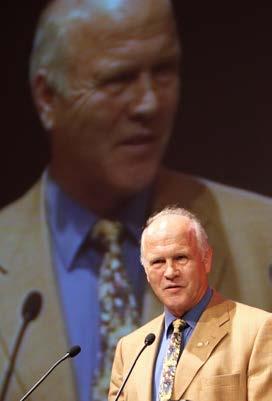
begann 1973 seine Lehrtätigkeit an der Internatsschule für Skisportler in Stams. Im Jahr darauf übernahm er dort das Skisprungteam um Karl Schnabl und Toni Innauer. 1984 wurde er Trainer der ÖSV-Nationalmannschaft. Von 1988 bis 1999 war Ganzenhuber sportlicher Gesamtleiter für den Bereich Sprunglauf im ÖSV sowie sportlicher Leiter im Schigymnasium Stams. Ab 2000 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 bekleidete er das Amt des Direktors. Daneben war Paul Ganzenhuber jahrzehntelang Vorsitzender des FIS-Weltcup-Komitees für Kalenderplanung.
Paul Ganzenhuber (79) gilt als Initiator von internationalen Wettkampfformaten im Damen-Skispringen. Im Ski Austria Interview spricht der Visionär und Förderer der ersten Stunde über die Anfänge und rasante Entwicklung dieser Sportart.
Herr Ganzenhuber, können Sie sich noch an den Schuleintritt von Eva Ganster im Jahr 1992 erinnern?
Natürlich. Eva war eine gute Alpin-Ski-Fahrerin und im Kader des K.S.C., aber sie hat gemeint, dass sie Skispringerin werden will. Ich dachte mir, warum soll das für Mädchen nicht möglich sein.
Gab es Hürden bei ihrer Aufnahme in das Schigymnasium Stams?
Nein, als Sportlicher Leiter konnte ich mir beim damaligen Direktor, mit dem ich ein gutes Verhältnis pflegte, Gehör verschaffen.
Sie war damals die erste Skispringerin in Stams.
Eva ist eine echte Pionierin. Vorher gab es zwar skispringende Mädchen in Amerika und Norwegen, aber keine Bewerbe. Für mich war klar, es muss eine Wettkampfserie geben. Hier war der ÖSV sicher Vorreiter.
Wie waren die Anfänge dieser Sportart?
Es ist uns gelungen Nationen wie Deutschland, Slowenien, Schweden, die USA und Kanada ins Boot zu holen. Auch Frankreich und Japan waren von Beginn an dabei. Später wurde ein FIS-Cup eingeführt. Das Niveau ist von Jahr zu Jahr gestiegen, gesprungen wurde ausschließlich auf Normalschanzen.
Wie hat man diese Entwicklung im Skiverband aufgenommen? Der Rettungsanker für die weitere Entwicklung war Peter Schröcksnadel. Bei einer Präsidiumssitzung in der Saison 1996/97 habe ich den Weg skizziert –vom Continental-Cup, über den Weltcup bis hin zur Teilnahmen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Ein paar haben damals darüber gelacht, aber Peter meinte „Paul, glaubst du das wirklich?“. Ich habe gesagt „Ja“ – da hat er uns erstmals ein eigenes Damen-Budget gewährt.
Ist der rasante Aufstieg dieser Sportart für Sie eine Überraschung? Nein, das war mir von Anfang an klar. Jetzt muss man aber aufpassen, dass die entstandene Euphorie das Können der Athletinnen nicht überholt. Im Moment gibt es vielleicht 10 bis 15 Damen, die auf der Großschanze gut springen und dann geht man schon Richtung Skifliegen – das kommt einer Überforderung gleich. Wichtiger wäre es, die Wettkampfserien weiterzuentwickeln, den Springerinnen optimale Trainingsbedingungen zu ermöglichen und ihnen Zeit zu geben.
80 © GEPA
Paul Ganzenhuber INTERVIEW
Das Interview führte Bernhard Foidl.









Sekunden Händedesinfektion 30 Bestzeit für Ihre Gesundheit Innovative Hygiene. www.hagleitner.com Offizieller Hygienepartner des ÖSV
Liebe Leserinnen und Leser, wir kommen zum Ende dieser Ausgabe von Ski Austria for Future. Und wir finden: Jetzt sind Sie am Wort!

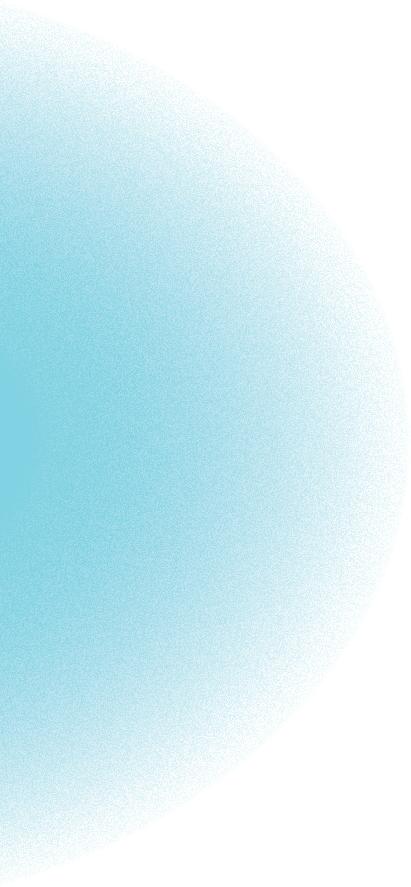
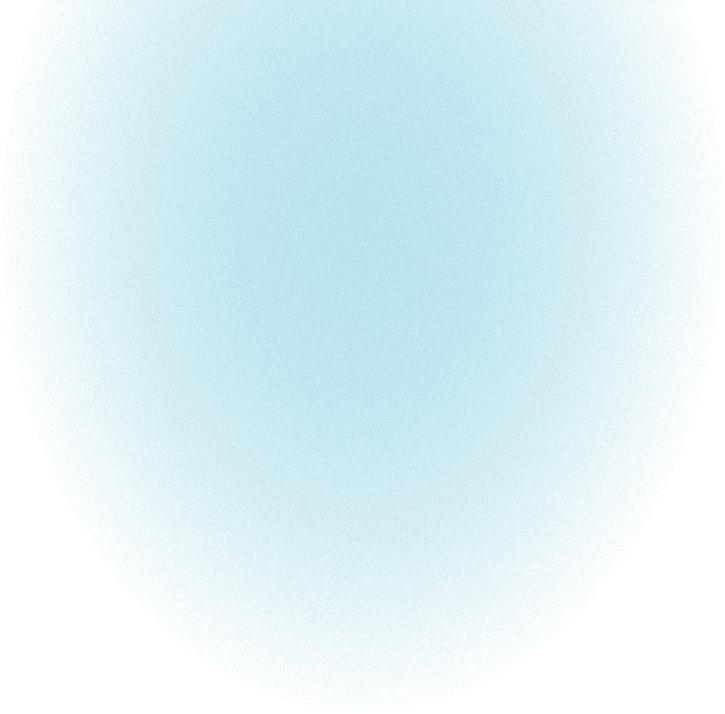
Welche Veränderungen und Innovationen können wir Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren erwarten? Wie können wir sicherstellen, dass der Wintersport auch für kommende Generationen nachhaltig und zugänglich bleibt? Wir möchten Ihre Gedanken über die Zukunft des Wintersports hören!
Als Mitglieder des Österreichischen Skiverbandes und Leser des Ski Austria Magazins liegt Ihnen dieses Thema sicher am Herzen. Deshalb laden wir Sie ein, Ihre Erkenntnisse und Ideen mit uns zu teilen.

















Schreiben Sie uns an presse@oesv.info

82








Green Ticket


Der einfachste und sauberste Weg ins Skivergnügen

Eine Kooperation der Silvretta Montafon und VMOBIL


Gratis An- und Abreise innerhalb Vorarlbergs und von den Grenzbahnhöfen Buchs, St. Margrethen (CH), Lindau (D) und St. Anton am Arlberg.



powered by Ski Austria –Zeitschrift des ÖSV –66. Jahrgang –Österreichische Post AG | MZ 02Z033091 M Austria Ski Team Handelsges.m.b.H. | Olympiastraße 10, 6020 Innsbruck | Retouren an Postfach 555, 1008 Wien



























































































































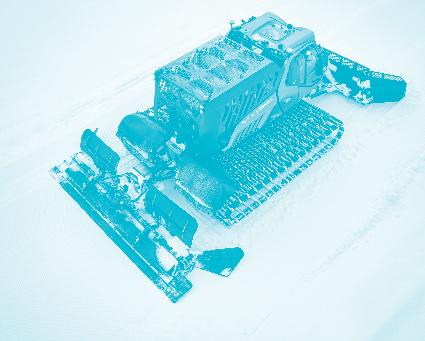

















































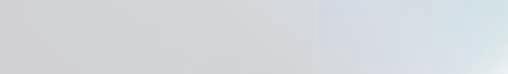







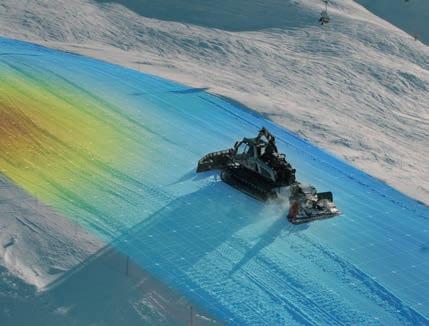

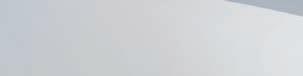











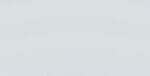











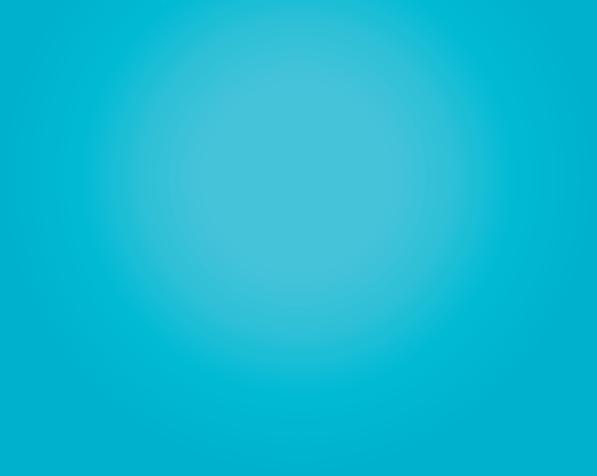



























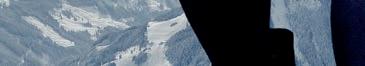














































































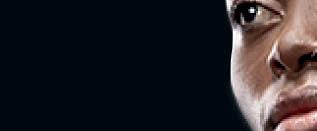






























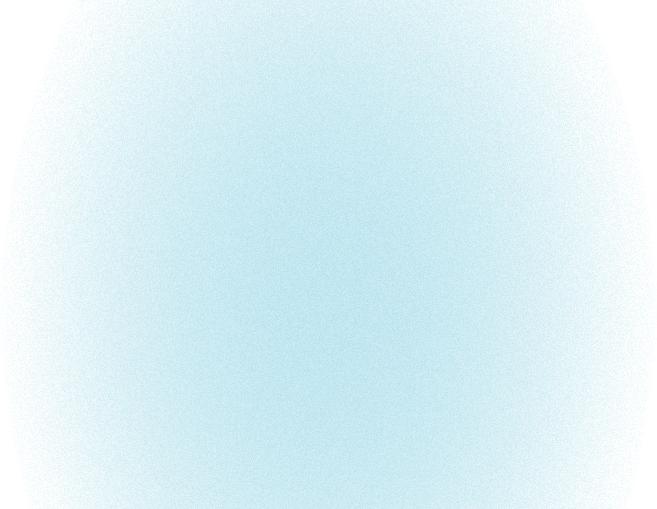






















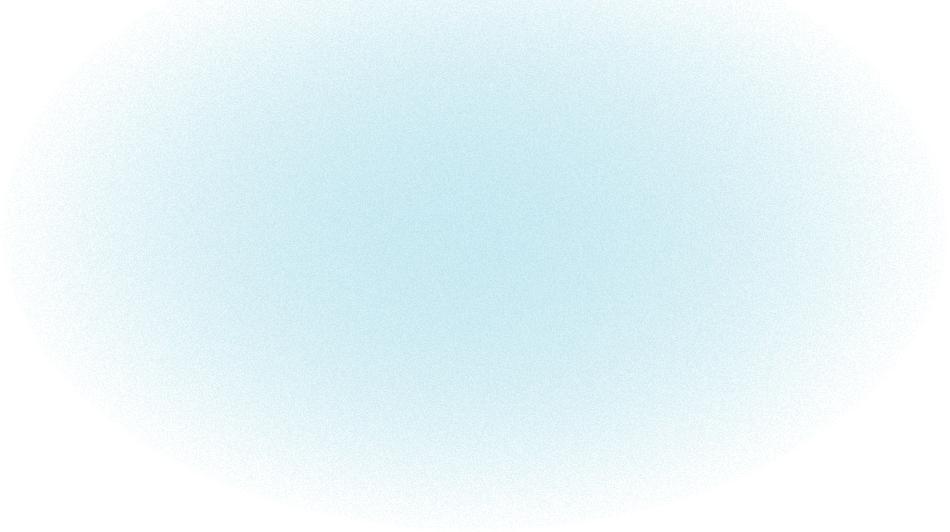











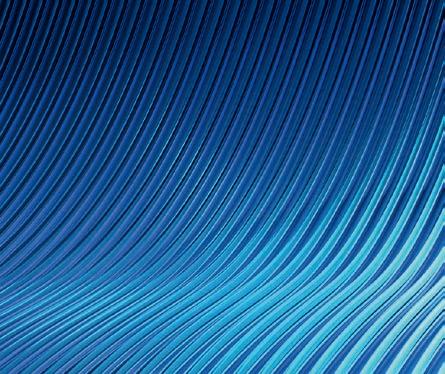

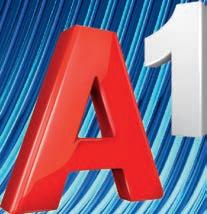



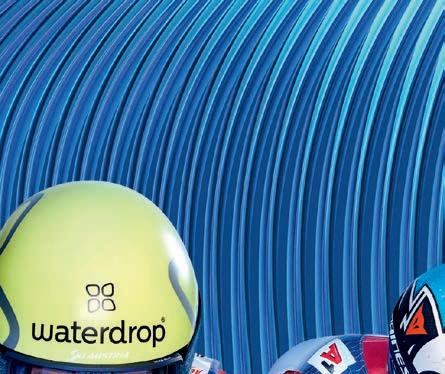





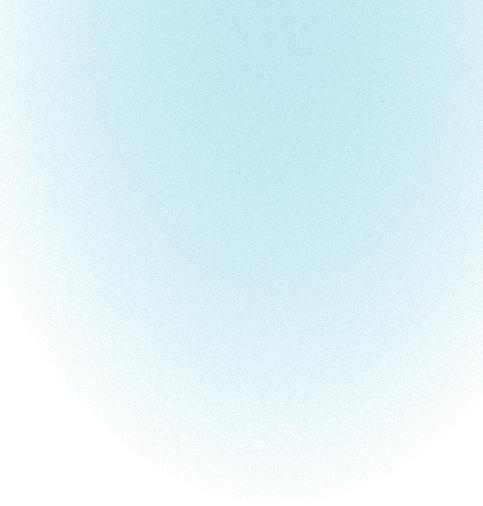



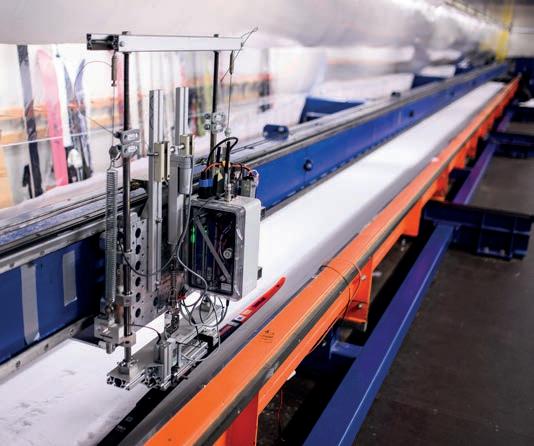



























































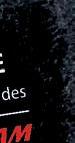







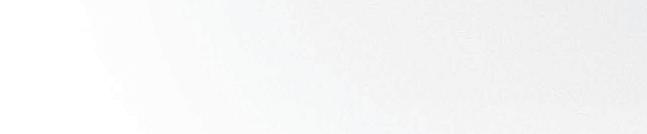
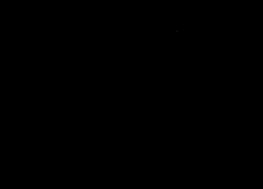
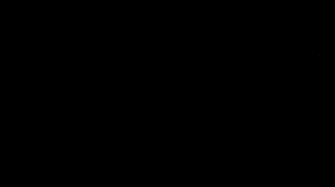

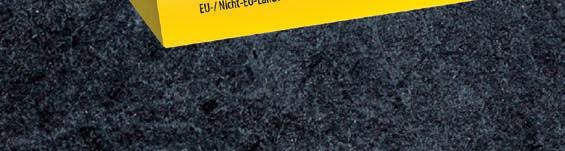






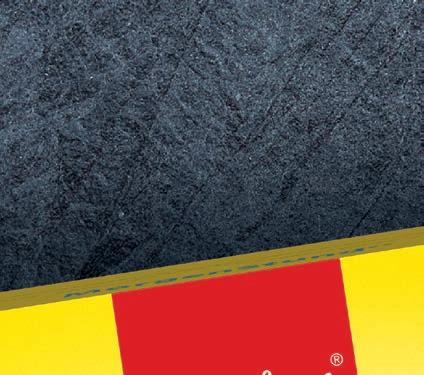
























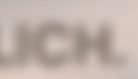








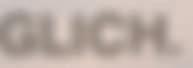













































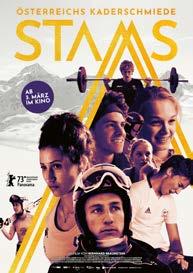

























































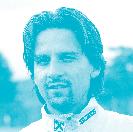

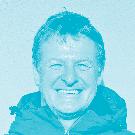






















































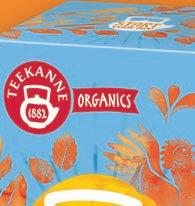



 Vitali Klitschko –Bürgermeister von Kiew.
Vitali Klitschko –Bürgermeister von Kiew.