Schwerpunktthema: Lösungen für Fischmigration
Südtiroler glänzen mit wegweisendem Synergieprojekt
Vorarlberger Gemeinde baut ihre Wasserkraftkapazitäten aus Kraftwerksneubau am Kleinsölkbach vervielfacht Ökostromausbeute
Fachmagazin für Wasserkraft




Schwerpunktthema: Lösungen für Fischmigration
Südtiroler glänzen mit wegweisendem Synergieprojekt
Vorarlberger Gemeinde baut ihre Wasserkraftkapazitäten aus Kraftwerksneubau am Kleinsölkbach vervielfacht Ökostromausbeute
Fachmagazin für Wasserkraft



Wussten Sie, dass die US-Amerikanische Universität in South Bend auf ihrem Campus gleich 10 StreamDiver zur Erzeugung sauberer Energie nutzt?
Für die Lieferung der kompakt Turbinen-Generatoren-Einheiten wurden wir mit dem „Procurement Partner Sustainability Award“ ausgezeichnet.
Technische Daten
Turbinentyp: 10 x SD-13,1
Leistung: 255 kW je Unit

Fallhöhe: 3,17 m
Scannen Sie hier und erfahren Sie mehr über die StreamDiver Lösung.
Die gute Nachricht im noch jungen Jahr 2023 liefert der aktuelle Electricity Market Report, der alljährlich von der Internationalen Energie Agentur (IEA) herausgegeben wird. Laut dieser neuesten Studie werden die Erneuerbaren zusammen mit der vielerorts wiederbelebten Kernkraft in den kommenden drei Jahren über 90 Prozent des weltweiten Wachstums der Stromnachfrage abdecken. Das ist insofern positiv zu sehen, als damit fossile Quellen immer mehr aus dem Markt gedrängt werden. Die Wissenschaftler der IEA gehen davon aus, dass auf diese Weise die CO2-Emissionen aus der globalen Stromerzeugung ein finales Plateau erreichen oder sogar absinken. Ein höchst wünschenswerter Effekt. Generell prognostizieren die Studienautoren einen Anstieg der globalen Stromnachfrage zwischen 2022 und 2025 um ca. 2.500 TWh auf nunmehr knapp 29.300 TWh. Das ist die weniger gute Nachricht, immerhin bedeutet dies ein Wachstum von beachtlichen 9 Prozent. Oder anders gesagt: Dieser Wert entspricht in etwa dem Strombedarf der gesamten Europäischen Union. Woher der steile Anstieg der Nachfragekurve kommt, ist mit fünf Buchstaben erklärt: CHINA. Bis zum Jahr 2025 wird ein Drittel des weltweiten Strombedarfs auf das Reich der Mitte entfallen. Im Vergleich dazu machte 1990 Chinas Strombedarf gerade einmal 5 Prozent aus. Summiert mit dem ungewöhnlichen Wachstum in anderen stark industrialisierten Regionen auf dem Kontinent wird Asien bis zum Jahr 2025 mehr als die Hälfte des weltweiten Strombedarfs abdecken. Und obwohl in Nordamerika und Europa ebenfalls noch ein Anstieg des Strombedarfs zu erwarten ist, geht statistisch der Anteil der „alten“ Industriegiganten am Nachfragewachstum im Vergleich zu den asiatischen „Boom-Nations“ zurück. Dennoch: Das positive Fazit des neuen Electricity Market Report liegt in der Grundaussage, dass die erneuerbaren Energien endgültig ihren Siegeszug angetreten haben. Bis 2025 werden sie eine globale Gesamtkapazität von 10,8 TWh erreichen und damit erstmalig die Stromproduktion aus der klimaschädlichen Kohle überholen. Ein echter Silberstreif am Horizont. Dass die Wasserkraft im weltweiten Ausbau der Erneuerbaren eine zentrale Rolle spielen wird, scheint sich dabei – entgegen so mancher Unkenrufe – immer klarer abzuzeichnen. Vor kurzem haben chinesische Wissenschaftler im Fachmagazin „Nature Water“ eine neue Studie veröffentlicht, wonach die weltweiten Wasserkraftkapazitäten auf 9 Petawattstunden verdoppelt werden könnten. (Seite 40) Im Kampf gegen den Klimawandel könnte der Wasserkraft somit eine Schlüsselrolle zukommen. Mit rund 85 Prozent schlummern die allergrößten Potenziale wenig überraschend vor allem noch in Asien und Afrika. Sie sind die zukünftigen Hoffnungsträger für die Wasserkraft. Dass die europäische Wasserkraftindustrie mit ihrem Know-how-Vorsprung bei diesen Ausbauoptionen ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann und wird – davon ist auszugehen.
Apropos Wasserkraft-Know-how: Wir haben uns für die erste Ausgabe der zek HYDRO im neuen Jahr 2023 wieder einige neue Kleinkraftwerke angesehen, die – jedes für sich – einige interessante technische oder ökologische Lösungen zu bieten haben. Ein wenig hervorzuheben wäre vielleicht das neue Kraftwerk Suldenbach (Seite 14) in der Südtiroler Nationalpark-Gemeinde Prad. Dabei wurde mit einem starken Willen für eine gemeinschaftliche Lösung das Kraftwerk als Teil eines großen Synergieprojektes realisiert – neben einer neuen Bewässerungsanlage, einer neuen Trinkwasserversorgung und einem neuen Radweg. Vier Fliegen mit einer Klappe: Das ist den Südtirolern dabei gelungen. Generell steht diese Ausgabe aber im Zeichen des aktuellen Schwerpunktthemas „Technische Lösungen für die Fischmigration“. In diesem Rahmen stellen wir etwa den mittlerweile schon sehr etablierten enature Fishpass und seine Qualitäten vor (Seite 46) oder den neuartigen eco2-Fischpass (Seite 50), der sich ebenfalls immer stärker am Markt behauptet. Und auch das innovative Fischschutz- und -leitsystem FishProtector, oder der neue Hydro-Fischlift, oder die Fishcon-Schleuse: Sie alle stellen höchst bemerkenswerte Ingenieur- und Wissenschaftsleistungen dar, in denen technische Lösungen für gewässerökologische Herausforderungen gefunden wurden. Diese Entwicklungen repräsentieren aber nicht nur praktische Anwenderlösungen, sie sind darüber hinaus auch der Beweis dafür, dass moderne Wasserkraft heute umweltverträglich und nachhaltig möglich ist – und sie weiterhin ihre Daseinsberechtigung an unseren Flüssen und Bächen hat.
Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.
Ihr Mag. Roland Gruber (Herausgeber)

Aktuell
14 Vinschgauer Kraftwerk als Teil eines Synergieprojekts umgesetzt KW SULDENBACH
19 Kraftwerksneubau vervielfacht die regionale Ökostromproduktion
KW KLEINSÖLKBACH
24 Kraftwerkskette an der Wildschönauer Ache erweitert
KW KLAMM II
28 Mit Innovationen von WATEC Hydro ins neue Jahr 2023


UNTERNEHMENS-NEWS
29
29 Neuanlage verdoppelt ÖkostromBilanz der Gemeinde Brand KW ST. THEODUL II
34 Der Talk: Versorgungssicher und unabhängig durch Wasserkraft RENEXPO INTERHYDRO 23


35 Steirisches Kraftwerk nach Kompletterneuerung wieder am Netz KW PERHAB
38 Beständig am Puls der internationalen Wasserkraftentwicklung
VIENNAHYDRO 22
40 Wasserkraftkapazitäten könnten weltweit verdoppelt werden STUDIE


41 Weltweit erster Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity MESSTECHNIK

42 Premiere für erste 6-düsige horizontalachsige Peltonturbine TURBINENTECHNIK
43 Messtechnik-Experte bewährt sich als kompetenter Partner MESSTECHNIK
44 Potenziell tödliches Problem drängt in den Vordergrund GEWÄSSERÖKOLOGIE

Mit der Fertigstellung der Kraftwerkskaverne im Dezember letzten Jahres hat Österreichs größte Kraftwerksbaustelle in Kaprun den ersten Meilenstein erreicht. Mit 43 Metern böte die Maschinenkaverne von Limberg 3 Platz für so manchen Sakralbau. Doch die Kaverne bleibt nicht hohl, sie wird nun nach Abschluss der Ausbruchsarbeiten Stockwerk für Stockwerk mit Beton gefüllt. Seit Beginn der Bauarbeiten im April 2021 sind 350 Arbeitskräfte rund um die Uhr am Werk, um in Kaprun das Pumpspeicherkraftwerk Limberg 3 voranzutreiben. Tief im Berg unterhalb der Limbergsperre wurde in monatelangen Sprengarbeiten eine Kraftwerkskaverne mit gewaltigen Dimensionen geschaffen. 25 Meter breit, 63 Meter lang und 43 Meter hoch ist der Hohlraum, der sich unmittelbar neben der Maschinenhalle von Limberg 2 befindet. Parallel zu den Betonierarbeiten in der Kaverne werden die Tunnel für die Wasserzufuhr der Turbinen, der horizontale Einlaufstollen und der Druckschacht betoniert und mit Rohrpanzerung versehen. Bei Limberg III handelt es sich um ein Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von insgesamt 480 Megawatt. Wie das 2011 in Betrieb genommene Limberg II wird es vollkommen unterirdisch zwischen den beiden bestehenden Speicherseen Mooserboden und Wasserfallboden (Stauziel 1.672 m) errichtet.

DROHENDE SCHLECHTERSTELLUNG
Maßlos enttäuscht zeigte sich Österreichs Interessensvertretung Kleinwasserkraft Österreich von der kürzlich von der Bundesregierung präsentierten Punktation zum geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz. „Dass bei den grundsätzlichen Rahmenbedingungen zwischen einzelnen erneuerbaren Technologien unterschieden werden soll, ist aus unserer Sicht völlig willkürlich und sachlich nicht nachvollziehbar“, hält Kleinwasserkraft Österreich Geschäftsführer Paul Ablinger fest. Mit der expliziten Ausnahme von Anlagen, welche Bewilligungen nach dem Wasserrechtsgesetz (WRG) benötigen, würden Kleinwasserkraft und Geothermie massiv benachteiligt, ohne dass daraus ein Nutzen für jemanden entstünde. Während für andere Technologien ein One-Stop-Shop für die Bewilligung etabliert werden soll und eine Strukturierung und Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens vorgesehen ist, bleiben für Geothermie und Kleinwasserkraft die Vielzahl an Einzelverfahren erhalten. Diese haben oft auch für kleine Projekte jahrelange Verzögerungen und sich widersprechende Bescheidauflagen zur Folge, so Ablinger.

HERAUSGEBER
Mag. Roland Gruber
VERLAG
Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG
Brunnenstraße 1, 5450 Werfen
Tel. +43 (0)664-115 05 70
office@zek.at
www.zek.at
CHEFREDAKTION
Mag. Roland Gruber, rg@zek.at
Mobil +43 (0)664-115 05 70
REDAKTION
Mag. Andreas Pointinger, ap@zek.at Mobil +43 (0)664-22 82 323
ANZEIGENLEITUNG / PR-BERATUNG
Mario Kogler, BA, mk@zek.at
Mobil +43 (0)664- 240 67 74
GESTALTUNG
Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG
Brunnenstraße 1, 5450 Werfen
Tel. +43 (0)664-115 05 70 office@zek.at
www.zek.at
UMSCHLAG-GESTALTUNG
MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Stabauergasse 5, A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662/8746 74

E-Mail: m.maier@rizner.at
DRUCK
Druckerei Roser

Mayrwiesstraße 23, 5300 Hallwang
Tel.: +43 (0)662-6617 37
VERLAGSPOSTAMT
A-5450 Werfen
GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN
zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich.


ABOPREIS
Österreich: Euro 78,00, Ausland: Euro 89,00 inklusive Mehrwertsteuer
zek HYDRO erscheint 6x im Jahr.
Auflage: 8.000 Stück
ISSN: 2791-4089
Der Technologiekonzern ANDRITZ erhielt von CH. Karnchang (Lao) Company Ltd. den Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für das neue Laufwasserkraftwerk Luang Prabang in Laos. Der Vertrag wird im Januar 2023 in Kraft treten. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2029 geplant. Der Lieferumfang umfasst Konstruktion, Fertigung, Lieferung, Transport, Montage, Tests und Inbetriebnahme von sieben großen Kaplanturbinen-Generator-Maschinensätzen (je 203 MW Leistung) und drei kleineren Maschinensätzen (je 18 MW) einschließlich Transformatoren, Turbinenreglern, Steuerungs-, Erregungsund Schutzsystemen, SCADA-Systemen sowie der elektrischen Nebenanlagen und der zugehörigen Hilfssysteme. Mit einer Nennleistung von 1.470 MW wird das Kraftwerk Luang Prabang eine Jahresproduktion von rund 6.500 GWh haben und erneuerbare Energie in das Stromnetz des Königreichs Thailand einspeisen.



AUSTRALIEN SETZT AUF PUMPSPEICHER-TECHNOLOGIE

Forscher der australischen Universität Australian National University (ANU) in Sydney haben eine Studie veröffentlicht, wonach man landesweit ca. 1.500 weitere Standorte identifiziert habe, die für Pumpspeicher-Zwecke geeignet wären. Sie sind der Meinung, dass damit die Abhängigkeit Australiens von fossilen Brennstoffen reduziert werden könne. Konkret fokussierten sich die Forscher auf Standorte mit einem bestehenden Reservoir und dem Potenzial für ein zweites Reservoir auf ungleichem Höhenniveau. Australien hat sich offiziell zum Ziel gesetzt, 82 Prozent seiner elektrischen Energie bis 2030 aus erneuerbaren Ressourcen zu produzieren. Bislang galt Australien aufgrund seiner Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen als einer der größten CO2-Emittenten der Welt. Die Forscher der ANU hatten zuvor bereits 530.000 Standorte für mögliche Pumpspeicherkraftwerke auf der ganzen Welt detektiert.

ÜBERGABE DER GESCHÄFTSLEITUNG BEI DER WILD ARMATUREN AG

Seit zwei Generationen ist die Wild Armaturen AG ein erfolgreiches Familienunternehmen. Gegründet wurde es im Jahr 1976 von Margrith und Kurt Wild. Nachdem Eliane und Massimo Wild das Unternehmen übernommen hatten, bauten sie dieses zum Systemanbieter aus. Unter ihrer Führung ist die Firma von zehn Mitarbeitenden auf rund 50 gewachsen. Nun, nach 30 Jahren erfolgreicher Geschäftsführung, ziehen sich die beiden Inhaber aus dem Alltagsgeschäft zurück. Die Führung des Unternehmens geben sie dabei vertrauensvoll in die erfahrenen Hände von Felix Landert. Mit Jahresbeginn 2023 hat Landert seine neue Aufgabe als CEO übernommen. Zuvor war er als COO für die operative Leitung verantwortlich und Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2022 ist neben Marco Decurtins (Verkauf) auch Fabienne Wild (Marketing & Kommunikation, Management-System und dritte Wild-Generation) in die Geschäftsleitung berufen worden. Zusammen werden sie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen. Massimo und Eliane Wild werden sich in Zukunft als Inhaber und Verwaltungsräte für die Firma engagieren. In dieser Funktion werden sie auch den Kontakt zu Kunden und Lieferanten weiterhin pflegen.

HYDRO NESS WASSERKRAFTSCHNECKE RÄUMT PREISE AB
Kurz nachdem die neue Wasserkraftschnecke am Fluss Ness in der Stadt Inverness mit dem britischen Structural Steel Design Awards 2022 bedacht worden war, folgte Ende letzten Jahres auch noch die prestigeträchtige Auszeichnung des National Construction Award. Zuvor hatte es bereits den Scottish Highlands & Islands Renewable Energy Award als bestes Onshore-Erneuerbaren Projekt in 2022 zugesprochen bekommen. Im Herzen des auffälligen Bauwerks, das mit Edelstahl umhüllt ist, dreht sich eine moderne Wasserkraftschnecke, die die Kraft des Flusses Ness hydroenergetisch nutzt. Die 92 kW starke Maschine liefert im Regeljahr rund 550.000 kWh und trägt somit zu einer CO2-Reduktion im Ausmaß von über 140.000 kg pro Jahr bei. Der Strom wird direkt an das benachbarte Inverness Leisure Centre geliefert, eine beliebte Sportund Wellness-Anlage, die zugleich einer der größten Stromverbraucher in der Region ist. Das Projekt River Hydro Ness soll in naher Zukunft auch den zahlreichen Besuchern nähergebracht werden – Video-Displays und Erklärtafeln sind geplant. Die nordschottische Stadt Inverness gilt mit ihren rund 280.000 Besuchern pro Jahr als die am viertstärksten besuchte Stadt Großbritanniens.

VERBUND-SCHWIMMKRAN BEI DONAUKRAFTWERK IM EINSATZ

Winterzeit bedeutet für die Wasserkraft auch, dass Revisionsarbeiten stattfinden können. Entsprechend einem Wartungsplan werden Turbinen und Wehrfelder außer Betrieb genommen und gründlich inspiziert. Damit die gewaltigen Anlagen überhaupt zugänglich werden, braucht es ebenso kräftige Hilfsmittel: Portalkran, Schwerlastbarge und vor allem den Schwimmkran DOKW 2. Dieses Wasserfahrzeug ist einzigartig an der Donau. Der Selbstfahrer kann bis zu 80 Tonnen schwere Lasten mit seinem Drehkran heben. Darüber hinaus ist eine hohe Standfestigkeit wichtig, denn die bis zu 30 Tonnen schweren Dammelemente müssen präzise in die Führungsschlitze am Wehrfeld eingefädelt und versenkt werden. Neben dem Wehrfeld wird auch eine der sechs Kaplan-Rohrturbinen zu Wartungszwecken trockengelegt, inspiziert und bei Bedarf ausgebessert. Die Arbeiten werden sich noch über einige Wochen erstrecken. Rechtzeitig zur Schneeschmelze wird das Kraftwerk AbwindenAsten dann wieder voll einsatzbereit sein.

RENEXPO INTERHYDRO STEHT IN DEN STARTLÖCHERN

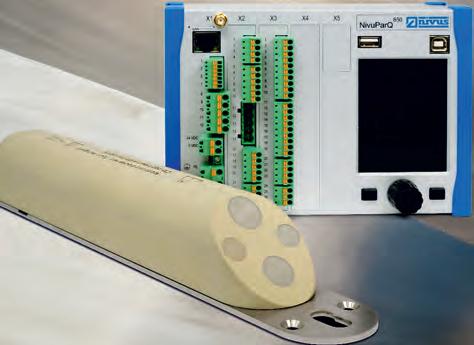

Ende März 2023 ist Salzburg mit der Renexpo Interhydro die Energiequelle, wenn es um neue Inputs aus der Branche geht. Die Fachmesse für Wasserkraft bietet eine perfekte Gelegenheit für Kundenkontakt, Networking, Unternehmens- und Produktpräsentationen sowie Informationsbeschaffung in allen branchenrelevanten Belangen. An beiden Tagen finden interessante Vorträge und Keynotes von Ausstellern und externen Hydro-Profis statt. Die Podiumsdiskussionen erfreuen sich prominenter Beteiligung aus Österreich, Deutschland und Italien. Beim Planer- und Betreibertag gibt es Auskunft über aktuelle Fördermöglichkeiten auf österreichischer und deutscher Seite. Die EREF organisiert im Rahmen des EU Projektes „HYPOSO“ einen Afrika-Tag als Kontaktplattform für europäische Unternehmen und afrikanischen Projektverantwortlichen. Zudem wird in verschiedenen Workshops unter anderem über die neuen EU Wasserkraftprojekte: ETIP Hydropower und Pen Hydropower informiert.


VERBUND UND BOREALIS BESCHLIESSEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT Borealis und VERBUND haben eine Stromabnahmevereinbarung (PPA) über eine Laufzeit von zehn Jahren zur Lieferung von Strom aus zwei VERBUND-Wasserkraftwerken an der Donau getroffen. Damit nähert sich Borealis dem Ziel, seine Polyolefin- und Kohlenwasserstoffproduktion bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Diese ab 1. Jänner 2023 gültige Vereinbarung folgt auf das kürzlich bekannt gegebene gemeinsame Projekt zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, das ebenfalls in Schwechat umgesetzt wird. „Die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele unserer Borealis Strategie 2030 rücken immer mehr in greifbare Nähe, nicht zuletzt dank unserer branchenübergreifenden Partnerschaft mit VERBUND“, erklärt Thomas Gangl, CEO von Borealis. Michael Strugl, VERBUND-Vorstandsvorsitzender, freut sich über die langfristige strategische Partnerschaft.


Am 1. November 2022 wurde Dr. Tobias Keitel zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Voith Hydro sowie zum Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Voith Group berufen. Er folgt auf Uwe Wehnhardt, der dem Unternehmen weiter als Senior Advisor zur Verfügung stehen wird. 2011 kam Tobias Keitel als Projektleiter zu Voith Hydro und wurde 2016 zum Mitglied der Geschäftsführung berufen. „Wir danken Uwe Wehnhardt für sein langjähriges Engagement und seinen wertvollen Beitrag für unser Unternehmen“, sagt Prof. Siegfried Russwurm, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Aufsichtsrates von Voith. „Zugleich freuen wir uns, mit Tobias Keitel einen internen Nachfolger in die Konzerngeschäftsführung berufen zu können, der das Wasserkraftgeschäft ausgezeichnet kennt.“ Nachfolger von Tobias Keitel und somit neuer Voith Hydro Chief Operating Officer wird Michael Rendsburg.

RWE STELLT MEGABATTERIE IN LINGEN UND WERNE FERTIG Anfang des Jahres wurde gemäß RWE-Presseaussendung eine „Megabatterie“ in Deutschland fertiggestellt. RWE hat in nur 14 Monaten ein Batteriesystem mit einer Gesamtleistung von 117 Megawatt (128 MWh) errichtet, das sekundenschnell für rund eine Stunde die ausgelegte Leistung bereitstellen kann. Insgesamt 420 Module mit Lithium-Ionen-Batterien verteilen sich auf die Kraftwerksstandorte Lingen (Niedersachsen, 49 MWh) und Werne (Nordrhein-Westfalen, 79 MWh). Roger Miesen, Vorstandsvorsitzender der RWE Generation: „Mit dem zunehmenden Ausbau der Erneuerbaren Energien braucht es in Deutschland innovative Speicherlösungen im industriellen Maßstab, die einspringen, wenn Wind und Sonne gerade nicht liefern. Was Größe und Technik betrifft setzen wir mit unserer Megabatterie hierzulande Maßstäbe. Die fertiggestellten Batteriespeicher und unsere Wasserkraftwerke an der Mosel werden künftig Hand in Hand arbeiten und so helfen, das Stromnetz zu stabilisieren.“ Der Batteriespeicher wird virtuell mit RWEs Laufwasserkraftwerken entlang der Mosel gekoppelt. Durch gezieltes Hoch- bzw. Herunterregeln der Durchflussmenge an diesen Anlagen kann RWE so zusätzliche Leistung als Regelenergie bereitstellen. Dadurch steigt die zur Netzstabilisierung nutzbare Gesamtleistung des Systems um bis zu 15 Prozent. Das Investitionsvolumen für die Megabatterie beträgt rund 50 Millionen Euro. Tests der von RWE entwickelten Software für die intelligente Kopplung mit den Moselkraftwerken verliefen erfolgreich. Ihr regulärer Einsatz soll noch im Frühjahr anlaufen. Bei der Umsetzung kam RWE ihre Expertise bei Energiespeichern zugute: Projektplanung, Modellierung, Systemintegration und Inbetriebnahme des Projekts hat das Unternehmen in Eigenregie umgesetzt. Durch die Errichtung der Megabatterie auf Flächen an bestehenden Kraftwerksstandorten können die Batterien Strom über bestehende Netzinfrastruktur ein- und ausspeisen.

Der Energiekonzern Vattenfall prüft, ob neue Speicherkapazitäten auf der Basis der Pumpspeichertechnologie in Deutschland eine wirtschaftliche Option darstellen, meldete das Portal IWR Online. Dazu hat Vattenfall die WSK Puls GmbH übernommen, die bislang für die Projektentwicklung des Vorhabens „Wasserspeicher-Kraftwerk Leutenberg/ Probstzella“ in Thüringen zuständig war. Als neuer Eigentümer will Vattenfall das Projekt in den kommenden Jahren weiterentwickeln und bewerten. Der Pumpspeicher könnte über eine Nennleistung von 400 MW verfügen. Für den Fall, dass das Vorhaben umgesetzt wird, würde das Bundesland Thüringen mit einer Speicherkapazität auf Basis von Wasserkraft von derzeit 1.500 MW auf dann gut 1.900 MW seine Position als ein wichtiger Player für die Energiewende und die Stabilität des deutschen Stromsystems weiter festigen, so Vattenfall.
KRAFTWERK THORENBERG AN DER KLEINEN EMME WIRD FISCHDURCHGÄNGIG
Zum vergangenen Jahreswechsel waren die Bauarbeiten zur Herstellung einer Fischaufstiegsanlage beim Kraftwerk Thorenberg in der Stadt Luzern voll im Gang, so der Betreiber ewl energie wasser luzern in einem Onlinebeitrag. Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit errichtet ewl eine Fischaufstiegshilfe in Form eines Vertical-Slot-Pass. Darüber hinaus werden die Wasserfassung, der Spazierweg und eine Fußgängerbrücke umfassend erneuert. Die Restwasserabgabe an der Wehr wird zukünftig über den Fischaufstieg geleitet und erzeugt somit die notwendig Lockströmung für die Gewässerlebewesen. Die sanierte Wasserfassung soll im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Abgeschlossen ist das Projekt für ewl damit aber noch nicht. „Wir starten zeitgleich mit der Inbetriebnahme das Monitoring der Anlage. Dabei überprüfen wir während zwei Jahren, ob und wie die Fische ihre neue Treppe tatsächlich nutzen“, so ewl-Projektleiter Rolf Stalder.


WASSERKRAFTWERK REICHENAU PRODUZIERT KÜNFTIG AUCH WASSERSTOFF

Axpo und Rhiienergie bauen beim Wasserkraftwerk Reichenau in Domat/Ems eine Wasserstoffproduktionsanlage. Die Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2023 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 350 t grünen Wasserstoff produzieren. Nach dem Baubewilligungsverfahren haben Axpo und Rhiienergie am 23. Jänner 2023 die Bauarbeiten der 2,5 MW-Wasserstoffproduktionsanlage begonnen. Die Anlage wird direkt ans Wasserkraftwerk Reichenau angeschlossen, an welchem Axpo eine Mehrheitsbeteiligung hält. Die Produktion von bis zu 350 t Wasserstoff jährlich entspricht ca. 1,5 Millionen Liter Diesel, der im Kanton Graubünden und dem benachbarten Rheintal eingespart werden kann. Gemeinsam investieren Axpo und Rhiienergie mehr als 8 Millionen CHF in die Anlage. Grüner Wasserstoff, welcher mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird, gilt als Pfeiler der Energiewende. Die Wasserstoffanlage beim Kraftwerk Reichenau ist eine von mehreren Anlagen bei Flusswasserkraftwerken, die Axpo in den nächsten Jahren in der Schweiz plant.

WASSERKRAFTWERK LAAS UMFASSEND MODERNISIERT
Anfang 2023 hat der Südtiroler Energieversorger Alperia die Modernisierung des in den 1950er Jahren errichteten Kraftwerks Laas abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 40 Millionen Euro, davon rund 24 Millionen für die Installation einer neuen, ca. 2,2 Kilometer langen unterirdischen Druckrohrleitung. Der Austausch des Kraftabstiegs, der fast ausschließlich mit lokalen Betrieben durchgeführt wurde, erfolgte mit dem Ziel, die Effizienz der Anlage unter Einhaltung der Umweltauflagen zu verbessern und den sicheren Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Die Modernisierungsarbeiten umfassten außerdem den Austausch der Wasserableitungsrohre der Beileitungen und deren Verteilerkabinen. Auch das Kraftwerk selbst wurde einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Es wurden der Generator und der Maschinentransformator ausgetauscht, die Turbinen modernisiert und das Automatisierungs- und Kontrollsystem sowie die elektrische Ausrüstung vollständig erneuert. Dank dieser umfangreichen Eingriffe ist das Wasserkraftwerk Laas nun wieder auf dem neuesten Stand der Technik und in der Lage, die Herausforderungen der Netzregulierung und -stabilität mit nachhaltiger Energie zu meistern.


MIT NEUEN UMSPANNWERKEN FÜR DIE ENERGIEZUKUNFT GERÜSTET

Vier neue Umspannwerke hat die Netz Oberösterreich GmbH, ein Unternehmen der Energie AG, im Jahr 2022 in Betrieb genommen. Laut Pressemeldung wurden dafür rund 45 Millionen Euro investiert. Die neuen Anlagen ermöglichen eine bessere und leistungsfähigere Versorgung in den Regionen Raab, Hörsching, Ohlsdorf und Kronstorf. Gleichzeitig schaffen sie neue Netzkapazitäten, die für die Aufnahme von dezentral erzeugtem Sonnenstrom notwendig sind. Manfred Hofer, Geschäftsführer von Netz Oberösterreich: „Umspannwerke sind die zentralen Schaltstellen im Stromnetz, mit denen eine leistungsfähige und zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit Strom sichergestellt werden kann.“ Manfred Hofer zur Bedeutung der neuen Anlagen: „Jedes Umspannwerk ist ein wesentlicher Schritt beim Umbau unseres Energiesystems. Wir werden in Zukunft sehr viel mehr Strom brauchen. Mit den neuen Umspannwerken können wir diesen zuverlässig und in entsprechender Qualität zur Verfügung stellen.“ Generell bringen Umspannwerke auch mehr Möglichkeiten für die Errichtung von PV-Anlagen in den angeschlossenen Ortsnetzen. Zentral ist Ihre Bedeutung aber dann, wenn z.B. PV-Großkraftwerke geplant werden.
Sie benötigen 1.4313 oder einen anderen Sonderwerkstoff?
Zuschnitte und Bleche direkt ab Lager schnellstmöglich bei Ihnen!
Sprechen Sie mich an: Bojan Milanovic bm@nironit.de

+49 4108 4301 32
CHINA STELLT ZWEITGRÖSSTES WASSERKRAFTWERK DER WELT FERTIG
Das Kraftwerk Baihetan ist eines von sechs riesigen Wasserkraftanlagen entlang des Yangtse-Flusses in China. Das Leistungsvermögen der Anlage wird nur vom Kraftwerk Drei-Schluchten-Talsperre, dem größten Wasserkraftwerk weltweit, übertroffen. Beim zweitgrößten Wasserkraftwerk der Welt ging Ende Dezember 2022 die finale stromerzeugende Komponente ans Netz, womit die Anlage endgültig fertiggestellt ist, berichtete futurezone.at. Die Bauarbeiten für das Großprojekt, das unter anderem die Errichtung eines 289 m hohen Damms beinhaltete, starteten im Sommer 2017, 2019 wurde die erste Turbine installiert. Die offizielle Eröffnung des Kraftwerks Baihetan fand bereits im Vorjahr statt. Zur Stromerzeugung nutzt die Anlage insgesamt 16 Turbinen mit einer Engpassleistung von jeweils 1 Gigawatt. Das Regelarbeitsvermögen der Anlage liegt bei ca. 62.000 GWh. Laut dem staatlichen Sender CCTV können mit dem Wasserkraftwerk jährlich mehr als 90 Millionen Tonnen Kohle eingespart werden.










• werden sowohl im Schleuder- als auch im Wickelverfahren hergestellt
• einlaminierte EPDM-Dichtung für sichere und einfache Montage
















• längskraftschlüssig
• ÖNORM geprüft
EXKLUSIV PARTNER für Schweiz, Liechtenstein, Österreich

• ÖNORM geprüft
• ÖVGW geprüft

Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, stand als zentrales Leitmotiv über dem jüngsten Nutzwasserprojekt im Südtiroler Nationalpark Stilfser Joch im italienisch-schweizerisch-österreichischen Dreiländerdreieck. Ausgehend von einer völligen Neukonzeptionierung eines bestehenden Kraftwerks am Suldenbach durch die Energie-Werk Prad Genossenschaft sollten im Rahmen der Projektumsetzung auch die bestehende Beregnungsanlage erneuert, eine neue Trinkwasserleitung und sogar ein neuer Radweg hinauf aufs Stilfser Joch errichtet werden. Rund 11 Mio. Euro des 20 Mio. Euro schweren Projekts flossen in den Neubau des Kraftwerks Suldenbach. Mit der neuen Peltonturbine aus dem Hause Troyer liefert die neue Ökostromanlage rund 21 GWh im Jahr, das bedeutet eine Verdreifachung des Stromertrags aus dem Altbestand.
Mit seiner maschinellen Ausrüstung war das alte Kraftwerk Mühlbach 1 etwas ganz Besonderes: Wo sonst findet man in einem Krafthaus Francis-, Kaplanund Peltonturbine unter einem Dach? „Wir haben das früher auch gerne bei Führungen präsentiert. Schulklassen etwa konnte man hier sehr anschaulich die drei wichtigsten Turbinentypen in unseren Breiten erklären“, erzählt Mag. Michael Wunderer, seines Zeichens geschäftsführender Verwaltungsrat der Energie-Werk Prad Genossenschaft, deren 100-jährige Geschichte vor allem auf der Nutzung der lokalen Wasserkraft fußt. Heute betreibt die Genossenschaft neben einem 28 km langen Fernwärmenetz auch ein 120 km langes Mittel- bzw. Niederspannungsnetz, über welches die Kunden und Mitglieder mit Ökostrom versorgt werden. Dieser stammt zum Großteil aus vier Wasserkraftwerken und vier Kraftwärmekopplungsanlagen. Eines dieser vier Kleinkraftwerke war das Kraftwerk Mühlbach 1, das bereits Anfang der 1980er

errichtet worden war. Es wurde nun erfolgreich erneuert und ausgebaut.
KONKURRENZKAMPF UM BESTES PROJEKT
Dass man das Kraftwerk Mühlbach 1 massiv ausbauen könnte, war einem schon seit langer Zeit bewusst: dem Vinschgauer Energiepionier Georg Wunderer. Der Onkel des heutigen Geschäftsführers stand als Obmann 40 Jahre der Energiegenossenschaft vor und propagierte seinerzeit das Leit-Motto „Energie von daheim“. Der Ausbau des Kraftwerks Mühlbach 1 blieb ihm dabei stets ein besonderes Anliegen. „Entscheidende Rahmenbedingungen für eine erweiterte Nutzung am Suldenbach schaffte einerseits das neue Landesgesetz aus dem Jahr 2015 hinsichtlich Genehmigung von mittleren und kleineren Ableitungen. Und andererseits die Konkretisierung möglicher wasserwirtschaftlicher Nutzungsoptionen im „Plan der sensiblen Gewässer“ – ein Beschluss, der 2015 von der Landesregierung Tirol gefasst wurde. Wir befinden uns hier ja im National-
park Stilfserjoch, einem der größten Naturschutzgebiete Europas. Das heißt, dass bei jedem Wasserkraftprojekt natürlich ganz genau hingeschaut werden muss“, sagt Michael Wunderer. Doch diese Optionen wurden auch andernorts wahrgenommen – und das sollte für tiefe Sorgenfalten bei der Energiegenossenschaft sorgen. „Tatsächlich wurde prompt von einem anderen Südtiroler Projektentwickler ein Projekt eingereicht. Und zwar vor uns, obwohl wir unser Projekt im Grunde in der Schublade hatten“, so Michael Wunderer. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sollte jedoch den Ausschlag für das Projekt der „Hausherren“ geben, wie der bekannte Südtiroler Planer Dr.-Ing. Walter Gostner vom Büro Patscheider & Partner näher ausführt:
„Das Erstprojekt sah die Einbeziehung eines zusätzlichen, bislang nicht genutzten Gewässerabschnitts vor, wodurch es gemäß der Richtlinien zur Wassernutzung im Nationalpark Stilfser Joch ausschied. Unser Projekt hingegen hatte sich ausschließlich auf Bestandsstre-
cken beschränkt, was letztlich den Ausschlag gab.“ Im Sommer 2018 erteilte die Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich des Landes Südtirol der Energie-Werk Prad Genossenschaft den Zuschlag. Der Spiritus rector hinter dem Projekt, Georg Wunderer, erlebte die freudige Nachricht noch, er verstarb im selben Jahr.


Streng genommen handelte es sich beim Altbestand um ein Doppel-Kraftwerk, da die drei installierten Maschinensätze über zwei Zuleitungen angespeist worden waren. Walter Gostner: „Anfang der 1980er wurden gemäß Stand der Technik eine Francis- und eine Kaplanturbine installiert, um das Wasserdargebot zu nutzen. Im Vergleich zur neuen Anlage war die Fallhöhe mit ca. 20 m wesentlich geringer, allerdings konnte man 4.500 l/s damit nutzen. Der Pelton-Maschinensatz folgte 1987 mit dem Bau der Beregnungsleitung für die Prader und Agumser Felder, über die in einer Parallelnutzung auch Strom erzeugt wurde. Sie erstreckte sich damals schon über jene Gefällstufe mit 180 m Fallhöhe von der Schmelz hinauf bis zur Stilfser Brücke, die heute für das neue Kraftwerk vollständig genutzt wird.“ Der wesentliche Unterschied zum Konzept für das neue Projekt lag nun einerseits in einer vom Kraftwerksbetrieb abgekoppelten Beregnungsleitung und andererseits in einer separaten Turbinenleitung. Dabei nutzt das neue Kraftwerk die bereits vormals vom Beregnungskraftwerk genutzte Gefällstufe, nämlich von der Stilfser Brücke bis zur Schmelz. Zu diesem Zweck sollte eine neue Druckrohrleitung der Dimension DN1200 über die Gesamtlänge von 3,3 km errichtet werden. „Bevor wir an die Umsetzung gingen, wollten wir noch einmal die Wirtschaftlichkeit des Projekts prüfen. Schließlich war man 2018 noch weit weg von den Strompreisen dieser Tage“, erinnert sich Michael Wunderer und ergänzt: „Im Zuge dieser Projektanalyse, bei der wir am Ende von einem
Kalkulationswert von 5 ct/kWh für die 30-jährige Konzessionsdauer ausgingen, haben wir gesehen, dass sich einige sehr interessante Synergieeffekte erzielen lassen.“ Zusammen mit dem Planungsbüro Patscheider & Partner erweiterte man das Kraftwerksprojekt Schritt für Schritt zu einem Mehrzweckprojekt, das heute als Vorzeigemodell gilt.
CRUX MIT GLETSCHERWASSER
Grundvoraussetzung dafür war allerdings, wie Walter Gostner und Michael Wunderer unisono betonen, dass man alle betroffenen Parteien an Bord holte. Für das Bonifizierungskonsortium Vinschgau stand natürlich die Erneuerung der Beregnungsleitung im Vordergrund. Die bestehende Stahlleitung wies bereits einige korrosionsbedingte Schwachstellen auf, wie Michael Wunderer feststellt. Doch auch das verwendete Wasser spielte eine zentrale Rolle. Dazu Walter Gostner: „Der Suldenbach und
sein wichtigster Zufluss, der Trafoibach, nehmen ihren Ursprung im Ortlergebiet. Mit 3.900 m ist der Ortler der höchste Berg Südtirols. Demzufolgen speisen mehrere Gletscher den Sulden- und Trafoibach, wodurch vor allem im Hochsommer beide Bäche stark suspensionsbeladen sind. Und gerade diese feinen Sedimente sind für die Beregnung extrem ungünstig. Im Hinblick auf die Oberkronenberegnung führen sie leicht zur Verstopfung der feinen Düsen, und bei der Tropfberegnung werden die Filter übermäßig beansprucht. Außerdem verursacht das trübe Wasser unerwünschte Staubeinschlüsse in der Apfelblüte. Daher war eine Alternative zum Wasser aus dem Suldenbach gewünscht.“ Die Lösung bestand nun darin, dass für die Beregnung exklusiv Wasser aus dem nahgelegenen, sedimentarmen Tramentanbach herangezogen und über eine eigene Leitung zur Zentrale in die Schmelz in Prad geleitet wird. Da der für die Landwirt-

Über
schaft im bekannt wasserarmen Vinschgau so wichtigen Beregnung Priorität eingeräumt wird, wurde dafür eine eigene technische Lösung entwickelt: Sollte der Tramentanbach zu wenig Wasser liefern, wird über ein automatisch öffnendes Schwimmerventil Wasser von der Oberwasserkammer des Kraftwerks in die Oberwasserkammer der Beregnung geleitet.


Ein weiterer zentraler Synergieeffekt sollte sich zudem für die Gemeinde Prad ergeben, die bislang stets mit der Qualität ihres Trinkwassers zu kämpfen gehabt hätte, wie Michael Wunderer schildert: „Für die Gemeinde Prad tat sich damit die Möglichkeit auf, die wasserreichen und qualitativ hochwertigen Rosimquellen in Sulden nutzen zu können. Damit kann die Trinkwasserversorgung in der wachsenden Gemeinde Prad über Jahrzehnte sichergestellt werden. Nachdem die politischen Vorgespräche mit der Nachbargemeinde Stilfs

erfolgreich verlaufen waren, entschied man sich, die dafür erforderliche Leitung in der geplanten Trasse von Kraftwerks- und Beregnungsleitung mitzuverlegen.“
Damit nicht genug. Noch eine weitere Synergieoption sollte sich im informellen Austausch mit den Gemeinden Prad und Stilfs, dem Tourismusverband, Nationalpark, Land und Behörden ergeben: eine eigene Rad-Aufstiegsspur zum Stilfserjoch von Prad nach Gomagoi. „Als eine der höchstgelegenen Passstraßen der Südalpen ist die Stilfserjochstraße bislang bei Radfahrern berüchtigt gewesen, da man sich die enge Bergstraße mit allen anderen Verkehrsteilnehmern teilen musste. Nun konnte der erste Abschnitt für eine separate Radspur – auf der geschlossenen Rohrtrasse bis zur Wasserfassung an der Stilfser Brücke angelegt werden. Er soll noch im kommenden Frühling offiziell eröffnet werden. Der zweite Abschnitt nach Gomagoi soll dann in einem Folgeprojekt realisiert werden“, erklärt Michael Wunderer. Die Kos-
ten dafür übernehmen die Bezirksgemeinschaft und das Land. Im Rahmen dieser Bauarbeiten wurde als weiterer Synergieeffekt die Staatsstraße an zwei Stellen bergwärts versetzt und eine Kurve entschärft.
BAUFIRMEN AUS DER REGION
Offizieller Start für die Bauarbeiten an dem durchaus komplexen Mehrzweckprojekt war in der ersten Oktoberwoche 2021. Trotz Problemen mit den bestellten Stahlrohren gestalteten sich die Arbeiten sehr zügig. Die beauftragten Baufirmen – mit Hofer Tiefbau, Marx Hoch- und Tiefbau sowie der Mair Josef KG allesamt erfahrene Branchenunternehmen aus der Gegend – profitierten dabei auch vom schneearmen Winter, der ein Durcharbeiten ohne Unterbrechung möglich machte. „Die Stahldruckrohrleitung der Dimension DN1200 wurde über die gesamte Länge von 3,3 km im Gefälle ohne Hoch- und Tiefpunkt verlegt. Die Druckprobe im April letzten Jahres bestä-

In der Entsandungsanlage wurde von Gufler Metall das bewährte HSR-System installiert, das dafür sorgt, dass es keine intermittierenden Entsanderspülungen benötigt.

eine Gesamtlänge von 3,3 km erstreckt sich die Rohrtrasse, in der nicht nur die stählerne Druckrohrleitung, sondern auch eine Leitung für die Beregnung und eine Trinkwasserleitung unterirdisch verlegt worden sind.Das neue Fassungsbauwerk noch im Rohbau. Die Sanierung und Aushöhlung des Maschinenhauses sind aufwändig.
tigte, dass die gesamte Bietergemeinschaft sehr gut gearbeitet hatte. Sowohl die TrinkwasserDN200 als auch die Beregnungsleitung DN500 wurden aus Gussrohren des Tiroler Traditionsherstellers TRM erstellt.“
Komplett erneuert wurde auch die Wasserfassung an der Stilfser Brücke. Dieses Baulos wurde dabei mustergültig von der Mair Josef KG umgesetzt. Das Fassungsbauwerk besteht im Wesentlichen aus einem Wehrfeld mit einer stählernen Fischbauchklappe und Seiteneinzug, einem Kiesgang und der Doppel-Entsanderkammer. Letztere wurde mit dem modernen HSR-Entsandungssystem ausgeführt, das einen kontinuierlichen Kraftwerksbetrieb ohne intermittierende Spülungen ermöglicht. Geliefert wurde selbiges vom Südtiroler Stahlwasserbau-Profi Gufler Metall aus Moos im Passeiertal, der für die gesamte stahlwasserbauliche

Ausrüstung der Wasserfassung verantwortlich zeichnete. Einzige Ausnahme stellt die Horizontal-Rechenreinigungsmaschine dar, die in Sub an den ebenfalls über die Südtiroler Grenzen hinaus bekannten Stahlwasser- und Maschinenbauer Wild Metal aus Ratschings vergeben wurde. Dessen horizontale Rechenreinigungsmaschinen genießen in der Branche einen hervorragenden Ruf aufgrund ihrer Zuverlässigkeit. Direkt aus der Fertigung von Gufler Metall stammt die stählerne, 12 m breite Wehrklappe, die von einer Seite von einem Hydraulikzylinder betrieben wird – und die für einen konstanten Pegel an der Wehranlage sorgt. Darüber hinaus lieferten die Passeirer Stahlbauer auch den Kiesgangschütz mit aufgesetzter Geschwemmselklappe, den 6 m breiten Einlaufschütz und die Rohrbruchklappen für die Turbinen- und die Beregnungsleitung. Und noch ein weiteres wichtiges Bauteil sollte Gufler Metall beisteuern. „Im ersten Betriebsjahr


haben wir festgestellt, dass das Beregnungswasser relativ trüb war und auch kleinere Zweige und Laub durch den Feinrechen, der eine Spaltbreite von 1,5 cm aufweist, in die Beregnungsleitung gelangten. Da mussten wir noch einmal reagieren“, erklärt Walter Gostner. In der Folge wurde Gufler Metall mit der Installation eines zusätzlichen Coanda-Rechens beauftragt. Dieser sorgt in der Druckhaltekammer der Beregnung dafür, dass das Feingeschwemmsel effektiv abgehalten wird. Zudem handelt es sich dabei um ein selbstreinigendes System, das kaum Wartungsaufwand erfordert.
AUS 3 MASCHINEN WIRD 1
Im Gegensatz zum Fassungsbauwerk und der Druckrohrleitung wurde das bestehende Maschinenhaus nicht komplett ersetzt. Vielmehr wurde es von der beauftragten Baufirma Systembau sehr aufwändig ausgehöhlt und für den Einbau eines einzigen, hochmodernen
Maschinensatzes umgebaut. Anstelle der drei unterschiedlichen Maschinensätze sollte nun eine einzige, 4-düsige Peltonturbine mit einem direkt gekoppelten Synchrongenerator treten, die allerdings für neue Leistungsmaßstäbe sorgen sollte. In der Frage der elektromaschinellen und zugleich auch in der leittechnischen Ausrüstung der Anlage setzten die Betreiber ebenfalls auf die Kompetenz eines höchst etablierten Südtiroler Anbieters: auf die Technik des Sterzinger Traditionsherstellers Troyer, der eine maßgeschneiderte elektromechanische Ausrüstung zur Maximierung der Stromerzeugung im Werk Suldenbach lieferte. Konkret umfasste der Auftrag des Sterzinger Wasserkraftallrounders nicht nur die 4-düsige Peltonturbine und den Marelli-Generator, sondern auch den Bypass zur Beregnungsleitung, sowie die erforderliche Absperrklappe im Maschinenhaus. Bei einer effektiven Fallhöhe von 173,4 m und einer Ausbauwassermenge von 1.980 l/s kommt die Maschine auf eine installierte Leistung von 3,0 MW.
Mit dem neuen Maschinensatz gelang der Energiewerk Prad Genossenschaft der erhoffte Quantensprung in ihrer Energieerzeugung: „Mit dem alten Kraftwerk Mühlbach 1 kamen wir im Jahr selten über 7 GWh Strom hinaus, jetzt produziert das neue Kraftwerk Suldenbach mit 21 GWh im Regeljahr rund das Dreifache“, freut sich Michael Wunderer. Für ihn und die Energiegenossenschaft ein echter Meilenstein, auch wenn ihr die Anlage nur zu zwei Drittel gehört. Das andere Drittel sicherte sich das E-Werk Stilfs, schließlich liegen 33 Prozent des
Kraftabstiegs – der obere Teil – auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Stilfs. Doch das schmälert keineswegs die Bedeutung des Projekts für die Energiewerk Prad Genossenschaft, wie deren Geschäftsführer betont: „Heute erzeugen wir in Summe zwischen 30 und 32 GWh Strom mit unseren Erzeugungsanlagen. Dank der erhöhten Erzeugungskapazität aus dem KW Suldenbach können wir nun alle unsere Kunden, sowohl die Genossenschaftsmitglieder als auch die anderen Stromkunden, jederzeit mit eigenem Strom versorgen – auch im Winter.“ Eine beachtliche Leistung: Schließlich handelt es sich bei Prad um eine kontinuierlich wachsende Gemeinde, die auch einen sehr vitalen Industrie- und Gewerbesektor beheimatet.

Nicht länger als ein gutes halbes Jahr hatte das E-Werk für den Neubau des Kraftwerks gebraucht. Anfang Juni konnte der neue Maschinensatz erfolgreich ans Netz gebracht werden. Seitdem läuft die Anlage ruhig, zuverlässig und effizient – wie ein Uhrwerk. Was die anderen Synergieprojekte angeht, so sind noch nicht alle fertiggestellt. Zwar wurde die Beregnungsanlage bereits im April letzten Jahres in Betrieb genommen, doch an der neuen Trinkwasserleitung in Prad wird noch gebaut. Michael Wunderer und Walter Gostner rechnen damit, dass Prad aber schon in zwei, drei Jahren sein Trinkwasser hauptsächlich aus dieser neuen Versorgungsleitung beziehen wird. Die neue Radaufstiegsroute soll noch vor dem Sommer freigegeben werden. Sie soll dann zusammen mit den anderen Teilen des umfangreichen Mehrzweckprojektes der Öffentlichkeit vorgestellt und gebührend eröffnet werden.
• Ausbauwassermenge: 1.980 l/s
• Turbine: 4-düsige Peltonturbinen
• Drehzahl: 500 Upm
• Generator: Synchron
• Fabrikat: Marelli Motori
• Stahlwasserbau: Gufler Metall
• Stauklappe: Länge 12 m

• Kiesgangschütz: b: 1,7 m h: 2,5 m
• Rechen-RRM: Horizontalanlage
• Druckrohrleitung: Stahl
• Beregnungsleitung: DN500 Guss (TRM)
• Bau: Hofer Tiefbau, Marx Hoch- und
• Netto-Fallhöhe bei Qmax: 173,4 m
• Fabrikat: Troyer
• Mittlere Nennleistung: 2,99 MW
• Generatorleistung: 3,8 MVA
• Kühlung: wassergekühlt
• Entsandung: Typ: HSR
• Stauhöhe: 1,5 m
• Einlaufschütz: b: 7,5 m h: 1,0 m
• Fabrikat: Wild Metal
• Länge: 3.300 m DN1200
WildMetalGmbH
HandwerkerzoneMareitNr.6
Tel.+390472759023
• I-39040Ratschings
• info@wild-metal.com
• Baumeisterarbeiten: Systembau (Kraft
• Planung: Patscheider & Partner

• Inbetriebnahme: Juni 2022
• Trinkwasserleitung: DN200 Guss (TRM) Tiefbau sowie Mair Josef KG haus) u. Schönthaler & Söhne (Fassung)
• Steuerung & E-Technik: Troyer
• Regelarbeitsvermögen: 21 GWh
In der Obersteiermark wurde mit dem Wasserkraftwerk Kleinsölkbach vor kurzem eine neue Ökostromanlage errichtet. Realisiert wurde das Projekt unter der Federführung des E-Werks Gröbming, das mit seiner neuesten Anlage nun an insgesamt 13 Standorten in der Region sauberen Strom aus Wasserkraft erzeugt. Der Einzug von 6 m³/s Ausbauwassermenge erfolgt an einem von den beiden Oberliegerkraftwerken gespeisten Sammelbecken, wodurch kein separates Querbauwerk im Gewässer errichtet werden musste. Vom Sammelbecken ins Maschinengebäude gelangt das Triebwasser über eine ca. 3,4 km lange Druckleitung aus GFK-Rohren. Im Krafthaus sorgen zwei unterschiedlich groß dimensionierte Francis-Turbinen in horizontalachsiger Ausführung mit über 3,7 MW Engpassleistung für ein Maximum an Effizienz. Durch den Neubau hat die nachhaltige Energieproduktion im Kleinsölktal einen Zuwachs von rund 13 GWh Ökostrom im Regeljahr erhalten.

Das 1909 gegründete E-Werk Gröbming zählt zu den ältesten Unternehmen im oberen Ennstal und genießt als zuverlässiger Partner für alle energietechnischen Belange einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung. Über das rund 600 km lange Leitungsnetz versorgt der moderne Energiedienstleister eine Vielzahl von Groß- und Kleinabnehmer in insgesamt sechs Gemeinden. Zudem beinhaltet das Leistungsspektrum des Unternehmens auch die Bereiche elektrische Installationen, Photovoltaik, Elektro-Fachhandel und E-Mobilität. Bei der Eigenstromerzeugung setzt das E-Werk Gröbming traditionell ausschließlich auf erneuerbare Ressourcen, wobei neben zwei

Photovoltaik-Anlagen vor allem die Nutzung von Wasserkraft die tragende Rolle spielt.
OBERLIEGER SPEISEN NEUBAU
Gleich zwei Wasserkraftprojekte – eine Anlagenerweiterung sowie ein Neubau – hat das E-Werk Gröbming vor kurzem im Kleinsölktal erfolgreich realisiert. Beim zek HYDRO Lokalaugenschein berichtet Gerhard Seebacher, Technischer Leiter und Projektkoordinator beim E-Werk Gröbming, dass ursprünglich nur der Bau eines Kraftwerks am Kleinsölkbach vorgesehen war. „Die erste Idee für eine neues Kraftwerk im Kleinsölktal entstand um das Jahr 2012. Als das Konzept weiter ausgearbeitet wurde, konnte mit den von der Anlageninfrastruktur betroffenen Grundstückseigentümern frühzeitig ein gutes Einvernehmen hergestellt werden. Auch die zuständigen Behörden und die naturschutzrechtlichen Stellen hatten dem Bauvorhaben grünes Licht erteilt, womit man 2016 ein mögliches Projekt in der Schublade hatte. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt die Energiepreise im unteren Bereich angesiedelt




und man hat sich dazu entschlossen, mit der Projektumsetzung noch zuzuwarten.“ Auf wirtschaftliche Beine konnte das Projekt schließlich durch den Einbezug der beiden Oberliegerkraftwerke Schwarzenseebach und Sagschneider gestellt werden. Die Maschinengebäude der Anlagen, die ebenfalls vom E-Werk Gröbming betrieben werden, liegen in unmittelbarer Nähe zueinander am Ursprung des Kleinsölkbach. „Das adaptierte Konzept bestand darin, das von den Bestandskraftwerken turbinierte Wasser in ein gemeinsames Sammelbecken zu leiten und von dort direkt über eine Druckrohrleitung ins Krafthaus des Neubaus zu führen. Mit dieser synergetischen Lösung musste kein baulich aufwändiges Querbauwerk im Gewässer errichtet werden“, erklärt Gerhard Seebacher. Bei dem im Jahr 2005 komplett erneuerten Kraftwerk Sagschneider sollte zudem auch die Ausbauwassermenge verdoppelt und eine zweite Turbine eingebaut werden. Dies ermöglichte eine deutliche Steigerung von Leistungs- und Erzeugungspotential bei der Bestandsanlage und die damit einhergehende Gewährleistung
des geförderten Ökostromtarifs. Gleichzeitig kommt die erhöhte Ausbauwassermenge auch dem neuen Kraftwerk Kleinsölkbach zugute und stellt dessen wirtschaftlichen Betrieb sicher.
Die Umplanungen erforderten ein wasserrechtliches Optimierungsverfahren, das von behördlicher Seite und den Naturschutzbeauftragten positiv bewertet wurde. Zuständig für die Generalplanung war das Grazer Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Zöschg & Groß GmbH, das seine Kompetenz schon in der Vergangenheit bei unterschiedlichen Projekten für das E-Werk Gröbming unter Beweis gestellt hatte. Bei der Ausschreibung qualifizierten sich zudem eine ganze Reihe von bewährten Branchenexperten für die Bau- und Techniklose. Die kompletten Hoch- und Tiefbauarbeiten inklusive Druckrohrverlegung erledigten die Professionisten der Unternehmensgruppe Gebr. Haider, deren Energieerzeugungssparte ebenfalls an der Kraftwerk Kleinsölkbach
teiligt ist. Als dritter Gesellschafter für den Neubau wurde die Gemeinde Sölk ins Boot geholt. Gerhard Seebacher lässt nicht unerwähnt, dass im Hinblick auf die regionale Wertschöpfungskette bewusst eine ganze Reihe von lokalen Unternehmen in die Projektumsetzung eingebunden wurden.


Am 15. März 2021 startete die Umsetzungsphase des Projekts inmitten eines verspäteten Wintereinbruchs. Um den Neubau und die Erweiterung des Kraftwerk Sagschneider möglichst rasch und effizient zu realisieren, waren mehrere Bau-Teams parallel im Einsatz. Beim Kraftwerk Sagschneider musste aufgrund der Verdoppelung der Ausbauwassermenge von 1,5 auf 3 m³/s fast die gesamte Infrastruktur der Anlage angepasst werden. Unberührt von den Bauarbeiten blieb im Prinzip nur die bestehende Druckrohrleitung DN1000. Da der Kraftabstieg ursprünglich nur auf einen maximalen Durchfluss von 1,5 m³/s ausgelegt war, führt die Verdoppelung der Wassermenge wegen der damit einhergehenden Reibungsverluste unweigerlich zu einer Verminderung der Nettofallhöhe. Nichtsdestotrotz konnten sowohl das
Leistungspotential als auch das Regelarbeitsvermögen der Anlage durch die erhöhte Nutzwassermenge erheblich gesteigert werden. Im erweiterten Maschinengebäude wurde die vorhandene Diagonal-Turbine um eine ebenso horizontalachsige Francis-Turbine vom oberösterreichischen Hersteller Global Hydro Energy GmbH ergänzt. Die beiden Maschinensätze kommen bei vollem Wasserdargebot auf 1.570 kW Engpassleistung und können im Regeljahr durchschnittlich rund 5,7 GWh Ökostrom erzeugen. Mehrere technische und bauliche Adaptierungen waren auch an der Wasserfassung der Anlage notwendig. Das Volumen des Entsanderbeckens wurde durch einen seitlichen Anbau an die bestehende Kubatur verdoppelt und somit die ordnungsgemäße Filtration der Sedimente aus dem Triebwasser gewährleistet. Die Sedimentrückgabe in dem nun aus zwei getrennten Kammern bestehenden Bauwerk erfolgt durch eine hydraulisch bewegte Spülklappe. Auch der Grobrechen am Tiroler Wehr musste für den verdoppelten Wassereinzug angepasst werden. Dazu wurde die Fläche eines beim Genehmigungsverfahren als nicht mehr notwendig erachteten Kleintieraufstiegs am Tiroler Wehr für die Verbreiterung um 80



Zentimeter genutzt. Der Grobrechen wurde mit speziellen Rechenstäben ergänzt, deren strömungsoptimiertes Profil die Geschwemmselabfuhr begünstigt. Um den Einzug von 3 m³/s Ausbauwassermenge zu ermöglichen, wurde zudem der Wintereinlauf für den ganzjährigen Betrieb adaptiert und ein automatischer Schütz installiert. Eine Umrüstung bedurfte auch die Feinrechenanlage vor der Druckrohrleitung. Dabei wurden der bestehende Vertikalrechen und die Rechenreinigungsmaschine verbreitert sowie der Rechenreiniger neu zentriert. In Summe nahmen die Arbeiten zur Erweiterung des Kraftwerks Sagschneider etwas mehr als ein halbes Jahr in Anspruch. Weitgehend unverändert blieb das zweite Oberliegerkraftwerk am Schwarzenseebach, das auf eine Ausbauwassermenge von 3,2 m³/s ausgelegt ist. An der 2013 in Betrieb genommenen Anlage mit einer 1,2 MW Diagonal-Turbine waren lediglich im Unterwasserbereich bauliche Anpassungen erforderlich. Das zuvor nach der Turbinierung ins Gewässer abgegebene Triebwasser wird nun durch ein kleines Einlaufbauwerk gefasst und strömt danach über eine ca. 27 m lange Leitung aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GFK) DN1500 zum Sammelbecken des

neuen Kraftwerks Kleinsölkbach. Auch beim Kraftwerk Sagschneider wurde der Unterwasserbereich baulich angepasst und eine rund 120 m lange GFK-Leitung DN1500 zum Sammelbecken verlegt.
Das gesamte Stahlwasserbauequipment für die Erweiterung des Kraftwerks Sagschneider und das neue Sammelbecken stammt vom oberösterreichischen Branchenspezialisten Danner Wasserkraft GmbH. Sämtliche hydromechanischen Komponenten wurden von dem im Almtal ansässigen Unternehmen in gewohnt hoher Qualität gefertigt und fachgerecht montiert. Neben den diversen Schützen und Regulierorganen zählten auch die Hydraulikaggregate und die Herstellung der entsprechenden Verrohrungen zum Auftragsvolumen von Danner. „Da das Triebwasser für den Neubau von den beiden Oberliegern schon im vorgereinigten Zustand ins Sammelbecken strömt, ist dort kein weiterer Schutzrechen notwendig“, merkt Gerhard Seebacher an. „Das Sammelbecken wurde großzügig dimensioniert, um eine Beruhigung der doch beträchtlichen Wassermenge von bis zu 6 m³/s vor dem Beginn der Druckrohrleitung zu gewährleisten. Wasserspiegelschwankungen durch variierende Zuflüsse von den Oberliegern können durch das große Becken, in dem auch die Sonden der pegelgeregelten Turbinen untergebracht sind, optimal ausgeglichen werden. Wenn mehr als 6 m³/s zur Verfügung stehen wird der Überschuss durch eine Regelklappe, die auch für die Nivellierung des Wasserstands im Becken zuständig ist, ins Gewässer abgegeben.“ Die Restwasserdotation in den Kleinsölkbach erfolgt bei den Oberliegern und beträgt in Abhängigkeit vom jeweiligen Wasserdargebot zwischen 600 – 1.500 l/s.

KRAFTABSTIEG AUS GFK-ROHREN
Vom Sammelbecken zur Turbinierung ins Krafthaus gelangt das Triebwasser über eine 3.470 m lange Druckrohrleitung. Die möglichst linear gewählte Trassenführung der Druckrohrleitung machte zwei Bachunterquerungen notwendig, die von den Monteuren der Gebr. Haider mittels Unterdükerung hergestellt wurden. Bei der Materialauswahl des Kraftabstiegs entschieden sich die Betreiber für GFK-Rohre, die weltweit im Wasserkraft- und Industriesektor sowie im kommunalen Bereich zum Einsatz kommen. Die im Wickelverfahren hergestellten Rohre des Fabrikats Flowtite vereinen hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie äußere Einflüsse und garantieren durch ihre äußerst glatte Innenfläche hervorragende Fließeigenschaften. Hinzu kommen das vergleichsweise geringe Gewicht und ein anwenderfreundliches Muffensystem. Dank der geringfügigen Ab-
winkelbarkeit der Rohrstöße innerhalb der Verbindungsmuffen können weitläufige Richtungsänderungen der Trassenführung ohne zusätzliche Rohrkrümmer hergestellt werden. Geliefert wurden sämtliche Rohre inklusive Sonderformstücke vom niederösterreichischen Vertriebsprofi Etertec/JSW Handelsvertretung. Um Transportkosten zu sparen, wurde die Druckrohrleitung in den Dimensionen DN1900/1800/1700 ausgeführt. Durch die drei unterschiedlichen Dimensionen konnten die Rohre beim Verladen ineinander geschoben und somit jeweils die dreifache Menge mit einem Lkw-Transport zur Baustelle geliefert werden.
Da sich das Krafthaus in einer potentiellen Lawinenzone befindet musste das Gebäude gemäß behördlicher Vorgabe entsprechend massiv ausgeführt werden. Wie beim Kraft-
• Einzugsgebiet: 96 km ²
• Ausbauwassermenge: 6 m ³/s
• Bruttofallhöhe: 76,25 m
• Druckrohrleitung: 3.470 m GFK
• Ø: DN1900/1800/1700
• Druckstufen: PN6/PN10
• Fabrikat: Flowtite
• Lieferant: Etertec/JSW Handelsvertretung
• Stauziel: 984 m ü. M.
• Energieableitung: ca. 12 km
• Wasserfassung: Sammelbecken v. Oberliegern
• Stahlwasserbau: Danner Wasserkraft GmbH
• Bauarbeiten/DRL-Verlegung: Gebr. Haider
• E- u Leittechnik: MGX Automation GmbH
• Turbine 1: Francis-Spiral
• Turbinenachse: Horizontal
• Durchflussmenge max.: 4 m ³/s
• Drehzahl: 750 U/min
• Engpassleistung: 2.494 kW
• Generator 1: Synchron
• Nennscheinleistung: 3.100 kVA
• Turbine 2: Francis-Spiral
• Durchflussmenge max.: 2 m ³/s
• Drehzahl: 1.000 U/min
• Engpassleistung: 1.294 kW
• Generator 2: Synchron
• Nennscheinleistung: 1.500 kVA
• Hersteller Turbinen: Global Hydro Energy
Regelarbeitsvermögen: ca. 13 GWh

im oberösterreichischen Mühlviertel ansässige Wasserkraftallrounder Global Hydro Energy GmbH lieferte zwei auf 4 bzw. 2 m³/s ausgelegte Francis-Turbinen inkl. direkt gekoppelter Synchron-Generatoren. Bei vollem Wasserdargebot erreichen die horizontalachsigen Turbinen mehr als 3,7 MW Engpassleistung.Francis-Leitapparat im Detail
werk Sagschneider stammt auch beim Neu bau die zentrale elektromechanische Ausstat tung vom Kleinwasserkraftallrounder Global Hydro Energy GmbH. Für das Kraftwerk Kleinsölkbach lieferten die Mühlviertler zwei horizontalachsige Francis-Turbinen, die auf einen Durchfluss von 2 bzw. 4 m³/s aus gelegt wurden. Mit dieser 1/3 – 2/3 Maschi nenkonstellation erzielt die Anlage auch bei verringertem Wasserdargebot ein Maximum an Effizienz. Die größere Turbine dreht mit 750 U/min und erreicht eine Engpassleis tung von 2.494 kW. Das kleinere Gegen stück rotiert mit 1.000 U/min und schafft bei vollem Zufluss 1.263 KW Engpassleis tung. Komplettiert werden die Maschinen sätze durch zwei direkt mit den Turbinen wellen gekoppelte Synchron-Generatoren mit 3.100 bzw. 1.500 kVA Nennscheinleis tung in wassergekühlter Ausführung. Beide Generatoren vom italienischen Hersteller Marelli wurden auf eine Frequenz von je 50 Hz ausgelegt und erzeugen im Betrieb je weils 690 V Spannung. Für die Kühlung der Energiewandler sorgen zwei im Unterwasser bereich der Turbinen positionierte Wärme

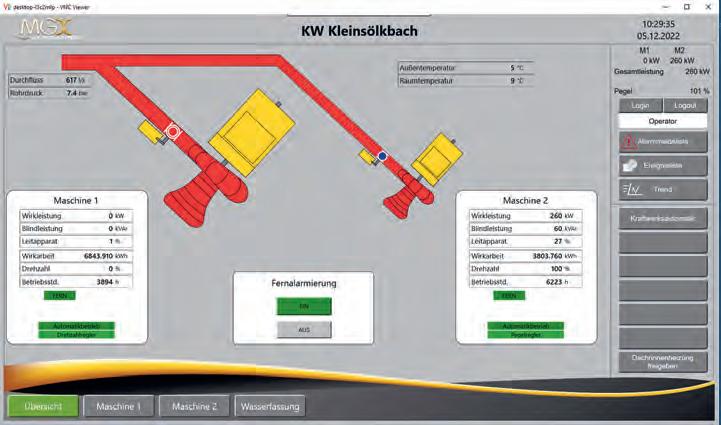






13 Jahre nach Einreichung des Projektes für ein Unterlieger-Kraftwerk an der Wildschönauer Ache in Tirol war es endlich soweit: 2019 schaltete die Ampel auf Grün für den Bau des neuen Kraftwerks Klamm II. Nach dem Baustart im Frühling 2020 und nach einer saisonbedingten Sommerpause der Bauarbeiten konnte das Öko-Kraftwerk im Frühjahr 2021 in den Probebetrieb gehen. Das neue Kleinkraftwerk liefert mit seinem leistungsstarken Maschinensatz im Regeljahr circa 3,7 GWh grünen Strom ins Netz der E-Werk Stadler GmbH. Mit dieser Menge können rund 900 Haushalte versorgt werden.

Im Hochtal Wildschönau vertrauen die Bewohner in Sachen Stromversorgung auf die E-Werk Stadler GmbH, ein Privatunternehmen, das seit über 90 Jahren in der Region aktiv ist. Heute betreibt es in Summe 9 Kleinwasserkraftwerke und versorgt über ein 75 Kilometer langes Leitungsnetz rund 1.350 Abnehmer mit Ökostrom aus der Region. Mit seinen Kraftwerken, die auf eine Engpassleistung von 3 MW kommen, erzeugt die E-Werk Stadler GmbH im Jahr durchschnittlich etwa 21 GWh. Dabei fußt die Produktion vor allem auf der Nutzung der Wildschö-
nauer Ache sowie zweier weiterer Gewässer im Hochtal. Nach einem langwierigen Genehmigungsprozedere konnte unlängst die Kraftwerkskette um ein zusätzliches Kleinkraftwerk erweitert werden.
13 JAHRE ZÄHE VERHANDLUNGEN
Das Konzept für die neue Anlage existierte schon eine ganze Weile. 2006 entschlossen sich die Verantwortlichen der E-Werk Stadler GmbH, die Pläne aus der Schublade zu holen und gemeinsam mit dem erfahrenen Planungsbüro Bernard Ingenieure aus Hall in

Das digitale Totalunternehmen für Ihre Zukunftstechnologien.Im unterirdischen Krafthaus sorgt ein modernes Maschinengespann, bestehend aus einer Francis-Spiralturbine und einem Hitzinger-Generator, für effiziente Ökostromproduktion für den Tiroler Energieversorger E-Werk Stadler GmbH. Das neue Kraftwerk Klamm II erzeugt im Regeljahr rund 3,7 GWh sauberen Strom. Für den Bau des Übergabebauwerks ging es bis zu 12 Meter in die Tiefe.
Tirol ein Projekt für den letzten ungenützten Abschnitt an der Wildschönauer Ache auf Schiene zu bringen. „Wir haben das Projekt im Jahr 2006 beim Amt der Tiroler Landesregierung eingereicht. Nach einem anfänglichen negativen Naturschutzbescheid gingen wir in Revision. Letztlich wurde das Urteil vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben“, erinnert sich Matthias Stadler, der gemeinsam mit seinem Bruder Kajetan das Energieversorgungsunternehmen in dritter Generation leitet. Doch mit diesem Urteil waren keineswegs alle Hürden beseitigt. „Im Grunde haben dann die zähen und anstrengenden Verhandlungen von Neuem begonnen. Aber Mitte Dezember 2018 war es dann soweit: Endlich kam der langersehnte positive Naturschutzbescheid – das war wie ein Weihnachtsgeschenk!“ Nun fehlte nur noch der Wasserrechtsbescheid, der in weiterer Folge Ende 2019 erteilt wurde. Damit waren alle behördlichen Genehmigungen unter Dach und Fach. Der Projektumsetzung stand nichts mehr im Wege. Nachdem bereits während der Wasserrechtsverhandlungen mit den Aus-
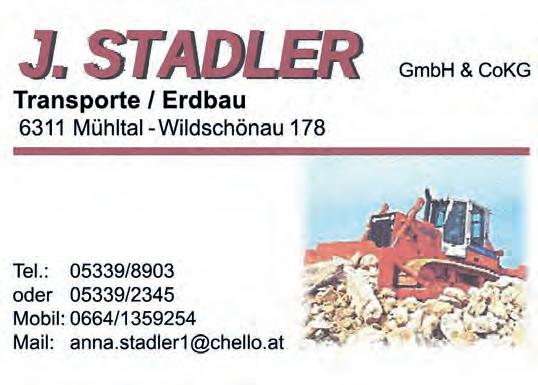


schreibungen begonnen worden war, konnten die Baulose umgehend vergeben werden und die Bauarbeiten konnten noch im Winter 2020 starten. „Uns war wichtig, dass wir Maschinen- und Materiallieferungen sowie die Bauarbeiten nach Möglichkeit an heimische Firmen vergeben. Das ist uns auch recht gut gelungen“, sagt Matthias Stadler.
WASSER AUS DEM OBERLIEGER




Volles Vertrauen setzten die Bauherren und ihr Planer dabei einmal mehr auf die Baufirma Rieder-Bau aus Kufstein, die man zuvor bereits bei zwei anderen Kraftwerksprojekten engagiert hatte und mit der man bislang immer sehr zufrieden war. Gemeinsam mit dem lokalen Baggerunternehmen J. Stadler konnte im Februar 2020 mit den Bauarbeiten am Übergabebauwerk gestartet werden. Ein eigenes Fassungsbauwerk war nicht vorgesehen. Gemäß des umweltfreundlichen Baukonzepts wird für das neue Kraftwerk Klamm II kein zusätzliches Wasser aus der Wildschönauer Ache ausgeleitet, sondern das abgearbeitete Betriebswasser

der Oberliegeranlage übernommen. Die dafür erforderlichen Bauarbeiten gestalteten sich allerdings durchaus anspruchsvoll. Matthias Stadler: „Die Baugrube für das Übergabebauwerk erreichte eine Tiefe von 12 Metern, weil die Wildschönauer-Ache von der Druckrohrleitung unterquert werden musste.“

MASCHINENHAUS UNTER WANDERWEG
Nach Fertigstellung dieses Bauabschnittes wurde umgehend mit dem Bau des circa 1,1 km entfernten Maschinenhauses begonnen. Von einem „Haus“ im eigentlichen Sinne ist dabei allerdings nicht die Rede. Das Krafthaus wurde ebenfalls komplett im Gelände versenkt angelegt – heute ist davon nichts mehr zu sehen. „Das Maschinenhaus liegt genau im Wanderweg, der durch die bekannte „Kundler Klamm“ führt. Für die Bauarbeiten bedeutete das, dass die 9 Meter tiefe Baugrube zum Beginn der Wandersaison im Juni wieder zugeschüttet sein musste, sodass der Wanderweg danach über die gesamte Wandersaison hinweg problemlos begehbar ist. Da
Wasserbau & Wasserkraft
Planungsleistungen in allen Leistungsphasen Flussbauliche Maßnahmen / Renaturierungen
Hydrologische / hydraulische Modellierungen
Kraftwerksmodernisierungen
Machbarkeitsstudien
Bauwerksprüfung
Beweissicherung
war Eile angesagt“, erinnert sich Matthias Stadler. Dabei musste das Gelände aufwändig gesichert werden, die Bauarbeiten wurden unter geologischer Bauaufsicht durchgeführt. Im Nachhinein zieht der Betreiber ein rundum positives Resümee: „Die vorgegebenen Bautermine haben wir trotz des starken Regens zu Baubeginn und der allgegenwärtigen Corona-Pandemie alle eingehalten. Und die Bauarbeiten wurden zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt“, so Stadler.

Nach der saisonbedingten Sommerpause konnten die Bauarbeiten Anfang Oktober mit der Verlegung der Druckrohrleitung wieder aufgenommen werden. Die Rohrtrasse erstreckt sich dabei über die gesamte Länge von 1.080 m entlang des Wanderwegs zur „Kundler Klamm“. Doch im Untergrund des Wanderwegs existierte mit dem regionalen Abwas-
serkanal für die innere Wildschönau bereits eine Leitung, was die Verlegung der Druckrohrleitung verständlicherweise erschwerte. Matthias Stadler: „Im Zuge der Verlegung der Druckrohrleitung musste auch der gesamte Abwasserkanal neu verlegt werden und durfte dabei in seiner Funktion nicht eingeschränkt werden. Das war eine beträchtliche Herausforderung, die von der beauftragten Baufirma mustergültig bewältigt wurde.“ Beim Rohrmaterial griffen die Bauherren auf Gussrohre DN1000 zurück, die vom namhaften Tiroler Rohrspezialisten TRM – Tiroler Rohre GmbH geliefert worden waren. Durch ihre Abwinkelbarkeit in den Muffen konnten sie sehr gut an den natürlichen Verlauf des Wanderwegs angepasst und somit auch spezielle Formstücke eingespart werden. Mit der Rohrleitung wurden auch die Energie- und Steuerkabel zur Anbindung an die Oberliegeranlage und ins Netz der E-Werk Stadler GmbH mitverlegt. Die gesam-
ten Verlegearbeiten wurden von der Baufirma PORR zur vollsten Zufriedenheit der Bauherrschaft durchgeführt und konnten sogar vor dem geplanten Termin mit der erfolgreichen Druckprobe abgeschlossen werden.

WASSERKRAFT-KNOW-HOW AUS TIROL

Das Herz der neuen Anlage im unterirdischen Maschinenhaus besteht aus einer Francis-Spiralturbine aus dem Hause GEPPERT mit direkt gekoppeltem Hitzinger-Generator. Der Maschinensatz wurde noch in den Wintermonaten 2020/21 montiert und anschließend in Betrieb gesetzt. Bei einer Ausbauwassermenge von 1,4 m³/s und einer effektiven Fallhöhe von 43 m erreicht das Maschinengespann eine Engpassleistung von 585 kW. Dank der ausgereiften Technik ist ein ausfallsicherer und effektiver Produktionsbetrieb über Jahre garantiert. Die gesamte elektro-, visualisierungs- und leittechnische Anlage wurde von einem weiteren

• Gewässer: Wildschönauer Ache
• Ausbauwassermenge: 1,4 m3/s
• Fallhöhe: 43 m
• Engpassleistung: 585 kW
• Turbine: Francis-Spiral-Turbine
• Fabrikat: Geppert
• Generator: 3-Phasen synchron
• Fabrikat: Hitzinger
• DRL: Länge. 1.080 m DN1.000
• Material: Guss
• Lieferant: TRM Tiroler Rohre
• Verlegung: PORR
• Bauarbeiten: Rieder Bau & J. Stadler
• E-Technik & Automationstechnik: EN-CO

• Stahlwasserbau: Wild Metal
• Regelarbeitsvermögen: 3,7 GWh
• Inbetriebnahme: März 2021
bekannten Branchenunternehmen geliefert. Und zwar vom Südtiroler Wasserkraftspezialisten EN-CO, der sich weit über die Grenzen Südtirols hinaus einen Namen in Sachen Kraftwerks- und Netzleittechnik gemacht hat und der auch der E-Werk Stadler GmbH schon bestens bekannt war. Eine Besonderheit der Kraftwerkssteuerung ist die von der Firma EN-CO installierte Taucheranlage, die nach dem Prinzip des Tauchsieders funktioniert, und die mit ihrer Leistungskapazität von 1,6 MW einen Inselbetrieb ermöglicht. Dabei ist die Steuer- und Regelungseinheit mit der Oberliegeranlage gekoppelt. Der Inselbetrieb ist ein wichtiger Punkt für die E-Werk Stadler GmbH, schließlich kann damit sogar in Notfällen die Versorgung der Stromabnehmer im eigenen Netz sichergestellt werden. Von einem Südtiroler Branchenspezialisten stammt auch die stahlwasserbauliche Ausrüs-
tung des Kraftwerks. Die erforderlichen Absperrschützen, ausgeführt als 4-seitig dichtende Gleitschütze mit Elektroantrieb mit der Dimension 2,2 m x 1,85 m, lieferte die Firma Wild Metal in bekannt hoher Qualität. Die Stahlbauprofis aus Ratschings übernahmen dabei auch die fachgerechte Montage der Bauteile.

Im März 2021 war es schließlich soweit. Das Kraftwerk Klamm II konnte nach einigen Testläufen in den Probebetrieb gehen und lieferte den ersten Öko-Strom ins Netz der E-Werk Stadler GmbH. Mit Einsetzen der Schneeschmelze gegen Ende April konnte dann die Maschine ihre Qualitäten unter Volllast unter Beweis stellen. Grundsätzlich – so resümiert Matthias Stadler zufrieden – sei das erste Betriebsjahr des neuen Kraftwerkes sehr positiv verlaufen: „Die Anlage kommt genau
zum richtigen Zeitpunkt. Sie leistet einen wichtigen Beitrag für die Grundversorgung der Wildschönau mit sauberem Strom aus heimischer Wasserkraft.“ Mit einem Regelarbeitsvermögen von circa 3.700 MWh können rund 900 Haushalte im Hochtal Wildschönau mit Strom versorgt werden. Umgerechnet auf eine mögliche Fahrstrecke für Elektroautos, wären das circa 18,5 Millionen Kilometer emissionsfrei gefahrene Kilometer. Die E-Werk Stadler GmbH hat mit diesem Kraftwerk eine weitere Stütze zu den bestehenden Anlagen gewonnen und kann heute als regionaler Stromversorger der Wildschönau rund 87 Prozent des Strombedarfes aus eigener Wasserkraftproduktion abdecken.
Nicht weniger als 320 Kleinwasserkraftanlagen hat das bayerische Wasserkraftunternehmen WATEC-Hydro in seiner nunmehr 20-jährigen Firmengeschichte erfolgreich ausgerüstet. Dank innovativer Lösungen und einer ausgeprägten Flexibilität behauptet sich der Mittelständler aus dem Unterallgäu seit 2002 auf den Kleinwasserkraftmärkten in ganz Europa. Mit dem Blick nach vorne gerichtet startet WATEC-Hydro nun ins neue Jahr, bereit für alle Chancen und Herausforderungen.
Dem Ausbau der erneuerbaren Ressourcen wird europaweit höchste Priorität eingeräumt. Im Bereich Kleinwasserkraft spielt dabei nicht nur der Neubau von Wasserkraftanlagen eine zentrale Rolle, sondern gleichermaßen auch die Modernisierung und Ertüchtigung vorhandener Bestandsanlagen. Ein Branchenplayer, der in der Lage ist, beide Bereiche kompetent abzudecken, ist WATEC-Hydro aus dem bayerischen Heimertingen. Der Wasserkraftspezialist stellt moderne vertikalachsige Kaplanturbinen mit einem Laufraddurchmesser von 0,4 m bis 2,50 m her – und bietet darüber hinaus umfassendes Know-how, um ein Wasserkraftprojekt letztlich erfolgreich umzusetzen. Das Unternehmen verweist selbstbewusst auf den Rückhalt und die Kompetenz seiner Mitarbeiter, der Monteure und externen Bearbeiter. In den letzten zwanzig Jahren wurden von WATEC-Hydro vier unterschiedliche Varianten der Kaplanturbine verbaut:
• KDP Kaplanturbine, doppeltreguliert mit permanenterregtem Synchrongenerator
• KSDP Kaplanspiralturbine, doppeltreguliert mit permanenterregtem Synchrongenerator und Vollspirale

• KDD Kaplanturbine, doppeltreguliert mit direktgekoppeltem V1 Generator

• KDR Kaplanturbine, doppeltreguliert mit Riemenabtrieb
Neben dem Neubau von Kleinwasserkraftanlagen im Leistungsbereich von 10 kW bis 1.000 kW hat sich WATEC-Hydro außerdem auf den Umbau bzw. die Modernisierung von Wasserkraftanlagen spezialisiert. Ferner bietet das Unternehmen seinen Kun-
den Lösungen für den Schalungsbau, Stahlwasserbau sowie die Steuerungs- und Regeltechnik aus einer Hand an.
HERSTELLUNG AM STANDORT
Die Herstellung der Turbinen erfolgt auf Bestellung. Das bedeutet, dass jede Turbine einzeln individuell und maßgefertigt für den jeweiligen Standort produziert wird. Dabei durchläuft die Turbine verschiedene Stationen der Produktion mit ständigen Qualitätsprüfungen. Die gewählten Materialien und Bauteile stammen überwiegend von deutschen Zulieferern.
Heute bietet WATEC Hydro vertikalachsige Kaplanturbinen mit einem Laufraddurchmesser von 40 cm bis 2,50 m.
Insgesamt beschäftigt WATEC in Heimertingen 18 Mitarbeiter, dazu kommen noch externe Monteure sowie Konstrukteure. Der Vertrieb für den deutschsprachigen Raum erfolgt direkt aus Heimertingen. Mit dieser Belegschaft bedient man den ganzen Vorgang von Bestellung über die Konstruktion hin zur Logistik, Montage und Fertigstellung samt Inbetriebnahme. Auf verschiedenste Kundenwünsche kann bei der Planung explizit eingegangen werden. Ein umfangreicher Einblick in die Prozesse kann der neu gestalteten Homepage www.watec-hydro.de entnommen werden.
Bei Interesse und Fragen:
e-mail: info@watec-hydro.de
Tel: +49(0)8335-989339-0
In der Vorarlberger Gemeinde Brand hat das Wasserkraftwerk St. Theodul II im November des Vorjahres erstmals sauberen Strom produziert. Der Neubau der Gemeinde ersetzt das ehemals im Besitz der örtlichen Pfarre stehende Kraftwerk St. Theodul I, das nach rund 40-jähriger Betriebszeit an seinem technischen Lebensende angelangt war. Durch die erhebliche Steigerung der Ausbauwassermenge von 86 auf 1.000 l/s wurde die Leistungs- und Erzeugungskapazität im Vergleich zum Altbestand um ein Vielfaches erhöht. An der Wasserfassung sorgt ein nahezu komplett selbstreinigendes Coanda-System für das Abscheiden von feinen Sedimenten aus dem entnommenen Triebwasser. Der ca. 1,6 km lange Kraftabstieg zwischen Wasserfassung und Maschinengebäude besteht komplett aus duktilen Gussrohren DN700. Das Herzstück der Anlage bildet eine 6-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Ausführung, die im Volllastbetrieb 1.174 kW Engpassleistung erreicht. Im Regeljahr produziert das neue Kraftwerk rund 3,6 GWh Ökostrom, womit die Gemeinde Brand ihre jährliche Stromerzeugung aus Wasserkraft verdoppelt hat.

Das Brandnertal im westösterreichischen Bundesland Vorarlberg erstreckt sich von den Hängen der 2.964 m hohen Schesaplana, der höchsten Erhebung in der länderübergreifenden Region Rätikon, bis hinunter nach Bludenz. Mit seiner beeindruckenden Bergkulisse und den vielfältigen Wander, Freizeit und Wintersportmöglichkeiten bildet das rund 12 km lange Tal traditionell einen beliebten touristischen Anziehungspunkt im Ländle. Aus energiewirtschaftlicher Perspektive bieten der regionale Wasserreichtum in Kombination mit der Topographie des Brandnertals ideale Voraussetzungen für die Stromproduktion aus Wasserkraft. Deutlich zeigt sich das in der rund 750 Einwohner zählenden Ortschaft Brand, in der die Gemeinde insgesamt vier Wasserkraftwerke sowie zwei Trinkwasserkraftanlagen betreibt. „Als Wintersport und Tourismusgemeinde mit entsprechendem Energiebedarf für die Bergbahnen, Beschneiungsan
lagen und Beherbergungsbetriebe wissen wir es sehr zu schätzen, dass ein wesentlicher Anteil des benötigten Stroms direkt vor Ort aus nachhaltigen Ressourcen erzeugt werden kann“, bekräftigt Bürgermeister Klaus Bitschi beim Lokalaugenschein von zek HYDRO im Brandnertal.

Die jüngste Ökostromanlage der Gemeinde, das Wasserkraftwerk St. Theodul II, hat im November des Vorjahres erstmals saubere Energie produziert. Der nach dem klassischen Ausleitungsprinzip konzipierte Neubau ersetzt das vormals im Besitz der örtlichen Pfarre gestandene Kraftwerk St. Theodul I, so Klaus Bitschi: „Anfang der 1980er Jahre hat die Pfarre das Kraftwerk Theodul I am Alvierbach errichtet, um die elektrische Kirchenheizung und andere Liegenschaften, wie den Kindergarten oder das Pfarrhaus, mit Strom zu versorgen. Nach knapp vier Jahrzehnten Dauerbetrieb hatte die technische Infrastruktur der Anlage ihren Zenit allerdings überschritten. Zudem stand die wasserrechtliche Konzession kurz
vor dem Ablauf. Da die Gemeinde bereits mehrere Kraftwerksanlagen realisiert hatte, wurde im Einvernehmen mit der Pfarre entschieden, dass die Gemeinde die Reinvestition für die Erneuerung der Anlage stemmen soll.“ Als Generalplaner des Projekts wurde die Vorarlberger breuß mähr bauingenieure gmbh beauftragt, die ihre Kompetenz schon zuvor bei einer ganzen Reihe von Wasserkraftund Trinkwasserversorgungsprojekten für die Gemeinde Brand unter Beweis gestellt hatte. „Für den Ersatzneubau des Kraftwerks St. Theodul I wurden bereits vor mehreren Jahren die ersten Vorkehrungen getroffen. 2014 hat die Gemeinde am Palüdbach ein Hochund Niederdruckkraftwerk errichtet, bei dem die beiden Maschinensätze in einem gemeinsamen Krafthaus untergebracht sind. Das
Krafthaus der Anlage St. Theodul II sollte an dieses Maschinengebäude angebaut werden. Mehrere bauliche Voraussetzungen, wie beispielsweise der Anschluss an den Unterwasserkanal, wurden schon damals geschaffen“, erklärt Markus Mähr, der Geschäftsführer des renommierten Planungsbüros. Markus Mähr ergänzt, dass gemeinsam mit dem Bau des Wasserkraftwerks St. Theodul II auch die zentrale Trinkwasserleitung und die Quellfassung der Gemeinde erneuert wurden. „Die um rund 110 m weiter vom alten Standort bachaufwärts positionierte Wasserfassung des neuen Kraftwerks befindet sich in direkter Nähe zur Trinkwasserquelle. Damit das Wasserkraftprojekt die behördliche Genehmigung erhält, musste zunächst ein zweites Standbein für die Trinkwasserversorgung der Gemeinde realisiert werden, um die Quellfassung während der Bauphase außer Betrieb nehmen zu können. Nachdem dieses Projekt vor ca. zwei
Jahren finalisiert wurde und ein Schutzkonzept für die bestehende Trinkwasserquelle während der Bauphase ausgearbeitet war, erteilte die Behörde grünes Licht für den Bau des neuen Kraftwerks.“
AMBITIONIERTER ZEITPLAN
Nach dem Erhalt der wasserrechtlichen Genehmigung und dem Abschluss des Ausschreibungsverfahrens konnte das Projekt im Frühjahr 2022 in die Umsetzungsphase übergehen. Durchgeführt wurden die kompletten Hoch und Tiefbauarbeiten sowie die Verlegung der Turbinen und Trinkwasserleitungen von der Vorarlberger Jäger Bau GmbH. Das über die Landesgrenzen hinweg aktive Unternehmen war bereits für Errichtung der Hoch und Niederdruckkraftwerke am Palüdbach zuständig gewesen. „Im Hinblick auf die Finanzierung des Projekts war das Zeitmanagement ein wichtiger Punkt. Die Anlage
musste bis spätestens 28. Februar 2023 ans Netz gehen, um die von der Bundesregierung im Zuge der CoronaKrise initiierte AWSFörderung zu erhalten. Bei diesem zeitlich begrenzenten Fördermodell erhalten Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien eine 14prozentige Vergütung der Baukosten, wenn das Projekt bis zu einem gewissen Stichtag abgeschlossen ist. Dank des vorbildlichen Einsatzes und Kooperation der beteiligten Unternehmen konnte der ambitionierte Zeitplan des Projekts eingehalten werden“, erklärt Markus Mähr.
COANDA-SYSTEMEN REINIGT TRIEBWASSSER Witterungsbedingt startete die Bauphase des Projekts Mitte März 2022 beim Maschinengebäude. Am Standort der Wasserfassung begannen die Arbeiten nach der Schneeschmelze ca. einen Monat später. Der Einzug des Triebwassers aus der Alvier erfolgt durch ein 7
• Ausbauwassermenge: 1.000 l/s
• Bruttofallhöhe: 147 m
• Wasserfassung: Tiroler Wehr/Coanda-System



• Coanda-Typ: Grizzly Power Optimus
• Hersteller: Wild Metal GmbH
• Druckrohrleitung: ca. 1,6 km DN700
• Material: Duktiler Guss
• Hersteller: Tiroler Rohre GmbH
• Turbine: 6-düsige Pelton
• Drehzahl: 750 U/min
• Engpassleistung: 1.174 kW
• Hersteller. WWS Wasserkraft GmbH
• Generator: Synchron
• Nennscheinleistung: 1.300 kVA
• Hersteller: AEM Dessau GmbH
Bauarbeiten an der Wasserfassung im Juli 2022. Durchgeführt wurden die kompletten Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Verlegung der Druckrohrleitung von der Vorarlberger Jäger Bau GmbH.
• Regelarbeitsvermögen: ca. 3,6 GWh
m breites und 1,8 m tiefes Tiroler Wehr. Aufgrund des vor allem im Frühjahr bzw. nach starken Niederschlägen hohen Geschiebetriebs wurde der Grobrechen mit 30 mm lichter Weite entsprechend massiv ausgeführt. Nach der Ausleitung strömt das Triebwasser zunächst in den Wehrkanal und danach weiter in den auf der orographisch rechten Gewässerseite angeordneten Verteilkanal im Entsandergebäude. Im Bauwerk sorgt das vom Südtiroler Stahlwasserbauallrounder Wild Metal gelieferte CoandaSystem „Grizzly Power Optimus“ für das Abscheiden der feinen Sedimente aus dem Triebwasser. Bei dem von Wild Metal selbst entwickelten und patentierten System, das im gesamten Alpenraum mittlerweile mehr als 500mal zum Einsatz kommt, handelt es sich um ein zum Großteil selbstreinigendes Schutzsieb für Wasserkraft und Trinkwasseranlagen. Der Grizzly in der Ausführungsvariante Optimus besteht im Wesentlichen aus einem robusten Feinsieb, das aus speziellem Edelstahl mit hoher Abriebbeständigkeit gefertigt wird. Durch den namensgebenden CoandaEffekt werden feine Partikel und Driftmaterial durch den Wasserstrom automatisch vom Feinsieb, dessen Spaltmaß beim Kraftwerk St. Theodul II 0,6 mm beträgt, abgespült und der Sandeintrag somit auf ein Minimum reduziert. In Summe lieferte Wild Metal 14 CoandaElemente, von denen jeweils sieben Stück links und rechts entlang des Verteilkanals im Entsandergebäude montiert wurden. Nach der Sedimentfiltration durch die Rechenfelder fließt das Triebwasser in ein Oberwasserbecken. Dieses Reservoir dient als Ausgleichsund Beruhigungsbecken sowie für die Bereitstellung des erforderlichen Regelvolumens für die Turbine im Krafthaus. In einer Schieberkammer vor dem Beginn der Druckrohrleitung befindet sich eine Rohrbruchsicherung
DN700. Der Rohrabgang in der gleichen Dimension sowie die Panzerungen des Verteilkanals und des Tiroler Wehrs stammen ebenfalls
von Wild Metal. Die verpflichtende Restwasserabgabe erfolgt schon zuvor am Wehrkanal und besteht aus einer Basisdotation von konstant 114 l/s plus 10,5 Prozent der jeweiligen Zuflussmenge.

KRAFTABSTIEG AUS DUKTILEN GUSSROHREN
Der rund 1,6 km lange Kraftabstieg zwischen Wasserfassung und Maschinengebäude besteht zur Gänze aus duktilen Gussrohren DN700. Die Trassenführung orientierte sich zu weiten Teilen am Verlauf eines bestehenden Güterwegs, in dem die Druckrohrleitung verlegt wurde. Markus Mähr weist auf eine Besonderheit des Druckrohrsystems hin: „2023 wird noch eine Anbindung des neuen Kraftabstiegs an die Druckrohrleitung der Hochdruckanlage Palüdbach, die bereits an das Beschneiungssystem des Skigebiets angeschlossen ist, hergestellt. Damit kann das aus der Alvier entnommene Wasser durch den Einsatz von Pumpen zukünftig auch für die Produktion von technischem Schnee verwendet werden.“ Geliefert wurde das komplette Rohrsystem für das Kraftwerk inklusive Sonderformstücke von der Tiroler Rohre GmbH (TRM). Die neue Trinkwasserleitung besteht
aus PolyethylenRohren und wurde im selben Graben wie die Druckrohrleitung für das Wasserkraftwerk verlegt. Die robusten Rohre von TRM kommen mit den oft extremen Anforderungen im alpinen Terrain bestens zurecht. In ökologischer Hinsicht hinterlassen die zu 100 Prozent aus Recyclingmetall gefertigten Rohre schon bei der Herstellung einen grünen Fußabdruck. Hinzu kommen die bekannten Vorzüge von duktilen Gussrohren wie hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und optimale Fließbedingungen durch eine äußerst glatte ZementmörtelInnenbeschichtung. Weitläufige Richtungsanpassungen der Rohrtrasse können durch die geringfügige Abwinkelbarkeit der Rohrenden innerhalb der Verbindungsmuffen ohne den Einsatz von zusätzlichen Rohrkrümmern hergestellt werden. Aufgrund der anspruchsvollen geologischen Bedingungen wurde die Druckrohrleitung für das Kraftwerk St. Theodul II weitgehend mit dem schub und zuggesicherten Verbindungssystem VRS®T ausgeführt. Kurz vor ihrem Endpunkt unterquert die Druckrohrleitung mittels Unterdükerung noch die Alvier und tritt danach ins Maschinengebäude ein.

LEISTUNGSSTARKE PELTON-MASCHINE
Als Herzstück der Anlage kommt eine PeltonTurbine in vertikalachsiger Ausführung mit direkt gekoppeltem Generator zum Einsatz. Der Maschinensatz stammt von der oberösterreichischen WWS Wasserkraft GmbH, die für den Neubau im Brandnertal ein umfassendes Technikpaket schnürte. Neben dem Maschinensatz und dem Hydraulikaggregat lieferte der international aktive Wasserkraft
allrounder auch die elektro und leittechnische Ausstattung sowie diverse Schützen und Reguliereinrichtungen für die Wasserfassung. Mit den insgesamt sechs hydraulisch geregelten Düsen schafft die Turbine auch bei stark reduziertem Wasserdargebot sehr gute Wirkungsgrade in einem breiten Teillastspektrum. Ausgelegt wurde die Turbine auf eine Ausbauwassermenge von 1.000 l/s und 147 m Bruttofallhöhe, womit diese bei vollem Zu

fluss 1.174 kW Engpassleistung erreicht. Der direkt mit dem Laufrad verbundene SynchronGenerator vom Hersteller AEM Dessau GmbH wird von der Turbine mit exakt 750 U/min angetrieben. Für optimale Temperaturen des auf 400 V Spannung und 1.300 kVA Nennscheinleistung ausgelegten Generators sorgt eine Wasserkühlung, die von einem Wärmetauscher im Unterwasserbereich versorgt wird. Vom Generator fließt der erzeugte Strom zu einer Mittelspannungsschaltanlage, die wie der ebenfalls neue Transformator im angrenzenden Krafthaus der Anlage Palüdbach platziert wurde. „Mit dem Neubau werden auch die Gebäude der Pfarre weiterhin mit Strom versorgt. Dazu wurde eine bestehende Stromleitung, die direkt am Maschinengebäude vorbeiführt, an das neue Kraftwerk angeschlossen“, so Markus Mähr.

ERFOLGREICHES PROJEKT
Rund acht Monate nach Baustart ging der mustergültig realisierte Neubau Mitte November 2022 erstmals ans Netz. Bürgermeister Klaus Bitschi zieht ein durchwegs positives Fazit über das Projekt: „Während der feuchten Witterung im Dezember konnte die Anlage ihr Leistungsvermögen bereits unter Beweis stellen. Mit der Erneuerung hat die Gemeinde ihr Erzeugungspotential aus Wasserkraft verdoppelt, wodurch man definitiv
Kaplan Turbinen
Francis Turbinen
Pelton Turbinen
WWS PowerGate
Stahlwasserbau
von einem erfolgreichen Projekt sprechen kann.“ Ebenso positiv fällt das Resümee von Markus Mähr aus: „Trotz des ambitionierten Zeitplans konnte das Projekt ohne größere Verzögerungen abgewickelt werden. Die Betriebserfahrungen mit dem neuen Kraftwerk sind grundsätzlich gut, es gab bislang keine nennenswerten Probleme. Erfreulich ist na
türlich auch, dass die zentrale Trinkwasserwasserleitung der Gemeinde im Zuge des Projekts erneuert wurde und die Quellfassung nun aus der Ferne elektronisch überwacht werden kann.“ Im Regeljahr wird das neue Kraftwerk St. Theodul II rund 3,6 GWh Ökostrom erzeugen. Klaus Bitschi bekräftigt, dass die Gemeinde Brand weiterhin auf die
nachhaltige Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen setzen wird: „Das Wasserkraftpotential in der Gemeinde ist mit dem jüngsten Projekt ziemlich ausgeschöpft. Zukünftig wollen wir die Photovoltaik im Ort noch stärker ausbauen und das vielversprechende Potential von Windkraftanlagen durch das Land Vorarlberg untersuchen lassen.“





Durch unsere Rohre fließt Wasser.

Am 30. und 31. März wird das Messezentrum Salzburg mit der Renexpo Interhydro zum Branchentreffpunkt der Wasserkraft.







Planer, Betreiber, Hersteller, Investoren und Energieversorger nutzen die Gelegenheit für einen fachlichen Austausch und neue Geschäftskontakte. Verbände und Behörden bieten die Chance auf Informationen aus erster Hand.




Programmhighlights runden den Messebesuch ab Bereits der Energietalk am Eröffnungstag „Versorgungssicher und unabhängig durch Wasserkraft! Was muss jetzt geschehen?“ mit Florian Streibl (Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Bayern), Dr. Jürgen Schneider (Leiter der Sektion Klima und Energie des BMK Österreich) und dem Salzburger Landesrat Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger verspricht einen aktuellen Einstieg in die Thematik.

Zudem lockt die Podiumsdiskussion „Ein Jahr Energiekrise: Wie steht es um die Wasserkraft?“, bei der Vertreterinnen aus Deutschland, Italien und Österreich Bilanz ziehen und Zukunftsperspektiven diskutieren. Eine unkonventionelle Herangehensweise an das Thema Energiekrise und -wende beschert die Keynote „Klimakrise endlich gelöst“ von Science Buster Martin Moder, ebenfalls am ersten Messetag. Am Freitag, 31. März sprechen Dr. Ulrich Streibl (Vorstandssprecher Oekostrom AG), DI Mag. (FH) Gerhard Christiner (technischer Vorstand Austrian Power Grid AG), DI Mag. Michael Strebl (Vorsitzender der Geschäftsführung Wien Energie GmbH) und Johannes Wahlmüller (Geschäftsführer Global 2000) zum Thema „Die Energiewende ist sichtbar! Akzeptanzschaffung als Herausforderung.“
Planer- und Betreibertag Wasserkraft
In Kooperation mit dem Verein Kleinwasserkraft Österreich und dem Land Salzburg wird der Planer & Betreibertag zum Thema „Förderung Wasserkraft“ am 30. März realisiert. Fördermöglichkeiten aus den Bereichen Klimaund Energiefonds, dem EAG – Erneuerbaren Ausbau Gesetz (Neuerrichtung und Erweiterung von Wasserkraftanlagen, Revitalisierung bestehender Anlagen), dem UFG – Umweltförderungsgesetz (Errichtung ökologischer Maßnahmen) und auf Landesebene in Österreich und Deutschland werden vorgestellt. Es erwarten Sie zwei vielversprechende, zukunftsträchtige Tage Ende März in Salzburg. Tickets sowie Informationen zu Ausstellern und Programm finden Sie unter www.renexpo-interhydro.eu.
RENEXPO INTERHYDRO
Fachmesse für Wasserkraft
30. – 31. März 2023
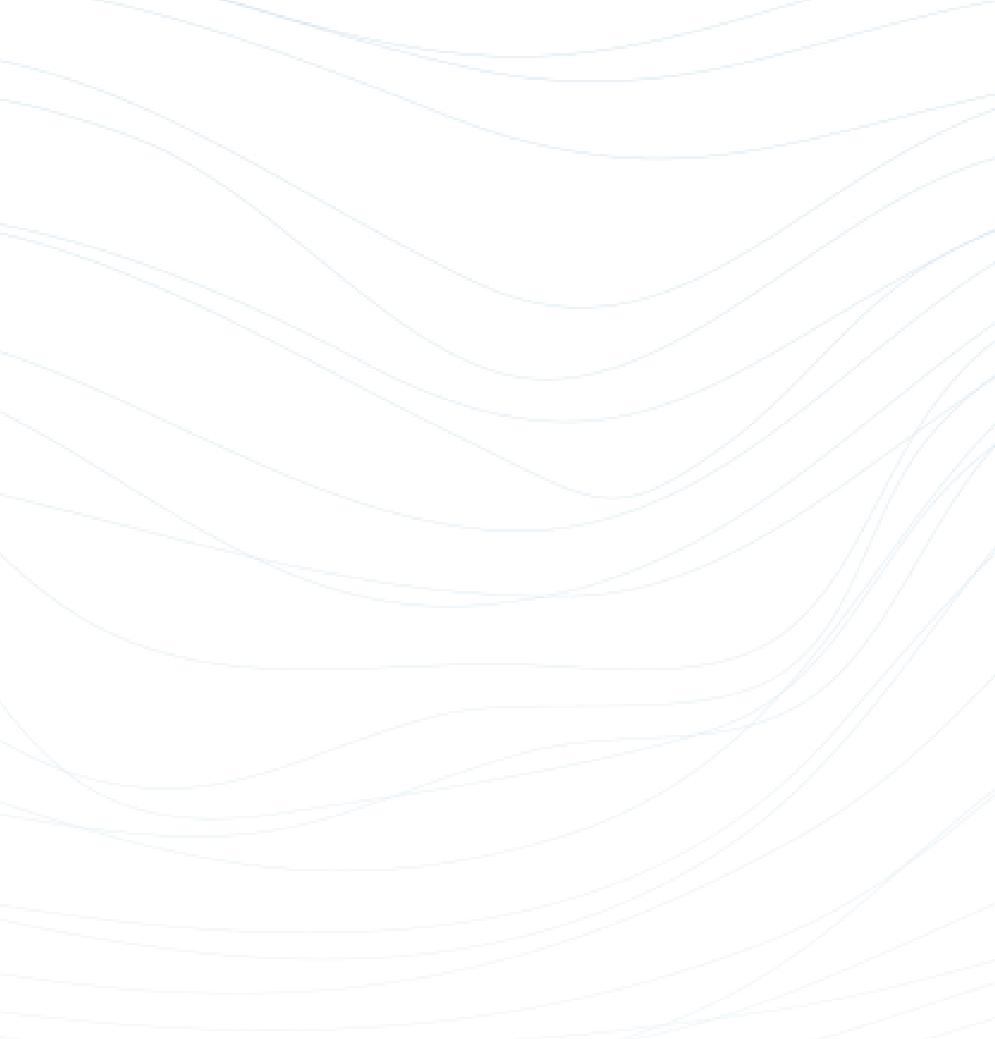
Messezentrum Salzburg
www.renexpo-interhydro.eu













Kurz nach dem Jahresbeginn 2022 ging das Kleinwasserkraftwerk Perhab in der steirischen Gemeinde Ramsau am Dachstein nach einer Kompletterneuerung wieder ans Netz. Bis auf die Druckrohrleitung und die Hülle des Maschinengebäudes wurde die gesamte hydroelektrische und bauliche Infrastruktur der Anlage modernisiert. An der Wasserfassung wurde durch den Einbau einer hydraulisch betriebenen Wehrklappe die Hochwassersicherheit gewährleistet. Im Krafthaus ersetzt eine Durchström-Turbine zwei Pump-Turbinen, die ihr technisches Lebensende erreicht hatten. Durch die Erhöhung der Ausbauwassermenge wurde die Engpassleistung der Anlage um mehr als das Doppelte auf ca. 150 kW gesteigert. Dank der Schwarzstart- und Inselbetriebsfähigkeit des Kraftwerks kann die Anlage auch bei einem großflächigen Stromausfall die lokale Energieversorgung aufrechterhalten.
In der obersteirischen Gemeinde Ramsau am Dachstein hat die Nutzung von Wasserkraft eine lange Tradition. Vor der flächendeckenden Einführung des elektrischen Stroms wurde die Kraft des Wassers in früheren Zeiten durch Wasserräder und mechanische Transmissionen genutzt. Mit der zunehmenden Elektrifizierung wurden viele Standorte sukzessive auf die Stromproduktion umgerüstet. Beispielsweise bei dem für seine hochwertigen Textilien bekannten Unternehmen Lodenwalker, das seinen Strombedarf zu 100 Prozent mit zwei eigenen Wasserkraftwerken abdeckt. Ganz in der Nähe des Traditionsbetriebs befindet sich am Ramsaubach das Kleinwasserkraftwerk Perhab, das ursprünglich ebenfalls als reine Eigenversorgungsanlage konzipiert worden war.


„Mein Großvater, mein Vater und mein Onkel haben Anfang der 1950er Jahre am Ramsaubach ein für den Inselbetrieb ausgelegtes Kleinwasserkraftwerk errichtet. Damit konnten die nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossenen Gebäude mit direkt vor Ort erzeugter Energie versorgt werden. Allerdings war die Anlage nur auf eine Engpassleistung von ca. 24 kW ausgelegt. Da die Siedlung im
Laufe der Jahre stetig angewachsen ist, war die Erzeugungskapazität schließlich nicht mehr ausreichend, um alle Verbraucher mit ausreichend elektrischer Energie zu versorgen“, erklärt Kraftwerksbetreuer Albert Perhab im Gespräch mit zek HYDRO. 1986, rund zehn Jahre nach der Anbindung der Siedlung an das öffentliche Stromnetz, wurde das Bestandskraftwerk erstmals umfassend erweitert. Dabei wurden die Ausbauwassermenge und die Fallhöhe gesteigert, das Krafthaus weiter bachabwärts verlegt und mit zwei Pump-Turbinen ausgestattet. Nach der Erneuerung des Kraftwerks wurde der von den lokalen Verbrauchern nicht benötigte überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist.
ZEIT FÜR MODERNISIERUNG
Rund 30 Jahre nach der erstmaligen Erweiterung beschäftigte sich die E-Werksgemeinschaft Perhab OG ab 2015 mit der Modernisierung ihres Wasserkraftwerks. Begründet war dies in erster Linie durch das kurz vor
dem Ablauf stehende Wasserrecht der Anlage. „Zur Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung musste das Kraftwerk auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Außerdem sollte die Maximalleistung der Anlage um mehr als 50 Prozent gesteigert werden, um die Bedingungen für die Ökostromförderung zu erfüllen“, erklärt Projektleiter Ewald Dröscher vom steirischen Ingenieurbüro PI Mitterfellner GmbH, das von den Betreibern mit der Generalplanung beauftragt wurde. Der Projektleiter des renommierten Planungsbüros ergänzt, dass im Rahmen der Neukonzeptionierung eine Entscheidung getroffen werden musste, mit welcher elektromechanischen Ausstattung die Anlage zukünftig Strom erzeugen sollte: „Zur Debatte stand die Sanierung der alten Turbinen inklusive der Ergänzung um einen dritten Maschinensatz. Da diese Variante deutlich mehr Umbauaufwand im Krafthaus sowie erhöhten Wartungsbedarf bedeutet hätte, wurde schließlich die Umrüstung auf eine
einzelne Maschinengruppe beschlossen. Dieses Konzept stellte gleichzeitig auch die kostengünstigere Lösung dar.“ Ein weiterer wichtiger Punkt des Projekts war laut Ewald Dröscher die Verbesserung der Hochwassersicherheit durch den Umbau der Wehranlage. Nachdem die E-Werksgemeinschaft die behördliche Bewilligung erhalten hatte, konnte das Projekt Anfang August 2021 in die Umsetzungsphase übergehen.
WASSERFASSUNG KOMPLETT UMGEBAUT
Gleich zu Beginn der Bauphase fokussierten sich die Arbeiten auf die Erneuerung der Wasserfassung. Die zuvor mit einem hölzernen Streichwehr ausgestattete Wasserfassung wurde bei der Neugestaltung mit einer hydraulisch betriebenen Wehrklappe ausgerüstet. Gefertigt wurde die Stauklappe von der oberösterreichischen Danner Wasserkraft GmbH, die auch das restliche Stahlwasserbauequipment lieferte. „Aufgrund des großzügigen
Staubereichs der Wasserfassung, in dem sich das Geschiebe und die Sedimente absetzen können, war kein separates Entsanderbecken notwendig. Das gezielte Ausspülen des angesammelten Geschiebes erfolgt durch den neben der Wehrklappe angeordneten Grundablassschütz“, so Ewald Dröscher. Nach der Entnahme fließt das Triebwasser durch einen Feinrechen mit vertikalem Stabprofil, der mit einer Rechenreinigungsmaschine in Teleskoparmausführung ausgestattet wurde. Das vom Feinrechen entfernte Geschwemmsel wird über eine Spülrinne direkt in die Restwasserstrecke abgeführt. „Die nun vollautomatische Rechenreinigung stellt für uns Betreiber eine enorme Erleichterung dar. Bei der alten Anlage musste der Schutzrechen vor allem während der Herbstmonate bis zu vier Mal täglich händisch von Laub und Geschwemmsel befreit werden“, bekräftigt Albert Perhab. Nach dem Feinrechen strömt das Triebwasser in ein kleines Beruhigungsbecken, in dem die Sonde
der pegelgeregelten Turbine untergebracht ist. Die an das Beruhigungsbecken anschließende Druckrohrleitung Richtung Krafthaus blieb vom Umbau weitgehend unberührt. Lediglich der oberste Abschnitt des Kraftabstiegs an der Wasserfassung, der zuvor auf einer Länge von ca. 80 m oberirdisch ausgeführt war, wurde erneuert und in das Erdreich verlegt. Ausgeführt wurde dieser Abschnitt mit GFK-Rohren DN800, wobei zur Verbindung an die etwas geringer dimensionierte Bestandsleitung aus Stahlrohren DN600 ein Übergangsstück gesetzt wurde. Albert Perhab weist darauf hin, dass 2023 noch eine weitere technische Ergänzung an der Wasserfassung ansteht: „Die dynamisch festgelegte Restwasserabgabe, die in Abhängigkeit vom Zufluss zwischen 100 und 200 l/s liegt, wurde im Zuge der Neukonzessionierung deutlich angehoben. Damit diese Wassermenge nicht für die Stromproduktion verloren geht, bauen wir heuer noch eine Restwasserturbine ein. Ein Anschluss für die Turbine wurde beim Bau der Wasserfassung bereits vorgesehen. Als Restwassermaschine nutzen wir zukünftig eine zuvor im Krafthaus montierte Turbine, die aktuell noch saniert bzw. für den neuen Einsatzzweck umgebaut wird.“

Die Leistungssteigerung der Anlage ist in erster Linie der Erhöhung der Ausbauwassermenge von 510 auf 800 l/s zu verdanken. „Vor der Erneuerung war das Kraftwerk relativ gering ausgebaut und lief dadurch oft unter Volllast. Mit der vergrößerten Ausbauwassermenge verringerten sich zwar die Volllastbetriebszeiten, dafür erreicht der neue Maschinensatz aber in einem breiten Teillastspektrum sehr gute Wirkungsgrade“, sagt Ewald Dröscher. Als neues Herzstück des

• Ausbauwassermenge: 800 l/s
• Bruttofallhöhe: ca. 29 m
• Nettofallhöhe: ca. 25 m
• Restwassermenge: 100 - 200 l/s
• Turbine: Durchström
• Drehzahl: 490 U/min
• Engpassleistung: ca. 150 kW
• Hersteller: Ossberger
• Getriebeübersetzung: 1 : 2
• Generator: Synchron
• Spannung: 400 V
• Nennscheinleistung: 180 kVA
• Hersteller: AEM
• Regelarbeitsvermögen: ca. 700.000 kWh
Kraftwerks kommt eine Durchström-Turbine vom deutschen Hersteller Ossberger zum Einsatz. Das walzenförmige Laufraddesign mit radial angeordneten Schaufeln sorgt in Kombination mit dem im Verhältnis 1/3 zu 2/3 aufgeteilten Turbinengehäuse für eine optimale Verwertung des vorhandenen Wasserdargebots. Das Triebwasser durchströmt das Laufrad zuerst von außen nach innen und tritt danach auf der gegenüberliegenden Seite wieder aus. Durch diesen konstruktionsbedingten Selbstreinigungseffekt wird Schwemmgut automatisch abgeführt und führt somit zu keinen Leistungseinbußen oder Funktionsstörungen. Bei vollem Zufluss erreicht die auf ca. 29 m Bruttofallhöhe und 491 U/min Drehzahl ausgelegte Turbine rund 150 kW Engpassleistung. Komplettiert wird der Maschinensatz durch einen luftgekühlten Synchron-Generator mit 180 kVA Nennscheinleistung. Als Verbindung zwischen der Turbine und dem mit 1.000 U/min schnell drehenden Generator kommt ein Getriebe mit dem Übersetzungsverhältnis 1 : 2,03 zum Einsatz. Ebenfalls völlig erneuert wurde im Zuge des Umbaus die elektro- und leittechnische Ausstattung des Kraftwerks. Dazu schnürte der steirische Automatisierungsspezialist aepick GmbH ein regelungstechnisches Komplettpaket, das unter anderem die Schutzeinrichtungen, den Turbinenregler und die Eigenbedarfsversorgung beinhaltete. Auch die Kraftwerkssteuerung inklusive übersichtlicher Visualisierung stammt von aepick. „Die erneute Herstellung der Schwarzstart- und Inselbetriebsfähigkeit war uns ein wichtiges Anliegen, damit unsere Gebäude beim Ausfall der öffentlichen Stromversorgung weiterhin mit Energie versorgt bleiben“, sagt Albert Perhab. Der von den Betreibern nicht für den Eigenbedarf benötigte Strom wird weiterhin an einer ca. 180 m vom Krafthaus entfernten Trafostation der Energie Steiermark ins öffentliche Netz eingespeist.


BETREIBER ZUFRIEDEN


Rund fünf Monate nach dem Baustart konnte das fast vollständig erneuerte Kleinwasserkraftwerk Anfang 2022 den Probebetrieb aufnehmen, bereits kurz danach ging die Anlage in den Regelbetrieb über. „Das Projekt ist sehr zufriedenstellend verlaufen, die beteiligten Firmen habe allesamt eine gute Leistung erbracht und vorbildlich zusammengearbeitet. Trotz der geringen Niederschläge im vergangenen Jahr ist die erzeugte Strommenge zu unserer Zufriedenheit ausgefallen“, so Albert Perhab. Ewald Dröscher zieht ebenso ein positives Fazit über den Projektverlauf: „Die vorhandene Infrastruktur des Kraftwerks wurde bestmöglich in die Erneuerung einbezogen. Aus den Gegebenheiten mit der bestehenden Druckrohrleitung und dem Krafthaus sowie der nutzbaren Fallhöhe wurde das Optimum herausgeholt.“ Der endgültige Projektabschluss ist mit dem 2023 anstehenden Einbau der Restwasserturbine, die alljährlich rund 20.000 kWh Strom erzeugen wird, bereits in Sichtweite. Im Regeljahr kann das erneuerte Kleinkraftwerk am Ramsaubach ca. 700.000 kWh Ökostrom erzeugen.

Nachdem sie 2020 Corona bedingt abgesagt werden musste, feierte die Viennahydro von 9. bis 11. November 2022 ihr Comeback auf dem Programmkalender der internationalen Wasserkraftveranstaltungen. Eine höchst willkommene Rückkehr des „Internationalen Seminars Wasserkraftanlagen“, das seit mittlerweile über 40 Jahren mit einem hochkarätigen technisch-wissenschaftlichen Programm aufwartet. Auch diesmal waren wieder rund 230 Teilnehmer aus 20 Ländern vertreten, die dazu beitrugen, dass die Viennahydro einmal mehr ihrem Ruf als Branchen-Highlight gerecht wurde. Unter dem Event-Slogan „Hydropower for Future Generations“ standen unter anderem zukunftsträchtige Fragen zu den Themen Digitalisierung, intelligente Netze, Quantencomputer und diverse Innovationstrends im Brennpunkt der diesjährigen Veranstaltung.
Vier Jahre nach der letzten Auflage im Jahr 2018 war es nun endlich wieder soweit: Die Viennahydro öffnete ihre Pforten, und zwar von 9. bis 11. November. Das Conference Center in Schloss Laxenburg vor den Toren Wiens, mittlerweile fest mit der Veranstaltung assoziiert, wurde einmal mehr für drei Tage zum internationalen Nabel der Wasserkraftbranche. Dank eines qualitativ hochwertigen Tagungsprogramms, bestehend aus 64 Fachvorträgen und 12 Präsentationen durch angehende DoktorandInnen, wurde sie letztlich wieder den hohen Erwartungen gerecht. Mit besonderer Spannung wurde dabei die unmittelbar nach der Eröffnung angesetzte Podiumsdiskussion „Nachhaltige Versor-

gungssicherheit durch regenerative Energiesysteme“ verfolgt. Dabei diskutierten bekannte VertreterInnen aus Politik, Energiewirtschaft und E-Control. Ein Meinungsaustausch, der zeigte, dass trotz unterschiedlicher Positionen und Zugänge doch im Wesentlichen sehr ähnliche Situationsbefunde konstatiert und letztlich auch Rückschlüsse gezogen wurden. Von der großen Perspektive wechselte man daran anschließend auf die konkreten Themenpunkte, es konnte ins Detail gehen.
INTERNATIONALITÄT WIRD GROSSGESCHRIEBEN


Seit 2008 engagiert sich Prof. Dr.-Ing. Christian Bauer, Dekan der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften an der TU Wien, für das traditionsreiche Event, das im Zweijahres-Rhythmus stattfindet. Er und sein Team sind die treibenden Kräfte dahinter. Für Dekan Bauer ist gerade auch die Internationalität ein wichtiger Erfolgsfaktor der Vien-
nahydro: „Wir sehen die Viennahydro als ideale Plattform für einen einfachen und schnellen Austausch zum Thema Wasserkraft. In Österreich ist die Community, also Ausbildungsstätten wie Universitäten, Hersteller, Betreiber und Consultants sehr gut vernetzt. Diese Eigenschaft wird durch die Tagung auch auf den internationalen Raum ausgedehnt.“ Gerade für internationale DoktorandInnen bietet die Viennahydro eine einzigartige Möglichkeit, ihre wissenschaftliche Forschungstätigkeit der Öffentlichkeit und einem fachkundigen Auditorium präsentieren zu können. Hinzu kommt, dass die Optionen für internationales Networking anderswo kaum günstiger sein könnten als hier.
HYDROPOWER FOR FUTURE GENERATIONS
Wie gewohnt, wurden die Räumlichkeiten von Schloss Laxenburg optimal genutzt und die einzelnen Programmpunkte im Wesentlichen auf drei Säle aufgeteilt. Der Nachmittag
von Tag 1 stand im Zeichen von eher praktischen Lösungsansätzen für die Kleinwasserkraft, einer durchaus originellen Gender-Debatte in der Wasserkraft, sowie Fragen zu Betrieb und Wartung und nicht zuletzt dem zunehmend wichtigem Thema der Ökologie. Abgerundet wurde das Programm von Tag 1 von einem gepflegten abendlichen Cocktail-Empfang im historischen Ambiente des Wiener Rathauses. Eine Gelegenheit, ein Stück Wiener Architekturgeschichte zu bestaunen und dabei Kontakte zu pflegen, die sich kaum ein Teilnehmer entgehen ließ.
Tag 2 war in der Folge geprägt vom stets zentralen Thema Pumpspeicherung, sowie von Themen wie Steuerung & Automation, Betrieb & Wartung, Hydraulische Systeme & Transiente Bedingungen, Digitalisierung und last but not least Numerische Simulation. Dabei zog sich das Hauptthema der Veranstaltung „Hydropower for Future Generations“ durch wie ein roter Faden. Für die Veranstalter hinter der Viennahydro liegt es auf der Hand, dass es die richtigen Fragen für die zukünftigen Nutzung der Wasserkraft zu stellen gilt. Konkret
sagte Dekan Bauer: „Es ist eine große Herausforderung Energie zu speichern und danach mit hoher Effizienz wieder in das Stromnetz zurückzuführen. Hier wollen wir unterstützen. Es geht nicht darum, neue Infrastrukturen aufzubauen, sondern bereits vorhandene Infrastrukturen, wie etwa bestehende Wasserreservoirs, zu nutzen. In Salzburg zum Beispiel gibt es künstlich angelegte Speicherseen für Beschneiungsanlagen, die circa 11 Monate im Jahr nicht genutzt werden. Mithilfe einer Neuentwicklung wie der modularen Pumpturbine könnte dezentral, ohne neue Stromleitungen Energie gespeichert und wieder in das Netz zurückgeführt werden. Da liegt Potenzial brach.“
Die intensiven Diskussionen und Fachgespräche konnten an Tag 2 in der Folge noch beim Abendessen in einem äußerst gemütlichen Ambiente weitergeführt werden: Wie seit vielen Jahren üblich wurde der zweite Veranstaltungstag mit einem Besuch beim Traditionsheurigen Fuhrgassl-Huber in Neustift am Walde abgerundet. Ein Punkt im Rahmenpro-
gramm, gesponsert vom Wasserkraftallrounder Voith Hydro, der sich klammheimlich zu einem unausgesprochenen gesellschaftlichen Höhepunkt der Viennahydro gemausert hat. Die Ungezwungenheit der Heurigen-Atmosphäre ist dem Networking bekanntermaßen zuträglich.
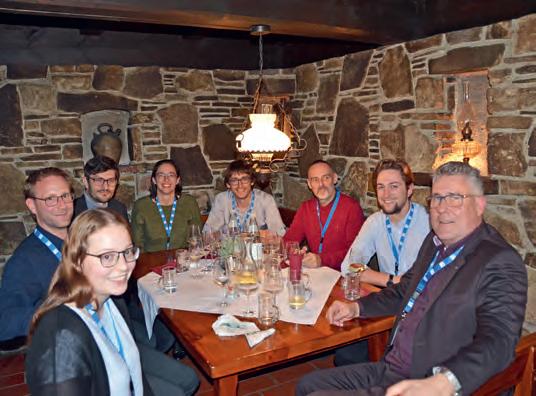

Selbstredend wurde das professionelle Umfeld der Tagung auch in diesem Jahr wieder von einigen Branchenunternehmen genutzt, um den „Key Playern“ der Wasserkraftbranche ihre Produkte und Dienstleistungen näherzubringen. Einige davon sind höchst bekannte Branchen-Player, die an der Viennahydro nicht nur neue Kontakte knüpfen, sondern sich auch im Hinblick auf die neuesten Entwicklungen informieren.

Der Schlusstag stand letztlich noch einmal im Zeichen des großen Themenkreises Betrieb & Wartung sowie dem zweiten Teil zum Thema Pumpspeicherung. Mit einigen hoch interessanten Vorträgen ging die 21. Auflage der Viennahydro langsam zu Ende. Einmal mehr zeigte sich, dass der Erfolg einer Branchenveranstaltung mit der Qualität ihrer Inhalte steht und fällt. Dass die Qualität der Viennahydro auf allerhöchstem Niveau bleibt, dafür garantiert ein mittlerweile fast 40-köpfiges Veranstaltungskomitee. Dieses sorgt dafür, dass ausschließlich Arbeiten von akademischer Güte und hohem Innovationsniveau zugelassen werden. Mit großem Aufwand wurden auch in diesem Jahr wieder die Details von Dekan Christian Bauer und seinem Team vorbereitet. Mit dem Erfolg der diesjährigen Veranstaltung wurde gleichzeitig schon wieder der Grundstein für die nächste, die mittlerweile 22. Auflage der Viennahydro gelegt. Diese wird im November 2024 stattfinden. Wasserkraftinteressierte auf der ganzen Welt werden sich diesen Termin wohl schon wieder rot im Kalender markieren.
Zwar ist das Wasserkraftpotenzial in unseren Breiten noch nicht zur Gänze ausgeschöpft, aber ganz große Sprünge sind in Mitteleuropa nicht mehr zu erwarten. Doch dies spiegelt keineswegs die weltweite Gesamtsituation wider. Im Gegenteil: Chinesische Forscher von der Südlichen Universität für Wissenschaft und Technologie in Shenzhen haben kürzlich im Fachmagazin „Nature Water“ eine Studie publiziert, derzufolge die weltweiten Wasserkraftkapazitäten auf 9 Petawattstunden verdoppelt werden könnten. Und dies sogar unter Rücksichtnahme auf Mensch und Natur, wie die Forscher betonen. Im Kampf gegen den Klimawandel könnte der Wasserkraft damit eine Schlüsselrolle zukommen. Vor allem in Asien und Afrika sollen der Studie zufolge noch riesige ungenützte Potenziale schlummern.
Rund 16 Prozent steuert die Wasserkraft heute zur globalen Stromerzeugung bei. Ein beachtlicher Wert, doch da geht noch mehr. Viel mehr, wenn es nach der Studie der Wissenschaftler um Rongrong Xu von der Südlichen Universität für Wissenschaft und Technologie im chinesischen Shenzhen geht. Sie haben sich 2,89 Millionen Flüsse auf der ganzen Welt näher angesehen und haben mögliche Standorte für Wasserkraftwerke detektiert, wo eine hydroelektrische Nutzung ihrer Einschätzung nach nicht nur technisch möglich, sondern auch wirtschaftlich und umweltverträglich ist. In ihre Standortbewertung flossen Faktoren wie Durchfluss, tangierter Lebensraum, Baukosten und Umweltverträglichkeit mit ein. Nach eigenem Bekunden wurden Standorte in dicht besiedelten Gebieten, in geschützten Arealen wie Wäldern, Mooren und Torfen und von Erdbeben bedrohten Regionen ausgeschlossen. Dabei räumten die Studienautoren durchaus ein, dass sich Standorte in naher Zukunft aufgrund des Klimawandels verändern werden –abhängig von Niederschlägen, Gletscherschmelze etc. sowohl zum Besseren als auch zum Schlechteren. Geographisch haben sich die Wissenschaftler um Rongrong Xu festge-
legt: Demnach sind vor allem Asien und Afrika mit 85 Prozent die zukünftigen Hoffnungsträger für die Wasserkraft. Konkret wird vor allem die Himalaya-Region hervorgehoben. Länder wie Nepal könnten alleine mit Hilfe der Wasserkraft ein Vielfaches ihres eigenen aktuellen Strombedarfs erzeugen. Das träfe nach Aussagen der Studienautoren auch auf Länder wie Afghanistan, Myanmar oder Peru zu.
IMMENSES POTENZIAL IN ASIEN UND AFRIKA
Allerdings müssen bei intensiver Wasserkraftnutzung auch nachteilige Folgen einkalkuliert werden. Die chinesischen Forscher rechnen in der Studie, dass im Falle der Umsetzung sämtlicher identifizierter Projekte rund 650.000 Menschen umsiedeln müssten. Das entspricht in etwa der Hälfte jener Anzahl, die für das chinesische Dreischluchten-Kraftwerk am Jangtsekiang weichen mussten. Ganz konkret ist es auch China, das mit dem größten Wasserkraftpotenzial aufwartet – und zwar mit über 2 Petawattstunden. Das ist eine Zahl mit 15 Nullen. Grundsätzlich könnten gemäß der Studie in ganz Asien Wasserkraftkapazitäten im Ausmaß von bis zu 3,9 Petawattstunden zugebaut werden. Hinter Asien gilt Afrika als der Kontinent mit dem größten nicht ausge-
schöpften Wasserkraftpotenzial. Es wird mit 0,6 Petawattstunden beziffert. In Summe könnten bei Nutzung aller identifizierter Standorte die Wasserkraftkapazitäten global um 5,27 Petawattstunden erhöht werden, was in etwa einer Verdoppelung der weltweiten Kapazitäten auf ca. 9 PWh entspricht. Im Vergleich dazu liegt die jährliche globale Stromerzeugung aktuell bei rund 27,4 PWh (Jahresdaten 2021 aus statista.com). Legt man die Vorzüge der Wasserkraftnutzung auf den Klimaschutz um, kommen die chinesischen Forscher ebenfalls auf beachtliche Werte: Circa 3,4 Milliarden Tonnen CO2 könnten pro Jahr eingespart werden, sollten alle identifizierten Wasserkraftprojekte realisiert werden – das wären rund 8,2 Prozent des menschengemachten CO2-Ausstoßes.
Vom Ausbau der Wasserkraft könnten dabei die mit guten Voraussetzungen gesegneten Länder profitieren, dies träfe in besonderem Ausmaß für Afrika zu, unterstreichen die Studienautoren. Für die europäische Wasserkraftindustrie sind dies ebenfalls interessante Perspektiven, da es vielen Branchenunternehmen in den letzten Jahren gelungen ist, sich erfolgreich auf den Boom-Märkten der Zukunft zu positionieren.

Mit maximaler Cybersecurity auf dem Weg zum Kundeneinsatz: Entwickelt und zertifiziert nach IEC 62443-4-2 erfüllt der Radar-Füllstandsensor VEGAPULS 6X die höchsten Standards, die zur Verfügung stehen.
Der Schwarzwälder Hersteller von Füllstand-, Grenzstand- und Druckmesstechnik VEGA begibt sich auf Sicherheitsmission. Im Januar 2023 lieferte er den weltweit wohl ersten Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity an seine Kunden aus. Er will damit ein starkes Zeichen gegen die auch industrieweit zunehmende Bedrohung durch Cyber-Kriminelle setzen.
Rein äußerlich ist ihm nichts anzumerken: Der Radarsensor VEGAPULS 6X passt mit der Dokumentation perfekt in den maßgeschneiderten Karton und erhält am Ende der Verpackungslinie sein Versandetikett. Adresse: Ein Chemieunternehmen in Nordhessen. Doch was beim Kunden ankommt, ist etwas anderes als alle bislang am Markt erhältlichen Füllstandsensoren. Integriert bringt der Sensor erstmals zusätzlichen Anlagenschutz mit. Er ist nach der Cyber-Sicherheitsnorm IEC 62443-4-2 entwickelt worden und erfüllt damit die höchsten Standards, die derzeit in der Prozessindustrie zur Verfügung stehen.


SICHERHEIT ABHÄNGIG VON DEN KOMPONENTEN
„Messdaten jederzeit sicher zu nutzen, ist inzwischen eine der wichtigsten Anforderungen unserer Kunden“, sagt Florian Burgert, der die Konzeption des universellen Füllstandsensors ab Schritt 1 mitbegleitet hat. „Wir hören das aus beinahe allen Branchen.“ Für eine tiefgreifende Sicherheit müsse daher nicht nur die Anlage an sich sicher sein, sondern auch alle eingebauten Komponenten den Standards entsprechen.
BEDROHUNGEN IN ZUKUNFT EINEN SCHRITT VORAUS
Gerade beim Thema Cybersicherheit geht es in der Industrie um Verlässlichkeit und darum, neuesten Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. VEGA will sich jedoch nicht auf dem ersten lieferfähigen Gerät nach IEC 62443 ausruhen. Mit der Zertifizierung als Leitfaden wird das Unternehmen künftige Produkte von Beginn an nach allen bestehenden Sicherheitsanforderungen entwickeln. Schutzmaßnahmen werden konsequent ausgebaut, um auch in Zukunft die verlässliche Basis für einen sicheren Anlagenbetrieb zu schaffen.
Mehr Informationen auf www.vega.com
Erstmals weltweit versandt und ausgeliefert: Ein Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity.
Seit über zwei Monaten läuft der erfolgreiche Probebetrieb der ersten horizontalen sechsdüsigen Peltonmaschine im Wasserkraftwerk Gerlos 1 und setzt neue Maßstäbe. Bei der Peltonturbine, die sich besonders für Anlagen mit großen Fallhöhen eignet, wird das Triebwasser in einem Strahl mit sehr hoher Geschwindigkeit aus einer oder mehreren Düsen auf die Becher des Laufrads gelenkt. Peltonturbinen mit mehr als drei Düsen wurden bisher stets mit vertikaler Welle ausgeführt. Hauptgrund hierfür war, dass damit bislang ein höheres Wirkungsgradniveau als bei horizontaler Anordnung erreicht werden konnte. Voith Hydro hat diesen Nachteil nun erfolgreich ausgeräumt – wie jetzt im Kraftwerk Gerlos 1 unter Beweis gestellt wurde. Hier wird erstmalig ein vergleichbarer Wirkungsgrad zur vertikalen Anordnung erreicht. Dabei wurden die bisherigen vier vertikalen Peltonturbinen erfolgreich durch eine sechsdüsige horizontale Peltonmaschine ersetzt.
Neben diesem Anwendungsfall ist die Technologie besonders für Modernisierungen bestehender Wasserkraftanlagen interessant bei denen bereits ein- oder zweidüsige horizontale Einheiten verbaut sind. Denn ein Austausch der Turbine ist ohne größeren baulichen Aufwand möglich, was Baukosten und Umbauzeiten stark reduziert. Gleichzeitig besteht enormes Potenzial den Wirkungsgrad zu steigern. Durch eine damit einhergehende, potenzielle Reduzierung der Maschinenanzahl, kann ebenso eine Senkung zukünftiger

Wartungskosten erreicht werden. Auch bei Neuanlagen punktet die neue Entwicklung, da sie gegenüber herkömmlichen Lösungen mit kleinerem Aushub bzw. mit kleinerer Grundfläche und weniger Bauvolumen auskommt. Damit verbunden ist auch eine verkürzte Installationszeit, die die Gesamtinvestitionskosten deutlich reduziert.
Die Dauer des Zusammenwirkens von Wasserstrahl und den Bechern des Peltonlaufrads ist äußerst kurz und beträgt oft nur wenige Millisekunden. Aus diesem Grund ist die Strömungssimulation von Peltonturbinen bei weitem die komplexeste und schwierigste aller hydraulischen Turbomaschinensimulationen. Bei Voith Hydro wurden die Methoden in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass beispielsweise auch die Gehäuseströmung untersucht werden kann. Dieser wichtige Fortschritt leistete auch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des neuen Konzepts. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat Voith Hydro Tausende von Peltonturbinen unterschiedlichster Größe und Leistung in alle Welt geliefert. Am Konzept der mehrdüsigen horizontalen Peltoneinheiten forscht das Unternehmen in Deutschland bereits seit Jahren intensiv. Unter der Bezeichnung „HP3+“ sind die daraus hervorgehenden Entwicklungen aller horizontaler Peltonturbinen mit mehr als drei Düsen zusammengefasst.
Voith Hydro Experten haben die Technologie im vergangenen Jahr erstmalig auf einer führenden internationalen Wasserkraftkonferenz in Wien vorgestellt. Dieser Weltpremiere gingen umfangreiche Tests und Modellversuche im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Heidenheim voraus. Erste Kunden setzen bereits auf die neuartige Konstruktion, darunter das führende Österreichische Energiewendeunternehmen Verbund.
BEEINDRUCKENDER TRANSPORT
Vor Inbetriebnahme der neuen Maschineneinheit sorgte bereits der spektakuläre Transport des Maschinengehäuses für Aufsehen. Anfang April 2022 verließ dieser 54 Tonnen schwere Koloss das Werksgelände des österreichischen Voith Hydro Standorts in St. Pölten. Neben seinem Gewicht beeindruckten auch die Abmaße von knapp neun Metern Länge, über sechs Metern Breite und vier Metern Höhe. Die logistische Meisterleistung konnte durch einen Schwertransport über ganze drei Nächte vollbracht werden.

ÜBER KRAFTWERK GERLOS 1
Das Kraftwerk Gerlos 1 ist ein Speicherkraftwerk im Zillertal in Tirol. Es wurde 1949 in Betrieb genommen und weist eine Jahreserzeugung von 326 GWh auf. Damit versorgt das Kraftwerk über 70.000 Vier-PersonenHaushalte mit erneuerbarer Energie.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1999 hat sich die österreichische medon GmbH als zuverlässiger Partner für Messtechnik im Energiesektor sowie der Chemie- und Pharmaindustrie etabliert. Zum Leistungsspektrum zählen darüber hinaus Dienstleistungen und Automatisierungen im industriellen und kommunalen Bereich. Mit der Verbund Hydro Power GmbH verbinden den Branchenexperten eine bald 10-jährige Geschäftspartnerschaft und eine Vielzahl erfolgreicher Projekte.
Ein messtechnisch besonders herausforderndes Projekt für die medon GmbH und gleichzeitig der Beginn einer erfolgreichen Unternehmenspartnerschaft stellte der Auftrag für das Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Malta-Hauptstufe in Kärnten dar. Mit 730 MW Engpassleistung ist die Anlage das leistungsstärkste Kraftwerk der Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck. Prinzipiell bestand das Projekt in einer Messaufgabe für die Realisierung eines hydraulischen Schutzes für das Großkraftwerk mit insgesamt sechs Messstellen. Zur Erhöhung der Mess- bzw. Ausfallsicherheit wurden sämtliche Messpunkte als redundante Zweikanalsysteme ausgeführt.
Im Projektvorfeld führte medon im August 2014 eine Testmessung durch, um die Eignung des Systems bei allen Betriebszuständen – Turbinieren, Pumpen, Pumpregelbetrieb – zu überprüfen. Eine wesentliche Herausforderung der Messaufgabe stellte die Nettofallhöhe von mehr als 1.000 m und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Druckrohrleitung dar. Es musste eine Lösung gefunden werden, um die Rohrumfangsveränderungen bei gefüllter bzw. leerer Rohrleitung zu kompensieren, damit in jeder Betriebssituation eine sichere und stabile Befestigung der Sensoren gewährleistet werden konnte. Gelöst wurde dies durch die Entwicklung einer sich selbst spannenden Seilbefestigung. Diese Variante mit Stahlseilen brachte zudem eine vielfach bessere Standfestigkeit bei auftretenden Vibrationen als bei der ansonsten gängigen Methode mit Metallbändern mit sich.
Die Testmessungen ergaben mit 10 m/s im Turbinenbetrieb sowie 8 m/s im Pumpbetrieb hohe Strömungsgeschwindigkeiten. Bei ca. 1.400 mm Rohraußendurchmesser stellen diese Werte den Grenzbereich für den Einsatz von Ultraschalldurchflusssensoren dar. Um messtechnische Reserven zu erhalten, wurde ein Versuch mit Ultraschallsensoren durchgeführt, die üblicherweise bei Gasanwendungen eingesetzt werden und aufgrund ihrer Konstruktion für viel höhere Strömungsgeschwindigkeiten geeignet sind. Der Versuch zeigte, dass der Sensortyp mit 150 kHz sehr gut funktioniert und hervorragend für die Anwendung geeignet ist. Die Montage der Sensoren und Messgeräte erfolgte parallel zum Kraftwerksbetrieb und brachte keinerlei Beeinflussungen der Produktion mit sich – ein großer Vorteil für die Planung des Projekts hinsichtlich Flexibilität und Unabhängigkeit. Neben der Lieferung der Messgeräte sorgte der Industrie-Allrounder medon auch für die e-technische Planung und Ausführung des zur
Implementierung notwendigen Schaltschranks. Installiert und in Betrieb genommen wurde das Equipment im April 2015, nach einer definierten Prüfungsperiode erfolgte der Übergang in den Regelbetrieb. Die erfolgreiche Implementierung in den bestehenden hydraulischen Schutz während des laufenden Betriebs legte den Grundstein für die zukünftige partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Verbund Hydro Power GmbH und der medon GmbH. Mittlerweile stellen die Branchenexperten ihre Kompetenz seit bald zehn Jahren bei einer ganzen Reihe von Verbund-Kraftwerken unter Beweis.

Die Zukunft der Wasserkraft in Zeiten eines sich immer schneller ändernden Klimas wird stark von den damit einhergehenden Änderungen und der Verlagerung von Niederschlag abhängen (IPCC, 2013). Dies wird Auswirkungen auf die Ökologie und Nutzungsmöglichkeiten von Flüssen haben. Mit immer genaueren Modellen lassen sich Prognosen sowohl für die globale als auch regionale Verfügbarkeit von Wasser erstellen. Übereinstimmend wird dabei von einer Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen berichtet (Jjunju et al., 2022). Neben bekannten Folgen wie Überschwemmungen oder Erdrutschen kann bei Wasserkraftwerken auch eine wenig beachtete Gefahr für Fische und aquatische Wirbellose entstehen: Gasübersättigung.
Mit Gas übersättigte Flüssigkeiten sind uns vor allem von Getränken bekannt, wo meist CO2 unter Druck in der Flüssigkeit gelöst wird. So entsteht zum Beispiel Kohlensäure in Mineralwasser. Durch den Druckabfall beim Öffnen der Flasche oder Dose entweichen in der Folge Gasblasen, was eine natürliche Entgasung darstellt. An diesem Beispiel lässt sich gut das Prinzip von Gasübersättigung ablesen, welches dem Henry-Gesetz folgt: Die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten ist direkt proportional zum Druck in der Flüssigkeit. Eine Übersättigung ist also vorhanden, wenn in einer Flüssigkeit im Verhältnis zum Druck zu viel Gas gelöst ist. Einen hier weniger relevanten Einfluss auf die Löslichkeit von Gasen hat außerdem die Temperatur.

TURBINENTYP SPIELT WICHTIGE ROLLE
Der bekanntermaßen wichtigste Parameter für die Energieerzeugung in Wasserkraftwerken ist neben der Durchflussmenge die Fallhöhe, welche den Druck bestimmt. Wird nun Luft in das Wasser eingebracht und dort hohem Druck ausgesetzt, löst sie sich im Wasser. Das kann in Mittel- oder Hochdruckkraftwerken der Fall sein, wenn zum Beispiel durch Verstopfung oder nicht ausreichende Dimensionierung von Kraftwerkseinläufen Luft in das System eingebracht wird. Dies kann bei Starkregenereignissen und anderen hohen Abflüssen wie z.B. Schneeschmelzen vorkommen, tritt aber auch bei zu seicht liegenden oder unterdimensionierten Einläufen auf.
Wichtig für die Entstehung von Gasübersättigung ist hierbei der Turbinentyp. Bei den meisten Pelton-Turbinen wird das Wasser beim Auftreffen auf die Turbinenschaufeln ausreichend entlüftet, während bei Kaplanund Francis Turbinen kaum eine Entgasung stattfindet. In anderen Fällen kann Gasübersättigung bei hohen Dämmen an großen Flüssen entstehen, wenn dort bei Hochwasserentlastung Luft in große Wassertiefen unterhalb des Dammes eingebracht wird. Im Rahmen von Messungen konnten Gassättigungen bis zu 120 Prozent auch im Zusammenhang mit Turbinenbelüftung zum Betrieb im Grenzlastbereich nachgewiesen werden (Pulg et al. 2018).
GEFÄHRDUNG VON ORGANISMEN
Gasübersättigung kann potenziell gravierende Folgen für Fische und aquatische Wirbellose im Gewässer stromab haben. Werden Fische einer erhöhten Gassättigung ausgesetzt, so kann die sogenannte Gasblasenkrankheit auftreten, welche Ähnlichkeiten mit der Taucherkrankheit bei Menschen hat. Dabei fallen aufgrund einer Erhöhung der Gaskonzentration im Organismus Gasblasen aus, bei Fischen häufig in den Flossen oder den Augen. Die Ausprägung der Krankheit hängt von der Höhe der Gasübersättigung, der Aussetzungsdauer, der Tierart und dessen Größe ab. Akute Ausprägungen führen meist zu Gasembolien innerhalb der Blutbahnen oder le-

benswichtigen Organe und damit zum Tod. Bei weniger akuten Ausprägungen ist die Krankheit reversibel, kann jedoch zu sekundären Schädigungen wie Pilzbefall und Stress führen. Die Gasblasenkrankheit tritt bereits bei geringer Übersättigung auf und kann ab 110 Prozent Gassättigung tödlich sein (wobei 100 Prozent Sättigung der Normalzustand ist). Dieser Wert ist auch als Grenzwert in manchen Staaten der USA und in Kanada in Flüssen mit einer Wassertiefe von mehr als 1 m festgeschrieben (Weitkamp & Katz, 1980). Studien in Nordamerika, China und Norwegen zeigen, dass durch Wasserkraft verursachte Gasübersättigung ein weit verbreitetes und unterschätztes Problem ist. In den USA und Kanada wurden die ersten Untersuchungen zur von Wasserkraft verursachten Gasübersättigung bereits in den 1960er Jahren durchgeführt. Dort sowie in China treten vor allem an
hohen Dämmen Gasübersättigungen auf. Anders in Norwegen, wo das Problem im Zusammenhang mit den vornehmlich eingesetzten Francis-Turbinen bei mittleren und hohen Fallhöhen auftritt. Das internationale Forschungsprojekt SUPERSAT unter Leitung des Norwegian Research Centre (NORCE) hat in den letzten Jahren unter anderem zur Verbreitung von Gasübersättigung in Norwegen, Deutschland und Österreich geforscht. Für die österreichische Forschung ist das Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung der BOKU Wien zuständig, in Deutschland die Universität Koblenz-Landau. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass ein beträchtlicher Teil der großen norwegischen Kraftwerke eine hohe bis sehr hohe Gefahr für Gasübersättigung aufweist. Nun wird an einer flächendeckenden Überwachung der stromab liegenden Gewässer gearbeitet (Pulg et al., 2020)
Das Entstehen von Gasübersättigung kann durch das Vermeiden von Lufteintrag in unter Druck stehendes Wasser vermieden werden. Dies kann zum Beispiel durch Leitbauwerke und Dämme oder ausreichende Dimensionierung von Kraftwerkseinläufen gewährleistet werden. Ist die Entstehung unvermeidbar, so lässt sich durch Lüften des Wassers an Überfällen, Schwellen oder mittels Deflektoren die atmosphärische Entgasung beschleunigen (Pulg et al., 2018). In Kanada wurde der Einsatz von Skisprung-Hochwasserentlastungsbauten zur Entgasung erfolgreich getestet (Kamal et al., 2020). Im norwegischen DeGas Projekt wird an weiteren technischen Lösungen zum schnellen Ausgasen der gelösten Luft gearbeitet. Dort stehen vor allem der Einsatz von Ultraschall und Blasenschleiern im Fokus (Rognerud et al., 2020).

Das Vermeiden von Gasübersättigung in Gewässern stromab von Wasserkraftwerken wird durch den Klimawandel mehr Relevanz bekommen. Die eingangs genannte Zunahme an Starkregenereignissen wird vor allem in Bergregionen mit Speicherkraftwerken, Francis- Turbinen und Sekundäreinläufen zu mehr Übersättigungsereignissen führen können. Deshalb sollte bei Verdacht auf Gasübersättigung ein Messsystem zur kontinuierlichen Überwachung des gelösten Gasgehalts am Kraftwerksauslauf installiert werden. In Kombination mit Daten aus dem Kraftwerksbetrieb können damit mögliche Ursachen für Gasübersättigung identifiziert und Fischsterben verhindert werden. Dies trägt zu Erreichung der Kriterien von Umweltauflagen, Tier-, Natur- und Artenschutz, sowie der Wasserrahmenrichtinie und der EU Taxonomie bei.

[Autoren: Wolf Ludwig Kuhn & Dr. Ulrich
Pulg & Sebastian Franz Stranzl]
Literatur
Jjunju, E., Killingtveit, Å., & Hamududu, B. (2022). Hydropower and Climate Change. In Comprehensive Renewable Energy (pp. 259–283). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819727-1.00111-4
Pulg, U., Isaksen, T. E., Velle, G., Stranzl, S., Espedal, E. O., Vollset, K. W., Bye-Ingebrigtsen, E., & Barlaup, B. T. (2018). Gassovermetning i vassdrag-en kunnskapsoppsummering (No. 312; Issue 312). Labora torium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske.
Weitkamp, D. E., & Katz, M. (1980). A Review of Dissolved Gas Supersaturation Literature. 45.
Pulg, U., Stranzl, S., Wagner, B., Flödl, P., & Hauer, C. (2020). Gasübersättigung in Flüssen? Messung, Ursachen und Auswirkungen – Ein internationales Forschungsprojekt untersucht Verbreitung und Umwelteffekte. Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 72(3–4), Article 3–4. https://doi.org/10.1007/s00506-020-00655-y
Kamal, R., Zhu, D. Z., Crossman, J. A., & Leake, A. (2020). Case Study of Total Dissolved Gas Transfer and Degasification in a Prototype Ski-Jump Spillway. Journal of Hydraulic Engineering, 146(9), Article 9. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001801
Rognerud, M. E., Solemslie, B. W., Islam, H., & Pollet, B. G. (2020). How to Avoid Total Dissolved Gas Supersaturation in Water from Hydropower Plants by Employing Ultrasound. Journal of Physics: Conference Series, 1608, 012004. https://doi.org/10.1088/17426596/1608/1/012004
Überall wo beengte Platzverhältnisse den Einbau einer Fischaufstiegshilfe erschweren, bietet sich mit dem enature® Fishpass heute eine effiziente wie wirtschaftliche Lösung für den Kraftwerksbetreiber an – unabhängig von Gewässertyp und Wasserführung. Der neuartige MultiStruktur Schlitzpass, der als eine Weiterentwicklung des klassischen Schlitzpasses oder Vertical Slot Passes gilt, hat sich mittlerweile bestens etabliert und wurde auch in den aktuellen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen 2021 aufgenommen. Nach zahlreichen Einsätzen an österreichischen Gewässern, wurde der enature® Fishpass mittlerweile auch an vier Schweizer Standorten erfolgreich installiert. Vertrieben wird das von der Kirchdorfer Concrete Solutions produzierte enature® System in der Schweiz exklusiv von dem in Kärnten ansässigen Ingenieurbüro Der Wasserwirt – Projektmanagement GmbH, das auch alternative Fischaufstiegshilfen wie etwa die bewährte Fischliftschleuse oder Lockströmungsdotationsbauwerke in seinem Leistungsportfolio führt.
Siedlungsgebiete, die vom Schweizer Bundesamt für Energie mit dem Zertifikat „2000-Watt-Areal“ ausgezeichnet wurden, stehen für eine vorbildliche Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedanken. Eines dieser Vorreiterprojekte nimmt aktuell am ehemaligen Industrie-Areal in der Gemeinde Cham im Kanton Zug Formen an. Dort wo mehr als 360 Jahre lang die Papierfabrik eine ganze Region prägte, entsteht heute ein neues Wohn- und Arbeitsquartier, das ein neues Kapitel der traditionsreichen Geschichte am Standort schreiben soll. Das besondere Merkmal des modernen Anlagenkomplexes liegt in seinem komplett CO2-freien Energiesystem mit einer 100 prozentigen erneuerbaren Energieversorgung. Der gesamte Strombedarf wird dabei zu 40 Prozent aus Photovoltaik-Anlagen und aus einem neuen Kleinwasserkraftwerk gedeckt. Letzteres existierte bereits am Standort Obermühle, von dem eine über 100-jährige Wasserkrafthistorie belegt ist. Aktuell ist eine Neuanlage im Entstehen, deren maschinelles Herz aus ei-
ner 220 kW starken doppeltregulierten Kaplanturbine bestehen wird. Auch die Wehranlage, wo 25 m3/s abgeleitet werden können, wird komplett neu gestaltet – und selbstverständlich auch ökologisch entsprechend adaptiert. „Hier an diesem traditionsreichen Standort herrschen nach wie vor relativ beengte räumliche Verhältnisse vor. Daher suchten wir eine einfache, wirtschaftliche und zugleich funktionelle Lösung für eine Fischaufstiegshilfe. Beim enature® Fishpass wurden wir letztlich fündig“, schildert der Planer des Kraftwerks, Fernando Binder vom Ingenieurbüro fmb- ingenieure.ch, die Ausgangssituation.
NEUE PASSAGE FÜR BEWOHNER DER LORZE
Gemeinsam mit dem Kärntner Ingenieurbüro Der Wasserwirt, der exklusiv die Lizenz für den Vertrieb des enature® Fishpass in der Schweiz innehat, ging fmb-ingenieure.ch an die Planung des neuen Fischpasses. Es galt, am Wehrbauwerk an der Lorze eine Höhendifferenz von 3,20 m zu überwinden. Konkret
fiel die Wahl auf ein System der Größe „mittel“ mit 27 Becken, wobei die Schlitzweite mit 35 cm gewählt wurde. Die Fischaufstiegshilfe wurde so konzipiert, dass auch 80 cm lange Fische sie problemlos passieren können. Sie ist für die Zielfischarten Seeforelle, Barbe, Nase, Laube, Schneider, Rotauge, Gründling, Bartgrundel und Trüsche ausgelegt. „Die Sohle der Fischaufstiegshilfe besteht aus einem ca. 20 cm dicken Sohlsubstrat aus einer gerundeten Gesteinsmischung von 90 bis 250 mm Durchmesser. Dieses Sohlsubstrat verfügt über zahlreiche kleinere und größere Hohlräume, in welchen die bodenorientierten Fischarten sich gut verstecken können“, erklärt Binder. Die zu überwindende Höhendifferenz zwischen den einzelnen Becken liegt bei 12 cm. Die FAH, deren Gesamtlänge 130 m beträgt, wird mit 250 l/s kontinuierlich dotiert. Bereits im Herbst 2022 konnte der Multistruktur-Schlitzpass eingebaut werden. Er geht nun Mitte Februar dieses Jahres in Betrieb. Danach stehen noch umfangreiche Funktionsüberprüfungen auf dem Programm.

In der Regel übernimmt das Kärntner Ingenieurbüro Der Wasserwirt neben dem Consulting bei der Planung auch die Lieferung der Fertigteile. Je nach Bedarf und Vereinbarung werden entweder das ganze System, U-Kanal plus Schlitzeinbauteile, oder nur die Schlitzeinbauteile von Der Wasserwirt geliefert. Im Fall des Projektes in Cham fungierte Der Wasserwirt als Berater in der Planung und lieferte die Schlitzeinbauteile.


Das erste enature® Projekt im Kanton Zürich wurde allerdings von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) am Limmat-Kraftwerk Dietikon realisiert. Bereits 2019 gelang den EKZ eine aufwändige Modernisierung des traditionsreichen Laufkraftwerks auf der städtischen Grien-Insel, wobei sowohl am Hauptals auch am neu angelegten Dotationskraftwerk ein enature® Fishpass installiert wurde. Das Kärntner Ingenieurbüro Der Wasserwirt zeichnete bei der Planung als Consulter verantwortlich und organisierte zudem die Lieferung und Montage. „Der U-Kanal wurde vor Ort in Ortbetonbauweise hergestellt. Danach wurden die Schlitzeinbauteile geliefert und
montiert“, umreißt der Geschäftsführer von Der Wasserwirt, Bernhard Monai, den baulichen Aspekt. „Beim Bau der Fischwanderhilfen für das Wasserkraftwerk Dietikon (Zürich) war die Ausgangslage geprägt von den engen Platzverhältnissen aufgrund der innerstädtischen Situierung der Anlagen. Der enature® Fishpass war unter diesen Voraussetzungen die ideale Lösung“, erklärt Alfredo Scherngell, Leiter Wasserkraft bei EKZ und zentraler Projektkoordinator. Er bestätigt, dass das System aufgrund der verminderten Betriebswassermenge auch aus wirtschaftlichen Gründen für den Kraftwerksbetreiber sehr interessant sei. Konkret benötigt der enature® Fishpass einen um 30 bis 40 Prozent geringeren Wasserdurchfluss als bei einem herkömmlichen Schlitzpass bei voller Funktionalität.
GUTE ABSTIMMUNG ERFORDERLICH
Konkret kam in Dietikon der enature® Fishpass System „mittel“ zum Einsatz. Dabei beträgt die Beckenbreite des Multistruktur-Schlitzpasses jeweils 217,5 cm, die Beckenlänge 300 cm, wobei die Schlitzweite in diesem Fall bei 30 cm liegt. Das Sohlsubstrat mit darin untergebrachten Störsteinen ist 20 cm hoch darin aufge-

bracht, und die Höhendifferenz zwischen den Becken wurde mit 15 cm gewählt. Die Fischaufstiegshilfe am Hauptkraftwerk an der Limmat wird kontinuierlich mit 224 l/s dotiert. Um die Auffindbarkeit der Fischaufstiegshilfe im Unterwasser für die Bewohner der Limmat zu erhöhen, wurde im Einstiegsbereich eine Zusatzströmung mittels eines Lockströmungsbauwerks geschaffen. Die Planung und der Bau von Lockströmungsbauwerken sind Teil des Leistungsportfolios von Der Wasserwirt, zahlreiche Referenzanlagen zeugen von der Effektivität dieser Anlagen. Geschäftsführer Bernhard Monai verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, sowie eine professionelle Abstimmung gerade im Hinblick auf Bautoleranzen das Um und Auf einer erfolgreichen Projektabwicklung seien. Im Falle des modernisierten Kraftwerks Dietikon mit zwei neuen enature® Fishpässen klappte die Umsetzung mustergültig. „Wir wurden von der Firma Der Wasserwirt in allen Projektphasen, von der Konzeption über die Projektierung und Bau bis hin zur Inbetriebnahme und Nachbetreuung, stets optimal unterstützt“, findet Alfredo Scherngell von EKZ lobende Worte.

WECHSELNDE SCHLITZFOLGE WIRKT
Grundsätzlich handelt es sich beim enature® Fishpass um die Weiterentwicklung des klassischen Schlitzpasses oder Vertical Slot Passes. Im Rahmen einer zweijährigen, intensiven Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien entwickelte die F&E-Abteilung der Kirchdorfer Concrete Solutions, einer Sparte der Kirchdorfer Gruppe, das neuartige Fertigteilsystem einer Organismenwanderanlage, das den Bedürfnissen der Gewässerorganismen in optimaler Weise gerecht wird, den Wasserbedarf minimiert und sich optimal für Standorte mit beengten Platzbedingungen eignet. Charakterisiert ist der Bautyp durch die vertikalen Schlitze der Zwischenwände, die über die gesamte Höhe des Bauteils reichen. Ein wesentlicher Unterschied zu den herkömmlichen Schlitzpässen liegt darin, dass die Schlitze alternierend angebracht sind. Das heißt: die Schlitze befinden sich nicht auf einer Seite, sondern sind wechselweise angeordnet. Auf diese Weise
Vorteile des enature® Fishpass:
+ Erhöhung der Rauigkeit
+ Reduktion der Fließgeschwindigkeit um bis zu 25 Prozent
+ Reduktion des Wasserdurchflusses (30 - 40 Prozent weniger als bei einem herkömmlichen Schlitzpass)
+ Reduktion der Turbulenzen
+ Verbesserter Aufstieg für schwimmschwache Arten und Juvenile
+ Definierte hydraulische Verhältnisse
+ Standardisiertes Fertigteilsystem
+ Geringe Bauzeit
+ Geringer Platzbedarf
bildet das System auch kleine Zwischenbecken aus. Diese liegen zwischen den großen Erholungs- bzw. Ruhebecken, in denen die Energiedissipation erfolgt. „Die Abwechslung der Schlitzseite je Bauteil sowie die Ablenkung beim Schlitz durch eine Art Umlenkung führen zu einer Strömungsumlenkung, um eine geradlinig durchgehende Kurzschlussströmung von Schlitz zu Schlitz zu verhindern. Damit wird eine geschwungene Hauptströmung gewährleistet“, erläutert dazu Bernhard Monai die Vorzüge des neuen Systems.
Um den Multistruktur-Fischpass an die Anforderungen an die jeweilige Leitfischart, respektive Fischregion bestmöglich anzupassen, ist das Fertigteilsystem in zwei verschiedenen Systemgrößen und mit unterschiedlich breiten Schlitzen (15 bis 35 cm) verfügbar. Für jede Systemgröße können zwei gerade Becken – entweder links oder rechts ausgerichtet – sowie ein
45-Grad-Becken gewählt werden, mit denen sich beliebige Kehren und Ausweichmöglichkeiten realisieren lassen. Für eine professionelle Planung bietet der Hersteller ein spezielles 3D-Tool an, das sämtliche Fertigteile des enature® Fishpass abbildet und sämtliche Bemessungsparameter für unterschiedliche Gefällevarianten berücksichtigt. Das standardisierte Fertigteilsystem bringt dabei nicht nur den Vorteil mit sich, dass es auch bei beengten Platzbedingungen sehr gut in neue und bestehende Anlagen integriert werden kann. Sondern darüber hinaus garantiert es auch eine sehr zügige bauliche Umsetzung, was nicht unwesentlich zur Wirtschaftlichkeit des Systems beiträgt.
Dass der enature® Fishpass funktioniert und von den Gewässerbewohnern exzellent angenommen wird, belegen auch die Ergebnisse aus den zahlreichen Monitoring-Studien in sämtlichen Fischregionen. Einerseits wurde die
concrete-solutions.eu enature-fishpass.at



Fische kennen keine (Länder-) Grenzen. Der enature® Fishpass von Kirchdorfer Concrete Solutions auch nicht.Sohlsubstrat mit Störsteinen im enature® Fishpass Dietikon. © Der Wasserwirt © Der Wasserwirt Im enature® Fishpass sind die Schlitze wechselweise versetzt angeordnet.
Passage von stark bodenorientierten Arten, wie etwa der Koppe, oder schwimmschwachen Arten, wie der Rotfeder, sowie von Jungfischen und Neunaugen dokumentiert. Andererseits konnte auch die Migration von größenbestimmenden Fischarten nachgewiesen werden. Die größten bislang über den enature® Fishpass aufgestiegenen Fische sind der Wels mit 1.350 mm, der Hecht mit 1.140 mm und der Huchen mit 1.200 mm Körperlänge. „Zudem konnte etwa an einem Draukraftwerk ein quantitativer Aufstieg adulter Nasen im Zuge deren Laichwanderung nachgewiesen werden. Aufgrund der Restwassersituation an dem Standort liegt eine sehr gute Leitströmung vor“, sagt Bernhard Monai und verweist auf die besondere Bedeutung der Leitstromdotation. Gerade weil der enature® Fishpass eine deutlich geringere Dotation benötigt, sei besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung des Einstiegs sowie auf die Leitstromdotation zu legen. Bei größeren Gewässern ist daher manchmal zugunsten der optimalen Auffindbarkeit eine zusätzliche Dotation erforderlich. In diesem Fall bietet Der Wasserwirt auch seine vielfach bewährten Lockströmungsdotationsbauwerke an, die in Lizenz mit der Uni Kassel geführt werden. Die erste Anlage wurde vor ca. 15 Jahren in Kärnten gemeinsam mit der Uni Kassel umgesetzt und praxisbezogen weiterentwickelt. Fünf wurden bislang auch an Standorten in der Schweiz realisiert.
ALTERNATIVE PASSAGE ÜBER DEN LIFT Gerade an „diffizilen Standorten“, dort wo der Stand der Technik an seine Grenzen stößt, braucht es mitunter spezielle Lösungen. Seit 2012 arbeitet das Kärntner Ingenieurbüro an der Entwicklung der Fischliftschleuse nach dem System Der Wasserwirt. Sie kommt dort
zum Einsatz, wo extrem beengte Platzverhältnisse kaum eine Standard-Fischaufstiegsanlage zulassen. Sie wurde daher auch für den Einsatz bei besonders beengten Platzverhältnissen in den österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen aufgenommen. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erfolgt der Transport in der Fischliftschleuse nach dem System Der Wasserwirt über ein auf der Seite offenes Transportsystem, das sich dem Wasserspiegel in einem Schachtbauwerk anpasst. Zwischenzeitlich sind schon einige dieser Anlagen in Betrieb, allerdings laufen die Forschungsarbeiten dazu im Hintergrund weiter. Dazu Bernhard Monai: „Aktuell haben wir das System an acht Standorten umgesetzt, drei weitere sind in Planung. Außerdem wurden etwa weitere 10 Anlagen in Machbarkeitsstudien aufgenommen.“ Sechs der realisierten

Anlagen wurden bereits einem vollständigen Monitoring unterzogen, wobei für alle der Nachweis der Funktionsfähigkeit erbracht werden konnte. Die zwei anderen Anlagen befinden sich noch in der Monitoring-Phase. Die jüngste Weiterentwicklung an der Fischliftschleuse nach dem System Der Wasserwirt betrifft die Fischerkennung. „Bislang erfolgten die Hübe der Fischliftschleuse nicht ereignisgesteuert, sondern gingen automatisiert 2 bis 3 Mal pro Stunde vonstatten. Wir konnten nun ein speziell entwickeltes System zur Fischerkennung implementieren, das die Anzahl der Hübe abhängig vom aktuellen Migrationsvorkommen um bis zu 50 Prozent reduzieren soll. Es wurde 2022 erstmals eingebaut“, erklärt Bernhard Monai. Das Monitoring dazu begann im Herbst 2022, die entsprechenden Auswertungen der Ergebnisse laufen gerade.

Eine der zentralen Herausforderungen moderner Wasserkraftnutzung ergibt sich aus den aktuellen fischökologischen Erfordernissen. Es braucht heute betreiberfreundliche, platzeffiziente und zudem kostengünstige Lösungen für Fischaufstiegshilfen, die keinerlei Kompromisse hinsichtlich ihrer Funktionalität eingehen. Mit exakt dieser Zielsetzung ist das Grazer Ingenieurbüro für Gewässerökologie und Wasserbau flusslauf an die Aufgabe herangetreten, das alte Konzept des Denil-Fischpasses in die Neuzeit zu übersetzen. Auf Basis einer umfangreichen wissenschaftlichen Kooperation mit der TU Graz und zahlreichen Untersuchungen konnte der modifizierte Denil-Fischpass (eco 2-Fischpass) entwickelt werden, der die Passage nicht nur großen, schwimmstarken Fischen, sondern auch den bodenorientierten, kleineren Vertretern ermöglicht. Neueste Studien belegen mittlerweile eindrücklich die Funktionalität des Systems.
Seit 1951 war das Kraftwerk Gliederwehr in der oststeirischen Stadtgemeinde Gleisdorf in Betrieb. Doch vor einigen Jahren kam die Ökostromproduktion am Standort zum Erliegen. Der bedauerliche Grund dafür lag im Wesentlichen in der behördlich geforderten Durchgängigkeitsgestaltung an der Wehranlage. Planer DI Martin Konrad, Geschäftsführer des bekannten Planungsbüros interTechno Engineering GmbH, erinnert sich: „Schon 2015 haben wir für den Standort einen natürlichen Beckenpass geplant, der jedoch nie zur Umsetzung gelangte. Der private Betreiber der Anlage lehnte den Umbau aus wirtschaftlichen Gründen ab, was in weiterer Folge zum Entzug der Wasserrechtskonzession führte.“ Doch das vermeintliche Ende für den traditionsreichen Kraftwerksstandort war damit keineswegs gekommen. Über Intervention der Stadt Gleisdorf schaltete sich der lokale Energieversorger, die Feistritzwerke Steweag GmbH, ein und übernahm das Projekt. „Nach intensiven Studien haben die Betreiber sich dann für eine sehr innovative Lösung in Sachen Fischaufstieg entschieden. Für uns als Planer der Anlage war diese Entscheidung an die Bedingung geknüpft, dass auch die Umsetzung eines leitfadenkonformen Aufstieges möglich sein muss, sollten die Ergebnisse des Monitorings nicht entsprechen. Das hatten wir auch im Bewilligungsverfahren gegenüber der zuständigen Behörde entsprechend darzustellen“, erklärt Planer Martin Konrad. Doch die Lösung für den Standort mit dem neuen
eco 2 -Fischpass sollte halten, was man sich von ihr versprach. Bereits im Herbstmonitoring konnten mehrere hundert Fische aus zahlreichen Arten gezählt und protokolliert werden. Die Bewohner der Raab überwinden die circa 5 m Fallhöhe an der Staumauer durch den eco2Fischpass problemlos. Dabei war die Reputation des herkömmlichen Denil-Passes, wie man ihn von früher kannte, lange Zeit nicht die allerbeste.
Der Grund für den nicht allzu guten Ruf des Systems lag darin, dass der Bautyp in seiner ursprünglichen Form nur sehr eingeschränkt für Klein- und Jungfische mit Sohlbezug funktionierte. Arten wie Koppe, Gründling oder Schmerle nahmen diese Art Fischpass nicht an. Ein Grund, warum er in aktuellen Leitfäden und Regelblättern für Fischaufstiegshilfen nicht mehr empfohlen wurde. Auf der anderen Seite hingegen brachte der Denil-Fischpass allerdings früher schon einige sehr günstige Qualitäten mit, wie DDipl.-Ing. Georg Seidl, Gründer und Geschäftsführer von flusslauf e.U. betont: „Aufgrund ihrer Kompaktheit und ihrer großen Gefällekompatibilität – von 10 bis über 25 Prozent – waren Denil-Fischpässe seit jeher die kosten-
trägt den Erfordernissen der EU-Wasserrahmenrichtlinie hinsichlich Durchgängigkeit vollumfänglich Rechnung. Ein Referenzbeispiel aus jüngster Zeit ist das Projekt an der Wehranlage des neu errichteten Kraftwerks Gliederwehr in Gleisdorf. Hier überwinden sowohl die größeren als auch die kleineren, bodenorientierten sowie schwimmschwächeren Fischarten einen Höhenunterschied von ca. 5 Metern.

günstigste Variante von Fischaufstiegshilfen. Abgesehen von den geringeren Errichtungskosten und dem geringeren Platzbedarf punkten sie aufgrund der Fertigteilbauweise, die eine rasche bauliche Umsetzung garantiert. Und das auch bei bestehenden Anlagen. Hinzu kommt, dass der Denil-Fischpass konstruktionsbedingt nur wenig Beton benötigt, was ebenfalls dem Umweltgedanken Rechnung trägt.“ Seine Funktionalität im Hinblick auf adulte Individuen und schwimmstarke Arten ist sehr gut belegt und steht seit Jahrzehnten nicht zur Debatte. Daher erscheint es auch wenig überraschend, dass Ingenieure es sich zur Aufgabe machten, eine beinahe abgeschriebene Technologie noch einmal zu überarbeiten und sie letztlich entscheidend voranzubringen.
Das Prinzip des Gegenstrompasses hat in jedem Fall Geschichte. Es geht im Wesentlichen auf die Entwicklung des belgischen Ingenieurs und Hydraulikers Gustav Denil zurück. Seine ersten Prototypen nahmen zwischen 1907 und 1909 ihren Betrieb auf. Ihrem Funktionsprinzip nach handelte es sich
um steile Gerinne mit Neigungen zwischen 10 und über 25 Prozent, in denen vertikale Lamellen Gegenströmungen genieren. Auf diese Weise wird die Fließgeschwindigkeit im Zentrum des Fischpasses vermindert, um Fischen auch bei großen Fallhöhen eine Passage zu ermöglichen. „Eine Grundeigenschaft des Standard-Denil-Passes ist die hohe Fließgeschwindigkeit in Oberflächennähe, die zur Sohle hin jedoch markant abfällt. In wirtschaftlicher Hinsicht waren sie in ihren Frühzeiten besonders deshalb interessant, da sie vor allem den laichreifen Individuen wirtschaftlich relevanter Fischarten, wie Heringen und Lachsartigen, die Migration über wasserbauliche Querbauwerke ermöglichten. Für bodenorientierte Kleinfische galten sie allerdings bislang zu Recht als hoch selektiv“, führt Georg Seidl aus. Bis in die 1990er Jahre wurden Standard-Denil-Pässe in zahlreichen Regionen der Erde errichtet und zählten auch in Europa zu den häufig umgesetzten Bautypen. In den USA kommen sie bis heute noch zur Anwendung. Aufgrund ihres Defizits im Hinblick auf die bodenorientierten, schwimmschwächeren Fische war ihr Einsatz in den letzten drei Jahrzehnten in unseren Breiten rückläufig. Doch in
den letzten Jahren erfuhr das Prinzip eine beachtliche Weiterentwicklung. In enger Zusammenarbeit mit der TU Graz gelang es dem Grazer Ingenieurbüro flusslauf den eco2-Fischpass zu entwickeln, der komplett neue Standards setzt.
Die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale des modifizierten sohloffenen Denil-Fischpasses zur Standardvariante bestehen einerseits in der Einbringung einer Substratgabione und anderseits einer neuen Lamellengeometrie. Bislang waren sämtliche Bautypen des Denil-Passes dadurch charakterisiert, dass ihre Lamellen auf der glatten Oberfläche aufliegen. Das bedeutete jedoch, dass Vertreter des Makrozoobenthos nicht zuletzt auch durch die turbulenten hydraulischen Bedingungen im Gerinne in ihrer Wanderbewegung beeinträchtigt werden. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist es beispielsweise noch nicht gelungen, die bodenorientierte Fischart Koppe in einem Standard-Denil-Pass nachzuweisen. Eine zentrale Weiterentwicklung des herkömmlichen Denil-Fischpasses bestand nun in der Integration von Sohlensubstrat für bodenorientierte
Kleinfische. Als Resultat zahlreicher Variantenstudien und Untersuchungen im Wasserbaulabor, am Computer und natürlich im Feld kamen die Wissenschaftler auf eine verkehrt-T-förmige Anordnung der Sohlensubstratgabione. „Grundsätzlich wurden mit der erstmaligen Substrateinbringung die Bedingungen geschaffen, dass bodenorientierte Arten nun den für ihre Wanderung erforderlichen Lückenraum bzw. Schotterkörper vorfinden. Durch die zentrierte Anordnung der Substratgabione gelang es uns zudem, eine markante Verringerung der Fließgeschwindigkeit, vor allem im bodennahen Bereich, zu erreichen. Generell konnten die hydraulischen Bedingungen im eco2-Fischpass gegenüber dem Standardmodell deutlich verbessert werden“, erklärt Georg Seidl. Er verweist dabei auf die höchst fruchtbare Zusammenarbeit mit der TU Graz, ohne die eine derartige Weiterentwicklung nicht möglich gewesen sei. „Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit den Forschern der TU Graz weit über 100 Messkampagnen lanciert und daraus wertvolle Erkenntnisse gewonnen“, so der Gründer von flusslauf.

Beginnend mit den ersten Untersuchungen im Wasserbaulabor der TU Graz im Jahr 2016 wurden bis jetzt laufend Optimierungen an dem System erarbeitet. Zuletzt wurde noch ein weiteres Mal an der Lamellengeometrie und an der Systemauslegung getüftelt. „Die neue Lamellengeometrie erlaubt eine noch größere Wasserersparnis und garantiert zugleich sehr gute hydraulische Konditionen bei geringeren Durchflüssen. Sie wurde bereits zum Patent angemeldet“, erklärt Seidl. Die Lamellen, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden, können dabei ganz leicht entfernt werden –etwa zu Spülzwecken. Speziell nach Unwetterereignissen und Hochwasser, wenn es zu einem Eintrag von Feinsedimenten gekommen ist,

Fachplanungen im konstruktiven Wasserbau
Projektentwicklung
Behördenverfahren
Ausschreibungsplanung
Detailplanung
Bauüberwachung
Projektmanagement
Erst die Einbringung der Substratgabione sorgte dafür, dass auch bodenorientierte Fischarten diese Art des Fischaufstiegs annehmen.
lich steht für uns heute im Vordergrund, dass wir mit Funktionsbelegen für das gesamte Arten- und Altersspektrum an sämtlichen relevanten Standorten aufwarten können“, erklärt Georg Seidl.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden 20 Anlagen errichtet, für 11 davon wurde das biologische Monitoring bereits erfolgreich abgeschlossen, weitere Anlage befinden sich noch in der Monitoring-Phase. Erste Belege für die Funktionsfähigkeit des eco2-Fischpasses konnten 2017 an der Pilotanlage gesammelt werden, die an einem Standort in der oststeirischen Barbenregion an der Raab errichtet worden war. „Hier hatten wir die Möglichkeit, das System bei einer Neigung von 20 Prozent zu testen. Eine weitere Pilotanlage des eco2-Fischpasses konnten wir parallel zu einem Beckenpass in der Forellenregion installieren, um beide einem vergleichenden Monitoring zu unterziehen. Dabei gelang es uns erstmals, die Passage von Koppen in einem Denil-Fischpass nachzuweisen“, erinnert sich Seidl. Besonders beeindruckend seien auch die Ergebnisse an einem weiteren Versuchsstandort an der Pinka im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet gewesen: „Wir haben hier einen eco2-Fischpass hydraulisch und biotisch untersucht. Interessant waren dabei die protokollierten Fischgrößen. Rund 2/3 der Individuen waren kleiner als 15 cm und rund 1/3 wies eine Körperlänge von unter 10 cm auf. Bei einem Gesamtaufstieg von knapp 9.300 Fischen in 57 Beobachtungstagen belegt dieses Ergebnis eindeutig die hohe Funktionalität des eco2-Fischpasses für kleine und schwimmschwache Arten und Altersstadien.“
KONZENTRATION AUF GRÖSSERE GEWÄSSER
stellt sich das Spülen von konventionellen Fischpasstypen, wie Schlitzoder Beckenpass, zumeist als diffizil dar. Bedarf jedoch der eco2-Fischpass einer Spülung, können die Lamellen in kürzester Zeit herausgezogen werden. Danach wird die Dotationsblende entfernt und ein Spülstoß in Form einer kurzzeitig erhöhten Wassermenge durch das Gerinne geschickt, sodass nicht nur der Fischpass an sich, sondern auch etwaige Ruhebecken im System effektiv gespült werden. Generell ermöglichen die mitgelieferten Dotationsblenden eine rasche Drosselung des Durchflusses für Sichtungs- und Wartungszwecke. „Der einfach durchführbare Spülvorgang erleichtert dem Betreiber seine Wartungsaufgaben erheblich. Zudem bleibt der Fischpass so gut wie permanent in seiner Funktion stabil“, sagt Georg Seidl. Dass bei derartigen Spülvorgängen auch Sohlensubstrat mitgerissen wird, kann ausgeschlossen werden. Das Substrat sei sehr gut in den verwendeten Gabionen gefasst, so der Ingenieur.
Der eco2-Fischpass wird in Stahlbauweise, wahlweise in Edel- oder Schwarzstahl, hergestellt und mit Sohlsubstrat befüllt eingebaut. Dabei ist er sehr einfach auch in bestehende Querbauwerke integrierbar. Die konstruktionsbedingte Einfachheit und der damit verbundene geringe Betonverbrauch macht den eco2-Fischpass auch zu einer sehr kostengünstigen Lösung. Da keine komplizierte und schadensanfällige Steuerung wie bei automatisierten Bautypen benötigt wird, kann der Betreiber auf eine sehr betriebssichere und wartungsfreundliche Lösung vertrauen.
Dank der engen wissenschaftlichen Kooperation mit der TU Graz konnte die traditionelle Form des Denil-Fischpasses nun derart modifiziert werden, dass der neue eco2-Fischpass von flusslauf mittlerweile als technisch ausgereift gilt. „Tatsächlich gibt es aus technischer Hinsicht kaum mehr Stellschrauben, an denen sich drehen lässt. Abgesehen vielleicht von einem aktuellen Forschungsprojekt, bei dem wir uns mit der Geometrie und Anordnung von Ruhebecken befassen. Aber grundsätz-


Speziell im Hinblick auf die Forellenregion kann der biotische Nachweis als abgeschlossen betrachtet werden. Schließlich wurde dabei das gesamte Artenspektrum nachgewiesen. Was die Barbenregion anbelangt, die mit bis zu 56 unterschiedlichen Fischarten artenreicher als die Forellenregion ist, kann das Team von flusslauf auf mittlerweile drei positive Monitorings verweisen, zwei weitere sind aktuell in der Beprobung. „Erst unlängst haben wir das Monitoring an einem klei-
Die neuartige Lamellenstruktur bringt mehrere Vorteile mit sich: Zum einen bewirkt sie verbesserte hydraulische Bedingungen mit geringeren Turbulenzen. Zum anderen ermöglicht sie dem Betreiber eine sehr einfache Wartung.
neren Gewässer mit einer durchschnittlichen Wasserführung von 500 l/s abgeschlossen. Dabei konnten wir rund 2.000 Fische aus allen dort lebenden Arten abbilden, was uns natürlich sehr gefreut hat. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir an kleineren Gewässern und in der Forellenregion unsere Hausaufgaben gemacht haben. Unsere Aufgabe sehen wir nun eher darin, die Funktionsfähigkeit in den größeren Gewässern vollumfänglich nachzuweisen“, sagt Georg Seidl. Was sich im Zuge der umfangreichen Feldstudien ebenfalls bestätigen ließ: Der Umstand, dass der eco2-Fischpass nun auch von kleineren und schwimmschwächeren wie bodenorientierten Arten genutzt wird, bedeutet keineswegs, dass damit die großen Fische benachteiligt würden. Für sie bleibt die ursprünglich günstige Qualität des Systems vollumfänglich erhalten.
NEUESTES

Ähnlich positiv bewertet der Forscher die jüngsten Ergebnisse des Herbstmonitorings am Standort des neu gebauten Kraftwerks Gliederwehr in Gleisdorf. „Es ist sehr erfreulich, dass wir bereits im Herbstmonitoring das gesamte Größen- und Artenspektrum –Größen zwischen 4,5 cm und bis zu 48 cm Körperlänge – darstellen konnten. Wir blicken
daher auch dem Frühlingsmonitoring sehr zuversichtlich entgegen“, so der Geschäftsführer von flusslauf. Zu diesem Zeitpunkt erwartet er dann auch die ersten Untersuchungsergebnisse aus einem noch spektakuläreren Projekt in der Steiermark. Während beim Wehrbauwerk des KW Gleisdorf rund 5 m überwunden werden, wurde an diesem jüngsten Kraftwerksprojekt ein eco2-Fischpass über eine Höhe von 8 m errichtet. „Auf die Ergebnisse sind wir natürlich sehr gespannt.“
Dem jungen Ingenieurbüro flusslauf ist mit dem eco2-Fischpass eine technische Weiterentwicklung gelungen, die sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht eine richtungsweisende Lösung für die aktuellen Anforderungen in der Kontinuumsanierung von Gewässern darstellt. Alternativ bietet das Unternehmen auch Fischschleusen, FischliftSysteme oder den technischen Beckenpass an, wenn es der Standort erfordert oder der Kunde es wünscht.


Der neuartige FishProtector hilft, Fische vor einer Turbinenpassage zu schützen und die Tiere zu einem seitlichen Bypass zu leiten. Die Technologie des FishProtectors basiert auf der Kombination einer mechanischen Barriere (Rechen) mit einem elektrischen Feld als verhaltensbiologische Barriere für Fische. Unterschiedliche Bauformen sind je nach standortspezifischen Gegebenheiten möglich. Anhand erster Pilotanlagen konnten die her vorragende Funktionalität und Fischschutzwirkung gezeigt werden.

Um die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle ökologisch noch verträglicher zu gestalten, werden immer größere Anforderungen an die Fischdurchgängigkeit der Gewässer gestellt. Dabei gilt es nicht nur den Fischaufstieg an Querbauwerken zu ermöglichen, sondern auch flussabwärts schwimmende Fische vor einer möglicherweise schädlichen Turbinenpassage zu bewahren. Zu diesem Zwecke wurde an der Universität Innsbruck der FishProtector entwickelt und in umfangreichen Forschungsprojekten hinsichtlich seiner technischen Machbarkeit sowie der Fischschutz- und Fischleitwirkung untersucht und optimiert.
Der FishProtector besteht grundsätzlich aus einer mechanischen Barriere, welche mit einer Verhaltensbarriere kombiniert wird. Die mechanische Barriere des FishProtectors besteht je nach Ausführungsform aus einem klassischen vertikalen oder horizontalen Einlaufrechen, oder auch aus einem neuartigen Seilrechen (bestehend aus horizontal gespannten Seilen). Die Verhaltensbarriere wird durch ein elektrisches Feld im Wasser gebildet, das auf Niederspannungsimpulsen beruht, welche an elektrisch leitenden Bauteilen (Elektroden) in der Rechenebene angelegt werden. Die Fische werden effektiv davon abgehalten den FishProtector zu durchschwimmen und können gleichzeitig an der Barriere entlang geleitet werden, bis sie zu einer sicheren Abstiegsmöglichkeit (z.B. Bypass) oder zu einer alternativen Wanderroute (z.B. Hauptstrom eines Gewässers, Wehrüberfall) gelangen. Die sehr gute Fischschutz- und Fischleitwirkung konnte in einer Reihe von ethohydraulischen Untersuchungen (Fischversuchen) im Freilandlabor, in Großversuchen und an ersten Pilotanlagen in Bayern und Südtirol gezeigt werden.
Die Bauformen der FishProtector-Technologie sind vielseitig. Sie eint die Tatsache, dass jeweils eine mechanische Barriere mit einer Verhaltensbarriere kombiniert wird. Der FishProtector wird hinsichtlich der Bauformen unterteilt in:
• Flexible FishProtector: Bewegliche (d.h. zu Reinigungszwecken ablegbare) Seile
• Fixed FishProtector: Fixe Seile, in einem Rahmen gespannt
• Bar Screen FishProtector: Stabrechen, mit Elektroden ausgestattet Zur Erreichung einer hohen Fischschutzrate sind lichte Seilabstände von mehreren Zentimetern möglich, sodass die hydraulischen Verluste am Rechen gering gehalten werden. Die großen Abstände erweisen sich auch im Betrieb als günstig, da Verlegungen deutlich seltener auftreten als bei Feinrechenanlagen mit vergleichbarer Barrierewirkung.
Für Standorte mit normalem bis hohem Treibgutaufkommen, bei welchen die Fische über länger Strecke zu einem geeigneten Abstieg geleitet werden sollen, ist der Flexible FishProtector die richtige Wahl. Zu Reinigungszwecken und im Hochwasserfall können die Seile an die Sohle abgelegt werden.
Die Verwendung des Fixed FishProtectors empfiehlt sich bei Wasserentnahmen, wo wenig Treibgut auftritt (z.B. in einem Hochgebirgsstausee) und daher auf eine permanente Reinigungsvorrichtung verzichtet werden kann. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bietet sich im Unterwasserkanal von Wasserkraftanlagen, bei denen das Einschwimmen der Fische in eine Sackgasse verhindert werden soll. Der Bar Screen FishProtector basiert auf der nachträglichen Ausrüstung von bestehenden Einlaufrechen mit Elektroden, welche auf der Stabvorderseite (dem Oberwasser zugewandt) angebracht werden und so die Verhaltensbarriere erzeugen. Eine vorhandene Rechenreinigungsanlage kann möglicherweise durch Ausnehmungen an den entsprechenden Stellen angepasst werden.

ERSTE ERFAHRUNGEN AN PILOTANLAGEN
Die erste Pilotanlage eines flexiblen FishProtectors besteht seit Oktober 2020 an der Wasserkraftanlage Leinau an der Wertach in Kaufbeuren
(Bayern). Die ersten Erfahrungen aus dem Betrieb und der Reinigung der Anlage sind sehr positiv. Aus anfänglichen Schwierigkeiten, die vor allem die Steuerung der Reinigungszyklen (Ablegen der Seile auf die Gewässersohle) und die Korrosion der Seile im Wasser betrafen, konnten wertvolle Erkenntnisse für die weitere Entwicklung erlangt werden. Die biologische Erfolgskontrolle in Form von Fischuntersuchungen im Sommer 2021 zeigte die erwartete Reaktion der Fische an der Barriere und die gute Leitwirkung hin zum Fischabstieg. Aktuell wird noch ein weiteres Monitoring mittels Imaging Sonaren (Aris) betrieben, das die natürliche Fischfauna zu unterschiedlichen Zeitpunkten während des Jahres beobachtet. Die Anlage steht im Sinne einer Demonstrationsanlage dem interessierten Publikum zur Besichtigung zur Verfügung.
Die zweite Pilotanlage wurde in Form eines Fixed FishProtector – also eines mit Seilen bespannten Rahmens – im Südtiroler Ultental errichtet. Dort dient die Fischschutzeinrichtung dazu, die Fische in einem hochalpinen Speicher von dem Einschwimmen in die Wasserfassung abzuhalten. Standortspezifisch kommt es nur selten zu Verlegungen des Rechens, weswegen auch keine permanente Reinigungsmöglichkeit vorgesehen ist. Das Monitoring zur Dokumentation der Wirksamkeit wurde mittels Videokamera durchgeführt und zeigte wie erwartet die typische Fluchtre-

aktion der Fische, sobald sie ins elektrische Feld geraten.
WEITERE ANLAGEN
Die FishProtector-Technologie ist an vielen Standorten und Einsatzgebieten gefragt. Weitere Projekte an Laufwasserkraftwerken


und an Wasserentnahmen werden derzeit von der HyFish GmbH – dem mit diesem Thema betrauten Spin-off der Universität Innsbruck – ausgearbeitet, sodass die FishProtector Technologie in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Fischschutz in unseren Gewässern leisten wird.
Leinau / Wertach (Flexibel FishProtector)
• Höhe Seilrechen: 2,55 m
• Spannweite: 20 m
• Seildurchmesser: 8 mm
• Lichter Seilabstand: 60 mm
• Anzahl der Seile: 40 Stk.
Weissbrunnsee / Ultental (Fixed FishProtector)
• Höhe: ca. 6 m

• Breite: 3,1 m
• Seildurchmesser: 8 mm
• Lichter Seilabstand: 60 mm
• Anzahl der Seile: 88 Stk.
Ein innovatives Fischliftsystem ging an der Staustufe Baldeneysee im Süden der Stadt Essen im Sommer 2020 erstmals in Betrieb. Wegen des Höhenunterschieds von fast 9 m zwischen Oberund Unterwasser an der Wehranlage und den beengten Platzverhältnissen war die Errichtung einer herkömmlichen Fischaufstiegsanlage nicht möglich. Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit setzte der Betreiber Ruhrverband auf das Fischliftsystem der Entwickler Baumann Hydrotec GmbH & Co. KG und Hydro-Energie Roth GmbH. Konzipiert ist das System als eine Art Schleuse, mit der auch schwimmschwache Arten durch ein als Kolben ausgeführtes Fischpassbecken kräfteschonend zwischen Ober- und Unterwasser wechseln können. Neben den positiven Betriebserfahrungen stellte das System im Sommer 2021 auch seine Robustheit bei einem extremen Hochwasserereignis unter Beweis.

Mit einem Fassungsvermögen von ca. 8,3 Mio. m³ ist der Baldeneysee im Süden der Stadt Essen der größte der sechs Ruhrstauseen. Betrieben wird das zwischen 1931 und 1933 errichtete Reservoir vom Ruhrverband. Am rechten Ufer der mit drei Wehrwalzen ausgeführten Wehranlage befindet sich das im Besitz der RWE stehende Wasserkraftwerk Baldeney. Zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Stauwehr gemäß den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie berief der Ruhrverband vor gut zwölf Jahren eine Expertenkommission ein. Die Kommission sollte für den Standort eine Lösung entwickeln, um den Gewässerlebewesen am Standort eine barrierefreie Wanderung zu ermöglichen. Die Errichtung eines Beckenpasses wäre aufgrund der stark verbauten Grundstücke neben der Wehranlage mit erheblichem Aufwand und hohen Baukosten verbunden gewesen. Zudem hätte die Fischtreppe bei einem Höhenunterschied von 8,7 m aus rund 90 Becken bestanden, was vor allem für schwimmschwache Arten eine zu große Anstrengung bedeutet hätte. Nach umfangreichen technischen Voruntersuchungen fiel die Entscheidung schließlich zugunsten eines innovativen Fischliftsystems, das von der Baumann Hydrotec GmbH & Co. KG und der Hydro-Energie Roth GmbH entwickelt wurde.
KRÄFTESPARENDER AUFSTIEG GARANTIERT
Erstmals eingesetzt wurde der Hydro-Fischlift an der ca. 5 m hohen Wehranlage des Kraftwerks Neumühle im Allgäu. Das seit September 2014 im Dauerbetrieb stehende System basiert auf einem Schleusenkonzept, bei dem die Fische durch ein als Schwimmkolben ausgeführtes Fischpassbecken aufsteigen können. Das Transportbecken befindet sich innerhalb

eines vertikal platzierten GFK-Rohres und wird durch den Schleusenwasserstand ohne mechanisches Windwerk rein hydraulisch bewegt. Anders als bei einer herkömmlichen Schleuse verändert sich die Wassertiefe im aufschwimmenden Becken nur geringfügig, wodurch die Fische für sie unmerklich und kräfteschonend auf ein höheres Niveau gehoben werden. Für die Anpassung des HydroFischlifts an den Standort Baldeney wurden am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) detaillierte numerische Simulationsstudien, Modelluntersuchungen sowie ethohydraulische Versuche durchgeführt. „Bei diesen Versuchen wurden mehrere funktionsverbessernde Details ermittelt werden. So wirkte während der Laboruntersuchungen eine horizontale Durchströmung für die Fische noch attraktiver, und der Ausschwimmvorgang konnte deutlich verkürzt werden. Zudem wurde das Einschwimmen in den Fischlift in der unteren Position durch einen speziell gestalteten Einstiegsbereich beschleunigt“, so die Entwickler Andreas Roth und Georg Baumann, deren System mehrfach ausgezeichnet wurde.
WASSER- UND ZEITSPARENDER BETRIEB
Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit ging das für den Baldeneysee adaptierte Fischliftsystem im Sommer 2020 erstmals in Betrieb. Um den Gewässerbewohnern eine kontinuierliche Passage zwischen Ober- und Unterwasser zu ermöglichen, wurden zwei abwechselnd auf- und abfahrende Fischlifte parallel nebeneinander positioniert. Das Auf- bzw. Abstiegsintervall eines Transportbeckens dauert lediglich ca. 5 Minuten, wobei für den Betrieb eines Fischlifts nur 250 l/s Wasser benötigt werden. Andreas Roth weist darauf hin, dass dem Hydro-Fischlift variierende
Stauwasserständen keine Probleme bereiten: „Selbst wenn sich während der Ausschwimmphase der Wasserstand im Oberwasser verändert, funktioniert das Ein- und Ausschwimmen weiterhin bzw. durchgehend. Nach meinem Wissen ermöglicht nur unser System bei variablen Stauwasserständen einen permanent an den Stauwasserstand angepassten Ein- und Ausstieg, was ein besonderes Alleinstellungmerkmal darstellt. Darüber hinaus wird zum Hoch- und Runterfahren keine Fremdenergie benötigt. Die Fische im Lift befinden sich in einem quasi abgeschlossenen Behältnis und merken nichts von der Auf -und Abbewegung. Weiters entstehen keine signifikanten Druckänderungen oder Strömungen.“

Seit der Inbetriebnahme im August 2020 wurden durchwegs positive Erfahrungen mit
den beiden Fischliften gesammelt, so die Entwickler: „Ein für die Installation und Wartung der Messeinrichtungen beauftragtes Fachbüro für Umweltplanung konnte bislang keine Betriebsstörungen feststellen. Vielmehr wird von zahlreichen Fischsichtungen in der für das im April 2023 beginnende Monitoring bereits installierten Zähleinrichtung berichtet. Teilweise nutzen pro Transfer mehr als 1.000 Organismen den Fischlift.“ Mittlerweile konnte der Hydro-Fischlift seine Robustheit auch bei extremem Hochwasser unter Beweis stellen. Am 15. Juli 2021 wurde am einige Kilometer stromaufwärts gelegenen Pegel Hattingen ein Hochwasserabfluss von 1.230 m³/s gemessen. Damit wurde die bisherige Rekordmarke von 974 m³/s deutlich übertroffen. Im Zuge des Hochwassers wurden die beiden Fischlifte zu mindestens 68 Prozent eingestaut, was einen Anstieg des Wasserstands um 5,92 m bedeutete. Da kein
Ende des ansteigenden Wasserpegels absehbar war, wurden die Fischlifte aus Sicherheitsgründen stromlos geschaltet. „Das System wurde schon im Vorfeld für eine besondere Hochwassersicherheit ausgelegt. Alle Baugruppen und die Steuereinheiten für die Schieber fanden einen Platz über der bis dahin bekannten Rekordhochwassermarke. Zum Schutz für einige elektronische Bauteile kam zudem eine Art Tauchglocke zum Einsatz“, erklärt Andreas Roth. Eine Woche nach dem Hochwasserereignis, das große Mengen an Treibgut mit sich gebracht hatte, starteten die Reinigungsarbeiten. Da keinerlei Schäden an den Fischliften festgestellt wurden, konnte das System innerhalb weniger Stunden wieder in Betrieb genommen werden. Die Entwickler freuen sich über die bestandene Bewährungsprobe und sind guter Dinge, dass ihr innovatives System bald an weiteren Standorten zum Einsatz kommen wird.




Mit einem innovativen Schleusensystem hat die oberösterreichische Fishcon GmbH eine hochinteressante Alternative zu herkömmlichen Fischwanderhilfen entwickelt. Das als 2-KammernOrganismenwanderhilfe oder FishconSchleuse bekannte System basiert auf einer patentierten hydraulischen Verschaltung von zwei gegenläufig betriebenen Schleusenkammern und ermöglicht Fischen den schonenden Auf- und Abstieg zwischen Gewässerbarrieren. Durch den im Rahmen von Monitorings nachgewiesenen Aufstieg von mehr als 30 Fischarten an zwei Kraftwerksstandorten hat die kompakte und gleichzeitig kostengünstige FishconSchleuse ihre Funktionsfähigkeit bravourös unter Beweis gestellt.

Die Entwicklung der 2-Kammern-Organismenwanderhilfe entstand aus der grundsätzlichen Problematik von gängigen Schlitz- oder Beckenpässen. Diese benötigen viel Platz und große Leitwassermengen, sind oftmals anfällig gegen Verklausungen und Wasserspiegelschwankungen und mit hohen Errichtungskosten verbunden“, erklärt Fishcon-Geschäftsführer Bernhard Mayrhofer. Bei der Fishcon-Schleuse wird durch die bewusst kompakte Bauweise nur wenig Platz benötigt. Das als vormontierte Einheit ausgelieferte System gewährleistet eine schnelle und unkomplizierte Installation. Der standardmäßige Einsatzbereich der für Gewässer aller Größen geeigneten Schleuse liegt zwischen 1,5 und 6 m Höhendifferenz und ermöglicht einen Betrieb mit sehr geringen Leitwassermengen. Aufgebaut ist die innovative Fischwanderhilfe im Wesentlichen aus zwei Kammern mit Verschlussorganen zum Ober- und Unterwasser und einem Rohr, das die beiden Kammern miteinander verbindet. Das Verbindungsrohr, das optional auch mit einer stromerzeugenden Turbine ausgestattet werden kann, enthält eine Drosselvorrichtung zur Begrenzung der Durchflussmenge. Die unter den Wasserspiegeln angeordneten Verschlussorgane der Schleuse werden so angesteuert, dass stets eine Kammer zum Unter- bzw. Oberwasser geöffnet ist. Nach Ablauf eines Zeitintervalls ändern die Verschlussorgane ihre Position und die in die Kammern eingetretenen Organismen können flussauf- bzw. flussabwärts wandern.
ERFOLGREICHE MONITORINGS
Angeboten wird die patentierte Fischwanderhilfe in vier standardisierten Größen. Bei sehr großen Gewässern oder Höhendifferenzen kann das System auch individuell an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Darüber hinaus sind auch Kombinationen mit herkömmlichen Fischwanderhilfen bzw. mehrerer Fishcon-Schleusen möglich. Bernhard Mayrhofer zeigt sich sehr erfreut über die positiven Erfahrungen, die bei den beiden Pilotanlagen in Oberösterreich gesammelt wurden: „2019 ging beim Lippenannerlwehr im Almtal die erste Fishcon-Schleuse in Betrieb, 2020 folgte der Einbau der nächsten Anlage bei einer Wehranlage an einem Aschacharm. Im Rahmen von Frühjahrs- und Herbstmonitorings wurden an beiden Standorten ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Während der Untersuchungszeiträume konnte der Aufstieg von insgesamt mehr als 30 heimischen Fischarten nachgewiesen werden, darunter auch eine Vielzahl von schwimmschwachen und sohlenbewohnenden Arten sowie Schwarmfische. Es hat sich auch gezeigt, dass keine Größen- oder Altersselektivität vorliegt. Dank dieser hervorragenden Resultate wurde dem System die Funktionsfähigkeit nach österreichischen und deutschen Standards bescheinigt.“
Im Herbst des Vorjahres wurde beim Kraftwerk Cortebert am Gewässer Schüss die erste Fishcon-Schleuse in der Schweiz installiert. Anfang 2023 gehen drei weitere Fishcon-Schleusen in Österreich und Deutschland in Betrieb. Zwei Fischwanderhilfen kommen in Oberösterreich bei einem weiteren Kraftwerk an der Alm sowie einer Anlage an der Mattig im Innviertel zum Einsatz.
Beim dritten Projekt wird eine Wehranlage in Bayern mit der neuen IPE-Ausführung der Fishcon-Schleuse ausgestattet. Bei dieser Variante handelt es sich um eine noch kompaktere und kostensparendere Konstruktion, die zukünftig ebenfalls in vier Baugrößen angeboten wird. Der Geschäftsführer lässt nicht unerwähnt, dass europaweit Interesse an der Fishcon-Schleuse besteht und in naher Zukunft die Umsetzung einer ganzen Reihe von Projekten im In- und Ausland geplant ist. International kooperiert Fishcon mit den Unternehmen WWS Wasserkraft für den amerikanischen Markt und Fishheart für Finnland. Darüber hinaus beschäftigt sich Fishcon mit neuen Entwicklungen im Bereich des Fischschutzes und der Wasserkraft. „Wir wollen beweisen, dass sich der ökologische Gewässerschutz und die Wasserkraftnutzung auf nachhaltige Weise vereinen lassen“, bekräftigt Bernhard Mayrhofer.

Troyer steht für Spitzenqualität in der Herstellung von Wasserturbinen und Kraftwerksanlagen. Seit Generationen garantieren wir dank maßgeschneiderter Lösungen die optimale Nutzung der Wasserkraft für eine sichere, wirtschaftliche und ressourcenschonende Energiegewinnung. Tel. +39 0472 765 195 troyer.it

Reliability beyond tomorrow.



























