WLADIMIR KLITSCHKO
Der frühere Boxweltmeister über das Durchhalten in gefährlichen Zeiten


WLADIMIR KLITSCHKO
Der frühere Boxweltmeister über das Durchhalten in gefährlichen Zeiten

In der Krise gründen mehr Menschen eine Firma. Afshin Doostdar, David Oudsandji und Roman Alberti beweisen mit ihrem Start-up, dass sich dieser Mut auszahlen kann
Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie |Energieverbrauch kombiniert(WLTP): 14,1–12,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionenkombiniert: 0g/km; CO₂-Emissionsklasse: A1
1Dietatsächliche Reichweite hängt vonzahlreichenFaktorenwie insbesondereder individuellen Fahrweise, Umgebungsbedingungen,dem Alterungsprozessder Batterie, Nebenverbrauchern, wie beispielsweise der Klimatisierung, Sonderausstattungen,Bereifung, Zuladung, dem Streckenprofil ab und kann dahervom angegebenen WLTP Wert abweichen.
2An DC-Schnellladesäulen mit 500 Ampere auf Basis der WLTP-Reichweite





Derneue vollelektrische CLA mit einer Reichweitevon bis zu 792 km (WLTP)1 istder richtige Partner für längereDienstreisen.Und auch seine Arbeitspausen fallen kurz aus.Der CLA lädt für bis zu 325 km in nur 10 Minuten.2 Eine Klasse für sich.





Kennen Sie schon unseren Newsletter? Abonnieren Sie ihn hier:
In Deutschland ist Wirtschaftsflaute. Das heißt: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kämpfen gegen das Ende durch Insolvenz, andere setzen auf einen Anfang mit Start-ups. Dieses Heft erzählt, wie die Skateboard-Marke Titus die Pleite gerade noch abwehrte und wie die Jungfirma Voltfang mit recycelten Batterien ihren Weg geht.
Außerdem verrät der Ex-Boxweltmeister und Ukraine-Aktivist Wladimir Klitschko, wie man in der Krise resilient bleibt. Oder es erst wird.
Viel Einsicht und Freude beim Lesen wünscht
Ihr Team von ZEIT für Unternehmer
www.zeitfuerunternehmer.de
TITELTHEMA
Warum es sich gerade in Krisenzeiten lohnt, Unternehmen zu gründen, und was es braucht, um dabei erfolgreich zu sein 6
MENTALE GESUNDHEIT
Moritz Keller über den Stress als Unternehmer und einen KI-Coach, der ihm neuerdings Rat gibt 12
Unsere Mittelstandsstudie zeigt, was Sie besonders belastet und wo Sie Hilfe suchen und finden 18
DIE ERFINDUNG MEINES LEBENS
Algen, die wie Lachs und Thunfisch schmecken 20
VERTEIDIGUNG
Früher wollten viele Mittelständler nicht für die Rüstungsindustrie produzieren. Das ändert sich 22
ARBEITSWELT
Die Wechseljahre sind in vielen Firmen ein Tabu. Dabei würden Arbeitgeber profitieren, wenn sie betroffene Frauen besser unterstützten 26
INSOLVENZEN
Ein Unternehmer wird für seine Technologie prämiert. Nun muss er um seine Firma kämpfen 30
Titus Dittmann hat mit seinem Unternehmen das Skateboarden in Deutschland groß gemacht. Sein Sohn Julius hat die Firma gerade noch vor der Pleite bewahrt und saniert. Wie passen Fame und Fail zusammen? Ein Doppel-Interview 34
FOTOSTORY
Zu Besuch in einer Fabrik am Tegernsee, die mit einer 150 Jahre alten Maschine Papier produziert 40 Der Inhaber Florian Kohler im Interview 44
SCHWERPUNKT INDUSTRIE 4.0
Was selbstlernende Maschinen heute schon können und welches Potenzial in ihnen steckt 46
Kleine Fehler können große Firmen teuer zu stehen kommen. Jetzt hilft KI beim Papierkram 50
KLIMA-CHECK
Wo man bei der Produktion von Marmelade und Schokoriegeln am meisten CO₂ sparen kann 54
EIN TAG MIT ...
... einem Unternehmer aus Delmenhorst, der seinen Ausbildungsbetrieb übernahm und damit heute Transporte in Krisenregionen organisiert 56
KI-KOLUMNE
Avatare in Menschengestalt übernehmen den Kundendienst – ohne sich zu verplappern 60
RESILIENZ
Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko über seinen Einsatz an der Front, Angst im Ring und Widerstandskraft im Geschäft 62
TO-DO-LISTE UND IMPRESSUM 66
»Mit jedem Schlag, den ich abbekommen habe, bin ich schlauer und stärker geworden« WLADIMIR KLITSCHKO, S. 62

Am Eurofighter arbeiten 400 Firmen mit. Ein lohnendes, aber umstrittenes Geschäft S. 22

Wladimir Klitschko rät, sich in guten Zeiten zu fordern, um schlechte zu überstehen S. 62
Wo die Firmen ihren Sitz haben, die in dieser Ausgabe vorkommen

Soziale Verantwortung übernehmen und Kinder stärken Gemeinsam stark
MehrInformationen findenSiehier: www.plan.de/unternehmen
Diese Ausgabe enthält eine Publikation von folgendem Unternehmen: The Generation Forest eG, 22769 Hamburg
PlanInternationalzähltzudengrößten KinderrechtsorganisationenderWelt. GemeinsamschaffenwirPerspektiven underöffnenMädchenundJungendie ChanceaufeineselbstbestimmteZukunft.

Nach jahrelangem Abwärtstrend gründen wieder mehr Menschen, auch größere Firmen.
Für viele von ihnen sind Krisen genau der richtige Zeitpunkt, um mutig zu sein
VON CAROLIN JACKERMEIER

Roman Alberti (links), David Oudsandji (mitte) und Afshin Doostdar (rechts) hatten die zündende Idee, als sie mit ihrem Camper zum Festival wollten
Mittlerweile kommt Afshin Doostdar wieder pünktlich zu seinen Meetings. »Aber anfangs habe ich die Wege hier unterschätzt«, erzählt der 31-Jährige. Über 6.000 Quadratmeter erstreckt sich das Gelände, das seine Firma Voltfang Anfang des Jahres im Aachener Industriepark Rothe Erde bezogen hat. Ausgeblichene Wegweiser, leer stehende Parkwärterhäuschen und eine stehen gebliebene analoge Uhr am Backsteingebäude versprühen eher alten Industrieduft als Startup-Flair. Hier hat Philips einst Millionen von Fernsehern produziert, zuletzt gehörten die Hallen dem insolventen Elektroautobauer e.Go. Jetzt bauen Doostdar und seine beiden Mitgründer David Oudsandji und Roman Alberti hier an der Zukunft.
Doostdar öffnet die Tür zur Produktionshalle. Die Kulisse erinnert an eine überdimensionierte Heimwerkergarage: Werkbänke mit Pressspanplatten, daran hängen Zangen und Schraubenzieher. An langen Metalltischen bestücken Mitarbeiter Batteriemodule mit elektronischen Kontakten und montieren sie in ein Metallgestell. Doostdar zeigt auf einen Stapel schuhkartongroßer Module: »Damit hat alles angefangen.«
Voltfang macht ausrangierte E-AutoBatterien zu Stromspeichern. Sie sollen dabei helfen, Schwankungen am Strommarkt auszugleichen, und erneuerbare Energien rund um die Uhr verfügbar machen. Die Idee dazu hatten die Gründer in ihrem Festival-Camper. Auf dem hatten die drei Maschinenbauingenieure ein Solarmodul installiert, konnten den produzierten Strom aber nirgendwo speichern. Auf eBay kauften sie eine gebrauchte E-Auto-Batterie und bauten sie zum Speicher um. »Wir haben gespürt, dass das etwas Großes werden könnte«, sagt Doostdar. Es folgte eine Bilderbuch-Gründerstory: Die drei schraubten in einer Garage an Prototypen, überzeugten Automobilhersteller, ausrangierte oder überschüssige Elektrobatterien zu guten Konditionen abzugeben, und fanden erste Kunden. Heute, nur fünf Jahre später, besitzt Voltfang nach eigenen Angaben die größte »Second-Life-Batteriespeicherfabrik« Europas. In der baut es aus den Batterien schrankgroße Speichereinheiten mit einer Kapazität von 45 Kilowattstunden und containergroße Großspeicher
mit fünf Megawattstunden Kapazität – zum Vergleich: Speicher heimischer Solaranlagen haben eine Kapazität von fünf bis zehn Kilowattstunden.
Die Fabrik sei damit ein »Meilenstein für zukunftsfähige Energiesysteme«, befand NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Einweihung der Fabrik. Zu den Kunden gehören die Fast-Food-Kette McDonald’s, der Tankstellenbetreiber Jet, der Stuttgarter Flughafen und mittelständische Unternehmen. »Wir haben schnell bewiesen, dass wir nicht nur eine Idee auf einer PowerPoint-
56 % der Start-ups arbeiten heute mit Konzernen zusammen. 2020 waren es laut »Startup-Monitor« noch
72 %
Folie sind, sondern das Ganze auch umsetzen können«, sagt Doostdar. Mittlerweile arbeiten rund 120 Mitarbeitende für Voltfang. Der Umsatz soll sich 2025 im unteren zweistelligen Millionenbereich verdreifachen, in ein bis zwei Jahren will Voltfang profitabel sein. Doostdar sagt: »Wir sehen uns mittlerweile mehr als junges Unternehmen denn als Start-up.«
Die drei haben das geschafft, worauf gerade wieder mehr Menschen hoffen.
Im ersten Halbjahr 2025 wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge knapp zehn Prozent mehr wirtschaftlich bedeutsame Betriebe gegründet als im Vorjahreszeitraum – also Firmen, die zum Beispiel als GmbH im Handelsregister eingetragen sind oder bereits Personal beschäftigen. Das deckt sich mit den Zahlen des Startupverbands: Die Gründungsaktivität in jedem einzelnen der
ersten sechs Monate des Jahres lag über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Wenn es so weitergeht, könnten die Zahlen bald wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen.
Die Stimmung in der Start-up-Szene ist zwar angespannt, aber deutlich optimistischer als im Rest des Landes: Mehr als 70 Prozent der Gründerinnen und Gründer rechnen laut Startup-Monitor bis Ende 2026 mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Verena Pausder, die Vorsitzende des Startupverbands, zeigt sich auf Anfrage von ZEIT für Unternehmer beeindruckt von der »positiven Energie und dem AnpackerSpirit« der Gründerinnen und Gründer.
Und das, obwohl eine schlechte Nachricht zur Wirtschaftslage die nächste jagt: massiver Stellenabbau in der Automobilbranche, willkürliche Zollpolitik aus Übersee, sich stetig unterbietende Stimmungsbarometer quer durch sämtliche Branchen. Und dann sind da noch die Dauerbrenner Fachkräftemangel, Bürokratie und stockende Digitalisierung.
Wie passt das zusammen?
Auch Voltfang hätte auf den ersten Blick einen besseren Zeitpunkt wählen können, um zu gründen: 2021, mitten in der Coronapandemie, melden die drei ihre Firma an. »Es wäre schon hilfreich gewesen, persönlich Hände zu schütteln, bevor man potenziellen Kunden einen Speicher für 100.000 Euro verkaufen möchte«, erinnert sich Doostdar.
Die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine spielt den Unternehmern hingegen in die Karten. »Viele Unternehmen wollten unabhängig sein und ihre Energie selbst speichern können«, sagt der Gründer und Chief Technology Officer. Trotz oder gerade wegen der Krise erhält Voltfang erste große Aufträge, startet die Produktion und etabliert sich als ernst zu nehmender Partner für die Industrie. Ein Einzelfall? Oder steckt vielleicht gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Chance für Gründerinnen und Gründer?
Anruf bei einem, der es wissen muss: Jannis Gilde ist Projektleiter für Forschung beim Startupverband und hat in der im Juli erschienenen Next Generation-Studie analysiert, wer eigentlich was, wo und warum gründet. »Gerade in Wirtschaftskrisen sehen
viele eine Chance, selbst Lösungen zu entwickeln«, sagt Gilde. Aktuell entstehen vor allem junge Softwarefirmen – fast jedes zweite Start-up wirbt mit KI als Kern ihres Produkts. Aber es gebe auch wieder mehr Firmen, die industrielle Lösungen entwickeln, wie zum Beispiel Voltfang. »Gerade in der klassischen Industrie brauchen wir diese neuen Ideen«, sagt Gilde.
Auch wenn die Gründungsaktivität pro Kopf in Berlin und München noch immer am höchsten ist, kommt die Innovation immer mehr aus der Fläche, vor allem forschungsnahe Standorte wie Dresden, Darmstadt oder Aachen holen auf. Die Gründungsszene rückt nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich näher an den Mittelstand. »Dort, wo geforscht wird, gibt es Ideen und Talente. Wichtig ist, dass hier noch Kapital dazukommt«, sagt Gilde. Mehr als 80 Prozent der Start-ups empfinden die Nähe zu einer Hochschule dem Startup-
ANZEIGE
Monitor des Verbands zufolge als entscheidenden Standortvorteil. Die RWTH Aachen belegt dabei den dritten Platz hinter den Universitäten München und Köln.
Es ist also kein Zufall, dass sich genau hier, im Aachener Stadtzentrum, an einem Abend im Herbst junge Menschen versammeln, die das erreichen wollen, was die Voltfang-Gründer geschafft haben: die eigene Idee groß machen. Ihr Wunsch soll in der ehemaligen Kirche St. Elisabeth erhört werden. Der Altar besteht aus einem Bartresen, eine Discokugel baumelt von der Decke, statt Kirchenbänken reihen sich nun Arbeitsnischen. Betrieben wird der bundesweit erste Co-Working-Space in einem Kirchenschiff vom Digitalhub Aachen, einem gemeinnützigen Verein, der Start-ups und mittelständische Unternehmen vernetzen will und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.
Die Betreiber haben den Ort zum Hotspot der Aachener Start-up-Szene erklärt.
Wiekannman HR im eigenenUnternehmen positionieren,umzukunftsfähig zu werden?
ExpertinnenLaura Bornmann undAnahita Thoms erklären im neuenLeitfaden vonPersonio, wie Entscheider:innen in Vorstand undAufsichtsrat strategische HR-KompetenzinFührungsgremien verankern–und warumdas jetztsoentscheidendist.
Jetztkostenlos herunterladen
personio.de
Beim »Founders Roundtable« treffen sich einmal im Monat Gründerinnen und Gründer und solche, die es werden wollen. Heute sind rund zwei Dutzend Interessierte da, fünf davon sind Frauen – das passt zur Gründerinnenquote in Deutschland, die seit Jahren bei rund 20 Prozent dümpelt. Mutige können spontan ihre Ideen pitchen, Feedback sammeln und sich kritischen Fragen stellen. Während sich einige erst mal mit einer Limo in die Ecke stellen, tauchen andere gleich ins Gespräch ein: »Habt ihr das Stipendium bekommen?«, »Wie lief dein Pitch?«, »Habt ihr inzwischen erste Kunden?«
Ruslan Goryanyy, Gastgeber und Startup-Coach beim Digitalhub, eröffnet den offiziellen Teil des Abends: »Jetzt ist die beste Zeit, um zu starten, die Wirtschaft braucht so viel Unterstützung wie nie!« So kann man Herausforderungen auch interpretieren.
Mit dabei ist Lara Nawrath, die mit zwei Freunden das Start-up Bluvero gegründet




hat. Sie wollen Mitarbeitenden von mittelständischen Betrieben mit Bodycams ermöglichen, Wissen für die nächste Generation zu sichern. Für die Idee ihres Mitgründers hat sich die 27jährige Marketingverantwortliche wegen der Schreinerei ihrer Eltern interessiert. Dort sind die Arbeitsschritte des zehnköpfigen Teams seit Jahren eingespielt und werden nicht dokumentiert. »In mittelständischen Unternehmen geht Wissen schnell verloren, wenn langjährige Mitarbeiter die Firma verlassen«, sagt Nawrath. Beim Stammtisch in Aachen tauscht sie sich regelmäßig mit anderen Gründerinnen und Gründern aus. »Die Perspektive zu wechseln, ist total wertvoll, wenn man selbst mal nicht weiterweiß«, sagt sie.
Zum Beispiel mit Nico Reguera, der nach vielen verworfenen Ideen Accesify gegründet hat: ein Startup, das den Zugriff auf Daten innerhalb von Unternehmen erleichtern will. Vor Ort sind aber auch Teilnehmende, die erst lose Ideen haben: ein Student, der eine KILernplattform für Studierende entwickelt, ein Sicherheitsingenieur, der Startups betreuen will, ein Energieberater, der an Sensoren für Heizkörper tüftelt. »Die meisten werden scheitern«, sagt Goryanyy. »Aber wenn es in der aktuellen wirtschaftlichen Lage eh keine absolute Sicherheit gibt, warum es nicht versuchen?«
Diese Einstellung lässt sich mit Zahlen untermauern. Stagniert die Wirtschaft, werden weniger Stellen ausgeschrieben, die Arbeitslosigkeit steigt – und die Opportunitätskosten fürs Gründen sinken. Anders ausgedrückt: Wird der Firmenwagen gestrichen, die Gehaltsverhandlung vertagt und der Vertrag befristet, erscheint die unternehmerische Freiheit verlockender. Wie bei einem Medikament mit starken Nebenwirkungen, das nur einnimmt, wer wirklich krank ist. »Eine angespannte Arbeitsmarktlage kann auch ein Sprungbrett für Gründungen sein«, sagt Dirk Schumacher, Chefökonom der Förderbank KfW. »Je schlechter die Lage, desto eher sind Leute bereit, ein Risiko einzugehen.« Gleichzeitig haben sich die Motive der Gründerinnen und Gründer nicht verändert: Sie wollen sich selbst verwirklichen und sehen ihre Geschäftsidee als eine Chance, nicht als Notlösung oder letzten Ausweg.
Die KfW befragt im Gründungsmonitor jährlich rund 60.000 Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Anders als beim Startupverband zählen dazu nicht nur größere Firmen mit Wachstumsambitionen, sondern auch SoloSelbstständige, typischerweise Freiberufler oder Handwerker, oft im Nebenerwerb. Auch dort zeichnete sich bereits 2024 ein positiver Trend ab, es gab drei Prozent mehr Gründungen als im Vorjahr. Doch auch wenn die Zahlen zuletzt gestiegen sind, geht der langfristige Trend seit 20 Jahren bergab und verharrt seit 2018

auf recht ähnlichem Niveau. Wurden zu Beginn des Jahrtausends noch knapp 1,5 Millionen neue Gewerbe angemeldet, war es 2024 nur noch gut ein Drittel. Wie stark die sanfte Trendwende ist, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. In den ersten drei Geschäftsjahren steigt etwa ein Drittel der Gründer wieder aus.
Dabei könnte auch viel davon abhängen, wie gut Jungunternehmer und Mittelständler miteinander ins Geschäft kommen. Und ausgerechnet in diesem Punkt hat sich die Lage eher verschlechtert, wie der StartupMonitor zeigt: Vor fünf Jahren gaben noch 72 Prozent der befragten Gründer an, mit etablierten Firmen zusammenzuarbeiten –aktuell sagen das nur noch 56 Prozent. Das könnte sich rächen: Wenn die alten Firmen nicht kooperieren, haben die jungen weniger
Zugang zu Pilotprojekten, Kunden und Partnern, warnt der Monitor. Denn das seien jene Hebel, »die sie für ihr Wachstum dringend brauchen«, heißt es in der Analyse.
Daraus lässt sich ein Appell an den Mittelstand ableiten: Gerade in schwierigen Zeiten kann es helfen, sich Partner mit neuen Ideen zu suchen, auch wenn die sich noch bewähren müssen. So wie es Voltfang gelungen ist. Dessen Gründer mussten anfangs eine Vielzahl von AldiNordFilialen abtelefonieren, bis sie den Energiemanager des Discounters von einem Pilotprojekt überzeugen konnten. Andere hätten da womöglich schon aufgegeben.
Die VoltfangGründer konnten auch Geldgeber wie die Commerzbank, den Logistiker Fiege und den Heizungsbauer Viessmann für ihre Unternehmen gewinnen, die Mehrheit der Anteile hält der niederländische DeeptechInvestor Forward One. Das ist bemerkenswert, denn hierzulande mangelt es noch immer an Wagniskapital, gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt Deutschland nur auf Platz 18 unter den 40 größten Volkswirtschaften. »Dabei gibt es genug Kapital in diesem Land – es fließt nur zu oft in Beton statt in die Zukunft«, sagt Verena Pausder.
Die StartupLobbyistin befürworte die Agenda von Digitalminister Karsten Wildberger, der sich für digitale Gründungen und die schnellere Anerkennung internationaler Abschlüsse einsetzt. Insgesamt wünsche sie sich aber mehr Priorität für Innovation in der gesamten Bundesregierung. »Wir erleben eine wackelnde Weltordnung und gleichzeitig ein Momentum, Europa unabhängiger, souveräner und technologisch führend zu machen«, meint Pausder, »wir wären doch bescheuert, dieses nicht zu nutzen.«
In Aachen denkt man schon heute in diesen Dimensionen: Voltfang will bis 2029 gemeinsam mit dem Investor Palladio Partners rund 250 Millionen Euro in den Aufbau von Großbatteriespeichern investieren. Afshin Doostdar öffnet das Tor hinter den beiden Produktionshallen und zeigt in den leeren Raum, der genauso groß ist wie die bisher genutzte Fläche. Voltfang hat das Vormietrecht. Wenn alles nach Plan läuft, wollen die Gründer die Hallen spätestens 2027 beziehen.




Erhalten sie hier Einblicke vonder diesjährigen Konferenz
Am 21. Oktober 2025wurde Heilbronn zur Bühne für Digitalisierung und KI im Mittelstand.
Aufder Konferenz RETHINK.MITTELSTAND –Erfolgreichdurch Machen trafen sichdie klügstenKöpfe aus Wir tschaft, Politikund Wissenschaft auf Einladung der ZEITVerlagsgruppe undder TechnischenUniversität München.Gemeinsam diskutier tensie die entscheidenden Fragenunserer Zeit: Wie können digitale Technologien undKünstliche Intelligenz denMittelstand stärken?Wie gelingt es,Exzellenzforschungund Wir tschaft nochenger zu verzahnen? Undwie behauptetsich Deutschland im internationalen Wettbewerb um Innovation undFor tschritt?
Werjetzt neugierig geworden ist: AlleVor träge, Fotosund Berichte desEventssindonline verfügbar– ein Blicklohntsich!






Alle Sessions als Video ansehen!



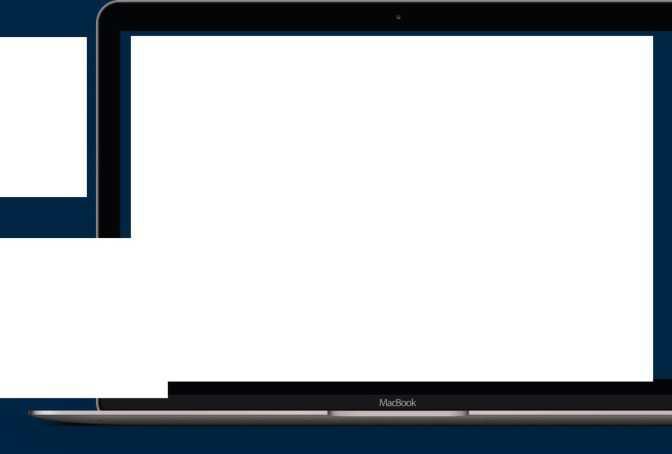



Moritz Keller hat erlebt, wie anstrengend der Alltag als Unternehmer sein kann. Also entwickelte er Routinen, macht bei seiner zweiten Gründung alles anders und lässt sich sogar von einem selbst gebauten KI-Chatbot coachen
Wenn man den Kommentaren auf Social Media glaubt, dann kommt Moritz Keller, 42, in die Hölle. Er hat ein alkoholfreies Bier mit pinkem Etikett auf den Markt gebracht, das reicht heute schon, um Hass auf sich zu ziehen. Ob ihn das stört? Nein, sagt er, als wir ihn in einem Co-Working-Space in München treffen, überrascht habe ihn der Hass trotzdem. Aber so ist das wohl als Unternehmer: Das Unvorhergesehene gehört zum Job dazu. Und Keller weiß mittlerweile, wie man damit umgeht.
ZEIT für Unternehmer: Herr Keller, Ihre erste Firma haben Sie als Schüler gegründet, mit Ihrem Bruder Jakob. Glauben Sie, es gibt ein Unternehmer-Gen?
Keller: Gen, ich weiß nicht, das klingt so, als wenn man etwas Besseres wäre. Ich glaube eher, es ist eine Haltungsfrage: Überdenkt man alles, oder legt man einfach los?
Wir haben ein Problem gesehen, das wir lösen wollten. Also haben wir angefangen. Welches Problem war das?
Wir haben damals Tennis gespielt. Aber die Schläger konnte man nur im Laden kaufen oder per Katalog bestellen. Wir wollten Sportprodukte online inszenieren und sie erlebbar machen. Also haben wir einen Onlineshop gestartet. Wir waren damals der
einzige rein digitale Händler in Deutschland, der von den großen Marken beliefert wurde, obwohl wir kein Ladengeschäft hatten. Ihr Unternehmen haben Sie Keller Sports genannt. Und der E-Commerce nahm damals richtig Fahrt auf. Hatten Sie das große Geld vor Augen?
Nein. Die Aussicht, reich zu werden, motiviert vielleicht manche Gründer, aber die wenigsten schaffen das. Wir wollten eher unser Taschengeld aufbessern und hatten Spaß an der Aufgabe. Die ersten Jahre haben wir uns 500 Euro Gehalt im Monat ausgezahlt. Damit war die Miete für unsere Wohnung bezahlt, in der wir auch das Büro hatten. Der Rest blieb in der Firma. Dann ist das Ganze etwas größer geworden. Damit hat sich auch das Gehalt gebessert. Aus einem Zweimannbetrieb haben Sie ein Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz und über 100 Mitarbeitern gemacht. Wann hatten Sie das Gefühl: Wir haben es geschafft?
Es gab immer wieder diese Momente: die erste Million Umsatz oder als wir die 30 Millionen geknackt haben. Irgendwann erreichst du die 100 Millionen. Von außen wirst du dafür gefeiert. Ich habe damit vor allem mehr Verantwortung und Komplexi-
tät verbunden. Für mich hat es sich immer schwerer angefühlt, je größer wir wurden. Was war das Anstrengendste?
Ab einer gewissen Größe brennt es ja immer irgendwo. Ständig bist du dabei, Feuer zu löschen. Wichtige Mitarbeiter kündigen ungeplant, der Umsatz bricht auf einmal ohne Grund ein, einer der wichtigsten Hersteller ändert seine globale Strategie mit direkten Auswirkungen auf die eigene Firma. Manche Leute, wie mein Bruder, können damit richtig gut umgehen. Meine Stärke ist, Branding-Strategien zu erarbeiten und sie umzusetzen. Oder neue Produkte zu erschaffen und zu designen. Aber dafür braucht es Ruhe. Da haben die Störfeuer mich gefühlt immer rausgerissen. 2021 sind Sie aus dem operativen Geschäft ausgestiegen. Gab es einen konkreten Auslöser?
Es war ein unterbewusster Prozess über Jahre. Meine Frau hat dann irgendwann gesagt: »Du hast abends kaum noch die Energie, mit mir mal länger zu sprechen. Das kann doch nicht der Preis sein, den man als Unternehmer zahlen muss!« Und sie hatte recht: Zum Ende meiner Zeit bei Keller Sports war ich abends meistens einfach durch. Ich wollte nur noch entspannen.

Wer innerlich in Schieflage gerät, kann wie Moritz Keller mit Routinen dagegenhalten
So habe ich immer häufiger auf DopaminKicks gesetzt, um mich kurzfristig besser zu fühlen: ungesundes Essen, eine Serie schauen, auf Social Media scrollen. War auch die wirtschaftliche Lage ein Grund dafür? Wenn man in die Geschäftsberichte schaut, hat Keller Sports immer mehr Verluste angehäuft. Nein, das Geschäft lief gut. Wir sind stark gewachsen. Gerade in der Zeit der Pandemie. Kurzfristig Verluste in Kauf zu nehmen, um mehr Kunden zu gewinnen und als Unternehmen größer zu werden, war damals eine bewusste Entscheidung. Danach wurden Unternehmen wie unseres bewertet. Deswegen haben auch wir damals bewusst in Wachstum investiert. Erst mit Beginn des Krieges in der Ukraine und dem Konsumeinbruch kam von heute auf morgen eine Zeitenwende, sodass von außen vor allem auf den Profit geschaut wurde.
Viele Unternehmer fallen in eine Depression, haben einen Burn-out, werden alkoholabhängig (siehe auch Mittelstandsstudie Seite 18). Wie war das bei Ihnen?
So weit ging es zum Glück nicht. Aber wenn ich mir Fotos aus dieser Zeit anschaue – mit 15 Kilo mehr –, frage ich mich: Wie konnte ich das so schleifen lassen? Ich hatte eine Firma, die sich nur um Sport drehte, steckte seit 15 Jahren viel Zeit in Persönlichkeitsentwicklung, war mit einem hinduistischen Mönch zum Meditieren in Nepal. Ich kannte alle Tools – und trotzdem habe ich meine Routinen so sehr vernachlässigt, obwohl ich wusste, wie gut sie mir tun. Ich habe mir dann eine zweiwöchige Auszeit genommen, um alles zu sortieren. Was war das Ergebnis?
Ich habe gemerkt: In dieser Form will ich nicht mehr arbeiten. Und ich habe mich gefragt: Wo bin ich eigentlich die Bestbesetzung? Als Unternehmer und Gründer hinterfragt man das viel zu selten. Man macht einfach immer weiter. Ich weiß jetzt: Ich bin gut darin, Firmen und Marken aufzubauen und Produkte zu designen und zu entwickeln, welche die Leute bewegen. Aber wenn die Firmen groß und komplex sind, können andere Menschen ihre Stärken besser ausspielen. Mein Bruder ist so einer.
»Alles im Leben ist Arbeit. Auch die innere Ruhe. Aber sie ist die Grundlage für richtige Entscheidungen«
Moritz Keller
Hat der Abschied Ihnen wehgetan?
Klar! Und natürlich habe ich mich gefragt: Lasse ich jetzt meinen Bruder, unseren dritten Geschäftsführer Marcus Trute und unsere Mitarbeiter im Stich? Das tut man wahrscheinlich immer. Aber ich hatte die feste Überzeugung, es war sowohl für mich als auch für die Firma der richtige Schritt. Und mein Bruder hat die Entscheidung sehr wertschätzend und liebevoll unterstützt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Was kam für Sie danach?
Ich bin erst mal mit meiner Familie verreist. Und dann habe ich mir überlegt, welche Werte für mich wichtig sind. Heute will ich die unternehmerische Reise, die vor mir liegt, bewusst genießen. Und ich habe meine Routinen wieder aufgenommen. Welche sind das?
Einfach die Basics: Ich ernähre mich gut, ich mache an sechs von sieben Tagen Sport, ich starte jeden Morgen mit Atemübungen und Journaling. Was schreiben Sie sich dabei auf?
Ich beantworte immer dieselben Fragen. Die erste ist: Welche Dinge, die ich habe, könnten mir genommen werden, und wie fühlt sich das an? Das ist sehr powerful
Und was steht da zum Beispiel?
Mein Zuhause oder meine gesunden Augen. Könnten Sie nicht einfach aufschreiben, wofür Sie dankbar sind?
Schon. Aber das nimmt das Gehirn ganz anders auf. Wenn man schreibt: Ich bin dankbar, dass ich sehen kann, dann stehen da die Wörter, aber du spürst das nicht. Wenn du aber die Augen schließt und dir zwei Minuten lang vorstellst, wie es wäre, wenn du auf einmal erblindest, und dann die Augen wieder öffnest, bekommst du eine Gänsehaut, wenn du die Farben siehst. Was schreiben Sie noch auf?
Welche Haupterkenntnis ich am Tag zuvor hatte. Das muss nicht immer etwas Großes sein. Vielleicht hat in einem Meeting jemand etwas gesagt, das mich getriggert hat. Also überlege ich, was ich in Zukunft besser machen will. Und dann notiere ich jeweils eine wichtige Sache, die ich an diesem Tag beruflich und persönlich schaffen will. Wirklich nur eine. Das gibt mir Energie und ein gutes Gefühl von Fokus. Geben Sie uns ein Beispiel?
Persönlich kann das sein, dass ich mir heute fest vornehme, Sport zu machen, auch wenn der Tag voller Meetings ist und ich familiäre Verpflichtungen habe. Beruflich kann das sein, dass ich auf jeden Fall ein Produktdesign finalisieren und umsetzen will. Das Coole ist, dass man diese beiden Dinge auf jeden Fall schafft, wenn man sie sich vornimmt. Meistens auch noch deutlich mehr. Gleichzeitig ist es das Gegenteil von den heute oft propagierten und sehr detaillierten To-do-Systemen. Die lassen die meisten Menschen gestresst und mit dem Gefühl zurück, keinen Tag genug gemacht zu haben.
Sport, Atmen, Journaling: Dazu raten auch Experten, um Stress zu reduzieren. Und doch klingt es nach Arbeit. Alles im Leben ist Arbeit. Auch die innere Ruhe. Deswegen finde ich das in Ordnung. Habe ich jeden Tag Lust, Liegestütze zu machen oder die langweilige obere Rückenmuskulatur zu trainieren? Nein, aber ich merke, dass es mir wahnsinnig guttut. Ich bin fest davon überzeugt, dass innere Ruhe die Grundlage für die richtigen unternehmerischen Entscheidungen ist.



Deshalbsorgenwir fürpassgenaue Sicherheit –in kritischen Infrastruk turen, Industrie, Verwaltung undSicherheitsbehörden.
secunetmacht souveräneDigitalisierung möglich.
Vor einem Jahr haben Sie mit einem Ihrer früheren Investoren wieder ein Start-up gegründet: zeroLabs. Sie bringen jetzt alkoholfreies Bier ohne Zucker raus. Wie lange haben Sie sich das überlegt?
Wir hatten die Idee, nachdem wir im Englischen Garten Fußball gespielt haben. Max Wittrock und ich sind schon lange befreundet. Wir waren als junge Gründer aus München in derselben Szene unterwegs. Er war damals einer von den Jungs, die Mymuesli aufgebaut haben. Wir haben uns über mehrere Monate mehrmals die Woche getroffen und unsere Vorstellungen übereinandergelegt: Was wollen wir in der Firma und was nicht? Welche Rolle möchte jeder übernehmen? Wie viel Zeit möchten wir da überhaupt reinstecken? Was sind unsere Werte? Das hat Klarheit gebracht. Inwiefern?
Wir wollten beide noch ausreichend Zeit für andere Dinge haben. Max teilt sein Marketing und Gründerwissen als Speaker oder in Workshops oft mit anderen. Mit meinem Brand und Designstudio Details Matter berate ich Unternehmer und Gründerinnen und helfe, ihre Marke sichtbar zu machen und sie in Design und Produkt zu übersetzen. Das wollten wir beide nicht aufgeben. Und auch nicht die Möglichkeit, hier und da Urlaub machen zu können. Das war nicht immer selbstverständlich.
Der amerikanische Unternehmer und Autor Ben Horowitz hat geschrieben: Beim Gründen gibt es nur zwei Gefühle: Euphorie und Terror. Wie sehen Sie das? Ich habe heute nicht mehr diese Extremausschläge. Mit Anfang 20 war das anders. Da habe ich bis drei Uhr nachts gearbeitet und bin um sieben Uhr morgens wieder aufgestanden, um weiterzumachen. Das Unternehmen war mein Lebensinhalt. Das ist heute anders. Aber natürlich freust du dich als Gründer, wenn etwas gut läuft. Und wenn am Freitagabend ein Anwalt eine Abmahnung schickt, dann nervt das, aber es haut mich nicht um. Ich lasse mir von so was weder einen noch mehrere Tage verderben. Ich weiß heute: Solche Dinge passieren, und sie lassen sich lösen. Sie haben einen ChatGPT-Coach gebaut, den Balanced Entrepreneur. Warum?

Ein Bier, das polarisiert:
»Do hau i ma liaba an rostign Nogl ins Gnia«, schrieb etwa ein User auf Social Media
Weil ich im Alltag manchmal einen Sparringspartner brauche, der mir hilft, zu fokussieren und klarer zu sehen. Mein KICoach vereint alle Tools und Weisheiten, die ich über die Jahre gesammelt habe. Von Stoizismus über das Wissen von hinduistischen Mönchen bis hin zu Büchern, die mich inspiriert haben. Ich füttere und nutze ihn regelmäßig. Jetzt habe ich ihn auch für andere Gründerinnen und Unternehmer auf meiner Website detailsmatter.com veröffentlicht, denn die erleben immer wieder Phasen, in denen sich alles überschlägt.
Um zu zeigen, wie sein KI-Coach funktioniert, zieht Moritz Keller sein Handy hervor. Er hat ihn mit E-Mails gefüttert und gefragt, was davon wichtig ist und was er guten Gewissens eher vernachlässigen kann. Die KI hat ihm geantwortet, er solle sich nur um das kümmern, was tatsächlich heute fällig sei und zu einem wichtigen Ziel oder einer Problemlösung beitrage. Klarheit entstehe nicht durch mehr Denken, sondern »durch das Trennen von Wichtigem und Lautem«, schreibt der Coach. Keller sagt, er tue zwar nicht alles, was die KI ihm empfehle, aber sie helfe ihm, ins Handeln zu kommen.
Was machen Sie heute anders als früher?
Ich blocke morgens und abends konsequent WhatsApp, E Mails und Slack und lese am Wochenende keine beruflichen E Mails. Dafür habe ich mir die ScreenzenApp installiert. Die brauchte ich gerade anfangs, sonst wäre die Versuchung doch zu groß gewesen, nur mal kurz zu checken, ob etwas Wichtiges reingekommen ist. Wäre das denn so schlimm?
Die dauerhaften DopaminKicks versetzen den Körper in ständige Alarmbereitschaft. Und das sorgt für Unruhe und Stress. Früher dachte ich, das gehört dazu, zum Erfolgreichsein. Ich dachte auch, ich müsste immer produktiv sein. Immer die Mails direkt beantworten. Die Wahrheit ist: Wer sofort antwortet, bekommt die meisten Mails, weil alle wissen: Der antwortet ja immer. Wie organisieren Sie jetzt Ihren Tag?
Früher hatte ich für alles Blocker im Kalender. Jede Minute war verplant. Heute sammle ich stattdessen alles in einer einzigen Liste, und arbeite die nach meinem Energielevel ab. Die unangenehmen Dinge – fordernde Gespräche, schwere Entscheidungen, Themen, die Fokus brauchen – gehe ich morgens an, wenn das Level hoch ist. Dann fallen sie einem deutlich leichter. Herrje, wie lang ist diese Liste denn?! Sie hat höchstens 20 Punkte. Einmal pro Woche lösche ich etwa die Hälfte aller Todos wieder raus – damit nur das Wesentliche bleibt. Am Anfang hat sich das nach Kontrollverlust angefühlt. Jetzt nach Freiheit. Kann man nach Energielevel eine Firma führen? Was sagen Sie Geschäftspartnern, wenn das gerade mal nicht reicht? Energieorientiert zu arbeiten, heißt nicht, sich treiben zu lassen, im Gegenteil. Es hilft, Prioritäten zu setzen und bewusst zu steuern, wo man den größten Hebel hat. Natürlich gibt es Termine, Verpflichtungen, Deadlines. Aber wenn man seine Energie kennt, kann man besser einschätzen, wann man die wichtigen Dinge wirklich gut entscheidet. Und? Sind Sie jetzt durchgängig happy? Nein, wer ist das schon? Aber ich bin an den meisten Tagen ziemlich zufrieden und entspannt. Und ich weiß auch, was ich tun kann, wenn es mal nicht der Fall ist.
Die Fragen stellte Nele Justus
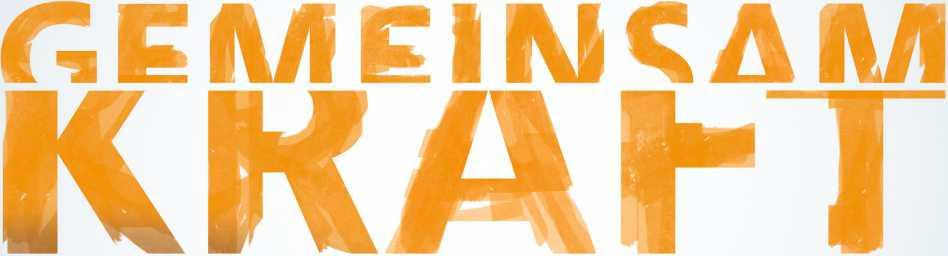


Leistu ng sf äh ig keit bedeutet fü ru ns, Herausforderunge ni nC hancen zu verwandeln .
DasjapanischeHandwerkKintsugiverbindet Bruchs tückemit Gold und schafft so etwasEinzigartiges und Besseres. Dies ist füruns In spiration: Gemein sammit un seren Kunden entwickeln wirindividuelleLösungen, diezukunft ssichere Strukturen ermö glichen. Er fahren Sie, wiewir Leis tung sfähigkeit sichern unter firmenkunden.dzbank.de
Druck, Stress, Verantwortung: Zusammen mit der Stiftung »In guter Gesellschaft« haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, was der Job mit ihrer Gesundheit macht und wie sie sich schützen
Wie schwer es Unternehmerinnen und Unternehmern fällt, Beruf und Privatleben
66 %
arbeiten auch an freien Tagen und im Urlaub. Selbst unter den Befragten mit drei oder mehr Kindern liegt der Anteil bei 56 %
36 %
fühlen sich oft hin- und hergerissen zwischen ihrer Familie und ihrem Unternehmen. Unter den weiblichen Befragten liegt der Anteil sogar bei 41 %
in Einklang zu bringen ...
fühle mich häufig ...
Zwar gelingt es der Mehrheit der Befragten, Job und Familienleben miteinander zu vereinbaren – auch dank Routinen. Aber ein erheblicher Anteil scheitert daran. Zeitmangel und »24/7 Erreichbarkeit« sind ein Problem, antworten Befragte.
37 %
fühlen sich häufig nicht wertgeschätzt für das, was sie im Unternehmen leisten. Unter den befragten Frauen liegt der Anteil bei
40 %
56 % haben Rituale und Strategien entwickelt, um Privatleben und Beruf zu trennen. Von den Befragten zwischen 18 und 40 sagen das 62 %
56 % der Befragten geben an, finanzieller Wohlstand sei ein wichtiger Treiber ihrer Arbeit
48 % geben an, Geld spiele eine wichtige Rolle in ihrem Leben
... bereitet mir Sorgen ... bereitet mir keine Sorgen
... bereitet mir Sorgen ... bereitet mir keine Sorgen
zu 100 Prozent fehlenden Befragten bereitet das Thema teilweise Sorgen
Prozent fehlenden Befragten bereitet das Thema teilweise Sorgen
Obwohl sich mehr Befragte vor Altersarmut fürchten als 2022, haben sich nur zwei von drei intensiv mit ihrer Altersvorsorge befasst.
68 % sehen in einem guten Einkommen nur eine angenehme Begleiterscheinung einer erfolgreichen Arbeit
31 %
verzichten zugunsten von mehr Freizeit auf Umsatz ihrer Firma
... wie sich der Alltag und die Sorgen auf ihr
Mich belastet ...
Mich belastet ...
eine Angststörung
Suchterkrankung
Die Folgen von Stress und Druck treffen Frauen häufiger als Männer. Aber auch jüngere Befragte zwischen 18 und 44 Jahren beider Geschlechter sehen sich häufiger als die Älteren mit Einsamkeit (26 %) und Ängsten (18 %) konfrontiert; zudem berichten sie etwas öfter über einen Burn-out (32 %) und Depressionen (23 %).
Die Gründe sind geschäftlicher und privater Natur: Finanzen und Nachfolge seien herausfordernd, schreiben Befragte, aber auch Beziehungsprobleme, »die Care-Arbeit« und »Familienstreitigkeiten bezüglich der Geschäftsübergabe«.
und
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer tun etwas gegen Stress und Druck. Und auch hier lässt sich ein Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellen: Frauen sind eher dazu bereit, sich Hilfe von außen zu holen. Und sie kümmern sich ganz generell mehr um sich und ihre Gesundheit. Außerdem: Während die Jüngeren eher auf Entspannungstechniken setzen, ist Älteren ausgewogene Ernährung wichtig.
In der Befragung haben viele auch geteilt, wie sie konkret Ausgleich suchen. Fasten, kochen, »genug schlafen« und »spazieren gehen mit dem Hund« scheinen sich zu bewähren. Aber auch »keinen Alkohol trinken«, Spiritualität, Meditation und »Coaching durch meine Ehefrau« werden genannt.
Für die Mittelstandsstudie wurden mehr als 1.000 Inhaber, Geschäftsführerinnen und Gründer befragt. Die Studie ist eine gemeinsame Initiative von ZEIT für Unternehmer und der Stiftung »In guter Gesellschaft«. Sie unterstützt die Befragung sowie die wissenschaftliche Auswertung durch das Analyse- und Beratungsunternehmen Aserto finanziell. Die Ergebnisse werden der Redaktion in anonymisierter Form unentgeltlich bereitgestellt, auf ihre Veröffentlichung hat die Stiftung keinerlei Einfluss.
Deniz Fiçicioglu will Meeresalgen auf jeden Teller bringen. Sie sieht darin das Nahrungsmittel der Zukunft. Nun muss sie nur noch die anderen davon überzeugen
VON CAROLYN BRAUN
Nahrungsmittelunverträglichkeiten nerven. Damit umgehen zu müssen, kann aber offenbar jede Menge Kreativität freisetzen. Zumindest gilt das für Deniz Fiçicioglu. Die Tochter eines Restaurantbesitzers konnte lange alles essen. Vor 15 Jahren aber litt sie plötzlich unter Beschwerden, die sie sich nicht erklären konnte. Bis zur Diagnose dauerte es Monate, dann war klar: Sie hat eine Fruktose-Intoleranz. Es dauerte weitere Monate, bis sie herausgefunden hatte, wie sie damit gut leben konnte. »Eine ganze Weile hatte ich Angst, ab jetzt dürfe ich nur noch Hühnchen mit Sahnesoße essen«, erzählt Fiçicioglu, die damals als Strategin in einer Innovationsagentur arbeitete.
Abhilfe schuf das Internet. Und zwar der Austausch mit einer australischen Facebook-Gruppe von Leidensgenossen: »Nach drei Tagen wusste ich mehr als alle Ernährungsberaterinnen, die mir zuvor begegnet waren.« Was machte man in den Nullerjahren mit einem solchen Wissensvorsprung? Klar: Man startete ein Blog.
Kurz darauf zog die junge Frau samt Blog nach Istanbul. Aus einem sechsmonatigen Sprachkurs wurden drei Jahre, und Fiçicioglu wurde zur Kochbuchautorin.
Ein Jobangebot lockte sie zurück nach Berlin und führte sie in die Start-up-Szene der Hauptstadt, natürlich in den FoodBereich, und schließlich in ein Förderprogramm speziell für Gründerinnen. Dadurch fand sie den Mut, selbst ein Unternehmen zu gründen, und auch das konkrete Thema, in dem sich ihr ganzes Vorwissen kristallisierte: die Alge.
Genauer: Makroalgen aus Nordeuropa, auf Englisch seaweed, eine weitgehend unerforschte Pflanze mit dem Potenzial, die menschliche Ernährung zu revolutionieren. Davon ist Fiçicioglu jedenfalls überzeugt. Denn Algen verbinden Geschmack und Umweltschutz: Das prote-
inreiche, natürliche Superfood braucht weder Süßwasser noch Dünger oder Ackerland. Wie alle Pflanzen bindet auch die Alge Kohlendioxid und setzt Sauerstoff frei. Und sie könnte Fischern eine Alternative bieten, sodass sich mit der Zeit die Meere von der Überfischung erholen könnten.
Zusammen mit Jacob von Manteuffel, der eine Doku über Algen gedreht hatte, gründete Fiçicioglu 2019 und 2020 gleich zwei Firmen: Oceanfruit und Wunderfish. Ihr Ziel: »Wir wollten die Alge raus aus dem Sushi-Umfeld kriegen und zeigen, wofür sie sich sonst noch eignet.« Oceanfruit warb dafür mit Salaten, die nach Senf oder Roter Bete schmecken und unter anderem von Rewe Nord und Denn’s Biomarkt verkauft wurden, Wunderfish mit einem veganen Thunfisch- und später auch einem Lachs-Ersatz, alles auf Algenbasis selbstverständlich.
Heute führt Fiçicioglu Wunderfish allein, Manteuffel ist ausgestiegen. Anfangs hatten sich die beiden aus eigener Tasche und mit Krediten von Familienmitgliedern finanziert, inzwischen sind Impact-Finanzierer eingestiegen. Weitere Kapitalgeber wären willkommen.

Optische Täuschung: sieht aus wie Thunfisch, schmeckt nach Thunfisch, ist aber aus Algen
»Wir sind im Jahr sechs immer noch ganz am Anfang damit, die Leute zu überzeugen«, sagt die Wunderfish-Chefin. »Aber wir kommen einfach nicht drum herum, Algen zu essen. Also will ich die wirklich irgendwann auf jedem Teller sehen.«
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung ist die 42-Jährige gerade gegangen. Auf der Lebensmittelmesse Anuga Anfang Oktober in Köln hat das siebenköpfige Wunderfish-Team seinen neuen Umami-Extrakt präsentiert, einen natürlichen Geschmacksverstärker, ganz aus Alge. Er wurde prompt unter die Top Ten der Innovationen gewählt.


Sca nnen und mehr erfa hren
Unternehmer aus völlig anderen Branchen wollen von den steigenden Verteidigungsausgaben profitieren. Dafür müssen sie Mitarbeiter überzeugen – und womöglich den Verfassungsschutz
VON JENS TÖBBEN

Am Bau des Eurofighter sind laut Airbus rund 400 europäische Firmen beteiligt. Damit stärke er die Wirtschaft und bringe Milliarden an Steuereinnahmen

Wenn es hart auf hart kommt, könnte man sich vielleicht mit einem Champagnersäbel verteidigen. Oder mit einem Taschenmesser. Die werden mit den Geräten der Heinz Berger Maschinenfabrik zu scharfen Werkzeugen geschliffen. Aber Produkte für die Rüstung fanden sich lange nicht im Portfolio des Wuppertaler Unternehmens. Bis Russland die Ukraine angriff.
Firmenchef Andreas Groß führt Mitte Oktober eilig durch seine Fabrikhalle. Der 59Jährige hat gleich einen Termin, seine Mitarbeiter grüßen schon mit »Mahlzeit«, aber er will noch seine Maschinen zeigen. Da ist eine, die Taschenmesser schleift. Dort eine, die spezielle Klingen für Druckverfahren fertigt, sogenannte DoctorBlades. Hier eine, die Rohlinge zu Messern für die Lebensmittelindustrie frisiert. Man kann zusehen, wie die Rohlinge in drei Minuten automatisch geschliffen, gefräst, entgratet, gewaschen und laserbeschriftet werden. »Ein bisschen Sendung mit der Maus«, scherzt Groß.
Für alle Maschinen bleibt keine Zeit, an etwa 40 Projekten arbeiten die 195 Mitarbeiter bei Berger. Aber eine will Groß noch zeigen. Er läuft zur anderen Seite der Halle und bleibt vor einer rahmenförmigen Anlage und einer Pappbox stehen. Fotografieren darf man das Gerät nicht, auch nicht im Detail beschreiben, was es macht. Nur, dass es Oberflächen bearbeitet. Welche Oberflächen kann man sich denken, wenn man einen der 18 Kilogramm schweren Metallklötze aus der Pappbox hochhebt. Es
sind Panzerkettenglieder. Vielleicht liegt in der Box das nächste Geschäft für Groß.
Rüstungsgüter waren lange nicht nur Andreas Groß fremd, sondern auch dem Großteil der Industrie. Viele wollten damit nichts zu tun haben, noch weniger damit Geld verdienen.
Aber das war einmal. Vor dem Angriffskrieg Russlands, vor der Energiekrise und dem Einbruch der Industrieproduktion. Und bevor die Bundesregierung die Schuldenbremse für Militärausgaben aushebelte. Allein im kommenden Jahr will der Staat 108 Milliarden in die Verteidigung stecken.
Kein Wunder, dass gerade Firmen im Industriesektor mit einem Einstieg flirten. Der Motorhersteller Deutz übernahm einen Zulieferer für Militärdrohnen, die Autozulieferer ZF und Schaeffler planen einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts. Der Laserhersteller Trumpf möchte sich für das Geschäft mit der Verteidigung öffnen, viele weitere Konzerne prüfen das ebenfalls. Der Bundesverband der Sicherungs und Verteidigungsindustrie (BDSV) hat in den vergangenen zwölf Monaten fast 200 neue Mitglieder gewonnen. Den Industriebetrieben könnte das Rüstungsgeschäft helfen. Vielleicht nicht als neues Flaggschiff, aber zumindest als Beiboot.
Das erhofft sich auch Andreas Groß von der Heinz Berger Maschinenfabrik. Das Unternehmen stellt seit 1957 Maschinen und Robotik für so ziemlich alles her, was in der Industrie geschliffen, gefräst oder poliert werden muss. Und das Geschäft in
den vergangenen Jahren lief eigentlich recht gut. Gut gefüllte Auftragsbücher, steigende Erlöse, konstante Gewinne. Für das Jahr 2023 weist die Bilanz einen Umsatz von 30 Millionen Euro und rund 880.000 Euro Jahresüberschuss aus.
Aber es gibt eine Ecke in der Fabrikhalle, die gerade gar nicht gut läuft. Die Maschinen für Abbrechklingen, DoctorBlades und Maschinenmesser. »Das ist alles USAGeschäft«, sagt Andreas Groß. 40 Prozent seines Umsatzes habe er bisher in den Staaten gemacht. Doch in diesem Jahr habe er von dort erst einen einzigen Auftrag erhalten. Durch das ZollHinundHer Donald Trumps sei die Nachfrage eingebrochen.
Deswegen also der Einstieg in die Rüstung? So will Andreas Groß das nicht verstanden wissen. In seinem Konferenzraum lehnt er sich zurück, er will gern den ganzen Kontext erklären. »Sie können Rüstung und Zollpolitik nicht mehr getrennt betrachten«, sagt Groß. Die Zollpolitik müsse sich Europa gefallen lassen, weil es sich nicht alleine verteidigen kann. »Ich bin abhängig«, sagt er und ballt die Faust, »Als Unternehmer ist das ein furchtbares Gefühl.«
Um die Wirtschaft zu beleben, braucht Europa also Rüstung. Dabei sollen Groß’ Schleifmaschinen helfen. In seiner Fabrik drückt der Unternehmer dem Reporter einen silberfarbenen Metallflügel in die Hand, er ist geschwungen und sehr leicht. »Das ist eine Titanlegierung«, sagt Groß. Der Flügel ist eine Turbinenschaufel, die unter anderem in Kampfflugzeugen zum
Einsatz kommt. Berger stellt Roboteranlagen her, die den Turbinenschaufeln die richtige Aerodynamik geben sollen. So spart der Flieger Treibstoff und bleibt länger einsatzfähig. Solche vernetzten Maschinen sind laut Groß eine Spezialität von Berger.
Wer in das Rüstungsgeschäft einsteigen will, braucht so eine Spezialität, sagt Matthias Witt, Inhaber der Beratungsfirma Wimcom im hessischen Höhr-Grenzhausen. In den 2000er-Jahren leitete Witt die Militärlogistik beim Konzern DHL, seit etwa zehn Jahren berät er bei Wimcom Mittelständler zum Einstieg in die Rüstungsbranche. Seine Firma bietet unter anderem ein sechswöchiges Einstiegsseminar für 3.000 Euro an. Mehr als 500 Kunden habe Wimcom bereits beraten, sagt der 57-Jährige, allein im vergangenen Jahr habe sich die Nachfrage verdreifacht.
Dem Geschäft von Witt dürfte es helfen, dass die Rüstung kein gewöhnlicher Markt ist. Wenn man die ausländischen Armeen ausklammert, ist die Bundeswehr der einzige Endkunde, den deutsche Firmen beliefern wollen. Das Gute ist, dass sie fast alles gebrauchen kann: Konserven, Jacken, Zelte, Schrauben, ja sogar Gartendienste für die Liegenschaften. »Das Potenzial ist groß«, sagt Matthias Witt. Ein Einstieg rechne sich aber nur für diejenigen, »die ein Alleinstellungsmerkmal haben«. Wie zum Beispiel die automatisierten Maschinen von Berger. Wenn dagegen zu viele Firmen das gleiche Produkt mit gleicher Qualität anbieten, könne man die Konkurrenz nur schlagen,
400.000
Menschen sind laut dem Verband BDSV für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie tätig oder arbeiten indirekt für sie
indem man die eigenen Preise drückt. Dann bliebe aber der erhoffte Gewinn aus.
Peter Hodapp ist schon in den Wettstreit mit der Konkurrenz eingetreten. Der Unternehmer aus Achern in der Nähe des Schwarzwaldes stellt unter anderem Sicherheitstüren her, an der jeder schon vorbeigefahren ist, der durch einen deutschen Tunnel fährt. Die Firma ist gut im Geschäft: 2023 erzielte sie etwa 1,7 Millionen Euro Gewinn, die Zahl der Mitarbeiter stieg auf etwa 230.
Als Russlands Staatschef Wladimir Putin in der Ukraine einfiel, war für Peter Hodapp klar, dass sein Unternehmen seine Türen nun auch dem Rüstungssektor liefern sollte. Der Angriff habe gezeigt, wie verletzlich die Infrastruktur ist – Hodapps Türen könnten da helfen. Dazu machte sich die Krise der Automobilindustrie bemerkbar. Hodapp ist Zulieferer für viele Automobilkunden, die nicht mehr bestellten. Zehn Prozent des Umsatzes fielen damit voraussichtlich weg. »Wir hoffen natürlich, einen Teil davon kompensieren zu können«, sagt der 59-Jährige. Sein Ziel: Das neue Geschäftsfeld soll in Zukunft 20 Prozent des Umsatzes decken.
Bevor Hodapp aber überhaupt an die Ausschreibungen kommt, muss er sich dem Verfassungsschutz stellen. Dieser schreibt auf Anfrage, dass private Unternehmen, die bestimmte Rüstungsgüter liefern, in die »staatliche Geheimschutzbetreuung« aufgenommen würden. Dafür würden auch bestimmte Beschäftigte des Unternehmens
einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. So eben auch Peter Hodapp und alle Beschäftigten, die an Projekten mitarbeiten sollen. Die Mitarbeiter seien zum Beispiel nach bestimmten Auslandsaufenthalten gefragt worden, erzählt Hodapp. Der Prozess bis zur Freigabe habe eineinhalb Jahre gedauert.
Dafür hat Hodapp nun schon zwei Aufträge für Kasernentüren erhalten, nur wenige Konkurrenten seien dafür zugelassen. Auch nicht alle seiner Mitarbeiter dürfen am Projekt mitwirken, er muss das nun sicherstellen. Die Fertigung der Kasernentüren muss er besonders schützen, gut, dass er sich mit Sicherheitstüren auskennt. Außerdem müsse Hodapp Arbeitsplätze ohne Internetanschluss einrichten, auf die man nicht extern zugreifen könne. Auch heute noch prüfe der Verfassungsschutz das Unternehmen kontinuierlich. Der Kontakt mit den Behörden sei teilweise per Post oder Fax erfolgt, aus Sicherheitsgründen. Das sei »eine kleine Zeitreise« gewesen.
Nur wenige Firmen können direkt mit dem Staat ins Geschäft kommen. »Die Bundeswehr beschafft das fertige Produkt«, sagt der Berater Matthias Witt. Die meisten Mittelständler könnten also nur die Rüstungskonzerne beliefern. Die Maschinenfabrik von Andreas Groß etwa liefert die Turbinenschaufel-Maschine an eine Firma, die wiederum einer weiteren Firma zuliefert. An wen genau, dürfe er nicht offenlegen, sagt Groß – im Rüstungsgeschäft gibt es überall Geheimhaltungsvereinbarungen.
Verteidigungsausgaben
Deutschlands in Mrd. Euro
In diesem Szenario machen die Ausgaben 1,9 Prozent des BIP aus In diesem Szenario steigen sie bis 2030 auf 3,3 Prozent des BIP
In diesem Szenario erreichen sie 3,5 Prozent des BIP schon 2030
Der Vorteil am reinen Zuliefern ist, dass man weniger Papierkram hat. Der Nachteil ist, dass mehr von der Marge verloren geht, je weiter hinten das Unternehmen in der Wertschöpfungskette steht. Dort wird auch der Wettbewerbsdruck höher, sagt der Berater Witt. Viele Unternehmen können Schrauben anbieten, einen Schützenpanzer nur wenige. Das erschwere die Entscheidung, ob man die Branche beliefere oder nicht. Der Umsatz sei nicht garantiert, und allein von der Entscheidung bis zum ersten Auftrag könnten Jahre vergehen, sagt Matthias Witt. Womöglich müsse man auch ehemalige Soldaten ins Team holen, das koste. Wer also umsatzmäßig schon schwächele, solle es sein lassen, rät der Experte. »Rüstung ist kein schneller Weg, um noch kurzfristig Gewinn zu machen«, sagt Witt. »Man braucht einen kühlen Kopf und muss strategisch denken.«
Leicht machen sich die Entscheidung wohl nur wenige Unternehmer – auch aus moralischen Gründen. Der Türenhersteller Peter Hodapp hat gleich zu Beginn die Mitarbeiter informiert, damit sie es nicht »aus der Presse« erfahren. Seine Erfahrung: »Wenn man es erklärt, verstehen es die meisten.« Hodapp betont auch, dass es ja ohnehin nicht um Waffen gehe, sondern nur um harmlose Türen.
Wie in dieser Frage Werte und Geschäftsinteressen aufeinanderprallen, zeigt sich bei der IG Metall. In der Satzung der größten Gewerkschaft der Welt ist die Abrüstung als Ziel verankert, Regional
verbände demonstrieren am Antikriegstag, und mehr als 6.000 Unterschriften listet die Onlineplattform »Gewerkschaftler gegen Aufrüstung«. Auf der anderen Seite steht die Krise: »Wir sehen gerade wenig Widerspruch, weil die Beschäftigten begründete materielle Ängste haben«, sagt Maximilian Locher, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in BadenWürttemberg.
Die IG Metall scheint in diesem Dilemma noch keine konsequente Position gefunden zu haben. Im März etwa sagte der Gewerkschaftsvize Jürgen Kerner in der Stuttgarter Zeitung, man spreche sich weiterhin gegen eine Aufrüstung von Europa aus, sehe aber die »Notwendigkeit für eine vernünftige Ausrüstung der Armeen zum Zweck der Landesverteidigung«.
Die Position des Maschinenfabrikanten Andreas Groß ist dagegen sehr eindeutig. Er sieht es als unternehmerische Verantwortung, zur Verteidigung beizutragen. Er habe die Entscheidung für Rüstung ohne seine Angestellten getroffen. »Es gab zwei jüngere Mitarbeiter, die ethische Probleme hatten«, sagt Groß. Beiden habe er seine Sichtweise erklärt. Für die anderen Mitarbeiter sei die Entscheidung okay gewesen.
Bei anderen Unternehmen im Bergischen Land war es nicht so einfach, zeigt der regionale Konjunkturmonitor der Bergischen Universität Wuppertal. Demnach hatten sich im Juni knapp 18 Prozent gegen ein Rüstungsgeschäft ausgesprochen – aus unternehmenspolitischen oder ethischen Gründen.
2035 wollen die Nato-Staaten 3,5 Prozent ihres BIP für Verteidigung ausgeben. Nach Berechnungen von McKinsey könnten die deutschen Ausgaben um insgesamt bis zu 350 Mrd. Euro steigen
Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sei Skepsis angebracht, sagt der Ökonom Patrick Kaczmarczyk von der Uni Mannheim: »Der Rüstungsboom wird den Mittelstand nicht retten.« Der deutsche Rüstungsmarkt sei aktuell ausgelastet, die Kapazitäten wüchsen nur langsam. Ein Geldregen von oben sickert vielleicht nicht bis zu den Mittelständlern unten durch. Kaczmarczyk befürchtet: »Zusätzliche Investitionen in eine Industrie, die am Kapazitätslimit ist, werden in die Profite der großen Konzerne gehen.« Dazu kommt: Laut einer Studie von Kaczmarczyk und dem Ökonomen Tom Krebs sollte man in Deutschland auch kein starkes Wirtschaftswachstum durch die Rüstungsbranche erwarten. Für jeden Euro, den der Staat in die Rüstung stecke, würden im besten Fall nur 50 Cent im BIP landen. Die Branche könne auch die Beschäftigten nicht aufnehmen, die ihre Jobs in der Automobilbranche verlieren, meint Kaczmarczyk. Und er sieht ein weiteres Problem: Wenn der Mittelstand sich zur Rüstung umorientieren sollte, würden Fachkräfte und Innovationen in anderen Bereichen fehlen, zum Beispiel bei den grünen Technologien.
Andreas Groß kann das gelassen sehen. Der Umsatzanteil der Rüstung soll bei ihm erst mal einstellig bleiben. Und seine Maschinen sind meist Einzelstücke, er kann flexibel produzieren: Küchenmessergriff oder Panzerkette, das ist aus rein wirtschaftlicher Sicht erst mal egal. Den richtigen Feinschliff kann schließlich jede Branche gut gebrauchen.

Mit diesen Plakaten will die Unternehmerin Susanne Liedtke den Wechseljahren mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die Slogans stammen von der Werbetexterin Nina Puri
Rund neun Millionen Frauen in Deutschland sind derzeit in den Wechseljahren. Das hat Folgen für die Arbeitgeber – und die Wirtschaft. Wie Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen gezielt unterstützen und warum Start-ups auf das Thema aufspringen
VON CATALINA SCHRÖDER
Manuela Heller erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie auf dem Heimweg von der Arbeit mit dem Auto rechts ranfahren musste. »Ich war so erschöpft – ich musste kurz die Augen zumachen«, sagt Heller. Seit Monaten schlief sie nachts schlecht, wachte häufig schweißgebadet auf und war morgens völlig gerädert. So erzählt es die heute 55-Jährige. Die Wechseljahre hatten zugeschlagen. Auch in ihrem Job als Krankenschwester im betriebsärztlichen Dienst in einem Bosch-Werk in Blaichach im Allgäu machte sich das bemerkbar: »Ich hatte starke Stimmungsschwankungen. Meine Arbeit habe ich aber so gut wie möglich durchgezogen, und vor allem meine Chefin hat mich dabei sehr unterstützt.«
Hellers Vorgesetzte, die Werkärztin Ulrike Roth, bekam mit, wie ihre Mitarbeiterin litt. »Mir ist dadurch bewusst geworden, dass die Wechseljahre kein rein privates Problem sind, sondern dass die Folgen auch den Arbeitgeber betreffen«, sagt die Arbeitsmedizinerin. Sie beschloss: »Wir als Unternehmen müssen die Frauen unterstützen.«
Rund neun Millionen Frauen in Deutschland sind zwischen 45 und 55 Jahren und damit im für Wechseljahre typischen Alter. Viele haben langjährige Berufserfahrung und könnten – da potenzielle Kinder meist aus dem Gröbsten raus sind – durchstarten.
Zugleich kämpfen etwa zwei Drittel dieser Frauen mit den Symptomen der Wechseljahre. Dazu gehören neben Schlafstörungen und Erschöpfung auch Muskel-, Gelenkund Kopfschmerzen, depressive Verstimmungen und »Brain-Fog«, der sich in Konzentrationsproblemen und Gedächtnislücken äußert. Laut einer Studie des Projekts MenoSupport zweier Berliner Hochschulen entstehen der Volkswirtschaft durch diese Beschwerden am Arbeitsplatz jährlich Kosten von 9,4 Milliarden Euro – das entspricht fast 40 Millionen verlorenen Arbeitstagen.
Mehr als 2.000 Frauen wurden für die Studie befragt. Jede vierte Frau in den Wechseljahren hat ihre Arbeitszeit reduziert, fast jede dritte war schon einmal krankgeschrieben oder hat unbezahlten Urlaub genommen. Jede sechste gab an, dass Wechseljahr-
beschwerden eine Rolle dabei spielten, den Job zu wechseln. Zehn Prozent wollen wegen Beschwerden früher in Rente gehen, von den Über-55-Jährigen sogar fast 20 Prozent.
Dabei braucht die deutsche Wirtschaft die Frauen dringend: Allein bis 2035 fehlen auf dem deutschen Arbeitsmarkt rund sieben Millionen Erwerbstätige. »Es ist nicht nur eine Frage der sozialen Verantwortung, sondern in Zeiten von Arbeitskräftemangel auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit, die Arbeitsfähigkeit von Frauen in dieser Lebensphase zu unterstützen und zu erhalten«, sagt Till Strohsal. Der Professor für Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ist einer der Studienautoren.
Bei Bosch kontaktierte die Werkärztin Ulrike Roth die Uni Magdeburg. Dort läuft ein Forschungsprojekt zu der Frage, vor welchen Herausforderungen Frauen in den Wechseljahren in unterschiedlichen Branchen stehen. Auch der Bosch-Standort im Allgäu nimmt nun mit Frauen aus allen Firmenbereichen daran teil. Viele von ihnen arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb am Fließband, um
unter anderem Bremssysteme für die Autoindustrie herzustellen. Die Arbeit ist getaktet, die Pausenzeiten sind genau vorgegeben.
»Die Frage ist, inwiefern wir die Arbeitsbedingungen so verändern können, dass die Frauen auch während der Wechseljahre gesund und leistungsfähig bleiben«, erklärt Sonja Hachenberger, Gründerin von thechange.org, einer Organisation, die Unternehmen bei diesem Thema berät. Im Rahmen des Forschungsprojekts mit der Uni Magdeburg führte sie die Interviews mit den Bosch-Mitarbeiterinnen. Ergebnis: Viele Frauen wünschen sich mehr Verständnis, Flexibilität und passende Rahmenbedingungen – etwa flexiblere Arbeitszeiten oder Rückzugsräume. »Schichtarbeit bleibt aber ein Knackpunkt«, sagt Hachenberger. »Es geht nicht um Sonderbehandlung, sondern um kleine, realistische Anpassungen – zum Beispiel Mikropausen –, damit Frauen in ihrer Kraft bleiben.«
Manche Staaten haben das Problem erkannt. In Großbritannien etwa gibt es eine nationale Strategie für Frauengesundheitspolitik, die auch die Wechseljahre berücksichtigt. Mehr als 3.400 britische Firmen haben den »Menopause Workplace Pledge« unterzeichnet und sichern ihren Mitarbeiterinnen darin zu, ein wechseljahrefreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen, indem sie etwa flexible Arbeitszeiten ermöglichen oder Führungskräfte schulen.
Deutschland hängt hinterher. Im Oktober 2024 forderten die Unionsparteien zwar auch für Deutschland eine MenopausenStrategie, doch gibt es die bislang noch nicht. Die neue Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag nur vorgenommen, alle Menschen in allen Lebensabschnitten so gut wie möglich medizinisch zu unterstützen.
Auch in der Wirtschaft ist das Thema noch nicht angekommen. In der MenoSupport-Studie sagten 88 Prozent der Befragten, am Arbeitsplatz werde nie oder nur selten über das Thema gesprochen. Und nur etwa jede siebte Befragte gab an, dass ihr Arbeitgeber ein Umfeld biete, in dem Frauen in den Wechseljahren unterstützt würden. Laut der Bewertungsplattform Kununu haben nur sieben Prozent aller Firmen hierzulande ein Programm zu den Wechseljahren.


Und doch: Langsam bewegt sich etwas. »Als ich mich 2019 selbstständig gemacht habe, haben mich die Leute immer fragend angeschaut«, erzählt die Ökotrophologin Susanne Liedtke, die sich auf die Wechseljahre spezialisiert hat. »Heute beschäftige ich ein festes Team von acht Personen und viele Freelancer, habe einen vollen Terminkalender und werde von Unternehmen auf Monate im Voraus gebucht.«
Einer ihrer Kunden ist die Mack-Gruppe, zu der auch der Europa-Park in Rust gehört. Das Unternehmen hat ein eigenes Gesundheitszentrum für seine Mitarbeitenden mit Sportangeboten, Vorsorgeuntersuchungen, Koch- und Nichtraucherkursen. Geleitet wird es von Miriam Mack aus der Inhaberfamilie. »Ich bin dadurch nah dran an unseren Mitarbeitenden und habe mitbekommen, dass viele Frauen sich Angebote zu den Wechseljahren wünschen«, sagt Mack. Etwa 1.300 der insgesamt 5.000 Mitarbeitenden in der Unternehmensgruppe sind Frauen zwischen 45 und 55 Jahren. Viele hätten erlebt, dass ihre Wechseljahresbeschwerden nicht ernst genommen würden. »Einer Mitarbeiterin wurde von ihrer Frauenärztin gesagt: Da müssen Sie jetzt durch!«, erzählt Mack.
Einer der Gründe: Frauenärzte können eine Beratung zu den Wechseljahren über die gesetzlichen Krankenkassen nicht gesondert abrechnen. Sie fällt in die Pauschale von nicht einmal 20 Euro pro Quartal, welche Frauenärzte für Vorsorgeuntersuchungen und allgemeine Beratung pro Frau berechnen dürfen.
Miriam Mack beschloss deshalb, diese Lücke zu schließen: Seit drei Jahren können Mitarbeiterinnen nun an einem dreiwöchigen Onlinekurs von Susanne Liedtke teilnehmen, der bei einer Buchung über die Website regulär 580 Euro kostet. Der EuropaPark hat einen eigenen Tarif ausgehandelt und finanziert die Hälfte der Teilnahmegebühren, 300 Frauen haben das Angebot bereits genutzt. Im Kurs lernen sie, wie sie mit Ernährung und Sport den Schlaf verbessern und das Energielevel anheben können. Aber es gibt auch Runden mit Frauenärzten, in denen sie ihre Fragen loswerden können.
»Wir haben viele Mitarbeiterinnen im betreffenden Alter, die nur in Teilzeit arbeiten«, sagt Miriam Mack. Eine Studie des
Europa-Parks in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen deutet darauf hin, dass die Wechseljahre daran einen Anteil haben. »Frauen in dem Alter sind wahre Diamanten«, sagt Mack. Viele seien gut ausgebildet und erfahren, die Kinder seien aus dem Haus, und die Frauen würden gerne wieder voll in den Beruf einsteigen. »Für uns als Unternehmen sind gerade Frauen ab Mitte vierzig enorm wertvoll«, sagt Mack.
Da die Gesundheitssysteme Frauen in den Wechseljahren bislang wenig zu bieten haben, hat sich ein neuer Markt für Gründerinnen und Gründer entwickelt. Sie bringen spezielle Nahrungsergänzungsmittel heraus, etwa gegen Schlafstörungen, entwickeln Kleidung mit kühlenden Effekten gegen Hitzewallungen und bieten Beratung an. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey wird der globale MenopausenMarkt bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar erreichen.
Valerie Kirchberger setzt auf diesen Markt. Ihre Idee: Arbeitgeber kaufen für ihre Mitarbeiterinnen den Zugang zu ihrer Onlineplattform Evela. Dort finden die Frauen Informationen und können Vier-AugenTermine mit Wechseljahresberaterinnen buchen. Vorab füllen sie einen Fragebogen rund um ihre Schlafprobleme oder Hitzewallungen, aber auch zu Medikamenten, Bewegung und Ernährung aus. »Von unseren Beraterinnen bekommen sie dann individuelle Tipps, und wir begleiten die Frauen auch bei der Umsetzung«, erklärt Valerie Kirchberger. 240 Euro kostet das Programm pro Jahr pro Teilnehmerin. Wer das für teuer hält, dem rechnet Kirchberger vor, dass es Betriebe »viele Zehntausend Euro oder mehr« koste, wenn Frauen aus gesundheitlichen Gründen länger ausfallen. »Dann sehen die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst, dass sich die Investition in unser Programm lohnt, sofern die Frauen davon profitieren.«
Seit anderthalb Jahren gibt es ihr Startup inzwischen. Kirchberger merkt, dass Firmen sich mehr für das Thema öffnen. Termine in Personalabteilungen und Chefbüros bekommt sie heute leichter als früher.
Auch bei Bosch tut sich was: Das Unternehmen wird an seinem Standort im Allgäu nun Vertrauenspersonen zum Thema Wechseljahre schulen, an die sich Betroffene mit Sorgen wenden können. Denn schon darüber zu reden, sorgt oft für Entlastung – und verändert etwas im Unternehmen. »Eine junge männliche Führungskraft hat mir nach dem Workshop erzählt, dass er zuvor überhaupt keine Ahnung hatte, was Frauen in den Wechseljahren durchmachen«, erzählt die Werkärztin Ulrike Roth. »Wir haben es immerhin geschafft, für dieses Thema zu sensibilisieren.« Ob die Schichtarbeit umorganisiert werden kann, ist zwar offen. Aber das Tabu ist gebrochen.
Ob Sieauf derSuche nach demricht igen Nachfolger sind oder einerwerdenwollen, AIAbringtdie best en Unternehmermit denbestenUnt ernehmen zusammen.
WirermöglichenerfahrenenFührungskräften, KMUs mitNachfolgebedarf zu übernehmen undals CEO undMit eigent ümer einzusteigen.

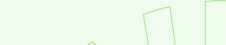



Auf dem Weg zur Arbeit kommt Jens te Kaat jeden Morgen an der Vergangenheit des Standorts Deutschland vorbei: Rostbraun türmt sich das stillgelegte Stahlwerk im Dortmunder Technologiepark vor ihm auf. Das alte Werk erinnert den 59-Jährigen an seine Kindheit, als das Ruhrgebiet noch Herz einer florierenden Kohle- und Stahlindustrie war. Dann geht er weiter, in Richtung Zukunft: Keine hundert Meter neben den alten Hochöfen steht in te Kaats Produktionshalle ein schiffscontainergroßer Kasten, in dem unter leisem Surren Schicht für Schicht ein Industriebrenner entsteht. Der Unternehmer lächelt und sagt: »Wir sind die Bekloppten mit dem 3D-Druck.«
Jens te Kaat ist Geschäftsführer von Kueppers Solutions. Gebürtiger Dortmunder, gelernter Maschinenbauer. Fester Händedruck. Verbindliches Lächeln. Seine Geschichte zeigt, dass man zupacken muss und nicht zu früh loslassen darf, wenn man etwas Neues wagen will. Die Firma hat inzwischen so oft Insolvenz angemeldet, dass man leicht den Glauben an ihre Zukunft verlieren könnte. Der Chef aber nicht. Im Gegenteil: Er kämpft mit einer neuen Idee um ihr Überleben. Seine Geschichte passt damit in eine Zeit, in der die Zahl der Insolvenzen steigt: Laut der Auskunftei Creditreform gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres 11.900 Insolvenzen – der höchste Stand seit 2015. Nur wenigen gelingt die Rettung durch eine Sanierung (siehe Seite 34).
Um zu verstehen, wo Jens te Kaat seine Zuversicht hernimmt, muss man die Zeit etwas zurückdrehen. Als er das Unternehmen Küppersbusch im Jahr 2016 aufkaufte, war es noch alles andere als »bekloppt«, sondern traditionell und bodenständig. Im Jahr 1875
in Gelsenkirchen als Hersteller von Kohleherden und -öfen für Haushaltsküchen gegründet, begann Küppersbusch in den 1940er-Jahren, auch Hochleistungsbrenner für die Industrie zu bauen. In großen Öfen und Kesseln schmelzen solche Brenner bis heute Metall und Glas, trocknen Milchpulver oder rösten Kaffeebohnen. Mit dem Niedergang von Haushaltsgeräten made in Germany um die Jahrtausendwende geriet der Mittelständler ins Straucheln und musste zum ersten Mal Insolvenz anmelden. 1999 übernahm die multinationale Teka-Gruppe. Erfolgreicher lief es dort für das Brennergeschäft auch nicht. 2012 gab Teka den Bereich wieder ab, an die Düsseldorfer Firma Loesche Thermoprozess. Und es wurde nicht besser: 2016 folgte die nächste Insolvenz. Und dann kam Jens te Kaat. Er war Vorstand beim Kran- und Aufzughersteller Böcker aus Werne und gerade 50 geworden, aber hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten, so erzählt er es. Die Idee reifte, sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen. Er stieß auf Loesche und die insolvente Industriebrenner-Sparte. Das Unternehmen
sei günstig gewesen, mehr möchte er zum Kaufpreis nicht sagen. »Sie können sich vorstellen, wenn ein Dortmunder ein Gelsenkirchener Unternehmen in einer Insolvenz kauft, dann sind das gleich zwei Probleme«, sagt er und grinst. Im Fußball verbindet die beiden Städte eine Hassliebe.
Küppersbusch Wärmetechnik – die Industriebrenner-Sparte – fand te Kaat vielversprechend: lange Geschichte, interessante Zielgruppe, am Markt etabliert. Knapp 10.000 Brenner liefen zu diesem Zeitpunkt in den Hochöfen und Brennkesseln der Republik, oft seit Jahrzehnten. Er witterte ein lukratives Reparatur- und Ersatzteilgeschäft.
Also kaufte te Kaat den Betrieb gemeinsam mit einem Kompagnon, der bis heute Mitgesellschafter ist. Seinen Anteil – etwas mehr als die Hälfte – zahlte te Kaat selbst. Gleich an seinem ersten Tag berief er die 16 verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Betriebsversammlung ein, stellte sich und seinen Plan vom Ersatzteilgeschäft vor. Die Gelsenkirchener seien schnell überzeugt gewesen, sagt te Kaat, sowohl von der Idee als auch von ihm. »Am Ende sind wir alle Ruhrpottler: Bodenständig, witzig, man kann mit jedem ein Bier trinken gehen.«
Doch in den ersten Monaten nach te Kaats Übernahme zeigte sich: Dass zuletzt kaum einer mehr Küppersbusch-Brenner gekauft hatte, lag nicht nur daran, dass sie ewig hielten. Sie mussten auch selten repariert werden. Das war Gift für das neue Geschäftsmodell, das dem Unternehmen aus der Krise helfen sollte. Der Unternehmer sagt, er habe vor der Übernahme nicht viel mehr über das Unternehmen als dessen allgemeine Kennzahlen erfahren. Und die hätten für ihn nicht darauf schließen lassen. Foto: Deutscher Zukunftspreis
Eine insolvente Firma retten? Jens te Kaat wagt es – mit einer riskanten Wette auf eine Innovation, die sogar dem Klima helfen soll. Nun braucht er Investoren, damit sie doch noch aufgeht
VON SARAH NEU UND DAVID SELBACH
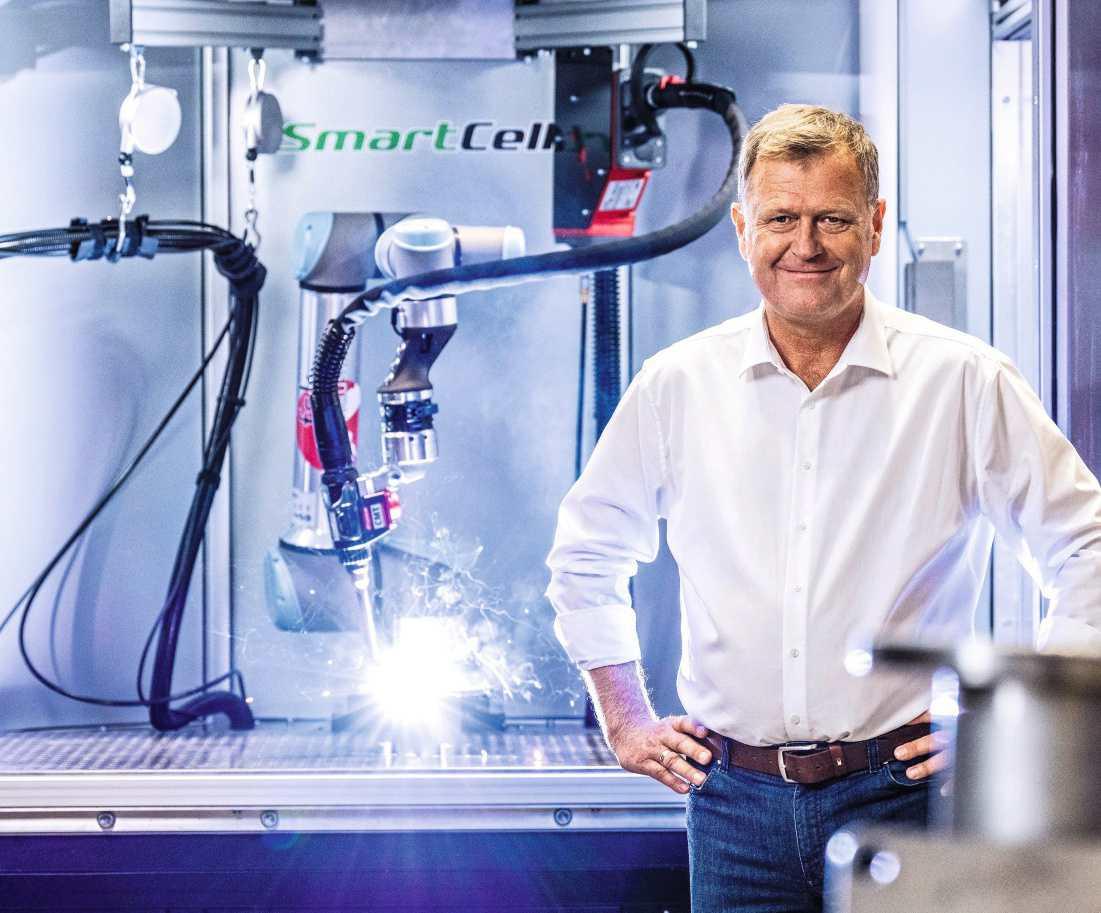
»Ich glaube an den Standort und will ihn stark machen«
Jens te Kaat
Hätte er genauer hinsehen müssen? Schon. Nun aber brauchte er einen Ausweg. Er wusste: Entweder hebt man sich über den Preis seines Produkts ab oder über die Technik. Über den Preis konnte er nicht gehen. »Dafür war unsere Bude zu klein und andere – Honeywell, Riello oder Andritz – zu groß«, sagt er. Es blieb die Technik.
So begannen Monate des Ausprobierens. Mit dem Gas- und Wärme-Institut Essen untersuchten te Kaat und sein Team, wie sich die Brenner, die bisher mit Erdgas liefen, für grünen Wasserstoff fit machen ließen. Oder fänden sie ein besseres Produktionsverfahren statt des herkömmlichen Guss- und Schweißprozederes? Könnte etwa der 3D-Druck dem Unternehmen Vorsprung in einem umkämpften Geschäft verschaffen?
Die Antwort lieferten te Kaat das Raumschiff Enterprise und ein Ritter. Der Entwicklungs- und Simulationsingenieur Adrian Moldovan hatte Bilder davon zu einer Besprechung mitgebracht. Das Raumschiff sei die Technologie – der 3D-Druck. Damit konnte man in einer Produktionsanlage lange, kurze, dicke oder dünne Brenner herstellen – flexibler geht’s nicht. Der Ritter stand für den herkömmlichen Industriebrenner. Stark – aber schwerfällig.
Was Moldovan sagen wollte: Das Kueppers-Team versuchte, mit einer ScienceFiction-Technik ein mittelalterliches Produkt zu bauen. Das war enorm teuer. Und es machte die alten Brenner nicht einmal besser. »Wir machen gerade also ziemliche Scheiße«, habe Moldovan damals gesagt, erinnert sich te Kaat an die Szene.
Aber Moldovan hatte eine Idee und präsentierte dem Chef den Entwurf eines völlig neuen Brenners. Mindestens 15 Prozent
CO₂ sollte der im Vergleich zu den aktuell effizientesten Modellen sparen. Indem er das heiße Abgas, das beim Brennen entsteht, in zopfförmigen statt geraden Kanälen außen am Brenner zurückleitete, brauchte er weniger Energie, um die Verbrennungsluft auf Temperatur zu bringen. Natürlich könnten die Brenner genauso mit Erdgas wie auch mit Wasserstoff laufen – ohne aufwendige Umbauten. Und tatsächlich: Die Prototypen hielten, was Moldovans Berechnungen versprachen, die neue Geometrie überzeugte die Ingenieurinnen und Ingenieure.
Allerdings war es schwieriger als gedacht, den Prototyp in Serie zu produzieren. Te Kaat und sein Team ließen eine Charge mit knapp 100 Brennern über ein Feingussverfahren aus Stahl herstellen. Nur fünf hielten dicht – die Geometrie war zu komplex. Also probierten sie es mit Keramik und nahmen die Bestellung eines Kunden über 80 Brenner an.
Auf dem Weg in den Urlaub, so erzählt es te Kaat, habe er erfahren, dass auch die Keramik-Variante nicht funktioniere. Ob er sich in solchen Momenten je gewünscht habe, wieder im alten Vorstandssessel zu sitzen? »Klar gab es schlaflose Nächte, und ich habe mit Sicherheit zwischendurch mal gedacht, ach, was ein Scheiß«, sagt te Kaat. »Aber das hat keine 24 Stunden angehalten.«
Um die 80 Brenner zu liefern, ließ er sie doch kurzerhand per 3D-Druck anfertigen. »Das war ein klares Minusgeschäft, aber es hat uns weitergebracht«, sagt er. Jetzt stand fest: Der 3D-Druck ist zwar teuer, aber er ist auch das einzig funktionierende Produktionsverfahren für den neuen Brennertyp.
Ein eigener Drucker musste her. Es folgte ein Investorengespräch nach dem anderen, denn der überdimensionierte Spezialdrucker
sollte mehrere Millionen Euro kosten. Nach mehr als einem Jahr Überzeugungsarbeit fand te Kaat einen norddeutschen Geldgeber, der an seine Vision glaubte und den siebenstelligen Betrag investierte. Kurze Zeit später nahm in der Dortmunder Produktionshalle einer von deutschlandweit gerade einmal drei Druckern dieser Größe die Arbeit auf. Heute laufen te Kaats gedruckte Brenner bei Industrieriesen wie Thyssenkrupp. 2023 waren er und Moldovan mit einem Forscher vom Gas- und Wärme-Institut für den Deutschen Zukunftspreis nominiert, 2024 gewannen sie den Innovationspreis NRW. Nur scheint das allein nicht zu reichen. Die schwächelnde deutsche Automobilindustrie und hohe Zölle auf Stahlexporte verunsichern te Kaats Auftraggeber. Anfang Oktober hat er sich entschieden, erneut Insolvenz anzumelden. Das Amtsgericht Dortmund hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt, der nun mitredet und dem Unternehmen Luft verschaffen soll, sich unter Gläubigerschutz neu zu ordnen und strategische Investoren zu finden. »Wir brauchen jetzt Partner mit internationalem Vertriebsnetzwerk, große Buden, um unsere energieeffizienten Brenner in die Welt zu bringen«, sagt Jens te Kaat. Viele Unternehmen wagten sich da noch nicht heran, obwohl sie doch klimafreundlicher werden wollen. Er findet: »Das passt nicht zusammen.«
Der Unternehmer glaubt weiter an die Zukunft seiner Firma, die schon so viele Insolvenzen überstanden hat. Sollte er »große Buden« finden, so hofft er weiterhin, könnten Kueppers-Brenner aus dem 3D-Drucker schon bald weltweit eingesetzt werden. Aufgeben, das kommt für Jens te Kaat nicht infrage.
Warum ESG für denMittelstand mehr ist als einModethema –und wie Unternehmenmit klaren Transitionsplänen langfristig profitieren können, erklärtDr. Andreas Wagner,Chief SustainabilityOfficer bei der HypoVereinsbank, im Interview.
DiewirtschaftlichenAussichten sind getrübt, die Zinsen hoch, regulatorische Anforderungen komplex.Trotzdem bleibt Nachhaltigkeitfür den Mittelstand ein zentrales Zukunftsthema.
Dr.Andreas Wagner, ChiefSustainability Officer beider HypoVereinsbank, berät mittelständische Unternehmen zurnachhaltigenTransformation. Im Interview sprichterüberChancen und Hürden aufdem Wegzur Klimaneutralität,überESG als Instrumentder Risikosteuerung und erklärt, warum Digitalisierung und Nachhaltigkeit untrennbar zusammengehören.
Herr Wagner,sind ESG undTransformation derzeitnochein Themafür denMittelstand?
DieEuphorieder Anfangszeitist vielleicht etwasverflogen,aberdie Probleme –vom Klimawandel bis zu geopolitischenVerwerfungen –sindgeblieben.Nachhaltigkeit ist heuteein Teil derUnternehmensführung Wirmüssen deshalb weg von Schlagworten und hin zur sinnvollen In tegration mit messbarenErfolgen
Also ist ESG kein Hype,sondern wirtschaftlich wichtig?
Genau. Weresrichtigeinsetzt, kann sich strategisch besser aufstellen.
Welche ESG-Investitionen sehen Siebei mittelständischen Unternehmenderzeit besondershäufig?
Energieeffizienz ist ein großes Thema, etwa durch Investitionen in Photovoltaik oder Speicherlösungen. Auch Elektromobilität oder modernisierte Produktionsprozesse sind gefragt. Oftgeht es dabeinicht nur um ökologische Ziele, sondern auch um
handfesteKosten- oder Wettbewerbsvorteiledurch nachhaltigeProduktportfolios
Wiestark beeinflusst dieaktuelleZinspolitik das InvestitionsverhaltenIhrer Kunden?
Wirhaben in den letzten eineinhalb Jahren eine große Investitionszurückhaltung gesehen, besondersimMittelstand.Die hohenZinsenwaren einFaktor, aberauchdie geopolitische Lageund einegenerelle Unsicherheit. Jetzt sehen wirwieder mehr Optimismus. DieZuversichtkehrt zurück, unddamit steigt auchdie Investitionsbereitschaft, gerade bei dergrünenTransformation.

»ESG istkeinA dd-on mehr,sondern wird zunehmendals Instrument im Wettbewerb und Risikomanagement verstanden.«
Dr.Andreas Wagner
Er ist ChiefSustainability Officerbei der HypoVereinsbank,Experte fürSustainabilityThemen rund um ESG, CSRD sowie Transformationskredite und berätmittelständische Unternehmen bei der Transformationin Richtung Nachhaltigkeit.
Tr ot zd em sa ge nv iel eUnt er ne hm en, dass ESG-Fi nanzierungen ko mpliziert sind.Werden Mittelständler abgehängt, wenn sie keinen Transitionsplan vorlegen können?
Nein, aber wirBanken sind verpflichtet, auch Nachhaltigkeitsrisiken–zusätzlichzu den klassischen finanziellen Risiken –zu analysieren. Unternehmen, die proaktiv sind und belastbare Plänevorlegen, werden da natürlichbesserbewertet.
Wasgenau interessiert Banken an diesen Plänen?
Zumeinen verfolgen wirselbstein Klimaziel: UnserKreditportfolio soll bis 2050 klimaneutral sein. Dafür brauchen wirKlarheit über den Transformationspfad unserer Kunden.Zum anderengenerierenTransitionspläne wertvolle Daten, nicht nur für uns, sondernauchfür Lieferkettenpartner undKunden.Und siehelfenUnternehmen dabei, Risikenfrühzeitigzuerkennen.
Welche Risikensind das genau? NebenTransitionsrisiken –alsoder Frage, ob einGeschäftsmodelllangfristig tragfähig ist –Spielen physische Risikeneine immergrößere Rolle,alsoExtremwetterereignisse wie Überschwemmungen und Stürme
VieleUnternehmen sagen: „Wir würden ja gern,aber uns fehlendie Daten.“Wie berechtigt ist diese Sorge?
DieDatenlagezuphysischenRisiken oder Energiebedarfenhat sichdeutlichverbessert.Esgibtheute zahlreicheSoftwarelösungen, Branchen-Tools und Unterstützun gd ur ch Ve rbände und IHKs. Fü r kleinereUnternehmen bleibt es natürlich herausfordernd,aberesist machbar.
Gibt es auch Missverständnisse rund um grüne Finanzierungen?
Ja,immer wieder.Zum Beispieldie Sorge, dass nurnochgrüne Projekte finanziert werden oder dassESG-Kriterien verpflichtend sind.Das stimmtabernicht.Als Bank verstehenwir unsals Partner undErmöglicher der Transformation. Wirbegleiten unsereKunden aufihrem Wegzumehr Nachhaltigkeit –durch die Finanzierung grüner Projekte,gezielte Investitionenund eine passgenaue Beratung.Solassensich die Chancen der grünen Transformation nutzen undfür ihre Wettbewerbsfähigkeit setzen
Wasempfehlen SieUnternehmen,die bei ESG und Transformation noch ganz am Anfang stehen?
Ichsage: Es geht doch!Injeder Branche gibt es Beispiele, an denenman sich orientieren kann. Wichtig ist, sich einen guten Finanzierungspartner zu suchen und die Digitalisierungnicht zu vergessen. Denn: Digitalisierung und ESG sind einPower Couple:Wer beides zusammendenkt, wird zukunftsfähig aufgestelltsein.
Informie re nS ie sich üb er die Chance ninitiativeund bewe rb en Siesichf ür eine nTransitionsplan , de rIhr Unte rnehme nnachhaltig voranbring t.

Julius und sein Vater
Titus Dittmann haben die deutsche Skate-Community geprägt und sind ein Teil davon

Titus Dittmann, der Gründer von Titus Skateboards
»Stimmt. Aber das war ein echt harter Slam«
Julius Dittmann, seit 15 Jahren der Geschäftsführer
2025 gehen mehr Firmen pleite als in den Vorjahren. Um ein Haar wäre auch der bekannte Skateboard-Händler Titus aus Münster dabei gewesen. Im Gespräch erzählen der Inhaber Julius Dittmann und sein Vater Titus Dittmann, wie das passiert ist und wie die Rettung aus der Insolvenz gelang
Es gibt wenige Familienunternehmen im Mittelstand, um die so ein Kult entstanden ist, wie um Titus aus Münster. Wer mal eine Zeit lang auf einem Rollbrett unterwegs war, hat von dem Münsteraner Skateboardhändler mindestens gehört, womöglich aber auch bei ihm eingekauft.
Doch dieses Jahr wäre beinahe das letzte des Unternehmens gewesen: Anfang Februar hat es einen Insolvenzantrag gestellt. So wie viele andere Firmen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle hat im zweiten Quartal dieses Jahres die meisten Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften seit 20 Jahren gezählt.
Zu selten gelingt es, die Betriebe zu retten. Umso interessanter ist die Frage, wie manche es doch schaffen – so wie Titus. Können andere Mittelständler daraus lernen?
Julius Dittmann, 42, ist seit 2010 der Chef. Aktuell beschäftigt er in der Zentrale und in 18 Skateshops 140 Menschen – vor der Insolvenz waren es noch 198 Mitarbeiter. Julius Dittmann sagt, für ihn hätten Skateboarding und Unternehmertum viel gemeinsam: »Wer skatet, muss sich auch immer auf neue Umgebungen einstellen, die sich noch dazu verändern.«
Seinem Vater Titus Dittmann, 76, fällt eine andere Analogie ein. Er war einst Sportlehrer, brachte Boards aus den USA am Zoll vorbei nach Deutschland und mit in sein Gymnasium, wo sie gut ankamen. 1978 gründete er das Unternehmen. Er sagt: »Beim Skaten ist es wie im Leben, in der Liebe, im Geschäft: Du lernst, auf die Fresse zu fallen und aufzustehen.«
ZEIT für Unternehmer: Titus und Julius Dittmann, kommen Sie eigentlich dazu, selbst noch Skateboard zu fahren?
Julius Dittmann: Die vergangenen Monate waren wild. Da habe ich es kaum geschafft. Aber mittlerweile stehe ich wieder öfter auf dem Brett, letztens noch bei den Deutschen Skateboard-Meisterschaften.
Titus Dittmann: Ich cruise nur noch, mit so einer alten Slalomtechnik, bei der ich kaum den Fuß vom Board nehmen muss. Zum Beispiel zum Bäcker. Oder mit meinem Enkel im Pumptrack, das ist so eine Auf-und-Ab-Strecke. Der schiebt mich dann den letzten Hügel hoch.
Wenn man Menschen erzählt, man interviewt die Dittmanns, fallen allen sofort Ihre Skateboard-Weltmeisterschaften Monster Masterships ein, die Hilfsprojekte mit Ihrer Hilfsorganisation Skate Aid in Afghanistan, aber auch: Waren die nicht insolvent? Wie passt das zusammen: der Fame auf der einen Seite – und der Fail auf der anderen?
Titus: Den Fame haben wir über Jahrzehnte aufgebaut. Und zwar nicht, weil ich vor mehr als 40 Jahren gesagt habe: ›Ich will der geilste Geschäftsmann sein.‹ Ich bin eigentlich Pädagoge und wollte vor allem, dass die Kids und auch ich Spaß haben. Wir hatten anfangs keine Mitbewerber, während die Nachfrage nach Boards wuchs. Ich konnte also jeden Fehler machen, es kam trotzdem immer mehr Kohle rein. Die habe ich aus Begeisterung in die Szene gesteckt: die Masterships, ein Magazin. Und das war das beste Marketing. Heute ist es viel schwieriger, als Unternehmen in unserem Markt zu bestehen. Deswegen bin ich froh, dass Julius mehr Ahnung von modernen Online- und IT-Prozessen hat als ich.
Wie erklären Sie, dass Sie in die Insolvenz gerutscht sind, Julius?
Julius: Durch Fehlentscheidungen. Und Fehlverhalten.
Welche waren das?
Julius: Wir führten einen neuen Logistikstandort und ein neues Warenwirtschaftssystem ein, das alte war von 1999. Zwei Jahre lang haben wir das Projekt vorbereitet, mithilfe einer IT-Agentur, die haben sich mit dem Projekt wohl ebenfalls übernommen. Und nach der Umstellung gab es keinen Weg zurück.
Was ist genau passiert?
Julius: Im Juni 2024 nahmen wir das neue Programm in Betrieb. Es sollte dafür sorgen, dass jeden Tag genau die Artikel ausgeliefert werden, die unsere Kunden online bestellen, und unsere Skateshops zuverlässig nachbestückt werden. Aber das funktionierte nicht. Das neue System gab falsche Informationen weiter, die Pakete gingen nicht raus. Und so hatten wir ein volles Lager, und die Läden waren leer: In unserem Skateshop in Münster hing kein einziges Einsteigerboard mehr an der Wand, obwohl
wir genug davon hatten. Von einem Monat auf den anderen brach unser Umsatz um die Hälfte ein.
Titus: Für mich war der größte Schock, als du erzählt hast, dass von den Onlinebestellungen nur zehn Prozent ausgeliefert werden konnten. Und dann noch so falsch, dass die Retourenquote höher war als je zuvor.
Julius: Wir hatten viele fehlerhafte Verkäufe. Die Kunden haben bestellt und bezahlt, aber die Ware war gar nicht vorhanden. Die Beschwerden häuften sich, und unser Kundendienst kam nicht mehr hinterher damit, das Geld zu erstatten. Ein riesiger Rückstau. Überall. Und es dauerte Wochen, bis wir die Probleme beheben konnten.
Wie haben die Kunden reagiert?
Julius: Viele waren sauer. Die Kundenbeziehung ist uns ultrawichtig. Auf dem Portal Trustpilot haben uns immer mehr Kunden nur noch einen von fünf Sternen gegeben. Der Durchschnitt ist von 4,6 auf 3,2 gerutscht. Da ist man fast schon in einer Riege mit diesen Betrügershops, die sich nur mit Fake-Bewertungen über Wasser halten. 40 Jahre lang hatten wir die Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut und gepflegt, dann kam dieser Rückschritt. Das tat weh – allen. Wie kommt man da wieder raus?
Julius: Du stehst vor diesem Riesenhaufen Scheiße und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und in genau solchen Momenten begeistert mich unsere Crew immer wieder: Selbst die Programmierer und Einkäufer halfen im Lager, sogar in Nachtschichten, um Bestellungen für unsere Kundinnen und Kunden da draußen zu verpacken. Darauf bin ich megastolz. Wann war klar, dass Sie Insolvenz anmelden müssen?
Julius: Bis zum Dezember 2024 haben wir es noch geschafft. Es ging langsam wieder aufwärts. Aber dann kam der Januar, im Handel der umsatzschwächste Monat. Titus: Es ist der Umtauschmonat. Da kommen die Retouren von Weihnachten zurück. Julius: Und gleichzeitig ist es der Rabattmonat. Du hast viel Arbeit für wenig Umsatz. Ende Januar dieses Jahres saß ich dann mit meinem Co-Geschäftsführer zusammen, und wir wussten: Das Geld reicht bald nicht mehr.
Als 1977 in Deutschland noch kaum jemand Skateboards kannte, rollte Titus Dittmann schon auf einem Brett durch Münster


Mitte der 1980er zeigt das Titus Show Team dem deutschen Publikum im »Aktuellen Sportstudio«, was eine Halfpipe ist
Wenn man einmal zahlungsunfähig ist, muss man »ohne schuldhaftes Zögern« eine Insolvenz beantragen, so steht es im Gesetz. Sonst macht man sich strafbar ... Julius: Genau. Deshalb handelten wir sofort, holten Restrukturierungsprofis an Bord, erarbeiteten einen Sanierungsplan. Ab zum Amtsgericht. So eine Phase fordert einen. Wo am meisten?
Julius: Du musst schnell sein mit dem Sanierungsplan. Zugleich brauchst du genügend Zeit, damit das Ding gut wird. Den Plan reichst du beim Gericht ein. Das entscheidet darüber, ob das Unternehmen in die Sanierung in Eigenverwaltung gehen darf oder voll in eine Regelinsolvenz läuft – dann ist Feierabend.
Titus, wie haben Sie und Ihre Frau Brigitta diese Zeit erlebt? Sie hatten das Unternehmen schließlich aufgebaut.
Titus: Das war hart. Die Marke trägt meinen Namen, auch wenn ich das Unternehmen schon vor 15 Jahren an Julius übergeben habe. Beim Generationswechsel lief es auch zwischen uns beiden nicht immer reibungslos, aber bereits Jahre vor der Insolvenz sind wir als Familie wieder zusammengerückt, das half in dieser Phase.
Julius, das Gericht hat dann eine Insolvenz in Eigenverantwortung angeordnet. Wie hat sich das angefühlt?
Mit drei stand Julius Dittmann erstmals auf dem Skateboard. Seitdem ist es nicht mehr wegzudenken aus seinem Leben
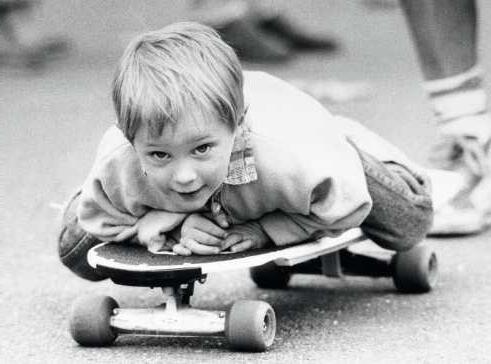
Julius: Es war eine Befreiung. Wir, die gesamte Titus-Crew, bekamen die Chance, das Unternehmen zu retten. Wir kamen aus dem Reagieren raus und konnten endlich wieder aktiv handeln.
Es bleiben dann genau drei Monate, um die Firma zu sanieren ...
Julius: In dieser Zeit übernimmt die Bundesagentur für Arbeit auf Antrag die Lohnkosten. Danach stehst du wieder auf eigenen Beinen. Mit der vollen Last.
Wie haben Sie die Zeit genutzt?
Julius: Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt. Während wir früher viel im Team diskutierten, bis alle mit den Entscheidungen einverstanden waren, wurden wir nun oft sehr schnell. Natürlich kann das verunsichern. Und gleichzeitig ist da dieser Fokus, den man aus Gefahrensituationen kennt: Man ist präsent, nimmt alles um einen herum wahr, ist ganz klar im Kopf.
Titus, hatten Sie den Reflex, sich wieder einzumischen?
Titus: Nein. Gerade in einer solchen Situation musst du als Chef einen klaren Weg vorgeben. Und der ist Julius.
Julius: Das machte ich damals bei der Übergabe im Jahr 2010 zur Bedingung.
Ihre Mutter Brigitta ist hingegen erst mal im Unternehmen geblieben.
Julius: Brigitta hatte seit Jahren die Finanzen geregelt, sie war beim Generationswechsel eine wichtige Konstante. Allerdings ist sie auch vor drei Jahren ausgestiegen. Während der Insolvenz haben Brigitta und Titus uns natürlich unterstützt, wo es ging, selbst bei den Nachtschichten im Lager.
Genau wie viele Freunde. Ich holte alle zusammen, die ich kriegen konnte.
Wie lange hat es gedauert, bis klar war:
Die Firma überlebt?
Julius: Irgendwie war ich die ganze Zeit davon überzeugt, dass wir einen Weg finden. Manchmal fährst du beim Skateboarden an, gehst in den Trick – fällst. Fährst wieder an – fällst. Und wieder ... Und dann kommt der Moment: Du fährst an, gehst in diesen Trick und spürst, dass du den jetzt stehst – obwohl du noch mitten in der Luft bist.
Wie haben Sie das Unternehmen gedreht?
Julius: Die Herausforderungen mit der Warenwirtschaft und Logistik lösten wir Schritt für Schritt – und kommunizierten offen darüber. Viele verschweigen eine Insolvenz. Wir haben auf Transparenz gesetzt. Und auf einmal wurde die Community aktiv, und Unterstützerinnen und Unterstützer meldeten sich: Eine Agentur produzierte Videos für uns. Eine andere half uns, die Skateboard-Einsteiger auf Amazon besser abzuholen. Wir wurden in Bereichen besser, in denen wir innerhalb des Krisenjahres den Anschluss verloren hatten – unabhängig von den Softwareproblemen. Wo war das?
Julius: Jedes Jahr investierten wir eine siebenstellige Summe für Marketing auf Google. Jetzt geben wir weniger aus und bewerben Produkte, die geringe Retourenquoten und stabile Margen haben. Wir umwerben gezielt Kunden, die höchstwahrscheinlich wiederkommen. Und wir holen unsere treuen Bestandskunden viel besser ab.
Das hat schon gereicht?
Julius: Nicht sofort. Im Rahmen der Sanierung in Eigenverwaltung starteten wir den »Distressed M&A«-Prozess – so nennt man das, wenn man Investoren anspricht. Aber im stationären Einzelhandel hat keiner von ihnen eine Chance gesehen, und wir betreiben ja mehrere Skateshops selbst. Zusätzlich steckt der europäische Onlinehandel in der Krise und wächst deutlich langsamer als früher. Am Ende sagten alle ab. Wer hat Titus dann gerettet?
Julius: In letzter Sekunde stellten wir mit viel Kraftaufwand selbst im Familienkreis eine Finanzierung auf die Beine. Mit der Firma 24/7 Distribution übernahmen wir die Marke Titus, die Waren und die Mitarbeitenden.
»Ich habe jetzt ordentliche
Julius Dittmann über seine Finanzierung in letzter Sekunde
Das muss man erklären: 24/7 Distribution ist der Großhändler für SkateboardZubehör und Bekleidung, den Sie mit Anfang 20 gegründet haben, bevor Sie bei Titus eingestiegen sind, und der Ihnen immer noch gehört.
Julius: Genau. Ich habe nach weiterem Geld gesucht, das ich einsetzen kann.
Haben Sie sich auch privat verschuldet?
Julius: Ja. Mit mehreren Gesellschaften. Volles Commitment.
Verraten Sie uns, in welcher Höhe etwa?
Julius: Nein. Aber ich sag mal so: Ich habe jetzt ordentliche Darlehen am Laufen.
Titus: Das ist in der Firmengeschichte ja nicht die erste Krise. Wir waren Anfang der 2000er in einer ähnlichen Situation. Ich
hatte Investoren an Bord geholt, um an die Börse zu gehen. Der Plan ging schief, wir rutschten in die roten Zahlen – und die Investoren wollten ihr Geld zurück.
Wie haben Sie die Pleite abgewendet?
Titus: Damals hätte ich mir eher die Finger abgehackt, als Insolvenz anzumelden. Ich weiß heute, dass das Quatsch ist. Aber so haben meine Frau Brigitta und ich unsere Lebensversicherungen, Immobilien und alles, was wir hatten, zu Geld gemacht, um die Firmenanteile zurückzukaufen. Wir sind also komplett ins Risiko gegangen. Nur Ihre Sammlung alter Autos haben Sie behalten ...
Titus: Es hätte lange gedauert und sich kaum gelohnt, die zu verkaufen. Heute habe ich noch eine kleine Autofirma, mit der ich Oldtimer restauriere und Werte schaffe. Die reichen uns als Altersvorsorge aus.
Hält man so eine Krise beim zweiten Mal besser aus?
Titus: Unbewusst bestimmt. Julius und ich sind ja früher Autorennen gefahren. Da passieren hin und wieder Unfälle. Auch schwere. Wenn du da mit ein paar blauen Flecken heil rauskommst, speicherst du diese Erfahrung ab und hast auch in Zukunft weniger Angst.
Ist das Unternehmen durch die Insolvenz gesünder und stärker geworden?
Titus: Das ist ja immer so: Mit jedem Mal Auf-die-Schnauze-Fallen wirst du stärker. Julius: Stimmt. Aber das war schon echt ein harter Slam. Ein bisschen weniger hätte es für mich auch getan.
Wie geht es Ihnen jetzt nach diesem turbulenten Jahr?
Julius: Ich fühle mich wie in einem Start-up, das sich täglich weiterentwickelt. Die Warenwirtschaft und die Logistik laufen nun rund. Die Trustpilot-Bewertung liegt bei großartigen 4,7 Sternen. Aktuell automatisieren wir immer mehr Prozesse mit KI – so können wir mit unserem kleineren Team volle Leistung bringen. Da ist Bewegung drin. Und Aufbruchstimmung. Gleichzeitig ist der Markt herausfordernd. Wir machen es wie im Skateboarding: dranbleiben.
Die Fragen stellten Nele Justus und Jens Tönnesmann
Die Familie, das Unternehmen und wir. Seit 25 Jahren.

Die Papierfabrik Gmund am Tegernsee produziert jedes Jahr 6.000 Tonnen Papier –mit riesigen Maschinen, von denen eine schon seit 1883 im Einsatz ist
VON NAVINA REUS, FOTOS: FRITZ BECK



1 Eine riesige Papierrolle der Firma, die seit 1829 in Gmund Papier herstellt. Schon damals wurde die Papiermühle durch Wasserkraft angetrieben. Noch heute liefert ein Wasserkraftwerk der Fabrik Strom
2 Ein Mitarbeiter im Leitstand steuert die Produktion, die mehr als 100.000 verschiedene Papiere ausspucken kann, jedes hat eine eigene Rezeptur
3 Die Zutaten: pflanzlicher Zellstoff und Wasser, dazu Bindemittel wie weiße Tonerde, Kreide, Leim. Hier werden sie zu einem Brei vermengt und – je nach Auftrag – gemahlen und gefärbt
4 Im Labor wird erforscht, welche Pflanzenfasern sich für die Papierherstellung eignen

5 Das Familienunternehmen mit 150 Mitarbeitenden beliefert Kunden wie Veuve Clicquot, BMW und Tchibo. Auch die goldenen Umschläge für die Oscarverleihung kamen einige Jahre lang aus Gmund
6 Jede Rolle wird auf einer von zwei Papiermaschinen hergestellt, die sich alle zwei Wochen abwechseln. Diese ist 150 Jahre alt, wurde mehrmals modernisiert und kann pro Sekunde bis zu 100 Meter Papier produzieren
7 Sie rüttelt, walzt und presst das Wasser aus den Fasern und trocknet das Papier bei bis zu 130 Grad Celsius




8 Eine Rolle wiegt am Ende zwischen 200 und 500 Kilogramm
9 Sie wird aber nicht am Stück verkauft, sondern erst zu Bögen geschnitten. Die Schneidemaschine ist mit einem Kamerasystem ausgestattet. Papiere mit einem sichtbaren Fehler sortiert sie direkt aus
10 Papiere mit besonderer Optik kontrolliert eine Mitarbeiterin im sogenannten Papiersaal. Sie blättert die Bögen per Hand durch und schlägt sie vor dem Versand in gewachstes Papier ein, um sie vor Dreck und Feuchtigkeit zu schützen. Rund 75 Prozent seiner Produkte exportiert Gmund ins Ausland


Florian Kohler gehört die Papierfabrik Gmund, die im Tal der Mangfall nahe dem Tegernsee seit 1829 Papier herstellt. Hier beantwortet der 63-Jährige den Fragebogen, der jede Fotostory begleitet. Nur die Frage, was sein Wachstum am meisten begrenzt, lässt er offen. Vielleicht liegt das daran, dass es der Traditionsfirma zuletzt schwergefallen ist, zu wachsen: Weil Zellstoff teurer geworden ist und Kunden in der Wirtschaftskrise zurückhaltend sind, erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2024 laut seiner Bilanz »trotz immenser Anstrengung« weniger Gewinn und Umsatz als 2023 und als erhofft.
Herr Kohler, was macht Ihr Unternehmen?
Wir stellen hochwertiges, nachhaltiges und besonders ästhetisches Papier her. Das verkaufen wir weltweit an Händler und Marken und verarbeiten es auch selbst zu Endprodukten wie Notizbüchern oder Karten. Was ist die größte Herausforderung?
Die Bürokratie der EU macht uns zu schaffen. Ein Beispiel: Die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) verursacht hohe Kosten und einen erheblichen Aufwand, weil wir uns etwa in einem EUInformationssystem registrieren müssen. Wir müssen auch neue Organisationsprozesse schaffen, um Daten über unsere Lieferketten zu sammeln und zu archivieren. Woran wäre Ihr Unternehmen beinahe gescheitert?
Wir betreiben ein Wasserkraftwerk, mit dem wir fast 50 Prozent unseres Strombedarfs decken. Vor drei Jahren wollte der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck die Förderung für solche Anlagen auslaufen lassen. Wäre es so gekommen, hätten wir sie aufgeben und teurere Energie kaufen müssen. Das hätte uns in Existenznot gebracht.

Was an Ihren Produkten finden Sie ästhetisch und was nützlich?
Ästhetik ist nützlich, weil sie Emotionen vermitteln kann.
Die Herstellung von Papier erfordert große Mengen an Holz, Wasser und Energie. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen?
Wir produzieren unser Papier dank unserer eigenen Wasserkraft und zusätzlichem Strom aus regenerativen Quellen besonders umweltfreundlich. Durch eine eigene Ozonreinigungsanlage können wir das Prozesswasser mehrfach wiederverwenden, und wir arbeiten stetig daran, alternative Pflanzenfasern in neues, innovatives Papier zu verwandeln.
Freuen Sie sich über Wettbewerber, oder ärgern Sie sich über sie?
Das sehe ich sportlich: Wettbewerber bewirken, dass man mehr trainiert und besser wird.
Was ist Ihre wichtigste Maschine?
Wir haben zwar einen Maschinenpark, aber am wichtigsten sind die Menschen, die sie bedienen und mit ihnen umzugehen wissen.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in Ihrem Unternehmen?
KI spielt eine große Rolle, wenn auch bisher nur für jeden einzeln. Wenn man heute keine KI nutzt, ist das, als hätte man nach der Erfindung von Google Maps weiter eine Landkarte verwendet. In zwei, drei Jahren hilft sie möglicherweise auch bei Prozessen im Unternehmen.
Welche Entwicklung Ihrer Firma erfüllt Sie mit der größten Genugtuung?
Dass wir – das hört sich jetzt sehr groß an –weltweit die einzige unabhängige und auch die führende Designpapierfirma sind. Wir sind nicht die größte, aber wir kommen ohne externe Investoren aus und haben deswegen die Möglichkeit, Prioritäten selbst zu setzen und über Investitionen selbst zu entscheiden.
Wo machen Sie keine Kompromisse?
Für manche Papiere verwenden wir Pflanzenfasern, die wir mit einer eigenen Technik aus gebrauchten Textilien gewinnen. Eine englische Modemarke hätte uns dafür gerne ihre alte Kleidung verkauft. Die allerdings enthielt Kunststoff – und der kommt nicht auf unsere Papiermaschine.
Was schätzen Sie am Unternehmertum? Es macht Spaß, kreativ zu werden, neue Produkte zu entwickeln und etwas anschieben zu können.
Welche Unternehmerin oder welchen Unternehmer würden Sie gerne mal zum Business-Lunch treffen?
Wenn ich eine Zeitreise machen könnte, dann wäre es Steve Jobs. Ansonsten: Elon Musk.
Elon Musk – trotz allem?
Ja, weil der so sehr für seine Vision brennt. Und man sollte auch mit Menschen sprechen, deren Meinungen man nicht teilt. So entsteht Demokratie und nicht durch Ausgrenzung.
Die Fragen stellte Navina Reus
Er fo lgre ic he Unte rn eh me rh ab en of te in e st rukt urelle He raus fo rd er un g: De rwei taus größte Te il de sVer mö ge ns stec kt im eige ne n Be tr ie b. Wiesie ih rVer mö ge nr ic ht ig st rukt urieren ,w ie sie e in en Ex it rich tigvor be re iten un d we lc he Mö glic hkei te nsic hihn en au ch in eine r zwei te nKar riereals Inve stor bieten ,d ar üb er sp richt Da ni el Sa ue rzap f, Co -H ea dWea lt h Ma na ge me nt bei Ha uc kAuf hä us er La mpe
Die meisten Unternehmer habenihr Vermögen weitgehend im eigenen Unternehmengebunden. Ab welchem Punktwirddas zur strategischen Herausforderung?
Die Frage ist weniger vonder Unternehmensgröße als vielmehr vonder jeweiligen Lebensphase abhängig: Wenn Kinder geboren werden, wenn es Veränderungen in der Familie gibt, wenn das Unternehmen stark wächst. Ab einem gewissen Punkt sollte mandeshalb systematischVermögen außerhalb des Unternehmens aufbauen. Fürdie eigene Lebensplanung, aber auch zur Absicherung. Damit sichHerausforderungen im Unternehmen nichtauf die Familie auswirken.
Wenn Sie die Vermögensstruktur durchleuchten, welche Aspektewerden typischerweise unterschätzt? Erstens die Absicherung der Familie für den Ernstfall. Viele Unternehmer haben keine saubereTrennung zwischenoperativem und privatem Vermögen. Zweitens steuerliche Strukturierungsmöglichkeiten. Die Frage, ob VermögenimBetriebs- oder Privatvermögen gehalten wird, kann erheblicheSummenausmachen. Unddrittens die Nachfolgeplanung, nicht nur im Unternehmen, sondern vermögensrechtlich. Ohne klareRegelungenkönnen im schlimmsten Fall Familienkonflikteoder Pflichtteilsauseinandersetzungen folgen.

Ein Unternehmer erwägt einen Verkauf. Wann lohntsich das erste strategische Gespräch?
Ein gut vorbereiteter Verkaufbraucht erheblichen Vorlauf.Esgeht zunächstum strategische Grundsatzfragen: Ist das Unternehmen verkaufsbereit?Stimmt die Bewertungsbasis?Sind steuerliche Weichenstellungen getroffen? Wie siehtdie Vermögensstruktur nach einem Verkauf aus? Manchestellen in dieser Phase fest, dass ein Verkaufgar nicht dasist, wassie wollen. Wererst kurz voreinem geplanten Verkaufdarübernachdenkt, hat meist Gestaltungsmöglichkeiten verschenkt.
DerVerkauf ist durch. Wasunterscheidet diejenigen, die diese Transition gut meistern, vondenen,die sich schwertun? Die erfolgreichen Akteurehabenmehrere Dinge vorabgeklärt. Dazu gehörteine klareVorstellung davon, wassie künftig tun wollen.Wer 30 Jahreoperativ gearbeitet hat und plötzlich„frei“ ist, brauchteine neue Perspektive. Wollen Sie als Privatier leben?Wieder unternehmerisch tätig werden? Oder sogar alsInvestor agieren? Dazu gehörteine durchdachteVermögensallokation. Und dann wäre da noch die Frage der Struktur: Brauchtesvielleicht ein Family Office? Eine Familiengesellschaft? Wie binde ich die nächste Generation ein? Diese Fragen sollten beantwortet sein, bevordas Geld aufdem Konto liegt

Eingut vorbereiteter Verkauf beginnt deutlich früher,als die meistendenken.

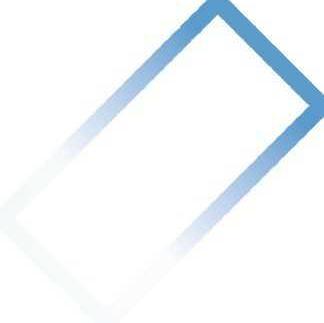

bleibenauchnach einem system aktiv. Wiehäufi Sehr häufig,denn Digitalisierung Cybersecurity sindm Wissen verbunden.Die einen investieren über VentureCapital in disruptiveGeschäftsmodelle, Unternehmenssoftware, neue Technologien. AnderesuchenDirektbeteiligungen, wo sie ihreErfahrungeinbringen können. Wasbeide Wege gemeinsam haben:Sie erfordern eine andere Haltung als das operativeGeschäft. Es geht um langfristige Portfoliostrategien,Diversifikation, realistische Renditeerwartungen.Wer die richtige Struktur dafür schafft,kann seine unternehmerischeErfahrungsehrwertvoll einsetzen.
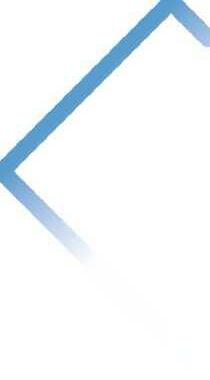

Selbstlernende Maschinen könnten für die deutsche Industrie entscheidend werden, aber viele Firmen zögern. Drei Beispiele zeigen, was schon möglich ist
VON NILS HECK UND LUKAS HOMRICH
Selbst große Einfälle verstecken sich oft hinter einfallslosen Namen. Die Firma Schunk etwa, die wie viele alteingesessene Mittelständler einfach heißt wie seine Inhaber, hat ihre neueste Erfindung nicht »Magic Fingers« oder »Robohand« genannt, sondern schlicht »2D Grasping-Kit«. Das passt zum Understatement des Unternehmens aus Lauffen am Neckar, das mit seinen 3.700 Mitarbeitern eine Vielzahl von Greifern für die Industrie herstellt. Und es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, wie groß die Innovation ist, die sich hinter dem Kit verbirgt. Und warum sie exemplarisch dafür steht, was in der deutschen Industrie abseits des ChatGPT-Hypes geschieht.
Seit mehr als 40 Jahren baut Schunk hochpräzise Greifwerkzeuge, die etwa in Autofabriken, in der Luft- und Raumfahrt und im Maschinenbau anpacken. Sie können klobige Kisten genauso bewegen wie filigrane Pipetten, mal umklammern sie Rohre, mal saugen sie Batterien an. Die Mechanik dafür hat die Firma über Jahrzehnte so präzisiert und Fabrikabschnitte so automatisiert, dass Roboter heute problemlos neben Menschen zupacken können. Aber: »Jetzt erst kommen alle Technologien zusammen, die die nächste
Stufe autonomer Robotik ermöglichen«, sagt Timo Gessmann, Technikchef bei Schunk. Jetzt haben sie die Mechanik, die Daten –und das Gehirn.
Schunk setzt auf eine künstliche Intelligenz, mit der sich Prozesse automatisieren lassen, von denen man früher dachte, Maschinen seien damit überfordert. Lagen auf einem Werkzeugtisch Schrauben oder Kleinteile auch nur einen halben Zentimeter versetzt, waren die Greifer von Schunk überfordert und mussten pausieren, mitunter legten sie die Produktion still. Dann musste ein Techniker die Roboterhand zurücksetzen und neu programmieren.
Heute können die Roboterhände von Schunk die Teile erkennen und greifen –und zwar egal, wie sie liegen. Dafür ist die »Grasping-Kit« genannte Zauberhand mit einem Kamerasystem ausgestattet, das die KI mit Bildern füttert, damit sie den Greifer richtig bewegt. Gessmann sagt, so ließen sich nun erstmals auch Produktionsprozesse automatisieren, die nicht immer gleich ablaufen. Die KI lernt permanent dazu. »Das«, sagt Gessmann, »verändert alles.«
Die deutsche Industrie befindet sich womöglich im größten Umbruch seit der
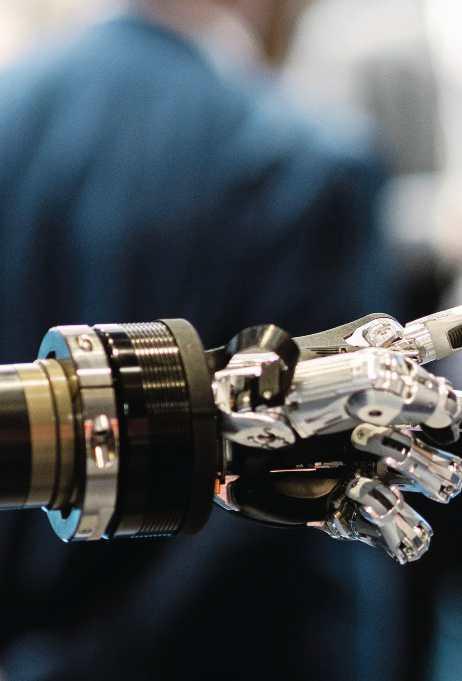
industriellen Revolution. Waren die Greifer und Automaten zunächst Muskelprotze und später Präzisionskünstler, werden sie nun zu mitdenkenden Maschinen. Möglich machen das die enorme Entwicklung ihrer Rechenleistung, ihre Vernetzung und KI. Getrieben wird die Entwicklung von Firmen, die über das Wissen zu den Maschinen verfügen, das anders als bei Sprachmodellen unerlässlich ist, um tatsächlich etwas zu bewegen.
Was also ist heute bei denen schon möglich – und was versprechen sie sich davon, wenn die Kunden nun schlaue Maschinen erhalten?
Timo Gessmann ist ein Tüftler. In seiner Jugend hat er Computer zerlegt und an Gokarts geschraubt, er ist nicht nur gelernter Ingenieur, sondern auch Kraftfahrzeugmeister. Er hat bei Bosch an der Vernetzung von Maschinen geforscht. Vor sechs Jahren wechselte er als Technikchef zum deutlich kleineren Mittelständler Schunk, wo er unter anderem die Digitalisierung verantwortet und eine Mission hat: »Wir wollen es jedem Mittelständler ermöglichen, KI zu nutzen.«
Das klingt edelmütig, zeigt aber vor allem, dass KI der Firma neue Branchen, Märkte und damit auch Kunden erschließt. So Foto: Schunk
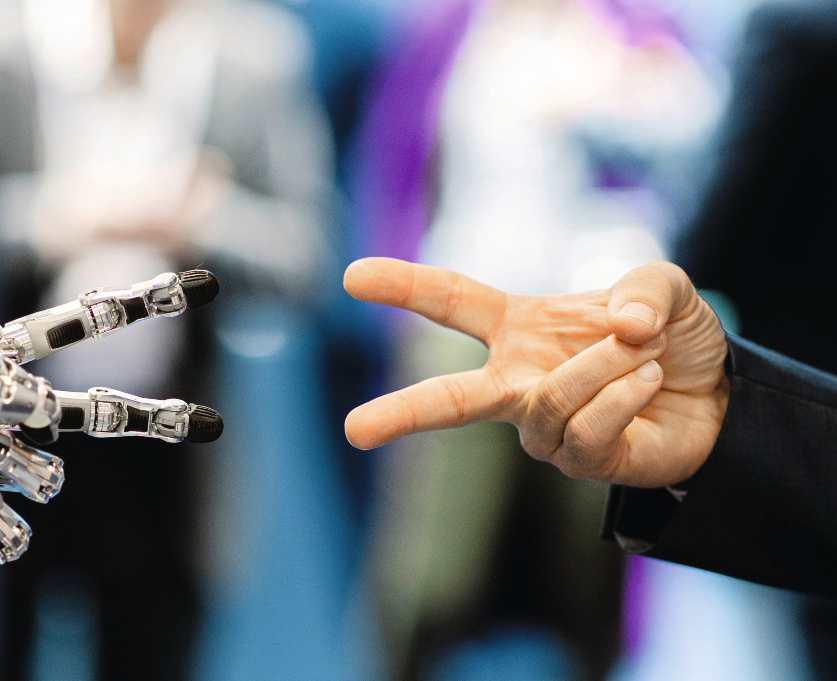
könnten die klugen Roboterhände nun auch in großen Schreinereien zum Einsatz kommen, in denen es für ihre Vorgänger bisher zu chaotisch war, erklärt Gessmann. Für Schunk bedeutet das: mehr Geschäft, mehr Umsatz und damit Wachstum trotz Konjunkturflaute und Handelskriegen. 2024 hat die 80 Jahre alte Firma als Gruppe rund 600 Millionen Euro umgesetzt – deutlich mehr als noch 2015. Damals waren es noch knapp 365 Millionen Euro. Timo Gessmann sagt: »Ohne KI würden wir deutlich weniger Umsatz machen, oder Worst Case: Wir wären gar nicht mehr wettbewerbsfähig.« Auch deshalb forciert er den Ausbau von KI immer weiter. Neben dem klugen Greifer entwickelt Schunk gerade auch eine humanoide Hand, die feinfühlig greifen, drehen und halten kann und beispielsweise eines Tages in Operationssälen eingesetzt werden könnte. »Das gibt es noch nicht, aber das wird es geben.«
Ist der Hype also berechtigt? Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom setzen bereits 42 Prozent der Industrieunternehmen KI ein, ein weiteres Drittel plant das, und 82 Prozent sind sich sogar sicher: KI werde entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sein.
Marco Huber bremst die Erwartungen. Er ist Professor an der Universität Stuttgart und Forschungsleiter für Artificial Intelligence and Machine Vision beim Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Den aktuellen Hype um KI sieht er zwar als großen Treiber: »Wir werden durch KI enorme Effizienzgewinne sehen und das in allen Bereichen der Produktion, angefangen bei der Planung bis hin zur Wartung einer Maschine.«
Dann folgt das Aber: Bisher sei KI gar nicht so weitverbreitet, wie viele denken würden. »Von den rund 30 Prozent der Industrieunternehmen, die KI einsetzen, machen das vielleicht 15 Prozent direkt in Produktionsprozessen und nicht nur in indirekten Bereichen wie dem Marketing«, sagt Huber. Er rät, lieber einzelne Teile wie Greifer, Maschinen oder Prozesse anzugehen, statt direkt auf die autonome Fabrik zu setzen. »Mittelständler sollten gerade zu Beginn keine großen Leuchtturmprojekte fahren, die oft mit einem hohen Risiko verbunden sind«, sagt Huber. Sie sollten lieber realistisch schauen, was sie ganz konkret verbessern können. »Sonst ist der Frust am Ende groß, wenn es doch nicht klappt.«
Wie wäre es mit einer Runde SchnickSchnack-Schnuck mit Kollege Roboter?
Das will Timo Gessmann vermeiden. »Viele Kunden rufen bei uns an und wollen sofort die maximale Ausbaustufe mit allem Drum und Dran«, erzählt er. Sinnvoll sei das nicht immer. Bei Schunk haben sie deshalb sogenannte CoLabs aufgezogen. 15 davon gibt es weltweit, und jedes von ihnen fungiert wie eine Art Robotiklabor, in denen Spezialisten vor jedem Projekt dessen Machbarkeit prüfen. Erst einmal schauen: Welche Technologie ist am sinnvollsten –und braucht es diese KI überhaupt, oder reicht nicht ein kluger Algorithmus?
Torsten Schmitz von Windmöller & Hölscher kennt diese Frage. Die Firma aus Lengerich produziert unter anderem Verpackungsmaschinen und hat ihre neueste Erfindung im Oktober in einer aufwendigen Show auf der Messe Düsseldorf präsentiert. Die wahre Neuerung aber ist auf dem Smartphone von Schmitz zu finden, das er abseits der Bühne zückt. Nach ein paar Klicks ploppt Ruby auf: eine App, über die die Nutzer jederzeit sehen können, wie gut eine Maschine läuft, wo es Probleme gibt und in welcher Schicht sie wie viel Material weiterverarbeitet haben. Seit der Einführung vor drei Jahren haben 500 Nutzer
rund 1.000 Maschinen an den Dienst angebunden. Die Verknüpfung mit den Maschinendaten, die in einer Cloud gespeichert sind, wird seit Neuestem über ein GPTModell von OpenAI und eine Chatfunktion zur Verfügung gestellt. Über sie können Nutzer etwa Auftrags- und Leistungsdaten abfragen. »Das ist der erste Impuls, um Kunden jetzt mal vorsichtig zu zeigen: Guck mal, was möglich ist«, sagt Schmitz.
Der Einsatz des Sprachmodells hat den Nebeneffekt, dass auch deutlich schlechter qualifizierte Mitarbeiter nun mit hochkomplexen Maschinen interagieren können. Eine große Hilfe kann das sein, sagt Michel Börner, Professor für KI in der Produktion an der TH Ulm, denn: »Die KI ist nicht dafür da, Mitarbeitende in die Arbeitslosigkeit wegzurationalisieren.« Das könnte sich die Wirtschaft gar nicht leisten. Denn geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, Jüngere auf Stellensuche wollen oft nicht so einfache, wiederholende Dinge tun. »Deswegen müssen Firmen das Stück für Stück automatisieren«, sagt der Forscher. »Da kann die KI eine große Hilfe sein, weil sie es auch Menschen ermöglicht, sie zu bedienen, sie zu warten oder sogar zu reparieren, die nicht seit Jahren an der Maschine arbeiten.«
Torsten Schmitz weiß, wie sehr es bisher auf Fachwissen ankam: »Unsere Industrie ist dadurch geprägt, dass noch sehr, sehr viel in den Köpfen der Mitarbeitenden passiert.« Die Maschinen von Windmöller & Hölscher mussten Kunden genau so einstellen, dass sie mit ihrem zylinderförmigen Gebläse Granulat auf wundersame Weise in hauchdünne Verpackungsfolie ziehen – wie bei einem aufgeblasenen Kaugummi. Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit: All das mussten Mitarbeiter abschätzen. Von ihrer Erfahrung hing ab, wie gut eine Maschine lief. Das hat sich geändert: Dank Dutzender Sensoren misst die Maschine nun selbstständig, wie hoch die Umgebungstemperatur oder wie feucht die Luft ist. Per Knopfdruck kann sie vollständig im Autopilot laufen und passt eigenständig insgesamt 1.000 Parameter wie Druck, Temperatur und Laufgeschwindigkeit in den Maschinenteilen an. So könne die Maschine deutlich effizienter produzieren, wie Windmöller &
der deutschen Industriefirmen gaben in einer Bitkom-Umfrage an, KI werde entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit
Hölscher auf der Messe in Düsseldorf zeigt. Auslastung ohne Autopilot: 63 Prozent. Auslastung mit Autopilot: 85 Prozent. Profitsteigerung für den Kunden: schätzungsweise 540.000 Euro im Jahr.
Womöglich ist noch mehr drin. Denn Windmöller & Hölscher setzt bei der Maschinensteuerung noch keine KI ein, sondern nur »Realalgorithmen« – also Algorithmen, die sich an Situationen anpassen können. Kommt KI in die Maschinen, dürfte das noch mal viel verändern. Der KI-Professor Börner erklärt das gerne so: »Bisher haben Sie zehn Bäckern denselben Ofen gegeben und es kamen zehn verschiedene Brote heraus, ganz abhängig davon, welche Erfahrung der Bäcker mitgebracht hat.« Die KI aber könne feststellen, welche Parameter relevant sind und dank Sensoren die optimalen Einstellungen vornehmen –und stets das perfekte Brot backen.
Bei Windmöller & Hölscher wollen die Ingenieure in den nächsten Jahren Labordaten der Verpackungsfolien mit den Parametern verknüpfen, mit denen sie hergestellt wurden. Damit soll die KI dann Vorhersagen über die Qualität treffen, die Parameter noch besser einstellen und bei Störungen Fehler sofort erkennen. Vielleicht kommt
die Maschine dann irgendwann auf 100 Prozent Auslastung.
Der Maschinenbauer Körber aus Hamburg ist da schon nah dran. Gestartet ist die Firma einst mit Zigarettenmaschinen, heute stellt die Unternehmensgruppe mit rund 12.000 Beschäftigten auch viele andere Anlagen her und beliefert etwa die Pharmaindustrie mit Maschinen. Diese scannen per Kamera beispielsweise, ob die Impfstoffe in ihren Ampullen rein sind. Sieht etwas komisch aus, sortiert die Maschine sie aus. Und genau das war lange ein Problem.
Denn nicht jeder Fleck auf der Ampulle ist eine Unreinheit, nicht jede Spiegelung ein Lufteinschluss. Manchmal war auch einfach Kondensat auf der Flasche, manchmal stand das Licht schlecht. »Es gab also deutlich mehr Ausschuss, als nötig war, was dann händisch jemand nachkontrollieren musste«, erklärt Kevin Hillmann, Chef des Business-Developments bei Körbers Pharmasparte. »Ein mühsamer und langwieriger Job, der dazu noch sehr teuer ist.«
Um diese Arbeit zu beschleunigen, haben sie bei Körber 2019 begonnen, eine KI zu entwickeln, die den Inspektionsprozess weiter optimiert. Während die Hightech-Maschinen inzwischen bis zu tausend Ampullen je Minute scannen und analysieren, übernimmt die KI die bisher aufwendige Nachkontrolle mit enormer Präzision. »Die fehlerhafte Ausschussrate können wir so um bis zu 90 Prozent senken«, beteuert Hillmann. »Das spart mitunter Millionen und ist auch noch sehr nachhaltig, weil Kunden weniger wegschmeißen müssen.«
Von der Einführung der KI verspricht sich Körber zum einen mehr Umsatz. 2024 lag der bei rund drei Milliarden Euro, fast eine Milliarde Euro mehr als 2019. Zum anderen will der Konzern seine Kunden so an sich binden. Dafür wirbt er mit schneller und günstiger Nachrüstung bei bestehenden Maschinen, auch denen der Konkurrenz. Im Prinzip braucht es nur ein paar ExtraKameras und einen Computer, auf dem Körber die KI trainiert, validiert und laufen lässt. Wie lange es dauert, eine Fabrik so nachzurüsten? »Ein paar Wochen«, sagt Hillmann. Zumindest diesen Job müssen schließlich Menschen übernehmen.
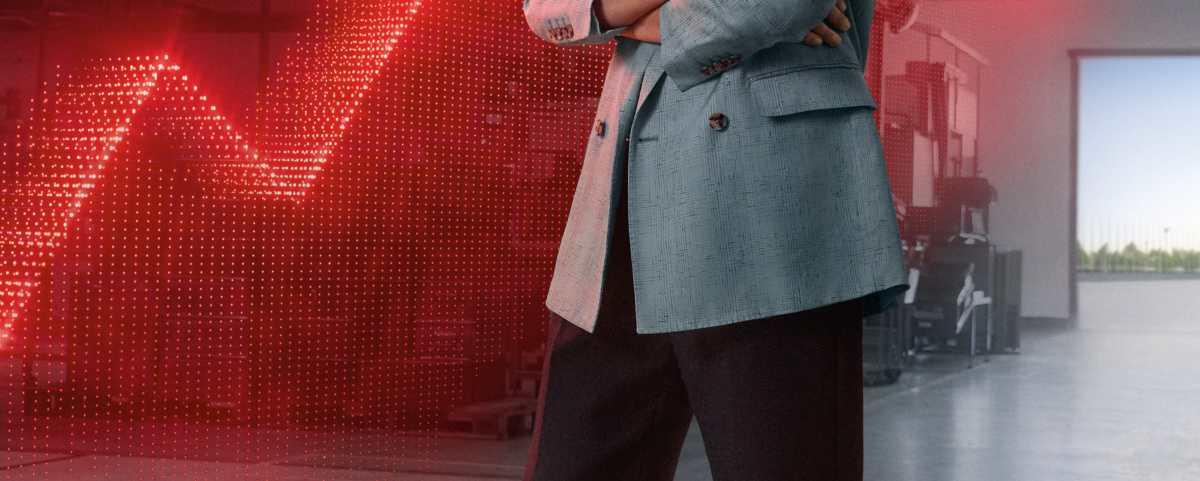


DieMärkteändern sich .I hr Un te rnehme n bleibt stark.
Mitder SparkasseanIhrer SeitesindSie fürkommende Herausforderungen bestensaufgestellt:jederzeit und überall. sparkasse.de/unternehmen
Weil’s um mehr alsGeldgeht.
Anforderungskataloge sind wie Platinen: so komplex, dass man sie nicht sofort versteht

übersehen
Selbst große Firmen wie KSB kämpfen mit kleinen Fehlern im Papierkram. Nun könnte KI die Wende bringen
VON JAN SCHULTE
Manchmal reicht ein einziges Wort, um eine Kalkulation ins Chaos zu stürzen. Oder besser gesagt: Manchmal reicht es, ein solches Wort erst mal zu übersehen.
Guillaume Tréfeu vom Pumpenhersteller KSB kann sich noch genau an eine solche Geschichte erinnern. Es ging um ein Speisewasser-Pumpenaggregat mit Turbinenantrieb für ein Kraftwerk. Pumpenaggregate gehören zum Spezialgebiet des Unternehmens mit einem Jahresumsatz von rund drei Milliarden Euro. Der Kunde, ein Kraftwerksbauer, war zudem einer, mit dem KSB schon zusammengearbeitet hatte. Das sollte also irgendwie machbar sein, auch wenn es dazu eine Sonderanfertigung brauchte. So was produziert man schließlich nicht von der Stange. Und so setzte sich der Vertriebsingenieur aus der Angebotsabteilung für konventionelle Kraftwerke an seinen Schreibtisch und ging die technischen Spezifikationen durch: 30 Dateien, rund 1.200 Seiten. Tréfeu setzte Haken an Haken und machte dem Kraftwerksbauer ein Angebot. Nicht alles kommt bei einem solchen System von KSB selbst. Die Turbine etwa bestellt die Firma bei einem anderen Unternehmen und integriert sie in sein System, auch diese Kosten musste Tréfeu einkalkulieren. Der Kraftwerksbauer war einverstanden, der Auftrag stand. Was Tréfeu aber überlesen hatte: Nicht nur die Pumpe sollte, wie beim letzten Mal, so konzipiert sein, dass sie automatisch aus der Leitzentrale gestartet werden kann – sondern das ganze Aggregat. »Als uns das auffiel, mussten wir unsere Turbinenbestellung ändern und eine teurere nehmen«, sagt er. »Das hat richtig wehgetan.«
Acht Jahre ist der Fall nun her. Doch er beschreibt ein Problem, mit dem sich so mancher Maschinenbauer herumschlagen muss, der Spezialanfertigungen macht: Sobald die Kollegen in der Angebotsabteilung ein entscheidendes Detail übersehen, kann sich ein vermeintlich lohnendes Geschäft in ein schlechtes verwandeln.
Diese Gefahr ist groß, erst recht in dem Markt, in dem KSB sich bewegt. Einerseits beobachtet die Firma, dass Kunden immer speziellere Wünsche haben. Andererseits müssen Angebote schnell raus, bevor die Konkurrenz den Auftrag wegschnappt. Was
Vermögensverwaltung,Fonds &ETFs
DJE – Zins &Dividende:
Unser Investmentfonds für regelmäßige Erträge
dje.de/de/zins-dividende

Dies isteine Marketing-Anzeige. Bittelesen Sieden Verkaufsprospektdes betreffenden Fonds und das PRIIPs-KID,bevor Sieeine endgültigeAnlageentscheidung treffen. Darin sind auch dieausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlosauf www.dje.de unterdem betreffendenFonds abgerufenwerden. Eine Zusammenfassungder Anlegerrechte kann in deutscher Sprachekostenlos in elektronischer Form auf der Webseiteunter www.dje.de/de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich IhrerInformation,können sich jederzeitändern und stellen keineAnlageberatungodersonstigeEmpfehlung dar. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantierenkeinen Anlageerfolg
ein Fehler kostet? Dazu macht das Unternehmen keine Angaben, das sei von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Und doch hatten sie am Sitz von KSB in Frankenthal die Idee, sich von künstlicher Intelligenz helfen zu lassen, um weitere Fehler zu vermeiden.
Stephan Bross, der Technikchef der Firma, fand den Plan gut. Er hatte 2017 eine Digitalstrategie erdacht, als das »Internet der Dinge« in aller Munde war, in dem alle Maschinen vernetzt sind. Für den Unternehmer ist klar: »Man kommt heutzutage um das Thema KI nicht mehr herum.«
Als er seine Karriere bei KSB vor mehr als 30 Jahren als Entwicklungsingenieur begonnen hat, war er noch einer von 2.400 Mitarbeitern – heute hören mehr als 15.000 auf ihn und seine drei Kollegen in der Chefetage. Und die haben große Pläne: Bis 2030 solle der Umsatz um ein Drittel auf mehr als vier Milliarden Euro und die Rendite von acht auf zehn Prozent steigen, sagt Bross. »Eine KI muss daher unsere Abläufe effizienter machen und helfen, unsere strategischen und operativen Ziele zu erreichen.« Und weil er die Kompetenz von KSB im Pumpen- und Armaturenbau sieht, sollen seine Leute die KI nicht selbst entwickeln, sondern einkaufen. Aber bitte nur eine, die wirklich nutzt.
Für Guillaume Tréfeu bedeutete das: Finde eine KI, die messbare Erfolge bringt und nicht nur Geld verschlingt. Der 42-Jährige leitet inzwischen die Abteilung Lean Process Governance und ist damit irgendwas zwischen Coach und Prozessoptimierer. Und Tréfeu ist fündig geworden: bei einem Programm namens Drim, kurz für »Digitalized Requirements and Interface Management«. Mit ihm soll die Arbeit folgendermaßen laufen: Die Kollegen in der Angebotsabteilung gehen wie bisher die Anfragen durch und markieren, was kritisch sein könnte. Die KI merkt sich das. Dann wird sie auf neue Anfragen losgelassen: Entdeckt sie dort eine Spezifikation, die zu einem ähnlichen Risiko führen würde, warnt sie. Je mehr Daten sie erhält, umso mehr lernt sie, und desto besser kann sie Angebote entwerfen und Mitarbeiter entlasten. Eines betont Tréfeu dabei: Die KI soll den Beschäftigten nutzen und sie nicht ersetzen. Entscheiden müsse am Ende immer noch ein Mensch.
Entwickelt wird Drim vom Münchner Start-up Drimco. Dessen drei Gründer heißen Pankaj Gupta, Costin Cozan und Bernt Andrassy; sie sind Informatiker und Ingenieure. Zwei der drei haben lange bei Siemens gearbeitet, wo die Idee zu Drim auch entstanden ist. Für seine Technologie setzt das Trio auf 22 KI-Agenten: Programme, die selbstständig Aufgaben ausführen, anstatt nur Befehle abzuarbeiten. Wenn diese Agenten Anfragen wie die von KSB-Kunden prüfen, fahnden sie nach verschiedenen Risiken: Ist das technisch überhaupt machbar? Würden die Produktionskosten steigen? Die KI entwickelt sich dabei passend zu den
Als Drim noch zu Siemens gehörte, hat auch Guillaume Tréfeu erstmals davon erfahren. Jetzt ist er dabei, die Soft ware bei KSB zu integrieren. Am Anfang hätten sie dabei Fehler gemacht, räumt Tréfeu ein. Um die 60 Lizenzen bestellten sie 2024. Was es nicht gab: eine richtige Begleitung der Kollegen, wie sie die KI einsetzen sollen. Auch die Führungskräfte waren nicht gut genug gebrieft: »Die muss man unbedingt an Bord haben, sie müssen die Kollegen bestärken und befähigen, sonst fehlt die Grundlage für die nachhaltige Veränderung«, sagt Tréfeu.
100
Millionen Anfragen hat das KI-Start-up Drimco bislang analysiert. Mit jeder einzelnen werden die KI-Agenten schlauer
Bedürfnissen ihres Anwenders weiter –wenn sie richtig gefüttert wird. Bisher schielen die Gründer vor allem auf große Unternehmen wie KSB als Kunden. Gupta ist der KI-Experte im Team. »Künstliche Intelligenz wird die industrielle Fertigung durch intelligente Orchestrierung transformieren – sie verbindet Fachwissen, Prozesse und Menschen, um Ineffizienzen zu beseitigen«, sagt er. Sein Mitgründer Andrassy übersetzt das so: »Unser Tool kommt überall dort zum Einsatz, wo komplexe Produkte hergestellt werden.« Etwa bei Automobilzulieferern oder im Energie- und Maschinenbausektor. Mitte des Jahres sammelte Drimco rund 4,3 Millionen Euro ein. Unter den Geldgebern war auch Siemens.
Bei den Mitarbeitern entstand zudem eine falsche Erwartungshaltung: »Alle dachten, sie könnten nun schneller arbeiten und so mehr Anfragen annehmen, aber so schnell zeigten sich natürlich keine Ergebnisse.« Von den 60 Kollegen verwendeten laut Tréfeu daher nur noch 20 die KI regelmäßig. Ein ärgerlicher Rückschlag für das Projekt, der auch erst mal den Technikchef Bross irritiert habe, erinnert sich Tréfeu.
Aber Tréfeu hat aufgeholt. Inzwischen nutzen tatsächlich 60 Mitarbeiter Drim und füttern es mit Daten. Die KI lernt nun mit, wenn Mitarbeiter Anfragen von Kunden durchgehen und Risiken markieren. Sie kann die zahlreichen Wünsche der Kunden in Themenfelder unterteilen, sie mit Standardangeboten abgleichen und erste kritische Punkte anzeigen. Wie treffsicher sie dabei ist, müssen sie bei KSB noch ermitteln. Und Tréfeu hat noch eine Idee: Pro Angebotsteam soll es einen »Key-User« geben. Der bekommt noch mal eine besondere Schulung, ist regelmäßig mit Drimco im Austausch und spricht mit dessen Entwicklern über mögliche Verbesserungen der KI.
In Deutschland, Spanien und den USA ist Drim laut Tréfeu nun im Einsatz und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass den Kollegen eine wichtige Spezifikation entgeht. Er hofft, dass als Nächstes Kollegen in China und Indien mitmachen. »Solch eine KI einzuführen, bedeutet auch immer einen kulturellen Wandel mit vielen Lernschleifen«, sagt er und dämpft die Erwartungen: Für 200 Mitarbeiter komme Drim infrage – und wenn in ein paar Jahren 100 von ihnen die KI »mit echtem Mehrwert« für die Kunden einsetzen würden, sei das ein Erfolg.




Energieerzeugung,Speicherung,L adeinfrastruktur oder derAusbau
IhrerE-Flotte: Wirfördern Ideen, dieSie aufdem Wegzumehr Nachhaltigkeit im Mittelst andvoranbringen.
Fragen SieIhreHausbanknacheiner NRW.BANK-Förderung.






Auf dieser Doppelseite schauen wir in jeder Ausgabe aufs Kleingedruckte. In Folge 10 unseres Klimachecks blicken wir auf die Schwartauer Werke und analysieren, was bei der Herstellung von Marmelade und Schokoriegeln die Emissionen nach oben treibt
VON KRISTINA LÄSKER
Das Unternehmen: Schwartauer Werke GmbH & Co. KG, kurz: Schwartau, aus Bad Schwartau bei Lübeck
Direkter CO₂-Ausstoß im Jahr 2024, der sogenannte Scope 1: 10.492 Tonnen
Indirekter CO₂-Ausstoß aus eingekaufter Energie, Scope 2, marktbasiert: 0 Tonnen
Indirekter CO₂-Ausstoß von Zulieferern, Dienstleistern und Kunden, Scope 3: 163.409 Tonnen
CO₂-Ausstoß insgesamt: 173.901 Tonnen
Quelle: Nachhaltigkeitsberichte 2023 und 2024
Klimaziele:
Die Schwartauer Werke haben sich 2023 verpflichtet, im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu handeln. So sei »eine neue Dringlichkeit entstanden«, sagt die Nachhaltigkeitsmanagerin Julia Schäfer. »Seit 2023 geht es nicht mehr darum, wie sehr wir uns engagieren möchten für den Klimaschutz. Es geht darum, wie sehr wir uns engagieren müssen«, sagt die 39-jährige Betriebswirtin. Konkret heißt das: Schwartau will seine direkten und indirekten Ausstöße von Treibhausgasen (Scopes 1 und 2) bis 2030 gegenüber 2019 um 46 Prozent und bis 2050 um 90 Prozent reduzieren. Der indirekte Ausstoß durch Lieferanten und Kunden (Scope 3) soll bis 2030 um 28 Prozent und bis 2050 um 90 Prozent sinken. Die Science Based Targets Initiative hat diese Ziele validiert und
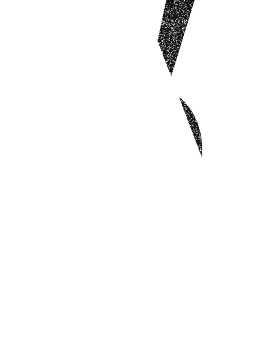

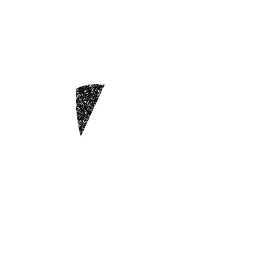
Schwartau bestätigt, dass sie mit dem Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens übereinstimmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. So steht es auch im Nachhaltigkeitsbericht, den das Unternehmen bereits seit 2014 erstellt – freiwillig. Damit und mit der Zertifizierung von außen gehört es zu den Pionieren der Lebensmittelbranche. »Wir haben die Nase im Vergleich zu anderen Mittelständlern sehr weit vorn«, sagt Schäfer.
Eigentümer und Produkte:
Im Juli 1899 gründeten die Brüder Otto und Paul Fromm die Chemische Fabrik Schwartau, aus der später die Schwartauer Werke wurden. Anfangs stellten sie Fußboden-Öl und Bohnerwachs her, 1912 brachten sie eine Konfitüre in einer Blechdose auf den Markt. In den 1960er-Jahren erbte Ursula Oetker, die Enkelin des Puddingkonzern-Gründers August Oetker, den Betrieb. Ihr Sohn Arend Oetker führte ihn bis 1985.
Heute ist Schwartau mit Marken wie Schwartau Extra, Schwartau Samt, Mövenpick und Corny der deutsche Marktführer für Marmelade und Müsliriegel. Das Unternehmen ist Teil der Schweizer Hero-Gruppe, die der Familie Oetker gehört. 2024 hat die Firma in den drei Werken 800 Millionen Riegel, 95 Millionen Gläser Marmelade und 17.000 Tonnen Sirup produziert. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent, die Absätze des Corny-Riegels treiben das Wachstum. Die Firma sei profitabel, sagt Markus KohrsLichte, 52, der sie und 1.100 Mitarbeiter führt.
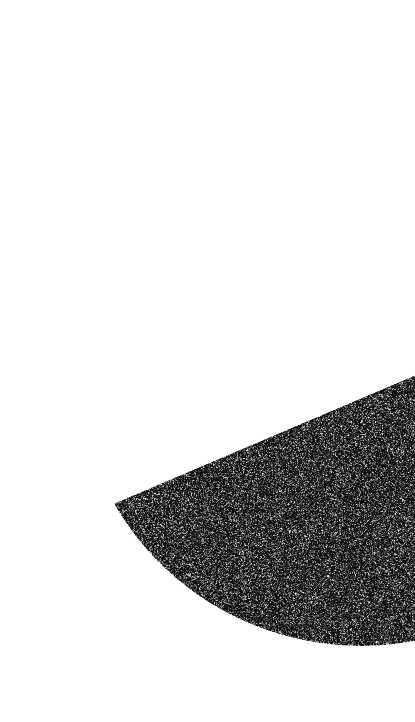
Was gab den Anstoß zu mehr Klimaschutz?
Seit 2001 lässt Schwartau den eigenen Umgang mit Wasser, Abfall und Energie extern zertifizieren. 2013 hätten die zwei dafür verantwortlichen Kollegen dann angeregt, auch die internen und externen Treibhausgas-Ausstöße zu erheben und zu bewerten, erzählt Julia Schäfer. Und sie hätten die Geschäftsführer

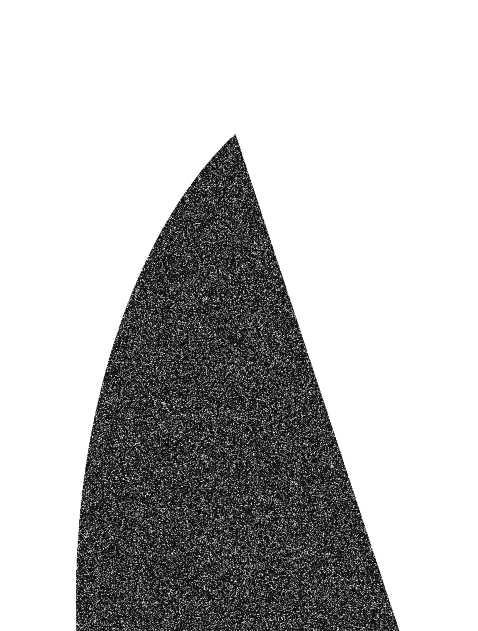




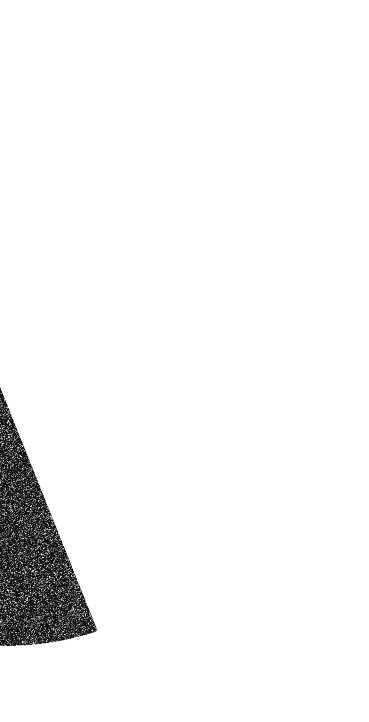
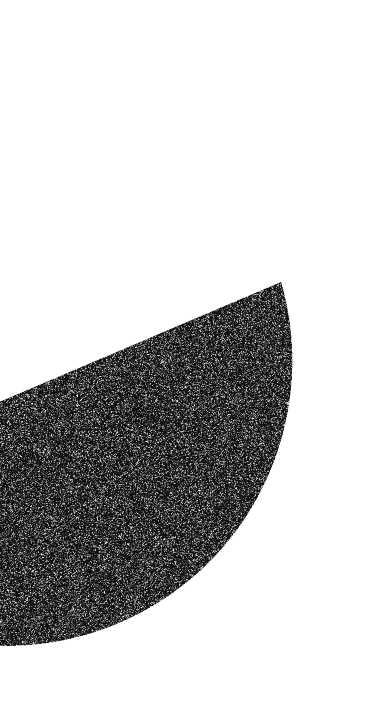
und die Familie Oetker davon überzeugt, ein Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen. »Das ist von innen heraus entstanden«, sagt sie. Markus Kohrs-Lichte erzählt, dass bei seinem Einstand 2023 auf seinem Schreibtisch neben Erdbeermarmelade und einem Schoko-Müsliriegel der Nachhaltigkeitsbericht gelegen habe. Das war als Ansage gemeint: »Ich spüre bei den Eignern ein ehrliches Interesse an Klimaprojekten«, sagt er.
Was schadet dem Klima am meisten?

Seit 2021 ist der Ausstoß von Scope 2 auf null, denn Schwartau kauft nur noch grünen Strom ein. Knapp sechs Prozent aller Emissionen entstehen in Scope 1. Der Grund: In den Werken werden etliche Anlagen noch mit Gas betrieben, das werde erst nach und nach umgestellt, sagt Julia Schäfer. »Wir brauchen viel Wärme in der Produktion.« Etwa beim Aufkochen von Marmelade oder beim Schmelzen von Schokolade. Gut 94 Prozent des gesamten CO₂Fußabdrucks entstehen extern (Scope 3). Der Großteil stammt aus gekauften Rohwaren, meist Lebensmittel und Verpackungsmaterial. Nur ein kleiner Teil wird durch Transporte verursacht. Schwartau setzt den Fokus bei der Reduktion auf die drei größten Treiber von Emissionen: zugekaufte Schokolade, Glas und Metalldeckel.

Was sind die wichtigsten Maßnahmen?
Schwartau will mehr Geld verdienen und trotzdem weniger CO₂ erzeugen, kein leichter Job. Deswegen bewertet der Mittelständler neue Projekte mit einem hypothetischen CO₂-Preis: Für jede Investition muss berechnet werden, wie viele Emissionen sie verursachen und was diese Verschmutzung kosten würde. »Das ist ein wichtiges Kriterium für Entscheidungen geworden«, sagt der Firmenchef Kohrs-Lichte. Bei Neubauten etwa wird viel Wert auf
Klimaschutz gelegt: Gerade errichtet Schwartau eine neue Produktionslinie für Müsliriegel – die größte Einzelinvestition seit der Gründung. Die Anlage allein kostet etwa 25 Millionen Euro, zudem fließen 20 Millionen in die Sanierung, etwa zur Wärmedämmung. Beim Umbau zum klimafreundlichen Betrieb leisten die Einkäufer einen der heikelsten Jobs: Damit die Scope3-Emissionen sinken, führen sie intensive Gespräche mit den 6.000 Lieferanten. Sie fragen nach grüneren Rohwaren und Zusatzkosten – und sie fordern Beiträge zum Klimaschutz ein. Man wolle Lieferanten »in die richtige Richtung schieben«, sagt Schäfer. Es klingt sanft, klar ist auch: Wer nicht mitmacht, könnte mittelfristig den Auftrag verlieren.
Was kostet es?
Klare Prioritätensetzung: Man müsse die größten Treiber zuerst angehen, sagt Julia Schäfer. Etwa erst das Gas für die Anlagen durch Grünstrom ersetzen und später die Flotte elektrifizieren.
Kaum Geld zurück: Kunden seien kaum bereit, mehr für klimafreundlichere Produkte zu zahlen, sagt KohrsLichte. Man bleibe also oft auf den Investitionen sitzen. Wie hoch die insgesamt sind, erhebt Schwartau nicht.
Was bringt es?
Preise: Im April gewann Schwartau den Corporate-SocialResponsibility-Preis der Bundesregierung in der Kategorie »Wirkungsvoller Schutz des Klimas und der Biodiversität«. Glaubwürdigkeit: Der Nachhaltigkeits-Bewerter Ecovadis hat Schwartau auf »Silber« hochgestuft, damit zählt die Firma zu den »Top acht Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen«.
Lob: Auf kununu.de bewerten Beschäftigte das Umweltbewusstsein als überdurchschnittlich positiv. »Die Schwartauer Werke arbeiten hart an diesem Thema«, schreibt ein Mitarbeiter.
Illustration: Pia Bublies für ZEIT für Unternehmer
Houssam Ammar wurde vom Lehrling zum Chef eines Logistikunternehmens, das kurz vor dem Aus stand. Heute organisiert er Transporte nach Syrien. Zu Besuch bei einem Unternehmer, der sich mit Krisengebieten auskennt VON ANNA-THERESA BACHMANN

Es ist kurz nach acht Uhr an diesem Dienstagmorgen Ende September, als Houssam Ammar die Tür von Roland Logistik aufschließt. Der Arbeitstag des Geschäftsführers hat da längst begonnen. Ammar schaut auf das Display seines Handys. »Vor einer Stunde kamen die ersten WhatsApp-Nachrichten«, sagt er. In seiner Stimme schwingt eine Mischung aus Routine und Aufbruch: Die ersten von insgesamt 200 Lkw-Ladungen mit Komponenten für eine Zementfabrik sollen an diesem Tag auf den Weg gebracht werden – von Österreich über die Alpen bis nach Italien und von dort verpackt in Containern weiter über das Mittelmeer bis nach Libyen.
Im Laufe des Tages wird das Handy des 42-Jährigen deswegen immer wieder klingeln. Sprachnachrichten, Rückrufe, neue Fotos von der Fracht. Wenn Ammar antwortet, ist er gedanklich immer dort, wo gerade etwas passiert. Als würde er die Lastwagen direkt vor sich sehen.
Rund 2.200 Kilometer trennen das nordafrikanische Empfängerland vom Firmensitz im niedersächsischen Delmenhorst. Von hier aus behält Ammar den Überblick –und vermittelt, wenn etwas hakt. »Die Fahrer waren zunächst an der falschen Halle in Peggau«, sagt er. Er hat ihnen noch einmal den richtigen Standort geschickt. Nun sind sie auf dem Weg dorthin. »Jetzt sollte nicht noch mehr Zeit verloren gehen.«
Für Roland Logistik ist es ein großer Auftrag – aber kein ungewöhnlicher. Ob Libyen, Iran oder Syrien: Ammars Firma ist auf Nordafrika und den Nahen Osten spezialisiert. Und auf all die Herausforderungen, die Transporte in eine von Krisen geprägte Weltregion mit sich bringen.
Viertel nach acht: Ammar läuft den Flur entlang, der zu seinem Büro führt. Auf dem Weg nickt er den Angestellten zu, die schon an ihren Schreibtischen sitzen und auf ihren Tastaturen tippen. Einer erzählt dem Chef aufgeregt von Panzern entlang der Grenzregion. Gemeint ist allerdings kein Konfliktgebiet im Nahen Osten. Sondern das Baltikum, gleich an der russischen und belarussischen Grenze, wo der Mitarbeiter jüngst seinen Urlaub verbracht hat.
Acht von zehn Roland-Angestellten haben wie Ammar eine Migrationsgeschichte.
Sie sprechen Englisch, Farsi, Kurdisch, Französisch, Spanisch. Auch ein Bruder von Ammar und seine aus dem Iran stammende Ehefrau gehören zur Belegschaft.
Ammar und sein Team kennen den Nahen Osten mit seinen Problemen. Als er drei Jahre alt war, floh seine Familie vor dem Bürgerkrieg aus dem Libanon nach Deutschland. Angekommen in Niedersachsen, belud sein Vater Lastwagen, Ammar besuchte ihn ab und zu bei der Arbeit. »Ich fand das spannend – das Verfrachten der Ware, die Anmeldung im Hafen«, erinnert er sich.
Also bewarb er sich 2001 für einen Ausbildungsplatz zum Speditionskaufmann bei Roland – dem Unternehmen, das er später übernehmen sollte und das in den 1970erJahren in Bremen gegründet worden und später nach Delmenhorst umgezogen war. Ins Bewerbungsgespräch sei er »total unvorbereitet« gegangen, erzählt er. Er hatte sich noch nicht einmal die mehrsprachige Website der Firma angeschaut. Deswegen hätten ihn die Fragen des damaligen Firmenchefs Günter Schulz über Ammars Arabischkenntnisse und den Islam überrascht. Bis heute spricht Ammar mit spürbarer Dankbarkeit über seinen ersten Chef, der ihm trotz alledem eine Chance gab.
Um 9.30 Uhr haben die Lastwagen in Peggau endlich die richtige Halle erreicht –die Beladung beginnt. Ammar nimmt eine Sprachnachricht auf, gibt Anweisungen zum
Ausfüllen des Frachtbriefs. »Von A nach B transportieren, das kann jede Spedition. Aber was ist mit dem Danach?«, sagt Ammar. 22 Länder gehören zur Arabischen Liga, jedes hat eigene Vorschriften, von der Hafenabwicklung bis zur Verzollung. Hinzu kommen unterschiedliche Mentalitäten, für die andere Firmen, die dort Geschäfte machen wollen, oft wenig Gespür haben. Zu Ammars Job gehöre deswegen immer auch die kulturelle Übersetzung, sagt er.
In nicht wenigen Ländern im Nahen Osten ist die politische Lage angespannt. Deshalb bietet Roland die Begleitung der Ware nicht nur bis zum Hafen, sondern bis zum Zielort an, wenn nötig, mit Sicherheitspersonal vor Ort. Etwa in Libyen, wo das Unternehmen weiterhin aktiv ist. Das Land ist derzeit gespalten – zwischen der international anerkannten Regierung im Westen und der Verwaltung des De-facto-Machthabers Chalifa Haftar im Osten.
Wer Ammar einen Tag lang bei der Arbeit zusieht, der merkt: Er ist jemand, der Probleme direkt angeht. Jemand, der gut Beziehungen aufbauen und vertiefen kann. Und jemand, dem andere etwas zutrauen.
Als sein alter Chef Ammar Anfang der 2000er-Jahre fragte, ob er lieber am Schreibtisch sitzen oder Karriere machen wolle, überlegte Ammar nicht lange – und fand sich mit 21 Jahren in Libyen wieder, wo er das Nordafrika-Geschäft weiter aufbauen sollte. Libyen näherte sich damals unter dem Langzeitdiktator Muammar al-Gaddafi dem Westen an, die USA und die EU hoben viele Sanktionen auf. Zahlreiche internationale Firmen – auch deutsche – versuchten nun, im rohstoffreichen Land Fuß zu fassen.
Ammar knüpfte schnell Kontakte und eignete sich den libysch-arabischen Dialekt an. Der gute Ruf deutscher Produkte half ihm dabei ebenso wie seine Doppelrolle als Handels- und Kulturvermittler. »Dass ich typisch deutsch zehn Minuten vor dem Termin da war, obwohl mein Gesprächspartner vielleicht erst zwei Stunden später erschien, kam gut an«, erinnert sich Ammar. Eine seiner wichtigsten Lektionen: Bloß nicht gleich übers Geschäft sprechen – besser erst einmal bei einer Tasse Tee ein Gespür für den Menschen auf der anderen Seite entwickeln.
Doch mit dem Arabischen Frühling änderte sich die Lage in Libyen und in anderen Ländern der Region. Fast gleichzeitig verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Europa und Russland, wo Roland damals einen Großteil seines Geschäfts machte. So geriet die Firma nach dem Tod von Gründer Schulz immer mehr in Schieflage – und musste 2014 Insolvenz anmelden.
Houssam Ammar sprang ein: Er übernahm die Firma für 75.000 Euro. Mit einem verkleinerten Team und dem neuen Hauptfokus auf Nahost gelang dem ehemaligen Lehrling der Neustart. Berichte aus der Lokalzeitung, die mit »Rolands Retter« und »Rolands Rote Zahlen sind passé« überschrieben sind, zeugen von diesem Moment. Heute hängen sie wie Trophäen an den Wänden im Empfangs- und Besprechungsraum des Betriebs.
Über die Jahre hat Roland viel Erfahrung im Umgang mit Ländern wie dem Iran oder dem Irak gesammelt, wo Konflikte, Kriege und Sanktionen zum Tagesgeschäft gehören. 2011 war Ammar selbst dabei, als bei der Auslieferung von Krankenhausequipment von Deutschland bis ins irakische Nadschaf Geschosse über den Köpfen des Teams abgefeuert wurden. »Ich bin ein Kind des Krieges«, sagt Ammar. An solch brenzlige Situationen sei er gewöhnt. Und doch begegne er ihnen mit Respekt.
Wie schnell sich Lagen vor Ort ändern können, hat Syrien bewiesen. Vor knapp einem Jahr, am 8. Dezember 2024, fiel die jahrzehntelange Assad-Diktatur. Neun Monate später entsandte Ammar einen Kollegen nach Damaskus, um die Geschäfte vor Ort zu betreuen. Zu dem schaltet sich Ammar um zehn Uhr per Videoübertragung aus dem Besprechungsraum. Okba Shech Ahmad meldet sich am anderen Ende der Leitung. »Strom ist hier immer noch ein Problem. Wir nutzen Solarenergie im Haus«, berichtet Shech Ahmad über den Bildschirm. Straßen, Krankenhäuser, Wasserleitungen – vieles liegt in Trümmern. Knapp 14 Jahre Krieg haben der Infrastruktur im Land stark zugesetzt. Shech Ahmad, ein syrischer Kurde, floh selbst vor dem Bürgerkrieg in Syrien und kam 2015 nach Deutschland. Und obwohl er keine Vorerfahrung in der Logistik-

Houssam Ammar, 42, übernahm den Betrieb, in dem er seine Karriere einst mit einer Lehre begonnen hatte
branche hatte, stellte ihn Ammar zwei Jahre später wegen seiner Sprachkompetenzen ein. Nun ist Shech Ahmad wieder zurück.
Mit dem Sturz des Regimes sind auch viele westliche Sanktionen gefallen. Der internationale Zahlungsverkehr normalisiert sich langsam, und mit ihm keimt die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung. Ausländische Investitionen werden in Syrien dringend benötigt, andersherum bietet der Wiederaufbau die Chance auf neue Märkte.
»Was ist mit den Amerikanern: Kann man da schon etwas sehen?«, fragt Ammar seinen Mitarbeiter vor Ort. Shech Ahmad verneint. »Katar, die Türkei und Saudi-Arabien sind momentan die großen Player.«
Auch deutsche Firmen könnten in Syrien bald wieder eine Rolle spielen. Vor dem Arabischen Frühling florierten die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. In Damaskus erinnert man sich gut daran –ebenso an die Aufnahme von fast einer Million syrischer Geflüchteter in Deutschland. »Syrien kann ein Paradies für Unternehmen sein«, sagt Shech Ahmad: »Aber es braucht noch Zeit, bis sich das Land stabilisiert.«
Ammar nickt. Am Vortag war er in Berlin, bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern. Der deutsche Vertreter in Syrien, Clemens Hach, berichtete von der Lage vor Ort, habe von positiven Signalen gesprochen, so erzählt es Ammar. Aber auch Übergriffe auf Minderheiten, lokale Racheakte
und ein fragiles Machtgefüge gehörten in den vergangenen Monaten zur Realität. »Meine Erfahrungen in Libyen haben mich gelehrt, bei neuen politischen Führungen wachsam zu sein«, sagt Ammar. Trotzdem ist er überzeugt: Jetzt ist die Zeit, um Präsenz zu zeigen. Gegen Ende des Gesprächs fragt er seinen Mitarbeiter in Damaskus: »Hast du die Einladungen bekommen?«
Das Deutsche Generalkonsulat im irakischen Erbil lädt zum Empfang. Beide wollen teilnehmen.
Gegen 11.30 Uhr eine neue Nachricht auf WhatsApp: Die Papiere in Österreich sind geregelt, der Transport der Zementfabrik in Richtung Libyen kann starten. Ammar lehnt sich zurück, für einen kurzen Moment der Zufriedenheit. Dann geht es weiter mit Kundengesprächen bis in den Nachmittag. Ein Kunde will eine weitere Zementanlage nach Saudi-Arabien geliefert bekommen, der nächste möchte medizinische Waren und Krankenhausausrüstung in den Jemen bestellen. Ammar muss disponieren, planen. Es ist ein Leben im Rhythmus der Fracht, ein Leben zwischen den Welten. In vielen Ländern des Nahen Ostens beginnt das Wochenende bereits am Freitag, am Sonntag wird wieder gearbeitet. Dann heißt es im Zweifel: erreichbar sein.
Nicht jeder kann oder will das. In einem der Büroräume stehen Tische und Stühle leer. Platz für vier weitere Angestellte wäre vorhanden. Arbeit gebe es mehr als genug. Ammar sucht Auszubildende: Radiowerbung, Aushänge – bislang ohne Erfolg. Dabei wäre er bereit, jungen Menschen eine echte Chance zu geben, so wie sein früherer Chef ihm einst eine gab. Traumnoten? Nicht entscheidend. »Man muss schnacken können«, sagt Ammar. »Und Lust haben, sich zu zeigen.«
Als sich gegen 17 Uhr die ersten Angestellten verabschieden, bleibt Ammar im Büro. Sein Tag ist noch nicht vorbei: Abendessen mit einem Kunden. Und wenn später noch ein Container auf Freigabe wartet, ein Fahrer Rückmeldung braucht oder jemand zwischen einem Sender und einem Empfänger übersetzen muss, wird er am Telefon vermitteln. Zwischen Delmenhorst und Damaskus, Berlin und Bagdad.
WiegelingtdieNachfolge im Familienunternehmen? Das wardie LeitfragebeimZEIT Gespräch,dasam6.Oktoberin hanseatischer Kulissezwischen denMenügängenüberdie Bühneging. Gastgeber wardie PrivatbankM.M.Warburg&CO.
ZunächstschilderteZoe Andreae,CEO bei Lecare, wie sie2017, damals23-jährig, von einem Tagaufdenanderendie GeschäftedesSoftwareunternehmensübernehmenmusste.Siesprach vonanfänglich

GenugZeit fürs Netzwerkenund fürvertiefendeGesprächebliebbeim kulinarischenGenussdes3-Gänge-Menüs.


»mulmigenGefühlen«, von Dingen,diesieimNachhinein andersangehenwürde(»erst zuhörenund wertschätzen, eigeneIdeenspätereinbringen«),und vonMenschen,die sieunterstützthaben inder Transition(allen voranihre Mutter, Freunde,professionelle Coaches).
BeiJohannaund Reinhold vonEben-Worlée verläuftdie Staffelübergabeselbstbestimmt undimProzess.»Ichbinsehr dankbar, dassichihnnochan

MarkusBolder, seit2022VorstandsmitgliedbeiM.M.Warburg &CO, inseinerFunktionalsGastgeberdes Events.
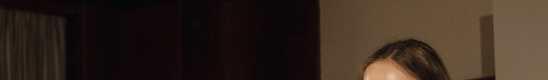

EhrlicheEinblicke:AmAnfanghabesiesichwieeineSchauspieleringefühlt, erzählt ZoeAndreae, alssiemit23JahrendieGeschäfteihresplötzlicherkrankten Vaters übernehmenmusste.WiederungeplanteGenerationenwechselgelang, schildertdieLecare-Geschäftsführerinhumorvoll.


»Verantwortung weitergebenheißtgemeinsamneugestalten«–sopflegen es ReinholdvonEben-WorléeundseineTochter Johanna vonEben-Worlée.ImGesprächmitModeratorRainerEsserüberGenerationennachfolge, Traditionund InnovationundihreWerte.
meinerSeitehabe«,so Tochter Johanna,»undpeu àpeuBereicheübernehme.« Tradition undInnovationzusammenzubringenistdiehohe Kunstim seitbald175Jahrenbestehenden Familienunternehmender E.H. WorléeGmbH.Vertrauen

und Mut sind dabei unerlässlich. Und der Seniorchef ist stolz, dassseine Tochterden Weitblickbehält und etwamit der Gründung der Initiative »Hamburgvorder Welt«,ähnlichwieer,auchdaswirtschaftspolitischeUmfeldbedenkt. etwa Tochter

Schau mal, meine KI ...
Selbst wenn man sich ständig mit künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigt, ist es immer noch beeindruckend, mit einer digitalen Person zu sprechen. Dass etwas, das wie ein Mensch aussieht, reagiert, antwortet, gestikuliert, doch nur auf Berechnungen basiert.
Solche Avatare sind eines der großen Versprechen der KI-Branche. Sie können in Erklärfilmen oder Videocalls auftreten und so ihren realen Vorbildern Arbeit abnehmen. Sie sind rund um die Uhr verfügbar, sprechen Dutzende Sprachen, beantworten geduldig tausendmal die gleiche Frage.
Ausprobieren kann man das zum Beispiel auf der Website der Techniker Krankenkasse (TK). Die Avatare Vanessa und René richten sich an Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, und Fragen haben. Darf ich zu Hause bleiben, wenn ich krank bin? Wie finde ich einen Arzt? In sechs Sprachen können die virtuellen Abbilder von echten TK-Mitarbeitern antworten.
Erstellt hat sie das Start-up von Lara Dörner. Mit Jan Schellenberger hat sie 2023 in Essen go AVA gegründet – mit dem Ziel, mehr zu bieten als schriftliche Kommunikation über Chatbots. »Um das Vertrauensvolle und Authentische, das man mit einer Person im echten Leben verbindet, im Digitalen weiterführen zu können, müssen wir es schaffen, den Menschen so echt wie möglich abzubilden«, sagt Dörner.
Der dunkelhaarige Avatar Vanessa, der für die TK antwortet, sieht durchaus realistisch aus. Sechs Wochen bekomme man sein Gehalt bei Krankheit weiter, erklärt die virtuelle Vanessa freundlich auf Englisch, mit leichtem deutschem Akzent.
Dass es sich hier nicht um einen Videocall handelt, erkennt man dennoch sofort, zu steif steht die Frau im Browserfenster, zu gleichförmig sind die Gesten und ihr Tonfall. Aber sie versteht viele der gestellten Fragen richtig und reagiert erstaunlich
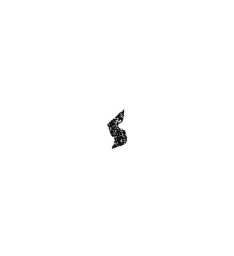



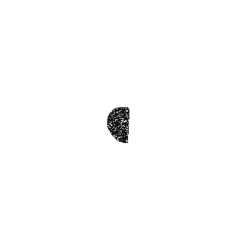
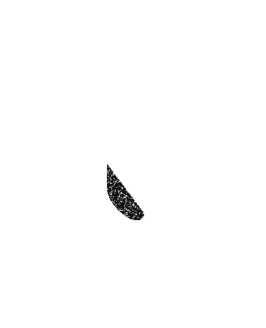
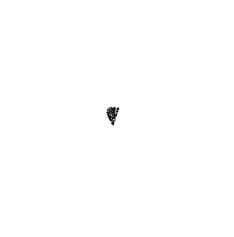

schnell. Allerdings nur dann, wenn auch eine zur Frage passende Antwort im dahinterliegenden KI-Modell gefunden wird.
»Wir haben unser eigenes Modell entwickelt, das nur mit verifizierten Inhalten trainiert wird«, sagt Dörner, also nur mit den Daten, die ein Kunde selbst bereitstellt. So klingen die Antworten der TK-Avatare zu einem Thema jedes Mal genau gleich. Das wirkt zwar weniger menschlich, gibt Kunden aber Sicherheit – auch darüber, dass ihre Avatare nicht plötzlich über, sagen wir, Hitler fabulieren. Im Test war Vanessa erstaunlicherweise dennoch eine (korrekte) Erklärung zum Stauffenberg-Attentat auf Hitler zu entlocken, aber nichts wirklich Heikles.
Natürlich sind die Avatare nicht perfekt. Vanessa versteht etwa eine Frage zum Thema Rezept falsch und erklärt stattdessen, was es mit Pfand in Deutschland auf sich hat. Auf die Frage, ob man auch zu Hause bleiben kann, wenn das Kind krank ist, wiederholt sie immer wieder, dass man regelmäßig mit seinem Kind zum Zahnarzt soll.

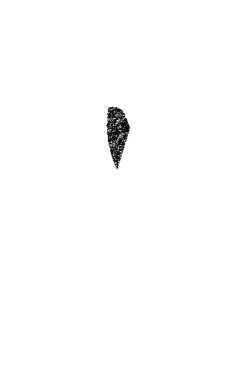
Nicht alles, wo KI draufsteht oder drinsteckt, bringt Sie weiter. Manches aber sehr.
Und das schaut sich unser Kolumnist Jakob von Lindern aus dem Digitalressort der ZEIT in jeder Ausgabe an.
Wenn Sie ihm erzählen wollen, was Ihre KI so kann, schreiben Sie ihm an jakob.vonlindern@zeit.de
Verglichen mit internationalen Wettbewerbern wie Synthesia oder HeyGen ist go AVA mit 30 Mitarbeitern und ohne großen Investor bisher eher klein. Dass es dennoch Erfolg hat, liegt wohl an der Technik, die komplett selbst entwickelt ist, wie Dörner sagt. Und daran, dass das Unternehmen eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet und Menschen in einem Studio filmt, um die Avatare zu bauen. Sein KI-Modell trainiert go AVA mit den Daten, die der Kunde zur Verfügung stellt. »Unsere Avatare sind tief in den Unternehmensprozessen verankert und bieten dadurch einen Mehrwert«, sagt Dörner.
Diese Erkenntnis setzt sich auch bei großen KI-Firmen durch, die Niederlassungen in Deutschland eröffnen: Beeindruckende Technik reicht oft nicht, um Firmenkunden zu überzeugen. Man muss ihnen auch helfen, sie anzuwenden.





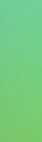






















„ i nge esser achen – bei








































L h








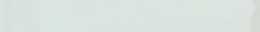
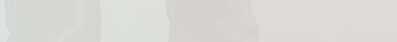



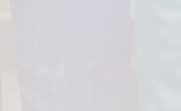


nd



i gesa te - ereic . it serer Ste erberatung u T si d i r beste s a fgestel lt.“

Ma rt in Es sl in ge ru nd Ka ri nB ern ec ke r, OR TL IE BS po rt ar ti ke lG mb H

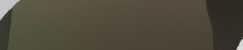



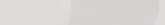






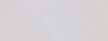


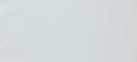

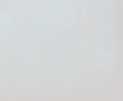








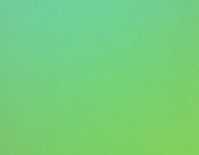



Ko nt in ui er li ch eO pt im ie ru ng is td ie Ba si sf ür je de nU nter ne hm en se rfol g– ge ra de au ch im Pe rs on alwe se n. Um ne ue nA nfor de ru ng en ef fizi entzub eg eg ne n, be nöti ge nL oh nb uchf üh ru ng un da nd er e HR-Auf ga be nfachl iche Ex pe rt is eu nd du rchg än gi gd ig it al eP roze ss e. Mi td em Kn ow -h ow Ih re r Steu er be ratu ng un dS of twarevon DATE Vi st Ih rU nter ne hm en be re it fü rj ed eH erau sfor de ru ng.
gemeinsam-besser-machen.de




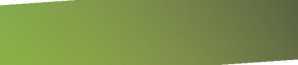

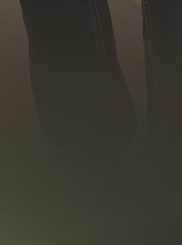
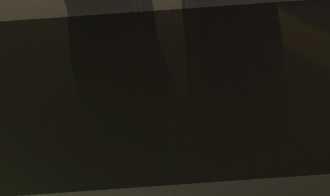




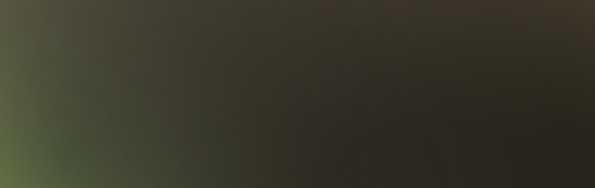

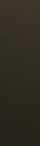



Wladimir Klitschko war Boxweltmeister. Heute reist er in der Ukraine an die Front und ist Unternehmer. Ein Gespräch über ein Comeback im Ring, Widerstandskraft im Geschäft und darüber, warum er für sein Land nicht sterben will
Wer den mehrfachen Boxweltmeister Wladimir Klitschko treffen will, sollte keinen Rucksack dabeihaben, in dem man alles Mögliche verstecken könnte. Der frühere Profisportler aus der Ukraine unterstützt sein Heimatland im russischen Angriffskrieg, sein Bruder Vitali Klitschko ist Bürgermeister der Hauptstadt Kyjiw. Also hat Wladimir Klitschko mitunter Bodyguards an seiner Seite, wenn er in Deutschland unterwegs ist, dem Land, in dem er 1996 seine Karriere als Profiboxer begann und in dem heute sein Unternehmen Klitschko Ventures ansässig ist. An einem Herbsttag nimmt der 49Jährige in einem Besprechungszimmer der Handelskammer Hamburg Platz, in der er vorher auf der Konferenz »Deutschland gestalten« des Zeitverlags mitdiskutiert hat. Nun soll er erklären, was Unternehmerinnen und Unternehmer von ihm lernen können, um schwierige Zeiten durchzustehen.
ZEIT für Unternehmer: Herr Klitschko, Sie waren Olympiasieger, gewannen mehrere Weltmeistertitel, und Sie haben als Profi nur fünf Kämpfe verloren. Ausgerechnet Ihr letzter Kampf endete aber 2017 mit einer Niederlage vor 90.000 Zuschauern. Können Sie sich vorstellen, noch einmal in den Ring zu steigen, um mit einem Sieg abzuschließen?
Wladimir Klitschko: Kurz nach diesem Kampf bin ich vom Profisport zurückgetreten. Seither höre ich diese Frage immer wieder. Tatsächlich trainiere ich immer noch täglich – so wie andere Leute das Vaterunser beten oder Zähne putzen. Also ja, ich könnte sicher noch einen Kampf bestreiten, aber ich habe nichts anzukündigen. Die Gerüchte halten sich, auch weil Sie eher halbherzig widersprechen. Und in manchen Podcasts heißt es, tatsächlich müsse nur jemand genug Geld auf den Tisch legen. Würde Sie das überzeugen? Nein. An erster Stelle ging es immer darum, Geschichte im Sport zu schreiben. Und wenn Sie mit einem Kampf Spenden für die Menschen in der Ukraine sammeln könnten?
Es gibt verschiedene Wege, sich für mein Heimatland zu engagieren. Einer davon ist das Engagement für #WeAreAllUkrainians.
Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, organisieren wir mit unserer Initiative neben Hilfslieferungen vor allem mittel- und langfristig angelegte Hilfsprojekte. Wir setzen uns beispielsweise dafür ein, nach Russland verschleppte Kinder zurückzuholen. Ich war auch an der Front: in der nahezu eingekesselten Hauptstadt Kyjiw und später im Osten und Süden meines Landes. An der Front gehst du all-in. Und ich verspreche Ihnen: Die Ukraine wird nicht fallen. Warum würden Sie Ihr Leben für die Ukraine opfern?
Moment! Ich will nicht für mein Land sterben. Ich will für mein Land leben. Für die Demokratie und gegen das Böse. Das ist im Moment schwieriger, auch für viele meiner Landsleute, die sich so tapfer seit fast vier Jahren gegen Putins Russland wehren. Aber wenn du den Tod täglich erlebst, fragst du dich automatisch, was wirklich wichtig ist im Leben. Welche Antwort haben Sie gefunden?
Es ist nicht das Geld auf deinem Konto, es sind nicht die Medaillen, Weltmeistergürtel und Titel, die du gesammelt hast. Es sind die Werte: Sie erlauben dir nicht, einfach wegzuschauen. Und die Moral. Wissen Sie, kurz nach Kriegsbeginn 2022 hat mich in der Ukraine mein Kumpel Rainer Schaller angerufen ...
... der Gründer der Fitnesskette McFit, der später auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist ... ... und er meinte, ich sei am falschen Ort und solle nach Deutschland kommen. Er hat geweint am Telefon. Ich konnte das nicht ertragen und musste einfach auflegen. Hatten Sie keine Angst, in den Krieg zu ziehen?
Natürlich. So wie früher manchmal im Sport. Ich war ja kein geborener Boxer, ich musste alles lernen. Mein Bruder Vitali war Ende der 1980er-Jahre in der sowjetischen Kickboxer-Nationalmannschaft und durfte deswegen in die USA reisen. Er hat mir Coca-Cola mitgebracht! Als Sportler die Welt bereisen, das wollte ich auch. Also habe ich angefangen zu boxen. Meine ersten Kämpfe waren schmerzhaft. Ich habe viele Schläge eingesteckt, aber ich wollte es schaffen, habe im wahrsten Sinne des Wortes
Blut geleckt. Erst mein späterer Trainer Emanuel Steward hat mir mit seinem außergewöhnlichen Stil gezeigt, wie man Zögern und Angst überwindet. Sie sind nebenbei promovierter Sportwissenschaftler, was nicht viele Boxer von sich sagen können. Wann wurde aus dem Boxer Wladimir Klitschko auch ein Unternehmer? Als Sie und Ihr Bruder 2004 Ihrem Hamburger Boxstall gekündigt und eine eigene Promotionfirma aufgebaut haben?
Das war sicher ein entscheidender Moment. Aber mein Interesse an Unternehmertum fing schon an, als ich noch ein Teenager war.
Wie kam denn das? Sie sind doch in der Sowjetunion und in der damaligen Tschechoslowakei aufgewachsen, wo es im Sozialismus weder erwünscht noch attraktiv war, Unternehmer zu werden ... Meine Mutter, eine Grundschullehrerin, hat mir den Roman Der Finanzier geschenkt. Ein Buch aus dem Jahr 1912, in dem der Schriftsteller Theodore Dreiser das Leben eines amerikanischen Geschäftsmanns erzählt und in dem man viel über das amerikanische Unternehmertum des frühen 20. Jahrhunderts lernen kann. Mein erstes Geld habe ich dann verdient, indem ich auf dem Schulhof Bilder von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone verkauft habe, die mein Bruder aus den USA mitgebracht hatte. Als ich Arnold Schwarzenegger übrigens Jahre später davon einmal erzählt habe, wollte er natürlich seinen Anteil haben, weil er ebenfalls unternehmerisch tickt. (lacht) Auch von dem amerikanischen Investor Warren Buffett habe ich mir später vieles abgeschaut, etwa dass man als Unternehmer Ausdauer braucht. Womit verdient der Unternehmer Wladimir Klitschko heute sein Geld? Für die Ukraine all-in zu sein, bedeutet, dass du finanziell leidest, weniger Einkünfte hast, viel Geld spendest für dein Land. Krieg ist teuer. Aber ich habe ein Family-Office, mit dem ich beispielsweise in Rohstoffe oder Kryptowährungen investiere. Mit einem weiteren Office beraten wir Unternehmen, die in der Ukraine tätig werden möchten. Und meine Hotels in der

Klitschko bei seinem letzten Profikampf im April 2017 im Londoner Wembley-Stadion gegen den Briten Anthony Joshua (rechts)

Wladimir Klitschko und sein Bruder Vitali (links), der Bürgermeister von Kyjiw, beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Mai 2022

Im Juli 2024 besucht Klitschko ein Kyjiwer Kinderkrankenhaus, das bei einem russischen Raketenangriff schwer beschädigt worden ist
Ukraine waren selbst im Krieg noch nie geschlossen. Klitschko Ventures hier in Hamburg bietet Coachings für CEOs, Führungskräfte und Mitarbeiter an, die auf einer besonderen Methode basieren, wir nennen sie »FACE the Challenge«. Was verbirgt sich hinter den vier Buchstaben?
FACE steht für Focus, Agility, Coordination, Endurance – Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Du lernst mit unserer Methode, wie du in herausfordernden Situationen Klarheit findest, wie du Pläne an Hindernisse anpasst, wie du dein Umfeld koordinierst, wie du Disziplin entwickelst. Das hilft dabei, den Herausforderungen ins Gesicht zu sehen und ihnen nicht den Rücken zuzuwenden.
Das klingt wie die einträgliche Geschäftsidee eines bekannten Sportlers, der sich vermarkten will. Wie können wir Ihnen glauben, dass die Methode funktioniert?
Auf die Prinzipien meiner Methode schwöre ich seit fast 30 Jahren. Ich habe sie während meiner Karriere als Boxer genutzt, um jeden Kampf aufzunehmen und mich gegen jeden Gegner zu wehren. Sie haben mir bei der Verteidigung meines Landes geholfen. Und sie helfen auch, wenn du dich als Unternehmer ständig Herausforderungen stellen musst, die deinen Geist und Körper beanspruchen. Gemeinsam mit der Harvard Business School haben wir in einer Fallstudie gezeigt, wie die Methode wirkt. Konzerne wie SAP oder die Deutsche Telekom haben sie bereits eingesetzt. Man kann sie sogar an der Universität St. Gallen in einem Weiterbildungsstudiengang erlernen.
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, viele Unternehmer könnten mehr Widerstandskraft brauchen. Aber können sie diese Resilienz wirklich lernen?
Ich denke schon. Der Weg ist allerdings herausfordernd und in Teilen sicherlich schmerzhaft. Und niemand mag schmerzhafte Erfahrungen – weder mental noch körperlich. Wenn ich Sie jetzt pieke, dann werden Sie schreien ... Hauptsache, Sie boxen uns nicht!
Na gut. Was ich sagen will: Mit jedem Schlag, den ich im Boxsport abbekommen
habe, bin ich schlauer und stärker geworden. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Gehen Sie mal ins Fitnessstudio: Wenn sich der Körper mit Muskelkater bedankt, ist das ein gutes Zeichen. Deswegen rate ich Unternehmern, sich in guten Zeiten herauszufordern, um in schlechten vorbereitet zu sein. Sie sollten sich beispielsweise früh mit KI auseinandersetzen, um den Wandel nicht zu verschlafen.
Das Schicksal der Ukraine hängt gerade sehr von Unternehmern ab. Von Elon Musk etwa, der Militäreinheiten über seine Starlink-Satelliten kommunizieren lässt, solange er das für eine gute Idee hält. Und vom Immobilienmogul Donald Trump, der heute Präsident der Vereinigten Staaten ist und der Ukraine einen Rohstoff-Deal aufgezwungen hat. Besorgt Sie das?
Nicht unbedingt. Es ist Teil der gesellschaftlichen Entwicklung, dass Unternehmer in der Politik mitreden. Ich glaube auch, dass ihre wirtschaftlichen Interessen sie eher berechenbar machen. Unternehmer sind zudem bereit, in unübersichtlichen Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber natürlich sollten sie sich ihrer Macht bewusst sein und sich für das Gute einsetzen.
Auch nach fast vier Jahren Krieg bezieht die Europäische Union immer noch Flüssiggas aus Russland und über Umwege auch russisches Öl. Was denken Sie: Braucht es härtere Sanktionen gegen Russland, obwohl sie europäische Unternehmer hart treffen würden? Muss die Wirtschaft also mehr Opfer bringen?
Ich stelle eine Gegenfrage: Was sind denn die Konsequenzen, wenn weiter Flüssiggas
und Öl aus Russland in deutschen Fabriken landen? Sie finanzieren Russlands Kriegsmaschine. Und der Krieg wird nicht enden, wenn die Ukraine fällt. Dann wird Putins Russland sich die baltischen Staaten vornehmen. Schon jetzt legen Drohnen die Flughäfen in Deutschland lahm und Hacker mit Cyberangriffen Behörden und Betriebe. Diesen Gefahren dürfen Unternehmer nicht den Rücken zuwenden, sondern nur ihr Gesicht. Ich bin dankbar für die bisherige Unterstützung aus Deutschland – und ich wünsche den Deutschen Mut zu mehr Leadership, Selbstbewusstsein und vor allem Ausdauer. Zögern und Wegschauen hilft nur den Angreifern.
Das Gespräch führten Uwe Jean Heuser und Jens Tönnesmann
ANZEIGE


Führungbraucht Vielfalt .E rfolgbraucht Netzwe rke. Generation CEO vereintD eutschlandsTop -M anagerinnen, dieWir tschaf tgestalten–kompetent ,vernetzt, sichtbar.M it der Netzwerkkooperationmit Zeit für Unternehmer geben wirweiblicherFührungdie Bühne, diesie verdient.
Ge meinsambegrüße nwir dieM anag erinnen desJahrgangs 2025.
Erfahren. Erf olgreich. E xklusiv. w ww .generation - ceo.com





















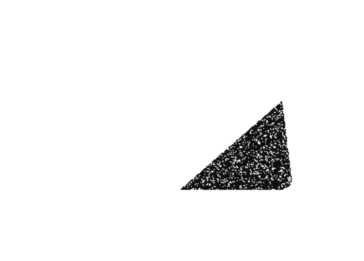



Hören Sie auf einen Weltmeister! Der Ex-Boxer Wladimir Klitschko berät heute CEOs und Führungskräfte und sagt: »Unternehmer müssen sich in guten Zeiten herausfordern, um in schlechten vorbereitet zu sein.« Er hat auch eine Methode entwickelt, mit der Sie das angehen könnten (S. 62). Manchmal braucht man keine Methode, sondern nur ein Wochenende mit Freunden, um auf die richtige Geschäftsidee zu kommen. Wie die drei Gründer in unserer Titelgeschichte (S. 6). Die sind mit dem Van zum Festival. Ein normaler Urlaub tut es bestimmt auch.
Sind Sie immer der Erste, der Mails beantwortet? Auch am Wochenende? Keine gute Idee. Denn dann bekommen Sie auch die meisten, sagt der Unternehmer Moritz Keller und erklärt, mit welchen Routinen und Tools man es schafft, als Unternehmer nicht auf der Strecke zu bleiben (S. 12). Nicht Sie, aber Ihr Unternehmen ist in Schieflage geraten? Dann verschweigen Sie das nicht, sondern reden Sie drüber: mit Mitarbeitern und Kunden. Julius Dittmann erzählt, wie Transparenz ihm geholfen hat, sein Unternehmen vor der Pleite zu retten (S. 34).








Chatbots sind ja schon fast wieder von gestern. Jetzt können Sie Ihre Kunden mit Avataren sprechen lassen, die aussehen wie Menschen und auch so reagieren und reden –in unterschiedlichen Sprachen und sogar mit deutschem Akzent. Eine Krankenkasse zeigt, wie das geht (S. 60). Und wenn Sie gerade einmal wieder vor einem 1.000-seitigen Anforderungskatalog eines Kunden sitzen, der Sie an den Rand der Geduld bringt: Auch da kann KI helfen und auf mögliche Risiken aufmerksam machen. Nur am Anfang braucht sie Ihre Unterstützung (S. 50).
Herausgeber: Dr. Uwe Jean Heuser Chefredakteur: Jens Tönnesmann Redaktion: Nele Justus Autoren: Anna-Theresa Bachmann, Carolyn Braun, Nils Heck, Lukas Homrich, Carolin Jackermeier, Kristina Läsker, Jakob von Lindern, Sarah Neu, Navina Reus, Catalina Schröder, Jan Schulte, David Selbach, Jens Többen Gestaltung: Haika Hinze (verantwortlich), Christoph Lehner Bildredaktion: Amélie Schneider (verantwortlich), Navina Reus Redaktionsassistenz: Andrea Capita, Katrin Ullmann Chef vom Dienst: Dorothée Stöbener (verantwortlich), Imke Kromer, Mark Spörrle Textchef: Johannes Gernert (verantwortlich), Anant Agarwala, Anita Blasberg, Dr. Christof Siemes Infografik: Pia Bublies (frei) Korrektorat: Thomas Worthmann (verantwortlich), Oliver Voß (stv.) Dokumentation: Mirjam Zimmer (verantwortlich) CPO Magazines & New Business: Sandra Kreft Director Magazines: Malte Winter Vertrieb: Sarah Reinbacher Marketing: Elke Deleker Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen: Silvie Rundel Herstellung: Torsten Bastian (Ltg.), Oliver Nagel (stv.) Anzeigen: ZEIT Advise, www.advise.zeit.de Anzeigenpreise: Es gilt die ZEIT-für-Unternehmer-Anzeigenpreisliste Nr. 3 vom 1. Januar 2025
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg Anschrift Verlag und Redaktion: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg; Tel.: 040/32 80-0, Fax: 040/32 71 11; E-Mail: DieZeit@zeit.de Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: produktsicherheit@zeit.de
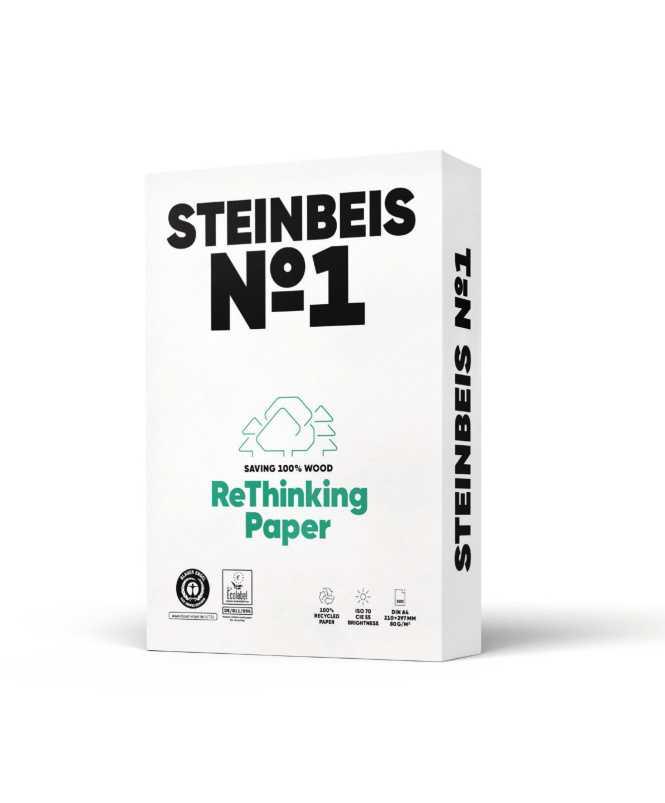

Steinbeis Papier istein Pionier für nachhaltige Innovation in der Papierindustrie. Durchden Einsatz moderner Recyclingtechnologienund kontinuierlicherForschung entwickelt das Unternehmenressourcenschonende Lösungen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. Mitdem Fokus aufdie Kreislaufwirtschaf thinterfragt Steinbeis Papier traditionelle Prozesse und setzt neueMaßstäbefür dieZukunft der Papierproduktion.
Belegegescanntund schonverbucht.
MitLexware.

Klare Tagesstruktur Summer School
Lernen lernen
Gymnasium & Realschule

IB World School Demokratieerziehung
Schüler in der Klasse, konzentrierte Lernatmosphäre, individuelle Förderung und mehr als 60 außerschulische Angebote jede Woche: leben und lernen in einer starken Gemeinschaft.
Maximal zehn
Kurpfalz-Internat

Schulzentrum Marienhöhe Umweltschule Breites Sportangebot inkl. Reiten Christliche Werte 24/7oder 5-Tage-Internat
Ob Internat, Gymnasium oder Realschule –mitten in der Natur und im Rhein-MainGebiet bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler als gesundheitsfördernde Schule auf ein ganzheitliches Leben vor.
Schuleigene Sternwarte Großes Fitnessstudio Kleine Klassenstärken
Tradition trifft Moderne –seit 1809: Gymna sium, Internat und Ganztagsschule, Lernen mit Werten, KI & Medienkunde, vielfältige AGs, Tennis, Gesang, Band, engagiertes Team, Abiturvorbereitung, starker Alumniverein, gutes Netzwerk.
Internatsschule Institut Lucius Internat –jedes Wochenende zu Hause

BetterSchool! Internatsberatung 20 Jahre Erfahrung Internationale Abschlüsse Wir begleiten Kinder, wir kennen Schulen!

Lust auf einen Auslandsaufenthalt? Wir helfen Ihnen, das perfekte Internat in Großbritannien, EU, Kanada oder USA zu finden –optimal abgestimmt auf die Bedürfnisse und Interessen Ihres Kindes!
Willkommen in Salem am Bodensee. Unsere Jahrgangsstufen 5–13 führen zum Abitur oder IB Diploma. Nach dem Leitsatz »Persönlichkeiten bilden mit Mut und Vertrauen« erziehen wir zur Übernahme von Verantwortung. Schule Schloss Salem Outdoor Education Internationale Netzwerke
Int. Austausch via Round Square
Akademisches
Tutoren-System
»Gemeinschaft erleben –Vorbild werden«, Internatsschule und Tagesheim, von Klasse 1 bis Abitur: individuell, motivierend, erfolgreich. Ergänzt durch ein umfangreiches außerschulisches Angebot an Sport, Musik und Kunst. Landheim Ammersee Großer Campus am Ammersee Neue Oberstufe mit starken Profilen
Attraktive Kooperationspartner Mit Auswahlverfahren
Frühstudium möglich
Schwerpunkt MINT
Als Internatsgymnasium fördern wir ab Klasse 10 MINT-Talente gezielt & individuell. Ein moderner Campus & innovative Bildungsangebote ermöglichen eine vertiefte technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung. MINT-Exzellenzgymnasium BW

Bestes
Preis-Leistungsverhältnis
(z. B. eigenes Hallenbad) Im Einklang mit Chor und Schule
Vielfältiges Freizeitangebot
Familiäres Internat 24/7
Singen im weltberühmten Chor, Lernen in einem bayerischen Gymnasium und Leben in Gemeinschaft mit familiärer Atmosphäre.
Regensburger Domspatzen
Individuelle Schulwahl Großzügiger Campus Weltberühmt und weltoffen Schule & Chor im Einklang

dition mit Moderne: Internat, Gymnasium und Realschule bieten individuelle Förderung, internationale Impulse und ein naturnahes Lernumfeld mit vielfältigen Aktivitäten.
Auf Schloß Wittgenstein verbinden wir Tra-
Schloß Wittgenstein Familiäres Umfeld Persönliche Betreuung Reitangebote Individuelles Lernen

Freundliche, zugewandte Lernatmosphäre Individuelle akademische Förderung Studienvorbereitende Exzellenzkurse Sport, Musik, Kunst u. v. m.
Talente und Begabungen zu entfalten.
Kopf. Herz. Charakter. Unser staatlich anerkanntes Internatsgymnasium bietet seit 175 Jahren einen außergewöhnlichen Rahmen, um individuelle
Collegium Augustinianum Gaesdonck
Lietz Internat Schloss Hohenwehrda Lietz Internat Schloss Bieberstein Lietz Internatsdorf Haubinda
Im Herzen unserer drei Internatsschulen in Hessen und Thüringen schlägt die Lietz-Pädagogik. Lernen und Leben in Internatsfamilien, in intakter Natur, immer die individuelle Förderung des Einzelnen im Blick.
Stiftung DLEH Hermann-Lietz-Schule

iPad-Klassen ab Jg. 8 Individuelle Förderung Wohnen im Tiny-Haus High Seas High School

In der starken Gemeinschaft unseres Internatsgymnasiums mitten im UNESCOWeltnaturerbe Wattenmeer prägen wir die verantwortungsbewussten, weltoffenen und erfolgreichen Persönlichkeiten von morgen. Hermann Lietz-Schule Spiekeroog

ECO-Profil in der Oberstufe
Unser Internatsgymnasium verbindet persönliche Förderung mit einer wertschätzenden Lernatmosphäre. Es ist ein Ort des Lernens, an dem Gemeinschaft gelebt und Persönlichkeiten entwickelt werden. Schule Marienau Kleine Lernund Wohngruppen Vielfältiges Sportund Freizeitangebot Internationale Schülerschaft
Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa Familiäre Atmosphäre Individuelle Förderung Internationalität Sport, Musik, Kunst Wo Musik Leben prägt: Im Internat & Tagesheim mit Knaben& Mädchenchor erfahren Kinder Gemeinschaft, bleibende Werte und Persönlichkeitsentwicklung –getragen von Musik und fördernder Begleitung. Windsbacher Chorcampus

Als älteste Internatsschule Norddeutschlands stehen wir für Tradition (gegründet 1890) und Moderne (iPad-Schule mit digitalen Displays in allen Klassenu. Fachräumen) gleichermaßen.
MINT-EC-Schule
KI als Unterrichtsfach
Abiturergebnisse
G8 Gymnasium ab Klasse 5 Exzellente
Höchstens zwölf Schüler in der Klasse, leistungsorientierte Förderung, Abitur in zwölf Jahren, Auslandserfahrung inklusive, mehr als 75 außerschulische Angebote jede Woche und Freundschaften fürs Leben.
Internatsgymnasium
Schloss Torgelow
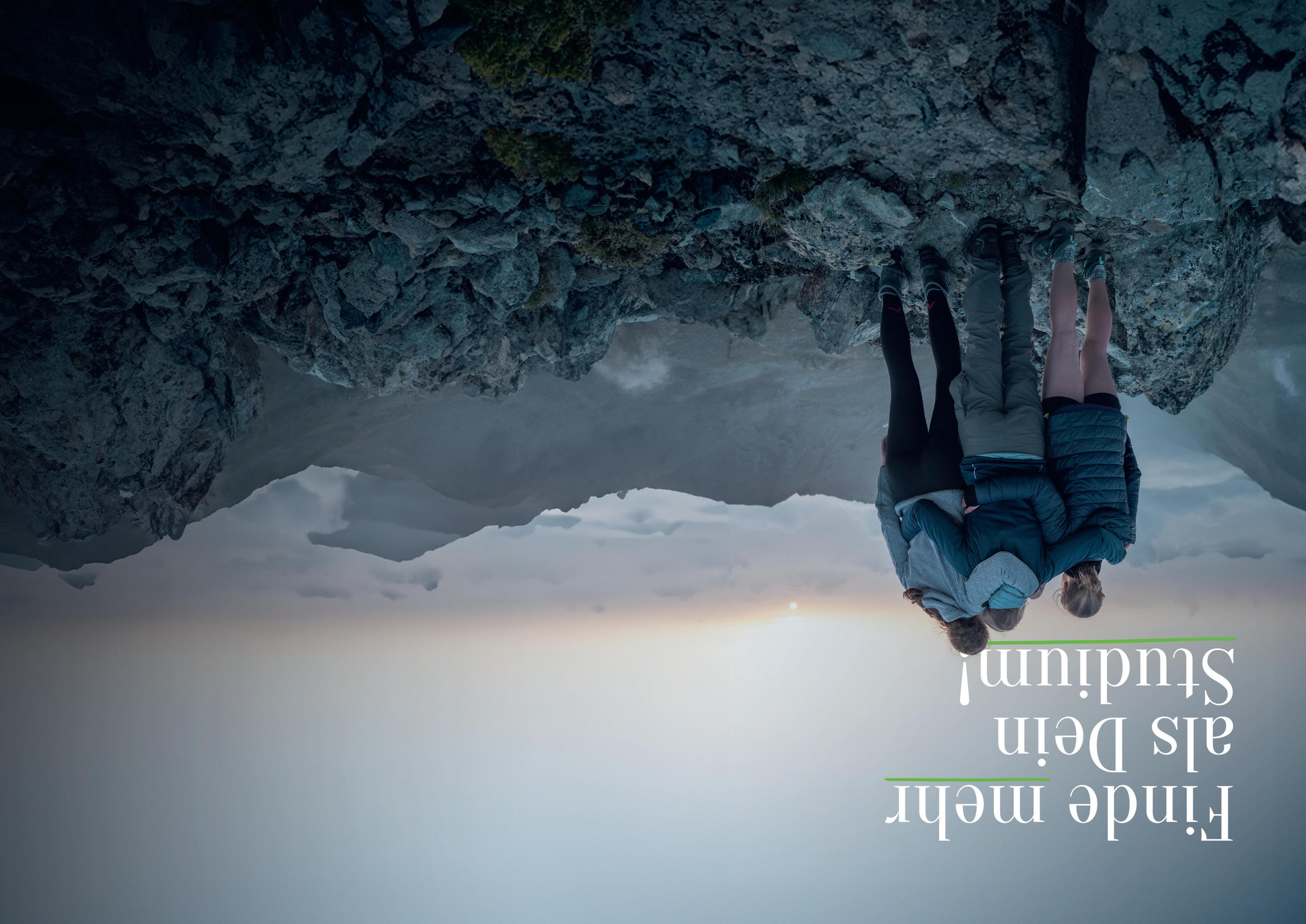
Im Internat lernen junge Menschen früh, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Klare Regeln wie feste Essens- und Lernzeiten geben Struktur. Innerhalb dieses Rahmens organisieren sich Lernende eigenverantwortlich und bilden etwa durch Patenschaften für Jüngere oder verpflichtende Dienste soziales Bewusstsein.
Ungewohnte Perspektiven einnehmen, Konflikte lösen, Toleranz üben – alles essenzielle Skills, die sich im Zusammenleben mit Gleichaltrigen verschiedenster Nationalitäten spielerisch formen. Mentoren und feste Bezugspersonen unterstützen Lernende in ihrer individuellen Entwicklung. Selbstständige Persönlichkeiten wissen früh, wie man sich in einer komplexen Welt zurechtfindet.
Im Chor singen, in einer Band den Rhythmus finden oder im Volleyball-Team den Matchball verwandeln – ein Internat bietet ein Leben in einem gemeinschaftlich geprägten, geschützten Umfeld: Gemeinsame Mahlzeiten und Wohnerlebnisse, Schulprojekte sowie außerschulische Aktivitäten stärken Zusammenhalt und Zugehörigkeitsgefühl.
Bilingual zum Abitur oder zum klassischen Fremdsprachenkanon etwa noch Chinesisch addieren? Kommunikation gilt als Schlüssel einer globalisierten Welt. International anerkannte Schulabschlüsse (Baccalauréat), das Cambridge Certificate oder ESOL-Sprachzertifikate öffnen die Tür für anschließende Auslandsstudien.
Kollaborative Lernkonzepte kommen in attraktiver Bildungsarchitektur zur Geltung: Kommunikationsinseln, schallschützende Materialien und eine positive Raumatmosphäre. Die digitale Ausstattung ist in der Regel exzellent: aktuelle Computertechnologie, cloudbasierte Tafeltechnik, innovativer Unterricht über iPads und Whiteboards.
Zwei Prozent der Bevölkerung gelten als hochbegabt. Internate fördern gezielt die individuellen Talente der Heranwachsenden. Projekte wie die Business School für junge Unternehmer oder Eco-Profile in der Oberstufe legen den Fokus auf Wirtschaft oder Nachhaltigkeit. Und MINT-Begabte experimentieren in modernsten Laboren.
IMPRESSUM
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, HelmutSchmidt Haus, Speersort 1, 20095 Hamburg Geschäftsführung: Dr. Rainer Esser, Iris Ostermaier, Christian Röpke und Nils von der Kall Art Direction: Dietke Steck Realisierung: Studio ZX GmbH – Ein Unternehmen der Zeitverlagsgruppe; Geschäftsführung: Dr. Mark Schiffhauer, Iliane Weiß, Lars Niemann; Projektmanagement: Stefanie Eggers; Grafik: Jörg Maaßen; Redaktion: Cornelia Heim; Lektorat: Egbert Scheunemann; Fotos/ Illustrationen: iStockphoto Produktmanagement: Kathi Andresen Chief Sales Officer ZEIT Advise: Lars Niemann Media Consultant: Udo Schulte, Tel.: 040 / 32 80 53 67, udo.schulte@zeit.de; Anzeigen preise: Preisliste Nr. 70 vom 1. Januar 2025
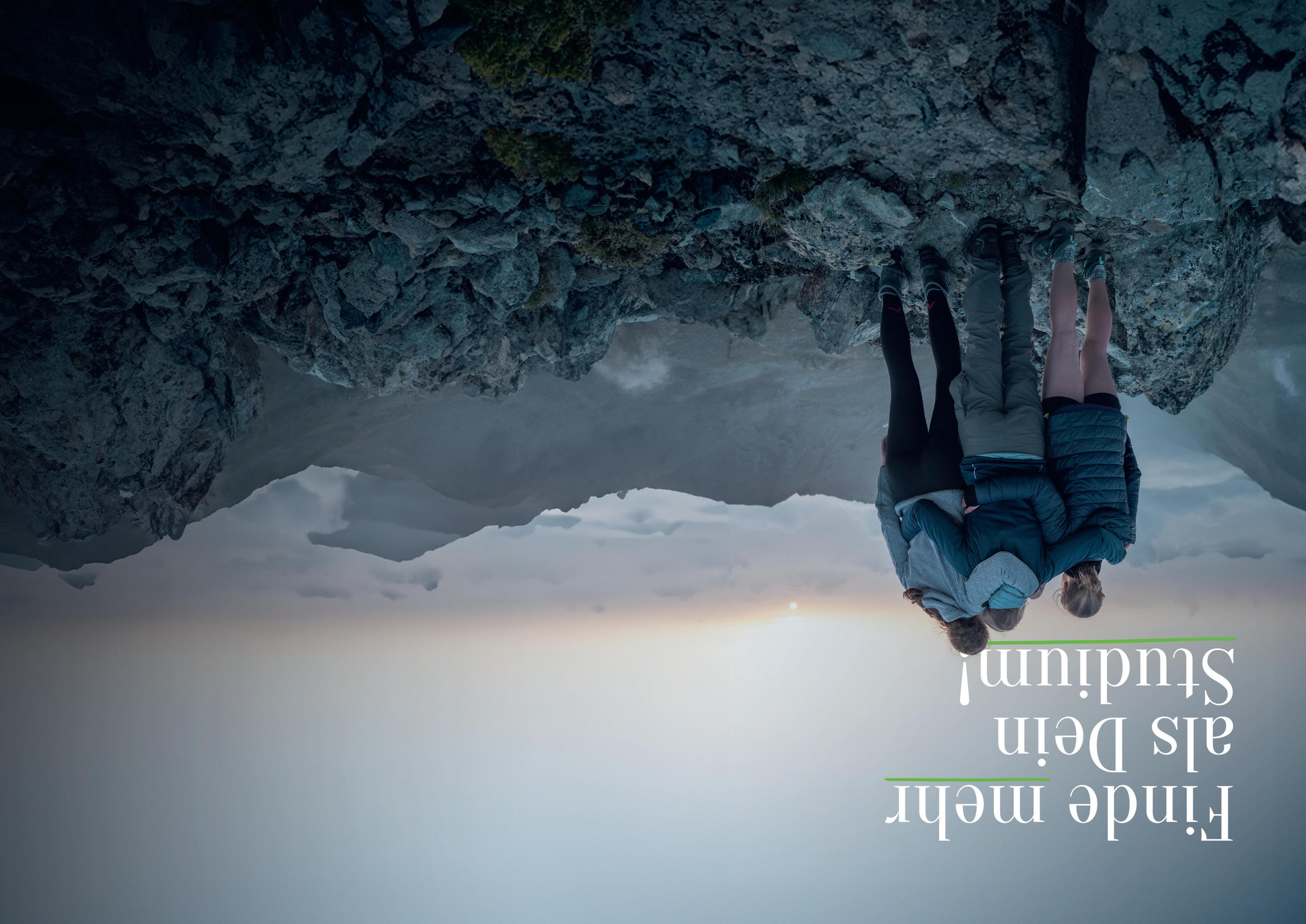
ANZEIGE
Internate bieten erstklassige Bildung, sie fördern die Persönlichkeitsentwicklung und bereiten die Führungskraft von morgen umfassend auf das Leben in all seinen Facetten vor.






















DasSalem Kolleg bereitet Abiturientinnenund Abiturienten in drei Trimestern aufihreakademisc undberufliche Zukunf tvor.ImStudium Generale gebenqualifizierte Dozierende Einblickeindie Natu Geistes- undGesellschaf tswissenschaften undfüh in interdisziplinäreArbeitsmethoden ein.





















r Education am Salem Kolleg. utdoo



DerStudienalltag wird durchVorlesungen an der Universitätund Hochschule Konstanz greifbar. DasAngeb ot wird durchBlockseminare sowieKur in denBereichen Theater, Musik, Sprachen undSp ergänztund beinhaltet außerdem eine Forschungs reise im Rahmen deswissenschaf tlichenProjektes „Soziale Wirklichkeit in Europa“.


DieKollegiatinnenund Kollegiatenlernen anhandvon Analysen und Beratungsgesprächenihreindividuellen Stärkenund Begabungen noch besser kennen und erlangen dieFähigkeit,einefundier te Studienwahl zu tref fen. Beidem gemeinschaftlichen Lebenauf demmodernenCampusamBodensee undder begleitenden OutdoorEducation geht es darum, dieeigenePersönlichkeitweiterzuent wickelnund gemeinsamHerausforderungen zu meistern




„Für mich wares aufjeden Fall mit das schönsteJahr meines Lebens! “ Alumna,Isabell
Jetztb ewerbenfür Dein Jahr am SalemKolle g!
DasSalem Kolleg isteineBildungsinitiativedes Vereins
Schule SchlossSalem e.V.,der Träger desSalem Kolleg ist.
www.salemkolle g. de