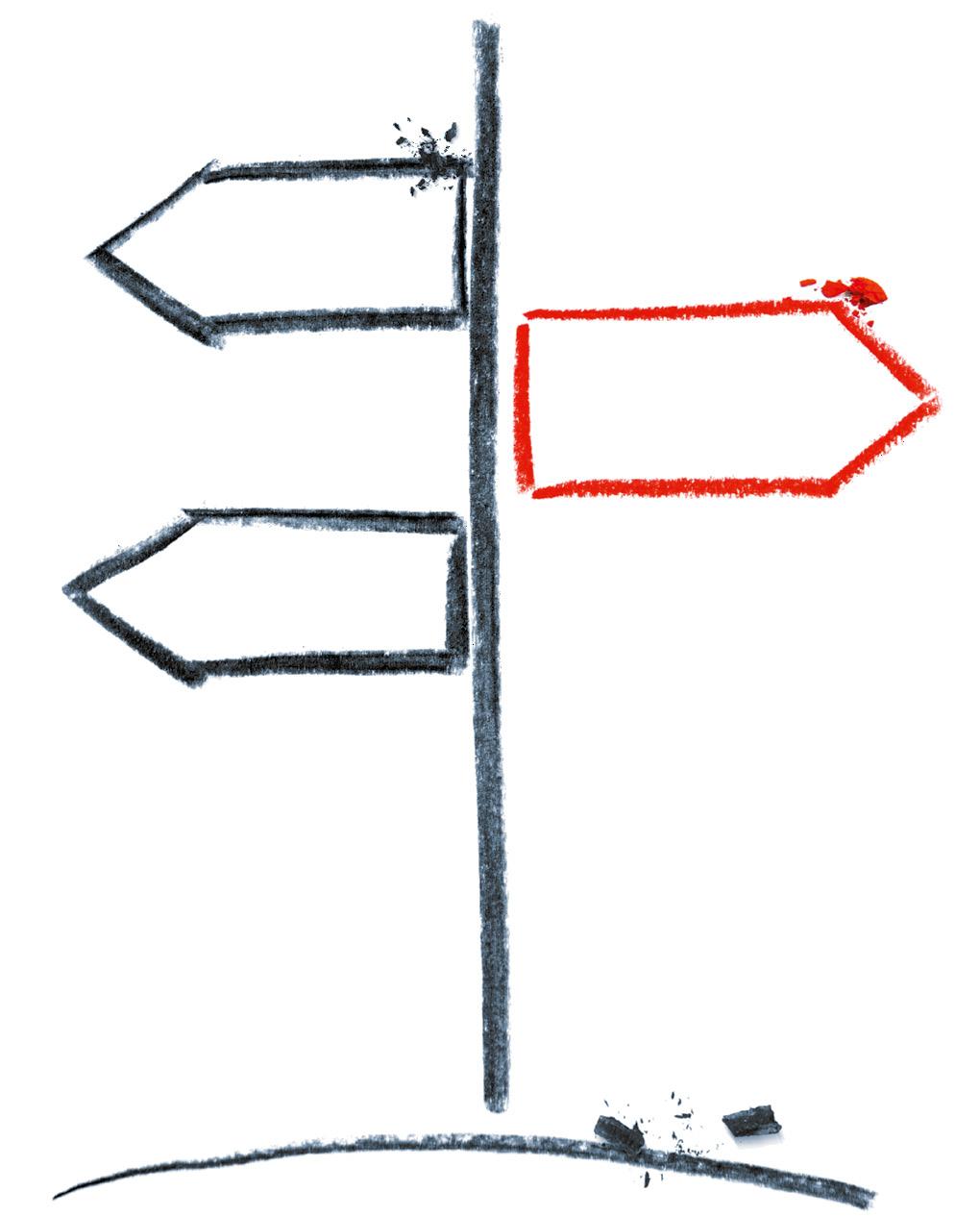1 minute read
Auf dem Weg zum Roboter-Anwalt
Im Auge des Betrachters. Wie viel künstliche Intelligenz (KI) verträgt das Ego der Anwälte, und wie viel geben die Kanzleien für KI aus? Wir haben nachgefragt.
Das Thema künstliche Intelligenz (KI) hat längst auch die heimische Anwaltsszene erreicht. Eine Umfrage des „Börsianer“ zeigt auf, welche Fragen die Großkanzleien dabei am meisten beschäftigen.
TEXT ANGELIKA KRAMER
Es klingt wie der Inhalt einer US-Anwaltsserie: Steven A. Schwartz hat sich bei der Suche nach Präzedenzfällen für eine Klage gegen eine Airline ChatGPT zu Hilfe genommen. Doch statt echte Fälle aufzulisten, erfand die KI Fantasie-Fälle und blamierte den New Yorker Anwalt vor Gericht. Ihm drohen nun Sanktionen, weil er die von ChatGPT gelieferten Ergebnisse nicht überprüft hatte. Nach diesem Fall entbrannte in den USA – nicht zum ersten Mal – die Diskussion darüber, ob und wie massiv KI in die Arbeit der Anwälte eingebunden werden sollte.
Das Thema ist längst auch in Österreich angekommen und erfährt mit der breiten Anwendbarkeit von ChatGPT noch einmal eine Beschleunigung. Auch der Börsianer hat sich der Materie angenommen und eine Umfrage unter Österreichs großen Rechtsanwaltskanzleien durchgeführt, wie relevant sie das Thema künstliche Intelligenz für ihre Branche wirklich einschätzen. Manche der Antworten fielen dabei sehr eindeutig aus wie jene auf Frage eins – ob die Kanzlei bereits KI verwendet.
Wie Teenage-Sex
Als Anwendungsgebiete wurden von den Kanzleien vorwiegend Dokumentanalyse, Übersetzungsarbeit, Analyse von Ar- beitsprozessen, Due Diligence, Massenverfahren, interne Untersuchungen im Bereich Kartellrecht oder Compliance, Marketing und PR sowie Know-how-Analyse genannt. Nur zwei internationale Kanzleien gaben an, auch generative KI, also eine Technologie, die auch Inhalte erzeugen kann, einzusetzen. „Es ist ein bisschen so wie mit Teenage-Sex. Alle reden davon, aber kaum einer hat es wirklich“, glaubt Sophie Martinetz, die an der WU das Legal Tech Center leitet. Die meisten Anwaltskanzleien würden wie das „Meerschweinchen vor der Schlange“ auf die KI reagieren, so Martinetz. Dies hänge auch mit zahlreichen rechtlichen Unsicherheiten in erster Linie datenschutzrechtlicher Natur zusammen. Vor allem beim Einsatz generativer KI würde der Großteil der Rechtsanwälte noch zuwarten.
Differenzierter fällt die Antwort auf die Frage aus, wie viel die Kanzleien für KI im Jahr ausgeben. Immerhin geben dabei 36,4 Prozent an, sich ihre KI mehr als 50.000 Euro pro Jahr kosten zu lassen. „80 Prozent aller Anwälte in Österreich haben kein Microsoft 365“, weiß Martinetz. Genau das könnte aber der entscheidende Faktor auf dem Weg zu flächendeckender Verbreitung der KI sein. Denn Microsoft 365 kommt im Herbst mit ChatGPT auf den Markt. Diese mögliche Investition warten einige nun ab.
UMFRAGE