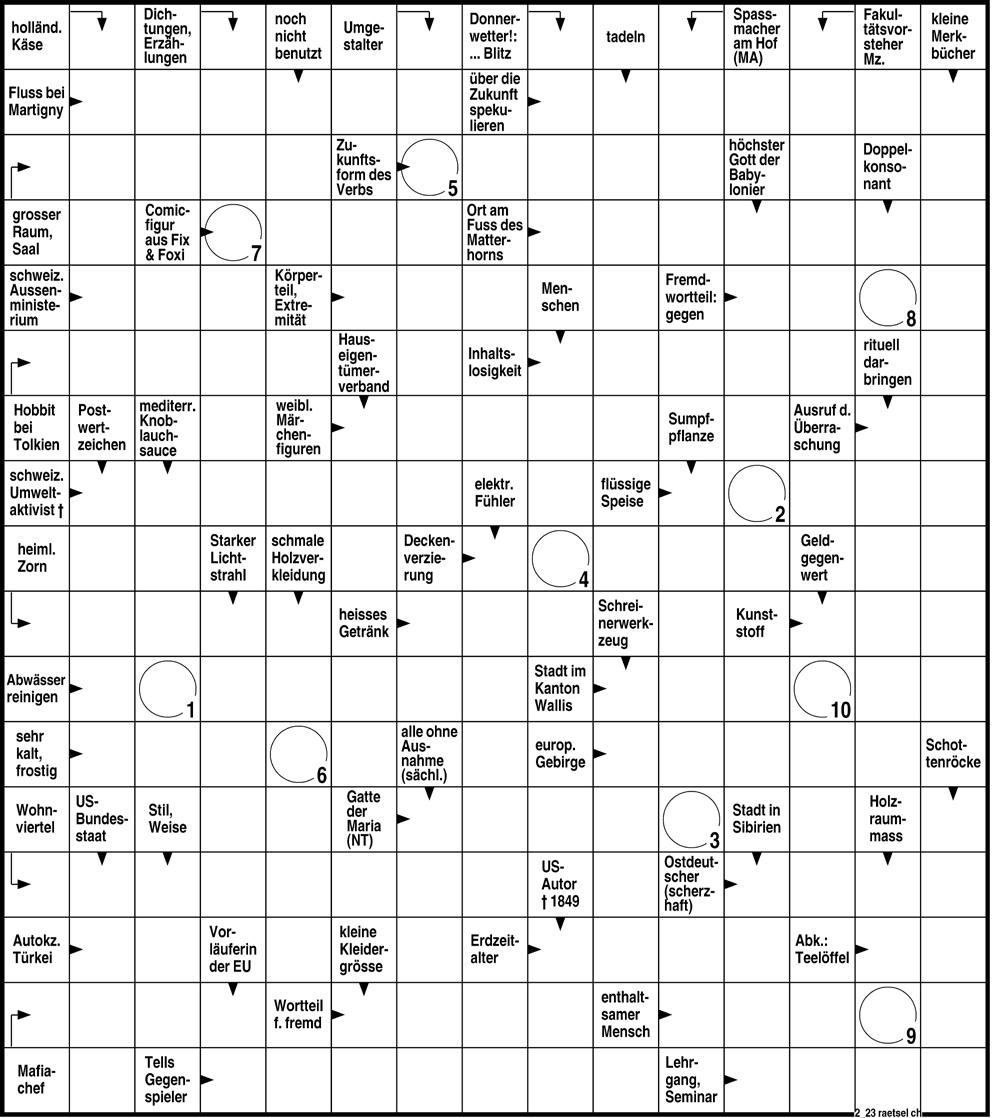2 minute read
Eine Quelle der Freundschaft
Von Ivo Bachmann*
Man muss es schon finden, dieses rote Haus im Grünen. Es steht auf dem Albis in der Nähe der Felsenegg, mitten in einer idyllischen Waldlichtung, fernab vom Alltag, von Verkehr und Lärm: das Kinderfreundehaus Mösli. Gut eine halbe Stunde dauert der Fussmarsch von der Bergstation der Luftseilbahn Adliswil–Felsenegg zum kleinen Paradies, etwa gleich lang der Aufstieg von Gamlikon im Reppischtal. Zum Haus gehören ein Schwimmbassin mit eigenem Quellwasser und einem Biotop, eine grosse Spielwiese sowie ein lauschiges Stück Wald.
Advertisement
Errichtet wurde das Mösli 1931, um Arbeiterkindern Erholung in der freien Natur zu ermöglichen. Seit 1988 ist es eine Stiftung und wird gerne von Schulklassen und Jugendgruppen genutzt. Unzählige Kinder haben hier schon ihre Ferienwochen oder Schulprojekttage verbracht – wie die zwei Freundinnen und zwei Freunde auf dem Bild nebenan. Die Aufnahme stammt aus dem Archivbestand des Landesverbandes der Schweizerischen Kinderfreunde Organisationen (LASKO) und entstand vermutlich irgendwann in den 1950er Jahren – so genau lässt sich das heute nicht mehr sagen.
Der LASKO stand der Arbeiterbewegung nahe. Er verfolgte idealistische Ziele und strebte eine ganzheitliche Erziehung der Kinder an. Als pädagogische Grundlage dienten ihm die sozialistischen Erziehungskonzepte der Philosophen und Pädagogen Max Adler (1873–1937), Otto Felix Kanitz (1894–1940) und Kurt Löwenstein (1885–1939) sowie der Pädagogin und Pazifistin Anna Siemsen (1882–1951). Das Ziel war eine Erziehung der Kinder zu freien, selbständig denkenden Menschen.¹
Das Konzept vermochte sich nicht durchzusetzen. Der LASKO wurde 1996 aufgelöst. Doch einige seiner pädagogischen Ansätze sind bis heute aktuell. So war etwa die sogenannte Koedukation, also die gleichberechtigte Erziehung der Geschlechter, in diesen Kreisen bereits damals ein grosses Thema.
Man versuchte sich in antiautoritärer Erziehung und probte das demokratische Zusammenleben. «Freundschaft» war ein häufig verwendetes Wort.
Aus mancher Jugendbekanntschaft entwickelt sich eine Freundschaft fürs Leben.
Heute sind sich Pädagogen und Psychologen darin einig, dass Freundschaften im Kindes und Jugendalter einen wichtigen Rahmen schaffen für kommunikatives und soziales Lernen. In Freundschaften entwickeln Kinder und Jugendliche gemeinsame Normen und Werte. Sie lernen, wie man sich in einer Gruppe verhält, und erfahren, wie sich Konflikte bewältigen lassen oder wie man Kooperationen eingeht. Freundschaftsbeziehungen sind eine Quelle der Anerkennung, aber auch der Kritik und Zurückweisung; sie ermöglichen einem Kind, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Für die Beziehungsfähigkeit eines Menschen sind diese Erfahrungen eine wichtige Grundlage.
Kommt hinzu: Aus mancher Jugendbekanntschaft entwickelt sich eine Freundschaft fürs Leben. So gab in einer deutschen Studie eine Mehrheit der Befragten an, ihre beste Freundin oder ihren besten Freund bereits seit der Jugendzeit zu kennen.² Das dürfte in der Schweiz nicht anders sein. Auch dank Orten wie dem Mösli.
¹ Gabriela Bossart: «Die Schmiede einer neuen gesellschaftlichen Ordnung?» Der Versuch «sozialistischer Erziehung» im Landesverband der schweizerischen Kinderfreundeorganisationen LASKO; Historisches Institut der Universität Bern.
² Jacobs Studie 2014: Freunde fürs Leben – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung; Institut für Demoskopie Allensbach.
* Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag, die das Visit redaktionell begleitet. Er war zuvor unter anderem Chefredaktor des « Beobachters » und der « Basler Zeitung ».
Das Thema im nächsten Visit: Wohnen im Alter
Die Generation der Babyboomer tritt ins Rentenalter. Sie verändert auch die Wohnformen im Alter. Die Art und Weise, wie und wo man seinen Lebensabend verbringt, wird vielfältiger. Wie stellen sich Alters- und Pflegeheime diesem Wandel? Wie reagieren Städte und Gemeinden?