APROPOS



Warum wir frieren Seite 16
Im Fokus: unsere Nase Seite 18
Entspannt durch den Winter Seite 27

Ist Ihnen gerade nach etwas Ruhe? Wie wäre es spontan mit einer kleinen Auszeit – zum Beispiel indem Sie sich in die neuste Ausgabe unseres Kundenmagazins vertiefen? Denn bereits kurze Pausen können Körper und Geist bei der Regeneration helfen und für mehr Energie im Alltag sorgen.
APROPOS: Gerne unterstützen Sie unsere Apotheken-Teams mit Rat und Tat dabei, vital und gesund durch den Winter zu kommen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Winterzeit und viel Freude bei der Lektüre.
Jasmin Geissbühler und das Redaktionsteam des APROPOS
TopPharm Apotheken und Drogerien Genossenschaft
Grabenackerstrasse 15
4142 Münchenstein
Tel. 061 416 90 90 kommunikation@toppharm.ch




Harmlos, aber lästig: Warzen
Seite 4
Antibiotika: im Einsatz gegen Bakterien
Seite 7
Häufige Augenbeschwerden
Seite 10
Gürtelrose: Wenn ein Virus erneut ausbricht
Seite 14
Warum wir frieren
Seite 16
Im Fokus: unsere Nase
Seite 18
Porträt: Borreliose
Seite 21
Interview: Hilfe aus der Apotheke
Seite 24
Entspannt durch den Winter
Seite 27
Antientzündliche Ernährung (mit Rezept)
Seite 30
Rätsel
Seite 33
E-PAPER
Diese Ausgabe auch online lesen! Besuchen Sie unsere Website: www.toppharm.ch
Impressum Ausgabe Nr. 4/2024 | Herausgeberin TopPharm Apotheken und Drogerien Genossenschaft, 4142 Münchenstein, kommunikation@toppharm.ch, Tel. 061 416 90 90 | Anzeigen Michael Bollinger | Leitung Marketing & Kommunikation Anita Spycher | Chefredaktion und Umsetzung Jasmin Geissbühler | Mitarbeit Redaktion Monika Bachmann, Marion Anna Becker, Vanessa Colombo, Moana Mika, Inga Pfannebecker, Christine Steiner | Druck und Versand Swissprinters AG, Zofingen | Auflage Druck 394’227 | Medical Clearing andfrank ag, Frauenfeld | Gestaltung design.isch. gmbh, Zürich | Fotos Andrea Tanner (S. 9), Christoph Läser (S. 21, 22, 36), Zeichenfaktur (S. 25) | Der Abdruck oder die Publikation im Internet ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet. | Für den Inhalt der abgebildeten Werbeinserate ist die jeweilige Vertriebsfirma verantwortlich. | APROPOS erscheint 4-mal pro Jahr.
Warzen sind weit verbreitet und ansteckend, normalerweise aber harmlos. Besonders häufig treten sie bei Kindern und Jugendlichen auf. Praktisch jeder und jede ist einmal im Leben von ihnen betro en. Von Christine Steiner
Warzen sind die häufigsten Virusinfektionen beim Menschen und werden von vielen als unästhetisch angesehen. Doch es gibt vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten.
Was sind Warzen?
Warzen sind gutartige Hautwucherungen, die durch Viren verursacht werden. Sie können an verschiedenen Körperstellen auftreten, besonders häufig an Händen, Füssen, Armen und im Gesicht. Sie verursachen üblicherweise keine Beschwerden und machen sich höchstens durch Druck-, Spannungsgefühle oder Juckreiz bemerkbar. Die Ausnahme bilden Dornwarzen an der Fusssohle, die beim Gehen Schmerzen verursachen.
Warzen sind normalerweise harmlos und viele verschwinden von selbst. Je nach betro ener Stelle sind sie jedoch lästig oder unansehnlich. Bei gewissen Warzen sind kleine schwarze oder bräunliche Punkte sichtbar, die durch geronnenes Blut in der Haut entstehen. Da gewisse Hautveränderungen ähnlich wie Warzen aussehen können, ist im Zweifelsfall immer eine genaue Abklärung bei einer Dermatologin oder einem Dermatologen angezeigt.
Welche Warzenarten gibt es?
• Gewöhnliche Warzen: Meist an Fingern, Nagelrändern, Handrücken oder Füssen, sie sind sehr klein, verhornen und werden rau und schuppig.
• Dornwarzen: Meist an Fusssohlen und Fersen, werden relativ gross und werden durch die Belastung beim Laufen nach innen gedrückt.
• Flachwarzen (Planwarzen): Tendenziell eher im Gesicht, auf der Stirn und den Wangen sowie an Händen und Unterarmen, wenige Millimeter gross und leicht bräunlich.
•Mosaikwarzen: Erscheinen an den Fussballen oder unter den Zehen, manchmal grossflächig auf der Unterseite des Fusses, weiss und flach, schmerzen selten beim Gehen.
•Pinselwarzen (filiforme Warzen): Meist störend im Gesicht, sehen fransig aus, fadenförmiges und stachelartiges Bild, das daher unangenehm au ällt.
•Daneben gibt es noch weitere Warzenarten wie beispielsweise Dellwarzen.

So entstehen Warzen
Warzen entstehen durch die sogenannten Humanen Papillomaviren (HP-Viren, HPV), von welchen es über hundert verschiedene Typen gibt. Weist die Haut kleine Verletzungen oder Risse auf, dringen die Viren ein und führen lokal zu Zellwucherungen. Es bildet sich eine dickere Hornhaut, die als Warze hervorsteht. Die Verbreitung der Warzenviren erfolgt durch direkten Hautkontakt oder gemeinsam genutzte Gegenstände wie Handtuch, Badeschuhe oder Rasierapparat. Das Risiko der Virenübertragung ist besonders bei feuchter oder verletzter Haut sehr hoch.
Personen mit einem geschwächten Immunsystem sind anfälliger für Warzen. Ihr Körper kann oftmals die Viren nicht erfolgreich bekämpfen. Gesunde Personen stecken sich weniger an, sie bauen mit der Zeit eine Immunabwehr gegen die Viren auf. Entsprechend verschwinden diese bei einer Ansteckung von selbst wieder. In welchem Zeitrahmen die Warzen jeweils verschwinden, hängt vom Virus- und Warzentyp sowie vom Gesundheitszustand der betro enen Person ab.
So werden Sie Warzen wieder los Obwohl Warzen normalerweise keine Schmerzen verursachen und oft von selbst verschwinden, möchten viele Betro ene aus ästhetischen Gründen die Warzen schnell wieder loswerden. Es werden dazu hauptsächlich zwei Behandlungsweisen angewendet:
Das Auftragen einer Lösung mit Salicylsäure erfolgt über einige Wochen mehrmals täglich auf die betro ene Hautstelle. Die verhornte
Warzen entstehen durch die Humanen Papillomaviren, von welchen es über hundert verschiedene Typen gibt.
So reduzieren Sie das Ansteckungs risiko mit Warzen
•Nach dem Duschen die Füsse gut abtrocknen (auch zwischen den Zehen)
• In Schwimmbädern, Saunen und Umkleidekabinen Badeschuhe tragen
• Rissige Hände und Füsse mit Fettcremes einreiben
• Warze möglichst nicht berühren; nach einer Berührung die Hände gründlich waschen
• Handtücher, Socken und Textilien, die Kontakt zu den von Warzen betro enen Stellen haben, täglich wechseln
• Waschlappen, Hand- und Duschtücher nicht mit anderen Personen teilen
• Vor Körperkontakt wie beispielsweise bei Kontaktsportarten Warzen soweit möglich abkleben
Haut löst sich so nach und nach auf. Salicylsäurelösung ist ohne Rezept in der Apotheke erhältlich und normalerweise gut verträglich.
Die Vereisung wird in der Regel von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen. Dabei wird flüssiger Sticksto auf die Warze aufgetragen. Die obere Hautschicht wird durch den sehr kalten Sticksto zerstört. Die Behandlung muss nach einer Woche wiederholt werden. Bei der Anwendung entsteht ein kurzer stechender Schmerz mit einer anschliessenden Schwellung und Rötung der Haut. Dabei kann sich zudem eine Blase bilden. Diese heilt jedoch innerhalb einiger Tage von selbst wieder ab.
Nicht jede Warze verschwindet allerdings nach nur einer Behandlung. Oft braucht es Geduld: In den meisten Fällen verschwindet sie innert einem bis zwei Jahren, doch können Warzen auch deutlich hartnäckiger sein und jahrelang stören. In solchen Fällen ist eine Beratung durch eine Dermatologin oder einen Dermatologen nötig.
Personen mit Gesundheitsrisiken wie Diabetes (Nervenschäden an den Füssen), Wundheilstörungen oder Hautkrankheiten, Schwangere oder stillende Frauen sollten sich vor einer Behandlung durch eine Ärztin oder einen Arzt beraten lassen.
Buchen Sie einen Termin oder kommen Sievorbei.spontan

«Für eine gezielte Behandlung ist eine umfassende Abklärung wichtig»
Symptome wie Gliederschmerzen, Fieber, Halsschmerzen, Husten, Ohrenschmerzen oder eine verstopfte/laufende Nase können verschiedene Ursachen haben. Damit Sie die Symptome gezielt behandeln können, ist oft eine Abklärung sinnvoll, ob die Symptome eine virale oder bakterielle Ursache haben. Für eine medizinische Erstabklärung können Sie die Apotheke aufsuchen – dort werden Sie unkompliziert und diskret beraten. Bei Bedarf können in bestimmten Apotheken auch weiter führende Messungen (z.B. Entzündungswert) durchgeführt werden, und Sie erhalten noch vor Ort das richtige Medikament – gegebenenfalls auch ein rezeptpflichtiges.
Ihre Gesundheit. Unser Engagement.
Im Winter häufen sich Erkrankungen der Atemwege – in vereinzelten Fällen hilft manchmal nur die Behandlung mit Antibiotika. Doch: Was sind eigentlich Antibiotika und wann braucht es sie? Von Moana Mika
Sarah* war erleichtert, als sie letzten Winter nach Tagen der Ungewissheit nicht nur eine Diagnose hatte, sondern auch eine gezielt wirkende Antibiotikatherapie verschrieben bekam. Gross war sie zwar, die Tablette. Und einen besonders guten Geschmack hinterliess sie auch nicht. Ihre Hausärztin informierte sie zudem detailliert über die möglichen Nebenwirkungen. Die junge Frau erho te sich, dass damit ihre Infektionskrankheit gezielt angegangen werden kann. Denn Sarah plagte schon seit mehreren Tagen das Fieber. Zudem war die Nase zu und der Oberkiefer schmerzte derart, dass sie kaum den Kopf vornüberbeugen konnte. Nur schon das Schuhebinden wurde zur Herausforderung. «Manchmal meinte ich, mein Kopf würde platzen», erzählt Sarah heute. Sie litt unter einer Infektion der Nasennebenhöhlen – einer sogenannten bakteriellen Sinusitis.
Gemäss des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden 2023 in der Schweiz mehr als 5,6 Mio. Packungen Antibiotika verkauft und pro Tag nahmen rund 95’200 Personen eine Dosis ein. Die häufigsten Krankheiten, bei denen Antibiotika verschrieben wurden, waren Harnwegsinfekte und Infektionen der oberen Atemwege – darunter fällt auch Sarahs bakterielle Sinusitis. Antibiotika scheinen also eine gängige Therapie zur Behandlung von Infektionen zu sein. Bloss: Was ist das eigentlich, ein Antibiotikum?
* Vollständiger Name der Redaktion bekannt
Die häufigsten Krankheiten 2023, bei denen Antibiotika verschrieben wurden, waren Harnwegsinfekte und Infektionen der oberen Atemwege.
Antibiotika richten sich «gegen das Lebende» Um dies zu verstehen, hilft es, bei der Bedeutung des Begri s anzufangen: «Antibiotikum» ist zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern «anti», was so viel heisst wie «gegen», und «biotikos», was «zum Leben gehörend» bedeutet. Übrigens wird für die Einzahl die Endung «-um» verwendet und für die Mehrzahl die Endung «-a» – also ein einzelnes Antibiotikum und mehrere Antibiotika. Antibiotika richten sich also gegen das Lebende. Damit ist natürlich nicht das Leben des Menschen gemeint, sondern Lebewesen, die Infektionen verursachen können: Bakterien. →

Das sind kleinste Lebewesen, die aus einer einzigen Zelle bestehen. Die Mikroorganismen sind äusserst anpassungsfähig und bevölkern fast die ganze Erde. So findet man Bakterien im Boden, in Tieren, auf Lebensmitteln und sogar in der Luft. Auch wir Menschen tragen entsprechend viele Bakterien auf und in uns. Die Gesamtheit aller Bakterien in unserem Körper wird als Mikrobiota bezeichnet. Ist es also die Mikrobiota, die uns krank macht? Nein, im Gegenteil: Die Bakterien, die wir auf unserer Haut und in unserem Körper tragen, sind nützliche Bakterien und wichtig für unsere Gesundheit. Darmbakterien helfen zum Beispiel bei der Verdauung und Hautbakterien schützen vor krank machenden Eindringlingen. Und die gibt es eben leider auch: Bakterien, die uns schaden. Wie im Fall von Sarah: Bei ihr haben sich krank machende Bakterien in den Nasennebenhöhlen so weit ausgebreitet, dass ihr Immunsystem nicht mehr dagegen ankam – in diesem Fall spricht man von einer Infektion.
Giftpfeile gegen Bakterien
In Sarahs Fall trat die erho te Wirkung ein: Das Antibiotikum wirkte – die Schmerzen im Oberkiefer liessen nach einigen Tagen nach, das Fieber nahm ab und sogar die Schuhe konnte sie wieder mühelos binden.
Antibiotika bekämpfen
Bakterien zwar sehr
e zient, aber sie können nicht zwischen nützlichen Bakterien und krank machenden Bakterien unterscheiden.
Wie scha en es denn Antibiotika, Symptome derart schnell zu lindern? Antibiotikatherapien wirken wie Giftpfeile auf Bakterien. Je nach Antibiotikum können die Pfeile verschiedene Ziele im Visier haben: Der eine tri t beispielsweise die Zellwand der Bakterien, sodass diese daran gehindert werden, ihre Schutzhülle aufzubauen. Ein anderer zielt auf den Sto wechsel der Bakterien und stört ihn empfindlich. Und der dritte Pfeil greift direkt das Erbgut der Mikroorganismen an. Alle drei Wirkweisen haben zur Folge, dass Bakterien entweder in ihrer Ausbreitung gehindert oder abgetötet werden.
Damit sind wir bereits beim nächsten Punkt: Antibiotika bekämpfen Bakterien zwar sehr e zient, aber sie können nicht zwischen nützlichen Bakterien – solchen, wie sie beispielsweise in unserem Darm überwiegend vorkommen – und krank machenden Bakterien unterscheiden. Dies führt dazu, dass zum Beispiel auch Darmbakterien abgetötet werden. In der Folge kann es zu Durchfall kommen. Oder die Hautbakterien werden in Mitleidenschaft gezogen, sodass sich eine Pilzerkrankung ausbreiten kann. Je nach Wirkweise des Antibiotikums werden zudem Übelkeit, Erbrechen, Hautrötungen sowie Überempfindlichkeitsreaktionen oder gar Störungen der Nierenfunktion als häufigste Nebenwirkungen genannt.
Antibiotika: nicht wirksam bei Viren, Pilzen und Parasiten
Antibiotika können zwar unerwünschte Wirkungen auslösen, sind aber dennoch sehr e ektiv. Sind sie also ein Wundermittel gegen jegliche Infektionen? Nein. Denn Antibiotika wirken nicht bei Infektionen, die durch Viren, Pilze oder Parasiten verursacht werden. Der Grund: Diese Erreger unterscheiden sich alle im Aufbau und im Stowechsel zu Bakterien. So haben Viren zum Beispiel keine bakterielle Zellwand, keinen eigenen Sto wechsel und auch das Erbgut ist anders zusammengesetzt. Antibiotika haben dadurch keinen Angri spunkt.
Die Schlussfolgerung daraus: Antibiotika helfen beispielsweise weder gegen die saisonale Grippe noch gegen eine COVIDInfektion – beides Krankheiten, die durch Viren verursacht werden.
Nochmals zurück zu Sarah: Fürchtet sie eine schwere Erkältung diesen Winter? «In meiner Apotheke erhielt ich nützliche Tipps, wie erste Symptome behandelt werden können», erzählt sie. So würde sie zum Beispiel eine Dampfinhalation machen oder einen geeigneten Nasenspray verwenden, um das Fortschreiten der Infektion einzudämmen. «Ich bin also zuversichtlich, dass ich diesen Winter ohne Sinusitis und Antibiotika durchkomme», sagt Sarah. Mit dieser Zuversicht kann der Winter gerne kommen.

Monika Wilders, Fachapothekerin in O zinpharmazie und Inhaberin der TopPharm Apotheke & Drogerie Erlinsbach, weiss Rat rund ums Thema Antibiotika.
Was gilt es bei der Antibiotikaeinnahme zu beachten?
Es ist wichtig, sich an die Dosierung und die Behandlungsdauer zu halten, um die optimale Wirkung des Antibiotikums zu erzielen. Setzen Sie das Antibiotikum nicht einfach ab, auch wenn Sie keine Symptome mehr haben. Zudem empfehle ich Ihnen, die Medikamente in der Regel mit Wasser einzunehmen, da die Einnahme mit Säften, Milchprodukten oder Alkohol die Aufnahme in den Körper beeinflussen kann. Halten Sie sich auch an die Einnahmezeitpunkte wie vor, nach oder 1–2 Stunden vor/nach dem Essen. Um einer Resistenzbildung vorzubeugen, sollten Sie zudem keine Einnahme vergessen.
Was empfehlen Sie, um möglichen Nebenwirkungen einer Antibiotikabehandlung vorzubeugen?
Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Probleme oder Vaginalpilzinfektionen können leider bei einer Antibiotikatherapie auftreten. Es kann zu Durchfall, Bauchschmerzen oder Übelkeit kommen. Um Darmprobleme zu verhindern, empfehle ich Ihnen, die Darmflora mit sogenannten Probiotika während oder spätestens nach der Antibiotikatherapie aufzubauen. Bei der Antibiotikaeinnahme ist ein zeitlicher Abstand von 1–2 Stunden zu beachten. Trinken Sie während der Therapie genügend Wasser und ernähren Sie sich mit Schonkost wie leicht verdaulichem Gemüse. Zur Vorbeugung von Vaginalpilzinfektionen empfehle ich die vaginale Anwendung von Milchsäurepräparaten, um die Vaginalflora wiederaufzubauen. Reinigen Sie den Intimbereich zudem nur mit Wasser.
Wir orientieren uns hauptsächlich über das Sehen. Daher schränken uns Probleme mit den Augen oftmals stark ein. Lesen Sie mehr über die häufigsten Augenbeschwerden. Von Christine Steiner
Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan, gleichzeitig gehören sie zu den empfindlichsten Körperteilen. Bei Problemen mit den Augen ist eine schnelle Abklärung wichtig. Folgende Augenbeschwerden treten häufig auf:
So können Sie Ihre Augen unterstützen
•Bei Sonnenschein eine Sonnenbrille mit entsprechendem UV-Schutz tragen
•Bei einer Allergie eine seitlich gut schliessende Sonnenbrille nutzen
•Regelmässiges Befeuchten der Augen, z.B. mit Tränenersatzmittel in Tropfen-, Gel- oder Sprayform
•«Blinzelpausen» einlegen, speziell bei Arbeiten am Computer
•Augen rollen und bewusst mit den Augen nach links/rechts/oben/unten schauen
•Fenster ö nen, denn frische Luft bringt auch Feuchtigkeit in den Raum (besonders im Winter wichtig)
•Genügend trinken: ausreichend Flüssigkeit ermöglicht die Produktion von Tränenflüssigkeit
• Gereizte Augen lassen sich mit kühlenden Gurkenscheiben oder Quarkwickeln beruhigen
•Zwei lauwarme Teebeutel Schwarztee auf die geschlossenen Augen legen (die enthaltenen Gerbsto e haben eine abschwellende Wirkung)
•Abends eine Zeit festlegen, ab wann nicht mehr auf das Handy geschaut wird
Trockene, gerötete Augen
Im Winter ist die Luft trocken und wir halten uns hauptsächlich in geschlossenen Räumen auf. Dies hat Auswirkungen auf unsere Augen und lässt sie eher tränen. Arbeiten wir zusätzlich am Computer, beugen uns über ein Tablet oder Handy, konzentrieren wir uns oft so stark, dass das Blinzeln der Augen vergessen geht. Normalerweise erzeugen wir durch Blinzeln rund 15’000 Lidschläge am Tag, das bedeutet, wir blinzeln pro Minute zwischen 15 und 25 Mal. So verteilen wir einen Tränenfilm über die Hornhaut. Blinzeln wir zu wenig, funktioniert das Benetzen der Augen nicht mehr oder zu wenig. Dies trocknet die Augen aus, sie beginnen zu schmerzen und röten sich. Aber nicht nur Bildschirmarbeit kann Beschwerden verursachen: Auch im Alter, aufgrund von Krankheiten oder anderen Umständen, kann sich der natürliche Tränenfilm der Augen reduzieren oder in der Zusammensetzung ändern. Mit künstlichen Tränen können Sie dem vorbeugen oder eine sich anbahnende Reizung lindern.
Bindehautentzündung
Die Bindehaut ist eine dünne, glasklare Schleimhaut, die den vorderen Teil unseres Augapfels, welcher nicht mit Hornhaut bedeckt ist, mit den Lidern verbindet. Wenn sie durch Fremdkörper oder Reizsto e gestört oder infiziert wird, entzündet sie sich und es zeigt sich eine Rötung im sichtbaren, weissen Teil des Auges. Man hat das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben. Dabei tränen und brennen die Augen und sondern oft ein Sekret ab. Diese Anzeichen können auf eine Bindehautentzündung hinweisen, die mit Abstand am häufigsten vorkommende Augenerkrankung. Eine Bindehautentzündung kann durch eine Allergie entstehen oder durch Viren, Bakterien und Pilze ausgelöst werden. Meistens klingen die Beschwerden nach einer Woche ab, selten dauern sie länger (vor allem bei Allergien). Bei leichten Beschwerden hilft es, kühlende Auflagen zum Lindern des Brennens und Juckens zu verwenden. Sie helfen auch zum Abschwellen. Zusätzliche künstliche Tränen (Augentropfen) oder Augengels unterstützen die Behandlung. Damit die Beschwerden gezielt behandelt werden können, ist es wichtig, die Ursache und den Schweregrad durch eine Fachperson abklären zu lassen. Gerade im Fall von Allergien kann eine Entzündung jedoch lange anhalten. Nicht immer ist es möglich, den Allergie-Auslöser zu meiden. Hält die Entzündung dadurch monatelang an, ist es wichtig, die genaue Ursache abzuklären und eine Behandlung zu starten.
Ein Gersten- oder Hagelkorn im Auge kann entstehen, wenn sich eine kleine Drüse am Lidrand entzündet. Dies ist für die Betro enen sehr unangenehm, in der Regel aber eine harmlose Augenlidentzündung. Die Entzündung kann am oberen oder unteren Augenlid entstehen; je nach betro ener Drüse nennt man es ein inneres oder äusseres Gerstenkorn.
Das Gerstenkorn wird umgangssprachlich auch oft «Urseli» oder «Gritli» genannt.
Die Bindehautentzündung ist die am häufigsten vorkommende Augenerkrankung.
Die Ursache kann zum Beispiel eine sichtbare Verdickung eines Wimpernhaarbalgs oder auf der Innenseite eine hochrote Vorwölbung sein. Die Talg- oder Schweissdrüsen schwellen an und der gesammelte Eiter zeigt sich häufig als dicker, gelber Punkt, entstanden durch eine bakterielle Infektion (etwa mit Staphylokokken oder Streptokokken). Verunreinigte Kosmetika oder unreine Kontaktlinsen können die Ursache dafür sein. Bei Kindern entsteht eine Entzündung, wenn sie sich mit ungewaschenen Händen die Augen reiben. Viele nennen das Gerstenkorn umgangssprachlich auch «Urseli» oder «Gritli». Ein Gerstenkorn muss nicht zwingend behandelt werden. Oft schwellen diese von alleine wieder ab. Bei einem chronisch auftretenden Gerstenkorn oder wenn sich nach einer Woche keine Besserung zeigt, sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden, da dies beispielsweise auch ein Anzeichen für Diabetes mellitus sein kann. Ein Hagelkorn ist nicht eitrig, schwillt auch nicht an und verursacht somit normalerweise keine Schmerzen. Es ist zudem nur die Lidhaut betro en. →



Ihre kleinen und grossen Halsschmerzen








Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.














Bei ersten Anzeichen von Halsbeschwerden: neo-angin® protect Dies ist ein Medizinprodukt.


Grüner Star (Glaukom)
Beim grünen Star handelt es sich um verschiedene Augenerkrankungen, bei welchen der Sehnerv nach und nach dauerhaft beschädigt wird. Zur Früherkennung bestimmter Glaukom-Formen empfiehlt es sich, ab dem 50. Lebensjahr regelmässig den Augeninnendruck messen zu lassen. Die Messung ist auch in einigen TopPharm Apotheken auf Anfrage möglich. Dank der entsprechenden Messgeräte ist es nicht nötig, dafür Tropfen ins Auge zu geben. Die Früherkennung eines erhöhten Augeninnendrucks kann zur Vorbeugung eines Glaukoms (Schädigung des Sehnervs) beitragen. Dieser kann bei zu spätem Erkennen Gesichtsfeldausfälle zur Folge haben.
Weitere Augenerkrankungen
Bei einigen Augenerkrankungen ist es wichtig, dass eine Augenärztin oder ein Augenarzt aufgesucht wird. Symptome wie Blitze vor den Augen, Schatten im Sehfeld, starke Schmerzen oder eine plötzliche Reduktion der Sehschärfe wie auch Verletzungen, Wunden, Prellungen müssen immer so schnell wie möglich ärztlich untersucht werden. Auch bei altersbedingter Makuladegeneration, grünem Star, grauem Star, Kurz- und Weitsichtigkeit oder Diabetes mellitus sind regelmässige Arzttermine unbedingt nötig.
Rasche Hilfe in der Apotheke Gerötete, juckende oder verklebte Augen sind zumeist Anzeichen für eine Bindehautentzündung. Damit diese Beschwerden gezielt behandelt werden können, ist es wichtig, der Ursache und dem Schweregrad auf den Grund zu gehen. Dazu können Sie direkt in den meisten TopPharm Apotheken eine vertiefte Abklärung vornehmen lassen.

Gürtelrose ist eine schmerzhafte Krankheit, die durch das gleiche Virus ausgelöst wird wie Windpocken: das Varizella-Zoster-Virus. Befinden sich die Erreger einmal im Körper, ist bei Immunschwäche Vorsicht geboten. Von
Wenn sich auf der Haut plötzlich kleine Bläschen und Rötungen zeigen, die wie ein Strang verlaufen, könnte es sich um Gürtelrose handeln. Der Name dieser Krankheit stammt aus dem Volksmund, da sich der Hautausschlag wie ein Gürtel am Körper abzeichnet. Im medizinischen Vokabular spricht man von Herpes Zoster, also von einem Virus, das von der Wirbelsäule aus einseitig entlang der Rippen zieht und zu einer schmerzhaften Entzündung führt.
Schlummern
die
Erreger einmal in den Nervenzellen des Körpers, können sie jederzeit reaktiviert werden.
Monika Bachmann





Dieser Erreger löst zuerst immer eine andere Erkrankung aus: die Windpocken (auch «wilde Blattern» genannt). Wer also als Kind oder als erwachsene Person davon betro en war, trägt ein Risiko, später als Zweiterkrankung unter der Gürtelrose zu leiden. Beide Krankheiten gehen auf dasselbe Virus zurück. Das heisst, die Gürtelrose ist immer die Folge einer Windpockenerkrankung. Schlummern die Erreger einmal in den Nervenzellen des Körpers, können sie jederzeit reaktiviert werden. Häufig sind es Stresssituationen zusammen mit einem geschwächten Immunsystem, die ein solches Szenario begünstigen und zu einem Ausbruch von Gürtelrose führen.
Ein Virus, zwei Krankheiten
Da viele Menschen einmal die Windpocken hatten, ist die Gürtelrose als Zweiterkrankung ein wichtiges Thema, wenn es um das «gesunde Altern» geht. Warum die Viren, die über Jahre oder sogar Jahrzehnte inaktiv waren, auf einmal wieder zum Leben erwachen, ist noch unklar. Doch es gibt bestimmte Faktoren, welche die Krankheit begünstigen können. Besonders betro en sind Frauen und Männer ab dem 50. Altersjahr, die an einer Immun-


schwäche oder an einer chronischen Erkrankung leiden, welche direkt oder über deren Behandlung das Immunsystem tangieren. Ist die körpereigene Abwehr geschwächt, haben die Viren ein leichteres Durchkommen. Grundsätzlich kann Gürtelrose aber auch bei jüngeren Menschen ausbrechen. Nicht zu unterschätzen sind auch psychische Elemente wie etwa ein Trauma oder eine überdurchschnittliche seelische sowie körperliche Belastung.
Gürtelrose frühzeitig behandeln Erste Anzeichen für eine Gürtelrose sind Schmerzen, Brennen oder Kribbeln in bestimmten Hautbereichen. Dazu kommen Fieber und Kopfschmerzen; Betro ene fühlen sich allgemein sehr unwohl, müde und stellen eine erhöhte Empfindlichkeit der Haut fest. In der Akutphase der Krankheit verbreitet sich der für Gürtelrose typische schmerzhafte Hautausschlag meist auf einer Körperseite. Es zeigen sich klare, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen auf roten Hautpartien. Diese können zusammenlaufen und über Tage eine gelbbraune Kruste bilden. Da es an den betro enen Stellen zu einem starken Juckreiz kommen
kann, ist eine frühzeitige Behandlung angesagt. Dazu muss die Fachärztin eine antivirale («den Virus bekämpfende») und schmerzstillende Therapie individuell auf den Patienten abstimmen. Eine passende Therapie kann daher zur Vorbeugung gewisser Komplikationen wie Sekundärinfektionen beitragen.
Das Immunsystem stärken Ist die Gürtelrose einmal ausgebrochen, zieht sie sich in der Regel über einige Wochen hin. Einige Menschen haben nur leichte Beschwerden, bei anderen hingegen treten Komplikationen auf. Diese können erheblich sein: Ist das Gesicht befallen, sind insbesondere die Augen und entsprechend das Sehvermögen gefährdet. Das Virus der Gürtelrose ist sogar in der Lage, einen chronischen Dauerschmerz zu verursachen, welcher nach Abheilen der eigentlichen Erkrankung anhält. Umso wichtiger ist die Prävention. Ihre Apothekerin oder Ihr Arzt berät Sie gerne bezüglich möglicher Massnahmen zur Prävention wie zum Beispiel der Gürtelrose-Impfung. Wer dazu auf eine gesunde Lebensweise, ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung und ausreichend Schlaf setzt, stärkt gleichzeitig auch das Immunsystem.
Gürtelrose-Impfung: auch in der Apotheke möglich Gemäss Impfplan 2024 wird die Impfung gegen Gürtelrose allen Personen über 65 Jahren empfohlen. Die Impfung ist in einigen TopPharm Apotheken auf Anfrage möglich.

Im Winter sinkt die Aussentemperatur weit unter unsere Körpertemperatur. Die Folge: Zittern, Frösteln und Hühnerhaut. Was gegen die Kälte hilft, erfahren Sie in diesem Beitrag. Von Moana Mika
Wer kennt es nicht: An einem kalten Winterabend auf den Bus zu warten, kann sich wie eine kleine Ewigkeit anfühlen. Zuerst werden Hände und Füsse kalt. Und dann kriecht die Kälte auch noch unangenehm durch alle Kleidungsschichten. Die Rückenmuskeln angespannt, die Schultern nach oben gezogen – aber der Bus ist immer noch nicht in Sicht. Schliesslich zittert’s und fröstelt’s am ganzen Körper.
Deshalb frösteln wir Frösteln mag wie eine lästige Begleiterscheinung in der kalten Jahreszeit wahrgenommen werden. Und doch ist es überlebenswichtig. Denn unsere Zellen und Organe haben eine innere Betriebstemperatur von rund 37 Grad Celsius – bei dieser Temperatur können sie ihre Aufgaben am besten wahrnehmen. Fällt die Körpertemperatur ab, kann es schnell einmal gefährlich werden: Die Nervenreflexe verlangsamen sich, das Bewusstsein ist eingeschränkt und im schlimmsten Fall treten Herzrhythmusstörungen auf.
Damit es nicht so weit kommt, hat unser Körper einen ausgeklügelten Mechanismus entwickelt. Und der funktioniert so: In unserer Haut liegen freie Nervenendigungen (sogenannte Thermorezeptoren), die wie Temperaturfühler funktionieren. Sobald sich deren Umgebungstemperatur ändert, leiten sie ein Signal an unser Gehirn weiter. Übrigens sind die Fühler nicht gleichmässig auf dem Körper verteilt: Nahe des Körperkerns – also zum Beispiel im Brustraum oder am Hals –gibt es mehr von den Rezeptoren als an den Händen und Füssen. Daher können unsere Hände auch mal kalt sein, ohne dass wir dies gleich wahrnehmen. Das Gehirn hat bei diesem Mechanismus eine zentrale Funktion: Es verfolgt laufend alle Rückmeldungen der Thermorezeptoren im Körper. Sinkt die Körpertemperatur aufgrund der Kälte, sendet das Gehirn Signale zurück in den Körper. Die Signale aktivieren unsere Muskeln, welche wiederum wie Heizkörper funktionieren: Indem sie sich anspannen und zittern, wird Wärme produziert.
Die Forschung hat gezeigt, dass sich der Mensch durchaus an die Kälte anpassen kann.
Das hat es mit der Hühnerhaut auf sich
Die Hühnerhaut ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als Vorfahren des Menschen noch stark behaart waren. Sie entsteht, wenn die kleinen Muskeln an den Haarwurzeln aktiviert werden. Die Härchen richten sich dadurch auf. Dies hat zur Funktion, die freigesetzte Wärme aus den Muskeln zurückhalten. Der Schaltkreis, der uns erwärmen soll, ist somit zwar ziemlich ausgeklügelt, nur leider nicht besonders e ektiv, weshalb wir auf isolierende Kleidung angewiesen sind.
So schützen Sie sich vor der Kälte
1.Setzen Sie auf gute Kleidung: Unser Körper produziert zwar Wärme, diese wird aber konstant über die Haut wieder abgegeben. Daher ist eine isolierende Kleiderschicht nötig. Tragen Sie am besten funktionale Kleidung, die Wind und Wasser abweist. Auch ein dicker Schal wirkt oft Wunder, da sich viele Thermorezeptoren am Hals und im Brustraum befinden.
2. Gehen Sie nach draussen: Indem wir uns der Kälte aussetzen, kann sich unser Körper bis zu einem gewissen Grad daran gewöhnen. Bewegen Sie sich daher täglich draussen. Bei einem Winterspaziergang zum Beispiel wird der Kreislauf angeregt und die Muskulatur aktiviert – beides wärmt.
3. Und wenn gar nichts mehr hilft: Wärmen Sie sich von innen. Dies gelingt am besten mit heissem Tee oder einer dampfenden Suppe. Auch eine warme Bettflasche auf dem Bauch kann helfen.
Allerdings hat die Forschung gezeigt, dass sich der Mensch durchaus an die Kälte anpassen kann. So wurde zum Beispiel bei indigenen Bevölkerungsgruppen in der Arktis ein erhöhter Grundumsatz gemessen. Das heisst, dass deren Körper automatisch mehr Wärme produziert. Ob dies eine Akklimatisation an die Kälte ist oder aufgrund von mehr körperlicher Tätigkeit zustande kommt, ist aber nach wie vor nicht ganz geklärt. Aufgrund unserer heutigen Lebensweise – mit funktionaler Kleidung und geheizten Räumen – spricht man anstelle von einer Anpassung an die Kälte eher von einer möglichen Gewöhnung. So zeigten Studien zum Beispiel, dass Menschen, die sich vermehrt der Kälte aussetzten, später zu zittern anfingen als solche, die kein Kältetraining machten.
Sie versorgt uns mit Atemluft, wehrt Krankheitserreger ab und weist uns den Weg durch die Welt der Düfte. Wie wichtig die Nase ist, merken wir jedoch oft erst, wenn sie bei einem Schnupfen verstopft ist. Was dann hilft und wie sich über die Nase sogar die Stimmung beeinflussen lässt, lesen Sie hier. Von Marion Anna Becker


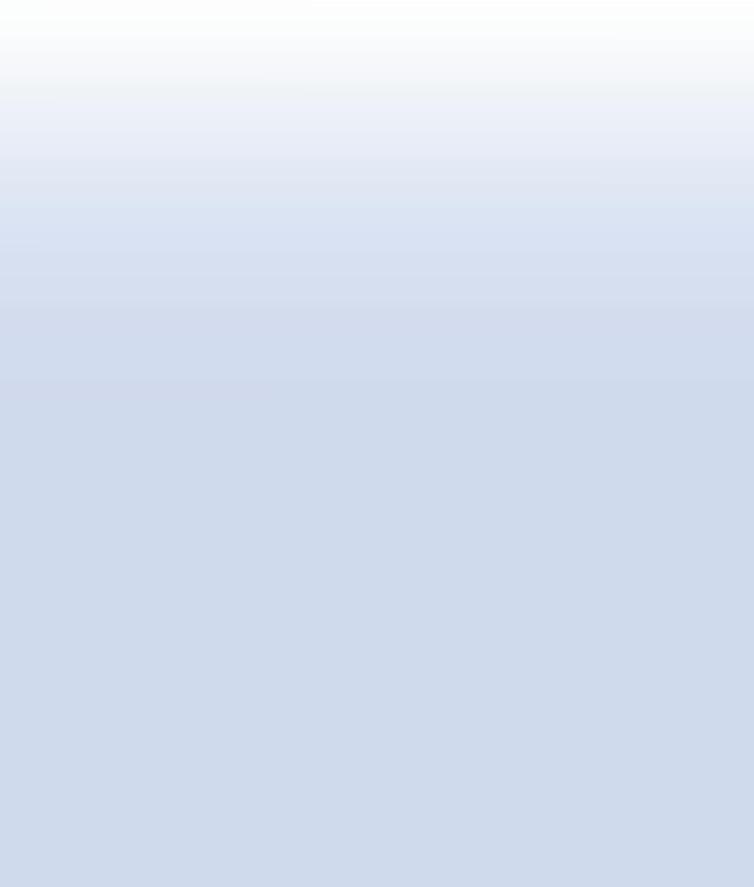

Dobere Nasenmuschel
mittlere Nasenmuschel
untere Nasenmuschel
ie Nase ist nicht nur ein markanter Teil des Gesichts, sie ist auch massgeblich an mindestens drei lebenswichtigen Körperfunktionen beteiligt: der Atmung, der Geruchswahrnehmung und der Erregerabwehr. Dabei ist die erstgenannte Funktion die o ensichtlichste, denn die Nase ist das Organ, durch das hauptsächlich frische Atemluft in den Körper strömt, und das letzte, durch das ihn verbrauchte Luft verlässt. Doch was hat die Nase mit dem Immunsystem zu tun und wie funktioniert eigentlich das Riechen?

Nasenskelett




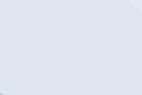

Knorpel
Nasenhaupthöhle


Nasenvorhof
Nasenlöcher
Wussten Sie, dass wir einen Grossteil unserer Nahrung nicht auf der Zunge, sondern über die Nase wahrnehmen?
Durch kleine Luftwirbel gelangen nämlich auch beim Kauen und Schlucken Duftsto e zu den Riechzellen. Ist die Nase durch Sekret verstopft, leidet daher auch der Geschmackssinn.
Multitalent Nasenschleimhaut
Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick in das Innere der Nase. Dort ist sie mit zwei verschiedenen Schleimhautarten ausgekleidet: der Atem- und der Riechschleimhaut. Die Atemschleimhaut ist mit feinsten Härchen besetzt, dem sogenannten Flimmerepithel. Dazwischen sitzen viele kleine Drüsen, die das Nasensekret bilden und dafür sorgen, dass die Schleimhäute feucht bleiben. Wie kleine Bürsten bewegen sich die feinen Flimmerhärchen hin und her. Zusammen mit dem gebildeten Sekret werden so Schmutz und Krankheitserreger aus der Nase «geputzt». Die Nasenschleimhaut bildet somit die erste Barriere des Körpers gegen eingeatmete Viren und Bakterien, was sie zu einem unverzichtbaren Teil der Immunabwehr macht.
Mindestens genauso wichtig sind die Funktionen der Riechschleimhaut. Diese befindet sich nur in einem sehr kleinen Bereich der Nase, ist aber mit vielen Millionen Riechzellen ausgestattet. Diese nehmen beim Einatmen flüchtige Duftsto e wahr und leiten sie an das Gehirn weiter, wo die Information verarbeitet und gespeichert wird.
So ist die Nase aufgebaut
Der sichtbare äussere Teil der Nase besteht im vorderen Bereich aus Knorpelgewebe und im hinteren aus dem knöchernen Nasenskelett. Die beiden Nasenlöcher bilden den Zugang zur inneren Nase. Dieser innere Teil wird durch eine Nasenhöhle gebildet, die von der Nasenscheidewand in zwei Hälften getrennt ist. Jede der beiden Nasenhöhlen weist einen Nasenvorhof und eine Nasenhaupthöhle auf. Letztere wird durch die Nasenmuscheln in den oberen, mittleren und unteren Nasengang unterteilt.
Die Nasenschleimhaut bildet die erste Barriere des Körpers gegen eingeatmete Viren und Bakterien.
Sekretstau – wenn die Nase bei Schnupfen verstopft ist
Die Schleimhaut der Nase ist mit vielen Blutgefässen durchzogen. Ist es draussen kalt, erweitern sich die Gefässe und die Schleimhaut schwillt an. Dadurch kann die Atemluft erwärmt und befeuchtet werden, bevor sie in die Lunge gelangt.
Zudem bildet durch Kälte gereizte
Schleimhaut mehr Sekret: Die Nase beginnt zu laufen und zwingt Sie, zum Taschentuch zu greifen. Was erst mal unangenehm erscheint, ist in Wahrheit ein cleverer Mechanismus des Immunsystems. Denn durch den vermehrten Schleim werden Viren und Bakterien aus der Nase gespült. Im Herbst und Winter kommen jedoch oft Erkältungsviren auf der Nasenschleimhaut an, welche eine (zum Glück oft unkomplizierte) Infektion der Nasenschleimhaut auslösen können: Es wird so viel Sekret gebildet, dass es zu einem Stau in den engen Nasengängen kommen kann. Dadurch verstopft die Nase immer mehr. Die Folge: Sie bekommen schlecht Luft, der Kopf dröhnt, Sie riechen und schmecken kaum noch etwas. Zwar klingen die Beschwerden eines erkältungsbedingten Schnupfens in der Regel in wenigen Tagen von allein wieder ab, dennoch sind sie oft sehr unangenehm. →
Wie Düfte Gefühle wecken
Signale zu den wahrgenommenen
Duftsto en erreichen - anders als andere Sinneswahrnehmungen - auf direkte Weise verschiedenste Hirnareale, welche für Gedächtnisverarbeitung und Emotionen zuständig sind. Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie beim Geruch frisch gebackener Guetzli an Kindheitstage denken müssen oder wenn sich beim Betreten einer Zahnarztpraxis ein banges Gefühl bei Ihnen einschleicht. Diese emotionalen Verbindungen sind fester Teil unseres Erinnerungsvermögens, welches wir schon früh in unserer Kindheit zu nutzen beginnen.
Ein Prinzip, das sich auch die Aromatherapie zunutze macht. Sie hat zum Ziel, mit wohltuenden Düften gezielt Beschwerden wie nervöse Unruhe, Ängste und Stimmungstiefs zu lindern. So sind zum Beispiel Düfte von Orange, Zitrone oder Bergamotte bekannt dafür, aufheiternd zu wirken, während das ätherische Öl von Lavendel oder Rose für Harmonie und Entspannung sorgen kann.

Schnell wieder durchatmen: Tipps gegen Schnupfen
Die wichtigste Massnahme gegen Schnupfen ist immer, es nach Möglichkeit gar nicht so weit kommen zu lassen. Deshalb ist gründliches
Händewaschen in der Erkältungszeit besonders wichtig. Zusätzlich lässt sich die Schleimhautfunktion von aussen unterstützen. Gehen Sie dafür viel an die frische Luft und sorgen Sie durch regelmässiges Lüften für ein gutes Raumklima. Erwischt es Sie dennoch, helfen Ihnen diese Tipps, schneller durch die Schnupfenzeit zu kommen:
1.Trinken Sie viel Wasser oder Tee, um festsitzenden Schleim zu verflüssigen.
2.Nasenspülungen mit Salzwasser helfen, Viren, Bakterien und Schleim aus den Atemwegen zu transportieren.
3. Ätherisches Eukalyptus- oder Pfe erminzöl löst festsitzendes Sekret und befreit so die Nase. Das Öl kann in stark verdünnter Form zum Inhalieren verwendet oder als Erkältungsbalsam auf Brust und Rücken aufgetragen werden. Alternativ können Sie Kapseln mit Eukalyptusöl aus der Apotheke einnehmen. Lassen Sie sich in der Apotheke beraten, ob ätherische Öle für Sie geeignet sind.
4.Nasensprays oder -tropfen mit den Wirksto en Xylometazolin oder Oxymetazolin haben einen gefässverengenden E ekt und lassen die Nasenschleimhaut abschwellen. Sie sollten aber nicht länger als sieben Tage angewendet werden.
Vertiefte Abklärung bei Erkältungs-/Grippesymptomen Symptome wie Gliederschmerzen, Fieber, Halsschmerzen, Husten, Ohrenschmerzen oder eine verstopfte/laufende Nase können verschiedene Ursachen haben. Damit Sie die Symptome gezielt behandeln können, ist oft eine Abklärung sinnvoll, ob diese eine virale oder eine bakterielle Ursache haben. Für eine medizinische Erstabklärung können Sie die Apotheke aufsuchen – dort werden Sie unkompliziert und diskret beraten. Bei Bedarf können in bestimmten Apotheken auch weiterführende Messungen (z.B. Entzündungswert) durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass Erkältungsund Grippesymptome auch auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen können. Ihre Apothekerin bzw. Ihr Apotheker berät Sie gerne, ob ein Test zur Abklärung bei Ihnen sinnvoll ist.
Es war ein ganz normaler
Waldspaziergang, der Rolf Lüschers Leben für immer verändern sollte. Der pensionierte Wirt (77) erzählt von seinem Kampf gegen die Borreliose und warum er trotzdem die Freude am Pilzesammeln nicht verloren hat. Von Vanessa Colombo
Rolf Lüscher wirkt entspannt, als er die Arbeit in seinem Garten in Seon im Kanton Aargau unterbricht. Doch als er von seinen Erlebnissen der letzten Jahre erzählt, wird deutlich, welche Herausforderungen er bewältigen musste. «Es fing alles mit einem harmlosen Waldspaziergang an», erinnert er sich. Ein Ausflug, der sein Leben auf den Kopf stellen sollte.

Von einer Rötung zum Krankenhaus
Ende August 2009 ist Lüscher, ein passionierter Pilzsammler, mit seiner Partnerin im Wald unterwegs. Trotz langer Hosen und Zeckenschutz entdeckt er am Abend eine Zecke an seinem Oberschenkel. Nichts Besonderes. «Zecken sind recht üblich, an manchen Tagen haben wir je bis zu vier Stück, die wir entfernen müssen», erzählt er. Diese Zecke lässt sich jedoch nicht entfernen, und Lüscher muss zum Arzt. Es scheint alles in Ordnung.
«Es fing alles mit einem harmlosen
Waldspaziergang an»
Rolf Lüscher vergisst den Stich wieder. Auch Wochen später, während einer Busfahrt auf einer Weinreise in Österreich, denkt er nicht daran, als er auf seinem Oberschenkel eine Rötung entdeckt. «Ich dachte, ich hätte mich verbrannt», erinnert er sich. In Wirklichkeit war dies aber die Wanderröte – ein typisches Symptom für Borreliose, die mit Antibiotika behandelt werden sollte. Rolf Lüscher unternimmt nichts, die Röte verschwindet von selbst wieder. →

«Ich gehe natürlich immer noch in den Wald zum Pilzesammeln»
Erst im Oktober, knapp zwei Monate nach dem Zeckenstich, kommt es zum Ausbruch. Rolf hat «Metzgete» in seinem Restaurant in Hendschiken, es ist volles Haus. «Es war ein Megastress und ich hatte viel zu tun.» Plötzlich hat Lüscher so starke Schmerzen, dass er nicht mehr gehen kann. «Ich musste fast auf allen vieren ins Bett kriechen.» Trotz Schmerzmitteln bessert sich sein Zustand nicht. Er fährt nach einigen Tagen ins Krankenhaus in Aarau, wo nach vielen Stunden und unzähligen Tests endlich eine Borreliose diagnostiziert wird.
Die Odyssee beginnt
Was folgt, ist eine medizinische Odyssee. Lüschers rechtes Bein ist gelähmt, auch im linken beginnen die Probleme. Er bekommt Antibiotika. Nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt und fünf Wochen Reha in Rheinfelden zeigt sich keine Besserung. «An beiden Orten ging ich mit gleich viel Schmerzen wieder raus», erinnert er sich kopfschüttelnd. Im Rollstuhl sitzend, kann er nicht arbeiten. Seine Partnerin muss das Restaurant allein führen. Die Rettung kommt durch einen Stammkunden, der Lüscher an einen inzwischen pensionierten Spezialisten in Zürich verweist. Nach einer vierwöchigen intensiven und intravenösen Antibiotikabehandlung spürt er endlich Linderung. «Am 23. Tag liessen die Schmerzen endlich nach.»
Wissen rettet Leben
Was viele nicht wissen: Die gängige Zeckenimpfung schützt nur gegen FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME), nicht aber gegen Borreliose. Das BAG schätzt, dass in der Schweiz jährlich 10’000 Personen an Borreliose erkranken. Etwa 5 bis 30 Prozent der Zecken sind mit dem Erreger infiziert.
Langzeitfolgen und neue Perspektiven
Die Borreliose hat beim 77-Jährigen Spuren hinterlassen. Drei Jahre lang musste er zur Physiotherapie. Nach monatelanger Therapie konnte er endlich wieder seine Zehen bewegen – ein emotionaler Moment. Über ein halbes Jahr war er arbeitsunfähig, eine enorme Herausforderung für den selbstständigen Wirt. «Meine Partnerin hat in dieser Zeit das Restaurant am Laufen gehalten», erzählt er voller Dankbarkeit. «Wir mussten auf ein einfacheres Menü umstellen, und ich habe sie am Telefon instruiert: vom Spitalbett aus, während sie am Herd stand.» Auch heute spürt Lüscher noch die Folgen. «Ich habe immer noch ein Kribbeln in der Fusssohle», erklärt er. «Und auf unebenem Boden fällt mir das Gehen schwer. Aber sonst gehts mir gut.»
Lüscher nutzt seine Erfahrungen, um andere zu warnen. «Es wird zu wenig über diese Krankheit geforscht», kritisiert er. «Und viele Ärztinnen und Ärzte erkennen die Symptome nicht.» Er rät Betro enen, sich an spezialisierte Fachpersonen zu wenden. «Eine frühe und richtige Behandlung ist entscheidend.» Trotz allem hat der pensionierte Wirt seine Lebensfreude nicht verloren. Mit einem Lächeln sagt er: «Ich gehe natürlich immer noch in den Wald zum Pilzesammeln.» Es bleibt sein liebstes Hobby – ein Beweis dafür, dass selbst nach schweren Zeiten die Freude am Leben zurückkehren kann.
Zeckenimpfung in Ihrer TopPharm Apotheke
In den meisten TopPharm Apotheken können Sie sich gegen FSME impfen lassen. Eine Impfung ist das ganze Jahr hindurch möglich. Idealerweise lässt man sich aber in den Wintermonaten gegen FSME impfen.
«Unsere Kundschaft soll sich auch mit sensiblen Themen vertrauensvoll an uns wenden können»
Nicht jedes gesundheitliche Problem bedingt einen Arztbesuch. Viele Anliegen lassen sich unkompliziert in der Apotheke abklären, wie Moritz Hauser, Geschäftsführer und Apotheker der TopPharm Apotheke & Drogerie Parc Rom in Müstair (GR), im Interview erklärt.
Von Jasmin Geissbühler
Herr Hauser, mit welchen Beschwerden oder Wünschen kommen Kundinnen und Kunden typischerweise zu Ihnen in die Apotheke? Ein Grossteil der Kundinnen und Kunden kommt mit leichten Beschwerden, die sie selbst behandeln möchten, zu uns. Eine kompetente Beratung mit passenden Produktempfehlungen ist dabei gefragt. Vor allem rezeptfreie, pflanzliche oder auch homöopathische Arzneimittel werden von uns empfohlen. Je nach Gesundheitsproblem kann aber auch eine intensivere Beratung samt vertiefter Abklärung nötig sein. Meist handelt es sich in diesen Fällen um Stammkunden, die eine kontinuierliche Betreuung durch uns und den persönlichen Service schätzen. Auch die Verlaufskontrolle von Therapien ist immer häufiger gefragt, etwa die Überprüfung der Blutfettwerte oder bei einer Eisensupplementierung die entsprechenden Eisenwerte. Besonders beliebt bei unserer Kundschaft ist zudem der Allergie-Check.
Wie stellen Sie die Privatsphäre in der Apotheke bei Beratungsgesprächen sicher?
Um eine vertrauliche und professionelle Beratung sicherzustellen, verfügen wir über einen separaten Beratungsraum, in dem Gespräche
über heikle oder persönliche Themen in einer ruhigen Atmosphäre geführt werden können. Wir legen grossen Wert darauf, dass sich unsere Kundinnen und Kunden wohl und ernst genommen fühlen. Sie sollen sich auch mit sensiblen Themen vertrauensvoll an uns wenden können. Der Beratungsraum ist dafür der ideale Ort.
Welche Art von Beratungen führen Sie in diesem Raum durch?
Sobald wir merken, dass eine Beratung für die Kundin oder den Kunden unangenehm wird oder sensible Themen berührt, bieten wir direkt ein Gespräch im Beratungsraum an. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine junge Frau nach der «Pille danach» verlangt; eine Mutter eine Windeldermatitis bei ihrem Baby vermutet oder es um die Abklärung eines Harnwegsinfektes geht. Wir nutzen den Raum ausserdem für die Durchführung verschiedenster Dienstleistungen wie den AllergieCheck, Impfungen, Wundversorgung, vertiefte Abklärungen oder diverse Messungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

«Unser Ziel ist es, die erste Anlaufstelle für die Gesundheitsprobleme unserer Kundinnen und Kunden zu sein»
Wie funktioniert eine «vertiefte Abklärung» und was kann man sich darunter vorstellen?
Die vertiefte Abklärung stellt, wie der Name bereits andeutet, eine fundierte Beurteilung eines komplexeren gesundheitlichen Problems dar. In einem ausführlichen Gespräch werden alle akuten Symptome sowie die medizinische Vorgeschichte erfasst und dokumentiert. Dies ermöglicht eine präzise Einschätzung der gesundheitlichen Situation der jeweiligen Person. Falls erforderlich werden zusätzliche Tests wie etwa eine Blutdruck- oder Blutzuckermessung durchgeführt und die Blutfette oder der Entzündungswert (CRP) bestimmt. Basierend auf den gesammelten Informationen gibt die Apothekerin oder der Apotheker dann Empfehlungen zu Behandlungsmöglichkeiten. Dabei orientieren wir uns an vorgegebenen Algorithmen, also Handlungsabfolgen, die
nach neusten wissenschaftlichen Standards mit Ärztinnen und Ärzten erarbeitet und laufend aktualisiert werden.
Welche Vorteile hat dieses Angebot für die Kundschaft?
Diese Form der Abklärung ermöglicht es uns, als Apotheke erste Anlaufstelle für die Gesundheitsprobleme unserer Kundinnen und Kunden zu sein. Ob verklebte Augen, ein leichter Harnwegsinfekt oder ein Hautekzem: Es ist nicht zwingend immer gleich ein Gang in die Arztpraxis erforderlich. Zahlreiche gängige Gesundheitsprobleme können so unkompliziert und ohne Voranmeldung direkt in der Apotheke behandelt werden.
Was aber, wenn für die Behandlung der Beschwerden ein rezeptpflichtiges Medikament nötig ist?
Seit 2019 besteht für Apothekerinnen und Apotheker die Möglichkeit, bestimmte vordefinierte verschreibungspflichtige Medikamente im Rahmen einer vertieften Abklärung und mit entsprechender Dokumentationspflicht ohne Rezept abzugeben. In diese sogenannte erleichterte Abgabe fallen Medikamente gegen häufig auftretende Beschwerden wie stärkere Schmerzen, Magen-Darm- und Atemwegsbeschwerden oder Hautprobleme. Nicht nur die Kundinnen und Kunden profitieren dabei von der sofortigen Hilfe, auch für die Arztpraxen und Notfallstationen stellt diese Möglichkeit eine Entlastung dar.
Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die vertiefte Abklärung?
Das ist in erster Linie abhängig vom Versicherungsmodell. Klären Sie deshalb eine allfällige Kostenübernahme sicherheitshalber im Voraus ab.
Welche Rückmeldungen erhalten Sie von Kundinnen und Kunden zu diesem Angebot?
Die Rückmeldungen unserer Kundschaft sind durchwegs positiv. Vor allem unsere italienischen Kundinnen und Kunden kennen das Angebot der vertieften Abklärung nicht und sind sehr dankbar für die unkomplizierte und rasche Hilfe, die sie damit bei uns erhalten. Auch liegen einige Dienstleistungen wie beispielsweise Impfen und Blutentnahme in Italien nicht in der Kompetenz der Apotheke. Unser Ziel ist es, die erste Anlaufstelle für die Gesundheitsprobleme unserer Kundinnen und Kunden zu sein.

Guetzli backen, Geschenke kaufen, Bekannte zum Adventska ee einladen – in der hektischen Vorweihnachtszeit sind Pausen zwischendurch besonders wichtig. Wir stellen acht bewährte Entspannungsmethoden vor, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Von Marion Anna Becker

Worum geht es?
Yoga ist eine jahrtausendealte Praxis, die Körperhaltungen (Asanas), Atemübungen (Pranayama) und Meditation miteinander kombiniert, um Beweglichkeit, Stärke und geistige Gelassenheit zu fördern. Es gibt viele verschiedene Yoga-Stile, von dynamischen Formen wie Vinyasa bis hin zu ruhigeren Varianten wie Hatha oder Yin Yoga.
Für wen eignet sich die Methode?
Wenn Sie eine Möglichkeit suchen, körperliche Aktivität mit geistiger Entspannung zu verbinden, ist Yoga bestens geeignet. Durch die verschiedenen Yoga-Stile lassen sich die Übungen gut auf individuelle Bedürfnisse anpassen. Bei körperlichen Einschränkungen oder akuten Verletzungen sollten Sie die Übungen nur nach Rücksprache mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt durchführen und eventuell eine andere entspannende Aktivität wählen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Eine typische Yoga-Einheit dauert 30 bis 60 Minuten. Um langfristig von der Wirkung der Übungen zu profitieren, sollten Sie Yoga mindestens zweimal pro Woche praktizieren.

Worum geht es?
Qigong ist eine Bewegungs-, Konzentrationsund Meditationsform aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Sie lernen dabei, Bewegungs-, Atem- und Meditationsübungen miteinander zu kombinieren, um das innere Gleichgewicht zu fördern und Energieblockaden zu lösen. Die sanften, fliessenden Bewegungen sind darauf ausgelegt, die Energieströme, das sogenannte «Qi», zu stärken und den Körper in Harmonie zu bringen.
Für wen eignet sich die Methode?
Wenn Sie eine sanfte, aber tiefgehende Methode zur Entspannung suchen, ist Qigong gut geeignet. Auch ältere Menschen oder Personen mit gewissen körperlichen Einschränkungen können die Übungen problemlos ausführen. Wenn Sie dagegen dynamische und kraftvolle Bewegungsformen bevorzugen, ist eine aktivere Entspannungsmethode wie Yoga vermutlich besser für Sie geeignet. →
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Eine typische Abfolge von Qigong-Übungen dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Um langfristige, gesundheitliche Vorteile zu erzielen, sollten Sie die Technik täglich oder mindestens dreimal pro Woche anwenden.

Worum geht es?
Bei der Meditation lernen Sie, Ihre Aufmerksamkeit bewusst zu steuern und sie beispielsweise auf Ihren Atem oder auf ein Mantra –dies kann ein Wort oder auch ein kurzer Satz sein – zu richten. Diese Praxis dient dazu, den Geist zu beruhigen und einen Zustand der inneren Klarheit zu erreichen. Es gibt zahlreiche Formen der Meditation, von der Atemmeditation über die geführte Meditation bis hin zur stillen Sitzmeditation.
Für wen eignet sich die Methode?
Wenn Sie einen Ausgleich zum stressigen Alltag suchen, ist Meditation genau richtig, denn die Übungen schulen Ihre Achtsamkeit, verbessern die Konzentration und können zu mehr Ruhe und Gelassenheit verhelfen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, längere Zeit still zu sitzen, oder wenn Ihr Geist ständig in Bewegung ist, kann es anfangs schwierig sein, sich auf die Übungen einzulassen. Hier könnte eine Kombination mit aktiveren Entspannungsmethoden wie Yoga sinnvoll sein.
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Für das Meditieren sollten Sie sich an mindestens drei Tagen pro Woche etwa 10 bis 30 Minuten Zeit nehmen. Je häufiger Sie üben, desto nachhaltiger ist die Wirkung auf Ihr Wohlbefinden.

Worum geht es?
Unter Stress, wie seelischer Anspannung, spannen wir oft unbewusst die Muskeln an, was zu Blockaden führen kann. Bei der Progressiven Muskelentspannung, kurz PMR, werden Sie angeleitet, nacheinander verschiedene Muskelgruppen des Körpers gezielt anzuspannen und wieder zu lockern. So lernen Sie, Ihren Körper besser wahrzunehmen und muskuläre Anspannung zu erkennen und abzubauen. Gleichzeitig kann damit versucht werden, seelische Anspannung wie Angstzustände oder Anzeichen von Nervosität zu reduzieren.
Für wen eignet sich die Methode?
PMR ist gut geeignet, wenn Sie unter Verspannungen und emotionaler Belastung mit Stresssymptomen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Schlafstörungen leiden. Die Methode ist leicht erlernbar und kann im Sitzen oder im Liegen ausgeführt werden. Bei akuten Muskel- oder Gelenkbeschwerden sollten Sie vor dem Üben jedoch vorsichtshalber mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt sprechen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich auf körperliche Empfindungen zu konzentrieren, könnte eine aktivere Form der Entspannung (z.B. Yoga) besser geeignet sein.
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Eine PMR-Einheit dauert in der Regel 15 bis 30 Minuten. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Übungen mindestens dreimal pro Woche durchführen.
Stress lässt sich gut mit Atemtechniken abbauen.

Worum geht es?
Beim autogenen Training nutzen Sie die Kraft Ihrer Gedanken, um zu innerer Ruhe und mehr Gelassenheit zu finden. Dafür wenden Sie sogenannte Autosuggestionen an: Sie sagen sich zum Beispiel «Mein rechter Arm ist ganz schwer» oder «Mein Herz schlägt ruhig und gleichmässig». Mit etwas Übung können sich die suggerierten Empfindungen tatsächlich einstellen, wodurch sich körperliche und seelische Anspannung reduzieren lässt.
Für wen eignet sich die Methode?
Wenn Sie systematisch an Ihrer Stressbewältigung arbeiten möchten, ist autogenes Training ideal. Auch bei gesundheitlichen Beschwerden wie Bluthochdruck, bei chronischen Schmerzen und bei Ein- und Durchschlafstörungen können die Autosuggestionen positive E ekte erzielen. Es erfordert jedoch etwas Übung und Geduld, bis die volle Wirkung spürbar wird. Daher ist die Technik weniger geeignet für Menschen, die sich unmittelbare Entspannung wünschen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Eine Übungseinheit dauert beim autogenen Training etwa 15 bis 20 Minuten und sollte täglich oder mindestens dreimal pro Woche praktiziert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Worum geht es?
Atemtechniken sind einfache, aber e ektive Methoden, um Stress abzubauen. Sie basieren auf der bewussten Kontrolle des Atems. Beispiele hierfür sind das tiefe Einatmen in den Bauch (Bauch- bzw. Zwerchfellatmung) oder das 4-7-8-Atemmuster, bei dem man einige Atemzüge lang 4 Sekunden einatmet, 7 Sekunden den Atem anhält und dann 8 Sekunden lang durch den geö neten Mund ausatmet.
Für wen eignet sich die Methode und für wen nicht?
Atemtechniken können in wenigen Minuten zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit verhelfen. Dadurch sind sie auch bei kleinem Zeitbudget ideal. Die Übungen sind leicht in den Alltag integrierbar, benötigen keine Vorkenntnisse und können nahezu überall durchgeführt werden. Bei Atemwegsbeschwerden sollten Sie vor dem Anwenden der Übungen jedoch vorsichtshalber mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt sprechen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Atemübungen dauern in der Regel nur 3 bis 10 Minuten. Sie können mehrmals täglich angewendet werden, vor allem in stressigen Situationen, als regelmässiges Ritual zur Beruhigung oder vor dem Einschlafen.
Gestresst? Ihre TopPharm Apotheke weiss Rat! Wenn Sie unter Beschwerden wie Schlafstörungen leiden, sich oft nervös und unruhig fühlen, kann das auf zu viel Stress in Ihrem Alltag hindeuten. Gerne beraten Sie die Teams der TopPharm Apotheken, wie Sie zum Beispiel mit bewährten heilpflanzlichen Mitteln wieder mehr Ruhe finden können.

Lang anhaltende oder wiederkehrende Entzündungsherde in unserem Körper sind ein Risikofaktor für weitverbreitete Krankheiten. Unsere Ernährungsweise kann einen bedeutenden Einfluss darauf haben.
Von Inga Pfannebecker
Entzündliche Prozesse sind an der Entstehung vieler Krankheiten mitbeteiligt. Entzündungsherde, die unter bestimmten Bedingungen unbemerkt in unserem Körper entstehen, können auf Dauer die Entstehung chronischer Erkrankungen begünstigen.
Antientzündliche Ernährung
Was wir essen, kann einen Einfluss auf die Entstehung oder das Fortschreiten dieser Entzündungsherde haben. Während eine Ernährung reich an freiem Fruchtzucker, Frischmilchprodukten, Wurstwaren und Fertiggerichten eher entzündungsfördernd wirkt, können wir mit reichlich pflanzlichen Lebensmitteln, gesunden Ölen und fettreichen Fischen gegensteuern.
Gesundheitszentrale Darm
Entscheidend für die antientzündliche Wirkung von pflanzlichen Lebensmitteln ist ihr hoher Ballaststo anteil. Die unverdaulichen Sto e sind bestes Futter für die Bakterien im Dickdarm. Bei der Fermentation der Ballaststo e durch die Bakterien entstehen antientzündliche Botensto e, die ihre
Für 2 Portionen 1 entsteinte MedjoolDattel und 30 g geschälte Hanfsamen mit 375 ml Wasser in einem leistungsstarken Mixer fein pürieren. Flüssigkeit mit 75 g Haferflocken, 25 g geschrotetem Leinsamen, ¼ TL Kurkumapulver und 1 Prise Salz in einen Topf geben. Alles aufkochen und unter Rühren ca. 5 Minuten köcheln lassen. Inzwischen 1 grossen Apfel waschen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden. In 1 TL zum Braten geeignetem Rapsöl unter Wenden 2–3 Minuten anbraten. 2 TL Ahornsirup, ½ TL Zimt und 100 g Blaubeeren (frisch oder tiefgekühlt) zugeben und zugedeckt 2–3 Minuten dünsten, bis die Apfelspalten beginnen weich zu werden. Porridge vom Herd nehmen und 2 TL ungesüsstes Nuss- oder Mandelmus unterrühren. In zwei Schalen verteilen. Obst darauf verteilen. Mit 30 g gerösteten, gehackten Baumnusskernen bestreut servieren.
Mögliche Lebensmittel für eine antientzündliche Ernährung
• Naturreis
• Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen
• Fettreiche Fische wie Lachs, Makrele, Thunfisch
• Gemüse, Obst, Salat und Kräuter
• Nüsse, Kerne und Samen wie z.B. Baumnüsse, Haselnüsse und Kürbiskerne
• Bestimmte pflanzliche Öle wie Oliven-, Nuss- oder Leinöl
• Gewürze wie z.B. Kurkuma oder Pfe er
Entzündungsfördernde Lebensmittel
• Weissmehlprodukte (z.B. Weissbrot, Nudeln, Reis)
• Tierische Lebensmittel mit vielen gesättigten Fettsäuren und verarbeitete Fleisch- und Wurstprodukte
• Fertiggerichte und industriell hergestellte Backwaren, die Transfette enthalten
• Zucker, zuckerreiche Lebensmittel mit viel Fruchtzucker, aber auch Ersatzzucker wie Agavendicksaft
• Bestimmte pflanzliche Öle wie Sonnenblumenöl, tierische Fette wie Butter oder Schmalz, Kokosöl, pflanzliche Streichfette mit gehärteten Fetten wie z.B. Margarine
Wirkung in anderen Bereichen des Körpers entfalten können. Ein gesundes Mikrobiom im Darm kann so helfen, Entzündungen zu lindern. Ein weiterer Faktor für die antientzündliche Wirkung von pflanzlichen Lebensmitteln sind ihre sekundären Pflanzensto e. Sie können freie Radikale binden, die beispielsweise durch UV-Strahlung oder Rauchen entstehen und Entzündungsherde fördern können.
Gesunde Fette
Omega-3-Fettsäuren, die beispielsweise in Baumnüssen, Leinsamen, Ölen wie Lein- oder Nussöl und in fettreichen Seefischen stecken, können Entzündungen entgegenwirken. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer essen jedoch zu wenig davon; wobei mehrfach ungesättigte Fette wie Omega-3- und -6-Fettsäuren nicht mehr als 5% unserer Gesamtkalorien ausmachen sollten. Dies
ist eine Möglichkeit, weshalb Entzündungen im Körper entstehen. Mit dem bewussten und regelmässigen Verzehr von Omega-3-reichen Lebensmitteln können Entzündungen entsprechend reduziert oder gar verhindert werden.
In Balance bleiben Entzündungsförderliche Lebensmittel können sich auf verschiedene Weise negativ auf die Gesundheit auswirken. Verarbeitetes Fleisch enthält Sto e wie Arachidonsäure und Transfette, die Entzündungen fördern können. Zu viel Zucker kann dazu beitragen, dass unser Bauchfett entzündungsfördernde Botensto e ausschüttet. Ernähren wir uns bewusst mit vielen antienzündlichen Lebensmitteln, können diese negative E ekte ausgleichen. Ausreichend Schlaf und regelmässige körperliche Aktivität helfen zusätzlich, Entzündungen zu verhindern und die Gesundheit zu fördern.



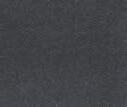






































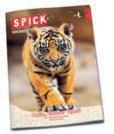





























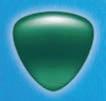











Gesamtwert: CHF 500.–
Gewinnen Sie einen von 5 TopPharm Gutscheinen im Wert von je CHF 100.– (einlösbar in allen TopPharm Apotheken). So nehmen Sie teil: Lösungswort online unter www.toppharm.ch/kreuzwortraetsel-424 eingeben (kostenlos).
Scannen und teilnehmen!
Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird keine Korrespondenz geführt. Mitarbeitende der TopPharm Apotheken und Drogerien Genossenschaft sind nicht teilnahmeberechtigt. Die GewinnerInnen werden schriftlich benachrichtigt. Keine Barauszahlungen. Die Datenschutzerklärung ist online abrufbar (www.toppharm.ch/datenschutzerklaerung).
Teilnahmeschluss: 28. Februar 2025
GewinnerInnen Ausgabe 3/24: Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
20× PUNKTE
mit der myTopPharm Treuekarte

Wirkt doppelt bei Schnupfen:
Öffnet die Nase und löst den Schleim.
Zum Beispiel Triofan ® Schnupfen* ohne
Konservierungsmittel Erwachsene Spray, 10 ml
| VERFORA AG, Villars-sur-Glâne

Bei akutem Durchfall:
20× PUNKTE
Zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfallerkrankungen, wie Gastroenteritis, MagenDarm-Grippe oder Reisediarrhö. Ab 3 Jahren. Perenterol Lyo-Sol*, 10 Einzeldosen | Zambon Schweiz AG, Cadempino
20× PUNKTE

Nährende Pflege von Weleda für weiche und geschmeidige Haut, die intensiv mit Feuchtigkeit versorgt wird.
Arnika Massage-Öl, 100 ml
Skin Food Body Butter, 150 ml
Skin Food, 75 ml
| Weleda, Arlesheim
20× PUNKTE

Bekämpft 6 Grippe & Erkältungssymptome: Fieber, Kopf- & Gliederschmerzen, Schüttelfrost, verstopfte & laufende Nase.
NeoCitran Grippe/Erkältung Sachet*, 12 Beutel | Haleon Schweiz AG, Risch
* Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson in Ihrer TopPharm Apotheke beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
Angebote gültig vom 01.12.2024 bis 28.02.2025 für Kundinnen und Kunden mit der myTopPharm Treuekarte. Keine Treuekarte? Melden Sie sich online unter www.mytoppharm.ch an und profitieren Sie bei Ihrem nächsten Einkauf. Für den Inhalt der Werbung ist die Vertriebsfirma verantwortlich.
mytoppharm.ch
Jetzt kostenlos registrieren und 499 Startpunkte erhalten!

Jetzt bei jedem Einkauf mit myTopPharm Punkte sammeln, profitieren und digital einlösen. Ihre Gesundheit. Unser Engagement.
Walid Hachicha
Apotheker

Walid Hachicha ist Apotheker und Geschäftsführer der TopPharm Emmen Apotheke in Emmenbrücke.
Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Wasser und regelmässige Bewegung sind wichtig für unser Immunsystem. Auch warme Kleidung und genügend Schlaf helfen, Erkältungen vorzubeugen. Ebenfalls trägt Vitamin D zu Ihrer normalen Immunabwehr bei. Sie können es durch Lebensmittel wie fetten Fisch und Eier oder Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen.