

Immer wieder Neues wagen
Julia Franz Richter über ihre Rollen in »Welcome Home Baby« und »Mother’s Baby«



Julia Franz Richter über ihre Rollen in »Welcome Home Baby« und »Mother’s Baby«
Kultur kann.


Entdecke dein persönliches Kulturprogramm in deiner Stadt – einfach, digital, für dich!



Kultur ist für alle da – ohne Barrieren oder Grenzen. Daher fördert die Stadt das Kulturprogramm und bietet dir einen gesammelten Überblick über das vielfältige Angebot: von kostenlosen Eintritten bis zu frei zugänglichen Veranstaltungen. Zum Mitmachen, Zuschauen und Dabeisein.
Medien sind blöd. Nein, ehrlich! Ich bin Medienwissenschaftler, ich muss das wissen. Das ist zwar ein /argumentum ad verecundiam/ (»Argument durch Ehrfurcht«), wie ich gerade ergoogelt habe, stimmt aber trotzdem. Denn, anstatt dass unsere Autor*innen einfach ihr Wissen, ihre Recherche und ihre Meinungen unmittelbar in eure Hirne beamen können, müssen sie den mühsamen Umweg gehen, ihre Gedanken erst in Sprache umzuwandeln, damit sie dann redigiert, gelayoutet, gedruckt, versandt, gelesen und – hoffentlich richtig! – verstanden werden. Mühsam das alles. Blöd eben.
Wirklich blöd wird es aber dann, wenn man ein bisschen Marshall McLuhan hinzuzieht – »The Medium Is the Message« etc. – und bedenkt, dass Medien ihre Inhalte nicht einfach neutral weitergeben, sondern immer nach ihren Möglichkeiten und Limitierungen formen. Das merkt man spätestens, wenn man versucht, eine 20.000-Zeichen-Coverstory in einen 280-Zeichen–Tweet zu verwandeln. The Platform (Formerly Known as Twitter) scheint mir überhaupt, als wäre sie im Labor dafür herangezüchtet worden, möglichst leicht und schnell möglichst vehemente Shitstorms auszulösen: Der Verlust von Nuancen durch die Kürze, das Aus-dem-Kontext-Reißen durch Retweets sowie die geringe Kontrolle über den Adressat*innenkreis laden quasi dazu ein, Aussagen misszuverstehen, Streits zu eskalieren, Uninformierte zu involvieren und Polarisierungen zu verstärken.
An dieser Stelle werden dann gerne die bösen Filterbubbles heraufbeschworen, doch ich halte es da eher mit dem Soziologen (Ehrfurcht!) Simon Cottee, der 2022 in der Zeitschrift The Atlantic argumentierte, dass unsere zunehmende gesellschaftliche Polarisierung nicht auf einen Mangel an Kontakt mit anderen Meinungen, sondern umgekehrt auf die schier ungebremste Flut an konträren, kontextlosen Meinungen zurückzuführen sei, auf die wir instinktiv mit Ablehnung reagieren. In der Endlosschleife des Algorithmus zählt ja auch nicht, ob uns gefällt, was wir gerade sehen, sondern nur, dass wir auf der Plattform bleiben, mit ihr interagieren, nicht gelangweilt wegklicken. Und Wut kann ein sehr guter Motivator für Engagement sein.
Genau um diesem Prozess entgegenzuwirken, braucht es Empathie, braucht es die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, dass hinter den 280 Zeichen ein Mensch mit einer eigenen Lebensgeschichte, mit Erfahrungen, Gefühlen, Ängsten und Sorgen steckt. Die Fähigkeit, bei aller Blendkraft von Medium und Message den Sender nicht zu vergessen.

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at
Web www.thegap.at
Facebook www.facebook.com / thegapmagazin
Twitter @the_gap
Instagram thegapmag
Issuu the_gap
Herausgeber
Manuel Fronhofer, Thomas Heher
Chefredaktion
Bernhard Frena
Leitender Redakteur
Manfred Gram
Gestaltung
Markus Raffetseder
Autor*innen dieser Ausgabe
Luise Aymar, Lara Cortellini, Sandra Fleck, Barbara Fohringer, Ania Gleich, Tizia Gulz, Johanna T. Hellmich, Selma Hörmann, Carina Karner, Anja Linhart, Veronika Metzger, Martin Mühl, Tobias Natter, Dominik Oswald, Simon Pfeifer, Sarah Wetzlmayr
Kolumnist*innen
Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner
Fotograf*innen dieser Ausgabe
Luca Celine, Alexander Galler
Coverfoto
Luca Celine
Lektorat
Jana Wachtmann
Anzeigenverkauf
Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl
Distribution
Wolfgang Grob
Druck
Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.
Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien
Geschäftsführung
Thomas Heher
Produktion & Medieninhaberin
Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien
Kontakt
The Gap c/o Comrades GmbH Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at
Bankverbindung
Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX
Abonnement
6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at
Heftpreis
€ 0,—
Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.
Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.
020 Friends and Benefits
Wer hat Musikförderungen verdient?
024 Komplizierte Solidarität
Antisemitismus in der österreichischen Kulturszene
028 Sesseltanz der Intendanz
Was bedeutet ein Führungswechsel im Theater?
032 »Ein Theaterabend
funktioniert nur im Team« Hinter den Kulissen dreier österreichischer Bühnen



Bühne Von den Brettern, die die Welt bedeuten
003 Editorial / Impressum
006 Comics aus Österreich: Vinz Schwarzbauer
007 Charts
018 Golden Frame
040 Prosa: Julia Pustet
042 Gewinnen
043 Rezensionen
052 Termine
010 Gender Gap: Toni Patzak
060 Screen Lights: Christoph Prenner
066 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl
Unsere Autorin Anja ist der lebende Beweis dafür, dass The Gap nicht nur zur Deko überall herumliegt. Als die gebürtige Wienerin nämlich im Filmcasino über eine Ausgabe stolperte, war sie – nach eigenen Angaben, bitte! – sofort begeistert und bewarb sich gleich bei uns. Und schon schreibt sie die Coverstory. Aber es geht ja auch um ihr Lieblingsthema: Film sowie die Menschen dahinter. Wer abseits von diesem Heft mehr darüber lesen möchte, wird auf ihrer Website www. dasfilmchen.com fündig.
Mitarbeiter*innen eines Popkulturmagazins werden ja gerne mal als »Berufsjugendliche« bezeichnet. Diesen Vorwurf muss sich Leo nicht gefallen lassen, ist er doch eher ein Jugendlicher mit Beruf. Einen Monat lang unterstützte er unsere Redaktion nämlich als Pflichtpraktikant und zog dafür extra aus dem fernen Hall in Tirol nach Wien. Als Grafiker polierte er unter anderem unseren SocialMedia-Bereich auf Hochglanz. Die neuen, schönen, bunten Kacheln auf Insta haben wir ihm zu verdanken.

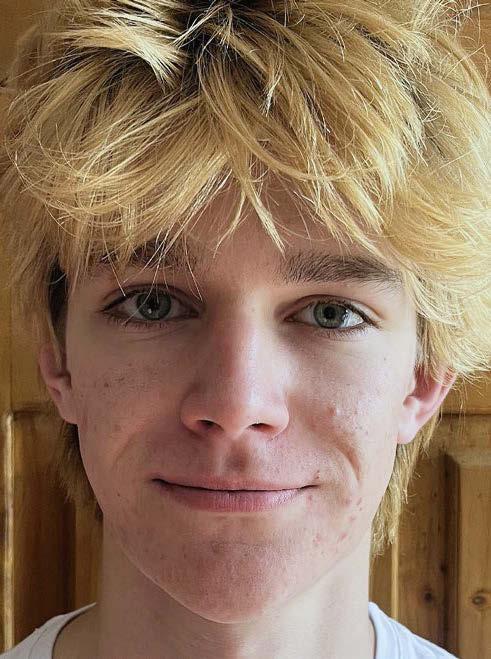

Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal erzählt Vinz Schwarzbauer eine Gruselgeschichte. ———— Vinz Schwarzbauers Stil ist ziemlich unverkennbar: markanter schwarzer Strich, starke Kontraste, reduziert eingesetzte Kolorierungen in Graustufen. Markant ist allerdings auch sein Einsatz von Schrift. Während andere auf Handlettering schwören, darum bemüht, die Schere zwischen den beiden Grundelementen Text und Bild möglichst zu schließen, stößt Schwarzbauer uns quasi mit der Nase darauf. In seinem Graphic-Novel-Debüt »Mäander«, 2023 im Verlag Edition Moderne erschienen, ging er sogar so weit, Text- und Bildebene teilweise auf getrennten Seiten anzuordnen. Aber auch im umseitigen Comic erzeugt die harte, nüchterne Digitalschriftart eine deutliche Distanz.
Vinz Schwarzbauer ist ein in Wien lebender Comiczeichner und Illustrator. Zwölf Jahre lang gab er gemeinsam mit anderen Künstler*innen das Magazin Franz the Lonely Austrionaut heraus. Seit 2022 ist er im Leitungsteam der Kabinett Comicpassage.
Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com
SABLATNIKMOOR, SÜDKÄRNTEN, 2025 SEIT ÜBER NEUNZIG JAHREN WACHE ICH TREU ÜBER SEE UND MOOR.
1932 KEHRTE DER SEE ENDLICH AUS SLOWENISCHER HAND ZURÜCK IN UNSERE OBHUT UND DAMIT WIEDER IN UNSERE HEIMAT. DAMALS WAR ICH NOCH IM JUGENDLAGER DES TURNERBUNDES, GEMEINSAM MIT MEINEN KAMERADEN.
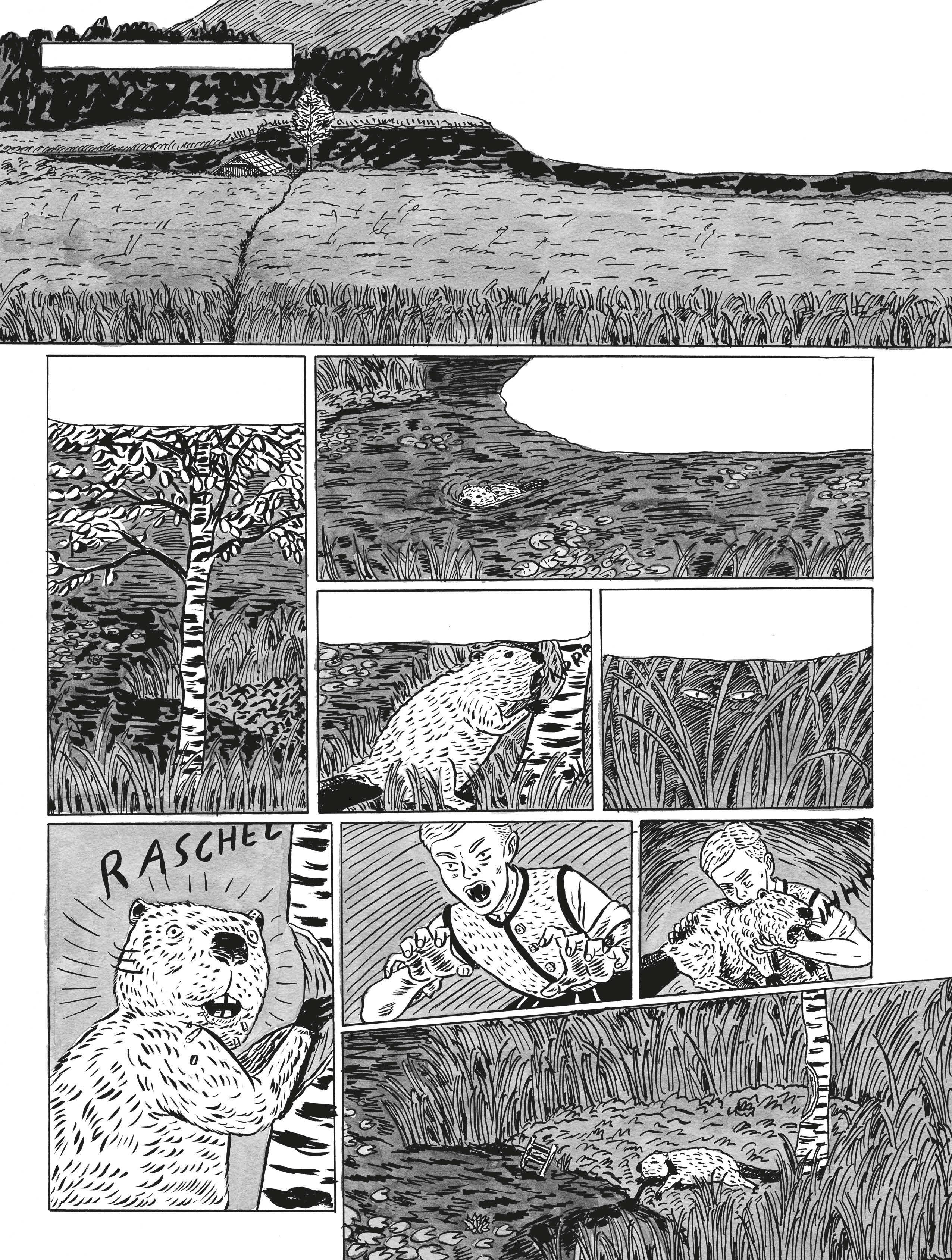
WIR SCHÜTZEN SEITHER DIE HEIMISCHE FLORA UND FAUNA, WIE DIE KÄRNTNER MOORBIRKE.
AUCH IN UNSEREM SEE TREIBT EIN BIBER SEIN UNWESEN.
VOR 20 JAHREN WURDEN FREMDE BIBER IN UNSEREN FEUCHTGEBIETEN AUSGESETZT. DIE NAGER WAREN SEIT ÜBER 200 JAHREN NICHT MEHR BEI UNS ANSÄSSIG.
DIE POPULATION IST IN DEN LETZTEN JAHREN ENTARTET. SEITHER IST DER BIBER WIEDER ZUR JAGD FREIGEGEBEN.
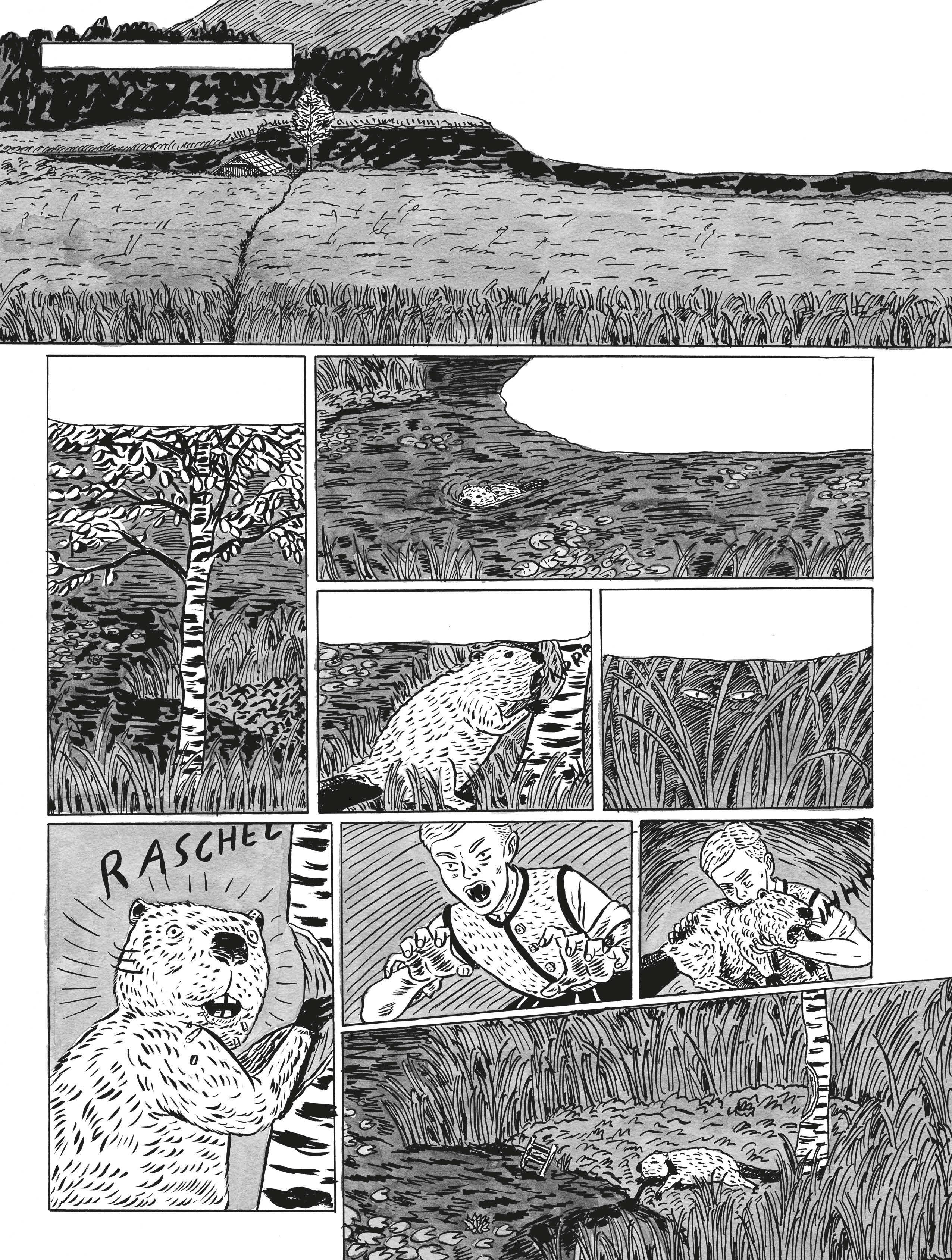
ImmerwiederFilme
01 »I Love Vienna« (1991)
02 »When We Were Kings« (1996)
03 »Elvis – That’s the Way It Is« (1970)
04 »Let’s Get Lost« (1988)
05 »A Star Is Born« (1976)
06 »Die Ahnungslosen« (2001)
07 »Blue Steel« (1989)
08 »Rush« (2013)
09 »Diego Maradona« (2019)
10 »Kedi – Von Katzen und Menschen« (2016)
Einzigartig an Wien

01 Einzige Weltstadt mit eigenem Weinanbau im Stadtgebiet
02 Erste Stadt der Welt, die Diversity-Ampeln einführte
03 Hat das beste Trinkwasser der Welt
Auch nicht schlecht:
Frische Semmel mit drei Schwedenbomben
Banu Mukhey ist Kuratorin und Projektleiterin des modernen Wanderkinos EU XXL. Die Reihe bringt seit zwanzig Jahren europäische Filme in kleinere Gemeinden Österreichs.
Tppfeler
01 Dnake!
02 Kewin Problem
03 Libe …
04 Vernastaltung
05 udn
06 Bitttt3!1
07 Knanst dud as machen?
08 Bin krnak
09 Ahnang vergessn
10 Liebe Größe!
TOP 03
Enden für ein Theaterstück
01 Kuss!
02 Schuss!
03 Black.
Auch nicht schlecht
Ein Bier am Strand von Barcelona

Bernhard Studlar ist Dramatiker und leitet das Autor*innenprojekt
Wiener Wortstaetten, das Ende November seinen zwanzigsten Geburtstag feiert. Dabei verwandelt sich das Theater am Werk am Petersplatz von 26. bis 28. November in ein »House of Words«.





























6 Ausgaben um nur € 19,97
Aboprämie: Oska »Refined Believer« (CD)
Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?

Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturschaffen aus und in Österreich begleitet?
Dann haben wir für euch das The-Gap-Jahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.

Über drei Jahrzehnte bedient das Magazin Skug seine kleine, aber feine Leser*innenschaft schon mit popkulturellen Themen abseits des Mainstreams. ———— Skug, das steht für »subkultureller Untergrund«. Seit 1990 setzt sich das Magazin mit den Nischen der Musik- und Kulturwelt auseinander. Dass sich Subkultur mittlerweile völlig anders gestaltet als noch in den Neunzigerjahren, ist offensichtlich. Die Grenzen zum Mainstream sind durchlässiger geworden, Phänomene aus dem Untergrund erfahren vermehrt zuvor ungeahnte Popularität. Die globale Vernetzung und trendhoppende Fast-Fashion-Marken sorgen dafür, dass sich einzelne Subkulturen auch optisch nicht mehr klar abgrenzen lassen. Skug hat all diese Entwicklungen begleitet. Es hat unentwegt Ränder sichtbar gemacht, die gerade nicht vom Spotlight der Aufmerksamkeit angestrahlt worden sind, und den Menschen dort eine Stimme gegeben. Vom Keller zum Salon
Bis 2015 wurde das »Journal für Musik«, wie es auf dem Titelblatt geschrieben stand, in gedruckter Form herausgegeben. Nach 104 Ausgaben musste das Magazin seine Printschiene einstellen. Man entschied sich dazu, als reines Onlinemedium weiterzumachen. Heute findet man auf der Skug-Website ein Sammelsurium von Beiträgen zur aktuellen Musik- und Kulturszene – der heimischen sowie der internationalen. Die Artikel reichen dabei bis in die Anfänge des Magazins zurück und bilden so ein historisches Archiv der popkulturellen Berichterstattung. Mit Themen aus Literatur, zeitgenössischer Kunst, aber auch aktuellen politischen Diskursen beweist das Medium seine thematische Breite. Es setzt dabei Schwerpunkte, die anderswo kaum Platz finden und eröffnet neue Perspektiven auf popkulturelle Phänomene. Immer wieder werden sozioökonomische, ästhetische und kulturpolitische Aspekte aufgegriffen und dienen als theoretischer Rahmen. Darüber hinaus führt Skug einen Terminkalender auf seiner Website, der regelmäßig mit handverlesenen Events befüllt wird. Zudem betreibt das Magazin die Veranstaltungsschiene Salon Skug mit Partys und Konzerten. Selma Hörmann
Um 35 Jahre Skug angemessen zu feiern, findet am 7. November ein Salon Skug im Wiener Gürtellokal Rhiz statt. Live mit dabei: Jeanne d’Arte, das Tubi Trio, Chris Hessle aka IZC und Martin Stepanek aka MStep. Wir gratulieren!

»Das zeitgemäße Theater« soll bei Wandel helfen
Die neue interaktive Website »Das zeitgemäße Theater« bietet Informationen rund um die Themen Gerechtigkeit und Verantwor tung am Theater. ———— Machtmissbrauch im Kulturbetrieb ist ein strukturelles Problem. Einen Impuls in Richtung nachhaltiger Verbesserung bietet ab sofort die Plattform »Das zeitgemäße Thea ter«, die sich an Theaterschaffende aller Hierarchieebenen richtet. Die Website ist für alle Menschen gedacht, die Interesse an Wan del im Theater haben. Mit Impulstexten und Gimmicks vereint sie Wissen rund um zeitgemäßes Arbeiten an Bühnen. Quizformate sollen helfen, Fehlverhalten in der Branche erkennen zu lernen. Auch die eigenen Kompetenzen im Bereich Recht lassen sich über prüfen. So gebe es die Möglichkeit, exemplarische Situationen aus Österreich selbst einzuordnen, erzählt die stellvertretende Obfrau Tine Wesp. »Darüber hinaus kann man im Ampelformat einschät zen, wie fit das eigene Theater in den Bereichen Prävention und Compliance ist.« »Das zeitgemäße Theater« versteht sich dabei als Wissensdrehscheibe und Orientierungshilfe, nicht als Bera tungsstelle. »Uns geht es darum, zu sensibilisieren. Information ist Macht. Wissen ist demnach der erste Schritt aus der Ohnmacht«, so Obfrau Charlotte Koppenhöfer.
Gemeinsam stärker
Die von User*innen verfassten Beiträge sollen Bewusstsein für eine faire und wache Arbeitskultur an Theaterhäusern schaffen. Auch für anonyme Einträge zu persönlichen Erfahrungen bietet »Das zeitge mäße Theater« digitalen Raum. Laut Wesp sei die Motivation hinter dem Projekt, dass Maßnahmen von allen getragen werden müssten: »Veränderung braucht Menschen, die den Mut haben, in den Dis kurs zu gehen und das Theater zeitgemäß zu gestalten.« In einem jährlichen Open Call sucht der Verein zudem nach Theatern aus dem deutschsprachigen Raum, die Verantwortung nicht nur einfor dern, sondern konkret leben. Aus den Einreichungen wird dann eine Institution als das zeitgemäße Theater der Saison ausgezeichnet. Von den unzähligen Playern, die in der Branche tätig sind, erwartet sich Koppenhöfer konkrete Schritte: »Wir freuen uns, wenn unsere Impulse bei der Umsetzung helfen. Aber wir sind weder Kontroll instanz noch bieten wir Schablonen an.« Selma Hörmann


Die Website »Das zeitgemäße Theater« ist seit Anfang September unter www.daszeitgemaessetheater.at zu finden.




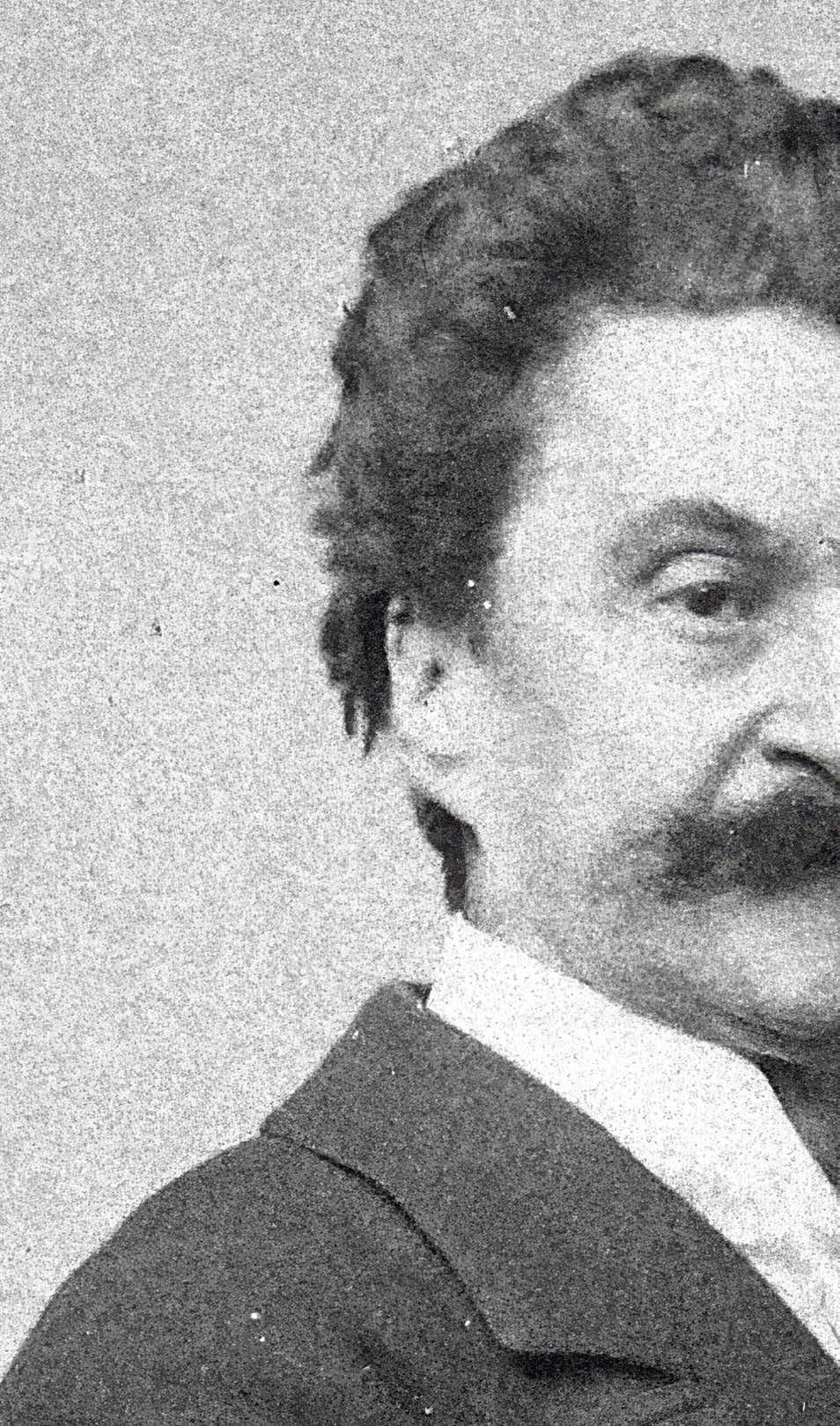

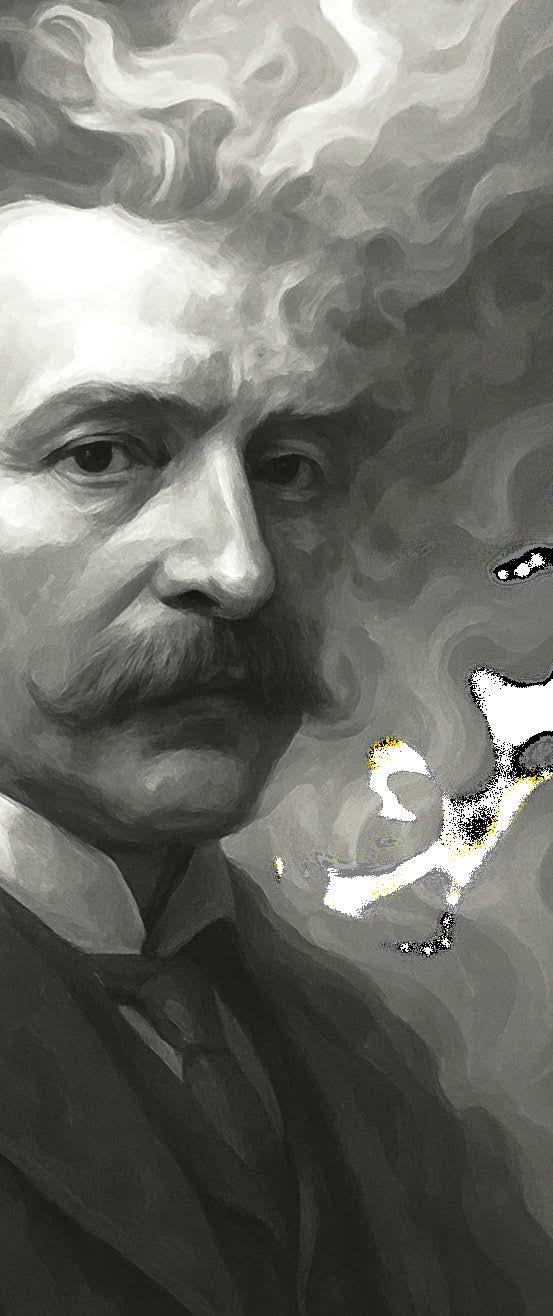




Toni Patzak
hakt dort nach, wo es wehtut
Der Begriff »Gaze« poppt aktuell meist auf, um zu beschreiben, wie eine Gruppe von Menschen von der gesellschaftlich hegemonialen Gruppe gesehen und medial dargestellt wird. Und wie dieses verzerrte Bild in der Folge das kollektive Gedächtnis aller Menschen prägt –gleich ob sie Teil der hegemonialen, der betroffenen oder irgendeiner anderen gesellschaftlichen Gruppe sind.
Der Male Gaze ist somit das feministische Konzept, das beschreibt, wie Männer Frauen nicht nur wahrnehmen, sondern eben auch darstellen, in Filmen, Büchern und Geschichten. Diese »women written by a man« sind meist übersexualisiert beschrieben, gutgläubig und den extrem attraktiven, aber missverstandenen Hauptcharakteren – die sicherlich überhaupt nichts mit den Autoren selbst zu tun haben – natürlich wohlwollend zugetan. Frauen sind in diesen Geschichten wandelnde Sammelbehälter für Adjektive und passive Verbkonstruktionen, in denen man sie »zu Wort kommen lässt«, anstatt dass sie sprechen. Sie können auch nicht einfach in den Raum gehen, sondern müssen mit ihren langen Beinen einen Raum betreten, der so runtergekühlt ist, dass man ihre Nippel durch ihre Kleider sieht.
Feministische Stirnfransen?
Ich als Feministin bin selbstverständlich für die Aufarbeitung des Male Gaze. Er steht für eine furchtbare Infantilisierung von Frauen oder weiblich gelesenen Personen, er ist geschmacklos … Aber irgendwie habe ich manchmal so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass ich auch so beschrieben werden will. Ich will auch einmal die Sie sein, die es schafft, für dreißig Seiten nichts Wertvolles beizutragen und trotzdem im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Die Sie, die mit dezentem Make up in der Früh aufwacht und durch ihre drapierten Stirnfransen in die Kamera schaut. Herrgott noch einmal, kann ich nicht die Sie sein, die mit den Beinen zuerst den Raum betritt und keinen Dialog bekommt?
Das mag sarkastisch rüberkommen, aber ich merke, dass ich zu einem gewissen Grad nach dieser Art, wahrgenommen zu werden, strebe. Wieso ist das so? Es kann ja nicht sein, dass ich eine sozialwissenschaftliche Definition eines feministischen Konzepts wiedergeben kann, ohne es zu googeln, aber mir trotzdem die unbequemere Hose anziehe, weil der Arsch darin geil aussieht und ich den Männaz gefallen will. Allein das zu schreiben, fällt mir schwer, weil ich ja eigentlich diejenige sein will, die sich nicht für den Male Gaze kleidet, sondern diejenige, die sich »for the gurls, the gays and the theys« dressed. Aber leider ist die Realität viel komplizierter, denn an denselben Tagen, an denen ich mich in die unangenehmen Jeans quetsche, denke ich mir in der UBahn: Oh Gott, ich will nicht von euren ekelhaften Blicken ausgezogen werden, mein Körper ist kein Laden, bei dem du Windowshopping betreiben kannst. Ein paar Stunden später überlege ich dann, mir die Augenbrauen abzurasieren, damit ich mich zwinge, mich mit meinem eigenen Schönheitsbild auseinanderzusetzen. Ein wenig hab e ich mich da sogar schon rangetastet und sie neulich blondiert – hat aber leider extrem scharf ausgeschaut. Naja, egal.
Wie kann ich all diese Standpunkte in mir vereinen, ohne zu zerreißen? Bei solchen Gedanken erinnere ich mich gerne an die Szene in »Fleabag«, in der die männerkritische, von einer Frau geschriebene Hauptfigur mit ihrer Schwester bei einem feministischen Vortrag sitzt und die Vortragende die rhetorische Frage stellt, wer gerne Lebenszeit gegen ein paar Kilos weniger auf der Waage eintauschen würde. Der ganze Saal bleibt ruhig, während die Hände der beiden Schwestern hinaufschnellen. Im Anschluss fragt sich die Protagonistin, ob sie eine schlechte Feministin sei.
Nachdem ich letzten Sommer zugenommen hatte, wollte ich das machen, was ich zuvor immer gepredigt hatte: meinen Körper lieben, egal wie sehr er sich verändert. Body
Neutrality zelebrieren und eins sein mit meiner Weiblichkeit. Ja, … das funktionierte nicht. Ich schmiss alle meine Röcke weg und bekam eine komplette Krise. Irgendwie ist mir das rückblickend peinlich, weil ich eigentlich ein feministischer Girlboss sein will. Das ist aber in der Umsetzung komplizierter als in der Vorstellung. Ich bin ein Produkt des frauenfeindlichen Weltbildes, das mir meine Gesellschaft mitgegeben hat. Dagegen zu arbeiten, während man Selbstwertprobleme hat und die Wäsche aufhängen muss, kann überfordernd sein.
Also: Wie weitermachen, wenn man merkt, man ist doch nicht die glänzende, aus dem Ei gepellte Feministin? Naja, ich denke, zunächst ist es einmal hilfreich zu verstehen, dass e s diese Art von Feministin in Wirklichkeit gar nicht gibt: eine unbelastete Frau, die sich entgegen jeder gesellschaftlichen Erwartung niemals auf persönlicher Ebene hinterfragt und niemals kritisiert; eine, die mit den Büchern von Angela Davis und bell hooks unterm Arm als Erste in jeden Raum schreitet und keinen Dialog, sondern nur Reden hält; eine, die immer das Wort ergreift und nicht einfach spricht; eine, die immer Funktion und Bequemlichkeit vor Ästhetik in ihrer Kleidung bevorzugt; kurz gesagt: eine absolut romantisierte Version meiner Ansprüche an mich selbst. Der feministische Kampf scheint mir nicht nur einer, der nach außen geht, auf die Umwelt bezogen ist. Genauso wichtig ist die interne Auseinandersetzung, die nicht mit Frustration und Selbstkritik gewonnen wird, sondern mit Geduld und Zuneigung sich selbst gegenüber. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, die unbequemen Jeans im Schrank zu lassen. Aber bis dahin werden sie im Stapel meiner nicht aufgehängten Wäsche neben jenem meiner feministischen Bücher liegen.
patzak@thegap.at @tonilolasmile







Julia Franz Richter kam erst über den Umweg des Komparatistikstudiums zum Schauspiel.
Nach zahlreichen Produktionen für Theater, Film und Fernsehen ist Julia Franz Richter diesen Herbst gleich mit zwei Kinofilmen zurück auf der großen Leinwand. Die Schauspielerin und Performerin über das Austesten von Grenzen, Mutterschaft im Horrorfilm und festgefahrene Stereotype. ———— Im schattigen Garten des Café Rüdigerhof tummeln sich die Leute. Drinnen hingegen herrscht an diesem heißen Sommertag eher gähnende Leere. Ein ungewöhnlicher Zustand für das Wiener Kultlokal. Julia Franz Richter sitzt bei unserem Eintreffen lässig in einer der gepolsterten Tischnischen. Dass sie sehr oft und gerne hier ist, erzählt sie später mit einem breiten Grinsen, als ein frisch eintrudelnder Kellner sie euphorisch begrüßt. Aus dem Rüdigerhof ist die in Wiener Neustadt geborene Schauspielerin und Performerin scheinbar ebenso nicht mehr wegzudenken wie aus der österreichischen Kulturszene.
Sie habe sich immer schon für »physische Räume, an denen Menschen kollektiv zusammenkommen, Geschichten gemeinsam erleben und anschließend darüber sprechen«, begeistern können, erzählt Richter. Und obwohl ihr schon lange etwas daran gelegen sei, in andere Rollen zu schlüpfen und Geschichten zu erzählen, sei der Wunsch, Schauspielerin zu werden, erst später gekommen: »Ich hatte bis auf die Kinder- und Jugendtheaterbesuche mit meiner Mama eigentlich null Berührungspunkte zum Theater. Dieses Bedürfnis nach angewandteren Räumen kam erst über die theoretische Auseinandersetzung mit Sprache, Literatur und Texten.« Schließlich sollte es das Komparatistikstudium in Wien sein, das Richter zu einem Schauspielstudium nach Graz und somit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Ausdrucksformen und Arbeitsweisen im Theater führte.



Im Café Rüdigerhof ist Richter häufig zu Gast.
Heute ist das Repertoire der Schauspielerin äußert vielfältig, reicht von Theater über Film und Fernsehen bis hin zur Performancekunst. Ihr Talent ist nicht unbemerkt geblieben: Davon zeugt neben zahlreichen Nestroy-, Romy- und Filmpreis-Nominierungen auch der Schauspielpreis der Diagonale für ihre Rolle in »Der Taucher«, den sie 2020 gewann. Im Vorjahr wurde sie außerdem vom österreichischen Kulturministerium mit dem Outstanding Artist Award in der Sparte Darstellende Kunst ausgezeichnet. Hervorgehoben wurden dabei besonders ihre scharfe Beobachtungsgabe, ihr intensives, körperliches Spiel sowie ihre Bandbreite an Emotionen. Ob auch sie darin ihre schauspielerischen Stär-
»Mutterschaft wurde sehr lange auf idealisierte Weise und aus stark männlicher Perspektive dargestellt.« — Julia Franz Richter
ken sieht? »Ich finde das schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass sich das von außen viel klarer beurteilen lässt. Grundsätzlich ist mein Zugang zu diesem Beruf – oder auch zum Leben selbst –, dass ich sehr gerne Neues lerne und Herausforderungen mag. Ich bin sehr neugierig auf Menschen, ihre Geschichten sowie Erfahrungen und freue mich, wenn sich das auch in den Figuren widerspiegelt, die ich spiele. Darin liegt dann vielleicht das, was von außen als Bandbreite gesehen wird.« Wie gut sie unterschiedlichste Rollen einnehmen und mit neuen Herausforderungen umgehen kann, wird spätestens in ihren beiden aktuellen Kinofilmen deutlich. In Andreas Prochaskas »Welcome Home Baby« und Johanna Moders »Mother’s Baby« verkörpert Richter Figuren, die konträrer nicht sein könnten.
Heimat als Grenzerfahrung
Prochaskas Psychothriller bietet nicht nur ein bildgewaltiges Horrorspektakel, sondern vereint auch die Themen Mutterschaft, Selbstbestimmung und transgenerationales Trauma. Gerade die letzten beiden Motive, hätten sie beim Lesen des Drehbuchs sofort angesprochen, so Richter. Im Film spielt sie die Hauptfigur Judith, die das Haus ihres Vaters in Österreich erbt, ohne diesen oder ihre Mutter je kennengelernt zu haben. Gemeinsam mit

Als Judith hat es Julia Franz Richter in »Welcome Home Baby« mit einer zunehmend übergriffigen Dorfgemeinschaft zu tun.
ihrem Ehemann Ryan (Reinout Scholten von Aschat) beschließt sie, in das kleine Heimatdorf ihrer Eltern zu reisen, um den Verkauf des Grundstücks abzuwickeln. Doch die Konfrontation mit ihrer zwielichtigen Tante Paula (Gerti Drassl) und der restlichen Dorfgemeinschaft gerät für Judith zu einer psychischen Grenzerfahrung. Allen ist scheinbar daran gelegen, sie nicht mehr gehen zu lassen. »Dieses Stadt-Land-Gefälle, die Landflucht und der Konservativismus, der in so einer Gemeinschaft verhaftet ist, haben mich interessiert«, erklärt Richter.
Mutterschaftshorror
Je länger sich Judiths Aufenthalt zieht, desto stärker holen sie die Bilder und Erinnerungen aus ihrer rätselhaften Kindheit ein – was sich zunehmend auch körperlich äußert. Hatte Richter Strategien, um diesen Wandel darzustellen? »Es war wichtig, bereits zu Beginn ein sehr klares Bild einer autonomen und im Leben stehenden Figur zu zeichnen, um dann eine Durchlässigkeit und Offenheit für die sich anbahnenden Extremzustände mitbringen zu können.« Diese Ausnahmesituationen nach dem Dreh wieder hinter sich zu lassen, dabei habe ihr nicht zuletzt eine Eigenheit des Genres geholfen: »Der Horror, der sich im Film über den Sound, Effekte oder Brüche erzählt, ist am Set ja nicht gegeben. Da ist die Arbeit viel trockener.«
Übernatürliche Babys, traumatische Geburten, Blut, Angst und Schrecken: Das Motiv
der Mutterschaft ist spätestens seit »Rosemaries Baby« ein fester Bestandteil im Horroruniversum. Doch warum findet sich gerade dort so eine gute Grundlage, um dem Thema zu begegnen? »Für mich – ohne jetzt selbst Mutter zu sein – gibt es im Horrorfilm das Potenzial, den Transformationsprozess, den
»Ich glaube, dass Horror fast etwas Kathartisches haben kann – gerade für FLINTA*-Personen.«
— Julia Franz Richter
Mutterschaft mit sich bringt und der ja auch etwas irrsinnig Brutales haben kann, anders zu erzählen. Gerade auch im Hinblick darauf, dass Mutterschaft sehr lange auf idealisierte Weise und aus stark männlicher Perspektive dargestellt worden ist.«
Im Fall von Judith zeige sich das eher über den Emanzipationsprozess, den die Figur durchläuft, sowie über den Druck, dem sie vonseiten der weiblichen Dorfgemein-
schaft zunehmend ausgesetzt ist: »Das kenne ich selbst auch – diese Auseinandersetzung mit gewissen Werten und damit, wie du als Frau zu sein hast; eben dieses Ideal einer Mutterfigur.« Besonders im Sich-Ekeln und -Gruseln sieht Richter eine Möglichkeit, auch andere Aspekte des Mutterseins zu bearbeiten, etwa postnatale Depression, ein Unwohlsein mit dem eigenen Körper, aber auch Angst: »Ich glaube, dass Horror fast etwas Kathartisches haben kann – gerade für FLINTA*-Personen –, wenn weibliche Körper plötzlich nicht mehr nach gewissen Sehgewohnheiten funktionieren müssen.«
Selbst Druck ausüben
Das alles sind Motive, die auch in Johanna Moders »Mother’s Baby« eine zentrale Rolle spielen. Der Thriller erzählt äußerst geschickt von einer traumatischen Geburtserfahrung und dem Unbehagen einer Mutter gegenüber ihrem ersten Kind. Julia (Marie Leuenberger) ist sich sicher, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmt, während ihr familiäres und ärztliches Umfeld versucht, sie vehement vom Gegenteil zu überzeugen. Darunter auch die Hebamme Gerlinde, verkörpert von Richter, die doch eigentlich nur das Beste für Julia zu wollen scheint.
»Das ist lustig, verglichen mit ›Welcome Home Baby‹, denn hier bin ich ja selbst in einer Rolle, die einer anderen Frau Druck aufbaut, indem sie sagt: ›So müsstest du dich eigentlich als Mutter fühlen.‹« Wäh -

Richter ist froh, dass sie nach wie vor die Freiheit genießt, verschiedene Arten von Rollen auszuprobieren.
»Ich bin sehr neugierig auf Menschen, ihre Geschichten sowie Erfahrungen und freue mich, wenn sich das auch in den Figuren widerspiegelt, die ich spiele.«
— Julia Franz Richter
rend Richter als Judith also versuche, sich aus ebendiesem Zustand zu befreien, gehe es bei Gerlinde gerade darum, »diese gesellschaftliche Wertung zu verkörpern« und ihrem Gegenüber mit einer gewissen Übergriffigkeit zu begegnen. Etwas, das ihr nicht immer leichtgefallen sei, so Richter. »Johanna (Moder; Anm.) meinte immer, ich sei eigentlich noch zu nett. Ich hatte den Impuls, dass ich mit meiner eigenen Figur sympathisieren will und dass andere Menschen ihr Verhalten nachvollziehbar finden sollen. Aber natürlich hat meine Figur innerhalb der Handlung eine andere Funktion.«
Vorbereitung ist alles
Die Drehstarttermine beider Filme lagen gerade einmal zwei Monate auseinander, von Gerlinde zu Judith gab es einen fliegenden Wechsel. Und obwohl sie eigentlich nur ungern parallel an Sachen arbeite, habe ihr das in diesem Fall sogar geholfen. Richter: »Dadurch, dass es inhaltlich schon einige Parallelen gab und ich ja quasi zweimal ein Kind zur Welt bringen musste (lacht), hat es sich in der Vorbereitung manchmal gut ergänzt.« Während sie für »Mother’s Baby« eng mit Hebammen
zusammenarbeitete, besuchte sie für »Welcome Home Baby« Notärzt*innen, um einen realistischen Einblick in den Geburtsprozess zu gewinnen. »So habe ich ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen – und mir am Ende sogar eingebildet, ich könnte wirklich bei einer Geburt helfen (lacht).«
Die richtige Vorbereitung war aber nicht nur in Bezug auf das Thema Geburten essenziell, sondern auch hinsichtlich der eindrucksvollen Unterwasserszenen in »Welcome Home Baby«. Während einige davon in einem extra dafür ausgerichteten Becken in Wien gefilmt wurden, musste Richter sich in Vorbereitung auf Szenen, die in einer Grotte spielen, sogar im Eisbaden üben. Ein Problem? Fehlanzeige. »Ich habe lustigerweise einen extremen Ehrgeiz in diesen Dingen. Es hat Spaß gemacht zu lernen, wie das geht.« Besonders in der Ruhe, die diese Szenen mit sich brachten und in der Kontrolle von Atmung und Puls, lag für die Schauspielerin der nötige Ansporn: »Für mich als eher aufgedrehte Person, hatte das einen total meditativen Effekt. Und ich entwickelte große Lust daran, auch körperlich in diese Extremzustände einzutauchen.«
Von Anfang an hatte Richter außerdem das Gefühl, dass Regisseur Andreas Prochaska sehr offen für Fragen gewesen sei. Das war auch notwendig. »Es hat sich schnell herausgestellt, dass es da viel gegenseitiges Vertrauen braucht.« Gerade in Bezug auf die Unterwasserszenen, in denen Schauspieler*innen leicht an körperliche und mentale Grenzen geraten können. Während Richter ihre heutigen Spielpartner*innen Gerti Drassl, Maria Hofstätter, Inge Maux und Co lange Zeit aus der Ferne bewundert hat, steht sie nun selbst in der ersten Reihe – und bekundet ihre Anerkennung: »Es war eine feine Zusammenarbeit, weil ich alle auch menschlich als unglaublich intelligente, starke und fürsorgliche Kolleg*innen erlebt habe.« Besonders die gute Atmosphäre und der Humor am Set hätten dazu beigetragen, sich auch von den extremsten Situationen immer wieder schnell erholen zu können.
Spiel in zwei Welten
An ihrer Arbeit im Film schätzt Richter besonders die Möglichkeit, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen und mit Geschichten ein breites Publikum zu erreichen. Produktionen wie »Welcome Home Baby«
und »Mother’s Baby« würden demonstrieren, dass sich auch die österreichische Filmbranche immer mutiger in Richtung Genrekino streckt. Ob sie die Arbeit im Theater dennoch manchmal vermisst? »Theater und Film sind scheinbar nah beieinander, aber gleichzeitig sind es irgendwie auch völlig andere Arbeitsweisen und Welten.« Im Unterschied zum Film sei das Theater nach wie vor viel diskurslastiger und biete die Möglichkeit, gemeinsam über sechs Wochen an einem Stück zu arbeiten. Besonders der unmittelbare Austausch mache die Arbeit am Theater zu etwas Einzigartigem. »Manchmal vermisse ich es, Vorstellungen zu spielen, weil es da wirklich jedes Mal diesen Dialog mit dem Publikum gibt – das hat man im Film halt einfach nicht.«
Auch im Umgang mit Texten sieht Richter einen großen Unterschied: »Natürlich hast du im Theater andere Ausdrucksmög-
Julia Franz Richters künstlerisches Schaffen zeichnet sich gesamtheitlich durch ihre unermüdliche Lust aus, Neues auszuprobieren; durch ihre Weigerung, sich in Schubladen stecken zu lassen. Etwas, »das gerade in einer überschaubaren Branche wie in Österreich ja schnell mal passieren kann, wenn du öfter eine gewisse Form von Figur gespielt hast«. Stereotype aufbrechen Ihr liege viel daran, sich mit unterschiedlichen Rollen und Themen zu beschäftigen und viele verschiedene Geschichten und Perspektiven zu erzählen. In ihrer bisherigen Arbeit sind tatsächlich schon sehr viele Genres dabei gewesen – »besonders dafür, dass ich viel in Österreich gearbeitet habe«, wie sie selbst betont. Es brauche aber noch viel mehr Mut bei der Besetzung, man müsse weniger in Schubladen und vielschichtiger denken. Diese Diversität habe für
In der Vorbereitung auf ihre Rolle in »Mother

lichkeiten, weil du performativer oder abstrakter arbeiten kannst. Beim Film sind die Spielweisen notwendigerweise mehr im Psychologischen verhaftet.« An neuen, innovativen Performanceformen versucht sich Richter auch abseits ihrer Tätigkeit als Schauspielerin. Im Frühjahr 2023 rief sie gemeinsam mit Regisseur Felix Hafner und Musiker Clemens Wenger das Franz Pop Collective ins Leben. Die im Zuge dessen entstandene Debüt-EP »Wuman on a Sofa« brachte das interdisziplinär arbeitende Trio im Studio Brut schließlich als hybride Popmusikperformance auf die Bühne.
Richter auch gesellschaftliche Relevanz, denn gerade durch ihre Arbeit als Schauspielerin sei die Beschäftigung mit queer-feministischen Themen für sie »zu einer immer größeren Notwendigkeit geworden«. Im Wiederholen und Performen von immer gleichen Rollen und Stereotypen zeige sich, wie diese sich über die Jahrzehnte festgesetzt haben. Für sie selbst ein ambivalentes Problem: »Als Spielerin muss ich immer wieder in Rollen schlüpfen, bei denen ich das Gefühl habe, ich als Julia bin da eigentlich schon ein bisschen weiter. Beziehungsweise, dass auch die Gesellschaft, in der wir leben, weit diverser ist als die abgebildete.«
Welche Genres und Rollen uns in Zukunft noch erwarten könnten? »Was ich grundsätzlich sehr schätze – sowohl als Zuseherin als auch als Darstellerin – sind Sci-Fi-Stoffe. Eigentlich jegliche Form von Spekulativem.« Mit »Rubikon« (2022) hat sie da bereits einen markanten Eintrag in ihrer Filmografie zu verzeichnen. Und auch ihre bislang eher zu kurz gekommene Arbeit im komödiantischen Bereich (erst letztes Jahr überzeugte sie in »Pfau – Bin ich echt?«) habe sie immer als höchst befreiend empfunden. Sie schätze »gute, kluge, scharfe Komödien und jene Figuren, die darin funktionieren, die scharfkantiger sind sowie etwas Böses oder Widerspenstiges haben«. In diesem Bereich habe sie das Gefühl, dass es noch einiges an Spielraum für sie zu entdecken gibt. Dass sie sich durchaus vorstellen könne, »in eine ganz andere Form von Welt und Geschichte einzutauchen«, scheint wenig verwunderlich, denn eines wird im Austausch mit ihr jedenfalls deutlich: Julia Franz Richter ist eine Person, die nicht vor Neuem zurückschreckt und immer wieder für eine Überraschung gut ist – für uns, aber vermutlich auch für sich selbst.
Anja Linhart
»Welcome Home Baby« mit Julia Franz Richter in der Hauptrolle startet am 3. Oktober in den österreichischen Kinos. Ab dem 24. Oktober ist dann auch »Mother’s Baby« ebendort zu sehen.


Östlund »The Square«, 2017, Magnolia Pictures
Der Film »The Square« von Ruben Östlund wollte 2017 eine Karikatur des Kunstbetriebs sein. In den letzten Wochen lief er wieder einige Male im Fernsehen. Denn acht Jahre und einen Trump später schaut sich diese Satire noch mal ganz anders. Zwischen Safe Spaces und Selbstgerechtigkeit: Wie rahmt man Horizonterweiterung? ———— Kunst braucht einen Rahmen, eine Eingrenzung. Doch was passiert in einer Welt, in der jegliche Grenzen überschritten werden – moralische, demokratische, persönliche? »The Square« ist eine schwedische Satire und handelt von einem Museumskurator, dessen Leben aufgrund eines PR-Skandals und eines gestohlenen Handys aus dem Ruder läuft. Im Film soll ein Kunstwerk namens »The Square« ein Safe Space sein. Kann Kunst, in ihrem Selbstverständnis, Tabus zu brechen, jemals so ein Ort der Sicherheit sein? Oder umgekehrt: Wie kann Kunst, die keine Grenzen überschreitet, diese jemals erweitern? »The Square« illustriert in peinlicher Deutlichkeit, wie der Kunstbetrieb sich an diesem Paradoxon abarbeitet, wie verlogen seine Beteiligten agieren, wie der eigene Horizont bei aller Erweiterung doch mit dem goldenen Rahmen des eigenen Privilegs endet.
Safe Spaces zu etablieren, wird im aktuellen politischen Klima immer wichtiger. Man kann sich nicht sicher fühlen, sobald man irgendwie von der cis-hetero-männlich-weißen Norm abweicht. Kunst bietet ohne Frage eine Plattform. Oder, wie bei »The Square«, ein Spielfeld. Sie erlaubt Linien zu übertreten, Grenzen zu überschreiten – im buchstäblich kleinen Rahmen. Doch Triggerwarnungen brauchen wir nicht vor der Kunst, wir brauchen sie vor den Nachrichten. Sollte Kunst nicht eine Art Katharsis bieten, indem sie uns empört, erschreckt, entgeistert? Aber nichts kann uns auf die eklatante Ungerechtigkeit der Welt vorbereiten. Triggerwarnung: Sexueller Missbrauch. Ein verurteilter Sexualstraftäter steht an der Spitze der mächtigsten Demokratie der Welt.
Kunst, die – ganz nach Kafka – beißen und stechen will, gibt es immer noch, vielfach aber vor allem solche, die uns Sicherheit vermitteln möchte. Doch in der Kunst ist man gleichermaßen in Sicherheit, wie man es in einem Krankenwagen ist. Sich wahrhaftig darin zu befinden, heißt, man ist bereits in seiner Sicherheit eingeschränkt. Wer sich Gedanken über Kunst und Demokratie macht – und wie viel unser eigenes Bewusstsein damit zu tun hat –, wird in »The Square« zwar keine Antworten finden, zum weinenden könnte aber vielleicht ein lachendes Auge hinzukommen. Veronika Metzger
»The Square« von Ruben Östlund kann in Österreich bei Sky sowie bei Prime Video gestreamt werden. Es empfiehlt sich, einen guten Snack vorzubereiten: Die Laufzeit beträgt 142 Minuten.

Wie fair ist Musikförderung in Österreich? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir gemeinsam mit Ines Dallaji sowie 52 weiteren Musiker*innen Bilanz gezogen und wir werfen einen kritischen Blick auf den Stellenwert von Transparenz, Vielfalt und Markttauglichkeit. ———— Kunst- und Kulturförderungen sind in aller Munde – hauptsächlich, weil sie gekürzt werden. Man schaue zum Beispiel in die Steiermark, wo nun dank FPÖ Blasmusik statt Diversität gepusht wird. Gebe es keine staatlichen Förderungen mehr, könnte man sich zwar einbilden, das sei ein fairer Wettbewerb am freien Markt – allerdings nur solange man bewusst ignoriert, wie unumgehbare Monopole und Algorithmen ein vielfältiges Angebot verdrängen und wie ungleiche Ausgangssituationen der Künstler*innen unter den Tisch gekehrt werden. Unzureichend verteilt sorgen Förderungen allerdings sogar für eine Verstärkung der Probleme: »Jene ohne finanzielle Unterstützung müssen dann mit deutlich weniger Ressourcen das Gleiche erreichen – ein Kampf unter verzerrten Bedingungen«, erzählt mir Ines Dallaji, Frontfrau der Band Bad Ida.
Um dem Einfluss von Förderungen auf den Grund zu gehen, haben Ines und ich gemeinsam eine kleine, anonyme Umfrage durch die Reihen der österreichischen Popmusik gehen lassen. Insgesamt haben 52 Personen mitgemacht und uns zu einem Stimmungsbild verholfen. Von etablierten Acts bis hin zu ausgewählten Newcomer*innen, von 23 bis 63 Jahren und von ca. 1.000 bis 100.000 Euro Jahresumsatz war eine große Bandbreite gegeben. Dieser Text bietet Einblick in die Ergebnisse und versucht sich an Lösungsvorschlägen.
Sich mit Förderungen auseinanderzusetzen, ist eine langwierige Arbeit. Für viele heimische Musiker*innen ist es Teil ihres Berufs, denn haben wollen diese Gelder alle. Dass das Stellen eines Antrags nicht mit zwei Klicks erledigt ist, vor allem weil es manchmal um fünfstellige Beträge geht, scheint sinnvoll. Welche Kriterien jedoch tatsächlich bei der Vergabe von Musikförderungen angewendet und vor allem in welcher Gewichtung diese gewertet werden, ist mir selbst nach meiner Recherche eher schleierhaft. Fangen wir aber beim offensichtlichsten Problem an: Alle Informationen und Websites sind ausschließlich auf Deutsch auffindbar. Von einer wenigstens englischsprachigen Bewerbungsmöglichkeit oder Informationen in einfacher Sprache kann man leider nur träumen. Manchmal klicke ich auf »Mehr Informationen«, nur um die gleiche Beschreibung noch einmal anders formuliert lesen zu dürfen. Es gibt viele Richtlinien, die über die Aufgaben der Künstler*innen aufklären, über Abrechnungen und Nachweise. Aber welche Pflichten haben eigentlich Fördergeber*innen?
Wer soll das verstehen?
Über achtzig Prozent der Umfrageteilnehmer*innen gaben auch an, dass sie das Beantragen von Förderungen zeitintensiv finden, sowie mittelschwer bis kompliziert. »Niederschwellig« erhielt hierbei keine, »inklusiv« eine einzige Stimme. Im Vergleich kam die SKE-Produktionsförderung bei den Teilnehmer*innen mit einigem positiven Feedback gut weg, wohingegen der Österreichische Musikfonds (ÖMF) mehrere Male als besonders schlecht verständlich oder intransparent beschrieben wurde.
Die meisten Absagen und auch Zusagen an Künstler*innen werden nicht begründet. Während etwas mehr als die Hälfte zufrieden mit dem bisher erfahrenen Servicekontakt zu Förderstellen ist, sorgen formlose Rückmeldungen auf Bewerbungen nicht selten für Unmut. Ohne eine Vorstellung davon, wie eine Entscheidung zustande kommt, muss sich auf den guten Willen der Jury verlassen werden und darauf, dass Beteiligte ihrer Aufgabe gewissenhaft nachkommen. Mechanismen laufen so im Hintergrund ab und können durch Mangel an Einsicht weder gelobt noch kritisiert werden.
»Wir brauchen ganz dringend Förderungen, aber wir brauchen noch viel dringender eine Instanz, die die Fördervergabe evaluiert.« — Ines Dallaji
Die große Intransparenz dieser Entscheidungsfindungen sorgt wiederum für Gemunkel, dass Musikförderungen gerne an die eigenen Freund*innen, Verwandten oder zum eigenen Vorteil vergeben sowie Informationen bewusst zurückgehalten würden. Das Onlinemedium Neue Zeit schrieb hierzu 2021 in Bezug auf den ÖMF: »Gerade bei intransparenten Verfahren und unbegründeten Entscheidungen ist es unumgänglich, größtmögliche Objektivität in der Jury zu gewährleisten.« Und weiter: »Bei den Jurymitgliedern handelt es sich um ein immergleiches Konsortium aus österreichischen Musikern, Redakteuren und Geschäftsleuten.«
Papa wird’s schon richten
Auch Ines Dallaji erzählt von einer oft als willkürlich empfundenen Vergabepraxis: »Es scheint nicht selten von glücklichen Zufällen abzuhängen«, schildert sie, »vom Zeitpunkt der Einreichung, von persönlichen Kontakten, von der Zusammensetzung des Beirats. Dieses Wissen erzeugt ein Gefühl der Machtlosigkeit, das viele in der Branche frustriert und langfristig zermürbt.«
Unsere Umfrage lässt darauf schließen, dass Vergaben nicht nur manchmal als unfair wahrgenommen werden – »exkludierendes Nepotismus-Biotop« war nur einer der Kom-
Um zu Erheben, was die Sicht von Musiker*innen auf die aktuelle Fördersituation in Österreich ist, führten wir eine Umfrage durch, an der 52 Personen teilnahmen. Hier einige zentrale Ergebnisse.
Hast du die gleiche Förderung schon mehrmals erhalten?
Stellst du deine Förderanträge selbst?
Wie empfindest du den Prozess der Antragstellung bei dir bekannten Förderausschreibungen in Bezug auf die Verständlichkeit der Richtlinien, Sprache und Formulierungen etc.? (mehrere Optionen ankreuzbar)
mentare zum Thema Transparenz –, sondern dass Bevorzugungen wirklich stattfinden. Circa 38 Prozent der Befragten geben zu, schon einmal einen eigenen Vorteil durch persönliche Beziehungen zu Jurymitgliedern wahrgenommen zu haben.
Zusätzlich lässt sich feststellen, dass manche Künstler*innen immer wieder Förderungen erhalten, während andere noch immer auf eine erste Zusage warten. Knapp 54 Prozent haben die gleiche Förderung schon mehrmals erhalten, manche von ihnen bis zu zehnmal –meist mit verschiedenen Projekten.
»Wir brauchen ganz dringend Förderungen, aber wir brauchen noch viel dringender eine Instanz, die die Fördervergabe evaluiert«, schlussfolgert Ines. Genaue Zahlen dazu, welche Genres, Personengruppen und welche Labels besonders häufig Unterstützung von Förderstellen genießen und welche nicht, fehlen nämlich. Genauso werden leicht ersichtliche Beziehungen zu Jurymitgliedern und Kurator*innen, die auf Nepotismus oder »Freunderlwirtschaft« hindeuten könnten, überhaupt nicht (öffentlich) verhandelt. Wären hier vielleicht »Schöff*innen« – Privatpersonen und Musikfans, die nach Losziehung mit im Beirat sitzen – sowie ein öffentliches Protokoll Schritte in Richtung Transparenz?
Die unsichtbare Hand
Während einige Förderungen an keine ausgewiesenen Bedingungen geknüpft sind, gibt beispielsweise der ÖMF unter anderem an, »markttaugliche« Projekte fördern zu wollen, die sowohl im Inland als auch im Ausland funktionieren. Doch ist nicht eine grundsätzliche Definition von Kunst, dass sie nicht zweckgebunden, nicht als Produkt verwertbar sein muss? Offen bleibt zum The-
»Ich beobachte eher Resignation als den Willen, aktiv mitzugestalten.«
— Ines Dallaji
ma »Vermarktbarkeit« bei den verschiedenen Förderungen auch, ob es das Ziel ist, Märkte für verschiedene Genres und Menschen zu schaffen und Österreichs Weltblick zu erweitern, oder ob es heißt, einfach den nächsten Indiepop-Act nach Europa zu exportieren. Dass die europäische und internationale Musikwelt durchaus offen für eine Vielzahl verschiedener Musikstile wäre, zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Festivals mit spezifischem Fokus – von Weltmusik bis Hardrock.
Glaubst du, dass dein Projekt schon einmal davon profitiert hat, dass du oder dein Management/Label jemanden in einer Jury/ einem Beirat persönlich kanntest/kannte und mit dieser Person bzgl. deines Ansuchens vielleicht auch im Austausch standest/stand?
Sollten mehr Hürden bzw. Bedingungen für den Erhalt von Förderungen eingeführt werden?
du dir mehr Feedback/Auskunft/Begründungen vonseiten der heimischen Förderstellen, vor allem bei Absagen?
Welche Eigenschaften treffen deiner Meinung nach auf heimische Förderungen zur Finanzierung von Produktionen (Musikfonds, SKE-Fonds etc.) zu? (mehrere Optionen ankreuzbar)
vergeben Diversität abbildend Genrevielfalt abbildend nur gewisse Genres abbildend auf die Qualität der Musik achtend auf die Vermarktbarkeit der Musik achtend auf den Mainstream abgestimmt transparent intransparent
Häufig werden auch bestimmte Personengruppen in den Ausschreibungen adressiert. Um Benachteiligungen abbauen zu können, ist es schließlich auch sinnvoll, diese zu benennen. Während einige Fördergeber*innen auf Vorteile für PoCKünstler*innen und weibliche Acts hinweisen, um einer weiß und männlich dominierten Musikszene entgegenzuwirken, ist mir – abgesehen von Nachwuchsinitiativen – nur beim ÖMF eine Richtlinie untergekommen, die soziale Aspekte zu berücksichtigen scheint. Auf dessen Website steht: »Das eingereichte Projekt sollte ohne Finanzierung durch den Musikfonds nicht bzw. nur in unzureichendem Umfang finanzierbar sein.« Ein guter Ansatz, denn auch das kleinste DIYProjekt braucht für eine Veröffentlichung meist mehrere Tausend Euro – vor allem, wenn alle Beteiligten fair entlohnt werden sollen. Wer aber kontrolliert, ohne Kontoauszüge oder sonstige offizielle Nachweise, wie viel Geld Antragsteller*innen wirklich zur Verfügung haben?
»Neiddebatte«
Kritiker*innen von Musikförderungen werden oft als Killjoys abgetan, wenn ihnen derzeit bestehende Konzepte nicht gefallen. Wer nicht selbst profitiere, habe es leicht, den Kolleg*innen den Erfolg nicht zu gönnen. Aber bleiben wir offen – oder wie Natascha Strobl auf moment.at in ihrer Analyse des Begriffs »Neiddebatte« schreibt: »Dieses Framing soll vor allem klarmachen, dass die Kritik unlauter ist und aus einer reinen negativen Emotion heraus entspringt. (…) Es soll so aussehen, als gäbe es nichts Sachliches oder Politisches zu kritisieren.«
Auch Ines meint: »Ich wünsche mir mehr öffentlichen Diskurs zu dem Thema. Man merkt eine allgemeine Unzufriedenheit unter Musiker*innen, aber ich beobachte eher Resignation als den Willen, aktiv mitzugestalten und sich für Veränderung stark zu machen.« Allein schon deshalb ist es wichtig, dass sich Menschen in ihren lokalen Szenen vernetzen. Denn was allein unmöglich erscheint, kann gemeinsam oft in Bewegung versetzt werden. Lara Cortellini
Bad Ida veröffentlichen am 7. November ihr neues Album »Ending Things« – inklusive Konzert in der Sargfabrik Wien – und sind am 2. Oktober auch Teil des Waves-ViennaLine -ups. An der Umfrage zu österreichischen Musikförderungen kann weiterhin unter www.thegap.at/umfrage-musikfoerderung teilgenommen werden.
Dieser Text ist im Rahmen des The-GapNachwuchspreises für Musikjournalismus in Kooperation mit dem Festival Waves Vienna entstanden.

Die Kaffeekultur von NESPRESSO trifft auf eine Musik-Ikone: Gemeinsam mit The Weeknd bringt NESPRESSO die SAMRA ORIGINS Kollektion nach Österreich. Ein neuer exklusiver Limited Edition Kaffee, eine Maschine und Accessoires verbinden Herkunft mit Design und machen jeden Kaffeemoment zu einem Erlebnis, mit dem Geschmack Tansanias als Highlight.
»When you embrace your roots, it reveals an unforgettable taste« – unter diesem Motto präsentiert Nespresso gemeinsam mit SAMRA ORIGINS und Abel »The Weeknd« Tesfaye eine neue, limitierte Kollektion. Diese Kollektion würdigt sowohl die jahrzehntelange KaffeeExpertise von Nespresso als auch die kreative Kraft von The Weeknd, um die Schönheit von Herkunft und die Magie des besonderen Kaffeemoments zu zelebrieren.

Eine Hommage an The Weeknds Mutter Samra Die Kampagne zelebriert nicht nur den einzigartigen Geschmack und die Qualität der ORIGINS Kollektion, sondern ist auch inspiriert von den äthiopischen Wurzeln von The Weeknd. In diesen ist eine einzigartige Geschichte über die Ursprünge von SAMRA verborgen. Es ist eine Geschichte über Herkunft, Tradition, Gemeinschaft und Familie. Inspiriert von seiner Mutter Samra – Muse, Unterstützerin und Namensgeberin der Kollektion – entstand der neue SAMRA ORIGINS Tanzania für das ORIGINAL System: ein Arabica aus der Region des Kilimandscharo im nördlichen Hochland Tansanias, der mit leichter Säure, zarten Fruchtnoten und subtilen Getreidearomen den Morgen zu einem besonderen Erlebnis macht. Die limitierte Kollektion ist nicht nur eine Hommage an Herkunft, sondern auch ein Statement für die Kraft, die in Musik und gemeinsamer Kreativität liegt.
www.nespresso.com/at/de/samra-origins

Die Fronten im Diskurs um Israel und Palästina haben sich verhärtet wie selten zuvor, auch in der Kulturszene. Alle, die nuancierter über die Lage sprechen wollen, erfahren Anfeindungen –nicht zuletzt jüdische Künstler*innen außerhalb Israels. Ein Text darüber, warum wir uns nicht nur mit Palästinenser*innen, sondern auch mit Jüd*innen solidarisieren sollten. ———— Eine dunkle Konzerthalle, rotes Strobolicht, ein tätowierter Mann mit nacktem Oberkörper hinter dem Mikro, ein anderer mit PussyRiot-Haube in den Farben der irischen Fahne über das Gesicht gestülpt. Das Publikum ist schon aufgewärmt, die Band stimmt an: »Guess who’s back on the news / It’s your favourite Republican hoods / It’s your fella with the Nike Air shoes / Two chains, two birds and we know what’s good.« Spätestens beim Refrain »Get your Brits out«, wird der ganze Saal zu einem strudelnden antibritischen Moshpit und alle im Publikum singen leidenschaftlich mit.
Das ist die Band Kneecap: eine punkige Hip-Hop-Gruppe aus Irland, die mit teils gälischen und teils englischen Lyrics das Leben ausgegrenzter junger Iren besingt, die in ihren Wohnungen noch eine Line ziehen, bevor sie rausgehen und Faschos verprügeln (»It’s gonna be a blood bath«). Aus ihrer eigenen nordirischen Geschichte heraus überrascht es dabei nicht, dass sie auch große Solidarität mit den Palästinenser*innen im Gazakrieg ausdrücken, wie Kneecap-Sänger Mo Chara während eines Konzerts: »Wir sind aus West-Belfast und Derry, zwei Orte, die noch immer unter britischer Besatzung stehen. Und doch wissen wir, dass eine schlimmere Besatzung gerade in Palästina stattfindet. Wir Iren, die 800 Jahre Kolonialismus miterlebt haben, wurden nie vom Himmel aus bombardiert, mit keiner Möglichkeit der Flucht. Die Palästinenser*innen werden dabei auch noch ausgehungert.«
Mo Chara fasst dabei zusammen, wie sich viele auf der Welt gerade fühlen, wenn sie Bilder vom Krieg in Gaza sehen: Der Anblick ganzer zerstörter Landstreifen, von blutüberströmten Leichen und ausgehungerten Menschen löst bei uns Betroffenheit, Hilflosigkeit oder Wut aus.
Der Krieg zwischen der palästinensischen Hamas, die den Gazastreifen regiert, und Israel tobt nunmehr seit Herbst 2023.
Er begann, als die Hamas am 7. Oktober Israel überfiel und über tausend Menschen tötete sowie Hunderte Geiseln nahm. Das Ziel der Terrorattacke waren dabei Zivilist*innen in Siedlungen nahe der Grenze sowie ein Technofestival in der Wüste. Die Brutalität des Angriffs schockierte Israel und die Weltöffentlichkeit zutiefst.
Die israelische Armee reagierte mit der erklärten Absicht, die Hamas ein für alle Mal militärisch zu besiegen. Seither wird im Gazastreifen gekämpft. Von Tag zu Tag steigen die Opferzahlen. Laut Schätzungen der UN wurden bis Redaktionsschluss mehr als 65.000 Palästinenser*innen – HamasKämpfer, aber insbesondere Zivilist*innen –getötet. Weil die Fläche des Gazastreifens sehr klein ist, ist die Bevölkerung gezwungen, den Kampfhandlungen mit einer stetigen Flucht vom einen zum anderen Ort auszuweichen. Hilfstransporte kommen nur beschränkt durch, die Menschen leiden unter zerstörter Infrastruktur, fehlender medizinischer Versorgung und bedrohlichen Hungersnöten.
Als militärisch eindeutig überlegene Macht steht Israels Regierung dabei zunehmend unter internationalem Druck, sich auf Friedensverhandlungen mit der Hamas einzulassen und in der Zwischenzeit die humanitäre Versorgung sicherzustellen. Im Moment wirkt es aber so, als würden sich weder Hamas noch Israel ernsthaft an den Verhandlungstisch setzen wollen. Für großen Aufruhr sorgen dabei Aussagen einzelner israelischer Regierungsmitglieder die die Vertreibung aller Palästinenser*innen aus dem Gazastreifen fordern – laut internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Sogar der Verdacht auf Völkermord wird aktuell gerichtlich untersucht.
Die Ereignisse in Israel und Gaza hinterlassen weltweit tiefe Spuren. Die Brutalität des Hamas-Angriffs und die verheerenden Folgen der israelischen Militärschläge lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen – und gleichzeitig bieten weder Terror noch Krieg eine Perspektive auf Frieden.
»Ich bin gegen diese Regierung und ihr Verhalten, doch in Israel werde ich damit schnell als
Hamas-Befürworter*in abgestempelt, während ich hier in Wien
zu einer Genozidbefürworter*in verkomme.«
— Sheri Avraham
»Ich merke aktuell, dass ich mich bei jeder Show frage, wie das Publikum reagieren wird, ob ich sicher bin.«
— Tamara Stern
Diese Widersprüchlichkeit spiegelt sich auch in den Reaktionen in Österreich wider. Seit Beginn des Krieges wird auch hierzulande für Palästina auf die Straße gegangen. Neben Kundgebungen, die sich für Frieden und Koexistenz von Israelis und Palästinenser*innen aussprechen, kam es immer wieder zu Protesten mit gewaltvollen Inhalten, unter anderem mit Bannersprüchen wie »Blessed is the flame that burns the settler colony« – womit Israel gemeint ist. Die Teilnehmer*innen dieser Proteste sind dabei meist links eingestellt und der Aufruf, Israel zu zerstören, wird als antikolonialer Kampfschrei verstanden. In diesem Zusammenhang wird die Hamas als Befreierin sowie als antiimperialistische Widerstandsorganisation gesehen und von einigen der Demoorganisator*innen sogar explizit gefeiert. Auch Kneecap positionierten sich so: Auf demselben Konzert, bei dem sie, wie oben beschrieben, über den Krieg in Gaza sprachen, riefen sie zur Unterstützung der Hamas auf und zeigten eine Hisbollah-Fahne. Widerstand und Terror
Was bei dieser Erzählung von Widerstand jedoch in den Hintergrund rückt: Ideologisch steht die Hamas den islamistischen Muslimbrüdern nahe und bei ihren Angriffen sind Zivilist*innen Hauptziel. Am 7. Oktober kam es zu massiven Verbrechen, darunter zahlreiche Vergewaltigungen von Frauen während des Angriffs auf das Technofestival. Viele der Opfer wurden anschließend brutal ermordet; ihre Leichen wurden öffentlich zur Schau gestellt und für die sozialen Medien inszeniert. Diese Gewaltästhetik verbreitete sich rasch online – und wurde von Anhänger*innen der Hamas mitunter glorifiziert.
Für den 1. September war ein Kneecap-Konzert in Wien geplant, das schließlich von den Veranstalter*innen – nach Bekanntwerden der Hamas-Unterstützung seitens der Band – »wegen akuter Sicherheitsbedenken« abgesagt wurde. Die Absage wiederum löste einen Aufschrei in der Kulturszene aus: Das Zwischennutzungskollektiv Wild im West organisierte ein Solidaritätskonzert, an dem Größen wie Buntspecht und Mavi Phoenix teilnahmen. Hier stellt sich natürlich die Frage, inwiefern allen beteiligten Künstler*innen bewusst war, dass Kneecap sich ausdrücklich mit Hamas und Hisbollah solidarisiert hatten. In den offiziellen Instagram-Storys fand dieser Umstand jedenfalls keine Beachtung, stattdessen ging es dort nur um eine allgemeine Solidarität mit Palästina. Genau diese Vermischung aber
macht es so schwierig: Wer Hamas oder Hisbollah unterstützt, vernachlässigt die Gräueltaten der Hamas an ihren israelischen Opfern und steht nicht für Frieden, sondern für eine Fortsetzung des Krieges.
Antisemitische FPÖ?
Dasselbe gilt natürlich umgekehrt auch für diejenigen, die keine klaren Worte gegen Israels Kriegspolitik finden. Besonders deutlich zeigt sich das bei der FPÖ. Sie gibt sich seit Beginn des Krieges als lautstarke Verteidigerin der israelischen Regierung und war auch eine der Ersten, die Druck auf die Veranstalter*innen des Kneecap-Konzerts ausübten. Die Strategie liegt auf der Hand: Die FPÖ versucht, sich von ihrem eigenen antisemitischen Erbe zu distanzieren, indem sie den Fokus auf antikoloniale Linke, Muslim*innen und LGBTQIA*-Gruppen als angebliche Hauptträger*innen von Antisemitismus verschiebt.
Doch die Rechnung geht nicht auf. Der Antisemitismus nach dem 7. Oktober ist in Österreich keineswegs auf linke Milieus beschränkt. Laut dem im November 2024 veröffentlichten »Rechtsextremismus Barometer« des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes stimmen 42 Prozent der Österreicher*innen der folgenden Aussage zu: »Israels Politik in Palästina ist wie die der Nazis im Zweiten Weltkrieg.« Unter Befragten mit stark rechtsextremen Einstellungen liegt dieser Wert aber sogar bei 60 Prozent. Den Krieg in Palästina mit der Shoa gleichzusetzen, ist eine Relativierung des Holocausts und die Studie hält fest, dass diese Aussage »als Straftatbestand nach dem Verbotsgesetz ausgelegt werden könnte«.
Generell zeigen die Zahlen aus dem jährlichen Antisemitismusbericht der Israelitischen Kultusgemeinde, dass die gemeldeten als antisemitisch eingestuften Fälle in Österreich seit 2023 auf das Doppelte angestiegen sind. Es ist dabei ein Zuwachs in allen Bereichen zu bemerken: Massenzuschriften (Onlinekommentare), verletzendes Verhalten, Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Angriffe. Doch diese Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Hinter ihnen stehen Menschen, die seit dem 7. Oktober eine Zäsur erleben, durch die ihr persönliches, politisches und berufliches Leben erschüttert wird. Speziell in der Kunst- und Kulturszene, die seitdem zu einem Brennpunkt der Debatte über Israel und Palästina geworden ist, treten diese Brüche deutlich zutage. Social Media ist dabei ein außerordentlich widriges Kampffeld, und einer der Orte, an dem Antisemitisches besonders bedenkenlos produziert und geteilt wird. Eine generelle Kritik an Israel
ist dabei längst nicht mehr genug, sie wird an Personen festgemacht, die es aus der Community auszuschließen gelte.
So passierte es Sheri Avraham. In Israel geboren lebt und arbeitet Avraham nun als Künstler*in, Kurator*in und Theatermacher*in in Wien. Im August veröffentlichte der Instagram-Account @ thepeoplesafa_vie einen Post, in dem Avraham und zwei weitere Personen öffentlichen Interesses namentlich als »GenozidBefürworter*innen« genannt wurden – mit der Absicht, deren Karrieren und Leben zu schaden: »In einigen Jahren werden diese Leute um politische Stimmen oder Unterstützung in ihren Karrieren bitten, in der Hoffnung, dass ihr deren bedingungslose Unterstützung des Genozids vergessen habt. (…) Genau deshalb sprechen wir das jetzt an –damit ihre Aktionen, ihr Schweigen und ihre Kompliz*innenschaft nie vergessen werden.« Als Stein des Anstoßes wird ein Statement angeführt, in dem sich Avraham für die Israelis, für die Palästinenser*innen, aber gegen die Hamas ausspricht. Andere Posts zum Thema werden schlicht als »99 Prozent Hasbara«, also israelische Propaganda, bezeichnet. Der Verdacht liegt nahe, dass Avraham vor allem als Jüd*in in den Fokus der Kritik gekommen ist.
Avraham erzählt uns von den Dissonanzen eines Lebens zwischen Wien und Israel: »Ich bin gegen diese Regierung und ihr Verhalten, doch in Israel werde ich damit schnell als Hamas-Befürworter*in abgestempelt, während ich hier in Wien zu einer Genozidbefürworter*in verkomme. Hier wehre ich mich gegen diese Beschuldigungen, während meine Schwester, die nahe der Grenze zum Gazastreifen wohnt, im Luftschutzbunker wartet bis der Bombenalarm vorbei ist, weil die Hamas nach wie vor Raketen auf Israel schießt.«
Avraham zählt zu den Mizrachim, arabischen Jüd*innen, einem lebenden Gegenbeispiel zum weitverbreiteten Narrativ, in dem die Israelis die weißen Kolonialisierer*innen sind, während die Palästinenser*innen die unterdrückten People of Color darstellen. Zwar gibt es mit der derzeitigen Besetzung des Gazastreifens und der Siedlungspolitik im Westjordanland klare koloniale Expansionspläne seitens Israels, doch die Bevölkerung in Israel und Palästina ist um einiges diverser in Ethnizität und Religion, als es die Debatte meist eingesteht.
Allerdings braucht es nicht unbedingt hasserfüllte Onlinekommentare, um Karrieren zu beeinträchtigen. Avraham berichtet, dass schon vor solchen Social-MediaPosts Projekte abgesagt worden seien und
»Wir haben beobachtet, dass sich Jüd*innen und antisemitismuskritische Personen immer mehr aus dem Kulturbetrieb zurückziehen.«
— Anna Jungmayr
Organisator*innen plötzlich nicht mehr auf Nachfragen reagiert hätten. Auch Tamara Stern, eine Schauspielerin, die in Wien und Berlin lebt, erzählt von Freund*innen in der Theater- und Filmszene, die schlichtweg weniger Aufträge bekommen würden, seit sie sich anlässlich des 7. Oktobers gegen Antisemitismus stellen. Als freie Schauspielerin, die nicht mit einem Theaterhaus assoziiert ist, spüre sie das selbst noch nicht so stark. Sie mache sich allerdings zunehmend Sorgen aufgrund ihrer exponierten Position als Schauspielerin: »In meinen Soloshows geht es oft um jüdische Themen, ich bin also sehr sichtbar. Seit Jahren spiele ich ein Programm, in dem ich ein Lied auf Hebräisch singe, und ich merke aktuell, dass ich mich bei jeder Show frage, wie das Publikum reagieren wird, ob ich sicher bin.«
Stern bezieht sich dabei unter anderem auf die unzähligen Bühnen, die in den letzten zwei Jahren von Pro-Palästina-Protestierenden gestürmt wurden. Das Anliegen mag verständlich sein: auf das Leiden in Gaza aufmerksam zu machen. Und eine demokratische Gesellschaft muss auch das Stürmen von Bühnen aushalten können. Doch ähnlich wie bei den Hasspostings gibt es die berechtigte Angst, dass der politische Protest schnell in eine persönliche Attacke übergehen könnte. Angesichts des markanten Anstiegs an Bedrohungen und tätlichen Angriffen auf Jüd*innen, die ein sichtbares Zeichen wie eine Kippa tragen, nur allzu verständlich.
Die Zunahme von Hasskommentaren, Diffamierungen und schließlich institutionellen Diskriminierungen, von der die interviewten Künstler*innen berichten, bedeutet einen täglichen Kampf für die Betroffenen. In diesem Kampf braucht es einen Rückhalt von Familie und Freund*innen. Während es diesen Rückhalt definitiv gibt – Sheri Avraham betont dabei, wie wichtig ihre BIPoC-Community für sie sei, und Tamara Stern spricht vom Rückhalt im engsten Freund*innenkreis –, wiegt es besonders schwer, wenn das Verhältnis zu langjährigen Wegbegleiter*innen brüchig wird. So berichtet uns etwa eine anonym bleiben wollende Gesprächspartnerin von einem Treffen mit einer alten Freundin, bei dem diese ausschließlich über Gaza sprechen wollte. Die Freundin habe dabei erwartet, dass ihre Pro-Hamas-Position einfach abgesegnet wer-
de. Der Einwand, dass Vergewaltigung kein Widerstand sei, wurde nicht ernst genommen. Das Gespräch habe kurz darauf abrupt geendet. Durch diesen täglichen Kampf gegen den erlebten Antisemitismus im öffentlichen und privaten Raum stellt sich für die Künstler*innen die Frage, ob sie in Österreich noch zu Hause sein können. Kaufmann bringt es dabei auf den Punkt: »Ich fühle mich unter Bombenalarm in Tel Aviv sicherer als in Wien. Natürlich überlege ich, nach Israel auszuwandern.« Auch Tamara Stern denkt darüber nach, fände es aber schwierig, weg aus Europa, in ein existenziell bedrohtes Land wie Israel zu ziehen.
Doch es formiert sich hierzulande auch Widerstand. Etwa von Gruppen wie der IG Antisemitismuskritik, die sich 2024 als Reaktion auf das politische Klima gegründet hat und Teil des Museumsbundes Österreich ist: »Wir haben beobachtet, dass sich Jüd*innen und antisemitismuskritische Personen immer mehr aus dem Kulturbetrieb zurückziehen. Dagegen wollen wir arbeiten«, erklärt Anna Jungmayr, eine der Organisator*innen. Die IG veranstaltet Workshops für Musemspersonal, in denen vermittelt wird, wie antisemitischen Ressentiments begegnet werden kann. »Uns geht es darum, Expertise zu bündeln und Wissen weiterzugeben. Gerade Museen sind Orte, an denen Geschichte und Gegenwart eingeordnet werden. Ein antisemitismuskritischer Blick ist da unverzichtbar.« Es ist klar, dass der 7. Oktober eine weltpolitische Zäsur darstellt, in der auch in der österreichischen Kulturszene vieles zerbrochen ist. Es liegt nun an uns allen – künstlerisch tätig oder nicht –, wieder Brücken zu bauen sowie die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung mit einer Sensibilisierung für Antisemitismus zu vereinen. Das ist jedoch nur möglich, wenn wir Empathie und Verständnis dafür haben, dass die Gegenwart gerade komplex und widersprüchlich ist und es dauern wird, bis man Zusammenhänge letztlich einordnen kann. Und wenn wir uns bewusst werden, dass Solidarität mit einem Teil der Weltbevölkerung niemals den Verlust der Solidarität mit einem anderen bedeuten darf. Carina Karner
Aktuelle Veranstaltungen der IG Antisemitismuskritik finden sich auf der Website des Museumsbundes. Von 7. bis 16. November findet das Klezmore Festival in Wien statt, ein Beispiel dafür, dass jüdische Kultur nicht mit der Politik des Staates Israel gleichgesetzt werden sollte.
Die bunten 3D-Buttons des Burgtheaters, das Neongrün und -pink des Volkstheaters, Teata statt Tag: äußere Zeichen eines inneren Wandels. Doch was steckt hinter der Fassade? Wie tiefgreifend kann sich ein Intendanzwechsel auswirken? ———— Es ist wieder Herbst und damit Saisonstart an den österreichischen Theatern. Mit diesem gehen auch heuer wieder einige Änderungen in den Chef*innenetagen einher. Wie nachhaltig eine neue Intendanz die betroffene Bühne verändert, kann dabei sehr unterschiedlich sein. Denn auch welche Aufgaben diese Position an einem Theater genau umfasst, ist von Haus zu Haus verschieden. So kann damit nur die künstlerische Leitung gemeint sein oder zusätzlich noch die administrative. Die Intendanz entscheidet jedenfalls über das Programm, die künstlerischen Engagements und die Ausrichtung eines Theaters. Sie repräsentiert das Theater gegenüber der Öffentlichkeit sowie den Medien und muss dabei verschiedene Interessen mitbedenken. Neue Intendanzen gibt es regelmäßig, aber in unterschiedlichen Abständen: Die Verträge laufen verschieden lang und werden dann teilweise neu ausgeschrieben, teilweise verlängert.
»Der Intendanzwechsel stellt einen tiefgreifenden Transformationsprozess dar, der weit über die personelle Neubesetzung hi-
nausgeht und das künstlerische Profil, die organisatorischen Strukturen, die Kommunikationsstrategien sowie die öffentliche Wahrnehmung eines Theaters nachhaltig prägt«, schreibt Manami Okazaki in ihrer Masterarbeit mit dem Titel »Der Wechsel der Intendanz und dessen Auswirkungen in Wiener
»Unsere Strukturen wachsen aus der Kunst heraus.«
— Claire Granier Blaschke
Theaterinstitutionen«. Wie weitgreifend diese Auswirkungen sind, hängt einerseits von der Institution, andererseits von den einzelnen Personen ab; davon, wie sehr diese ihren eigenen Stempel auf eine Institution drücken wollen oder ob doch das Haus und wofür es steht im Vordergrund bleiben.
Mit der Saison 2025/26 übernahm Jan Philipp Gloger das Volkstheater von Kay Vo -
ges. Mit grellen Farben, herumtorkelnden Sujets und einem Wochenende mit gleich drei Premieren präsentierte sich das Haus neu. Viel aus der alten Intendanz wurde nicht mitgenommen: eine Handvoll Schauspieler*innen und ein paar Produktionen, darunter »Fräulein Else«, »Krankheit oder Moderne Frauen« und »Prima facie«. Ähnlich wie das Schauspielhaus Wien zeigt sich nun auch das Volkstheater als »Open House«, das möglichst »vielen Menschen der Wiener Stadtgesellschaft« offenstehen soll. Wie sehr das einer so großen Institution gelingen wird, bleibt abzuwarten.
Ganz in der Nähe wechselt auch das Tanzquartier Wien seine Spitze. Bettina Kogler wird als künstlerische Leitung vom Kurator Rio Rutzinger und der Choreografin Isabel Lewis abgelöst, die kaufmännische Leitung übernimmt Gerda Saiko von Ulrike Heider-Lintschinger. Außerhalb von Wien gibt es ebenfalls ein paar Änderungen: Das Festival Operklosterneuburg hat Peter Edelmann als neuen Intendanten, ans Landestheater Niederösterreich kommt ab der Saison 2026/27 Patricia Nickel-Dönicke, die Marie Rötzer ablöst. Letztere übernimmt ab Beginn derselben Spielzeit gemeinsam mit Stefan Mehrens als kaufmännischem Direktor die

Aus der Ensemble-Sprechtheater-Bühne Tag wird das Koproduktionshaus Teata mit Fokus auf Diversität und Mehrsprachigkeit.
Leitung des Theaters in der Josefstadt. Dort ersetzen sie den Langzeitintendanten Herbert Föttinger, dessen Wutausbrüche für ein angsterfülltes Arbeitsklima gesorgt haben sollen. Für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe habe es, laut Berichten von Der Standard, unter ihm kaum Konsequenzen gegeben.
Die Tradition der so gut wie uneingeschränkt handelnden Direktor*innen an den Theaterhäusern fördert Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten. Das zeigt auch die Situation am Theater der Jugend, an dem der Direktor Thomas Birkmeir körperlicher und verbaler Übergriffe beschuldigt wurde. Gleichzeitig gab es am Haus auffällig viele Kündigungen sowie ein dementsprechendes Kommen und Gehen in allen Abteilungen. Birkmeir leitet das Theater der Jugend schon seit 2002, mittlerweile sind kürzere Führungsverträge an Theatern üblich. Dadurch soll solch ein totalitäres Führungsverhalten unterbunden werden. Mit Herbst 2026 übernimmt nun Aslı Kışlal die Leitung.
In den Sprachen Wiens
Ein Intendanzwechsel drückt sich oft vor allem in strukturellen Änderungen verschiedener Dimensionen aus. Davon bekommt das Publikum mal mehr, mal weniger mit. Die Marke bleibt meist erhalten. Eher selten passiert es, dass ein Theaterhaus komplett
umgekrempelt wird und künstlerische sowie kaufmännische Leitung gleichzeitig ausgeschrieben werden. Ebendies war aber kürzlich der Fall – im ehemaligen Theater an der Gumpendorfer Straße, kurz Tag.
Sara Ostertag und Claire Granier Blaschke haben als künstlerische beziehungsweise kaufmännische Leitung den Standort übernommen. Der Wechsel ist hier überaus deutlich spürbar. Aus dem Tag wird nun nämlich das Teata. Das Gebäude bleibt zwar dasselbe, doch gibt es lange und umfangreiche Sanierungsarbeiten. Aus der Ensemblebühne Tag mit Fokus auf Sprechtheater wird mit dem Teata ein Koproduktionshaus für die freie Szene mit einem Fokus auf Diversität und Mehrsprachigkeit. »Dieses Jahr passiert alles noch etwas reduzierter«, so Ostertag. »Der Stadt war zuerst nicht bewusst, was da alles zu tun ist. Es gibt jetzt aber ein sehr konstruktives Verhalten der Stadt und einen Willen zum Standort.«
Das Duo bewarb sich zwar separat, wollte jedoch von Anfang an gerne zusammenarbeiten. »Saras Konzept hat mich mit der Vision von Mehrsprachigkeit, Inklusion und dem Kulturpolitischen angesprochen – alles Themen, die in unserer Branche Relevanz haben«, erklärt Granier Blaschke. Als kaufmännische Leitung beschäftigt sie sich mit dem Budget und Fördergeldern, die künstlerische Leitung

Claire Granier Blaschke, kaufmännische Leitung Teata

Sara Ostertag, künstlerische Leitung Teata

Ferdinand Urbach, Gründungsmitglied Tag
»Mehr
Zusammenarbeit der Stadt mit den auszuschreibenden Institutionen wäre cool. Jetzt zieht man einfach den Stecker.«
— Ferdinand Urbach
sei für sie wie ein Kompass, der die Richtung vorgibt. Neben der inhaltlichen Gestaltung muss auch ein Betrieb mit neuen Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden. »Unsere Strukturen wachsen aus der Kunst heraus.« Ostertags Vision von Mehrsprachigkeit soll sich dabei auf den Ebenen von Text, Programm, Personal, Kommunikation und Publikum widerspiegeln. Die Stadtgesellschaft, die auch viele andere Sprachen als Deutsch spricht, soll abgeholt werden: »Ich habe darüber nachgedacht, was es in Wien gibt – und was nicht.« Dabei habe sie eine Bühne für mehrsprachige Autor*innen vermisst, so die neue künstlerische Leiterin. Nun folgt eine komplette Umstrukturierung des Betriebs und damit einhergehend die neue Marke Teata. »Die Sprachbarriere beim Zugang zu Kultur ist krass«, meint Granier Blaschke. Das sei zu ändern. Ein großer Bruch mit der Tradition des Tag.
Das Tag im Abriss
Ferdinand Urbach, Gründungsmitglied des Tag, weiß von dessen Ursprüngen und Geschichte zu erzählen. In den 1980ern hat die Gruppe 80 ein altes Kino in der Gumpendorfer Straße umfunktioniert. Über zwanzig Jahre führten sie es als private Institution. Doch das änderte sich mit der Theaterreform um 2005. »Es geht immer darum, wem das alles gehört und wer die Entscheidungen trifft«, erklärt Urbach. Mit der Theaterreform wollte die Stadt Wien die Intendanzen von privat geführten Theatern, die aber öffentliche Gelder bekommen, ausschreibbar machen. Zu diesem Anlass reichten drei erfolgreiche freie Gruppen ein Konzept für eine Vierjahresförderung ein und bekamen auf Empfehlung der Jury den Standort an der Gumpendorfer Straße. Ihr erklärtes Ziel: Theaterstrukturen demokratischer und offener für die freie Szene zu gestalten und die gläserne Decke der Kulturbranche zu zerbrechen.
Diesem Ansatz verliehen sie zusätzlich Nachdruck, als sie ihre Struktur 2014 an die Stadt übertrugen, genauer gesagt an den Theaterverein Wien, der damit für Kontrolle und Ausschreibung der Leitungspositionen zuständig war. Für das Tag sei nur folgerichtig gewesen, dass, wenn man öffentliche Gelder bekommt, die Politik auch mitgestalten können sollte, erinnert sich Urbach: »Manche nennen das vielleicht naiv, wir fanden das eigentlich demokratisch und richtig.« Doch dann sah sich das Tag 2023 mit den ernsthaften Konsequenzen dieser Entscheidung konfrontiert: Der Vertrag der Leitung wurde nicht verlängert. Die Intendanz wurde neu ausgeschrieben.
»Mehr Zusammenarbeit der Stadt mit den auszuschreibenden Institutionen wäre cool. Jetzt zieht man einfach den Stecker«,
so Urbach. Es sei nicht gefragt worden, was die Themen dieses neugedachten Hauses sind, ob Ostertags Konzept überhaupt räumlich möglich ist. Auch die Namensänderung sieht er kritisch, sei das Tag doch ab sic htlich neutral genug benannt worden, sodass der bekannte Name in eine neue Intendanz hätte mitgenommen werden können. Und während der Sanierungsarbeiten fehle nun eine wichtige Bühne in der Wiener Szene. »Es geht viel Wissen und Kontinuität verloren. Auch wenn die Übergabe mensch-
»Dieses Jahr passiert alles noch etwas reduzierter. Der Stadt war zuerst nicht bewusst, was da alles zu tun ist.«
— Sara Ostertag
lich, finanziell und strukturell vorbildlich war.« Es sei ihm wichtig gewesen, betont Urbach, nicht alles hinter sich niederzureißen, wie es an anderen Standorten passiert sei. »Ein Wechsel ist immer teuer. Wir haben die Saison früher beendet, um das finanzieren zu können. Wir mussten Leute früher kündigen. Das war schmerzhaft und das hätten wir so nicht machen müssen.« Wien verliere eine mittlere Ensemble-Sprechtheater-Bühne, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal des Tag.
Wohin nun?
Auch das lange Jahre treue Publikum muss sich nun fragen, wohin es zukünftig gehen wird. »Man muss den Schieberegler zwischen Erneuerung und Kontinuität für das bestmögliche Ergebnis verstellen«, befindet Ferdinand Urbach. Die Stadt habe ihren Teil an diesem Wechsel nicht gut genug gemacht. »Wie der Übergang betreut – oder besser: nicht betreut – wurde, hat mich enttäuscht.« Eines scheint jedenfalls klar: Der Umbau von Tag zu Teata ist ein deutliches Beispiel dafür, dass ein Intendanzwechsel mehr als nur einen neuen kosmetischen Anstrich bedeuten kann.
Johanna T.
Hellmich
Das Teata feiert am 12. November in Kooperation mit dem Schauspielhaus Wien seine erste Premiere mit der Produktion »Das Ende ist nah« unter der Regie von Sara Ostertag.
Les Blancs
Drama von Lorraine Hansberry
Deutschsprachige Erstaufführung
Jetzt im Schauspielhaus Graz
Lorraine Hansberry – heute fast vergessen – war in den 1960er Jahren die bekannteste Schwarze Autorin der USA. In ihrem letzten Stück treffen drei Brüder in einem fiktiven afrikanischen Land nach langer Zeit wieder aufeinander und werden vor schicksalhafte Entscheidungen gestellt. Ein aufwühlendes Drama zwischen Familie und Revolution.
Im Theater passiert so einiges im Schatten des Offensichtlichen. Abseits der Strahlkraft von Bühne, Ensemble und Aufführung gibt es eine Reihe von Geschichten über jene Abteilungen zu erzählen, die nicht im Rampenlicht stehen. Und diese machen deutlich, wie sehr für einen gelungenen Theaterabend alle Hand in Hand arbeiten müssen. ———— Mit schnellen Schritten nähert man sich den großen Eingangstüren des Theaters. Nach energischem Taschenwühlen auf der Suche nach der Eintrittskarte, übergibt man den Fund am Einlass und hört ein kurzes, papiernes »Ratsch«. Im Saal angekommen, wird man mal von prunkvollem Rokoko mit Samtsitzen und verzierten Logen, mal von einem minimalistischen Raum mit schwarzen Wänden und schwarzen Stühlen begrüßt. Die Gespräche des erwartungsfrohen Publikums vermischen sich zu einem rauschenden Gemurmel. Langsam füllen sich die Reihen, das Licht geht aus, Stille kehrt ein und der Vorhang öffnet sich.
Ein Abend im Theater bringt eine ganz eigene Stimmung mit sich, die noch lange nachhallt. Ja, so kitschig es klingen mag, auch einen Zauber. Wie viele Menschen allerdings hinter der Bühne daran beteiligt sind, dass Theater Tag für Tag stattfinden kann, kommt dabei selten zum Vorschein. Wen braucht es hinter dem Vorhang, damit der perfekte Theaterabend gelingt? The Gap befragte Menschen am Schauspielhaus Graz, am Schauspielhaus Salzburg und am Kosmos Theater in Wien zu ihrer meist unsichtbaren Arbeit. Luise Aymar
Das Schauspielhaus Salzburg startete am 13. September unter neuer künstlerischer Leitung von Alexander Kratzer und Sophia Aurich in die Spielzeit 2025/26. Für Anna Vilter begann am selben Tag ihre dritte Saison an der Schauspielhaus-Graz-Spitze. Und mit der Produktion »Retrotopia« ging es am 16. September im Kosmos Theater los – nach wie vor unter Intendantin Veronika Steinböck.
Sie sind Allrounder*innen: Logistiker*innen, Psycholog*innen, Feuerwehrmenschen, die überall mitanpacken, wo gerade der Hut brennt. Als Produktionsleitung des Kosmos Theaters in Wien habe man viele Aufgaben, erklären Sebastian Klinser und Katharina Koch. Ihre Arbeit drehe sich vor allem um die Übersetzung der künstlerischen Ideen in Budgets, Zeit- sowie Ablaufpläne. Zwischen Regie, Technik, Bühne, Kostüm und vielen anderen Bereichen seien sie das Bindeglied: »Als Produktionsleitung sind wir unsichtbare Strippenzieher*innen.« Jeder Tag sei anders, denn die Mischung aus Kreativität und Organisation mache jede Produktion zu einem besonderen Abenteuer. Das begrenzte Budget des Theaters legt dabei gerne Steine in den Weg. Für Klinser und Koch heißt das notgedrungen Prioritäten setzen oder kreative Lösungen finden. Dazu komme der klassische Zeitdruck: »Da hilft nur Improvisationstalent, verbunden mit dem Schmieden von Notfallplänen – sowie eine Prise Humor.«
Von schaurigen Grimassen, über quietschbunte Frisuren bis hin zu großen Eiterpickeln auf den Gesichtern des Ensembles – zugegeben, bezüglich Letzterem habe es einiges an Ekel seitens der Darsteller*innen gegeben, verrät Cindy Geyer vom Schauspielhaus Graz. Als Leiterin der Maskenbildabteilung versucht sie mit ihrem Team, trotz Zeitdruck jedes noch so skurrile Konzept der Kostümbildner*innen umzusetzen. Eine gute Zusammenarbeit mit Requisite und Ankleider*innen sei dabei unabdingbar. »Im Theater ist es wichtig, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, sonst ist eine Theateraufführung nicht möglich.« Allerdings seien Geyer und ihr Mitarbeiter*innen nicht nur für kreative Einfälle und präzises Handwerk verantwortlich, sondern auch Kummerkasten, Teilzeitpsycholog*innen und feinfühlig im Umgang mit allen, die sich in den Schminkstuhl setzen. Verschwiegenheit ist dabei das A und O: »Was beim Schminken geredet wird, bleibt in den Maskenräumlichkeiten.«
Erzählt man von einer Theateraufführung, geht es dabei meist um Regie, Ensemble oder die eine Person, die mal wieder vergessen hat, das Handy auszuschalten. Was einen eigentlich auf die Idee für den Theaterbesuch gebracht hat, bleibt meist unerwähnt. Ob Presse, Outreach oder Marketing, die Öffentlichkeitsarbeit eines Theaters umfasst viele Bereiche. Katja Nindl vom Schauspielhaus Graz sieht ihre Aufgabe darin, die künstlerische Idee eines Hauses in eine Sprache zu übersetzen, die Menschen anspricht. Beispielsweise in Bild, Text, mittels Veranstaltungen oder im direkten Gespräch. Wie sie es selbst treffend beschreibt: »Wir öffnen den Raum nach außen.«
Die Herausforderung liege dabei darin, möglichst viele Personengruppen für diesen Raum zu begeistern. Stammgäste, Schüler*innen, Student*innen oder Menschen ohne bisherigen Bezug zu Theater – sie alle sollen sich angesprochen fühlen. Neben Inklusionsprojekten und Publikumsgesprächen mit Groß und Klein gehöre auch der Umgang mit dem ein oder anderen kritischen Kommentar dazu, etwa über das Gendern auf der Bühne oder über vermeintlich eitle Regisseur*innen.
»Mit wenig Geld Imposantes rüberbringen.« Diese Aufgabe stellt Dulci Jan, die technische Leitung des Kosmos Theaters, immer wieder vor Herausforderungen. Ohne eigene Bühnenabteilung sei dabei viel technische Kreativität gefragt. Jan selbst sieht sich deshalb als »Ermöglicherin«, die die Aufführung einer Inszenierung technisch realisiert – trotz Einschränkungen in Sachen Ressourcen und Budget. In Zusammenarbeit mit Produktionsleitung, Bühnenbildner*innen und Co wird für jede Vorstellung ein technischer Zeitplan gestaltet und es werden dafür Licht, Ton und manchmal sogar Video programmiert. Alles, um nach den Wünschen von Regie und Choreografie das perfekte Stimmungsbild zu basteln. Die Mischung aus technischer und künstlerischer Arbeit sei hierbei für Jan besonders schön. Ein kreativer Prozess, bei dem es auch schon mal um den logistischen Umgang mit Livemusik, simuliertem Regen, Drehbühnen mit Wasser, Schleimbecken und vierzehn Tonnen Erde auf der Bühne gehen könne.
Wie die Regie und das Ensemble gehört auch die künstlerische Direktion zu den exponierteren Teilen eines Theaters. Aber was genau wird da denn eigentlich dirigiert? Das künstlerische Programm, erklärt Alexander Kratzer vom Schauspielhaus Salzburg. Zusammen mit seiner Co-Leitung Sophia Aurich erstellt er die Spielpläne, bestimmt, welche Stücke aufgeführt werden, wer im Ensemble welche Rolle übernimmt und wer welche Produktion inszeniert. Dabei verwaltet er auch das Budget der unterschiedlichen Abteilungen. Eine Herausforderung, denn das Geld ist begrenzt und die Wünsche aller Beteiligten sind groß. Trotz dieser Hürde sieht Kratzer vor allem das Schöne an seinem Beruf: aus verschiedenen Konstellationen von Menschen eine Gruppe zu formen und sich mit dieser in ein Thema zu vertiefen. »Das ist eine sehr intensive Arbeit, denn wir proben jeden Tag stundenlang miteinander, obwohl wir uns vor drei Wochen noch gar nicht gekannt haben.«
Inspizient*innen
Wirft man einen Blick in das Inspizient*innenbuch eines Theaters, findet man darin alles, was für den gesamten technischen Ablauf einer Produktion entscheidend ist. Für Proben und Aufführungen funktioniert es daher wie eine Partitur für Dirigent*innen. Von seinem Inspizient*innenpult aus ist Roland Fischer vom Schauspielhaus Graz verantwortlich für die technische Umsetzung der gesamten Inszenierung. Mit Licht- und Funkzeichen gibt er Anweisungen an die Bühnentechnik und macht Einrufe für das Ensemble und alle anderen Gewerke. Neben dem Publikumseinlass bringt ihn besonders der reibungslose Ablauf von Aufführungen mit aufwendigen Bühnenbildern zum Schwitzen, etwa wenn schwere Elemente bewegt werden müssen oder knappe Blacks nur wenig Zeit für Szenenwechsel bieten. Anmerken lassen dürfe er sich das jedoch nicht. Ruhe bewahren sei die Devise. Selbst, wenn mal etwas schiefgeht. Dafür sei es wichtig, dass alle Abteilungen eines Theaters vor und während einer Aufführung ineinandergreifen, erklärt Fischer: »Ein Theaterabend funktioniert nur im Team.«
Die einzigartige Theateratmosphäre sowie die langen Gespräche mit Publikum, Ensemble, Regie und Technik sind für Jadwiga Majewska das Besondere an ihrer Arbeit als Barleiterin im Kosmos Theater. Seit zwanzig Jahren kümmert sie sich nun schon um das »Herzstück des Theaters«, wie sie es stolz nennt. Vor sowie nach jeder Vorstellung wird die Bar zum Sammelbecken für Besucher*innen, Künstler*innen und das gesamte Team des Theaters. Während Majewska für sie alle die unterschiedlichsten Drinks mixt, verteilt sie individuelle Horoskope, spricht über Sternzeichen und rechnet Aszendenten aus. Ihre eigene kleine Spezialität, die für sie ein Teil ihrer Aufgabe sei, alle am Bartresen willkommen zu heißen.
Als erster und letzter Eindruck eines Theaterbesuches befindet sich das Vorderhauspersonal zwar nicht hinter den Kulissen, seine Bedeutung für das Theater wird aber dennoch häufig unterschätzt. Diese Mitarbeiter*innen fungierten nämlich als wichtige Repräsentant*innen des Hauses, meint etwa Alexander Kratzer vom Schauspielhaus Salzburg. Schließlich hätten sie den direktesten Kontakt mit dem Publikum – ob beim Kartenverkauf, bei der Ticketkontrolle, an der Garderobe oder bei der Platzanweisung. Auch dem Feedback der Zuschauer*innen lässt sich dort am besten zuhören: Sei es ein »Das war ein super Abend«, während man Mäntel und Jacken überreicht, oder ein »Die Abschlussszene habe ich wirklich nicht verstanden«, während man den Weg zum Ausgang weist.

Matthias Dvoracek
Bestattungsfachkraft
Im makellosen Anzug und mit leuchtend blauer Krawatte begrüßt uns Matthias Dvoracek im Logistikzentrum der Bestattung Himmelblau mitten im Industriegebiet des elften Bezirks. Es ist halb sieben – Zeit für Dvoracek, den Arbeitstag zu beginnen. Er zeigt uns, wie er einen Sarg vorbereitet und befüllt ihn mit Maissnips: »Damit die Person gleich weicher liegt und Flüssigkeiten aufgesaugt werden.« Seit fünf Jahren übt er seinen Beruf als Bestattungsfachkraft aus – mit Herzblut. Ursprünglich wollte er Gerichtsmediziner werden, er entschied sich dann aber doch für eine Laufbahn als Koch, die durch Corona ein jähes Ende fand. Auf Rat seines Großvaters begann er schließlich als Bestatter. »Bei uns im Team rennt immer der Schmäh«, meint er, und das sei auch notwendig, um mit der Schwere des Berufs umzugehen. In der Hochsaison holen Dvoracek und seine Kollegen am Tag bis zu zwanzig Verstorbene ab. »Es gab drei Freunde, die sich von mir abgewendet haben, weil sie den Tod nicht im Freundeskreis haben wollten.« Für ihn schwer nachzuvollziehen, denn trotz der oft harten Momente findet er seinen Job sehr schön. Ein gesunder Magen, Einfühlungsvermögen, Kraft und Geduld für Bürokratie sind wohl nichtsdestotrotz Voraussetzungen. Einen Ausgleich findet Dvoracek übrigens im Fallschirmspringen – und als Bestatter weiß er dabei genau um die möglichen Konsequenzen.


Naturbestattungsexpertin
Trifft man Pamina Pröglhöf bei ihrer Arbeit in der Naturbestattung Waldesruh würde man wohl kaum glauben, dass sie privat bei Dragshows auf der Bühne steht. »Ich war immer eine Rampensau«, lässt sie uns wissen. Ursprünglich studierte sie deshalb auch Schauspiel. Doch nun ist sie in einem gänzlich anderen Beruf angekommen: »Organisation und Durchführung von naturnahen Bestattungen«, so lautete die Stellenausschreibung für den Waldfriedhof in Breitenfurt, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Wien, auf die Pröglhöf sich vor etwa einem Jahr bewarb. »Bestattung hat mich immer fasziniert, aber ich wusste nicht, ob ich die Skills dafür habe«, erzählt sie. Jetzt führt die 34-Jährige Beisetzungen durch, schreibt Nachrufe und gestaltet gemeinsam mit den Kund*innen Trauerfeiern. Dabei sei eine der größten Herausforderungen, sich emotional nicht zu sehr mitnehmen zu lassen, ganz anders als im Schauspiel. Im Vordergrund müssten immer die spezifischen Bedürfnisse der Kund*innen stehen. Für Menschen, die es besonders naturverbunden mögen, zeigt uns Pröglhöf sogar eine Urne aus Pilzgeflecht: »Damit kommt man wirklich zurück zur Natur.« Auch bei der Trauerfeier selbst gebe es zahlreiche Optionen – von der stillen Verabschiedung bis hin zu größeren Zeremonien mit Musik. »Einmal wurde beim Schließen der Grabstelle ›Don’t Stop Me Now‹ gespielt. Das war einer meiner Lieblingsmomente.«

Julia Pustets Debüt »Alles ganz schlimm« verbindet scharfen Humor mit präziser Ideologiekritik. Der Roman erzählt von Identitätsdiebstahl, einer geheimen Vergangenheit und dem Scheitern an widersprüchlichen Erwartungen. Unser Textauszug macht deutlich: Julia Pustet ist eine Stimme, die man jetzt hören muss.
Als ich fünf Jahre alt war, waren zwanzig Mark für meine Tante Elisabeth doppelt so viel Geld wie für meine Eltern und bestimmt nur halb so viel wie für mich. Sie lebte in einer Wohnung, in der statt Teppich Kunstrasen auslag und deren Wohnzimmer auf eine massive Schrankwand ausgerichtet war, die hinter Kristallglas eine umfangreiche Sammlung von Diddlmäusen barg, flankiert von den Zierständern mit den Pfeifen meines Großvaters. Neben den Pfeifen standen, ordentlich auf einem Holzschiffchen aufgereiht, Zinnfiguren aus dem Überraschungsei, die, wie sie mir erklärt hatte, einmal viele tausend Mark wert sein würden, weshalb ich nicht mit ihnen spielen und Jens sie nicht einmal anfassen durfte. Gerahmte Fotos, die sich dicht aneinandergehängt über jede Wand ihrer Wohnung zogen, zeigten fünf Jahrzehnte aus dem Leben meiner Tante und ihrer Familie, weshalb ich nie das Gefühl hatte, ich hätte viel verpasst: Elisabeth, ein dickes Kind mit fast weißen Wimpern, war als zweite von sechs Töchtern in einem Bungalow an der tschechischen Grenze zur Welt gekommen, hatte mit siebzehn eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin begonnen und war noch im gleichen Jahr zum ersten und einzigen Mal schwanger geworden. Den verantwortlichen Nachbarsjungen hatte sie im Hochzeitskleid ihrer Mutter geheiratet, das ihren schon fortgeschrittenen Bauch, nicht aber ihren Büstenhalter vollständig bedeckte und in Knöchel- statt Bodenhöhe endete. Von meiner Mutter, die zur Zeit der Eheschließung ihrer Schwester noch ein Kind gewesen war, wusste ich außerdem, dass das gelbliche Kleid so stark nach dem Schweiß aus einer zwanzig Jahre zuvor durchtanzten Hochzeitsnacht gestunken hatte, dass der pubertierende Bräutigam es nicht geschafft hatte, die Braut zu küssen, weshalb das Brautpaar sich nur betreten umarmt und er unwillkürlich, aber
zumindest geräuschlos, eine würgende Geste gemacht hatte. Meine Cousine Janine war auf der Eckbank ihrer Großeltern geboren worden, Teil desselben Ensembles in Eiche rustikal, in dem unsere ukrainische Urgroßmutter kurz zuvor im Sitzen gestorben war. Kare, ein kränklicher und schweigsamer Mann, von dem man sich, vielleicht gerade weil er so kränklich und schweigsam war, im Dorf erzählte, dass er Anwalt, Notar oder sogar Arzt hätte werden können, hatte, um sich, Elisabeth und Janine ernähren zu können, eine Büttnerlehre gemacht, war mit achtundzwanzig auf dem Weg zur Kaffeemaschine tot umgefallen und hatte meiner Tante nichts hinterlassen als ein Moped mit gerissenem Keilriemen. In der Bäckerei im Untergeschoss ihres Wohnhauses hatte sie Anstellung als Verkäuferin gefunden, weshalb sie meistens schon am frühen Nachmittag damit begann, bei laufendem Fernseher abstrakte Bilder zu malen, die meine Mutter hochnäsig gar nicht so schlecht nannte. Elisabeth saß nie länger als fünf Minuten am selben Ort. Alle Fotos in ihrer Wohnung waren schwarz eingerahmt, auch die von Janine, Jens und mir, obwohl wir, und damit waren wir in der Unterzahl, noch lebten.
Wenn wir bei meiner Tante Elisabeth waren, durfte ich Nusspli aus dem Glas essen und ganze Streichholzpackungen über dem Spülbecken anzünden, die zischende Flammen in die Luft jagten und enttäuschend schnell in klamme Asche zerfielen. Über das riesige Radio auf dem Küchenschrank lief ein Sender mit Werbeanzeigen, die genauso laut durch die Wohnung dröhnten wie die Lieder, zu denen meine Tante, die kein Englisch konnte, erfundene Laute mitgrölte. Überall, auch im Bad, auf dem Fahrradtrainer und beim Essen, rauchte sie Zigaretten, die von den Märkten hinter der Grenze stammten und nicht wie Zigaretten, sondern wie Zigarren rochen. Oft
vergaß sie ihre brennenden Kippen in Aschenbechern in den verschiedenen Zimmern der Wohnung, zündete sich, während im Wohnzimmer noch eine Zigarette brannte, in der Küche eine neue an und hielt, wenn sie zurück im Wohnzimmer nur noch einen Stummel vorfand, die Glut der alten an die neuen Zigaretten, für die sie, wie sie mir einmal stolz und auch ein wenig abfällig erzählt hatte, nur halb so lang brauchte wie mein Vater. Sie hatte blonde, rote und schwarze Haare und einen runden Bauch, der von zwei schiefen Kinderbeinen getragen wurde und aussah, als könne man ihn zum Schlafen abnehmen und neben das Bett legen, damit er die Form nicht verlor. Wenn Janine nach Feierabend zu Besuch kam, brachte sie uns Tüten voller zerschmetterter Bonbons aus der Fabrik mit, in der sie arbeitete. Nach einer Zigarette mit ihrer Mutter fuhr sie nach Hause, um dem Mann mit dem amerikanischen Namen, der von zu Hause aus Kugelschreiber zusammenbaute, das Abendessen zu kochen. Mit den Bonbontüten und einer alten Zeitung legten wir uns dann auf den Teppich und suchten die größten Stücke aus, die wir in Zellophanstücke verpackten wie echte Bonbons.
Alles in Tante Elisabeths Wohnung war entweder verbrannt oder feuerfest. Wenn Jens und ich in Unterhemden und Strumpfhosen auf dem Sofa lagen und die Schlümpfe auf Video schauten, bohrten wir unsere Finger in die Zigarettenlöcher des Plüschbezugs, bis die von der Hitze geschmolzenen und zu Plastik erstarrten Ränder brachen. Am meisten Befriedigung verschafften mir die Löcher, die so groß waren, dass mein Finger gerade so hineinpasste, aber noch klein genug, um nur durch das Hineinstecken meines Fingers aufzubrechen; waren sie zu klein, riss auch das umliegende Gewebe mit ein, waren sie zu groß, genügte der Druck eines ein-

Julia Pustet, geboren 1991, legt mit »Alles ganz schlimm« ein Debüt vor, das Brüche nicht kaschiert, sondern feinsinnig seziert. Die Handlung folgt Susanne, die ihre ordentliche Fassade verliert, als Vergangenheit und Verrat sie einholen: ein gestohlener Text, ein Shitstorm, alte Dämonen. Pustet schreibt scharf, klar und mit trockenem Humor über den Grenzbereich zwischen Nähe und Selbstverlust, Familie und Flucht. Die Autorin, Musikerin und kompromisslose Antifaschistin veröffentlicht damit einen Roman, der mitten rein geht in die gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart – und lange nachhallt. »Alles ganz schlimm« ist im Haymon Verlag erschienen.
zelnen Fingers nicht, um den Plastikkreis zum Knacken zu bringen. Löcher kaputtzumachen bedeutete, hatte ich Jens erklärt, Zerstörungen wieder aufzuheben, weshalb nur das Plastik kaputtgehen durfte, nicht aber der Stoff, der noch heil war. Nach einem lautstarken Streit über Charakter und Sinn von Zerstörung begann Jens, den Stoff zwischen den Löchern mit Rissen zu verbinden, um längere Lochstrecken zu erzeugen, und glättete deren Ränder mit dem Feuerzeug wieder zu Plastik. Papa, der dem Geruch versengten Plastiks widerwillig ins Wohnzimmer gefolgt war, löschte das Kanapee mit einem Glas Weißbier und warf dann das Weißbierglas an die Wand. Tante Elisabeth schimpfte beide, doch nur Jens weinte. Von den Schwestern meiner Mutter wurde mein Bruder oft gemaßregelt, während die Geschwister meines Vaters sein Temperament zum Zeichen besonderer Charakterstärke verklärten, ein Irrtum, den sich mit Vorliebe diejenigen Menschen leisteten, die mein Vater die besseren Leute nannte.
16.– 28. OKTOBER
PROGRAMM AB 7. OKTOBER TICKETS AB 11.





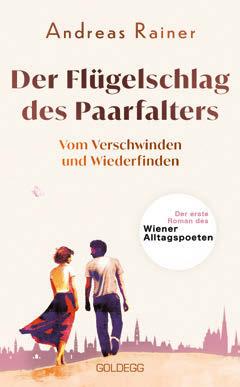
1 FM4 × Peng! »The Sabotage Collection«
Anlässlich seines Dreißigers droppt FM4 eine limitierte Modekollektion. In Kollaboration mit dem Kreativstudio Peng! liefert die »Sabotage Collection« festivaltaugliche Unikate, die nachhaltig produziert sind und den Spirit FM4s zum Ausdruck bringen. Die Kollektion wird bei einem Pop-up am 3. Oktober beim »FM4 Unlimited«-Event im Prater präsentiert. Wir verlosen zwei Teile aus der Kollektion.
2 »28 Years Later«
Im Jahr 2002 perfektionierte »28 Days Later« den postapokalyptischen Horror. Das langersehnte zweite Sequel brachte Regisseur Danny Boyle diesen Sommer auf die Leinwände: »28 Years Later« handelt von den Ereignissen fast dreißig Jahre später – in einem markant veränderten Großbritannien. Das Horrorszenario ist dabei abermals gespickt mit Sozialkritik. Wir verlosen drei Blu-rays.
3 Nina Schedlmayer »Hitlers queere Künstlerin«
Die Chefredakteurin des Kulturmagazins Morgen hat wieder ein Buch geschrieben. Nina Schedlmayer erzählt in »Hitlers queere Künstlerin« die Geschichte Stephanie Hollensteins und zeichnet das Porträt einer Malerin, die queer war und gleichzeitig radikale NSDAP-Anhängerin. Ein Denkanstoß, wie weit Naziideologie die Kunstszene durchdringen kann. Wir verlosen drei Exemplare.
4 »Reading Rock – Lauter! Schöne neue Kurzgeschichten« Reading Rock« bringt seine spannenden Erzählungen erneut auf Papier. Das von Andi Appel und Gordon McMichael ins Leben gerufene Format verbindet die Welten von Literatur und harter Musik. Den Geschichten kann man auch in einem Podcast lauschen. Das zweite Buch der Reihe präsentiert eine bunte Vielfalt von Beiträgen – diesmal sind es 24 Erzählungen auf 200 Seiten. Wir verlosen drei Exemplare.
5 Andreas Rainer »Der Flügelschlag des Paarfalters« Andreas Rainer, Gründer von »Wiener Alltagspoeten«, begeistert mit Anekdoten und Alltagspoesie über Wiener Eigenheiten. Nun erzählt er in seinem ersten Roman »Der Flügelschlag des Paarfalters« die Geschichte des Protagonisten Jonas. Bei seinem Streifzug durch Wien begegnet dieser der Schönheit, der Skurrilität und dem Grant der Bundeshauptstadt. Wir verlosen drei Exemplare.


»Zu viele Jahre habe ich mich wohl täglich gefragt, ob es denn überhaupt noch Menschen da draußen gibt, die Freude hätten mit einer neuen Platte?«, meinte Oliver Welter, Mastermind von Naked Lunch, einmal. Ja, verdammt noch mal! Zwölf Jahre nach ihrem letzten kommt die Band mit einem neuen Album daher, auf das viele gewartet, aber nicht zu hoffen gewagt haben. »Lights and a Slight Taste of Death« ist nach Neu- und Umbesetzungen das Erwachen eines österreichischen Indie-Riesen aus den von so vielen schmerzlich vermissten Neunzigerjahren. Ein Erwachen, das nicht ohne seismografische Verwerfungen einhergeht. Die erste Singleauskopplung »To All and Everyone I Love« war mehrere Wochen auf Platz eins der Austrian Indie Charts. Die zweite Single »Go Away« ist zumindest gerade auf dem Weg dorthin. Nach all den Jahren ein starkes Stück. Starke Stücke sind auch die Lebenserzählungen von Welter.
Unverputzte Monumentalität
Zart und fragil, roh und euphorisch hat er das Fürchterliche und das Schöne in ein dröhnendes Werk über das Leben mit all seinen Zerwürfnissen gegossen. Der »Arschloch-Krebs«, gegen den er ringen musste, die Liebe als große Befreiung: Es tönt immer dringlich, immer unerbittlich auf diesem Album. Die Wolken hängen tief, das Licht blendet. »Lights and a Slight Taste of Death« besitzt die gravitätische Größe des freien Falls, aber eben auch die des Fluges. Naked Lunch klopfen indes die Popmusik auf ihre Möglichkeiten ab. Die Gesangsmelodien sind von melancholischer Schönheit. Keys in Dur und dramatischem Moll schweben darüber. Kristalline Trompeten, ein kreischendes Saxofon, ins Geräusch kippende Gitarren, die sich schon im nächsten Moment gezupft, vom treibenden Schlagzeug getragen, wieder öffnen, hallende Elektro-Dissonanzen, die in strahlenden Hymnen ihre krönende Auflösung finden sowie Klavierbegleitungen im Stile großer Balladen. Epische Ästhetik trifft auf unverputzte Monumentalität: »Imagine there’s no echo in the canyons and no name for you and me.« Ja! Aber: Bitte nicht mehr so lange auf das nächste Album warten lassen. (VÖ: 7. November) Tobias Natter
Live: 17. Jänner, Ebensee, Kino — 22. Jänner, Wien, Arena — 23. Jänner, Graz, PPC — 29. Jänner, Innsbruck, Treibhaus — 30. Jänner, Dornbirn, Spielboden — 31. Jänner, Salzburg, Arge Kultur

Feber Wolle Records

Hallelujah! Nora Blöchl haut endlich wieder die feinste Darkwave-Postpunk-Mische raus, die nicht nur den grauen Betonfassaden der Stadt die Farbe zurückgibt, sondern auch alle sommergebräunten Underground-Goths endlich wieder in ihre eigentliche Lieblingsjahreszeit überführt. Gut also, dass pünktlich zum Beginn der spooky season die neue EP »II« von Elastic Skies erscheint. Mit »Collapsing Places« machte uns die Wiener Musikerin bereits im Februar Lust auf mehr. Spätestens mit der zweiten Vorabsingle »Hills of Pastel« aus dem Sommer ist klar: Wir wollen nicht nur, wir brauchen diese EP. Denn wenn Blöchl Musik macht, wird nicht nur der Himmel elastisch, sondern auch unsere Knie werden es. Bei diesen düsteren Synthsounds bleibt einem kaum etwas anderes übrig, als die trägen Beine durch die nebelverhangene Tanzfläche zu jagen. Es ist der Soundtrack zu jener Stunde der Nacht, in der man nicht mehr weiß, ob man träumt oder schon längst Teil des Traums geworden ist.
Zwischen Pathos und Subtilität
Elastic Skies erzeugt Soundscapes, die wie Wetterumschwünge funktionieren: An Sonnentagen bringen sie Regen, an Regentagen Sonne. Pathos und Subtilität gehen Hand in Hand, ohne jemals ins Überladene abzudriften. Es sind Tracks, die sich wie Blitze in die Nacht brennen, dabei aber gleichzeitig so elegant schimmern, dass sie noch lange nachwirken. Manchmal braucht es eben nicht mehr als fünf Stücke, um ein Statement zu setzen. »II« wirkt dabei wie ein kompaktes Manifest in Sound gegossen: jeder Track ein Fragment, das sich zum Ganzen fügt, und jeder Beat ein Puls, der im Raum nachzittert. Zwischen kalten Wänden und warmem Herzschlag spannt sich eine Atmosphäre auf, die gleichermaßen clubtauglich wie introspektiv ist. Wir waren ja schon seit der ersten EP überzeugt, aber jetzt sind wir endgültig verloren. Glückliche Super-Trouper-Fans, die in den Soundgewitterwolken von Elastic Skies nichts anderes mehr wollen als weitertanzen.
(VÖ: 17. Oktober)
Live: 2. Oktober, Wien, Waves Vienna

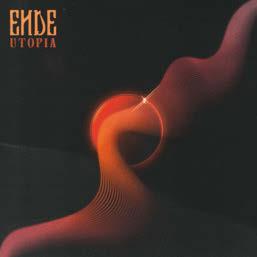
Es sind die großen Themen, die uns alle einen. Liebe, Leidenschaft, Verdammnis und – Überraschung! – das Imposter-Syndrom. Eigentlich eher Lohnarbeitslingo, schenkt uns dieses Phänomen das Gefühl, trotz nachweislichem »Erfolg«, was auch immer das sein mag, einfach nicht gut genug zu sein und dass die draußen irgendwann merken werden, dass das alles nur Zufall war. Das stimmt natürlich in den meisten Fällen auch, vor allem in Liebe, Leidenschaft und Verdammnis. Davon können auch die sehr schön fatalistisch betitelten Ende alle Lieder singen. Und auf ihrer Debüt-EP machen sie das gleich zu Beginn: »Ich weiß, ich hab dich nicht verdient / Auch wenn du das anders siehst« (aus »Kopfverdrehn«).
Sowieso, diese Selbstzweifel trotz guter Auswirkung, quasi: DNA. Weil eigentlich eher nur zum Zeitvertreib gegründet, wurde erst nach dem ausgiebigen Airplay ihres 2023er-Hits »Cowboy1«, bekannt vom Radiosender eurer Wahl, aus Spaß Ernst und das Duo aus Wien sowie Linz vor allem in Oberösterreich zum Publikumsliebling. Naturgemäß folgten Live-Anwachsen zum Quartett, Festivalshows mit Tausendercrowds, weitere Singles, mit »Räuber« ein weiterer Hit. Jetzt die EP, auf einmal Ausrufung als große Hoffnung des österreichischen Postpunk, Vergleiche mit Edwin Rosen (aber cooler), Salò (aber weniger grindig) und was weiß ich noch – the sky is da the limit.
Ania Gleich
Und ja, natürlich ist das Genre mehr Trend als Genre, im Großen und Ganzen sagen die meisten »Neue neue neue deutsche Welle«, weil die mit zwei »neue« auch schon wieder zwei Jahre her ist. Also so Achtziger-Postpunk mit eher kühler Anmutung, aber irgendwie auch persönlicher. Ihr wisst, was gemeint ist. Jedenfalls: Trend egal, weil – und hier jetzt wieder der Dolchstoß für sämtliche Imposties – das ist völlig fernab von irgendwelchen Einordnungen einfach richtig gute Musik. Ja, gut, es ist die erste EP und, ja, gut, es sind gerade mal fünf Nummern in nicht einmal einer Viertelstunde, aber – und das ist auch so eine Sache – es zählt der erste Eindruck. Und der sitzt. Bei den ersten Singles und jetzt auf der Mittelstrecke. Ich glaub, die tun nicht nur so. Ich glaub, die wissen, was sie tun. (VÖ: 3. Oktober) Dominik Oswald
Live: 4. Oktober, Linz, Stadtwerkstatt





Grüne Parkanlage bei Sonnenschein? Fehlanzeige! Die Musik von The Ghost and the Machine schreit nach einer kalten dunklen Nacht, nach mit Menschen vollgestopften Bars, aus denen der Zigarettendunst in den Himmel emporsteigt. Wo sich der Kummer, passend zum Titel des Albums »Sorrows«, unter Gleichgesinnten frei entfalten darf. Dass man die Texte nur ansatzweise versteht, versinnbildlicht das Schluchzen in tiefer Not. Denn es geht fortwährend um Dunkelheit, Kälte und ein Herz, das zusammenbricht und sich erhebt. Ein weltthematisch wie saisonal perfekt platzierter Albumrelease.
Wunschkonzert der Musiklegenden
Die zwölf Songs gleichen einem Webstück musikalischer Assoziationen: Sie rufen, wie in einem Wunschkonzert der Musiklegenden, das Timbre David Bowies und musikalische Motive von Led Zeppelin sowie Leonard Cohens »Hallelujah« wach. Es ist nicht zuletzt die akustische Gitarre mit eingebauten Metallresonatoren, die an die internationalen Größen der Musikgeschichte erinnert – gepaart mit Andreas Lechners tiefer Stimme, gleichermaßen verzerrt wie wuchtig. In der zweiten Hälfte des vierten Albums von The Ghost and the Machine erklingt das Schlagzeug (Aurora Hackl Timón) dann nuancierter: Denn inmitten des Morasts der Finsternis brechen Sonnenstrahlen hervor, die das Dunkel mit leuchtender Abwechslung durchziehen. Ebenso wirkungsvoll sind das in zwei Songs vorkommende Akkordeon (Martti Winkler) und die Backing Vocals von Leonie Schlager (bekannt als The Zew). Und immer wieder dringt der Gitarrenverstärker durch: mal säuselnd im Nachhall, mal bebend mit dem ersten Ton. Die beiden Lovesongs »Ghost Romance« und »Light of Love« entschleunigen ganz entzückend. Sie nehmen mehr Sekunden als andere Songs auf dem Album ein, lassen schwelgen und dem Analogen nachspüren. Wer in diese eigentümliche emotionale Welt aus Geist und körperlicher Maschine eintauchen möchte, darf sich auf Schwermut einstellen, gespickt mit ein paar und hoffnungsfrohen Lichtmomenten. (VÖ: 14. November) Sandra Fleck
Live: 13. November, Wien, Chelsea


Aus der unbeliebten Reihe »Probleme der vermeintlich Überprivilegierten«: Ageism im Rock. Die Betroffenen sind Kreisky, die zuletzt – etwa im Vorfeld des Popfests – immer wieder mit altherrlichen Attributen versehen wurden und deren »Ausdauer« als krasses Gegenteil zu jugendlichem Übermut und Spielfreude inszeniert wurde. Quasi als Verbraucher*inneninformation für eine stabile Wahl. Dass das natürlich ein ausgemachter Blödsinn ist, dafür braucht’s nur Hausverstand, als Informationsdienstleister liefern wir euch den Kontext dennoch frei Haus(verstand).
Man ist so alt …
Erstens: Soo (mit beliebig intensivem Vokalstretching) alt sind die vier auf dem feschen Foto da auch nicht. Die Gruppe feiert mit »Adieu Unsterblichkeit« zwar schon ihren Zwanziger, aber Alter ist immer auch in Relation zu setzen. Im Vergleich zu den Rolling Stones, quasi den britischen Kreisky (Vergleich mit Bauchweh, aber so von der Erzählung her), nuckeln sie nachgerade noch am Schnuller. Zweitens: Diese Musik ist einfach zeitgeistig. Selbstverständlich ist da in jeden Akkord »Kreisky« eingebrandet, wie alle guten aktuellen Rockbands fliegt der Wiener Vierer aber weiterhin über sämtliche mittlerweile ohnehin komplett abgebauten Genregrenzen hinweg, landet zwischen Artrock, Math, Kraut, Pop und Hippierock (manchmal braucht es alt klingende Worte, um modern klingenden Sound zu beschreiben, paradox!). Drittens: Dieser Franz Adrian Wenzl kann halt einfach texten, erkennt die Herausforderungen der Zeit (das machen »zu alte Gruppen« tendenziell eher nicht) und stülpt dem Album, etwa im Unterschied zum jugendlichen Vorgänger »Atlantis«, das Thema des Abgründigen, des Morbiden, der Vergänglichkeit, des Todes über. Gut, das ist jetzt für unsere Anti-Aging-Argumentation ein bisschen eine Widersprüchlichkeit. Aber ist eine Frage, wie du damit umgehst – im Idealfall selbstironisch. Auch deshalb ist der Siebenminüter »Pedale« als erste Single sehr repräsentativ: Wenn dir als Bobo über 35 nichts mehr bleibt als die Wahl zwischen Siebträgerfaschismus und Rennradsportgruppe mit Wortspielnamen (»Piraden«), weißt du – das war’s jetzt mit der Unsterblichkeit. (VÖ: 17. Oktober) Dominik Oswald
Live: 26. November, Wien, Wuk — 27. November, Graz, Orpheum — 28. November, Salzburg, Arge — 29. November, Linz, Stadtwerkstatt

Mittelschwerere Ekstase
Bader Molden Recordings
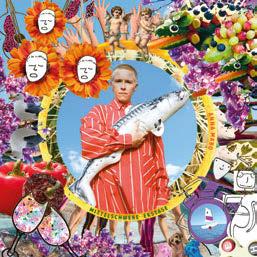
Sei ruhig rastlos. Klingt paradox? Ist es nicht, wenn es nach Anna Mabo geht. Auf ihrem neuen Album feiert die Musikerin sowohl den Aufbruch als auch alle Widersprüche, die damit einhergehen. Das beinhaltet einerseits das Aufbrechen von bestimmten Denk- oder Verhaltensmustern, aber auch das tatsächliche Kofferpacken und Losfahren. Dass Aufbruch auch bedeuten kann, sich in nichts mehr als einer Nussschale aufs offene Meer zu begeben, zeugt von jener mindestens mittelgroßen Ladung Optimismus, die sich durch »Mittelschwere Ekstase«, das neue Album von Anna Mabo und den Buben, zieht. Wobei das nicht bedeutet, dass delulu immer the solulu ist, denn in ihren Songs stellt Mabo etwa auch – auf subtile, humorvolle, aber eindringliche Weise – gesellschaftliche Normen infrage. Unter anderem die weit verbreitete Vorstellung, in bestimmten Lebensphasen an bestimmten Punkten angekommen sein zu müssen. Für Anna Mabo gilt eher: Alles ist im Entstehen, im Werden, am Wachsen. »Keine Angst und keine Ahnung von angewandter Zukunftsplanung«, singt sie im Lied »Meer«.
Gemütliche Nussschale
Von angewandter Poesie hat Mabo dafür umso mehr Ahnung und auch keine Angst davor, ihr Gefühl für Sprache in kleine Sprachkunstwerke zu verpacken, die gleichzeitig aufwühlen und beruhigen. Die Songs auf »Mittelschwere Ekstase« sind virtuos und berührend gleichermaßen. Sie laden dazu ein, es sich mit Mabo und den Buben in einem winzigen Segelboot, das kaum größer als eine Nussschale ist, gemütlich zu machen, obwohl sich die hohe See vielleicht gerade eher von ihrer unruhigen Seite zeigt: »Mich stressen die Wellen im Atlantik sehr / Ich bin halt keine zwanzig mehr«, singt sie in »Ich bin halt keine zwanzig mehr«. In a nutshell lässt sich also Folgendes sagen: Die Einladung, ruhig rastlos zu sein, nimmt man gerne an, wenn sie von Anna Mabo und den Buben ausgesprochen wird. Weil spätestens nach dem ersten Durchhören von »Mittelschwere Ekstase« klar ist, dass Aufbrüche keine einsamen Unterfangen sein müssen. (VÖ: 3. Oktober) Sarah Wetzlmayr
Live: 15. Oktober, Porgy & Bess, Wien — 18. Oktober, Posthof, Linz — 23. Oktober, Altes Kino, Rankweil — 25. Oktober, Nexus, Saalfelden

brut nordwest
Mi. 08., Fr. 10. & Sa. 11. Oktober, 20:00
Karin Pauer
LOW
Uraufführung
Breitenseer Lichtspiele
Di. 14. Oktober, 20:00
Alex Franz Zehetbauer
An Evening with
studio brut
Mi. 15., Do. 16., Fr. 17. & Sa. 18. Oktober, 19:00
Lens Kühleitner & Olivia Hild
trace my layers, thrust your guts
Uraufführung
brut nordwest
Mi. 22., Do. 23., Fr. 24. & Sa. 25. Oktober, 20:00
Matteo Haitzmann
Im Styx baden
Uraufführung

Krrra
Wirbelwind Productions

»Hip-Hop ist tot!« Diese Ansage rauscht alle paar Jahre mal wieder durch den Blätterwald. Letztes Jahr hat dann der Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar das totgesagte Genre in den Augen der Kondolenzschreiber*innen doch noch wiederbelebt. Aber auch abseits medial gut ausschlachtbarer Diss-Track-Kleinkriege haben sich die voreiligen Nachrufe bislang eben immer als das erwiesen: voreilig. Trotzdem lässt sich eine gewisse Genremüdigkeit nach gut fünfzig Jahren durchaus nachvollziehen. Zum Glück ist Hip-Hop außerordentlich gut darin, sich immer wieder neu zu erfinden. Es braucht nur Artists die dabei helfen.
Narrative Reimkaskaden
Und hier kommen wir endlich zu Nenda: Vier Jahre nach der vielversprechenden Debütsingle »Mixed Feelings« der gebürtigen Tirolerin folgt nun endlich ihr Debütalbum. »Krrra« ist vollgepackt mit musikalischen Geistesblitzen, mit Beats, die überraschen, Wendungen, die bekannte Muster in neue Richtungen drehen, sowie einem technisch ausgeklügelten Flow, der all dieses sprudelnde Potenzial nicht nur zusammenhält, sondern in genreerneuernde Bahnen lenkt. Da ist »Growing Pains«, in dem Nenda über reduziertem Beat in schier endlosen Reimkaskaden rezentes Trauma verarbeitet sowie ihren beginnenden Ausstieg aus dem tiefen Loch der Trauer skizziert. Oder »Alone« mit einer unwiderstehlichen Hook aus melodischem Gitarrenriff und hingehauchtem Refrain. Oder die verträumt-verliebte Ode an »Ella«, in der der titelgebende »angel fallen to this earth« besungen wird (Bonuspunkte für den Rihanna-Teaser). Oder die hypnotische Erzählung in »Sleep«, dessen dröhnende Bassline exakt den Moment zwischen Ein- und Schlafen evoziert. Oder die wütend-abgeklärte Abrechnung mit rassistischen Diskursen im Titeltrack. Oder die zwei Indie-Jumpscares »Stellar« und »Runaway«, die in weniger fähigen Händen Steine im Getriebe sein könnten, hier aber einfach eine weitere Facette hinzufügen. Oder … Es sind Platten wie »Krrra«, bei denen klar wird, dass Hip-Hop noch lange nicht den Teich der frischen Ideen leergefischt hat. Auch wenn Nenda sich gerade einen beachtlichen Teil davon geangelt hat. (VÖ: 14. November) Bernhard Frena
Live: 3. Oktober, Salzburg, Arge — 26. November, Linz, Stadtwerkstatt — 27. November, Villach, Kulturhof — 28. November, Graz, Dom im Berg


Selten, aber doch, aber vor allem selten erzählen einzelne Songzeilen die Geschichte und das Gefühl eines ganzen Albums. Aktuelles Beispiel aus dem bereits vierten Langspieler der Wiener Omnipop-Gruppe Pauls Jets und dem Song »Didn’t Make It«, wo es heißt: »Du weißt, I cannot sleep alone / Schauen wir Tiktoks all night long.« Und – hier beginnt sich der Bogen zu spannen – so klingt, so fühlt sich »Morgen sind wir Fantasy«, so fühlen sich die fünfzehn Songs auf »Morgen sind wir Fantasy« an. Eklektisch und wie ein unendlicher Stream channeln Pauls Jets deinen inneren Goldfisch, jeder Song eine neue Welt, dein → im Abspielgerät wird zum resetting Scroll-down, der immer wieder neue Skizzen, neue Ideen, neue Memes, neue fertige Songs bringt, die häufig nicht so viel mit dem zu tun haben, was du kurz davor noch gehört hast. Da ändern sich Stimmen, Stimmungen, ausgedachte und neu belebte Genres, jedes Lied für eine ganz andere Playlist. Das macht Pauls Jets im Endeffekt dann doch wieder zu einer Jazzband, wie das letzte Album ja bereits groß ankündigte. Aber vor allem macht es Paul Buschnegg und Konsort*innen zur Reinkarnation von Mila Superstar mit einem Kopf voll Fantasie. Passend dazu: sehr internetty Lyrics mit zahlreichen Anspielungen auf »Internetkulturelles« und die eigene überbordende Bildschirmzeit.
Wer genau wissen will, wie sich dieser Stream anfühlt, aufgemerkt: Scroll zu »Pompeii« – Weltuntergangs-Spacepop. Scroll zu »Kiss Me in the Morning« – Slackersurf (ist ja auch mit Tobias Hammermüller von Laundromat Chicks). Scroll zu »Erdmaus« – Weirdo-Keyboard-Pop. Scroll zu »Ich schreib dir« – gepitchter Drummachine-Hyperpop. Scroll zu »Smash« – Stadionrock für kleine Arenen. Scroll zum »Fokustrack« namens »Ich habe Angst so ohne dich kann ich nicht leben oder kann ich doch ich glaub schon aber schön ists nicht« – hittiger Synthrock. Scroll zu »Interlude« – Space-Age-New-Age-Wave. Scroll zu »Hardcore« – Echokammer-Poprock. Scroll zu »Harry Potter« – optimistischer GagaPop. Scroll zu »Blau (live im Stu)« – Feedback-Rock. Viel Spaß beim Einsortieren! (VÖ: 10. Oktober) Dominik Oswald
Live: 30. Oktober, Salzburg, Arge Kultur — 1. November, Wien, Flucc — 13. Dezember, Linz, Stadtwerkstatt


SLDK Records

Soul ist per se meist mitreißend, bewegend, körperlich und emotional. Davon profitieren auch die vielen immer wiederkehrenden Protagonist*innen verschiedener musikalischer Schulen, die mit dessen Versatzstücken mal direkter und mal weiter hergeholt arbeiten. Nicht selten auf einer gewissen Nostalgie reitend. Und da ist es schon wirklich bewundernswert, was dem Grazer Trio Sladek gelingt: Der auf Gitarre, Bass, Schlagzeug – und ausgeborgten – Keys basierende Sound, wird hier großartig gespielt sowie auf den Punkt abgemischt, genauso klar die Vergangenheit zitierend wie im Jetzt verankert. Grundsätzlich relaxed wird hier stark reduziert, die Energie kommt nicht aus Lautstärke oder Geschwindigkeit, sondern aus dem gekonnten Einsatz der Melodien und Instrumente. Dass Sänger David Sladek seine Stimme ziemlich hoch ansetzt, passt da ausgezeichnet – nicht nur in Bezug auf die Vorbilder aus den späten 1960er-Jahren. Das lässt auch live den Blutdruck steigen und bringt mindestens Körper in Bewegung. Ein kleiner Club mit schwitzendem und dicht gedrängtem Publikum – in diesem Biotop stellt man sich Sladek am liebsten vor.
Verspielte Rhythmen als Anker
R&B und Soul hatten ursprünglich häufig eine spezielle Dringlichkeit. Gospel wurde bei diesen mit weltlicher Lust am Sex aufgeladen – und zwar so direkt und unverblümt wie selten zuvor. Historisch ist das alles nicht vom Civil Rights Movement und Schwarzer Kultur zu trennen. Eine inhaltliche Ebene, die Sladek in Texten und im Gesang nicht erreichen (können). Aber das Vergessen der Sorgen und des Alltags, das ist Soul und dem Club generell immer schon eingeschrieben – auch wenn manchmal gar nicht so viel da ist, das vergessen werden muss, um zu genießen. Und so ist es vielleicht nur richtig, dass Sladek daran keine Gedanken zu verschwenden scheinen, sondern sich und den Hörer *innen einfach die Freude schenken, die ihre Musik zu vermitteln vermag. (VÖ: 24. Oktober) Martin Mühl
Live: 13. März, Wien, Porgy & Bess


150 Millionen Kilometer – so weit ist die Sonne in etwa von der Erde entfernt. Sobald Tape Moon aka Michael Naphegyi aber über den strahlenden Himmelskörper singt, wirkt dieser Abstand plötzlich gar nicht mehr so unüberbrückbar. Da träumt man sich gerne in die warmen Sphären dieses übergroßen Sterns, ohne dabei zu verbrennen. Denn wenn Naphegyi Musik macht, gleitet man ganz ohne Anstrengung in Welten, die sonst unerreichbar scheinen.
Auch wenn das Album des ursprünglich aus Vorarlberg stammenden, mittlerweile in Wien lebenden Musikers »Detached« heißt, abgeschnitten fühlt man sich dabei zu keinem Zeitpunkt. Vielmehr vermittelt es das Gefühl von Losgelöstheit im besten Sinn – frei, schwerelos, entrückt. Schon der Auftakt eröffnet einen Kosmos aus feinen Synthflächen, fließenden Rhythmen und einer Atmosphäre, die gleichzeitig weit und intim klingt. Spätestens ab dem Track »Waiting« treibt man endgültig davon, hinein in Wellen aus intergalaktischer Melancholie und nahbarer Verträumtheit. Irgendwo zwischen gestern und morgen, auf einem imaginären Raumschiff, das einen sanft durchs All trägt.
Ein atmender Soundorganismus
Was Musik von Tape Moon so besonders macht, ist deren erfrischende Unaufdringlichkeit. Sie will nicht überwältigen oder beeindrucken, sondern entfaltet ihre Wirkung gerade dadurch, dass sie einen umschließt und trägt. Der musikalische Tausendsassa Naphegyi versteht es, aus komplexen Arrangements eine Leichtigkeit zu destillieren, die man in der heutigen, schnelllebigen Gegenwart oft vermisst. »Detached« ist kein Album, das man konsumiert und wieder vergisst. Es ist eher wie ein Kreislauf aus Trance, Flow und Stille, ein atmender Organismus, der Gelassenheit schenkt, ohne in Belanglosigkeit abzurutschen. Jeder Song ist sorgfältig geschichtet, aber nie verkopft; die Loops wirken hypnotisch, die Harmonien schimmern subtil, und immer wieder blitzt eine fast schon poppige Eingängigkeit durch. So macht das Album seinem Titel alle Ehre: Es trennt uns ab von dem, was uns unten hält, und schenkt einen kurzen, kostbaren Moment der Schwerelosigkeit. (VÖ: 17. Oktober) Ania Gleich
Live: 29. Oktober, Graz, Café Wolf – 30. Oktober, Wien, Rhiz –14. November, Linz, Raumteiler


Das passt schon gut zusammen: Im Sommer 2022 spielte das Wiener Kollektiv Thalija im Rahmen der gleichnamigen Reihe ein »Baulückenkonzert« am Nordwestbahnhof. Eine – nach wie vor so vorhandene – Zwischennutzung, in der per Definition der Moment Räume öffnet. Thalija nutzten auch diese Gelegenheit, um in einem Raum zu improvisieren und spielten in vierzehnköpfiger Besetzung vier Stücke, die nun als »Track 41« bis »Track 44« als Livealbum erscheinen. Sieben Gitarren, zwei Bässe, zwei Schlagzeuge, ein Synthesizer, zwei Stimmen und ein Laptop kamen zum Einsatz. Das gibt schon fast überraschend viel von dem vor, was hier passiert – und Thalija wollen das offenbar auch gar nicht anders.
Zum Großteil sind die vier Stücke dominiert von einer Wall of Noise, die Akzentuierungen und Details zulässt, aber selten in den Vordergrund rückt. Mal scheint ein Rhythmus den Rahmen zu bestimmen, dann wieder ein Riff. Auch der natürlichen Tendenz, innerhalb der Stücke eher Dringlichkeit und Dichte aufzubauen und zu intensivieren, wird zumeist nachgegeben. Selten, dass ein Track irgendwann auch wieder abschwillt oder die Richtung ändert.
Pointierter Griff in die Trickkiste
Dass man derlei aber auch zu ernst nehmen kann und die Musik von Thalija in erster Linie eben ein Erlebnis im Moment ist, das ordentlich einfahren kann, zeigen sie unter anderem damit, dass sie Anfang Oktober ein Releasekonzert spielen und der improvisierte Augenblick der Stücke damit nicht nur auf Platte gepresst wurde, sondern auch live wiederholt und wohl auch variiert wird. Und dann gibt es da noch das großartige Video zur »Singleauskoppelung« »Track 44«, das man auf der Website der Band ansehen kann: Hier wird gekonnt in die Trickkiste gegriffen und pointiert mit musikalischen, visuellen und anderen Klischees gespielt – unter anderem wenn Thalija zum Wüstenrockkollektiv werden. Das zaubert ein Lächeln ins Gesicht, was man sich bei Thalija vielleicht gar nicht erwartet hätte. Großes Kino, denn Thalija sind eben mehr als ihr raumfüllender Sound. (VÖ: 3. Oktober) Martin Mühl
Live: 3. Oktober, Wien, Rave Up Records — 11. Oktober, Wien, Funkhaus
16.10.25 LOFT KOKOROKO 30.10.25 FLEX
GHOSTWOMAN 15.11.25 LOFT JAKUZI 02.11.25 LOFT




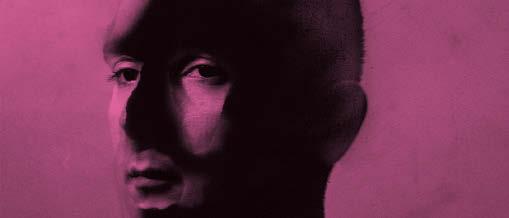

MOLLYNILSSON 07.12.25
FLUCCWANNE






















17.-25.10.25



Singer-Songwriter*innen aus der Indie- und Folk-Ecke kann man beim Blue Bird Festival lauschen. Seit 2004 wird dieses von der Vienna Songwriting Association veranstaltet und bietet an drei Tagen arrivierten Acts sowie Newcomer*innen eine Bühne. Hauptaugenmerk wird dabei auf erzählerische Musikformen gelegt. Zwölf Künstler*innen sind 2025 im Line-up vertreten. Man darf sich auf Acts wie The Songs of Joni Mitchell, Alicia Edelweiss (Bild) und The Zew freuen. 20. bis 22. November Wien, Porgy & Bess



Ein Metalfestival von und für FLINTA*? Endlich! Veranstaltet wird das nach eigenen Angaben weltweit erste Festival dieser Art vom Kollektiv Heavy Lezzers. An zwei Tagen bringt es ein vielfältig kuratiertes Line-up von Metalbands ins Flucc – fernab stereotyper Männlichkeitsbilder. Als Ergänzung zu den musikalischen Acts (Bild: Lurch) wird es Dragshows, »Dungeons & Dragons«-Runden sowie eine Chill-out-Area mit Brettspielen geben. 21. und 22. November Wien, Flucc





Der Indiepunkrocker Anda Morts besingt humorvoll das pure Leben – Zustände von Wut, Desillusion und allem, was sonst so dazu gehört. Sein Debütalbum »Ans« changiert zwischen subkulturellem Ethos, »Fuck you!«-Attitüde und einer Prise Selbstironie. 15. Oktober Graz, PPC — 16. Oktober Salzburg, Rockhouse — 17. Oktober Dornbirn, Conrad Sohm — 18. Oktober Innsbruck, Treibhaus — 24. Oktober Wien, Arena
Mit ihrer unverkennbaren Stimme machte sich die britischdeutsche Sängerin Anika erstmals 2010 einen Namen. Auf ihrem dritten Album »Abyss« spricht sie nun insbesondere politische Themen an, unter anderem unsere Beeinflussung durch soziale Medien sowie das Wiedererstarken der Rechten. Ihr Stil bewegt sich dabei zwischen elektronischer Avantgarde und Postpunk. 24. Oktober Wien, Rote Bar
In puncto Garagenrock stehen The Hives wohl kaum jemandem nach. Sie sind einer jener Acts, die die Jahrtausendwende in musikalischer Hinsicht wesentlich mitgeprägt haben. Nun kommen die Schweden mit den schwarz-weißen Anzügen im Zuge ihrer Welttournee wieder nach Wien – und sie werden dabei mit Hits wie »Tick Tick Boom« oder »Walk Idiot Walk« die Halle bestimmt zum Ausrasten bringen. 26. Oktober Wien, Gasometer
Mit ihrem 2022 erschienenen Debütalbum »Preacher’s Daughter« schaffte die aus Florida stammende Musikerin Ethel Cain recht rasch den Durchbruch. Für virales Geschehen sorgte zuvor schon der Song »Crush«, der Ambient-Elemente mit Indie vereint. FolkFlair und eine nostalgische Südstaatenaura zeichnen sich in ihrer Musik ab. Wer Lana Del Rey mag, wird vermutlich auch mit Ethel Cain glücklich. 2. November Wien, Gasometer
Wenn King Gizzard & the Lizard Wizard die Bühne betreten, lässt der Moshpit nicht lange auf sich warten. Ihre Konzerte streamen sie gerne in voller Länge auf ihrem Youtube-Kanal – einen Spotify-Katalog sucht man jedoch vergeblich, obwohl die Band bereits 25 Studioalben veröffentlicht hat. Immer wieder haben die Australier dabei ihren Sound verändert, als »experimentierfreudiger Rock« ist dieser wohl am besten beschrieben. 12. November Wien, Gasometer
Wer diesen Bandnamen zum ersten Mal hört, erwartet vermutlich keinen Indiepop. Auch das Herkunftsland der Mitglieder – Norwegen – lässt viele wohl eher an Metal denken. Spätestens die Melodie ihres Hits »Restless« sorgt dann aber für einen Aha-Moment: Feelgood-Indie, der Kakkmaddafakka gut steht. 5. November Wien, Flex
Mit ihrem Album »Doppeldenk« spielten Gewalt kürzlich eine Tour, die sie bis nach Mexiko und in die USA führte. Die nächste folgt in Kürze. Raue Lyrics und maschinelle, treibende Beats prägen die Handschrift der Gruppe. 11. November Innsbruck, PMK — 12. November Linz, Stadtwerkstatt — 16. November Wien, Chelsea

Sie kommen in Frieden. Das sagen Feine Sahne Fischfilet auf ihrem neuen Langspieler. Auch wenn sich dieser, ihr insgesamt siebter, eher nicht nach friedlichem Zusammensitzen anhört, sondern durchaus Moshpit-Potenzial aufweist. 19. November Dornbirn, Conrad Sohm — 20. November Linz, Posthof — 21. November Graz, Orpheum

Leiterin Re:pair Festival
Worin genau besteht dein Aufgabenbereich beim Re:pair Festival?
Ich verantworte Konzept, Planung, Fundraising und Organisation. Aber ich mische auch bei der Pressearbeit und bei Social Media mit. Das hat nichts mit Größenwahn zu tun, sondern ist dem äußerst knappen Budget geschuldet. Leider ist es wahnsinnig stressig, das Geld aufzustellen. Aber: Der große Erfolg des Re:pair Festivals – 2024 kamen über 4.000 Besucher*innen – motiviert mich, mein Ziel, Menschen für das Reparieren zu begeistern, weiter voranzutreiben. Denn jede Reparatur ist ein Beitrag gegen den Klimawandel.
Was wird bei euch denn eigentlich »repariert«?
Das vierte Re:pair Festival bietet insgesamt über 140 Veranstaltungen, unter anderem Kreativworkshops, wo man Sashiko, Punch-Needling, Filzen und Flicken sowie Scotch und Swiss Darning ausprobieren kann. Das sind coole Techniken, um Gewand zu upcyceln, die richtig Spaß machen. Wir veranstalten wieder Ambulanzen, bei denen man einfach vorbeikommen kann, und die defekten Sachen werden von Expert*innen kostenlos repariert. Heuer gibt es zwei Fahrradambulanzen, eine Gitarrenambulanz, bei der man auch mit Ukulele oder Mandoline vorbeikommen kann, und erstmals findet eine BH-Ambulanz statt. Und am 18. Oktober, dem International Repair Day, gibt es in der Festivalzentrale ein Repair-Café.
Welche Bedeutung hat das Reparieren in unserer heutigen Wegwerfgesellschaft?
Ich kämpfe dafür, dass das Reparieren wieder in Mode kommt, also in breiten Bevölkerungsschichten als kreativ und hip wahrgenommen wird. Boomer kennen und schätzen das Reparieren und viele junge Menschen begeistern sich inzwischen auch dafür. Ziel ist es, die Kultur der Reparatur aufzuwerten und das Konsumbewusstsein und die Sensibilität für Nachhaltigkeit zu stärken. Also kommt vorbei und lasst uns zusammen flicken! Denn Reparieren ist nicht nur kreativ und günstig, es ist gelebte Nachhaltigkeit. Und: Es macht einfach glücklich.
13. bis 31. Oktober Wien, Atelier Augarten
14. Oktober Leser*innenführung durch die Ausstellung »Masterpieces of Repair & Upcycling«; Tickets unter www.thegap.at/gewinnen

Wien hat viele Gesichter, gerade was Musik angeht. Das wohl bekannteste gehört der Wiener Klassik. Haydn, Beethoven, Mozart – man kennt die Namen. Stimmt es allerdings wirklich, dass das goldene Zeitalter dieser Entwicklungslinie im 19. Jahrhundert endete? Mit diesem Klischee bricht Wien Modern. Im Fokus steht die sogenannte Neue Musik der letzten hundert Jahre. Bereits zum 38. Mal zeigen Künstler*innen aus der ganzen Welt nicht nur die bestehende Bandbreite, sondern wagen auch neue, spannende Experimente. Einen ganzen Monat bespielt das Festival mit seinen Konzerten und Performances zahlreiche Ecken der Stadt: vom Großen Saal des Wiener Konzerthauses (etwa beim Eröffnungskonzert dirigiert von Vimbayi Kaziboni; Bild) bis zum Keller des Café Korb. 30. Oktober bis 30. November Wien, diverse Locations

Biennale? Berlinale? Nein, nein, um die Viennale geht es hier! Unter dem Namen mit permanenter Autokorrekturgefahr findet Österreichs größtes internationales Filmevent auch heuer wieder seinen Weg in die Kinos der Wiener Innenstadt. Zahlreiche Besucher*innen aus aller Welt können hier vorab sehen, was die Kinoleinwände und Preisverleihungen der nächsten Monate dominieren wird. Dabei sind neben diesen umjubelten Arthousestreifen auch wieder mehrere historische Retrospektiven zu sehen. Besonders spannend: die neu restaurierten Werke von Jean Epstein (Bild). 16. bis 28. Oktober Wien, diverse Locations
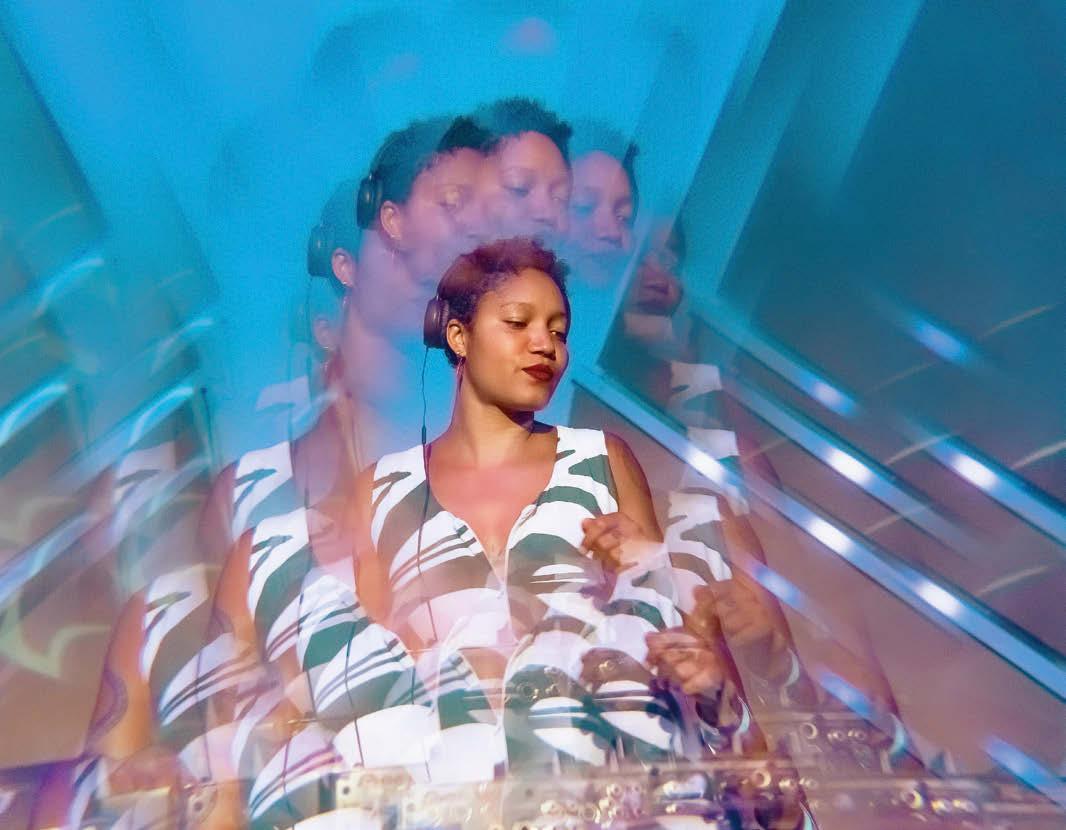
KI, KI, KI – allgegenwärtig und doch bemerkt man sie oft kaum. Nachzuvollziehen, wie dieser neue digitale Raum unseren physischen prägt, ist nicht immer einfach. Unter dem Motto »Life Is Good in the New Real« hinterfragt das heurige Sonic-Territories-Festival mit seinen innovativen Soundperformances unser Leben, die Technologie darin und die Realität, die all das umgibt. Seine Artists (etwa die französisch-ghanaische Künstlerin Pö; Bild) nutzen in ihrer Kunst ihre eigenen Stimmen und Körper, natürliche Materialien sowie handgefertigte Instrumente, um so jenes komplexe Mensch-Natur-TechnikVerhältnis neu zu denken. 17. bis 25. Oktober Wien, diverse Locations
»Age is just a number«, das zeigt das Youki jedes Jahr aufs Neue. Während das Festival dieses Jahr selbst 27 Jahre alt wird, widmet es sich weiterhin den jüngsten unter den Medienschaffenden. Egal ob erste Versuche oder ausgereifte Projekte, egal ob professionelle Kamera oder Smartphone – bereits ab dreizehn Jahren können sich hier alle Kreativwütigen mit ihren Ideen auf Leinwand oder Bühne verwirklichen. 18. bis 22. November Wels, Alter Schlachthof, Programmkino und Medien Kultur Haus
Der Name ist Programm: »Hunger Macht Profite –Die Filmtage zum Recht auf Nahrung«, das proklamiert das Filmfestival auf seinen Plakaten – gleichermaßen polarisierend wie pointiert. Das sind übrigens zwei Adjektive, die auch die gezeigten kritischen Dokumentarfilme über globale Landwirtschaft, Ernährung, die Ursachen von Hunger und jene Menschen, die für das Recht auf Nahrung einstehen, gut beschreiben. 9. Oktober bis 28. November diverse Kinos
»Die Welt soll queerer und weiblicher werden« –für die einen ein Wunschgedanke, für das Festival Queertactics eine durch die gezeigten Filme zu realisierende Mission. Präsentiert werden dafür aktuelle Produktionen der internationalen queeren Filmszene sowie handverlesene historische Arbeiten. Und all das gut gerahmt: Die Eröffnung findet im neurenovierten Stadtkino statt, zum Abschluss gibt’s eine rauschende Party. 12. bis 16. November Wien, diverse Kinos
Das internationale Filmfestival für Menschenrechte richtet den Blick auf Zustände, bei denen wir sonst oft wegschauen. Mit seinem Programm bietet This Human World dem weltweiten Kampf gegen Ausbeutung und Misshandlung eine Plattform. So begreift es Kino nicht nur als Kunstform, sondern auch als Ort für Dialog. Die Filmschaffenden laden dazu ein, über den Tellerrand unserer Privilegien hinauszublicken. 27. November bis 6. Dezember Wien, diverse Kinos
Nach einer kleinen Locationrochade kommt die Ausstellung über das Werk von Marina Abramović nun im Oktober in die Albertina Modern. Wer glaubt, Kunst sei nur zum Anschauen da, wird hier eines Besseren belehrt. Schmerz, Ausdauer, Stille –Abramović verwandelt ihren Körper in Instrument, Werkzeug und Behältnis ihres Œuvres. Ob sie sich bedingungslos dem Publikum ausliefert oder einfach stundenlang schweigend dasitzt, ihre Performances lassen die Anwesenden mitunter ratlos und stets überrascht zurück. Die Ausstellung zeigt ikonische Arbeiten wie »Rhythm 0« oder »The Artist Is Present« und vermittelt, was Kunst wirklich bedeuten kann.
Abramović ist für ihre Werke Mauern abgeschritten und hat mit ihnen Mauern eingerissen. Sie schafft Erlebnisse, die wehtun. Es lohnt sich, das in Kauf zu nehmen. 10. Oktober bis 1. März Wien, Albertina Modern

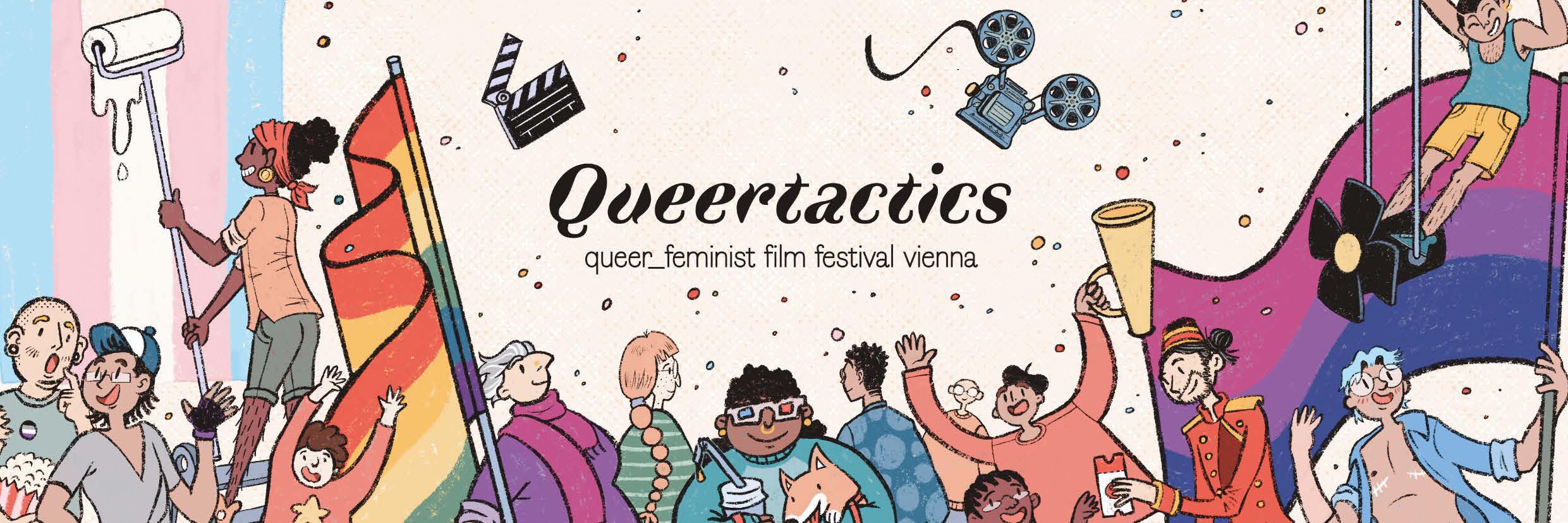




Bei der jährlichen Gruppenschau in der Stadtgalerie Lehen dreht sich dieses Jahr alles um »Zersplitterte Wahrheit«. Inmitten des allgegenwärtigen Diskurses rund um Fake News sowie Polarisierung in den sozialen Medien eine lohnenswerte Auseinandersetzung. »Die Wahrheit ist hässlich, aber wir haben die Kunst, damit wir an ihr nicht zugrunde gehen«, so lautet das programmatische Zitat von Friedrich Nietzsche. Bezugnehmend darauf ebnen die vier Künstler*innen Om Bori, U. S. Buchart, Bernhard Gwiggner sowie Annelies Senfter (Bild) den Weg zum Nach- und Weiterdenken. 9. Oktober bis 13. November Salzburg, Stadtgalerie Lehen
Fleisch ist weit mehr als nur Essen, es ist Identitäts- und Glaubensfrage. Von der Schlachtbank bis zum Supermarkt, vom Sonntagsbraten bis zur Veganismusdebatte zeigt die Sonderausstellung im Wien Museum, wie Fleisch unser Verhältnis zu Tieren, Körpern und Konsum prägt. Mit Objekten, Kunstwerken und Installationen wird Fleisch so als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen inszeniert. Ein Anlass, sich selbst die Frage zu stellen: Wie soll es mit unserem Fleischkonsum zukünftig weitergehen? 2. Oktober bis 22. Februar Wien, Wien Museum
Mit über 120 Werken internationaler Künstlerinnen blickt diese Schau im Linzer Lentos auf das Bild von Mädchen in Kunstgeschichte und Gegenwart. In neun thematischen Abschnitten werden alte Rollen den heutigen Dynamiken gegenübergestellt: »Vom Tafelbild zu Social Media«, wie der Untertitel verkündet. Parallel laden Workshops Mädchengruppen ein, kreativ zu werden, ihre Perspektiven zu Körperoptimierung, Identität, Vielfalt sowie Inklusion einzubringen und über eigene Erfahrungen nachzudenken. 23. Oktober bis 6. April Linz, Lentos
Die Landesgalerie Burgenland wird von Ralo Mayer ab Oktober in eine schräge Spacestation der Kunst verwandelt. Inspiriert von Materialien aus der Raumfahrt, verknüpft er Wissenschaft, Sci-Fi und Alltag auf einer Reise durchs Universum der Stoffe. Mal ernst, mal augenzwinkernd zeigt er, wie alles mit allem verwoben ist –vom Weltraumanzug bis zum Plastikbecher. Die Ausstellung lädt ein, mit Kunst und Wissenschaft aus dem Alltag abzuheben sowie den eigenen Horizont zu erweitern. 25. Oktober bis 25. Jänner Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland
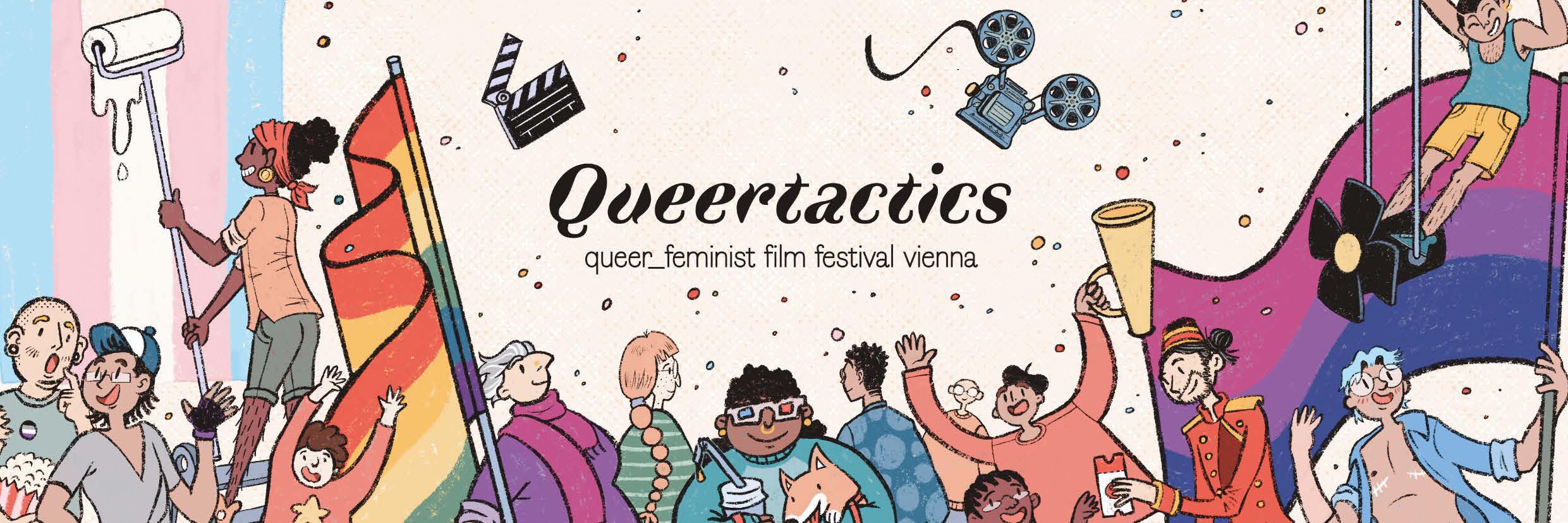



»Girls and Gods«
Euer Film handelt vom Zusammenhang von Feminismus und Religion. Welchen Zugang zu Religion hattet ihr vor der Arbeit an »Girls & Gods«?
Inna Schewtschenko: Ich wuchs in einer russisch-orthodoxen Familie auf. Als ich meine erste Menstruation bekam, meinte eine Frau in der Kirche, ich solle keine Hosen tragen. Meine Mutter antwortete, dass es ohnehin besser sei, wenn ich an diesem Tag nicht die Messe besuche, weil ich ja meine Periode hätte und mein Körper daher schmutzig sei. Das war der Beginn für mich, Religion kritisch zu sehen.
Verena Soltiz: Die Familie meines Vaters war religiös, die meiner Mutter atheistisch. Ich selbst ging an eine katholische Privatschule und habe dort in meinem Umfeld Missbrauch mitbekommen. Diese Erfahrung führte dazu, dass ich begann, institutionelle Religion abzulehnen.
Arash T. Riahi: Mein ganzes Leben ist sehr von Religion beeinflusst. Meine Eltern sind atheistisch, meine Großeltern und andere Familienmitglieder muslimisch. Meine Familie und ich mussten aus dem Iran fliehen, weil islamistische Diktatoren die Herrschaft übernommen hatten. Mir wurde bewusst, dass Religion ein besonders einflussreicher Grund für Kriege ist.
Der Film soll keine Antworten geben, sondern Räume öffnen. Ist uns diese Art der Konversation abhandengekommen?
Schewtschenko: Wir sollten uns mit Meinungsverschiedenheiten wohlfühlen. Wir sind so von unseren Identitäten besessen, dass unsere Meinungen zu unseren Identitäten werden. Und genau darin besteht das Problem: Wenn wir mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit haben, denken wir gleich, dass wir die Person an sich ablehnen müssen.
Hat euch die Arbeit an diesem Film Hoffnung für eine bessere Zukunft gegeben?
Riahi: Dieser Film war daher für uns ein Akt des dialogischen Tuns. Die Leute sollen sich einen Film wie »Girls & Gods« nehmen und ihn nutzen. Einige Protagonist*innen des Films wollen den Film künftig verwenden. Das sind superkatholische Menschen, die in einem Film vorkommen, in dem eine Aktivistin ein Kreuz abhackt und nackte, menstruierende Frauen zu sehen sind. Dass dieses Nebeneinander möglich ist, freut uns.
»Girls & Gods« Start: 10. Oktober

Regie: Ari Aster Ein Mord erschüttert eine Stadt und führt zu weiterer Gewalt. Der Konflikt droht zu eskalieren, also müssen Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) eingreifen. Ari Aster konnte bereits mit »Hereditary« und »Midsommar« große Erfolge verbuchen. Nun setzt er auf das Westerngenre – und einen an Stars reichen Cast. Die Handlung spielt während der Coronapandemie und den Black-Lives-Matter-Protesten, dunkler Humor und ein ambivalentes Ende zeichnen »Eddington« aus. In einem Interview mit dem Time Magazine erklärte Aster: »Der Film handelt von einer Reihe von Menschen, die sich um die Welt sorgen und wissen, dass etwas nicht stimmt. Sie spüren ganz deutlich, dass etwas nicht stimmt, aber sie leben alle in unterschiedlichen Realitäten und sind sich uneinig darüber, was genau das Problem ist.« Start: 20. November

Regie: Nikolaus Geyrhalter Die zermürbende Hitze des Sommers ist überwunden. Folgt nun ein Winter des ewigen Eises und Schnees? Wohl kaum. Ein fröhlicher Ausblick auf ein winter wonderland wird in »Melt« jedenfalls nicht geboten – der Film weist in eindrucksvollen Bildern auf das weltweite Verschwinden des Eises hin. Regisseur Nikolaus Geyrhalter ist für die Produktion von Kontinent zu Kontinent gereist und bildet in weiten, langen Einstellungen Eismassen, Schneewände sowie Gletscher ab. Er begleitet dabei Menschen, die täglich von diesen Naturgewalten umgeben sind, und stellt dar, was die Klimakrise für sie bedeutet. Geyrhalter dokumentiert diese Zustände ohne wertenden Kommentar und liefert so mit »Melt« auch ein Archiv der Drehjahre 2021 bis 2025 – für nachfolgende Generationen, deren Verhältnis zu Schnee wohl ein völlig anderes sein wird. Start: 21. November
Regie: Emanuel Pârvu ———— Adi Dragoi (Ciprian Chiujdea) lebt in einem kleinen rumänischen Dorf. Eines Sommers verliebt er sich in einen anderen Burschen und erfährt schnell die Ablehnung von Familie, Kirche und Staat – bis hin zu körperlicher Gewalt. Der dritte Spielfilm des Regisseurs und Schauspielers Emanuel Pârvu war im Vorjahr für Rumänien im Rennen um den Auslandsoscar mit dabei. Start: 3. Oktober
Regie: Daniel Hoesl ———— Zuletzt mit »Veni Vidi Vici« erfolgreich, hat Daniel Hoesl nun einen neuen Film parat, bei dem abermals Geld und Gier im Fokus stehen: In der italienischen Exklave Campione d’Italia inmitten des Schweizer Tessins befindet sich das größte Casino Europas, das lange Zeit leer stand. Ein auch ästhetisch verstörender Film über Geld und dessen Wert sowie darüber, wer von den etablierten Strukturen profitiert. Start: 3. Oktober
Regie: Kelly Reichhardt ———— Im Jahr 1970 scheint die Zukunft für Blaine Mooney (Josh O’Connor) trist: Er findet keine Arbeit, also bricht er mit zwei Komplizen in ein Museum ein und stiehlt mit ihnen vier Gemälde. Fortan muss er ein Leben auf der Flucht führen. Vor dem Hintergrund vieler gesellschaftlicher Umbrüche – wie dem Vietnamkrieg und dem Kampf um Frauenrechte – erzählt Kelly Reichhardt von einem Mann, der seinen Platz in der Welt sucht. Start: 31. Oktober
Regie: Radu Jude ———— Orsolya (Eszter Tompa) ist Gerichtsvollzieherin. Eines Tages erfährt sie, dass ein Obdachloser, den sie aus seinem Unterschlupf vertrieben hatte, Suizid beging. Die Frau wird mit ihrem schlechten Gewissen konfrontiert und das Publikum mit Themen wie Wohnungsnot, postsozialistischer Wirtschaft sowie Nationalismus. Der viel beschäftigte rumänische Regisseur Radu Jude hat demnächst übrigens auch eine Adaption von »Dracula« in petto. Start: 31. Oktober
Regie: Mascha Schilinski ———— Den Preis der Jury in Cannes gab es heuer für diesen Film, der das Leben von vier Frauen (Hanna Heckt, Lea Drinda, Lena Urzendowsky und Laeni Geiseler) aus unterschiedlichen Epochen über einen Zeitraum von hundert Jahren begleitet. Eine klassische Erzählstruktur bietet uns Regisseurin Mascha Schilinski nicht, dafür ein offenes Spiel mit Bildkomposition, Montage, Rhythmus und Sound. Start: 7. November

Idee: Vince Gillian Fünf Staffeln lang hielt uns Vince Gillian mit »Breaking Bad« in Atem, danach folgte »Better Call Saul« und nun legt der Serienerfinder mit »Pluribus» nach. Er setzt dabei auf eine Mischung aus ScienceFiction und Drama. Wie in »Breaking Bad« spielt die Serie in Albuquerque, außerdem ist Rhea Seehorn, die Fans aus »Better Call Saul« kennen, mit von der Partie. Der Plot: Der unglücklichste Mensch auf Erden muss die Welt vor dem Glück retten. ab 7. November Apple TV+

Idee: Matt Duffer und Ross Duffer »Stranger Things« ist einer der größten Erfolge der Streamingära. Die Show brachte 1980erNostalgie zurück in die Popkultur, bescherte Kate Bushs Hit »Running up That Hill« ein Comeback und machte seine Darsteller*innen zu Stars. Den Hype möchte Netflix wohl möglichst lange mitnehmen: Die vierte Staffel lief bereits 2022, die fünfte und letzte wird ab Herbst 2025 zu sehen sein – mit einem großen Finale zu Silvester. ab 26. November Netflix
20.10.: Salzburg - DAS KINO
Um 18:00 Uhr & 20:30 Uhr
23. 10.: Graz - Schubertkino
Um 18:30 Uhr & 20:30 Uhr
3. 11.: Linz - Moviemento
Um 18:30 & 20:30 Uhr
5. 11.: Wien - Stadtkino
Um 19:00 Uhr & 21:00 Uhr
6. 11.: St. Pölten - Cinema Paradiso
Um 18:30 Uhr & 20:30 Uhr
12. 11.: Innsbruck - Cinematograph
Um 18:30 Uhr & 20:30 Uhr
Cinema Next TOUR & BRAVÖ Hits – ein Abend als Happening! Im Oktober und November 2025 ist es wieder so weit: das größte
Format der Initiative Cinema Next geht in eine neue Runde – die Cinema Next TOUR kehrt zurück!

Christoph Prenner
bewegen bewegte Bilder – in diesem Kompendium zum gleichnamigen Podcast schreibt er drüber
»Don’t Look Back in Wehmut«, murmelt man leise vor sich hin, während man in den Socials durch die tägliche Springflut negativer Feels surft. Und man sich kurz dunkel daran erinnert, dass all das einst eine Bereicherung war statt einer toxischen Abhängigkeit. Bewundernswert, wer unter diesen sekundenlangen Spektakeln aus galoppierendem Wahnwitz und moralischer Verrohung heute noch einen klaren Verstand oder gar eine hoffnungsfreudige Wahrnehmung der Welt bewahren kann. Aber wenn eben nicht gerade mal die Zankbrüder von Oasis mit ein paar Arenashows zumindest eine Ahnung von kollektiven Freudenerlebnissen evozieren, wie sie längst nicht nur im Netz verschwunden zu sein scheinen, dann sind sie leider recht rar gesät: die echten Oasen im Alltag von 2025. Wo man diese Momente der Leichtigkeit leider ebenfalls nicht mehr suchen sollte, das sind all die zahlreichen Portale, die sich eigentlich all things pop verschrieben haben. Denn auch dort springt einem nicht nur der ohnehin überall sonst schon vorherrschende Ragebait mit Aufschaukelungsabsicht entgegen, sondern mitunter gleich noch ein trauriger Rest dessen, was einmal kritische Auseinandersetzung mit Popkultur sein wollte. Statt dieser erwarten einen nun mit erheblicher Penetranz Teasertexte der Sorte: »Hundert Prozent auf Rotten Tomatoes: Das Thriller-Meisterwerk, das niemand kennt!« Oder: »Diese vergessene Serienperle hat den perfekten Score auf Rotten Tomatoes!«
Hundert Prozent
Während man noch überlegt, was da geheimniskrämerisch gemeint sein könnte – Spoiler: meistens etwas zurecht Übersehenes oder Untergegangenes –, ist man dem zynischen Spiel der Klickökonomie allerdings schon auf den Leim gegangen. Wobei zuvorderst ja ohnehin einmal die Frage erlaubt sein sollte, warum ausgerechnet der Review-Aggregator Rotten Tomatoes überhaupt noch als irgendeine Instanz für die Einordnung von Bewegtbildproduktionen gelten darf. Schließlich sind die Zweifel an der

»Die, My Love«: Jennifer Lawrence als frischgebackene Mutter, deren Welt zunehmend aus den Fugen gerät
Seriosität dort hinterlegter Wertungen Legion – und die Zahlen ohnehin in etwa so belastbar wie Horoskope in zerknüllten U-Bahn-Blattln von vorgestern. Doch was, wenn dieser rezente Rettungsanker aus Algorithmusfetischisierung, übersichtlichen Daumen-rauf/runter-Einschätzungen und dem stillschweigenden Abkommen, so zu tun, als bedeute das alles noch irgendetwas, mittelbar eine ganze Sparte mit nach unten zieht? Es lässt sich zumindest nicht mit einem Wert von hundert Prozent ausschließen.
Im Gegensatz zum dysfunktionalen großen Ganzen ist das freilich ein Verdruss, dem sich hier ganz konkret entgegenwirken lässt: mit einem genaueren Blick auf ein Werk, das so aufregend anders ist, dass es vollkommen egal sein kann, ob es später mit Konsens gefeiert oder zu Content verarbeitet werden wird. Die Rede ist von »Die, My Love« von Lynne Ramsay, einem weiteren unverwechselbar kraftvollen Eintrag in das Œuvre der schottischen Regisseurin, das besonders eindringliche Studien von Frauen am Rande des Zusammenbruchs (beängstigend ungut: »We Need to Talk About Kevin«) umfasst.
Ab aufs Land!
Auffällig idyllisch präsentiert sich dahingehend erst einmal das Setting dieses Films, der im Rahmen der Viennale seine Österreichpremiere feiern und ab dem 13. November regulär im Kino laufen wird. Nachdem Grace (Jennifer Lawrence) und ihr Partner Jackson (Robert Pattinson) aus New York in ein heruntergekommenes Landhaus übersiedelt sind, das er von seinem Onkel geerbt hat, steht noch alles im Zeichen aufgeregter Ausgelassenheit. Noch während der euphorisierten Einstiegsmontage wird Grace schwanger und bringt ein Kind zur Welt, um kurz darauf allerdings plötzlich wie ein Raubtier durchs hohe Gras zu kriechen, ein Messer in der Hand, wobei das Schreien des Neugeborenen aus dem Off zu hören ist. Was zur Hölle?
Dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dämmert einem früh. Bei aller Liebe zu ihrem Sohn lassen Graces Verhaltensweisen auf
eine akute postpartale Depression schließen: Ihre Blicke schweifen zwanghaft ins Leere, wie in Trance stillt sie ihr Kind oder schiebt den Kinderwagen durch die Landschaft. Auch die Beziehung zum überforderten oder schlicht abwesenden Jackson kühlt kontinuierlich ab. Mithilfe ihres kongenialen Kameramanns Seamus McGarvey führt Ramsay dieses Zerbrechen in Zeitlupe in einen beharrlich beunruhigenden Fiebertraum über. Grace reißt sich die Kleider vom Leib oder die Tapete von den Wänden, wandert nachts in den Wald hinaus und begegnet dort einem Pferd sowie einem mysteriösen Motorradfahrer. Geschieht all dies wirklich oder spielt es sich rein in ihrer Vorstellung ab? So oder so wird ihre Unruhe bald auch zu unserer.
Dabei weigert sich Ramsay beharrlich, Grace und ihr Verhalten zu erklären. Vielmehr errichtet sie ein Kino des reinen Fühlens: roh, widersprüchlich, fiebrig. Zeit und Realität zerfallen zusehends, Erinnerung, Fantasie und Gegenwart vermischen sich ununterscheidbar. Wie Grace selbst haben auch wir keine Idee, wohin diese Reise führt – ahnen aber zusehends, dass sie uns an Orte bringen könnte, an die wir ihr möglicherweise nicht mehr zu folgen imstande sind. Dass wir es dennoch so lange versuchen, liegt an Jennifer Lawrences wahrlich furchtloser Performance – so feinfühlig wie wild, von furioser Wut, aber auch von trockenem Witz getragen. Ein echtes Empfehlungsschreiben für ihren zweiten Oscar im kommenden März. Bis dahin wird man Lynne Ramsays »Die, My Love« vermutlich auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Klickoptimiert hieße das: »Wenn du die meisten Filme mit einem Rotten-Tomatoes-Score von hundert Prozent schon längst wieder vergessen hast, wird dich dieses radikal empathische Psychodrama immer noch beschäftigen.«
prenner@thegap.at • www.screenlights.at
Christoph Prenner plaudert mit Lillian Moschen im Podcast »Screen Lights« zweimal monatlich über das aktuelle Film- und Seriengeschehen.




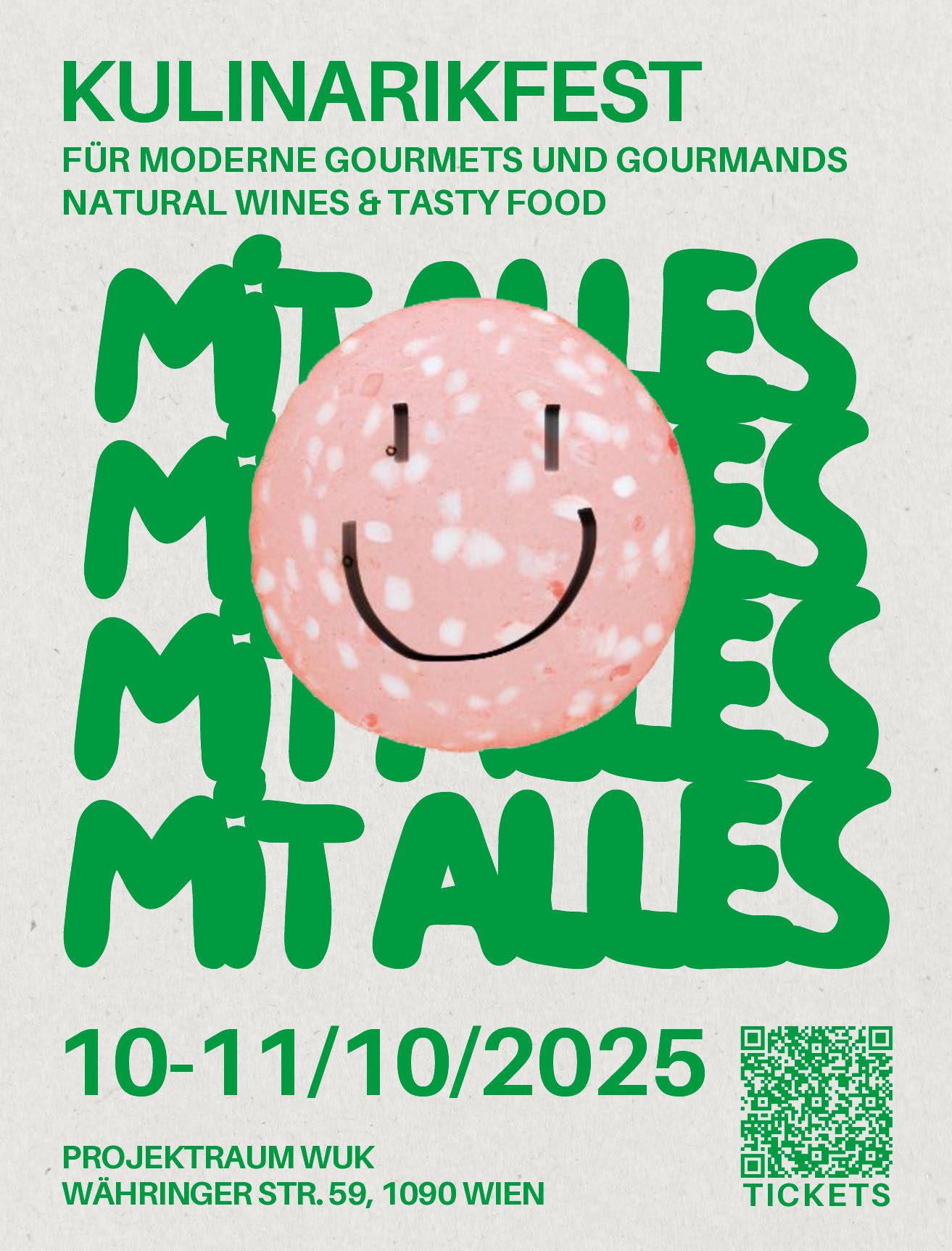


Wer »Fräulein Else« bislang verpasst hat, aber gerne noch sehen möchte, hat nun die Gelegenheit dazu. Frei nach Arthur Schnitzler bringen Schauspielerin Julia Riedler und Regisseurin Leonie Böhm die Novelle mit feinem Gespür für Humor und Abgrund auf die Bühne – weitergedacht für die Gegenwart. Denn auch 101 Jahre nach deren Veröffentlichung sind die Themen Machtmissbrauch, Doppelmoral und Kommodifizierung weiblicher Körper noch immer genauso aktuell. Else spricht, denkt, stolpert und strahlt, und das Publikum ist ihr dabei so nah, dass es schwerfällt, Abstand zu halten. Riedler trägt den Abend allein und wechselt dabei mühelos zwischen Leichtigkeit und Schwere. Ein Solo, das lange nachhallt. 18. und 29. Oktober Wien, Volkstheater

Was erst noch skeptisch gesehen wird, wird bald normalisiert und gar gutgeheißen: Peu à peu erobern die Nashörner die gesamte Stadt. Während sie für den Protagonisten Bérenger schnauben, ist es für seine Frau Daisy eher ein Singen. Eugène Ionescos Drama aus dem Jahr 1958 ist eine Warnung vor Autoritarismus sowie faschistoiden Entwicklungen und stellt dabei Fragen, die aktueller kaum sein könnten: Wie schnell wird das Unfassbare zur Gewohnheit? Wie verlockend ist es, mitzulaufen, wenn alle rennen? Im Kern steckt Ionescos Erklärung für den totalitären Mechanismus: Menschen haben selten die Kraft, dauerhaft allein dazustehen. Darum verlässt man das Theater (hoffentlich) mit dem Mut, den Nashörnern von heute kollektiv entgegenzutreten. bis 30. Oktober Linz, Phönix Theater
Zwischen Ohn- und Übermacht: »Das Ende ist nah« wirft einen mitten hinein in die Geschichte rund um das Leben des Künstlers A. Eine Geschichte von Flucht, Liebe, Überleben und der Zumutung, helfen zu wollen – oder zu müssen. Inszeniert von Sara Ostertag mit Livemusik des Klangpoeten Paul Plut entstand das Stück als Koproduktion während der Renovierung des Teata in der Gumpendorfer Straße (ehemals Tag), das Ostertag ab 2025/26 leitet – für weitere Details siehe Artikel auf Seite 28. 13. November bis 6. Dezember Wien, Schauspielhaus
Lorraine Hansberrys letztes Drama »Les Blancs« situiert eine Familiengeschichte sowie Verhandlungen von kolonialer Gewalt und persönlicher Verantwortung in einem fiktiven afrikanischen Land und lässt dabei die Grenzen zwischen Hautfarbe, Gesinnung und Moral verschwimmen. Im Rahmen der Kanonerweiterung widmet sich das Schauspielhaus Graz der weitgehend vergessenen Autorin und zeigt ein Stück voller kluger Dialoge, komplexer Figuren und pointierter Analysen von kolonialen Machtverhältnissen. bis 29. November Graz, Schauspielhaus
Ein Raum, der vibriert. Körper, die sich falten, stoßen, fließen. »Thrusting« als geologische und emotionale Bewegung. In »Trace My Layers, Thrust Your Guts« verdichten sich Klang, Tanz und Material zu einem intensiven Beben. Zwischen Hackbrett und Soundskulpturen verschwimmen Grenzen: von Haut und Stein, Ton und Berührung, Erdschicht und Gefühl. Das Publikum bewegt sich frei durch den Raum. Wer hier dabei ist, spürt nicht nur die Performance, sondern auch, wie sich Schichten neu ordnen. 15. bis 18. Oktober Wien, Studio Brut
Die »Revue der Entpörung«, veranstaltet von der Alten Schmiede, ist zu Gast im Schauspielhaus. Zwischen kultureller Aneignung, Gender, Sprachverboten und »woker Cancel Culture« wird es immer schwieriger durch den von Rechtskonservativen instigierten »Kulturkampf« zu navigieren. Darum nehmen sich vierzehn Autor*innen der Frage an, wie man bei all der Empörung überhaupt noch schreiben kann. Die Lesungen finden von 15 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt statt. Um Anmeldung unter karten@schauspielhaus.at wird gebeten. 25. Oktober Wien, Schauspielhaus










































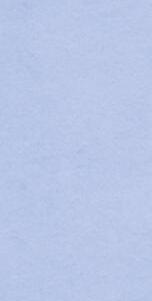






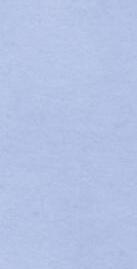




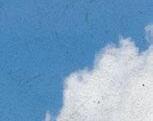










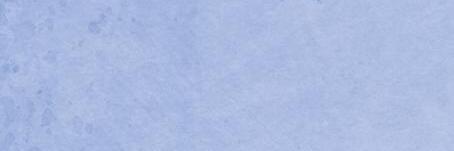












Der Haltung gewidmet.













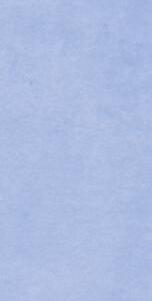











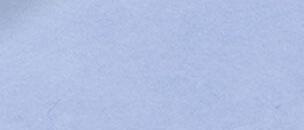










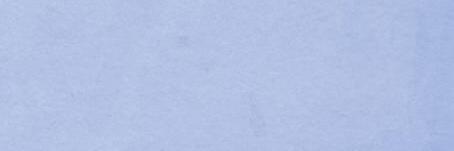
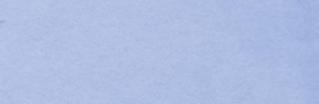














Eine Haltungsübung für stürmische Zeiten: Nach vorne schauen. Und zwar so oft es geht. Dann spüren Sie nämlich nicht nur den Gegenwind, sondern sehen vielleicht auch die Chancen und Möglichkeiten, die auf Sie zukommen. derStandard.at
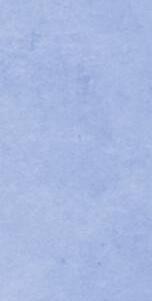

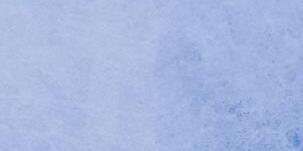

Gewidmet all denjenigen, die beim Lesen auf die eine oder andere Wissenslücke gestoßen sind.
»Apathy’s a tragedy, and boredom is a crime« ist eine Zeile aus »Welcome to the Internet« von Bo Burnham. Der Song ist Teil seines musikalischen Comedyspecials »Inside«, das Burnham während der Covid-19-Pandemie im Alleingang aufnahm. Es behandelt unter anderem die Themen Mental Health, soziale Medien und Isolation. »Delulu is the solulu« ist ein Slogan der vor allem in sozialen Netzwerken wie Tiktok Verbreitung fand und ausdrückt, dass delusion, also das (un)bewusste Ignorieren negativer Zustände, die solution, also die Lösung für den Umgang damit, sei. Zwischen Drake und Kendrick Lamar herrscht schon seit einigen Jahren eine eisige Stimmung, die letztes Jahr in zahlreichen Diss-Tracks, in denen sie sich gegenseitig eine Reihe von Anschuldigungen an den Kopf warfen, eskalierte. Höhepunkt war der Release von Lamars »Not Like Us«, in dem er Drake unter anderem der Pädophilie bezichtigte (»Tryna strike a chord, and it‘s probably A-minor«) und das zu einem weltweiten Hit wurde. Das Konzept der Filterbubbles wurde um 2010 herum vom Internetaktivisten Eli Pariser eingeführt. Es beschreibt, dass Menschen aufgrund von Mechanismen wie personalisierten Suchanfragen oder Empfehlungsalgorithmen zunehmend nur noch ein limitiertes und einseitiges Bild von Welt, Nachrichten und Informationen vermittelt bekämen. Der Begriff Male Gaze geht auf das Essay »Visuelle Lust und narratives Kino« der Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey aus dem Jahr 1975 zurück. Darin beschreibt sie, wie Frauen beginnend mit dem klassischen Hollywoodkino dargestellt wurden, um möglichst große Lust beim männlichen Publikum auszulösen. Reparieren ist eines der fünf Rs, die – mit absteigender Priorität – Strategien im Kampf gegen wachsende Müllberge beschreiben: Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Recycle. Rokoko ist eine künstlerische Stilrichtung aus dem 18. Jahrhundert, die sich durch verspielte, liebliche und überschwängliche Elemente auszeichnet. »Sabotage« ist ein Song von den Beastie Boys. Es ist der erste Song, der 1995 auf FM4 gespielt wurde, und gibt deshalb nun auch der Modekollektion zur Feier des Senderjubiläums ihren Namen.

Coverstory mit Fortsetzung, Personalie mit Nachwirkung. ———— Kennt ihr einen österreichischen Horrorfilm, der so erfolgreich war, dass dazu sogar ein Sequel gedreht wurde? Mit »In 3 Tagen bist du tot« ist Andreas Prochaska dieses Kunststück geglückt. Teil zwei des »Blut-und-BeuschelThrillers« war uns Ende 2008 eine Coverstory wert, in der Markus Keuschnigg (der spätere Gründer des Slash Filmfestivals) den Bogen hin zum europäischen Gruselkinowunder spannte. Demnächst startet Prochaskas »Welcome Home Baby« in den Kinos. Und dessen Hauptdarstellerin Julia Franz Richter findet ihr wiederum am Cover der vorliegenden Ausgabe. Also auch in Sachen The-Gap-Coverstorys ein Doppelschlag des Regisseurs. In Person von Arash T. Riahi gibt es noch eine weitere Überschneidung: Damals war er mit »Ein Augenblick Freiheit« im Heft, dieses Mal ist er es mit »Girls & Gods« (Seite 58). Außerdem wurde im Editorial Stefan Niederwieser als Leiter der Musikredaktion präsentiert – eine Personalie mit langfristigen Auswirkungen: 2011 sollte Stefan die Chefredaktion übernehmen (bis 2016). Aktuell stellt er seine Musikexpertise übrigens in Form des Ö1-Podcasts »100 Songs« (im Dialog mit Robert Stadlober) unter Beweis. Hörenswert!
The Gap?
gibt’s
Wo

OKH Vöcklabruck
Das offene Kunst- und Kulturhaus Vöcklabruck macht keine halben Sachen in puncto Kultur. Das Areal des alten Stadtkrankenhauses wurde 2012 umfunktioniert und ist nun kultureller Hotspot für die Vöcklabrucker*innen. Im Haus findet regelmäßig ein buntes Programm statt: von Vorträgen über Tanzkurse bis hin zu Brettspieltreffen – auch regionale Projekte wie die Foodcoop Vöcklabruck wirken im OKH mit. Und dann ist da natürlich die OKHKonzertgruppe, die regelmäßig urbane alternative Musik in die Stadt bringt. Hans-Hatschek-Straße 24, 4840 Vöcklabruck
Morawa Moser Graz
Die Traditionsbuchhandlung Moser ist längst fixer Treffpunkt für Grazer Literaturinteressierte. Das Café im zweiten Stock lädt zum Schmökern und Entspannen ein. Am Eisernen Tor 1, 8010 Graz
Das Café Liebling vereint relaxte Atmosphäre und gutes Essen –und hält auch für Veganer*innen zahlreiche Optionen bereit. Empfehlenswert: The Gap lesen im Schanigarten. Zollergasse 6, 1070 Wien

Digital durch die Woche. Gedruckt ins Wochenende.

KOMBI-ABO
Nachrichten für jeden Moment
Freitag bis Sonntag die gedruckte Zeitung
Jederzeit digital alle premium-Artikel 12 Monate besonders günstig
36,99 € STATT 44,99 € für 12 Monate

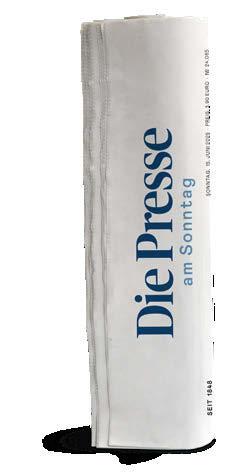

Jetzt abonnieren: diepresse.com/kombiabo

Josef Jöchl
artikuliert hier ziemlich viele Feels
Seit einiger Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ein Freund fragte neulich nach dem Grund. Ich antwortete: »Weißt du, die größten Comedians der Welt sind depressiv.« Doch er zuckte nur mit den Schultern und sagte: »Ja, ich weiß, aber warum bist du depressiv?« Dann mussten wir beide lachen.
Wir wussten natürlich, dass eine einfache Traurigkeit nichts mit einer Depression zu tun hat. Für Letztere muss laut ICD-10 mindestens ein Hauptsymptom über zwei Wochen praktisch durchgehend vorhanden sein: anhaltende gedrückte Stimmung, Verlust von Interessen und Freude oder geringe Energie. »Halblustige Witze vor spärlichem Publikum erzählen gehört noch nicht dazu«, setzte er nach, »da ist sich die WHO noch nicht ganz einig.« Dann signalisierte ich ihm, dass es nun aber gut sei.
Mit meiner Niedergeschlagenheit bin ich nicht alleine. Gefühlt jede zweite Person berichtet von Schwermut, als gehe sie gerade um wie eine Grippe. Ein Zeichen der Zeit im Jahr 2025. Manchmal frage ich mich deshalb: Ist das noch ein normaler Weltschmerzvibe im Co-Working-Space oder sollte man beginnen, den Trinkwasservorkommen flächendeckend kleine Mengen Ketamin beizugeben?
Eat, Sleep, Cardio, Repeat
Hier spitze ich natürlich ein bisschen zu – was allerdings nicht unüblich ist für Personen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Drogen im Trinkwasser sind selbstverständlich auch keine Lösung. In manchen Fällen ist Microdosing von Ketamin oder Psilocybin aber das Einzige, das hilft.
Zumindest wird mir das von Menschen erzählt, die sich damit auskennen. Die Wirkung von Antidepressiva ist hingegen umstritten. Niemand wisse wirklich, ob an der Serotoninhypothese etwas dran sei, erklärte mir vor
Kurzem sogar eine Pharmazeutin. Auch sie hatte einen harten Tag hinter sich und tröstete sich mit etwas Spritzwein. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wären nichts anderes als Placebos. Dann schon lieber Alkohol, auch wenn der Spritzer mittlerweile bald fünf Euro kostet, seufzte sie resignierend.
Fragt man hingegen klinisch Depressive, was ihnen guttut, lautet die Antwort eher selten Ketamin. Die meisten schwören – neben fachärztlich begleiteter, medikamentöser Behandlung – auf gesundes Essen, frühes Schlafengehen und regelmäßiges Cardio-Workout. Struktur! Auch ich habe begonnen, mir auf einer Joggingrunde regelmäßig ein paar Endorphine abzuholen. Immer öfter stellt sich mir aber die Frage, ob ich den Lauf der Welt noch wegjoggen kann.
Denn an äußeren Anlässen für Gefühle von Schwere mangelt es nicht. Manchmal zieht mich schon das Morgenjournal runter, obwohl Ö1-Redakteur*innen die Realität immer ein bisschen sugarcoaten, indem es jeden zweiten Tag eine halbe Stunde um einen Streit in der Ärztekammer geht. Die verbleibende Sendezeit reicht jedoch völlig aus, um mir meine mangelnde Wirksamkeit in der Welt vor Augen zu führen. Eine Runde auf Instagram tut dann das Übrige.
»Vielleicht wärst du glücklicher, wenn du weniger Zeit auf Insta verbringst«, riet mir unlängst ein Freund. Er habe in einer Arte-Doku gesehen, dass die starke Nutzung von sozialen Medien nur unglücklich macht. »Vielleicht wärst du glücklicher, wenn du weniger Arte-Dokus anschauen würdest«, gab ich ihm etwas trotzig zurück. Wer mit Personen spricht, die gerade Krise haben, muss auf etwas Gegenwind gefasst sein. Denn nichts verteidigen Traurige so
vehement wie ihre eigene Misere. Hausbackene Vorschläge nerven, egal wie vernünftig sie sind, wenn man eigentlich nur sudern will.
Vor ein paar Jahren war alles noch einfacher. Steckte jemand in der Krise, konnte man mit zwei Wörtern einen Plottwist herbeiführen. Man sagte, »Mach’ Bildungskarenz!« –und das Gegenüber sah ein neues Leben am Ende eines Regenbogens. Wie wir alle wissen, ist diese Maßnahme mittlerweile dem Rotstift zum Opfer gefallen. Meine Meinung: Der Mangel an Spanisch sprechenden Yogalehrer*innen wird sich in naher Zukunft rächen.
Zurück auf Werkseinstellung
Noch ein paar Jahre früher, in den Nullerjahren, redete kein einziger Comedian von Traurigkeit. Damals redeten überhaupt nur Emos davon. Die dafür aber ziemlich oft. Viele Depressive übten sich in Tapferkeit, weil der Ausdruck von Niedergeschlagenheit, Ängsten oder der schlichten Unzufriedenheit mit den Verhältnissen verpönt war. Noch heute werden wir dazu gedrängt, Traurigkeit schnell zu überwinden, uns rasch zu erholen und auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Das ist aber nicht, was ich in so einer Situation brauche. Viel lieber wäre mir, wenn ein Freund einfach nur da ist und auf Empfehlungen zum Lebensstil verzichtet. So hilft er, die traurige Energie zu absorbieren, bis sie für einen Moment verschwindet und ich ein bisschen fröhlich bin. Um dann vielleicht zu sagen: »Dein Leben ist doch gar nicht so schön, Josef. Solltest du nicht eigentlich Depressionen haben?« joechl@thegap.at • @knosef4lyfe
Josef Jöchl ist Comedian. Sein aktuelles Programm heißt »Erinnerungen haben keine Häuser«. Termine und weitere Details unter www.knosef.at.


Aufwachsen zwischen 1938 und 1955

