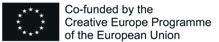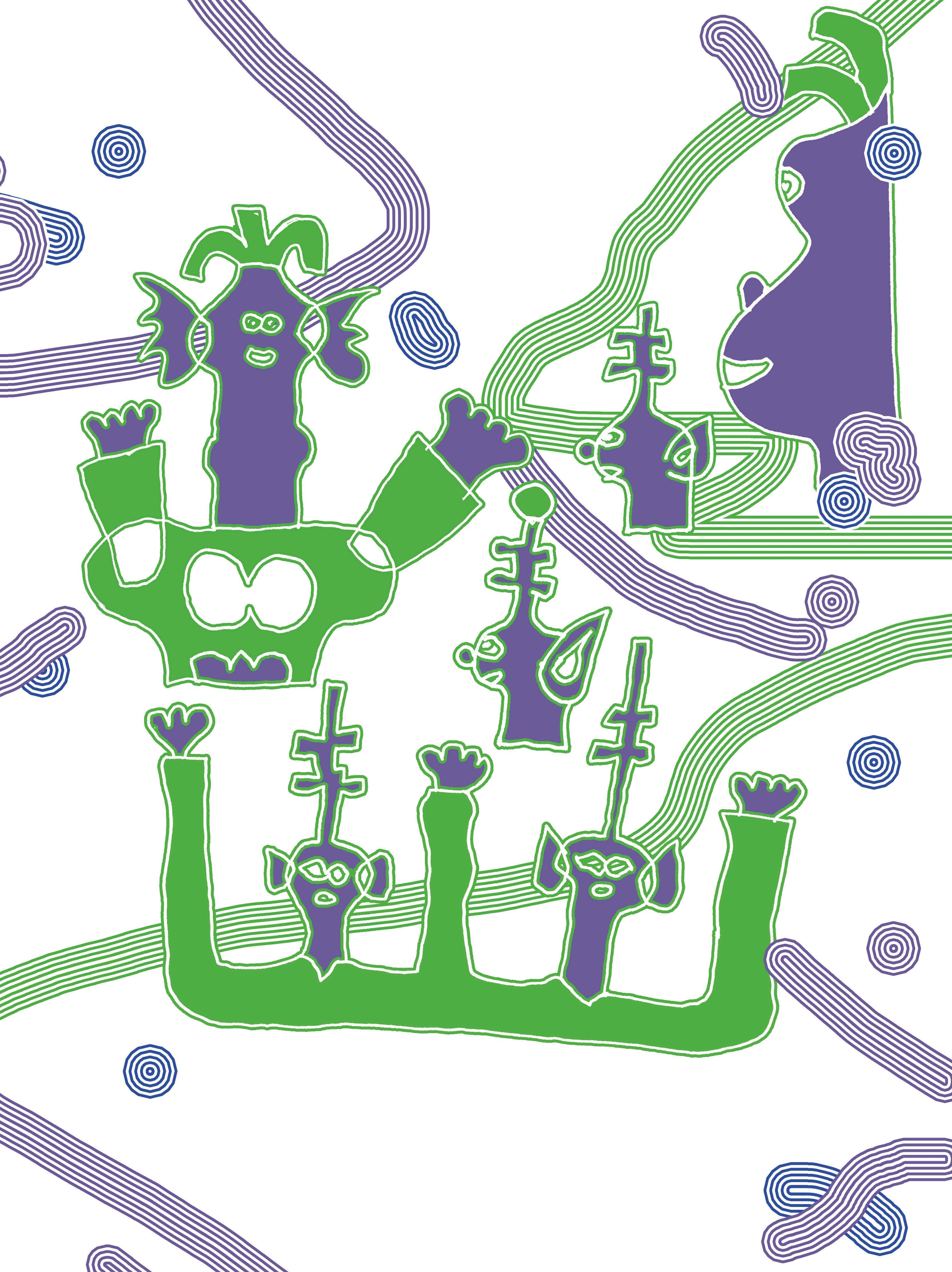









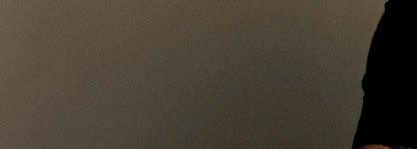






























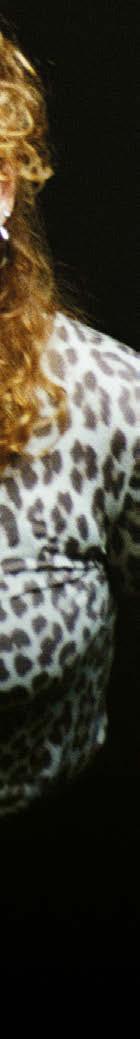

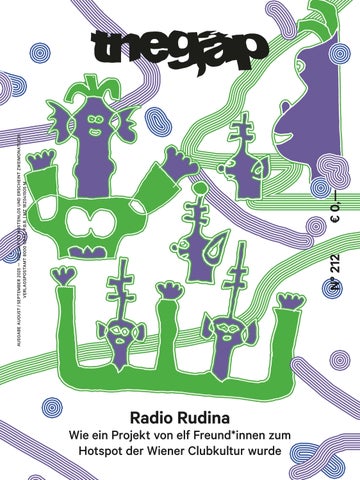
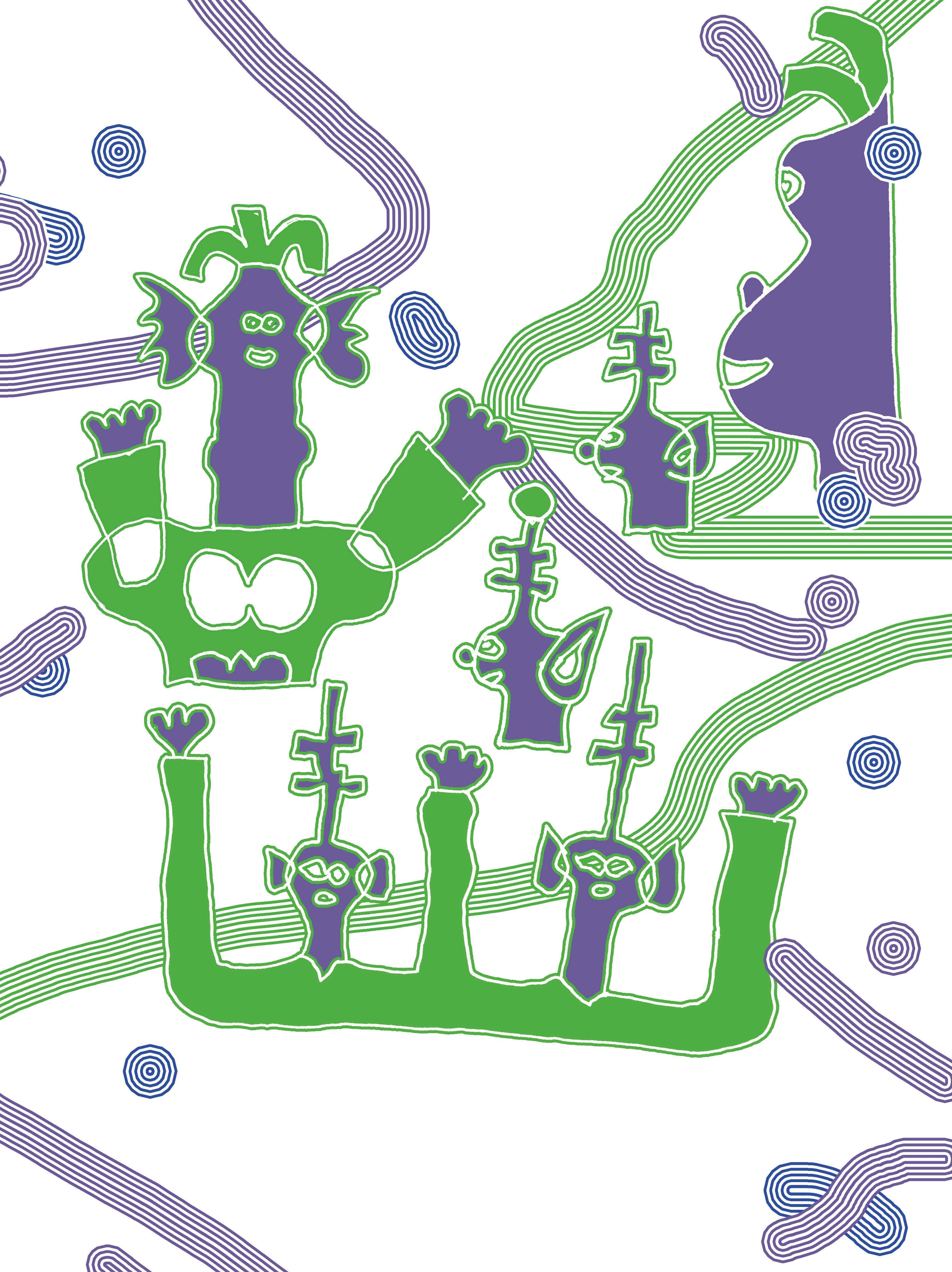









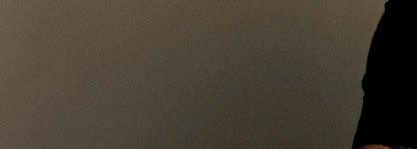






























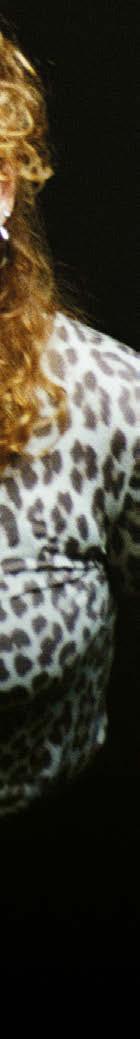

»Das Leben im Jahr 2025 ist eines der erschöpfendsten«, schreibt Dominik Oswald in seiner Rezension des Debütalbums von Alles Exhausted. Die Antwort dieser Band: Shoegaze. Immersive Soundwände und Blick nach unten auf die Schuhspitzen. Ania Gleich wiederum befindet in ihrer Kritik zu Lizki, dass deren Hyperpop – musikalisch gesehen – der »zeitgemäßeste Ausdruck für Überforderung« sei. Wer hat recht? Augen runter und durch oder doch lieber Flucht nach vorne?
Das eigentliche Problem ist allerdings, dass allzu oft eine dritte Option gewählt wird. Statt ausgelaugter Resignation oder manischem Optimismus wird eine imaginierte Vergangenheit zurückersehnt , in der alles besser, einfacher und idyllischer gewesen sein soll. Das ist natürlich pure Realitätsverweigerung. Zieht aber. Musikalisch wäre das wohl irgendwo zwischen Best ofthe EightiesSamplern, volkstümlichen Schlageralben und konzertanten Klassikaufnahmen einzuordnen.
Die österreichische Kulturbranche scheint – so im Großen und Ganzen – seit jeher darum bemüht, den Blick nur ja nicht zu weit nach vorne zu richten. Sicher, die Nischen, in denen wir uns als Magazin bewegen, bilden da häufig Ausnahmen, aber auch hier wird nur allzu oft mit traurigem Hundeblick in Richtung verflossener Jugend geschielt. Deswegen ist es wichtig, neben all den Jubiläen von etablierten Größen, altehrwürdigen Venues und unantastbaren Institutionen nicht zu übersehen, wenn Menschen versuchen, neue Wege zu gehen.
Auch aus diesem Grund haben wir in dieser Ausgabe das noch recht junge Projekt Radio Rudina aufs Cover genommen. Dessen Mitglieder sind einerseits weit entfernt von altehrwürdig, andererseits aber quasi gerade auf dem Sprung, so etwas wie eine Institution der Wiener Clubszene zu etablieren. Unser Redakteur Jannik Hiddeßen hat ihnen auf den Zahn gefühlt.
Weiters interessiert Johanna T. Hellmich, wie Menschen mit ContentCreation ihr Geld verdienen, und Helena Peter hat unter die Haube verschiedener Kulturnetzwerke geblickt. Aber auch die Tradition bleibt nicht völlig außen vor: Catherine Hazotte hat sich anhand der Emaillemanufaktur Riess angesehen, wie man es schaffen kann, trotz aller Geschichtsträchtigkeit nicht auf die Gegenwart zu vergessen.

Bernhard Frena Chefredakteur
Web www.thegap.at
Facebook www.facebook.com / thegapmagazin
Twitter @the_gap
Instagram thegapmag
Issuu the_gap
Herausgeber
Manuel Fronhofer, Thomas Heher
Chefredaktion
Bernhard Frena
Leitender Redakteur
Manfred Gram
Gestaltung
Markus Raffetseder
Praktikum
Marlene Mierl
Autor*innen dieser Ausgabe
Luise Aymar, Victor Cos Ortega, Barbara Fohringer, Ania Gleich, Susanne Gottlieb, Catherine Hazotte, Johanna T. Hellmich, Jannik Hiddeßen, Kamia Liu, Martin Mühl, Dominik Oswald, Helena Peter, Simon Pfeifer, Mira Schneidereit, Jana Wachtmann
Kolumnist*innen
Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner
Fotograf*innen dieser Ausgabe
Patrick Münnich
Coverillustration
Burnbjoern
Lektorat
Jana Wachtmann
Anzeigenverkauf
Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl
Distribution
Wolfgang Grob
Druck
Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.
Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien
Geschäftsführung
Thomas Heher
Produktion & Medieninhaberin
Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien
Kontakt
The Gap c/o Comrades GmbH
Hermanngasse 18/3, 1070 Wien office@thegap.at — www.thegap.at
Bankverbindung
Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX
Abonnement
6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at
Heftpreis
€ 0,—
Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.
Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.
Der
018 Eine Frage der Zugehörigkeit
Olga Kosanović und ihr Film
»Noch lange keine Lipizzaner«
024 Die Ellbogen einfahren
Networking abseits von Nepotismus und Freunderlwirtschaft
027 Content-Culture
Social Media als Kunst und Beruf
030 Design aus Ybbsitz
Wie Emaillegeschirr von Riess zum Kultobjekt wurde
034 Zwischen Prompt, Post und Zweifel
Wie kreativ sind die Creative Industries?

030


Creative Industries Von Kreativität und jenen, die sie einsetzen
003 Editorial / Impressum
006 Comics aus Österreich: Maria Litvinkina
007 Charts
016 Golden Frame
040 Prosa: Antonia Löffler
042 Gewinnen
043 Rezensionen
046 Termine
009 Gender Gap: Toni Patzak
054 Screen Lights: Christoph Prenner
058 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl
Unsere Autorin Catherine bereut nichts. Nicht einmal die Phase, in der sie dachte, lila Lidschatten passe zu allem. Diese Zeiten sind vorbei, aber sie ist mittlerweile immerhin auch aus der großen Stadt (Wien) in eine deutlich kleinere (Gmunden) gezogen. Da kann sich der persönliche Stil schon mal ändern. Und von Stil weiß Catherine so einiges zu berichten, beschäftigt sie doch alles, was mit Gestaltung und Design zu tun hat. Nicht nur bei uns, sondern etwa auch in der Arbeit mir ihrer eigenen Agentur (chchch.xyz).
Als »chaotisch narrativ« beschreibt unser Coverillustrator seinen Stil. Das trifft es recht gut, finden wir, und es passt auch zu den Geschichten, die Burnbjoern uns so erzählt hat. Etwa, dass er in seiner Jugend versehentlich den Balkon seines Nachbarn angezündet habe (»Sorry, Mike!«). Oder, dass er tatsächlich ohne Training mit einem alten Rad aufs Stilfser Joch (2.757 Meter Seehöhe!) geradelt sei. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich im Druckstudio Soybot wortwörtlich ein Bild von ihm machen lassen.



Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal illustriert Maria Litvinkina, wie viel Dynamik in Mangas steckt. ———— Sind Mangas Comics? Sicher, beide Formen sind im Kern sequenzielle Geschichten in Wort und Bild. Sie beruhen jedoch auf unterschiedlichen Traditionslinien und ihre Communitys überschneiden sich überraschend wenig. Was schade ist, denn von Mangas könnte die Comicszene viel lernen. Etwa, wie man durch abwechslungsreiche Blickwinkel und Seitenlayouts selbst in statische Szenen Bewegung bringt. Das führt auch Maria Litvinkina aka Necrosishead auf der folgenden Seite gekonnt vor. Der Grazerin ist es bei ihren Geschichten wichtig, Empathie für die Figuren zu vermitteln. Kein Wunder also, dass ihre Mangas auch über Sprachgrenzen hinweg funktionieren und Litvinkina es als erste Mangaka aus Österreich geschafft hat, im renommierten japanischen Magazin Weekly Shōnen Jump (bekannt für »One Piece« und »Dragon Ball«) veröffentlicht zu werden. Mit »Otherside Bell« hat Maria Litvinkina kürzlich auf der Japan Expo 2025 in Paris den Preis für Nachwuchsmangakas gewonnen.
Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

Hilfsmittel, um im Sommer ausreichend zu trinken und gut hydriert zu bleiben
01 Wasserkaraffe am Tisch
02 Minze im Wasser
03 Zitrone im Wasser
04 Basilikum im Wasser
05 Gurke im Wasser
06 Heidelbeeren im Wasser
07 Himbeeren im Wasser
08 Wassermelonen
09 Sprudelwasser
10 Bodenversiegelung stoppen
Dinge, die im Sommer besser sind als im Herbst
01 Outdoorkonzerte
02 Outdoorkonzerte bei freiem Eintritt
03 Die Vorfreude auf den Herbst
Auch nicht schlecht:
Rosmarin und Orangen im Wasser (für Fortgeschrittene)















Stefanie Steinwendtner ist Kulturmanagerin und leitet den Betriebsteil »Kunst und Kultur« des Wuk, wo von 12. bis 29. August in einem der schönsten Innenhöfe Wiens die Platzkonzerte stattfinden – bei freiem Eintritt.
Soundtrack fürs Radln
01 Turnstile »Look Out for Me«
02 Fjørt »Magnifique«
03 K.I.Z. »Ehrenlos«
04 Enter Shikari »The Dreamer’s Hotel«
05 Amyl and the Sniffers »Hertz«
06 Wunderhorse »Midas«
07 Twenty One Pilots »Next Semester«
08 Tycho »Awake«
09 Kendrick Lamar feat. Jay Rock »Money Trees«
10 Refused »New Noise«
Radfahren als Therapieform

01 Trittfrequenz gegen Grübeln – nach zwanzig Minuten übernimmt der Körper, der Kopf hat Pause
02 Einsamkeit, aber freiwillig
03 Struktur durch Strecken – einfach was geschafft haben
Auch nicht schlecht
Philly Cheese Steak Sandwich bei The Hungry Heart in Graz
Joni Zott ist Programmchef des Rockhouse Salzburg und wird im Sommer
2026 die Geschäftsführung vom langjährigen Leiter Wolfgang Descho übernehmen. Am 11. Oktober feiert das Rockhouse seinen 32. Geburtstag, unter anderem mit Steaming Satellites, Ben Clean und Amelie Tobien.














6 Ausgaben um nur € 19,97
Aboprämie: Oska »Refined Believer« (CD)
Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?

Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturschaffen aus und in Österreich begleitet?
Dann haben wir für euch das The-Gap-Jahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.
Du interessierst dich für Kulturjournalismus? Dir brennt ein Thema zur österreichischen Musikszene unter den Nägeln? Du brauchst finanzielle Unterstützung, um das Ganze umzusetzen?
Dann bewirb dich beim The Gap Nachwuchspreis für Musikjournalismus , der im Rahmen des Festivals Waves Vienna vergeben wird. Gewinne 1.000 Euro für die Umsetzung deines journalistischen Projekts!
Wir suchen Nachwuchsjournalist*innen bis inklusive 27 Jahre, die bislang noch nicht hauptberuflich als Journalist*innen tätig sind.
Details zur Bewerbung findest du unter www.thegap.at
Die Deadline für die Einreichung ist der 12. September 2025.

Der*die Gewinner*in wird von einer Fachjury ausgewählt. Die Bekanntgabe erfolgt im Rahmen der Verleihung des diesjährigen XA-Awards. Der*die Gewinner*in erhält 500 Euro unmittelbar nach Gewinn des Preises und 500 Euro nach Veröffentlichung der Arbeit.

Das Kunstprojekt »MA 35 & Friends« übt Kritik an der österreichischen Migrationspolitik – in Form einer Lecture-Performance im Touri- Style. ———— Sechsmal wird der umfunktionierte Tourist*innenhit im September durch Wiens Straßen kurven. Doch anstatt wie üblich im Hop-on-Hop-off-Modus die charmantesten Attraktionen der Bundeshauptstadt abzuklappern, geht es bei dieser Fahrt zu »Sehenswürdigkeiten« der etwas anderen Art. Es werden nämlich Orte wie das Anhaltezentrum Roßauer Lände oder das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl angesteuert und die Schattenseiten der österreichischen Migrationsbürokratie satirisch beleuchtet. Die Texte dafür sind in Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt worden, die in Abhängigkeit von diesen bürokratischen Institutionen leben. »Gemeinsam mit unseren Teilnehmer*innen haben wir amtliche Briefe mithilfe von Ironie umgeschrieben«, berichtet Shahrzad Nazarpour, die künstlerische Leitung der Performance. Da Migrierende oft an bürokratischen Hürden scheitern, soll das Projekt einen Kontrast zur gelebten Diskriminierung darstellen, die in den komplexen, amtlichen Vorgängen unsichtbar bleibt. Zum Abschluss wird ein öffentliches Fest im Kulturverein Planet 10 veranstaltet.
Das Projekt ist dabei für zwei Zielgruppen gleichzeitig gedacht. Während die Busfahrten, als Zentrum der Aktion, frustrierende bürokratische Prozesse für Nichtbetroffene erlebbar machen, gibt das Erarbeiten der Inhalte Menschen mit Migrationshintergrund Raum. Ziel sei es, den Fokus auf solidarischen Widerstand zu lenken, indem diskriminierende Erfahrungen geteilt werden. »Der Prozess war für unser Team sehr bereichernd, weil wir viele persönliche Erlebnisse und auch schmerzhafte Erfahrungen im Umgang mit Bürokratie miteinander teilen konnten. Ein Moment kollektiver Ermächtigung.« Das Konzept hat Nazarpour aufbauend auf ihren bisherigen Performances erarbeitet: »Ironie ist ein zentrales Mittel meiner künstlerischen Praxis – besonders weil ich mich oft mit komplexen politischen Themen auseinandersetze.« Kamia Liu
Die Bustour-Performance »MA 35 & Friends« findet von 4. bis 12. September 2025 insgesamt sechsmal statt. Beginn: 18 Uhr; Treffpunkt: Oskar-Morgenstern-Platz.

Toni Patzak
hakt dort nach, wo es wehtut
Es wäre ja nicht so, als böte meine Kolumne hier immer etwas zum Lachen. Selbst, wenn ich versuche, ernste und düstere Topics mit realitätsbezogenem Humor aufzufrischen, gelingt mir das nicht immer. Diesmal schon gar nicht. An dieser Stelle möchte ich eine fette Triggerwarnung bezüglich sexualisierter Gewalt aussprechen. Falls jemand selbst Erfahrungen mit diesem Topic sammeln musste und heute einmal nicht damit konfrontiert sein will, würde ich vorschlagen, diese Seite lieber zu überblättern.
Thema dieser Kolumne sollen allerdings nicht die konstant unveränderten und konstant deprimierenden Statistiken zu sexualisierter Gewalt an Frauen in Österreich sein – laut Amnesty International betrifft das jede dritte Frau. Stattdessen geht es um eine Problematik, die ich erst seit Kurzem in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis bespreche und bei der ich traurigerweise auf Verständnis sowie ähnlich gelagerte Geschichten treffe. Etwas salopp beschreibe ich diese Situationen als »Selbstvergewaltigungen«. In Studien findet man für eine ähnliche Problematik auch den Begriff »sex as self-injury«.
Für mich geht in dieser Wissenschaftsformulierung allerdings etwas verloren: ein Gefühl zwischen Nähe, Faszination und Ekel. Der Begriff Selbstvergewaltigung fühlt sich hingegen wie ein Schlag in die Magengrube an und sorgt sofort für Ambivalenz: Kann man sich überhaupt selbst vergewaltigen? Braucht es dafür nicht mindestens eine zweite Person, die entweder ein Nein absichtlich ignoriert, auf kein Ja gewartet oder in einer Situation ein Ja herausgelockt hat, in der man nicht Herrin seiner eigenen Sinne war? All dem gebe ich recht und trotzdem sage ich: Es fühlt sich genau so an.
Grenzen von Consent
Doch was meine ich überhaupt mit dem Begriff? Selbstvergewaltigungen sind für mich Situationen, in denen sich Menschen – bewusst und aus freien Stücken – auf Sex einlassen, obwohl sie diesen von Anfang an nicht wollen. Nicht nur nicht wollen, sondern wissen, dass sie ihn aktiv hassen werden. Das mag paradox klingen für Menschen, die diese verzwickte psychische und physische Situation nicht
kennen. In meinem Bekanntenkreis ruft es regelmäßig zumindest drei separate Reaktionen hervor. Die erste und häufigste ist: »Großer Gott, wieso machst du das dann?« Gute Frage. Wieso geht man eine Situation ein, die man nicht haben will, und fügt sich somit körperliche und seelische Schäden zu, die man weit länger aufarbeiten muss, als der Akt an sich dauert? Ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin und kann hier auch keine Wahrheiten aussprechen, sondern nur eine Vermutung: Autoaggression im Erwachsenenalter kann ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn die Themen, mit denen man ringt und die so sehr schmerzen, dass der Körper es seelisch nicht aushält, sexueller Natur sind sowie Gewalt beinhalten, dann ist Selbstvergewaltigung wohl eine Möglichkeit, sich wieder und wieder in ähnliche Situationen zu bringen, wie man sie bereits durchleben musste. Entweder als Versuch, etwas zu begreifen, oder schlicht aus Selbsthass. Klingt furchtbar, oder? Ist es auch.
»It Is What It Is«
Die zweite Reaktion ist: »Ja, das kenne ich auch. Das habe ich besonders in meinen Teenagerjahren oder Anfang zwanzig gemacht.« Immer wieder erwähnen meine Bekannten dann, dass sie sich in einem jüngeren Alter in diese Notlage begeben hätten, während sie ihre Sexualität entweder gerade ausprobierten oder festigten. Das Gespräch geht anschließend meistens so weiter, wie man es sich von der Gen Z erwartet: eine Abfolge von zynischen Witzen gegen sich selbst oder die Situation, gepaart mit dem frequenten Verwenden der Beifügungen »lol«, »naja egal« oder »it is what it is«. Auch wenn das merkwürdig klingen mag: Ich freue mich dann immer, nicht alleine zu sein, zu wissen, dass es anscheinend kein individuelles Problem ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Die Witze helfen, über Erlebtes zu lachen und bieten ein Medium, um Informationen weiterzugeben, die zu schmerzhaft für eine normale Konversation sind. Wir lachen, wir weinen, wir reden – das Wichtigste ist, dass wir es gemeinsam tun. Die letzte Reaktion ist die, über die ich am meisten grüble. Sie kommt von Männern in meinem Bekanntenkreis. Meistens taucht
sie auf, nachdem sie fragen, wieso, weshalb, warum, ob es jetzt besser gehe und wie man helfen könne. Dann kommt lange nichts – und schließlich doch noch die Frage: »Glaubst du, das hat eine bei mir auch schon einmal gemacht?« Gemeint ist, ob eine ehemalige Sexualpartnerin auch einmal mit dieser Intention etwas Sexuelles eingegangen ist. Ich will jetzt nicht zu viel Fokus auf die Männer legen, sie bekommen sonst eh genug Aufmerksamkeit. Aber das ist die Reaktion, die mein Herz am schwersten macht. Sie fragen, ob der Typ das nicht bemerkt habe. Ich antworte: Nein, wie auch – ich wollte ja nicht, dass er es bemerkt. Dann reden sie sich ein, dass sie es bestimmt gemerkt hätten – am Atmen, an den Bewegungen, an der Stimme. Ich versichere ihnen, dass sie es nicht bemerkt hätten. Und dann schaue ich ihnen zu, wie sie ihre Aufrisse, Exfreundinnen und Schmusis durchgehen und sich überlegen, ob da eine darunter war, der es genauso ging wie mir. Ich fühle mich dann meistens etwas schuldig, dass ich die Typen instrumentalisiert habe, um mein komplexes psychisches Gaga zu verarbeiten. Das hatten weder ich noch sie verdient.
Ich frag mich manchmal, ob das in meinem Umfeld immer noch passiert. Ob Freundinnen mir strahlend und zwinkernd von ihrem Aufriss erzählen – und dahinter eigentlich die Tatsache steht, dass es für sie alles andere als lustig war und ihnen das bereits zuvor bewusst gewesen war. Und dann frage ich mich, wieso ich nicht die Einzige bin, sondern eine von vielen, die diese Dinge tun? Wieso vergewaltigen wir uns selbst? Wieso inszenieren wir unseren eigenen sexualisierten Übergriff? Wieso casten wir uns als Akteurinnen und schreiben die Szene, nur damit wir, wenn der Vorhang fällt, die Scherben aufklauben können?
Vielleicht, weil der weibliche Körper eine Ware ist, die wir als Frauen verwalten, aber nie wirklich besitzen? Vielleicht, weil wir denken, dass wir das verdient haben? Oder vielleicht, weil wir sonst keine Nähe bekommen? Trotz mehrfachem Zerdenken finde ich einfach keine gute Antwort darauf. Well, I guess, it is what it is.
patzak@thegap.at @tonilolasmile





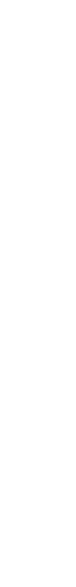



Zehn Freund*innen, ein Studio und die Liebe zur Musik – was vor fünf Jahren in einem kroatischen Inseldorf begann, prägt heute die Wiener Club- und Radioszene. Was macht Radio Rudina, gleichzeitig Veranstalter, Radiosender und DJKollektiv, so erfolgreich? Und wie sieht die Zukunft dieses Projekts zwischen Hobby, DIY und Kreativwirtschaft aus? ———— »Als ich das erste Mal nach Rudina kam, war ich von seiner Idylle und scheinbaren Ursprünglichkeit verzaubert. Ich kam wieder und machte es bald darauf zu einem zweiten Zuhause.« Genauso unvermittelt, wie die Frauenstimme ertönt, verstummt sie auch wieder. Sanfte Boom-Bap-Drums setzen ein und »Gang Starr – Code of the Streets« ist im Player des Onlineradios zu lesen. Der als Jingle dienende Sprachschnipsel stammt aus einem Feature des WDR über das kleine Örtchen Rudina auf der kroatischen Insel Hvar. In ebenjenem Siebzig-Seelen-Dorf keimte vor knapp sechs Jahren eine Idee, die sich zu einem der interessantesten Projekte der Wiener Kreativszene entwickeln sollte: Radio Rudina. In einem Satz zu beschreiben, worum es sich dabei handelt, fällt gar nicht so leicht, denn seit den Anfängen in Kroatien ist viel passiert. Ausverkaufte Partys an ikonischen Orten wie in der Grellen Forelle oder im
Kunsthistorischen Museum, Livestreams mit internationalen DJ-Größen und ein 24/7-Radioprogramm. Radio Rudina ist Veranstalter, DJ-Kollektiv und Onlineradio in einem. »Wir machen Radio im breiten Sinne«, fasst Yvonne Tadić, die das Projekt mitbegründet hat, die Aktivitäten zusammen. »Wir verbreiten Musik, sodass sie jede*r hören kann.«
»Wir machen Radio im breiten Sinne.« — Yvonne Tadić
Im Jahr 2019 ein Onlineradio zu gründen, ist eine ungewöhnliche, zumindest antizyklische Entscheidung, wird dem Medium doch bereits seit vielen Jahren der sichere Tod prophezeit. Und auch die Nachfrage nach DJ-Kollektiven scheint in Wien kaum auf ein zu kleines Angebot zu treffen. Was ist es also, das dieses Projekt besonders macht? Welche Entscheidungen haben die Gründer*innen
getroffen, um Radio Rudina seit über sechs Jahren am Laufen zu halten? Und wie hat sich das Kollektiv in so kurzer Zeit zu einem Fixpunkt in der Wiener Musikszene entwickeln können?
Antworten auf diese Fragen gibt es mitten im ersten Bezirk. Kaum hundert Meter von der Oper entfernt, befindet sich das Studio Mahlerstrasse, die Homebase des Radiosenders. »Du musst nach unten in den Keller«, meldet sich Julian Lenz an der Freisprechanlage. Über eine breite schwarze Wendeltreppe geht es hinab ins Untergeschoß, wo er bereits wartet. Dröhnender Bass mit 128 Beats per Minute dringt durch die Wände und bringt den Boden des Studios zum Beben. Verantwortlich dafür ist der deutsche DJ Oliver Huntemann, der vor seinem abendlichen Closing-Gig beim Donauinselfest auf eine Stippvisite bei Radio Rudina vorbeischaut.
Mit Julian geht es durch den verwinkelten Keller, durch eine kleine Küche und in einen länglichen Raum, der über eine enge Tür mit dem Hauptstudio verbunden ist. Beißende Hi-Hats dringen zu uns herüber. Das DJ-Set nähert sich seinem Höhepunkt. An einem runden Holztisch lässt sich Julian zum Gespräch nieder. Komplettiert wird



einmal drei Minuten nur Meeresrauschen von dort«, sagt Philipp und grinst.
Zurück in Wien, machten die Freunde einfach weiter, wo sie in Rudina aufgehört hatten. Julian: »So einen richtigen Plan hatten wir dabei eigentlich nie. Es hat einfach Spaß gemacht, die Musik zu hören und zu verbreiten.« Keines der Gründungsmitglieder brachte Radioerfahrung mit. Wie man mit Open-Source-Programmen einen Onlinesender aufsetzt, bei welchen Verwertungsgesellschaften man sich melden muss und wie man 24 Stunden Airtime füllt, all das brachten sich die Freund*innen selbst bei.
Zeit, um das Projekt voranzutreiben, hatten sie genug, denn nur wenige Monate nach der Galerija Šolyard erreichte die Coronapandemie Österreich. »Wir hatten dann alle eher weniger zu tun«, erinnert sich Julian und lacht. »Da hat uns das Projekt ganz gut in die Karten gespielt.«
Auch ein Quäntchen Glück im Timing spielte also eine Rolle für den Erfolg des Senders. Denn während viele die Zeit der Lockdowns nutzten, um eigene Projekte im Internet zu starten, war Radio Rudina schon seit einem halben Jahr auf Betriebstemperatur und anderen Radio-Newcomer*innen damit einen Schritt voraus. Selbst unter Einhaltung der strengen Coronarichtlinien, schaffte es die Gruppe, DJs für Livesets einzuladen und diese in die Wohnzimmer clubabstinenter Musikfans zu streamen. »Ich glaube, das war schon auch ein Punkt, wieso es während Corona so gut lief für uns. Wir hatten die Infrastruktur schon, auch das Studio«, so Philipp.
Vom Keller in die Welt
Ach, ja: das Studio. Auch der Hauptraum des Studios Mahlerstrasse, von dem aus Radio Rudina streamt, trägt zweifellos zum Erfolg des Projekts bei. Jedes Set, das hier gespielt wird, läuft zunächst live im Radio. Später landen die Mitschnitte auf dem Youtube-Kanal des Kollektivs. Die Kulisse im Rücken der DJs ist vielen Fans elektronischer Musik daher ähnlich bekannt wie der grüne Fliesenraum von Hör Berlin oder der zugestickerte Container des The Lot Radio in New York. Ein wandfüllender Spiegel auf der einen Seite, massive Säulen auf der anderen. Vor der gepolsterten Rückwand mit dem Radio-Rudina-Schriftzug ein gemütliches Sofa.






Studio Dan & MuTh: YOU BETTER LISTEN! in Kooperation mit Musiktheatertage Wien



INSERAT_TheGap_105x140_3mm_v2_coated.indd














































































































»Alle DJs, die zu uns kommen, sagen, es sei hier viel größer, als sie erwartet hätten«, erzählt Yvonne. Die Größe des Studios hat seine Vorteile. Denn im Gegensatz zu den zuvor genannten Formaten können die Acts bei Radio Rudina Freund*innen und Fans mitbringen und dem Livestream dadurch Leben einhauchen. In den meisten Videos sieht man Menschen im Hintergrund tanzen, reden, viben. »Ich finde es toll, dass uns Leute sagen, DO 25.







dass nicht nur der Raum den Wiedererkennungswert ausmacht, sondern auch die Atmosphäre im Raum«, sagt Philipp.
Doch wie kommt man eigentlich zu so einer exklusiven Location, noch dazu im ersten Bezirk? Die Antwort ist simpel. Yvonne: »Phil und Fabi haben das gemeinsam auf Willhaben gefunden.« Ein echter Glücksgriff, denn aufgrund eines alten Mietvertrags liegt die Miete weit unter dem, was in der Gegend üblich ist. Genutzt werden die Räumlichkeiten allerdings nicht nur von Radio Rudina. Zahlreiche Kreative aus den unterschiedlichsten Sparten sind Teil des Studios Mahlerstrasse. Gleich neben dem Hauptstudio befindet sich eine Werkstatt, in der Instrumente gebaut werden. Ein paar Zimmer weiter lagert der Fundus einer Stylistin.
Sprung zurück: Es ist der 12. Mai 2024 und der große Raum im Studio Mahlerstrasse ist gut gefüllt. Dort wo normalerweise DJ-Decks und Mischpulte stehen, finden sich Naturweinflaschen, Tschickpackungen und eine rote Vinylplatte. Einer der Menschen im Hintergrund reckt einen Amadeus Award in die Höhe. Irgendwo in der Menge lässt sich eine vierköpfige Band ausmachen. Bibiza bahnt sich seinen Weg durch die Menschen. Schnurstracks läuft er auf die Kamera zu, entzündet lässig einen Tschick an einer Kerze und stimmt seinen Song »Hautevolee« an. Mehr als 50.000 Aufrufe hat das Youtube-Video des Auftritts bis Juni 2025 gesammelt, die zugehörigen Social-Media-Clips mehr als 300.000. »Die Bibiza-Liveshow hat uns sicher noch mal einen Push gegeben«, stellt Tobi fest. Eine ganze Band im Studio zu haben, sei anspruchsvoller, als ein DJSet zu streamen. »Da hatten wir zum ersten Mal einen eigenen Tontechniker dabei.« Jedenfalls wolle man das Format in Zukunft weiter ausbauen, um die musikalische Vielfalt der Livestreams zu erweitern. Denn obwohl sich der Großteil der Sets im House-Trance-Techno-Spektrum bewegt, hat die Gruppe keine musikalischen Scheuklappen auf. Um das festzustellen, reicht es, tagsüber Radio Rudina einzuschalten. Von Boom Bap über Reggae und Italo-Schlager bis Postpunk – die fein kuratierte Musikrotation kennt keine Genregrenzen.
An den Decks sind alle gleich Wie fühlt es sich an, als Musikliebhaber*in plötzlich die Lieblingskünstler*innen im eigenen Studio begrüßen zu dürfen? »Das ist schon eine Ehre, so große Leute einzuladen, die dann auch noch zusagen«, schwärmt Philipp. »Krass war für mich Cyan 85«, ergänzt
Yvonne. »Der ist gar nicht so riesig, aber ich spiele seine Tracks oft in meinen Sets.« Diesen Künstler plötzlich vor sich stehen zu sehen, das sei ein tolles Gefühl gewesen, erzählt sie. Das Booking sei laut Philipp mit den Jahren deutlich einfacher geworden. Viele Künstler*innen würden mittlerweile selbst anfragen, ob sie ein Set spielen dürften. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn für die Livestreams zahlt Radio Rudina keine Gagen. Egal, wer kommt. »Bei uns im Studio sind alle gleich«, so Philipp. Internationale Star-DJs würden genauso behandelt wie Newcomer*innen aus Wien. »Bei uns spielen Oliver Huntemann und Marlon Hoffstadt auf dem gleichen Tisch mit dem gleichen Background wie irgendein kleines Kollektiv aus Wien.«
Inklusion statt Exklusivität: Radio Rudina sieht sich als Projekt aus der Community für die Community. Auch das ist Teil des Erfolgsgeheimnisses. Die Grenze zwischen Publikum
Gibt es Ambitionen, das zu ändern? Natürlich wäre es ideal, so Philipp, irgendwann von dem Projekt leben zu können. Doch dafür die eigenen Ideale zu verkaufen, das käme für die Gruppe nicht infrage. Ein Ablaufdatum, bis zu dem das Projekt Geld abwerfen müsse, habe niemand im Kopf. Wichtiger sei es, die gemeinsame Freundschaft zu bewahren. Denn klar, wer anfängt, die eigenen Hobbys zu professionalisieren – und das auch noch mit den engsten Freund*innen –, läuft Gefahr, dass das, was einmal Ruhe und Entspannung brachte, plötzlich Stress auslöst.
Community als Ausgangspunkt

»Wir stecken extrem viel Arbeit da hinein, damit das Menschliche im Vordergrund bleibt«, verrät Philipp. Seit einiger Zeit würden sie zum Beispiel mit einem Feelgood-Management in ihr wöchentliches Planungstreffen starten. »Das verlängert unsere Meetings«,
»So einen richtigen Plan hatten wir dabei eigentlich nie. Es hat einfach Spaß gemacht, die Musik zu hören und zu verbreiten.«
— Julian Lenz
und Sender ist bewusst durchlässig gehalten. Philipp: »Viele unserer Zuhörer*innen kommen tatsächlich irgendwann vorbei und spielen selbst ein Set.« Gut vernetzt sei man darüber hinaus auch mit der freien Radioszene. Mit Res.Radio und Vlan.Radio organisierte Radio Rudina etwa ein gemeinsames Event, das Common Air Festival.
Trotz des Erfolges ist Radio Rudina noch immer vor allem eine Herzensangelegenheit. Geld zahlt sich keines der Mitglieder aus. Alle Einnahmen fließen zurück in das Projekt. Fast alle arbeiten daher nebenbei in anderen Berufen, um sich zu finanzieren. » Wir sind Fotograf*innen, Filmemacher*innen, Bibliothekar*innen, Architekt*innen, Angestellte und Selbstständige. Es ist komplett bunt gefächert«, führt Philipp aus.



sagt Yvonne lachend. Trotzdem sei das für den Zusammenhalt in der Gruppe enorm wichtig. Wie auch Philipp erläutert: »Wir wollen nicht nur nach außen tragen, dass Inklusion und Respekt unsere wichtigsten Werte sind, sondern das auch selbst verinnerlichen.« Angesichts von über 500 Shows allein im vergangenen Jahr keine leichte Aufgabe. Und da sind die Partys, die Radio Rudina in Wien und anderswo veranstaltet, noch gar nicht eingerechnet. Als Haupteinnahmequelle halten ebendiese das Projekt auch am Leben. Denn das Livebusiness entwickelte sich schon früh zum zweiten Standbein des Radiosenders. Bereits 2019, kurz nach der Gründung, beteiligte sich Radio Rudina an Veranstaltungen im mittlerweile geschlossenen Club Horst. Das erste eigene Event fand


dann kurz nach Corona in der Grellen Forelle statt. »Wir haben uns richtig angeschissen«, erinnert sich Philipp. Parallel zur Party fand das Lighthouse Festival statt. »Alle haben uns gesagt: ›Macht’s das nicht, niemand ist in Wien, keiner geht fort‹« Doch am Ende ging alles gut. Die Forelle war ausverkauft, Einlassstopp. »Und wir sind nur mit offenem Mund dagestanden«, erzählt Philipp.
Längst beschränkt sich Radio Rudina nicht mehr auf klassische Clubevents. Mit der Zeit wurden die Locations außergewöhnlicher und die Konzepte ausgeklügelter. Im Rahmen der Reihe »Kunstschatzi« legen die DJs des Kollektivs regelmäßig in den Hallen des Kunsthistorischen Museums auf. Bereits zweimal verwandelten sie außerdem die Lugner City mit »Lugner de la Noche« in einen Club. »Die Idee war zu fünfzig Prozent dumm und zu fünfzig Prozent geil«, sinniert Philipp rückblickend. Was überraschen mag: Das Event war kein Geistesblitz der Freund*innengruppe selbst. Der Einfall sei stattdessen aus dem Umfeld der Lugner City an sie herangetragen worden. »Und wir haben dann einfach gesagt: Let’s go, probieren wir es.«
Weitere Raves in Einkaufszentren wird es sobald wohl nicht geben. Dennoch ist der Terminkalender für die nächsten Monate prall gefüllt. Schon bald steht die nächste ForelleParty an, kurz darauf das Paradies Garten Festival, bei dem das Kollektiv eine eigene Bühne kuratiert. Parallel arbeitet man im Studio Mahlerstrasse konzentriert an der Einrichtung eines zweiten Radiokanals. Irgendetwas ist immer zu tun.
Und auch, wenn sich das Team derzeit betont antikommerziell gibt und Stolz auf seine Unabhängigkeit ist, so werden doch Fühler in Richtung einer stärkeren Monetarisierung der eigenen Arbeit ausgestreckt. Wenige Tage nach dem Gespräch erscheint eine Werbekooperation mit Samsung auf dem Instagram-Kanal des Kollektivs. Vielleicht wird das ja doch noch was mit dem Rad io als Hauptberuf: »Wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, Kooperationen einzugehen, wenn sie mit unseren Werten übereinstimmen«, meint Philipp. Der Plan für die nächsten Jahre stehe allerdings fest. Tobi fasst ihn zusammen: »Freund*innen bleiben, weiter wachsen, trotzdem nicht unseren Arsch verkaufen.«
Jannik Hiddeßen
Radio Rudina ist auch diesen Sommer umtriebig. Neben den üblichen Partys hostet das Kollektiv beim Paradies Garten Festival in Bruck an der
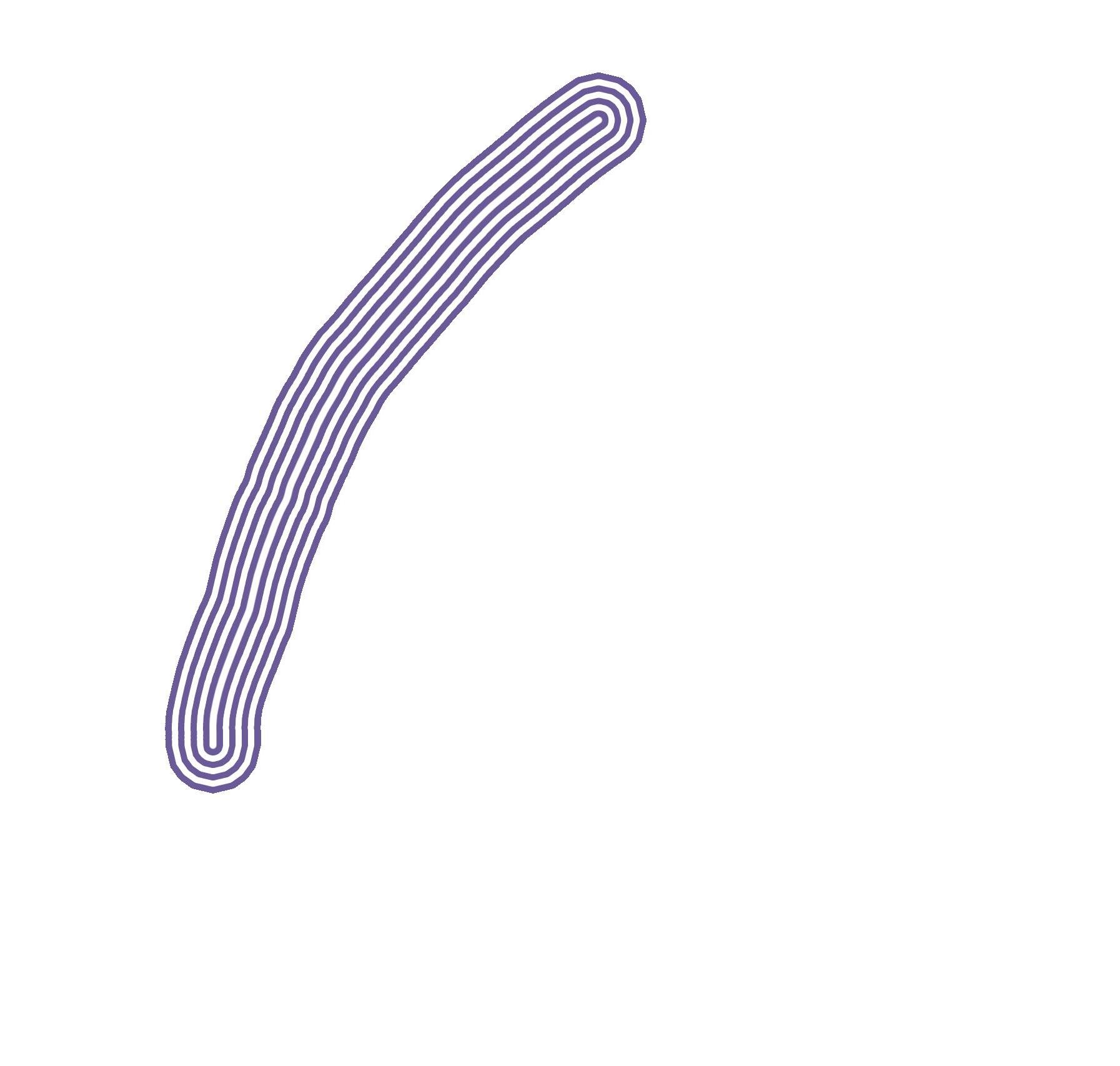

UHR OTTO WAGNER AREAL GARTEN PAViLLON 9 BAUMGARTNER HÖHE 1, 1140








Felix Lenz wurde vom Mak für den österreichischen Beitrag zur 24. Internationalen Ausstellung der Triennale Milano ausgewählt. Das Thema der Triennale: »Inequalities«. »Brute Force«, die zentrale Arbeit des Beitrags, handelt einerseits von der Verstrickung analoger und digitaler Wirklichkeit, trifft andererseits Aussagen über das Verhältnis von Wissen und dessen Gegenstand. ———— Der Planet Erde besteht zu 15 Prozent aus Silizium, in der Erdkruste beträgt der Massenanteil sogar 25 Prozent und es ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element. Auch oberirdisch ist Silizium mittlerweile weit verbreitet: Es steckt in Solarzellen, mit denen Strom erzeugt wird, in Bildsensoren, die in Digitalkameras verbaut sind, und in Computerchips, die sich im Inneren von Laptops verstecken, mit denen solarstrombetriebene Websites aufgerufen werden können, die Informationen bereithalten.
Informationen, zum Beispiel, zu Felix Lenz. Eine Google-Suche zu diesem Namen bringt in 0,23 Sekunden knapp 3,5 Millionen Ergebnisse. Das zuoberst angezeigte führt zu seiner Website. Deren Landingpage besteht aus einer Grafik und dem Hinweis, dass diese Internetpräsenz selfhosted und solarbetrieben sei und manchmal offline gehe. Aktueller Batterieladestand: 25 Prozent. Die virtuelle Seite bekommt damit eine Materialität, erscheint als etwas Plastisches. Das ist nichts, was an sich nicht anderswo auch der Fall wäre – es ist hier nur transparent gemacht worden. Ein Link führt zu weiteren Projekten, darunter »Brute Force«, das, als jüngstes, ganz oben auf der Liste steht.
»Brute Force« setzt Kameralinsen, Datenzentren, Greenscreens und topografische Renderings als Motive einer vom Analogen getragenen digitalen Welt ein, kehrt die Blickrichtung aber um: So, wie das Silizium, das hier für die physische Welt steht, die digitale Wirklichkeit hervorbringt, bringt Letztere auch Erstere hervor. Die entsprechenden Bilder dazu sind Close-ups und Luftaufnahmen von Landschaften, die von den Folgen der Extraktion von Silizium aus dem Erdboden, der Verarbeitung von Daten in Rechenzentren und der Kühlung dieser Zentren durch Wasser geformt sind: Bilder von architektonischen Megakomplexen, Transportsystemen, Erdlöchern und Salzwüsten.
Mit der Beschwörung der Heisenberg’schen Feststellung, dass der Akt der Beobachtung die beobachtete Welt beeinflusst, wenn nicht sogar hervorbringt, wirft der Film gleich zu Beginn einen theoretischen Anker. Im Laufe der dreißig Minuten – und nicht zuletzt im Mailänder Kontext der Einbettung des Films in eine Installation, die die Fassaden der Big-TechKonzerne des Silicon Valleys evoziert – zeichnet sich darüber hinaus eine Stoßrichtung des Films ab, die auf Machtstrukturen hinweist, die mit den historischen Praktiken des Beobachtens und Abbildens verbunden und unter den Oberbegriffen Neuzeit sowie Kolonialismus versammelt sind. Oder ganz nüchtern gesagt: »Wissen ist keine Ansammlung von Daten. Es ist eine materielle Praxis.« Victor Cos Ortega
»Brute Force [Exhibition Cut]« ist zwischen 2022 und 2025 im universitären Rahmen in Österreich, Deutschland, Frankreich und den USA entstanden. Co-Regie führte Ganaël Dumreicher. Bei der Triennale Milano ist der Film bis 9. November als Teil der Multimediainstallation »Soft Image, Brittle Grounds« zu sehen.
Die Regisseurin Olga Kosanović kämpft seit sieben Jahren um die Staatsbürger*innenschaft ihres Geburtslandes Österreich. Über dessen problematische Immigrationspolitik hat sie nun den Film »Noch lange keine Lipizzaner« gedreht. ———— »Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner.« So kommentierte ein anonymer Account auf der Website einer österreichischen Tageszeitung die Frage, ob die Regisseurin Olga Kosanovi ć die österreichische Staatsbürger*innenschaft bekommen solle. Geboren 1995 in Korneuburg als Kind serbischer Eltern und aufgewachsen im vierzehnten Wiener Gemeindebezirk, ist sie eigentlich ein Paradebeispiel einer Österreicherin – nur dass sie zufällig einen anderen Pass hat.
Doch statt dies von offizieller Seite anzuerkennen, stellt sich den Behörden absurderweise die Frage, ob Kosanović denn integrierbar sei. Sie selbst greift diese abstruse Situation nun in ihrer Doku »Noch lange keine Lipizzaner« auf. Der Film, der beim Festival Max Ophüls Preis seine Weltpremiere feierte, im März bei der Diagonale zu sehen war und im September in den österreichischen Kinos startet, macht die Regisseurin auf humorvolle Weise zur Protagonistin. Er
zeigt, wie sie durch den verdrehten österreichischen Behördendschungel navigiert, und geht gleichzeitig der Frage auf den Grund, was Staatsbürger*innenschaft überhaupt bedeutet. Wer bestimmt, was die kulturellen Merkmale eines Landes sind und wer dessen Bürger*innen? Was hat ein Land davon, sich gegenüber neuen Menschen abzuschotten?
Diese Fragen beschäftigen nicht nur Kosanović: Viele Leute hätten sich bereits bei ihr bedankt, weil sie selbst oder ihre Eltern, Geschwister und Cousin*innen ähnliche Erfahrungen gemacht hätten. »Im Zuge meiner Recherchen habe ich so viele ähnliche Geschichten gehört. Das war unfassbar«, erinnert sich die Regisseurin. »Auch wenn ich natürlich damit gerechnet habe, dass ich nicht die Einzige bin. Deshalb war es mir ja ein Anliegen, einen Film daraus zu machen.«
»Unvorteilhafte« Bedingungen Österreich und die Staatsbürger*innenschaft. Wenn man nicht unter das Abstammungsprinzip fällt, Nachkomm*in einer im Zweiten Weltkrieg verfolgten Person oder berühmt und daher für die Republik von Interesse ist, hat man es schwer. Zehn Jahre rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich und davon mindestens fünf Jahre ununterbrochenen

Hauptwohnsitz setzt der Staat voraus. Man muss ein gesichertes Einkommen haben und ohne Sozialhilfe auskommen. Die Deutschkenntnisse müssen das Niveau B1 erreichen und auch über Kenntnisse der demokratischen Ordnung sowie der Geschichte Österreichs muss man verfügen. Ebenso dürfen keine relevanten Vorstrafen oder offene Ermittlungsverfahren vorliegen. Seine alte Staatsbürger*innenschaft muss man abgeben und – vielleicht der einfachste Teil – sich zur österreichischen Verfassung sowie zu den Grundwerten bekennen.
Was den Zugang zur Staatsbürger*innenschaft angeht, ist Österreich damit eine der restriktivsten Nationen in ganz Europa. Im Migrant Integration Policy Index erhalten die Regelungen hierzulande das Prädikat »Unvorteilhaft« mit gerade einmal 13 von 100 möglichen Punkten. Im Vergleich: In Schweden sind die Hürden mit 83 Punkten sehr niedrig und sogar unser zunehmend nationalistisches Nachbarland Ungarn liegt mit 25 Punkten deutlich vor der Alpenrepublik. Für Herrn und Frau Österreicher sind diese Problematiken, wie auch der Film in kleinen Animationssequenzen zeigt, oft nur weißes Rauschen. Man selbst würde ja recht bequem leben.

Die Regeln, wie man an eine österreichische Staatsbürger*innenschaft kommt, sind oft undurchsichtig.
Doch gerade auch für diese autochthonen Österreicher*innen habe Kosanovi ć »Noch lange keine Lipizzaner« gedreht. So betont etwa eine der im Film interviewten jungen Frauen mit österreichischem Pass, wie egal ihr dieser eigentlich sei. Eine privilegierte Aussage? Klar, aber irgendwie verstehe Kosanović das auch: »Pass und die Staatsbürger*innenschaft können einem erst mal wurscht sein, wenn man mit dieser Problematik nicht in Berührung kommt. Woher soll man das auch wissen? Wir lernen es ja nicht in der Schule.« Bei ihr habe sich der unschuldige Gedanke, mal schnell bei der MA 35 den Wechsel ihrer Staatsbürger*innenschaft einzuleiten, alsbald als Sisyphosarbeit entpuppt: »Erst da habe ich gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist.«
Ich-Erzählerin
Schwierig war für sie auch die Überlegung, den Film um sich selbst als Erzählerin herum zu konzipieren. »Ich habe mich extrem lang gewehrt, da mit dabei zu sein. Sich im Dokumentarfilm zur Protagonistin zu machen, ist eine umstrittene Methode.« Letztendlich habe dann der Finanzierungs- und Pitchingprozess diese Entwicklung vorangetrieben. »Die Geschichte beginnt nun mal bei mir. Das
ist der Grund, warum ich dieser Spur überhaupt nachgehe.« Aber, so betont Kosanović, auch wenn es ein Film mit ihr ist, solle er nicht ausschließlich von ihr handeln. »Ob ich die Staatsbürger*innenschaft schlussendlich bekomme oder nicht, ist für den Film ja völlig irrelevant. Mir geht es um die größere Debatte dahinter. Was bedeutet das Thema für alle anderen? Was bedeutet es für uns als Gesellschaft? Wer sind wir? Wer sind ›die anderen‹?«
Als »andere« wäre Kosanović nie aufgefallen. Nach einer Kindheit im vierzehnten Bezirk besuchte sie ebendort die Graphische, wollte eigentlich Fotografin werden. »Als sie mich dann in der Multimediaklasse haben wollten, bin ich relativ schnell in den Film reingerutscht.« Nach der Matura besuchte Kosanović ein Jahr die Schule Friedl Kubelka. »Dort konnte man Super-8- und 16-Millimeter-Filme selbst entwickeln. Der Analogfilm hat mir auf der Graphischen gefehlt.« Danach folgte der Wechsel ins Ausland, an die Hochschule für bildende Künste (HFBK) Hamburg in die Klasse von Angela Schanelec.
»Ursprünglich war das die Klasse von Wim Wenders. Deswegen hatte ich mich dort
»Mit einer privilegierten Blauäugigkeit bin ich damals zur Behörde gegangen. Danach fühlte ich mich wirklich das erste Mal fremd.« — Olga Kosanović
Auch dreißig Jahre nach ihrer Geburt in diesem Land ist Olga Kosanović immer noch keine österreichische Staatsbürgerin.
beworben. Aber just in dem Moment, als ich aufgenommen wurde, ging er in Pension.« Der Aufenthalt in Hamburg zählte beim Einbürgerungs-Nein mit zu jener Zeit, die Kosanović zu viel im Ausland verbracht hatte. Achtzehn Tage zu lang war sie schlussendlich nicht in Österreich ansässig gewesen. Paradoxerweise sei sie aber genau in Hamburg »die Wienerin, die ich immer sein wollte«, geworden. Sie sei dort der Klassenclown gewesen, »der Kasperl, der so lustig ist und lieb spricht«. Rückblickend, meint Kosanović grinsend, müsse man quasi zweimal migrieren, um irgendwo anzukommen. Wienerin im Ausland zu sein, sei nämlich nie das Ziel gewesen. Die Bundeshauptstadt sei ihr Zuhause und, wie sie im Film betont, hier wolle sie auch mitbestimmen können. »Sobald man ein bisschen weg ist, merkt man, wie toll und wie lebenswert Wien ist.«
Wieder daheim feierte sie erste Erfolge mit »Genosse Tito, ich erbe«, ihrem Abschlussfilm an der HFBK Hamburg. In dieser Doku musste sich ihre Familie der Frage stellen, was eines Tages mit dem Landhaus ihrer Großeltern in Serbien passieren solle. »Genosse Tito, ich erbe« gewann 2022 den Österreichischen Filmpreis in der Kategorie »Bester Kurzfilm« und gastierte bei zahlreichen Festivals.
Danach musste ein Spielfilm folgen, denn: »Ich wollte nicht sofort den Stempel der ›Doku-Olga‹ bekommen. Aus dieser strategischen Sicht ist ›Land der Berge‹ entstanden. Die Idee für die Geschichte hatte ich aber schon lange.« Die Handlung folgt dem Serben Vladimir, der mit seiner Tochter einen Aufenthaltstitel und Papiere in Österreich erlangen will, aber an einem »Catch-22« der österreichischen Gesetzgebung scheitert: 8.000 Euro braucht er auf dem Konto. Doch da er keine Papiere hat, darf er nicht legal arbeiten und muss zu unkonventionellen Mitteln greifen. Die Handlung sei ein Potpourri aus wahren Erfahrungen, so Kosanović: »Es ist die Geschichte meiner Eltern, die in den Neunzigern und Nullerjahren für den Daueraufenthalt kämpften. Damals mussten sie diese Kontodeckung wirklich vorweisen. Das finde ich bis heute total absurd.« Mit »Land der Berge« gewann die Regisseurin im Juni 2025 abermals den Österreichischen Filmpreis für den »Besten Kurzfilm«.
Schon vor diesen Erfolgen beginnt die Geschichte von »Noch lange keine Lipizzaner«, die Kosanović nun seit sieben Jahren begleitet. Im Alter von 23 suchte sie nämlich erstmals um die Staatsbürger*innenschaft an – mittlerweile ist sie dreißig. Als Tochter einer serbischen Germanistin genieße sie die Privilegien einer guten Bildung und perfekten Deutschs, wie sie betont. »Mit dieser privilegierten Blauäugigkeit bin ich auch zur Behörde gegangen.

Danach fühlte ich mich wirklich das erste Mal fremd und hatte den Eindruck, gar nicht so richtig dazuzugehören.« Bekanntheit erlangte ihr Fall dann 2021, als sie eine Kampagne von SOS Mitmensch mit einem kurzen Video unterstützte und es daraufhin Kommentare wie das eingangs erwähnte hagelte.
»Ich habe gemerkt, dass ich ein sehr gutes Beispiel dafür bin, dass dieses Gesetz schlecht funktioniert, und zwar so, wie es der Gesetzgeber ursprünglich vielleicht gar nicht wollte. Das Prozedere hat sich aber verselbstständigt.« Da schlage, so die Regisseurin weiter, auch die österreichische Tradition wieder zu: »Nichts ändert sich. Alles bleibt, wie es ist. Das war schon immer so.«
Gericht statt Gesetz
Was in Österreich ebenfalls Tradition hat: dass oft einmal die Gerichte dort bemüht werden müssen, wo der Gesetzgeber und die Behörden auslassen. In Österreich entsteht Veränderung immer wieder erst am Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof. Dank Letzterem hat sich zwischen Dreh und Kinostart auch einiges für Kosanović getan: »Ich habe jetzt eine Zusicherung von der österreichischen Seite. Das war aber nicht die Arbeit der MA 35, sondern wir haben eine Säumnisbeschwerde eingelegt, weil die Behörde schon wieder zu lange gebraucht hat. Der Richter hat dann gemeint, dass er gar nicht verstehe,
warum das nicht schon längst entschieden wurde, weil die Lage total klar sei.«
In acht Minuten sei die ganze Angelegenheit zu ihren Gunsten abgehandelt gewesen. Sie habe nun zwei Jahre Zeit, die serbische Nationalität zurückzulegen – aber auch in anderen Ländern mahlen die behördlichen Mühlen langsam. »A g’mahde Wies’n« ist ihr Weg zur Staatsbürger*innenschaft jedenfalls noch immer nicht: »Bis zum Tag der Verleihung in Österreich muss ich weiterhin alle Kriterien erfüllen, etwa auch die Straffreiheit und die Verwaltungsstraffreiheit.«
Was das für sie bedeutet, erklärt sie an einem banalen Beispiel: »Wir wohnen im Dachgeschoß und haben vor unserer Tür immer die Schuhe abgestellt. Neulich kommt der Brandschutzbeauftragte und sagt: ›Guten Tag, Sie müssen das hier wegräumen. Das ist eine Vorschrift, sonst gibt es eine Verwaltungsstrafe.‹ Da klingeln bei mir natürlich gleich alle Alarmsignale. Okay, Schuhe rein.« Aber nur vorerst, wie Kosanović spitzbübisch grinsend erklärt – und sie betont, dass man das durchaus drucken dürfe: »Sobald ich die Staatsbürgerschaft habe, stelle ich die Schuhe wieder auf den Gang. Eine Verwaltungsstrafe kann man sich dann ja mal leisten.« Susanne Gottlieb
Der Film »Noch lange keine Lipizzaner« von Olga Kosanović startet am 12. September in den österreichischen Kinos.








Mehr als 200 Teilnehmer*innen tauschten sich bei der Musikwirtschaftskonferenz Bzzzz über Rahmenbedingungen, Zusammenarbeit und Professionalisierung in ihrer Branche aus.

»Selten war die Gelegenheit besser und die Notwendigkeit höher, sich aktiv an der Zukunft des Musikstandorts Österreichs zu beteiligen: 2025 haben wir neue Ansprechpartner*innen im Ministerium, bedingt durch die Wirtschaftskammerwahlen im März neu gewählte Funktionär*innen sowie neu konstituierte Berufsgruppenausschüsse, einen in Gang befindlichen Generationenwechsel in den Interessenvertretungen und eine Menge großer Herausforderungen, nicht zuletzt angesichts budgetärer, sozialer und weltpolitischer Unsicherheiten«, stellte Hannes Tschürtz, Ink-MusicChef und Vorsitzender der Berufsgruppe »Label« im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft, in seiner Begrüßungsrede fest.
Über 200 Menschen lockte die dritte Ausgabe der Musikwirtschaftskonferenz Bzzzz in die WKÖ in Wien. Vertreter*innen aus sämtlichen Bereichen der Musikbranche und aus allen neun Bundesländern setzten sich dabei mit den drängenden Herausforderungen der Zeit und den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinander.
Echte Zusammenarbeit
Nach einer gleichermaßen launigen wie leidenschaftlichen Keynote von Yasmin Hafedh aka Yasmo, in der sie – in bester Poetry-Slam-Manier –eine Lanze brach für Community und Solidarität als wichtige Faktoren für die nachhaltige Stärkung der
Jeremias Meyer, Ines Frieda Försterling und Kylian Kaos Keimel sind drei Viertel des Leitungsteams des Kunstraums Vinzenz.
Konkurrenzdruck ist auch in der Kulturbranche allgegenwärtig. Die Vorherrschaft von Kapitallogik und Ellbogentaktik macht ein gutes Netzwerk unabdingbar. Doch welche Initiativen positionieren sich bewusst gegen Freunderlwirtschaft? Und wie kann Networking inklusiver und niederschwelliger werden? ———— Der Kulturbereich unterscheidet sich in vielen Aspekten von klassischen Brotberufen. Die meisten Kreativschaffenden arbeiten freiberuflich, sind also selbstständig. Anstellungsverhältnisse, geregeltes Einkommen und Urlaubsanspruch sind dabei die Ausnahme. Zwar bleibt man so von autoritären Chef*innen verschont, muss sich dafür aber als Individuum im freien Markt behaupten – und der folgt seiner ganz eigenen Logik: knappe Ressourcen, Konkurrenzkampf, begrenzte Fördermittel. Als Künstler*in ist man da zunächst einmal auf sich allein gestellt, denn das gilt ja nicht als systemrelevante Beschäftigung, es gibt keine freigewordenen Stellen, die nachzubesetzen sind. Man muss sich selbst einen Markt schaffen, die Marktlücke erfinden und sich selbst hineinschreiben. Was dabei hilft ist ein unterstützendes Umfeld. Networking gehört in einer neoliberalen Gegenwart zur Job-Description jeder kunstschaffenden Person. Wenn Galerien ausstellen, was sich gut verkaufen lässt, Filmschaffende von staatlicher Förderung abhängig sind und Musiker*innen fast gleich viel Zeit in ihren Social-Media-Auftritt wie in ihre Musik investieren, dann werden Beziehungen aller Art zum A und O.

Durch den Konkurrenzdruck verkommt Networking dabei mancherorts zum Poker mit Visitenkarten. Die Kapitallogik reduziert Kontakte zu einer weiteren Ressource auf dem Karriereweg. Das bietet wiederum den perfekten Nährboden für Nepotismus, in Österreich besser bekannt als Freunderlwirtschaft.
Gatekeeping reflektieren
Ein Gegenmodell zum kapitalorientierten Networking bieten die Ausstellungsräumlichkeiten des Vinzenz im achtzehnten
Wiener Gemeindebezirk. Anstatt auf persönliche Kontakte zu setzen, haben sich die Initiator*innen Ines Frieda Försterling, Kylian Kaos Keimel, Jeremias Meyer und Christian Friesenegger für einen dauerhaften Open Call entschieden. So können sich Künstler*innen jederzeit mit Ausstellungskonzept und Portfolio bewerben, um ihre Arbeiten in der mit Hängesystem und Beleuchtung professionell ausgestatteten Räumen zu zeigen. Der Open Call ist eine bewusst gesetzte Maßnahme, um sich von einer klassischen Ausstellungspraxis zu lösen. Statt sich als Kurator*innen zu pro -


Nora Friedel und Lisa Hasenhütl von FC Gloria versuchen, die patriarchalen Strukturen der Filmbranche zu überwinden.
filieren, hinterfragt das Team seine Rolle als Gatekeeper*innen. Das Vinzenz-Team tritt somit als vernetzendes Umfeld auf, damit Künstler*innen ihre Ideen verwirklichen und präsentieren können.
Gatekeepen heißt nämlich zu kontrollieren, was an die Öffentlichkeit tritt und was nicht, wer Publicity bekommt und wer ungesehen im Atelier verstaubt. Mit dieser Macht kommt Verantwortung. In einer Branche, die nicht sozial gerechten Strukturen folgt, sondern nach den Regeln des freien Marktes funktioniert, sind diese Entscheidungsprozesse oft intransparent und damit anfällig für Freunderlwirtschaft. Ein Teufelskreis entsteht, die Kunstbranche wird immer elitärer und ein Einstieg für Außenstehende zusehends schwieriger.
Vertrauen ist gut … Dabei sei die Wertschätzung persönlicher Beziehungen an sich durchaus nachvollziehbar, so Kylian Kaos Keimel vom Kunstraum Vinzenz: »Ich glaube, dass Freunderlwirtschaft auch aus Niederschwelligkeit und Vertrauen entsteht, aber natürlich muss man trotzdem versuchen, den Raum für alle offen zu halten.« Ines Frieda Försterling ergänzt: »Wenn ich alleine entscheiden würde, wer hier ausgestellt wird, dann würde ich natürlich an Leute denken, die ich kenne. Deshalb ist der Open Call so wichtig.«
Denn wenn in einer Branche immerzu nur Einzelpersonen nach eigenem Ermessen dar-
über entscheiden können, wer Zugang dazu erhält und wer nicht, schreibt sich Ausgrenzung regelrecht in die DNA ein – bis hinein in die behäbigen Institutionen in Kunst und Politik. Wie so oft sind dann Personen aus marginalisierten Gruppen besonders davon betroffen: Frauen, queere Personen, BIPoC, Menschen mit Behinderung beziehungsweise Migrationsgeschichte. Für Nora Friedel –
»Ich glaube, dass Freunderlwirtschaft auch aus Niederschwelligkeit und Vertrauen entsteht.«
— Kylian Kaos Keimel
Vorstandsmitglied des Vereins FC Gloria und Leiterin seines Mentoringprogramms – stellt sich daher die Frage nach der Durchlässigkeit dieser Netzwerke. Es gehe darum, Teilhabe für alle zu ermöglichen. Der »Filmclub« Gloria ist ein Verein für FLINTA*-Filmschaffende, der vor rund fünfzehn Jahren aus dem Bedürfnis nach Austausch und Empowerment von Frauen im Film entstanden ist und sich
seither für Geschlechtergerechtigkeit in der österreichischen Filmbranche einsetzt. Dabei wird brancheninternes Networking mit einer politisch-aktivistischen Haltung verschränkt. Auch in der Filmbranche führt die Verzahnung von Gatekeeping und Konkurrenzdruck zu Ausgrenzungen. Filmproduktion ist Teamarbeit und von Entwicklung bis Durchführung enorm teuer. Damit sind Filmschaffende besonders stark auf Förderungen angewiesen. Lisa Hasenhütl, die bei FC Gloria für Social Media und PR zuständig ist, bestätigt das: »Man braucht einen gewissen Vertrauensvorschuss. Man muss dir zutrauen, dass du so ein großes Team leiten kannst, es schaffst eine entsprechend lange Geschichte zu schreiben und arbeitsfähig genug bist.« Dieses Vertrauen wird in einer patriarchal geprägten Gesellschaft häufiger Männern als Frauen geschenkt.
Daher arbeitet FC Gloria auch auf politischer Ebene daran, die Strukturen der Branche gleichberechtigter zu gestalten. So wurde beispielsweise 2021 eine Geschlechterquote für die Vergabe von Fördergeldern in die Richtlinien des Österreichischen Filminstituts integriert. Eine Maßnahme, die europaweit ihresgleichen sucht und einen großen Erfolg auf dem Weg zu gerechterer Ressourcenverteilung darstellt.
Neben Lobbying bildet ein Mentoringprogramm das Kernelement des Vereins. Bei diesem wird aufstrebenden Filmschaffenden eine erfahrenere Person aus der Branche zur Seite

gestellt. Viele, die daran teilnehmen, würden laut Friedel feststellen, dass Erfahrungen, die sich zunächst wie persönliches Scheitern anfühlen, oft strukturell bedingt sind: »Es entsteht ein sehr intimer Gesprächsraum, wenn FLINTA*-Personen mit ähnlichen Geschichten aufeinandertreffen. Plötzlich versteht man, dass andere dieselben Probleme gehabt haben und es mögliche Lösungsansätze gibt.« Manchmal muss Netzwerken also auch in geschlossenen Räumen stattfinden, um für Personengruppen, die von Diskriminierungsmechanismen innerhalb einer Branche betroffen sind, eine Art Safe Space zu ermöglichen. Der Lösungsansatz: Solidarität statt Vereinzelung.
Eine Stellschraube im Tauziehen um mehr Teilhabe für alle sind möglichst offene und niederschwellige Zugänge. Michels Musikstammtisch versucht das durch Networkingevents mit WG-Party-Charakter. Seit bald zehn Jahren organisiert Michel Attia, Event- und Bookingchef bei Radio FM4, alle zwei Monate ein Netzwerktreffen in Wien. Zumeist im Wuk, nur zu Popfest-Zeiten wechselt der Stammtisch in das Lokal Ludwig und Adele am Karlsplatz. Eingeladen dürfen sich von der neugegründeten Garagenband, über Musikmanager*innen und -journalist*innen bis hin zu Labelchef*innen alle fühlen, die mit Musik zu tun haben – egal ob professionell oder als Hobby. So können Menschen, die sich an unterschiedlichen Punkten ihrer Musikkarriere befinden, miteinander in Austausch treten.
»Niederschwellig bedeutet bei mir auch, dass es keine Vorträge, keine Konzerte, keine
Für Michel Attia ist beim Musikstammtisch vor allem eine ungezwungene Atmosphäre entscheidend.
DJ-Sets und keine Paneltalks gibt«, erklärt Attia. »Es klingt absurd, aber mir kommt vor, dass Menschen, die sich mit Musik beschäftigen, beim Musikstammtisch möglichst wenig mit Musik zu tun haben wollen.« Sein Konzept sei es daher zu socializen, ohne dass die
seit der Gründung im Frühjahr erhalten hat. Bis Jänner 2026 ist das Programm bereits fixiert, die Ausstellungen wechseln wöchentlich. Diese Resonanz spricht für sich und zeigt einmal mehr auf, was eigentlich längst klar sein sollte: Die Kultur- und Kreativbranche, in der Vereinzelung und Ellbogentaktik aktuell zur Tagesordnung gehören, kann von offenen Vernetzungsorten nur profitieren. Ines Frieda Försterling vom Vinzenz ist überzeugt, dass damit auch die ständige Angespanntheit in der Kunstszene abnehmen würde. Bisher entstehen diese wichtigen Begegnungsräume aber immer auf Eigeninitiative von Betroffenen. Sie werden aus der Notwendigkeit heraus ins Leben gerufen und durch ehrenamtliche Arbeit erhalten. Der Bedarf ist jedenfalls gegeben, wo bleiben also die Mittel? »Gleiche Startbedingungen für alle!« – so stellen sich Friedel und Hasenhütl vom FC Gloria eine utopische Variante des Networkings vor. Bis diese Utopie in unserer neoliberalen Gesellschaft Wirklichkeit wird, braucht es Räume, in denen Vernetzung nicht strategisch, sondern solidarisch gedacht wird. Denn der Mensch ist schließlich ein Herdentier, die Vereinzelung steht uns nicht gut zu Gesicht
»Meine Networkingutopie wäre: Rooftop, gutes Wetter, Essen, Getränke – am allerliebsten noch ein Schokobrunnen!«
— Michel Attia
Arbeit explizit Thema werden müsse. »Wir inszenieren uns eh schon genug in der Musikbranche. Bei einem Branchenevent kann man das ruhig mal zur Seite schieben, sich entspannen und eine gute Zeit haben.«
Gegenseitig bestärken
Auch FC Gloria ist ungezwungener Austausch ein Anliegen: »Wir brauchen nicht nur Orte, die funktional sind, sondern auch solche, wo wir unsere Arbeit sehen, darüber sprechen, uns gegenseitig stärken können«, befindet Friedel. Denn das sei sowieso viel erfolgsversprechender als der krampfhafte Versuch, eine bestimmte Person kennenzulernen. Im Vinzenz merkt man den hohen Bedarf an niederschwelligem Ausstellungsraum an den unzähligen Einreichungen, die das Team
und gerade in einer Branche, die eigentlich vom kreativen Austausch und vom Grundinteresse an unterschiedlichsten Lebensrealitäten zehrt, sollte Kollaboration mehr wiegen als Konkurrenz. Helena Peter
Die nächste Ausgabe von Michels Musikstammtisch findet am 25. September im Wuk statt. Weitere Infos gibt’s auf Facebook und Instagram. Das Ausstellungshaus Vinzenz hat in seiner Instagram-Bio einen dauerhaften Open Call verlinkt. In der Vinzenzgasse 24 in Wien finden wöchentlich Ausstellungseröffnungen statt. FC Gloria unterstützt filmschaffende FLINTA*-Personen mit diversen Angeboten. Im Herbst wird ein Chor als neuestes Netzwerkprojekt gelauncht. Weitere Infos unter www.fc-gloria.at.

Content: Creator*innen produzieren, was User*innen konsumieren.
Kunst lebt von Anerkennung. Soziale Medien wie Youtube, Instagram oder Tiktok bieten ihr dafür eine Bühne – eine Bühne, die zugänglicher und größer ist als alle anderen zuvor. Die beiden Content-Creator*innen Grindig und Cloudhead über ihren Beruf, wie sie damit Geld verdienen und warum Posten Kunst ist. ———— Wenn man sich die Views von online geteilten Videos ansieht, wirken zwei- bis dreitausend manchmal lächerlich wenig. Doch wenn man sich diese Anzahl an Menschen an einem Ort vorstellt, sieht das schon ganz anders aus. Von solchen Publikumsgrößen können viele Künstler*innen nur träumen – in den sozialen Medien sind sie aber tagtäglich Realität. Christoph Huber ist seit drei Jahren unter dem Namen Grindig als Content-Creator von Comedy- und Satirevideos auf Tiktok
(@grindig, 64.600 Follows) sowie Instagram (@_grindig_, 43.300 Follows) tätig. Bamlak Werner ist neben ihrer Tätigkeit als Sängerin, Gesangslehrerin und ORF-Moderatorin seit 2020 auch als Cloudhead auf Tiktok (@__cloudhead_, 524.400 Follows) sowie Instagram (@_cloudhead__, 26.800 Follows) unterwegs. Dort postet sie Feelgood- und relatable Content. Auf Youtube teilt sie zudem ihre Lieder und Musikvideos. Außerdem berät sie Kleinbetriebe und Künstler*innen bezüglich Marketing auf Social-Media-Plattformen.
Sowohl für Werner als auch für Huber ließ sich der Start auf Tiktok rasant an. Bei beiden gingen die ersten Videos sofort viral, was ihnen den Mut und die Energie gab, diesen Weg
»Der DopaminRush des Gesehenwerdens – der ist auch gefährlich.« — Bamlak Werner
Die Produktion von Onlineinhalten ist oft aufwendiger als vermutet.
»Social-Media-Content-Creation ist eine direkte Reflexion der Kultur. Es geht gar nicht noch direkter.«
— Christoph Huber
weiterzuverfolgen. Während der Lockdowns waren die Möglichkeiten, Kunst und Kultur auszuleben sowie zu teilen, stark reduziert. Social-Media-Plattformen boten da für viele eine Alternative. Gleichzeitig gab es damals noch nicht so viele Content-Creator*innen in Österreich – eine Lücke, die sich aber zusehends füllt. »Wir Künstler*innen leben auch für die Anerkennung. Soziale Medien waren die neue Bühne für mich«, meint Werner. Ihr erstes Video hat sie gepostet, um eine persönliche, frustrierende Erfahrung zu teilen – viele der User*innen konnten sich damit identifizieren. Werner wurde bald danach von einem Berliner Management unter Vertrag genommen. Hier gab es zwar schnell ganz gutes Geld, doch die Belastung stieg ebenfalls, weshalb Werner sich zunehmend in Richtung Beratungstätigkeiten im Bereich Social Media bewegt. »Der Dopamin-Rush des Gesehenwerdens – der ist auch gefährlich.«
Doch wie finanzieren sich Creator*innen eigentlich? So direkt wie in manch anderen Ländern funktioniert das hierzulande nicht. Tiktok hat etwa eigentlich einen sogenannten »Creator Fund«, der an berechtigte Accounts je nach Views Geld ausschüttet. ContentCreator*innen aus Österreich gelten aber generell nicht als berechtigte Accounts – auch wenn es hier kreative Umgehungsmöglichkeiten gibt, als Creator*in doch an dieses Geld heranzukommen. Was es jedenfalls gibt, sind Sponsorings, Werbeanzeigen, AffiliateMarketing, Kooperationen, Crowdfunding wie zum Beispiel über die Plattform Patreon und den Verkauf von eigenen Produkten sowie Merchandisingartikeln. Zudem können Social Media auch als Sprungbrett für andere Formate und Medien dienen.
»Eine Frage des Erfolgs« Huber meint, er habe vor allem Glück gehabt. Sehr früh schon habe er von einer Bank ein Angebot bekommen. Das Experiment erfreute sich großen Zuspruchs und er eines regelmäßigen Einkommens. Daneben hat er auch eine Kooperation mit dem ORF für eine Tiktok-Reihe. Hier sei allerdings noch unklar, ob diese weiter bestehen wird: »Es ist immer eine Frage des Erfolgs.« Zwischendrin gibt es noch Einzelkooperationen mit Brands. Von
den vielen Anfragen der Unternehmen sucht sich Huber die wenigen aus, die seiner eigenen Marke am wenigsten schaden. »Wenn ich bissigen Satire-Content machen möchte, ist absolut jede Kooperation eigentlich ein Widerspruch zu dem Image, das ich haben will – aber am Ende des Tages muss ich was essen.« Und um wie viel Geld geht es dabei? »Die ganze Branche ist so überbezahlt, weil wir direkt in Kontakt mit den Unternehmen stehen. Ich kann an einem Tag je nach Video 11.000 Euro verdienen. The sky’s the limit. Und das ist pervers«, meint Werner.

Christoph
Huber aka Grindig
Doch wann gelten solche Summen in einem Kreativberuf wirklich als »verdient«? Braucht es das große Leiden, die institutionelle Anerkennung, eine akademische Ausbildung? Im Fall von Content-Creation und Influencer*innen meist nicht, während solche Assoziationen für traditionelle Kulturschaffende durchaus noch existieren. Doch das Marketing von Unternehmen verändert sich, die Budgets bewegen sich immer mehr hin zu Influencer*innen. Da gibt es eine größere Reichweite, genauere Metriken und es liegt auch einfach im Trend. Huber: »Es zählt nicht das Like, es zählt die Sekunde« – und die möglichst regelmäßigen Posts.

»Der Content ist eine Art Portfolio für potenzielle Kund*innen«, so der Tiktoker. Das gängige Prozedere? Firmen fr agen Influencer*innen oder ContentCreator*innen beziehungsweise ihr Management an, es gibt ein vorgeschlagenes Honorar sowie Spezifikationen für das Video. Diese Abmachungen basieren jedoch nicht auf einheitlichen Kriterien und müssen individuell ausverhandelt werden. Gerade wenn man erst anfängt, mit Sponsorings zu arbeiten, ist es dabei besonders schwierig, sich nicht unter dem eigenen Wert zu verkaufen, weil man keinen Maßstab oder Vergleich hat. »Alle haben die gleich schlechten Chancen. Es wird immer versucht, dich extrem runterzudrücken«, meint Huber.
Werner bemerkte einen Bruch rund um 2022, nach dem Tiktok plötzlich viel alltäglicher geworden sei: »Da kam dann aber auch plötzlich eine Menge Hass auf die Plattform. Tiktok ist ein gutes Abziehbild der Gesellschaft, dafür, wie sie sich entwickelt. Wir kommen immer mehr in die Superlative. Die Leichtigkeit ist weg. Das ist sehr schade.« In ihrer eigenen Community, die sich rund um Themen wie Selflove gebildet hat, merkt Werner dabei keinen großen Unterschied zwischen Instagram und Tiktok.
Auf die Frage, warum sie überhaupt Content erstellt und teilt, antwortet sie: »Menschen haben mehr denn je das Bedürfnis

angeht, verteile sich dieses aber sowohl bei ihm als auch bei Werner über Österreich und Deutschland. Huber: »Wenn Leute sehen, der Creator ist aus Österreich, schafft das schon eine auf einem gewissen Nationalstolz basierende parasoziale Beziehung. Meine Meinung ist, dass man sich sehr schnell eine Community aufbauen kann, wenn man die Menschen dort abholt, wo sie sind.« Dazu gehörten auch die Sprache, der Dialekt und gewisse Referenzen wie in Hubers Fall etwa auf das Wiener U-Bahn-Netz.
Content ist Kultur
»Social-Media-Content-Creation ist eine direkte Reflexion der Kultur. Es geht gar nicht noch direkter«, meint der Satiriker. »Ich sehe mich als Spiegel der Kultur, wie ich sie wahrnehme, komplett unzensiert.« Kurzvideos
»Du machst das nicht wegen des Geldes, sondern weil du etwas teilen möchtest.« — Bamlak Werner
nach Anerkennung, Wohlfüllen, Sicherheit. Der Aufstieg von Social Media ist vielfach ein verzweifelter Hilferuf von Generationen, die sich alle gleich leer fühlen. Ich möchte diese Verzweiflung verstehen.«
Im Vergleich zu Deutschland ist die österreichische Creator*innen-Community noch eher klein. »Ich fühle mich noch immer wie einer von wenigen«, erzählt Huber. »Es fehlt der starke Konkurrenzdruck durch zehn andere, die genau dasselbe machen wie ich.« Das liege nicht zuletzt an der begrenzten Größe Österreichs. Was das Publikum
und Trash seien eigene Kunstformen. Für Huber sei das, was er macht, seine künstlerische Erfüllung. Diese zu erreichen, ist in klassischeren Kunstbereichen oft schwer. Nicht selten wird dort nach Möglichkeiten der Niederschwelligkeit und des Zugangs gesucht. Die sozialen Medien würden hier vorlegen, so Huber. Sie hätten eine »Einfachheit, in der man so schnell kreativ sein und etwas aussprechen kann, was sich jeder irgendwie denkt«. Er selbst habe auf den virtuellen Plattformen seine Liebe zum Kurzfilm entdeckt –oder besser gesagt zur Kurzvideoform: »Alles
ist hier sehr visuell und aufmerksamkeitsheischend.«
Für Content-Creator*innen gibt es keinen festgelegten Karrierepfad, keinen Lehrberuf für Tiktoker*innen, keine Kunstuni für Instagram. Und das sei auch etwas Schönes, meint Werner: »Es gibt keinen anderen Beruf, wo du dein Handy nimmst, die Kamera anmachst und aus dir selbst schöpfst, ohne Qualifizierung oder irgendetwas. Was würde passieren, wenn wir uns diese Berechtigung, aus uns selbst zu kreieren, wegnehmen?«
Oft frage sie sich auch, ob Social-MediaArbeit eigentlich eine Form des kreativen Schöpfens, ob es Kunst sei. Ihre Antwort: »Eigentlich ja.« Werner sieht Social-MediaInhalte als kulturelles Gut und möchte sie auch als solches anerkannt wissen. Wenn Content-Creation als Kunst gesehen wird, sollte dafür zu zahlen normalisiert werden. Derzeit weichen zahlreiche Creator*innen, die keine Kooperationen mit Firmen eingehen können oder wollen, auf Patreon aus, um sich direkt über ihr Publikum zu finanzieren. »Cooler wär’s, wenn da der Staat hergehen würde und das nicht in der Verantwortung einzelner Personen bleiben würde. Ich habe ein wenig Sorge, wenn der Druck, Kunst zu erhalten, auf Individuen übergeht«, meint Bamlak Werner. Weder sie noch Christoph Huber sind derzeit auf Crowdfunding angewiesen, was die beiden Glück, Privileg und ihrem frühen Erfolg zusprechen.
Werner betont jedoch den Unterschied zwischen Content-Creator*innen wie ihr und Influencer*innen, die hauptsächlich einen Lifestyle verkaufen sowie Kooperationsposts mit Unternehmen veröffentlichen. Erstere seien für sie nämlich äquivalent mit traditionellen Künstler*innen in der analogen Welt: »Die meisten Content-Creator*innen, die ich kenne, wollen einfach nur ihre Sachen teilen, aber sie müssen trotzdem irgendwie Geld reinkriegen, und das ist, wo Influencing ins Spiel kommt.« Diese Unterscheidung ist Werner sehr wichtig, weil sie ihre Arbeit als kreatives Schöpfen versteht: »Ich hadere jeden Tag damit, dass das wirklich mein Beruf ist. Du machst das nicht wegen des Geldes, sondern weil du etwas teilen möchtest.«
Johanna T. Hellmich
Auch hierzulande wird die Relevanz von Social Media und deren wirtschaftliche Kraft immer größer, wie man auch an der Gründung des IAA Creator Hub Austria erkennt, der ersten Interessensvertretung für ContentCreator*innen und Influencer*innen in Österreich.
Riess macht vor, wie Handwerk, Nachhaltigkeit und gutes Design idealerweise ineinandergreifen – mit Töpfen aus Emaille, die nicht nur praktisch sind, sondern Geschichte erzählen. Und dabei zeigen, wie langlebiges Alltagsdesign heute aussehen kann. ———— Was in vielen Haushalten als nostalgischer Alltagsgegenstand gilt, ist längst im internationalen Designkanon angekommen: Riess-Töpfe. Weiß mit blauem Rand, himmelblau oder zitronengelb. Lange galten die Produkte des niederösterreichischen Familienbetriebs als unscheinbare Alltagsgegenstände – heute entdecken Designaffine aus aller Welt ihre Qualitäten neu. Seit 1922 produziert man in Ybbsitz in Niederösterreich Kochgeschirr aus Emaille. Dahinter steckt ein Unternehmen, das von Haltung geprägt ist. Gestaltung wird hier immer als integraler Bestandteil des Gesamtprodukts verstanden: funktional, langlebig, zeitlos – und dabei durchaus mit dem Anspruch, im Alltag Freude zu stiften. Dieser Zugang bringt Erfolg. Und er macht Riess zu einem Paradebeispiel für die Potenziale österreichischer Kreativindustrien abseits der Ballungsräume.
Creative Economy, lokal verankert
Die Geschichte von Riess ist auch eine Geschichte von Wandel und Weiterentwicklung. 1550 gegründet, ist der Betrieb seit 1690 in Familienhand, ab dem frühen 20. Jahrhundert spezialisierte man sich auf Emaille. Emaille, das klingt nach Tradition – und ist doch hochmodern. Bereits vor Jahrhunderten wurde das
Material für Schmuck verwendet. Es entsteht durch das Aufschmelzen von Glas auf Metall und kombiniert die Härte von Eisen mit den pflegeleichten Eigenschaften von Glas. Das Ergebnis ist schnitt- und kratzfest, leicht zu reinigen und langlebig. Bei Riess wird Emaille seit Generationen verfeinert: Die Rezepturen sind hauseigen, die Oberflächenveredelung erfolgt in mehreren Schritten. Die Farbpa-
Hier wird nicht für eine Galerie gestaltet, sondern für die Küche: einen Ort, an dem sich gutes Design bewähren muss.
lette ist dabei nicht nur dekorativ, sondern folgt auch funktionalen Überlegungen, etwa in Bezug auf Sichtbarkeit beim Kochen oder Hitzebeständigkeit.
Heute umfasst das Sortiment über 500 Produkte – gefertigt in Handarbeit mit eigenem Ökostrom aus Wasserkraft. Das Unternehmen ist tief in der Region verwurzelt, gleichzeitig international gefragt. Rund ein Viertel der Produktion wird exportiert, die
Nachfrage steigt, auch weil sich das Bewusstsein für ressourcenschonende Produktionsweisen verändert hat. Während viele Herstellbetriebe ihre Standorte verlagerten, blieb Riess in Ybbsitz. Qualität, so das Selbstverständnis, braucht Nähe – zu den Produkten, zu den Menschen und zum Prozess.
Handwerkliche Unikate
Hier, am Rande des Mostviertels, entsteht keine museale Handwerksromantik, sondern gelebte, marktfähige Kreativität: ein Betrieb, der mit Design Geld verdient, Arbeitsplätze schafft – und dabei zeigt, welche Chancen in regionaler Produktion liegen. Dabei war dieser Weg keineswegs selbstverständlich. In den 1990erJahren stand das Unternehmen wirtschaftlich unter Druck, die Globalisierung machte vielen Produzent*innen zu schaffen. Wie Geschäftsführungsmitglied Julian Riess 2018 gegenüber der Initiative Lobby der Mitte bestätigte, waren damals »schmerzliche Anpassungen notwendig«. Der Fokus auf Qualität, Regionalität und zeitgemäßes Design wurde dann allerdings zum entscheidenden Wendepunkt.
Wer die Produktion von Riess besucht, betritt eine Welt, in der Handarbeit und Technik ineinandergreifen. Die Arbeitsprozesse sind klar strukturiert, viele Handgriffe jahrzehntelang eingeübt. Die Wärme der Öfen hängt in der Luft, Tiefziehmaschinen arbeiten rhythmisch vor sich hin, während Werkstücke durch die Hände erfahrener Mitarbeiter*innen gehen. Diese 130 Menschen prägen nicht nur das Produkt, sondern


Der Aromapot (hier in Weiß) wurde in Kooperation mit dem Designstudio Dottings entwickelt.
auch ein Betriebsklima, das auf langjähriger Zusammenarbeit und großem Fachwissen beruht. Bei aller Effizienz bleibt Raum für handwerkliche Intuition – etwa beim Tauchen der Töpfe in die Emaille, wo ein Zehntelmillimeter über die spätere Optik entscheidet. So wird jedes Stück zum Unikat.
Übrigens: Auch die berühmten blauen Wiener Straßenschilder stammen aus Ybbsitz – ein kaum bekanntes, aber charmantes Detail der Firmengeschichte. Auf Anfrage werden die Schilder bis heute produziert. Zu erkennen sind die Originale in der ganzen Hauptstadt an der betriebseigenen Farbe »Wiener Blau«. Küche statt Galerie
Die Gestaltung der Riess-Produkte orientiert sich an einem klaren Prinzip: Form folgt Funktion. Die Linien sind reduziert, die Oberflächen glänzend, die Farben präzise gewählt. Dabei geht es nicht um dekorative Spielereien, sondern um Klarheit im Gebrauch. Gutes Design wird hier nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Einladung zur Nutzung – schlicht, robust und ästhetisch zugleich. Diese Eigenschaften sollen nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich gegenseitig bedingen. Die Form dient stets der Funktion –sie erleichtert das Kochen, macht das Stapeln effizienter oder sorgt für ein angenehmes Griffgefühl. Diese konsequente Umsetzung verleiht den Produkten nicht nur Zeitlosigkeit, sondern auch emotionale Langlebigkeit: Wer einmal mit einem gut ausbalancierten Schöpflöffel hantiert hat oder bemerkt, wie präzise ein Deckel sitzt, will selten zu etwas anderem zurück. Hier wird nicht für eine Galerie gestaltet, sondern für die Küche: einen Ort, an dem sich gutes Design bewähren muss.
Dass Emaille heute wieder gefragt ist, liegt auch an einem anhaltenden Retrotrend: Schlichter Look, sichtbares Material und die Erinnerung an Großmutters Küche treffen den Nerv einer Generation, die sich nach Beständigkeit sehnt. Auf Social Media tauchen die Töpfe in durchgestylten Küchenfeeds auf. Stilvoll arrangiert auf offenen Regalen und flankiert von fermentierten Karotten sowie drapierten Leinentüchern. Riess reagierte darauf mit einer behutsamen Öffnung: Limited Editions, Sonderfarben, Designkooperationen.
Dabei bleibt die gestalterische DNA des Unternehmens stets klar erkennbar. Jedes neue Produkt soll das Bestehende verbessern, nicht ersetzen. In den letzten Jahren hat Riess verstärkt mit externen Designerinnen, Gestalterinnen und Akteurinnen aus der Kulinarik kooperiert. Eine besondere Zusammenarbeit entstand mit dem Designstudio Dottings, mit dem unter anderem der universell einsetzbare Aromapot entwickelt wurde – ein Stück mit vielen Funktionen: Topf, Kasserolle, Pfan-
ne und der umgedrehte Deckel kann als Untersetzer oder während des Kochens als temporäre Schlüssel verwendet werden.
Branche im Wandel
Längst hat Riess die Grenzen Österreichs hinter sich gelassen. Auch renommierte Magazine wie Architectural Digest haben das Emaille aus Ybbsitz entdeckt. Trotz des Erfolgs ist der Manufakturbetrieb aber nicht frei von Herausforderungen. Steigende Energiepreise, globale Lieferkettenprobleme und der zunehmende Fachkräftemangel stellen auch Riess vor neue strategische Herausforderungen. Emaille verlangt hohe Temperaturen, hat dadurch einen hohen Energiebedarf. Die Produktion kann also nicht wie ein Haushalt im Winter sagen: Heute wird weniger geheizt. Gerade deshalb setzt man in Ybbsitz konsequent auf erneuerbare Energien: »Wir haben vier Wasserkraftwerke und können überschüssigen Strom ins Netz einspeisen«, so Geschäftsführer Friedrich Riess gegenüber der Tageszeitung Der Standard.
Auch der Aufbau junger Fachkräfte ist Teil der Zukunftsstrategie. Riess kümmere sich um Sonderschulungen für Lehrlinge, kooperiere mit lokalen Bildungseinrichtungen und schaffe langfristige Perspektiven in der Region, so der Chef des Unternehmens weiter. Zugleich gebe es mittlerweile aber für den Werkstoff Emaille weder einen offiziellen Lehrberuf noch Fächer an technischen Schulen. Das Mostviertler Unternehmen ist daher eine der letzten Stützen dieser resilienten Produktionsweise.
Design, das bleibt?
Ihre Resilienz zeigt sich unter anderem darin, dass viele Kund*innen ihre Töpfe über Jahrzehnte nutzen. Viele Stücke werden vererbt und sorgen so auch für eine emotionale Langlebigkeit. Das klassische Emaillegeschirr spricht unterschiedlichste Generationen gleichermaßen an, ohne sich zu verstellen. In der Küche ist Riess kein Star, sondern ein stiller Begleiter. Und gerade deshalb funktioniert das Produkt – als Designobjekt, als nachhaltige Alternative, als wirtschaftlich tragfähiges Modell. Wer also wissen will, wie man kreative Arbeit marktwirtschaftlich verwertbar macht, muss nicht ins Silicon Valley schauen. Ein Blick ins Mostviertel genügt. Dort zeigt ein Familienbetrieb, wie viel Potenzial in einem Topf stecken kann.
Catherine Hazotte
Weitere Informationen zu Riess gibt es unter www.riess.at. Die Manufaktur kann nach Voranmeldung besichtigt werden.
Kreativität gilt als Währung der Gegenwart – doch welche Bedeutung hat sie tatsächlich im Zeitalter von KI, Content-Optimierung und ständiger Selbstvermarktung? Ein Essay. ———— Fragt sich irgendjemand in Anbetracht von durchgefilterten Trendästhetiken und permanentem Selfbranding eigentlich, ob der Content, den wir alle tagtäglich »produzieren«, überhaupt noch irgendetwas mit uns selbst zu tun hat? Ob dieser Inhalt kreativ und originell ist – oder bloß das, was der Algorithmus eben ausspuckt, wenn man lange genug auf Sichtbarkeit optimiert? Ich frage mich das jedenfalls regelmäßig. Immer dann, wenn ich auf einen leeren Bildschirm starre und überlege, ob ich einen Gedanken wirklich zu Ende denken oder ihn doch lieber einmal schnell von Chat GPT vorformulieren lassen soll. Oder dann, wenn sich der Text, den ich gerade noch als »selbst geschrieben« empfand, bei näherem Hinsehen als gut geprompteter Remix entpuppt – zusammengesetzt aus halb gelesenen Theorien, dem Deep-Searchgestützten Wissensfundus des Internets und vielleicht ein paar vereinzelten individuellen Gedankenfetzen.
Prekär zur Käsesemmel
Klar, man könnte sich alldem entziehen. Boykott den bösen Großkonzernen, die unsere Hirnkapazitäten von KI frittieren lassen! Boykott den umweltzerstörenden Höflichkeitsfloskeln auf Chat GPT! Am besten gleich den Rückzug in den digitalen Urwald antreten, Offlinetagebuch schreiben und stattdessen wieder richtig denken. Aber, naja … Denn gleichzeitig stellt man sich damit selbst ein Bein – zumindest, wenn man sich in den »Creative Industries« bewegt oder »irgendwas mit Medien« macht. Sich der Gegenwart nicht zumindest ein bisschen auszusetzen, wäre ja fast schon fahrlässig. Wenn man ohnehin in prekären Arbeitsverhältnissen steckt, wo sich die 0,015 Euro pro Zeichen beim nächsten Billa-Einkauf in zwei Käsesemmeln und einen Eistee verwandeln – warum dann nicht die geistige Leere in Kauf nehmen? Vielleicht ist ja genau darin der Anfang einer neuen Form von Kreativität zu finden.
Doch was meinen wir eigentlich, wenn wir heute von »Kreativität« sprechen? Der Begriff selbst ist erstaunlich jung und gleichzeitig uralt aufgeladen.
Wer ihn historisch aufrollt, stößt zuerst auf Transzendenz: Schöpfung als göttlicher Akt oder das Kreative als Geschenk von außen, das dem Menschen durch Eingebung zuteilwird. Erst mit der Aufklärung wird das schöpferische Potenzial dem Individuum zugeschrieben und aus göttlicher Gnade wird Geniekult. Kreativität heißt nun: aus sich selbst heraus Neues hervorbringen. Im 20. Jahrhundert wandelt sich dieser Anspruch erneut. Kreativität wird zum individuellen Potenzial, das sich nicht mehr über göttliche Eingebung oder heroischen Eigensinn legitimiert, sondern oft gegen die Norm arbeitet: als Avantgarde oder Subkultur. Wer kreativ ist, will nicht dazugehören – oder wenigstens irgendwo anecken. Das kreative Subjekt provoziert und entwirft damit Möglichkeitsräume für neue, eigene Gedanken, die nicht dem normativen Einheitsbrei entsprechen.
»Was mit Medien«
Doch spätestens mit dem Übergang ins 21. Jahrhundert ist auch diese Vorstellung ins Wanken geraten. Kreativität wurde selbst zum gesellschaftlichen Imperativ. »Wer ›was mit Medien‹ macht, gehört zu einer viel beachteten Erwerbsgruppe«, schrieb Alexandra Manske bereits 2015 in ihrem Essay »Sternenstaub und Volkswirtschaft« in der Berliner Taz. »Lange galten Künstler als geniale Sonderlinge. Heute sind sie zu einem Rollenvorbild geworden.« Was einst als Ausbruch galt, ist heute ein Karrieremodell: Der kreative Mensch solle
»Die genialen Sonderlinge von einst wurden ideologisch vereinnahmt, ohne es zu merken.«
— Alexandra Manske, Soziologin
sich selbst verwirklichen und gleichzeitig gerne prekär arbeiten – Hauptsache mit Leidenschaft. Kreativität wurde von ihrer normkritischen Kraft entkoppelt und markttauglich gemacht. »Die genialen Sonderlinge von einst wurden ideologisch vereinnahmt, ohne es zu merken«, so Manske weiter. Aus dem kreativen Außenseiter sei dabei der »Kulturunternehmer« geworden, der für wirtschaftliche Erneuerung sorgen soll. Eine lebendige Szene gelte plötzlich als Standortvorteil. Gentrifizierung wird vom Vordringen der Kultur angetrieben. Die »Creative Class« liefert die Aura und wird dabei selbst unsichtbar gemacht.
Während KI-generierte Inhalte immer flüssiger, effizienter und scheinbar »kreativer« werden, stellt sich die Frage: Reicht ein gelungener Prompt schon als schöpferischer Akt? Wenn Prompts heute juristisch als geistiges Eigentum gelten, wird der kreative Prozess auf die Bedienung eines Tools reduziert. Das ist eine neue Form der geistigen Arbeit, ja, aber auch eine Entfremdung. Gleichzeitig fordern SocialMedia-Plattformen kreative Selbstverwirklichung im Sekundentakt – nur bitte möglichst authentisch. Doch wie echt kann etwas sein, das unter permanenter Beobachtung entsteht? Wie der Autor Eugene Healey kürzlich in einem Meinungsessay für The Guardian schrieb: »Das Internet hat die Bedingungen, unter denen echte Selbstdarstellung existieren kann, grundlegend verändert.« Die moderne Erfahrung sei, sich selbst von außen zu betrachten – »als etwas, das gemanagt werden muss«. Droht Kreativität zwischen Prompt und Selbstdarstellung zur Simulation zu werden?
Content statt Ausdruck?
Nicht unbedingt. Denn Kreativität muss nicht zwangsläufig unter KI und Kommerz leiden . Darauf weist Misha Verollet hin. Er ist Kreativstratege bei der Werbeagentur Kubrik, aber auch freier Autor, der lange außerhalb marktorientierter Kontexte gearbeitet hat. Der Unterschied liege oft weniger in der Qualität der Idee als in ihrem Rahmen. »Im Agenturkontext ist Kreativität vor allem eine Dienstleistung«, meint er. Das heißt: Kreative würden nicht für sich arbeiten, sondern für Kund*innen – und das sei kein Widerspruch zur künstlerischen Praxis, sondern eine andere Form von Verantwor-
tung. Gute Ideen könnten auch unter einer Auftragslogik entstehen. Kreativität sei hier nicht Ausdruck von Innerlichkeit, sondern gutes, solides Handwerk und damit schon »eine Kunst für sich«. Verollet betont, dass gerade kluge Marken die Perspektiven ihrer Gestalter*innen nicht nur zulassen, sondern aktiv einfordern würden – und dass sie so kreativen Spielraum auch in der Werbung ermöglichten. Vielleicht geht es also weniger darum, ob Kreativität heute echt ist, sondern ob sie unter den gegebenen Bedingungen wirksam bleiben kann.
Und deswegen ist es möglicherweise auch gar nicht schlimm, wenn ich manchmal nicht
»Das Internet hat die Bedingungen, unter denen echte Selbstdarstellung existieren kann, grundlegend verändert.«
— Eugene Healey, Autor

weiß, ob der Gedanke, den ich da gerade aufschreibe, wirklich meiner ist. Könnte das heute die eigentliche kreative Bewegung sein? Sich durch die Tools und Zumutungen hindurchzutasten – in der Hoffnung, dass irgendwo zwischen Prompt, Post und Zweifel noch etwas aufleuchtet, das tatsächlich von mir kommt? Und wenn nicht, dann gibt es vielleicht auch noch ein Leben jenseits einer aufgesetzten Work-Life-Balance. Vielleicht beginnt Kreativität ja genau dort.

Ania Gleich
Weitere kritische Perspektiven dazu, wie sich Kreativität unter digitalen und ökonomischen Bedingungen verändert, finden sich in Alexandra Manskes Essay »Sternenstaub und Volkswirtschaft« bei der Berliner Taz sowie in Eugene Healeys Text »Gen Z and Gen Alpha Brought a Raw, Messy Aesthetic to Social Media. Why Does It Feel as Inauthentic as Ever?«.
AB 22. AUGUST IM KINO
INFOS UND TERMINE


Glasschleifer
Im Eingangsbereich der bereits 200 Jahre alten Glasmanufaktur Lobmeyr glitzert und funkelt es: hier moderne wie traditionelle Gläserdesigns, da zahlreiche Spiegel, dort prunkvolle Kronleuchter aus Dutzenden fein geschliffenen Glassteinen. In der darüberliegenden Werkstatt verleiht Glasschleifer Jürgen Mechura genau diesen Objekten in heikler Präzisionsarbeit ihren spektakulären Glanz. »Das schaut echt lässig aus«, meint er, während er die im Schliff entstehenden Details beschreibt. Als »lässig« könnte man auch Mechura selbst bezeichnen. Mit Dreadlocks, schwarzer Arbeitskleidung und einer Menge Liebe für seine Arbeit erzählt er, wie viel Gefühl für die Grob- und Feinschliffe sowie die diversen Poliergänge nötig sei. Sein Motto dabei: »je aufwendiger, desto interessanter«. Das sorge für einen gewissen Nervenkitzel. Aufgrund des Jobangebots von Lobmeyr entschied er sich gegen den Traum vom Musiker- und Lehrerdasein. Bereuen würde er das bis heute nicht, schließlich hätten ihn die vierjährige Ausbildung in einer Tiroler Glasfachschule, seine ruhige Hand und eben die Manufaktur zu Auftragsarbeiten für internationale Designer*innen sowie zum ein oder anderen Staatsempfang in die Hofburg gebracht.

Porzellandesignerin
In den wunderschönen, alten Räumlichkeiten einer ehemaligen Wiener Herrenschneiderei steht Sandra Haischberger inmitten von Porzellan, das sich fast bis hinauf zum prunkvollen Stuck der Decke stapelt. Der Grundstein für alles, was hier heute zu sehen ist, war vor zwanzig Jahren – nach einer Meisterklasse in Wien und einem Studium in London – die Idee für eine eigene kleine Manufaktur. Heute designt Haischberger in ihrem Keramikstudio namens Feine Dinge farbenfroh, kreativ und praktisch. Das liegt vor allem an ihrer Liebe zum Entwickeln neuer Entwürfe und am Ansatz, ihre Stücke stets alltagstauglich und nachhaltig zu gestalten. In der Serie »Raw« haucht die Designerin etwa alten und zuvor eingefärbten Porzellanmasseresten ein zweites Leben in neuen Kreationen ein. Um anderen Menschen einen Einblick in ihre Arbeit zu geben, kombiniert sie Werkstatt und Geschäft an einem Ort. So sei es einfacher, den Kund*innen ihre Philosophie von handgefertigten Stücken mit deren kleinen Unregelmäßigkeiten und Formfehlern zu erklären. Die daraus entstehenden »verzogenen Häferl« stehen für die Schönheit dieser Individualität – und sind gleichzeitig ein echter Hingucker für jeden Frühstückstisch.

Zwischen Tankstellen, Autobahnbucht, Abschleppwagen und nächtlichen Zugfahrten –Antonia Löffler erzählt in ihrem Text von einer bewegten Pannenodyssee, die durch die sinistren Zwischenräume des Alltags führt. Eine Suche nach Sicherheit und Ankommen inmitten stürmischer Zeiten.
Über dem Wienerwald färbt sich der Himmel rot. Das bringt das Grün der Tankstelle zur Geltung. Die letzte Tankstelle vor der Autobahn. Die Preise auf der großen Tafel kommen näher. 2,40 für den Liter Diesel. Niemand hält hier an, außer er muss. Ich muss. Auf dem Armaturenbrett ist eine Lampe angesprungen, das Auto sagt: Motoröl Fehler – Werkstatt aufsuchen. Ich gieße Kühlflüssigkeit nach, das hilft bei dem alten Wagen meistens. Ich tätschle das blaue Blech und fahre weiter. Die Frühlingsnacht kommt schnell, die Bäume fliegen schwarz unter dem verglimmenden Himmel vorbei. Ich muss meinem Freund vorschlagen, nächste Woche den Zug zu nehmen. Es stellt sich heraus, dass das Gefühl nachts am Rand der Autobahn dem Gefühl ähnlich ist, das ich als Kind unter dem Esstisch hatte, während ich den Erwachsenen zuhörte. Sie erklärten einander die Welt und vergaßen darüber meine Anwesenheit. Ich sitze in meinem Wagen in der Dunkelheit. Hinter mir steht ein hoher Siloturm. Ich habe alle Fenster verriegelt und alle Lichter abgedreht, seit mich der ÖAMTC-Mann vor einer Stunde auf diesen Parkplatz gelotst hat. Bei Kilometer 14,3 war die Fahrt zu Ende, das Lämpchen hatte wieder geblinkt, diesmal hektischer. Daneben ein neues Zeichen: mein Auto an einem Haken.
Hinter der Absperrung ziehen Lichtbalken vorbei, manchmal die obere Hälfte eines Lkws. Keiner sieht mich und ich sehe die Sterne über mir. Mein Freund sagt am Telefon, dass er fasziniert ist, wie viele Versicherungen ich besitze. Ich sage: Haushalt, Auto, Zusatzkrankenversicherung, Pensionsvorsorge, gar nicht so viele. Er sagt: Ich habe weniger. Ich sage: Meine Familie mag Versicherungen. Aber lieber als diese Versicherungen hätte ich eine gegen die Angst vor dem Sturm und vor der Dunkelheit,
und gegen die Angst vor dem Triebtäter, der gleich an die Scheibe klopft. Er sagt: Du bist viel sicherer dort auf deinem Parkplatz als auf der Autobahn.
Ich sitze neben dem Mechaniker in der Fahrerkabine des Abschleppwagens. Er hat mein Auto auf die Ladefläche geschnallt und mich wählen lassen: hinten alleine oder vorne bei ihm. Er hatte mich zuerst übersehen, dort neben dem Silo, weil alle meine Lichter aus waren. Ob mir schon kalt gewesen sei, fragt er, als wir losfahren. Ob bei ihm weniger los sei als sonst, frage ich zurück. Wegen der Tankpreise und wegen des Kriegs. Er hat ein kreuzartiges Tattoo auf dem Rücken der Hand, mit der er den Schaltknüppel bedient, und die Stimme eines Fernsehmoderators, die nicht zu ihm passt. Er lacht, als hätte ich einen Witz gemacht, den er bereits kennt. Es ist alles wie immer, sagt er. Acht bis zwölf Panneneinsätze habe er am Tag, heute auch. Alles wie immer. Aber wir können nachsehen, sagt er und zeigt auf den weißen Bildschirm von der Größe eines Notizblocks, der in der Mitte montiert ist. Die Auftragsliste ist leer. Sehr gut, sagt der Pannenfahrer, gerade wartet keiner auf mich. Er fährt mich zurück nach Wien, wo ich vor zwei Stunden aufgebrochen bin. Er fragt noch einmal, ob ich wirklich kein Ersatzfahrzeug will, um nach Linz zu kommen. Es wäre in meiner Versicherung inkludiert. Nein, danke, sage ich, ich glaube, heute Nacht wäre ich ein Risiko.
Die Menschen am Bahnhof Meidling ducken sich weg vom Sturm, der kalt in den Schacht der Station bläst. Wenn die Rolltreppe einen weit genug hinuntergetragen hat, wird es langsam windstill. Dafür riecht die Kälte hier nach Urin. Ein Mann mit weißen Haaren redet mit sich selbst und wird ignoriert. Ein Sicherheitsmitarbeiter erzählt seinem Kollegen eine Geschichte und flucht dabei
laut. Gruppen junger Männer, fast noch Kinder, ziehen über die Bahnsteige, sie sind nicht aus Österreich, sie scheinen von weither gekommen und haben nur einander als Begleitung. Die Menschen starren hoch auf die blaue Anzeigetafel, der Nachtzug nach Zürich ist pünktlich. Als ich einsteigen will, höre ich laute Stimmen aus dem rechten Wagon und entscheide mich für den linken. Du fährst nirgends mehr hin, schreit eine Männerstimme, du steigst jetzt aus. Ich höre keine Antwort mehr, während ich durch den Gang mit Abteilen gehe. Später kommt eine Durchsage. Leider habe der Zug Aufenthalt, leider sei ein Polizeieinsatz notwendig. Die Stimme klingt entnervt. Vor meinem Fenster laufen junge Männer den Bahnsteig entlang. Es sind andere als zuvor. Hast du deinen Zug erwischt?, fragt mein Freund am Telefon. Ja, sage ich, aber jetzt sind wir eine Viertelstunde gestanden, Polizeieinsatz. Einer musste aussteigen, ich habe im Vorbeifahren die Polizisten gesehen, mindestens zehn Männer in Uniform standen um einen ohne. Ich verpasse meine Haltestelle. Die Schuld liegt bei der Haltestelle. Die Haltestelle von Leonding ist so unsichtbar wie ich in meinem Wagen nachts am Rand der Autobahn. Die Haltestelle von Leonding ist ein schwarzes Feld und schon wieder vorbei. Ich steige beim nächsten schwarzen Feld aus, das ist Pasching. Ich gebe auf und rufe das örtliche Taxiunternehmen, Taxi Wondrak. Es ist kurz vor Mitternacht. Die Sterne sind jetzt alle draußen. Das Sammeltaxi kommt und der Fahrer sagt mit einem Blick auf den Fahrgast neben sich: Ich führe noch schnell den Kollegen heim, und dann dich. Ich habe kein Zuhause, sagt der Fahrgast, ich habe nur einen Tschickautomaten. Wir kommen zum

Antonia Löffler, geboren 1991, studierte Jus sowie Vergleichende Literaturwissenschaft und bog vor dem Gerichtsjahr in den Journalismus ab. Sie arbeitete als Wirtschaftsredakteurin für Die Presse und war Gestalterin einer Ö1-Literaturreihe. Heute ist sie freie Autorin bei Ö1 und schreibt daneben an eigenen Texten. Ihr erster Roman »Hydra« erscheint im September im Milena Verlag. Mehr zur Autorin unter www.antonialoeffler.com.
Tschickautomaten. Er ist außer Betrieb, also gibt ihm Wondrak eine der Zigarettenpackungen aus seinem Handschuhfach.
Ein Freund?, frage ich, als der Mann ausgestiegen ist und sich bei uns verabschiedet hat, als wären wir gemeinsam auf einer sehr guten Party gewesen.
Ein Stammgast, sagt Wondrak, ein Kellner, arbeitet draußen bei der Plus City. Der fährt jeden Abend mit mir heim. Wondrak ist ein stämmiger Mann mit weichen Augen. Vielleicht heißt er gar nicht so, vielleicht ist er der Mitarbeiter von Wondrak.
Bei euch sieht man viel mehr Nacht in der Nacht, sage ich.
Ja, wir sind schon am Land, das ist was anderes als in der Stadt, sagt Wondrak, während wir über dunkle Landstraßen fahren.
Ist viel los?, frage ich.
Freitag eigentlich immer, sagt er. Ist mir auch lieber so, sagt er, mit Pausen ist die Nacht mühsamer.
Wondrak drückt mir die Visitenkarte seines Unternehmens in die Hand, fürs nächste Mal. Er wartet, bis ich den Schlüsselkasten gefunden habe. Dann winkt er zum Abschied. Ich winke zurück. Neben mir zittern die Lamellen der Jalousien. Der Sturm ist stärker geworden. Ich sperre die Tür auf.
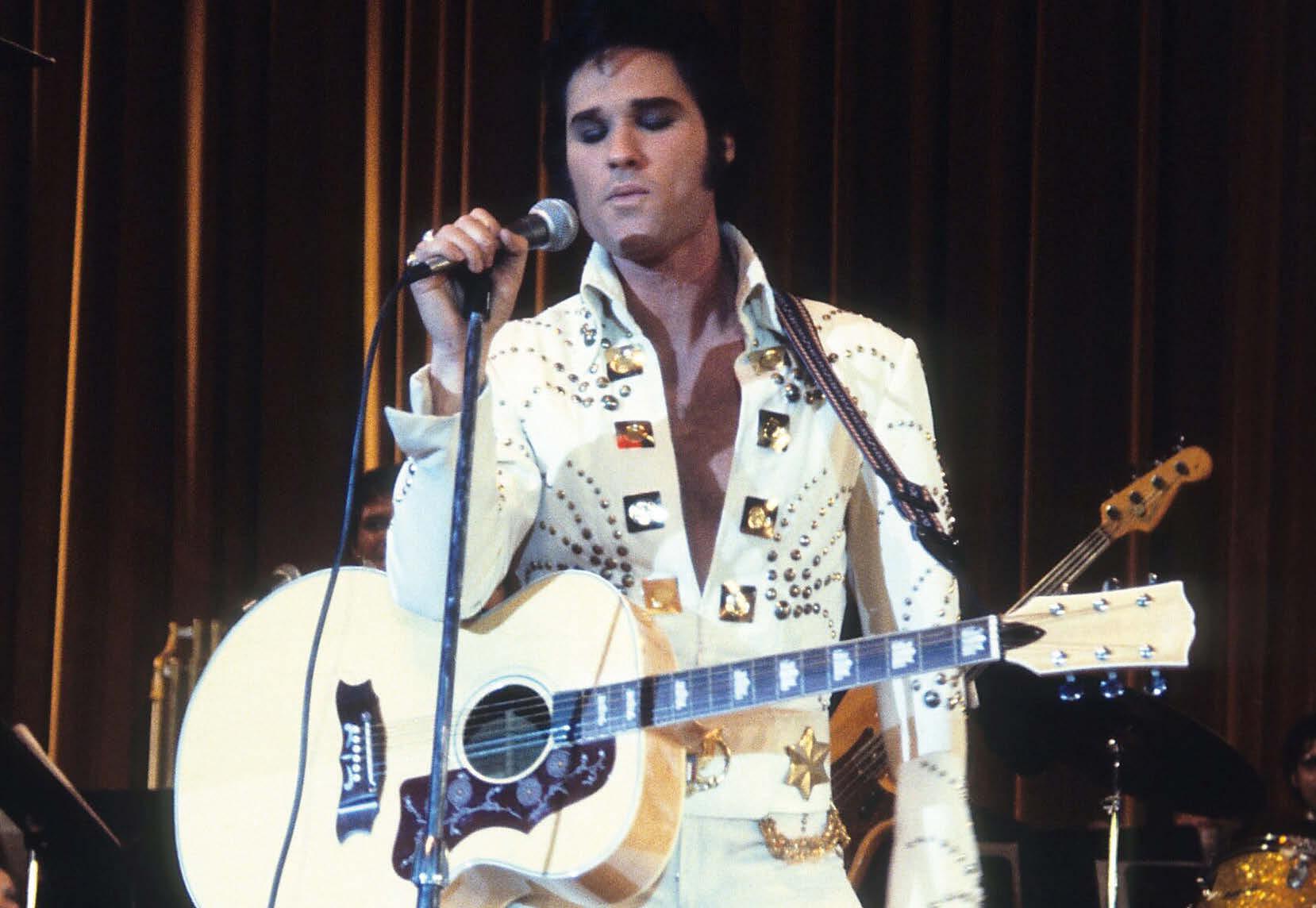







Von 4. September bis 16. Oktober zeigt das Filmmuseum das Gesamtwerk des Horror-, Science-Fiction- sowie Actionthriller-Großmeisters John Carpenter (»Halloween«). Zu sehen ist auch »Elvis«, ein TV-Film von 1979, in dem Carpenters Lieblingsschauspieler Kurt Russell (fulminant!) den King of Pop gibt. Ein Film abseits des Genrekinos.
Fr., 5. September, 18 Uhr
Mi., 1. Oktober, 20:30 Uhr Filmmuseum
Augustinerstraße 1, 1010 Wien
Wir verlosen je 10 � 2 Tickets für die beiden von The Gap präsentierten Screenings von »Elvis« im Rahmen der Retrospektive »John Carpenter – Das Gesamtwerk« im Filmmuseum.
Gewinnspielteilnahme bis 2. September unter www.thegap.at / gewinnen möglich.
In Kooperation mit
Teilnahmebedingungen: Die Gewinnspielteilnahme kann ausschließlich unter der angegebenen Adresse erfolgen. Die Gewinner*innen werden bis 3. September 2025 per E-Mail verständigt. Eine Ablöse des Gewinns in bar ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter*innen des Verlags sind nicht teilnahmeberechtigt.
Die Sauce »Nur a bissi Schaf« ist trotz des Namens auf jeden Fall hot stuff. Immerhin hat sie Gold bei den European Hot Sauce Awards 2025 gewonnen. Außerdem aus der Kollaboration zwischen Content-Creator Austriankiwi und Chili-Champ Tommy Hlatky hervorgegangen: »Nix für’n Kindergeburtstag« und »Geh leck mi am Arsch«. In der Austriankiwi-Dreierbox ist damit für jeden Chili-Head etwas dabei. Wir verlosen drei Boxen.
2 Mieze Medusa »Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es genauso gemacht«
Die Rapperin und Pionierin des Poetry-Slams in Österreich fügt ihrem vielfältigen Werk nach »Freischnorcheln« (2008), »Du bist dran« (2021) und »Was über Frauen geredet wird« (2022) einen weiteren Roman hinzu. Humorvoll und aus feministischer Perspektive erzählt Mieze Medusa von Mut, Zusammenhalt und dem Guten in falschen Entscheidungen. Wir verlosen drei Exemplare.
3 Timo Blunck »Ein kleines Lied über das Sterben« und »Der Schlaf Fotograf«
Mit spannenden Twists, schwarzem Humor und schrillen Charakteren unterhält Timo Bluncks Package aus Indie-Trash-Krimi und Begleitalbum sowohl Literatur- als auch Musikliebhaber*innen. Der Musiker (und Autor) veröffentlicht nämlich gleichzeitig den Roman »Ein kleines Lied über das Sterben« sowie den Longplayer »Der Schlaf Fotograf« mit drei Songs, die auch im Buch vorkommen. Wir verlosen drei Packages.
4 Fabian Navarro »Vienna Falling«
Irgendwo zwischen Krimi, Netflix-Serie und Stephansdom bewegt sich der Debütroman des erfolgreichen Poetry-Slammers Fabian Navarro. Eine Frau sucht ihren verschollenen Mann und stößt dabei auf Unerwartetes. Aluhüte aufgesetzt! Wer schon immer mal in die (wortwörtliche) Wiener Unterwelt abtauchen wollte, kommt hier auf seine Kosten – und kann sich auf Gänsehaut gefasst machen. Wir verlosen drei Exemplare.
5 »Badespots« und »Wien originell« Reif, aber nicht schon wieder für die Insel? Rechtzeitig zur Sommerhitze versammelt »Badespots«, der elfte Band der Wild-Urb-Places-Reihe, 43 weniger bekannte Naturbadeplätze. Der zwölfte mit dem Titel »Wien originell« wiederum lässt sogar alteingesessene Bewohner*innen anhand von dreißig skurrilen Orten über Österreichs Hauptstadt staunen. Wir verlosen drei Packages mit je einem Exemplar.


»Authentisch und kein Arschloch zu sein, find ich wichtig.« Damit beschreibt Anda Morts den Ansatz seiner Musik ziemlich treffend. Der Punkrocker versucht auf seinem D ebütalbum »Ans«, weder unsere Welt zu romantisieren noch lange drum herumzureden. Er nimmt die Dinge lieber, wie sie sind. Für seinen explosiven Indiepunkrock schöpft der Linzer aus persönlichen Lebensbetrachtungen und Gefühlslagen, einer Menge Humor, der gewissen »Fick dich«-Mentalität sowie einer gesunden Prise Gleichgültigkeit.
Sein Album »Ans« behandelt dabei die unterschiedlichsten Geschichten und Themen, etwa Gemächlichkeit beim Prokrastinieren oder die nicht so glamourösen Seiten des Tourneelebens. Der Songtext zu »Fascho« nimmt wiederum das ewig große Ego rechter Recken auseinander – untermalt von schnellen Beats und kratzigen Gitarren. In »Kein Bock« hat der Musiker keine Lust mehr auf misogyne Papisöhnchen und gelackte Crypto-Bros in Tesla- oder BMW-Karossen. »Sie« und »Lied 19« zeigen eine nachdenklichere Seite von Anda Morts, während er über manic pixie dream girls sowie das Hin-und-hergerissen-Sein sinniert. Durchzogen ist das alles von schrillen Gitarrenklängen, lässiger Stimme, wilden Drum-Lines sowie Synthesizern, die an NDW-Legenden wie Ideal oder Spider Murphy Gang erinnern. Mit den Songs »Bett« und »Freitag« beweist Anda Morts außerdem, dass er Humor hat und man sich eben auch nicht zu ernst nehmen sollte. Lyrics wie »mein Bett ist freundlich« beschreiben beispielsweise die innige Freundschaft zum eigenen Wohlfühlort fürs Schlafen, Gammeln, Schnarchen und das herrliche Nichtstun. Mit »Nikotin« geht es im klassischen Stil des Punk weiter. Aber nicht nur in der Musik, sondern auch im Text: »Ohne mich bist du im Arsch, aber mit mir leider auch …« Tja, so ist das eben. Mit solch humorvollen Lebensweisheiten, seiner dezent auf Krawall gebürsteten Musik und seiner herrlichen Ehrlichkeit spricht Anda Morts wohl allen in ihren Zwanzigern und darüber hinaus aus der Seele. (VÖ: 19. September) Luise Aymar

Alles Exhausted
Siluh Records

Eine Erkenntnis, deren Nachrichtenwert sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegt wie die Blutspiegel bei der beliebtesten Coping-Strategie – nämlich im einstelligen Promillebereich: Das Leben im Jahr 2025 ist eines der härtesten, der erschöpfendsten. Wer da noch den Blick nach vorne wagt, bekommt im Genick nicht nur einen metaphorischen Ermüdungsbruch. Der Blick nach unten hingegen – in der Pop-Prosa Bewanderte werden gleich aufschreien – lohnt sich stattdessen immer. Wer jetzt »Shoegaze!« schreit, hat gewonnen. Auch die neue supere Supergroup aus Wien, Alles Exhausted, denkt sich beides, müde und Blick nach unten, und speist mit ihrem Debüt in Österreich ungehörten Shoegaze in die digitalen Ausbeutungskanäle. Supergroup deshalb, weil Mitglieder schon bekannt: Culk, Pauls Jets, Fuzzybrains und Jansky heißen deren eigentliche Gruppen. Shoegaze deshalb, weil sich da breiige Soundwände und ziemlich schüchtern-zaghafte, teilweise kaum entzifferbar leise Vocals auftürmen und die Effektpedale gekickt werden wie überall sonst nur gesunde Menschenverstände. Das ist handwerklich alles sehr schön gemacht, passt alles ziemlich fein zusammen und ergibt in jeglicher Hinsicht einfach nur Sinn. Eine Band, ein Sound für ein Jetzt. »Hilf mir raus!«
Besonders schön: Die intrinsische Motivation, all die Unwegsamkeiten der Gegenwart aus sich herauszupressen und abzuschütteln, das Auferstehen aus Ruinen der welt- und persönlichkeitspolitischen Zermürbung spürt man dem Minialbum in jeder aufeinandergeschichteten Tonspur – und es sind viele! – an. Ein mattes »Hilf mir raus!« (aus: »Alles so verbraucht«). Aber irgendwie muss es weitergehen, auch wenn noch nicht klar ist, wie das überhaupt funktionieren soll, weil Müdigkeit und Erschöpfung sind irgendwie allein schon ein Fulltime-Job. Daher ist es auch nur konsequent, dass das Album gerade einmal sieben Stücke hat, keine 23 Minuten lang ist. Alles darüber hinaus wäre einfach nur weitere Überforderung. Und das ist so ziemlich das Letzte, was jetzt hier irgendjemand braucht. (VÖ: 5. September) Dominik Oswald
Live: 4. September, Wien, Flucc
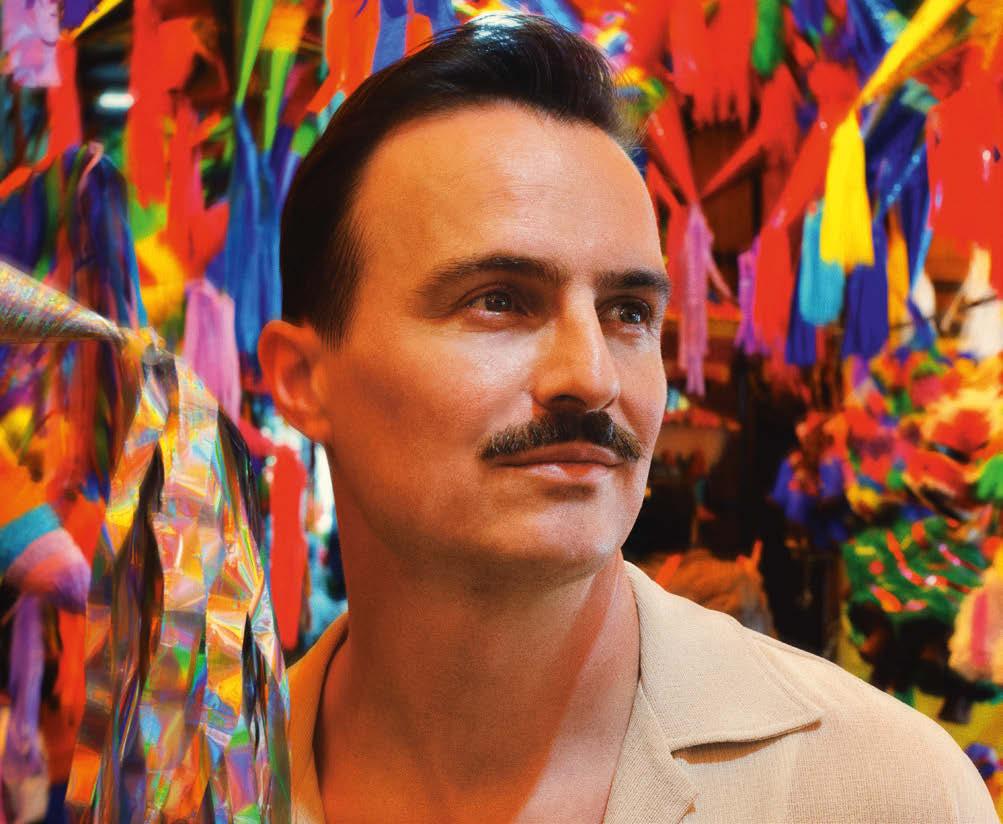

Cid Rims neues Album »Sprint« ist eine bewusste Öffnung in Richtung Freude und des Positiven an sich. Es klingt natürlich trotzdem vieldeutiger und musikalisch komplexer als ein Großteil dessen, was sonst so veröffentlicht wird. 2023 hat Clemens Bacher aka Cid Rim auf Einladung seines Lucky-Me-Labelkollegen Joseph Marinetti Mexico City besucht, ein paar Monate des darauffolgenden Winters dort verbracht – und sich ganz von der Stadt in den Bann ziehen lassen. Von den Boxklassen im Park, der Sonne, dem leichten Bier, dem guten Essen und dem kreativen Umfeld. Cid Rim ist ein extrem guter Schlagzeuger mit einem Hang zu verspielten Rhythmen, die er bislang als Basis nahm, um darauf elektronische Songs zu stellen. In Mexiko spielte er auf alten Rockdrums, verbreiterte das Instrumentarium und schrieb viele, viele Songskizzen, die er dann zurück in Österreich mit seinen guten Freunden Dorian Concept und The Clonious ausproduzierte. Mit dem deklarierten Ziel, dabei die Sonne und eine allgemeine Freude als treibendes Element nicht zu verlieren.
Wobei »Sprint«, wenig überraschend, bei allen Feelgood-Vibes und Pop als Referenz immer noch komplex ausgefallen ist: Einen Großteil der Songs bestimmen nicht der Text oder die (Gesangs-)Melodien, sondern weiterhin die verspielten Rhythmen, denen sich alles andere unterordnet. Als musikalische Referenzen geht es in Richtung SiebzigerFeelgood-Jazz, der immer wieder für lateinamerikanische Einflüsse offen war; ebenso nachvollziehbar fühlen sich andere an frühe AcidPartys erinnert. Und »Light Me Up« startet Feuer im Sinne eines »Firestarter«, wenn auch ganz sicher freundlicher, während »Limbo« auf keiner Indiepop-Party fehl am Platz wäre.
»Sprint« ist also ein klassisches Cid-Rim-Album geworden, auf dem sehr viel passiert und dessen Nummern weiterhin gleichermaßen Songs sind, wie sie musikalisch von anderen Genres und Richtungen ihren Ausgang nehmen. Wer dafür offen ist, findet einen Soundtrack für die heiteren Stunden des Sommers. (VÖ: 27. Juni) Martin Mühl
Live: 31. Oktober, Wien, Porgy & Bess


Das neue Album von Lizki trägt seinen Titel nicht zufällig. »Losing Grip in a Chaotic World« fragt nach Halt in einer Welt, die jegliche Haltung verloren zu haben scheint – und das im doppelten Sinn, moralisch wie emotional. Lena Britzelmair, die hinter dem Projekt Lizki steckt, antwortet darauf nicht mit Pathos, sondern mit dem wohl zeitgemäßesten Ausdruck für Überforderung: Hyperpop. Zwischen flirrenden Synthies, zersplitterten Rhythmen und klassischem Gesang entsteht der Soundtrack für ein Gefühl, das wir alle kennen, aber selten benennen: den diffusen Schmerz, in einer vernetzten Welt trotzdem isoliert zu sein. Lizkis Musik verwebt digitale Kälte mit menschlicher Wärme. Ihre klare, zugleich verletzliche Stimme trägt durch glitchende Beats, verzerrte Kicks und das, was ihr Mash-up aus Alt-Pop und Hyperpop im Kern ausmacht: gesteigerte Gefühle in Großbuchstaben.
Zartheit im digitalen Lärm
Doch statt sich im Lärm zu verlieren, bietet Lizki Struktur im Chaos. Ihre Songs geben dem Kontrollverlust eine Form, machen ihn tanzbar, zugänglich und damit fast tröstlich. Melancholie liegt über allem, doch sie flimmert dabei hinter Nebelschwaden und bunten Bühnenlichtern. Der Beat wird zum Orientierungspunkt, der sich im Club in flüchtige Momente zerstreut. Textzeilen schreien auf, dann flüstern sie. Manchmal scheint es, als würde Lizki uns direkt anschauen mit einem Hyperfokus auf die kleinen, rohen Wahrheiten, die im digitalen Strom untergehen. Ihre Musik hält kurz inne, wo sonst gescrollt wird. Zwischen Autotune und Synthie-Layern öffnet sich ein Raum für Zugehörigkeit oder zumindest für das Bedürfnis danach.
»Losing Grip in a Chaotic World« ist kein Manifest, sondern ein Spiegel. Es zeigt unsere Unsicherheiten, ohne sie auszuschlachten. Es will nicht retten, sondern begleiten. Und das ist vielleicht das Schönste daran: Dieses Album will gar nicht erklären, wie man den Halt wiederfindet. Es will nur kurz die Hand reichen, während wir gemeinsam durchs Chaos tanzen. (VÖ: 27. September) Ania Gleich


Nach mehr als zehn Jahren persönlicher und künstlerischer Entwicklung steht Mavi Phoenix nun an einem Punkt, an dem er in seiner eigenen Identität nicht nur gefestigt scheint, sondern diese gezielt inszeniert. Mit »Drama Cowboy« legt er ein Album vor, dass sich als kunstvolles Statement über Selbstbild und gesellschaftliche Erwartungen lesen lässt Zentrales Motiv ist die Figur des Cowboys – Sinnbild eines überzeichneten Männerideals, das Mavi Phoenix gezielt bricht und neu besetzt. Das Westernklischee dient aber nicht als romantisches Stilmittel, sondern als Kontrast zur eigenen Identitätsfindung. Es geht nicht um Authentizität im klassischen Sinne, sondern um das bewusste Spiel mit Rollenbildern und um die Freiheit, sich inmitten dieses Spiels zu behaupten.
Angelehnt an die Einteilung literarischer Dramen spaltet sich das Album in zwei Akte. Während der erste vor Energie, Tempo und Konfrontation nur so strotzt, schlägt der zweite ruhigere Saiten an und richtet den Blick auf den inneren Prozess. Drama funktioniert hier also auch synonym für allerlei Auseinandersetzungen. Anfangs spiegeln sich Rausch und Faszination dieser Konflikte wider, während danach die innere Leere und Reflexion übrigbleiben. »Drama is adrenaline, addictive […] but what I’ve learned is, letting go is power«, heißt es an einer Stelle, was die Zweischneidigkeit des Themas knapp zusammenfasst.
Diese Dualität hat auch eine musikalische Entsprechung auf dem Album: Zum Einstieg gibt es Upbeat-Melodien mit viel Elektronik bis hin zum Hyperpop, während der Ausklang von melancholischeren SynthieBeats begleitet wird. Zu den gewohnten Soundwelten von Mavi Phoenix gesellen sich diesmal – passend zu Titel und Thema – klassische Elemente der Countrymusik wie Slide-Gitarren. Unterm Strich ist »Drama Cowboy« eine künstlerische Antwort auf die gesellschaftliche Dauerkrise: Das innere Drama sollte nicht gescheut, sondern angenommen werden. (VÖ: 27. Juni) Mira Schneidereit
Live: 13. und 14. September, Wien, Canale Totale — 3. Oktober, Salzburg, Arge Kultur — 6. Dezember, Graz, PPC — 10. Dezember, Wien, Flucc — 11. Dezember, Linz, Stadtwerkstatt — 12. Dezember, Innsbruck, Bäckerei
11.09.2025






Das Frequency Festival feiert 25 Jahre. Seit 2001 lockt die Veranstaltung mit einer Mischung aus internationalen Headlinern und lokalen Lieblingen. Dieses Jahr spottet man neben Chappell Roan und Shawn Mendes unter anderem das Rap-Unikat Money Boy, den Wiener Strizzi Bibiza und die Szene-Newcomer Neunundneunzig. Das dreitägige Programm findet auf fünf Bühnen sowie im Night Park statt und verspricht neben vielfältiger Unterhaltung auch den etablierten Nonstop-Party-Spirit. 13. bis 15. August St. Pölten, Green Park

Die Linzer Band ist überzeugt davon, dass Punk Leberschäden vorbeugt. Ebenso wie eine »gesunde Denkweise«, was so viel heißt wie: weg mit Egoismus, Sexismus, Fremdenhass und all den anderen Auswüchsen des Patriarchats. »Es reicht!« heißt passenderweise auch ihr Debütalbum. 1. August Waidhofen an der Ybbs, Fleischrock — 2. August Attersee, Perspektiven Festival — 3. August Wien, Kultursommer — 8. August Klagenfurt, Artrium Kulturfestival — 9. August Döbriach, Sauzipf Festival — 30. August Hollabrunn, Alter Schlachthof




hat einen eigenen Sound irgendwo zwischen Cold Wave, FuturePop und Techno gefunden. Im Vorprogramm: NNHMN und Vöest. 29. August Wien, Das Werk


Vorhang auf für Prater Sounds! Die Spielreihe feiert im September Premiere. Im zirkusartigen Ambiente halten hier Lesungen, Comedy- und Musikauftritte Einzug in die glitzernde Manege. Erste Acts sind schon bekannt: Kreiml & Samurai (18. September), Garish (19. September), Hangweyrer & Palfrader (25. September) sowie Mira Lu Kovacs (27. September; Bild). 18. bis 27. September Wien, Spiegelpalast
Und nochmal Postrock! Schon in regulärer Besetzung klingt die isländische Band zutiefst ergreifend, nicht zu Unrecht zählt sie zu den bekanntesten Acts des Genres. Nun bringen Sigur Rós im Rahmen ihrer »Orchestral Tour« das Soundbad zum Überlaufen, wenn sie dem Publikum ihr zuletzt erschienenes Album »Átta« (2023) in sinfonischer Begleitung präsentieren. 6. und 7. September Wien, Konzerthaus
Noch vor ein paar Jahren hätten wir ein Konzert von Montell Fish wohl nicht empfohlen. Damals machte er noch Contemporary Christian Music und vertrat recht starre religiöse Ansichten. Doch beides hat sich seither geändert und mittlerweile setzt er auf kontemplativen R&B und Neo-Soul. 18. August Wien, Arena Open Air
Bei einer Band, die so lange around ist wie Nada Surf – ihr Durchbruch gelang 1996 mit »Popular« –, ist es bemerkenswert, wenn immer noch Releases mit besonderer Strahlkraft anfallen. Ihr zehntes Album »Moon Mirror«, mit dem sie gerade auf Tour sind, ist ein solcher Release. 14. September Salzburg, Rockhouse
Musiker Fuzzman hat wieder gezaubert: Das Line-up des heurigen Bergfestivals schaut nach einem Mordsspaß aus. Das Motto? »Sonne, Almen, Liebe, Blumen.« Fern von Hüttengaudi und Après-Ski tummeln sich hier zahlreiche Indie-Interpret*innen, darunter viele heimische. 21. bis 24. August Unterort, Petzen

Warum widmet sich euer Festival dem »fantastischen Film«?
Einerseits erlauben es Genres wie Horror, SciFi und Fantasy die Kreativität der diversen Departments maximal herauszukitzeln. Man darf dort viel expressiver mit Formen, Farben und Kamerabewegungen umgehen, weil es keine Regeln gibt. Denn wer schreibt einem vor, wie eine Fantasiewelt funktionieren soll? Andererseits können im fantastischen Film Verwerfungen unserer Gegenwart oftmals treffsicherer behandelt werden als in einem Film, der sich an einem konkreten Zeitpunkt abarbeiten muss. Ich hatte als Jugendlicher, der nicht immer unter idealen Voraussetzungen – also queer und am Land – aufgewachsen ist, oft das Gefühl, dass ich die Gesellschaft durch Horrorfilme besser verstehen konnte.
Warum zieht der fantastische Film so häufig auch queere Menschen an?
Das hat sicher mit den Figuren zu tun, die darin eine Rolle spielen. Die Held*innen sind dort ja ganz oft Mauerblümchen, Außenseiter*innen. Es geht viel um Freaks, also um Leute, die nicht dazugehören. Und dann spielt natürlich Camp eine große Rolle. Das Spiel mit Masken, mit Kostümen, mit Inszenierungen, mit grellen Charakteren. Freddy Krueger war für mich schon immer eine Dragqueen, so viel Sass und Shade, wie er raushaut. Da gibt es nur graduelle Unterschiede zu anderen performativen Aneignungen von Weirdness und Freakiness.
Wie ist es deiner Meinung nach um den fantastischen Film in Österreich bestellt?
Man hat diese Genres bei uns jahrzehntelang sehr schlecht behandelt, sodass sich keine deutschsprachige Kultur des fantastischen Films etablieren konnte. Vor dem Zweiten Weltkrieg war im Horrorfilm die Weimarer Republik federführend. Mittlerweile schauen die Deutschen recht neiderfüllt auf Österreich, weil unser Fördersystem durchlässiger ist für idiosynkratische Stimmen und morbide Thematiken. Auch vonseiten der Kreativen gibt es zunehmend Interesse an einem behänden Spiel mit fantastischen Mitteln – und dabei muss ja am Ende nicht immer ein klassischer Genrefilm herauskommen.
Slash Filmfestival 18. bis 28. September Wien, Filmcasino, Gartenbaukino und Metro Kinokulturhaus

Ars Electronica
Wissenschaftlicher Größenwahn. Eine künstliche Intelligenz erwacht zum Leben. Und am Ende unterjochen Superroboter die Welt. Diese metaphorische Warnung davor, es mit der KI bloß nicht auf die Spitze zu treiben, kennt man ja aus so manchem Film. Dabei fällt es gerade aufgrund der rasanten technologischen Veränderung mittlerweile tatsächlich schwer, zwischen echtem Grund zur Panik und Panikmache zu unterscheiden. Die Ars Electronica scheut mit ihrem heurigen Thema »Panic – Yes/No« nicht vor dieser Frage zurück, sondern begreift die Zukunft als entwicklungsfähige Perspektive. Weg vom Status quo der Verunsicherung und hin zur kreativen Arbeit auf Basis technologischer Entwicklungen. 3. bis 7. September Linz, diverse Locations

Bei den Worten »Nie wieder Friede« muss man zweimal nachschauen, ob man wirklich richtig gelesen hat. Hat man, denn der Steirische Herbst bezieht sich damit auf Ernst Tollers gleichnamiges satirisches Theaterstück und lässt sich von der Frage inspirieren, ob wir Menschen uns im Grunde genommen Krieg oder Frieden wünschen. Mit Blick auf viele der aktuellen Krisenherde ein mehr als zeitgemäßer Gedanke. Damit besinnt sich das Festival – wohl auch angesichts der unseligen steirischen Landespolitik – zurück auf seine antifaschistischen Wurzeln. 18. September bis 12. Oktober Graz, diverse Locations

Die Vienna Design Week zeigt jedes Jahr aufs Neue, dass es beim Thema Design weder nur um das abstrakte, museale Möbelstück geht noch um Menschen in schwarzen Rollkragenpullis, die am eleganten Glastisch an neuen Entwürfen tüfteln. Vielmehr versucht das Festival einen breiten praktischen Einblick zu geben, welche Formen, Farben, Texturen und Funktionen gestalterisch wirksam gemacht werden können. Von kleinen bis hin zu großen Ideen. Von Handwerkskunst bis hin zur Architektur. Von experimentellen Projekten bis hin zu neuen Konzepten für moderne Stadtentwicklung. 26. September bis 5. Oktober Wien, diverse Locations
Berlin, Mailand oder doch Paris? Manchmal muss man für seinen Miranda-Priestly-Moment gar nicht so weit reisen. Denn Designer*innen und ihre Labels findet man nicht nur auf den Laufstegen der üblichen Modehochburgen, sondern auch diesen Sommer wieder bei der Vienna Fashion Week. Unter dem Motto »Sehen und gesehen werden« wird dort rund 40 Modeschöpfer*innen eine Bühne für ihre neuesten Kollektionen geboten. 15. bis 20. September Wien, Museumsquartier
Am Ufer des Herrensees strecken bald gewaltige Kathedralen die Spitzen ihrer Türme in den Himmel empor. Jedoch keine aus altem Stein und mit verstaubten Wandgemälden. Nein, es handelt sich um »Kathedralen der Demokratie«, die das spannende Thema des heurigen Hin & Weg Theaterfestivals bilden. Der Ansatz: Unsere Demokratie Mauerstein um Mauerstein weiterzuentwickeln, genau wie es bei jenen gotischen Monumenten der Fall war. 8. bis 17. August Litschau, diverse Locations
»Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt!« Angelehnt an Pippi Langstrumpfs Leitspruch fordert das diesjährige Calle-Libre-Festival unter dem Schlagwort »Youtopia« seine Künstler*innen dazu auf, ausgewählte Straßen Wiens zur Leinwand für die eigenen Utopien zu machen. Damit möchte das Festival auch seine Besucher*innen dazu ermuntern, sich und den persönlichen Wünschen für eine bessere Zukunft Ausdruck zu verleihen. 16. bis 23. August Wien, diverse Locations
Mit ihrem Fokus auf die aufstrebenden Kunstszenen Zentral- und Osteuropas bietet die Vienna Contemporary jedes Jahr eine übernationale Plattform für Künstler*innen – von etablierten Größen bis hin zu aufregenden Newcomer*innen. Die Schiene »Statement« richtet dabei auch heuer wieder den Blick auf ein drängendes Thema. Diesmal darauf, wie zwischen KI, Manipulation und Desinformation neue Realitäten entstehen. 11. bis 14. September Wien, Messe
Małgorzata Mirga-Tas
Die künstlerische Praxis von Małgorzata Mirga-Tas speist sich aus der Zugehörigkeit der Künstlerin zur Rom*nja-Kultur, deren Lebenswelten sie in ihren Arbeiten abbildet. Damit treibt sie den Prozess der Rückeroberung der eigenen Erzählungen voran. Dieser Anspruch liest sich auch aus den Darstellungen selbst heraus, zum Beispiel aus den Bildern von Frauen beim gemeinsamen Nähen, das nicht als Last, sondern Träger einer geteilten Identität erscheint. Entsprechend stellen Textilarbeiten den wichtigsten Werkkomplex der Ausstellung, die sich über drei Stockwerke verteilt und daneben auch Skulpturen aus Wachs umfasst. bis 28. September Bregenz, Kunsthaus


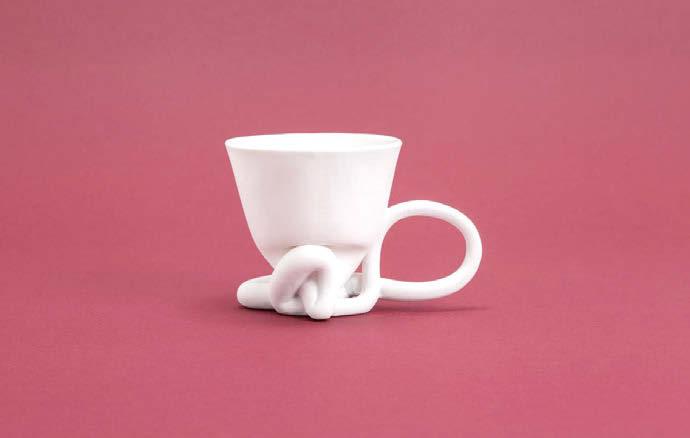

Stjernfelt,
Kjaer /
Weile



Bilder, die in den öffentlichen Raum eingebettet sind, zum Beispiel Werbegrafiken und Darstellungen explizit politischen Inhalts, sind gleichermaßen von geschlechterspezifischen Machtverhältnissen und Darstellungstraditionen beeinflusst, wie sie dieselben umgekehrt auch in die ein oder andere Richtung lenken. Lucy McKenzie untersucht ebenjene Objekte und Orte mit dem Ziel einer Verschiebung der bestehenden Verhältnisse. Ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Österreich ist interdisziplinär angelegt und imitiert den Bühnencharakter des von ihr behandelten Materials. bis 21. September Wien, FJK3
Wie jedes Jahr beginnt die neue Saison der Wiener Kunstdiskurswelt mit dem Curated-by-Festival. 24 Galerien haben Kurator*innen eingeladen, mit Ausstellungen auf den Impulsessay »Fragmented Subjectivity« von Sophia Roxane Rohwetter zu reagieren. Alle Ausstellungen sind am Eröffnungswochenende vom 5. bis 7. September ganztägig geöffnet. Wer dem Trubel entgehen möchte, hat die Möglichkeit, sich im Verlauf des Septembers auf individuelle Entdeckungstour zu begeben. 5. bis 7. September Wien, diverse Locations
Die Ausstellung »Freeing the Voices« hat ihren Ausgangspunkt in der Annahme, dass unsere individuellen wie kollektiven Stimmen kolonisiert sind – übertönt vom allgegenwärtigen Rauschen, kontrolliert von einer »Cancel Culture« oder angesichts überbordender Krisen ganz verstummt. Die Zusammenstellung von Arbeiten verschiedener Künstler*innen versucht, Formen der Befreiung aus diesem Zustand aufzuzeigen, und wendet sich dem Atmen, Schreien, Dichten, Singen, Sprechen und Murmeln zu. bis 24. August Graz, Kunsthaus
»Ich möchte, dass die Kunst ins reale Leben geht.« So beschreibt der dänische Künstler Esben Weile Kjær seinen Ansatz. Er führt das auf seine Zeit in der Hausbesetzer*innenszene zurück, als er erlebte, wie Orte durch ihre Benützung verändert wurden. Seine wichtigste Referenz, vielleicht als der Ort seines Handelns zu beschreiben, ist die Popkultur mitsamt ihren Sounds, Bildsprachen, Partys und Protesten sowie zentralen Begriffen wie Nostalgie und Authentizität. bis 14. September Salzburg, Kunstverein
Für die Dauer von vier Monaten verwandelt sich die Kunsthalle Wien am Karlsplatz zum »Blatt«, zum Träger einer sprachlichen Struktur, in die Arbeiten von Künstler*innen, die Text und Sprache in ihren Werken verwenden, gesetzt sind und während der Ausstellung gesetzt werden. Dabei wird aus der dem Material und der Praxis des Schreibens eigenen Zeitlichkeit und referenziellen Struktur geschöpft, um sie auch in anderen Formen des Ausdrucks – Tanz, Skulptur, Performance, Film – zu aktualisieren. bis 19. Oktober Wien, Kunsthalle Karlsplatz
Ein Mercedes, ein ehemaliger Polizeipräsident, ein Mitglied der Grauen Wölfe, ein Unfall im Jahr 1996. Das als Susurluk-Skandal in die Geschichte eingegangene Ereignis ist die Ausgangssituation, von der aus sich Göksu Kunak mit Momenten des Durchbrechens unterdrückter und verschwiegener Realitäten befasst. Dieses Feld erweitert die Künstlerin um Motive der Bewegung und Verlangsamung, Überwachung und Vertuschung, die in Form von einer Installation, Gemälden, Drucken und einer Performance untersucht werden. bis 26. Oktober Krems, Kunsthalle

Regisseur*innen »To Close Your Eyes and See Fire«
Euer Film handelt von den Folgen der Explosion im Jahr 2020 im Hafen von Beirut. Welchen Bezug hattet ihr davor zu dieser Stadt?
Nicola von Leffern: Meine Beziehung zum Libanon begann vor vierzehn Jahren. Ich arbeitete dort für eine NGO. Diese Zeit prägte mich nachhaltig. Der Perspektivenwechsel zeigte mir, wie verzerrt dieses Land in unseren Medien dargestellt wird. Kurze Zeit später beschlossen Jakob und ich, gemeinsam eine Kurzdokumentation über die andauernde Energiekrise des Libanon zu drehen. Als sich dann die Explosion ereignete, fanden wir es vorerst unpassend einzureisen. Alle internationalen Medien stürzten sich auf das Ereignis, aber das ist nicht unsere Art, Filme zu machen. Also warteten wir mehrere Monate und fuhren erst, als wir merkten, dass ein großer Mangel an Aufarbeitung herrschte.
Jakob Sauer: Nach unzähligen Gesprächen, schrecklichen, traurigen, aber auch berührenden Geschichten fassten wir den Entschluss, zu bleiben und der Stille danach, abseits des grausamen Ereignisses, Gehör zu verschaffen. Die Explosion wurde medial ausgeschlachtet. Was im Vakuum nach großen Tragödien geschieht, findet selten Platz in Zeitungsartikeln. Filme haben die Kraft, sich diese Zeit und Aufmerksamkeit zu nehmen sowie das Menschliche – fernab vom Nachrichtenwert – zu erzählen.
Ihr begleitet in eurem Film mehrere Protagonist*innen. Wie habt ihr diese gefunden?
Sauer: Es war uns wichtig, mit genügend Zeit dem Rhythmus des Ortes und seinen Menschen begegnen zu können und abzubilden, was ist, nicht, was in ein filmisches Narrativ passt. Letztlich haben Zufall und Sympathie mitentschieden, wen wir über die drei Jahre begleitet haben.
Der Film behandelt die unterschiedlichen Möglichkeiten, mit Traumata umzugehen.
Von Leffern: Wie Traumabewältigung gelingen kann, war die Frage, mit der wir den Film begonnen hatten. Die Antwort, die wir unterwegs fanden, ist, dass Bewältigung ein Luxus ist. Denn selbst Trauer ist ein Privileg im Kampf ums Überleben.
To Close Your Eyes and See Fire« Start: 5. September

Regie: Natalie Halla 2021 übernahmen die Taliban erneut die Macht in Afghanistan. Vor allem die Rechte von Frauen und Mädchen sind seither stark eingeschränkt, ebenso die Medien- und Meinungsfreiheit. Die wirtschaftliche Lage hat sich verschlechtert. Vor diesem Hintergrund erfuhr Natalie Halla von Manizha Bakhtari, einer afghanischen Diplomatin in Österreich, die sich für die dortige Bevölkerung starkmacht, und sie beschloss, ihr ein Porträt zu widmen. »Als Juristin interessierte es mich sowohl aus rechtlicher als auch aus menschlicher Sicht, wie es nun mit dieser Botschaft weitergehen würde, die eine Regierung vertritt, die es nicht mehr gibt und die im Namen eines Landes handelt, das jetzt unter der Macht von Terroristen steht«, erzählte sie dem Österreichischen Filminstitut. Eine Dokumentation über eine Aktivistin, die unermüdlich Widerstand leistet. Start: 15. August

Regie: Marie Luise Lehner Eine Coming-of-Age-Story kombiniert mit einer Milieustudie, eine Sicht auf das Thema Klasse jenseits des Sozialpornos sowie einen Score voll guter (österreichischer) Musik – all das bietet »Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst«. Regisseurin Marie Luise Lehner ist eine umtriebige Person in der österreichischen Kulturszene: Sie macht mit der feministischen Punkband Schapka Musik, veröffentlichte zwei Romane und eine Reihe von Kurzfilmen. Letztere zeichnen sich insbesondere durch einen Fokus auf queere Figuren und deren Leben aus. In ihrem neuen Film richtet Lehner den Blick vor allem auf Klassenunterschiede, Community und Solidarität, wenn sie vom Aufwachsen der zwölfjährigen Anna (Siena Popović) erzählt, die mit ihrer gehörlosen Mutter Isolde (Mariya Menner) lebt. Start: 26. September
Regie: Caroline Poggi und Jonathan Vinel ———— Die Geschwister Pablo (Théo Cholbi) und Apo (Lila Gueneau) lieben das Onlinegame »Darknoon«, doch dieses soll bald eingestellt werden. Ein Schock für die beiden, schließlich hat sie das Spiel ihr halbes Leben begleitet. Während Apo einfach nur die verbleibenden sechzig Tage weiterzocken möchte, trifft ihr Bruder auf seine große Liebe – und wird in eine blutige Fehde verwickelt. Start: 15. August
Regie: Darren Aronofsky ———— Darren Aronofskys Filme kreisen um Themen wie Obsession und Selbstzerstörung, Surrealismus und körperliche sowie psychische Qualen. Und damit ist er recht erfolgreich. Zuletzt brachte »The Whale« Brendan Fraser einen Oscar ein. In »Caught Stealing« taucht ein ehemaliger Baseballspieler in die kriminelle Unterwelt im New York der 1990er ein. Mit Austin Butler, Zoë Kravitz und Bad Bunny. Start: 29. August
Regie: Nathalie Borgers ———— Ihre eigene Familiengeschichte stand bereits in Nathalie Borgers Film »Liebesgrüße aus den Kolonien« im Fokus, nun richtet sich der Blick der Regisseurin auf die Geschichte ihres Mannes: Dieser wurde mit 22 Jahren bei Protesten gegen die türkische Militärdiktatur angeschossen. Borgers spürt somit sowohl diesen physischen Narben nach als auch jenen im demokratischen Selbstverständnis der Türkei. Start: 6. September
Regie: Isabella Brunäcker ———— Als »österreichisches Indiekino von Weltformat« bezeichnete die Diagonale das Langfilmdebüt der Regisseurin Isabella Brunäcker. In diesem begegnen einander Iga (Jana McKinnon) und Ethan (Bill Caple) auf einem Roadtrip in den Norden Großbritanniens. Eine Autofahrt; zwei Menschen, die einander fremd sind; ein Autoradio, das nicht funktioniert; der Versuch, Nähe aufzubauen; und eine überraschende Wendung. Start: 12. September
Regie: Florian Pochlatko ———— »Menschen, die in psychotischer Wahrnehmung leben, haben oft ein Detachment von der Realität. Und wenn eine manische Phase beginnt, fühlen sich viele wie in einem Film«, erklärte Florian Pochlatko gegenüber The Gap. Pia (Luisa-Céline Gaffron) kehrt nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie nach Hause zurück und versucht, mit dem Leben klarzukommen. Doch Realität und Fantasie vermischen sich zusehends. Start: 19. September

Idee: Alfred Gough und Miles Millar Die erste Staffel der Serie wurde zum Hit, nun startet – mit etwas Verzögerung wegen der Streiks in Hollywood – die zweite. Abermals ist Jenna Ortega in jener Titelrolle zu sehen, in der sie Berühmtheit erlangte. Gleich zu Beginn der neuen Folgen muss sich Wednesday aus den Fängen eines Serienkillers (Haley Joel Osment) befreien. Lady Gaga hat eine Gastrolle, auch Stars wie Steve Buscemi sind Neuzugänge im Cast. ab 6. August Netflix

Idee: Noah Hawley Nicht nur Sequels, sondern auch Prequels haben Hochkonjunktur: »Alien: Earth« ist ein Beispiel für Letztere, die Sci-Fi-Serie spielt etwa zwei Jahre vor dem ersten »Alien«-Film. Ein Raumschiff stürzt auf der Erde ab und ein Rettungsteam versucht, Überlebende zu finden. Dabei stoßen sie auf eine fremde Lebensform, die bald den gesamten Planeten bedroht. Nach der TV-Adaption von »Fargo« ein markanter Genrewechsel für Showrunner Noah Hawley. ab 13. August Disney+



4. September bis 16. Oktober 2025
Das Gesamtwerk
Das Österreichische Filmmuseum zeigt im September und Oktober eine umfassende Retrospektive zu John Carpenter – einem der einflussreichsten Genre-Regisseure des 20. Jahrhunderts. Seine Filme prägten Horror, Science-Fiction und Actionthriller mit klarer Bildsprache, virtuoser Kameraarbeit und markanten elektronischen Soundtracks, die er oft selbst komponierte. Zentrale Themen wie Paranoia, Gesellschaftskritik und tiefes Misstrauen gegenüber Autoritäten sind heute aktueller denn je.
Detaillierte Informationen und Ticketkauf bzw. -reservierung ab 1. August 2025
Tickets sind für Mitglieder des Filmmuseums für 5,50 € erhältlich. Das nonstop Kinoabo gilt für sämtliche Vorstellungen.

bewegen bewegte Bilder – in diesem Kompendium zum gleichnamigen Podcast schreibt er drüber

Algorithmus? Ach was! Es ist doch immer noch die gute alte analoge Assoziation, die einem die bezauberndsten Querverbindungen in den Alltag wirbelt. So auch kürzlich, als mir unvermittelt eine Eingebung in die Großhirnrinde schoss und meine Aufmerksamkeit zusätzlich in Beschlag nahm – mitten hinein ins eh schon rege Wechselspiel aus rezenten Sinneseindrücken und innerer Reflexion. Der Auslöser? Ein Lied – genauer: »Aua aua« von Future Franz, einem eher in der Nische agierenden Drucker verschmitzter Alltagsgschichtln deutscher Zunge. Dieser hinterfotzige Ohrwurm machte sich just in jenem Moment bemerkbar, als sich auf der Leinwand vor mir eine der markerschütterndsten Szenen der jüngeren Kinogeschichte abzuzeichnen begann.
Holla, was war das denn bitte? Ein perfider Zufall? Oder doch ein unbewusster Schutzmechanismus? Schwer zu beurteilen. Leichter fällt dafür die grundlegende Erkenntnis, dass dieser Song mit seinem schmerzerfüllten Titel und einem Text, in dem rätselhaft von Messern in Küchen fabuliert wird, erschreckend gut zu jenem konkreten Ereignis des Grauens in »Bring Her Back« (ab 15. August im Kino), dem neuen Werk des australischen Brüderpaars Danny und Michael Philippou, passt. So gut sogar, dass man meinen könnte, »Aua aua« wäre auch als Tagline auf dem Poster eine ausgezeichnete Wahl gewesen.
Nach ihrem präzise beunruhigenden Einstand »Talk to Me« (2023) erzählen die Zwillinge in ihrer jüngsten Arbeit mit dreiteiligem Imperativ von den Stiefgeschwistern Andy (Billy Barratt) und Piper (Sora Wong), die eines schicksalhaften Tages die Leiche des Vaters im Badezimmer vorfinden. Bis Andy aber volljährig wird und das Sorgerecht für seine sehbehinderte Schwester übernehmen darf, landen die Neowaisen erst einmal in der Obhut der ehemaligen Sozialarbeiterin Laura (Sally Hawkins), deren
schrullige Herzlichkeit allerdings rasch Risse bekommt. Was hat es mit dem ausgestopften Welpen in der Küche auf sich? Was mit dem leeren Pool und dem stummen Kind darin? Was mit den gruselig-grieseligen VHS-Aufnahmen seltsamer Rituale und dem Kreidekreis ums Grundstück? Und was ist mit der Pflegemutter selbst, die mit erschreckender Vehemenz daran zu arbeiten scheint, die Verbindung zwischen den Kindern zu torpedieren?
Die Wahl der Quahl
Die Philippous gehen mit Bedacht daran, die Verletzungen ihrer Figuren zu enthüllen, unterfüttern ihren psychologischen Horror dabei mit viszeralen Schockmomenten – wie der erwähnten Splatterszene –, die selbst abgebrühte Schauder-Afficionados durchrütteln dürften. Und doch ist es primär die stetig beklemmender werdende Atmosphäre dieser Wahl- und Qualverwandtschaft, dieses nicht spezifizierbare Unbehagen, das einem so richtig fies und tiefgreifend zusetzt. »Bring Her Back« stellt nicht einfach die handelsübliche Frage nach Gut oder Böse, sondern lotet lieber aus, wie eine alles einnehmende Trauer Menschen von Grund auf verändern kann – bis sie Handlungen tätigen, die sonst kaum vorstellbar scheinen. Die Balance aus Körper- und Kopfhorror, aus okkultem Thrill und nuancierter Charakterstudie, sie ist hier herzschlagerhöhend herausragend gelungen.
»Bring sie zurück« – das könnte genauso gut das Mantra eines weiteren Ausnahmefilms dieses Sommers sein, der zufällig sogar am selben Tag anläuft. Auch in »Sirât«, dem in Cannes frenetisch empfangenen vierten Spielfilm des galicischen Regisseurs Óliver Laxe, steht der Verlust eines geliebten Menschen im Zentrum. Hier ist es ein Vater, der nach seiner Tochter sucht, die sich vor Monaten zu illegalen Raves in der marokkanischen Sahara verabschiedet hat und nie zurückgekehrt ist. Eben dorthin, wo Subwoofer und Substanzen die Regie für einen

»Bring Her Back« und »Sirât« loten beide die Grenzen des Erträglichen aus, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
euphorischen, egalitären Zirkus von Outcasts führen, verschlägt es nun Luis (Sergi López) sowie seinen ihn tapfer sekundierenden Spross. Von der Vermissten fehlt zunächst zwar jede Spur, doch eine Clique von Feiernden setzt dem Gespann die Idee in den Kopf, dass man es ja auf dem nächsten Event weiterversuchen könnte – zu dem sich diese Gemeinschaft der gemeinsam Verlorenen denn auch quer durch die Einöde aufmacht.
Wie in »Bring Her Back« entsteht auch in »Sirât« aus der Not heraus eine zusammengewürfelte Zufallsersatzfamilie, die lediglich einem prekären Zusammenhalt unterliegt. Die Parallelen reichen weiter, denn auch diese Geschichte nimmt zunehmend wahrlich wilde, wunderliche und wahnwitzige Ausformungen an. Aus der Dystopie eines Rave-Roadmovies an der Schnittstelle von »Lohn der Angst« und dem »Mad Max«-Franchise erwächst letztendlich eine entschieden albtraumhafte Parabel. Der sich auf die schmale Brücke zwischen Himmel und Hölle in der islamischen Mythologie beziehende Filmtitel darf dabei durchaus als Programm verstanden werden.
Hat diese weißglühende Wüstenodyssee dann erst einmal den Punkt ohne Wiederkehr erreicht, führt die Reise geradewegs durch ein Tal sandstaubiger Tränen – mitten hinein in eine hypnotische Meditation über Tod, Schmerz und die Grenzen des noch Erträglichen. Auf unvergleichliche und nahezu unerträgliche Weise zieht einen diese vieldeutige, nervenzerfetzende Erkundung einer bis zum Äußersten getesteten menschlichen Psyche emotional durch den wringer. Und doch möchte man keine Sekunde dieses Seelenschleudertraumas missen. Because it hurts so good. Aua aua. prenner@thegap.at • www.screenlights.at
Christoph Prenner plaudert mit Lillian Moschen im Podcast »Screen Lights« zweimal monatlich über das aktuelle Film- und Seriengeschehen.

Unabhängiger Qualitätsjournalismus. Bürgerlich-liberal.
Die Presse Seit 1848

Nachrichten. Meinung. Magazin. Gedruckt. Digital. Audio. Video. Events.


Eine Küchenlandschaft, fünf Gesetzesbrecher*innen und ein Staat, der FLINTA*Personen zur Rückkehr ins Gestern zwingt – »Retrotopia« ist eine bitterböse Zukunftssatire, die mit absurdem Humor, politischem Ernst und surrealem Übermut ein Szenario serviert, das sich gleichzeitig wie Warnung und Empowerment anfühlt. Ob wegen arbeitsrechtlicher Kämpfe, Beihilfe zum Schwangerschaftsabbruch oder »Vernachlässigung der Familienpflicht« – die zum »sozialen Zwangsdienst« Verdonnerten tischen alles auf zwischen queerer Wut, Tradwife-Content und widerständigen Fantasien. Dabei zeigen sie nicht nur, wie sich Unterwerfung anfühlen kann, sondern auch, wie subversiv Gemeinschaft wird, wenn alles auf Anpassung drängt. 16. September bis 3. Oktober Wien, Kosmos Theater

Was, wenn ein Nein nicht gehört wird – oder nicht gesagt wurde? »Sie sagt. Er sagt.« verspricht keinen einfachen Theaterabend, sondern eine Auseinandersetzung mit einem Thema, das unter die Haut geht. Nach Ferdinand von Schirachs Dramen »Terror« und »Gott« wird die Bühne ein weiteres Mal zum Gerichtssaal, aber auch zum Spiegel einer Gesellschaft, die um Deutungshoheit ringt. Aussage steht gegen Aussage, und plötzlich geraten eigene Gewissheiten ins Wanken. Statt klarer Urteile rückt hier das Fragen in den Vordergrund: Wer spricht? Wem wird geglaubt? Welche Rolle spielen Wahrheit, Verantwortung und Macht? Und was, wenn die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt? 7. September bis 14. Jänner Wien, Kammerspiele der Josefstadt
Basierend auf dem Roman von Robert Prosser eröffnet »Verschwinden in Lawinen« einen neuen Zugang zu den Themen Natur, Gemeinschaft und Erinnerung. Verschüttet von der Lawine und zerrüttet vom Tourismus hinterfragt das Stück die Existenz der vermeintlichen Freiheit der Alpen. Regisseurin Mira Stadler bindet Prosser und Schlagzeuger Lan Sticker in eine Performance zwischen Sprache, Rhythmus sowie Musik ein und schafft damit eine dichte Atmosphäre jenseits klassischer Erzählformen. 14. September bis 17. Oktober Innsbruck, Tiroler Landestheater
Bei den Bregenzer Festspielen weht im August frischer Regiewind durch Rossinis »La Cenerentola«: Mit Gespür für Timing und Zwischentöne nimmt sich Amy Lane der Opera buffa an. Zwischen Rollenklischees, Machtspielen und dem Wunsch nach echter Verbindung kommt die auf »Aschenputtel« basierende Handlung ganz ohne Magie aus und setzt stattdessen auf soziale Maskeraden. Die Musik unter der Leitung von Kaapo Ijas verspricht Leichtigkeit, die Geschichte Spielraum für kluge Brechungen. 12. bis 15. August Bregenz, Theater am Kornmarkt
Im Rahmen der Jubiläumsreihe »Johann Strauss 2025« macht »Turn« Theater zum lebendigen Erlebnis, bei dem sich Tanz, Musik und Gespräche vermischen sowie Regeln, Ränge und Konventionen neu gedacht werden. Inspiriert von den Bewegungen des Walzers dreht sich alles an dieser Soiree um 200 Jahre Überleben im Kapitalismus. Das Performancekollektiv Gob Squad lädt ein, mitzudrehen, Plätze zu tauschen, gemeinsam nach einem Ausweg aus diesem System zu suchen und auszuprobieren, wie soziale Begegnungen anders funktionieren können. 25. September bis 1. Oktober Wien, Kasino am Schwarzenbergplatz
»Cock« ist schnell, scharf(sinnig), manchmal tragisch, oft komisch – und kommt ohne großes Drumherum (aus). Quasi entblößt, ohne Bühnenbild und Requisiten, steht hier ganz die innere Zerrissenheit der Figuren im Mittelpunkt: John weiß nicht, wer er ist. Er weiß nur, dass er sich von seinem toxischen Boyfriend M distanzieren muss, als er W kennenlernt und sich zum ersten Mal sexuell zu einer Frau hingezogen fühlt. Ein Beziehungsdreieck, das mehr Fragen aufwirft, als es Antworten bietet. 4. bis 13. September Wien, Off Theater
Gewidmet all denjenigen, die beim Lesen auf die eine oder andere Wissenslücke gestoßen sind.
Der Physiker Werner Heisenberg formulierte 1927 die Heisenbergsche Unschärferelation, die besagt, dass zwei zusammenhängende Werte eines Systems – etwa Ort und Impuls eines Teilchens – nicht gleichzeitig völlig exakt bestimmt werden können. Wird beispielsweise der Ort eines Elektrons genau eruiert, bleibt der Impuls bis zu einem gewissen Grad unscharf, und umgekehrt. Das Prinzip bildet eine der Grundlagen der modernen Quantenmechanik. Die Magistratsabteilung 35 ist in Wien für »Einwanderung und Staatsbürgerschaft« zuständig. Insofern ist sie auch für die (Nicht-)Vergabe von Aufenthaltstiteln verantwortlich und steht hierbei häufig in der Kritik. Mangaka ist die Bezeichnung für Menschen, die Mangas zeichnen. Wobei weitläufig die Meinung herrscht, dass man ganz streng genommen erst dann wirklich zum*zur Mangaka wird, wenn zumindest ein Werk professionell veröffentlicht worden ist. Der Begriff Odyssee beschreibt die Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus auf seiner zehnjährigen Rückreise nach Ithaka im Anschluss an den Trojanischen Krieg. Wobei er pikanterweise allein sieben Jahre dieser Zeit bei der Nymphe Kalypso verbrachte. Das Wort Potpourri war ursprünglich eine direkte Übersetzung des spanischen Gerichts Olla podrida, wurde dann generell für Eintöpfe verwendet und bezeichnet vermutlich seit dem 17. Jahrhundert Mischungen wohlriechender Pflanzenteile sowie die Gefäße, in denen diese aufbewahrt werden. Ironischerweise lautet die wörtliche Übersetzung aus dem Französischen »verfaulter Topf«. »Pushin’ back a deadline, gotta make my bedtime«, lautet eine Zeile aus dem Song »Ringtone« des Duos 100 Gecs von deren Debütalbum »1000 Gecs«, dem mitunter zugeschrieben wird, das Genre Hyperpop popularisiert zu haben. Achtung, Silicon wird im Deutschen mit Silizium übersetzt und nicht mit Silikon! Letzteres hat im Englischen nämlich ein E am Ende. Diese Verwechslung dürfte wohl schon zu einiger Verwirrung darüber geführt haben, was denn eigentlich im Silicon Valley produziert wird.


Clubkultur neu, Pointen tief. ———— Die Diskokugel am Cover inszenierte unser Fotograf Erli Grünzweil. Über die »Experimente in der Clubkultur«, auf die diese Bezug nahm, schrieb die damalige Chefredakteurin Yasmin Vihaus. Im Zentrum ihrer Coverstory stand das Festival Hyperreality, das sich damals schon mit neuen Formen der Clubkultur auseinandersetzte. Über den Status quo auf dem hart umkämpften heimischen Festivalmarkt war ebenfalls zu lesen. Wie auch über Glamping als »teurere Alternative zum normalen Zelten, die ein wenig biedermeierliche Geborgenheit aufs Festivalgelände bringt«, sowie über das Rostfest als (inzwischen leider eingestelltes) Paradebeispiel dafür, wie ein Festival als »echter Ausnahmezustand im positiven Sinn« den ländlichen Raum beleben kann. Apropos eingestellt. Was es damals auch noch gab: eine Gastrokolumne von Martin Mühl mit dem – wie wir finden – grandiosen Titel »Lokaljournalismus«, Gabriel Rolands Modekolumne »Einteiler« und die »Know-Nothing-Gesellschaft« von Illbilly. In The Gap frönte dieser viele Jahre lang »der hohen Kunst der tiefen Pointe«. Unvergessen.

Liechtensteinstraße 64, 1090 Wien Wo gibt’s The Gap?
Es gibt wenige Orte in Wien, an denen Comics so zu Hause sind wie bei Pictopia. Der kleine Laden im neunten Bezirk ist bis unter die Decke mit den bunten Bänden vollgestopft. Doch nicht nur die ausgiebige
Auswahl an Druckwerken – inklusive
The Gap natürlich – füllt den Laden, denn Besitzer Sebastian Broskwa lädt regelmäßig zu Signieraktionen und Buchpräsentationen. Und bei diesen Gelegenheiten quetscht sich die halbe Wiener Comicszene in die engen Räume. Sollte man sich nicht entgehen lassen!
Rialto Clubcafé Salzburg »Beats, Drinks & Vibes« stehen im Clubcafé Rialto auf dem Programm. Bei Cocktails, guter Musik und The-Gap-Lektüre lassen sich hier gemütliche Stunden verbringen. Anton-Neumayr-Platz 5, 5020 Salzburg
Hotel am Brillantengrund Wien
Das familiäre Hotel mit den 34 individuell eingerichteten Zimmern ist auch für Ortsansässige interessant – als Geheimtipp für exzellente philippinische Küche. Bandgasse 4, 1070 Wien

Josef Jöchl
artikuliert hier ziemlich viele Feels
Instagram ist schlecht für die Psyche. Diese Wahrheit, die klingt wie der Krone bunt entnommen, musste ich kürzlich am eigenen Leib erfahren. Die Story eines Freundes lud mich ein, die Profile aller verlinkten Personen zu besuchen. Dabei musste ich feststellen, dass seine beste Freundin mir nach einigen Jahren des gegenseitigen Likens unfollowed war. Nur ein kleiner Zwischenfall, aber immerhin genug, um mir den Tag zu verderben.
In der Hoffnung, die beiden würden sich noch auf dem Spaziergang befinden, den ich auf Instagram verfolgt hatte, fragte ich sofort: Warum bitte ist sie mir unfollowed? Der Freund wollte mich zurückrufen, sobald er wieder zu Hause sei. Doch mein persönliches Insta-Gate war längst angerichtet. Bis zu seinem Anruf vergingen gefühlt Stunden, in denen ich wenig anderes tat, als jede bisherige Interaktion mit besagter bester Freundin auf Abwertungen hin abzuklopfen und mir zu versichern, dass ich eine besonders nette, absolut follow-worthy Person sei. Aber warum wurde dieser Vorfall überhaupt zum Gate?
Wann ist ein Gate ein Gate?
Vielleicht lag es daran, dass es meiner Psyche an diesem Tag von Haus aus nicht besonders gut ging. Wegen der Hitze lag ein schlechtes Schlafi hinter mir. An solchen Tagen wirken Likes und Follows wie ein aufmunterndes Lächeln. Jeder Unfollow hingegen raubt mir ein Stück meiner Seele. In so einem Fall muss man als Creative im Jahr 2025 tun, was einem gut tut. Ich entspanne mich dann, bleibe bei mir, mache etwas Yoga und ritze mich, wenngleich nur im übertragenen Sinne. »Josef, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich bei diesem Vorfall um ein Gate handelt«, sagte der Freund später am Telefon. »Mei-
ne beste Freundin feiert deinen Content einfach nicht mehr.« Ich kannte jedoch ihre FollowerFollowing-Ratio. Jemand, der circa drei Dutzend verwaiste Haustier-Accounts abonniert hat, würde mir nicht ohne handfesten Grund unfollowen. »Na gut«, gab der Freund auf mein Nachbohren hin zu, »du hast sie bei irgendeiner Lesung nicht gegrüßt.« Ich bedankte mich bei ihm für diese schlüssige Erklärung und war eigentlich ganz zufrieden. Schließlich ist Nichtgrüßen eine legitime Grundlage für einen Unfollow. Doch ad acta legen konnte ich die Angelegenheit noch nicht.
Ich hätte wohl einfach etwas Gras berühren sollen. Die Gedanken über eine abhandengekommene Followerin waren jedoch attraktiver als alle Grünflächen der Innenstadt zusammen. Am nächsten Morgen schrieb ich ihr eine Nachricht: »Hi, selbstverständlich habe ich dich bei der Lesung gegrüßt. Ich grüße alle. Nur ›Stop and Chat‹ mache ich selten, weil ich eher introvertiert bin. Bekannten zu unfollowen, ist hingegen immer ein bisschen rude, gell. Liebe Grüße, Josef.« Ein treffsicheres Meisterwerk der passiven Aggression! Zufrieden hittete ich Senden. Dann zahlte ich es ihr mit gleicher Münze heim und unfollowte ihr ebenfalls. Rache ist süß. Schon witzig, dieser Millennial Urge, soziale Beziehungen minutiös auf Social Media zu spiegeln. Das macht man irgendwie auch nur auf Meta-Plattformen. Auf Tiktok ist so was allen wurscht. Weil ich schon mal dabei war, begann ich gleich ein bisschen auszumisten. Schauspielerin, die mir immer ein bisschen fake um den Hals fällt? Unfollow. Ärztesohn, der sich als Arbeiterführer geriert? Unfollow. Typ, der behauptet hatte, ich würde in meiner The-Gap-Kolumne nichts anderes tun, als auf
persönliche Beefs anzuspielen? Un-fuckingfollow. Binnen ein paar Klicks kappte ich circa zehn Verbindungen, die ihr Haltbarkeitsdatum bereits überschritten hatten. Erst ein paar Wochen später realisierte ich, dass ich die Welt in diesen Momenten für alle ein bisschen peinlicher gemacht hatte. Denn jede einzelne Person, der ich in meinem Furor unfollowte, sollte mir in den Wochen darauf persönlich begegnen: auf Geburtstagsfeiern, in Kabarettvorstellungen, bei Straßenfesten. Einige hatten meinen Unfollow wohl mitbekommen. Die Awkwardness war förmlich zum Angreifen. Das war es schließlich auch, was ich damit erreichen wollte.
Manche waren jedoch extranett und lösten Zweifel aus, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Einmal saß ich mit dreien von ihnen zufällig an einem Tisch und musste auf die Toilette gehen, um dort schallend zu lachen. Ich kann natürlich nicht genau wissen, ob sie meinen Unfollow überhaupt registriert hatten. Niemand würde zugeben, solchen Lappalien Aufmerksamkeit zu schenken oder, technisch versierter, eine Friend-Tracker-App zu verwenden. Viel souveräner wäre ohnehin, gar nicht erst zu unfollowen, sondern sich durch feindlichen Content täglich ein bisschen abzuhärten, was bestimmt auch die Psyche stärkt. Das würde ich der besten Freundin von meinem Freund gern sagen, aber meine Nachricht würde wohl in diesem versteckten Ordner landen. joechl@thegap.at • @knosef4lyfe
Josef Jöchl ist Comedian. Sein aktuelles Programm heißt »Erinnerungen haben keine Häuser«. Termine und weitere Details unter www.knosef.at.



Jetzt Mitglied der STANDARD Publikumsjury bei der Viennale 2025 werden.













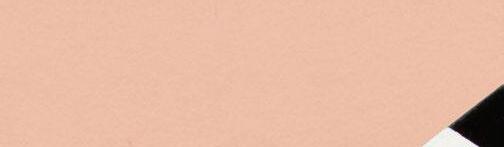





























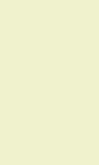






































Der Haltung gewidmet.



























































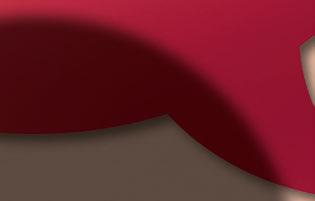














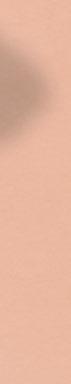








Möchten Sie Filme bewerten und Teil einer exklusiven Jury sein? Wir suchen drei begeisterte Filmfans, die zwölf von der Viennale ausgewählte Filme bewerten. Der prämierte Film wird im STANDARD mit einem Werbevolumen von EUR 25.000,– unterstützt, wenn ein Filmverleih ihn ins Programm aufnimmt. Bewerben Sie sich bis Freitag, 19. September 2025, 24.00 Uhr, per E-Mail an: Publikumsjury@derStandard.at Mehr auf dSt.at/publikumsjury

[ K S R ] (UK) AFAR (DE) Anoraak (FR)
Baby Smith (DE) Beaks (AT) Creams (GE)
Ende (AT) Flora Hibberd (FR) Genn (UK)
Glazyhaze (IT) Gloin (CA) Holli (AT)
JØL (ES) Julia Rover (PL) KOIKOI (RS)
KuleeAngee (UK) Milo Korbenski (UK)
Mwita Mataro (AT) Rap&Vogue (BY)
Stone Sober (HU) Stina Holmquist (DE)
Sunnbrella (CZ) The Empty Threats (AU)
Ziferblat (UA) …more to come soon!




www.wavesvienna.com