

Franziska Barmettler



Franziska Barmettler
Trotz adressierter Gründe für ein Nein im 2021, überparteilicher Unterstützung, grossem Rückhalt aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie zuversichtlicher Hochrechnungen hatte die Vorlage zur e-ID an der Urne einen schweren Stand. Das äusserst knappe Ja zur e-ID ist Chance und Auftrag zugleich. Der Abstimmungssonntag zur staatlichen e-ID zeigt, wie wir in der Schweiz mit der digitalen Transformation umgehen. Wir gehen vorwärts, aber mit angezogener Handbremse. Vor vier Jahren wurde die e-ID wuchtig verworfen, diesmal haben wir dem Schweizer Stimmvolk nur knapp ein Ja abgerungen. Das ist ein Fortschritt. Zugleich ist der hauchdünne Entscheid zugunsten der e-ID ein Warnsignal. Offensichtlich ist: Die Schweizer Bevölkerung hat kein blindes Vertrauen, nicht in den Staat, nicht in die Wirtschaft und nicht in den technologischen Fortschritt. Und das ist auch gut so. Die Digitalisierungsskepsis weiter Teile der Bevölkerung liegt mit dem Abstimmungsergebnis auf der Hand. Die digitale Wirtschaft ist gefordert, die bestehenden Vertrauensund Verständnislücken zu schliessen. Dazu braucht es breitere Allianzen und einen vertieften gesellschaftlichen Dialog über die Chancen der Digitalisierung. Mit Blick nach vorne müssen einerseits die Anliegen der Bevölkerung bei der nun anstehenden Umsetzung der e-ID berücksichtigt werden. Gleichzeitig gilt es den konkreten Nutzen der e-ID im Alltag frühzeitig und für breite Teile der Bevölkerung sichtbar zu machen. Im Fall der e-ID sind wir überzeugt: Sobald sie verfügbar ist, wird sie schnell genutzt werden, denn die zuverlässige Identifikation von Menschen im Internet wird in Zeiten von Fake News immer wichtiger. Und wer die ID oder den Fahrausweis zu Hause vergessen hat, wird sicherlich froh sein, die e-ID auf dem Handy zu haben.

Die e-ID zeigt, wie die Schweiz die digitale Zukunft selbst in die Hand nehmen kann.
Die e-ID wird davon leben, dass wir sie überall nutzen können. Deshalb wird digitalswitzerland nun gemeinsam mit dem Bund und relevanten Akteuren konkrete Anwendungsfälle priorisieren. In runden Tischen mit Mitgliedern, Verbänden, Behörden und Expertinnen und Experten schärfen wir Anforderungen, klären Zuständigkeiten und definieren das gemeinsame Vorgehen. Darauf aufbauend werden Pilotprojekte priorisiert, vorbereitet und in realen Umgebungen getestet.
Schliesslich zeigt die e-ID, wie die Schweiz die digitale Zukunft selbst in die Hand nehmen kann. Die e-ID ist eine Lösung «Made in Switzerland». Sie ist sicher, modern und souverän. Dieses aktive Handeln sollten wir uns auch in anderen Digitalisierungsfeldern zutrauen.
Die nächste grosse technologische Revolution ist bereits gestartet und geht rasant voran: die künstliche Intelligenz. Die Schweiz ist bereits gut aufgestellt, aber auch hier gilt es die Handbremse zu lösen und die Chancen ins Zentrum zu stellen. Mitte Oktober wird digitalswitzerland in Bern die Erarbeitung eines «AI Action Plans» für die Schweiz lancieren. Dieser Plan sieht vor, dass die Chancen und Herausforderungen von KI gemeinsam diskutiert, offene Fragen adressiert und Massnahmen im Austausch zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erarbeitet werden. Er soll auch dazu beitragen, dass die gesamte Schweizer Bevölkerung an dieser technologischen Entwicklung teilhaben kann.
Parallel dazu bereitet der Bund die internationale Bühne für die Schweiz vor und bringt die wichtigste internationale KI-Konferenz, den Global AI Summit, 2027 nach Genf. Nach der e-ID ein weiteres Momentum, das es zu nutzen gilt.
Auch hier wird es breite Allianzen und viel Dialog brauchen. Dies klingt nach intensiver Arbeit. Aber wenn wir diesen Weg nicht konsequent einschlagen, werden wir die Digitalisierung in der Schweiz nie ins Rollen bringen und stets mit angezogener Handbremse unterwegs sein. Was uns angesichts der rasanten technologischen Entwicklung schon bald vor die nächsten grossen Herausforderungen stellen wird.
Text Franziska Barmettler, CEO digitalswitzerland
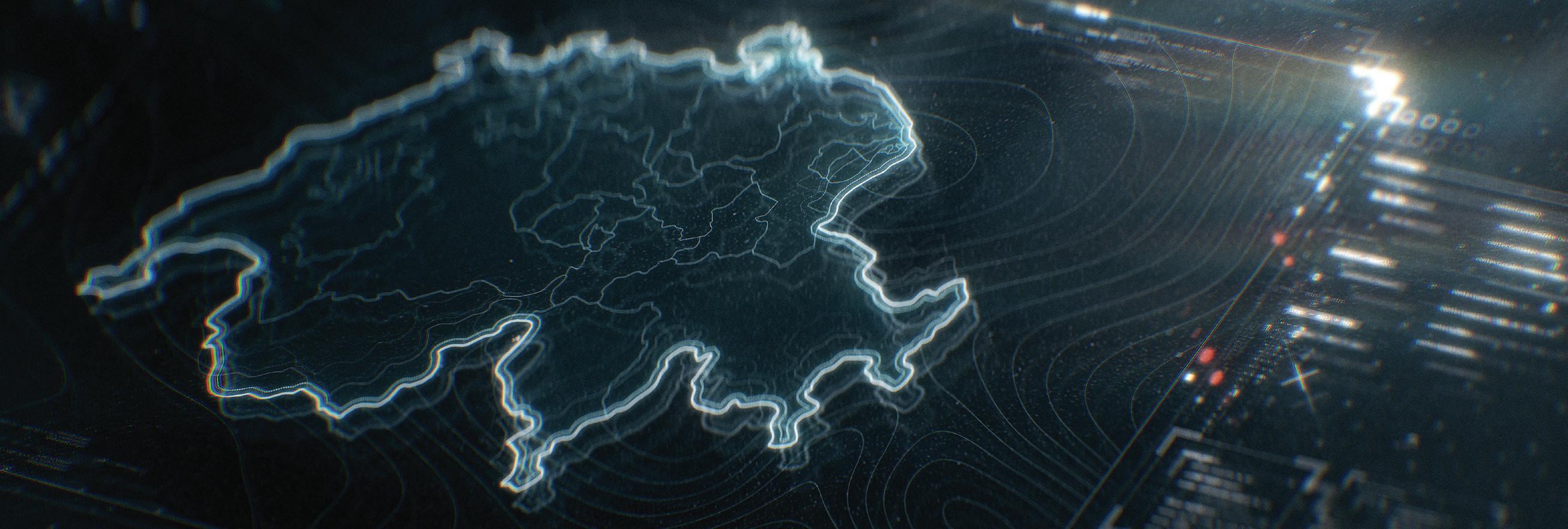
Brandreport • Digicomp
Lesen Sie mehr. 04 Quantencomputing 10 Interview: Catrin Hinkel 14 Cybersecurity 16 Interview: Maria Girone 18 Cloud-Computing 22 Digitale Transformation
Fokus Kampagnentitel.
Projektleitung
Jeton Radi
Country Manager
Pascal Buck
Produktionsleitung
Nicolas Brütsch
Layout
Mathias Manner
Text
Aaliyah Daidi, Max Wellenhofer, SMA Titelbild zVg
Distributionskanal
Finanz und Wirtschaft
Druckerei DZZ Druckzentrum AG
Smart Media Agency. Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz Tel +41 44 258 86 00 info@smartmediaagency.ch redaktion@smartmediaagency.ch fokus.swiss


Norina Peier
Gründerin und Inhaberin der gleichnamigen Firma für Organisationsentwicklung und Trainerin, Digicomp Academy
KI muss Teil der Unternehmensstrategie sein. Doch ohne klare Strategie bleibt sie wirkungslos. Entscheidend ist, sie konkret in die Unternehmensstrategie einzubetten, Prozesse klar zu definieren und Mitarbeitende einzubeziehen. Wie das gelingt, erklärt Norina Peier, Expertin für Organisationsentwicklung, im Interview.
Welche strategischen Fragen sollten vor der Einführung von KI im Unternehmen unbedingt geklärt werden? KI muss Teil der Unternehmensstrategie sein – und zwar nicht als abstraktes Zukunftsthema, sondern ganz konkret. Es sollte klar definiert sein, welche Prozesse sie übernimmt und warum. Diese Entscheidungen
dürfen nicht im stillen Kämmerlein getroffen werden, sondern müssen gemeinsam im Unternehmen diskutiert werden. Die Vorstellung, KI sei ein Wundertool, das automatisch alle Probleme löst – auch die, die man selbst noch gar nicht erkannt hat – ist schlicht falsch. KI ist eine Assistenz, kein Autopilot. Sie braucht klare Instruktionen, klare Ziele und eine klare Rolle. Was vorher nicht funktioniert hat, wird auch mit KI nicht plötzlich funktionieren. Vielleicht hilft ein Vergleich. Man würde einer neuen Mitarbeiterin auch nicht einfach sagen, «Frau Müller, schauen Sie sich mal in allen Abteilungen um und machen Sie, was Ihnen einfällt». Das funktioniert selten. Genauso braucht KI Orientierung – sonst bleibt sie wirkungslos. Was für eine Rolle spielt Identität bei der erfolgreichen Gestaltung einer KI-Strategie? Identität spielt eine zentrale Rolle. Viele Mitarbeitende empfinden KI als Bedrohung – nicht unbedingt wegen der Technologie selbst, sondern weil sie ihr berufliches Selbstverständnis infrage stellt. Deshalb ist es entscheidend, gemeinsam zu klären, welche Prozesse und Teilschritte künftig von KI übernommen werden. Wer zuhört, Ängste ernst nimmt und die Expertise der Mitarbeitenden einbezieht, schafft Vertrauen. Denn die Mitarbeitenden kennen die Abläufe, die Schwachstellen und die Potenziale für Verbesserung am besten. So entsteht Klarheit – und Klarheit nimmt Angst.
Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit theoretische Modelle zur Veränderung im Arbeitsalltag Wirkung entfalten können?
Theorie allein verändert nichts. Damit Modelle Wirkung entfalten, müssen Menschen sie verstehen, nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch. Sie müssen gemeinsam besprochen, im eigenen Kontext verortet und dahingehend überprüft werden, wo sie konkret helfen. Erst wenn Mitarbeitende erkennen, wie sie ein Modell für sich nutzen, anwenden und in ihren Alltag übersetzen können, entsteht echte Veränderung.
Fördern bestimmte Gestaltungsprinzipien die psychologische Sicherheit in Organisationen, die sich im Wandel befinden? Psychologische Sicherheit entsteht nicht durch einzelne Massnahmen, sondern durch eine Haltung, die sich in der Organisation spürbar zeigt. Es geht darum, dass Menschen ihre Meinung sagen dürfen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Dass sie ihre eigenen Werte einbringen können und erleben, dass diese gehört und respektiert werden. Wichtig ist auch, dass man gemeinsam etwas entwickelt – nicht jeder für sich, sondern im Miteinander. Fehler dürfen passieren, sie sind Teil des Prozesses. Und es braucht eine Kultur, in der man einander vergibt, in der nicht Perfektion zählt, sondern Lernbereitschaft.
Wie verändern sich Anforderungen an Führung, wenn menschliche und technologische Perspektiven in Einklang gebracht werden müssen?
Wenn technologische und menschliche Perspektiven zusammenkommen, verändert sich Führung grundlegend. Das Zwischenmenschliche rückt noch stärker in den Mittelpunkt. Es geht weniger darum, Aufgaben zu verwalten, sondern vielmehr darum, Menschen zu begleiten. Führung bedeutet dann, Orientierung zu geben, Vertrauen zu schaffen und Räume zu öffnen, in denen Zusammenarbeit möglich ist. Man führt nicht mehr von oben herab, sondern gemeinsam im Team.
Weitere Informationen unter: digicomp.ch/ai

Der wirtschaftliche Druck auf Schweizer Unternehmen steigt weiter. Die Frage nach der Profitabilität rückt daher in allen Branchen in den Fokus. Mit einer EBIT-Optimierung unterstützt Horváth Firmen dabei, nachhaltig resilient zu werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. «Fokus» wollte wissen, wie das funktioniert.


Herr Kollmer, Herr Klaus, welche sind die häufigsten Gründe, aus denen Unternehmen eine Managementberatung in Anspruch nehmen, und mit welchen Fällen sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit konfrontiert?
Andreas Kollmer: Das Spektrum an Unternehmen, die unsere Unterstützung suchen, ist breit gefächert. Es reicht von sehr leistungsfähigen Firmen, die ihre Resilienz weiter steigern und sich von «Good to Great» entwickeln möchten, bis hin zu Betrieben in kritischen Situationen. Diese schreiben vielleicht bereits Verluste oder haben sogar mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. In meiner Rolle habe ich hauptsächlich mit Unternehmen aus dem industriellen Sektor zu tun. Und obschon viele Schweizer Betriebe gut dastehen, ist der Handlungsdruck auch hier merklich gestiegen.
Karsten Klaus: Unabhängig von Branche oder Unternehmensgrösse haben Erhalt und Steigerung von Profitabilität und Margen aktuell oberste Priorität. Horváth kommt aus dem PerformanceManagement; die Unterstützung von Unternehmen bei der nachhaltigen EBIT-Optimierung ist eine unserer zentralen Dienstleistungen. Sie betonen, dass die EBIT-Optimierung für Unternehmen aller Branchen relevant ist. Doch der jeweilige Tätigkeitsbereich hat sicherlich Auswirkungen auf die Festlegung der konkreten Massnahmen?
Karsten Klaus: Selbstverständlich berücksichtigen wir den spezifischen Kontext jedes Kunden. Bei Horváth Schweiz sind wir erfolgreich für Unternehmen der produzierenden Industrie und Dienstleister, Chemie und Pharma, Banken und Versicherungen sowie den Versorgungssektor tätig. Bei uns arbeiten Branchen- und Fachexpertinnen und -experten eng zusammen, um bei unseren Kunden maximalen Mehrwert zu schaffen. So können wir deren aktuelle Performance einordnen, realistische Lösungswege aufzeigen und wirksame Massnahmen entwickeln. Benchmarks dienen uns dabei immer als Startpunkt, nie als das finale Ziel. Wie sehen jeweils die ersten konkreten Schritte in Richtung EBIT-Verbesserung aus?
Andreas Kollmer: Zuerst definieren wir gemeinsam mit dem Kunden in welchem Umfang die Profitabilität gesteigert werden muss – Massstab sind hier u. a. nachhaltig genügend Mittel für zukünftige Investitionen und Wachstum zu erwirtschaften. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob wir vorbehaltlos das gesamte Unternehmen in die Optimierung einbeziehen müssen oder uns vorab auf bestimmte Bereiche fokussieren können, weil der Handlungsbedarf dort offensichtlich und dringend ist. Auch eine gute Kommunikation zu planen, ist ein wichtiger Schritt zu Beginn eines solchen Projekts.
Karsten Klaus: Zu Beginn eines Projekts setzen wir den Fokus bewusst so, dass wir die zentralen Handlungsfelder sowohl kosten- als auch umsatzseitig identifizieren können. Der erste Blick soll die wesentlichen Potenziale aufzeigen. Kennzahlen wie Wachstumsraten, Deckungsbeiträge und Umsätze – aufgeschlüsselt nach Kunden, Produkten und Leistungen sowie Regionen – sind hierfür entscheidend, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Wie einfach ist es in der Praxis, an diese Daten zu gelangen?
Andreas Kollmer: Die Qualität der Daten erfordert oft eine gewisse Aufbereitung von
Horváth Ansatz zur EBIT-Verbesserung – zielsicher & schnell zu nachhaltig wirksamen Resultaten!
1. Potenzialanalyse – Ist -Situation – Baseline Umsetzungsentscheid
2. Aufsetzen & Umsetzen Programm
Unser Mehrwert – Branchenfokus & alles aus einer Hand: Lösung & Umsetzung, Change & wirksame Steuerung –Schnelligkeit & Realisierbarkeit – Senior Experts & ehemalige C-Levels – «Return on Consulting» aus Prinzip Kommunikation & Change
Zuerst definieren wir gemeinsam mit den Kunden das Ziel. Meistens geht es darum, die Profitabilität signifikant zu steigern.
– Dr. Andreas Kollmer, Experte Manufacturing Industries
unserer Seite – KI ist hier bereits heute ein wichtiges und effektives Instrument in unserer Praxis geworden, um eine gemeinsame Absprungbasis zu legen. Entscheidend für die weitere Arbeit sind eine gemeinsame Einschätzung und Verständnis für das sich ergebende Bild.
Sobald Sie dann die initialen Daten analysiert haben – wie leiten Sie daraus konkrete Massnahmen zur EBIT-Steigerung ab?
Karsten Klaus: Es ist uns ein grosses Anliegen, die Antworten entlang von Suchfeldern gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln. Schliesslich kennen sie ihr Unternehmen und ihre Situation am besten. Wir selbst bringen ein klares Bild für eine tragfähige Lösung mit an den Tisch. Gemeinsam gelangen wir zum Kern der Sache und definieren die optimalen Massnahmen. Die Dynamik des Umfelds erfordert es dabei, in Szenarien für die Umsetzung zu planen.
Andreas Kollmer: Sobald wir das erreicht haben, stellen wir die gemeinsame Verbindlichkeit mit dem Management her, bevor die Umsetzung startet.
Können Sie uns konkrete Beispiele nennen?
Karsten Klaus: Generell definieren wir Massnahmenpakete in den Feldern Produkt- und Leistungsportfolios, Pricing & Vertrieb, Operations & Supply Chain, Einkauf und Organisation & Overhead. Konkrete Massnahmen können beispielsweise den Stopp von margenschwachen Produkten umfassen, das Initiieren von Wachstum und Preiserhöhungen bei starken
Produkten, die Konsolidierung von Produktionsstandorten und -netzwerken oder Produktivitätssteigerungen mit Re-Design der Organisation und Digitalisierung.
Neben betriebswirtschaftlicher Expertise sind sicherlich auch Soft Skills gefragt, um diesen Prozess zu begleiten.
Andreas Kollmer: Absolut, die Kommunikation ist das A und O. Wir behandeln sie daher als integralen Bestandteil, der von Anfang an zusammen mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten sorgfältig geplant wird. Wir unterstützen das Management des Kunden, die richtigen Nachrichten zur richtigen Zeit zu vermitteln und wichtige Stakeholder, v. a. auch die Mitarbeitenden für die Sache zu gewinnen.
Kürzlich haben Sie die Ergebnisse der sechsten «Annual CxO Priorities Study» veröffentlicht. Worum handelt es sich bei der Studie – und wie lauten ihre wichtigsten Erkenntnisse?
Karsten Klaus: Für die Studie befragen wir jährlich über 1000 Top-Managerinnen und Top-Manager, um zu erfahren, welche Themen und Entwicklungen für unsere Kunden prioritär sind. In diesem Jahr hat sich gezeigt, dass Ertrags- und Kostenoptimierung branchenübergreifend neu höchste Priorität hat. Das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf das Thema künstliche Intelligenz. Der Tenor der Führungskräfte hierzu ist eindeutig: Die Technologie muss das Labor verlassen und im Geschäftsalltag einen realen, messbaren Mehrwert liefern.
Es ist uns ein grosses Anliegen, die Antworten entlang von Suchfeldern gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln.
– Karsten Klaus, Experte Strategie & Transformation
Andreas Kollmer: Gleich nachfolgend liegen folgerichtig die Prioritäten «Digital Transformation» und «Cyber Security» branchenübergreifend in der Top Drei. Neueinsteiger unter den Top Ten ist das Thema «Innovation und R&D». Um Unternehmen bei der EBITSteigerung nachhaltig unterstützen zu können, müssen Sie Entwicklungen und Trends antizipieren. Welche Themen stehen aktuell auf Ihrem Radar? Andreas Kollmer: Die Resilienz bleibt entscheidend, insbesondere, solange wir uns in einer verhältnismässig dynamischen Lage befinden. In diesem Zusammenhang sind KI und Digitalisierung wichtig, wobei wir uns auf Anwendungsfälle konzentrieren, die echte Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Das «Predictive Performance Management», also das Antizipieren und Steuern von Leistung in Echtzeit, ist in diesem Zusammenhang besonders spannend: Es ermöglicht die Simulationen von Szenarien, was die Planungsgenauigkeit und damit auch die Effizienz signifikant steigern kann.
Karsten Klaus: Einen Schritt weiter gedacht erweitert ein EBIT Improvement auch die strategischen Handlungsspielräume unserer Kunden – zum Beispiel für Investitionen in eine fokussierte Wettbewerbsstrategie, um der direkten Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und zusätzlichen Handlungsspielraum zu gewinnen.
Weitere Informationen unter: horvath-partners.ch

Über Horváth
Als unabhängige Unternehmensberatung mit über 1400 weltweit tätigen Mitarbeitenden ist Horváth ein starker Lösungspartner für Unternehmenssteuerung und Transformation und seit 1999 in der Schweiz präsent. Mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berät Horváth Schweizer Grossunternehmen sowie grosse Mittelständler und öffentliche Organisationen rundum kompetent in den Schweizer Landessprachen.
Die ganze Welt spricht pausenlos von KI. Doch dadurch tritt eine andere technologische Revolution, welche die Zukunft ebenfalls massgeblich prägen wird, in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund: das «Quantencomputing». Dabei bietet dieses enorme Chancen – zum Beispiel für den Schweizer Finanzplatz.

Dem Begriff «Quantencomputing» haftet ein Hauch von Science-Fiction an. Und tatsächlich erscheint das Potenzial, welches die Technologie birgt, beinahe fantastisch: Besonders die Rechenleistung und damit das grundlegende Potenzial für komplexe Anwendungsfälle ist unendlich grösser, als dies bei heutigen Computern der Fall ist. Stark vereinfacht ausgedrückt: Die Funktionsweise des Quantencomputings basiert auf den Prinzipien der Quantenmechanik, wodurch sich enorme Mengen an Operationen parallel durchführen lassen, was zu erheblich schnellen Lösungen führt, auch wenn deutlich komplexere Berechnungen notwendig sind. Um das Potenzial des Quantencomputings besser nachvollziehen zu können, hilft es, sich konkrete Use-Cases vor Augen zu führen. In der Schweiz liefert natürlich der Finanzsektor attraktive Einsatzbereiche für Quantencomputing. Denn wie Fachleute betonen, steigen die Anforderungen an die IT-Systeme von Banken stetig. Durch die kontinuierlich wachsenden Datenmengen sowie die Verbreitung von KI könnten die Systeme auf Dauer überfordert werden. Im Risikomanagement und der Risikoüberwachung könnten Quantencomputer dank ihrer enormen Prozesspower nun die Analyse komplexer Abhängigkeiten zwischen Vermögenswerten und
Brandreport • QuantumBasel
Quantencomputing schafft industrieübergreifende Chancen und kann in jeder Branche neue Möglichkeiten eröffnen –vorausgesetzt, man hat die notwendige Expertise und Infrastruktur, um diese zu ergreifen.
Derivaten sowie deren Echtzeitüberwachung verbessern. Im Portfoliomanagement wiederum können Quantencomputer Portfolios optimieren, indem sie parallele Berechnungen und bessere Simulationen durchführen – und so potenziell die Renditen verbessern. Und im Algo-Trading würden Quantencomputer effizientere sowie präzisere Algorithmen für den Handel an Finanzmärkten unterstützen. Selbst im Zusammenspiel mit KI eröffnen Quantencomputer ganz neue Möglichkeiten: So beschleunigen sie etwa den Aufbau und das Training von KI-Modellen und gestalten diesen Prozess dadurch kostengünstiger.
Neue Anforderungen
Nebst diesen Chancen birgt das Quantencomputing allerdings auch neue Risiken, denen begegnet werden muss, insbesondere durch den Übergang zu quantensicheren Verschlüsselungsmethoden. Angesichts der Gefahr durch «Harvest now, decrypt later»-Angriffe und des langen Vorlaufs zur Einführung quantensicherer Kryptografie stellt Quantencomputing eine Herausforderung dar, die bereits heute ernst genommen werden muss. Vor diesem Hintergrund empfehlen Fachleute den Banken, ihre bestehenden Sicherheitspolicen kontinuierlich anzupassen und eine Roadmap zur Einführung quantensicherer
Kryptografie zu erarbeiten. Sie sollten zudem mit spezialisierten Organisationen und Forschungsinstituten zusammenarbeiten, um ihre Quantencomputing-Fähigkeiten stetig auszubauen. Das gilt indes nicht nur für den Finanzsektor: Quantencomputing schafft industrieübergreifende Chancen und kann in jeder Branche neue Möglichkeiten eröffnen – vorausgesetzt, man hat die notwendige Expertise und Infrastruktur, um diese zu ergreifen. Interdisziplinäre Kooperation ein Muss Um genau dies sicherzustellen, sind – wie bei jedem technologischen Innovationsschritt – die enge Zusammenarbeit zwischen Marktteilnehmern und Forschungsinstituten (von der ETH über das EPFL bis hin zur Uni Basel), kurze Kommunikationswege sowie eine hohe Anpassungsfähigkeit der Unternehmen notwendig. Dieses typisch schweizerische, interdisziplinäre Erfolgsrezept muss auch in Zukunft bestehen bleiben und gefördert werden. Glücklicherweise gibt es in der Schweiz bereits Organisationen, welche diesen Wissens- und Technologietransfer von der Forschung in die Wirtschaft vorantreiben. Dass man hierzulande bereits über kommerziell nutzbare Quantenrechner verfügt, ist ein Vorteil, den die hiesige Unternehmenslandschaft dadurch nutzen kann.
Was, wenn wir gerade Milliarden in die falsche KI-Wette setzen –und der eigentliche Durchbruch längst woanders passiert?
Die nächste KI-Generation entsteht nicht durch noch grössere Sprachmodelle, sondern durch robuste, datennahe Systeme und die gezielte Verbindung von KI und teilweise QuantumComputing. Erfahrungen mit Industriepartnern zeigen: Nach dem ersten Wow verpuffen viele Piloten aufgrund von Kosten, sich verändernden Daten, Halluzinationen, Vendor-Lock-in, Sicherheits- und Rechtsfragen. Entscheidungsträgerinnen und -träger fragen zu Recht: Wo ist der belastbare ROI?
Die Antwort: Hybrid-Intelligenz statt Monolith. QuantumBasel kombiniert moderne KI mit Quantum-inspirierten Verfahren und sauberem Engineering. Im Zentrum stehen zwei Bausteine:
1. QiML – Quantum-inspired Meta-Learning. Mehrere spezialisierte Modelle übernehmen, wofür sie am besten sind: Identifikation von Trends, Saisonalität, Baselines oder Ausreisser. Ein leichter Meta-Lerner gewichtet die Teilprognosen dynamisch. So passen sich Vorhersagen an Markt- und Prozesssprünge an, bleiben stabil bei sich verändernden Daten und sind ideal für What-if-Analysen. Auf Wunsch liefert QuantumBasel Dashboards, in denen Teams Parameter live variieren und sofort Effekte auf Kosten, Servicelevel oder Energiebedarf sehen können.
2. QiRL – Quantum-inspired Reinforcement-Learning. Wenn Daten fehlen, die Umgebung hochdynamisch ist oder keine saubere Gleichung existiert, lernt ein Agent durch gezielte Exploration. Quantuminspirierte Strategien beschleunigen das Lernen, reduzieren Rechenaufwand und finden belastbare Vorgehen. So entstehen bessere Routen, fairste Allokationen und resiliente Pläne – genau dort, wo klassische Optimierer an Grenzen stossen. Warum QuantumBasel? Das Unternehmen vereint Forschungstiefe mit Industriereife: physischer Zugang zu Quantenhardware am Campus, On-prem-Optionen für Datensouveränität, Verfügbarkeit von IonQ, D-Wave und IBM bis zu offenen Frameworks. Das Credo: Der erste Nutzen aus Quantencomputing ist hybrid. Deshalb werden Quantenalgorithmen dort integriert, wo sie heute Mehrwert bringen – etwa beim Umgang mit Ausreissern oder in extrem nicht linearen Mustern – und lassen den Rest effizient klassisch laufen. Das Ergebnis sind kleinere, schnellere und nachvollziehbare Modelle.
Aktuelle KI-Herausforderungen, die wir adressieren:
Kosten und Latenz:
Effiziente Modelle, schnelle Ergebnisse, auch direkt vor Ort
– Robustheit: Systeme, die sich laufend an neue Daten anpassen
– Sicherheit und Compliance: Nachvollziehbare Abläufe und Schutz von Daten und Rechten
– Talent: Lösungen, die mehrfach nutzbar sind statt teurer Einzelprojekte
Wirkung in der Praxis:
– Energie: Last- und Preisprognosen, Netzstabilität, Flex-Optimierung
– Logistik: Netzwerk- und Routenplanung
– Industrie: vorausschauende Instandhaltung, Durchsatz- und Qualitätssteuerung
– Finanz: Portfolios, Betrugsindikatoren, Szenariotests für Vertrieb und Risk
Das Entscheidende: QuantumBasel liefert nicht nur Modelle, sondern praktische Entscheidungsfähigkeit. Teams können Szenarien in intuitiven Oberflächen durchspielen – was passiert, wenn die Nachfrage um sieben Prozent steigt, eine Linie ausfällt oder ein Preisdeckel greift. KI wird so vom Buzzword zum Steuerungsinstrument.
Das Fazit nach vielen Projekten: Die Zukunft liegt in robusten, hybriden KI-Architekturen, die reale Dynamik beherrschen und für Quantenhardware bereit sind.
Der nächste Quantensprung besteht nicht im Grösserwerden, sondern im Klügerwerden: in hybriden KI-Quanten-Systemen, die robust, adaptiv und zukunftssicher sind. QuantumBasel verwandelt Datenökosysteme in eine lernende Pipeline – hochpräzise, auditierbar und Quantum- ready. Wer morgen vorn sein will, beginnt heute damit. QuantumBasel zeigt, wie diese Zukunft bereits beginnt und liefert Projekte, Infrastruktur und das notwendige Ökosystem für Quantum-Computing und KI – digital souverän mit der Hardware vor Ort in der Schweiz.
Weitere Informationen unter: quantumbasel.com




Seit über 40 Jahren begleitet die Abacus Research AG Schweizer Unternehmen aller Grössen und Branchen durch die digitale Transformation. Ob Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, HR, Auftragsabwicklung oder Produktionsplanung – die modulare ERP-Software sorgt für Effizienz, Transparenz und Swiss-Made-Qualität.
Als die Arbeitswelt vor einigen Jahren noch vom Megatrend Digitalisierung geprägt war, reagierte Abacus mit der Gründung der DeepCloud AG. Damit vollzog das Unternehmen den entscheidenden Schritt vom klassischen ERP hin zur digitalen Plattform: Daten, Prozesse und externe Systeme wurden vernetzt und die Basis für neue Geschäftsmodelle geschaffen. Heute geht das Unternehmen erneut einen Schritt weiter: Mit Abacus Intelligence beginnt das Zeitalter der künstlichen Intelligenz in der Business-Software. Eine neue Generation von Business-Software Die menschliche Sprache wird zum primären Mittel der Interaktion mit Software und Computern. Der Trend geht klar weg davon, dass Menschen lernen müssen, Software zu bedienen. Stattdessen wird Software so entwickelt, dass sie Menschen versteht – ihre Sprache, ihre Absichten und ihre Arbeitsweise. Mit Abacus Intelligence setzt Abacus diesen Wandel in die Praxis um: Über 2300 Programme und Applikationen, genutzt von mehr als 65 000 Unternehmen in allen Branchen, sprechen jetzt dieselbe Sprache – die der Anwenderinnen und Anwender. KI ist dabei nicht ein zusätzliches Feature, sondern das Fundament einer neuen Generation von Business-Software. Abacus Intelligence agiert wie eine digitale Assistenz, die Kontexte versteht, Workflows anstösst und auch komplexe Geschäftsprozesse automatisiert.
Eigenentwickelte KI für maximale Unabhängigkeit
Herzstück von Abacus Intelligence ist eine IntentEngine, die natürliche Spracheingaben interpretiert, in Geschäftslogik übersetzt und direkt ausführt. Dazu nutzt Abacus ein eigenes Large Language Model (LLM), das mit kuratierten, geschäftsrelevanten Daten trainiert wurde. Statt auf Cloud-Dienste von OpenAI, Google oder Microsoft zu setzen, betreibt Abacus seine Modelle im eigenen Rechenzentrum im Tessin. Das garantiert Datensouveränität und die Einhaltung der Schweizer Datenschutzgesetze, da keine Informationen das Land verlassen und keine Daten ins Internet gelangen. Zudem fliessen Kundendaten nicht zurück ins Modelltraining, sodass selbst sensible Finanz- und Personaldaten geschützt bleiben. Starke Partnerschaften für ein robustes Ökosystem Gemeinsam mit ausgewählten Technologie- und Infrastrukturpartnern stellt Abacus sicher, dass Abacus Intelligence nicht nur technologisch führend ist, sondern auch den höchsten Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance gerecht wird. Mit dem Partner Artificialy entwickelt Abacus Sprach- und Computer-VisionModelle, die es ermöglichen, mit der Business-Software in natürlicher Sprache zu interagieren – sowohl gesprochen als auch geschrieben. Darüber hinaus kooperiert Abacus mit dem Institut für Data Science der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo der
Fokus auf der Echtzeitverarbeitung gesprochener Sprache liegt, und mit Tinext, die die KI-Infrastruktur im Rechenzentrum im Tessin hostet.
Dialektkompetenz als Produktivitätsboost Ein Alleinstellungsmerkmal ist die SchweizerdeutschKompetenz: Das selbst entwickelte Sprachmodell versteht Züritüütsch, Baseldytsch oder Wallissertitsch genauso zuverlässig wie Hochdeutsch. «Wir wollen, dass unsere KI nicht nur Hochdeutsch versteht, sondern auch Dialekt – so wie die Menschen im Unternehmen miteinander sprechen», sagt Raffaelle Grillo, COO der Abacus Research AG. Da viele Nutzerinnen und Nutzer Spracheingabe bereits aus dem Alltag kennen – etwa durch WhatsApp-Sprachnachrichten –, knüpft Abacus bewusst an dieses Verhalten an. Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Mit der mobilen App AbaClik AI können Mitarbeitende beispielsweise ihre Arbeitszeiten mit mehreren Pausen bequem auf Mundart ins Smartphone sprechen. «Keine Eingabeart ist schneller, als zu sprechen», sagt Raffaelle Grillo. Abacus Intelligence erkennt den Dialekt, wandelt die Eingabe in eine präzise Zeitbuchung um und schreibt sie direkt in die Abacus Zeiterfassung. Kein manuelles Eintippen, kein Nachbearbeiten.

So verändert die KI schon heute den Geschäftsalltag
Mit der Abacus Version 2025 ist der KI-Assistent direkt im AbaMenu und im MyAbacus verfügbar, dem zentralen Einstiegspunkt für alle Userinnen und User. Ohne zusätzliche Installation oder separate Log-ins steht die künstliche Intelligenz sofort bereit. Sie beantwortet Fragen zur Software oder zu fachspezifischen Inhalten, stösst auf Wunsch Prozesse an, ermöglicht es, mit Dokumenten wie dem Personal- oder Spesenreglement zu chatten, und liefert auf Abruf die relevanten Reglemente. Das Ergebnis: weniger Klicks, weniger Zeitaufwand, weniger Fehler – dafür schnellere Entscheidungen.
– Finanzbuchhaltung: Statt Kontonummern zu suchen, reicht die Eingabe «Buche 250 Franken auf Konto Büromaterial». Die Intent-Engine erstellt automatisch den Buchungssatz.
– MWST-Prozess: Die KI führt Schritt für Schritt durch die Abrechnung, erkennt fehlende Belege und gibt Hinweise zur Korrektur.
– HR- und Lohnwesen: Mitarbeitende können Abwesenheiten per Chat melden, Personalabteilung oder Vorgesetzte erhalten sofort Benachrichtigungen.
– Reporting in den Finanzen: «Zeig mir die Bilanz und vergleiche sie mit dem Vorjahr» – die Software erstellt direkt eine Auswertung.
– Dokumentenrecherche: Verträge oder Reglemente lassen sich mit einer einfachen Frage durchsuchen – die KI zeigt relevante Absätze an, nicht nur Dateinamen.
für die nächsten Jahre. «Wir haben uns bewusst für die Entwicklung eines eigenen KI-Modells entschieden, damit wir die Daten jederzeit unter Kontrolle haben und sie nicht ins Internet gelangen», erklärt Alexander Vegh, CAIO der Abacus Research AG. «So können wir sicherstellen, dass keine Kundendaten zum Training externer Modelle verwendet werden und die KI möglichst keine Halluzinationen produziert. Für uns war klar: KI darf nicht einfach ein zusätzliches Modul sein, sondern muss das Fundament der gesamten Business-Software bilden.» Intelligenz, die den Unterschied macht Abacus Intelligence steht für einen Wendepunkt: ERP-Software wird vom passiven Werkzeug zum aktiven Partner im Arbeitsalltag. Sie versteht die Sprache der Menschen, ihre Absichten und ihre Arbeitsweise – und reagiert in Echtzeit. Das bedeutet weniger Routinearbeit, weniger Klicks und mehr Raum für das Wesentliche: Entschei-
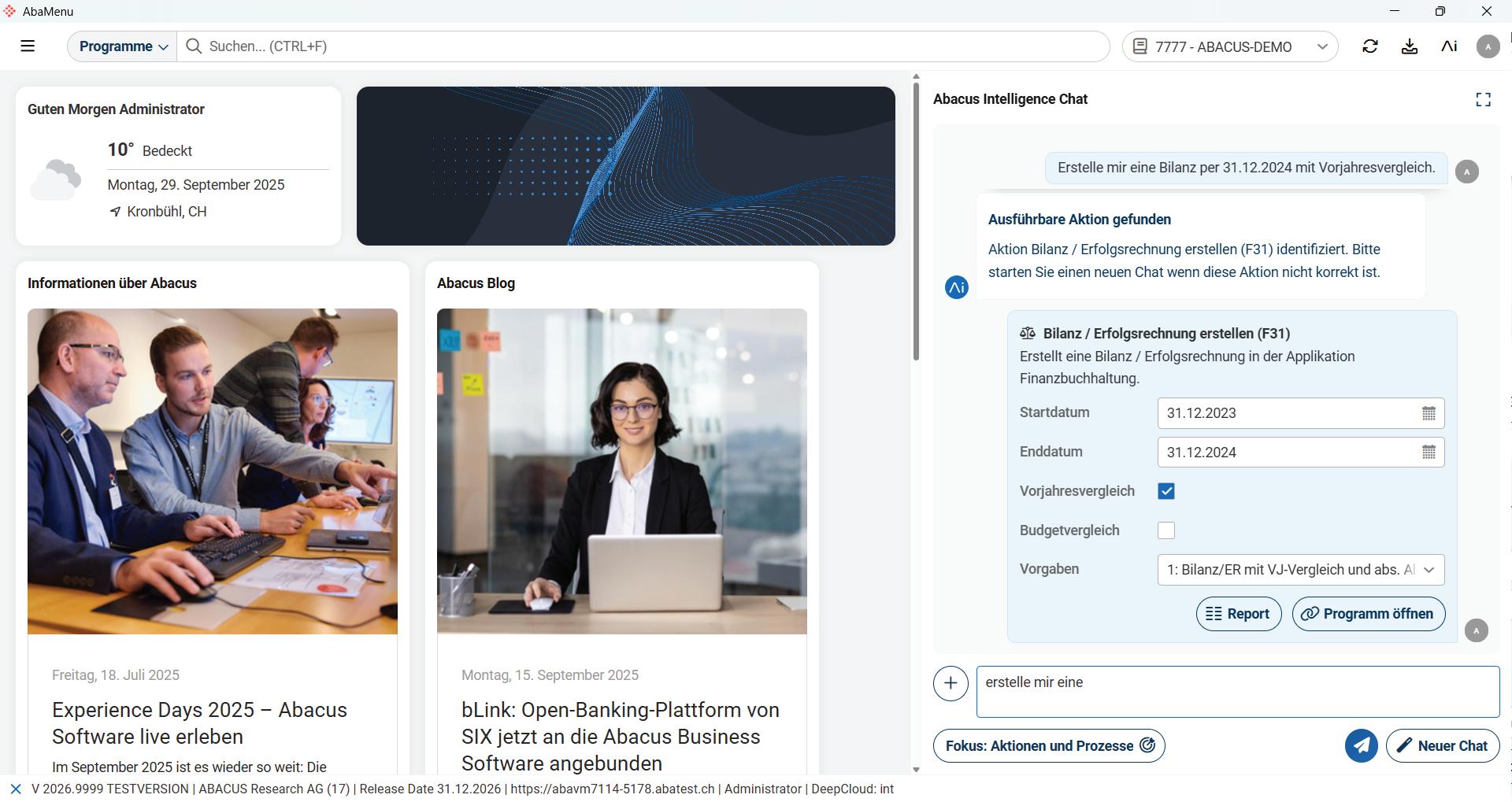
KI-gestützte Sicherheit und Verlässlichkeit Neben Produktivität steht Sicherheit im Mittelpunkt. Abacus Intelligence berücksichtigt Zugriffsrechte, die heute bereits konfiguriert sind. So sehen Mitarbeitende nur, was sie sehen dürfen. Ein weiteres zentrales Qualitätsmerkmal von Abacus Intelligence ist die Transparenz in der Kommunikation. Das Modell wird so trainiert, dass es möglichst keine erfundenen Antworten liefert, sondern offen angibt, wenn Informationen fehlen oder Daten nicht verfügbar sind. Damit wird Abacus Intelligence zum verlässlichen Assistenten im Arbeitsalltag.
Dem Markt voraus Während viele ERP-Anbieter ihre Lösungen noch in Pilotprojekten testen, hat Abacus seine Lösung breit ausgerollt. Kundinnen und Kunden arbeiten heute produktiv mit Abacus Intelligence. Mit der Ernennung eines Chief AI Officer (CAIO) in die Geschäftsleitung macht Abacus klar: Künstliche Intelligenz ist nicht nur Technologie, sondern Teil der Unternehmens-DNA und strategischer Wegweiser
dungen treffen, gestalten und vorwärtsgehen. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Schweiz, die Prozesse werden schneller und sicherer, und die Nutzererfahrung wird von Grund auf neu gedacht. Abacus zeigt damit nicht nur, wie ERP-Software in Zukunft aussehen wird: intelligent, nah am Menschen und in Swiss-Made-Qualität.
Weitere Informationen unter: abacus.ch
Die Grenzen zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Effizienz verschwimmen. Das hat auch Auswirkungen auf die Kommunikation von Unternehmen. Im Gespräch erörtern zwei Experten, wie KI nicht nur Geschäftsprozesse revolutioniert, sondern auch die Unternehmenskultur und die Arbeitsweise grundlegend verändert.


Herr Bojer, Herr Jain, was bedeutet für Sie persönlich «Future of Technology» – und wo sehen Sie die grössten Umbrüche in den nächsten fünf Jahren?
Alexander Bojer: Der Begriff steht meines Erachtens für Innovationen, die unser Leben verbessern. In den nächsten fünf Jahren sehe ich die grössten Umbrüche im Feld der KI, die bestehende Arbeitsprozesse sowie unseren Alltag allgemein revolutionieren werden. Ebenfalls sehe ich Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energien – darunter Lösungen, um den steigenden Strombedarf für KI zu decken, ohne das Klima weiter zu belasten. Pranay Jain: Unser Fachgebiet liegt in der «Conversational AI» – also KI, mit der man sich unterhalten kann. Für mich markiert diese die «Future of Technology». Die grösste Disruption erwarte ich dementsprechend im Wechsel von Chatbots hin zu agentenbasierten KI-Systemen, die Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende abdecken. Zudem werden Echtzeit-Sprache, multimodale Interaktionen sowie «Privacy by Design» zum Standard werden.
Wie positioniert sich Inacta als Partner und Integrator im Schweizer Markt, wenn es um künstliche Intelligenz und Automatisierung geht?
Alexander Bojer: Seit über 15 Jahren bieten wir mit Inacta praxisnahe, skalierbare Lösungen zur Automatisierung von Prozessen, wodurch wir die Produktivität unserer Kunden steigern und Wettbewerbsvorteile schaffen. Im Fokus stehen KI-gestützte Services, etwa im Input-Management (automatisierte Erfassung und Analyse von Dokumenten und Daten), in der Kundenkommunikation mit Conversational AI sowie individuelle Softwareentwicklung mit Low-Code und KI-Technologien, die nahtlos in bestehende Systeme integriert werden.
Herr Jain, Enterprise Bot (EB) gehört zu den führenden Anbietern von Conversational AI – was unterscheidet Sie von globalen Playern wie Microsoft oder Cognigy/Nice?
Pranay Jain: Obschon es einige globale Akteure auf dem Markt gibt, bieten die meisten nur fragmentierte Lösungen an. Zum Beispiel decken sie nur Sprache, E-Mail oder Chat ab. EB wiederum gehört zu den wenigen globalen Omnichannel-Plattformen, die alle drei Kanäle abdecken, was es unseren Kunden ermöglicht, eine einzige KI für sämtliche Kanäle zu nutzen, den Aufwand dadurch zu reduzieren sowie die Skalierbarkeit zu erhöhen. Wir bieten On-Premise-Installationen für stark regulierte Branchen und Kunden an und stellen eines der grössten Sprachsortimente für die Sprachverarbeitung zur Verfügung – einschliesslich Schweizerdeutsch. Welches gemeinsame Ziel verfolgen Inacta und Enterprise Bot mit ihrer Partnerschaft und warum ist dieser Schulterschluss für den Markt relevant? Alexander Bojer: Wir verfolgen mit unserer Partnerschaft das gemeinsame Ziel, durch die Integration von Conversational AI die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen, indem wir die Kundeninteraktionen über Kanäle wie Chat, E-Mail und Voice automatisieren, die Prozesseffizienz steigern und das Kundenerlebnis radikal verbessern. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie erreichen das Kundenservicecenter jedes Unternehmens rund
Wir sehen in sämtlichen Firmen eine höhere Produktivität, da repetitive Aufgaben automatisiert werden. Dies führt zu einer Kultur, die stärker auf Innovation, Agilität und kontinuierliches Lernen ausgerichtet ist.
– Alexander Bojer, CEO Inacta
darüber zu führen, was wir von KI-Technologie heute, in fünf sowie in zehn Jahren erwarten. Zudem sollten wir KI als Ergänzung und nicht als Ersatz für unsere grossartigen Teams sehen. Welche Fähigkeiten brauchen Mitarbeitende künftig, um mit KI-Systemen produktiv zusammenzuarbeiten?
Alexander Bojer: Hierfür benötigen Mitarbeitende eine Kombination aus technischen, analytischen und sozialen Fähigkeiten, die sich an die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung anpasst. Technisch im Sinne, dass Kenntnisse über die generelle Funktionsweise von KI, maschinellem Lernen und Automatisierung wichtig sind, um mit diesen Systemen effektiv zu interagieren. Analytisch, da Mitarbeitende in der Lage sein müssen, KI-Analysen zu nutzen, Daten zu interpretieren und kritisch zu bewerten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
um die Uhr, auch am Wochenende, ohne Wartezeiten – das ist bereits heute dank Conversational AI Realität – und Unternehmen, welche diesen Service nicht anbieten, werden Wettbewerbsnachteile haben.
Pranay Jain: Generell besteht das gemeinsame Ziel darin, die Einführung von sicherer, konformer KI in der Schweizer Finanzbranche zu beschleunigen. Während Inacta die Kundenfirmen auf ihrer Digitalisierungsreise begleitet, sorgt unsere Plattform für regulierte Automatisierungen, die echten Mehrwert bringen. Das ist gerade jetzt, wo der Fachkräftemangel zunimmt und der Bedarf nach schnellen, risikoarmen Pilotprojekten steigt, essenziell.
Conversational AI ist längst mehr als ein Chatbot. Können Sie uns ein Beispiel geben, wie Ihre Technologie komplexe Geschäftsprozesse in Banken oder Versicherungen abbildet?
Pranay Jain: Nehmen wir die Versicherungsbranche zur Veranschaulichung: Conversational AI kann von der ersten Schadenmeldung bis zur Auszahlung alle versicherungstechnischen Punkte abdecken, von der Erfassung des Vorfalls über die Überprüfung der Police bis hin zur Vorabbeurteilung und Erstellung der Meldung im Schadensystem. Und in den nächsten zwei Jahren wird noch viel mehr möglich werden.
Welche Rolle spielen LLMs (Large Language Models) und RAG (Retrieval-Augmented Generation) konkret in Ihren Lösungen –und wie stellen Sie sicher, dass Antworten präzise und regelkonform sind?
Pranay Jain: LLMs und RAG spielen eine wichtige Rolle und der Markt hat sich sogar über RAG hinaus zu KI-Agenten entwickelt. Doch unabhängig davon, ob es sich um RAG, KI-Agenten oder eine andere Nutzung von LLMs handelt, ist die Verankerung der Technologie der wichtigste Aspekt, um sicherzustellen, dass die Antworten auf den Unternehmensrichtlinien basieren sowie präzise und konform sind. Dies ist einer der Gründe, warum sich Unternehmen wie Swica, Generali, SIX und viele andere Finanzdienstleister für uns entschieden haben. Wie verändern KI-Agenten demnach das Verhältnis zwischen Unternehmen, Kundschaft und Mitarbeitenden?
Pranay Jain: Wir stellen fest, dass sich die Beziehungen zwischen Unternehmen, Kund:innen und Mitarbeitenden durch schnellere Lösungen sowie einem Plus an Kapazität für die Mitarbeitenden festigen. Die Belegschaft kann sich stärker auf die Kundschaft statt auf repetitive Aufgaben konzentrieren, was einen näheren und kundenorientierteren Service fördert. Die Tatsache, dass sich unsere Lösungen dank optimierter Schnittstellen unkompliziert in bestehende Systemlandschaften integrieren lassen, erleichtert die Umstellung zusätzlich.
Wie verändert KI die Unternehmenskultur in Schweizer Firmen – insbesondere bei Mitarbeitenden, die Automatisierung kritisch sehen?
Alexander Bojer: Wir sehen in sämtlichen Firmen eine höhere Produktivität, da repetitive Aufgaben automatisiert werden. Dies führt zu einer Kultur, die stärker auf Innovation, Agilität und kontinuierliches Lernen ausgerichtet ist. Diese Veränderungen und die Geschwindigkeit, mit der sie gerade passieren, werden für viele Mitarbeitende eine Herausforderung darstellen, mit der die Unternehmen umgehen werden müssen.
Pranay Jain: Wir beobachten unsererseits eine steigende Akzeptanz von KI bei unseren Schweizer Mitarbeitenden. Selbst als «AI-first»Unternehmen beschäftigen wir eine gesunde Mischung aus Vorreitern und Skeptikern – und das ist sehr wichtig, um von den Produktivitätssteigerungen zu lernen, aber auch vom negativen Feedback der Skeptiker:innen, um die Erfahrung kontinuierlich zu verbessern. Der beste Weg zur Akzeptanz besteht nicht darin, KI als separates Werkzeug hinzuzufügen, sondern darin, sie in die Aufgaben und Plattformen einzubetten, die Unternehmen bereits nutzen. Der wichtigste Teil ist jener, eine Diskussion
Alexander Bojer: KI-Agenten verändern dieses Verhältnis tiefgreifend. Sie ermöglichen beispielsweise einen 24/7-Kundenservice und personalisierte Angebote, was die Zufriedenheit der Kund:innen steigert. Unpersönliche KI-Interaktionen hingegen können das Kundenvertrauen mindern, besonders in datenschutzsensitiven Branchen – daher sind eine professionelle Integration im Rahmen der Einführung von KI-Agenten sowie eine laufende Verbesserung in den ersten Monaten essenziell.
Zudem schaffen wir Klarheit, bevor wir skalieren, denn eine klärende Frage im Vorfeld ist besser als tausend Wiederholungen. Kurz gesagt: Bei uns legt Kreativität die Regeln fest und Effizienz wendet sie fehlerfrei an.
– Pranay Jain, CEO Enterprisebot.ai
Und sozial, um klare Anweisungen an KI-Systeme zu formulieren – das sogenannte «Prompt Engineering» – sowie ein Bewusstsein für ethische Fragen zu entwickeln, das es ermöglicht, verantwortungsvoll mit KI umzugehen.
Pranay Jain: Klare Kommunikation ist der Schlüssel. KI ist wie ein Mensch: Je besser und klarer Sie Ihre genauen Bedürfnisse kommunizieren oder ein eindeutiges Feedback geben, was schiefgelaufen ist, desto besser kann sie Ihre Anforderungen erfüllen. Das klingt nach einer simplen Fähigkeit, sie ist aber tatsächlich Mangelware. Glücklicherweise werden wir Menschen im Laufe der Digitalisierungsreise zunehmend besser darin.
Zum Schluss: Wie gehen Sie in Ihren Unternehmen mit der Balance zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Effizienz um?
Alexander Bojer: Bei Inacta wird eine Kultur der Innovation und der Zusammenarbeit innerhalb der Firma sowie gemeinsam mit unserer Kundschaft gelebt. Die Kreativität bei der Problemlösung und die Flexibilität in der Umsetzung erfahren immer grössere Bedeutung und werden durch uns aktiv gefördert. Bei Inacta dürfen wir uns täglich mit neuen Technologien beschäftigen und diese in unserer täglichen Arbeit nutzen. Zu sehen, was alles möglich ist, ist äusserst spannend und bereichert unseren Arbeitsalltag.
Pranay Jain: Bei uns kümmert sich der Mensch um das «Warum», er verleiht also dem kreativen Akt Bedeutung; die KI wiederum steht für Wiederholung und Geschwindigkeit. Ideen werden bei uns per «Policy as Code» umgesetzt: Wir erstellen Prompts, Leitplanken, Evaluatoren sowie ein Roll-back. Zudem schaffen wir Klarheit, bevor wir skalieren, denn eine klärende Frage im Vorfeld ist besser als tausend Wiederholungen. Kurz gesagt: Bei uns legt Kreativität die Regeln fest und Effizienz wendet sie fehlerfrei an.
Weitere Informationen unter: inacta.ch und enterprisebot.ai

«Wir

Dokumentationen von älteren Fahrzeugen, bei denen essenzielle Informationen nur in Papierform vorlagen und verzögerte Prozesse – die Bucher Municipal AG benötigte dringend eine Lösung, um Wartungsdaten für ihre diversen Fahrzeugmodelle schnell verfügbar zu machen. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeugen und Maschinen zur Reinigung und Sicherheit öffentlicher und privater Verkehrsflächen. Mit 2500 Mitarbeitenden weltweit liefert der Betrieb Lösungen für die Strassenreinigung, Kanalreinigung, den Winterdienst und die Abfallentsorgung. «Doch während man in den Zielmärkten stets innovativ und führend ist, wiesen die nachgelagerten Administrationsprozesse Optimierungspotenzial auf», erinnert sich Thorsten Korell, CEO von Option 4.0. Die Schweizer IT-Beratung betreut ihre Kundschaft über den gesamten Technologie-Lebenszyklus
hinweg. Sie ist von Microsoft als Solution Partner in den Bereichen Data & AI, Digital & App Innovation sowie Infrastructure akkreditiert –und war damit der perfekte Partner, um Bucher Municipal ins digitale Zeitalter zu begleiten. Die smarte KI Wie ging man dafür konkret vor? «Mithilfe von Microsoft-Azure-Technologien haben wir für Bucher Municipal eine KI-Chat-Anwendung entwickelt, die den Wartungsteams weltweit nun einen schnellen und präzisen Zugriff auf technische Daten ermöglicht», erklärt Korell. Der KI-Chatbot eliminiert zeitaufwendiges Suchen, beschleunigt Wartungsprozesse und steigert die Fahrzeugverfügbarkeit, was die Betriebskosten sowie die Effizienz erhöht. Hierfür war es wesentlich, dass man die Daten aus der bestehenden Systemlandschaft übernehmen konnte. Da Bucher Municipal bereits MicrosoftKunde war, gestaltete sich das Retrieval der Daten vergleichsweise einfach. «Und in rund sechs Wochen stand die KI-Lösung bereit, die dem Kunden jetzt das Leben erleichtert.» Dasselbe kann Option 4.0 für Firmen aller Branchen und Grössen anbieten.
Weitere Informationen unter: option40.com
Global Strategic Capital AG • Brandreport
Die Digitalisierung verändert Branchen und Unternehmen aller Art. Von dieser Dynamik können dank Global Strategic Capital auch Anlegerinnen und Anleger profitieren – denn die Research-Boutique und Anlageberaterin bündelt innovative Unternehmen und Technologien in attraktive Portfolios.

Daniel Brühwiler Gründer und CEO
Herr Brühwiler, weshalb ist «Future Technology» gerade jetzt ein entscheidendes Thema für Investorinnen und Investoren?
Weil Technologie heutzutage nicht mehr nur für einen spezifischen Sektor relevant ist, sondern sämtliche Branchen durchdringt und Unternehmen aller Arten und Grössen tangiert. Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur, Cybersecurity oder Quantencomputing verändern Geschäftsmodelle grundlegend. Darum verzeichnen diejenigen Firmen, welche die dafür notwendigen technischen Infrastrukturen zur Verfügung stellen und so zu Wegbereitern anderer Unternehmen werden, ein enormes Wachstum. Für Investorinnen und Investoren eröffnet diese Dynamik spannende Chancen auf überdurchschnittliche Renditen. Entscheidend ist jedoch, echte Trends von kurzfristigen Hypes zu unterscheiden.
Wo sehen Sie dementsprechend die Rolle von Global Strategic Capital im Umfeld dieser Innovationsführer?
Unsere Rolle ist komplementär: Während andere Firmen Innovationen entwickeln, übersetzen wir diese in attraktive Investitionsstrategien.
Auf diese Weise bieten wir Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu den Gewinnern der Transformation – mit aktiv gemanagten Portfolios, die
konsequent auf Zukunftstechnologien fokussieren. Unter anderem offerieren wir ein «AI Infrastructure Portfolio», ein «Quantum Computing Portfolio» sowie ein «NextGenTec Portfolio».
Wie kann man konkret in diese Innovationsthemen investieren?
Wir demokratisieren mit unserem Angebot das Feld, indem wir mithilfe ausgewählter Finanzinstitute digitale Investitionsplattformen anbieten. Bereits mit einer Anlage von 3000 Franken kann man an den verschiedenen Portfolios partizipieren. Dieser Ansatz schafft maximale Transparenz und Agilität – diese Produkte kann man sogar «intra day» handeln. Sie haben eingangs erwähnt, dass man echte Trends von kurzfristigen Hypes unterscheiden müsse. Auf welche Kriterien stützen Sie sich bei der Analyse von Unternehmen?
Wir kombinieren klassische Finanzkennzahlen wie Wachstum, Margen sowie Kapitalrendite mit Innovationsfaktoren wie Patentqualität, Marktanteilen und F&E-Quoten. Nur wer technologisch führend ist, Skalierbarkeit beweist und über eine attraktive Wachstumsdynamik verfügt, wird in unsere Portfolios aufgenommen.
Welche Technologiefelder erachten Sie als derzeit besonders spannend?
Der Bereich «AI-Infrastrcture» ist aktuell zweifellos der essenzielle Treiber, da er den enormen Energie-, Hardware- und Softwarebedarf von KI-Anwendungen deckt. Unternehmen, die in diesem Segment tätig sind, werden ein enormes Wachstum verzeichnen. Man kann hier Parallelen zum amerikanischen Goldrausch in den 1850erJahren ziehen: Reich wurden nicht zwingend die Goldschürfer – sondern vor allem die Hersteller von
Schaufeln und Infrastrukturen. Dementsprechend gehören nicht nur die Anwender von KI-Lösungen zu den Gewinnern der Digitalisierung – sondern vor allem die Firmen, welche deren Einsatz erst ermöglichen. Ein weiteres attraktives Technologiefeld ist das Quantum-Computing. Dieses befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, besitzt aber bereits jetzt enormes disruptives Potenzial für Branchen wie Pharma-, Material- und Finanzmärkte.
Passive Anlagen wie ETFs haben sich in der Vergangenheit einer grossen Beliebtheit erfreut. Wie unterscheiden Sie sich von ETFs oder Standardfonds?
Der zentrale Unterschied liegt in unserer aktiven, hoch spezialisierten Selektionsstrategie: Während passiv gemanagte ETFs einen Marktindex lediglich abbilden, liegt unsere Expertise in der gezielten Identifikation und Auswahl derjenigen Unternehmen, die wir als künftige Wachstumsführer erachten. Unsere Portfolios sind zudem nicht nur fokussiert, sondern basieren auch auf einem proprietären Research-Ansatz, der es uns ermöglicht, jenseits der «breiten Masse» Mehrwert für unsere Investorinnen und Investoren zu schaffen.
Welche Rolle spielt Technologie in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Eine zentrale! Denn Technologie wird nicht mehr als isolierter «Sektor» betrachtet, sondern als ein Querschnittsthema, das sämtliche Industrien und Unternehmen durchdringt. Damit wird es auch zum Fundament eines jeden zukunftsorientierten und diversifizierten Portfolios. Die Fähigkeit, technologische Innovationen über alle Industrien hinweg zu bewerten und zu integrieren, wird dementsprechend zur Kernkompetenz im Investmentmanagement. Mit unserer Positionierung an dieser kritischen Schnittstelle zwischen Innovation
und Kapitalmarkt sehen wir uns in einer optimalen Ausgangslage, um diesen Wandel aktiv zu gestalten.
Bieten Sie auch Lösungen für Banken oder Vermögensverwalter an, die ihrer Kundschaft Technologie-Investments zugänglich machen möchten?
Das tun wir in der Tat, denn wir haben erkannt, dass eine Nachfrage nach spezialisierten technologischen Anlagestrategien auch auf institutioneller Ebene besteht. Aus diesem Grund entwickeln wir sogenannte «White-Label-Lösungen». Diese ermöglichen es Banken und Vermögensverwaltern, unsere sorgfältig konzipierten Strategien im Bereich der Zukunftstechnologien unter ihrer eigenen Marke anzubieten. Dies stellt für unsere Partner eine attraktive Möglichkeit dar, ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu hochinnovativen Investments zu verschaffen, ohne selbst die erheblichen Kosten und den Aufwand für den Aufbau einer eigenen Research- und Portfolio-Infrastruktur tragen zu müssen. Eine echte Win-win-Situation.
Weitere Informationen sowie das Interview in voller Länge unter: globalstrategic.ch

Generative KI ist zum Taktgeber der digitalen Transformation geworden. Während neue Modelle und Funktionen die Schlagzeilen bestimmen, zeigt sich in den Unternehmen ein anderes Bild: Viele stehen noch am Anfang ihrer KI-Reise, erproben erste Szenarien und suchen nach Orientierung. Häufig fordert das Topmanagement klassische Kennzahlen wie den Return on Investment (ROI) als Entscheidungsgrundlage. Wichtiger ist jedoch die Frage, wie sich echter Business-Value erschliessen lässt und wie der Schritt von individueller Produktivität zur Optimierung ganzer Prozesse gelingt.

Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland bei Campana & Schott, begleitet seit mehr als zwei Jahren Unternehmen auf diesem Weg. Im Interview erläutert er, warum sich der Mehrwert von generativer KI nicht in ROI-Formeln fassen lässt, welche Use-Cases bereits heute greifen und worauf Organisationen achten sollten, wenn sie von ersten Pilotprojekten zur breiten Einführung und strategischen Nutzung übergehen.
Herr Brunner-Nikolla, die Diskussion über generative KI ist allgegenwärtig. Wie erleben Sie die Stimmung in den Unternehmen: eher Euphorie oder Zurückhaltung? Beides. Viele Unternehmen spüren, dass hier ein Wendepunkt erreicht ist, und starten inzwischen auch grössere Vorhaben in Sachen generative KI. In den letzten zwei Jahren hatten viele Aktivitäten noch Pilotcharakter. Erste Anknüpfungspunkte fanden und finden Unternehmen meist in Anwendungen, die unmittelbar im Arbeitsalltag ansetzen – ein prominentes Beispiel ist M365 Copilot. Heute sehen wir immer häufiger Programme mit klaren Zielen, Budgets und Verantwortlichkeiten.
Gleichzeitig herrscht jedoch auch Unsicherheit. Viele beschreiben es, als stünden sie vor einem Berg, den noch niemand zuvor bestiegen hat. Was wir beobachten: Ohne strategische Implementierung bleibt es in der Regel beim ersten Projekt und die Initiative läuft aus, ohne Impact zu erzielen. Wo liegen aktuell die grössten Hürden, wenn es darum geht, den Schritt von ersten Pilotprojekten hin zu einer strategischen Implementierung zu schaffen?
Eine zentrale Hürde liegt darin, dass viele Unternehmen ohne ein stabiles Fundament starten. Oft fehlen saubere Berechtigungen, eine konsistente Klassifizierung von Informationen und klare Regeln für den Umgang mit Daten. Das führt zu Oversharing, also zum unbewussten oder zu grosszügigen Teilen von Inhalten ohne eindeutige Zugriffsbeschränkungen. Mit M365 Copilot werden solche Inhalte erst recht auffindbar, selbst wenn sie tief in Ablagen liegen. Deshalb braucht es klare Governance mit definierten Zugriffsrechten, Regeln und Verantwortlichkeiten. Hinzu kommen strukturelle Punkte. Oftmals tun sich Unternehmen schwer, von einem Pilotprojekt zu einem grossen Roll-out zu gelangen. Der Grund: Die eigentliche Zielsetzung, die mit dem Vorhaben erreicht werden soll, wird häufig vernachlässigt. Dann rückt die ROI-Frage in den Vordergrund, die nicht unbedingt der zielführende Messwert ist. Es bleibt bei einem Bottom-up-Ansatz, bei dem der kulturelle Wandel und das AI-Mindset nicht gleich stark forciert werden können und Unternehmen dadurch nicht schnell zum einfach messbaren Mehrwert in den Prozessen gelangen.
Können Sie das näher erläutern: Weshalb greifen klassische Erfolgskennzahlen an dieser Stelle zu kurz?
Viele Führungskräfte im Topmanagement verlangen vor einer Investition eine belastbare ROI-Rechnung, da sie es so auch aus anderen Projekten kennen. Im Fall von Copilot und generativer KI greift dieser Massstab jedoch zu kurz. Persönliche Produktivität lässt sich nur schwer in klassische Finanzkennzahlen übersetzen. Selbst wenn Aufgaben schneller erledigt werden, verschwinden die Kosten nicht automatisch aus der Organisation, denn die frei werdende Zeit wird vielmehr für andere Tätigkeiten genutzt. Der eigentliche Mehrwert entsteht deshalb nicht durch reine Kosteneinsparungen, sondern durch die Möglichkeit, in gleicher Zeit mehr Wert zu schaffen. Genau das verstehen wir unter Business-Value. In unseren Assessments machen wir diesen greifbar, indem wir etwa kürzere Durchlaufzeiten, geringere Fehlerquoten,
Eine zentrale Hürde liegt darin, dass viele Unternehmen ohne ein stabiles Fundament starten. Oft fehlen saubere Berechtigungen, eine konsistente Klassifizierung von Informationen und klare Regeln für den Umgang mit Daten.
– Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland
höhere Kundenzufriedenheit oder zusätzlichen Umsatz pro Kunde betrachten. Zusätzlich steigt die Employee-Experience und damit die Attraktivität der Arbeitgeber. Diese Faktoren sind aus meiner Sicht aussagekräftiger als kurzfristige Rentabilitätsrechnungen. Copilot und generative KI sind strategische Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit KI in der Fläche wirksam wird? Der erste Nutzen von KI entsteht häufig im Alltag: Routinetätigkeiten lassen sich schneller erledigen, Informationen sind leichter zugänglich und Mitarbeitende können produktiver und kreativer arbeiten.
Damit sich dieser Effekt nicht auf einzelne Projekte beschränkt, sondern in der Breite trägt, braucht es drei zentrale Rahmenbedingungen. Erstens eine AI-Ready Organization mit klaren Entscheidungswegen und Verantwortlichkeiten. Strukturen wie ein Center of Excellence bündeln Wissen, machen Erfahrungen unternehmensweit nutzbar und sorgen für kurze Entscheidungen. Zweitens AI-Ready Tools – eine technische Basis, die auf konsistenter Dokumentenklassifizierung und einem durchgängigen Berechtigungsmanagement aufbaut. Drittens AI-Ready People: Transformation beginnt beim Mindset. Mitarbeitende müssen befähigt werden, sich bei jeder Aufgabe zu fragen, wie KI sie konkret unterstützen kann und welchen Mehrwert sie dadurch schaffen.
Wie geht es weiter, wenn diese Grundlagen geschaffen sind?
Dann folgt der nächste Schritt: die Optimierung von Business-Prozessen, sowohl intern als auch dort, wo die eigentliche Wertschöpfung entsteht. Vom individuellen Produktivitätsschub geht es zur zweiten Stufe, in der der Mehrwert deutlich sichtbarer und auch berechenbarer wird. Ein typisches Beispiel ist HR. Viele Anfragen betreffen Informationen, die in Richtlinien oder Dokumenten bereits vorliegen. Ein HR-Agent kann solche Fragen direkt beantworten, die Zahl der Tickets sinkt und HR gewinnt Zeit für strategische Aufgaben. Durch die Anbindung bestehender Systeme lassen sich Anfragen nicht nur beantworten, sondern auch direkt umsetzen – etwa bei der Urlaubsplanung oder der Änderung persönlicher Daten. Ähnliche Effekte sehen wir beim Onboarding neuer Mitarbeitenden. In den ersten Wochen tauchen viele Fragen auf, die sich mit intelligenten Assistenten sofort klären lassen oder gezielt an die richtigen Ansprechpersonen weitergeleitet werden. Das erleichtert den Einstieg und verkürzt die Einarbeitungszeit.
Auch der Rechtsbereich profitiert. Bei der Prüfung umfangreicher Dokumente können
Agenten relevante Inhalte wie Garantiepflichten oder Fristen automatisch identifizieren. Risiken sinken, Abläufe beschleunigen sich. Gerade im Rechtsbereich zeigt sich zudem, dass durch den Einsatz von Agenten externe Kosten, etwa für Rechtsberatung, spürbar reduziert werden können.
Neben diesen universellen Szenarien entstehen zunehmend branchenspezifische Anwendungen, die direkt an wertschöpfende Prozesse andocken. Entscheidend ist, Systeme sinnvoll zu verknüpfen und Agenten orchestriert einzusetzen.
Ihr Unternehmen hat bereits mehr als 400 Copilot-Projekte begleitet. Welche Stolpersteine treten nach dem Start bei der Einführung und Nutzung von Copilot und generativer KI am häufigsten auf? Ein häufiger Stolperstein ist die Erwartungshaltung. Copilot ist ein starkes Werkzeug, aber kein Allheilmittel. Wenn ohne klare Zielarchitektur gestartet oder organisatorische Defizite ausgeblendet werden, entsteht schnell Ernüchterung.
Darüber hinaus erleben wir, dass das hohe Tempo zur Herausforderung wird. Allein 2024 gab es über 700 Updates und 150 neue Funktionen bei M365 Copilot. Unternehmen müssen diese Dynamik kanalisieren und ihre Mitarbeitenden Schritt für Schritt mitnehmen. Warten, bis die Technologie «fertig» ist, ist keine Option – wer zögert, verliert schnell den Anschluss. Gefragt ist vielmehr Agilität: Statt starren Planungen braucht es flexible Strukturen, die Anpassungen zulassen und kontinuierliches Lernen ermöglichen.
Wie gelingt es, Mitarbeitende auf dieser Reise mitzunehmen und mögliche Ängste in Motivation zu verwandeln? Der Schlüssel liegt in einem klaren «Why». Organisationen, die KI nur einführen, weil es alle tun, stossen schnell an Grenzen. Erfolgreich sind diejenigen, die von Beginn an definieren, warum sie starten und welches Ergebnis sie erreichen wollen. Das schafft Orientierung für Management, Projektteams und die gesamte Belegschaft.
Ebenso wichtig ist Transparenz. Risiken und Unsicherheiten sollten offen angesprochen werden, gleichzeitig machen konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag den Nutzen unmittelbar erfahrbar.
Und schliesslich braucht es Zeit. Transformation gelingt nicht nebenbei. Mitarbeitende müssen die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln. Oft reicht schon der erste Aha-Moment, um Begeisterung zu wecken. Unsere Aufgabe ist es, genau solche
Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen, den Wandel aktiv zu begleiten.
– Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland
Erlebnisse zu ermöglichen und praxisnahe Use-Cases bereitzustellen, die inspirieren und direkt weiterhelfen. Wenn KI zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags wird, wie verändert sich die Rolle des Menschen?
Ich sehe den Menschen klar in der Rolle des aktiven Gestalters. Technologie lässt sich nicht aufhalten, sie lässt sich nur mitgestalten. Wer diese Chance nicht nutzt, verliert an Relevanz. Mit dem Einzug von KI verschieben sich Aufgabenfelder: Routinetätigkeiten können stärker von Systemen übernommen werden, während für die Mitarbeitenden komplexere, kreative und strategische Aufgaben in den Vordergrund rücken. Das erfordert neue Fähigkeiten und eine Kultur, die den bewussten Umgang mit KI fördert.
Wichtig ist, die sozialen Aspekte nicht auszublenden. Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen, den Wandel aktiv zu begleiten. Ängste und Unsicherheiten gehören zu jeder technologischen Transformation, vergleichbar mit historischen Umbrüchen wie Elektrizität oder dem Internet. Auch damals gab es Verunsicherung – heute können wir uns ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Neben der Rolle des Menschen rückt auch die Rolle intelligenter Agenten in den Fokus. Aktuell wird viel über KI-Agenten diskutiert. Welche Bedeutung werden sie in den kommenden Jahren in Unternehmen haben? KI-Agenten sind die nächste Evolutionsstufe. Heute sehen wir erste Szenarien, in denen Agenten Informationen beschaffen oder einfache Aufgaben übernehmen. Der wirkliche Durchbruch kommt dann, wenn spezialisierte Agenten in Drittsysteme schreiben und komplexe Prozesse abwickeln können –immer orchestriert durch einen Process-Owner und abgesichert durch den Human in the loop. Damit ist gemeint, dass der Mensch weiterhin an entscheidenden Punkten eingreift, kontrolliert und korrigiert, um die Qualität und Verlässlichkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass die Agenten auch autonomer agieren können und werden. Damit entsteht eine ganz neue Form der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Unternehmen, die frühzeitig Erfahrungen sammeln, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Denn hier geht es nicht mehr um einzelne Tools, sondern um den Aufbau einer zentralen AI-Plattform, die Prozesse, Systeme und Menschen intelligent verbindet. Wer diese Entwicklung aktiv mitgestaltet, legt heute den Grundstein für die Wettbewerbsfähigkeit von morgen.
Weitere Informationen unter: campana-schott.com

Zur Person
Pascal Brunner-Nikolla ist Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland bei der Management- und Technologieberatung Campana & Schott. Darüber hinaus ist er Microsoft MVP im Bereich M365 Copilot und Copilot Agents. Als LinkedIn Top Voice erreicht er jährlich über vier Millionen Menschen und teilt regelmässig Einblicke rund um Copilot in Organisationen. Sein Newsletter «Copilot Your Day» erscheint wöchentlich am Montagmorgen und gibt praxisnahe Impulse für den erfolgreichen Einsatz von KI im Arbeitsalltag.
Krypto-Vermögenswerte haben sich als eigenständige Möglichkeit zur Diversifikation eines Portfolios etabliert. Sie fungieren nachweislich als wirksames Mittel gegen Inflation und Volatilität – und haben dabei überdurchschnittliche Renditen im Vergleich zu traditionellen Anleihen erzielt.
Kein Krypto-Exposure bedeutet ein höheres Risiko bzw. Opportunitätskosten
Bitcoin hat eine Performance geliefert, die in der modernen Finanzgeschichte ihresgleichen sucht. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg hat es nicht nur traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und Gold übertroffen, sondern dies mit bemerkenswerter Konstanz: Seit 2013 resultierte daraus eine annualisierte Rendite von rund 106 % sowie ein kumulativer Zuwachs von nahezu 900'000 %. In den übrigen drei Jahren musste Bitcoin deutliche Rückschläge hinnehmen und gehörte zu den schwächeren Anlageklassen – ein Hinweis auf die ausgeprägte Volatilität, die seine langfristige Outperformance begleitet. Trotz anhaltender Volatilität zeigt die Datenlage ein klares Muster: Die mehrjährige Dominanz von Bitcoin ist kein Ausreisser, sondern Teil eines nachhaltigen Trends der Outperformance. Für die Portfolio-Konstruktion positioniert sich Bitcoin damit weniger als spekulative Randerscheinung, sondern vielmehr als legitime, wachstumsstarke Komponente mit erheblichem Potenzial für langfristige Kapitalsteigerung.
Seit 2015 hat Bitcoin zudem konstant die sogenannten Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) übertroffen. Die Berechnung der jährlichen Wachstumsraten (CAGR) ab jedem einzelnen Einstiegsjahr zeigt, dass die annualisierten Renditen von BTC selbst die Erträge der erfolgreichsten Technologiewerte deutlich übertreffen. Einzige Ausnahme bildet der US-Chipkonzern Nvidia, der in einzelnen Szenarien – bei einer hypothetischen 100%-Allokation in nur diese Aktie – zeitweise eine höhere Rendite erzielen konnte. Unsere Analyse verdeutlicht jedoch, dass selbst eine konzentrierte Allokation in die bestperformenden Tech-Leader der letzten Dekade nicht mit der Wertentwicklung von Bitcoin mithalten konnte. Für langfristig orientierte Anleger unterstreicht dies die Rolle von Bitcoin als wachstumsstarkes Anlagegut mit hoher Überzeugungskraft, das selbst die dominierendsten Aktien des letzten Zyklus hinter sich lässt – und dies bei einem überlegenen Risiko-Rendite-Profil, hoher Liquidität und globaler Diversifikation.
Die Integration von Bitcoin in ein global diversifiziertes Portfolio verbessert sowohl die absolute Rendite als auch die risikoadjustierte Performance signifikant. Bereits eine Allokation von fünf Prozent in Bitcoin führt zu einer mehr als doppelt so hohen SharpeRatio im Vergleich zu einem traditionellen Portfolio ohne Krypto-Komponente Eine 10%-Allokation würde die Performance gar mehr als verdreifachen: Die annualisierte Rendite steigt von 6,5 % (0% BTC) auf 16,5 % (10% BTC). Damit wird die asymmetrische Chance auf langfristige Wertsteigerung trotz Volatilität deutlich. Bemerkenswert ist, dass der

“Die einzige Allokation, die keinen Sinn ergibt, ist null Prozent.”
Lyn Alden, Gründerin von Lyn Alden Investment Strategy
Anstieg der Gesamtvolatilität des Portfolios nur marginal ausfällt, da Diversifikationseffekte einen Grossteil der Rohvolatilität ausgleichen. Diese Verbesserungen treten selbst in einem konservativen Portfolio-Mix mit Gold und Geldmarktanlagen auf und unterstreichen die Rolle von Bitcoin als wertvolle Diversifikationskomponente. Entgegen weit verbreiteter Annahmen erhöht bereits eine moderate BTC-Allokation die Portfolioeffizienz erheblich – und macht Bitcoin zu einer überzeugenden Ergänzung für zukunftsorientierte Investoren mit Anspruch auf langfristige Outperformance.
Bitcoin-Allokationen unter 10 Prozent haben das Verhältnis von Risiko und Ertrag durchgängig verbessert.
bei verschiedenen BTC-Allokationen
Quelle: Bitcoin Suisse, Daten: TradingView, Stand: 11. August 2025
Die bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder eine Finanz-, Anlage- noch eine Handelsempfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Umfassende Krypto-Dienstleistungen
Bitcoin Suisse bietet Ihnen eine einzigartige Kombination aus ausgewiesener Krypto-Expertise, einem perfekt aufeinander abgestimmtes und flexibles Dienstleistungsangebot sowie einer persönlichen und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kundenbetreuung.
→ Krypto-Vermögenswerte handeln
Kaufen und verkaufen Sie über 65 Krypto-Vermögenswerte, darunter Marktführer wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).
→ Krypto-Vermögenswerte sicher verwahren
Schützen Sie Ihre Bestände mit unserer institutionellen, unabhängig geprüften Verwahrungslösung – dem Bitcoin Suisse Vault.
→ Attraktive Erträge erzielen
Profitieren Sie von Staking-Rewards, die regelmässig über den Branchenbenchmarks liegen – bei Krypto-Vermögenswerten wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Cardano (ADA).
Schützen Sie Ihre Kryptos mit dem grössten Krypto-Verwahrer der Schweiz
→ Bewährte Erfolgsbilanz
Seit 2013 steht Bitcoin Suisse für Kontinuität und Verlässlichkeit und bietet hochsichere Verwahrungslösungen für Privat-
personen, Unternehmen und institutionelle Anleger.
→ Robuste Infrastruktur
Durch modernste kryptografische Sicherheitsverfahren, strenge physische Schutzmassnahmen und redundante BackupSysteme gewährleisten wir den umfassenden Schutz Ihrer Krypto- Vermögenswerte.
→ Unabhängige Qualitätssicherung
Seit 2018 unterzieht sich die Bitcoin Suisse Vault jährlich einer ISAE-3402 Typ-2 Prüfung durch PwC – für geprüfte Sicherheit, Transparenz und Vertrauen.
Individuelle, persönliche Kundenbetreuung – Immer an Ihrer Seite
Entdecken Sie, wie Sie unsere Lösungen in den Bereichen Verwahrung, Handel und Staking nutzen können, um Ihr Portfolio mit Krypto-Vermögenswerten zu diversifizieren –einer Anlageklasse, die in den vergangenen zehn Jahren nachweislich zur Steigerung langfristiger, risikoadjustierter Renditen beigetragen hat. Scannen Sie den QR-Code – unsere Kundenbetreuung freut sich auf Sie.



Talk to the natives.
Die Schweiz ist weltweit als Innovationsstandort bekannt. Kein Wunder, werden die Chancen von KI mittlerweile vielerorts enthusiastisch ergriffen. Wo die spannendsten Potenziale liegen und wie man als Technologiepartner Firmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft begleitet, fragte Fokus bei Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, nach.
Interview SMA Bild zVg
Frau Hinkel, vor zwei Jahren durfte ich Sie zuletzt interviewen – technologisch betrachtet eine halbe Ewigkeit. Was waren die wesentlichen Entwicklungen in dieser Zeit für Microsoft? Wir haben in den letzten beiden Jahren einen fundamentalen Wandel erlebt, wie neue Technologien wie KI viele Bereiche der Wirtschaft umgestaltet haben. Wir sehen, dass KI in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Mit unserem kontinuierlichen und langfristigen Engagement in der Schweiz sind wir Teil dieses Wandels. Und auf diesem Fundament bauen wir auf: Im Juni dieses Jahres haben wir weitere Investitionen in die Schweiz angekündigt. Wir erweitern nicht nur Rechenzentren, sondern investieren in ein ganzes Ökosystem und stärken damit die digitale Souveränität des Landes. Das ist entscheidend für regulierte Branchen wie Banken und Versicherungen, für das Schweizer Gesundheitswesen und für KMU. Diese Demokratisierung von Zugang ist einzigartig und unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Schweizer Wirtschaft voranzutreiben. Ich habe noch nie eine Technologie erlebt, die so schnell adaptiert und produktiv genutzt wurde wie KI. Sie sagen, dass KI in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Was ist dementsprechend Ihrer Meinung nach «the next big thing» in diesem Feld? Die nächste Entwicklungsstufe ist Agentic AI. Bei diesen Agenten handelt es sich um KI-gestützte Softwarelösungen, die mit Mitarbeitenden oder in deren Auftrag arbeiten, indem sie Kontext erfassen, Aufgaben planen und Massnahmen ergreifen können. Viele unserer Kunden sind bereits auf diesem Weg. Die International Data Corporation erwartet bis 2028 rund 1,3 Milliarden Agenten. Unser Work Trend Index zeigt, dass 80 Prozent der Schweizer Führungskräfte der Ansicht sind, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für den strategischen Einsatz von KI ist. 72 Prozent planen, KI-Agenten als digitale Teammitglieder einzusetzen. Und 52 Prozent der Schweizer Unternehmen automatisieren bereits ganze Geschäftsprozesse mit KI, diese Zahl liegt über dem globalen Durchschnitt. Das ist nicht nur eine technologische Weiterentwicklung – es ist ein wirtschaftlicher Wendepunkt. Schweizer Unternehmen sind bei der Transformation führend. Wichtig dabei ist, dass die Technologie ein Co-Pilot bleibt und der Mensch steuert.
Die Schweiz nutzt KI also rege. Das passt zu ihrem Ruf als Innovationsstandort. Wie sieht die KI-Adoption bei Ihren Kunden konkret aus?
Wir sehen derzeit eine Transformation über alle Branchen hinweg. Die Finanzindustrie ist einer der führenden Sektoren in der KI-Anwendung. Die UBS zeigt beispielsweise, was strategische Implementierung bedeuten kann: 55 000 Copilot-Lizenzen, acht Millionen KI-Prompts allein im zweiten Quartal dieses Jahres. Zurich Insurance wiederum nutzt KI für präzisere Risikobewertungen und das EKZ optimiert die Energieverteilung. Damit ist KI zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. Das Luzerner Kantonsspital beispielsweise hat durch den Einsatz von KI zwei Drittel weniger Planungsaufwand. Das bedeutet konkret mehr Zeit für Patientenbetreuung. Die Mobiliar setzt KI ein, um Anfragen schneller an die richtigen Ansprechpartner zu leiten. Der in Bern entwickelte KI-Chatbot «Sophia» unterstützt global Opfer häuslicher Gewalt anonym. Oder die Firma Virtuosis AI aus Lausanne erkennt Burn-out-Anzeichen durch Stimmanalyse mit über 90-prozentiger Genauigkeit. Diese Schweizer Innovationen zeigen: KI, mit Verantwortung entwickelt, kann Leben verbessern. Und wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden in der Schweiz Zugriff auf die aktuellsten Technologien haben. Wie wichtig ist der Standort Schweiz für Microsoft in diesem Kontext? Wir sind seit 36 Jahren in der Schweiz aktiv und arbeiten eng mit Unternehmen, Behörden und der Zivilgesellschaft zusammen. Die Schweiz ist für uns ein strategischer Innovationspartner. Über 50 000 Kunden nutzen bereits unsere KI- und CloudDienste in unseren vier Rechenzentren in Zürich und Genf. Unsere letzten Investitionen gehen über

Meine Vision ist es, dass Technologie in der Schweiz verantwortungsvoll eingesetzt wird und Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen unsere Kunden und Partner befähigen, das volle Potenzial von neuen Technologien zu nutzen.
– Catrin Hinkel
für Menschen ist: Kreativität, Empathie und die Fähigkeit, komplexe Entscheidungen zu treffen. Microsoft möchte eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn es um die technologische Begleitung von Unternehmen geht. Welche Meilensteine haben Sie sich dementsprechend als CEO von Microsoft Schweiz für die Zukunft gesetzt?
den Ausbau der Infrastruktur und die Verfügbarkeit der neuesten Technologien hinaus: Bis 2027 haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine Million Menschen bei der KI-Weiterbildung zu unterstützen. Mit Partnerschaften mit ETH, EPFL und Switzerland Innovation Parks schaffen wir gemeinsam ein nachhaltiges Ökosystem. Zudem arbeiten wir daran, die Position der Schweiz als internationales Innovationszentrum zu stärken. Mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen im Ökosystem von «International Geneva» fördern wir den Wissenstransfer über die Schweiz hinweg. Sie haben erwähnt, dass hiesige Unternehmen in gewissen Bereichen sogar überdurchschnittlich sind, wenn es um die Nutzung von KI geht. Welche Vorteile ergeben sich für Firmen und ihre Mitarbeitenden, wenn diese KI einsetzen können?
Gerade in einer Zeit, in der der Arbeitsdruck
zunimmt und Unterbrechungen allgegenwärtig sind, kann KI administrative Aufgaben automatisieren und dabei helfen, Informationen schneller zu finden sowie Routineprozesse effizienter zu gestalten. Dadurch gewinnen Mitarbeitende wertvolle Zeit. Unser aktueller Report «Breaking the Infinite Workday» zeigt die Notwendigkeit hierfür: Mitarbeitende werden heute alle zwei Minuten in ihrer Arbeit unterbrochen, 275-mal täglich. 40 Prozent checken E-Mails vor sechs Uhr morgens und Meetings nach 20 Uhr sind um 16 Prozent gestiegen. Ein Teil der Lösung kann sein, was wir als «Frontier Firms» bezeichnen: Unternehmen, die KI als integralen Bestandteil ihrer DNA verstehen. Sie berichten von 55 Prozent mehr Kapazität für strategische Aufgaben und 71 Prozent ihrer Führungskräfte berichten, dass der Einsatz von KI positive Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg hat. Der Einsatz der Technologie ermöglicht es Mitarbeitenden also, sich wieder auf das zu konzentrieren, was einzigartig
Meine Vision ist es, dass Technologie in der Schweiz verantwortungsvoll eingesetzt wird und Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen unsere Kunden und Partner befähigen, das volle Potenzial von neuen Technologien zu nutzen – für mehr Produktivität, Innovation und Nachhaltigkeit. Unsere Growth-Mindset-Kultur bei Microsoft ermöglicht es uns, offen für Neues zu sein, kontinuierlich zu lernen und das Schweizer Ökosystem zu stärken und zusammen innovative Lösungen zu erarbeiten. So leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Schweiz auch in Zukunft ein attraktiver und nachhaltiger Standort bleibt, in dem neue Ideen und Impulse für Wirtschaftswachstum entstehen.
Zur Person
Seit Mai 2021 fungiert Catrin Hinkel als CEO von Microsoft Schweiz. Bevor sie diese Position übernahm, hatte sie diverse leitende Rollen beim Beratungskonzern Accenture inne. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Technologiesektor und einer Vielzahl an Aufgaben in unterschiedlichen Ländern, Branchen und Organisationen ist sie fest davon überzeugt, dass Technologie die Fähigkeit besitzt, sowohl die Arbeitswelt als auch die Lebensumstände global zu verbessern. Als engagierte Führungspersönlichkeit setzt sich Catrin Hinkel schon seit Langem für Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz ein.
Künstliche Intelligenz ist weit mehr als nur die «Technologie der Stunde» – sie stellt mittlerweile einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Doch nur wer sie zielgerichtet einsetzt, kann sich ihr volles Potenzial erschliessen. Genau das ermöglicht die «Drei-Vektoren-Strategie» von Cognizant.

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Gamechanger – und kann gerade für Schweizer Firmen eine echte Bereicherung darstellen. «Doch im hektischen Tagesgeschäft benötigen die meisten Betriebe einen Partner an ihrer Seite, der ihnen dabei hilft, echten finanziellen Mehrwert aus KI zu ziehen», sagt Andreas Golze, Country Manager Schweiz bei Cognizant. Vor allem für CFOs (Chief Financial Officers) sei KI mittlerweile zu einem finanziellen Betriebs- und Erfolgsmodell geworden. Was bedeutet das genau? «Bei KI geht es nicht mehr um experimentelle Pilotprojekte, sondern darum, wie man sie auf strategischer und prozessualer Ebene einsetzen kann», führt Golze aus. CFOs dient KI mittlerweile als finanzieller Alleskönner, mit dem sich Kostenstrukturen, Compliance-Rahmenwerke sowie die langfristige Wertschöpfung abbilden, analysieren und direkt neu gestalten lassen. Durch diese enorme Agilität und Flexibilität ergeben sich aufregende Chancen. «Schweizer CFOs – bekannt für Präzision, Disziplin und gewissenhafte Unternehmensführung – befinden sich nun in der spannenden Position, ihre Organisationen durch einen nie zuvor erlebten Wandel zu führen.» Und genau dafür bietet die «Drei-Vektoren-Strategie für KI» von Cognizant den
passenden Rahmen: einen pragmatischen Fahrplan, der Faktoren wie Hyperproduktivität, industrialisierte KI sowie «agentenbasierte» Unternehmensprozesse umfasst. Miteinander kombiniert ermöglichen es diese drei Vektoren Schweizer Unternehmen, KI verantwortungsvoll, effizient und profitabel einzusetzen.
Jeden Franken mehr arbeiten lassen «Betrachten wir uns die drei Vektoren einmal im Detail», sagt Andreas Golze. Der erste zielt auf exponentielle Produktivitätssteigerungen ab, indem KI in Entwicklungs- und Betriebsabläufe integriert wird. «Für Finanzchefs bedeutet dies direkte Kosteneinsparungen sowie eine schnellere Kapitalrendite.» Die Grundlage hierfür bildet die «Flowsource-Plattform» von Cognizant, welche den Software-Entwicklungszyklus (SDLC) durch die Integration von KI-Code-Assistenz und Automatisierung optimiert. Die auf diese Weise erzielten Erfolge sprechen eine klare Sprache: Bereits wurden durch Cognizant mehr als 70 Kundenimplementierungen in diversen Branchen vorgenommen, die zu 29 Grossprojekten mit einem Wert von jeweils über 100 Millionen Dollar durch KI-gesteigerte Produktivität führten.
Sicherheit als A und O Veraltete Systeme stellen sowohl eine Kostenbelastung als auch ein Risiko dar. Darum konzentriert sich der zweite Vektor der Cognizant-Strategie darauf, KI systematisch in die Unternehmensinfrastruktur zu integrieren, um intelligente, anpassungsfähige sowie kontrollierbare Plattformen zu schaffen. Zu diesem Zweck adressiert die «Neuro Suite» von Cognizant die kritischen Prioritäten von CFOs: Sie umfasst beispielsweise Tools, welche die vollständige Automatisierung und Überwachung kritischer Finanzsysteme erlauben, ermöglicht die KI-gesteuerte Betrugserkennung und
erlaubt die Schaffung echter Transparenz hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften. Zudem lassen sich über die Neuro Suite verschiedene KI-Agenten über sämtliche Unternehmensabläufe hinweg einsetzen. Mit über 1400 Kundenprojekten konnte man bereits beweisen, dass die industrialisierte KI keine blosse Vision mehr darstellt, sondern sich bereits zur bewährten Best Practice entwickelt hat. «Für CFOs bietet dieser Vektor einen essenziellen Mechanismus zur Risikominimierung: Er modernisiert die Infrastruktur, senkt die IT-Kosten und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften in regulierten Umgebungen wie dem Banken-, Versicherungs- und Gesundheitswesen», so der Cognizant-CountryManager. Dieser «Service as a Software»-Ansatz markiere den Übergang von digitalen Werkzeugen hin zu autonomen, digitalen Mitarbeitenden.
Tools waren gestern Dies führt direkt zum dritten Vektor, einem tiefgreifenden Paradigmenwechsel: Statt Werkzeuge zu erwerben, die den Mitarbeitenden assistieren, können CFOs nun intelligente KI-Agenten einsetzen, welche End-to-End-Dienstleistungen autonom ausführen. Das Beispiel einer europäischen Bank veranschaulicht diesen Wandel eindrucksvoll: Durch den Einsatz von KI-Agenten für Onboarding, Dokumentenvalidierung und Compliance-Prüfungen reduzierte die Bank ihre Onboarding-Zeit um 85 Prozent – von sieben Tagen auf nur einen. Der finanzielle Effekt war sofort in Form von schnelleren Kundenaktivierungen, geringeren Personalkosten und weniger Risiken spürbar. Die «Agent Foundry» von Cognizant erschliesst die Chancen dieses Paradigmenwechsels für diverse Branchen und Funktionen: Ob Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Fertigung oder Telekommunikation – alle diese Felder profitieren vom
Einsatz vollwertiger autonomer KI-Agenten, denn diese können sowohl im Personalwesen, im Kundenservice, in der Logistik als auch im Sicherheitsbereich Anwendung finden. «Für CFOs steht dieser Vektor für mehr als Automatisierung: Er signalisiert den Aufstieg digitaler Mitarbeitenden, welche Betriebsmodelle strukturell verändern, Kosten senken und Compliance in grossem Massstab verankern», so Golze.
Weitere Informationen unter: cognizant.com

Über Cognizant Schweiz Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt Cognizant Schweizer Unternehmen tatkräftig dabei, ihre Produktivität und Effizienz massgeblich zu steigern. Durch die fundierte Expertise in lokalen wie internationalen Märkten und durch enge Partnerschaften mit führenden Institutionen und Branchenakteuren liefert Cognizant massgeschneiderte Lösungen, die präzise auf die spezifischen geschäftlichen, operativen und technologischen Anforderungen der Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.
Capgemini AG • Brandreport
Der Einsatz neuer KI-Technologien und die Sicherstellung der Cloud-Souveränität stellen viele Unternehmen vor Herausforderungen. Es gilt, geeignete Strategien zu entwickeln, um Risiken zu minimieren und die Chancen der Digitalisierung sinnvoll zu nutzen.

Martin Weis
Geschäftsführer Capgemini Schweiz
Herr Weis, Unternehmen stehen derzeit unter starkem Transformationsdruck. Was sind aus Ihrer Sicht die dringendsten Themen, die Führungskräfte heute angehen müssen? Die Herausforderungen sind vielschichtig. Ein zentraler Fokus liegt darauf, wie Generative und Agentic AI skalierbar, sicher und nachhaltig in bestehende Prozesse integriert werden können. Viele Unternehmen haben Pilotprojekte gestartet, kämpfen nun aber mit Fragen der Governance, Kostenkontrolle und langfristigen Tragfähigkeit. Der «EU AI Act» bringt neue regulatorische Anforderungen mit sich, die auch Schweizer Unternehmen mit EU-Geschäft betreffen. Gleichzeitig gewinnt das Thema Cloud-Souveränität an Bedeutung – etwa durch Initiativen wie die «Swiss Government Cloud». Cybersicherheit bleibt ein Dauerbrenner. Angriffe werden zunehmend KI-gesteuert und auch Verteidigungssysteme müssen sich entsprechend weiterentwickeln.
Strukturelle Herausforderungen – wie der Rückstand bei ERP-Migrationen, da viele Unternehmen bis 2027 auf neue Plattformen umstellen müssen – erhöhen die Komplexität zusätzlich. Hinzu kommen Fachkräftemangel und neue Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung, etwa nach TCFD oder der EU-CSRD.
Wie unterstützt Capgemini Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?
Wir helfen unseren Kunden, diese Herausforderungen in konkreten Geschäftsnutzen zu übersetzen. Im Bereich «AI & Data» bauen wir sichere, skalierbare Plattformen mit robuster Governance und tragfähigen Kostenmodellen. Im Bereich «Cloud & Infrastruktur» setzen wir auf souveräne Multi-Cloud-Architekturen, die den Schweizer Anforderungen an Datenschutz und Datenresidenz gerecht werden. Unsere Cybersecurity-Services basieren auf Zero-Trust-Prinzipien und KI-gestützten Security-Operations-Centers, die Bedrohungen frühzeitig erkennen und darauf reagieren. Für die ERP-Modernisierung bieten wir «Conversion Factories» und automatisiertes Testing, um einen reibungslosen und wirtschaftlich sinnvollen Umstieg auf moderne ERP-Plattformen zu ermöglichen. Zudem unterstützen wir Unternehmen bei regulatorischen Anforderungen – von AI-Act-Gap-Analysen bis hin zu ESG-Datenpipelines für verlässliches Reporting. Und wir investieren in Talentlösungen und Upskilling, um dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. Welche Entwicklungen werden Ihrer Meinung nach das kommende Jahr prägen? Drei Trends stechen hervor. Erstens wird Agentic AI den Sprung vom Pilot in die Produktion schaffen. Unternehmen denken über Copiloten hinaus – hin zu autonomen Agenten, die Prozesse zuverlässig steuern. Zweitens bleibt Cybersicherheit zentral – sowohl Angriffe als auch Verteidigung werden zunehmend KI-gesteuert. Drittens tritt die Regulierung in eine neue Phase: Der «EU AI Act bringt» ab 2025 konkrete Pflichten mit sich, auf die sich auch Schweizer Unternehmen mit EU-Bezug vorbereiten müssen. Darüber hinaus
werden Cloud-Souveränität, ERP-Migrationen und Nachhaltigkeitsreporting weiterhin die Agenda bestimmen. Bei Capgemini Schweiz bereiten wir uns darauf vor, indem wir Technologie, Business und Nachhaltigkeit integrieren – und unseren Kunden helfen, Transformation sicher und mit messbarem Impact zu gestalten.
Was sind die neuen Markttreiber – und wie verändern sie das Zusammenspiel von Produkten und Software? Wir beobachten, dass Konnektivität und die Integration von Software in physische Produkte zu entscheidenden Differenzierungsmerkmalen werden. Unternehmen entwickeln keine isolierten Produkte mehr, sondern vernetzte Ökosysteme –branchenübergreifend, im Gesundheitswesen und bei Konsumgütern. Die Fähigkeit, Daten aus vernetzten Geräten in Echtzeit zu analysieren und mit intelligenter Software zu kombinieren, wird zum strategischen Vorteil. Gleichzeitig verändern geopolitische Spannungen, neue Regulierungen und technologische Sprünge wie Agentic AI die Spielregeln. In unsicheren Zeiten ist es entscheidend, Marktdynamiken zu verstehen und flexibel zu reagieren – etwa mit modularen Plattformen, digitalen Services oder resilienten Lieferketten.
Am 30. Oktober veranstaltet Capgemini gemeinsam mit Microsoft das «Accelerator Forum Switzerland». Was erwartet die Teilnehmenden?
Das Forum steht unter dem Motto «Disruption, meet Action» und zeigt auf, wie Unternehmen technologische Disruption in Wettbewerbsvorteile verwandeln können. Im Fokus stehen praxisnahe Strategien zur Nutzung von Agentic und Generative AI, Cloud-nativen Plattformen, resilienten digitalen Kernen, digitalen
Zwillingen und intelligenter Fertigung. Die Agenda adressiert branchenübergreifende Herausforderungen wie Handelsbarrieren, Kostenrestrukturierung und das Aufkommen physischer KI – etwa KI-gesteuerter Roboter.
Spezielle Break-out-Sessions für Life-Sciences, Konsumgüter und Industrieprodukte beleuchten Themen wie digitale Service-Innovation und intelligentes Asset-Management.
An wen richtet sich das Forum – und was nehmen die Teilnehmenden mit? Das Forum richtet sich an CxOs, Business Leader und Technologieentscheider, die sich mit den strategischen Implikationen der digitalen Transformation auseinandersetzen. Die Teilnehmenden erhalten nicht nur Inspiration, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen. Neben fachlichem Input bietet das Forum Raum für Austausch und Networking – mit dem Ziel, neue Ökosysteme zu gestalten und ihre Organisationen zukunftssicher aufzustellen.
Weitere Informationen unter: capgemini.ch
Anmeldung unter:


Technologien entscheiden nicht. Führung tut es. Dieser Wandel verlangt Prioritäten, Governance und messbaren Mehrwert, nicht Schlagworte. KI gehört dorthin, wo sie Prozesse verbessert und Kundenbeziehungen stärkt.


Künstliche Intelligenz (KI) entfacht gleichzeitig Begeisterung und Skepsis. Täglich erscheinen Meldungen über neue, erstaunliche Tools. Zugleich wächst die Sorge, dass KI ganze Geschäftsfelder verdrängen und Arbeitsplätze vernichten könnte. Viele Führungspersonen begegnen dem Hype mit Vorsicht. Doch der genauere Blick zeigt: KI wird weder ganze Industrien zerstören noch den Menschen verdrängen. Sie ist vor allem ein Werkzeug, das richtig eingesetzt enorme Produktivitätsschübe bringt, ohne das Wesen eines Unternehmens zu ersetzen.
KI-Hype: Zwischen Innovation und Jobangst In datengetriebenen Bereichen wie Softwareentwicklung oder Finanzanalyse automatisiert KI bereits Teilaufgaben mit hoher Geschwindigkeit. An den US-Börsen läuft rund 70 Prozent des Aktienhandels über algorithmische Systeme. Zugleich warnen Studien, dass Millionen Jobs in den kommenden Jahren neu definiert werden. Das Weltwirtschaftsforum etwa erwartet, dass in den nächsten fünf Jahren 69 Millionen neue Stellen entstehen, während 83 Millionen verschwinden könnten. Wichtig ist jedoch die Differenzierung: Meist ersetzt
KI Teilaufgaben, nicht ganze Berufe. McKinsey hat berechnet, dass nur rund fünf Prozent aller Jobs vollständig automatisierbar sind. In allen anderen Fällen bleibt menschliche Arbeit unentbehrlich. Gut bezahlte Tätigkeiten erfordern Fähigkeiten, die Maschinen schwer fassen können: komplexe Abstimmung mit Kunden oder kreative Strategieentwicklungen. Eine Harvard-Studie zeigt, dass gerade zwischenmenschliche Interaktion zu den am wenigsten automatisierbaren Kompetenzen gehört. «KI entscheidet nicht über Erfolg oder Misserfolg, das tun die Unternehmen selbst.
KI
entscheidet nicht über Erfolg oder Misserfolg, das tun die Unternehmen selbst. Gefährlich ist nicht die Technik, sondern Untätigkeit.
– Nicolas Kämpfen
menschliches Urteilsvermögen unverzichtbar bleibt. Ein KI-Pilotprojekt ist erfolgreich, wenn es Transparenz schafft und Mitarbeiter mitnimmt –nicht, wenn es möglichst spektakulär klingt. Kontrolle und Verantwortung KI ist nicht fehlerfrei. Ihre Entscheidungen hängen von Daten ab, die verzerrt oder unvollständig sein können. Deshalb braucht es Menschen, die Ergebnisse prüfen und Verantwortung übernehmen.
Gefährlich ist nicht die Technik, sondern Untätigkeit», warnt Nicolas Kämpfen, Mitgründer des Zürcher Software-Produktstudios Axisbits.
Lehren aus vergangenen Revolutionen
Die Befürchtung, Technologie könnte massenhaft Jobs vernichten, ist nicht neu. Schon die Ludditen zerstörten im 19. Jahrhundert mechanische Webstühle aus Angst um ihre Arbeit. Doch der Rückblick lehrt: Technische Umwälzungen verdrängen zwar kurzfristig Berufe, schaffen langfristig aber neue Felder und mehr Wohlstand.
Ein eindrückliches Beispiel ist die Dampfmaschine. Sie mechanisierte Fabriken, steigerte Produktivität und liess Unternehmen wachsen. Historische Analysen zeigen, dass Industriezweige, die früh auf Dampfkraft setzten, langfristig mehr Beschäftigte hatten und höhere Löhne zahlten. Auch die Einführung von Elektrifizierung und Massenproduktion führte erst zu Verdrängung, später zu Wachstum. McKinsey vergleicht das Potenzial der heutigen KI direkt mit der Dampfmaschine und schätzt, dass sie weltweit jährlich 4,4 Billionen Dollar an zusätzlicher Wertschöpfung generieren könnte.
KI im Unternehmensalltag
Damit KI ihr Potenzial entfalten kann, muss sie als Werkzeug verstanden werden. Sie glänzt überall dort, wo es um grosse Datenmengen und wiederholbare Standardprozesse geht. Ein Beispiel ist der Kundenservice: Chatbots können Anfragen vorfiltern und priorisieren. IBM schätzt, dass sich dadurch der Aufwand um 24 Prozent reduzieren lässt. Schwierige Fälle bleiben aber beim Menschen, da Empathie und Problemlösung Maschinen fehlen.
Hier setzt die Praxisperspektive ein. «In unseren Softwareprojekten zeigt sich bereits, wie gegensätzlich Firmen reagieren: Manche blockieren KI aus Angst vor Kontrollverlust, andere jagen unkritisch jedem Trend hinterher», sagt Denis Gomes Iljazi, CEO von Axisbits. «Sinnvoll ist es, sich auf den Mehrwert zu konzentrieren. Denn Technologie darf kein Selbstzweck sein, sondern ist Mittel zum Zweck. Ihr Wert zeigt sich erst in besseren Prozessen und stärkeren Kundenbeziehungen.»
Axisbits beobachtet, dass genau hier Beratung nötig ist: Unternehmen müssen Klarheit gewinnen, welche Prozesse sich für KI eignen und wo
Das Risiko liegt nicht in der KI selbst, sondern darin, wenn Führungskräfte glauben, sie könne ihnen das Denken und die Verantwortung abnehmen.
– Denis Gomes Iljazi
«Das Risiko liegt nicht in der KI selbst, sondern darin, wenn Führungskräfte glauben, sie könne ihnen das Denken und die Verantwortung abnehmen», sagt Denis Gomes Iljazi. Gerade in regulierten Feldern wie Medizin oder Finanzberatung bleibt der Mensch im Zentrum. Die Rolle verschiebt sich vom Ausführer repetitiver Aufgaben hin zum Entscheider und Qualitätsgaranten. Die Welle reiten statt ignorieren Für Unternehmen gilt: Es ist klüger, die KI-Welle aktiv zu reiten, statt sich dagegenzustemmen. Studien zeigen, dass über 90 Prozent der Firmen ihre Investitionen in KI in den kommenden drei Jahren erhöhen wollen. Wer zögert, riskiert, Wettbewerbsfähigkeit einzubüssen.
Die Geschichte grosser technischer Umbrüche zeigt: Solche Momente entscheiden über Aufstieg oder Niedergang.
KI als Chance begreifen
KI sollte als Chance verstanden werden, nicht als Bedrohung. Sie nimmt uns Routinelasten ab und ermöglicht eine neue Art von Skalierung. Doch sie ersetzt weder den Menschen als kreativen Kopf noch die Identität eines Unternehmens.
«KI nimmt uns Routinelasten ab, aber nicht unsere Identität», bringt es Nicolas Kämpfen auf den Punkt. «Wer früh lernt, Mensch und Maschine zu kombinieren, wird langfristig vorne liegen.»
Damit wird klar: Die Technik schreitet voran, ob wir wollen oder nicht. Entscheidend ist, ob Unternehmen sie aktiv gestalten, Mitarbeitende qualifizieren und Verantwortung übernehmen. Wer beides vereint, technologische Kompetenz und menschliche Urteilskraft, wird auch diese Revolution meistern.
Die Experten Nicolas Kämpfen und Denis Gomes Iljazi sind Mitgründer des Zürcher Software-Produktstudios axisbits.ch . Das Unternehmen erlebt an der Frontlinie täglich, wie Unternehmen mit KI und digitalen Plattformen Chancen und Risiken neu austarieren.

In den letzten Jahren hat sich die künstliche Intelligenz (KI) in der Unternehmenswelt enorm weiterentwickelt. In den verschiedensten Industrien, im Gesundheitswesen oder in Finanzdienstleistungen, schafft die KI neue Geschäftsmodelle, Strategien und Produkte. Doch mit diesen Fortschritten kommen auch regulatorische Herausforderungen.
Künstliche Intelligenz als Innovationstreiber
Der Einsatz von KI ist in verschiedenen Unternehmen bereits gang und gäbe – oder deren zunehmende Integration zumindest geplant. Im Gesundheitswesen führt die KI zu besseren Diagnosen und personalisierten Behandlungen. In der Automobilindustrie ermöglicht sie die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen, während sie im Finanzsektor bei Betrugsfällen und Risikomanagement eingesetzt wird.
Die KI ist jedoch nicht nur auf Effizienzsteigerungen beschränkt, sondern ermöglicht auch komplett neue Produkte oder generiert neuartige Geschäftsmodelle. Verschiedene Unternehmen treiben die Entwicklung unterschiedlicher Sprachmodelle und Automatisierungen an. Sogar das Entsperren des Smartphones oder der Haustür per Gesichtserkennung, Sprachsteuerung oder Fingerabdruck wird von künstlicher Intelligenz gesteuert.
KI spielt eine zunehmend zentrale Rolle in Unternehmen verschiedenster Branchen. Besonders stark kommt sie in der Produktion zum Einsatz, wo Prozesse automatisiert werden, Effizienz gesteigert und Qualität verbessert wird. Doch auch in datengetriebenen Unternehmen und direkten Kundenkontakten wird KI immer häufiger eingesetzt – sei es für personalisierte Kommunikation, Datenanalysen oder intelligente Automatisierung.
Unabhängig von Branche oder Unternehmensgrösse bringt KI viele Vorteile mit sich. Sie optimiert Produktionsabläufe, erleichtert die Datenverarbeitung und verbessert den Kundenservice. Durch Algorithmen und maschinelles Lernen können Unternehmen strategische Entscheidungen treffen, zukünftige Entwicklungen vorhersagen und ihre Geschäftsmodelle flexibler gestalten.
Diese digitale Revolution eröffnet viele Möglichkeiten: KITechnologien tragen dazu bei, Ressourcen effizienter einzusetzen, Kosten zu sparen und Arbeitsprozesse zu optimieren. Viele Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt
Die KI ist jedoch nicht nur auf Effizienzsteigerungen beschränkt, sondern ermöglicht auch komplett neue Produkte oder generiert neuartige Geschäftsmodelle.
– von monotonen Aufgaben bis hin zu komplexen Entscheidungsprozessen – lassen sich durch künstliche Intelligenz erleichtern. Unternehmen, die diese Potenziale frühzeitig erkennen und nutzen, können nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch neue Innovationspotenziale erschliessen und ihre Zukunft nachhaltig gestalten.
Regulierungsmassnahmen sind ein Muss Es werden bereits durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strenge Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten gestellt. Zusätzlich ist eine KI-Verordnung geplant, die striktere Regulierungen bezüglich der Hochrisikoanwendungen fordert. Durch diese Verordnung fordert die EU eine sorgfältige Prüfung der KI-gestützten Prozesse bei Unternehmen, um Transparenz, Sicherheit und Datenschutz gewährleisten zu können.
Die Herausforderungen sind klar: Unternehmen müssen ihre KI-Systeme fair und diskriminierungsfrei anwenden, dürfen keine intransparente Modelle einsetzen und müssen Mechanismen zur Erklärbarkeit implementieren. Zudem gibt es in verschiedenen Ländern bereits Regulierungen, um Diskriminierung und Intransparenz zu vermeiden.
Datenschutz und Cybersicherheit sind entscheidende Faktoren, die nicht nur im Sinne von Transparenz eine wichtige Rolle spielen, sondern auch um das Vertrauen von Partnern und Kunden zu gewährleisten.
Chancen nutzen und Risiken minimieren Um in der Unternehmenswelt KI nutzen zu können und gleichzeitig die regulatorischen
Wer sich frühzeitig mit den Regulierungen der KI auseinandersetzt, kann sich als Vorreiter im Markt positionieren und somit langfristig von den vielen Vorteilen einer ethisch und gut regulierten künstlichen Intelligenz profitieren.
Anforderungen zu erfüllen, sollte man sich an folgenden Grundsätzen orientieren:
– Transparenz und Erklärbarkeit: KI-Modelle sollten nachvollziehbar sein, um die Gründe der Entscheidungen verstehen zu können. Explainable AI hilft, das Vertrauen der Regulierungsbehörden und Nutzer:innen zu stärken.
– Anpassungsfähigkeit: Die Strategien der Unternehmen sollten sich kontinuierlich an neue Richtlinien und rechtlichen Anforderungen anpassen können, da sich die regulatorischen Vorgaben stets in einem dynamischen Wandel befinden.
– Interne Schulungen: Es wird empfohlen, regelmässige Schulungen in Unternehmen anzubieten, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden auf dem neuesten Stand der KI-Richtlinien sind.
– Ethische Verantwortung und Datensicherheit: Um Risiken wie Diskriminierung oder Missbrauch von Daten zu minimieren, ist die Implementierung von ethischen KI-Richtlinien essenziell.
– Compliance-Experten: Durch eine Zusammenarbeit mit Datenschutz- und Rechtsexpert:innen, können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Modelle und -strategien stets konform mit gesetzlichen Vorschriften sind.
Ein Blick in die Zukunft Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen Potenzial für Wachstum und Innovation, doch dies bringt auch regulatorische Herausforderungen mit sich. Unternehmen, die sich sorgfältig mit der KI auseinandersetzen und in ethische, transparente und vorschriftsmässige KI-Lösungen investieren, können viele Vorteile strategisch nutzen.
Die Regulationen betreffend KI werden sich weiterentwickeln und Unternehmen tun gut daran, dies nicht als Hindernis, sondern als Chance zu verstehen. Wer sich frühzeitig mit den Regulierungen der KI auseinandersetzt, kann sich als Vorreiter im Markt positionieren und somit langfristig von den vielen Vorteilen einer ethisch und gut regulierten künstlichen Intelligenz profitieren.
Text Aaliyah Daidi

Die Anzahl an Cyberangriffen steigt und künstliche Intelligenz ermöglicht immer raffiniertere Betrugsmaschen. Expertinnen und Experten betonen daher, dass die Frage längst nicht mehr lautet, ob ein Betrieb attackiert wird – sondern wann. Der beste Schutz lautet: Bewusstsein.
277 Cybervorfälle in einer Woche. So viele Vorkommnisse sind laut den Zahlen des Bundesamts für Cybersicherheit (Bacs) längst Alltag geworden. Vergleicht man die Zahlen mit dem Vorjahr, wird klar, dass die Bedrohung immer grösser wird. Fachleute und Expert:innen sind längst alarmiert, sprechen von einer Zuspitzung der Lage. Zudem gelte es zu beachten, dass diese Zahlen nur die gemeldeten Vorfälle wiedergeben. Die Dunkelziffer der nicht deklarierten oder nicht erkannten Vorfälle dürfte nochmals merklich höher liegen. Laut Marktbeobachterinnen und -beobachtern werden derzeit vor allem Malware- und Ransomware-Angriffe ausgeführt. Zudem lässt sich ein neues Phänomen beobachten: Bisher wurden Unternehmensdaten und -infrastrukturen bei Ransomware-Angriffen verschlüsselt und die Unternehmensverantwortlichen dadurch «ausgesperrt».
Auf diese Weise verloren Betriebe, die über entsprechende Back-ups verfügten, zwar ihre aktuellsten Daten, doch meistens mussten nicht mehr als zwei oder drei Tage Arbeit abgeschrieben werden. Nun aber werden die Daten von den Angreifenden zusätzlich entwendet. Ist das betroffene Unternehmen nicht bereit, das geforderte Lösegeld zu bezahlen, werden die Daten im Darknet zum Kauf angeboten. Der Verlust solcher sensiblen Informationen kann gerade für KMU rasch kritisch werden.
Brandreport • Datarec AG
Umso wichtiger ist es gemäss Fachleuten, dass in KMU sowie Konzernen auf allen Betriebsebenen ein Verständnis für sicheres Verhalten kultiviert wird.
In mehrfacher Hinsicht teuer Nebst operationellen Unterbrüchen und Reputationsschäden können Cyberangriffe für die betroffenen Betriebe auch empfindliche Bussen nach sich ziehen. Das Schweizer Datenschutzgesetz sieht Strafen in der Höhe von bis zu 250 000 Franken für fehlbare Personen vor. Sind Daten von EU-Bürger:innen betroffen, können bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes als Busse fällig werden. Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Angriffe immer professioneller ablaufen und sich die Chance für einen Vorfall damit erhöht. Zudem bieten moderne KI-Anwendungen zusätzliche Möglichkeiten,
um sich unbefugten Zutritt zu Unternehmenssystemen zu verschaffen. Für Cyberkriminelle stellen Schweizer Unternehmen, die innovationsstark sind und hinsichtlich Cybersecurity oftmals Nachholbedarf aufweisen, daher attraktive Ziele dar. Umso wichtiger ist es gemäss Fachleuten, dass in KMU sowie Konzernen auf allen Betriebsebenen ein Verständnis für sicheres Verhalten kultiviert wird. Hierfür können externe Partner und Bildungsinstitutionen helfen, das benötigte Fach- und Prozesswissen im Betrieb zu verankern. Spezifische Trainings und KMU-zentrierte Schulungen können wichtige
Aufklärungsarbeit leisten und insbesondere auf Managementlevel aufzeigen, wie wichtig das Thema ist und welche Handlungen im Ernstfall zu priorisieren sind. Darüber hinaus empfehlen Fachleute, dass Unternehmen Notfallpläne und klare Kommunikationsstrategien entwickeln, um im Angriffsfall schnell reagieren zu können. Auch Cyberversicherungen gewinnen an Bedeutung, da sie zwar keine Prävention ersetzen, aber zumindest die finanziellen Folgen abfedern können. Entscheidend ist jedoch nicht allein die technische Abwehr, sondern die Unternehmenskultur. Geschäftsleitungen tragen eine besondere Verantwortung, Cybersecurity als strategisches Thema ernst zu nehmen und es nicht allein der IT-Abteilung zu überlassen. Nur wenn das Bewusstsein für Risiken bei allen Mitarbeitenden geschärft wird, können Phishing-Mails erkannt, verdächtige Zugriffe gemeldet und Sicherheitslücken frühzeitig geschlossen werden. Prävention bedeutet dabei auch, regelmässig Updates einzuspielen, Passwortrichtlinien konsequent durchzusetzen und die IT-Infrastruktur systematisch auf Schwachstellen zu überprüfen. Wer diese Grundlagen vernachlässigt, riskiert im Ernstfall nicht nur hohe Kosten, sondern auch das Vertrauen von Kundinnen, Partnern und Behörden. Ein Wert, der sich nur schwer wiederherstellen lässt. Text SMA

Cyberbedrohungen nehmen in der Schweiz deutlich zu: Beim Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) geht im Schnitt alle 8,5 Minuten eine Meldung zu einem Cybervorfall ein. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Angesichts dieser Häufung von Fällen überrascht es
nicht, dass hierzulande immer mehr Unternehmen Gegenmassnahmen ergreifen und ihre IT-Infrastruktur besser absichern. Doch oftmals geht dabei ein wesentlicher Faktor vergessen: «Viele Unternehmen realisieren nicht, dass auf Datenträgern essenzielle Informationen schlummern, die nicht in falsche Hände geraten sollten», erklärt Thomas Rieder, Managing Director der Datarec AG. Sein Appell ist daher klar: «Wer im Zeitalter von Social Engineering echte Cybersecurity gewährleisten will, muss den physischen Datenschutz zwingend miteinbeziehen – sonst bleibt Sicherheit reines Wunschdenken.» Genau diesen Schutz kann Datarec mit Beratung und physischer Datenvernichtung –vom PC bis zu allen Arten von Datenträgern inkl. Papier – professionell und zertifiziert gewährleisten. Wie geht man dafür konkret vor? «Es gibt zwei Varianten», erklärt Thomas Rieder. Bei der ersten fahren die Fachleute der Datarec AG mit einem gesicherten GPS-getrackten Lastwagen beim Kundenbetrieb vor. Die Datenträger werden anschliessend in spezielle, verschliessbare Container verladen und dann innert 24 Stunden zerstört. Bei der zweiten Variante wird die Vernichtung direkt auf dem Kundenareal vorgenommen. «In beiden Fällen garantieren wir, dass man die aufgezeichneten,
gespeicherten oder gedruckten Informationen nicht wiederherstellen kann, auch nicht mit modernsten Methoden.» Zu diesem Zweck werden spezifische Schredder- und Zerkleinerungsanlagen eingesetzt, die in mehrstufigen Prozessen Papier, Festplatten, SSD-Chips, Mobiltelefone, Memorysticks und weitere Speicher aller Art ein für alle Mal vernichten und die enthaltenen Informationen nutzlos machen. Die anfallenden Rohstoffe werden anschliessend in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft überführt und rezykliert. Datenschutz mit Nachhaltigkeit.
Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden
Die Datarec AG kommt nicht nur bei der Vernichtung von Datenträgern zum Einsatz: Die tiefgreifende Sicherheitsexpertise gibt man auch in Form von Beratungen an die Kundenfirmen weiter. «Wir nehmen die Abläufe unter die Lupe und machen unsere Kundschaft auf die verschiedenen Fallstricke aufmerksam, die Social-Engineering-Angreifende gerne als Angriffsvektor nutzen», führt Rieder aus. Als klassische Beispiele für Schwachstellen nennt er die Wahl und Hinterlegung der Passwörter, den Datentransfer auf Drittgeräte oder die Gefahr, die sich ergibt, wenn man auf sozialen Netzwerken wie
LinkedIn auch unbekannte Anfragen unkritisch annimmt. «Wir zeigen auf, welche Alltagsszenarien welches Gefahrenpotenzial aufweisen, und wie man diese Schwachpunkte gezielt ausmerzt.»
Weitere Informationen unter: www.datarec.ch sowie für eine unverbindliche Beratung: +41 56 418 10 10




Grant Thornton unterstützt Sie im Digitalisierungsprozess von der Strategie bis zur Realisierung.
Ob Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung oder Buchhaltung: Wir gehen für Sie die Extrameile.
grantthornton.ch/gobeyond
ibt der Chatbot unerlaubt Rabatte? Ist er rassistisch? Empfiehlt er die Konkurrenz? Lässt er sich zu Aussagen verführen, die der Reputation schaden können? Leitet er vertrauliche E-Mails weiter? Aktuell sorgen Chatbots für reale Schlagzeilen, die mit Reputationsschäden und finanziellen Verlusten verbunden sind. So können Chatbots zum Albtraum werden –wenn man sie nicht ausreichend absichert.

KI-Chatbots müssen anders geprüft werden Chatbots sollten gezielt getestet werden, um oben genannte Risiken zu vermeiden. Redguard als führender Schweizer Berater für Informations- und Cybersicherheit unterstützt seine Kunden bei solchen Prüfungen mit dem erprobten Ansatz des GenAI Red Teaming. Damit berücksichtigen sie
gezielt die Eigenheiten von Chatbots, die auf Large Language Models (LLMs) und generativer AI basieren: z. B. ihre vielfältige Architektur (Texte, Bilder, Sprache und Mischformen), die variierenden Zufallsergebnisse und die gleichzeitige Prüfung von Sicherheits- und Verantwortungsrisiken.
Maschinen prüfen Maschinen?
Um effizient testen zu können, setzt Redguard selbst LLMs ein. Mit diesen entwickeln sie gezielt mehrschichtige Angriffe, die Schwächen und Verhaltensmuster des geprüften Systems ausnutzen. So wird sichtbar, wie anfällig ein Chatbot ist – etwa wenn er Sicherheitsmechanismen umgeht, vertrauliche Informationen preisgibt, falsche oder rufschädigende Inhalte erzeugt oder sich manipulieren lässt. Braucht es die menschlichen Security-Tester:innen noch?
Mit GenAI Red Teaming verbindet Redguard die systematische Hartnäckigkeit von KI mit der Kreativität und Erfahrung ihrer Expert:innen im Bereich Security-Testing und KI. Erst diese Kombination deckt realistische Angriffsszenarien ab und liefert Unternehmen fundierte Erkenntnisse, wie sie Chatbots sicher und verantwortungsvoll einsetzen können – und reputative und finanzielle Schäden verhindern.
Haben Sie Ihren Chatbot auf Herz und Nieren geprüft? Holen Sie sich Experten-Unterstützung: redguard.ch
Suissedigital • Brandreport

Die rund 170 Mitglieder von Suissedigital adressieren mit ihren Angeboten zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Vordergrund stehen dabei Dienstleistungen in den Bereichen Konnektivität, Kommunikation und Rechenzentren. Der Verband unterstützt seine Mitglieder, indem er an der kommenden Branchentagung Suissedigital-Day den Schwerpunkt auf KMU-Themen legt.

Immer mehr Aspekte des Geschäftslebens finden digital statt. Dies gilt gerade auch für KMU, die dank der Digitalisierung ihre Prozesse effizienter gestalten und potenzielle Kunden leichter erreichen können. Voraussetzungen dafür sind eine leistungsfähige Anbindung ans Internet, intelligente Kommunikationslösungen, eine sichere Vernetzung von verschiedenen Unternehmensstandorten und ein zuverlässiger Kundendienst. All dies bieten die rund 170 lokal tätigen Suissedigital-Mitglieder, wobei sie auf die spezifischen Bedürfnisse der KMU eingehen können.
Eigene Rechenzentren vor Ort Einzelne Suissedigital-Mitglieder bieten zudem Dienstleistungen in den Bereichen Colocation und Rechenzentren, von denen KMU profitieren können. Dank Glasfaseranbindung und erstklassigen Sicherheitsmassnahmen wie Brandschutz, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Notstromanlagen und abschliessbaren Racks eignen sich diese Rechenzentren zur Speicherung sensibler Daten. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Wie die Rechenzentren sind die Suissedigital-Anbieter in der Nähe ihrer regionalen KMU-Kunden. So ist ein schneller und unkomplizierter Kundendienst möglich.
Online-Test zur Sensibilisierung für Cybersecurity Mit zunehmender Digitalisierung steigt für die KMU das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Aus diesem Grund hat Suissedigital Anfang Jahr einen Online-Test lanciert, der KMU für das Thema Cybersecurity sensibilisieren soll. Der Test, der unter www.suissedigital.ch auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar ist, ermöglicht eine Selbsteinstufung und im Laufe der Zeit einen Vergleich mit anderen KMU. «Ich bin überzeugt, dass der Test dazu beiträgt,
Wie die Rechenzentren sind die SuissedigitalAnbieter in der Nähe ihrer regionalen KMU-Kunden.
dass KMU ihr Bewusstsein für die Gefahren von Cyberkriminalität schärfen und die notwendigen Schutzmassnahmen treffen», sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital.
Informationen und Vernetzung am Suissedigital-Day 2025
Möchten Sie mehr wissen zu den KMU-Angeboten der Suissedigital-Mitglieder? Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Kommunikationsunternehmen unter www.suissedigital.ch/kmu oder besuchen Sie den Suissedigital-Day 2025, der am 19. November 2025 im Kursaal in Bern stattfindet. An diesem Anlass treffen sich rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Telekommunikations- und IT-Unternehmen mit KMU und weiteren Interessierten zu Networking und Austausch. Das Rahmenprogramm bietet spannende Referate zu aktuellen Themen aus den Bereichen IT, Digitalisierung, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Telekommunikation. Wichtiger Bestandteil der Tagung ist eine umfangreiche Ausstellung mit mehr als 40 Telekommunikations- und IT-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz.
Weitere Informationen und Anmeldung: info@suissedigital.ch oder Tel. +41 31 328 27 28
Maria Girone
Am Forschungszentrum Cern werden Milliarden von Teilchenkollisionen analysiert, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.
Dafür ist eine enorme technische Infrastruktur notwendig. An diesem System war Maria Girone, Leiterin des Cern openlab, federführend. Für «Fokus» gibt sie Einblicke in ihre Arbeit und erklärt, warum die Zukunft der Forschung nicht allein in der Technologie liegt.
Interview SMA Bild zVg
Frau Girone, das Cern ist weltberühmt für seine Beiträge zur Teilchenphysik. Können Sie erklären, was Cern openlab ist?
Im Grunde handelt es sich dabei um eine öffentlichprivate Partnerschaft, welche die Zusammenarbeit zwischen dem Cern sowie mehreren führenden Technologieunternehmen und Forschungsinstituten fördert. Unser Ziel lautet, gemeinsam innovative ICT-Lösungen zu entwickeln und zu testen. Die Mission ist simpel, aber ehrgeizig: Wir treiben Innovationen in den Bereichen Computer- und Datentechnologien voran, die es dem Cern ermöglichen, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzielen – und unterstützen auf diese Weise die gesamte Hochenergiephysik-Gemeinschaft.
Und was sind Ihre konkreten Aufgaben als Leiterin von openlab?
Meine Hauptaufgabe besteht darin, kritische ICT-Herausforderungen zu erkennen, die sich am Horizont abzeichnen. Zudem fördere ich die Zusammenarbeit zwischen der Industrie und der Wissenschaft, damit wir nicht nur potenzielle Probleme gemeinsam angehen, sondern zusammen auch echten Mehrwert schaffen können. Zu den aktuellen Projekten, die Cern openlab derzeit unterstützt, gehört unter anderem die Erforschung des Potenzials verschiedener Spitzentechnologien.
Von welchen Spitzentechnologien sprechen wir da?
Derzeit interessieren uns etwa der Einsatz von digitalen Zwillingen, die Verwendung neuer Materialien für die langfristige Datenspeicherung sowie heterogene Computing- und HPC-Systeme (High-PerformanceComputing). Ich koordiniere auch die Umsetzung unserer Strategie für die HPC-Integration am Cern –ein Thema, das eng mit der Industrie verbunden ist. In meiner Funktion bin ich zudem für die Vernetzung mit verschiedenen HPC-Zentren zuständig. Damit wir uns in all diesen Bereichen einbringen können, arbeiten wir von Cern openlab mit diversen Partnerorganisationen zusammen – darunter Oracle, Micron, Pure Storage, Siemens, Nvidia, Intel und der Simons Foundation. Weitere Partnerschaften mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind in Vorbereitung. Sie spielten eine Schlüsselrolle beim «Worldwide LHC Computing Grid» (WLCG). Wie genau funktioniert dieses Grid – und welche Rolle spielt es im Kontext der Cern-Mission?
Die Aufgabe des WLCG ist es, die weltweiten Rechenressourcen für die Speicherung, Verteilung und Analyse der Daten bereitzustellen, die von unserem Teilchenbeschleuniger (dem «Large Hadron Collider», kurz «LHC»), erzeugt werden. Und das sind wirklich enorme Datenmengen! Am Ende des «Long Shutdown 2» des LHC überstiegen die globalen Transferraten 260 Gigabyte pro Sekunde. Das Computing Grid vereint daher etwa 1,4 Millionen Rechenkerne und 1,5 Exabytes an Speicherplatz aus über 160 Standorten in mehr als 40 Ländern. Diese massive Recheninfrastruktur ermöglicht es mehr als 12 000 Physikerinnen und Physikern weltweit, nahezu in Echtzeit auf die LHC-Daten zuzugreifen und diese zu verarbeiten. Meine Aufgabe im Rahmen des WLCG war es, das heutige Betriebsmodell zu entwickeln. Von 2010 bis 2014 war ich auch die Teamleiterin, die für den Betrieb und die Umsetzung dieses Modells verantwortlich war. Nach über 15 Jahren Betrieb vergisst man leicht, dass diese Form des «verteilten Rechnens» damals eine wirklich revolutionäre Idee darstellte und enorme Investitionen für die Inbetriebnahme und Umsetzung erforderte. Ich bin daher stolz auf die Rolle, die ich dabei gespielt habe. Ohne das WLCG wäre es einfach nicht möglich gewesen, die Grösse und Komplexität der Daten, die wir am Cern erzeugen, zu bewältigen. Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang aus, der Sie bis zu dieser Position geführt hat?
Ich bin «von Haus aus» Physikerin. Meine Leidenschaft für dieses Fach wurde in der Schulzeit richtig entfacht, doch ich war schon immer fasziniert von Mathematik und Physik. Die Hochenergiephysik hat mich besonders begeistert, weil man dabei die Grundlagen der Materie erforschen und somit Einblicke in die Naturgesetze gewinnen kann. Mein Vater war Jurist

Besonders wichtig ist, dass der Fokus nicht nur auf der Entwicklung von Werkzeugen liegt, sondern auch auf deren Anwendung.
– Maria Girone
und wir haben immer gescherzt, dass wir uns beide auf unsere Art mit Gesetzen beschäftigten (lacht).
KI ist das Hype-Thema Nummer eins der letzten zwei Jahre. Wie beurteilen Sie diese Technologie?
Künstliche Intelligenz ist definitiv spannend – vor allem, weil sie die Art und Weise verändert, wie wir an wissenschaftliche Forschung herangehen. Am Cern wird KI für alle Schritte der Datenverarbeitung erforscht, von der Datenerfassung bis zur Datenanalyse. Dazu gehört auch das Nutzen von Testumgebungen für die kollaborative Entwicklung neuer KI-Modelle und Optimierungs-Workflows. Im Cern openlab tragen wir auf unterschiedliche Weise zur Weiterentwicklung der KI-Forschung bei, unter anderem in Bereichen wie generativer KI, verteilter KI-Optimierung sowie Grundlagenmodellen für die Physik. Wir befassen uns auch mit der optimalen Implementierung von KI-basierten Algorithmen in modernen Rechnerarchitekturen und erforschen, wie diese Architekturen für KI-Workloads optimiert werden können. Ich bin auch daran interessiert zu eruieren, wie sich High-Performance-Computing (HPC), heterogene Architekturen und datenzentrierte KI einander annähern. Denn diese Entwicklungen prägen nicht nur die Grundlagenforschung, sondern auch die Industrie sowie die Gesellschaft als Ganzes. Quantencomputing ist ein weiteres Thema, das in den Medien kursiert. Wie interessant ist das für Sie und Ihre Arbeit am Cern?
Das Quantencomputing stellt ebenfalls ein aufstrebendes Gebiet dar. Und obwohl wir in unseren
derzeitigen Arbeitsabläufen keine Quantentechnologien direkt anwenden, treiben wir die Diskussionen, die Forschung und die Entwicklung in diesem Bereich durch die «Quantum Technology Initiative» (QTI) aktiv voran. Seit 2024 wird die QTI durch das «Open Quantum Institute» ergänzt, das die Anwendung von Quantentechnologien für die Gesellschaft erforscht. Wir beobachten die Entwicklungen sehr genau, um zu sehen, wie sie zur Lösung unserer zukünftigen technologischen Herausforderungen beitragen könnten.
2022 erhielten Sie eine Goldmedaille der Vereinigung «Brutium». Wofür gab es die Auszeichnung und was bedeutet sie Ihnen? Die Verleihung der Brutium-Goldmedaille war eine zutiefst bewegende Erfahrung, die mich sehr geehrt hat. Die Auszeichnung würdigte meine Beiträge zu Wissenschaft und Innovation sowie meine Rolle als Bindeglied zwischen Forschung und Industrie. Sie hat mich aber auch dazu gebracht, innezuhalten und die Teams, Kooperationen und Mentoren zu würdigen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Die Auszeichnung hat zudem mein Engagement gestärkt, Vielfalt und Bildung in den naturwissenschaftlichen und technologischen Bereichen zu fördern. «Förderung» ist das perfekte Stichwort, denn Sie haben die Organisation «ideas4hpc» mitbegründet. Bitte erzählen Sie uns mehr über deren Mission und Ziele. ideas4HPC ist ein gemeinnütziger Verein, den ich zusammen mit Florian Ciorba (Universität Basel), Marie-Christine Sawley (ICES Foundation Geneva), Sadaf Alam (Universität Bristol) sowie Cerlane Leong
und Maria Grazia Giuffreda (ETHZ-CSCS) gegründet habe. Sein Ziel besteht darin, Vielfalt zu fördern und die Inklusion von Frauen und anderen unterrepräsentierten Gruppen in den Bereichen High-Performance-Computing (HPC) und Large-Scale-Computing zu verbessern. Die Grundidee lautete, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, in dem Forscher, Entwickler und Branchenführer neue Ideen und Initiativen austauschen können, um eine vielfältigere Belegschaft zu fördern. Das ist deshalb so wichtig, weil wir der Überzeugung sind, dass für die Lösung der heutigen wissenschaftlichen Herausforderungen nicht nur leistungsfähigere Maschinen benötigt werden, sondern auch offenere, kreativere und inklusivere Ökosysteme. Durch eine Partnerschaft zwischen Cern openlab und ideas4HPC unterstützen wir seit 2024 eine Studentin im Rahmen des «Cern openlab-Sommerstudentenprogramms». Zu unserem Programm gehören auch Aktivitäten wie Schulungsveranstaltungen, Vernetzungskonferenzen sowie die Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen in MINT-Fächern. All dies wird in enger Zusammenarbeit mit der internationalen Organisation «Women in HPC» vorangetrieben. Abschliessend bitten wir Sie um einen Blick in die Glaskugel: Welche Technologien, Trends oder Entwicklungen werden in den kommenden Jahren bedeutend sein?
Ich denke, dass KI-integriertes HPC, energieeffiziente Architekturen und Hochleistungsnetzwerke von grundlegender Bedeutung sein werden. Da die nächste Generation wissenschaftlicher Projekte Jahr für Jahr Exabytes an Daten produzieren wird, werden Technologien wie Edge-Computing und Echtzeitanalyse entscheidend sein – insbesondere der Einsatz von zunehmend autonomen Systemen wird an Bedeutung gewinnen. Ferner ist es essenziell, das wissenschaftliche und gesellschaftliche Potenzial der riesigen Datenmengen zu erkennen und zu nutzen, das aus wissenschaftlichen Projekten und Kooperationen entsteht. Dies erfordert sowohl technische Innovation als auch ein starkes Engagement für ökologische Nachhaltigkeit. Besonders wichtig ist dabei, dass der Fokus nicht nur auf der Entwicklung von Werkzeugen liegt, sondern auch auf deren Anwendung – sowohl zur Förderung der Hochenergiephysik als auch zur Schaffung breiterer gesellschaftlicher Vorteile.
Der Einsatz von Large Language Models (LMM) und Generative AI setzt sich im unternehmerischen Umfeld vermehrt durch.
Doch für hoch regulierte Branchen sind viele KI-Losungen nicht ausreichend. Hier setzt Squirro mit ihrer «Enterprise-Grade Gen AI Platform» an, die höchste Sicherheit bietet – und deterministische sowie wahrscheinlichkeitsbasierte Prinzipien vereint.

Frau Hawker Zafer, die ganze Welt spricht über die enormen Vorteile von KI-Lösungen für Unternehmen. Wie differenziert sich Squirro mit seiner KI-Plattform gegenüber der Konkurrenz?
Wir lösen die grösste Herausforderung für Unternehmen im KI-Zeitalter: Wie kann man die volle Leistung von Generative AI nutzen, ohne die geringsten Kompromisse bei Datensicherheit und Compliance einzugehen?
Unsere «Enterprise GenAI Platform» ist die Antwort darauf. Sie wurde speziell für die anspruchsvollsten und am stärksten regulierten Branchen entwickelt. Deshalb vertrauen uns führende Finanzinstitute, Pharmaunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors – Organisationen, die es sich nicht leisten können, ihre sensiblen Daten externen Modellen preiszugeben. Wir bringen die Innovationskraft moderner KI sicher hinter die Firewall des Unternehmens. Unsere Plattform verwandelt die eigenen, vertraulichen Daten in wertvolle Erkenntnisse, um Chancen aufzudecken, Innovationen zu beschleunigen und Abläufe zu optimieren. Das ist unser entscheidender Vorteil.
Worin liegen die zentralen Unterschiede zwischen der «Enterprise GenAI Platform» aus dem Hause Squirro und anderen Lösungen? Unser entscheidender Vorteil ist die Fusion des Deterministischen und des Probabilistischen.
Für den deterministischen Ansatz nutzen wir Technologien wie Knowledge-Graphs. Diese bilden Unternehmensdaten und deren komplexe Beziehungen zueinander ab und ermöglichen eine absolut präzise, faktenbasierte Suche. Der probabilistische Ansatz ist die Stärke von Large Language Models (LLMs): Er versteht Kontext, erkennt Absichten und kann kreativ neue Inhalte generieren.
Die eigentliche Innovation unserer Plattform liegt in der intelligenten Verknüpfung dieser beiden Welten durch ein Verfahren namens Retrieval-Augmented Generation (RAG). Dabei zwingen wir das LLM, seine Antworten ausschliesslich auf den Fakten aufzubauen, die wir zuvor über die präzise Suche aus ihren eigenen, sicheren Datenquellen abgerufen («retrieved») haben. Wir wenden KI also in der Realität von Unternehmensdaten an. Das Ergebnis: Man kann mit den firmeneigenen Daten chatten sowie komplexe Fragen stellen und erhält Antworten, die präzise und nachvollziehbar sind und viel weniger Halluzinationen aufweisen. Diese Zuverlässigkeit ist der Grund, warum führende Unternehmen in regulierten Branchen auf uns setzen.
Wie wird diese Kombination von deterministischen und wahrscheinlichkeitsbasierten Informationen technisch umgesetzt? Durch den Ansatz der Retrieval-Augmented Generation (RAG). Zuerst erstellen wir aus allen

«MIT
Unternehmensdaten einen faktischen KnowledgeGraph, der als verifizierte Wissensbasis dient. Anstatt eine Nutzeranfrage blind an ein LLM zu senden, sucht unsere Plattform zuerst in dieser Wissensbasis nach den relevanten Fakten. Erst diese Fakten werden dann, angereichert mit der ursprünglichen Frage, an das LLM weitergereicht, das seine Antwort ausschliesslich auf dieser Grundlage formulieren muss. Dieser Prozess erdet die KI in der Realität der jeweiligen Unternehmensdaten, verhindert Halluzinationen und stellt sicher, dass jede Antwort präzise und auf ihre Quellen zurückführbar ist.
Die Vorteile der Plattform liegen auf der Hand. Wie gestaltet sich der Onboarding-Prozess für neue Kunden?
Der Prozess ist vielschichtig und erfordert eine sorgfältige Analyse der Datennutzung, die Implementierung unserer Lösung in die IT-Infrastruktur der Kunden sowie die Einhaltung sämtlicher Compliance-Richtlinien. Wir verfügen in diesem Bereich über umfassende Erfahrung und sind in der Lage, Kundenunternehmen auf ihrer Transformationsreise Schritt für Schritt zu begleiten.
Sie sind die Schöpferin des mehrfach preisgekrönten Podcasts «Redefining AI». Welche bedeutenden Trends und Entwicklungen beobachten Sie derzeit im KI-Sektor?
Derzeit zeichnen sich drei zentrale «Bubbles» ab, in denen sich die wichtigsten Entwicklungen bündeln. Die erste ist die Asset-Bubble (Anlageblase): Hier sehen wir die teilweise «aufgeblähte» Aktienbewertung von KI-Unternehmen, was nicht nur entfernt an die Dotcom-Blase der 90er-Jahre erinnert. Bei der Infrastructure-Bubble (Infrastrukturblase) wiederum
geht es um die enormen Investitionen, welche derzeit in die KI-Infrastruktur gepumpt werden, etwa in die Entwicklung neuer GPUs, Stromversorgungssysteme und Kühltechnologien. Und zu guter Letzt gibt es die Hype-Bubble (Hype-Blase): Hierbei geht es um die überzogenen Erwartungen von Menschen, Branchen und Unternehmen an die KI-Technologie. Sie sehen: An interessanten Themen und Entwicklungen mangelt es nicht und wir werden auch künftig unsere Mission verfolgen, unsere Kundschaft in diesem dynamischen Handlungsfeld zu begleiten und zu unterstützen.
Weitere Informationen unter: squirro.com

Zur Person
Lauren Hawker Zafer gilt als eine der internationalen Vordenkerinnen der KI-Thematik. Seit April dieses Jahres ist sie in der Rolle des Chief Operating Officers als strategische Architektin und operative Leiterin bei Squirro tätig. Zuvor hatte sie als Marketingleiterin die Markenidentität des Unternehmens geschärft.
Nicole Schnittfeld
Mitglied der Geschäftsleitung Operations Schweizerische Post






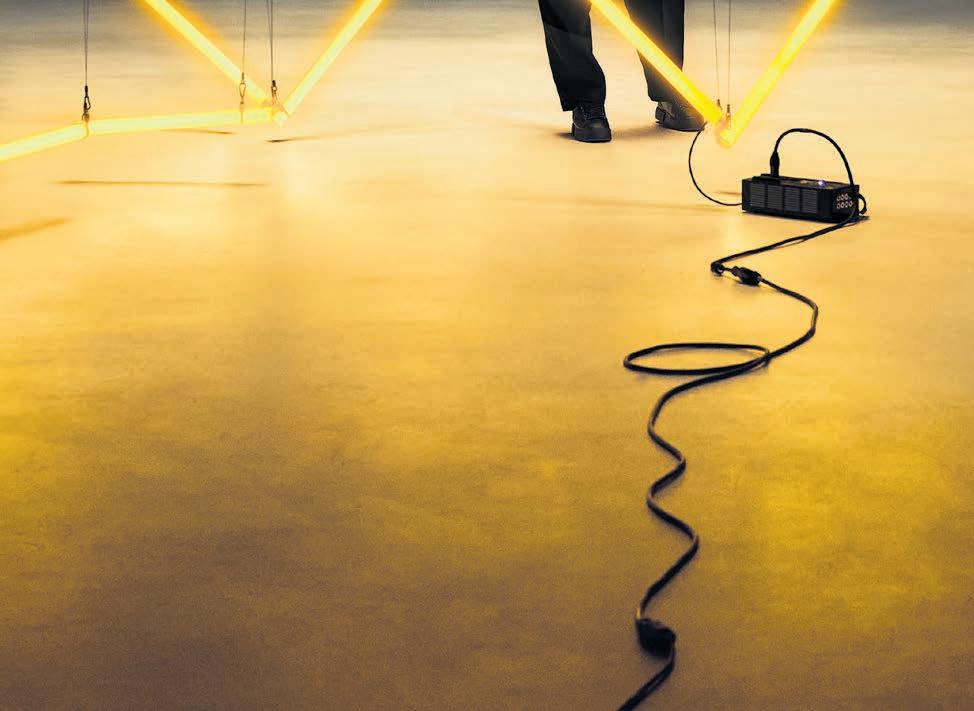
Grosse Aufgaben brauchen zukunftsfähige Lösungen. Unser mehrfach ausgezeichnetes Mobilfunk- und leistungsstarkes Glasfaserkabelnetz verbindet seit fast zehn Jahren alle Mitarbeitenden, Filialen und Geräte der Post in der gesamten Schweiz.


Die Schweiz steht vor einer digitalen Weggabelung: Immer mehr Daten werden in die Cloud verlagert, doch die Frage nach Kontrolle und Verantwortung bleibt bestehen. Zwischen globalen Anbietern und nationaler Kontrolle sucht das Land nach Lösungen, die Sicherheit, Effizienz und Eigenständigkeit vereinen – eine zentrale Herausforderung für Behörden und Unternehmen gleichermassen.
an stelle sich vor: Ein mittelständisches Finanzunternehmen in der Schweiz plant, Kundendaten in der Cloud zu verwalten, um Analyseprozesse zu beschleunigen und Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen treffen zu können. Die Auswahl reicht von internationalen Plattformen, die hohe Flexibilität und bekannte Technologien bieten, bis hin zu nationalen Cloud-Anbietern, die garantieren, dass sämtliche Daten innerhalb der Schweiz verbleiben. Diese Wahl hat weitreichende Konsequenzen: Sie betrifft Compliance, Datensicherheit und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden, aber auch die langfristige strategische Unabhängigkeit des Unternehmens.
Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit, digitale Technologien unabhängig, selbstbestimmt und verantwortungsvoll einzusetzen. Für die Schweiz, die international in Finanzdienstleistungen, Forschung und Innovation vernetzt ist, bedeutet dies insbesondere, Kontrolle über sensible Daten zu behalten. Wesentliche Fragen betreffen den Speicherort der Daten, Zugriffsrechte und die Verarbeitungsvorgänge – unabhängig von ausländischen Cloud-Anbietern.
Chancen und Herausforderungen der Cloud Cloud-Computing eröffnet neue Möglichkeiten:
– Skalierbare Speicherlösungen, die an den Bedarf angepasst werden können
Digitale Souveränität hängt nicht allein von der Infrastruktur ab. Fachkräfte müssen in der Lage sein, Technologien verantwortungsvoll zu nutzen.
– Flexible Rechenkapazitäten für komplexe Anwendungen
Kosteneffizienz durch Verzicht auf eigene Hardware
Gleichzeitig ergeben sich Risiken. Daten auf Servern im Ausland unterliegen nicht automatisch den Schweizer Datenschutzgesetzen und die Abgängigkeit von internationalen Anbietern kann politische und wirtschaftliche Unsicherheiten erhöhen.
Ein Beispiel: Ein Forschungsinstitut möchte Patientendaten für klinische Studien speichern und analysieren. Werden die Daten auf internationalen Servern abgelegt, können unterschiedliche Rechtslagen und Zugriffsmöglichkeiten in Drittländern entstehen. Ein nationaler Cloud-Dienst gewährleistet dagegen die Einhaltung schweizerischer Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften, reduziert regulatorische Risiken und erleichtert die Einhaltung ethischer Standards.
Strategien für nationale digitale Souveränität
Die Schweiz verfolgt einen pragmatischen Ansatz: Staatliche Stellen fördern sowohl die Nutzung internationaler Plattformen unter klar definierten Sicherheits- und Datenschutzauflagen als auch den Aufbau lokaler Cloud-Lösungen. Öffentliche Ausschreibungen, Förderprogramme und gesetzliche Rahmenbedingungen sollen sicherstellen, dass Unternehmen und Behörden Zugriff auf rechtlich konforme und technisch sichere Dienste haben. Ergänzend werden Standards für Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Datenmanagement definiert, um ein hohes Mass an Sicherheit zu gewährleisten.
Wirtschaftliche Perspektiven
Die Nachfrage nach Cloud-Diensten, die Anforderungen erfüllen, steigt insbesondere in Finanzwesen, Gesundheitswesen und Forschung. Schweizer Anbieter
entwickeln Plattformen, die Flexibilität, Skalierbarkeit und Rechtssicherheit verbinden. Unternehmen können dadurch digitale Innovationen nutzen, ohne Abhängigkeiten von ausländischen Anbietern einzugehen und gleichzeitig die Anforderungen von Datenschutz und Compliance erfüllen.
Kompetenzaufbau und Bildung
Digitale Souveränität hängt nicht allein von der Infrastruktur ab. Fachkräfte müssen in der Lage sein, Technologien verantwortungsvoll zu nutzen. Schulen, Hochschulen und Unternehmen setzen daher auf Ausbildung, Weiterbildung und Forschung, um Expertise im sicheren Umgang mit CloudDiensten und sensiblen Daten zu entwickeln. Dies umfasst sowohl technische Fähigkeiten als auch Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die digitale Souveränität bleibt ein dynamisches Zusammenspiel aus Technologie, Recht und Wirtschaft. Die Schweiz muss die Balance zwischen internationaler Vernetzung und nationaler Kontrolle finden. Erfolg wird daran gemessen, inwiefern technologische Innovationen genutzt werden können, ohne die Datenhoheit zu verlieren und wie gut Sicherheits- und Datenschutzstandards in der Praxis umgesetzt werden. Cloud-Lösungen, Kompetenzaufbau und klare gesetzliche Rahmenbedingungen bilden dabei die zentralen Säulen für eine souveräne digitale Zukunft.


Zwischen Schlagwort und Substanz
«Digitale Souveränität» ist derzeit eines der meistgenutzten Schlagworte in der IT- und Wirtschaftspresse. Politiker, Branchenverbände und Anbieter betonen ihre Wichtigkeit, wenn es um Datenschutz, Sicherheit und digitale Unabhängigkeit geht. Doch abseits von Panels und Fachartikeln bleibt die Debatte oft oberflächlich und voller Fragen. Unternehmen hören Schlagworte wie Datenhoheit oder Sovereign Cloud, ohne eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, was diese Begriffe für die eigene Organisation wirklich bedeuten.
Der Preis dieser Unschärfe kann hoch sein: Entscheidungen werden vertagt, Chancen verpasst und Risiken übersehen.
Was macht eine Cloud souverän?
Eine souveräne Cloud ist mehr als Datenresidenz in einem Rechenzentrum im Inland. Sie beruht auf einer Kombination aus rechtlichen, technischen und organisatorischen Eigenschaften, die sicherstellen, dass die gesamte Datenverarbeitung im Einklang mit den geltenden Gesetzen und den strategischen Interessen des Unternehmens steht.
Kernkriterien
– Rechtskonformität: Erfüllung aller relevanten Datenschutzgesetze. Dabei geht es nicht nur um Speicherort, sondern auch um Zugriffskontrolle und Zugriffsmöglichkeiten aus dem Ausland.
– Datenhoheit: Der Kunde behält jederzeit die volle Kontrolle darüber, wer Zugriff auf seine Daten hat, und kann technische sowie organisatorische Zugriffsbeschränkungen nicht nur einsehen sondern auch durchsetzen.
– Technische Souveränität: Ist in der Schweiz und Europa nicht zu 100 Prozent möglich. Aber man kann durch die Nutzung von Standards, offenen Schnittstellen und interoperablen Technologien ein sinnvolles Mass erreichen, um Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern oder politischer Volatilität zu reduzieren.
– Transparenz: Nachvollziehbare Prozesse und klare Vertragsgestaltung, um rechtliche Grauzonen zu minimieren.
– Betrieb in vertrauenswürdigem Rechtsraum: Idealerweise schliesst man als Unternehmen Verträge über kritische Infrastruktur ausschliesslich mit Anbietern, die keine extraterritorialen Zugriffsmöglichkeiten wie den US Cloud Act kennen.
Diese Kriterien klingen selbstverständlich – ihre konsequente Umsetzung ist es jedoch keinesfalls, denn es handelt sich hier um Gestehungskostentreiber. Mit Ausnahme von Anbietern, die Datenschutz als Teil ihres Angebots vermarkten, bleibt das Thema für die meisten Unternehmen ein unliebsamer Kostenpunkt. Relevanz für Unternehmen – Pflicht oder Kür? Nicht jede Organisation hat die gleichen Anforderungen. Dennoch gibt es mindestens drei Gründe, weshalb Schweizer Unternehmen die Frage nach Cloud-Souveränität nicht ignorieren sollten:
1. Regulatorische Anforderungen: Banken, Versicherungen, Gesundheits- und öffentliche Einrichtungen unterliegen teilweise strengen Auflagen zur Datenspeicherung und -verarbeitung. Hier unterliegt aber nicht alles, was beispielsweise eine Bank technisch macht, diesen Regularien, sondern nur (besonders) schützenswerte Anwendungsfälle. Eine Differenzierung wird oft vernachlässigt.
2. Vertrags- und Haftungsrisiken: Kunden und Partner erwarten zunehmend, dass sensible Daten unter klar definierten Rahmenbedingungen verarbeitet werden. Das ist aber in den wenigsten Unternehmen technische Realität. Ringt sich ein Unternehmen dazu durch, ein Audit durchzuführen, ist dies lediglich eine Momentaufnahme und keine Garantie, dass Daten dauerhaft effektiv auf ausreichendem Niveau geschützt sind.
3. Strategische Resilienz: Abhängigkeit von Anbietern, deren strategische Ausrichtung oder Rechtslage sich ändern kann, birgt operative Risiken. Convenience und Commodity verleiten dazu, sich in grössere Abhängigkeiten zu begeben, als man das
Souveränität ist in aller Munde, aber gelebt wird sie nur von jenen, die langfristig in ihre Unabhängigkeit investieren wollen.
– Max Wellenhofer, Senior Business Development Manager
Was kann man also als IT-Leiter tun, um sich zu schützen? Herangehensweise: kein Unterschied zum klassischen Vorgehen.
Eine souveräne Cloud ist Stand 2025 kein Plugand-Play-Produkt. Wer sich für eine Umstellung entschieden hat, sagt «Ja» zu strategischer Vorbereitung und pragmatischen Umsetzungsschritten:
1. Bedarfsklärung: Welche Daten und Systeme sind kritisch? Welche regulatorischen Vorgaben gelten? Welche Risiken sind akzeptabel?
als Unternehmer möchte. Oft fehlen aber marktfähige Alternativen zu einem wettbewerbsfähigen Preis und so geht man die Abhängigkeit auf gut Glück ein. Ein Risiko, das die meisten Unternehmen bewusst oder unbewusst in Kauf nehmen.
Kaum eine Firma hat vollständige Transparenz darüber, welche Daten sie überhaupt warum speichert und wie.
Aus dieser Unsicherheit heraus werden Ansätze wie ein «reiner Inlandsbetrieb», ein weiterer «On- Premise Lifecycle» oder «wir schieben jetzt einfach alles zu Azure» als kategorische Lösung herangezogen, doch keines der Extreme löst das Problem im Normalfall. Denn weder rechtlich noch technisch wurde hier eine passgenaue Lösung erarbeitet. Die Kunst besteht darin, eine risikoadäquate, wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden.
Bevor ein Unternehmen über die Wahl zwischen souveräner Cloud und Hyperscaler entscheidet, sollte es zunächst genau verstehen, welche Daten, Prozesse und Anwendungsfälle es tatsächlich betreibt. In der Praxis zeigt sich, dass viele Organisationen – oft unbewusst – mit besonders schützenswerten Daten umgehen. Dazu gehören etwa Gesundheitsinformationen aus Arztzeugnissen im HR-Bereich, biometrische Daten aus Zutrittskontrollen, strafrechtliche Informationen aus Bewerbungsverfahren oder Kundendaten mit sensiblen Inhalten, die im CRM vermerkt sind. Auch technische Konstruktionspläne oder vertrauliche Vertragsdokumente können einen hohen Schutzbedarf haben, selbst wenn sie nicht unter das Datenschutzgesetz, sondern unter das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen fallen.
Erst wenn diese Bestandsaufnahme erfolgt ist, lässt sich fundiert beurteilen, ob und in welchem Umfang eine souveräne Cloud erforderlich ist – oder ob ein Hyperscaler unter klar definierten Rahmenbedingungen den Anforderungen ebenso gerecht wird. Ohne diese Analyse bleibt jede Entscheidung über den Cloud-Typ ein Stück weit spekulativ.
Performance und Skalierbarkeit –Konkurrenz zu Hyperscalern?
Ein häufiges Argument gegen unabhängige CloudPlattformen lautet, dass sie in Sachen Skalierbarkeit, Performance und Funktionsumfang nicht mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud mithalten könnten. Und meistens stimmt das. Was auch stimmt ist, dass die meisten Unternehmen den Grossteil der Features gar nicht nutzen (können), sowohl Skalierbarkeit als auch Performance lokaler Anbieter vollkommen ausreichend ist und die Nähe zum Support oft eine sehr grosse Rolle spielt.
Technologisch sind viele regionale Anbieter heute auf einem guten Stand. Gerade in der Schweiz ist das Niveau der Service-Landschaft sehr hoch. Moderne Virtualisierung, Container-Orchestrierung, Software-Defined Networking und OpenSource-basierte Plattform-Services ermöglichen Leistungsniveaus, die für die meisten Unternehmensanwendungen weit mehr als ausreichend sind.
Geografische Skalierung ist kein zentrales Kriterium für Schweizer Unternehmen, deren Zielmärkte primär in Europa liegen.
Latenz und Verfügbarkeit profitieren theoretisch von der Nähe zum Kundenstandort, da Datenwege kürzer und Service-Teams greifbarer sind, aber technisch spielt die Latenz in der Schweiz für die meisten Unternehmen aufgrund der sehr hohen Qualität der Connectivity keine Rolle.
Die meisten IT-Leiter sehnen sich danach, einfach mal mit jemandem sprechen zu dürfen, der ihnen nichts verkaufen muss.
Keine Frage: Innovationstempo bleibt ein Vorteil der Hyperscaler, insbesondere bei KI-, IoT- oder Big-Data-Diensten, aber es gibt für alles Alternativen, wenn der Bedarf da ist.
Besonders in kleinen Märkten wie der Schweiz müssen unabhängige Anbieter hier durch Integration und Partnerschaften punkten.
Die Fragen sind:
– Welches Set-up ist optimal für meine Kunden?
– Was brauche ich als Unternehmen wirklich?
– Welche Services entlasten mich und mein Team und helfen uns, kompetitiv, vorne im Markt mit dabei zu bleiben?
– Welche Service-Tiefe soll mein Team konsumieren können?
– Welche Abhängigkeiten sollten wir vermeiden?
– Welche Systeme helfen mir dabei, Automatisierung und Geschwindigkeit in meinem Unternehmen bei gleichzeitiger Reduktion meiner Grenzkosten für jeden zusätzlichen Kunden zu erhöhen?
Der Dienstleister, der diese Fragen individualisiert, verständlich und zu einem fairen Preis beantworten kann, hat beste Chancen, einen wertvollen Beitrag zu einer modernen und zukunftsfähigen Schweizer Wirtschaft beizutragen.
Risikoanalyse als Entscheidungskompass
Die Wahl zwischen einer souveränen Cloud und einem Hyperscaler ist selten eine rein technische oder preisgetriebene Entscheidung. Sie berührt Rechtsfragen, strategische Abhängigkeiten, Innovationsfähigkeit und nicht zuletzt die Organisationsstruktur. Der erste Schritt ist daher immer, eine unternehmensspezifische Risikoanalyse durchzuführen.
Diese Analyse sollte für beide Szenarien – souveräne Cloud und Hyperscaler – durchgeführt werden und mindestens folgende Dimensionen betrachten:
1. Recht & Compliance: Welche Gesetze und regulatorischen Anforderungen gelten und wie hoch ist das Risiko eines Verstosses?
2. Datenhoheit: Wer hat die operative und rechtliche Kontrolle über die Daten?
3. Technologische Abhängigkeiten (Vendor-Lockin): Wie aufwendig wäre ein Anbieterwechsel?
4. Performance, Skalierbarkeit und Funktionsvielfalt: Passen die technischen Möglichkeiten zum Wachstumspfad des Unternehmens?
5. Kostenentwicklung: Wie stabil und kalkulierbar sind die langfristigen Kosten?
6. Sicherheitslage und Betriebsstabilität: Wie hoch sind die Risiken durch Ausfälle, Cyberangriffe oder interne Fehler?
Unternehmen bewerten jede Kategorie nach Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Schadenshöhe. Daraus ergibt sich eine Risikopriorität, die als objektive Grundlage für strategische Entscheidungen dient. Die Ergebnisse sollten anschliessend in einer Risikomatrix visualisiert werden, um Prioritäten auf einen Blick zu erkennen.
Dieses Vorgehen hat zwei Vorteile:
1. Transparenz – Entscheidungen beruhen auf nachvollziehbaren Kriterien statt auf Bauchgefühl oder Trends.
2. Individualisierung – Jedes Unternehmen erkennt, welche Risiken für den eigenen Kontext wirklich relevant sind und kann seine Roadmap entsprechend gestalten.
Unternehmen, die diese Übung sauber absolviert haben, kommen meist zu dem Schluss, dass es eine MultiCloud-Strategie wird, in der nebst dem Standard-Portfolio der ausgewählten Anbieter noch einige Spezialanforderungen hinzukommen. Es wird ein Projekt.
Genau an diesem Punkt scheitern viele Cloud-Transformationsprojekte. Denn jetzt heischen alle um den grössten Teil des Kuchens. Der Hyperscaler beteuert, dass er alles kann und es keine weiteren Anbieter braucht. In der Open-Source-Community ist man allergisch gegen alles Proprietäre und es gibt nur selten eine Entität, die beide Welten gut kennt und die richtigen Leute – zu einem für das betroffene Unternehmen sinnvollen Preis – an einen Tisch bekommt. Am Ende sollte es um die beste Lösung für den Kunden gehen, aber effektiv geht es um Revenue.
2. Anbieterauswahl: Neben Preis und Leistung muss geprüft werden, ob der Anbieter rechtliche und technische Souveränitätskriterien erfüllt.
3. Migrationsstrategie: Security-Konzept, Proof of Concept, schrittweise Migration und klare ExitStrategien sind Pflicht. Wenn an dieser Stelle noch ein Application-Modernisation-Projekt von LegacyApplikationen eingeschoben wird, kann die Komplexität des Projekts schnell überwältigend werden.
4. Governance und Compliance: Rollen, Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen definieren, um langfristig die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen.
5. Betriebsprozesse: Monitoring, Incident-Response und Support-Strukturen müssen die Sicherheits- und Verfügbarkeitsziele widerspiegeln.
6. Exit-Planung: Schon vor Vertragsunterzeichnung klären, wie Daten und Anwendungen im Bedarfsfall migriert werden können. Das wird fast immer vergessen.
Der blinde Fleck in der Diskussion Was in der öffentlichen Debatte selten thematisiert wird: Souveränität ist nicht allein eine Frage der Technologie, sondern eine des Organisationsdesigns. Selbst die sicherste Cloud-Architektur nützt wenig, wenn interne Prozesse, Schulungen oder Berechtigungskonzepte Lücken lassen. Ebenso kann eine Übererfüllung technischer Kriterien zu hohen Kosten führen, wenn sie nicht auf reale Geschäftsrisiken abgestimmt ist.
Die nüchterne Auseinandersetzung mit den eigenen Abhängigkeiten, Risiken und Prioritäten ist oft schwieriger als der Einkauf der «passenden» Technologie. Fazit
Digitale Souveränität ist kein Allheilmittel für jahrelang aufgeschobene Cybersecurity-Basis-Arbeit oder technische Schulden aller Art, sondern in erster Linie eine perspektivische Auseinandersetzung mit dem Thema «Technologische Unabhängigkeit». Eine souveräne Cloud ist keine neue Erfindung. Sie ist eine moderne, auf den Anwendungsfall abgestimmte und optimierte Technologie, die es einem Unternehmen gemeinsam mit passenden Prozessen und Kultur erlaubt, rechtlich, technisch und organisatorisch Risiken und Kosten zu steuern, Compliance sicherzustellen und langfristige Unabhängigkeit zu sichern. Die Debatte sollte sich deshalb von pauschalen Forderungen und politischen Symbolhandlungen lösen – hin zu individuellen Analysen und massgeschneiderten Lösungen.
Wer diesen Weg beschreitet, muss weder dogmatisch noch technikgläubig vorgehen, sondern konsequent geschäftsorientiert.
Souveränität ist in aller Munde, aber gelebt wird sie nur von jenen, die langfristig in ihre Unabhängigkeit investieren wollen.
Weitere Informationen unter: cyberlink.ch/de/cloud

Über den Autor Max Wellenhofer unterstützt seit über zehn Jahren Unternehmen im DACH-Raum bei der Einführung und Weiterentwicklung souveräner Cloud- und Datenstrategien. Sein Schwerpunkt liegt auf technologischen und organisatorischen Systemen, die eine fundierte und datenzentrierte Unternehmensführung ermöglichen. Seine Expertise bringt er vor allem bei Kunden der Cyberlink AG ein, einem Schweizer Managed-Service-Provider aus Zürich mit eigener, souveräner digitaler Infrastruktur.
Die Welt ist digitalisiert. Die Datenmengen nehmen zu. Die Rechenlasten wachsen schneller als die Budgets. Die regulatorischen Ansprüche an Datenkontrolle und Transparenz steigen immer stärker. So verschieben sich IT-Infrastrukturentscheidungen nicht mehr nur in den Maschinenraum jedes Unternehmens, sondern in die Chefetagen und die Unternehmensphilosophie.

Im Kontext der KI wachsen und verändern sich physische Infrastrukturen derart, dass sie nur noch von spezifisch darauf fokussierten Datacentern effizient betrieben werden können. Die Cloud gewinnt dabei weiter an Bedeutung und mit ihr rückt Datensouveränität in den Fokus. Noch deutlicher zeigt sich, dass der Einfluss der KI und der Umgang damit zu existenziellen Faktoren der Marktleistung und Unternehmensführung werden. Private und staatliche Institutionen, Organisationen, Unternehmen, sie alle brauchen deshalb dringend ein Souveränitätskonzept und davon abgeleitet konkrete, flexibel anpassbare Massnahmen.
Gute Rahmenbedingungen in der Schweiz
Die Schweiz bietet ein sehr gutes Set an Rahmenbedingungen: Stabilität, Rechtssicherheit, Standortqualität und Vertrauen – der Hintergrund also, auf dem Sicherheit und Zukunftsfähigkeit gedeihen können. Zudem verfügt sie über eine aufstrebende Hochleistungs-Datacenterlandschaft, die es ermöglicht, lokale Standortvorteile mit globaler Vernetzung zu verbinden und so hybride IT-Architekturen wirkungsvoll zu unterstützen.
Es braucht Souveränitätskonzepte Digitale Souveränität ist kein politisches Schlagwort, sondern eine praktische Notwendigkeit im Umgang mit Daten. Sie zeigt sich darin, dass jederzeit klar ist, welche Daten überhaupt vorhanden sind, wo welche Daten gespeichert sind, welche Daten wie geschützt werden müssen, wer die Schlüssel dazu verwaltet und wie Zugang und Zugriff gesteuert werden. Mit dem revidierten Datenschutzgesetz in der Schweiz steigen die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Das heisst, dass IT-Architekturfragen immer auch Governancefragen sind. Wer Souveränität ernst nimmt, baut seine Systeme so, dass Nachweise gegenüber Kundschaft, Stakeholdern, Behörden usw. jederzeit erbracht werden können. Digitale Souveränität verlangt aber vor allem auch umfassende, dokumentierte Schutzmassnahmen und -mechanismen, um Daten, Anwendungen, Prozesse und Zugänge vor externen Angriffen jeder Art (DDoS, Ransomware, Phishing usw.) zu schützen.
Sicherheit und Vertrauen als Währung Die Sicherheitsarchitektur von staatlichen und privaten Unternehmen und Organisationen erhält überlebenskritisches Gewicht. Die zunehmenden Cyberangriffe, Industriespionage und geopolitische Spannungen machen deutlich, dass Vertrauen nicht selbstverständlich ist und es hier für Souveränität intensivierte Anstrengungen braucht. Moderne HochleistungsDatacenter wie jene von Green nutzen ihren Standortvorteil und bieten physische Barrieren, redundante Systeme, maximale Ausfallsicherheit und autarke Energieversorgung. Ihre Prozesse sind zertifiziert und
Schon das Nachdenken über digitale Souveränität kann IT-Welten erhellen, und das ist so spannend wie lohnenswert.
nachprüfbar. Sie sind in der Lage, weitaus umfassendere Sicherheits-, Kapazitäts- und Nachhaltigkeitswerte zu liefern, als das bei Inhouse-Datacentern überhaupt denkbar, geschweige denn finanzierbar wäre.
Souveränität und Nachhaltigkeit: Grundlage für freie Entfaltung
Digitale Souveränität ist die Grundlage für freie Entfaltung. Aber um diese Souveränität zu erlangen, braucht es allein schon unternehmensintern grosse Anstrengungen; die Devise heisst «Wissen, Denken, Tun». Zudem kommen noch bedeutende äussere Einflüsse und Anforderungen hinzu. Einerseits sind dies anspruchsvolle Nachhaltigkeitskriterien. Politik, Unternehmen, Investoren, Regulatoren verlangen belastbare Nachweise für Energieverbrauch und Klimawirkung. Einzelne Kennwerte wie PUE reichen alleine nicht mehr aus. Gefordert ist eine ganzheitliche Betrachtung, die ESG-Kriterien und Emissionen transparent abbildet und sich an definierten Zielsetzungen orientiert. Wer hier Klarheit schafft, gewinnt Glaubwürdigkeit. Nachhaltigkeit wird heute nicht zuletzt auch zu einem Image- und Wettbewerbsfaktor.
KI als ökologischer Störfaktor
Andererseits ist es gar nicht so einfach, unabhängig zu sein oder es zu werden. Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Anwendungen, sondern auch die Infrastruktur. Trainingsdaten, Modelle und Simulationen brauchen Rechenleistungen und Storage, die den Energieverbrauch massiv erhöhen. KI-Racks erzeugen hohe Wärmelasten, die die klassische Luftkühlung an ihre Grenzen bringen.
KI und digitale Abwärme als Chance Internationale Analysen zeigen, dass Rechenzentren in diesem Jahrzehnt einen spürbar wachsenden Anteil am Gesamtstrombedarf ausmachen werden. Energie wird zum strategischen Faktor und schafft neue Abhängigkeiten. Der Umgang mit Wärme, Abwärme, Kühlung, Wasser muss weitergedacht werden. Flüssigkühlung und deren Wärmerückgewinnung werden zu Kerntechnologien. Moderne Datacenter nutzen die Abwärme als Ressource, speisen diese in lokale Wärmeverbünde ein und beheizen damit ganze Quartiere. Je intelligenter diese Massnahmen umgesetzt werden, desto geringer ist der negative Impact der Digitalisierung.
Datensouveränität, Datensicherheit und IT-Strategien
So schön der Gedanke der Datensouveränität ist, so anspruchsvoll ist ihre Verwirklichung. Deshalb ist es wichtig, das Wissen über seine eigenen und die von aussen kommenden Daten umfassend auszubauen. Denn nur auf dieser Grundlage wird es möglich zu entscheiden, welche Technologien für welche Datengruppen geeignet, gestattet, vertretbar sind. Marktanalysen bestätigen, dass Multi-Cloud- und Hybridstrategien zur Norm werden. Unternehmen nutzen globale Anbieter für Skalierung und Innovation, sichern aber gleichzeitig kritische Daten lokal inhouse oder bei einem Schweizer Anbieter von Datacenter-Services, der Private Clouds, individuelle Racks oder ganze Serverräume zur Verfügung stellt. Die modernen Schweizer Datacenter bilden das Rückgrat für die Digitalisierung und die grössten davon sind für jede Form der Speicherung von Daten, Applikationen und Services gerüstet – konservativ, hybrid oder vollständig cloudbasiert. Ausserdem sind sie technologie- und kapazitätsmässig bereits heute für die KI-Zukunft ausgebaut oder zumindest dafür konzipiert.
Dringlichkeit ohne Alarmismus Es ist tatsächlich Zeit, sich jetzt mit dem Thema «Datensouveränität» zu befassen und individuelle Souveränitätskonzepte zu entwickeln. Denn es ist zukunftsentscheidend, sich rechtzeitig mit der Qualifizierung und dem Schutz der eigenen und der externen Daten zu befassen und auf dieser Basis eine nachhaltige IT-Infrastrukturlösung zu finden. Dass da aber nicht nur rein technologische Faktoren eine Rolle spielen, sondern auch menschliche, sollte nicht vergessen werden. Wegen der zunehmenden Digitalisierung und dem Aufkommen von KI sind nicht nur Unternehmen gefordert, sondern auch die Privatbevölkerung wird mit dem Thema Datensouveränität konfrontiert.
Datensouveränität ist die Basis für digitale Resilienz In einer Welt, die von KI geprägt und umgestaltet wird, wird digitale Resilienz zu einem starken Erfolgsfaktor. Sie bringt Ruhe und Sicherheit in die technologische Dynamik, hilft Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu verbinden und bietet damit gute Grundlagen für Innovation und Entfaltung.
Voraussetzung dafür ist IT-, Daten-, Applikations- und Prozesssouveränität. Um diese optimal zu verwirklichen, bieten die Datacenter-Services von Green geeignete Dienste und Anlaufstellen. Datensouveränität ist die Basis für digitale Resilienz und digitale Resilienz ein Erfolgsfaktor im professionellen Umgang mit den kommenden Entwicklungen von IT und KI. Schon das Nachdenken über digitale Souveränität kann IT-Welten erhellen und das ist so spannend wie lohnenswert.

Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich nach Europa. Mit neuen, sicheren und energieeffizienten DatacenterKapazitäten in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation.
Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in Planung. Green bietet geo-redundantes Hochleistungscomputing für Cloud-Anbieter und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte hinweg. Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem renommierten «M&O Stamp of Approval» ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert –unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG, 2020–2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards, 2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).
Weitere Informationen unter: green.ch
«Das
wird oft unterschätzt»

Benjamin Kocher Gründer und Managing Partner
Viele Schweizer Unternehmen treibt die Angst um, im anbrechenden KI-Zeitalter den Anschluss zu verpassen. Die relyz AG bringt hier Ruhe und neue Perspektiven rein – und sorgt dafür, dass Firmen genau zu der KI-Lösung kommen, die ihren Anforderungen wirklich entspricht.
Herr Kocher, die relyz AG unterstützt Unternehmen dabei, den digitalen Wandel erfolgreich zu vollziehen. Mit welchen Fragen treten Kundinnen und Kunden an Sie heran?
Viele Unternehmen spüren einen starken Handlungsdruck – KI ist allgegenwärtig und die Sorge, den Anschluss zu verpassen, ist gross. Doch der Umgang damit bleibt oft diffus: KI wird häufig als reine Technologie oder gar als Spielerei betrachtet, während ihr disruptives Potenzial unterschätzt wird. In der Folge wird viel ausprobiert, meist aber ohne strategischen Rahmen. Deshalb stellen wir zu Beginn eine einfache, aber zentrale Frage: Was genau soll KI im Unternehmen bewirken? Fehlt ein klares Zielbild, setzen wir mit unserem Modell an – den fünf Dimensionen einer KI-Strategie.
Können Sie die erste Dimension, die Sie hierfür mit Ihren Kunden betrachten, näher beschreiben? Wir beginnen mit der Dimension «Unternehmensstrategie» und der Frage nach dem konkreten Nutzen: Welchen Mehrwert kann KI im jeweiligen Unternehmen und für dessen Kundschaft stiften?
Es ist uns zudem ein Anliegen, unseren Kunden die Dringlichkeit zu nehmen und ihre Befürchtung zu lindern, sie könnten den Anschluss verpassen. Wir transformieren also die anfängliche Angst in Klarheit, was den Weg für die zweite strategische Dimension, die «Organisation», ebnet.
Geht es hierbei um die Formulierung von Prozessen?
Die Prozessgestaltung ist in der Tat ein wichtiger Aspekt – doch zuerst braucht es Klarheit über Regeln, Rollen und Verantwortlichkeiten. Sie bilden die Grundlage für funktionierende Prozesse, machen Handlungen nachvollziehbar und schaffen Kontrolle. Viele unserer Gesprächspartner auf C-Level-Ebene glauben, sie müssten alle KI-Initiativen selbst vorantreiben. Wir entlasten sie von dieser Bürde, indem wir die Verantwortlichkeiten im Unternehmen verteilen.
Es wird oft gesagt, dass die digitale Transformation eine Angelegenheit des Managements sei. Stimmen Sie dem zu?
Nur teilweise, denn gerade im Bereich der KI liegt enormes Potenzial im Bottom-up-Ansatz, da die Mitarbeitenden aus den Fachbereichen oft am besten wissen, wo Verbesserungsbedarf besteht. Deshalb initiieren wir jeweils eine AI-Taskforce, bestehend aus KI-affinen Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen und Hierarchieebenen. Dieser partizipative Ansatz liefert deutlich bessere Resultate, als wenn das Management allein entscheidet. Was geschieht, sobald die Regeln, Verantwortlichkeiten und Prozesse definiert sind?
Dann führen wir in der strategischen Dimension «Technologie» eine Analyse des technologischen IstZustandes durch. Dabei klären wir, ob das Unternehmen bereits eine Cloud-Strategie verfolgt und welche Plattformen genutzt werden. Als unabhängige Beratungsboutique kennen wir eine Vielzahl an Lösungen
und evaluieren, welcher KI-Ansatz sich am besten in die bestehende IT-Architektur integrieren lässt. Stehen diese technologischen Leitplanken, folgt die nächste Dimension: die «Daten». Hier steht der verantwortungsvolle Umgang mit einer der wichtigsten Unternehmensressourcen im Zentrum. Neben Verfügbarkeit und Qualität geht es um Klassifikation, Zugriffsrechte, Speicherung und Sicherheit – stets im Spannungsfeld zwischen technologischen Möglichkeiten, Governance und Compliance. In der letzten Dimension, «Ethik», beleuchten wir Aspekte wie Transparenz, Integrität und Nachhaltigkeit – sowohl im Umgang mit Daten als auch im Einsatz von KI insgesamt. Wenn ein Unternehmen die fünf Dimensionen hat, wie sieht die KI-Lösung aus, für die es sich entscheidet?
Die richtige KI-Lösung ist immer individuell – es gibt kein Pauschalrezept. Entscheidend ist, dass sie sich nahtlos in die bestehende IT-Strategie und -Architektur integriert. KI darf nicht isoliert betrieben werden, sondern muss mit den bestehenden Systemen und Prozessen zusammenspielen. Nebst den etablierten Ökosystemen von Anbietern wie Microsoft oder Google beobachten wir aktuell einen klaren Trend zu mehr Unabhängigkeit: Immer mehr Unternehmen betreiben KI-Modelle in Private Clouds mit Serverstandort Schweiz oder EU – oft auf Basis von Open-Source- oder Open-Weight-Sprachmodellen.
Nach der Strategieentwicklung und Identifikation der Handlungsfelder geht es um die konkrete Umsetzung. Wie gehen Sie hierfür vor? Echte Wirkung entsteht erst durch konsequente Umsetzung. Unser Vorgehen folgt dabei sechs klaren Schritten: Wir starten explorativ, identifizieren systematisch Use-Cases, testen diese in schlanken Pilotprojekten und messen ihren Nutzen. In iterativen Zyklen werden erfolgreiche Ansätze weiterentwickelt, in Prozesse integriert und schrittweise
skaliert. Erfolge wie Rückschläge werden transparent kommuniziert und neue Erkenntnisse fortlaufend adaptiert – als Teil einer lernenden Organisation.
Wie lange dauert ein «typisches» Projekt bei relyz?
Strategieprojekte dauern bei uns in der Regel vier bis sechs Wochen. Sie liefern schnell Klarheit, ein Zielbild und eine priorisierte Roadmap. Bei Umsetzungsprojekten sind wir Verfechter von einem 90- bis 100-Tage-Rhythmus. Dieser Zeitrahmen ermöglicht fokussiertes Arbeiten mit klaren Ergebnissen – ohne den Drive durch eine zu hohe Komplexität zu verlieren.
Was treibt Sie persönlich an, Unternehmen auf ihrer digitalen Reise zu begleiten?
In einer Zeit, in der viele Unternehmen zwischen Verunsicherung und Aktionismus schwanken, motiviert es mich, auf Basis meiner Erfahrung Orientierung zu geben, Neues auszuprobieren und gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden den Wandel aktiv zu gestalten. Genau dafür steht auch relyz – das Unternehmen, das ich vor rund drei Jahren gegründet habe: Als interdisziplinäres Team gestalten und entwickeln wir digitale Lösungen mit technologischem Weitblick, betriebswirtschaftlichem Fokus und echter Nutzerzentrierung. Weitere Informationen sowie das Interview in voller Länger unter: relyz.ch/ki-strategie

Warum OT-Sicherheit überlebenswichtig ist OT-Sicherheit ist längst keine Zusatzoption mehr, sondern ein entscheidender Faktor für den Fortbestand jedes industriellen Unternehmens. Produktionsanlagen sind heute hochvernetzt – und genau diese Vernetzung macht sie angreifbar. Historisch gewachsene Netzwerke, unkontrollierte Dienstleisterzugriffe oder fehlende Segmentierung. Risiken, die nicht nur Daten gefährden, sondern ganze Produktionsprozesse lahmlegen und im schlimmsten Fall Menschenleben bedrohen können.
Unser Ansatz: Sicherheit dort, wo es zählt Während klassische IT-Security den Fokus auf die Vertraulichkeit von Daten legt, geht es in der OT-Welt vor allem um Sicherheit, Integrität und Verfügbarkeit. Ein Angriff auf Ihre OT-Umgebung ist kein technisches Detailproblem – er kann existenzielle Folgen für Ihr Unternehmen haben. Wir setzen deshalb auf international anerkannte Standards wie SANS ICS/OT und entwickeln Lösungen, die zu Ihrer Realität passen.
Typische Herausforderungen
• Unsichere Vendor-Zugriffe Fernwartung ist nötig – aber oft ein Einfallstor für Angreifer. Wir sichern jeden Zugriff mit Privileged Access Management (PAM).
• Histroische Strukturen veraltete Netzwerke und mangelndes Asset-Management schaffen blinde Flecken. Wir sorgen für Transparenz.
• IT vs. OT-Konflikte Unterschiedliche Ziele führen zu Spannungen. Wir bauen Brücken durch praxisnahe Schulungen.
• Regulatorik Neue Vorgaben wie die IKT-Minimalstandards in der Schweiz bringen Unsicherheit. Wir sorgen für Compliance – ohne Stillstand.
Unser für 5-Schritte-Fahrplan für Sie
1. Verstehen Analyse Ihrer Assets, Vendor-Zugänge und Risiken. Wir definieren, was wirklich kritisch ist.
2. Architekur erstellen Basierend auf dem Purdue-Modell erstellen wir ein zoniertes Soll-Konzept.
3. Umsetzen Wir implementieren Segmentierung und PAM –ohne den Betrieb zu stören.
4. Teams harmonisieren Workshops bringen IT- und OT-Teams zusammen und fördern eine Sicherheitskultur.
5. Vorbereiten Wir entwickeln Incident-Response-Pläne und etablieren Monitoring & Alarmierung.
Unsere Lösung ist adaptiv, pragmatisch und störungsfrei.
Sind Sie bereit für echte OT-Sicherheit? OT-Security bedeutet Verantwortung – für Ihre Anlagen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Zukunft. Wir sind Ihr schweizer Partner mit echter IT/OT-Expertise.
Ihre Sicherheit ist unser Auftrag: ensec.ch | +41 44 711 11 44 | hello@ensec.ch
Generative KI ist kein Werkzeug mehr für Experimente, sondern der Motor der digitalen Transformation.
Doch damit Unternehmen von Effizienz und neuen Geschäftsmodellen profitieren können, braucht es mehr als Algorithmen: Datenqualität, Sicherheit und Vertrauen entscheiden über Erfolg oder Scheitern.
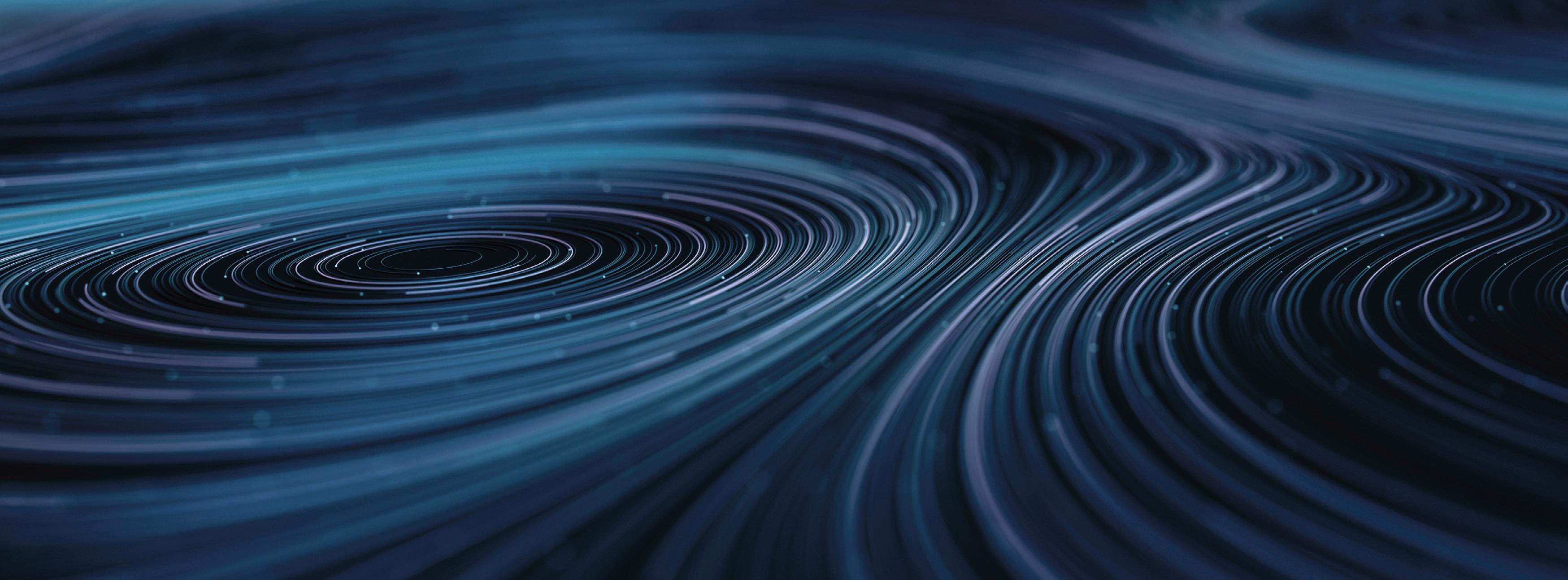
Generative KI gilt inzwischen als unverzichtbar für die Zukunftsfähigkeit vieler Unternehmen. «Ohne künstliche Intelligenz keine Zukunft»: Dieser pointierte Leitsatz spiegelt 2025 die Realität in Schweizer Chefetagen wider. Vom Bankensektor über das Gesundheitswesen bis zur Industrie: Überall testen Firmen derzeit massiv den Einsatz generativer KI, um Abläufe zu verschlanken, die Produktivität zu steigern und völlig neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Doch jenseits des Hypes zeigt sich, dass der digitale Wandel durch KI nur mit den richtigen Grundlagen gelingt. Datenqualität, Vertrauen und Infrastruktur erweisen sich als die stillen Helden der digitalen Transformation. Zusammenspiel von Cloud, Daten und Automation
Kaum eine Technologie hat verschiedene IT-Themen so miteinander verflochten wie die generative KI. Sie wirkt als Klammer, die Cloud-Computing, Datenmanagement, Cybersicherheit und Automatisierung zusammenführt. So erfordert etwa der Einsatz von Sprachmodellen enorme Rechenleistung und Zugriff auf umfangreiche Daten, was ohne flexible Cloud-Infrastrukturen kaum machbar ist. Gleichzeitig treiben KI-Anwendungen die Automatisierung voran. Routinetätigkeiten werden von smarten Assistenten übernommen, während Mitarbeitende sich komplexeren Aufgaben widmen können.
In Schweizer Unternehmen werden diese Zusammenhänge bereits sichtbar. Beispielsweise setzen Banken KI-gestützte Chatbots und Analyse-Tools ein, um Kundenanfragen zu beantworten oder interne Prozesse effizienter zu gestalten. Im Gesundheitswesen erproben Spitäler KI-Modelle, die bei Diagnosen unterstützen oder administrative Arbeit erleichtern. In der Industrie kommen KI-Systeme zum Einsatz, um etwa vorausschauende Wartung
Routineaufgaben wie die Sortierung von Anfragen, Textentwürfe oder erste Datenanalysen lassen sich automatisieren.
(Predictive Maintenance) zu ermöglichen oder Qualitätsprüfungen in Fabriken zu automatisieren. Generative KI dient hier als Drehscheibe. Sie verbindet Daten und Systeme und sorgt dafür, dass aus digitalen Visionen konkrete Verbesserungen im Alltag werden.
Datenqualität, Vertrauen und Infrastruktur als Fundament So bahnbrechend KI-Anwendungen auch sind, ohne solide Grundlagen verpufft ihr Potenzial. Viele Unternehmen merken schnell, wenn Datenqualität und Systemarchitektur nicht stimmen, kann auch die modernste KI keinen Mehrwert liefern. Verstreute Datensilos, fragmentierte Bestände oder fehlerhafte Inputs bremsen Projekte aus. Entsprechend investieren Firmen heute verstärkt in Datenmanagement und IT-Integration. Systeme werden modernisiert, Schnittstellen geschaffen, Bestände bereinigt. Ziel ist es, Algorithmen mit konsistenten, vertrauenswürdigen Daten zu versorgen. Erst dann lassen sich KI-Lösungen unternehmensweit skalieren.
Ebenso wichtig ist Vertrauen in die Technologie selbst und in ihre Sicherheit. Mitarbeitende und Kund:innen müssen darauf zählen können, dass KI transparent agiert und Entscheidungen nachvollziehbar bleiben. Dafür braucht es klare Leitplanken: Regeln, wofür KI eingesetzt wird und wann menschliche Kontrolle nötig ist. Parallel sind Datenschutz und Cybersecurity zentrale Voraussetzungen.
Schweizer Firmen bewegen sich in einem strengen regulatorischen Umfeld, vom revidierten Datenschutzgesetz bis zu europäischen Vorgaben. Wer KI im Umgang mit sensiblen Daten nutzt, muss höchste Standards erfüllen, von Verschlüsselung über sichere Cloud-Angebote bis hin zu spezifischen, lokal trainierten Modellen. Sicherheit und Compliance sind dabei nicht nur Pflicht, sondern Fundament für Akzeptanz und nachhaltigen Nutzen.
Mitarbeitende werden entlastet Richtig umgesetzt, entfaltet KI enormes Potenzial. Unternehmen berichten von klaren Effizienzgewinnen: Routineaufgaben wie die Sortierung von Anfragen, Textentwürfe oder erste Datenanalysen lassen sich automatisieren. Mitarbeitende werden entlastet und können sich wertschöpfenden Tätigkeiten widmen. Schätzungen gehen von zweistelligen Produktivitätssteigerungen aus, teils bis zu 30 Prozent. Das wirkt sich direkt auf die Kosten aus und federt den steigenden Druck in vielen Branchen ab.
Ein weiterer Vorteil: KI hilft, den Fachkräftemangel zu entschärfen. Digitale Assistenten unterstützen Entwickler:innen bei Standard-Codierungen oder Serviceteams bei Kundenanfragen. Das vorhandene Personal wird effizienter eingesetzt, Engpässe lassen sich teilweise überbrücken. Entscheidend bleibt der «Human in the Loop»-Ansatz: KI ergänzt den Menschen,
ersetzt ihn aber nicht. Dieses Zusammenspiel steigert die Leistung und erhält Akzeptanz im Team.
Governance und Security im Blick Wo Chancen sind, bestehen Risiken. Besonders sensibel ist der Datenschutz. Grosse Datenmengen sind nötig, doch deren Nutzung darf nicht in Konflikt mit Compliance-Anforderungen geraten. Anonymisierung, sichere Umgebungen und klare Richtlinien sind unverzichtbar. Unternehmen müssen dokumentieren, welche Daten genutzt werden, wie Modelle trainiert wurden und wie Entscheidungen entstehen. Parallel wächst die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Manipulierte Trainingsdaten oder der Missbrauch generativer KI für Phishing sind reale Bedrohungen. Deshalb gilt es, Sicherheitskonzepte von Beginn an mitzudenken, von Zugriffsrechten über Verschlüsselung bis zu regelmässigen Audits. Nicht zuletzt entscheidet die Belegschaft über Erfolg oder Scheitern. Fehlende Akzeptanz und Ängste können selbst die beste Strategie blockieren. Transparente Kommunikation, Schulungen und sichtbare Erfolge sind essenziell, um eine Kultur zu schaffen, in der KI als Chance verstanden wird. Generative KI steht heutzutage auf jeder C-LevelAgenda. Sie verspricht Effizienz, Kostenreduktion und neue Geschäftsmodelle, fordert aber ebenso klare Regeln für Datenschutz, Sicherheit und Governance. Wer seine Grundlagen stärkt und Teams aktiv einbindet, kann das volle Potenzial ausschöpfen. Digitale Transformation bleibt ein Marathon, doch mit KI beschleunigt sich das Tempo spürbar. Unternehmen, die jetzt mutig, aber strukturiert handeln, sichern sich die Poleposition im digitalen Zeitalter.
Text SMA

«Wer
Künstliche Intelligenz ist längst keine Spielerei mehr: Sie verändert Geschäftsmodelle und ganze Branchen. Gleichzeitig stellen geopolitische Spannungen die IT-Strategien vieler Unternehmen auf die Probe und der Wettbewerb um Talente verschärft sich. Hasan Tekin, Geschäftsführer Deutschschweiz bei Wavestone, navigiert sein Unternehmen durch diese Phase der Transformation. Seit dem Merger von Wavestone und Q_Perior treibt er die Integration voran, baut Synergien auf und entwickelt die Unternehmenskultur Schritt für Schritt weiter.

Geschäftsführer Deutschschweiz
Herr Tekin, wie mutig ist die Schweiz im internationalen Vergleich, wenn es um Digitalisierung und künstliche Intelligenz geht?
Die Schweiz ist eher pragmatisch als wagemutig. Wir experimentieren nicht unbedacht, sondern setzen auf Lösungen, die wirklich funktionieren. Wenn wir uns für eine Technologie entscheiden, dann führen wir sie nachhaltig und robust ein. Das sieht man besonders in der Finanzindustrie: Chatbots wurden zunächst sehr vorsichtig getestet, heute sind sie breit im Einsatz. In Bereichen wie Compliance-Checks oder Betrugserkennung war es ähnlich, aber heute sind wir im internationalen Vergleich sogar fast einen Schritt voraus. Das ist typisch Schweiz: lieber zuerst zögern und abwarten, dann dafür aber richtig und breit akzeptiert.
Gibt es Branchen, die im Bereich der generativen KI besonders schnell vorangehen und solche, die eher zögerlich sind?
Die Finanzindustrie ist eine der schnellsten Branchen, wenn es um Adaption geht. Auch weil sie grossem Druck unterliegt, effizient und regelkonform zu arbeiten. Auch Life-Sciences und Pharma sind sehr weit, weil sie international stark vernetzt sind. Ganz anders der öffentliche Sektor: Dort sind Entscheidungswege lang, Budgets knapp und Sicherheitsbedenken hoch. Auch die Industrie ist eher zurückhaltend. Dort dauert es, bis eine neue Technologie in grossem Stil ausgerollt wird.
Wo sehen Sie die grössten Quick Wins und wo die echten Gamechanger?
Die Quick Wins liegen klar in der Automatisierung repetitiver Aufgaben. RPA – also robotergestützte Prozessautomatisierung – war regelbasiert eine Art «dummer Computer». Die KI kann lernen, mit Ausnahmen umgehen und Prozesse intelligenter gestalten – der «schlaue Computer». Heute können Maschinen dank künstlicher Intelligenz Graubereiche erkennen, Ausnahmen verarbeiten und Prozesse deutlich besser gestalten.
Die echten Gamechanger entstehen dort, wo völlig neue Geschäftsmodelle möglich werden: Robo-Advisory in der Finanzindustrie, Predictive Maintenance in der Industrie oder KI-gestützte Diagnostik im Gesundheitswesen. Das sind Lösungen, die es ohne KI gar nicht gäbe. Es entstehen Plattformen, die in Echtzeit massgeschneiderte Lösungen bieten. Das ist echte Innovation und sie verändert ganze Branchen, nicht nur Prozesse. Was macht den Erfolg solcher Projekte aus? Erfolg ist mehrdimensional. Es geht um Produktivität, Time-to-Market, Innovationsgeschwindigkeit. Aber auch um Akzeptanz. Ein KI-Projekt ist nur dann erfolgreich, wenn es genutzt wird. Deshalb ist es entscheidend, dass Mitarbeitende verstehen, warum KI eingeführt wird, und Vertrauen entwickeln. Datenschutz ist in der Schweiz ein grosses Thema. Wie wichtig ist der verantwortungsvolle Einsatz von KI? Extrem wichtig. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind Pflicht. In vielen Ausschreibungen sind Nachhaltigkeits- und Compliance-Ziele heute Standard. Responsible AI ist damit kein Marketingbegriff, sondern eine Erwartungshaltung, und sie ist kulturell entscheidend für die Akzeptanz von KI. Ein anderes Zukunftsthema ist die IT-Souveränität. Nice-to-have oder Überlebensfaktor?
Ganz klar Überlebensfaktor. Wer seine digitale Souveränität verliert, verliert die strategische Handlungsfähigkeit. Geopolitische Risiken wie der Ukrainekrieg haben gezeigt, wie abhängig wir von globalen Lieferketten und Energiezufuhren sind, dasselbe gilt für IT. Kunden fragen uns heute gezielt, wie sie ihre Infrastruktur resilienter machen können, welche Nearshore-Optionen es nebst Osteuropa gibt, wie sie ihre Lieferketten absichern.

Was macht Wavestone zu einem ausgezeichneten Arbeitgeber?
Resilienz ist kein einmaliges Projekt, sondern eine Daueraufgabe.
– Hasan Tekin, Geschäftsführer Deutschschweiz
Beobachten Sie eine Rückkehr zu lokalen Lösungen?
Nein. Wir sehen eher, dass Multi-Cloud-Strategien punkten. Eine vollständige Rückkehr zu lokalen Lösungen ist nicht realistisch. Lokale Anbieter gewinnen zwar an Bedeutung, aber entscheidend ist, Abhängigkeiten zu reduzieren und flexibel zu bleiben.
KI wird auch zur Waffe. Wie bereiten
Sie Kunden darauf vor?
Automatisierte Phishing-Kampagnen und Deep Fakes sind nur der Anfang. Wir werden gezielte, KI-gestützte Angriffe sehen, die kritische Daten manipulieren oder ganze Lieferketten stören. Das passiert bereits. Und darauf muss man vorbereitet sein. Wir setzen auf regelmässige Awareness-Trainings, Krisenübungen und eine technologische Abwehr auf höchstem Niveau. Resilienz ist kein einmaliges Projekt, sondern eine Daueraufgabe.
Lassen Sie uns über Kultur sprechen: Vor über einem Jahr hat Q_Perior mit Wavestone fusioniert. Wie haben Sie eine gemeinsame Identität geschaffen? Mit Q_Perior waren wir vor allem im DACH-Raum stark, Wavestone im frankofonen Europa – beide auch mit Standorten in den USA. Als gemeinsame Sprache ist Englisch gesetzt, gleichzeitig bleiben die lokalen Sprachen im Tagesgeschäft bestehen. Um die Sprach- und Kulturgrenzen zu überwinden, haben wir bewusst Begegnungsformate geschaffen, in denen Teams aus unterschiedlichen Regionen zusammenkommen. Unser Ziel: die Organisation zusammenzuführen, ohne sie komplett umzubauen. In der Schweiz haben wir uns entschieden, die Teams in der Deutschschweiz und in der Romandie nicht vollständig zu verschmelzen. Stattdessen setzen wir auf eine Strategie, die die Stärken beider Regionen erhält und die Zusammenarbeit fördert. Dazu organisieren wir gemeinsame Events und Marketinginitiativen, bei denen auch Kunden und Mitarbeitende aus beiden Regionen eingebunden sind. So entstehen Synergien, ohne die Unterschiede zwischen Märkten, Sprachen und Kunden zu vernachlässigen.
Wieso? Wäre es nicht einfacher, alles zu vereinheitlichen?
Nein. Es sind unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Kunden. Wir wären nicht die ersten, die versuchen würden, alles unter einen Hut zu packen und daran scheitern würden. Die Kulturen sind anders. Aber das dürfen sie auch sein. Es sind die Werte, die uns verbinden. Die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das macht die Fusion erfolgreich.
Welche Synergien haben Sie realisiert?
Wir ergänzen uns perfekt: Wavestone brachte starke konzeptionelle Kompetenz ein, Q_Perior die Erfahrung bis tief in die Umsetzung. Heute können wir Strategien entwickeln und sie gemeinsam mit dem Kunden implementieren. Geografisch sind wir stärker aufgestellt, haben Zugang zu neuen Märkten und können uns nun auch für grosse globale Kunden positionieren, für die wir vorher nicht interessant waren.
Fusionen sind selten einfach. Was war die grösste Herausforderung? Vertrauen aufzubauen. Am Anfang herrscht immer Skepsis. Wir haben viel zugehört, transparent kommuniziert und Schritt für Schritt Vertrauen aufgebaut. Und ja, wir mussten akzeptieren, dass sich Dinge ändern. So etwa die Informationskultur, weil wir nun börsenkotiert sind. Heute haben wir eine stärkere, integrierte Organisation mit einem grösseren Portfolio und neuen Chancen für unsere Mitarbeitenden. Mein persönliches Learning: wichtig für Management ist «zuelose ... zuelose ... zuelose» und Geduld haben. Kultur kann nicht top-down vorgegeben werden, Kultur muss wachsen. «Responsible Consulting» klingt nach einem grossen Versprechen. Was bedeutet das für Sie? Für mich bedeutet es, dass wir Projekte so gestalten, dass neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschaftlicher und ökologischer Nutzen entsteht. Wir messen unseren CO2-Fussabdruck pro Mitarbeitenden, haben klare Budgets und monitoren sie aktiv. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil unseres Geschäftsberichts, nicht nur Marketing.
Spüren Sie, dass Kunden stärker Nachhaltigkeit einfordern? Ja, sehr deutlich. Viele Projekte enthalten heute ESG-Kriterien – das macht uns nicht nur attraktiver als Arbeitgeber, sondern stärkt auch langfristig den wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig hinterfragen wir unsere eigenen Prozesse kritisch: von der Haltedauer unserer Firmen-Smartphones und Notebooks bis hin zu unserem Einsatz für mehr Diversität und Chancengleichheit. Natürlich gibt es konjunkturelle Schwankungen: In Phasen politischer oder wirtschaftlicher Unsicherheit rückt Nachhaltigkeit manchmal in den Hintergrund. Der langfristige Trend ist jedoch eindeutig: Verantwortung wird zum Wettbewerbsvorteil – unabhängig davon, wer gerade in Washington regiert.
Wenn ich unsere Resultate der letzten zehn Jahre vom Great Place to Work anschaue – dann machen wir nicht alles falsch (schmunzelt). Wir sind ein People-Business. Fachliches Know-how lässt sich vermitteln, entscheidend ist der persönliche Fit. Unsere Werte – energetic, responsible, together – sind unverhandelbar. Wir leben sie und das spüren sowohl bestehende als auch neue Mitarbeitende. Wie sprechen Sie die Generation Z an? Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, leben unsere Werte und treten dabei ehrlich auf. Sind wir schon die perfekte Company für alle Jungen? Nein. Aber wir unterscheiden uns durch unser Werteschema und unser Leadership lebt es vor. Flexibilität ist wichtig: In jedem Vorstellungsgespräch wird nach flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten gefragt. Gleichzeitig ist ein gewisses Mass an Präsenz im Unternehmen entscheidend. Purpose erlebt man nur gemeinsam – physische Begegnungen schaffen Identifikation und Kultur. Wir wollen, dass sich Menschen mit unserer Marke verbunden fühlen. Gibt es CSR-Projekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Ja, unsere Powerdays. Mitarbeitende pflanzen Bäume, engagieren sich gegen Food-Waste oder unterstützen Kinder in afrikanischen Schulen. Sie bringen eigene Ideen ein, setzen Projekte um und das Unternehmen beteiligt sich finanziell. Das schafft Sinn, Gemeinschaft und Stolz.
Wenn Sie unbegrenzte Ressourcen hätten, welches Projekt würden Sie sofort starten? Ich würde eine offene, globale Plattform für nachhaltige Technologieberatung aufbauen. Jedes Unternehmen sollte Zugang zu diesem Wissen haben: open source, kollaborativ und inklusiv. Wie sieht für Sie die Unternehmensberatung 2035 aus?
In zehn Jahren wird Beratung Technologie, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit nahtlos verbinden – der Mensch bleibt dabei stets im Mittelpunkt. Das ist unser Zielbild und macht uns zum idealen Partner für jede Transformation.
Weitere Informationen unter: wavestone.com und office_ch@wavestone.com
Daten gehören zu den wichtigsten Rohstoffen überhaupt. Doch viele Firmen tun sich schwer damit, aus ihrem Datenschatz realen Mehrwert zu ziehen. Die Navique AG unterstützt sie dabei – und erbringt dafür nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch ein strukturiertes Change-Management.

Herr Fasel, Navique hat seine Wurzeln in einer technologischen Spezialisierung auf Data-Governance, Advanced AI und Data-Analytics. Wie gelangten Sie zur Erkenntnis, dass ein ganzheitlicher Ansatz – einschliesslich des ChangeManagements – unerlässlich ist?
Im Kern sind wir noch immer eine Ingenieurfirma, die sich auf Big Data in stark regulierten Märkten konzentriert. Wir unterstützen Unternehmen in verschiedenen Sektoren dabei, grosse Datenplattformen aufzubauen und künstliche Intelligenz gewinnbringend zu nutzen. Dabei kann es zu sehr spezifischen Anwendungen kommen. Ich erinnere mich an einen Forschungsbetrieb, der mithilfe von Daten die Genom-Sequenzierung vorantreiben wollte. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass hochregulierte Betriebe oft an der Skalierbarkeit ihrer Datenprojekte scheitern. Zwar setzten wir die technologische Infrastruktur exakt nach ihren Anforderungen um, doch der erwartete Mehrwert fiel kleiner aus als erhofft. Eine genaue Analyse ergab, dass die technologischen Fortschritte nicht mit der notwendigen Anpassung der Prozesse und Kultur einhergingen, das erforderliche ChangeManagement fehlte. Uns wurde klar, dass wir einen holistischen Ansatz, der auch die organisatorische und kulturelle Ebene berücksichtigt, verfolgen müssen.
Wo lag das Kernproblem in der Praxis? Daten werden in Unternehmen oft als reine IT-Angelegenheit betrachtet. Doch dies greift viel zu kurz. Die Analyse von Daten ist primär eine Managementaufgabe, denn echten Mehrwert schafft man nur, wenn man das Daten-Rohmaterial mit Analytics kombiniert. Es braucht Data-Literacy – eine gemeinsame Sprache – zwischen der Business- und der IT-Abteilung. Daraus erwächst strategisches Datenmanagement, heute eine zentrale Führungsaufgabe, die wir systematisch entlang von vier Quadranten gestalten, die als Orientierung für uns und unsere Kunden dienen. Sie sprechen die vier Quadranten «Wertschöpfung», «Technologiemanagement», «Governance» sowie «Organisation» an. Wie greifen diese in der Praxis ineinander? Die vier strategischen Quadranten bilden unseren holistischen Ansatz ab und schaffen die Basis für eine nachhaltige Data- und Analytics-Kultur. Als «Navigator» leiten wir unsere Kunden durch vier Dimensionen. Im Quadranten «Wertschöpfung» steht die Frage im Mittelpunkt, welchen konkreten Mehrwert Datenerfassung und -analyse bringen. Anschliessend muss man das Daten-Rohmaterial und die Technologie für Aggregation und Auswertung beherrschen, um nicht nur eine grosse «Datenkrake» zu schaffen, sondern die Daten einem realen Nutzen zuzuführen. Der Quadrant «Governance» umfasst interne und externe Vorgaben, die es abzubilden gilt. Dazu gehört das BAG im Gesundheitswesen und die Finma im Finanzsektor ebenso wie regional unterschiedliche Vorgaben im Energiesektor.
Und was umfasst der Quadrant «Organisation»?
Dieser beschäftigt sich damit, wie ein Unternehmen seine Prozesse anpassen oder neugestalten muss, um sämtliche Vorgaben zu erfüllen. Er dient als Kompass für die Datenprofessionalität einer Organisation und zeigt, wie Mitarbeitende in Verantwortlichkeiten und Abläufe eingebunden werden müssen, um Datenprojekte erfolgreich umzusetzen. Alle vier Quadranten beeinflussen sich gegenseitig: Der Aufbau einer Datenplattform ist zwar in erster Linie ein technischer Akt, doch wirkt er sich direkt auf die anderen drei Achsen aus. Unser Ziel ist es daher, eine Balance zwischen den Quadranten herzustellen. Dieser Ansatz erlaubt es uns, ein individuelles Massnahmenportfolio zu entwickeln, das exakt auf die spezifischen Bedürfnisse des Kundenunternehmens zugeschnitten ist.

Daten werden in Unternehmen oft als reine IT-Angelegenheit betrachtet. Doch dies greift viel zu kurz .
– Dr. Daniel Fasel, CEO
Der Wandel vom reinen Technologiepartner zum Anbieter eines holistischen Beratungs- und Umsetzungsansatzes erforderte sicherlich auch eine Neuausrichtung Ihres Unternehmens. Das tat es auf jeden Fall. Wir haben unsere eigene Transformation auf der Grundlage unserer Kernwerte vollzogen. Unser Ziel ist es, die digitale Selbstständigkeit unserer Kunden zu fördern und sie auf diesem Weg zu begleiten, um eine wertvolle Zukunft zu gestalten. Diese Werte spiegeln sich in unserem Portfolio wider und finden grossen Anklang bei Schweizer Unternehmen.
Sie betonen die Wichtigkeit, zuerst den Mehrwert von Daten zu klären, bevor die technische Umsetzung beginnt. Welchen Ansatz verfolgen Sie, um diesen Mehrwert bei Ihren Kunden zu identifizieren?
Im Rahmen einer initialen Discover-Phase identifizieren wir zuerst Medienbrüche und Handlungsfelder, um ein «Target Architektur Scoping» zu erstellen. Dieser Ansatz ist besonders für KMU interessant, da er mit einem moderaten Budget auskommt. Wir beginnen mit der grundlegenden Frage: Warum benötigen Sie die Daten überhaupt und was macht sie relevant? Anschliessend analysieren wir auf strategischer Ebene, welche Daten in welcher Phase benötigt werden. So entsteht
eine detaillierte Datenlandkarte, die vom initialen «Warum» zu einem klaren Purpose führt. Diese Karte dient dann als das zentrale Steuerelement für einen CDAO (Chief Data und Analytics Officer) um ein datengesteuertes Organisationsmodell zu schaffen. Der grosse Vorteil von Navique-Kunden ist, dass wir aus unzähligen Projekten über genaue Blaupausen für diese Datenlandkarten verfügen, sodass wir 90 Prozent der Kundenanforderungen direkt «Out of the Box» abdecken können, was einen erheblichen Effizienzgewinn schafft. Darauf basierend entwickeln wir dann individuelle Schablonen, die für eine Grossbank ebenso pragmatisch funktionieren wie für ein Bauunternehmen. Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant. Viele Firmen stehen vor der Herausforderung, Automatisierung voranzutreiben, obwohl ein Grossteil des essenziellen Fachwissens im «Human Capital» gebunden ist. Wie unterstützen Sie Ihre Kunden in diesem Spannungsfeld? Bei einem Projekt im Bereich «Predictive Maintenance» halfen wir einem Infrastrukturunternehmen das Wissen erfahrener Mitarbeitender auf eine Plattform zu übertragen, damit es trotz Nachwuchsmangel erhalten bleibt. Gleichzeitig gibt es menschliche Expertise, die keine Maschine übernehmen kann. Es gilt, Rollen und Verantwortlichkeiten neu
Entscheidend ist also, ob man die eigenen Daten im Griff hat und welche Informationen wirklich relevant sind. Die zentrale Frage bleibt jedoch, welche Rolle der Mensch in der Zukunft spielt. Kritisches Denken und Kreativität bleiben unverzichtbar.
– Dr. Daniel Fasel, CEO
zu definieren, damit Prozesse effizient gesteuert werden. Auch im Bankenwesen, wo KI künftig vermehrt das Trading übernimmt, stellt sich die Frage, nach welchen Werten und welcher Kultur vorgegangen werden soll. Es braucht eine solide Data- und Analytics-Kultur im Unternehmen. Als Partner von hochregulierten Unternehmen ist die Einhaltung der DataCompliance ein zentraler Pfeiler Ihrer Dienstleistungen. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden stets rechtskonform agieren? Governance und Compliance müssen proaktiv und in Echtzeit vorangetrieben werden. Allerdings belassen es viele Firmen oft bei riesigen Dokumenten, die einfach Papiertiger sind. Wir kehren diesen Ansatz um und schreiben die Governance-Regeln und Richtlinien direkt auf die Datenprodukte. Anhand von Metadaten können wir in Echtzeit messen, ob beispielsweise eine Schnittstelle regelkonform ist und bei Abweichungen sofort Alarm schlagen. Welche zukünftigen Entwicklungen und Trends werden für Ihre Kundschaft und Ihr Unternehmen wesentlich sein? Kurzfristig ganz klar KI. Mittelfristig gewinnen politische Entwicklungen an Bedeutung. Sollte sich eine «Blockbildung» ergeben, dürfte Souveränität zum zentralen Thema werden. Schon heute fragen sich Unternehmen, ob sie noch mit Anbietern zusammenarbeiten können, die anderen Hoheitsgebieten unterstehen. Das Problem ist, wer die eigenen Daten nicht versteht, kann dies nicht steuern. Entscheidend ist also, ob man die eigenen Daten im Griff hat und welche Informationen wirklich relevant sind. Die zentrale Frage bleibt jedoch, welche Rolle der Mensch in der Zukunft spielt. Kritisches Denken und Kreativität bleiben unverzichtbar. Es ist essenziell, die Automatisierung zu verstehen und in der Schweiz frühzeitig die notwendigen Kompetenzen aufzubauen und zugleich die Fähigkeiten und Erfahrung der Mitarbeitenden gezielt zu fördern. Zuletzt noch eine Frage zu Ihrer Partnerschaft mit AlpineAI. Navique ist die erste Firma, die einen direkten Zugang zu Swiss GPT implementiert. Wie erweitert diese Kooperation Ihr Angebot? Pascal Kaufmann und sein Team setzen sich dafür ein, die Datensouveränität in der Schweiz zu stärken. Swiss GPT ist ein AI-System, das ausschliesslich mit Schweizer Daten trainiert wurde und die hiesigen Datenschutzstandards erfüllt. Navique ist die erste Firma, die den Zugang zur neuen Swiss GPT API implementiert. Der grosse Vorteil ist, dass die Unternehmensdaten bei Anfragen an Swiss GPT immerzu in der Schweiz bleiben, sie können sensibel ausgewertet werden und die Plattform ist gezielt auf die Bedürfnisse Schweizer Unternehmen und hoch regulierter Behörden zugeschnitten: ein entscheidender Schritt für digitale Selbstbestimmung. Weitere Informationen unter: navique.com
Über die Navique AG
Die Navique AG ist ein spezialisiertes Ingenieurunternehmen für Big Data und künstliche Intelligenz. Ursprünglich auf den Aufbau komplexer Dateninfrastrukturen fokussiert, ist Navique heute ein ganzheitlicher Anbieter massgeschneiderter Datenlösungen. Navique verbindet Business, Technologie, Compliance und Organisationsentwicklung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine nachhaltige Data- und Analytics-Kultur zu etablieren und langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Digitalisierung verändert, wie erfolgreiche Firmen funktionieren. Mit digitalen Assets und künstlicher Intelligenz eröffnet sich eine neue Ära für Institutionen, Märkte und auch Privatpersonen.

Die digitale Transformation verändert die Art, wie eine Firma zum Erfolg kommt. Der sichtbarste Wandel ist, dass ein skalierbares Geschäftsmodell hohe Umsätze generieren kann, und das mit nur vergleichsweise wenigen Mitarbeitenden.
Die traditionelle Finanzindustrie ist abhängig von grossen Teams, komplexer und schwerfälliger technischer Infrastruktur, veralteten, mühsamen Prozessen mit langen Abwicklungszeiten und Korrespondenzbanknetzwerken. Diese Finanzfirmen müssen viele Aufgaben in den Bereichen Compliance, Recht, Controlling, Entwicklung und Betrieb manuell erledigen. Hohe Kosten und regulatorische Hürden dienen als Eintrittsbarrieren und schützen die Branche bis heute vor der Welle von Innovationen, die sie in ihrer jetzigen Form letztlich umwälzen wird. Dies zeigt sich bereits in aktuellen Bewertungsmodellen von Finanzanalyst:innen. Institute, welche noch keine Digital-Asset-Strategie haben, erhalten einen Malus auf die Zukunftsfähigkeit. Der Druck kommt einerseits von Märkten, die schon voll digitalisiert sind, wie CloudDienste, Soziale Netzwerke und nun AI, andererseits von einem Wettrüsten im globalen Konkurrenzkampf und sich etablierenden neuen Geschäftsmodellen (Bitcoin ETFs, Stablecoins, Kryptohandelsplätze), die sich aber noch langfristig bewähren müssen. Hier bieten sich auch Chancen für unterentwickelte Märkte in ärmeren Ländern, die damit historische Entwicklungsschritte überspringen können.
Digitale Transformation erfordert
End-to-End-Redesign
Der Grossteil der Finanzindustrie ist noch nicht tokenisiert und hat, abgesehen von einigen Neobanken, bisher keine nennenswerte digitale Transformation durchgemacht. Fortschritte beschränken sich auf bessere Tools, Nutzung der genannten digitalisierten Services und optimierter Hardware. Effektive digitale Transformation und Automatisierung ist nur möglich mit einem End-to-End-Redesign von Finanzprodukten, Märkten, Netzwerken und Prozessen. Dies umfasst auch Entwurfs- und Konfigurationsentscheidungen, die Schutz gegen Cyberrisiken gewährleisten und die Integration von agentischer und genereller KI-Automatisierung mit einbeziehen.
Digitale Assets: vom Newcomer-Markt zur institutionellen Integration
Während die traditionelle Finanzindustrie mit ihrer Legacy kämpft und am Limit ist, wie sie auf bisherige Weise weiter skalieren kann, kämpft der Digital-AssetBereich darum, in den institutionellen und professionellen Sektor einzutreten. Der Digital-Asset-Markt ist im Vergleich zu anderen Finanzmärkten noch klein. Als Crypto Finance 2017 startete, trafen sie auf ein institutionelles Umfeld, in dem ähnliche Services wie heute vor allem auf klassische Finanzlösungen beruhten oder gar nicht verfügbar waren. Wallets wurden in physischen Schliessfächern verwahrt, mit umständlichen Zugriffs- und Genehmigungsprozessen, die wenig zur Sicherheit der eigentlichen Übertragung von digitalen Assets beitrugen. Trading in Digital-Asset-Märkten (ausschliesslich Kryptowerte) wurde von Newcomern und kleinen Anbietern dominiert, mit Bid-Ask-Spreads, die in der klassischen Finanzwelt seit Jahrzehnten nicht mehr üblich sind. Marktdaten, Order-Routing, technische Integrationen waren nicht standardisiert; jeder Kryptohandelsplatz hatte seine eigene Lösung, ohne Integrationspartner oder fertige Konnektoren.
Crypto Finance: Eine digital-native Lösung für institutionelle Kunden
Die Crypto Finance setzte sich somit zum Ziel, eine digital-native, skalierbare, 24/7- und institutionelle Digital-Asset-Lösung anzubieten. Sie haben eine eigene, sichere Speicherlösung für digitale Assets und bieten institutionellen Kunden Trading- und Custody-Dienstleistungen an.

Die Crypto Finance setzte sich somit zum Ziel, eine digital-native, skalierbare, 24/7- und institutionelle Digital-Asset-Lösung anzubieten.
Es war und ist strategisch wichtig, mit Schlüsselakteuren der Finanzindustrie zusammenzuarbeiten, um durch einen Netzwerkeffekt eine Skalierung zu ermöglichen. Dies begann schon früh mit einer Partnerschaft mit Avaloq, dem Core-Banking-Provider.
Clearstream nutzt Crypto Finance als regulierten Sub-Custodian, damit Banken über ihre bestehenden Clearstream-Konten und Schnittstellen (z. B. SWIFT, bestehende Settlement-Routinen) nahtlos auf Kryptoverwahrung und -abwicklung zugreifen können, ohne neue technische oder vertragliche Integration zu nativen Kryptodienstleistern. Kürzlich wurde das Produkt AnchorNote gestartet, eine digitale Zusicherung, die es Institutionen erlaubt, Assets als Sicherheit zu nutzen, um das Liquidity-Management auf angebundenen Handelsplätzen zu optimieren.
Chancen durch Modernisierung des Tech-Stacks und Einsatz von KI In der Partnerschaft mit Google wird der Tech-Stack modernisiert. Ziel ist es, den Data-Center-Footprint zu reduzieren, Workloads möglichst in die Cloud zu verschieben und das Angebot für digitale Assets weiter auszubauen. Die Verarbeitung von Daten wird modernisiert und KI-Technologien gezielt eingesetzt, um einen messbaren Mehrwert zu erzielen.
Agentische KI-Lösungen werden angewendet, um Geschäfts- und technische Prozesse zu automatisieren.
Zusätzlich werden einfache KI-Q&A-Lösungen wie Copilots für tägliche Aufgaben genutzt: E-Mails und Texte zusammenfassen, Antworten formulieren, Meeting-Minutes erstellen, Dokumente entwerfen, Code-Reviews und -Änderungen durchführen.
Digitale Transformation, Tokenisierung und KI bieten Chancen nicht nur für Firmen und unterentwickelte Märkte, sondern auch für Privatpersonen. Jede Person kann ihre eigene Bank, ihr eigenes Innovationszentrum oder Investmentunternehmen sein und frei auf unzähligen Smart Contracts und dezentralen Systemen aufbauen. Dies bringt jedoch eigene Einschränkungen und grosse Risiken mit sich. Man spricht in diesem Zusammenhang in der Kryptoszene auch oft von einem «Dark Forest» von einem dunkeln Wald, wo Dinge (Kryptowerte) scheinbar plötzlich verschwinden (gestohlen oder verloren gehen) wie in einem schwarzen Loch. Diese Limitationen und Gefahren sind Teil der Begründung für die Existenz von Intermediären.
Risiken und globale Herausforderungen Bisher wurden vor allem die Vorteile und Chancen neuer Technologien betrachtet. Wir haben die Entwicklung der letzten fünf Jahrzehnte gesehen: Personal Computer wurden Mainstream, das Internet hat fast alle Bereiche durchdrungen, Krypto- und tokenisierte Assets drängen in den Mainstream, KI findet täglich Anwendung und Quantencomputing beginnt erste Schritte zu machen.
Digitale Transformation, Tokenisierung und KI bieten Chancen nicht nur für Firmen und unterentwickelte Märkte, sondern auch für Privatpersonen.
Globalisierung und neue Technologien kommen jedoch auch mit erheblichen Risiken: Schwierigkeiten bei der Sicherstellung globaler Standards, Zentralisierung der Wirtschaftsmacht bei grossen Konzernen und Nationen, Reduktion lokaler Vielfalt zu einseitigen globalen Marken, oft verbunden mit aggressiven Praktiken, die die Umwelt, Tiere und Menschen schädigen. Zudem entstehen durch die globale Vernetzung Cyberrisiken, die von organisierten Gruppen und von staatlichen Akteuren ausgehen. Wie Konzerne organisiert, agieren sie mit militärischer Präzision und haben fast endlose Ressourcen und jahrelange Geduld. Beispiele sind Nordkorea (Lazarus Group), Russland (Bear Groups), China (Panda Groups), Israel (Stuxnet) und USA (Equation Group) neben nationalen Sicherheitsbehörden und weiteren unabhängigen Gruppen. Im Digital-Asset-Bereich verfolgen Foren und Blogs unzählige Hacks und dokumentieren täglich neue Meldungen. Mit KI werden die Angriffe immer raffinierter (Deepfakes, Stimmveränderungen, gezielt formulierte E-Mails, Trickbetrüger) – und leider stehen wir noch am Anfang dieser Entwicklung.
Dezentrale Finanztechnologie und die Rolle von Intermediären Endkunden oder Institutionen ausserhalb der Finanzbranche möchten sich nicht zwingend mit diesen Bedrohungen auseinandersetzen, solange die Lösungen mehr Sicherheit, Wahlfreiheit, Effizienz, tiefere Preise und bessere Services bieten. Bei Interesse und Sicherheitsbewusstsein erlaubt die dezentrale Finanztechnologie allen, selbst ins Banking einzutauchen. Manche sehen darin ein Ideal, dass das dezentrale Finanzsystem alle alten und staatlichen Finanzinstitute überflüssig macht. Die aktuelle Realität zeigt, dass dies in der Breite wohl nicht möglich sein wird. Eine offene Architektur, die Leidenschaft einzelner und der Beitrag unabhängigen Gruppen erlaubt ein Mindestmass an Kontrolle. Darüber hinaus liegt der Anspruch an und die Rechtfertigung für Intermediäre in der Sicherheit, der Regulation, dem Vertrauen, der Nutzererfahrung und der nahtlosen Integration in bestehende Anwendungen.
Text Nathaniel Zollinger, CTO der Crypto Finance AG
Weitere Informationen unter: crypto-finance.com
«Zuerst
Wenn Unternehmen echten Mehrwert aus Zukunftstechnologien ziehen möchten, müssen sie erst ihre Basisprozesse digitalisieren. Die Scheer Group unterstützt Firmen dabei, ein stabiles, digitales Fundament zu legen – und darauf langfristig aufzubauen.

Dr.
Geschäftsführer
Robert, viele Unternehmen in der Schweiz fürchten sich davor, im Zeitalter von KI und Co. ins Hintertreffen zu geraten. Wie geht es euren Kunden diesbezüglich? Wer die aktuellen Schlagzeilen verfolgt, könnte in der Tat den Eindruck erhalten, dass alle Unternehmen längst vollständig digitalisiert sind, denn überall liest man von künstlicher Intelligenz, Quantencomputing sowie autonomen Systemen. Im täglichen Kundenumgang stellen auch wir immer wieder bei manchen Betrieben eine gewisse Angst fest, den Anschluss zu verpassen. Doch in der Realität zeigt sich ein anderes Bild: In zahlreichen Produktionshallen werden Arbeitsaufträge noch immer auf Papierlaufzetteln erfasst, Änderungen mit Bleistift ergänzt und Daten erst Tage später ins ERP-System übertragen. Dieser Kontrast zwischen Hightech-Vision und Alltagsrealität offenbart eine zentrale Erkenntnis: Bevor Unternehmen die Chancen von Zukunftstechnologien nutzen können, müssen sie zunächst ihre digitale Basis schaffen.
Wie meinst du das genau?
Die Wirtschaftswelt spricht mit Begeisterung über Zukunftstrends, während viele Unternehmen noch mit Problemen der Gegenwart kämpfen. Besonders im Mittelstand ist die digitale Lücke gross. Zwar sind zentrale Systeme wie ERP oder CRM häufig vorhanden. Doch an den Rändern, dort, wo Wertschöpfung tatsächlich passiert, dominieren Excel-Listen, Insellösungen – oder eben Papier. Warum ist das deiner Meinung nach der Fall?
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Eine wesentliche Rolle spielen historisch gewachsene Strukturen – Prozesse wurden über Jahrzehnte hinweg entwickelt, ohne dass Digitalisierung mitgedacht wurde. Dazu gesellt sich eine gewisse Investitionszurückhaltung, angetrieben durch globale Unsicherheiten wie etwa die aktuellen Zolltarife. Gerade kleinere Unternehmen scheuen die Kosten und Risiken umfassender IT-Projekte. Dann darf der Faktor des Fachkräftemangels nicht unerwähnt bleiben: IT- und Prozesskompetenz sind vielerorts knapp, Veränderungen lassen sich dadurch oft nur schwer umsetzen. Und zu guter Letzt spielen kulturelle Faktoren hinein: In vielen Werkhallen sind Aussagen wie «Das haben wir schon immer so gemacht, das muss man nicht ändern» gelebte Realität. Die Quintessenz all dieser Punkte: Prozesse, die für Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit entscheidend sind, laufen oft ohne digitale Unterstützung ab. Das war bis anhin auch absolut ausreichend – doch nun stösst das «altbewährte Vorgehen» oft an seine Grenzen. Kannst du uns diese Punkte anhand eines Praxisbeispiels näher erläutern? Natürlich. Nehmen wir an, ein Zulieferer der Schweizer Maschinenindustrie dokumentiert seine Produktionsaufträge noch per Laufzettel. Mitarbeitende notierten also Arbeitszeiten, Materialverbräuche oder Qualitätsprüfungen handschriftlich. Änderungen werden auf den Zetteln ergänzt, Fehler nachträglich korrigiert und erst am Ende der Schicht oder gar zum Ende der Woche werden dann die Informationen manuell ins SAP-System übertragen. Dieser Ansatz hat diverse Folgen: Das Management hat keine Echtzeitsicht auf den Auftragsstatus, die Fehlerquoten steigen aufgrund von Übertragungsfehlern und die Kunden haben keine Transparenz darüber, wann ein Auftrag fertiggestellt wird. Zudem ist dieses Vorgehen sehr personenabhängig – was geschieht etwa, wenn der Vorarbeiter erkrankt? Dann trägt niemand mehr die Informationen nach.
Wie sieht die Lösung für diese Problematik aus?
Solche Betriebe haben wir in der Vergangenheit erfolgreich bei der Einführung eines digitalen Shopfloor-Systems unterstützt, das Maschinen- und Personaldaten direkt in SAP zurückmeldet. Dadurch
Prozesse
wurden über Jahrzehnte hinweg entwickelt, ohne dass Digitalisierung mitgedacht wurde.
– Dr. Robert Lettow, Geschäftsführer Scheer Schweiz AG
Realität vieler Unternehmen nicht ausblenden. Zwischen der Vision von künstlicher Intelligenz und der Praxis mit Laufzetteln klafft eine Lücke. Diese Lücke muss systematisch geschlossen werden: durch die Digitalisierung, Integration und «Intelligenter-Machung» der Geschäftsprozesse. Die Prozessexpertinnen und -experten von Scheer IDS begleiten Unternehmen auf diesem anspruchsvollen Weg – von der Ablösung papierbasierter Abläufe über die Integration in SAP-Systeme bis hin zur Nutzung moderner KI-gestützter Prozessintelligenz. Seit mehr als 40 Jahren widmet sich unser Unternehmen der Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Damit gilt: «Future of Technology» beginnt im Hier und Jetzt – und der erste Schritt ist der Abschied vom Laufzettel.
änderte sich die Lage beträchtlich: Auftragsfortschritte sind nun in Echtzeit sichtbar, Engpässe können sofort adressiert werden und die Grundlage für weitere Automatisierung und Prozessoptimierung ist geschaffen. Dieser «Weg vom Papier hin zu digitalen Lösungen»-Ansatz ist für Unternehmen aller Grössen und Branchen zielführend. Ein anderes Beispiel aus der Praxis, das mir hierzu einfällt, betrifft einen mittelständischen Hersteller von Präzisionsbauteilen. Wo lag bei diesem Unternehmen das Problem? Die Firma führte Qualitätsprüfungen bis vor Kurzem auf Papierformularen durch. Jede Abweichung wurde handschriftlich erfasst, anschliessend eingescannt und archiviert. Bei Kundenreklamationen mussten die Unterlagen dann mühsam aus verschiedenen Ordnern zusammengesucht werden. Hier setzten wir die Umstellung auf ein digitales Qualitätsmanagementsystem um, integriert in SAP. Dadurch änderte sich der Ablauf grundlegend: Abweichungen werden neu digital dokumentiert und sofort ausgewertet, Reklamationen können per Mausklick mit Prüfprotokollen verknüpft werden und Prozessdaten fliessen in Echtzeit ins Reporting – dies bildet die Grundlage für Predictive Analytics. Erst durch diesen Schritt wurde es letztlich möglich, KI-gestützte Prognosen für Qualitätsabweichungen zu erstellen.
Wie viel Zeit und Aufwand sind im Rahmen eines Projektes notwendig, um den Wandel vom Laufzettel zur KI zu meistern?
Der Weg in die «Future of Technology» ist kein Sprung – sondern ein Stufenmodell. Bevor wir überhaupt die erste Stufe erreichen, gilt es, die Geschäftsprozesse des Unternehmens zu analysieren und wo nötig zu standardisieren. Wir wollen ja nicht veraltete, nicht mehr gelebte oder übermässig komplizierte «Papier-Prozesse» einfach genau so kompliziert digitalisieren. Wissen wir, wie die Kernprozesse des Unternehmens in Zukunft aussehen und gelebt werden sollen, geht es eine Stufe weiter. Die erste eigentliche Digitalisierungsstufe besteht aus der Digitalisierung der erhobenen, analysierten Basisprozesse. Dabei werden, wie bereits ausgeführt, Papier und Excel durch moderne digitale Systeme ersetzt. Auf diese Weise entstehen automatisch Daten, die der Betrieb nutzen kann. Anschliessend geht es um Integration und Prozessintelligenz: Die Systeme werden in ERP-Landschaften wie SAP integriert, wobei «Process Mining» Transparenz über reale Abläufe schafft. Der dritte Schritt besteht darin, Automation und Optimierung einzuleiten.
Worum geht es bei diesem dritten Schritt? Wir führen Workflow-Engines sowie KI-Agenten ein, welche Abläufe optimieren, Fehler minimieren und Durchlaufzeiten beschleunigen. Anschliessend ist der Kundenbetrieb ready, um Zukunftstechnologien wirklich umfassend und sinnstiftend zu nutzen. Erst auf dieser neuen Basis entfalten KI, IoT oder Quantencomputing echten Wert. Denn ohne valide Daten und stabile Prozesse sind selbst die besten Algorithmen wirkungslos. Wie schwierig fällt es Unternehmen deiner Erfahrung nach, sich von alten Mustern, Lösungen und Prozessen zu lösen?
Das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich und natürlich achten wir darauf, die Menschen auf die Digitalisierungsreise mitzunehmen. Ich kann kaum ausreichend betonen, wie wichtig dieses ChangeManagement ist. Menschen stehen Veränderung generell erstmals negativ gegenüber. Wenn Neues, und im Falle von KI Disruptives, kommt, macht dies den Menschen Angst. Darum verfügen wir über ein versiertes in-house Change-Management, um die notwendigen Veränderungen vorzuspuren, zu begleiten und so sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden «an Bord» sind. Der berühmte Bauhaus-Satz «Form follows Function» prägte das 20. Jahrhundert. Übertragen auf die Wirtschaft von heute lautet die Formel aber vielmehr: «Business follows Processes.» Wo siehst du künftige Chancen und Herausforderungen auf Schweizer Unternehmen zukommen – wie wird die nächste Stufe der Digitalisierung aussehen? Viele Unternehmen in der Schweiz stehen gerade am Übergang von der Basisdigitalisierung zur intelligenten Prozesssteuerung. Es gibt verschiedene Trends, die prägend sein werden. Ein wesentlicher ist die EchtzeitTransparenz: Digitale Zwillinge von Produktionslinien werden es vermehrt ermöglichen, Prozesse live zu überwachen. Auch die Prozessintelligenz rückt stärker in den Fokus: Mit KI lassen sich Engpässe und Qualitätsprobleme vorhersagen, bevor sie entstehen. Ferner werden wir eine automatisierte Rückkopplung erleben, bei der Systeme Prozesse zunehmend selbstständig steuern – mit dem Menschen als Kontrollinstanz.
Wie unterstützt ihr bei Scheer IDS Unternehmen dabei, sich auf diese Zukunftstrends einzustellen?
Die Diskussion über KI und Zukunftstechnologien ist zweifelsfrei wichtig, aber man darf dabei die
Ein wesentlicher ist die Echtzeit-Transparenz: Digitale Zwillinge von Produktionslinien werden es vermehrt ermöglichen, Prozesse live zu überwachen. Auch die Prozessintelligenz rückt stärker in den Fokus.
– Dr. Robert Lettow, Geschäftsführer Scheer Schweiz AG
Weitere Informationen unter: scheer-ids.com
Über Scheer IDS
Als Consulting-Haus mit ausgewiesener Prozessexpertise unterstützt Scheer IDS Unternehmen bei allen Themen rund um Geschäftsprozesse, deren Umsetzungen im SAP sowie beim Betrieb ihrer IT. Beratungslösungen und Produkte der Scheer Group bieten gleichermassen innovative wie verlässliche Lösungen für die zukunftssichere End-to-End-Digitalisierung von Unternehmen.
Business-Process-Management neu gedacht Donnerstag, 6. November 2025, Plaza Klub Zürich, 13:30
Die digitale Transformation verändert nicht nur Technologien – sie fordert ein radikales Umdenken in Strategie, Struktur und Prozessen. BPM Reloaded ist das führende Event für Entscheider:innen, die Business-Process-Management als strategischen Hebel für nachhaltige Unternehmensentwicklung verstehen.
Der Gründer der Scheer Group, Prof. Dr. AugustWilhelm Scheer, wird die Veranstaltung eröffnen. Im Anschluss teilen verschiedene Branchenexpert:innen wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.
Was erwartet Teilnehmende?
Organisationsstruktur: Wie gestalten Unternehmen ihre Strukturen zukunftsfähig und agil?
Prozessgovernance: Welche Steuerungsmechanismen sichern nachhaltige Wirkung?
– Prozessintegration: Wie entstehen End-to-EndProzesse ohne Silos?
– KI-Agenten im Prozessmanagement: Wie verändert künstliche Intelligenz die operative und strategische Steuerung?
Warum teilnehmen?
– Praxisnahe Impulse von führenden Expert:innen
– Interaktives Format für echten Austausch
– Inspiration für digitale Strategie
– Zugang zu einem exklusiven Netzwerk aus Vordenker:innen und Innovator:innen
Weitere Informationen und Anmeldung unter:















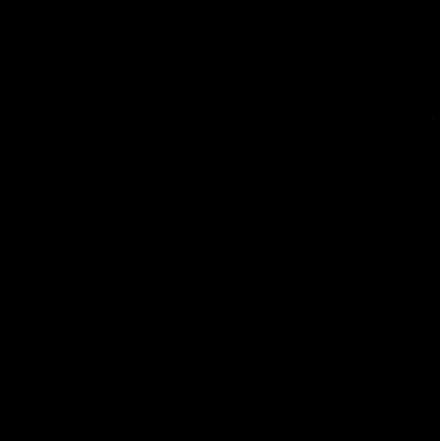
















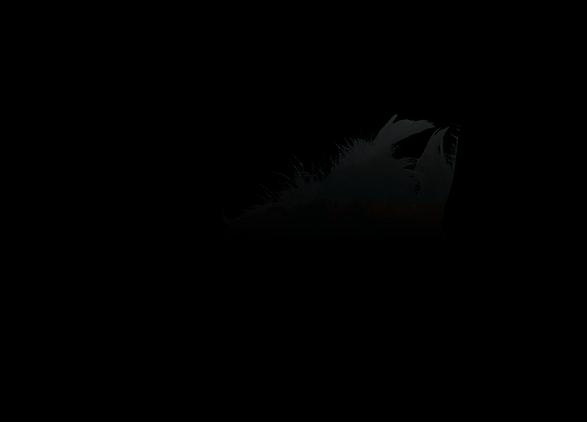





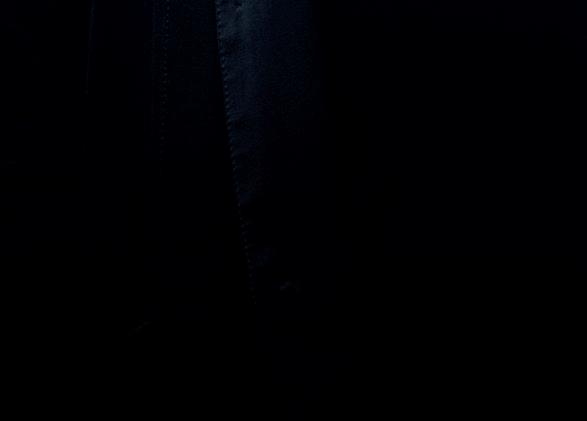
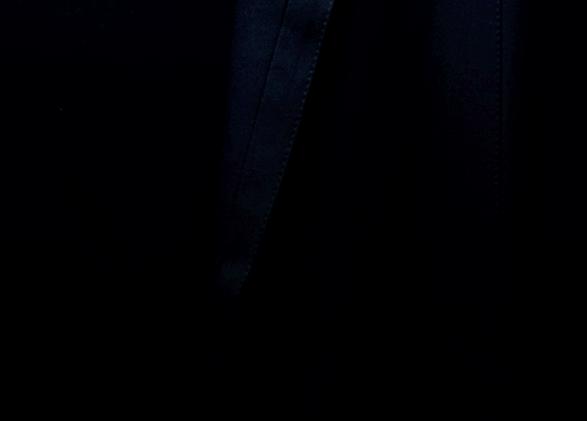

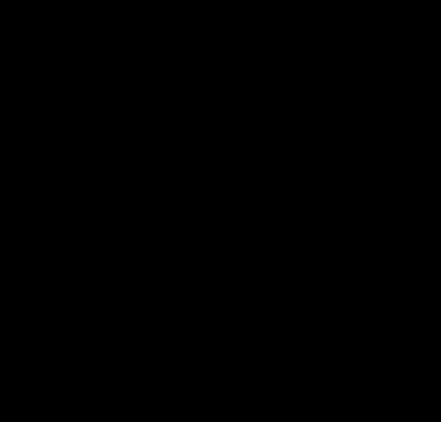
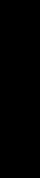

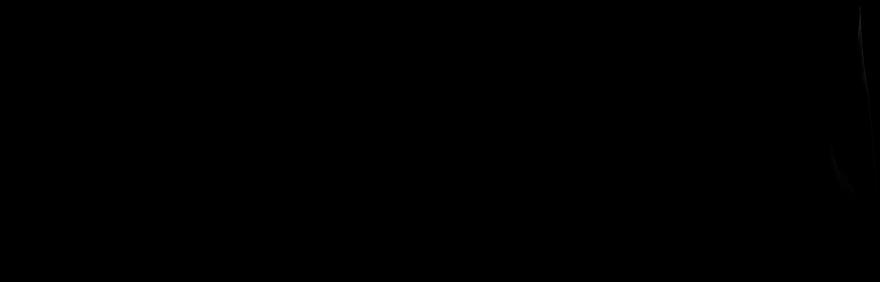

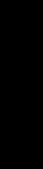

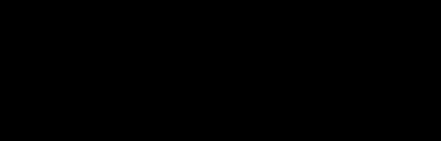









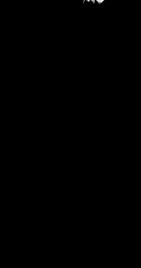
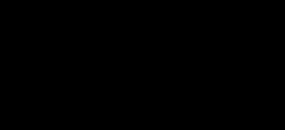
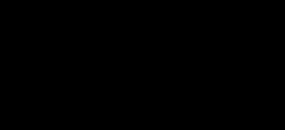
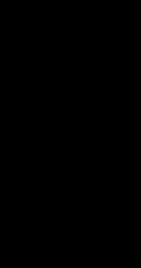




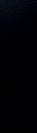




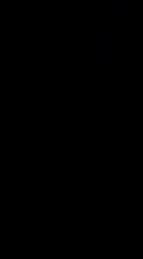

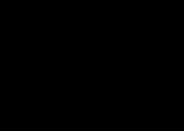
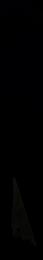
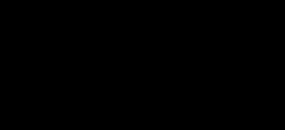
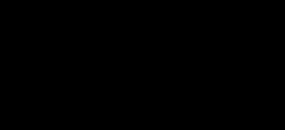
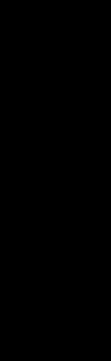
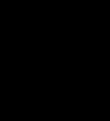
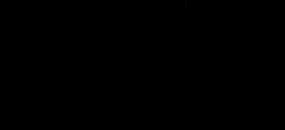
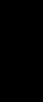
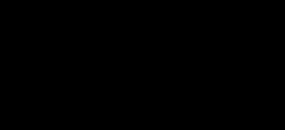
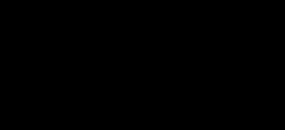
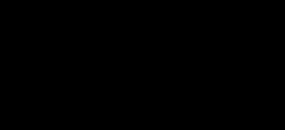













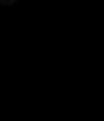
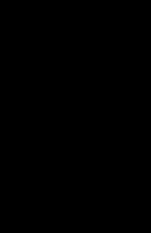











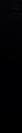
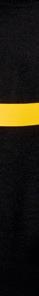
















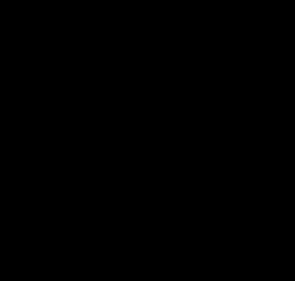
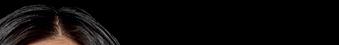




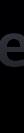

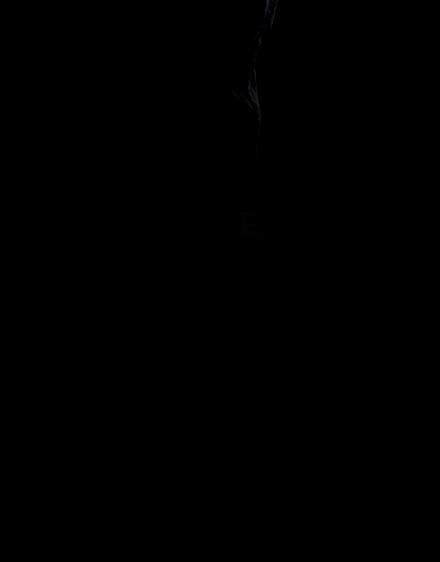






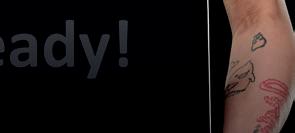


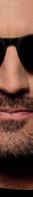
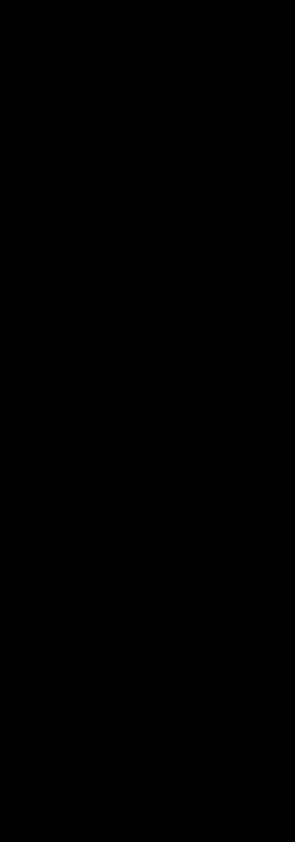
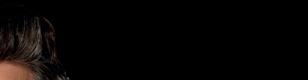

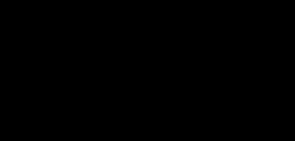








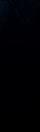



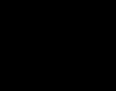



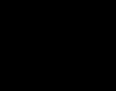












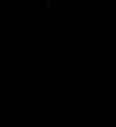


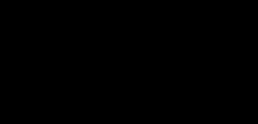
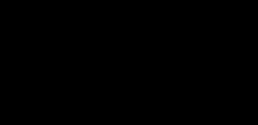
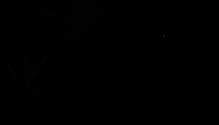

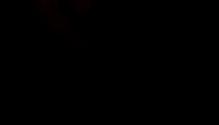
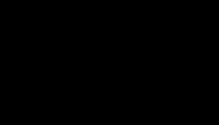
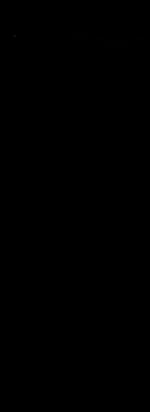
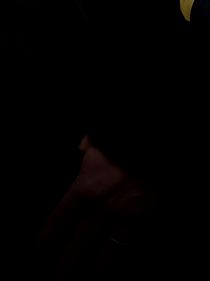
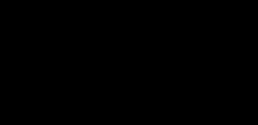
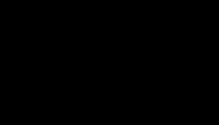

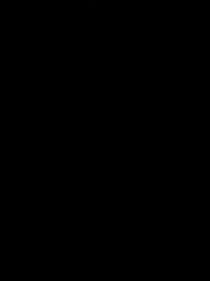
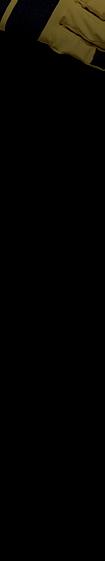


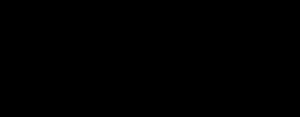
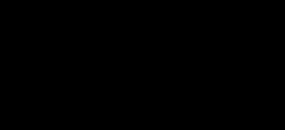

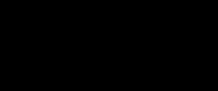
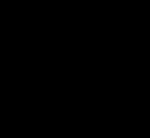
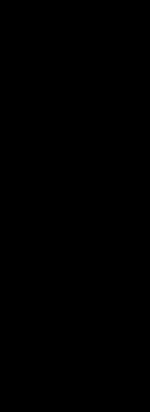
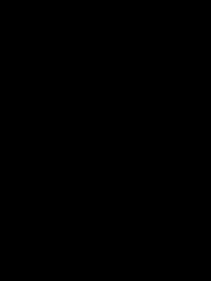
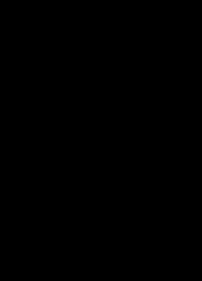
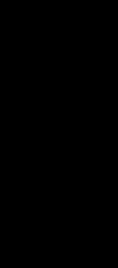
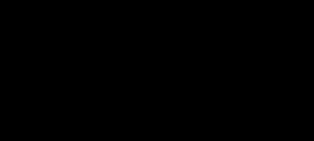
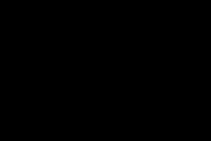
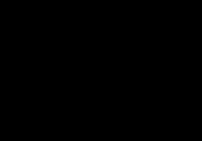

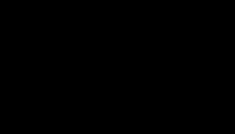
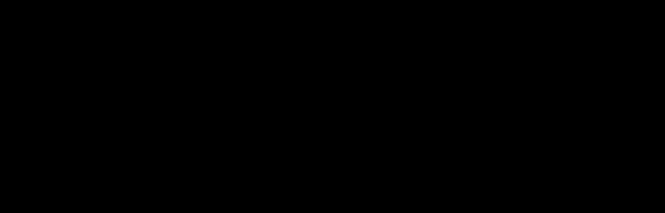

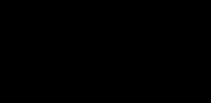
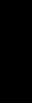
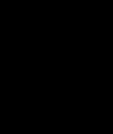
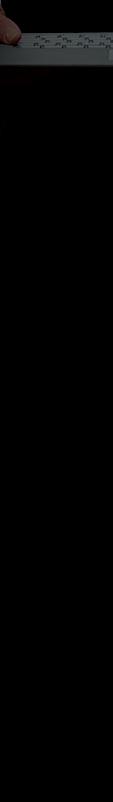
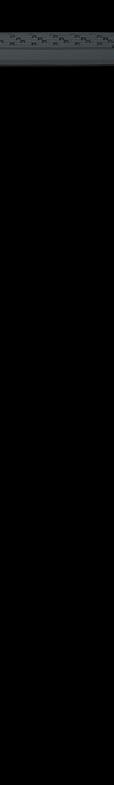



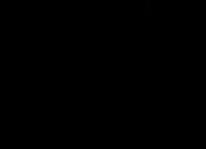
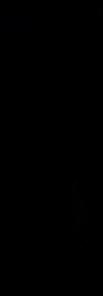
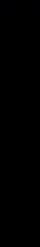


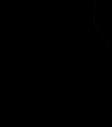
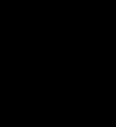
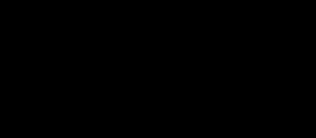
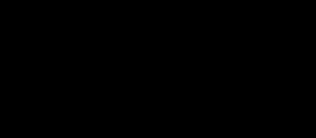
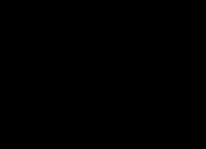

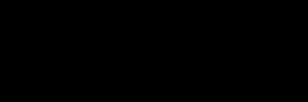
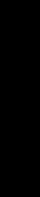
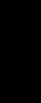


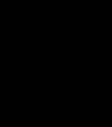
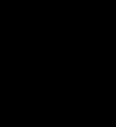



Moderne und komplexe Angriffe sind heute an der Tagesordnung. Darum gehört das Thema Cybersecurity bei jeder Organisation ganz oben auf die Agenda. Selbst einfachste Dienstewie eine Kopiermaschine, ein Drucker oder ein beliebiges anderes Bürogerät - können zum Einfallstor für Angriffe werden. Darum braucht es jemanden, der Sie hier berät und beschützt. Und dies nicht aus einer Perspektive, sondern als Teil einer Gesamtsicht auf Ihr Unternehmen. Genau das bietet der UMB Security-Angel als Teil des UMB Experten Teams und IT as a Service. umb.ch
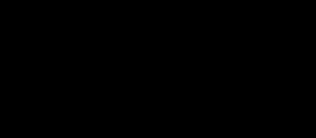
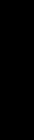
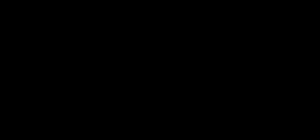
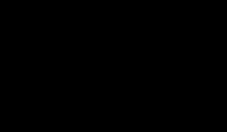
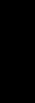
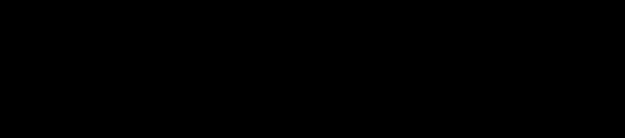
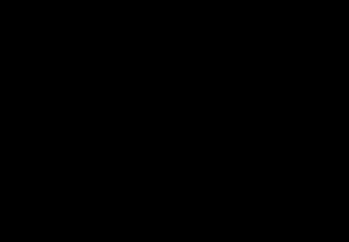
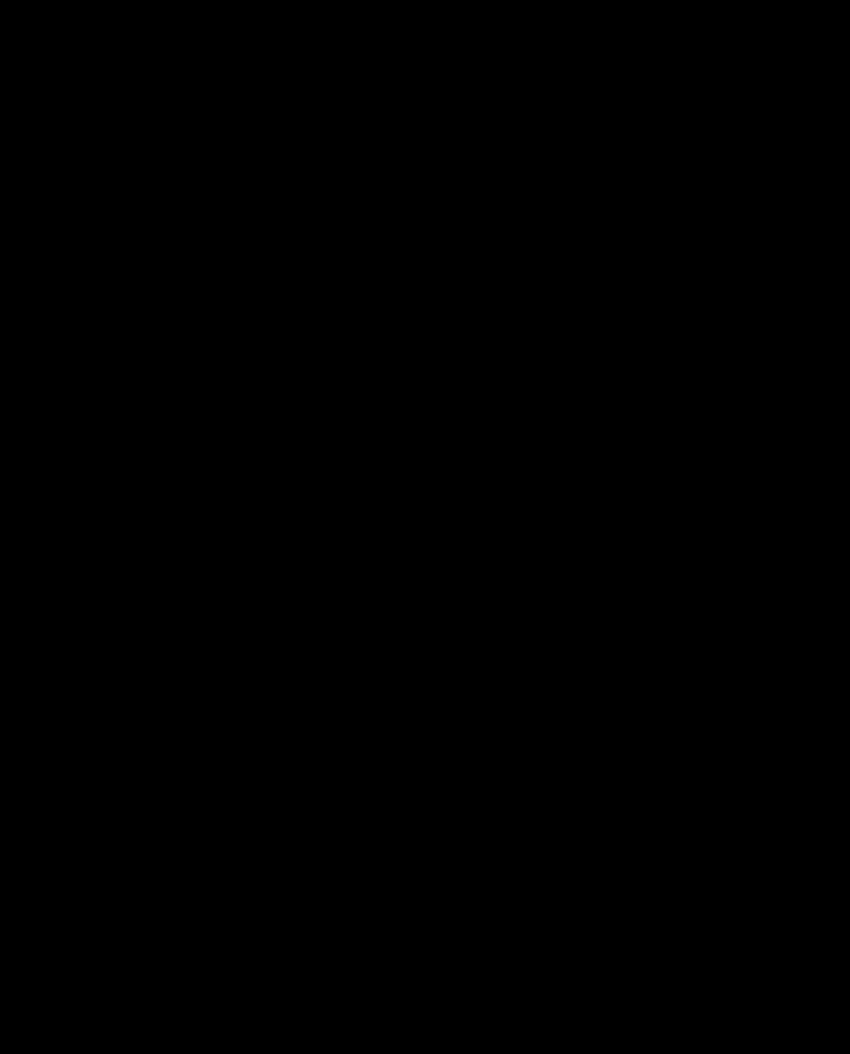
Combine human expertise with AI innovation − for smarter decisions and accelerated growth.
KPMG. Make the Difference.