KUNSTSTOFF XTRA
OFFIZIELLES ORGAN VON
KUNSTSTOFF.swiss


DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR WERKSTOFFE – VERARBEITUNG – ANWENDUNG



OFFIZIELLES ORGAN VON
KUNSTSTOFF.swiss


DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR WERKSTOFFE – VERARBEITUNG – ANWENDUNG


Fachinformationen aus erster Hand. KunststoffXtra – Ihre aktive Plattform rund um die Kunststoff verarbeitende Industrie.
Ein Abonnement der KunststoffXtra verschafft Ihnen das Plus an Wissen.
Magazin mit 7 Ausgaben pro Jahr –Print, Website und Newsletter.
Bequem bestellen unter: info@sigimedia.ch www.kunststoffxtra.com
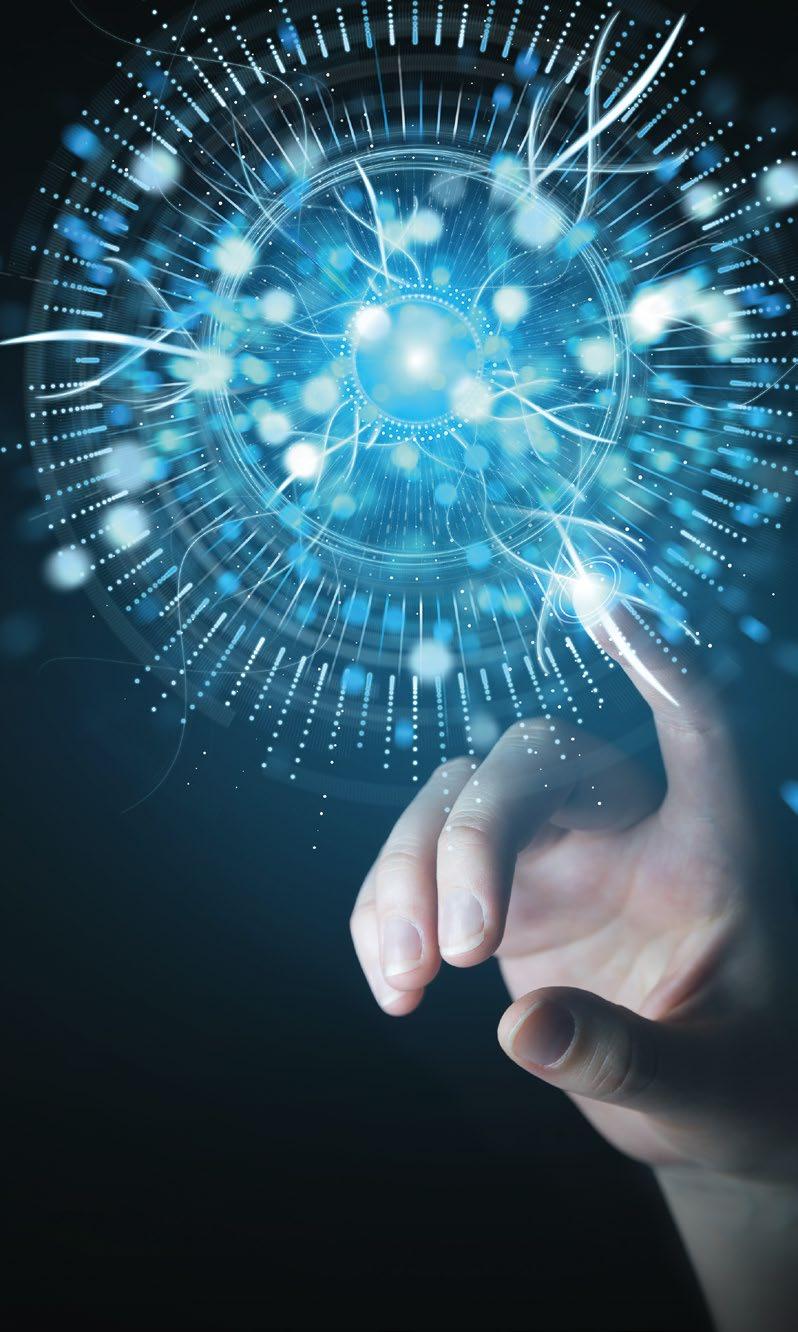
Verlag
SIGImedia AG
CH-5610 Wohlen
info@sigimedia.ch
+41 56 619 52 52

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Presse oder Politik das Ende Europas und unseres Wohlstands eingeläutet wird – schliesslich erzielen Hiobsbotschaften die grösste Aufmerksamkeit. Zugegeben: Die Zeiten stehen auf Sturm, und das nicht erst seit gestern. Der globale Wettbewerb, Kriege, steigende Energie- und Rohstoffpreise und jetzt noch ein drohender Zollstreit machen auch der Kunststoffbranche zu schaffen. So verlor sie 2024 allein in Deutschland weitere 4,3 Prozent Umsatz (Seite 40).
Ein wesentlicher Faktor ist die schwächelnde Automobilbranche. Laut einer Studie der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company sind die durchschnittlichen Entwicklungskosten pro Fahrzeug bei chinesischen Automobilherstellern mehr als dreimal tiefer als die von deutschen (Seite 29). Soweit die Zahlen. Den Schluss, den die Studienbetreiber daraus ziehen, stimmt hingegen nachdenklich: Europäische Autohersteller sollten ihre Forschung und Entwicklung zunehmend in günstigere Länder verlagern, sagen sie. Doch: Was bleibt da am Schluss noch übrig?
Dass es auch anders geht, zeigte der Besuch an den Technologie-Tagen von Arburg (ab Seite 4). Das Unternehmen hält am Standort Deutschland fest und ist stolz auf eine Fertigungstiefe von rund 60 %. Es gelte nun, das Erfolgreiche zu erhalten und gleichzeitig das Portfolio weiterzuentwickeln sowie an die neuen Herausforderungen anzupassen, sagte Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter von Arburg. Zwar durchlebt auch Arburg schwierige Zeiten, aber nicht nur aufgrund der globalen Marktlage, sondern auch wegen der zunehmenden Regulierungswut und Bürokratie in Europa. Damit hängt sich der Kontinent im internationalen Wettbewerb immer mehr ab – ohne Not.
Anwesende Schweizer Kunststoff-Verarbeiter äusserten sich an den Technologie-Tagen in ähnlicher Weise: Die Krise sei noch nicht ausgestanden, umso mehr müsse man jetzt vorwärts gehen. Der Ausweg aus der Krise liege in der Innovationskraft und Kreativität – und im klugen Agieren auf den Bühnen dieser Welt. Aufgeben, hingegen, sei sicher keine Option.

Raphael Hegglin, Redaktor r.hegglin@sigimedia.ch
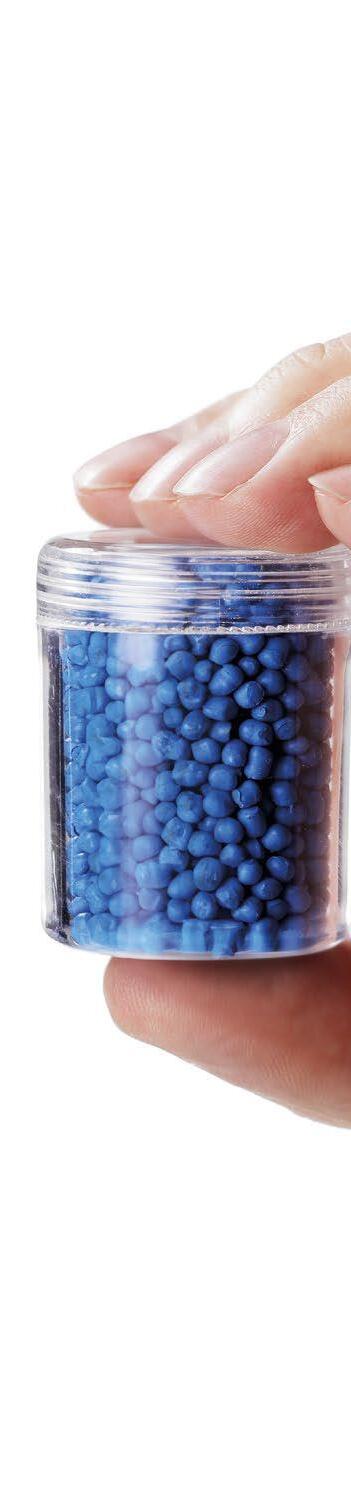
4

Arburg Technologie-Tage 2025

Auf den Technologie-Tagen zeigte Arburg über 40 zukunftsweisende Anwendungen zur Kunststoffverarbeitung.
10

Composites-Markt setzt Abwärtstrend fort
Die Europäische Composites-Industrie konnte auch 2024 den Abwärtstrend nicht stoppen. Bereits im dritten Jahr in Folge ging das europäische Produktionsvolumen deutlich zurück.
14
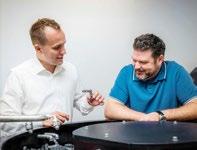
Hochautomatisierte Gleitschlifflösung
Die grosse Werkstück- und Materialvielfalt war bei der Investition in neue Gleitschlifftechnik ein wesentlicher Punkt im Pflichtenheft der Eingliederungsstätte Baselland ESB.
Die Fachzeitschrift für Werkstoffe – Verarbeitung – Anwendung www.kunststoffxtra.com
Erscheinungsweise
7 × jährlich Jahrgang 15. Jahrgang (2025)
Druckauflage 3900 Exemplare
WEMF / SW-Beglaubigung 2024 3032 Exemplare total verbreitete Auflage 1138 Exemplare davon verkauft
ISSN-Nummer 1664-3933
Verlagsleitung
Thomas Füglistaler


Bring Plastic Back
Bring Plastic Back, das Sammelsystem von Haushaltkunststoffen, kann für das Jahr 2024 mit einer neuen Rekordsammelmenge aufwarten.
18

DIGITALISIERUNG
Selbstlernender Algorithmus regelt Füllverhalten
In Zusammenarbeit mit der ZHAW und Kistler entwickelte das IWK einen selbstlernenden Regelalgorithmus für die Heisskanal-Balancierung im Spritzgiessen.

Leitthema der K 2025: Embracing Digitalisation
Die K 2025, vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf, hat es sich zur Aufgabe gemacht, zentrale Herausforderungen unserer Zeit aufzugreifen und konkrete Lösungen zu präsentieren.
Vorstufe
Herausgeber/Verlag
SIGImedia AG
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.sigimedia.ch www.kunststoffxtra.com
Anzeigenverkauf
SIGImedia AG
Jörg Signer
Thomas Füglistaler
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch
Redaktion
Raphael Hegglin +41 56 619 52 52 r.hegglin@sigimedia.ch
Marianne Flury (Senior Editor) +41 32 623 90 17 m.flury@sigimedia.ch
Triner Media + Print Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch
Abonnemente +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.kunststoffxtra.com
Druck
Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch
Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.) Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)
Copyright Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGImedia AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Copyright 2025 by SIGImedia AG, CH-5610 Wohlen


ERDE Schweiz steigert Sammelmenge signifikant
Das Rücknahmesystem für Agrarkunststoffe von ERDE Schweiz sammelte im Jahr 2024 rund 2500 Tonnen Agrarkunststoffe, das sind fast 15 % mehr als im Vorjahr.
26

F & E
Isocyanatfrei schäumen
Forschende am Fraunhofer IAP haben eine Folie entwickelt, die durch Wärme zu einem PU-Schaum aufschäumt – und das ohne gesundheitliche Risiken.
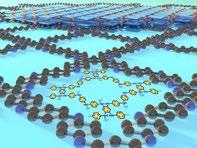
F & E
Polymerkristall leitet Strom
Forschende der TUD haben ein zweidimensionales leitendes Polymer entwickelt und damit einen grundlegenden Durchbruch in der Polymerforschung geschafft. 28
ZUM TITELBILD
Bei der Prozesskühlung im Spritzguss- und Extrusionsbereich entsteht Abwärme, die aufgrund zu niedriger Temperaturen kaum für direkte Heizzwecke in Gebäuden genutzt werden kann. Um diese Abwärme zu nutzen, setzt ONI hocheffiziente Wärmepumpen mit frequenzgeregelten Schraubenverdichtern ein. Sie kühlen das Prozesswasser ab und bringen es auf die erforderliche Vorlauftemperatur für die Heizzwecke. Mit einer elektronischen Kondensationsdruckregelung können bei Bedarf Heizwassertemperaturen von bis zu 78°C erreicht werden! Ausserhalb der Heizperiode wird ein Trockenkühler zur Prozesskühlung eingesetzt, um die Effizienz des Kühlsystems zu maximieren.
ONI bietet seit über vier Jahrzehnten energieeffiziente Systeme zur Kühlung und Wärmerückgewin-
29

Autobauer: mehr Effizienz ist notwendig
Junge chinesische Automobilmarken erhöhen zunehmend den Wettbewerbsdruck auf die etablierten europäischen Hersteller. Eine Studie zeigt, wie man wettbewerbsfähig bleibt.
32

Moulding Expo 2025
Vom 6. bis 9. Mai 2025 zeigt die Branche in Stuttgart, was der europäische Werkzeug-, Modell- und Formenbau sowie die zugehörigen Zulieferertechnologien zu bieten haben.
LIEFERANTENVERZEICHNIS
nung an, die weltweit in verschiedenen Branchen eingesetzt werden und staatlich förderfähig sind.
ONI-Wärmetrafo GmbH
Vertretung in der Schweiz: KUMA Solution AG
Bresteneggstrasse 5 CH-5033 Buchs +41 62 557 37 01 info@kuma-solution.ch www.kuma-solution.ch

Auf den Technologie-Tagen 2025 zeigte Arburg über 40 zukunftsweisende Anwendungen zur Kunststoffverarbeitung. Im Fokus standen Rezyklate und Biokunststoffe, 3D-Druck-Verfahren für die Medizintechnik, das Spritzgiessen von Flüssigsilikon sowie flexible Automations- und Turnkey-Lösungen. Mehrere Exponate verbanden bewährte Technik mit digitalen Assistenzsystemen, Robotik und neuen Werkstoffen.
Raphael Hegglin
«Die vergangenen Jahre waren und sind virulent und herausfordernd: Covid, Lieferkettenschwierigkeiten, Kriege – und daraus resultierend: u. a. Energieprobleme – haben die Weltwirtschaft negativ beeinflusst und tun dies bis heute», sagte Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter von Arburg, an der Pressekonferenz zu den Technologie-Tagen 2025. So verlief das vergangene Geschäftsjahr weniger gut als erwartet: Der konsolidierte Umsatz beträgt 600 Millionen Euro –20 Millionen weniger als erwartet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 23%.
In dieser herausfordernden Situation beschäftige die Frage, wie es in Zukunft weitergehen wird, so Hehl. Er sieht die Lösung in einer Balance aus Kontinuität und Innovation. Es gelte, das Erfolgreiche zu erhalten und gleichzeitig das Portfolio weiterzuentwickeln sowie an die neuen Herausforderungen anzupassen. «Wichtige Impulse hierfür liefern internationale Branchen-Events wie die Technologie-Tage und die Weltleitmesse K.» Dazu zeigte Arburg an den diesjährigen Technologie-Tagen über 40 Exponate und zahlreiche Anwendungen aus den Bereichen Kunststoffverarbeitung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Schwerpunkte lagen auf folgenden Themen:
Rezyklate
Arburg präsentierte an den TechnologieTagen 2025 Lösungen für nachhaltiges Spritzgiessen – mit Rezyklaten, Biokunststoffen und digitalen Tools. So fertigte ein elektrischer Allrounder 370 A ein sechsteiliges Geduldsspiel aus «Paper Pearls» – Papierfasern kombiniert mit Biokunststoffen – in einer Zykluszeit von 60 Sekunden

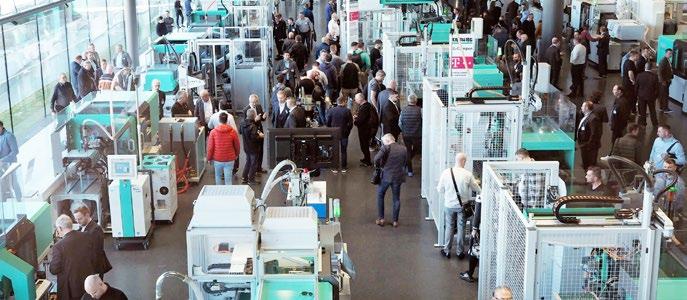
Die Arburg-Technologie-Tage zogen auch dieses Jahr zahlreiche Besuchende an. (Bilder: Raphael Hegglin)
(siehe auch Interview ab S. 6). Weitere alternative Materialien waren zum Beispiel ein Compound mit 20% Eierschalen, das zu Bleistifthaltern verarbeitet wurde, oder das PP-Compound «GC green» der Firma Golden Compound mit 30 Prozent Sonnenblumenkernschalen als Füll- und Verstärkungsmaterial. Aus diesem spritzte ein Arburg Allrounder 170 S innert 15 Sekunden einen «Göffel» – eine Kombination aus Löffel und Gabel. Auf besonderes Interesse stiess zudem eine Anwendung aus der Medizintechnik, in der Biokunststoffe und Rezyklate noch wenig vertreten sind: In einem Reinraum verarbeitete ein Allrounder 370 A PLA aus Maisstärke zu Spritzenkolben. Da solche medizinischen Produkte nach Gebrauch in der Regel verbrannt werden müssen, lässt sich deren CO2-Bilanz durch das PLA deutlich verbessern.
Mit dem neuen Freeformer 550-3X lassen sich resorbierbare Implantate, zum Beispiel aus Resomer LR 706, direkt in Kliniken drucken. Die Maschine arbeitet dank erhöhtem Tropfenaustrag schneller und
erlaubt einen einfacheren Materialwechsel. Ein integrierter Produktionsassistent unterstützt den Anwender bei jedem Schritt, von der Auftragswahl bis zum Druckstart. So gelingt der 3D-Druck auch ohne fachspezifische Vorkenntnisse zuverlässig.
LiQ 5 ist ein 3D-Drucker für die additive Fertigung mit Standard-Silikon (LSR) der Arburg-Tochter Innovatiq. Sein zweiter Druckkopf und neues Stützmaterial ermöglichen Überhänge, Hinterschnitte und Kanäle. Das Gerät eignet sich dadurch besonders für die Anfertigung von anspruchsvollen Kleinserien, etwa im medizinisch-orthopädischen Bereich.
Spritzguss mit Flüssigsilikon Mehrere Allrounder-Spritzgiessmaschinen demonstrierten, wie sich Flüssigsilikon (LSR) effizient verarbeiten lässt. Ein Allrounder More 2000 kombinierte zum Beispiel optisches LSR mit biobasiertem PA11, das vollständig aus erneuerbarem Rizinusöl gewonnen wird. Die Maschine arbeitete dazu mit zwei elektrischen Spritzeinheiten und fertigte mit einer Zykluszeit von 65 Sekunden eine Zwei-

Ein Mitarbeiter von Arburg präsentiert zahlreiche 3D-Druck-Anwendungen für die Medizintechnik.
Komponenten-Brille. Neu war der Arburg Flow-Pilot: Mit ihm lassen sich Werkzeugtemperaturen exakt steuern, denn er regelt den Durchfluss und die Temperatur pro Kanal einzeln. Dank angepasster Pumpendrehzahl und optimaler Nutzung der Kühlkapazität des Werkzeugs lässt sich der Energiebedarf der Temperiergeräte je nach Anwendung um über 85 Prozent
senken bzw. die Zy kluszeit um bis zu 75 Prozent reduzieren.
Ein grosser Fokus lag auf den Themen Automation und Turnkey: Arburg präsentierte rund 25 Anlagen mit integrierten RobotSystemen – vom Integralpicker bis zum Sechs-Achs-Roboter. In einer Turnkey-Anlage mit dem hydraulischen Allrounder 470 C Golden Edition arbeiteten das integrierte Robot-System und ein mobiler Cobot zum Beispiel Hand in Hand, um Pommes-Schalen herzustellen und anschliessend zu verpacken. Dazu entnahm ein Multilift Select 6 die im 15-Sekunden-Takt entstehenden Schalen aus dem Werkzeug und legte sie auf ein Förderband. Ausserhalb des Schutzzauns nahm darauf ein mobiler Cobot die abgekühlten Schalen auf und stapelte sie für die Verpackung. Dazu übermittelte ein integriertes Kamerasystem laufend die Position der Teile auf dem Band. Die gesamte Lösung ist mobil und



Das in den Allrounder 470 C Golden Edition integrierte Robot-System arbeitet Hand in Hand mit einem mobilen Cobot.
lässt sich flexibel als End-of-line-Automation an verschiedenen Anlagen einsetzen.
Kontakt
Arburg GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
D-72290 Loßburg
Tel.: +49 7446 330 www.arburg.com n

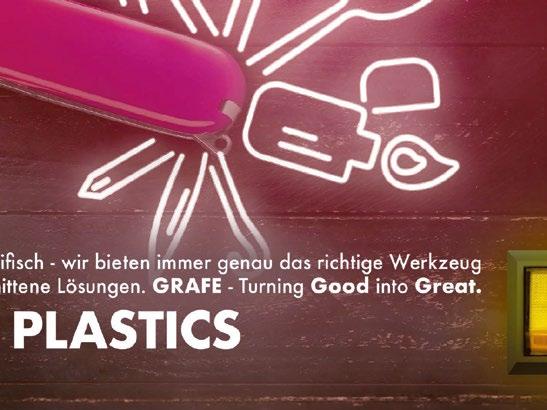

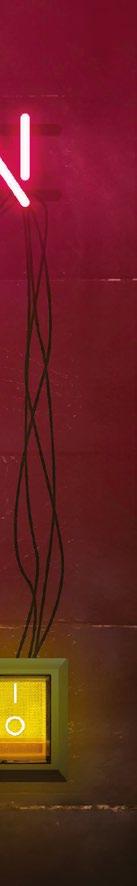
Eine Attraktion an den Arburg Technologie-Tagen war das Papierspritzgiessen mit einem elektrischen Allrounder 370 A. Zum Einsatz gelangte ein neu entwickeltes Granulat, bestehend aus Papierfasern und PLA. Diese sogenannten Paper-Pearls sind das Ergebnis einer Entwicklungszusammenarbeit zwischen Arburg und der Model Group. Im Interview verraten Luca Simon (Applications Manager Circular Economy bei Arburg) und Severin Kasper (Team Leader Innovation bei der Model Group), was derzeit möglich ist – und was noch auf uns zukommt.
Raphael Hegglin
Herr Kasper, Herr Simon, für das von Ihnen entwickelte Spritzgiessverfahren verwenden Sie eine Standardmaschine. Welche Anpassungen mussten Sie vornehmen, damit diese die neuen PaperPearls verarbeitet?
Luca Simon: Die heute von uns eingesetzten Paper-Pearls bestehen zu 51 % aus Papierfasern und zu 49 % aus dem Biokunststoff PLA. Für sie ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich; diese PaperPearls lassen sich problemlos auf Standard-Spritzgiessmaschinen verarbeiten. Allerdings gibt es werkzeugseitig Einschränkungen: Die Papierfasern mindern die Fliessfähigkeit des Kunststoffes, wie wir das von anderen faserverbundenen Kunststoffen auch kennen. Wir haben den Prozess daher lange optimiert, und bereits heute sind Wandstärken von weniger als 1 mm möglich. Doch der Entwicklungsprozess ist längst nicht abgeschlossen. Wir lassen gerade anhand unserer gewonnenen Erkenntnisse ein neues Testwerkzeug bauen. Ich denke, dass wir mit diesem noch deutlich mehr Erkenntnisse sammeln können.

Mit einem elektrischen Allrounder 370 A gefertigtes sechsteiliges Geduldsspiel aus Paper-Pearls. (Bild: Raphael Hegglin)


Severin Kasper (li) und Luca Simon vor dem elektrischen Arburg Allrounder 370 A fürs Papierspritzgiessen. (Bild: Raphael Hegglin)
Severin Kasper: Für uns war zentral, dass wir ein Standardverfahren entwickeln und dass keine Änderungen am Maschinenpark erforderlich sind. Der Fokus unserer gemeinsamen Entwicklungsarbeit lag daher zuerst auf den Paper-Pearls. Sie müssen so beschaffen sein, dass sie sich wie Pellets aus herkömmlichen, erdölbasierten Kunststoffen einsetzen lassen. Dies haben wir erreicht, unser Produkt ist bereits unter dem Namen «Paper-Pearls +VS51» lieferbar.
Für welche Endprodukte eignen sich die von Ihnen heute angebotenen Paper-Pearls?
Luca Simon: Prädestiniert sind Produkte im Single-Use-Bereich, die am Ende nicht rezykliert werden können und damit verbrannt werden. Solche fallen in der Baubranche wie auch im Verpackungs- und Lebensmittelbereich zuhauf an. Mit PaperPearls gefertigte Erzeugnisse sind biologisch abbaubar und auch ihre Verbrennung ist unproblematisch: Das freigesetzte Kohlendioxid befindet sich in einem natürlichen Kreislauf, da sowohl die Papierfasern wie auch das PLA aus nachwachsen -
den Pflanzen stammt. Einschränkend ist allenfalls die minimale Materialstärke, die erreicht werden kann – die fällt bei anderen Kunststoffen dünner aus. Auch sind aus Paper-Pearls gefertigte Produkte, ähnlich wie Verpackungen aus Karton, nicht über längere Zeit wasserbeständig. Flüssigkeitsbehälter muss man also innen zusätzlich beschichten.
Severin Kasper: Erste Interessenten sind bereits auf uns zugekommen und es laufen einige Tests mit unserem Material. Details darf ich allerdings noch nicht verraten. Aber um eine Vorstellung zu bekommen: Solche Endprodukte können zum Beispiel Fliesenkreuze für den Bau sein, wie sie täglich zigtausendfach verwendet werden. Oder Distanzhalter, Dübel, Verpackungseinlagen, Montagehilfen, Dosen und Spielwaren. Es gibt nur wenig Einschränkungen.
Sie fertigen Ihre Paper-Pearls aus nachwachsenden Rohstoffen, was auf eine gute CO2-Bilanz hinweist. Können Sie diese bereits belegen?
Severin Kasper: Den Carbon-Footprint Cradle-to-Gate haben wir berechnen lassen. Er liegt bei 1,5 CO2-Äquivalenten pro Kilogramm Paper-Pearls. Das ist schon sehr gut, doch für uns nur Schritt eins. Wir möchten künftig Produkte mit bis zu 75 % Anteil an Papierfasern anbieten. Dazu gehört auch eine vollständig rezyklierbare Variante. Als Bindemittel verwenden wir für diese nicht PLA, sondern wasserlösliche Kohlenhydrate, die ich nicht genauer spezifizieren darf. So erzeugte Produkte lösen sich innerhalb von fünf bis zehn Minuten im Wasser auf, die Papierfasern lassen sich damit einfach zurückgewinnen und bis zu 20-mal wiederverwenden. Das kohlenhydrathaltige Abwasser lässt sich

Produkte aus Paper-Pearls weisen eine gute CO 2 -Bilanz auf. (Bild: Arburg)
zudem in einer Biogasanlage zu Biogas fermentieren. Spritzmaterial mit Kohlenhydraten als Bindemittel und mit 75% Papierfaseranteil lassen sich natürlich nicht überall einsetzen, doch wir sehen grosses Potenzial in der Verpackungsindustrie –nicht nur aufgrund der hervorragenden Ökobilanz unseres Materials, sondern auch hinsichtlich des Preises. Ab einer gewissen Menge erreichen wir tiefe Kosten.
Die Stärke für das PLA wie auch die von Ihnen erwähnte Kohlenhydrate sind nachwachsende Rohstoffe, angebaut auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Entsteht dadurch die Gefahr, die Nahrungsmittelproduktion zu gefährden?
Severin Kasper: Auch wenn wir landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Biokunststoffen nutzen, können wir ausreichend Lebensmittel herstellen. Entscheidend ist die Art der Landwirtschaft: Mit weniger Tierfutter werden die Flächen auch für biologische Werkstoffe reichen. Ich bin daher überzeugt, dass Biokunststoffe Teil einer nachhaltigen Landwirtschaft sein können. Und wir streben ja einen möglichst hohen Gehalt an Papierfasern an – diese stammen aus der Forstwirtschaft.

Das Ausgangsmaterial Paper-Pearls. (Bild: Arburg)
Welche Faktoren sind entscheidend, um Spritzgiessen mit einem hohen Anteil an Papierfasern zu ermöglichen?
Luca Simon: Es sind verschiedene Herausforderungen zu meistern. Bei Materialien mit so hohem Faser-Anteil entstehen sehr grosse Reibungskräfte und entsprechend Wärme – dies muss man beim Auslegen des Arbeitsprozesses berücksichtigen. Es ist auch nicht einfach, bei einem so hohen Faseranteil eine fliessfähige Masse aufzuarbeiten, deshalb müssen die Plastifizierkomponenten darauf ausgelegt
sein. Ein weiterer Punkt ist das Granulat: Durch den hohen Faseranteil neigt es dazu, sich bei der Zuführung zu verhaken. Das passiert teilweise auch bei Standardkunststoffen. Bei sehr hohen Papierfaseranteilen wie die erwähnten 75 % handelt es sich also nicht mehr um ein StandardSpritzverfahren. Es sind Anpassungen der Maschine erforderlich, diese sind bei uns jedoch alle erhältlich und werden vielfach eingesetzt. Doch die Maschine ist nicht alles: Wir von Arburg stecken viel Entwicklungsarbeit in die Betriebsoptimierung, da
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
06.-09. Mai 2025 in Stuttgart
Wir unterstützen Sie bei Ihren Anwendungen:
– Medical- Devices – Technische Teile
Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Dienstleistungen mit den erweiterten Angeboten präsentieren zu dürfen: Halle 6, Stand 6E50 (28A)
Werkzeug- & Formenbau
Werkzeugkonstruktionen | Spritzgussformen
MIM- & Druckgussformen | Vorrichtungsbau
Duroplast- & Mehrkomponentenwerkzeuge
Tiefzieh- & Umform-Werkzeuge
Service & Revision
Werkzeug- & Formenservice
Revisionen von Fremdformen
Artikeländerungen in Fremdformen
Präzisionsfertigung
Komplette Einsatz- & Ersatzgarnituren
Spezielle Maschinenbauteile
Stanz- & Umformtechnik
Wilerstrasse 98 CH-9230 Flawil Tel. +41 (0)71 394 13 00 info@brsflawil.ch

Nachhaltige Werkstoffe für die Zukunft Papierspritzgiessen macht es möglich, papierbasierte Werkstoffe mit herkömmlichen Spritzgiessmaschinen zu verarbeiten. Erste Ansätze zur Nutzung von Zellulosefasern in Formmassen entstanden bereits im 20. Jahrhundert. Mit der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Materialien haben sich in den letzten Jahren vermehrt biologisch abbaubare und kreislauffähige Werkstoffe etabliert. Eine neue Entwicklung in diesem Bereich stammt von Arburg und der Model AG. Gemeinsam haben sie die Werkstoffklasse Paper-Pearls geschaffen, die aus Papierfasern und biobasierten Kunststoffen besteht. Als Bindemittel dienen Lignin oder Stärke, sodass sich das Material spritzgiessen lässt. Auf der Fakuma 2024 konnte Arburg zusammen mit Model das Potenzial dieser Technik anhand des Slot-Lock-Positioniertools bereits demonstrieren. Gefertigt mit herkömmlichen Spritzgiessmaschinen, besteht das Material zu 51 Prozent aus Papierfasern. Der Werkstoff enthält keine störenden Zusatzstoffe und könnte künftig sogar günstiger sein als manche herkömmlichen Kunststoffalternativen. Die nächsten Schritte zielen nun darauf ab, den Faseranteil weiter zu erhöhen und als Bindemittel wasserlösliche Kohlenhydrate zu verwenden. So lässt sich ein geschlossener Materialkreislauf schaffen, indem gebrauchte Produkte wieder in ihre Fasern zerlegt und als Ausgangsmaterial für neue Anwendungen genutzt werden.
wir viel Potenzial im Papier-Spritzgiessen sehen. Wir profitieren von der Zusammenarbeit mit der Model Group daher sehr –
mit dem erlangten Know-how können wir unsere Kunden in dieser Sache nun ideal unterstützen.
Severin Kasper: Auch für uns hat sich die Zusammenarbeit als absoluter Glücksfall entwickelt. Wir sind ohne Vorwissen über die Kunststoffbranche auf Arburg zugegangen und man hat uns sehr unterstützt –nicht nur beim Entwickeln, sondern auch beim Netzwerken und Bekanntmachen unserer Paper-Pearls. Ohne die Expertise von Arburg und die Plattform, die sie uns bieten, stünden wir jetzt nicht mit einem marktfähigen Produkt da.
Kontakt
Arburg GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
D-72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 330 www.arburg.com
Model AG
Industriestrasse 30 CH-8570 Weinfelden www.modelgroup.com n
F_Beitragsbilder
Weitere Stärken sind:
• ausgezeichnetes Rückstellverhalten
• sehr gute Gleit- und Abriebeigenschaften
• breite Chemikalienbeständigkeit
• geringe Wasseraufnahme
Unser Portfolio haben wir gezielt erweitert, um noch mehr maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit einem breiteren Leistungsspektrum und innovativen Produkten setzen wir neue Maßstäbe und bieten Ihnen zusätzlichen Mehrwert und Flexibilität.
Scannen Sie den QR-Code für weitere Infos

Entdecken Sie unser erweitertes Portfolio – einfach den

Die Verarbeitung von technischen Thermoplasten im Spritzgussprozess erfordert höchste Präzision, um qualitativ hochwertige Formteile zu produzieren. Ein entscheidender Faktor ist die Restfeuchte des verwendeten Kunststoffgranulats. Sie kann eine Vielzahl von Problemen verursachen – angefangen bei mechanischen Schwächen bis hin zu Oberflächenmängeln.
Und so lässt sich gemäss Barlog, renommierter Lieferant von technischen Kunststoffen, die Restfeuchte bei der Verarbeitung von technischen Thermoplasten effektiv managen:
der Problematik
Viele Kunststoffe sind hygroskopisch, was bedeutet, dass sie Wasser aufnehmen können. Diese Feuchtigkeit kann sowohl innerhalb des Granulatkorns, als auch an der Oberfläche vorhanden sein. Die Qualität der spritzgegossenen Formteile hängt wesentlich von der Feuchte im Granulat ab. Die Restfeuchte im Kunststoffgranulat kann sich auf viele Aspekte der Verarbeitung und Qualität der Formteile auswirken. Sie beeinflusst den hydrolytischen Abbau der Formmasse, mechanische Eigenschaften, Fliessverhalten der Formmasse, Spritzdrücke, Oberflächenqualität, Gratbildung sowie das Entstehen von Formbelag und Zusetzen der Werkzeugentlüftung. Ein tieferes Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend, um die optimale Restfeuchte für Ihr spezifisches Verarbeitungsverfahren zu ermitteln.
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Feuchtegehalt und Restfeuchte zu kennen. Feuchtegehalt bezieht sich auf den Wasseranteil im Material, während Restfeuchte den Masseanteil bei einer definierten Temperatur beschreibt. Je nach Messmethode können auch andere flüchtige Substanzen detektiert werden, was zu ungenauen Ergebnissen führen kann.
Die genaue Bestimmung der Restfeuchte ist entscheidend. Hierfür gibt es verschie

dene Messverfahren wie die Infrarotwaage, die Dampfdruckmethode durch Reaktion des Wassers mit Calciumhydrid und die Karl FischerTitration. Jedes Verfahren hat seine Vor und Nachteile. Die Wahl hängt von den Anforderungen und gegebenen Ressourcen ab.
Die Infrarotwaage ist eine gängige Methode zur Messung der Restfeuchte. Dabei wird der Gewichtsverlust der Probe aufgrund der Verdampfung von Wasser gemessen. Zu beachten ist, dass diese Methode nicht spezifisch für Wasser ist, da auch andere flüchtige Stoffe verdampfen und somit das Ergebnis verfälschen können. Bei der Verwendung von Infrarotwaagen ist ausserdem darauf zu achten, dass das Ergebnis durch äussere Einflüsse wie zum Beispiel Luftzug oder Vibrationen nicht beeinflusst wird.
Die Dampfdruckmethode durch Reaktion mit Calciumhydrid ist eine zuverlässige Methode zur Messung der Restfeuchte. Sie ermöglicht eine spezifische Erfassung von Wasser und minimiert die Einflüsse anderer flüchtiger Substanzen. Dieses Verfahren bietet genaue Ergebnisse, erfordert jedoch eine sorgfältige Handhabung und periodischen Austausch des Calciumhydrid Reagenzes sowie regelmässige Wartungsläufe zur Trocknung der Anlage.
Das KarlFischerTitrationsverfahren ist ein präzises Messverfahren zur Bestimmung der Restfeuchte. Dabei wird Wasser mithilfe einer Reaktion mit Jod und Schwefeldioxid nachgewiesen. Die Probe wird erhitzt, um das Wasser freizusetzen, das dann in die Titrationslösung gegeben wird. Die Wassermenge wird anhand der verbrauchten Jodlösung gemessen. Das Verfahren ist äusserst genau, aber vergleichsweise aufwändig in der Handhabung. Bei jeder Messung fallen Chemieabfälle an, deren Entsorgung teuer ist.
Empfehlung
Barlog Plastics empfiehlt die Dampfdruckmethode mittels Calciumhydrid zur Restfeuchtemessung. Dieses Verfahren bietet ausreichende Genauigkeit und minimiert zusätzliche Einflüsse (Zugluft/Additive) auf das Messergebnis. Barlog setzt auf modernste Messgeräte, um die optimale Verarbeitungsfeuchte sicherzustellen. Bei der Verwendung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien ist die Wahl des richtigen Messverfahrens von entscheidender Bedeutung, um die maximale Leistungsfähigkeit der Kunststoffe zu gewährleisten. Insgesamt ist die Kontrolle der Restfeuchte bei der Verarbeitung von technischen Thermoplasten im Spritzgussprozess von entscheidender Bedeutung. Die richtige Messmethode, genaue Handhabung der Geräte und die Berücksichtigung der Empfehlungen der Experten helfen, die Qualität der spritzgegossenen Formteile zu verbessern und Ausfallzeiten zu minimieren.
Kontakt
Barlog Plastics GmbH D 51491 Overath +49 151 4460 57 74 Oliver.Heinicke@barlog.de www.barlog.de n

Marktentwicklungen, Trends, Herausforderungen und Ausblick
Die Europäische Composites-Industrie konnte auch 2024 den Abwärtstrend nicht stoppen. Bereits im dritten Jahr in Folge ging das europäische Produktionsvolumen deutlich zurück. Die derzeitige Entwicklung sei massgeblich strukturellen Schwächen in zentralen Anwendungsbereichen sowie wirtschaftlichen und industriellen Herausforderungen in den europäischen Kernregionen geschuldet, kommt die Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (AVK) in ihrem Marktbericht 2024 zum Schluss.
Besonders betroffen ist Deutschland, als nach wie vor grösste Volkswirtschaft innerhalb der EU. Nach einer ersten Schätzung von Eurostat ist das BIP im Euroraum um 0,7% und in der EU um 0,8% gestiegen. Im selben Zeitraum ging es in Deutschland Schätzungen zufolge um 0,2% zurück. Auslöser dieses negativen Trends sind allgemeine wirtschaftliche Schwächen, vor allem im produzierenden Gewerbe und der Industrie. Besonders die Automobilindustrie und der Bau- und Infrastrukturbereich, als wichtigste Anwendungsindustrien der Composites-Industrie in Europa, zeigen derzeit stark negative Tendenzen. Analog zeigt sich das Bild der CompositesIndustrie. Das Sinken des absoluten Marktvolumens in Europa war gepaart mit einem wachsenden Weltmarkt. Das trieb die Schere zwischen der europäischen und der weltweiten Composites-Industrie immer mehr auseinander. Der Marktanteil Europas ist seit vielen Jahren rückläufig.
Die Analyse der AVK betrachtet alle Glasfaserverstärkten (GFK-) Materialien mit einer duroplastischen Matrix. NCF (NonCrimp-Fabrics) werden gesondert ausgewiesen. Im Thermoplast-Markt werden die langfaserverstärkten Thermoplaste (LFT), glasmattenverstärkten Thermoplaste (GMT) sowie endlosfaserverstärkten Thermoplaste (CFRTP) berücksichtigt. Ausserdem wird die europäische Herstellungsmenge für kurzglasfaserverstärkte Thermoplaste gesondert ausgewiesen.
Gesamtentwicklung des Composites-Marktes
Das Volumen des weltweiten CompositesMarktes betrug im Jahr 2024 insgesamt


Ein Grossteil der thermoplastischen Composites findet Anwendung im Transport- und Elektro-/Elektronikbereich. (Bild: adpic)
13,5 Millionen Tonnen (Quelle: JEC). 2023, mit einem Volumen von 13 Millionen Tonnen, lag das Wachstum bei etwa 4%. Im Vergleich dazu ist die europäische Composites-Produktionsmenge 2024 um 5,6% zurückgegangen. Der gesamte europäische Composites-Markt umfasst damit ein Volumen von 2416 Kilotonnen (kt) nach 2559 kt in 2023. Der Markt entwickelte sich somit rückläufig und fiel auf das Niveau von 2012 zurück.
Insgesamt war die Marktdynamik in Europa deutlich geringer als im Markt weltweit. Der Marktanteil von Europa am Weltmarkt liegt jetzt bei etwa 18% (nach etwa 20% in 2023). Die Marktanteile verschieben sich weiter zugunsten Amerikas und Asiens. Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Entwicklung innerhalb Europas nicht einheitlich. Zurückzuführen ist das auf regional sehr unterschiedliche Kernmärkte, die hohe Variabilität der verarbeiteten Materialien, ein breites Spektrum unterschiedlicher Herstellungsverfahren sowie stark unterschiedliche Einsatzgebiete. Der mengenmässig grösste Teil der gesamten Composites-Produktion fliesst in den Transportbereich, der fast 50% des
Marktvolumens ausmacht. Die beiden nächstgrösseren Bereiche sind der Elektro-/Elektronikbereich sowie Anwendungen in Bau und Infrastruktur.
Die gesamte Herstellungsmenge duroplastischer Composites (ohne CFK) betrug im Jahr 2024 insgesamt 983 kt, nach 1073 kt im Vorjahr. Damit lag der Anteil dieser Materialgruppe bei 41,8% des Gesamtmarktes in Europa. Im Vergleich zum langfristigen Trend zeigt sich eine mittlerweile deutliche Abnahme des Marktanteils im Gegensatz zu den thermoplastischen Systemen. Die Hauptanwendungsgebiete für duroplastische Composites bleiben der Bau-/Infrastrukturbereich sowie der Transportbereich.
Entwicklung des Marktes für thermoplastische Composites
Der Markt für thermoplastische Composites umfasste in Europa im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen von 1368 kt, nach 1423 kt im Vorjahr. Dennoch steigt der Marktanteil dieser Systeme am europäischen Gesamt-
markt auf 58,2% nach 57% im Jahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Marktvolumen um 3,9% und somit weniger deutlich als bei den duroplastischen Materialien. Die grösste Materialgruppe innerhalb der thermoplastischen Composites, aber auch im Gesamtmarkt, sind dabei die sogenannten kurzglasfaserverstärkten Kunststoffe. Die zweitgrösste Gruppe innerhalb der Gruppe der thermoplastischen Materialien sind die langfaserverstärkten Kunststoffe (LFT). Hauptanwendungsgebiet für thermoplastische Composites ist mit fast zwei Dritteln des Marktes der Transportbereich. Innerhalb dieses Segmentes dominieren der PW- und Nutzfahrzeugbereich. Zusammen mit Elektro-/Elektronik-Anwendungen ergibt sich für das Jahr 2024 ein Marktanteil von fast 90 %. Von zentraler Bedeutung für die thermoplastischen Composites ist der PWMarkt. Wurde in der Automobilindustrie in den ersten beiden Jahren nach der CoronaPandemie oftmals noch von einer konjunkturellen Schwäche gesprochen, offenbart sich 2024 das ganze Ausmass des strukturellen Problems der europäischen und vor allem auch deutschen Automobilindustrie. Weiterhin zeigt sich ein genereller Trend auf Seiten der europäischen OEMs (Original
Equipment Manufacturer), der die Verkaufszahlen weiter drückt. Es zeigt sich eine Erholung des Fahrzeugmarktes, der sich aber derzeit im europäischen Composites-Markt nur sehr geteilt widerspiegelt.
SMC/BMC als grösstes Einzelsegment im europäischen GFK-Markt (alle duroplastischen sowie die lang- und endlosfaserverstärkten thermoplastischen Materialien) mit einem Marktvolumen von 259 kt, verzeichneten 2024 ein um fast 8% tieferes Produktionsvolumen. Gründe hierfür sind bspw. regulatorische Unsicherheiten in speziellen Einsatzgebieten und die verlangsamte Nachfrage im PW- sowie Bauund Infrastrukturbereich. Der SMC-Markt ging 2024 um 7,4% und der BMC-Markt um 8,9% zurück.
NCF als zweitgrösste Gruppe weisen noch ein Volumen von 212 kt auf, das Marktsegment verliert insgesamt 7,8%. Trotz hoher Investitionen in die Windenergie bleibt das Segment unter Druck, da die Produktion zunehmend von asiatischen Anbietern dominiert wird.
Die Offenen Verfahren – Handlaminieren und Faserspritzen – sind mit einer Herstellungsmenge von 165 kt weiterhin eines
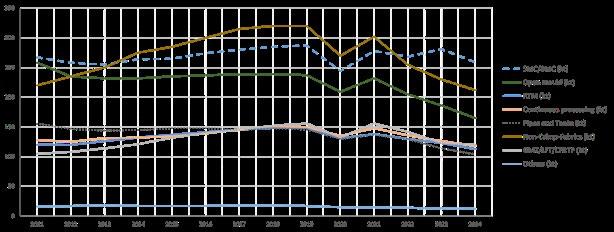
Langfristige Entwicklung ausgewählter Composites-Marktsegmente (in kt) (Grafiken: AVK)
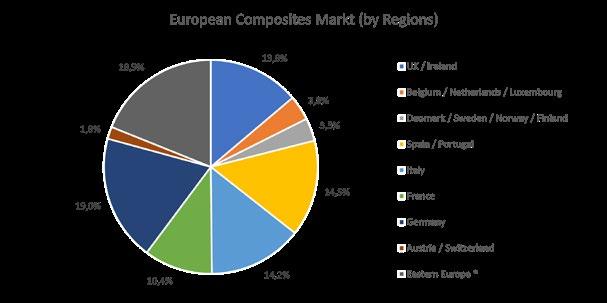
Regionale Verteilung des europäischen Duroplast-Marktes

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN

TIEFTEMPERATURTECHNIK
KÄLTETECHNIK FÜR EXTREME EINSATZFÄLLE

STEUERUNGSTECHNIK

WASSERAUFBEREITUNG
Besuchen Sie uns auf der KUTENO 13-15. Mai Stand C21 | Halle 20
L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG Hachener Straße 90 a-c 59846 Sundern-Hachen T: +49 2935 9652 0 info@lr-kaelte de | www lr-kaelte de

der grössten Segmente im GFK-Markt in Europa. Im Jahr 2024 ging jedoch auch dieses Marktsegment um überdurchschnittliche 11,3% zurück — bedingt durch strengere gesetzliche Auflagen, Fachkräftemangel und die abnehmende Nachfrage in speziellen Anwendungsbereichen.
Nach einer Phase, in der sich die RTMVerfahren kontinuierlich entwickeln konnten, ging das europäische Produktionsvolumen um 8,1% auf insgesamt 113 kt zurück. Damit ist der Rückgang etwa so hoch wie der des gesamten duroplastischen Composites-Marktes.
Die Produktion von GFK-Bauteilen mit den sogenannten kontinuierlichen Verfahren (Pultrusion und Herstellung planer Platten) wies 2024 einen Volumenrückgang von 6,4% auf. Insgesamt fiel das Produktionsniveau bei der Pultrusion um 4% auf eine Menge von 48 kt. Bei den planen Platten stand ein Rückgang von 7,9% auf ein Volumen von 70 kt.
Das Marktsegment der GFK-Rohre und -Tanks, hergestellt mit Schleuder- oder Wickelverfahren, ist im betrachteten Jahr um 6,3% zurückgegangen. Das Produktionsvolumen lag 2024 bei insgesamt 104 kt, wobei 56 kt auf die Wickelverfahren und 48 kt auf die Schleuderverfahren entfallen. Trotz generell positiver Zukunftsaussichten ist auch dieser Sektor in besonderer Form von den Schwächen im Bereich Bau und Infrastruktur und einer schwierigen Wirtschaftslage betroffen.
Der Markt für GMT ist 2024 um 4,3% auf ein Gesamtvolumen von 22 kt zurückgegangen. Der Rückgang war somit etwas höher als der des Gesamtmarktes für thermoplastische Materialien, der um 3,9% geschrumpft ist. Die LFT (langfaserverstärkten Thermoplaste) verloren 2024 insgesamt 2,2% und erreichten ein Produktionsvolumen von 88 000 Tonnen. Die CFRTP (endlosfaserverstärkte Thermoplaste) sind nach wie vor ein Nischenprodukt. Hier zeigen sich keine nennenswerten Änderungen, was vor dem Hintergrund eines generell rückläufigen Marktes eher als positives Signal zu verstehen ist. Das Marktsegment erreichte ein Volumen von 10 kt. Auch wenn sich die Eigenschaften von kurzglasfaserverstärkten Materialien zu lang- und endlosfaserverstärkten Systemen teils deutlich unterscheiden, zählt diese wichtige Materialgruppe zu den Composites. Der europäische Markt für thermoplastische kurzglasfaserverstärkte Materialien ging im Jahr 2024 um fast 4 % zurück. Das Produktionsniveau sank auf 1248 k. Dennoch bleiben die Kurzglasfaserverstärkten Thermoplaste mit Abstand das grösste Einzelsegment in der Composites-Industrie.
Die prozentualen Verschiebungen nach regionalen Schwerpunkten haben sich 2024 gegenüber 2023 nur im Nachkommabereich verändert. Insgesamt gab es in allen erfassten Regionen absolute Rückgänge.
Der deutsche Duroplast-Markt erreichte im Jahr 2024 ein Volumen von 187 kt (2023 = 208 kt). Mit einem Anteil von 19% ist Deutschland wieder der derzeit grösste Markt innerhalb der erfassten Regionen. An zweiter Stelle folgen die osteuropäischen Länder mit einem Marktanteil von 18,9%. Diese Region umfasst Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien. Spanien/Portugal bilden mit einem Marktanteil von 14,5% die drittgrösste Gruppe. Nur knapp dahinter folgt Italien mit einem Marktanteil von 14,2%. Diese vier Regionen stehen zusammen für fast zwei Drittel des europäischen Composites-Marktes. Als nächstgrös sere Verarbeitungsregion folgt UK/Irland mit einem Marktanteil von 13,8%. Frankreich liegt mit einem Marktanteil von 10,4% bereits deutlich dahinter. Die verbleibenden Verarbeitungsregionen werden angeführt von den Benelux-Staaten mit einem Anteil von 3,8%. Etwas geringer war das Volumen mit 3,5% in den nordeuropäischen Ländern. Der geringste prozentuale Anteil entfällt mit 1,8% auf Österreich/Schweiz. Es gilt zu berücksichtigen, dass es in fast allen Regionen sehr unterschiedliche Schwerpunkte der Composites-Industrie gibt. Dementsprechend sind die verschiedenen Länder/Regionen oftmals auch sehr unterschiedlich von den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen betroffen.
Master of Advanced Studies (MAS) in Kunststofftechnik an der FHNW
Praxisnahes, nebenberufliches Weiterbildungsstudium für Ingenieur:innen und Fachkräfte mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und digitale Transformation
Nächster Start: 12. September 2025 fhnw.ch/mas-kunststofftechnik

Studieninhalte
• Theoretische Grundlagen und praxisnahe Anwendungen
• Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen
• Themen wie neue Werkstoffe, Recycling sowie moderne Fertigungstechniken
Die europäische (Composites-) Industrie am Scheideweg «Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab!» Mit Blick auf die aktuelle Diskussion über die Zukunft der Industrie in Europa, appelliert die AVK mit dieser Metapher an die Wertschöpfung. Wichtige Indikatoren, wie die Krise in der Automobilindustrie, schwächelnde Baukonjunktur und steigende Energiepreise, deuten auf eine schwierige Lage hin. Gleichzeitig nimmt die Produktion in Schwellenländern wie China und Indien zu, während die Wettbewerbsfähigkeit der etablierten Industrien sinkt.
Wird es also Zeit, vom Pferd abzusteigen?
Ist die europäische (Composites-) Industrie tatsächlich am Ende und muss sich letztlich der Tatsache beugen, dass in anderen Regionen besser und billiger produziert werden kann? Aus Sicht der europäischen Composites-Industrie ist das der falsche Weg!
«Europa befindet sich in einer Zeit des tiefgehenden Umbruches, aber das bedeutet nicht das Ende», so die AVK. «Der Umbruch wird nicht schnell oder einfach sein, er ist aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Ein einfaches ‹Weiter so!› wird nicht reichen. Es stellt sich die Frage nach mittelfristigen Lösungen und was unsere Industrie Jahrzehnte lang ausgezeichnet hat – Qualität, Innovationskraft und Forschung.»
Europa kann im globalen Wettbewerb nicht mit Niedrigpreismodellen konkurrieren, vor allem nicht mit China. Doch anstatt die Industrie abzuschreiben, sollte sie neue Chancen ergreifen. Die Debatte um Nachhaltigkeit bietet besonders für die Composites-Industrie Potenzial, da neue Antriebssysteme und regenerative Energien grosses Wachstumspotenzial bieten. Diese Chancen müssen durch politische Unterstützung und ein faires internationales Wettbewerbsumfeld gefördert werden.
Ein nachhaltiger Strukturwandel ist notwendig, um den Klimawandel zu bekämpfen. Dabei ist es entscheidend, dass Europa seine Innovationen vorantreibt. Forschungskooperationen und Investitionen in neue Technologien wie KI und Robotik sind unerlässlich. Die europäische Industrie muss ihre Innovationskraft ausbauen und gleichzeitig die Wertschöpfungskette optimieren, von der Idee bis
zum fertigen Produkt, so die Forderungen der AVK.
Die derzeitige Krise ist nicht nur eine Folge der Corona-Pandemie, sondern das Resultat langfristiger Probleme.
«Die Industrie muss jetzt entschlossen handeln, um sich mittel- und langfristig neu aufzustellen. Die Composites-Industrie hat grosses Potenzial, insbesondere in Zeiten, in denen neue Herausforderungen auch neue Chancen mit sich bringen. Die europäische Industrie ist nicht am Ende –
sie muss nur neue Wege finden, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen – dann kann das Pferd auch weiterhin geritten werden.»
Kontakt AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.
D-60329 Frankfurt am Main +49 69 27 10 77-0 info@avk-tv.de www.avk-tv.de

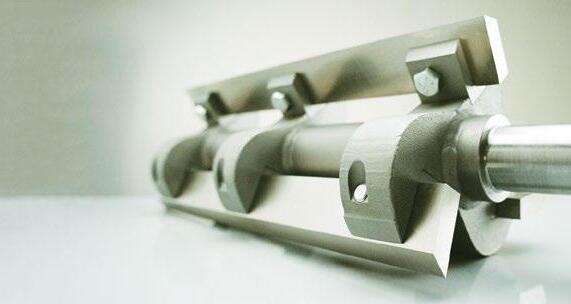

Die grosse Werkstück- und Materialvielfalt war bei der Investition in neue Gleitschlifftechnik einer der wesentlichen Punkte im Pflichtenheft der Eingliederungsstätte Baselland ESB. Ausserdem sollte die Bearbeitung für die Mitarbeitenden einfacher und zeitgemässer sowie insgesamt umweltgerechter werden. Diese Anforderungen setzte Rösler mit einer hochautomatisierten Gleitschlifflösung um.
Die 1975 gegründete Eingliederungsstätte Baselland ESB mit Hauptsitz im schweizerischen Liestal ist eine private Stiftung im öffentlichen Auftrag und umfasst 10 Standorte. Die Aktivitäten des sozialen Unternehmens zielen darauf ab, Menschen mit Unterstützungsbedarf darin zu stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu zählt der Betrieb in Liestal, in dem unter anderem die Bearbeitungsschritte Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Schleifen, Sägen und Reiben als Dienstleistung angeboten werden. Der moderne Maschinenpark ermöglicht dabei, dass Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl ebenso wie Kunststoffe verarbeitet werden können. Sowohl für die intern gefertigten Teile als auch für extern hergestellte Werkstücke umfasst das Leistungsportfolio darüber hinaus das Entgraten und Kanten entschärfen mittels Gleitschleifen.
Neu automatisiert
«Unsere Anlagen dafür waren jedoch in die Jahre gekommen und haben heutige Anforderungen an Arbeitskomfort, Ergonomie und Nachhaltigkeit nicht mehr erfüllt. So mussten beispielsweise die Teile manuell aus den Arbeitsbehältern entnommen werden. Ausserdem wurden die Prozesse mit Frischwasser durchgeführt, was einen hohen Wasser- und Ressourcenverbrauch verursachte», berichtet Sascha Berger, CoLeiter des Betriebs in Liestal der ESB. Neben der Möglichkeit, das enorm breite Spektrum an Bauteilen, Geometrien und Materialien problemlos bearbeiten zu können, waren die Automatisierung des Prozesses sowie eine möglichst einfache Steuerung und Handhabung wesentliche Punkte im Pflichtenheft. Darüber hinaus musste die Einbringsituation berücksichtigt

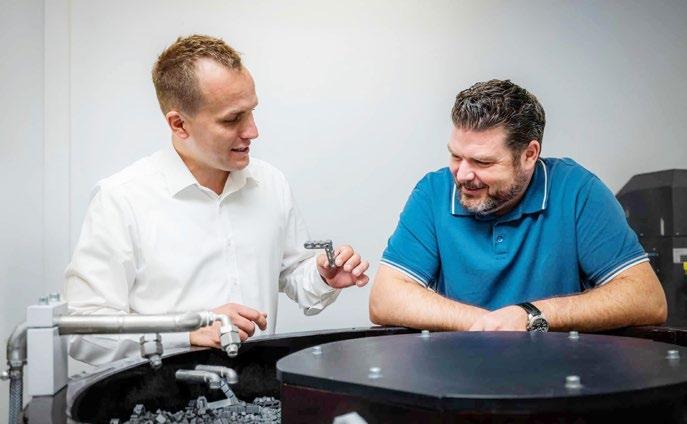
Rösler Schweiz AG)
werden, da die Gleitschliffprozesse in einem Raum mit einer nur 1,20 m breiten Tür im Untergeschoss durchgeführt werden.
Nach intensiven Gesprächen über das Projekt hat sich ESB für die Lösung der Rösler Schweiz AG entschieden. Sie besteht aus zwei Rundvibratoren R 220 Euro mit automatischer Separierung, deren Siebe einfach und werkzeuglos getauscht und so für verschiedene Teile eingesetzt werden können. Die Vibratoren sind durch ein Transportband mit dem Trockner RT 150 Euro DH verbunden. Er verfügt über ein Wärmeblock-Heizsystem, das mit der Bodenplatte des Arbeitsbehälters direkt gekoppelt ist und dadurch im Vergleich zu klassischen Trocknern Energieeinsparungen von bis zu 40% ermöglicht. Für die Kreislaufführung des Prozesswassers ist eine halbautomatische Zentrifuge Z 800
K-HA-TF in die Lösung integriert, deren Ausstattung auf die Materialvielfalt ausgelegt wurde.
«Ausschlaggebend bei der Entscheidung war, dass Rösler sehr detailliert auf unser Pflichtenheft eingegangen ist und uns ausführlich zu unseren speziellen Anforderungen beraten hat. So informierte uns der Rösler-Mitarbeiter genau darüber, was bei der Aufbereitung des durch verschiedene Metalle verunreinigten Prozesswassers zu beachten ist», erklärt Sascha Berger. Für die verschiedenen zu bearbeitenden Bauteile wurden im Customer Experience Center in Kirchleerau Versuche durchgeführt und anhand derer die jeweiligen Bearbeitungsparameter wie Einsatz der geeigneten Schleifkörper, Compound, Bearbeitungsintensität und -zeit definiert. «Während der Zusammenarbeit und der Versuche hat uns Rösler viel Know-how zum Gleitschleifen vermittelt. Dadurch wissen wir heute, was wir machen und

was es braucht, damit wir Ziele beim Gleitschleifen optimal erreichen», ergänzt Berger.
gesetzt wird. Es trocknet die Teile im Einmaldurchlauf, danach werden sie automatisch in ein vor dem Trockner platziertes Behältnis ausgegeben. Um eine Teilevermischung zuverlässig zu vermeiden, kann ein erneuter Separiervorgang für den Rundvibrator erst freigegeben werden, wenn das Behältnis entfernt wurde.
Im ersten Schritt wählt der Mitarbeitende das teilespezifische Bearbeitungsprogramm am Schaltschrank aus. Die Bedienung der Vibratoren erfolgt jeweils über eine Bediensäule mit drei Knöpfen für Start, die Freigabe der Separierung und einen ausserplanmässigen Stopp. Mit dem Druck auf den Startknopf beginnt der Arbeitsbehälter im sogenannten Belademo -
dus leicht zu vibrieren und wird befüllt. Nach einer festgelegten Zeit wechselt der Vibrator in den Bearbeitungsmodus und der Schallschutzdeckel wird durch eine Zweihandsteuerung an der Bediensäule geschlossen. Am Ende der Bearbeitungszeit fragt die Anlage ab, ob direkt separiert werden kann. Ist das der Fall, wird die Separierklappe pneumatisch aktiviert. Die Schleifkörper fallen durch das grossflächige Separiersieb zurück in den Arbeitsbehälter und die Teile gelangen über das Transportband zum Trockner, in dem ein Naturprodukt als Trocknungsmedium ein -
Über 50 % höhere Produktivität Im Vergleich zu den bisherigen Anlagen ermöglicht die neue Gleitschlifflösung deutlich kürzere Prozesszeiten und einen mindestens 50% höheren Durchsatz. Gleichzeitig konnte der Verbrauch an Frischwasser und Compound durch die Kreislaufführung des Prozesswassers spürbar reduziert werden. All dies trägt dazu bei, dass das Gleitschleifen wirtschaftlicher geworden ist. «Grundsätzlich steht bei uns der Mensch an erster Stelle und unseren Mitarbeitenden macht die Arbeit mit der neuen Anlage viel mehr Freude. Aber natürlich ist die Wirtschaftlichkeit auch ein Aspekt, auf den wir achten, und auch da haben wir einiges erreicht», merkt Sascha Berger abschliessend an.
Kontakt
Rösler Schweiz AG
Staffelbacherstrasse 189
CH-5054 Kirchleerau www.rosler.com n Die neue, automatisierte Gleitschlifflösung
Kistler hat die Softwarelösungen ComoNeo und AkvisIO optimiert und hebt


IMA Schelling Precision hat eine Präzisionsplattensäge aus der fk 8-Serie auf die speziellen Bedürfnisse der faigle Industrieplast GmbH abgestimmt. Anpassungen unter anderem am Druckbalkensystem und am Vorritzeraggregat sorgen nun im täglichen Betrieb für eine weitere Steigerung der Produktionsqualität und eine optimale Materialausnutzung.
Die faigle Industrieplast GmbH mit Sitz in Hard am Bodensee gehört zur faigle-Unternehmensgruppe und ist spezialisiert auf die Zerspanung von Kunststoffen. Bereits seit 1995 setzt die Gruppe auf die Technologie von IMA Schelling und nutzt die Präzisionsplattensägen aus der fk-Baureihe aktuell an zwei Standorten. «Die Sägen sind sehr stabil und präzise im Zuschnitt», lobt Tobias Wanner, Leiter der Produktion und Technik bei faigle Industrieplast. «Ausserdem möchten wir bei Sägen eine einheitliche Technologie im Hause haben.»
Ein Grund für die Wahl der neuen fk 8 war deren hohe maximale Paket- oder Plattendicke von 150 mm. Auf dieser Basis konzipierte IMA Schelling Precision eine massgeschneiderte Lösung, die alle Konfigurationswünsche des Kunden erfüllt. Eine wichtige Anpassung ist das überarbeitete Druckbalkensystem. Dieses ist zweigeteilt mit elektrischem Antrieb und besitzt eine Verschliesseinrichtung für die Ausnehmung der Klemmer. Das angepasste System ermöglicht es, Zuschnitte mit Kratzschnitten anzufertigen. Das spart Material, da ausser Spänen kein Abfall entsteht. Durch die genaue Dosierung der Anpresskraft eignet sich der

faigle Industrieplast verarbeitet auf der neuen fk8 eine Vielzahl technischer Thermoplaste.


Druckbalken auch gut zur Fixierung von druckempfindlichen Materialien.
Zahlreiche Verbesserungen für optimale Qualität
Ein weiteres Detail der verbesserten fk 8 ist das hochspringende Vorritzeraggregat. Diese Einheit ist mit einem Vorritzer-Sägeblatt ausgestattet und führt automatisch am Ende der Platte eine vertikale Bewegung von bis zu 70 mm nach oben aus. Dadurch kommt es beim Austritt des Sägeblatts an der Platte nicht mehr zu Ausrissen.
Die Sägeblätter lassen sich nun sofort nach dem Ausschalten der Maschine austauschen, da sie nach dem Motorstopp fixiert werden. Bisher mussten die Bediener etwa 30 bis 60 Sekunden warten, bis das Sägeblatt sich nicht mehr bewegt hat. Der Schnittspalt ist mit federbelasteten Kulissen verschlossen und öffnet sich nur, wenn das Sägeaggregat dort vorbeifährt. Das stellt sicher, dass während des Zuschnitts keine Säumlinge in die Maschine
fallen und unnötige Beschädigungen verursachen. Alle Verbesserungen tragen zu einer noch höheren Genauigkeit und Prozesssicherheit der angepassten fk 8 gegenüber dem Vorgängermodell bei. Die IMA Schelling Group entwickelt, konzipiert und produziert Maschinen und Anlagen für holz-, kunststoff- und metallverarbeitende Betriebe. Internationale Möbelhersteller zählen ebenso zu den Kunden wie Flugzeughersteller oder anspruchsvolle Tischlerei-Familienbetriebe. Auf Basis seiner über 100-jährigen Erfahrung entwickelt das Unternehmen innovative Bearbeitungslösungen für modernste vernetzte Produktionen, zugeschnitten auf individuelle Kundenansprüche – bis hin zu vollautomatisierten Losgrösse-1-Anlagen.
Kontakt
IMA Schelling Group D-32312 Lübbeck +49 5741 3310 info@imaschelling.com www.imaschelling.com n
Bring Plastic Back, das Sammelsystem von Haushaltkunststoffen, kann für das Jahr 2024 mit einer neuen Rekordsammelmenge aufwarten. Insgesamt wurden schweizweit 9090 Tonnen Haushaltkunststoffe dem Recycling zugeführt, das sind 1211 Tonnen mehr als im Jahr 2023. Das System Bring Plastic Back zählt heute über 600 mitmachende Sammelgemeinden.
Die Steigerung der Gesamtmenge um rund 15 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass die Sammlung von Haushaltkunststoffen im vergangenen Jahr in weiteren neuen Gemeinden und Städten eingeführt wurde. Das Sammelsystem Bring Plastic Back ist nun in über 600 Gemeinden, verteilt auf 17 Kantone, vertreten. Somit haben nahezu 2,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit, in ihrem Wohnort Haushaltkunststoffe mit Bring Plastic Back zu sammeln. Die Sammelsäcke können an total 1387 Verkaufsstellen erworben, und die gefüllten Säcke an insgesamt 674 Sammelstellen abgegeben werden.
Erfolgsgeschichte geht weiter
Als Leuchtturm darf der Kanton Bern erwähnt werden, wo seit dem Projektstart im Mai 2023 bereits über 200 von 335 Gemeinden für die Sammlung gewonnen werden konnten. Und die Erfolgsgeschichte rund um Bring Plastic Back geht 2025 in die nächste Runde. Nach einer umfassenden Evaluation hat der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden VSEG
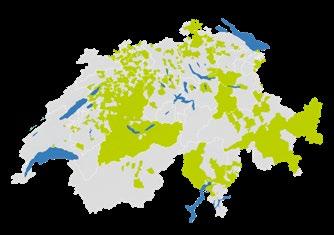
Über 600 Gemeinden unterstützen heute das Sammelsystem Bring Plastic Back.
das System mit marginaler Adaption übernommen und allen Solothurner Gemeinden zur Umsetzung empfohlen. Damit ist man dem Ziel einer flächendeckenden Lösung einen bedeutenden Schritt nähergekommen.
Kunststoff wiederverwertet statt vernichtet
Was mit der Sammelmenge von 9090 Tonnen Haushaltkunststoff eingespart werden kann, ist beachtlich. Die im letzten Jahr mit Bring Plastic Back gesammelten Kunststoffe ersetzten im stofflichen Recycling 4545 Tonnen Neumaterial, was 13 635 000 Liter Erdöl einsparte. Das daraus gewonnene Regranulat reicht zum Beispiel für die Herstellung von 3550 km Kabelschutzrohren.
Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wurden der Schweizer Zementindustrie als Ersatzbrennstoff (EBS) zugeführt und ersetzten über 4500 Tonnen Stein- oder Braunkohle.
CO2- Emissionen verhindert
Dank der Sammlung von Haushaltkunststoffen konnten wertvolle Ressourcen eingespart und Emissionen gesenkt werden, welche die Förderung von Erdöl, der Transport und die Herstellung von Neumaterial verursacht. Dies gilt auch für den Anteil, welcher der Zementindustrie als EBS zugeführt wird. Der Abbau fossiler Rohstoffe wird geschont und die hohen CO2-Emissionen beim Abbau und Transport von Stein- und Braunkohlen fallen weg. So konnten im Jahr 2024 insgesamt 25 725 Tonnen CO2 eingespart werden. Dies entspricht einer Autofahrt mit einem Mittelklassewagen von über 198 000 000 Kilometern oder 5000 Mal um die ganze Erdkugel.

Die Sammlung von Haushaltkunststoffen mit dem System Bring Plastic Back hat sich 2024 bei der Schweizer Bevölkerung weiter etabliert. (Bilder: InnoWay)
Das Sammelsystem ist nach den strengen Anforderungen des Verbands Schweizer Plastic Recycler (https://plasticrecycler. ch) zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet ein komplettes und regelmässiges Stofffluss-Monitoring nach der Methode der Eidgenössischen Materialprüfungsund Forschungsanstalt Empa. Dies garantiert, dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe gewonnen werden.
Kontakt InnoWay CH-8360 Eschlikon www.sammelsack.ch n

In einem durch die Innosuisse geförderten Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der ZHAW und der Kistler Instrumente AG ein selbstlernender Regelalgorithmus für die Heisskanal-Balancierung im Spritzgiessen entwickelt. Dieser wurde von der Firma Kistler im vergangenen Jahr als Standalone-Lösung umgesetzt und unter dem Namen ComoNeoMultiflow vorgestellt.
Jasper Hollender ¹
Prof. Dr. Juan Gruber 2
Martial Willimann 3
Für die Herstellung grosser Stückzahlen von Kunststoffbauteilen im Spritzgiessen werden Mehrkavitätenwerkzeuge mit Heisskanalverteiler eingesetzt. Der Heisskanal verhindert ein frühzeitiges Abkühlen der Kunststoffschmelze, wodurch die Zykluszeit minimiert, der Angussabfall reduziert und die Bauteilqualität verbessert wird. Der Kunststoff (gelb) wird über den Heisskanal in das Werkzeug eingespritzt (Bild 2). In diesem Beispiel werden zur Vereinfachung drei Teile produziert, während in der Praxis bis zu 128 möglich sind. Jedes Bauteil ist dabei mit einem Werkzeuginnendrucksensor ausgestattet. Eine gleichmässige Füllung aller Kavitäten ist essenziell für eine hohe Bauteilqualität aller Bauteile. Allerdings können in der Praxis z. B. unterschiedliche Scherraten im Werkzeug auftreten, die die Viskosität des Kunststoffs beeinflussen und dadurch zu einer ungleichmässigen Füllung führen. Die Temperatur und somit auch die Viskosität des Kunststoffs können durch aktive elektrische Heizbänder (rot) des Heisskanals im Optimalfall so verändert werden, dass sich alle Kavitäten gleichmässig füllen. Die Regelung erfolgt entweder über einen in die Spritzgiessmaschine integrierten oder über einen externen Heisskanalregler.
1 Jasper Hollender, Fachbereichsleiter Spritzgiessen, IWK
2 Prof. Dr. Juan Gruber, Institute of Embedded Systems (InES), ZHAW
3 Martial Willimann, Product Manager Plastics Systeme, Kistler Instrumente AG


In der Praxis ist eine gleichmässige Füllung jedoch nur schwer einstellbar und muss über die Produktionsdauer mehrmals korrigiert werden. Vor der Produktion werden in mehreren Versuchen die Temperatur der verschiedenen Heizzonen für ein optimales Ergebnis eingestellt. Die Inbetriebnahme von Mehrkavitätenwerkzeugen ist dabei äusserst aufwendig. Bei jeder Änderung des Setups aus Maschine, Werkzeug, Heisskanalregler, Material oder Materialcharge erfordert dies einen hohen Aufwand für die erneute Optimierung. Während der Produktion kann sich der Prozess zudem durch sich ändernde Umgebungsbedingungen (Hallentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Materialchargenschwankungen) sowie durch Anpassungen am Werkzeug oder Heisskanalregler verändern. Abhilfe schafft ein Regelalgorithmus, der einerseits bei der Bemusterung unterstützt
und anderseits während der Produktion eine gleichmässige Füllung kontinuierlich überwacht und im vorher definierten Temperaturbereich automatisch kompensiert. Eine besondere Herausforderung für die zu entwickelnde Regelung ist die Vielzahl der Kombinationen aus verschiedenen Komponenten, die je nach Setup variieren. Faktoren wie Maschine, Werkzeug, Material, Heisskanalregler und Prozessparameter haben einen grossen Einfluss auf die Regelstrecke. Um diese Vielfalt an Kombinationen sowie auftretende Schwankungen zuverlässig abzudecken, wird ein selbstlernender, adaptiver Regelalgorithmus für den Spritzgiessprozess benötigt.
Heisskanalbalancierung über den Werkzeuginnendruck
Das Ziel der Heisskanalbalancierung ist es, in allen Kavitäten identische Füll- und Druckverhältnisse zu erreichen. Als Regel -
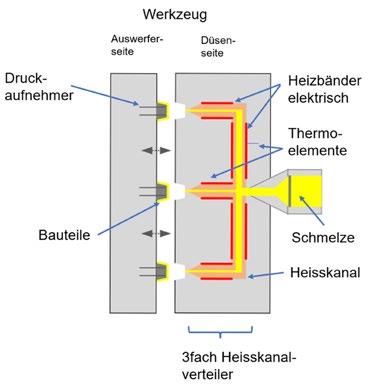
Bild 2: Vereinfachte Darstellung eines 3fach-Werkzeuges mit Heisskanalsystem (Grafiken: IWK)
grössen dienen die Verläufe des Werkzeuginnendrucks in den einzelnen Kavitäten, während die Temperatur der Heisskanaldüse als Stellgrösse fungiert.
Der Algorithmus minimiert die Zeitdifferenz zwischen den Werkzeuginnendruckkurven der Kavitäten durch die Anpassung der Düsentemperaturen auf ein einstellbares Minimum (t1 = t2). Bild 3 zeigt eine beispielhafte Regelung:
– Links: Die blauen und orangefarbenen Druckkurven sind zeitlich versetzt, was auf eine ungleichmässige Füllung der Kavitäten hinweist.
– Um die Füllung zu synchronisieren, wird die Temperatur in Kavität 2 (orange) erhöht.
– Rechts: Die Kavitäten füllen sich nun gleichmässiger, was zu einer stabileren Prozessführung und besseren Bauteilqualität führt.
Versuche und Prototyp im Labor des IWK
Zur Entwicklung und Erprobung des Prototyps wurden umfangreiche Versuche im Labor des IWK in Rapperswil durchgeführt. Die eingesetzten Spritzgiessmaschinen und Heisskanalregler ermöglichten die Aufzeichnung von Prozessdaten und Stellgrössen. Zudem ist die Maschine zur Aufzeichnung der Werkzeuginnendruckkurven mit einem ComoNeo des Industriepartners Kistler ausgestattet.
Der Prototyp des Heisskanalbalancierungs-Algorithmus wurde in MATLAB implementiert und greift via ComoNeo auf die neuen Werkzeuginnendruckkurven jedes Zyklus zu. Der BalancierungsAlgorithmus berechnet daraufhin die optimalen Soll-Temperaturen und übermittelt diese an den Heisskanalregler, der die Anpassung vornimmt.
Eine Übersicht über den Regelkreis ist in Bild 4 dargestellt. Die als «Blackbox» gekennzeichnete innere Regelstrecke – sie umfasst den Temperaturregler und das Werkzeug selbst – kann nicht durch den Algorithmus verändert werden.
Dieser Aufbau vor Ort erlaubte eine flexible Entwicklung des Algorithmus in der Laborumgebung durch die OST und ZHAW.
Besuchen Sie uns! Stand 20-D30 13.-15. Mai 2025

Die METRO G Reihe bietet Ihnen mit dem modularen Baukastensystem eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, egal ob einfach oder hochkomplex.
www.motan-group.com



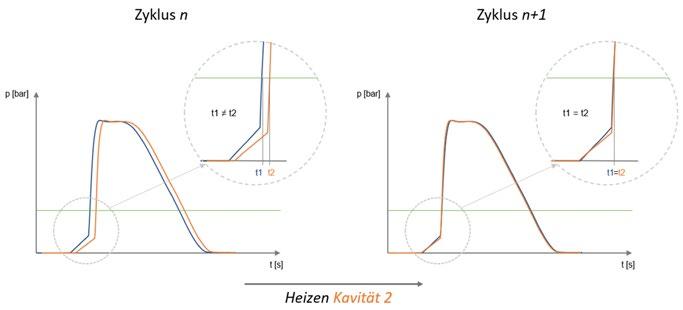
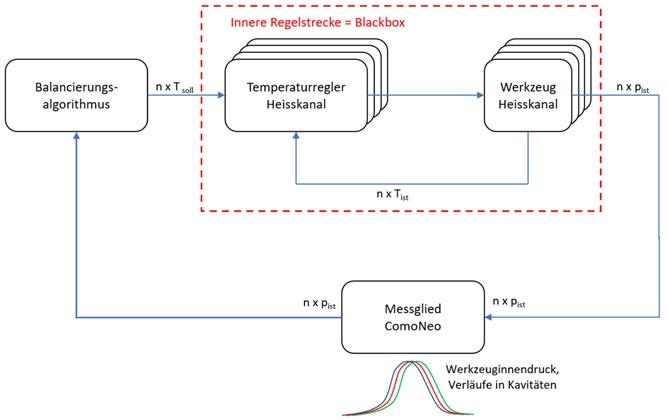
Um die Stabilität des entwickelten Balancierungs-Algorithmus zu testen, wurde dieser in unterschiedlichen Kombinationen aus Spritzgiessmaschine, Heisskanalregler, Werkzeugen und Materialien verwendet.
Insgesamt wurden in den finalen Tests sechs unterschiedliche Materialien eingesetzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich diese besonders in der Bandbreite des Temperaturbereichs sowie hinsichtlich ihres Temperaturniveaus unterscheiden.
Regelprinzip
Die klassischen Regelprinzipien, wie beispielsweise die Auslegung als PID-Regler,

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde der Regler als sogenannter Fuzzy-Regler ausgelegt. Die Fuzzy-Regelung ist eine Methode zur Steuerung oder Regelung von Systemen, bei denen die Eingangs- und/oder Ausgangsgrössen unscharf oder vage definiert sind. Im Gegensatz zur klassischen Regelungstechnik, die auf exakten mathematischen Modellen und festen Regeln basiert, ermöglicht die Fuzzy-Regelung die Verarbeitung unsicherer oder variabler Informationen, die sich unvorhersehbar ändern können.
In Verbindung mit dem Heisskanalbalancierungs-Algorithmus wird die Regelung durch selbstlernende Parameter ergänzt. Dadurch verbessert sich das System von Zyklus zu Zyklus und passt sich dynamisch an das jeweilige Setup und den spezifischen Spritzgiessprozess an.
sind für die vorliegende Anwendung aufgrund der zyklusübergreifenden Regelung und des adaptiven Charakters, bedingt durch die Vielzahl möglicher Setups aus Maschine, Material, Heisskanalregler und Werkzeug, nicht zuverlässig. Aufgrund dieser Kombinationen und der inneren Regelstrecke ist es schwierig, ein Modell zu entwickeln, das allgemeingültig für unterschiedliche Prozesse eingesetzt werden kann. Ansätze wie ein Zustandsregler mit Luenberg-Beobachter oder eine modellprädiktive Regelung scheiden daher ebenfalls aus. Nach eingehender Untersuchung dieser Methoden wurden sie im Projekt verworfen.
Funktion und Ergebnisse des selbstlernenden
Zur Einrichtung des Algorithmus nimmt der Bediener im User-Interface einige Grundeinstellungen vor. Dabei müssen die Heisskanaldüsen den jeweiligen Kavitäten und somit Drucksensoren zugewiesen werden. Ausserdem müssen die gewünschten Temperaturgrenzen des verwendeten Kunststoffs eingegeben werden. Sämtliche weiteren Parameter werden vom Algorithmus selbständig ermittelt bzw. erlernt, können jedoch bei Bedarf vom Bediener überschrieben werden. Es gibt sowohl global bestimmte selbstlernende Parameter als auch eine Vielzahl von Parametern, die individuell für jede Kavität festgelegt werden.
Der selbstlernende Regler kann sich innerhalb von fünf Zyklen pro Kavität auf ein neues Werkzeug einlernen. Der Algorithmus wurde als Zustandsmaschine entwickelt und hat die drei Zustände: Lernen, Regeln und Halten, die automatisch durch den Algorithmus festgelegt werden. In den durchgeführten Tests konnte der Heisskanalbalancierungs-Algorithmus erfolgreich für die automatisierte Balancierung von Mehrkavitätenwerkzeugen eingesetzt werden. In Bild 5 ist ein Beispiel für ein Werkzeug mit vier Kavitäten dargestellt, bei dem der ursprüngliche Füllunterschied bei gleichen Heisskanaltemperaturen von 0,385s auf unter 0,002s durch die Multiflow-Regelung reduziert wurde.

Umsetzung der innovativen Lösung
Die im Rahmen des Innosuisse-Projekts entwickelte Lösung wurde in die Firmware des Prozessüberwachungssystems ComoNeo integriert und erfolgreich getestet. Neben der grundsätzlichen Funktion konnte die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und vereinfachte Anwendbarkeit des selbstlernenden Regelalgorithmus sichergestellt werden. Auf dem Rapperswiler Kunststoff-Forum 2024 sowie auf der Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung (Fakuma) wurde das finale Produkt erstmals von der Firma Kistler präsentiert.
Kontakt
IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung OST Ostschweizer Fachhochschule Jasper Hollender CH-8640 Rapperswil-Jona jasper.hollender@ost.ch www.ost.ch/iwk n





Die K 2025, die Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie, hat es sich zur Aufgabe gemacht, vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf zentrale Herausforderungen unserer Zeit aufzugreifen und konkrete Lösungen zu präsentieren. Dies spiegeln auch ihre Leitthemen wider. Eines davon lautet «Embracing Digitalisation».
Die fortschreitende Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, effizienter und nachhaltiger zu produzieren. Einen Hinweis auf den zunehmenden Digitalisierungsgrad gibt der Digitalisierungsindex 2024 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), wonach die deutsche Wirtschaft in den letzten fünf Jahren um rund 14 Prozent digitaler geworden ist. Besonders stark gestiegen ist die Kategorie «Prozesse», die sowohl den digitalen Reifegrad der unternehmensinternen Abläufe als auch die Vernetzung mit externen Partnern abbildet.
Künstliche Intelligenz (KI) gilt dabei als entscheidender Meilenstein. Laut einer Bitkom-Studie sehen 78 Prozent der befragten Industrieunternehmen KI als entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit an, während mehr als die Hälfte zunächst die Erfahrungen anderer abwartet. Gleichzeitig fehlen 48 Prozent die notwendigen KI-Kompetenzen und 91 Prozent fordern weniger regulatorische Hürden, um KI-Innovationen nicht auszubremsen.
«Im Kunststoffmaschinenbau wird schon seit über 40 Jahren automatisiert. Jetzt gehen fast alle den Schritt weiter und setzen auf Digitalisierung», sagt Ulrich Reifenhäuser, Vorsitzender des Ausstellerbeirats der K in Düsseldorf. Cyber-Physische Systeme (CPS) und das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen es, Produktionsdaten lückenlos zu erfassen und in Echtzeit auszuwerten. Sensoren überwachen zum Beispiel Temperatur, Durchfluss oder Werkzeuginnendrücke und leiten die Werte an Cloud-Anwendungen weiter. Ein wichtiger Kommunikationsstandard ist dabei OPC UA, der einen sicheren und herstellerübergreifenden Datenaustausch ermöglicht.


Künstliche Intelligenz steigert die Effizienz der Kunststoffindustrie. (Bilder: Messe Düsseldorf)
Die steigende Datenmenge führt zu Fragen der Datennutzung. Laut der Industrieverbände hat der sogenannte EU Data Act hierzu mittlerweile Klarheit geschaffen. Das neue Datengesetz verpflichtet die Maschinenhersteller, die im Betrieb anfallenden Daten dem Nutzer der Maschine auf einfache und verständliche Art maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig rückt die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) in den Fokus, denn durch Echtzeitanalysen können Abweichungen frühzeitig erkannt und ungeplante Stillstände reduziert werden.
KI verleiht digitalen Prozessen eine neue Dynamik, indem selbstlernende Algorithmen grosse Datenmengen analysieren und Prozesse flexibel optimieren. «KI und Digitalisierung sind ein Game-Changer für die Kreislaufführung von Kunststoffen. Voll-
automatisierte Produktionsprozesse, digitale Produktpässe und Simulationen ermöglichen optimierte Arbeitsabläufe und helfen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Ressourcen einzusparen», sagt Dr. Alexander Kronimus, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von PlasticsEurope Deutschland. Maschinelles Lernen beschleunigt darüber hinaus Entwicklungszyklen und verbessert die Prozesssteuerung. Digitale Zwillinge gehen noch einen Schritt weiter: Sie bilden reale Produktionslinien virtuell ab und liefern strukturierte Informationen über die gesamte Maschinenauslastung. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, Maschinendaten und Informationen strukturiert und maschinenlesbar über die gesamte Lebensdauer abzuspeichern. Digitale Zwillinge sollen sich auch für die Anforderungen des Digitalen Produktpasses (DPP) eignen, der mit der im Juli 2024 in Kraft getretenen Ökodesign-Verordnung der EU

Digitalisierung ist ein Leitthema an der K 2025.
(ESPR) eingeführt wurde. Diese virtuellen Abbilder realer Produktionsanlagen beschleunigen Entwicklungsphasen und erleichtern Wartungsstrategien.
Im Bereich der Qualitätssicherung unterstützen Kamerasysteme und KI-basierte Bildverarbeitung die Produktionsprozesse. Sie erkennen Formabweichungen, Oberflächenfehler oder Materialverunreinigungen während der Herstellung und sorgen für ein konsistentes Qualitätsniveau. Diese Technologien ermöglichen eine frühzeitige Fehlererkennung, wodurch Ausschuss reduziert und Ressourcen effizienter genutzt werden.
Im Zuge verschärfter Umweltauflagen und wachsender Kundenansprüche rückt ebenso die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen in den Mittelpunkt. KI-gestützte Sortiersysteme mit Nahinfrarot-Sensorik (NIR) identifizieren verschiedene Kunststoffarten, trennen hochwertige Rezyklate von Verunreinigungen und verbessern die Recyclingqualität.
Digitale Systeme sind zudem eng mit dem DPP verknüpft, der umfassende Informationen über verwendete Rohstoffe, Produktionsprozesse und Recyclingwege liefert.
Diese Technologien unterstützen Unternehmen dabei, geschlossene Material -
kreisläufe zu etablieren, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Anforderungen der ESPR zu erfüllen.
«Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben noch nicht hinreichend in die Digitalisierung investiert, da dies mit erheblichen Kosten verbunden ist und eine spezifische Kompetenz voraussetzt», berichtet Mauritius Schmitz vom Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV). Doch die Digitalisierung erweist sich als Katalysator für eine nachhaltigere und effizientere Kunststoffindustrie. Welch enormes Potenzial die Digitalisierung für die Kunststoffbranche bietet wird auf der K 2025 sowohl an den über 3000 Ausstellerstände zu sehen sein, als auch in den verschiedenen Specials aufgezeigt, die gleichermassen die Herausforderungen diskutieren, allen voran die offizielle Sonderschau der K «Plastics Shape the Future», organisiert von Plastics Europe Deutschland oder auch das VDMA Forum.
Kontakt
Messe Düsseldorf GmbH D-40474 Düsseldorf
+49 211 4560-01
www.k-online.de n



Der offizielle Monitoringbericht bestätigt: Das Rücknahmesystem für Agrarkunststoffe von ERDE Schweiz sammelte im Jahr 2024 rund 2500 Tonnen Agrarkunststoffe. Damit stieg die Menge gegenüber dem Vorjahr (2200 Tonnen) um fast 15%.
Debora
Rondinelli
Silagestretchfolien, Siloflachfolien, Unterziehfolien oder auch Pressengarne – in der Landwirtschaft kommen Jahr für Jahr grosse Mengen an Kunststoffprodukten zum Einsatz und enden oft als Abfall. Um die Umwelt zu schonen, wurde das freiwillige Rücknahmesystem ERDE Schweiz ins Leben gerufen. Hersteller, Landwirte und Sammelstellenbetreiber übernehmen gemeinsam Verantwortung und sorgen dafür, dass Erntekunststoffe über stoffliche Verwertung erfolgreich in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden, um Rohstoffe zu erhalten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Im dritten Sammeljahr konnte ERDE Schweiz die Sammelmenge erneut erhöhen: Rund 2500 Tonnen Agrarkunststoffe wurden gesammelt und Silo- sowie Stretch folien dem Recycling zugeführt. Erstmals wurden auch Pressengarne in das Rücknahmesystem integriert. Zudem konnte das Sammelstellennetz weiter ausgebaut werden, insbesondere in der Westschweiz und im Tessin. Mittlerweile beteiligen sich mehr als 120 Sammelstellen an


Anlieferung der Folien bei der Sammelstelle
der Initiative, indem sie gebrauchte Erntekunststoffe sammeln.
«Damit die Sammlung von Erntekunststoffen gut funktioniert, braucht es genug Sammelstellen. Es ist erfreulich zu sehen, wie das Netz wächst und alle Beteiligten Verantwortung übernehmen, um die Rohstoffe im Kreislauf zu halten», erklärt Riccardo Casanova, Geschäftsführer von ERDE Schweiz, der an der Mitgliederversammlung am 30. Oktober 2024 diese Position neu übernommen hat.
Das Sammelstellennetz wird in Zusammenarbeit mit dem Systembetreiber RIGK kontinuierlich ausgebaut. Wenn die nächste Sammelstelle weit weg ist, besteht die Möglichkeit selbst eine Sammelstelle zu eröffnen (permanent oder mit einzelnen Sammeltagen im Jahr). So können auch die
Betriebe in der Umgebung von einer kürzeren Distanz profitieren. Die Landwirtschaftsbetriebe können hier selbst aktiv werden. Die gebrauchten Folien werden in der Schweiz und in weiteren zertifizierten Verwertungsanlagen in der EU recycelt. Unabhängige Prüfer bestätigen die Sammlung und das Recycling und erstellen einen Bericht, der die Verwertung zertifiziert. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei ERDE Schweiz schliesst den Wertstoffkreislauf, schont die Ressourcen und schützt die Umwelt.
In der Schweiz werden aktuell nur ca. ein Drittel der gebrauchten Silofolien recycelt. Das Potenzial ist folglich noch gross, wirtschaftlich wie umwelttechnisch. Gebrauchte Agrarkunststoffe zu sammeln und zu recyceln, macht einen Unterschied!
Weitere Informationen über ERDE Schweiz ERDE Schweiz ist ein Rücknahme- und Recyclingsystem für Siloballenfolien, Netze und Garne in der Schweiz, das aktiv zu nachhaltiger Agrarwirtschaft in der Futtermittelproduktion und im Obst- und Gemüseanbau beiträgt. Der unabhängige Verein ERDE Schweiz – assoziiertes Mitglied des Dachverbands der Schweizer Kunststoffindustrie KUNSTSTOFF.swiss – ist zusammengesetzt aus Herstellern, Händlern, Entsorgern und Partnerverbänden.
www.erde-schweiz.ch

Entdecken Sie die neuesten Veranstaltungen von KUNSTSTOFF.swiss und bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserer ständig aktualisierten Agenda auf www.kunststoff.swiss/events
Veranstaltung
KOPAS – Einführungskurs: Praxisnaher Einführungskurs der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für die Verantwortlichen im Betrieb mit Bruno Albrecht und Alex Mühlemann mit vielen Übungen an Maschinen, Rollenspielen und Erfahrungsaustausch. 08.04.25
ER FA-Tagung Rapperswil: Ausbildung und Erfahrungsaustausch für Kontaktpersonen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Sicherheitsbeauftragte zu den Themen Stress und Burnout, Rechte und Pflichten der KOPAS und dem Safety Day. Ergänzt durch praxisnahe Workshops und Austauschmöglichkeiten. Zertifiziert mit 2 Fortbildungseinheiten (FBE). 29.04.25
Impuls-Treff St. Gallen: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.
Impuls-Treff Zürich: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends. 05.06.25
Mitgliederversammlung 2025 im Lindt Home of Chocolate: Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm im grössten Schokoladenmuseum der Schweiz. Seien Sie dabei, um mitzubestimmen und wertvolle Kontakte zu knüpfen!
25.06.25
Impuls-Treff Luzern: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.
Berufsbildungstagung in Aarau: Die Tagung bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen in der Berufsbildung auszutauschen
26.08.25
28.08.25
ER FA-Tagung in Olten: Ausbildung und Erfahrungsaustausch für Kontaktpersonen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Sicherheitsbeauftragte zu den Themen Stress und Burnout, Rechte und Pflichten der KOPAS und dem Safety Day. Ergänzt durch praxisnahe Workshops und Austauschmöglichkeiten. Zertifiziert mit 2 Fortbildungseinheiten (FBE). 11.09.25
Impuls-Treff Schaffhausen: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.
17.09.25
Abschlussfeier 2025 in Cham: Auch dieses Jahr feiern wir unsere Absolventinnen und Absolventen und zeichnen die Besten aus. 01.07.25
Impuls-Treff Aargau: Mit dem Impulsreferat «Aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik» beleuchten Experten der Schweizerischen Nationalbank wirtschaftspolitische Themen wie Zinsentwicklungen, Wechselkurse sowie nationale und internationale Konjunkturtrends.
Kontakt Kunststoff.swiss
Debora Rondinelli CH-5000 Aarau +41 62 834 00 65 d.rondinelli@kunststoff.swiss www.kunststoff.swiss n


Forschende am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP haben eine Folie entwickelt, die durch Wärme zu einem Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) aufschäumt – und das ganz ohne gesundheitliche Risiken: Die Folie ermöglicht es, isocyanatfrei zu schäumen und verbessert so die Arbeitssicherheit. Das Material kann für verschiedene Anwendungen angepasst werden, die sich von der Automobil- und Bauindustrie bis zur Verpackungswirtschaft erstrecken.
die Formteilqualität
die Formteilqualität
die Formteilqualität Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten
Sie minimiert gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz und verbessert die Arbeitssicherheit, insbesondere bei Anwendungen vor Ort, wie beispielsweise in der Bauindustrie», betont Pretsch.
Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten
Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten die Formteilqualität
«Ein häufig diskutierter Aspekt bei der Herstellung von PU-Schaum ist das Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz durch Isocyanate, einer der Hauptbestandteile in der chemischen Reaktion zur Bildung von Polyurethan», erläutert Dr. Thorsten Pretsch, Leiter des Forschungsbereichs Syntheseund Polymertechnik am Fraunhofer IAP im Potsdam Science Park. «Unsere Folie ermöglicht es, isocyanatfrei zu schäumen.
Für den Umgang mit Isocyanaten gelten strenge Regelungen und Schutzmassnahmen. Sie sind toxisch und wirken sensibilisierend auf die Atemwege sowie auf die Haut; einige Isocyanate stehen in Ver-
Kühlen und Temperieren mit System Energiekosten
dacht, Krebs zu erzeugen. Die neu entwickelte Folie formt sich allein durch Wärmezufuhr in einen PU-Schaumstoff um, ohne chemisch zu reagieren. Der innovative Ansatz des Forschungsteams bedeutet zugleich eine neue Technologie für die Schaumherstellung selbst: das thermische Schäumen. Das Produkt trägt den Namen FOIM – eine Kombination aus den Worten Foil (Folie) und Foam (Schaum).
Herbold Meckesheim – Spezialist für Maschinen und Anlagen zum Kunststoffrecycling
Systeme für die Kunststoffindustrie Produkte und Lösungen
Brehm - Ihr Peripherie Spezialist -
•Energieeffizienz
•Produktivitätssteigerung
•Wirtschaftlichkeit
•Nachhaltigkeit
• von der Planung bis zur Ausführung – alles aus einer Hand
• Qualität und Kundenfreundlichkeit sind unser Erfolgsrezept
•Unsere Ruhe schafft Freiraum für das Wesentliche
Herbold Meckesheim GmbH
•Flexibilität durch unser grosses Ersatzteillager
Industriestrasse 33 D-74909 Meckesheim
Verfahrenslösungen für die Aufbereitung von Kunststoffabfällen


Die neuartige Folie schäumt durch Wärme zu einem Polyurethan-Schaum auf. Dabei werden keine Isocyanate freigesetzt. (Bild: Fraunhofer IAP, Jadwiga Galties)
Das neuartige Material ist ein Formgedächtnispolymer, d.h. es ist imstande, in seine ursprüngliche Form zurückzukehren, nachdem es verformt wurde. Ein äusserer Reiz wie beispielsweise Wärme löst den Formgedächtniseffekt aus. Für die Folie haben die Forschenden einen Polyurethan-Schaum synthetisiert und anschliessend verdichtet. Bei der Temperatur von 60 Grad Celsius dehnt sich die Folie von 2,5 Millimetern Dicke zu einem Schaum mit 40 Millimetern Höhe aus – eine Expansion um den Faktor 16. Das Ergebnis ist ein weich-elastischer PU-Schaum mit der Dichte von 80 Kilogramm pro Kubikmeter. Gemäss der Norm DIN EN ISO 33 861 handelt es sich um einen Schaum mit niedriger Dichte, der sich unter anderem als Verpackungsmaterial eignet. Die industrielle Produktion nutzt Polyurethanschäume häufig als standardisiertes, vorgefertigtes Zwischenprodukt in zugeschnittener Form. Im Fertigungsprozess werden diese sogenannten Halbzeuge weiterverarbeitet oder direkt in Endprodukte integriert. Sie ermöglichen die Massenproduktion bei gleichbleibender Qualität. Ihr Manko: Polyurethanschäume nehmen viel Volumen ein. «Unsere Folie spart Platz bei dem Transport und bei der Lagerung», betont Pretsch. Erst durch das Erwärmen auf 60 Grad Celsius schäumt die Folie auf.
PU-Schäume mit niedriger Dichte sind für zahlreiche Anwendungsfelder und Branchen geeignet: Möbelhersteller nutzen sie für Polster, in der Verpackungsindustrie schützen sie zerbrechliche Waren beim Transport, im Bauwesen hinterfüllen PUSchäume Fugen, in Fahrzeuginnenräumen
dienen sie der Dämmung oder Verkleidung. Anwendungsversuche zum Füllen von Hohlraumstrukturen mit der neuartigen Folie waren erfolgreich. Komplexe geometrische Formen schäumte das Material nach dem Erwärmen nahezu vollständig aus. Zudem eignet sich die Folie für die Verbindungs- und Fügetechnik. Die Forschenden konnten zeigen, dass sich zwei Objekte durch das Ausschäumen eines zwischen ihnen liegenden Hohlraums fixieren lassen. Wie flexibel oder
wie transparent die Folie vor dem Aufschäumen ist, können die Wissenschaftler individuell einstellen. Ebenso die Dichte, die Wärmeleitfähigkeit, die Elastizität oder die Kompressionseigenschaften des Schaums.
Kontakt
Fraunhofer IAP
D-14476 Potsdam +49 331 568-1000 www.iap.fraunhofer.de n
Wir maximieren Ihre


Ein internationales Forschungsteam hat unter Mitwirkung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden (TUD) ein zweidimensionales leitendes Polymer entwickelt. Eine spezielle, geordnete Form von Polyanilin (2DPANI) weist eine aussergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit und ein metallisches Ladungstransportverhalten auf. Die Entdeckung ist ein grundlegender Durchbruch in der Polymerforschung.
Leitende Polymere wie Polyanilin, Polythiophen und Polypyrrol sind für ihre hervorragende elektrische Leitfähigkeit bekannt und haben sich als vielversprechende kostengünstige, leichte und flexible Alternativen zu herkömmlichen Halbleitern und Metallen erwiesen. Die Bedeutung dieser Materialien wurde im Jahr 2000 durch die Verleihung des Nobelpreises für Chemie an Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid und Hideki Shirakawa für ihre bahnbrechende Entdeckung und Entwicklung leitfähiger Polymere unterstrichen.
Trotz bedeutender Fortschritte leiten diese Materialien Elektronen hauptsächlich entlang ihrer Polymerketten. Die Leitfähigkeit zwischen den Polymersträngen oder -schichten bleibt jedoch begrenzt, da die Moleküle nicht gut miteinander verbunden und die elektronischen Wechselwirkungen schwach sind.
Um dieses Problem zu lösen, hat ein Forschungsteam der TUD und des MaxPlanck-Instituts für Mikrostrukturphysik Halle in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern einen mehrschichtigen zweidimensionalen Polyanilin-Kristall (2DPANI) synthetisiert und charakterisiert.
«Dieses Material weist eine aussergewöhnliche Leitfähigkeit auf – nicht nur innerhalb seiner Ebenen, sondern auch senkrecht über die Schichten hinweg. Das nennen wir einen metallischen out-of-plane Ladungstransport oder auch 3D-Leitung. Das ist ein grundlegender Durchbruch in der Polymerforschung», erklärt Thomas Heine, Professor für Theoretische Chemie an der TU Dresden. Gemeinsam mit seinem Team an der TUD und dem Center for Advanced Systems Understanding CASUS in

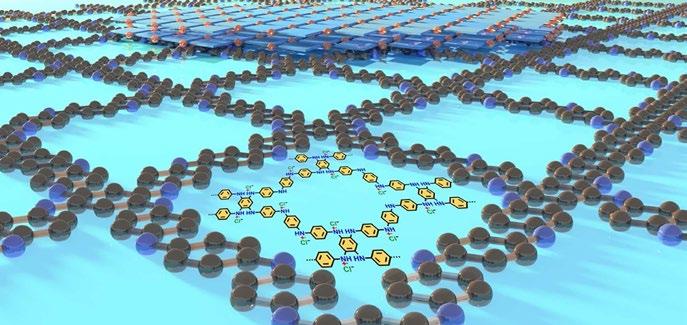
Schematische Darstellung des Verfahrens zur Synthese von 2DPANI auf der Wasseroberfläche. (Bild: TUD)
Görlitz hat er die Struktur des Polymers zunächst simuliert und den metallischen Charakter berechnet.
Xinliang Feng und sein Team am Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed) der TUD und am Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle synthetisierten das neue Polymer und führten Gleichstromtransportstudien durch. Diese Messungen zeigen eine anisotrope Leitfähigkeit mit 16 S/cm in der Ebene und 7 S/cm ausserhalb der Ebene – etwa drei Grössenordnungen höher als bei herkömmlichen linear leitenden Polymeren. Darüber hinaus zeigen Messungen bei niedrigen Temperaturen, dass die Leitfähigkeit ausserhalb der Ebene mit abnehmender Temperatur zunimmt – ein charakteristisches Verhalten von Metallen – was die aussergewöhnlichen metallischen elektrischen out-of-plane Transporteigenschaften des Materials bestätigt. Weitere Messungen wurden am CIC Nano-Gune in San Sebastián, Spanien, mittels Infrarot- und Terahertz-Nahfeldmikrosko -
pie durchgeführt. Diese ergaben eine Gleichstromleitfähigkeit von etwa 200 S/cm. Dieser Durchbruch eröffnet die Möglichkeit, dreidimensionale metallische Leitfähigkeit in metallfreien organischen und polymeren Materialien zu erreichen. Damit bieten sich neue Perspektiven für Anwendungen in der Elektronik, der elektromagnetischen Abschirmung oder der Sensorik. Das metallische Polymer könnte als funktionelle Elektrode in der Elektro- und Photoelektrochemie dienen, z.B. zur Produktion von Wasserstoff.
Kontakt
Prof. Thomas Heine
Professur für Theoretische Chemie
+49 351 463-37637 thomas.heine@tu-dresden.de
Prof. Xinliang Feng
Professur für Molekulare Funktionsmaterialien
+49 351 463-43251
xinliang.feng@tu-dresden.de www.tu-dresden.de n
Junge chinesische Automobilmarken erhöhen zunehmend den Wettbewerbsdruck auf die etablierten europäischen Hersteller. Sie kombinieren hohe Stückzahlen mit starken Gewinnmargen – und das bei deutlich geringeren Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die Studie «When Less Is More: Shifting Gears in Automotive R&D» der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company zeigt, wie etablierte Hersteller wettbewerbsfähig bleiben.
Die durchschnittlichen Entwicklungskosten pro Fahrzeug (Full Vehicle Equivalent, FVE) lagen der Studie zufolge bei einigen der führenden chinesischen Automobilhersteller im Zeitraum von 2020 bis 2024 bei nur 27 Prozent der Kosten der fünf grössten deutschen Hersteller. Zudem geben letztere in Summe deutlich mehr aus. Ein zentraler Grund dafür ist die ausgeprägte Modellvielfalt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten brachten europäische Hersteller wesentlich mehr verschiedene Fahrzeugmodelle auf den Markt als ihre asiatischen Wettbewerber. Zwei führende europäische Marken beispielsweise haben ihr Modellportfolio seit dem Jahr 2000 um 250 Prozent vergrössert. «Innovationen aus Forschung und Entwicklung bestimmen, wie attraktiv künftige Fahrzeuge sein werden. Gleichzeitig sind sie mit sehr hohen Investitionen verbunden», erklärt Bain-Partner Dr. Eric Zayer, Leiter der Praxisgruppe Automotive und Mobilität und Co-Autor der Studie. «Daher wird es entscheidend sein, die Effizienz der F&E-Ausgaben zu steigern und sich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren.»
Entwicklungszeiten
Europäische Automobilhersteller benötigen derzeit durchschnittlich 48 bis 54 Monate für die Entwicklung neuer Modelle. Ihre aufstrebenden Wettbewerber hingegen kommen oft mit nur 24 bis 30 Monaten aus. «Um diesen Abstand zu verringern und einen Schritt vorauszubleiben, müssen etablierte Hersteller ihre Modell- und Variantenvielfalt reduzieren sowie die Produktentwicklungszeiten spürbar verkürzen», so Zayer. «Dazu sind zentrale Prozesse stärker zu parallelisieren, KI-gestützte

Europäische Automobilhersteller müssen Entwicklungszeit verkürzen. (Bild: adpic.de)
Tools zu nutzen und einzelne Entwicklungsschritte zu automatisieren.» Möglichkeiten hierfür eröffnen sich bereits heute in Bereichen wie der Dokumentation von Softwarecode oder der Qualitätsprüfung von Konstruktionszeichnungen. Zudem helfen digitale Zwillinge und simulationsgestützte Testverfahren, den Bedarf an Tests mit physischen Prototypen zu reduzieren.
Laut der Studie sollten etablierte Automobilhersteller gezielt in Innovationen und Fähigkeiten investieren, die ihnen bislang intern fehlen. Künftige Kernkompetenzen werden unter anderem Batterietechnologie, Energiemanagementsysteme, softwaregesteuerte Funktionen wie Fahrerassistenzsysteme (FAS), Datenmanagement und Infotainment sein. Vor diesem Hintergrund gilt es für die Hersteller, ihre Innovationsfelder neu zu definieren und Ressourcen gezielt auf diese zukunftsweisenden Bereiche auszurichten. Beschleunigte Entwicklungszyklen ermöglichen es zudem, neue Modelle schneller mit aktuellen, marktgerechten Funktionen auf die Strasse zu bringen.
Europäische Automobilhersteller betreiben ihre F&E-Abteilungen überwiegend in Hochlohnländern nahe ihrer Heimatmärkte. Chinesische Wettbewerber hingegen setzen verstärkt auf Entwicklungszentren in Mittel- und Niedriglohnländern. Dies verschafft ihnen nicht nur eine höhere Kosteneffizienz, sondern auch mehr Flexibilität im Wettbewerb. «Für europäische Hersteller bleibt es daher ein strategisch relevantes Thema, F&E-Kapazitäten zu verlagern», betont Bain-Partner und Co-Autor Daniel Suter. «Neben der Optimierung der Kostenstruktur kann es auch sinnvoll sein, F&E gezielt in Schlüsselmärkten anzusiedeln.» Dort liessen sich die Bedürfnisse und Präferenzen der lokalen Kundschaft –etwa die Gestaltung von Innenräumen und Benutzeroberflächen – oft besser verstehen und könnten direkt in die Produktentwicklung einfliessen.
F&E-Kapazitäten im Ausland aufzubauen, ist ein langfristiger Prozess, der meist schrittweise erfolgt – beginnend mit den weniger komplexen Aufgaben und Kompetenzen. Doch der Handlungsdruck ist bereits heute hoch. «Aufstrebende Wettbewerber aus Asien haben sich das Prinzip «Weniger ist mehr» zu eigen gemacht», bilanziert Suter. «Die etablierten europäischen Automobilhersteller benötigen einen Gangwechsel. Noch verfügen sie über eine gute Ausgangsposition, um ihre F&E-Prozesse zu optimieren und die Zukunft der Branche auch künftig massgeblich zu prägen.»
Kontakt
Bain & Compay Switzerland, Inc. CH-8001 Zürich
+41 44 668 80 00
www.bain-company.ch n

Plagiarius-Wettbewerb
Produktfälschungen können hohe Schäden anrichten. Die Leidtragenden sind oft mittelständische Unternehmen, die sich eine Verfolgung der Plagiatsfälle kaum leisten können. Bereits zum 49. Mal wird daher der Negativpreis Plagiarius verliehen. Ziel der Aktion ist laut den Veranstaltern, die skrupellosen Geschäftsmethoden von Produktund Markenpiraten ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und Industrie, Politik und Verbraucher für die Problematik zu sensibilisieren.
Der erste Platz beim Plagiarius-Wettbewerb wurde dieses Jahr an die Front- und Seitengreifzange Knipex Twingrip der Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG verliehen. Die Kombination aus Frontgreif- und Seitengreif-Funktion ist laut Hersteller einzigartig, das besonders belastbare Gelenk ist fünffach einstellbar und soll die ideale Anpassung an verschiedene Werkstückgrössen ermöglichen. Optisch unterscheiden sich die Plagiate vom Original nur durch den glatten Kunststoff der Griffe. Die minderwertige Qualität zeigt sich laut Aktion Plagiarius in einer geringeren Lebensdauer durch billige Materialien und Verarbeitung sowie an dem schwer zu bedienenden Druckknopf – und an chemischen Ausdünstungen. Knipex‘ Kritik an Temu & Co: Trotz Kenntnis der Schutzrechte und trotz «Notice-and-Take-Down» eines Plagiats können problemlos baugleiche oder dieselben Plagiate wieder eingestellt werden. Zu wenig Prävention. Und zu wenig Sanktionierung der Verletzer.
Zudem ausgezeichnet wurde der Spielzeug-Mobilbagger «Bruder Roadmax» der Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG. Das Plagiat (XE 7000) kostet fast das Gleiche wie das Original (XE 5000), ist aber deutlich kleiner. Das Angebot des Vertreibers Brigamo auf amazon.de wurde zwar gelöscht, der Händler ist aber laut Verein weiter uneinsichtig. Aktion Plagiarius: «Nachahmer aus aller Welt kopieren seit Jahren ungeniert das erfolgreiche BruderDesign – der Kunststoff ist jedoch meist minderwertig und bricht schnell, so dass Verletzungsgefahr besteht. Bruder schützt daher all seine Designs und technischen Lösungen international und zieht Nachahmer konsequent zur Rechenschaft.»
Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Insektenstichheiler «BR 60» der Beurer GmbH. Das Plagiat stammt vom chinesischen Hersteller Hangzhou Industrial Instrument Meter Co., Ltd. und wurde unter anderem über 1688.com und andere eCommerce-



Der Plagiarius-Preis wird jedes Jahr für die dreistesten Produktfälschungen verliehen. (Bilder: Aktion Plagiarius e.V.)
Plattformen vertrieben. Ein deutscher Online-Händler hat laut Aktion Plagiarius eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Aktion Plagiarius: «Nicht nur das Design des BR 60 wurde kopiert und irreführende Werbebehauptungen getätigt – das Plagiat beansprucht auch eine medizinische Funktion, ohne die strengen Anforderungen und Prüfungen der EU für Medizinprodukte durchlaufen zu haben. Mehr als genug Gründe für den deutschen OnlineHändler, den Verkauf des Plagiats zu stoppen und eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Auch auf amazon.de wurden nach Hinweis auf das eingetragene Design alle rechtsverletzenden Angebote entfernt. Dreist: Der chinesische Hersteller hat in China Designschutz für sein Plagiat eintragen lassen und bietet es online in grossen Stückzahlen an.»

Rotho regelmässig betroffen
Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Recycling Müllsystem «Albula» der Rotho Kunststoff AG. Im Internet kursieren zahlreiche Nachahmungen des Systems. Die Abmessungen und Proportionen sind laut Verein identisch zum Original und das Design ist bis ins letzte Detail kopiert: Vom abnehmbaren Deckel mit integrierter Klappe, den Tragegriffen mit patentierten Rastverschluss-Knöpfen bis hin zur farblichen Abgrenzung von Container, Deckel und Griffen. Aktion Plagiarius: «Rotho ist regelmässig von Plagiaten betroffen und geht konsequent gegen Design- und Patentverletzungen vor. Nach Hinweis auf das geschützte Design wurden rechtsverletzende Angebote auf amazon.de entfernt. Woka Home Product, der sich als erfahrener Hersteller von Kunststoffprodukten präsentiert, bestreitet, das Plagiat

je hergestellt oder vertrieben zu haben. Im Woka Home Katalog wurde das Plagiat jedoch mit Fotos (drei Farbvarianten), technischen Detailinformationen, Preisen sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen beworben.»
Eine weitere Auszeichnung geht an die elektrisch-isolierten Schraubendreher «Proturn» der Wiha Werkzeuge GmbH. Den Plagiaten des chinesischen Herstellers Dongguan Yile Electronic Commerce Co., Ltd. fehlt unter anderem die VDE-Registrierung gemäss DIN EN IEC 60900. Beworben werden sie laut Verein trotzdem als «isolierte» Schraubendreher für Elektriker. Tests sollen gezeigt haben, dass sie die Anforderungen der internationalen Norm nicht erfüllen, es bestehe die Gefahr eines

Stromschlags. Unübersehbar seien auch die Qualitätsunterschiede bei Materialien und der Verarbeitung. Die Wiha-typische Form und Farbkombination der Griffe wurde 1:1 kopiert, was zur Irreführung bezüglich der Herkunft führen könne. Aktion Plagiarius: «Wiha lässt Billig-Plagiate regelmässig auf eCommerce-Plattformen löschen. Die Betreiber einer chinesischen Online-Plattform haben auf das Anschreiben von Plagiarius reagiert: sie würden unverzüglich nach Meldung Plagiats-Angebote löschen und hätten auch Systeme zur proaktiven Erkennung von rechtsverletzenden Produkten installiert – und sie haben uns eine persönliche Ansprechpartnerin genannt. Erreichbarkeit: Geht so. Den Versprechen müssen jetzt Taten folgen.»
Kontakt www.plagiarius.com n

Vom 6. bis 9. Mai 2025 findet in Stuttgart die fünfte Moulding Expo statt. Die Messe ist eines der wichtigsten europäischen Events für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau: Die Top-Herstellenden der Branche zeigen an vier Tagen, was der europäische Werkzeug-, Modell- und Formenbau sowie die zugehörigen Zulieferertechnologien zu bieten haben.
Der Weg zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit erfordert kontinuierliche Anpassung und Innovation. Volker Nonnenmann, Geschäftsführer der Nonnenmann GmbH, betont die Bedeutung der Moulding Expo als wichtige Plattform zur Präsentation neuer Produkte und zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit: «Wie die deutsche Industrie befindet sich auch der Werkzeug- und Formenbau in der DACHRegion im Umbruch und muss alte Beschaffungsstrukturen überwinden. Weltmarktführendes Wissen allein genügt nicht, um global konkurrenzfähig zu bleiben. Gerade jetzt bietet die Moulding Expo eine wichtige Plattform. Wir freuen uns, auf der Messe unsere Neuprodukte zu zeigen, die wir vor der Messe einführen.» Die Bedeutung der kontinuierlichen Weiterentwicklung wird auch von der Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH betont. Auf der Messe stellt das Unternehmen innovative Technologien und Werkzeuge vor. Geschäftsführerin Christel Hufschmied fasst zusammen: «Kontinuierliche Innovation und die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen sind entscheidend, um als europäischer Werkzeughersteller wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit patentierten Lösungen wie dem Graftor steigern wir Produktionskapa -
Über die Moulding Expo
zität, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Besucher können sich an unserem Messestand über unsere neuesten Entwicklungen und Werkzeuge informieren.»
Für die Sodick Deutschland GmbH steht auf der Moulding Expo die Präsentation ihrer präzisen Erodiermaschinen im Mittelpunkt. Auf einer Standfläche von 99 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher sich live überzeugen. Salvatore Cocco, Vice President von Sodick, hebt hervor: «Die Moulding Expo zählt zu den wichtigsten deutschen Messen für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau. Seit Beginn nutzen wir die Messe, um unsere neuesten Entwicklungen zu präsentieren. Bei der Wahl einer Erodiermaschine stehen Genauigkeit, Performance, Energieeffizienz sowie die Kosten pro Stunde im Mittelpunkt – genau hier setzt die Sodick+-Serie an. Besucher können sich auf der Moulding Expo persönlich von den neuesten Maschinen überzeugen.»
Für die Werkzeugbau Winkelmühle GmbH gilt die Moulding Expo als ein bedeutendes Branchen-Event, um Expertise im Bereich Präzisionswerkzeuge und moderne Produktionstechnik zu präsentieren. Geschäftsfüh-
Im Fokus der internationalen Fachmesse Werkzeug-, Modell- und Formenbau stehen kleine und mittelständische Werkzeug-, Modell- und Formenbau-Betriebe mit ihrer Expertise und ihrem Know-how für die Umsetzung kundenspezifischer Projekte. Zudem bildet die Messe alle relevanten Technologiepartner der Branche ab, die den hohen Ansprüchen der Branche an Qualität und Genauigkeit genügen: von Normalien, Werkstoffen und Heisskanalsystemen über Bearbeitungswerkzeuge, Spannmittel und Werkzeugmaschinen bis hin zu Prüf- und Messtechnik und Software-Anbietern. Die Messe findet im Zwei-Jahres-Turnus in Stuttgart statt.


rer Tom Berthold sagt: «Die Moulding Expo gehört zu den wichtigsten Terminen in unserem Messekalender. Wichtige Impulse zum Thema Smart Manufacturing im Werkzeugbau, die dazugehörenden Zulieferertechnologien sowie Ausblicke auf angrenzende Forschungsfelder stehen für uns im Fokus. Bereits 2023 konnten wir die Messe nutzen, um uns als Werkzeughersteller für Industrieprozesse sowie gleichzeitig als Lieferant von Stanz-, Biege- und Kunststoffteilen erfolgreich zu positionieren. 2025 möchten wir daran anknüpfen.»
Zur 5. Moulding Expo erwartet die Landesmesse Stuttgart 200 Aussteller aus 16 Ländern.
Kontakt
Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG D-70629 Stuttgart +49 711 18560-0 info@messe-stuttgart.de www.messe-stuttgart.de n


Die Kuteno geht mit über 360 Ausstellern am neuen Standort Bad Salzuflen an den Start. Gemeinsam mit der erstmals parallel stattfindenden KPA – Kunststoff Produkte Aktuell präsentieren sich vom 13. bis 15. Mai 2025 über 440 Unternehmen. Damit wird das Messezentrum Bad Salzuflen zum neuen Hotspot der Kunststoffbranche im Norden.
Trotz der aktuellen Herausforderungen für die Kunststoffindustrie zeigt sich die Ausstellergemeinschaft optimistisch. Kuteno und KPA sind keine reinen Präsentationsplattformen, sondern gezielt auf fachliche Beratung und Geschäftsanbahnung ausgerichtet. Die hohe Buchungslage unterstreicht, dass die Branche auf persönliche Begegnungen, konkrete Lösungen und neue Geschäftsbeziehungen setzt. Ob kunststoffverarbeitende Maschinen, Werkzeug- und Formenbau, Materialinnovationen oder Recyclingtechnik – führende Unternehmen wie Arburg, KraussMaffei, Engel, Meusburger, BASF, Motan und Rapid Granulier-Systeme sind vertreten. Die kompakte und fokussierte Atmosphäre schafft ideale Voraussetzungen für fachlichen Austausch und gezielte Projektgespräche.
Die gesamte Wertschöpfungskette an einem Ort
Die beiden Messen decken die gesamte Wertschöpfungskette der Kunststoffverarbeitung bis in die Anwenderindustrien ab. Während die Kuteno gezielt Kunststoffverarbeiter anspricht, richtet sich die KPA branchenübergreifend an Unternehmen, die Kunststoffprodukte einsetzen. Hier präsentieren sich Kunststoffverarbeiter, Anbieter von Kunststoffen und neuen Materialien sowie Dienstleister entlang der Produktionskette. «Die Parallelführung mit der KPA eröffnet uns neue Besucherzielgruppen. Wir erwarten spannende Gespräche mit potenziellen Kunden aus den Anwenderindustrien», sagt Peter Barlog, Geschäftsführer der Barlog Plastics GmbH. Ein Unternehmen, das die Kuteno von Anfang an begleitet, ist die Günther Heisskanaltechnik GmbH. «Als Aussteller der ersten Stunde freuen wir uns darauf, die

Am 13. Mai 2025 öffnet das Messeduo Kuteno und KPA für drei Tage seine Tore. (Bild: Easyfairs)
Kuteno in Bad Salzuflen weiter wachsen zu sehen. Sie überzeugt mit hoher Besucherqualität, direktem fachlichen Austausch und einer familiären Atmosphäre, die das Netzwerken erleichtert. Besonders die technischen Experten aus der Region, die wir auf anderen Messen so nicht erreichen, machen die Kuteno für uns wertvoll», betont Horst-Werner Bremmer, Leitung Anwendungstechnische Beratung und Vertrieb.
Das Fachprogramm der Kuteno und KPA greift alle relevanten Themen der Kunststoffindustrie auf. In verschiedenen Themenblöcken erhalten Besucher wertvolle Impulse zu Automatisierung, Nachhaltigkeit in der Kunststoffverarbeitung, KI und Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, Produktdesign sowie Nachwuchskräftegewinnung. Renommierte Branchenakteure wie das Kunststoff-Institut Lüdenscheid, SKZ, Kunststoffland NRW, KUZ Leipzig, KB Hein, Marktspiegel Werkzeugbau und CirQuality OWL kuratieren die Inhalte
und sorgen für eine hohe fachliche Relevanz.
Neue Aussteller unterstreichen
Attraktivität des Messe-Duos Zahlreiche Unternehmen präsentieren sich 2025 erstmals auf der Kuteno. Unter den Neuausstellern finden sich führende Anbieter aus verschiedenen Bereichen, darunter Campetella und Ruhrbotics im Bereich Automation & Robotics, Mitsubishi Electric für Werkzeugmaschinen, Diener electronic für Oberflächenbehandlung, Chen Hsong für Spritzgiessmaschinen sowie BASF Polyurethanes für Materialien. Auch Spezialisten wie FIPA für Greifertechnik, Ferlin für Peripheriegeräte sowie bd tronic für Maschinen zum Dosieren, Imprägnieren und Heissnieten sind erstmals vertreten. Ergänzt wird das Angebot durch Rapid Granuliersysteme und Reinbold, die Lösungen für Schneidmühlen und Kunststoffrecycling präsentieren.
Kontakt www.kuteno.de www.kpa-messe.de n


Die rapid.tech 3D ist die zukunftsweisende Pionierveranstaltung der AM-Szene in der Messe Erfurt und feiert vom 13. bis 15. Mai 2025 ihre 21. Auflage. Die Veranstaltung basiert auf einem Dreiklang aus Kongress – Messe –Networking und schafft mit ihrer Verbindung von Theorie und Praxis ein für Besucher wie Aussteller erfolgreiches Gesamtpaket.
Unter dem Motto «Innovativ & Profitabel – Die Zukunft der Additiven Fertigung» stehen bei der rapid.tech 3D praxistaugliche Anwendungen, innovative Technologien und zukunftsweisende AMTrends im Mittelpunkt. Geboten werden spannende Inhalte, Events zu verschiedenen Fokusthemen, Produktkategorien oder für bestimmte Zielgruppen. Für die Besucher, die schon immer wissen wollten, wie sie den 3D-Druck in ihrem Unternehmen gewinnbringend zum Laufen bringen können, ist die rapid.tech 3D mit der Messe und den diversen Foren die richtige Anlaufstelle. Hier erhalten sie Know-how von Machern für Macher und profitieren direkt vom intensiven fachlichen Austausch mit Experten.
So steht beispielsweise das Zusammenspiel von Additive Manufacturing (AM) und Robotik im Zentrum des diesjährigen Forums der VDMA-Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing. Unter der Überschrift

«AM4industry – Using & Enabling Robotics» zeigen Fachleute aus Industrie und Forschung am 13. Mai 2025 die Potenziale auf, die aus der Verbindung von AM und Robotik erwachsen. «Wir zeigen auf, weshalb und wie additive Fertigung und Robotik ein perfektes Paar bilden. Zum einen stellen unsere Referenten aus Industrie


und Forschung dar, wie Robotertechnik dazu beiträgt, additive Prozesse zu optimieren. Zum anderen demonstrieren sie, wie die additive Fertigung die Produktionsabläufe verbessert – querbeet durch viele Branchen von der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie über die Kunststoffverarbeitung bis hin zur Metallbearbeitung», erläutert Rainer Gebhardt, AM-Experte beim VDMA und verantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung des Forums. VDMA Additiv Manufacturing ist ideeller Träger der Erfurter Fachveranstaltung.
Stützstrukturen maschinell entfernen
Wenn es um die Entfernung von Stützstrukturen nach dem additiven Fertigungsprozess geht, dann war das oft manuell mit Flex oder Meissel zu erledigen. Das macht den Prozess nicht nur zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig. Toolcraft hat eine Lösung zur maschinellen Entfernung der Stützstrukturen entwickelt, die sich optimal an industrielle Anforderungen anpas-

sen lässt. Uwe Schulmeister wird die Technologie anhand eines praxisnahen Fallbeispiels vorstellen und einen Ausblick auf zukünftige Automatisierungspotenziale für AM-Produktionslinien geben.. Dem Robotikeinsatz zur Industrialisierung additiver Fertigungsabläufe widmet sich auch der Vortrag von Dr. Matthias Brück vom Fraunhofer IAPT und Dr. Karsten Heuser von Siemens. Sie nehmen den kompletten End-to-End-Datenfluss in der Systemprogrammierung von der Datengenerierung bis zur nahtlosen Echtzeitintegration in industrielle Anwendungsfälle in den Fokus. Der Schlüsselaspekt ist nicht nur die Automatisierung und Verbesserung bestehender Prozesse, sondern auch die Nutzung möglicher Synergien durch neue Denk- und Herangehensweisen über die gesamte Fertigungskette.
Innovative AM-Robotik-Greifer für viele Anwendungen
Im zweiten Teil des Forums demonstrieren Industrievertreter, wie mit AM-gefertigte Greifer-Systeme und weitere Werkzeuge für innovative Robotertechnik Produktionsprozesse effizienter gestaltet werden. «Für diesen Themenblock gab es zahlreiche Vortragseinreichungen von Unternehmen, die ihre Anwendungen präsentieren möchten. Die grosse Resonanz zeigt, welche Potenziale in diesem Bereich schlummern und branchenübergreifend gehoben werden können», betont Rainer Gebhardt. Innovative additive multimateriale Greiferlösungen für die Spritzgiessautomation stellt Martin Neff von ARBURGadditive vor. Ein Beispiel ist ein Entnahmemodul für Blumentöpfe. Der aus zwei Komponenten bestehende Greifer wird durch die additive Fertigung nicht nur leichter. In ihm können ausserdem wesentliche Handhabefunktionen integriert werden, sodass das gesamte Entnahme- und Handlingsystem kompakter und günstiger wird.
Plenums-Diskussion zum Abschluss
Im abschliessenden Plenum geht es u. a. um die Frage, welche weiteren AM-Anwendungen es neben Greifer-Systemen im Bereich Robotik gibt. Die Teilnehmer haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Anmerkungen und Fragen direkt mit den Referenten zu diskutieren.
Einblicke in die neuesten
AM-Entwicklungen
Neben dem VDMA-Fachforum offerieren weitere Foren des rapid.tech 3D-Fachkongresses Einblicke in neueste AM-Entwicklungen und -Anwendungen. Am ersten Tag laden dazu das Forum Aerospace sowie das qualitätsgeprüfte Wissenschaftsforum ein. Am zweiten Tag hat das Forum Elektronik & Komponenten Premiere. Zudem stehen die Foren Chemie & Verfahrenstechnik sowie Mobilität auf dem Pro -
gramm. Software, KI & Design, Innovation in AM sowie Energietechnik & Wasserstoff sind die Foren des Abschlusstages.
Kontakt Messe Erfurt GmbH D-99094 Erfurt +49 361 400-0 rapidtech@messe-erfurt.de www.rapidtech-3d.de n
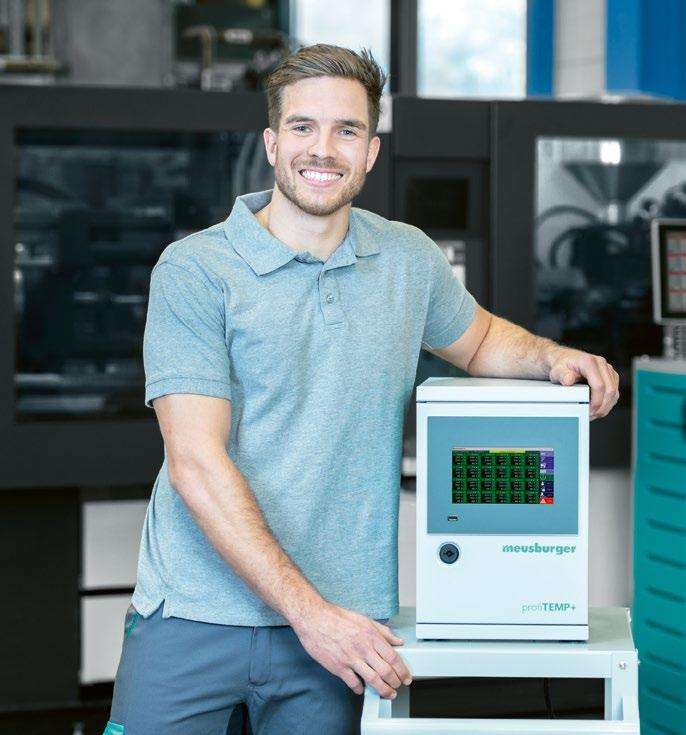



Eine nachhaltige Abfallwirtschaft verlangt innovative Lösungen. Unter der Leitung der Silicann Systems GmbH startet das SKZ zusammen mit der HAIP Solutions GmbH und dem Fraunhofer IFF das Forschungsprojekt SpectralAIge. Ziel ist es, die weltweit ersten spektroskopischen Messsysteme zu entwickeln, welche die prozessbedingte Materialalterung von Kunststoffen schnell und präzise bewerten können. Mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) sollen die bestmöglichen Entscheidungen für die Aufbereitung und Verwendung von Sekundärkunststoffen getroffen werden, um unterschied -
lich stark gealtertes Kunststoffmaterial zu erkennen, zu sortieren und dem optimalen Recyclingpfad zuzuführen. Mit den gewonnen Projekterkenntnissen soll die Erkennung von degradierten Materialien im geschlossenen PET-Pfandflaschen-Kreislauf und in Kunststoffsortieranlagen möglich sein. Dies bietet die Option, bestmögliche Entscheidungen für die Aufbereitung und Verwendung von Sekundärkunststoffen zu treffen. Durch das frühzeitige Aussortieren von zu stark degradierten Materialien wird eine höhere Qualität des Rezyklats sichergestellt. Dies ist unter anderem in der Herstellung von Lebensmittelverpa -

Quelle: Bertold Zugelder/Adobe Firefly)
All about plastics: Kunststoffwissen auch in Englisch
Die Bildung im Fachbereich Materialien, Compoundieren und Extrudieren des Kunststoff-Zentrum SKZ in Würzburg erweitert ihr Angebot um zwei neue englischsprachige Grundlagenkursen. Die Arbeitswelt wird immer internationaler, und mit ihr die Anforderungen an Weiterbildungen und Qualifikationen. Um allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gleichermassen Zugang zu hochwertigem Kunststoffwissen zu ermöglichen, bietet das SKZ zwei neue Grundlagenkurse in englischer Sprache an: Basics of Plastic Materials und
Das Forschungsprojekt ModiBioPol der Technischen Hochschule Nürnberg und des SKZ entwickelte ein innovatives Verfahren zur kontinuierlichen Biosynthese des Biopolymers Polyhydroxybutyrat (PHB). Ziel war es, die bei biologischen Synthesen übliche Variabilität durch eine spezielle Prozessführung so zu kontrollieren, dass zentrale Materialeigenschaften wie mittlere Molmasse und mechanische Stabilität gezielt einstellbar sind. Zudem wurden umweltfreundliche ’Green Chemicals’ zur Aufreinigung der Polymere erprobt, um schädliche chlorierte

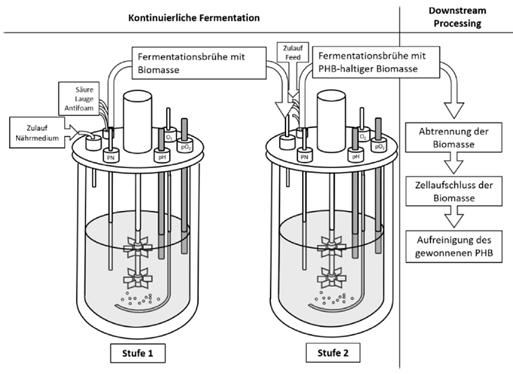
Schematische Darstellung des kontinuierlichen Herstellungsprozesses (Quelle: Felix Berthold, Technische Hochschule Nürnberg)
ckungen wie Pfandflaschen unabdingbar.
Im ersten Projektansatz werden hyperspektrale Kamera-Systeme (HSI), die bereits in der Kunststoffsortierung etabliert sind, um LED-basierte Lichtquellen für die Fluoreszenzanregung erweitert. Die Entwicklung KI-unterstützter, günstiger, inverser Spektrometer steht im zweiten Ansatz im Fokus. Hierfür werden aus breitbandigen Messergebnissen von HSI-Messungen relevante Wellenlängen extrahiert und mithilfe dieser Daten ein inverses Spektrometer gebaut. Diese sollen Rückschlüsse auf die prozessbedingte Alterung von Kunststoffmaterialen ermöglichen.
Basics of Plastic Technology. Beide Kurse werden zweimal jährlich angeboten – als LiveOnline-Kurs und als Präsenzkurs am SKZ-Hauptsitz in Würzburg.
Lösungsmittel zu ersetzen. Kernpunkt der erfolgreichen Effizienzverbesserung war die Optimierung der Verfahrensschritte in der sogenannten Aufreinigung (Downstream Processing) der synthetisierten Polymere. Die Abbildung zeigt den schematischen Ablauf des optimierten Herstellungsprozesses.

Kontakt SKZ – Das Kunststoff-Zentrum Friedrich-Bergius-Ring 21 D-97076 Würzburg +49 931 4104-503 m.ruff@skz.de, www.skz.de
Die international tätige Maag Group mit Hauptsitz in Oberglatt, Schweiz, hat ihre Geschäftsaktivitäten in China intensiviert. Der Umsatz von Maag China steigt kontinuierlich. Heute ist das Unternehmen auf einer Fläche von 7500 Quadratmetern tätig, die Montagehalle am Standort in Jiading, einem Stadtteil von Shanghai, hat sich mittlerweile verdoppelt. Mit über 100 Mitarbeitern bietet das Unternehmen seinen Kunden Produktion, Vertrieb und diverse Dienstleistungen an. Produkte, die in der Schweiz oder in Deutschland entwickelt werden, werden in China an die lokalen Bedürfnisse angepasst und – kostensparend –

Produktion der Maag Group in Jiading/Shanghai, China (Bild: Maag)
im Werk in Shanghai gefertigt und montiert. Maag stellt seit mehr als 20 Jahren Produkte für den chinesischen Markt her, angefangen von Komponenten bis hin zu den heutigen komplexen Produktionssystemen. Ueli Thürig, Präsident der Maag Group: «‹Made in China für China› ist eine der Schlüs-
selstrategien, auf die sich unser Unternehmen in den letzten Jahren konzentriert hat; mehr als 90 Prozent der in unserem Werk in Shanghai montierten Anlagen sind für den chinesischen Markt bestimmt.»
Damit die technisch komplexen Maschinen langfristig optimal
arbeiten, bietet Maag China erstklassigen Service durch geschultes Fachpersonal, egal ob das Produkt bei Maag Shanghai oder einem anderen Maag Standort weltweit gekauft wurde. Ein lokales Lager zur Aufbewahrung der gängigsten Ersatzteile stellt eine schnelle Lieferung sicher. In den lokalen Schleifzentren in Shanghai (Ostchina) und Guangzhou (Südchina) werden schnell, zuverlässig und professionell Schneidrotoren, Schneidmesser und Lochplatten – auf Anfrage, auch von anderen Herstellern – geschliffen.
www.maag.com

EMS-GRIVORY – Innovation in Hochleistungs-Kunststoffen. Als Ihr globaler Entwicklungspartner bringen wir Ihre Ideen schneller zur Serie.
innovativer Entwicklungspartner
Mit Expertenwissen, modernster Technik und massgeschneiderter Beratung schaffen wir wegweisende Lösungen für den gemeinsamen Erfolg.

Per 1.1.2025 hat die PWF Kunststofftechnik AG das operative Geschäft der Espisa AG übernommen. Dabei handelt es sich nicht um einen Unternehmenskauf, sondern um einen Asset-Deal, in dem keine Forderungen und Verbindlichkeiten übernommen werden. PWF Kunststofftechnik AG ist eine aufstrebende Firma im Familieneigentum. Mit der Übernahme des Geschäftes der Espisa AG von einer Investorengesellschaft in Baar, wird PWF die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und den Standort Koblenz wieder zu alter

Stärke zurückführen. Espisa war im gleichen Kunden- und Produktesegment tätig und rundet das Angebot von PWF
durch Einbringen von Spritzgussmaschinen im hohen Schliesskraftbereich bis zu 1600 Tonnen nach oben ab.
Mit rund 60 Spritzgussmaschinen mit einer Schliesskraft von 15 bis 1600 Tonnen, über 100 Mitarbeitenden, davon 6 Projektleiter, und einer Produktion von über 100 Mio. Teilen jährlich, zählt PWF mittlerweile zu den grösseren Anbietern in der Schweiz.
Mit der Rückenstärkung durch eine langfristig orientierte Eigentümerschaft und im Verbund mit den anderen Produktionsstandorten freut sich das Team in Koblenz mit Elan in eine neue Zukunft zu starten.
www.pwf.swiss
Ziel dieser Kooperation zweier starker Partner ist es, innovative Technologien für die Überflutung mit PUR weiterzuentwickeln und industrielle Anwendungen mit noch höherer Qualität und Effizienz zu ermöglichen. Die Nachfrage nach hochwertigen PUR-beschichteten Bauteilen wächst stetig. Engel nennt diese Technologie clearmelt. Mit diesem Verfahren werden Bauteile nach dem Spritzgiessprozess direkt in der Maschine mit PUR lackiert. Nun verstärkt der österreichische Spritzgiess-
maschinenhersteller seine Position durch die Partnerschaft mit Cannon – eine Kooperation zweier erfahrener, familiengeführter Unternehmen, die kontinuierlich in nachhaltige Innovationen investieren. Technologisch basiert die Partnerschaft auf der Zusammenführung der Stärken beider Unternehmen: Engel bringt seine umfassende Kompetenz in der Spritzgiesstechnologie ein, während Cannon mit seiner herausragenden Expertise in der PUR-Verarbeitung die
Erfahren Sie mehr über Ihr Einsparpotential. Wir zeigen Ihnen gerne persönlich unsere neuen individuellen Lösungen.
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
info@buschag.ch I www.buschvacuum.com

Prozesssicherheit und Effizienz optimiert. Die clearmelt-Technologie, die thermoplastische Bauteile mit einer widerstandsfähigen PUR-Oberfläche beschichtet, wird durch das mehr als zwanzigjährige Know-how von Cannon weiterentwickelt und optimiert.
Ein herausragendes Beispiel dieser Zusammenarbeit ist die weltweit grösste Spritzgiesszelle mit PUR-Anlage für clearmelt, die im Engel-Technikum in Sankt Valentin (A) in Betrieb genommen wurde. Kunden

Oberflächenveredelung von Kunststoffteilen (Bild: Engel)
können dort praxisnahe Versuche mit unterschiedlichsten PUR-Farbvarianten durchführen.
www.engelglobal.com
Coperion K-Tron, ein weltweit führender Anbieter von Dosierund Fördertechniklösungen, vergrössert sein hochmodernes Test Center in Niederlenz (CH). Mit diesem strategischen Schritt hat das Unternehmen deutlich mehr Möglichkeiten, auch Versuche mit Materialien durchzuführen, die eine räumliche Abgrenzung (Containment) erfordern.
Versuche für Kunden dienen einem doppelten Zweck: Mit ihnen werden zum einen das Verhalten kundenspezifischer Schüttgüter getestet und Herausforderungen identifiziert und gelöst, bevor sich der Kunde zum Kauf entscheidet. Das Ziel eines jeden Tests besteht darin, dem Kunden die am besten geeignete Dosier- und/ oder Förderanlage anzubieten.

Das Test Center in Niederlenz wird mit der neuesten Technologie und Ausrüstung ausgestattet sein. (Bild: Coperion K-Tron (Schweiz) GmbH)
Coperion K-Tron führt in seinem Test Center Versuche durch, bei denen Kunden Lösungen für Herausforderungen bei der Dosierung und Förderung testen können. Der neue Bereich des Test Center wird mit modernster Technologie ausgestattet, um höchste Sicherheits- und Effizienzstandards zu ermöglichen. Zudem wird das Test Center für die Handhabung aller Arten von Materialien über ContainmentSysteme mit Luftschleusensystemen verfügen, um die Sicherheit des Testprozesses, der Mitarbeiter und der Umwelt sicherzustellen. Damit können nun auch Kunden aus der Batterie-, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, wo Containment- und Hygieneanforderungen ein kritisches Thema sind, umfangreiche Versuche durchführen.





Zum anderen dient das Test Center den Forschungs- und Entwicklungsteams, Prototypen neu entwickelter Produkte zu testen oder bestehende Anlagen und Prozesse zu verbessern. Coperion führt in Niederlenz etwa 150 Versuche pro Jahr durch und testet dabei verschiedenste Materialien wie Kunststoffgranulate, Pulver, Flocken oder Flüssigkeiten sowie Endprodukte wie Flaschenverschlüsse, Schokoladenchips oder Frühstückscerealien. Alle Versuchsergebnisse fliessen in eine globale Datenbank ein, die über 15 000 Werkstoffe umfasst.
Die Erweiterung soll im April 2025 abgeschlossen sein.
Der
Ganzheitliche Lösungen − engineered by IE
Eine effiziente Kunststoffproduktion bedingt, dass die Fertigungsprozesse, die Haustechnik und die Architektur von Anfang an aufeinander abgestimmt werden. Das Gebäude muss entsprechend konzipiert sein. Darauf sind unsere erfahrenen Architekten und Ingenieure spezialisiert. Sie achten darauf, dass die Material- und die Personenflüsse kreuzungsfrei verlaufen, der Lagerbereich direkt an die Produktion angebunden ist und das Gebäude später flexibel erweitert werden kann.
Unsere Experten erarbeiten mit Ihnen bei Bedarf ganzheitliche Hygiene- und Reinraumlösungen inkl. Qualifizierung, die sicherstellen, dass partikuläre und mikrobiologische Belastungen für den Produktionsprozess optimal gesteuert sind.
Die Beachtung solcher Kriterien entscheidet letztlich über Ihre Wettbewerbsfähigkeit in der hart umkämpften Kunststoffbranche.
Wie immer Ihre Ausgangslage ist − wir haben die ganzheitliche, maßgeschneiderte und praxiserprobte Lösung für Sie.
IE Plast Zürich
+41 44 389 86 00 zuerich@ie-group.com www.ie-group.com
www.coperion.com
IN IHRER BRANCHE ZU HAUSE
MITARBEITER ALS UNTERNEHMER
ALLE EXPERTEN UNTER EINEM DACH SICHERHEIT DURCH GARANTIEN


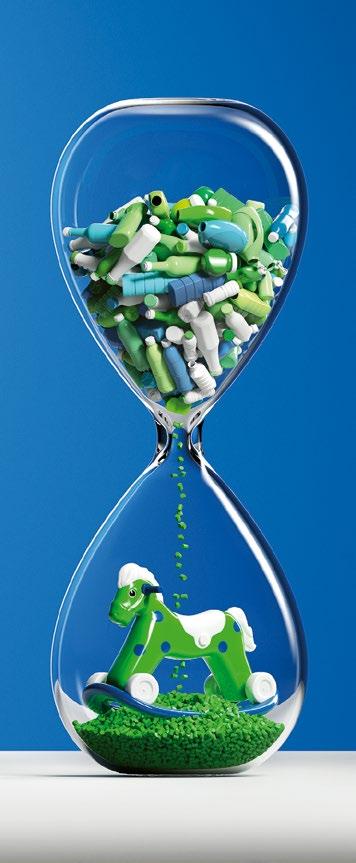
Der deutsche Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. (GKV) zog anlässlich seiner Jahres-Wirtschaftspressekonferenz am Aschermittwoch wie bereits im Vorjahr ein durchwachsenes Bild der Wirtschaftslage des Industriezweigs.
Wirtschaftslage. Insgesamt haben mehr als 330 Betriebe aus der Branche an der Befragung teilgenommen.
Die weitaus überwiegende Zahl der Betriebe verzeichnete 2024 einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Bei den Er-
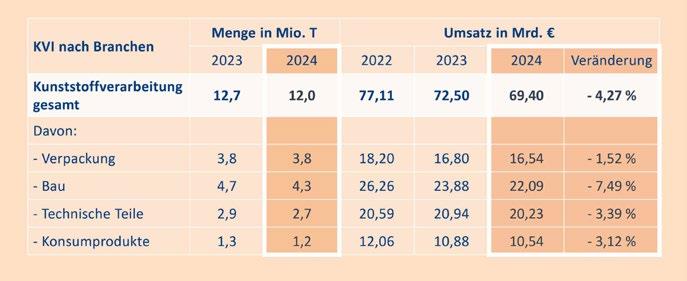
Menge und Umsatz der Kunststoff verarbeitenden Industrie (Grafik: GKV)
Nach Rückgängen im Jahr 2023 setzte sich der Abwärtstrend der Kunststoff verarbeitenden Industrie in Deutschland 2024 fort. Der Umsatz der Branche ging von 72,5 Mrd. Euro auf 69,4 Mrd. Euro zurück. Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich von mehr als 319 000 auf noch ca. 313 000. «Insbesondere die Wertschöpfungsketten Bau und Automobil bewegten sich auf einem unbefriedigenden Niveau», verdeutlichte GKV-Präsidentin Dr. Helen Fürst.

Für 2025 sieht Fürst die Chance auf ein Ende der Talfahrt. «Unsere Industrie hat das Potenzial für Wachstum. Der sprichwörtliche Silberstreif am Horizont wird nach zwei für die Kunststoff verarbeitende Industrie herausfordernden Jahren allmählich sichtbar.» Die Voraussetzung für einen Aufschwung sind aus Sicht der Unternehmen jedoch insbesondere eine Entlastung der Industrie von hohen Energiekosten und ein konsequenter Bürokratieabbau. Weiteren Schwung erhofft sich die Branche von der Weltleitmesse der Kunststoffindustrie, der K 2025, die vom 8. bis 15. Oktober 2025 in Düsseldorf stattfindet.
Der verhaltene Optimismus auf ein Ende der Talfahrt wird gestützt durch die jährlich bei den Mitgliedsunternehmen der Trägerverbände des GKV durchgeführte Umfrage zu ihrer Einschätzung der Konjunktur- und

wartungen für das Jahr 2025 überwiegt mittlerweile die Zuversicht, dass es wieder aufwärts gehen könnte. Immerhin 42 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit steigenden Umsätzen in diesem Jahr. Parallel zu den Umsätzen entwickeln sich auch die Betriebsergebnisse der Unternehmen: Überwog im Jahr 2024 noch deutlich die Zahl der Unternehmen, deren Betriebsergebnis schlechter ausfiel als im Vorjahr, so erwarten 40 Prozent gleichbleibende und immerhin 34 Prozent der Unternehmen steigende Gewinne für das laufende Jahr.
Die Unternehmen wurden in diesem Jahr erneut zum Ausmass der einzelnen Kostenaspekte auf die Wettbewerbsfähigkeit befragt. 2024 haben Bürokratie- und Lohnkosten die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am stärksten beeinflusst, gefolgt von den Stromkosten, die 2023 den grössten Einfluss hatten.
Den ausführlichen Bericht finden Sie hier:
Das Schweizer Industrieunternehmen Jakob Müller Holding AG (JMH) mit Sitz in Frick hat per 31. Januar 2025 100 Prozent der Anteile der Buss AG mit Sitz in Pratteln übernommen. Durch diese Akquisition baut die JMH ihre Sparte «Process Solutions» aus und sichert sich eine führende Position im Bereich der kontinuierlichen
nen und unseren Kunden zu künftig einen zusätzlichen

Netzwerk–immer dabei! Fachtagungen –immer up to date!


Hochviskosverfahrenstechnik.
Stephan Bühler, Inhaber der JMH: «Wir werden zukünftig noch mehr und noch leistungsfähigere Lösungen im Bereich verfahrenstechnischer Maschinen- und Anlagebau anbieten können. Dazu gehören Verfahren im Bereich des Knetens, Mischens, Compoundierens und Kühlens.»
Die Buss AG wird durch die Übernahme in die Unternehmensstruktur der JMH integriert, aber eigenständig weitergeführt. «Die Buss AG verbindet bereits sehr viel mit dem neuen Unternehmensumfeld. Unsere Technologien sind stark komplementär und das verfahrens- und maschinenbautechnische Know-how ergänzen sich ideal. Gemeinsam mit der JMH wird die Buss AG ihren Wachstumskurs fortsetzen kön-
Durch die Übernahme umfasst die Sparte «Process Solutions» künftig die drei Unternehmen List Technology AG, BBA Innova AG und Buss AG. «Textile Solutions», die zweite Sparte der JMH, bestehend aus der Jakob Müller Group und der Benninger AG, bleibt in ihrer bisherigen Struktur bestehen. Mit der Buss AG verfügt die Sparte nun neben der Entgasungs-, Reaktions- und Kühltechnologie auch über tiefgehendes Know-how im Bereich der Compoundierung hochviskoser Materialien. Die Bandbreite der verfahrenstechnischen Lösungen reicht dabei von Feinvakuum bis zu Überdrucktechnik. www.jmh.swiss
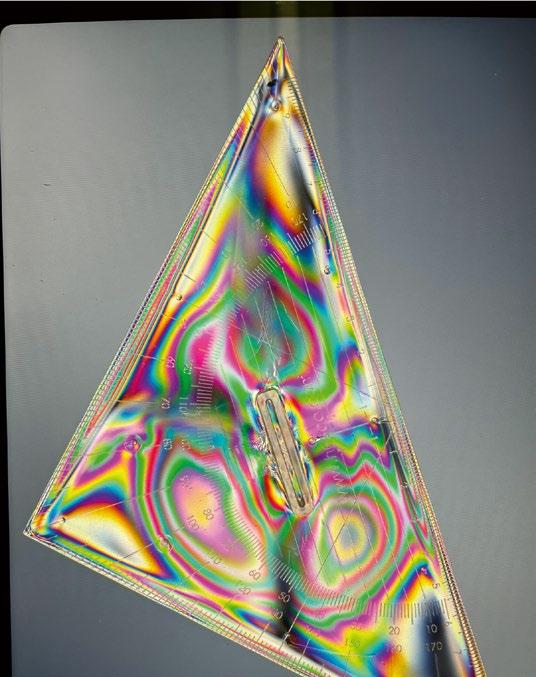
Job und Karriere –wissen was läuft!

Austausch –innovativ und visionär!

monatliche Zeitschrift –immer informiert!


Swiss Engineering STV Fachgruppe Kunststofftechnik www.swissengineering.ch/fachgruppe-kunststofftechnik
Der Berufsverband der Ingenieure und Architekten in der Schweiz
Gleitschlifftechnik
Elektropolieren
Strahltechnik
AM Solutions

Rösler Schweiz AG
09. – 10.09.2025|Luzern Halle 1|Stand B 1049
Staffelbacherstrasse 189 | CH-5054 Kirchleerau
Tel. +41 62 738 55 00 rosler-ch@rosler.com | www.rosler.com

Dank spezieller Verfahren und Musterboxen sparen Kunden mit Grafe eine Menge Entwicklungszeit.
Mit einem speziellen Verfahren ist die Grafe Gruppe, Blankenhain, in der Lage, Farbideen für Multilayer Anwendungen bereits in der Entwicklungsphase zu testen und zu simulieren. «Auf diese Weise kommen wir bei Materialdesigns in diesem Bereich schneller zu Ergebnissen und können für individuell abgestimmte Produkte die Entwicklungszeit zugunsten unserer Kunden optimieren», erläutert Lars Schulze, Head of Color Development and Material Sciences.
MehrschichtAnwendungen finden vielfältigen Einsatz in der Verpackungs und Pharmazeutischen Industrie, um die Produkte vor Umwelteinflüssen zu schützen und die Haltbarkeit zu verlängern. In der Möbelindustrie oder für hochwertige Gebrauchsgüter sind Laminate eine kostengünstige Alternative, die eine hochwertige Oberflächenoptik erzielt– und das mit einem minimalen Einsatz an Effektpigmenten.
Einzigartige Farbspiele
«Das Trägermaterial in der Grundfarbe, in Kombination mit dem aufgebrachten Effektträger, spart durchgefärbten Kunststoff», erklärt Schulze. Eine Dekorfolie, die teure Effektpigmente für die Optik trägt, wird mit dem kostengünstigen durchgefärbten Grundmaterial verbunden, welches die Stabilität des Produktes sichert», ergänzt der Experte. «Diese Kombination bestehend aus Grund und einer transluzenten EffektSchicht ermöglicht einzigartige Farbspiele,
die mittels Monoeinfärbung nicht, oder nur sehr kostenintensiv realisierbar sind». Die Herausforderung bei der Entwicklung des Farbdesigns besteht in der Dosierung der Pigmente in der Deckschicht im Zusammenspiel mit der Optik des Trägermaterials. «Mit unserer Technologie können entsprechende Farbideen kostengünstig getestet und in house simuliert werden, was dem Kunden Zeit, Material sowie Maschineneinrichtungskosten und damit auch Kosten bei der Produktentwicklung spart», berichtet Schulze.
Mit eigens entwickelten Musterprofilen bietet Grafe seinen Kunden einen Service, mit dem diese sich vorab ein eindrucksvolles Bild machen können. «Mit Hilfe von vier Grundfarben, von Weiss über Grau bis hin zu schwarzen Abstufungen, haben wir verschiedene EffektVarianten aufgebracht. Sie veranschaulichen, bedingt durch den Aufbau in mehreren Lagen, den Tiefeneffekt, der durch das Layering erzielt wird», informiert der Farbentwickler und weist darauf hin, dass die Deckschicht zudem mit den gewünschten Eigenschaften, Additiven oder Zuschlagstoffen ausgerüstet werden kann. «Jede individuelle Farbentwicklung ist dabei in unserem Entwicklungsservice enthalten.»
Für die Kundenberatung steht eine Musterbox mit einer Kollektion Muster Plätt


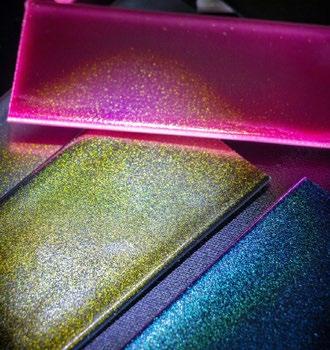
Auswahl aus dem Multilayer-Programm (Bild: Grafe)
chen aus PETG zur Verfügung. Die Plättchen in der Grösse einer Scheckkarte orientieren sich an den Grafe Farbtrends 2024/25. «Mit Blick auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Folien und Plattenindustrie sind weitere Kunststoffe denkbar», so Schulze. Ausserdem freue man sich auf Anfragen und eine enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern verschiedenster Branchen für eine Vielzahl weiterer dekorativer Effekte.
Kontakt
Grafe GmbH & Co. KG
D 99444 Blankenhain +49 36459 45 0 grafe@grafe.com www.grafe.com n
Die Kunststoffbranche entwickelt sich rasant weiter. Mit dem Master of Advanced Studies (MAS) in Kunststofftechnik an der FHNW erwerben Sie das Fachwissen, um jegliche Herausforderungen zu meistern. Profitieren Sie von praxisnaher Lehre, direktem Austausch mit Industriepartnern und neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Entwicklung.
Kunststoffe sind aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Doch steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit, Effizienz und Funktionalität erfordern kontinuierliche Innovationen. Der MAS Kunststofftechnik der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Fachkräften aus verwandten Disziplinen die Möglichkeit, ihr Wissen gezielt zu vertiefen und auf die Bedürfnisse der Industrie auszurichten. Das Studium kombiniert fundierte theoretische Grundlagen mit praxisnahen Anwendungen. In Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Kunststoffbranche lernen Sie neue Werkstoffe, moderne Verarbeitungstechnologien und innovative Fertigungstechniken kennen. Besonders im Fokus stehen nachhaltige Kunststofflösungen, Recyclingtechnologien sowie digitale Transformationsprozesse.
Ein besonderes Highlight ist die enge Verknüpfung mit der Industrie: Praxisprojekte, Exkursionen und Gastvorträge renommierter Expertinnen und Experten ermöglichen Ihnen einen tiefgehenden Einblick in aktu -


Das Studium kombiniert fundierte theoretische Grundlagen mit praxisnahen Anwendungen. (Bilder: FHNW)
elle Herausforderungen und Chancen der Branche. Durch kleine Studiengruppen und interaktive Lehrmethoden wird ein intensiver Wissensaustausch gefördert.
Nach Abschluss des MAS Kunststofftechnik stehen den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Karrieremöglichkeiten offen. Ob in der Entwicklung neuer Materialien, der Optimierung von Produktionsprozessen oder im Management nachhaltiger Kunststofflösungen – das erlangte Wissen bietet eine optimale Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Der nächste CAS Nachhaltige Kunststoffe und Technologien startet am 12. September 2025.
Mehr Informationen zum Studium finden Sie unter: www.fhnw.ch/ /mas-kunststofftechnik
Industrievertreter und Entscheidungsträger zusammen, um aktuelle Entwicklungen in der nachhaltigen Kunststofftechnologie zu diskutieren. Themen wie Kreislaufwirtschaft, biobasierte Kunststoffe und innovative Recyclingmethoden stehen im Fokus. Die erste SSPC findet am 23. Mai 2025 statt und ist eine ideale Gelegenheit, um sich mit Expertinnen und Experten zu vernetzen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt aus erster Hand zu erhalten.
Mehr Informationen zur Konferenz finden Sie unter: www.fhnw.ch/mas-kunststofftechnik

Kontakt
Institut für Kunststofftechnik FHNW Prof. Dr. Christian Rytka christian.rytka@fhnw.ch www.fhnw.ch/ikt n Sensoren Harting
Neben der Weiterbildung bietet die FHNW eine weitere hochkarätige Plattform für den Wissensaustausch: die Swiss Sustainable Polymer Conference (SSPC). Diese Konferenz bringt führende Forschende,

Das Kunststoff-Zentrum SKZ ist seit vielen Jahren mit dem Schweizer Kunststoffmarkt vertraut und baut seine Aktivitäten kontinuierlich aus, um seine Internationalisierung weiter voranzutreiben. Das grösste Kunststoffinstitut Deutschlands hat ein Netzwerk aus über 400 Mitgliedern und ist durch die Expertise der unterschiedlichen Geschäftsbereiche breit aufgestellt, um die verschiedenen Fragestellungen der Branche erfüllen zu können.
Mit einem breiten Dienstleistungsangebot darunter Prüfung, Zertifizierung und Überwachung von Produkten, unterstützt das SKZ seine Kunden dabei, Produkte erfolgreich auf dem Schweizer und internationalen Markt zu etablieren. Hinzu kommt die Erstellung von Schadensgutachten sowie Prüfungen nach mehr als 1000 Normen und Regelwerken im akkreditierten Labor in Würzburg. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit internationalen Produktzertifizierern wie AFNOR, CSTB, VTT und WRAS, um sicherzustellen, dass die Produkte den geltenden Normen und Standards entsprechen, insbesondere im Bereich der Rohre und Geokunststoffe.
Kooperation mit Schweizer Zertifizierern und Verbänden
Für Organisationen wie den Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), Qplus und VKR übernimmt das Institut Prüf- und Inspektionsaufgaben bei Herstellern von Rohren und Rohrleitungsteilen in den Bereichen Trinkwasser, Gas, Heizung, Kabelschutz und Abwasser. Im Bereich der Geokunststoffe werden Inspektionen der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen der CE-Zertifizierung durchgeführt,



Hauptsitz des SKZ ist Würzburg (Bilder: SKZ)
etwa für Abdichtungsbahnen gemäss europäischer harmonisierter Normen.
Prüfaufträge und Unterstützung bei Bauprojekten
Die Expertise des SKZ ist auch bei namhaften Infrastrukturprojekten in der Schweiz gefragt, etwa beim Ceneri- und Gotthard-Basistunnel. Hier unterstützt das Unternehmen bei Qualitätssicherungsmassnahmen für Kunststoffprodukte auf der Baustelle oder bei Lebensdaueranalysen eingebauter Kunststoffkomponenten. Für die International Table Tennis Federation (ITTF) mit Sitz in Lausanne übernimmt das Institut Prüfaufträge von Tischtennisbällen und Tischtennisschlägerbelägen.
Bei der Automatisierung von Produktionsprozessen spielen Fachkräfte eine Schlüsselrolle für die Produktqualität und tragen entscheidend zur Sicherstellung eines reibungslosen Arbeits- und Produktionsablaufs bei. Mit einem umfangreichen Weiterbildungsangebot von Präsenzschulungen
über Live-Online-Kurse und Inhouse-Schulungen bis hin zu e-Learning Modulen unterstützt das SKZ Unternehmen bei der Qualifizierung von Mitarbeitern in der Kunststoffbranche. Zu den Trainingsfeldern gehören Spritzgiessen, Extrusion, Additive Fertigung, Werkstofftechnik, Fügen, Kleben & Oberflächentechnik sowie Kreislaufwirtschaft mit Recyclinganwendungen & Nachhaltigkeit.
Praxisnahe Industrieanwendungen
Mit einem breiten Überblick über die Möglichkeiten und Potenziale der Kunststofftechnik, industriellen Methoden und neuen Technologien, unterstützt das Institut Unternehmen bei der Initiierung und Durchführung von geförderten und industriefinanzierten Projekten sowie Dienstleistungen.
Kontakt
SKZ – Das Kunststoff-Zentrum D-97076 Würzburg +49 931 4104-0 www.skz.de n
Nach dem erfolgreichen Produktlaunch der Einkreis-ÖlGeräte im Juli 2024 bringt Tool-Temp mit der Matic-Baureihe die ersten Doppelgeräte auf den Markt. Die ZweikreisÖl-Geräte mit den Heizleistungen 2×16 kW und 2×24 kW stehen dem bewährten Einkreisgerät in nichts nach. Sie wurden speziell für die Anforderungen hoher Temperaturen von bis zu 360 ° C entwickelt, überzeugen durch ihre Effizienz und sind dank ihrer kompakten Bauform auch bei geringen Platzbedingungen ideal einsetzbar.
Die zuverlässigen und leistungsstarken Modelle verfügen über zwei unabhängige Regel -
kreise in einem Gehäuse, welche sich unabhängig voneinander steuern lassen. Jeder Regelkreis des Matic Oil 360 2×16 kW und 2×24 kW ist mit zwei Regelungssystemen und entsprechenden Touchscreens ausgerüstet. Das bedeutet, dass unterschiedliche Zonen eines Werkzeugs oder Prozesses gleichzeitig auf verschiedene Temperaturen eingestellt werden können. Da die Kreisläufe unabhängig voneinander arbeiten und auch mit je einer drehzahlgesteuerten Pumpe ausgestattet sind, wird nur so viel Energie aufgewendet, wie tatsächlich erforderlich ist. Dies reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern senkt

auch die Betriebskosten. Darüber hinaus wird durch die kompakte Bauweise von ZweikreisTemperiergeräten wertvoller Platz in der Produktion gespart. Diese beiden Geräte ergänzen die etablierten Classic Modelle TT-390/2 mit Heizleistung von 2×16 kW und 2×24 kW. Mit
Der Normalienhersteller Meusburger begegnet den aktuellen Herausforderungen im Werkzeug- und Formenbau mit einer strategischen Kombination aus Effizienzsteigerung und verstärkter Digitalisierung. Um kontinuierlich aktuelle Trends und Herausforderungen der Branche zu kennen, hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der WBA Werk-
zeugbau Akademie einen eigenen Marktbarometer ins Leben gerufen. Der Fokus sämtlicher Analysen liegt darauf, die Kundenbedürfnisse zukünftig noch besser zu bedienen. Dazu gehört beispielsweise ein OnlineService, durch den Kunden noch schneller und effizienter zu ihren Produkten gelangen. Ziel der internen Prozessoptimierung und Digitalisierung ist

es, die Kunden weiterhin bestens zu unterstützen und der verlässliche Partner im Werkzeug- und Formenbau zu sein. Beispiele für die Optimierung sind das neue «Fahrerlose Transportsystem» (FTS), das im Herbst erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Darüber hinaus wurden die Verpackungs- und Kommissionierprozesse optimiert. Beide Massnahmen tragen dazu bei, die Lieferzeiten weiter zu verkürzen. «Heute bestellt, sofort ausgeliefert» – mit diesem Anspruch möchte Meusburger seinen Kunden auch weiterhin beste Qualität und kurze Lieferzeiten garantieren. Bei der Digitalisierung spielt das neue Portal eine zentrale Rolle. Seit dem Launch des modernen Webshops wird dieser durch regelmässige Updates um viele neue Funktionen erweitert. Diese verbessern die Benutzererfahrung
dem integrierten IRIS-Regelungssystem sind sie als Matic Oil 360 Modelle erhältlich, während die Classic Varianten mit dem Standardregler MP 888 weiterhin verfügbar sind. Diese Auswahl bietet den Kunden maximale Flexibilität für ihre spezifischen Anforderungen.
Entwickelt und gefertigt in der Schweiz stehen die Classic und Matic-Temperiergeräte für Qualität, die weltweit geschätzt wird.
Tool-Temp AG
CH-8583 Sulgen +41 71 644 77 77 info@tool-temp.ch www.tooltemp.ch
und bieten den Kunden noch mehr Möglichkeiten. Das Meusburger Portal steht den Nutzern rund um die Uhr in bis zu 20 Sprachen zur Verfügung. Von detaillierten Einblicken in Aufträge bis zu zeitsparenden Konstruktionsmöglichkeiten unterstützt das Portal entlang der gesamten Wertschöpfungskette und ermöglicht den Kunden, schnell und effizient ihre Ziele zu erreichen. Meusburger ist überzeugt, dass die Kombination aus einem perfekt aufeinander abgestimmten Produktportfolio, exzellentem Service und innovativen digitalen Lösungen auch in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg ist.
Meusburger Georg GmbH & Co. KG, Formaufbauten A-6960 Wolfurt +43 5574 6706-0 office@meusburger.com www.meusburger.com

Durch das neu konzipierte Hydraulikaggregat und das abgeschirmte Gehäuse reduziert die EVO-Serie den Lärmpegel um über 20% – im Vergleich zum Vorgängermodell auf durchschnittlich 65 dB(A). Dies verbessert die Arbeitsbedingungen erheblich. Damit erfüllt die EVO-Serie die hohen Anforderungen an Komfort und Arbeitssicherheitsbestimmungen. Die EVO-Serie überzeugt zudem mit fortschrittlicher Technologie für eine einfache und effiziente Bedienung. Ein neues Schnellverschluss-System bei den Pelletizern erleichtert den Zugang für Wartungen und ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung. Das innovative Smart Signal vereint eine vierfarbige Signal -

leuchte mit einer integrierten Warnsirene, die es ermöglicht, den aktuellen Betriebsstatus aus der Entfernung schnell und klar zu erkennen. Die genormte Farbgebung signalisiert, ob sich die Maschine in Produktion, Betriebsbereitschaft oder in einem Störungs- bzw. Eingabeaufforderungsmodus befindet.
Ergänzt wird dies durch eine intuitive Software mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Eine klare Struktur und einfache Steuerung auf dem Touchpanel unterstützen den Bediener dabei, die Produktionskapazitäten präzise und flexibel anzupassen. Häufig genutzte Produktionsmengen können bequem als Favoriten gespei -
Innovative Steckereinsätze und Kabel ermöglichen eine schnelle und platzsparende Verdrahtung von Kraft-/Signalsteckern an der Form. Mit einer erweiterten Produktpalette bietet Hasco hot runner noch mehr Möglichkeiten, Anwendungen effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Für Anwendungen, bei denen das Premium Kabel nach DIN 16765 mit seinen Spezialeinsätzen, Metallgeflecht-Schirmung und dem robusten Silikonmantel nicht erforderlich ist, bietet Hasco das Kabel H1251/… mit Aluminiumabschirmung und PVC-Ummantelung an. Dieses schützt nicht nur hervorragend vor Störsignalen, es ist darüber hinaus auch preislich äusserst attraktiv.
Als besonders benutzerfreundlich erweist sich ein Steckertyp,

der neue Massstäbe in der Verdrahtung von Spritzgussformen setzt. Die integrierten Verschlüsse benötigen kein Werkzeug, um die Litzen sicher zu fixieren. Ein Mechanismus im Stecker hält die Kabel fest und ermöglicht gleichzeitig eine mühelose Entfernung. Wie auch bei bisherigen Verdrahtungen sind Kabelschuhe erforderlich, die Verdrahtungszeit selbst kann im Gegensatz zu der verschraubten Variante um 75% reduziert werden. Mit Blick auf Platzprobleme im Werkzeugbereich bietet Hasco einen neuen Stecker an. Dieser bietet nicht nur 12 Regelzonen, sondern behält gleichzeitig die maximale Belastbarkeit von 16A pro Zone bei. Das bedeutet, dass weniger Platz für die Steckverbindungen am Werkzeug benötigt wird und grosse, unübersichtliche Anschlusskäs-
chert und über eine Schnellauswahl aufgerufen werden. Zudem lassen sich Zusatzfunktionen und Maschinenkombinationen einfach über vordefinierte Schnittstellen konfigurieren. Diese Kombination aus visueller Rückmeldung des Smart Signal und intuitiver Steuerung sorgt für eine optimale Benutzererfahrung. Die neue Evo-Serie ist zunächst für die Trockeneis-Pelletizer P15 und P28 zur Bestellung verfügbar. Der neue Standard wird zukünftig auf weitere Asco TrockeneisproduktionsMaschinen erweitert.
Asco Kohlensäure AG CH-9300 Wittenbach +41 71 466 80 80 www.ascoco2.com

ten der Vergangenheit angehören. Das Anbaugehäuse ist identisch zu den bisherigen 6-Zonen-Steckereinsätzen. Zu guter Letzt bietet Hasco nun passend zum neuen Steckertyp ein Verbindungskabel, das auf der einen Seite die neue, kompakte Steckerbelegung aufweist und auf der anderen Seite die bewährte Hasco-Verdrahtung besitzt. Damit
kann die bereits vorhandene Regeltechnik nahtlos und ohne Probleme weiterverwendet werden.
Hasco Hasenclever GmbH+Co KG
D-58513 Lüdenscheid +49 2351 957-0 info.ch@hasco.com www.hasco.com
Sauter Engineering+Design (sautercar.ch)
3D Druck Bauteile < 914 × 610 × 914mm
CT Messdienstleistung < D310 × H700mm

AUTOMATIONSTECHNIK/ AUTOMATIONSSYSTEME
AUTOMATIONSTECHNIK/ AUTOMATIONSSYSTEME
BEDIENUNGSELEMENTE

Lanker AG, Kunststofftechnik Kriessernstrasse 24 CH-9462 Montlingen Tel. +41 (0)71 763 61 61 info@lanker.ch, www.lanker.ch
LOGISTIK
DIENSTLEISTUNGEN
DACHSER Spedition AG Regional Office Switzerland Althardstrasse 355, CH-8105 Regensdorf Phone +41 (0)44 8721 100 dachser.regensdorf@dachser.com dachser.ch

FORMENBAU
HEIZELEMENTE
ERGE Elektrowärmetechnik
Franz Messer GmbH Hersbrucker Str. 29-31, D-91220 Schnaittach Tel. +49 (0)9153 921-0, Fax +49 (0)9153 921-117 www.erge-elektrowaermetechnik.de mail: verkauf@erge-elektrowaermetechnik.de

Grossäckerstrasse 15 8105 Regensdorf Tel. +41 44 871 63 63 info.swiss@kaeser.com www.kaeser.com KAESER Kompressoren AG
KÜHLGERÄTE KÜHLGERÄTE
Wilerstrasse 98 CH-9230 Flawil Tel. +41 71 394 13 00 Fax +41 71 394 13 10 info@brsflawil.ch www.brsflawil.ch
Temperaturkontrolle. Einfach. Zuverlässig. CH-9006 St. Gallen · T +41 71 282 58 00 · info@regloplas.com

Jehle AG
Werkzeug- und Formenbau Büntenstrasse 125 CH-5275 Etzgen
Temperaturkontrolle. Einfach. Zuverlässig. CH-9006 St. Gallen · T +41 71 282 58 00 · info@regloplas.com
Temperaturkontrolle. Einfach. Zuverlässig. CH-9006 St. Gallen · T +41 71 282 58 00 · info@regloplas.com

BLASFORMEN UND BAUGRUPPEN
BLASFORMEN UND BAUGRUPPEN

Vogel Kunststoffe AG Hauptstrasse 77 CH-4243 Dittingen Tel. 061 761 40 80 www.vogelkunststoffe.ch


Co m p os i te -We r k s to f f e Flüssigkunststo e wie Laminier- und Giessharze, Carbon-, Glas- und Aramidgewebe, Klebsto e, Stützsto e, CFK- und GFK-Rohre, Stäbe, Pro le und Frästeile und vieles mehr
COMPOSITES COMPOSITE-WERKSTOFFE
Wir schenken Kunststoff einen zweiten Frühling. Für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. vogelkunststoffe.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 031 763 60 61 www.swiss-composite.ch info@swiss-composite.ch
Anspruchsvoller Spritzguss Komplexe Baugruppen Formenbau www.weiss-kunststoff.de

COMPOUNDIERANLAGEN
COMPOUNDIERANLAGEN
Buss AG
4133 Pratteln Tel. +41 61 825 66 00 info@busscorp.com www.busscorp.com
info@coperion.com www.coperion.com
Theodorstr. 10 D-70469 Stuttgart Tel +49 711 897-0 Fax +49 711 897-3999
DICHTUNGSPROFILE
Grenzweg 3 5726 Unterkulm 062 832 32 32 info@poesia-gruppe.ch www.poesia.ch

DICHTUNGSSYSTEME
FIP(F)G/RADS DICHTSYSTEME FIP(F)G/RADS




www.meusburger.com
GRANULIERANLAGEN

Maag Pump Systems AG Aspstrasse 12, CH-8154 Oberglatt Telefon +41 44 278 82 00 welcome@maag.com www.maag.com
Ihre In du striepart ne rin für Heissverstemmen T 081 257 15 57 | info@argo-gr.ch ww w.a rgo.industries

KUNSTSTOFFPROFILE KUNSTSTOFFPROFILE Industriestrasse 5 CH-4950 Huttwil Tel. 062 965 38 78 Fax 062 965 36 75 www.ac-profil.ch ac-profil@bluewin.ch

KUNSTSTOFFPROFILE / 3D-DRUCK



KUNSTSTOFFSPRITZGUSSTEILE FÜR KLEINSERIEN
KUNSTSTOFFSPRITZGUSSTEILE FÜR KLEINSERIEN


Grenzweg 3 5726 Unterkulm 062 768 70 95 info@poesia-gruppe.ch www.poesia.ch service
KUNSTSTOFF-FERTIGTEILE
Halbzeug, Fertigteile & Profiltechnik
KUNSTSTOFF-FERTIGTEILE www.kuvaplast.com

LACKIEREN UND BEDRUCKEN VON KUNSTSTOFFTEILEN
LACKIEREN UND BEDRUCKEN VON KUNSTSTOFFTEILEN
● Tampondruck
● Laserbeschriftung
● Digitaldruck
● Stoffbeschichtung
● Kunststoffbedampfung (PVD)
● Wassertransferverfahren (Karbon etc.)


● Gummi-/Softbeschichtung www.topcoat.ch Tel. 062 917 30 00
LOGISTIK
LOGISTIK


DACHSER Spedition AG Regional Office Switzerland Althardstrasse 355, CH-8105 Regensdorf Phone +41 (0)44 8721 100 dachser.regensdorf@dachser.com dachser.ch
MASTERBATCHES MASTERBATCHES
Industrie Nord 27 CH-5634 Merenschwand phone + 41 56 664 2222 fax + 41 56 664 2223 sales@granula.ch www.granula.eu Granula AG
MIKROSKOPE
• Tisch und Bodenwaagen
• Präzisionswaagen
PLATTENSÄGEN RECYCLING
PLATTENSÄGEN
IMA Schelling Austria GmbH
6858 Schwarzach | Austria T +43 5572 396 0 www.imaschelling.com
www.dreatec.ch FILTER

REINIGUNGSGRANULATE

SCHNECKEN UND ZYLINDER SCHNECKEN UND ZYLINDER

www.bernexgroup.com sales@ch.bernexgroup.com SPRITZGUSS UND PERIPHERIE
Bernex Bimetall AG Winznauerstrasse 101 CH-4632 Trimbach Tel. 062 287 87 87
HATAG Handel und Technik AG
Rörswilstrasse 59 CH-3065 Bolligen Tel. +41 31 924 39 39 Mail hatag@hatag.ch www.hatag.ch
SCHNEIDMÜHLEN SPRITZGUSS UND PERIPHERIE
HATAG Handel und Technik AG

Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG
Rörswilstrasse 59 CH-3065 Bolligen Tel. +41 31 924 39 39 Mail hatag@hatag.ch www.hatag.ch

Vennstrasse 10 D-52159 Roetgen Fon +49 (0) 2471 4254 Fax +49 (0) 2471 1630 www.hellweg-maschinenbau.de
SPRITZGIESSEN
SPRITZGUSS UND PERIPHERIE
SPRITZGUSS UND PERIPHERIE
HATAG Handel und Technik AG
Rörswilstrasse 59 CH-3065 Bolligen Tel. +41 31 924 39 39 Mail hatag@hatag.ch www.hatag.ch

SPRITZGUSSTEILE UND BAUGRUPPEN

Jehle AG
Werkzeug- und Formenbau Büntenstrasse 125 CH-5275 Etzgen T +41 62 867 30 30 I verkauf@jehleag.ch I www.jehleag.ch FORMENBAU
TAMPONDRUCK
TAMPONDRUCK
Ihre Industriepartnerin für Tampondruck 1- bis 4-farbig T 081 257 15 57 | info@argo-gr.ch www.argo.industries


MIKROSKOPE www.kern.swiss
Swiss Waagen DC GmbH
CH-8614 Bertschikon ZH
• Zählwaagen • Laborwaagen und viele weitere Modelle für jeden Bereich!
Tel. +41 (0)43 843 95 90 www.swisswaagen.ch
PERIPHERIE PERIPHERIE
Ingenieurbureau DR. BREHM AG
Lettenstrasse 2 CH-6343 Rotkreuz Tel. 041 790 41 64 info@brehm.ch www.brehm.ch PERIPHERIE
KUMA Solution AG
PERIPHERIE
motan swiss ag
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen Tel. +41 62 889 29 29 PERIPHERIE
Bresteneggstrasse 5 CH-5033 Buchs Tel. +41 62 557 37 01 info@kuma-solution.ch www.kuma-solution.ch

MARTIGNONI AG Kunststofftechnologie CH-3110 Münsingen Tel. 031 724 10 10 Fax 031 724 10 19 info@martignoni.ch www.martignoni.ch know-how in technology and plastics SPRITZGIESSEN
info.ch@motan.com www.motan-group.com
Gartenstrasse 7 CH-4537 Wiedlisbach Tel. 032 636 00 55 sales@thomaplast.ch www.thomaplast.ch

Tel: 041 833 80 10
www.styro.ch/spritzguss

SPRITZGIESSEN UND BAUGRUPPEN

Lanker AG, Kunststofftechnik Kriessernstrasse 24 CH-9462 Montlingen Tel. +41 (0)71 763 61 61 info@lanker.ch, www.lanker.ch BEDIENUNGSELEMENTE

SPRITZGIESSEN UND BAUGRUPPEN

THERMOFORMEN THERMOFORMEN
WAAGEN
anpac gmbh
THERMOFORMEN
Lindenhof 4 CH-6060 Sarnen Tel. 041 661 10 38 info@anpac.ch www.anpac.ch

• Vakuum-Tiefziehmaschinen
• CNC Fräsmaschinen

FLIEGEL eigener Service und Montagen D-68259 Mannheim • Tel: +49 (0)621-79975-0 • www.fliegel.de
• Tisch und Bodenwaagen
• Präzisionswaagen
• Zählwaagen • Laborwaagen und viele
Swiss Waagen DC GmbH
CH-8614 Bertschikon ZH
Tel. +41 (0)43 843 95 90 www.swisswaagen.ch
www.kern.swiss

ZERKLEINERUNGSANLAGEN/ RECYCLINGANLAGEN SPRITZGUSS UND PERIPHERIE
HATAG Handel und Technik AG
TROCKENEISSTRAHLEN
TROCKENEISSTRAHLEN
ASCO KOHLENSÄURE AG
Hofenstrasse 19
CH-9300 Wittenbach Tel: +41 71 466 80 80 Fax: +41 71 466 80 66 ascoco2.com info@ascoco2.com
ZERKLEINERUNGSANLAGEN/ RECYCLINGANLAGEN
Rörswilstrasse 59 CH-3065 Bolligen Tel. +41 31 924 39 39 Mail hatag@hatag.ch www.hatag.ch

Herbold Meckesheim GmbH D-74909 Meckesheim www.herbold.com
Unsere Vertretung in der Schweiz: Ingenieurbüro Dr. Brehm AG, www.brehm.ch



























