Gabi DolffBonekämper, HansRudolf Meier,
Stephanie Herold, Wolfram Höhne, Nikolai Roskamm, Daniela Spiegel ( Hg.)
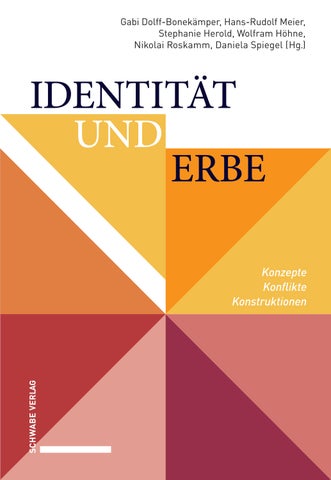
Gabi DolffBonekämper, HansRudolf Meier,
Stephanie Herold, Wolfram Höhne, Nikolai Roskamm, Daniela Spiegel ( Hg.)
Konzepte
Konflikte
Konstruktionen
Gabi Dolff-Bonekämper, Hans-Rudolf Meier, Stephanie Herold, Wolfram Höhne, Nikolai Roskamm und Daniela Spiegel (Hg.)
Schwabe Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Schwabe Verlag Berlin GmbH
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Korrektorat: Ute Wielandt, Markersdorf
Cover: icona basel gmbh, Basel
Layout: icona basel gmbh, Basel
Satz: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim
Druck: Prime Rate Kft., Budapest
Printed in the EU
Herstellerinformation: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7574-0161-0
ISBN eBook (PDF) 978-3-7574-0162-7
DOI 10.31267/978-3-7574-0162-7
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabeverlag.de www.schwabeverlag.de
Gabi Dolff-Bonekämper, Stephanie Herold, Wolfram Höhne, Hans-Rudolf Meier, Nikolai Roskamm, Daniela Spiegel
Identität und Erbe. Konzepte, Konflikte, Konstruktionen – Einleitung .. 7
Konzepte
Gabu Heindl
Kritisches Erben anhand der konkreten Utopie Rotes Wien
Hans-Rudolf Meier Die Denkmalpflege in der Identitäts-Falle?
Nikolai Roskamm
Die europäische Stadt. Heimsuchungen und Identität ................ 71
Gerhard Vinken
Machtvolle Logiken der Essentialisierung – Identitätskonstruktionen, «Selbstbestimmung» und kulturelles Erbe ..........................
Mirjam Wenzel
Jüdisches
Ariella Aïsha Azoulay
Zwischen der Erfahrung europäischer Juden und der Unsrigen. Brief an Hannah Arendt ......................................... 121
Gabi Dolff-Bonekämper
Ost-West-Ost. Berliner Identitäts- und Erbekonflikte ................ 161
Wolfram Höhne
Kulturerbe aktualisieren? Überlegungen zur künstlerischen Arbeit mit Denkmälern
Monica Juneja
Das Nachleben der Vergangenheit. Umstrittene Erinnerungen an das architektonische Erbe im postkolonialen Indien .....................
Winfried Speitkamp
Kulturerbe und Antisemitismus. Die Documenta in Kassel und die Passionsspiele in Oberammergau ..............................
Konstruktionen
Knut Ebeling
Das Gedächtnis brennt. Identität, Erbe und Trauma in Alain Resnais’
Susanne Hauser
Zum Klimawandel. Neue Narrative für alte Städte ...................
Daniela Spiegel
Bist du Bauhaus? Die Bauhaus-Universität und ihr historisches Erbe ...
Sophie Stackmann
Das Bundesbüdchen. Über Metaphern, Verdrängung und Abwehr im Erbe der Bonner Republik ....................................
Janna Vogl
Gibt es ein Erbe ohne Gedächtnis? Erbe und soziale Ungleichheit
Daniela Zupan
A Memory of Power Extended Over Time – a Memory of Power
Extended Over Space? Gedanken zur ‹europäischen Stadt› und zur ‹russischen Dorfkommune› .......................................
Anhang
Am Graduiertenkolleg verfasste Forschungsarbeiten und Publikationen
Identität und Erbe.
Gabi Dolff-Bonekämper, Stephanie Herold, Wolfram Höhne, Hans-Rudolf Meier, Nikolai Roskamm, Daniela Spiegel
Identität und Erbe: Begriffe und Grundidee des Graduiertenkollegs
Identitäts- und Erbekonstruktionen, die auf Bauwerken, historischen Orten und anderen, hauptsächlich dinglichen, kulturellen Überlieferungen gründen, kritisch zu erforschen, war die Grundidee unseres Graduiertenkollegs, dessen Vorbereitungen Gabi Dolff-Bonekämper und Hans-Rudolf Meier 2011 mit einer Tagung an der TU Berlin begannen.1 Gefragt werden sollte nach dem Zusammenhang zwischen dem Affirmationsbedarf von Gemeinwesen und der Aneignung von Kulturerbe, das für Geschichts- und Identitätspolitiken mobilisiert wird, und es galt, das Gesamtkonzept von kulturerbebasierten Identitätskonstruktionen zu untersuchen. Die zu erforschenden Objekte verstanden und verstehen wir als Medien von gestaltbaren und in Raum, Zeit und Gesellschaft beweglichen Bindungen zwischen Erben und Geerbtem. Dabei sind historisches Material, Formgebung und historische Sinngebungen sowie die gegenwärtigen Aushandlungsprozesse zu Interpretation und Wert des Erbes nicht von der materiellen und historischen Grundlage zu lösen.
Mit dem Titel «Identität und Erbe» – nicht «Identität und Denkmal» – haben wir für das Graduiertenkolleg Weichen gestellt. Wir wollten dazu einladen, nicht nur geschützte oder noch zu schützende Denkmale, deren Form und Substanz, Wert und Pflege, Schutz und Würdigung uns durchaus am Herzen liegen, zu bearbeiten, sondern durch die Wahl des Begriffs «Erbe» materiell und methodisch deutlich weiter auszugreifen. Erbe ist nicht nach dem Vorbild amtlicher, in Denkmalschutzgesetzen formulierter formaler Kriterien zu bestimmen. Es wird vielmehr, ob als Gut oder als Wert, in sozialen Denk- und Handlungsrahmen aufeinander folgender Generationen fassbar sowie sach-
lich und sozial immer wieder neu bestimmt.2 Jeder Gegenstand kann Erbe sein, wenn er von Personen als solches identifiziert und empfunden wird.
Eine Grundlage für die im Kolleg verwendete soziale Definition von Erbe ist die im Jahr 2005 verabschiedete Faro-Konvention des Europarats. Anders als die vorangegangenen Konventionen von Valetta (1992) und Florenz (2000) zum Schutz des archäologischen bzw. des landschaftlichen Erbes in Europa,3 die gemeinsam anerkannte Regelwerke zum praktischen Umgang mit Orten und Objekten festhalten, sollte die Faro-Konvention zu grenzüberschreitenden sozialen Kulturerbe-Konstruktionen anregen. Dort heißt es in Artikel 2 zu «Definitionen»:
a. cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time;
b. a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations.4
Mit der Wahl des Erbebegriffs wurden der thematische und disziplinäre wie auch der politische Rahmen des Kollegs möglichst weit gesteckt. Es sollten nicht nur die Objekte in ihrer fassbaren formalen und materiellen Eigenart, sondern ebenso die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer über Generationen vermittelten Wertschätzung, ihrer Weitergabe und sozialen Bindungskraft als Erbe erforscht werden. Der Begriff «Identität» im Titel des Kollegs sollte die individuell begründete, stets wandelbare Eigenart von Personen sowie deren Zugehörigkeit zu familiär, beruflich, kulturell oder religiös verfassten Gruppen bezeichnen, die einander in Einigkeit über oder im Streit um ein Erbe begegnen. Es galt, die Aufmerksamkeit für die sozialen Rahmen der im engeren Sinne baugeschichtlichen, denkmalwissenschaftlichen und denkmalpflegerischen Forschungen zu schärfen.
Zur bleibenden Aktualität des Themas
Seit der Einrichtung unseres Kollegs haben die beiden zentralen Begriffe in der Forschung unterschiedliche Konjunkturen erfahren. Weil «Identität» zu einem politischen Kampfbegriff geworden ist und sich die von Lutz Niet-
hammer bereits im Jahr 2000 – im Untertitel seines Werks zum Begriff und Konzept der kollektiven Identität – angesprochene «unheimliche Konjunktur» drastisch verstärkt hat, erlangte der Begriff auch in der Forschung eine größere Aufmerksamkeit.5 Während der als Vordenker der Nouvelle Droite geltende
Alain de Benoist versuchte, eine «Identität ohne Wunschdenken» als menschliche Notwendigkeit darzustellen, ohne dass es ihm aber gelang, den Begriff genau zu fassen,6 wurde dieser vom französischen Philosophen und Sinologen
François Jullien in einer viel beachteten Schrift radikal in Frage gestellt; Jullien schlug vor, statt von kultureller Identität von «kulturellen Ressourcen» zu sprechen.7 Ressourcen seien nicht exkludierend, würden nicht lauthals propagiert und schlössen einander nicht aus. Die kategorische Ablehnung des Identitätsbegriffs blieb allerdings nicht unwidersprochen. Aleida Assmann setzte dieser in ihrem Vortrag an unserem Graduiertenkolleg das Postulat einer «Grammatik der Identitäten» entgegen.8 Auch die zu unserer Jahrestagung 2019 eingeladene Philosophin Ursula Renz wies die terminologischen Vorschläge von Jullien zurück, insistierte aber darauf, ihre Überlegungen nicht als Korrektur von dessen Kernthese zu verstehen.9 Renz unterscheidet zwischen «wesentlichen» – im Sinne von wesensbestimmenden – und «unwesentlichen» Eigenschaften von Personen und Dingen. Kulturelle Prägungen, unsere Wertvorstellungen und die Gehalte unserer Überzeugungen hätten zwar einen sozialen Ursprung, wie man sich dazu verhalte und welche Einstellungen man ihnen entgegenbringe, seien indes Eigenschaften von Individuen, die immer die «Option einer nur teilweisen Verpflichtung auf gemeinschaftliche Werte und Auffassungen» hätten.10 Renz kommt zu dem Ergebnis, dass für das Konzept des Kulturellen Identität als Grenzbegriff tauglich sei. Die Kultursoziologin Heike Delitz hält dazu fest, jede kollektive Identität sei «eine mehrfache, kontrafaktische Imagination, die nur mittels vielfältiger symbolischer oder kultureller Artefakte und ihrer Bedeutungen stabilisiert wird. In diesen wird sie […] überhaupt erst sichtbar und teilbar. Sie ist kulturell erzeugt».11
Für den Historiker Valentin Groebner ist Identität dagegen allgemein der «Superkleber für soziale Ontologie» und deshalb unwiderstehlich, weil der Begriff eine ganze Menge andere ältere Wörter wie «Volk», «Nationalcharaktere» und «Wesen» beerbt habe.12 Aus politikwissenschaftlicher Sicht greift ein von Yves Bizeul und Dennis Bastian Rudolf herausgegebener Tagungsband die Frage von Jullien auf, untersucht die Funktion von Identitätsnarrativen und thematisiert die offensichtliche «Kluft zwischen Theorie und sozialer bzw. poli-
tischer Praxis bezüglich der kulturellen Identität».13 Auch Francis Fukuyama rekurriert in der Korrektur seiner Fehldiagnose vom «Ende der Geschichte» unter der Überschrift «Identität» die Identitätsproblematik, die er auf den Thymos als Streben des Menschen nach Anerkennung zurückführt. Er plädiert für ein inklusives Gefühl der nationalen Identität: «Die nationale Identität beginnt mit der gemeinsamen Überzeugung, dass das politische System des Landes, sei es demokratisch oder nicht, legitim ist. […] Daneben erstreckt sich die nationale Identität auf den Bereich der Kultur und der Werte […].»14 Während Fukuyama für Assimilation eintritt, beharrt der Philosoph Burkhard Liebsch in seiner Analyse identitärer Vorstellungen als Gefährdung Europas –ausgehend von kritischen Bezügen auf Emmanuel Levinas und Jacques Derrida – auf der Zumutung, das Eigene vom Anderen her zu denken. Wer das im Fremden enthaltene Risiko nicht eingehen wolle, sei unausweichlich zur «Gefangenschaft im Eigenen» verurteilt, zum «Existieren ‹bei geschlossenen Türen›».15 Einen Bezug zum denkmalpflegerischen Tun bildet dabei der Hinweis, das Andere sei nicht nur ein Faktor der örtlichen Herkunft, sondern auch der Zeit, «die früher oder später aus allem Anderes macht, […] sofern nicht ein identitäres kollektives […] Gedächtnis jegliche Alterität leugnet, die es daran hindern könnte, im gegenwärtig Erinnerbaren und Antizipierbaren nur die Wiederkehr des Selben wahrzunehmen».16 Auch Kwame Anthony Appiah deckt Identitäten als Fiktionen von Zugehörigkeiten auf und zeigt, wie fluide der Begriff als Kategorie ist und dass der Einbezug afrikanischer und asiatischer Konzepte, die das Subjekt als komplexe Nichteinheit denken, die Debatte bereichert.17 Eine weitere Position, die etwa in den Vorträgen von Oliver Marchart und Nora Sternfeld in unserer Ringvorlesung vorgestellt wurde, ist die psychoanalytisch getränkte Idee einer postfundamentalistischen Ethik. Ziel einer solchen Haltung ist die Ent-Identifizierung, das Auslösen von Identitätskrisen, die Durchsetzung eines «Recht[s] auf Nicht-Identität»18. Wie so etwas gehen kann, zeige sich in den Praxen postidentitärer sozialer Bewegungen und ihrer Kämpfe um Rechte und Anerkennung. Diese fänden statt, «ohne die eigene Identität als stabil vorauszusetzen», und hätten zum Ziel, Identität «konstant zu hinterfragen und damit dem rechtlichen (wie kulturellen und polizeilichen) Druck auf Identitätsfestlegung zu entziehen».19
In den politischen Debatten spielt spätestens seit der Bewegung Black Lives Matter auch der bereits in den späten 1970er Jahren von US-amerikanischen Schwarzen Feministinnen geprägte Begriff der «Identitätspolitiken»
eine bedeutende Rolle als emanzipatorisches Konzept. Definiert werden kann es als
politische Praxis marginalisierter Gruppen […], die sich in Bezug auf eine kollektive Identität gegen ihre Benachteiligung durch Strukturen, Kulturen und Normen der Mehrheitsgesellschaft wehren […]. Identitätspolitiken bauen auf geteilten Praktiken, Erfahrungen und Interessen auf, indem sie diese zu etwas Gemeinsamen verknüpfen und kollektive Subjektivität herstellen.20
Die Kritik daran ist vielstimmig: Während von konservativer Seite Identitätspolitiken als cancel culture denunziert werden, manifestiert sich für Fukuyama in der Identitätspolitik die Krise der Linken, für die sie ein billiger Ersatz für die Ratlosigkeit sei, mit der diese der zunehmenden sozialen Ungleichheit begegne.21 Identitätspolitiken werden als partikularistisch und essentialistisch kritisiert: Neben positionalem Fundamentalismus und strategischen Essentialisierungen seien auch Reinheitsvorstellungen und Humorlosigkeit zu bemängeln.22 Festgestellt wird allerdings auch, dass die Kritik an Identitätspolitik insbesondere von rechter und konservativer Seite aus betrieben wird, und zwar aus bestehenden Machtpositionen heraus, die Artikulationen ethnischer und sexueller Minderheiten attackieren. Ein übergreifender Zusammenhalt –darauf hat etwa Adrian Daub in seinem Vortrag auf unserer Jahreskonferenz 2023 hingewiesen – dieser Diskussionen sei: Identitätspolitik machen immer die anderen. Debatten über Identitätspolitik seien daher, häufig und vielleicht auch vor allem, als Phantomdebatten zu klassifizieren.23
In (selbst-)ironischer Weise ist das Thema inzwischen auch literarisch verarbeitet.24 Die Kontroversen sind freilich noch längst nicht beendet, sondern haben seit Donald Trumps Wahlsiegen und den Kulturkampf-Attitüden der europäischen Konservativen sogar noch an Schärfe gewonnen.25
Eine vergleichbare grundsätzliche wissenschaftliche oder gesellschaftspolitische Beschäftigung hat der Erbebegriff in der Laufzeit unseres Kollegs im deutschsprachigen Raum nicht erfahren. Dennoch hatte auch er in der Berichtsperiode eine gesteigerte Konjunktur, etwa im Europäischen Kulturerbejahr ECHY2018 mit seinem Motto Sharing Heritage. Zwar konnte durch vielfältige Aktivitäten ein breiter Kreis an Beteiligten mobilisiert werden, doch blieben bedauerlicherweise die wichtigen kritischen Fragen zum konfligierenden Erbe und zu divergierenden Erbekonzepten meist ausgeblendet. Bezeichnend ist, dass – anders als noch 1975, als das European Architectural Heritage
Year im deutschsprachigen Raum ganz selbstverständlich zum «Denkmalschutzjahr» wurde – nun auch hier der Heritage-Begriff übernommen wurde. Darin spiegelt sich eine bis in die behördliche Nomenklatur hineinreichende Verschiebung vom Denkmal zum (Kultur-)Erbe bzw. Heritage wider.26 Verbunden ist damit zum einen ein stärkerer Einbezug der Akteure, zum anderen die vermehrte Beachtung der Interdependenzen von materiellem und sogenanntem immateriellem Kulturerbe. Insbesondere aus der international zunehmend an Bedeutung gewinnenden Association of Critical Heritage Studies (ACHS) kommt die Forderung nach grundlegenden Änderungen in Bezug auf Gegenstände, Fragestellungen, Ansätze und Methoden sowie Akteuren der Erbeforschung. Anregend für unser Kolleg war dabei insbesondere die von Mirjana Ristic und Sybille Frank herausgegebene Sammelschrift «Urban Heritage in Divided Cities. Contested Pasts», die Arbeiten über geteilte Städte und Kulturerbe als Medium sowohl von Konflikten als auch von postkonfliktuellen Verständigungen vorstellt.27 In dieser und in vergleichbaren soziologisch, kulturgeografisch oder anthropologisch ausgerichteten Studien werden gegenwärtige und vergangene soziale Figurationen und Konfrontationen, räumliche und soziale Konfliktlinien, Debattenformate und Verständigungs(un)möglichkeiten eindringlich studiert und verhandelt. Die materielle und formale, künstlerisch-handwerkliche oder von den Zeitläufen geformte Substanz von Orten und Gebäuden, wie sie für unser Kolleg zentral sind, findet allerdings wenig Beachtung. Zu fragen ist schließlich auch, ob mit der Zurückdrängung des Denkmalbegriffs gleichzeitig die in ihm mitschwingende Widerständigkeit zurücktritt.
Aufgrund der geschilderten Komplexität und disziplinären Vielschichtigkeit erschien uns ein Graduiertenkolleg zu diesem Themenpaar als geeignetes und besonders vielversprechendes Forschungsgerüst. Mit einem Kolleg bietet die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Forschenden die Möglichkeit, über den langen Zeitraum von bestenfalls neun Jahren sowohl gemeinsam als auch individuell zu einem übergreifenden Thema zu arbeiten. Im Mittelpunkt steht die Qualifizierung von Doktorand*innen im Rahmen eines thematisch fokussierten Forschungsprogramms sowie eines strukturierten Qualifizierungskonzepts, zu dem auch eine Ringvorlesung gehörte, die es uns erlaubte,
in der Förderzeit über 150 Referent*innen zu Vorlesungen und zugehörigen Seminaren einzuladen. Innerhalb der beiden, jeweils viereinhalb Jahre umfassenden Förderperioden konnten insgesamt 39 Doktorand*innen für jeweils drei Jahre gefördert werden, dazu kam in der zweiten Förderphase eine Postdoc-Stelle; zusätzlich wurden insgesamt 13 assoziierte Doktorand*innen unterstützt.28 Unser Kolleg war ausgesprochen interdisziplinär ausgerichtet und zunächst auf die Standorte Berlin und Weimar aufgeteilt, später kamen durch die Wegberufung von zwei Nachwuchswissenschaftler*innen Erfurt und Dessau hinzu. Neben der Denkmalpflege sowie der Bau- und Stadtbaugeschichte waren auf Seiten der antragstellenden Wissenschaftler*innen die Fachrichtungen Architekturtheorie, Bildende Kunst, Bauforschung, Kunst- und Kulturgeschichte, Medienkulturwissenschaft, Antisemitismusforschung, Philosophie, Landschaftsarchitektur, Planungs- und Architektursoziologie, Raumplanung und Raumforschung sowie auch die Stadtplanung in wechselnden Konstellationen und Intensitäten vertreten. Kooperationspartner waren die Landesdenkmalämter von Brandenburg, Berlin und Thüringen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie die Klassik Stiftung Weimar.
Anhand der Themen, die in den Dissertationen, den Jahrestagungen und den Exkursionen der drei Kohorten behandelt wurden, lässt sich die inhaltliche Entwicklung unseres Kollegs deutlich ablesen. Ausgehend von den Konflikten um den Erhalt und die Würdigung von Denkmälern der 2000er Jahre, verlagerte das Graduiertenkolleg die Perspektive weg von den historischen Sinngebungen kulturellen Erbes und hin zur Aushandlung der Werte und zu Deutungen in der Gegenwart. Im Rahmen von Exkursionen beschäftigten wir uns mit dem Erbe des Faschismus in Rom (2018), mit Orten des indigenen Erbes in Kanada (2018) sowie mit dem von Konflikten geprägten Kulturerbe des ehemaligen Jugoslawiens in Nordmazedonien, Bosnien und im Kosovo (2022). Während die dinglichen Überlieferungen von Kultur in Form von Orten, Bauwerken und Gegenständen konkrete Ausgangspunkte für die Forschungen boten, zielte die interdisziplinäre Ausweitung von der Denkmalpflege auf die Sozial- und Kulturwissenschaften darauf ab, die Vorgänge der Bedeutungszuschreibung und Inwertsetzung zu verstehen.
In der ersten Förderperiode (2016–2020) wurde die Wechselbeziehung von Identitätsversprechen und Kulturerbe vor allem begrifflich erkundet, um zum ursprünglich anvisierten, später aber aufgegebenen Ziel einer kritischen Kulturerbetheorie beizutragen. Die zweite Förderperiode (2021–2025) trug
der zunehmenden Mobilisierung von Identitätspolitiken Rechnung, indem kulturelles Erbe verstärkt vor dem Hintergrund von Machtfragen, Gewalt und kriegerischen Konflikten betrachtet wurde. Neben dem Erhalten und Würdigen von kulturellem Erbe wurden vermehrt Praktiken des Vergessens, Verdrängens und Verlorengehens in den Forschungen adressiert. Der Aspekt der Selbstpositionierung als Forscher*in und die Auseinandersetzung mit der forschungsethischen Diskussion um die Frage ‹Wer spricht über wen?› gewann in der zweiten Förderperiode zusätzlich an Bedeutung. Wesentliche Impulse verdankten wir während dieser Jahre den Mercator Fellows Jurek Elżanowski (Kanada), Zvi Efrat (Israel) und Renato Cymbalista (Brasilien), die zur internationalen Anschlussfähigkeit unserer Forschungen beitrugen.
Die thematische Entwicklung wird auch anhand der Titel der insgesamt acht Jahrestagungen deutlich, die anfänglich aus dem Kollegium angeregt wurden, später aber zunehmend von den Kollegiat*innen zum großen Teil eigenständig konzipiert und anschließend in der Schriftenreihe Identität und Erbe auch publiziert wurden. Die erste, in Kooperation mit dem Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e. V. durchgeführte Jahrestagung Denkmal – Erbe – Heritage. Begriffshorizonte am Beispiel der Industriekultur (2017) arbeitete die Perspektive einer globalen Schicksalsgemeinschaft heraus, deren Erbe von den Erhaltungsstrategien des UNESCO-Weltkulturerbes nur unzureichend erfasst und geschützt wird.29 Mit dem Titel Collecting Loss (2018) fragte die zweite Jahrestagung nach Konzepten von Verlust und thematisierte dabei insbesondere produktive Momente von Abwesenheit, die zu gemeinschaftsfördernden Praktiken des Sammelns, Speicherns und Zeigens führen.30 Das Versprechen von Stabilität und Kontinuität wird oft mit dem Begriff der Identität verbunden, wenn von Kulturerbe die Rede ist. Diese Aneignungen des Begriffs hinterfragte die erste Gruppe von Kollegiat*innen in der dritten Jahrestagung mit dem Titel Instabile Konstruktionen (2019).31 Bereits im Zeichen der Coronapandemie stand die online stattfindende vierte Jahrestagung Praktiken des Erbens. Metaphern, Materialisierungen, Machtkonstellationen (2020). Die Form, in der auf bestimmte Vergangenheiten und Identitäten Bezug genommen wird, wie die Verweigerung dieser Beziehung im Vorgang des Erbens, standen im Mittelpunkt dieser Konferenz.32 Unter dem Titel Censored? Conflicted Concepts of Cultural Heritage (2021) widmete sich die fünfte Jahrestagung identitätspolitischen Debatten, die nicht selten mit dem Hinterfragen von Denkmalsetzungen verbundenen waren. Insbesondere auf das
als unerwünscht, unterdrückt, abgelehnt und verhindert betrachtete Erbe richtete die Konferenz ihr Augenmerk.33 Die zweite Gruppe von Kollegiat*innen konzipierte zum Abschluss ihrer Förderperiode die sechste Jahrestagung Dinge, die verbinden. Objekte und Erbekonstruktionen (2022). Dabei bildeten die Materialisierungen von Kulturerbe in Artefakten und Dokumenten den Ausgangspunkt für die Erkundung widersprüchlicher Aneignungen und Deutungen.34 Die Ambivalenz eines unscharfen Identitätsbegriffs, der im Zuge der Sinnkonstruktionen von kulturellem Erbe zu eng gefassten Vorstellungen essentialisiert wird, war das Thema der siebten Jahrestagung With / Out Identity. Zur Frage von Identitätskonstruktionen in Raum, Erbe und Communities (2023). Der Vereinnahmung von Identitätsbegriffen wurden marginalisierte Akteure gegenübergestellt, die nach Identitätsbildung streben, um ihre Geschichte selbst zu artikulieren.35 Die achte und letzte Jahrestagung Bodies in, als, von, mit, und «Identität und Erbe» mit Beiträgen von Kollegiat*innen der letzten Promovierendengruppe thematisierte schließlich Körperbegriffe und Körpererfahrungen in Kulturerbetheorien. Verletzlichkeit und Emotionen im Gegenüber von Kontrolle und Disziplinierung bildeten das Spannungsfeld, in dem die Wissensproduktionen zu kulturellem Erbe diskutiert wurden.36
Als Partner hat das Graduiertenkolleg neben zahlreichen kleineren Veranstaltungen die Konferenzen [dis]solving boundaries (2018)37 und Der Intellektuelle, die Erinnerung und die Stadt. Maurice Halbwachs im Spiegel des 21. Jahrhundert (2021)38 sowie die Publikation «Rationelle Visionen – Raumproduktion in der DDR»39 mitgestaltet.
Die abschließende Publikation unseres Graduiertenkollegs ist der hier vorliegende Sammelband. Die Idee dazu ist aus dem Wunsch nach einem rückblickenden Resümee zur Arbeit des Graduiertenkollegs und zu den dort diskutierten und verhandelten Inhalten entstanden. Dabei war allen Beteiligten schnell klar, dass es nicht das Ziel sein konnte, nun doch noch zu einer inhaltlich abschließenden Klärung und Festlegung des Themenfeldes zu kommen. Auch der Versuch, die unterschiedlichen Perspektiven und Diskurse in ein wie auch immer gestaltetes vereinheitlichendes Narrativ einzuordnen, widerstrebte uns Herausgeber*innen von Anfang an. Stattdessen war es unser Anliegen, unterschiedliche Akteur*innen und Wegbegleiter*innen des Gradu-
iertenkollegs zu Wort kommen zu lassen und ihnen die Möglichkeit und den Raum zu geben, über die beiden titelgebenden Begriffe «Identität» und «Erbe» und das damit verbundene Spannungsfeld aus ihrer jeweiligen fachlichen und / oder persönlichen Perspektive zu reflektieren. Diese sehr breite Anfrage führte zwangsläufig zu sehr unterschiedlichen Beiträgen, was sich nicht nur in deren verschiedenen Inhalten und Charakteren widerspiegelt, sondern auch in den unterschiedlichen Textformaten. So wird in dem Band verschiedentlich vom
Format des wissenschaftlichen Aufsatzes abgewichen, wie das abgedruckte Interview mit Mirjam Wenzel zeigt oder der in Briefform verfasste Text von Ariella Aïsha Azoulay, den diese uns auf unsere Anfrage hin nach einem Beitrag in der Ring-Vorlesung zur Verfügung gestellt hat. Die weiteren Texte versammeln – der Interdisziplinarität des Kollegs entsprechend – Beiträge aus den Bereichen der Denkmal- und Museumswissenschaften, der Philologie, der Kultur und Medienwissenschaften, der Kunst- und Architekturgeschichte, der kritischen Stadtforschung, der Soziologie und der Geschichtswissenschaften, die mit unterschiedlichen Gewichtungen und Schwerpunktsetzungen die Themen «Identität» und /oder «Erbe» behandeln.
Eine Einordnung dieser unterschiedlichen Themenbeiträge und Formate in ein die Lesenden führendes Gerüst kann immer nur skizzenhaft bleiben. Wir haben uns für eine grobe Strukturierung der Beiträge anhand der drei Leitkomplexe «Konzepte, Konflikte, Konstruktionen» entschieden. Alle drei Themenkomplexe entsprechen Perspektiven, unter denen sich das Graduiertenkolleg in den vergangenen Jahren dem Begriffspaar «Identität und Erbe» angenähert hat. Die Grenzen zwischen den Themenfeldern bleiben dabei fließend – schließlich kann auch ein Konzept eine Konstruktion sein, ebenso wie Konstruktionen Konflikte beinhalten können usw. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Ordnungssystem um einen Vorschlag, der verschiedene Schwerpunkte in den Vordergrund stellt, ohne sie dabei von den anderen Bereichen abgrenzen zu wollen. Innerhalb der drei Kategorien sind die Beiträge nach Namen der Autor*innen alphabetisch geordnet. Dies soll nicht nur die Unabgeschlossenheit eines jeglichen Ordnungsversuchs verdeutlichen, sondern auch, dass wir keine Choreografie für ein richtiges Lesen des Bandes vorgeben wollen, sondern die Leser*innen ermutigen möchten, sich den Texten dem eigenen Interesse folgend zu nähern und sich auf die Suche nach den vielen unterschiedlichen Querbezügen zu machen, die sich in ihrer Vielschichtigkeit nie vollständig abbilden lassen.
In der Kategorie «Konzepte» versammeln sich zunächst Texte, die schwerpunktmäßig die konzeptionelle Ebene beleuchten. Hans-Rudolf Meier und Gerhard Vinken untersuchen dazu den Identitätsbegriff in seiner Verbindung zur Geschichte und zur aktuellen Entwicklung der Denkmalpflege. Mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen stellen sie dabei die Frage, ob es nicht gerade das Mehrdeutige und Disparate des Erbebegriffs (Vinken in Anlehnung an Jacques Derrida) bzw. das dem Denkmal inhärente Widerständige ist (Meier), welches das Potential hat, sich exkludierenden und vereinheitlichenden Identitätsbestrebungen potentiell zu widersetzen bzw. diese in ihrer Eindimensionalität herauszufordern. Ebenso mit Bezug auf Derrida berichtet Gabu Heindl über das Erbe des Roten Wiens und entwickelt dabei den konzeptionellen Ansatz für ein «kritisches Erben», das sich durch ein reflektiertes Verhältnis sowohl zu historischen politischen Strategien als auch in Hinblick auf die Entwicklung von Alternativen für die Zukunft auszeichnet. Stephanie Herold nimmt das Prozesshafte des Erbe(n)s zum Anlass, um das dem Konzept inhärente Spannungsfeld zwischen Stabilität und Veränderung zu beleuchten, und betrachtet dies anhand des historischen, sozialen und materiellen Erbes von Behelfsheimsiedlungen des Zweiten Weltkriegs. Nikolai Roskamm untersucht das Konzept der ‹europäischen Stadt› und zeigt, wie es in politischen und städtebaulichen Debatten für identitäre Schließungen verwendet worden ist und dabei von einem mehrfach kolonial codierten Kern heimgesucht wird. In dem Gespräch, das Wolfram Höhne und Hans-Rudolf Meier mit Mirjam Wenzel geführt haben, berichtet die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main darüber, wie sich das Konzept des Museums wandelt und dieses zunehmend zu einem Diskursort wird, in dessen Zentrum die Paradoxien, Sensibilitäten und Gewalterfahrungen stehen, die die Gegenwart von Jüdinnen und Juden auszeichnen.
Die unter der Kategorie «Konflikte» zusammengeführten Beiträge veranschaulichen die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und Situationen, in denen Konflikte anhand von oder über Erbe ausgefochten werden. Diese Themen reichen von den historischen Vertreibungen von Jüdinnen und Juden aus Algerien und den Nachwirkungen dieser Vertreibungen in die aktuellen Konflikte im Nahen Osten (Ariella Aïsha Azoulay) über Streitfälle auf stadtgesellschaftlicher bzw. nationaler Ebene am Beispiel Berlins in der Transformationszeit der 1990er Jahre (Gabi Dolff-Bonekämper) bis hin zu lokalen Auseinandersetzungen in Bezug auf Erbe-Objekte in lokalen, zeitlichen und
Akteurszusammenhängen (Wolfram Höhne). In allen Fällen dient der Blick auf die ausgetragenen Kontroversen bzw. das Adressieren der offenliegenden oder unterschwelligen Konfliktlinien zur Anregung der Frage, welche Rolle unsere Vorstellungen von Identität und Erbe in den untersuchten Streitfällen explizit oder implizit spielen. Dass sich ein Blick auf die historischen Stränge dieser Konflikte lohnt, verdeutlichen die Texte von Monica Juneja und Winfried Speitkamp, die auf der einen Seite die Folgen des Kolonialismus für Identitätsund Erbekonflikte auf dem indischen Subkontinent und auf der anderen Seite das Fortwirken antisemitischer Denkweisen bei kulturellen Großereignissen (wie den Passionsspielen in Oberammergau und der Documenta in Kassel) bis in die Gegenwart thematisieren. In ihrem Brief an Hannah Arendt schreibt Ariella Aïsha Azoulay von ihrer «Reise des Verlernens», nämlich eines Verlernens der Identität, die ihr – so formuliert es die Autorin – «in der imperialen Menschenmanufaktur» ihres Aufwachsens in Israel mitgegeben wurde.
Der dritte Block rückt das Thema der Konstruktion in den Vordergrund, indem die Autor*innen auf unterschiedliche Weise die Konstruiertheit von Identitäten und Erbe adressieren. Sophie Stackmann geht der Frage nach, wie das Bundesbüdchen – ein ikonischer Kiosk im Bonner Regierungsviertel – und seine Rezeption zur Konstruktion einer bundesdeutschen Nachkriegsidentität beitragen. Auch Daniela Spiegel setzt sich in ihrem Beitrag mit dem gezielten Rückgriff auf bestimmte Geschichtsbilder zum Zweck der Identitätsbildung auseinander. In ihrem Beitrag zur Weimarer Bauhaus-Universität zeigt sie, dass das Bauhaus ein dynamisches Erbekonstrukt ist, das von den jeweiligen Akteur*innen immer wieder neu konfiguriert, verhandelt, mit Bedeutung aufgeladen und angeeignet wird. Knut Ebeling untersucht die Identitätskonstruktionen in Muriel oder die Zeit der Wiederkehr, einem Film von Alain Resnais, in dem die Traumata des Zweiten Weltkriegs und des französischen Kolonialismus miteinander verschmelzen (und damit Bezüge zu Azoulays Beitrag schaffen). Während Susanne Hauser eine aktuelle Freiraumplanung in Wien zum Anlass nimmt, die Wirkung von Narrativen des Klimawandels auf die Stadtplanung zu beleuchten und so die Relevanz identitätsbezogener Konstruktionen auch für wissenschaftliche und planerische Herangehensweisen anzusprechen, legt Janna Vogl in ihrem Beitrag den Fokus auf die sozialen Aspekte bei der Konstruktion von Erbe. Vor diesem Hintergrund betrachtet sie den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Erbeprozessen und verdeutlicht so, dass sich Erbe- und Identitätsansprüche in ungleichen Mög-
lichkeitsräumen des Erinnerns formieren. Identitätskonstruktionen auf städtischer Ebene widmen sich nochmals die beiden Beiträge von Daniela Zupan und Jerzy Elżanowski: Beide nutzen den Vergleich scheinbar unterschiedlicher Phänomene, um neue Bedeutungsebenen zu erschließen. Daniela Zupan vergleicht die Konstruktionen der ‹europäischen Stadt› und der ‹russischen Dorfkommune› miteinander und argumentiert, dass dem erstgenannten Modell eine zeitliche, dem zweitgenannten eine räumliche Grundstimmung zu eigen sei. Jerzy Elżanowski stellt die Rekonstruktion Warschaus nach dem Zweiten Weltkrieg in einen zeitlichen und kontextuellen Zusammenhang mit dem Bau Disneylands in den USA und ebnet so den Weg für neue Perspektiven auf diese unterschiedlichen und doch verwandten Phänomene und ihre Bezüge zur Konstruktion von Identität und Erbe.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die hier vorgeschlagene Einteilung der Texte in die Bereiche «Konzepte», «Konflikte» und «Konzeptionen» ein Vorschlag bleibt, der nur eine von mehreren Perspektiven auf die allen Beiträgen zugrunde liegende Auseinandersetzung mit Identität und Erbe einnimmt. Parallel dazu lassen sich beim Lesen neue Querverweise entdecken, beispielsweise in der immer wieder stattfindenden Bezugnahme auf die Theorien von Maurice Halbwachs (Dolff-Bonekämper und Vogl), in der Diskussion von Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit von Erbe und Denkmal (Herold und Höhne) oder in den unterschiedlichen Perspektiven auf Stadt und die damit verbundenen räumlichen und narrativen Bezugnahmen auf Identität und Erbe (Heidl, Roskamm, Hauser, Zupan). Als Herausgeber*innen möchten wir dazu einladen, neue und weitere Bezüge zwischen den Beiträgen herzustellen. Schließlich hoffen wir, den Leser*innen mit unserem nicht abschließenden Abschlussband des Graduiertenkollegs möglichst viele Anregungen zum mannigfaltigen Weiterdenken angeboten zu haben.
Dank
Es bleibt zu danken: Allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge, Lenia Barth für die redaktionelle Aufbereitung der Texte, Morgan Powell und Wilhelm Werthern für die Übersetzungen der englischen Beiträge, Katrin Viviane Kurten für das Ko-Lektorat, Harald Liehr und Makbule Rüschendorf vom Schwabe Verlag für die angenehme und produktive Zusammenarbeit und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung unseres Graduiertenkollegs.
1 https://arthist.net/archive/1527/_=&lang=de_DE [24. 03. 2025].
2 Dolff-Bonekämper 2009.
3 Zur Konvention von La Valetta: https://rm.coe.int/168007bd31, zur Konvention von Florenz: https://rm.coe.int/168008062a [24. 03. 2025].
4 Faro Konvention 2005. Die autorisierte deutsche Übersetzung gibt die bündige Präzision der französischen und englischen Originalfassung nicht wieder, daher wird hier die englische Fassung zitiert.
5 Niethammer 2000. Dort S. 9–10 auch der Hinweis, dass bereits in Aldous Huxleys Brave New World von 1932 der Leitspruch des Weltstaats lautete «Community, Identity, Stability».
6 Benoist 2023.
7 Jullien 2017, 65–66.
8 Assmann 2018.
9 Renz 2019.
10 Ebd., 102.
11 Delitz 2018, 29.
12 Groebner 2018, 110.
13 Bizeul / Rudolf 2020, 15.
14 Fukuyama 2019, 153.
15 Liebsch 2019, 3.
16 Ebd., 27. Zur Alterität im Kontext der Denkmalpflege vgl. auch Meier 2009.
17 Appiah 2019.
18 Marchart 2010, 349.
19 Ebd.
20 Schubert / Schwiertz 2021, 569; vgl. auch Schubert 2024.
21 Fukuyama 2019, 142.
22 So beispielsweise Federsen / Gessler 2021.
23 Daub 2025; vgl. auch Daub 2022.
24 Vgl. z. B. Sanyal 2021.
25 Lilla 2017, macht die Identitätspolitik der Linken für Trumps ersten Wahlsieg verantwortlich, vgl. dazu Boehm 2017.
26 Dazu auch die erste Jahrestagung des Graduiertenkollegs: Bogner et al. 2018.
27 Ristic / Frank 2019; dazu auch Apaydin 2020.
28 Vgl. die Zusammenstellung im Anhang am Ende dieses Bandes.
29 Bogner et al. 2018.
30 Bogner et al. 2021.
31 Bogner et al. 2022 a.